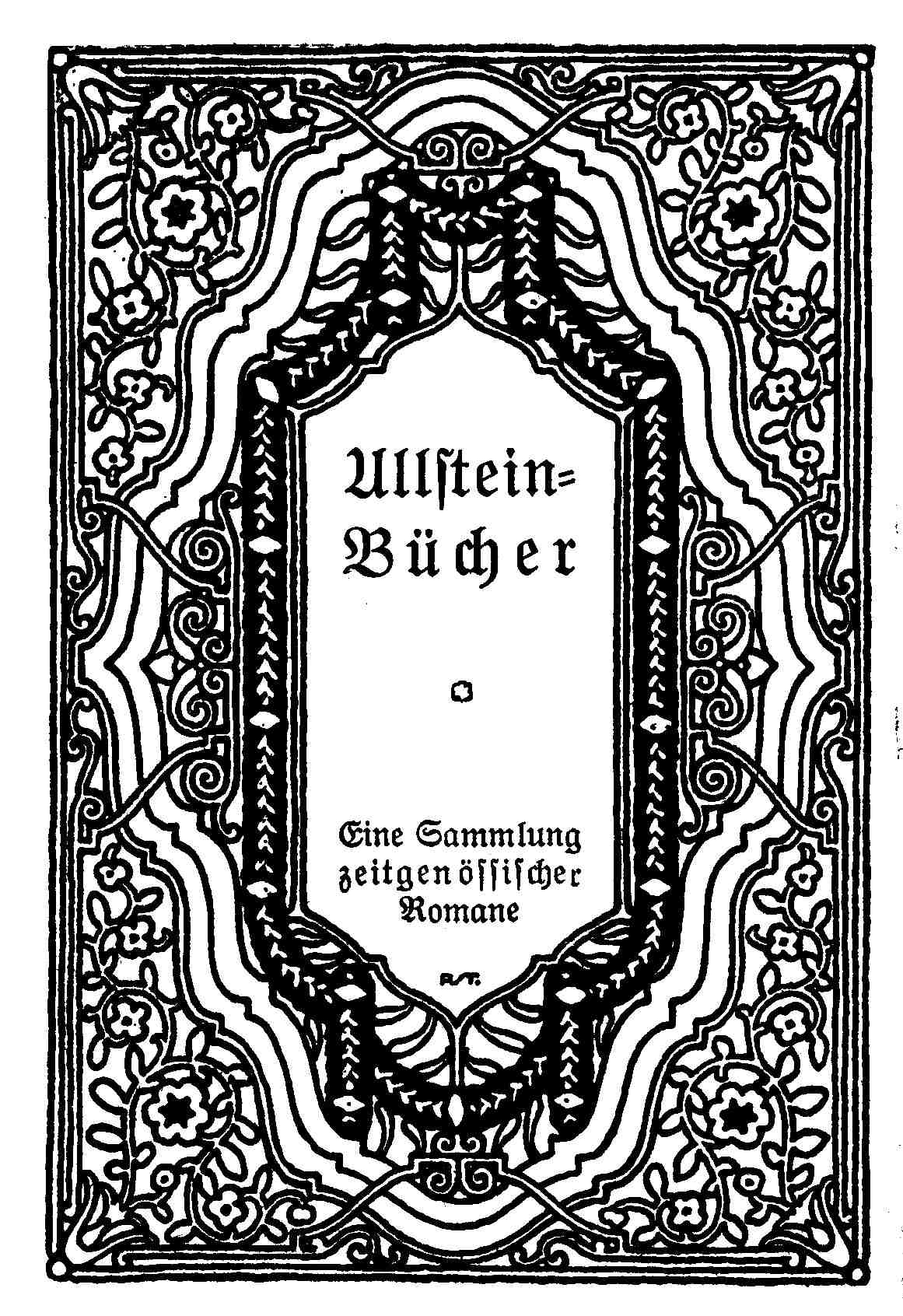
The Project Gutenberg eBook of Bruder Leichtfuß und Stein am Bein, by Richard Skowronnek
Title: Bruder Leichtfuß und Stein am Bein
Author: Richard Skowronnek
Release Date: June 4, 2023 [eBook #70910]
Language: German
Produced by: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
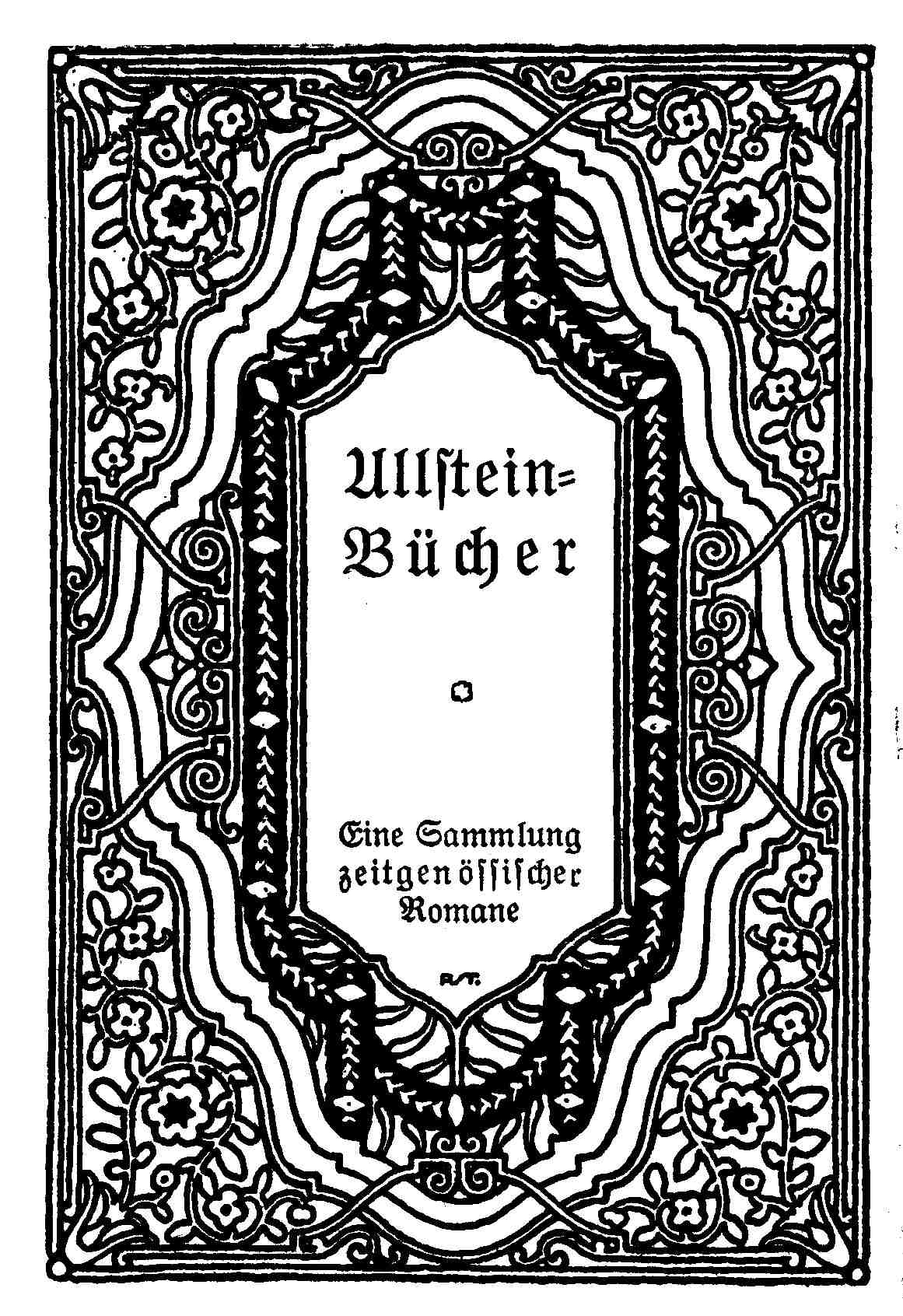
Ullstein-
Bücher
Eine Sammlung zeitgenössischer Romane

Roman
von
Richard Skowronnek
Ullstein & Co
Berlin-Wien
Copyright 1911 by Ullstein & Co, Berlin
„Draußen bleiben, Kalinski!“
„Aber, meine Herren, der Fisch wird schlecht, läßt die Köchin sagen, und wenn’s noch länger dauert, kann sie auch für den Braten nicht garantieren.“
„Ist egal, raus! Und kommen Sie hier nicht alle Nas’ lang ’reingeschettert, um zu horchen! Wenn wir essen wollen, werden wir’s schon sagen!“
„Na schön, meinetwegen! Wenn aber nachher das Diner nicht auf der sonstigen Höhe ist, ich hab’ keine Schuld!“
Herr Kalinski, Oberkellner des Grand Hotel de Russie in dem ostpreußischen Landstädtchen Stradaunen, zog sich gekränkt von der Tür zurück, hinter der die Tischgesellschaft Masovia eine geheime Sitzung abhielt, und nahm vor seinem Stifte Louis eine würdevolle Haltung an.
„Horchen! Ich und horchen! Hast Du so was schon mal an mir erlebt, Louis?“
„An Ihnen? Gott steh’ mir bei, nein, Herr Kalinski! Aber das sind immer diese gemeinen Erfindungen von dem Herrn Provisor Kellmigkeit. Wo er unsereinen zu sehen kriegt, hängt er einem ’ne Grobheit an.“
Herr Kalinski hob geringschätzig die glattrasierte Oberlippe.
„Keine Klasse! Und merk Dir das für Deine zukünftige Laufbahn, mein Jungchen: Wie sich einer gegenüber ’nem Kellner benimmt, danach kannst Du ihn gleich eintaxieren, was er ist. Der gemeine Powel schimpft, der Mittelstand ist freundlich, für die ganz vornehmen Herrschaften aber ist der Kellner Luft. Einfach Luft!“
Das pfiffige Jungengesicht des Stiftes verzog sich zu einem Grinsen.
„Der Herr Provisor schimpft! Und neulich hat er mich an den Ohren gerissen, ich soll in dem kleinen Schrankchen gekramt haben, wo die Herren das Protokollbuch verwahren über die geheimen Sitzungen.“
„Du hatt’st natürlich gekramt!“
Der Stift legte beteuernd die Hand auf die Brust.
„Herr Kalinski, ich schwör’ Ihnen, wahrhaft’gen Gott, nein! Aber wie das so kommt, das Schrankchen war ganz zufällig umgekippt, neulich, und dabei ging die Tür auf. Na und weil ich doch nun nicht in ’nen falschen Verdacht geraten wollt’, als hätt’ ich drin rumspioniert, fing ich in meiner Verlegenheit an zu probieren, ob ich die Tür vielleicht wieder zukriegen möcht’. Also da hat sich denn ’rausgestellt, daß mein Kommodenschlüssel zu dem Schrankchen paßt, als wenn er extra dafür gemacht wär’.“
„Hm,“ sagte Herr Kalinski und sah seinen Lehrling wohlwollend an, „was steht denn nun in dem geheimen Protokollbuch drin?“
„Gott, so allerhand. Einnahmen und Ausgaben, Berichte über Sitzungen und Festlichkeiten, für heute aber war ’ne Tagesordnung angesetzt.“
„Eine Tagesordnung?“
„Ja, ich hab’s ganz genau gelesen. Beschlußfassung über den Antrag Kellmigkeit, betreffend Stellungnahme zu dem Referendarius Brenitz.“
„Derselbe, wo bei uns von Berlin aus telegraphisch Zimmer bestellt hat? — Was zum Deuwel haben die Herren da drinnen zu ihm für Stellung zu nehmen?“
Der Stift zuckte mit den Achseln.
„Keinen Schimmer, das stand in dem Protokollbuch nicht drin. Aber morgen früh wird man ja sehen, was der Herr Provisor über die Sitzung eingeschrieben hat.“
Herr Kalinski kraute nachdenklich in seinen spärlichen Bartkoteletten und sah den Fliegen zu, die in dichtem Schwarme um das Bassin der Hängelampe kreisten.
„Hm, das ist so ’ne Sache. Was Gutes ist’s auf keinen Fall, wenn man zu einem ‚Stellung nimmt‘! Dieser Herr Referendarius Brenitz hat bei uns zwei Zimmer mit Salon bestellt, erst mal bloß für acht Tage, aber vielleicht, wenn’s ihm gefällt, bleibt er auch länger. Da würde es einen also schon vom rein geschäftlichen Standpunkt aus interessieren, was die Herren von der Masovia mit ihm vorhaben. Aber, hörst Du, ich bin ein Schäntelmann. Mit so was, wie Nachschlüsseln, will ich nichts zu tun haben.“
Louis, der Stift, kniff ein Auge zu und lächelte pfiffig.
„Das Schrankchen kann ja vielleicht wieder umfallen, wenn man aus Versehen dagegenstößt!“
„Kleines Beest,“ sagte Herr Kalinski, gab seinem Lehrling eine wohlwollende Kopfnuß und sprang diensteifrig zu, um einem verspäteten Mitgliede der Tischgesellschaft, dem Referendarius Heino von Bergkem, Hut und Stock abzunehmen; einem hochgewachsenen jungen Manne, dem im gebräunten Gesichte ein Paar lustige blaue Augen standen.
„Ergebensten guten Tag, Herr Baron! Wieder zurück aus Przygorowen? Und haben Herr Baron Weidmannsheil gehabt?“
„Dieses nun weniger! Aber seien Sie nicht so bestrickend liebenswürdig, Kalinski, Geld gibt’s heute doch noch nicht. Ich hatte keine Gelegenheit, meiner alten Dame die bei Ihnen angebundenen zweihundert Emm zu beichten.“
Herr Kalinski verneigte sich unterwürfig.
„Aber, Herr Baron! Und wie können Herr Baron bloß glauben, daß ich auch nur im entferntesten auf diese Kleinigkeit anspiegeln wollte?“
„Na, um so besser,“ unterbrach ihn Heino lachend und wandte sich zum Speisezimmer.
Die Herren von der Tischgesellschaft Masovia verneigten sich leicht auf ihren Stühlen, der Vorsitzende jedoch, Herr Provisor Kellmigkeit von der Apotheke zum goldenen Engel, runzelte die Stirn.
„Herr von Bergkem, in Anbetracht des wichtigen, zur Verhandlung stehenden Gegenstandes hatte ich eigens um pünktliches Erscheinen ersucht. Ich sehe mich daher genötigt, Sie in eine Strafe von zwanzig Pfennigen zu nehmen.“
„Mit Vergnügen,“ sagte Heino und schlug seine langen Beine rittlings über einen Stuhl, „was steht denn so Wichtiges zur Verhandlung? Ich war zwei Tage lang auf meiner heimatlichen Klitsche, um — leider vergeblich — einem kapitalen Bock nachzustellen.“
„Bitte, alles in der gehörigen Reihenfolge!“
Herr Kellmigkeit schob eine blecherne Sparbüchse vor Heinos Platz, wartete, bis die verwirkten zwanzig Pfennige erlegt waren, und läutete schließlich heftig mit einer kleinen Präsidentenglocke.
„Meine Herren! Nachdem durch das Erscheinen des Herrn von Bergkem eine beschlußfähige Zahl von Mitgliedern laut Paragraph 7 unserer Statuten erreicht ist, treten wir in die eigentliche Tagesordnung ein. Ich konstatiere als anwesend außer dem Vorsitzenden die Herren Steuerassistenten Lehmann, Petrigkeit, Annuschat, den Herrn Regierungsbauführer Rennebahrt, die Herren Referendarien Meyer und Freiherr von Bergkem. Die Schlußabstimmung ist namentlich und öffentlich, zur Sache selbst aber bemerke ich folgendes.“ Der Herr Provisor räusperte sich, legte sein bartloses Gesicht in wichtige Falten und machte eine Kunstpause, während der er sich in dem kahlen, nur von ein paar billigen Oeldrucken und einer Kaiserbüste geschmückten Raume umsah.
„Meine Herren! Wie wir hier versammelt sind, stehen wir alle auf dem Boden der absoluten und unbedingten Satisfaktion, halten unerschütterlich zu Kaiser und Reich, sind uns einig in der Wahrung der von den Vorfahren übernommenen, echt germanischen Weltanschauung. Meine Herren, in unsern so homogenen Kreis soll sich nunmehr ein fremdes Element drängen, ein gewisser Herr Peter Brenitz aus Berlin, von Beruf Referendarius, von Religion Jude. Der Herr Dezernent für Personalangelegenheiten im hohen Justizministerium hat in seltsamer Verkennung der bei uns herrschenden Anschauungen diesen Herrn Brenitz an das hiesige Amtsgericht versetzt ... nun gut, dagegen können wir uns nicht wehren. Wogegen wir uns aber wehren können, ist, daß dieser Herr in unserem Kreise Zutritt findet und so von vornherein die ihm gebührende Stellung in der guten Gesellschaft Stradaunens zugewiesen erhält. Ich habe mir daher erlaubt, einen Antrag einzubringen, dahin zielend, daß Herr Referendarius Brenitz aus Berlin zum Eintritte in die Tischgesellschaft Masovia nicht aufgefordert wird. Es ist wohl selbstverständlich, daß dieser Antrag einstimmige Annahme findet, um aber auch in diesem Falle nach Paragraph 21 meiner statutenmäßigen Pflicht zu genügen, frage ich, ob einer der Herren dazu noch das Wort wünscht.“
Zu beiden Seiten des langen Tisches, in dessen Mitte ein verstaubter Strauß aus künstlichen Blumen prangte, erhob sich zustimmendes Gemurmel, nur Herr Heino von Bergkem reckte sich auf seinem Stuhle heraus. Mit ernsthaftem Gesicht, aber in seinen blauen Augen blitzte es verräterisch.
„Ich bitte ums Wort zu einer kurzen Anfrage.“
Der Herr Vorsitzende läutete heftig.
„Silentium für den Herrn von Bergkem!“
„Danke! Also, Herr Kellmigkeit, wenn ich fragen darf: Versprechen Sie sich von der Annahme Ihres Antrages und dessen konsequenter Durchführung irgendeine erzieherische Wirkung?“
„Wie meinen Sie das?“
„Nun, sehr einfach. Glauben Sie, daß die Ausschließung aus unserer Tischgesellschaft auf den Herrn Referendarius Brenitz so niederschmetternd wirken wird, daß er danach in sich geht und den in diesem Kreise Anstoß erregenden Glauben seiner Väter ablegt?“
Der Herr Vorsitzende lächelte nachsichtig.
„Wieder ’mal eins Ihrer beliebten Scherzchen, Herr von Bergkem! Ich bemerke dazu, daß der in Rede stehende Gegenstand, wenn ich so sagen darf, gewissermaßen die Wahrung unserer heiligsten Güter, uns allen zu ernst sein dürfte, um denselben humoristisch zu behandeln. Was die Sache selbst anlangt ...“
„Einen Augenblick, Herr Kellmigkeit,“ unterbrach ihn Heino. „Ich konstatiere hiermit, daß meine Anfrage natürlich den Anspruch erhebt, ebenso ernst genommen zu werden wie alle sonstigen Verhandlungen in diesem Kreise. Eine Bemerkung unseres Herrn Vorsitzenden veranlaßt mich jedoch zur Stellung einer Unterfrage. Halten Sie das, was Herr Kellmigkeit soeben unsere heiligsten Güter nannte, für bedroht, falls Herr Referendarius Brenitz Mitglied dieser Tischgesellschaft wird? Sub 1, bedroht durch das schlechte Beispiel der genannten Persönlichkeit oder, sub 2, bedroht durch unsere eigene mangelnde Festigkeit in germanischer Sitte und Weltanschauung?“
Jetzt wurde der Herr Provisor ärgerlich. Er schwang eine Weile lang seine Glocke und bemerkte dann mit rotem Kopfe: „Ich lehne es ab, aufs strikteste ab, die Fragen unseres Mitgliedes, des Freiherrn von Bergkem, zu beantworten, nehme ihn vielmehr wegen Anulkung des Präsidiums in eine Ungebührstrafe von dreißig Pfennigen!“
Damit schob er die blecherne Sparbüchse vor Heinos Platz. Der Referendar Meyer aber, ein kleiner, dicker Herr mit verdächtig dunkler Haarfarbe, der schon während der vorausgegangenen Anfragen unruhig auf seinem Stuhle herumgerutscht war, hob die Hand.
„Ich beantrage Schluß der Debatte!“
Der lange Heino entrichtete umständlich seine Strafe und, während er mit der Rechten in der Westentasche nach Groschen suchte, reckte er die Linke in die Höhe.
„Ich protestiere! Sollte der Antrag Meyer aber wider Erwarten angenommen werden, so bitte ich ums Wort zu einer persönlichen Bemerkung.“
Der Herr Vorsitzende blickte fragend im Kreise umher und entschied nach einigem Zögern: „Herr von Bergkem hat das Wort. Der Antrag auf Schluß der Debatte ist abgelehnt.“
Heino verneigte sich leicht.
„Verbindlichsten Dank. Ich richte nunmehr an unseren verehrten Herrn Präsidenten die dritte Anfrage, und zwar dahin zielend: Soll der mehrfach genannte Referendar Brenitz lediglich aus religiösen Gründen oder aber auch wegen Zugehörigkeit zur semitischen Rasse von der Tischgesellschaft Masovia ausgeschlossen werden?“
Die Steueramtsassistenten und der Regierungsbauführer feixten heimlich vor Vergnügen, der Herr Provisor bemerkte, ein wenig unsicher, diese letzte Frage wäre wohl die überflüssigste von allen dreien. Heino aber blieb unerschütterlich.
„O, doch nicht so ganz, Herr Kellmigkeit. Falls nämlich auch die Rassenfrage für die Zugehörigkeit zu unserer Tischgesellschaft ausschlaggebend sein sollte, müßten wir eine recht fatale Konsequenz ziehen und ein hochgeschätztes Mitglied unserer Tafelrunde ebenfalls ausschließen.“
Jetzt sprang der Referendarius Meyer auf, dunkelrot vor Zorn und Verlegenheit:
„Was wollen Sie damit sagen, Herr Kollege?“
„Nichts anderes, als in meinen Worten lag. Daß Sie, Herr Kollege Meyer, sowohl als auch Ihr Herr Papa bereits seit längerer Zeit dem christlichen Glauben angehören, ist mir wohlbekannt, ebenso aber auch, daß Sie, rein ethnologisch gesprochen, zu derselben Menschenrasse zählen wie der hier zur Verhandlung stehende Referendarius Brenitz. Ich müßte also zu meinem Bedauern Ihre Ausschließung beantragen, falls unsere Tischgesellschaft in ihrer Mehrheit meine eben gestellte Frage bejahen würde.“
„Sollen diese Ausführungen für mich vielleicht eine beleidigende Spitze enthalten?“
Heino von Bergkem klappte die Hacken zusammen und neigte verbindlich seinen langen Oberkörper.
„Durchaus nicht, Herr Kollege, denn ich nehme natürlich an, daß Sie sich Ihrer Abstammung ebensowenig schämen wie ich mich der meinigen. Außerdem aber hatte ich mir vorhin erlaubt, Sie ein ‚hochgeschätztes Mitglied unserer Tafelrunde‘ zu nennen und, da diese Bezeichnung nicht ironisch gemeint war, dürfte mir wohl jede beleidigende Absicht fern gelegen haben.“
Der Referendarius Meyer gab sich mit dieser Erklärung zufrieden, der Herr Vorsitzende aber nicht. Er bemerkte, er wüßte wohl, gegen wen sich diese rabulistischen Fechterkunststücke des Freiherrn von Bergkem richteten. Wenn man mit seiner Führung der Präsidialgeschäfte unzufrieden sein sollte, wäre er gerne bereit, seinen Platz einem Würdigeren abzutreten. Im übrigen aber müßte er sich persönlich sehr wundern, daß Herr von Bergkem sich hier so nachdrücklich für jemand ins Zeug legte, von dem es doch jetzt schon ziemlich feststände, daß er nie und nimmermehr in den Kreis der Masovia aufgenommen würde.
Heino erwiderte darauf mit liebenswürdigem Lächeln, das hätten die Bergkems ungefähr seit der Deutschordenszeit so an sich, für Leute vom Leder zu ziehen, die sich selbst nicht zur Wehr setzen könnten.
Der Herr Provisor replizierte gereizt, er müßte sich jede Belehrung in Fragen eines korrekten Benehmens verbitten.
Heino bemerkte dazu verbindlich, nichts hätte ihm ferner gelegen als ein derartiger Versuch am untauglichen Objekt, und der Krach war fertig. Der Herr Provisor fuchtelte erregt mit dem Arm in der Luft:
„Dafür werden Sie mir Genugtuung geben, Herr von Bergkem!“
„Mit Vergnügen!“
„Außerdem lege ich meine Funktion als Vorsitzender nieder. Ich habe keine Lust, mich hier länger von Ihnen anulken zu lassen!“
„Schade,“ sagte der lange Heino gleichmütig, „Sie bringen mich dadurch um eine Beschäftigung, die mir im Laufe der Zeit recht lieb geworden war!“
Der Herr Provisor sah seinen Gegner vernichtend an.
„Das war Nachtusche, Herr von Bergkem! Sie werden wissen, was Ihnen danach bevorsteht.“
„O ja, aus ähnlichen Vorkommnissen ist mir’s so dunkel erinnerlich. Ich muß diese Nachtusche nicht nur revozieren, sondern auch feierlichst deprezieren, ehe ich Sie morgen früh im Zweikampfe vom Leben zum Tode befördere!“
Herr Kellmigkeit schnappte ein paarmal nach Luft.
„Abwarten, ob’s nicht vielleicht umgekehrt kommt! Vorläufig aber befinden Sie sich in einem Zustande, in dem honorige Menschen anständigerweise mit Ihnen nicht verkehren können. Ich hoffe daher, die anderen Herren werden mit mir daraus die einzig mögliche Konsequenz ziehen!“ Sprach’s und verließ dröhnenden Schrittes das Lokal.
Die Zurückgebliebenen saßen unschlüssig da, nur der Referendarius Meyer erhob sich, ein wenig zögernd, und langte nach seinem an der Wand hängenden Strohhütchen. Da reckte sich der lange Heino zu seiner ganzen Größe heraus, auf seiner weißen Stirn zeichnete sich eine feine blaue Ader ab.
„Einen Augenblick, Herr Kollege! Bis jetzt war es leidlicher Spaß, ich würde es aufs lebhafteste bedauern, wenn’s mit einem Male blutiger Ernst werden sollte. Ich muß Sie daher ersuchen, Herrn Kellmigkeit nicht zu folgen, sondern für heute mit meiner kümmerlichen Gesellschaft vorlieb zu nehmen. Ich bitte Sie, mit mir auf das Wohl unseres früheren Herrn Vorsitzenden ein Glas Sekt zu trinken.“
Der Referendarius Meyer nahm seinen Platz wieder ein und zwang sich zu einem Lächeln.
„Zu komisch mit Ihnen, Herr Kollege! Man weiß nie, meinen Sie’s wirklich ernsthaft oder machen Sie sich nur über alles und jedes lustig!“
Da lachte der lange Heino auf, daß ihm unter dem blonden Schnurrbärtchen die weißen Zähne blitzten.
„In der Tat, manchmal weiß ich’s selbst nicht. Aber der vorliegende Fall ist recht lehrreich, denn er zeigt wieder einmal deutlich, wie inopportun es ist, weltbewegende Fragen mit hungrigem Magen zu behandeln. Sehen Sie mal“ — er griff nach dem auf dem Tische liegenden Menü — „wir essen heute Soupe Julienne, Zander à la Maître d’Hôtel, Hammelrücken à la Westmoreland, Butter und Käse oder eine Tasse Kaffee, je nach Wahl. Unser gewesener Herr Präsident aber muß sich drüben im Gasthof zum Kronprinzen mit einem zähen Beefsteak begnügen, denn dort gibt es keine Table d’hote! Glauben Sie, meine Herren, daß er das lange aushalten wird?“
„Jetzt aber mal zur Sache selbst,“ bemerkte einer der Steueramtsassistenten, „und Spaß beiseite. Darf ich fragen, wie Sie zu dem Antrage Kellmigkeit gestimmt hätten? Dafür oder dagegen?“
Heino von Bergkem sah den Fragenden fest an.
„Spaß beiseite, Herr Annuschat? Nun gut! Wir sind hier eine Gesellschaft von jungen Leuten, die der Zufall zusammengeweht hat, weil’s in diesem kleinen Nest nur einen einzigen Gasthof gibt, in dem man ohne allzu schwere Schädigung seiner Gesundheit zu Mittag essen kann. Außerdem beobachten wir beim gegenseitigen Zutrinken gewisse Gebräuche, und Beleidigungen fechten wir nicht mit dem Knüppel aus. Das ist an und für sich sehr schätzenswert, aber ich zweifle doch daran, ob es uns das Recht gibt, einen anständigen Menschen von vornherein von der Gesellschaft des hiesigen Städtchens zu diffamieren, nur weil er Jude ist, denn darauf, nicht wahr, würde der Antrag des Herrn Kellmigkeit doch im letzten Sinne hinauslaufen? Den Herrn Brenitz kennen wir alle nicht, aber aus der Tatsache, daß er zum königlich preußischen Referendar ernannt worden ist, scheint mir hervorzugehen, daß er nicht die Gepflogenheit besitzt, silberne Löffel zu stehlen, im Kartenspiel zu betrügen oder Wechsel zu fälschen. Alles übrige aber dürfte uns egal sein. Ich hätte also ... gegen den Antrag unseres Herrn Vorsitzenden gestimmt.“
„Ich nicht,“ sagte Herr Annuschat, „und ich glaube, meine Herren Kollegen ebenfalls nicht. Daß wir selbstverständlich voll und ganz auf dem Boden des Antisemitismus stehen, brauche ich wohl nicht erst besonders zu betonen. Ich mache Sie daher darauf aufmerksam, daß sich in unserer bisher so harmonischen Gesellschaft doch wohl eine Spaltung vollziehen dürfte, falls Sie auf Ihrem Standpunkte beharren.“
Heino machte ein betrübtes Gesicht.
„Wie beneide ich Sie, meine Herren, daß Sie in so jungen Jahren sich schon zu einer so festen Weltanschauung durchgerungen haben. Ich muß zu meiner Beschämung gestehen, ich hatte bisher dazu noch keine Zeit. Den zweiten Teil Ihrer werten Ausführungen aber habe ich nicht recht verstanden. Beabsichtigen Sie, unserem verehrten Herrn Präsidenten zu folgen und von jetzt an ebenfalls im Hotel zum Kronprinzen zu speisen?“
Herr Annuschat bekam einen roten Kopf und reckte den Hals aus dem Uniformkragen.
„Ich muß doch sagen .. ich muß doch sagen ..“
„Na, was denn?“ fragte Heino freundlich und klemmte sich ein Monokel ins rechte Auge. „Das Essen ist Ihnen drüben zu schlecht, nicht wahr?“
„Allerdings. Außerdem aber möchte ich bemerken, daß wir in der Mehrzahl sind, es also wohl nicht nötig haben, uns von Ihnen hier aus dem Hotel de Russie verdrängen zu lassen!“
„Aber, mein lieber Herr Annuschat, wer spricht denn davon? Im Gegenteil, ich werde mich ganz außerordentlich freuen, Sie hier morgen zu begrüßen!“
„Ebenfalls,“ sagte der andere steif, „aber da wir, wie bereits bemerkt, in der Majorität sind, haben wir doch wohl auch das Recht, darüber zu bestimmen, mit wem wir verkehren wollen und mit wem nicht!“
Heino ließ sein Monokel fallen.
„Sieh mal an, so steht die Sache? Nun denn: Morgen mittag wird der Herr Referendar Brenitz hier an diesem Tische mein Gast sein. Sollte er wider Erwarten den Fisch mit dem Messer essen, bin ich als Erster bereit, gegen ihn und mich den Antrag auf Ausschließung zu stellen. Im anderen Falle aber erwarte ich von Ihnen, meine Herren, daß Sie ihm mit derjenigen Höflichkeit begegnen, die ich für meine Gäste beanspruchen darf.“
„Es geht doch aber absolut nicht,“ erwiderte der andere erregt, „daß Sie uns hier so ganz einfach Ihren Willen aufzwingen?“
Heino verneigte sich freundlich.
„Wieso nicht, Herr Annuschat? Gehen geht alles, es fragt sich nur, ob die anderen sich’s gefallen lassen. Ihnen aber möchte ich im speziellen den wirklich gut gemeinten Rat geben, morgen mittag meinem Gaste gegenüber in dem Ausdrucke Ihrer sogenannten Weltanschauung recht vorsichtig zu sein. Wenn ich mir mal ’was in meinen dicken Schädel gesetzt habe, kriege ich’s fertig, dafür selbst bis zu zwei Jahren Festung abzusitzen! Haben wir uns verstanden?“
„Vollkommen,“ sagte Herr Annuschat mit gemessener Verneigung, „mir jedoch verbietet’s meine Erziehung, anderen Leuten unerbetene Ratschläge zu erteilen. Ein jeder muß wohl selbst am besten wissen, was er zu tun oder zu lassen hat!“
„Na, dann sind wir uns ja einig! Ich stelle nunmehr den Antrag, mit dem Essen zu beginnen.“ Heino sah sich lächelnd im Kreise um. „Es erfolgt kein Widerspruch, der Antrag ist einstimmig angenommen. Kalinski, die Suppe! Und auf meine Rechnung eine Flasche Champagner extra, der Herr Kollege Meyer und ich haben ein freudiges Ereignis zu begießen!“ — — —
„Stradaunen, sechs Minuten!“ Der Schaffner eilte am Zuge entlang und riß die Türen auf. Aus einem Coupé zweiter Klasse stieg ein schmächtiger junger Mann in elegantem Reiseanzuge, rückte mit einer mechanischen Handbewegung den Klemmer in dem bartlosen Gesichte zurecht und sah sich suchend um.
Herr Kalinski, der in Anbetracht der vorausbestellten zwei Zimmer mit Salon persönlich auf dem Bahnhofe erschienen war, trat herzu und lüftete den schäbigen Zylinder.
„Habe ich die Ehre mit Herrn Referendar Brenitz aus Berlin?“
„Zu dienen, mein Name ist Brenitz.“
„Kalinski! Repräsentant des Grand Hotel de Russie. Und jetzt geben Sie mir bitte den Gepäckschein für Ihr Koffertchen, das kann der Hausknecht mit dem Omnibus besorgen. Wir beide gehen wohl am besten zu Fuß. Der Omnibus hat keine Federn, und auf unserm Steinpflaster stuckert’s so, daß man die Seekrankheit kriegen kann.“
Ueber das schmale Gesicht des jungen Mannes flog ein Lächeln. Der breite ostpreußische Dialekt, der in seiner Klangfarbe etwas unsäglich Gutmütiges und Treuherziges hat, amüsierte ihn.
„Ein Köfferchen? Ich habe, außer meinem übrigen Gepäck, allein zwölf schwere Bücherkisten mitgebracht. Es dürfte sich also wohl empfehlen, einen größeren Wagen zur Abholung zu schicken.“
Herrn Kalinski verschlug’s vor Erstaunen fast die Rede:
„Gott erbarm sich, zwölf Kisten! Wozu braucht ein Mensch bloß so viel Bücher?“
„Zum Lesen, Herr ... Herr ...“
„Kalinski,“ half der andere aus und griff unwillkürlich nach dem Zylinder, während er den Gepäckschein in Empfang nahm. Wer sich den Luxus gestattete, mit zwölf schweren Bücherkisten zu reisen, mußte entschieden aus gutem, wenn nicht gar wohlhabendem Hause stammen. Und überhaupt, der neue Referendarius sah gar nicht so jüdisch aus, wie er’s nach den, teilweise recht laut geführten Erörterungen der Tischgesellschaft Masovia eigentlich erwartet hatte. Eher nach einem jungen Oberlehrer sah er aus mit seinem blassen, feingeschnittenen Gesicht. Und ein Paar braune Augen hatte er, die trotz des störenden Kneifers recht freundlich und gutmütig dreinblickten.
Sie schritten selbander die schattige Allee entlang, die unter dichtbelaubten Linden vom Bahnhofe zum Städtchen führte. Herr Kalinski hob von Zeit zu Zeit die Hand, um seinen Begleiter auf besondere Sehenswürdigkeiten aufmerksam zu machen: den hohen Schornstein der Brauerei und die erst im vorigen Jahre neuerbaute Feldscheune des Stadtverordnetenvorstehers Pielemann, des reichsten Ackerbürgers von Stradaunen.
Sein Begleiter hörte ihm freundlich zu, unterbrach ihn jedoch plötzlich mit der Frage, ob sich im Hotel de Russie schon sein Chauffeur gemeldet hätte.
Herr Kalinski blickte verwundert auf.
„Ein Schofföhr?“
„Ja, mit meinem Auto. Mein Arzt hat mir zwar empfohlen, hier recht viel zu Fuß zu laufen, aber ich habe mich doch entschlossen, meinen Wagen mitzunehmen. Ich will auch etwas von der weiteren Umgebung kennen lernen. Meiner Berechnung nach hätte er eigentlich heute früh hier sein müssen.“
Jetzt blieb Herr Kalinski stehen und schöpfte tief Atem. Ein Referendarius, der ein Auto besaß, war ihm in seiner Praxis noch nicht vorgekommen.
„Ein Au... Auto? Und e... entschuldigen Sie, Herr Brenitz, Sie si... sind wohl sehr reich?“
Peter Brenitz lachte herzlich auf.
„Reich? Das ist ein recht relativer Begriff. Ich habe ungefähr so viel, wie ich brauche, denn mein seliger Großvater hatte die Vorsicht, mein zukünftiges Vermögen in Terrains anzulegen.“
„Terrains!“
Herr Kalinski nahm unwillkürlich einen halben Schritt Abstand und lüftete hochachtungsvoll seinen bräunlich schimmernden Zylinder.
„Von Terrains habe ich schon öfter gehört. Da sollen manche Leute in Berlin klotziges Geld verdienen. Wo früher kaum Sandhafer wuchs, soll man ja heute für den Morgen zehntausend und mehr Daler zahlen. Hier noch nicht mal dreihundert Mark.“
Von da an geriet die Unterhaltung ins Stocken, denn Herr Kalinski war in schweres Nachdenken versunken. Einen Gast, der ein eigenes Automobil und Terrains in Berlin besaß — mit dem Worte „Terrain“ verband sich ihm unwillkürlich der Begriff von ungezählten Millionen — hatte das Grand Hotel de Russie seit seinem Bestehen nicht beherbergt, märchenhafte Preise waren da zu nehmen, zum mindesten vier Mark pro Zimmer und Tag, und märchenhafte Trinkgelder zu verdienen. Dazu aber gehörten mehr als die vorläufig bestimmten acht Tage. Vor allem aber war es notwendig, den antisemitischen Uebereifer des Herrn Provisors Kellmigkeit zu dämpfen, damit dem hochgeschätzten Gaste unangenehme Eindrücke erspart blieben. Gewiß, wer ein bißchen ’was auf sich hielt, war natürlich Antisemit, aber, wenn das Geschäft in Frage kam, verschloß man seine Gefühle im innersten Schreine seines Herzens, und wenn die Millionen anfingen, hörten selbst in den allervornehmsten Kreisen die antisemitischen Gesinnungen auf. Also mußte in diesem ähnlich liegenden Falle eine diplomatische Aktion ins Werk gesetzt werden, vielleicht in der Weise, daß der Besitzer des Grand Hotel de Russie sich zu dem Besitzer der Apotheke zum goldenen Engel begab und diesem auseinandersetzte, daß sein Provisor den fatalen Ausschließungsantrag zurückzog. Wenn man ihm deutlich mit der Kündigung winkte, falls er sich’s beifallen ließe, den sozialen Frieden des Städtchens zu stören, war es anzunehmen, daß er im Interesse eines gesicherten Broterwerbs ein Opfer an Ueberzeugung brachte. Der Besitzer der Goldenen Engel-Apotheke aber war zu einer so gearteten Einwirkung sicherlich sehr leicht zu bestimmen, denn er handelte unter anderem auch mit Benzin, und weshalb sollte er wegen der antisemitischen Gesinnung seines Provisors auf einen Kunden verzichten, der als Automobilbesitzer sicherlich Tausende von Litern dieses kostbaren, in Stradaunen sonst nur zur Entfernung von Fettflecken verkauften Stoffes gebrauchte? ...
So weit war Herr Kalinski in seinen Erwägungen gekommen, als ihn eine Frage seines Begleiters aus dem Nachdenken riß. Wie geartet die Bevölkerung des Städtchens wäre, fragte nämlich der Herr Referendarius Brenitz, und da kam Herrn Kalinski ein Einfall, so genial, daß er vor Freude fast einen Luftsprung getan hätte.
„Die Bevölkerung? Prima, prima, Herr Referendarius! Pferde können Sie hier mit den Leuten stehlen gehen, so gutmütig und entgegenkommend sind sie. Der einzige Störenfried ist ein Apotheker.“
„Ach! Ein Apotheker?“
„Ja! Sonst ein ganz umgänglicher Herr, aber er fängt alle Nas’ lang Krach an. Namentlich mit Fremden. Wenn ’was Fremdes zugereist kommt, das ist für ihn, wie für den Bullen das rote Tuch. Aber man muß das nicht ernst nehmen, nach einiger Zeit begibt er sich wieder.“
„Um Himmels willen,“ sagte Peter Brenitz. „Da müßte ich mich ja hüten, bei ihm ein Rezept machen zu lassen!“
„Nein, so verrückt ist er nun nicht, der Herr Provisor Kellmigkeit, nur so leicht „übergebraten“, wie alle Apotheker. Aber Sie wissen ja jetzt Bescheid, und wenn Sie den Herrn Provisor treffen, werden Sie auch wissen, wie Sie ihn zu behandeln haben.“
„So so,“ erwiderte Peter Brenitz zerstreut, denn seine Aufmerksamkeit war von einem die Straße entlang fahrenden Wagen in Anspruch genommen, einem Dogcart, vor dem ein Paar schnittige Trakehner trabten, gelenkt von einer blondhaarigen jungen Dame. Die Aufmachung war tadellos, Peitsche und Zügelversammlung in bester Haltung, und die Trakehner gingen wie an der Schnur. Unwillkürlich war er stehen geblieben, hatte grüßend die karierte Reisemütze gezogen. Die junge Dame auf dem Bocke neigte dankend die Peitsche, und nach einem Dutzend Pferdelängen sah sie sich nach der unbekannten Erscheinung um ... eine scharf gegen den blauen Himmel gezeichnete, elegante Silhouette, deren Umrisse in dem von den Rädern aufgewirbelten Staube verschwanden, wie eine Fata Morgana, die sich dem Wanderer im Wüstensande zeigte ...
„Wer war das, eben?“
Herr Kalinski zuckte, ein wenig geringschätzig, mit den Achseln.
„Das gnädige Fräulein aus Przygorowen, auch so ’ne Sache mit unverkäuflichen Terrains. Wenn der Wind schlecht steht, laufen sie über die Grenze, aber neulich munkelte man so ’was von Hellingen. Hellingen! Man muß wissen, was das in hiesiger Gegend bedeutet: dreiundsechzigtausend Morgen! Lächerlich, an so was überhaupt nur zu denken!“
Peter Brenitz hätte seinen Führer gerne gebeten, diese, wohl nur einem eingeborenen Stradauner verständliche Runensprache ins Deutsche zu übersetzen, aber eine gewisse anerzogene und angeborene Schüchternheit verschloß ihm den Mund. Zuweilen, selbst von näheren Bekannten, wurde sie ihm als Hochmut ausgelegt, aber er konnte nichts dafür. Es war ein Erbteil vom Vater her, der in einer weltfremden Zurückgezogenheit gelebt hatte, halb ein Gelehrter, halb ein Fanatiker. Ein Gelehrter, der die gesamte Weltliteratur durchforschte, um Beweise für eine Theorie zu finden, daß das Volk Israel allenthalben als Träger einer höheren Kultur zu wirken hätte, und, trotz des eigenen, eingesponnenen Lebenswandels, ein fanatischer Gegner aller Absonderungsbestrebungen. Restlos hätte das auserwählte Volk in den Stämmen aufzugehen, die ihm nach höherer Weisung Schutz und Obdach gewährten, und von dieser Verschmelzung erhoffte er eine neue Blüte des ganzen Menschengeschlechtes ... Wie aus einer glücklichen Ehe, deren Nachkommen alle guten Eigenschaften der Eltern erbten, und ein Vermögen hatte er gemeinnützigen Stiftungen geopfert, die ihm geeignet erschienen, sein Ideal um einen einzigen kleinen Schritt der Verwirklichung näher zu bringen ...
Ein Erlebnis in heißer Feldschlacht hatte ihm den Sinn auf rastlosen Erwerb gewandelt und den neuen Weg gewiesen, wie die Erscheinung aus Himmelshöhen einstmals dem Apostel der Christengemeinde ... Bei St. Privat war es gewesen, das zweite Garderegiment rückte in Kolonne nach der Mitte gegen die feindlichen Stellungen vor. Die Kugeln pfiffen, die platzenden Schrapnells rissen Lücken in die stürmenden Reihen, die sich wie auf dem Exerzierplatze wieder zusammenschlossen, die Musik spielte den Avanciermarsch, wie auf dem Tempelhofer Felde. Ab und zu gab es in dem dröhnenden Gekrach einen schrillen Mißklang, wenn einem der tapferen Bläser von feindlichem Geschoß die Brust zerrissen wurde, unentwegt aber erklang nach dem letzten Paukenschlag die schrille Melodie der Pfeifer: „Wir geh’n dem Tod entgegen, tirilititi, tiriliti, wir geh’n dem Tod entgegen ...“
Eine Mauer stand im Weg, in weißlichen Pulverdampf gehüllt, irgendwoher kam ein lauter Kommandoruf: Drauf und drüber! ... Einen Augenblick lang geriet die anstürmende Welle ins Stocken, einen Augenblick später kletterten Hunderte von verwegenen Gesellen über das Hindernis ... Ein grober Kolben schwebte hoch in der Luft, um dem Einjährigen Brenitz den Kopf zu zerschmettern, eine blitzende Klinge fuhr dazwischen ... „sac’ nom de Dieu ...“ Der Hieb ging vorbei, ein schwarzbärtiger Turko stürzte vornüber aufs Gesicht.
„Herr Leutnant, schön’ Dank!“
„Unsinn, Einjähriger! Einhauen!“
Und ein paar Augenblicke später, die Gefangenen waren in einem Winkel des Kirchhofes zusammengedrängt, gab es Revanche. Eine der am Boden liegenden braunen Bestien hatte hinterrücks den Revolver erhoben, zielte auf den Leutnant, wie ein Wurfspeer fuhr die bajonettbewehrte Flinte des Einjährigen dem Kerl in die Gurgel.
„Jetzt sind wir wieder quitt, Herr Leutnant!“
„Na schön, dann können wir das nächste Mal wieder von vorne anfangen!“ ...
Der Christ hatte dem Juden das Leben gerettet, und der Jude dem Christen, vierzehn Tage später aber kamen die Eisernen Kreuze heraus, und der Herr Regimentskommandeur hielt bei der Ueberreichung eine markige Ansprache, stellte sie beide, den Leutnant Freiherrn von Bergkem und den Kriegsfreiwilligen Hermann Brenitz den anderen als ein nacheifernswertes Beispiel todesverachtender Kameradschaft dar ...
An diesem Tage glaubte der Kaufmann Brenitz seinen wahren Beruf erkannt zu haben, und als ihm ein paar Jahre später der Tod seines Vaters die wirtschaftliche Unabhängigkeit verlieh, übergab er das Geschäft seinem Bruder und widmete sich mit stiller Zähigkeit der Arbeit an einem Ziele, dessen Erreichung ihn höher dünkte als alles, was Menschengeist sonst erstrebte.
In diesem Glauben hatte Hermann Brenitz seinen spät geborenen Einzigen erzogen, und als ihn noch vor der Schwelle des Greisenalters ein rascher Tod von dannen rief, hinterließ er dem Sohne als köstlichstes Erbteil seinen hochgerichteten, allem Kleinlichen abholden Sinn, seine schier leidenschaftliche Liebe zu allem, was schwach und unterdrückt war, und ein milde urteilendes Herz, das über Fehler und Gebresten der anderen verzeihend hinwegsah. Daneben aber leider keine Spur von praktischer Lebenserfahrung und auch nicht ein Quentchen jenes gesunden Egoismus, der in den heutigen harten Zeiten selbst einem reinen Idealisten vonnöten ist ...
Seine erste Tat, nachdem er die Universität bezogen hatte, war die Gründung eines Studentenvereins „Utopia“, in dem er zu seinem Teil an der Verwirklichung der väterlichen Ziele zu arbeiten gedachte, der Verbrüderung von Deutschtum und Judentum. Auf seinen Aufruf am schwarzen Brette meldeten sich drei Mitglieder, ein Jude und zwei Christen. Der Jude, ein Rabbinersohn aus dem Posenschen, war aus Opposition eingetreten und bewies ihm in stundenlangen Debatten, daß seine Theorien Unsinn wären, daß das Ziel des Judentums vielmehr in der strengen Absonderung läge und in letztem Sinne in der friedlichen Wiedereroberung der alten zionistischen Heimat. Die beiden Christen aber waren praktischer gesonnen. Sie faßten die geplante Verbrüderung mehr im Sinne einer Vermögensteilung auf, lebten ein Semester lang auf seine Kosten und pumpten ihn an. Und als der Rabbinersohn aus dem Posenschen zu Beginn des zweiten Semesters in seiner Eigenschaft als Kassenwart an die Zahlung der rückständigen Mitgliederbeiträge erinnerte, traten sie aus, bezeichneten die Bestrebungen der Verbindung roherweise als „Mumpitz“ und sengten den beiden jüdischen Mitgliedern der „Utopia“ bis zur Abfuhr auf. Der Rabbinersohn erklärte, seine Anschauungen gestatteten ihm nicht die Teilnahme an einem Zweikampfe, Peter Brenitz aber, der von seinem Vater gelernt hatte, ein rechter Mann müßte im Notfalle seine Ueberzeugung auch mit seinem Blute besiegeln, trat mit dem Schläger in der Faust für die gekränkte Ehre der „Utopia“ ein. Das Resultat waren zwei gewaltige „Abfuhren“, eine über den Kopf und die andere quer über die Stirn und Nase, so daß er nach dem langwierigen Ausheilungsprozesse Schwierigkeiten hatte, vor seinen kurzsichtigen Augen den Klemmer zu befestigen.
Aber das focht ihn weiter nicht an, viel schmerzlicher berührte ihn ein anderes Erlebnis, das mit der Pauksuite gegen die beiden abtrünnigen Mitglieder unmittelbar in Zusammenhang stand. Sein tapferes Verhalten auf den beiden Mensuren hatte das Wohlgefallen der „Alanen“ erregt, bei denen er „Waffen belegt“ hatte, und der Erste dieses in Berlin hochangesehenen Korps lud ihn ein, sich an einem der nächsten offiziellen Abende auf der Kneipe einzufinden. Diese Einladung aber erfüllte ihn mit Stolz, denn sie bedeutete nichts anderes, als daß man in den Kreisen der „Alania“ Wert darauf legte, seine Mitgliedschaft zu gewinnen. Mit geschwelltem Busen ging er zu der offiziellen Kneipe hin, trank mehr, als seinen frischen Schmissen dienlich war, sang begeistert im Chore mit „Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun“ und „Strömt herbei, ihr Völkerscharen“. Als er sich aber zum Eintritt meldete, nahm ihn der Erste der „Alania“, ein narbenbedeckter, sehniger Bursch’, der das schwere, dunkle Bier wie Wasser hinabschüttete, beiseite.
„Scharmant, lieber Herr Kommilitone, aber wir haben zu unserm lebhaftesten Bedauern erst heute nachmittag erfahren, daß Sie noch nicht getauft sind. Wenn Sie bereit sind, dieses Versäumnis nachzuholen — es könnte ziemlich rasch und schmerzlos bewerkstelligt werden, denn einer unserer alten Herren ist zufällig Pastor in Rixdorf — wären wir unsererseits ebenfalls bereit, Sie aufzunehmen.“
„Entschuldigen Sie gütigst,“ sagte Peter Brenitz darauf, „der Paragraph 1 Ihrer Statuten lautet doch: ›Das Korps ist eine Vereinigung von Studierenden zur Pflege echten Burschensinnes ohne Rücksicht auf Religion und politisches Glaubensbekenntnis‹?!“
„Gewiß, das war früher einmal, aber heute haben sich die Zeiten geändert. Heute müßten wir befürchten, im hohen Kösener Verband als ein Bund zweiter Klasse eingeschätzt zu werden, falls wir nicht lauter christliche Mitglieder hätten. Wenn wir Ihnen gestatten, durch eine, immerhin gangbare Hintertür das hohe Ziel der Mitgliedschaft eines Korps zu erreichen, so mögen Sie daraus ersehen, daß wir immerhin auf Ihren Eintritt einigen Wert legen.“
„Herzlichen Dank,“ erwiderte Peter Brenitz, „aber das Betreten dieser Hintertür muß ich ablehnen. Mein seliger Vater erträumte Zeit seines Lebens die Verschmelzung von Christen und Juden als sein höchstes Ideal, aber nur auf dem Grunde der Gleichberechtigung, als von zwei gleichwertigen Komparenten, die bei einer Vereinigung nichts aufzugeben hätten. Ich würde nicht in seinem Sinne handeln, wenn ich auf Ihre Bedingung einginge.“
Der Erste der Alanen stand auf und klappte förmlich die Hacken zusammen.
„Dann bedauere ich lebhaft! Darf ich meinen Rest auf Ihr Wohl trinken, Herr Studiosus?“ Er schüttete den Inhalt seines Glases die Kehle hinab, und Peter Brenitz verstand ihn. Er hob sein Glas: „Ich löffle mich, Herr Studiosus“ — studentische Gebräuche hatte er gelernt, als er noch der selig entschlafenen „Utopia“ präsidierte — und nach einer kurzen Schicklichkeitspause, damit sein Abgang nicht so absichtlich aussähe, entfernte er sich. Nicht so sehr über die Zumutung betrübt, die man ihm gestellt hatte, als über den Verlust jeder Möglichkeit, in den Kreisen der Alanen für die Ausbreitung der väterlichen Ideen wirken zu können.
In der Zeit, als er sich für die beiden Mensuren einpaukte, hatten die lustigen Gesellen ihm gar sehr gefallen, einer oder der andere unter ihnen sah auch wohl so aus, als entbehrte er nicht eines gewissen Interesses für höhere, über die tägliche Kneipe und den Fechtboden hinausreichende Ziele, aber wie sollte man ihm näher kommen? Sie lebten ja alle in einer Gemeinschaft, die sich mit einer aus Vorurteilen gebauten Mauer umgab. Und wenn er später im Vorhofe der Universität unter dem bunten Gewimmel der dort paradierenden Studentenverbindungen die Farben der Alanen auftauchen sah, zog sich ihm immer das Herz zusammen ...
Für eine Weile gab er es auf, Freundschaften im andern Lager zu suchen. Er betrieb mit gewissenhaftem Eifer sein juristisches Studium und versenkte sich in die Schätze der väterlichen Bibliothek. In seinen kärglichen Mußestunden aber huldigte er einem Sport, zu dem er aus Zufall und Gutmütigkeit gekommen war. Eines Tages nämlich hatte er aus der Konkursmasse eines Fabrikanten, dem sein Vater zur Etablierung eine erhebliche Summe vorgestreckt hatte, ein Automobil übernehmen müssen. Der Chauffeur erklärte, er müßte brotlos werden, wenn der Wagen in andere Hände überginge. Eine solche Verantwortung aber mochte Peter Brenitz nicht tragen, also behielt er Gefährt und Lenker, und wenn dieser in gemessenen Zwischenräumen erklärte, es wäre wieder einmal nötig, die Maschine zu bewegen, wurde eine Spazierfahrt in den Grunewald unternommen. Von dem alten Hause in der Wilhelmstraße, in dem der Studiosus Brenitz den ersten Stock bewohnte, nach Pichelswerder und nach einer Erfrischungspause, deren Dauer der Chauffeur bestimmte, wieder zurück. In Pichelswerder nämlich besaß dieser eine Braut, die im „Seeschlosse“ als Köchin diente, und wenn sie von beruflichen Pflichten nicht allzusehr in Anspruch genommen wurde, nützte der verliebte Chauffeur die günstige Gelegenheit zu einem längeren Beisammensein. Sein Herr aber trank indessen geduldig eine Tasse Kaffee, rauchte nachdenklich eine oder mehrere Zigaretten und paßte auf den in Sichtweite am Gartenzaun stehenden Wagen auf ...
So vergingen allmählich die Semester. Peter Brenitz war auf dem besten Wege, ein versponnener und menschenscheuer Einsiedler zu werden, wenn ihn nach dem glücklich bestandenen Examen nicht seine Wahrheitsliebe unversehens in eine andere Umgebung versetzt hätte. Als nämlich die neugebackenen Referendarien nach „besonderen Wünschen bezüglich ihres zukünftigen Beschäftigungsbezirks“ gefragt wurden und die Mehrzahl natürlich sich mit triftigen Gründen um das Verbleiben in Berlin bewarb, wußte er allein keine solchen Gründe anzuführen. Er besaß zwar als einziger, der das Examen mit dem Prädikate Gut bestanden hatte, einen gewissen Anspruch auf Berücksichtigung und wäre ja auch recht gerne in Berlin und seinen liebgewordenen Gewohnheiten geblieben. Die anderen aber versicherten, sie wären in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, wenn man sie nicht in der Reichshauptstadt beschäftigte, und das traf bei ihm nicht zu. Er war weder genötigt, seinen Unterhalt durch Stundengeben zu verdienen, noch darauf angewiesen, bei Verwandten zu wohnen. Einen triftigen Grund aber frei zu erfinden, vertrug sich nicht mit seiner Wahrhaftigkeit.
Also trat er bescheiden hinter den anderen zurück und erhielt acht Tage nach dem Examen die offizielle Mitteilung, er wäre an das Amtsgericht Stradaunen im Landgerichtsbezirke Lyck versetzt. Er mußte das Konversationslexikon zu Rate ziehen, um zu erfahren, in welche Gegend des deutschen Vaterlandes ihn die amtliche Verfügung für die nächsten Jahre seines Lebens verschlug, und mit einem leichten Seufzer klappte er den dicken Band wieder zu.
„Stradaunen, Stadt im Regierungsbezirke Allenstein, Provinz Ostpreußen, 2000 Einwohner, Amtsgericht,“ lautete die dürftige Notiz. Das klang nicht sehr ermutigend, aber einen Trost gab es immerhin: das Städtchen lag in Ostpreußen, und von diesem Landstriche hatte der verstorbene Vater immer mit besonderer Liebe gesprochen. In jungen Jahren, noch vor dem Feldzuge, hatte ihn eine geschäftliche Reise dorthin geführt, und seit dieser Zeit bewahrte er in seinem Herzen eine dankbare Erinnerung an die gastfreie Aufnahme, die er allenthalben gefunden. Gar nicht genug aber wußte er die biedere und offene Gesinnung der Bevölkerung zu rühmen, bei der ein Wort und ein Handschlag mehr galten als anderwärts geschriebene Verträge, und mit einem gewissen Stolze pflegte er hinzuzufügen, daß bei „seinen lieben Ostpreußen“ die Seuche des Antisemitismus verhältnismäßig die geringste Ausdehnung gefunden hätte. In diesem Lichte besehen, nahm sich die Versetzung nach Stradaunen also schon bedeutend freundlicher aus, und schließlich, was ließ er denn in Berlin zurück, um das er sich sonderlich hätte grämen müssen? Freunde besaß er keine, die Vergnügungen der Weltstadt lockten ihn nicht, und mit seinen Verwandten von Vatersseite her verknüpfte ihn nur ein recht loses Band. Das Schwierigste dünkte ihm die Auseinandersetzung mit seinem Chauffeur, an den er sich im Laufe der Jahre gewöhnt hatte, und den er doch nicht gut brotlos machen konnte. Auf der anderen Seite aber durfte er ihn doch auch nicht vor den schweren Konflikt stellen, zwischen den Pflichten gegen seinen Herrn und seine Braut zu wählen. Wider alles Erwarten jedoch vollzog sich die Lösung dieses Dilemmas in sehr einfacher Weise.
Der Chauffeur nämlich erklärte ziemlich gelassen, an der Braut in Pichelswerder läge ihm wenig. Er könnte alle Tage eine andere finden, nimmermehr aber einen so guten und freundlichen Herrn. Da hielt ihm Peter Brenitz eine kleine Standrede, daß es frivol wäre, mit einem Menschenschicksal so leichtsinnig zu spielen. Als er aber die Versicherung empfing, auch die Pichelswerderin würde sich gar bald mit einem anderen trösten, war er’s zufrieden. Er händigte dem Chauffeur ein namhaftes Geldgeschenk ein, um die verlassene Braut wenigstens ein bißchen für die Untreue zu entschädigen, an der er sich selbst nicht ganz schuldlos fühlte, und begab sich leichteren Herzens nach der Tiergartenstraße, um dem Geheimen Kommerzienrat Brenitz, dem einzigen Bruder seines Vaters und Inhaber der altangesehenen Bankfirma Samuel Brenitz’ sel. Witwe Söhne, deren Gründungsjahr in die Regierungszeit Friedrich Wilhelms des Zweiten hinaufreichte, seinen pflichtgemäßen Abschiedsbesuch zu machen.
Der alte Herr, der in den Kreisen der Börse und der Industrie ein gewaltiges Ansehen genoß, verwaltete dem Neffen das Vermögen, beteiligte ihn, ohne groß zu fragen, an sicheren und gewinnbringenden Unternehmungen, für seine besondere Wesensart aber hatte er kein Verständnis. Ein junger Mensch, aus dem etwas Tüchtiges werden sollte, hätte mit beiden Füßen im wirklichen Leben zu stehen, statt unerfüllbaren Phantastereien nachzuhängen, und was er einstmals dem Bruder verziehen hatte, machte er dessen Sohn zum Vorwurf. Ein hart empfundenes Geschick hatte ihm selbst den männlichen Erben versagt, nur zwei Töchter wuchsen ihm heran, die von einer eitlen Mutter nach dem eigenen Vorbilde erzogen wurden. Es verbitterte ihm die beste Schaffensfreude, daß er die stolze, alte Firma, die ihre in schweren Zeitläuften errungene Größe seiner rastlosen Arbeit verdankte, einmal fremden Händen hinterlassen sollte. Als sein Bruder starb, empfand er daher neben aller gerechten Trauer fast ein Gefühl der Freude, denn jetzt gab es eine Möglichkeit, sich einen Nachfolger zu erziehen, der seinen Namen trug und aus seinem Blute war; aber schon nach den ersten ernsthaften Gesprächen mußte er zu seinem Leidwesen erkennen, daß er sich einer trügerischen Hoffnung hingegeben hatte. Der damals kaum den Knabenschuhen entwachsene Jüngling hörte ihn respektvoll an, aber seinen Werbungen setzte er ein festes Nein entgegen. Denn er hatte dem sterbenden Vater in die Hand gelobt, seinem Lebenswerke mit allen Kräften ein Erfüllen zu geben.
Da wurde der Geheimrat heftig, schalt seinen verstorbenen Bruder einen Narren, der aus dem Sohne einen noch größeren Narren gemacht hätte, und erklärte, die einzige Lösung der Judenfrage wäre die, den Christen Respekt einzuflößen, statt ihnen nachzulaufen.
Peter Brenitz verbat es sich, daß in seiner Gegenwart das Andenken seines Vaters geschmäht würde, und das Zerwürfnis war fertig. Seither wurde er in dem Hause seines Onkels ein seltener Gast, der sich nur bei besonderen Gelegenheiten einstellte, und keiner fand den Weg zum andern, wenn sie sich im innersten Herzen auch einsam fühlten. Der Jüngere fürchtete den Spott, und der Ältere hatte sich über seiner enttäuschten Hoffnung verbittert. Erst als Peter zum Abschiednehmen kam, traten sie sich wieder um ein weniges näher.
Der alte Geheimrat empfing ihn gegen alles Herkommen sehr freundlich, hörte der Mitteilung, daß er ans Amtsgericht Stradaunen versetzt worden wäre, mit halbem Ohre zu, dann aber legte er los, um einen Groll, der ihm am Herzen fraß, in eine verschwiegene Brust zu entladen.
Eine Weile lang ging er in dem geräumigen Gemache, durch dessen hohe Scheiben die Eichen des Tiergartens im grünen Blätterschmucke grüßten, auf und ab, die Hände auf dem Rücken und das bartlose Gesicht mit der mächtigen Stirn leicht zur Seite geneigt. Und plötzlich blieb er stehen.
„Also, sie hat’s richtig geschafft, die geborene Guggenheimer,“ — wenn er auf seine Frau zornig war, pflegte er sie mit ihrem Mädchennamen zu bezeichnen, auf den sie als Angehörige eines alten Frankfurter Geschlechts nicht wenig stolz war — „es ist ein Gardeleutnant! Noch dazu von der Kavallerie und aus ältestem, verschuldetem Adel. Von Krotthelm heißt er. Schon in den Kreuzzügen haben seine Vorfahren gegen die Ungläubigen gekämpft, und er setzt die Traditionen seiner Ahnen mit ungeschwächten Kräften fort, nimmt mir mein Geld und meine Tochter. Die Ilse natürlich, denn die Frida ist, Gott sei Dank, so unbedeutend und häßlich — sie schlägt mehr nach mir ... Also da hat sich noch keiner herangetraut. Denn die Lüge, seine Liebe wäre so abgrundtief und so weiter, wäre zu knüppeldick!“
„Aber, Onkel,“ warf Peter schüchtern ein, „ist es denn so ganz und gar ausgeschlossen, daß dieser Herr von Krotthelm für Deine Tochter Ilse eine wirkliche Zuneigung empfindet?“
Der Geheimrat Brenitz lachte höhnisch auf.
„Bloß Zuneigung, mein Söhnchen? Liebe empfindet er, eine so heftige Liebe, daß er ohne mein Kind nicht leben kann! Und das stimmt aufs Haar, denn ich habe mich sehr sorgfältig und bei allen möglichen Stellen über ihn erkundigt. Er kann wirklich ohne die Ilse nicht weiterleben, denn die Schulden schlagen ihm über dem Kopf zusammen. Seine Pferde und seine Maitresse kann er nicht weiter halten, wenn er meine Ilse nicht kriegt mit ihren baren zwei Millionen Mitgift.“
„Dann würde ich doch aber ganz einfach meine Zustimmung verweigern, lieber Onkel?!“
„Ach, was Du sagst!“ Der Geheimrat stellte sich vor seinen Neffen hin und legte ihm die Hand auf die Schulter: „Zustimmung! Dazu gehören doch immer zwei, einer, der fragt, und der andere, der Ja sagt. Meine Frau aber hat mich gar nicht gefragt“ — er schlug mit der geballten Faust einen zornigen Lufthieb — „sondern hinter meinem Rücken die Anzeigen verschickt. Aus der Vossischen Zeitung heut früh hab’ ich’s erfahren, daß meine älteste Tochter sich verlobt hat. Nicht auf die Börse hab’ ich mich getraut, um mich nicht auslachen zu lassen, und in die Ressource geh’ ich vor den nächsten drei Monaten nicht, trotzdem ich meine Partie Bridge vor dem Essen nötiger hab’ als ein Kranker seine Medizin! ‚Gratuliere,‘ sagt der alte Hirschfeld, der Louis Meyer und der Goldschmidt desgleichen, und nachher, beim Spielen, kommen die Gemeinheiten.
‚Ich überlasse,‘ sagt der Hirschfeld, ‚und nicht wahr, lieber Brenitz, Ihr zukünftiger Herr Schwiegersohn steht, wenn ich recht gelesen habe, bei den Gardedragonern?‘
‚Pik,‘ sagt der Meyer, ‚was soll es bei meinem Pech schon anders sein? Aber ich habe gehört, bei einer Heirat mit einer Jüdin muß der Bräutigam zum Train.‘
Und der Goldschmidt mit seinem kahlen Schädel und der einsamen Skalplocke nimmt die Karten zusammen:
‚Die Herren von der Gegenpartei hätten bei richtigem Verständnis der Lage drei Trick in sans atout gemacht! Was aber Ihren zukünftigen Schwiegersohn angeht, lieber Brenitz‘ — dabei wetzt er die Zunge an den Lippen, denn jetzt kommt die größte Gemeinheit — ‚so kann ich’s verstehen, daß Sie mit beiden Händen zugegriffen haben. Einen versierteren Vorsteher der Wechselabteilung, als den Baron von Krotthelm, können Sie sich gar nicht wünschen. Der reitet auf ’nem Wechsel so gut wie auf ’nem Pferd, und auch in der Industrie weiß er Bescheid. Neulich hat er von einem Gurglerkonsortium einen größeren Posten Damenkorsetts übernommen und mit Nutzen losgeschlagen. Denn die Valuta blieb er natürlich schuldig ...‘
Also, was sollst Du da tun? Alten Freunden, die es gut mit Dir meinen, die Karten an den Kopf werfen? Oder mit der Faust auf den Tisch hauen: Da ist nur die geborene Guggenheimer daran schuld? Weil sie aus einem Geschlechte stammt, das mit den Rothschilds Haus an Haus gewohnt hat in der Judengasse zu Frankfurt und das damals schon über diese Parvenüs die Nase rümpfte, weil zweihundert Jahre früher ein Guggenheimer zu Worms auf dem Scheiterhaufen brannte? Deshalb aber — ausgerechnet — kennt sie keinen höheren Ehrgeiz, als ihrer Tochter einen adligen Christen zum Eidam zu suchen, und ich als Vater muß den Mund halten? Weil sie mich einmal erwischt hat, als ich ein junges Tanzmädchen aus einem Theater hübscher fand als die geborene Guggenheimer? Na, und jetzt freu’ Dich doch, Weltverbesserer,“ so schloß der Geheimrat Brenitz mit grimmigem Auflachen, „das Ziel Deiner Sehnsüchte ist ja erreicht. Einer aus dem anderen Lager steigt über die trennende Mauer, das Christentum verschmilzt mit dem Judentum, und — Hosiannah — ein neuer Fortschritt des Menschengeschlechtes ist endlich angebahnt?!“ ...
Der Geheimrat Brenitz wandte sich ab und starrte zornig über den blumengeschmückten Vorgarten auf die breite Straße hinab. Sein Neffe aber hob den feinen Kopf mit den schwärmerischen Augen.
„Mein seliger Vater, lieber Onkel, hat immer gesagt, in einem wäre die Lehre der Christen erhabener und schöner als die unsrige: in der verzeihenden Liebe, die einen reuigen Sünder höher einschätzte als eine ganze Schar von Gerechten. Und weshalb sollen wir uns diesen Satz nicht annehmen? Vielleicht, wenn Du Deinen zukünftigen Schwiegersohn mit Liebe empfängst, daß es Dir gelingt, durch Zuspruch und Beispiel aus ihm einen Mann zu erziehen, der Dir eine Freude wird und eine Stütze für Dein Alter?“
Der Geheimrat Brenitz fuhr jählings herum, als er aber in das Gesicht seines Neffen blickte, stockte ihm das kränkende Wort, das sie schon einmal geschieden hatte, auf den Lippen.
„Also, es ist gut, mein Sohn. Ich weiß, Du meinst es ehrlich. Aber geh hinüber auf die andere Seite des Hauses, da führen sie zu Dreien ein Lustspiel auf: ‚Der adlige Mitgiftjäger oder der geprellte Schwiegervater‘, und da paßt Du mit Deinen Anschauungen besser hin. Ich gratulier’ Dir, es wird ein Trauerspiel daraus. Aber was liegt Dir an dem Hause Brenitz? Ein leerer Name ist’s für Dich, Schall und Rauch, wie der Dichter sagt, und nichts spricht zu Dir, daß auch ein Name Pflichten auferlegt?!“ ...
Peter Brenitz atmete tief auf.
„Lieber Onkel, es kommt mir nicht zu, Dir Ratschläge zu erteilen, eins nur möchte ich Dir noch sagen: Dein zukünftiger Schwiegersohn ist doch ein Edelmann! Leichtsinnig vielleicht und auch leichtfertig, aber doch im Innersten von anständiger Gesinnung, sonst hätte er des Königs Rock nicht tragen dürfen. Und ein gutes Wort findet gute Stelle! Sprich Dich mit ihm aus, so recht aufrichtig und herzlich, und ich bin überzeugt, Du wirst noch an dieser Verbindung Freude erleben!“
Der alte Herr Geheimrat lächelte trübe.
„Mein Sohn, was bist Du noch jung! Fast könnte man Dich beneiden, denn es muß schön sein, das Leben durch eine rosenrote Brille anzusehen ... Auch ich kenne manchen Edelmann, Barone, Grafen, Fürsten und Herzöge ... den Hut ab vor ihnen; denn ihre Gesinnung ist lauter und ihr Wort wie Eisen. Aber sie kommen in mein Geschäftskontor in der Behrenstraße, um sich bei mir Rat zu holen für spekulative Anlagen, oder sie bringen mir ihr Vermögen zur Verwaltung, weil sie wissen, bei Samuel Brenitz sel. Witwe Söhne liegt es so sicher wie im Juliusturm. Was aber in mein Haus kommt hier in der Tiergartenstraße, das, mein Sohn, ist Ausschuß! Und glaub’ mir, jeder Edelmann, oder, ich will dieses Wort nicht mißbrauchen, sondern lieber dafür sagen, jeder Mann aus einer einstmals adligen Familie, der einem Judenmädchen in die Augen sieht, um es zu seinem Weibe zu machen, hat vorher schon in den Lauf einer Pistole gesehen. Solche Menschen aber erzieht man nicht! Und ich werde Dir sagen, wie alles kommen wird: Die Freude da drüben wird genau so lange vorhalten wie das Geld, das die Guggenheimer ihrer Tochter mitgeben kann, denn ich steure zu dieser Verbindung keinen Pfennig bei! Von dem Guggenheimerschen Gelde — es sind immerhin zwei Millionen — wird der Herr Baron erst seine Schulden bezahlen und dann sich ein Rittergut kaufen, hier irgendwo in der Nähe von Berlin. Dort aber wird ein Leben sein, wie im Himmel, jeden Tag ein Fest mit Gästen, bis das Geld zu Ende ist. Und eine Weile danach wird mein Kind hier vor mir stehen, an Leib und Seele gebrochen, mir vielleicht fluchen, daß ich sie heute nicht zurückgehalten habe ... Also, es ist gut, ich kann’s nicht ändern. Und jetzt adieu, mein Sohn, nimm’s mir nicht übel, daß ich alter Mann zu Dir von meinen Sorgen und Kümmernissen gesprochen habe. Reise mit Gott und nimm all Deine Ideale mit in Deinen neuen Wirkungskreis. Ich wünsch’ Dir alles Gute. Wenn Du jedoch Dir eines Tages das Herz wund gestoßen hast da draußen, denk’ an das alte Haus in der Behrenstraße mit dem verwitterten Firmenschild über der Tür. Der Tag soll gesegnet sein, an dem Du unter ihm durchschreitest, und das Haus hat schon Schwereres getragen als einen Chef, der nicht nur seine Angestellten und sich selbst, sondern die ganze Menschheit beglücken wollte“ ....
Da begehrte Peter Brenitz nicht auf, sondern hob dem Bruder seines Vaters die schlaff vom Lehnstuhle herabhängende Hand.
„Lieber Onkel, Du hast vorhin gesagt, ein Name verpflichtet. Der meinige legt es mir auf, meinem verstorbenen Vater zum Wohlgefallen zu leben. Er hat mir den Beruf eines Richters erwählt, und für diesen will ich mich mit Ernst vorbereiten. Verzeih mir also, wenn ich Dir nicht zu Willen sein kann, und verzeih mir auch jetzt in der Stunde des Abschieds, daß ich Dir damals vor vier Jahren mit heftigen Worten widersprach. Heute sehe ich, daß Du mich nicht in böser Absicht kränken wolltest, und es tut mir leid, daß ich nicht öfter den Weg zu Dir fand!“ ...
Dem alten Herrn wurden die Augen feucht, und noch lange saß er sinnend in seinem Lehnstuhle ...
Ein Kind ging da ins Leben hinaus, ein reiner Tor, der nach dem heiligen Grale der Versöhnung suchte ... Und fast wie Neid sprang’s ihn an gegen den verstorbenen Bruder, der in dem Sohne einen Nachfolger besaß, einen, der an seinem Werke weiterarbeitete, mochte es noch so unfruchtbar und töricht sein. Er aber?! ... Er hatte gerafft und gescharrt, Schätze auf Schätze gehäuft, und wenn er von dannen ging, mußte er sehen, daß die Arbeit seines Lebens in die Hände verschwenderischer Erben fiel ..
Ein heißer Groll stieg ihm im Herzen empor, und er reckte die Hand nach dem Klingelknopfe auf dem Schreibtische. Der Diener erschien in der Tür: „Herr Geheimrat?“
„Meinen Wagen!“
Und als er fünf Minuten später in Ueberzieher und Zylinder auf die Straße trat, sah er mit ingrimmigem Lächeln zu den Fenstern hinauf, hinter denen die geborene Guggenheimer sich ihres Triumphes freute — mit ihrem adeligen Schwiegersohn.
Der Kutscher auf dem Bocke griff an den Hut.
„Jerusalemer Straße 21, Justizrat Wolff!“
Und mit einem kurzen Auflachen stieg der Geheimrat ein, wie jemand, der im Begriffe stand, einen guten Witz zu machen. Nur schade, daß er bei der Pointe nicht mehr dabei sein konnte! Aber die Vorfreude war auch etwas wert, und er sah ordentlich die langen Gesichter seiner Erben, wenn sie bei der Testamentseröffnung nachrechneten, was ihnen nach dem Abzuge aller Legate für wohltätige Stiftungen übrig blieb. So lange er lebte, hielt er das Brenitzsche Geld mit eiserner Hand, aber ein vorsichtiger Mann sorgte beizeiten dafür, daß sein Wille auch nach dem Tode respektiert wurde ...
Peter Brenitz hatte sich auf dem Schauplatze seiner neuen Tätigkeit umgesehen, und er gefiel ihm wohl. Aus den Fenstern der Vorderzimmer im Grand Hotel de Russie blickte er auf einen freien Platz, in dessen Mitte das übliche Kriegerdenkmal stand, eine geflügelte Viktoria auf einem Unterbau aus unbehauenen Findlingssteinen. Im Hintergrunde erhob sich ein altes Kirchlein mit schlankem Glockenturm, und freundliche Häuser mit sauberen Läden zogen sich zu beiden Seiten hin.
Aus dem Schlafzimmer aber bot sich die Aussicht auf den blauen Spiegel eines weitgestreckten Sees, sanft geschwungene Hügel umrahmten seine Ufer, und weit hinten in der Ferne grüßte der dunkle Saum des Waldes, lockte zum Wandern und Träumen ...
Die Zimmer waren hell und geräumig, auf dem Tische des sogenannten Salons prangte zum Willkomm ein großer Blumenstrauß, und Frau Popiella, die rundliche Gattin des Wirtes, knickste und dienerte.
„Aber bester, trautster Herr Referendarius, bloß von acht Tagen kann ja gar keine Rede sein, so rasch lassen wir Sie nich weg, i wo nein, Sie tragen uns ja die Ruh aus dem Haus!“
Peter bemerkte schüchtern, es hätte allerdings in seiner Absicht gelegen, eine mittlere Sechszimmerwohnung zu mieten, eine kleine Villa am liebsten, mit abgeschlossenem Garten. Frau Popiella aber legte, ordentlich erschrocken, die speckige Hand auf die zum Platzen gespannte Kattunbluse.
„Gott erbarm sich, sechs Zimmer und hier in Stradaunen? So viel hat ja nich mal der Herr Amtsgerichtsrat mit seinen sieben Kindern, und wozu braucht ein einzelner junger Herr bloß so viel Gelaß?“
„Ja,“ sagte Peter, ein wenig hilflos, „ich gebe zu, daß ich in dieser Beziehung wohl allzu sehr verwöhnt bin. Immerhin brauche ich doch mehrere Räume für meine Bibliothek, einen für den Flügel und etliche andere unentbehrliche Einrichtungsstücke, die ich mir aus Berlin nachschicken lassen möchte. Auch ein eigenes Badezimmer hätte ich gerne.“
Frau Popiella schüttelte den Kopf.
„Hier wird nur im Sommer gebadet, unten im See. Und überhaupt, so ’ne Wohnung werden Sie in ganz Stradaunen nich finden. Auf Spekelatzion wird hier nich gebaut, was die paar Herrschaften vom Steueramt sind, die sind froh, daß sie unter sind, wenn wer nach außerhalb versetzt wird, is auch gleich schon immer der Nachfolger da. Und die Herren Assistenten und so, die begnügen sich mit einem Budchen. Aber, was wollen Sie, Herr Referendarius, wir nehmen hier noch zwei Zimmer zu, und Sie leben wie im Himmel!“
So sprach Frau Popiella fort und fort, pries mit erheblicher Zungenfertigkeit die Annehmlichkeiten der zentralen Lage, deren sich das Grand Hotel de Russie erfreute, und hob die Vorzüge hervor, die das Wohnen in einem Gasthofe mit sich brächte: Prompte Bedienung von geschultem Personal und warme Restauration zu jeder Tageszeit.
Peter Brenitz aber zögerte noch immer, sich durch ein festes Abkommen für längere Zeit zu binden. Auf der Fahrt von Berlin hatte ihm etwas anderes vorgeschwebt als eine Wohnung im geräuschvollen Hotel ... irgendwo ein rosenumbuschtes Häuschen in schattigem Garten mit verschwiegenen Laubengängen am Ufer eines stillen Weihers ... Da spann man sich mit seinen geliebten Büchern ein, oder, wenn man das Glück hatte, einen gleichgestimmten Gefährten zu finden, wurde an den Abenden ein wenig musiziert und in langen Gesprächen alles erörtert, was in der Brust nach Klarheit rang ... Schließlich gab Herr Meltzer, der Chauffeur, der mit seinem pfauchenden und rasselnden Wagen eine halbe Stunde vorher unter dem Staunen der ganzen Bevölkerung einen triumphartigen Einzug gehalten hatte, den Ausschlag. Nach einer bedeutungsvollen Rücksprache mit Herrn Kalinski und einer kurzen Musterung des weiblichen Küchenpersonals, die ein zufriedenstellendes Ergebnis gehabt zu haben schien, begab er sich in den oberen Stock hinauf, wo sein Herr noch immer der Beredsamkeit von Frau Popiella standhielt.
„Also, Herr Doktor, ick hab mir informiert, so wat, wie wir suchen, jibt et hier nich. Det sind in bezuch auf hochherrschaftliche Wohnungsverhältnisse ja die reinen Zulukaffern. Wenn wir uns nich selbst ’ne Villa bauen wollen, müssen wir schon hier wohnen bleiben!“
Peter Brenitz seufzte auf und griff nach seinem Zylinderhute, um sich zur Meldung aufs Amtsgericht zu begeben. Alle geschäftlichen Verhandlungen waren ihm ein Greuel, und wenn Frau Popiella noch lange in ihn gedrungen wäre, hätte er schließlich das ganze Grand Hotel de Russie gemietet ...
„Es ist gut, hier unsere freundliche Wirtin hat mir schon Aehnliches berichtet. Also machen Sie für ein Vierteljahr zunächst alles ab! Einigen Sie sich auch über den Preis, und teilen Sie mir dann das Nötige mit!“
„Wird besorgt,“ sagte Herr Meltzer und schlug in militärischer Haltung die Hacken aneinander. Seinem findigen Geiste, der sich bisher nur bei der Neubeschaffung von Reifen und größeren Reparaturen des Autos in der Festsetzung seines, vom Chauffeurstandpunkte aus legitimen Gewinnanteils betätigt hatte, erschloß sich hier mit einem Male eine neue Erwerbsquelle, und nach einer langen, geschäftlichen Auseinandersetzung, bei der Frau Popiella leuchtende Augen und rote Backen bekommen hatte, klappte er befriedigt sein öliges Notizbuch zusammen. Die vereinbarten Preise betrugen ungefähr das Doppelte von dem, was Herrn Kalinski selbst bei ausschweifender Phantasie als Maximum vorgeschwebt hatte. Wenn die einträgliche Stellung noch ein paar Jährchen vorhielt, konnte man sich selbständig machen und ein kleines Geschäft anfangen ...
„Wenn er sich nu aber irgendwo erkundigt?!“ meinte Frau Popiella bedenklich. Herr Meltzer aber machte eine beruhigende Bewegung mit der von Oel und Benzin geschwärzten Hand:
„Und wenn schon, dann jloobt er’t nich! Wissen Se, jnädje Frau, wat det for ’n Mensch is? Immer mit ’n Kopp in de Wolken und ’n Herz wie ’n Lamm! Eher denkt er, de Welt jeht unter, als det ihn eener hochnehmen könnte, und janz abjesehen von dieser Noblijkeit — et schadt ihm nischt, denn von den Reichtum kann sich unsereens jar keene Vorstellung nich machen. Klotzig, sag ick Ihnen, und wat er for ’n jutet Tierchen is, dafor nur een Beispiel. Ick hatt’ da unter anderm ooch ’ne Braut in Pichelswerder. Und wie wir nu fortmachten von Berlin, händicht er mir doch tausend Märker ein, als Entschädigung for det Mächen, und det se sich über meinen Verlust nich zu sehr jrämen sollte. Wie ville, meenen Se wohl, det ick meine jewesene Braut von diese tausend Märker abjejeben habe?“
„Taugenichtssche Berliner Kreet,“ sagte Frau Popiella und gab ihrem Gegenüber mit der quabbeligen kleinen Faust einen wohlgefälligen Stoß gegen die schwarze Lederjacke. Herr Meltzer aber zwirbelte sich das spärliche Schnurrbärtchen auf und revanchierte sich mit einem zärtlichen Blick in ein Paar wässerig-blaue Augen. Fortan war er auch über die Größe der Bratenportionen beruhigt, die zu seinem täglichen Ausgedinge gehörten ...
Herr Popiella, der gewichtige Besitzer des Grand Hotel de Russie, hatte sich unterdessen quer über den Marktplatz in die Apotheke zum goldenen Engel begeben, um mit deren Inhaber, dem Beigeordneten und Vorsteher des konservativen Wahlvereins, Herrn Kraska, ein ernsthaftes Gespräch unter vier Augen zu führen. Und das von Herrn Kalinski erfundene Argument eines gesteigerten Benzinabsatzes, das Herr Popiella jedoch nach den zwischen Prinzipalen und Angestellten herrschenden Grundsätzen als sein eigenes Geistesprodukt bezeichnete, tat seine Schuldigkeit. Herr Kraska fand, der Antisemitismus wäre durchaus kein integrierender Bestandteil der konservativen Parteirichtung, vielmehr ein lediglich nebensächlicher Satz, dessen Befolgung oder Nichtbefolgung ganz im freien Belieben des einzelnen läge. Herr Popiella aber hätte seinerseits vollkommen recht, wenn er im Interesse eines gesteigerten Fremdenverkehrs von dieser im Programme vorgesehenen Freiheit Gebrauch machte und sich, diskret, aber energisch, gegen eine unangemessene Störung seines Geschäftsbetriebes wandte. Und als er sich nach einem kräftigen Händedrucke entfernte, hörte er, wie der Provisor Kellmigkeit von seinem Chef aus dem vorderen Ladenraume nach hinten in die Rezeptierkammer gerufen wurde. Die Tonstärke dieses Rufes aber ließ darauf schließen, daß die nachfolgende Belehrung an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen würde ...
Das Gerücht von der Ankunft eines millionenreichen Berliner Referendars hatte sich schon in den frühen Morgenstunden im Städtchen verbreitet, kaum, daß Herr Kalinski seinen Gast unter verstärktem Anschlage der Hotelglocke in die vorher bestellten Gemächer geleitet hatte. Das Eintreffen des Autos, dem der bebrillte und staubbedeckte Lenker auf dem Vordersitze höchst überflüssigerweise eine Anzahl greulich klingender Signale entlockte, erregte geradezu Sensation und ließ auch die letzten Zweifler verstummen, denn eine solche Maschine war in Stradaunen noch nie zuvor gesehen worden. Wer sich einen derartigen Luxus verstattete, mußte allerdings sehr reich sein. Die abenteuerlichsten Erzählungen wurden weitergetragen und geglaubt. Das ganze Grand Hotel de Russie sollte er gemietet haben, dieser sagenhafte Millionenreferendar, und zwar mit der Bedingung, daß während seiner Anwesenheit dort kein anderer Gast wohnen dürfte. Später aber gedächte er sich an passendem Platze anzukaufen, und gar mancher Hausbesitzer trat auf den Marktplatz hinaus, musterte prüfenden Blickes sein Anwesen und überlegte, wie hoch im Ernstfalle wohl der Aufschlag zu dem ortsüblichen Grundstückspreise zu berechnen wäre.
In den Schaufenstern der beiden Läden, die mit Herrenartikeln handelten, erhielten die Auslagen einen keckeren Schmiß, und etliche der Mütter, die ihrem gesellschaftlichen Range gemäß darauf rechnen konnten, daß der neue Referendarius in ihrem Hause einen Besuch machen dürfte, sahen sich ihre heranwachsenden Töchter an.
„Olga, Du mußt Dir entschieden eine modernere Frisur zulegen. Du aber, Marie, spring’ rasch in die Buchhandlung hinüber und hol’ die letzte Modenzeitung. Man weiß ja schon gar nicht mehr, was getragen wird, und wenn einer aus Berlin kommt, möcht’ man sich doch nicht gern lächerlich machen.“ ...
So übte das rote Gold seine Macht, und als Peter Brenitz in korrektem Gehrock, Lackstiefeln und Zylinder unter der Obhut des wegkundigen Stiftes Louis über den Marktplatz nach dem in einer Seitenstraße gelegenen Amtsgerichte ging, verneigten sich die in den Türen stehenden Ladenbesitzer, und hinter den behutsam zur Seite geschobenen Gardinen im ersten Stock sahen blaue und braune Augen auf die Straße hinab. Peter Brenitz aber freute sich über die freundliche und zutrauliche Haltung der Bevölkerung. Sie stimmte so ganz zu dem Bilde, das ihm der verstorbene Vater von „seinem lieben Ostpreußen“ gezeichnet hatte ...
Das Gerücht von dem Reichtum des neu aus Berlin gekommenen Referendars war natürlich auch in das Amtsgericht gedrungen, und Heino von Bergkem saß mißmutig über einem dickleibigen Aktenstücke im Richterzimmer; baute an einem Erkenntnis, rauchte eine Zigarette nach der anderen und ärgerte sich. Aergerte sich über sich selbst, daß er tags zuvor in der „Masovia“ für diesen Kollegen Brenitz so gewaltig und nachdrücklich vom Leder gezogen hatte, halb aus innerlichem Gerechtigkeitsgefühl, halb, um die stumpfsinnigen Bonzen der Tischgesellschaft wieder einmal in Verlegenheit zu versetzen und sie die Ueberlegenheit seines Geistes fühlen zu lassen. Für ein hilfloses Bürschlein hatte er geglaubt zu fechten, und jetzt kam da ein protzenhafter Bengel daher, im eigenen Auto und aufgeblasen natürlich wie alle Berliner ... womöglich geriet man in den Verdacht, man hätte von diesem Reichtum vorher gewußt und rechtzeitig, wegen eines etwa vorzunehmenden größeren Pumpes, den Mantel nach dem Winde gehängt ... ah, pfui Deuwel noch einmal! ...
Der alte Gerichtsdiener Wichotta kam die Treppe hinaufgestürzt, riß die Tür zum Richterzimmer auf:
„Er kömmt, Herr Baron, er kömmt!“
Und wahrhaftig, sämtliche Orden und Feldzugsmedaillen hatte er zu seiner besten Sonntagsuniform angelegt. Da hieb der lange Heino mit der starken Faust auf den Tisch, daß das hölzerne Tintenfaß fast aus seinem Behältnisse sprang.
„Zum Donnerwetter noch mal, Schockschwerenot, sind Sie auch verrückt geworden, Wichotta? Wer kommt? Vielleicht der Herr Landgerichtspräsident aus Lyck, daß Sie sich in Wichs geschmissen haben?“
„N ... nein, Herr Ba ... baron,“ stotterte der brave Beamte, „aber der neue Herr Reff’rendarius aus Berlin mit dem Au ... Automobil!“
„Na, dann scheren Sie sich weg! Und der Deuwel holt Sie, bei meinem Zorn, wenn Sie sich draußen beifallen lassen, vielleicht stramm zu stehen!“ ...
Eine Weile danach pochte es an der Tür, auf das laute „Herein“ betrat der „neue Reff’rendarius aus Berlin“ das Zimmer. Heino von Bergkem markierte erst ein paar Augenblicke den eifrig Beschäftigten, dann hob er den Kopf.
„Sie wünschen?“
„Den Herrn Amtsgerichtsrat zu sprechen.“
„In welcher Angelegenheit?“
„Meldungshalber. Mein Name ist Brenitz, ich bin an das hiesige Amtsgericht versetzt worden.“
„Ah so, Sie sind der neue Herr Kollege aus Berlin? Bergkem! Und, bitte, nehmen Sie Platz!“
Der lange Heino hob sich zu einer leichten Verneigung und deutete nach dem nächsten Stuhle. Scheußlich patent sah dieser Herr Brenitz aus in dem modernen Gehrock, den diskret gestreiften Hosen und dem blanken Zylinderhute zwischen den in taubengrauen Handschuhen steckenden Händen. Nur ein Milderungsgrund war dabei, zwei ordentliche Schmisse, die quer über die Stirn liefen und zeigten, daß ihr Inhaber wenigstens kein „Kneifer“ war. Etwas freundlicher fügte er daher hinzu: „Ganz sicher ist es aber nicht, ob der Herr Oberkollege heute an Gerichtsstelle erscheint. Termine sind keine, und gestern abend hatte er, Gott sei Dank, einen recht kräftigen Gichtanfall.“
Peter Brenitz trat ein wenig näher, der lange Kollege gefiel ihm.
„Entschuldigen Sie gütigst, aber vorhin, als Sie sich vorstellten, habe ich Ihren werten Namen nicht verstanden.“
Der lange Heino erhob sich und sagte deutlich: „Heino Freier und Edler Herr von Bergkem-Przygorowski aus dem Hause Bergheim.“
Peter Brenitz aber fuhr vor freudigem Schrecke ordentlich zusammen.
„Verzeihung, Herr Kollege, aber es ist nicht bloße Neugier: war einer Ihrer Herren Verwandten vielleicht Leutnant im zweiten Garderegiment?“
„Zu dienen, so ziemlich alle. Das zweite Regiment war für uns Bergkems sozusagen Familientradition. Ich bin als erster aus der Art geschlagen, ich zog es vor, Kürassier zu werden.“
„Aber Ihr Herr Papa, nicht wahr, der hat doch den Sturm auf St. Privat mitgemacht?“
„Allerdings! Aber, wenn ich fragen darf, weshalb interessiert Sie das?“
Peter Brenitz atmete tief auf, griff mit der Linken nach dem herabfallenden Klemmer und streckte dem Kollegen in heißer Aufwallung die Rechte entgegen.
„Weil ... weil ... also Ihr Herr Vater hat dem meinigen, und er wiederum dem Ihrigen das Leben gerettet!“ Und mit sprudelnden Worten erzählte er die Episode aus dem heldenmütigen Ringen um den Kirchhof von St. Privat, wie er sie wohl hundertmal aus dem Munde seines Vaters gehört hatte.
Der lange Heino aber stand dabei, machte ein seltsam bekniffenes Gesicht, und als die Erzählung zu Ende war, sagte er: „Ach nee, wie ulkig, wie manchmal der Zufall spielt: Wir, die beiderseitigen Söhne, treffen uns jetzt hier als Kollegen.“
Als Peter jedoch weiter berichtete, wie sein verstorbener Vater jedesmal am Tage der Schlacht von St. Privat in einem Glase edlen Weines das Hoch auf seinen Lebensretter und Waffenbruder ausgebracht hätte, wurden dem Langen plötzlich die Augen feucht, und er sah ins Leere.
„Na ja, die alten Herren! Mein seliger Papa machte aus diesem Jahrestage ebenfalls immer ein großes Festschießen und knüpfte daran allerhand Nutzanwendungen für mich, wissen Sie, er war sonst ein riesig anständiger Kerl, natürlich ein Grandseigneur vom Scheitel bis zur Sohle, aber politisch gehörte er einer Spezies an, die in Ostpreußen längst ausgestorben ist, nämlich den liberalen Großgrundbesitzern ... ihre Söhne sitzen im Bund der Landwirte, ja, und ich war damals noch sehr jung, verstand ihn kaum, denn ich bin erst lange nach dem Feldzuge geboren ... Sie sehen ja, Ihr werter Name war mir bedauerlicherweise nicht so geläufig wie Ihnen der meinige. Immerhin ist wohl einiges aus jener Zeit bei mir hängen geblieben ... Aber, um auf unsere Gegenwart zurückzukommen“ — der lange Heino richtete sich auf — „weshalb in drei Deuwels Namen haben Sie hier in diesem kleinen Nest einen so geräuschvollen Einzug gehalten? Das stößt manchen vor den Kopf, denn wir sind arme Luders, und mit ’nem Automobilbesitzer können wir nicht Tempo halten!“
Da lachte Peter Brenitz fröhlich auf, denn der neue Kollege hatte mit seiner offenen Art sein Herz im Sturm erobert, und mit kurzen Worten erklärte er, wie wenig er für diesen Anstoß erregenden Luxus könnte. Sein Chauffeur hätte eines Tages Besitz von ihm ergriffen, um ihn seither nicht mehr loszulassen. Und als sein Zuhörer lustig mitlachte, ging er noch mehr aus sich heraus, erzählte ein weniges von seinem einsamen Leben, den Enttäuschungen, die er durchgemacht hatte, und schloß mit der schüchternen Hoffnung, hier neben einer befriedigenden Tätigkeit vielleicht auch ein bißchen Freundschaft zu finden. Heino von Bergkem hörte aufmerksam zu, in sein sonst zu allerhand lustigen Streichen aufgelegtes Gesicht war ein Zug nachdenklichen Ernstes getreten, und als der andere ein wenig scheu die Hand ausstreckte, schlug er kräftig ein.
„Na, wir wollen mal sehen! Für heute mittag bitte ich Sie, im Hotel de Russie mein Gast zu sein. Um ein Uhr cum tempore treffen wir uns dort, alles übrige aber werde ich schon vorher einrenken!“
Peter Brenitz wollte in aller Harmlosigkeit fragen, was dabei „einzurenken“ wäre, wenn sie beide im Hotel de Russie Mittag äßen, aber der Herr Amtsgerichtsrat betrat das Zimmer, und Heino bat wegen eines dringenden Ganges um Urlaub. Noch im Abgehen winkte er mit der Hand, schnitt hinter dem Rücken des Oberkollegen eine lustige Grimasse, und Peter wollte es scheinen, als wäre die vorhin so ungemütliche und nüchterne Amtsstube plötzlich ganz hell und freundlich geworden ...
Einen „ulkigen Zufall“ hatte der andere in seiner burschikosen Sprechweise ihr Zusammentreffen genannt, ihm aber dünkte es eine von Anbeginn bestimmte Fügung. Ein gütiges Geschick ließ ihn gleich in der ersten Stunde den Sohn jenes Mannes finden, der in dem Leben seines Vaters eine so bedeutungsvolle Rolle gespielt hatte, einen herrlichen Jüngling von echt deutscher Art, den zum Freunde zu haben ein gar köstlicher Gewinn sein mußte ...
Es folgte die Zeremonie der Vereidigung mit einigen kernigen Worten über die erhabenen Aufgaben des juristischen Berufes, und als der Amtsgerichtsrat — ein kränklich aussehender Herr in den Sechzigern — die schwarze Robe ausgezogen hatte, lud er den jüngeren Kollegen für einen der nächsten Abende zu einem gemütlichen kleinen Essen ein, im allerengsten Familienkreise. Wenn er musikalisch wäre, würde er ein paar gleichgestimmte Seelen finden.
Peter Brenitz sagte freudig zu. Es überraschte ihn nicht weiter, daß eine kurze Weile danach ein junges Mädchen den Kopf zur Tür hereinsteckte, „na, Papchen, bist Du noch nicht fertig? Mutti läßt sagen, die Suppe wird kalt!“
Hier in der gemütlichen kleinen Stadt schienen selbst die Amtsgeschäfte einen familiären Anstrich zu haben, denn die junge Dame zog sich nicht etwa zurück, sondern betrat in lieblicher Verwirrung das Zimmer. Ob sie jung war oder alt, hübsch oder häßlich, konnte Peter nicht erkennen, denn zu dem feierlichen Vorgange der Vereidigung hatte er den Kneifer abgenommen, nur so viel vermochte er zu unterscheiden, daß sie ein fußfreies Kleid trug und einen Strudelkopf brauner Locken.
Der Herr Amtsgerichtsrat stellte vor: „Herr Kollege Brenitz — meine Tochter Trudchen,“ und fügte freudig hinzu: „Denk Dir nur, eben hab’ ich erfahren, Herr Brenitz ist musikalisch!“
Peter wehrte bescheiden ab, er wäre wohl ein großer Verehrer guter Musik, seine eigene Kunstübung erhöbe sich jedoch in nichts über einen mäßigen Dilettantismus.
Fräulein Trudchen aber trat mit zierlichem Knixe näher und klatschte in die Hände:
„Das ist himmlisch! Dann wollen wir recht fleißig vierhändig spielen. Wer so bescheiden tut, ist immer ein Künstler. Lieben Sie Chopin?“
Und als Peter, ein wenig verwundert über die plötzliche Frage, bejahte, erfuhr er, daß Fräulein Trudchen eine geradezu leidenschaftliche Verehrerin des großen Tondichters wäre, der wie kein zweiter die schwermütige Note des polnischen Nationalcharakters zu treffen gewußt hätte, darin aber wäre sie sachverständig, denn von ihrer Mutter her, einer geborenen von Zuchopolska, flösse ihr polnisches Blut in den Adern.
Und weiter erfuhr Peter, daß sie nach vierjährigem Studium am Königsberger Konservatorium schweren Herzens auf den Beruf einer Künstlerin verzichtet hätte, aus Rücksicht auf die amtliche Stellung ihres geliebten Papchen. Zugleich aber sah er in der Nähe, daß Fräulein Trudchen sich bedeutend jugendlicher trug, als es ihren fünf- oder sechsundzwanzig Jahren angemessen war. Auf einem hageren braunen Halse saß ein unschöner eckiger Kopf mit einer breiten Stumpfnase, über deren Sattel ein Streifen häßlicher Sommerflecke lief. Das tat ihm leid für die junge Dame, aber da sie freundlich zu ihm war, mochte er sie durch einen raschen Abschied nicht kränken. Er hörte ihr noch eine ganze Weile geduldig zu, wie sie von den Triumphen erzählte, die sie auf einigen Wohltätigkeitskonzerten gefeiert hätte. Und als er sich schließlich empfahl, weil die Zeit, zu der ihn sein Gastgeber ins Hotel de Russie geladen hatte, schon verstrichen war, hatte er, ohne es zu wollen, ein Mädchenherz in helle Flammen gesteckt.
Das hatte nun freilich nicht viel auf sich, denn Fräulein Trudchen verliebte sich schon seit Jahren gewohnheitsmäßig in jeden neu an das Stradauner Amtsgericht versetzten Referendar; diesmal jedoch war die Leidenschaft heftiger denn je, und sie gestand sich errötend, daß auch sie entschieden Eindruck gemacht haben müßte. Freimütig erklärte sie dem Vater, daß sie es nicht verstände, wie junge Mädchen einem sonst sympathischen Bewerber gegenüber konfessionelle Bedenken haben könnten. In den Augen jedes aufgeklärten Menschen wäre der Antisemitismus ein verbrecherischer Unfug, und sie dürfte stolz bekennen, daß sie sich dessen niemals, auch in ihrer frühesten Jugend nicht schuldig gemacht hätte.
Der alte Herr Amtsgerichtsrat nickte dazu und lächelte trübe. Mit Freuden hätte er selbst einem Heiden oder Türken den väterlichen Segen gegeben; denn in der im Oberstock des Gerichtes belegenen Dienstwohnung wuchs ihm noch eine ganze Schar von Töchtern heran, die aus Rücksicht auf die älteste Schwester sich noch jugendlicher tragen mußten als Fräulein Trudchen, aber im Laufe der Jahre war er ein Pessimist geworden. Zu dem ersten „gemütlichen Abend im engsten Familienkreise“ erschienen die Herren Referendarien wohl, in der Folge aber blieben sie fort .....
Als Peter auf die Straße trat, flogen seine Gedanken zu einer anderen Begegnung, die er am frühen Vormittag auf dem Wege vom Bahnhofe gehabt hatte, und der Vergleich fiel nicht zugunsten von des Herrn Amtsgerichtsrats Töchterlein aus. Ein Paar rassige Trakehner streckten sich in schlankem Trabe, eine elegante junge Dame in rohseidenem Jackett mit Herrnschlips und Kragen führte auf dem Kutschersitze mit sicherer Hand die Zügel. Von dem Strohhütchen auf schwerem blonden Haar wehte ein kurzer blauer Schleier, grüßend neigte sich die Peitsche, und jetzt, da, ganz als wenn der heute über ihm stehende Glücksstern es besonders freundlich mit ihm meinte, wiederholte sich vor seinen sichtigen Augen die Erscheinung, mit der er sich in langenden Gedanken getragen hatte!
Aus einer Seitenstraße bog das Gefährt auf den Marktplatz, die Trakehner flogen dahin wie der Wind, und grüßend neigte sich wie am Vormittag die Peitsche neben einem Strohhütchen mit flatterndem Schleier.
Ganz unwillkürlich hatte er nach dem Hute gegriffen und sah dem davonrollenden Wagen nach, bis er im Staube verschwand, und wieder blickte die junge Dame auf dem Kutschersitze sich um .... Da trieb ihm das Blut rascher durch die Adern. Ein sehnsüchtig-beklommenes Gefühl erfüllte seine Brust, und eine Vorahnung stieg in ihm auf, daß diese beiden Begegnungen in seinem Leben noch mal eine Rolle spielen würden ....
Als Peter Brenitz ein paar Augenblicke später das Grand Hotel de Russie betrat, läutete die Glocke schon zum Mittagessen. Eilig begab er sich nach dem Speisezimmer, und da verstand er mit einem Male, was der rätselhafte Zusatz am Schlusse der Einladung des Herrn von Bergkem bedeutet hatte. Sein Gastgeber saß allein an dem einen Ende der langen Tafel, die in der Mitte des nüchternen Raumes stand, am anderen Ende aber eine Anzahl jüngerer Herren, die seinen höflichen Gruß mit eisiger Zurückhaltung erwiderten. Da blieb er neben seinem Stuhle stehen und kämpfte wacker gegen den wehen Kloß, der ihm plötzlich die Kehle zuschnürte. Auch hier in diesem freundlichen Städtchen, in dem ihm alles sonst so liebenswürdig entgegengekommen war, gab es anscheinend eine „Alania“, und um lächelnd über sie die Achseln zu zucken, war er noch immer zu jung .....
„Herr von Bergkem,“ sagte er, und die Stimme bebte ihm ein wenig, „ich danke herzlich für Ihre Einladung, die ich ohne Absicht gewissermaßen provoziert habe, aber ich möchte nicht die Veranlassung sein, Sie von Ihren bisherigen Freunden zu trennen!“ Nach diesen wohlgesetzten Worten wollte er sich mit einer gemessenen Verneigung zurückziehen, der lange Heino aber hielt ihn lachend am Aermel zurück und gab sich nicht die geringste Mühe, seine Stimme zu dämpfen.
„Aber nicht doch, lieber Herr Kollege. Wo wir beide sitzen, ist immer das vornehmere Ende. Wer sich davon ausschließt, hat die Folgen selbst zu tragen, aber alles auf der Welt endet schließlich friedlich und schiedlich. Wie oft bin ich zum Beispiel in Gedanken schon im Zweikampfe gestreckt worden, ehe es aber Ernst wird, verträgt man sich wieder, und, wie Sie sehen, lebe ich noch heute. Na, prost, Herr Kellmigkeit, darf ich mir einen Schluck aufs Spezielle gestatten? .... Ach so, wir haben noch keinen Stoff, also, Kalinski, los! Eine Buddel guten Schampus, aber kalt und ein bißchen plötzlich!“
Der Oberkellner verschwand mit hastigem Serviettenschwung, und ein am anderen Ende der Tafel sitzender Herr mit goldener Brille und bartlosem Gesicht verneigte sich gemessen: „Wenn ich Stoff habe, werde ich mich löffeln!“
Ganz beiläufig fügte Heino hinzu: „Nämlich unser verehrter Herr Vorsitzender, der nach glücklicher Beilegung eines unbeträchtlichen Zwistes zu meiner großen Freude den Präsidentensitz in unserer Tischgesellschaft Masovia wieder eingenommen hat! Na und nun erzählen Sie mal, Herr Kollege, wie sieht’s in Berlin aus? Haben Sie eine nette Reise gehabt? Es muß nicht ganz leicht gewesen sein, sich bis zu unserm geliebten Stradaunen durchzufinden!“
Peter erwiderte, es wäre ganz leidlich gegangen. Am liebsten aber hätte er seinem neuen Freunde und Beschützer die Hand geschüttelt, nicht zum wenigsten aus Bewunderung über die nonchalante Manier, mit der er die Herren vom anderen Ende der Tafel behandelte. Er unterließ es nur, weil es ihm unwürdig dünkte, vor der mit unverhohlener Neugier herüberspähenden Gegenpartei irgendwelche Gefühlsregungen zu zeigen. Aber das Herz wurde ihm dick in der Brust, und er wünschte nichts sehnlicher, als für den langen Heino auch einmal in die Bresche springen zu dürfen ...
Die Suppe wurde aufgetragen, die Spannung zwischen den beiden Tischenden verstärkte sich. Der Herr Provisor saß finster brütend da, drehte ein Brotkügelchen zwischen den Fingern und überlegte, wie er wohl die beabsichtigte Beleidigung der Gegenseite am witzigsten formulieren könnte, um den Beifall der Parteigenossen zu erringen und zugleich dem Grolle in seiner Brust Luft zu machen. Vor ein paar Stunden nämlich hatte ihn sein Chef in die Rezeptierkammer gerufen. Um schnödes Geld sollte er seine innerste Ueberzeugung verkaufen, nur weil sein Chef in kapitalistischer Verblendung eins der erhabensten Parteiprinzipien verleugnete? Gütlichem Zureden wäre er vielleicht zugänglich gewesen, aber der plumpen Drohung gegenüber verstockte sich sein Herz. Bei seinen Tischgenossen von der Masovia fand er einhellige Zustimmung, als er erklärte, ein aufrechter Mann in seiner Lage könne sich nur durch einen Eklat revanchieren. Nur über das Wie dieses Eklats war er sich trotz angestrengten Nachdenkens noch nicht klar geworden. Als aber Louis, der Stift, die von dem Freiherrn von Bergkem bestellte Flasche Champagner im Eiskühler hereinbrachte, kam ihm ein erleuchteter Gedanke. Er räusperte sich ein wenig, um die allgemeine Aufmerksamkeit auf seine Person zu lenken, und als in der Tischgesellschaft Stille eintrat, bestellte er sich in jüdelndem Tonfalle ebenfalls eine Flasche Sekt, wobei er den mit der Verteilung der Suppe beschäftigten Kalinski mit dem Titel „Herr von Oberkellnerleben“ anredete.
Heino von Bergkem sprang zornig auf, die blaue Ader auf seiner weißen Stirn war dick angeschwollen.
„Herr Provisor Kellmigkeit, ich habe nach einem fehlgeschlagenen Versuche zu gütlicher Einigung Ihnen und den anderen Herren vorhin erklärt, ich würde keine irgendwie geartete Kränkung meines Gastes dulden. Ich ersuche Sie also, sich auf der Stelle wegen Ihres unglaublich rohen Benehmens zu entschuldigen!“
„Niemals,“ schrie der andere heftig zurück, Peter Brenitz aber, dem bei dem Worte „Provisor“ die Erinnerung an eine Unterredung durch den Kopf schoß, die am frühen Vormittag zwischen ihm und dem Oberkellner stattgefunden hatte, zupfte den langen Heino am Rockschoße und deutete zugleich mit dem Zeigefinger in diskreter Weise nach der Stirn. Leider war aber diese gutgemeinte Bewegung auch von der Gegenseite bemerkt worden, Herr Kellmigkeit sprang auf und schnappte erst ein paarmal nach Luft, ehe er sich mit zornrotem Kopfe zu einer Erwiderung anschickte.
„Das ist infam,“ kreischte er auf, „eine ganz bodenlose jüdische Unverschämtheit!“ Warf seinen Stuhl zurück und wollte sich auf seinen ruhig dastehenden Gegner stürzen. Herr Popiella aber, den der laute Wortwechsel herbeigeführt hatte, umschlang ihn von hinten mit starkem Arm, drehte ihn in gewandter Ausführung eines oft geübten Griffes blitzschnell um die eigene Achse, und ehe Herr Kellmigkeit sich recht versah, war er draußen. Dort aber setzte Herr Popiella ihn auf einen Stuhl und hielt ihm eine kurze Ansprache. „Herr Provisor, ich schätz’ Sie sehr, und Sie sind mein angenehmer, lieber Gast seit vielen Jahren. Wenn Sie aber jetzt noch einen Ton reden, hau’ ich Ihnen eine ’runter, daß Sie glauben, Ostern und Pfingsten fällt auf einen Tag! Wir leben doch nicht in Rußland, sondern im zwanzigsten Jahrhundert!“ ...
Diesen, aus körperlichen und intellektuellen Argumenten zusammengesetzten Ausführungen gegenüber hielt Herr Kellmigkeit es am geratensten, zu schweigen, drinnen aber im Speisezimmer bemühte sich Herr Referendarius Meyer nach stattgehabter Vorstellung, die Rolle eines besonnenen Vermittlers zu spielen. Das Ganze wäre nichts weiter als ein bedauerliches Mißverständnis und bei einigem Entgegenkommen von beiden Seiten in kürzester Frist aus der Welt zu schaffen.
Peter Brenitz jedoch schüttelte den Kopf. Unter der jähen Beleidigung war er bleich geworden bis in die Lippen, jetzt aber stand er äußerlich ganz ruhig da, nur seine Nasenflügel bebten ein wenig, und in seinen Augen brannte ein seltsames Feuer.
„Ich bedaure! Wenn dieser Herr Provisor mit mir persönlich nicht verkehren will, so steht das in seinem freien Belieben. Nur wäre es vielleicht empfehlenswert gewesen, mit der Aeußerung seiner Willensmeinung zu warten, bis ich von meiner Seite seinen Verkehr gesucht hätte. Nichts aber gibt ihm das Recht, mich zu verunglimpfen, weil ich Jude bin. Ich müßte keine Selbstachtung besitzen, wenn ich mich nach einer solchen Beleidigung mit einer einfachen Abbitte begnügen würde.“
„Bravo,“ sagte der lange Heino, und weil ihn der Spotteufel plagte, fügte er hinzu: „Sie, Herr Kollege, sind schon zu lange Christ, um meinem Freunde Brenitz die Schwere dieser Beleidigung nachfühlen zu können!“
Darauf erklärte Herr Referendarius Meyer gekränkt, unter solchen Umständen müßte er auf eine Fortsetzung seiner Vermittlertätigkeit verzichten.
Die Angelegenheit nahm den üblichen Verlauf. Der Herr Provisor beauftragte den Steueramtsassistenten Annuschat, der als Vizefeldwebel der Reserve eine Autorität in allen die Ehre angehenden Fragen war, mit der „Wahrnehmung seiner Interessen“. Peter Brenitz betraute von seiner Seite aus den Herrn von Bergkem mit den gleichen Funktionen, die beiden Sekundanten aber vereinbarten in würdevoller Sitzung die Bedingungen des bevorstehenden Zweikampfes, dreimaligen Kugelwechsel aus gezogenen Pistolen bei fünf Schritten Barriere. Der lange Heino erklärte sich bereit, aus dem heimatlichen Gewehrschranke die benötigten Waffen zu stellen, und als er sich von dem Gegensekundanten verabschiedete, ließ er ganz beiläufig die Bemerkung fallen, wie sehr er’s bedauerte, daß die Herren von der Tischgesellschaft Masovia sich seinen gütlichen Vorstellungen nicht zugänglich gezeigt hätten. Herr Brenitz wäre, soviel er gehört hätte, ein ausgezeichneter Pistolenschütze, der sicherlich nicht vorbeischießen würde, und wenn er persönlich dem Herrn Provisor zwar einen gehörigen Denkzettel gönnte, so dauerten ihn dafür umsomehr die anderen Herren. Der unerquickliche Handel, der bei einem blutigen Ausgange des Zweikampfes unfehlbar zur Kenntnis der vorgesetzten Behörden kommen müßte, wäre durchaus nicht dazu angetan, fördernd auf die Karriere einzuwirken, denn man flöge dabei gar leicht in die Versenkung: als ein sonst ganz tüchtiger Beamter, der jedoch in schwierigen Situationen des nötigen Taktgefühls ermangelte!
Diese offensichtlich wohlgemeinte Bemerkung zeitigte zunächst die Folge, daß Herr Provisor Kellmigkeit sich am Nachmittag im Stadtwäldchen mit einem verrosteten Revolver „auf Pistolen einpaukte“, bis ihm der städtische Polizeiwachtmeister die Fortsetzung dieser gefährlichen Uebung untersagte. Die Herren Steueramtsassistenten aber sowie der Referendarius Meyer fanden mit einem Male, daß ihr sonst gewiß recht schätzenswerter Vorsitzender in diesem Falle einen bedauerlichen Mangel an Taktgefühl gezeigt hätte. Wo kühle Zurückhaltung allein am Platze gewesen wäre, hätte er einen plumpen und geschmacklosen Vorstoß inszeniert. Man diskutierte ernsthaft die Frage, ob es angängig wäre, ihn noch länger auf dem immerhin verantwortlichen Posten eines Präsidenten zu belassen, und stellte einstimmig fest, daß von ihm allein die erste Anregung zu dieser verhängnisvollen Demonstration ausgegangen wäre. Man selbst huldigte gar nicht so extremen Anschauungen, ein jeder vielmehr entsann sich plötzlich, unter den Juden auch recht anständige Kerle getroffen zu haben, und schließlich bezeugte man sich gegenseitig, auch in diesem Falle eine derartig korrekte Haltung bewahrt zu haben, daß man selbst bei einem tödlichen Ausgange des bevorstehenden Zweikampfes keine Maßregelung von seiten der vorgesetzten Behörde zu fürchten hätte.
Als der Herr Provisor sich am runden Tische des Grand Hotel de Russie zum gewohnten Abendschoppen einfand, stieß er zu seiner großen Ueberraschung auf verlegene und verfrorene Mienen. Seine Versicherung, er würde den „kleinen Judenknaben“ am nächsten Morgen mit einem tadellosen Blattschusse zur Strecke bringen, begegnete durchaus nicht der erwarteten freudigen Zustimmung, und gegen zehn Uhr fand unter nichtigem Vorwande ein allgemeiner Aufbruch statt. Nur der Steueramtsassistent Annuschat in seiner Eigenschaft als Sekundant und der trinkfeste Kreisarzt, den man notgedrungen ins Vertrauen hatte ziehen müssen, weil er bei dem bevorstehenden Zweikampfe als Paukdoktor fungieren sollte, blieben sitzen. Die Unterhaltung aber war wenig dazu angetan, den ohnedies schon nicht erheblichen Mut des Herrn Provisors zu steigern, denn der Kreisarzt verbreitete sich in längeren Ausführungen über Wundverletzungen im allgemeinen und Geschoßwirkungen im besonderen. Und er tadelte es heftig, daß bei Pistolenduellen nicht die verhältnismäßig humanen, modernen Hinterlader gebraucht würden, sondern die gänzlich veralteten „Vorderstopfer“, deren Projektile die unangenehme Eigenschaft besäßen, Teile der mit Milliarden von Bazillen infizierten Bekleidung in den Wundkanal zu reißen. Die Folge aber wäre bei leichten Verletzungen eine langwierige Eiterung, bei schwereren hingegen, trotz aller ärztlichen Kunst, ein exitus letalis, ein tödlicher Ausgang. Denn gegen eine Wundinfektion mit Tetanusbazillen z. B., den Erregern des so gefürchteten Starrkrampfes, besäße die moderne Medizin noch immer kein wirksames Mittel.
Der Herr Provisor lächelte dazu, trank aber einen Magenbittern nach dem andern, angeblich, um am andern Morgen eine ruhige Hand zu haben, in Wirklichkeit aber, weil die mit praktischen Beispielen aus der medizinischen Literatur belegten Schilderungen des Kreisarztes in ihm neben einem starken körperlichen Unbehagen eine seelische Zwangsvorstellung ausgelöst hatten. Er sah sich plötzlich mit einem gewaltigen Loche im Leibe am Boden liegen. Der Doktor aber beugte sich über ihn.
„Ja, mein lieber Herr Kellmigkeit, da ist nichts zu machen! Die verdammte Bleikugel hat Ihre halbe Hose in den Wundkanal hineingerissen. Wenn Sie in dieser Zeitlichkeit noch einiges zu ordnen haben, besorgen Sie’s ungesäumt. In drei Tagen sind Sie ein stiller Mann!“ ...
Da erhob er sich, wünschte den beiden Herren eine geruhsame Nacht und erklärte, er hätte vor der morgigen Entscheidung noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Einen Brief an die „alte Dame“, etliche noch immer unbezahlte Rechnungen aus seiner feucht-fröhlichen Studentenzeit und eine ganze Schublade voll Dokumente von zarter Hand, die ein Gentleman unmöglich indiskreten Augen aussetzen dürfte.
Dabei fuhr er sich mit vielsagendem Blicke durch die spärlichen Haare und schüttelte den Insassen des runden Tisches, die sich mittlerweile um die Person des „zufällig vorbeigekommenen“ Herrn von Bergkem vermehrt hatten, die Hand.
Dieser aber erwiderte den Händedruck mit besonderer Herzlichkeit, und seine Stimme klang leicht umflort, als er, unbeschadet natürlich seiner offiziellen Stellung als Sekundant der Gegenpartei, dem „Genossen froher Stunden“ den Rat erteilte, sich für alle Eventualitäten gerüstet zu halten. Dieser jüdische Referendarius wäre ein Teufelskerl, in allen Sportkünsten wohl erfahren und ein Schütze, vor dem man selbst als erfahrener Weidmann den Hut ziehen müßte. Vor seinen Augen hätte er mit einer Zimmerpistole ein Pik-As so zerschossen, daß das Mittelstück der Karte ein einziges Loch bildete, und nachdem er, Heino von Bergkem, sich zu seinem Bedauern davon überzeugt hätte, daß die alten Mensurpistolen seines Vaters ungefähr dieselbe Schaftlage besäßen wie die tägliche Uebungswaffe des Referendars Brenitz, sähe er dem kommenden Morgen mit einiger Besorgnis entgegen. Der Herr Provisor erwiderte darauf mit grünlichem Lächeln, im Ernstfalle pflegte doch die „Mensurpraxis“ zu entscheiden, die Ruhe und Besonnenheit des kampferprobten Fechters, und erzählte rasch noch zwischen Tür und Angel, wie er als Erster der „Pharmazeutia“ in Königsberg, einer farbentragenden Vereinigung studierender Apotheker, den Fechtwart der „Germania“ im Zweikampfe auf schwere Säbel „hinabgetan“ hätte. Der lange Heino versetzte darauf, eine heimtückische Kugel wäre doch etwas anderes als ein ehrlicher Säbelhieb, den man im Notfalle mit einer starken Schädeldecke parieren könnte, ohne Gefahr für Leib und Leben, und Herr Kellmigkeit empfahl sich mit der Bemerkung, was der kommende Tag auch bringen möge, er sei sich jedenfalls bewußt, für eine gerechte und tief im Nationalempfinden des deutschen Volkes wurzelnde Sache zu fechten. Er schloß mit einem Zitate, das ihm einmal in dem Feuilleton einer reichshauptstädtischen Zeitung gar mächtig imponiert hatte: „Qui vivra verra!“ Danach schlug er mit seinem Spazierstocke eine elegante Terz. Draußen aber auf dem nachtdunklen Marktplatze stimmte er mit lauter Stimme den uralten Schlachtgesang an, den die Füchse der „Pharmazeutia“ am frühen Morgen eines Mensurtages zu singen pflegten:
Der Nachtwächter gesellte sich zu ihm mit der besorgten Frage, ob er ihn über die gefährlichen Untiefen des Marktplatzes gegen Erlegung eines Trinkgeldes nach dem sicheren Hafen der Apotheke geleiten sollte, der Herr Provisor aber schluchzte in betrunkenem Elend auf: „Hol’ Sie der Teufel, kommen Sie lieber morgen zu meinem Begräbnis!“
Und während er in wehmütiger Stimmung dem roten Lichtlein zuschwankte, das zu Häupten eines goldenen Engels flackerte, führte der Schalksnarr Heino im Hotel de Russie mit dem Kreisarzte und dem Sekundanten allerhand tiefsinnige Gespräche über die letzten Fragen des Menschentums, Sterben und Vergehen, Auferstehung und Fortleben nach dem Tode, bis der schlaftrunken in einer Ecke lehnende Herr Kalinski erklärte, er könnte sich länger nicht mehr auf den Füßen halten, müßte unter allen Umständen „Kasse machen“.
Fahles Frühlicht drang durch die Scheiben und mischte sich mit dem Scheine der blakenden Petroleumlampe über dem runden Tische, draußen aber, in Dachrinnen und auf dem Eisengitter der kranzhaltenden Viktoria des Kriegerdenkmals lärmten mißtönend die Spatzen. Da stand der Herr von Bergkem auf und reckte gähnend die langen Arme in die von Zigarrenrauch geschwängerte Luft:
„Meine Herren, war’s heute nicht recht nett in unserem geliebten Stradaunen? Ordentlich großstädtisch ging es zu mit Automobilgehupe und dem Zusammenstoß feindlicher Weltanschauungen! Und was meinen Sie, Herr Doktor, wo werden wir die Leiche des Herrn Provisors Kellmigkeit waschen, wenn der Brave, von jetzt an gerechnet, in anderthalb Stunden als ein Opfer seiner Ueberzeugungen den Märtyrertod stirbt?“
Der Herr Steueramtsassistent Annuschat, der seit dem Mittag unter Alkohol stand, sah ihn verständnislos an. Der trunkfestere Kreisarzt aber erwiderte mit schwerer Zunge: „Scheußlich, ei ... einfach scheußlich! Früher wurde so ein K ... Kerl glatt verbrannt!“
„Ja,“ sagte der lange Heino, „das war entschieden gesünder! Aber der Herr Provisor gehört so vielen Vereinen an, daß ich mich der Hoffnung hingebe, er ist auch Mitglied des Bundes für Feuerbestattung. Guten Morgen, meine Herren!“
Der Kreisarzt wollte erwidern, daß er eigentlich den andern gemeint hätte, aber der Herr von Bergkem war schon draußen, schritt mit hochgeklapptem Rockkragen über den Marktplatz seiner Wohnung zu. Pfiff vergnügt vor sich hin, denn das war wieder einmal ein Tag nach seinem Herzen gewesen. All die Philister im Städtchen hatte er gehörig durcheinander gewirbelt, ihnen gezeigt, was für Hohlköpfe sie waren. Seinen Hauptwitz aber sparte er für den feierlichen Augenblick des Zweikampfes auf. Nicht so sehr aus übermütiger Lust an allerhand Fastnachtsstreichen, als aus mitleidigem Herzen. Da oben im ersten Stockwerke des Hotels de Russie saß ein netter kleiner Kerl am Schreibtische, ordnete Papiere und zimmerte an einem umfangreichen Testamente, weil er trotz allen freundlichen Zuredens der Ueberzeugung war, er müßte bei dem bevorstehenden Duelle sein junges Leben lassen. Der Teufel mochte wirklich wissen, wie der tückische Zufall sein Spiel trieb. Eine Bleikugel riß ein böses Loch, und gar manchmal schon war der Bessere gefallen. Also war es am geratensten, man schaltete den blinden Zufall aus und setzte sich selbst an die Stelle einer freundlich waltenden Vorsehung, die über Gerechte und Ungerechte die schützende Hand hielt: Man sorgte dafür, daß im entscheidenden Augenblicke die Pistolen nicht losgingen.
Und als er seine bescheidene Junggesellenwohnung im Hause des Kaufmannes Pollnow erreicht hatte, klopfte er mit hartem Knöchel an die Schlafzimmertür seiner Wirtin, einer ehrsamen Briefträgerwitwe:
„Frau Wengoborski, rasch, kochen Sie mir einen ordentlichen Kaffee! Ich will auf ’nen Rehbock. Dann aber pumpen Sie mir zwei dünne Nähnadeln!“
„Um Gottes willen nein, Herr Baron,“ erwiderte die Wirtin und erhob sich von ihrer Lagerstatt, „wollen Sie sich am End’ in aller Herrgottsfrühe Hosenknöpfe annähen?“
„Dieses nun weniger,“ sagte der lange Heino, „vielleicht aber einer alten Dame, die mit ihrer großen Schneiderschere gewohnheitsmäßig Fäden abschneidet, ein bißchen ins Handwerk pfuschen.“
Und in seinem Zimmer versenkte er sorgfältig die beiden Nadeln in die Pistons der Duellpistolen, brach sie ab und verwischte ebenso sorgfältig die Spuren seiner Tätigkeit mit einer Fingerspitze voll Staub, den er vom Ofensims holte. Als er sich aber durch mehrmaliges Abfeuern eines Kupferhütchens davon überzeugt hatte, daß die Zündkanäle der beiden Waffen gründlich verstopft waren, schmunzelte er stillvergnügt vor sich hin, denn er allein wußte jetzt, daß der bevorstehende „Zweikampf“ kein Opfer fordern würde. Um den einen wäre es schade gewesen, für den anderen aber war schließlich die ausgestandene Todesangst Strafe genug ...
Gegen fünf Uhr des Morgens setzte aus wolkenverhangenem Himmel ein dauerhafter Landregen ein, der Wald und Flur in einen trüben Schleier hüllte, und der lange Heino zog zur Vorsorge einen Gummimantel an, als er sich anschickte, seinen Paukanten mit dem Pistolenkasten unter dem Arm aus dem Hotel de Russie abzuholen. Peter Brenitz erwartete ihn schon auf der Freitreppe, bleich von der schlaflos verbrachten Nacht, aber leidlich gefaßt, und während sie sich begrüßten, konnten sie sehen, wie die Mitglieder der Tischgesellschaft Masovia sich von dem Portale der Kirche, die man wohl als allgemeinen Treffpunkt ausersehen hatte, nach dem nahen Stadtwalde in Bewegung setzten. Paarweise schritten sie unter aufgespannten Regenschirmen dahin, in dunkeln Ueberröcken und friedlichen Zylinderhüten.
Peter Brenitz hob mit trübem Lächeln die Hand.
„Da! Sieht’s nicht wie ein Leichenzug aus, der einem unsichtbaren Sarge folgt? Wem mag es wohl gelten? Mir oder dem andern?“
„Hm,“ sagte der Herr von Bergkem ernsthaft, „das möchte ich nicht so ohne weiteres entscheiden. Sie haben — das steht nun mal fest — für das nasse Wetter viel zu dünnes Schuhwerk an und werden sich bei dem Zweikampf bestimmt einen Schnupfen holen. Von da aber bis zu ’nem Begräbnis ist immer noch ein ganzes Ende!“ Und als Peter ein wenig gekränkt vor sich hin sah, fügte er hinzu: „Nichts für ungut, Herr Kollege, mir fehlt eben jede Anlage zum Pathos. Wo andere sich entrüsten oder begeistern, sehe ich fast immer die komische Seite. Sie aber grübeln zu viel, und trotzdem ich Sie erst ein paar Stunden kenne, möchte ich wetten, Sie haben noch nie in Ihrem Leben einen dummen Streich gemacht!“
Peter nickte. „Dazu hatte ich vielleicht keine Zeit. Aber wenn alle so dächten wie Sie, Herr Kollege, wo bliebe da der Fortschritt der Menschheit? Und wer keine Fähigkeit besitzt, sich für ein Ideal zu begeistern, muß doch rettungslos im Schlamme des Alltags ertrinken?!“
Der lange Heino zuckte mit den Achseln.
„Larifari, Fortschritt der Menschheit! Der kommt ganz von selbst, wenn jeder von uns ein tüchtiger Kerl ist und an dem Platze, an den ihn das Schicksal gestellt hat, seine Pflicht und Schuldigkeit tut. Aus der Summe der also geschaffenen Werte ergibt sich auch ein stetiger Fortschritt, denn es findet eine Mehrung unseres Kulturbesitzes statt. Was aber die Frage der Begeisterungsfähigkeit anlangt, so reden wir ein bißchen aneinander vorbei. Ich kann mich auch begeistern, freilich für andere Dinge in der Regel als die Mehrzahl unserer Zeitgenossen. Wenn bei politischen Parteiversammlungen zum Beispiel der Redner allen Andersdenkenden die „Maske der Heuchelei vom Gesichte reißt“ oder unter dem Beifallsgebrüll seiner Parteifreunde den schnöden Eigennutz der andern „geißelt“, muß ich immer lachen, denn ich sehe deutlich, daß — der Klempnermeister Pigulla meinetwegen — beim Bravoschreien nach dem Vorstandstische schielt, ob seine patriotische Begeisterung auch gebührend bemerkt wird. In den nächsten Tagen gelangen nämlich die Arbeiten am neuen Schulhause zur Vergebung! ... Wenn ich aber in der Zeitung lese, daß irgendwo im fernen Indien ein kleiner Doktor gestorben ist, weil er in Pesthöhlen einen neuen Bazillus zu greifen gedachte, sehen Sie, da läuft mir ein Schauer über den Rücken vor Begeisterung. Der kleine Doktor ist vielleicht auch nur in den Pesthöhlen herumgekrochen, weil er ein berühmter Mann werden wollte. Ist egal! Aber an seinem Platze war er ein ganzer Kerl und hat mehr für den „Fortschritt der Menschheit“ getan als alle, die mit geschwollenen Worten davon reden, schreiben oder predigen! ... Und vielleicht liegt auch auf einem ähnlichen Wege“, so fuhr er mit einem Gedankensprunge fort, „eine Lösung der Frage, die Ihnen ja am allermeisten am Herzen liegt. Seht nicht immer so viel zu uns hinüber, sondern nötigt uns durch besondere Leistungen Achtung ab. Vielleicht kommen wir dann ganz von selbst zu Euch!“
„Wie sollten wir wohl,“ warf Peter Brenitz bitter ein, „wenn uns die Mehrzahl aller Berufe verschlossen ist!! Nicht durch das Gesetz, aber durch ein Vorurteil, das stärker ist als alle Gesetze?!“
Der lange Heino lachte auf, und als der andere verwundert emporblickte, machte er eine entschuldigende Gebärde.
„Verzeihen Sie, ich bin kein berufsmäßiger Weltverbesserer, und eben fiel mir etwas Schnurriges ein. Als ich in unserer Kreisstadt Lyck die Schulbank drückte, hatten wir in der Untersekunda einen Juden namens Salomon. Ich gehörte auch nicht gerade zu den kleinsten, aber ich reichte ihm gerade bis zum Ohrläppchen, und der Kerl hatte Bärenkräfte, daß er uns am ausgestreckten Arm den Aufschwung machen ließ. Aus dieser Zeit stammen vielleicht meine ersten philosemitischen Regungen, denn der p. Salomon prügelte jeden Andersdenkenden windelweich.“
Da mußte Peter mitlachen und trug’s dem Herrn von Bergkem nicht nach, daß er Fragen, die ihm an das Innerste seines Wesens rührten, im oberflächlichen Plaudertone behandelte. Und von da an setzten sie ihren Weg schweigend fort. Der lange Heino überlegte, wie die bevorstehende Mensur wohl am besten mit einem möglichst zeremoniellen Brimborium zu umgeben wäre, und Peter sann darüber, daß er vor wenigen Tagen ein ähnliches Gespräch geführt hatte. Ein wenig verschieden in der äußeren Form, aber im Inhalt gleich. Und er nahm sich vor, bei dem Zweikampfe eine recht würdige Haltung zu bewahren, um sich die Achtung der Gegenpartei zu erringen. Im kritischen Augenblicke gedachte er natürlich in die Luft zu schießen, denn es verlangte ihn nicht nach dem Blute seines Gegners. Wenn er aber mit der Wunde in der Brust auf dem grünen Rasen lag, sollte sein letzter Gruß einer gelten, die ihn in diesen Stunden mehr als alles andere beschäftigt hatte. Blaue Augen hatte sie über einem feingeschnittenen Näschen, so viel er hatte erkennen können, und über blonden Haaren wehte ein kurzer blauer Schleier im Wind ... Gar zu gerne hätte er sich bei seinem Begleiter nach ihr erkundigt, aber er fürchtete die lachende Gegenfrage: „Nanu, Herr Kollege, Sie haben sich vor Ihrem seligen Ende doch nicht etwa rasch noch verliebt?“ ...
Die vorausziehende Gegenpartei hielt auf einer kleinen Lichtung, Peter blieb auf das Geheiß seines Sekundanten am Rande stehen, und der lange Heino näherte sich mit formellem Gruße der ein wenig ratlos in der Mitte haltenden Gruppe. Er zog den verregneten Hut:
„Wir von unserer Seite sind bereit!“
„Na schön,“ sagte der zum Unparteiischen erwählte Referendarius Meyer, „dann können wir ja anfangen!“
Danach aber entstand ein peinliches Schweigen, denn Herr Meyer hatte sich zwar am Abend vorher über seine Funktionen von der Autorität in Ehrenfragen, dem Steueramtsassistenten und Vizefeldwebel der Reserve Annuschat, informieren lassen, als es aber Ernst wurde, versagten seine mühsam erworbenen theoretischen Kenntnisse. Und weil er sich nicht anders zu helfen wußte, sagte er mit verlegenem Lächeln:
„Ach, Herr Kollege von Bergkem, Sie sind wohl so liebenswürdig, die erforderlichen Arrangements zu übernehmen?“
„Ich bedaure,“ erwiderte der lange Heino kühl, „das ist ausschließlich Sache des Herrn Unparteiischen. Hier sind die Waffen, zu deren Besorgung ich mich verpflichtet hatte,“ damit setzte er den Pistolenkasten vor dem Referendar Meyer nieder. „Alles übrige liegt jetzt in Ihrer Hand, Herr Kollege!“
Er trat zu seinem Paukanten zurück. In dem Kreise der Gegenpartei aber steckte man die Köpfe zusammen und nach einer längeren Belehrung durch den Steueramtsassistenten trat Herr Meyer endlich vor.
„Ich mache die Herren Paukanten darauf aufmerksam, daß es meine Pflicht ist, einen Versöhnungsversuch zu veranstalten.“
„Von unserer Seite aus abgelehnt,“ sagte der lange Heino.
„Na schön,“ bemerkte wiederum Herr Meyer und begab sich nach der empfangenen Instruktion an die Abmessung der Entfernung. Sprang dreimal je fünf Schritte ab und bezeichnete die Grenzen durch abgebrochene Zweige. Der Herr von Bergkem jedoch erklärte sich nicht einverstanden, schätzte die Entfernung für viel zu weit und verlangte im Auftrage seines Paukanten eine kürzere Bemessung.
„Sie wollen wohl mit Gewalt,“ flüsterte ihm der Referendar Meyer zu, „daß bei der Sache ein Unglücksfall vorkommt?“
„Das ist allerdings unsere feste Absicht,“ erwiderte der Herr von Bergkem. „Wenn Herr Provisor Kellmigkeit nicht die gleichen Intentionen hegen sollte, hätte er sich’s gestern überlegen müssen!“
Er trat mit höflichem Gruße zurück und sah zu seiner innigen Befriedigung die spitze Nase des Herrn Provisors noch um ein Endchen länger werden, während sich um die hohlliegenden Augen grünliche Schatten breiteten. Sein eigener Paukant sah auch nicht gerade festlich aus in seinem verregneten Sommerröckchen, aber er bewahrte wenigstens äußerlich eine korrekte Haltung ....
Es folgte das Laden der Pistolen, bei welchem schwierigen Geschäfte Heino notgedrungen aushelfen mußte, denn in der Behandlung von Vorderladern wußte selbst der Herr Steueramtsassistent Annuschat nicht Bescheid, und endlich standen sich die beiden Duellanten mit der Waffe in der Hand gegenüber. Der Kreisarzt hatte unter dem Schutze einer überhängenden Tanne sein schweres Besteck entfaltet, die Hähne über den blank funkelnden Zündhütchen waren verderbendrohend gespannt, vom trüben Himmel rann unablässig der feine Regen, und die Corona der Zuschauer, die sich zum Rande der Lichtung gezogen hatte, wartete bangen Herzens auf das Kommando des Unparteiischen.
Statt dessen erscholl aus der dichten Kiefernschonung, die die Lichtung von der einen Seite umgab, eine gewaltige Stimme:
„Halt, im Namen des Gesetzes, halt!“
Gleich danach aber arbeitete sich die dicke Figur des städtischen Polizeiwachtmeisters durch die regennassen Zweige, gefolgt von Herrn Popiella, dem Wirte des Grand Hotel de Russie, trat in die Mitte und schrie:
„Halt und nochmal halt! Wer sich von der Stelle rührt, ist verhaftet!“
Der lange Heino war der erste, der sich von der plötzlichen Ueberraschung erholte.
„Nanu, Herr Wachtmeister, und weshalb stören Sie uns in unserm harmlosen Vergnügen? Das Ganze ist nämlich nur eine Wette, weil der Herr Provisor behauptet hatte, er schieße besser als Herr Brenitz!“
„Hat sich was mit Wette,“ sagte der Wachtmeister, „und mich machen Sie ja nicht dumm, Herr Baron! Das hier ist eine zweikämpferische Vergehung gegen das Strafgesetzbuch, Sie kriegen alle zu sitzen, meine Herren, und infolge eingegangener Anzeige werde ich jetzt die Corpusse Delikti konfiszieren!“
Der Herr von Bergkem wandte sich lachend zu dem Wirte des Grand Hotel: „Ihnen also, Herr Popiella, verdanken wir diese Störung unseres morgendlichen Spazierganges?!“
„Na nu, nein,“ erwiderte der Brave und schickte einen zornigen Blick zu dem Herrn Provisor hinüber, „wenn Sie, und Sie haben einen Gast, der bei Ihnen fest auf drei Monate gemietet hat, würden Sie sich den so mir nichts dir nichts totschießen lassen?“
„Nein,“ versetzte der lange Heino, „und das ist ein sehr vernünftiger Standpunkt, viel vernünftiger als manches, was in den letzten vierundzwanzig Stunden hier von den verschiedensten Seiten vertreten wurde!“ Er steckte die Hände in die Taschen seines Regenmantels und sah sich lachend um.
„Na, meine Herren! Sollen wir den Spaß noch einmal wiederholen oder wäre es vielleicht angebracht, jetzt zu einer restlosen Versöhnung zu schreiten? Ein zweites Paar Pistolen habe ich nicht zu versenden, und beide Paukanten haben ja gezeigt, daß sie zu ernsthaftem Austrag ihres Handels entschlossen waren!“ ...
Da übergab Herr Kellmigkeit als erster seine Waffe dem dicken Polizeiwachtmeister, schritt auf den Referendar Brenitz zu und zog mit würdevoller Verneigung den Hut. Jetzt ging’s ans Reden, und das lag ihm als geborenem Vereinspräsidenten besser als der Umgang mit Schußwaffen.
„Herr Brenitz, zu meinem Bedauern bin ich um die Ehre und das Vergnügen gekommen, mit einem ritterlichen Gegner die Waffen zu kreuzen, aber wie sagt der Lateiner? „Et in magnis voluisse sat est.“ Nehmen wir den Willen für die Tat und betrachten die Angelegenheit als erledigt. Ich revoziere meinerseits alle irgendwie beleidigenden Aeußerungen, strecke Ihnen die Hand zur Versöhnung entgegen und erwarte von Ihnen das gleiche!“
Peter war von dem plötzlichen Umschwunge der Ereignisse so benommen, daß er sich auf eine stumme Erwiderung des Händedruckes beschränkte. Der lange Heino aber warf in gemachter Begeisterung den Hut in die Luft, schrie mit gewaltiger Stimme: „Ein donnerndes Hoch unseren edelmütigen Herren Duellanten. Sie leben einmal hoch, noch ’mal hoch, und zum drittenmal hoch!“
Die Corona stimmte jubelnd ein, einschließlich des Polizeiwachtmeisters, der bei dem feierlichen Vorgange eine ähnliche Erhebung empfand wie bei festlichen Veranstaltungen des Kriegervereins, nur das fehlende Absingen der Nationalhymne störte ihn am Schlusse. Und alles atmete erleichtert auf, nicht zum mindesten die Herren Steuerbeflissenen, denn der unblutige Ausgang der „unerquicklichen Affäre“, wie sie Herr von Bergkem treffenderweise genannt hatte, bewahrte sie vor einer hochnotpeinlichen Untersuchung, ob sie im gegebenen Falle nicht des erforderlichen, für die Erreichung höherer Rangstufen unbedingt nötigen Taktgefühls ermangelten. Als daher Herr Popiella den Vorschlag machte, in Anbetracht des feuchten „Klimas“ auf den Schreck ein ordentliches Glas Grog zu setzen, fand er allseitige Zustimmung, und in schönster Harmonie wurde der Rückweg zum Städtchen angetreten. Nur die Zugfolge war ein wenig anders als auf dem ungemütlichen Hinwege.
Voran schritt der dicke Herr Polizeiwachtmeister mit einer großen Zigarre im Munde, flankiert von dem Baron von Bergkem und dem Besitzer des Grand Hotel de Russie, die ihm beide auseinandersetzten, das Ganze wäre doch eigentlich ein lustiger Streich gewesen, nicht wert, daß sich eine hohe Behörde darum echauffierte. Und der Herr Polizeiwachtmeister neigte als Privatmann ihrer Meinung zu, offiziell aber gedachte er den Widerstreit zwischen menschlicher Nachsicht und strenger Beamtenpflicht erst nach dem dritten Glase Grog im Sinne der Milde zu entscheiden. Einmal war er das seiner Würde schuldig, zum zweiten aber war der Polizist sozusagen doch auch ein Mensch. Wenn man ihn zu nachtschlafender Zeit in ein solches Hundewetter hinaustrieb, mußte man doch auch dafür sorgen, daß er an seiner Gesundheit keinen Schaden nahm ...
Den Beschluß des Zuges bildete der Herr Provisor mit seinem vormaligen Duellgegner. Der Zufall hatte es wohl gefügt, daß sie zusammenkamen, aber Herr Kellmigkeit nahm dankbar die Gelegenheit wahr, sich vor „zuständiger Stelle“ über seine Haltung gegenüber dem Antisemitismus im allgemeinen und dem Herrn Brenitz im besonderen auszusprechen.
Und da ergab es sich, daß er seinen vielbemängelten Antrag in der Tischgesellschaft Masovia lediglich aus prinzipiellen Gründen gestellt hätte, erst durch die „ewigen Witzeleien“ des Herrn von Bergkem hätte die Angelegenheit eine so persönliche Zuspitzung erfahren, wie denn dieser Herr überhaupt ein recht unbequemes Mitglied wäre, nur mit größter Vorsicht zu genießen.
Peter Brenitz hörte mit höflichem Schweigen und ohne Widerspruch zu, nur wollte es ihm scheinen, als wenn der Lauf der Verhandlungen in der Tischgesellschaft ein wenig anders gewesen wäre. Er akzeptierte dankend die Einladung, sich von nun an „voll und ganz“ als Mitglied zu fühlen, aber ein heißer Dankesblick flog zu dem an der Spitze des Zuges Schreitenden hinüber, der die anderen alle um Haupteslänge überragte. ...
An den ersten „Erwärmungsgrog“ im Hotel de Russie schloß sich auf Vorschlag des Herrn Popiella eine Versöhnungsbowle aus Türkenblut, einem Gemisch aus Porter, Sekt und Kognak, das abscheulich schmeckte, in hohem Grade aber die Eigenschaft besaß, Männerherzen fröhlich zu stimmen. Trinksprüche wurden gewechselt, und mit einem Male — der Polizeiwachtmeister war unter Obhut des Herrn Kalinski in das Bürgerzimmer abgeschoben worden — stand ein Würfelbecher auf dem Tische. Eine Tafel mit Zahlen wurde ausgebreitet, und Herr Referendarius Meyer übernahm zu einem „harmlosen kleinen Frühschoppenspielchen“ die Bank. Die Gesellschaft drängte sich zusammen, in die Augen trat ein Funkeln, und Silberstücke schoben sich auf die Tafel. Der Bankhalter schüttelte rasselnd den Becher ... „drei gewinnt, meine Herren,“ strich ein und zahlte aus. Peter wollte sich still entfernen, aber ein paar Hände griffen nach seinem Rock, „Halt, hiergeblieben! Und mitgefangen, mitgehangen!“ Da setzte er sich wieder hin. Das starke Getränk tat seine Wirkung, und er verspielte, was er bei sich trug. Der Referendarius Meyer aber mußte sich einen Suppenteller geben lassen, um seinen sich häufenden Gewinn zu bergen, und Peter sah wie durch einen Schleier, daß der lange Heino nach öfterem Verluste den Wirt oder den Oberkellner beiseite nahm, um mit heißem Gesichte weiter zu spielen. Da zog sich ihm das Herz zusammen, und ihm war zumute, als wäre auf ein liebes Bild ein häßlicher Fleck gefallen. — — — —
Des langen Heino scherzhafte Prophezeiung war eingetroffen, Peter Brenitz hatte sich an dem regennassen Duellmorgen einen fürchterlichen Schnupfen geholt, und die Erkältung mit den bösen Nachwehen der ungewohnten Türkenblutbowle hielt ihn ein paar Tage lang ans Zimmer gefesselt. Aber er hatte sich nicht über Mangel an Gesellschaft zu beklagen, ab und zu erschien irgendein Mitglied der „Masovia“ bei ihm, um im Vorbeigehen einen Kognak zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen. Auch der Herr Amtsgerichtsrat stellte sich ein, bedauerte herzlich, zugleich im Namen von Frau und Tochter, daß der geplante gemütliche Abend im engsten Familienkreise eine Verschiebung erfahren müßte. Bloß der lange Heino, nach dem er sich sehnte, erschien nur ein einziges Mal zu kurzer Stippvisite, erklärte, er wäre durch ein geradezu greuliches Erkenntnis über alle Gebühr in Anspruch genommen. Von seinen anderen Besuchern aber erfuhr Peter, daß diese Abhaltung in Wirklichkeit aus einer Frauenzimmergeschichte bestände, einem Verhältnis mit der bildhübschen Tochter des Posthalters Wykrasinski, das allgemach schon zu einem öffentlichen Stadtskandal auszuarten drohte. Auch sonst schienen die Herren von der Tischgesellschaft ihrem Mitgliede Bergkem wenig gewogen. Sie beklagten sich über seinen anmaßenden, herrischen Ton und wunderten sich, woher er die Mittel zu seinem ausschweifenden und kostspieligen Lebenswandel nähme. Herr Meyer z. B., der es genau wissen mußte, erklärte, an ihn allein hätte er an dem vergnügten Duellmorgen siebenhundert Mark verloren, dreihundert bar und den Rest auf Ehrenwort, aber der Himmel mochte wissen, wann diese Schuld eingelöst würde, denn das väterliche Gut steckte bis unter den Schornstein voll von Hypotheken, und die alte Frau Baronin hätte ihre liebe Not, nur die Zinsen herauszuwirtschaften.
Und Peter Brenitz hörte betrübten Herzens zu. Zum Widerspruche fehlte ihm jedes Recht, wenn er auch zu erraten vermeinte, woher diese Mißgunst der Kleinen stammte. Es verdroß ihn tief, daß sein neu gewonnener Freund ihn behandelte wie all die anderen, ihn mit einer leeren Ausflucht abspeiste, statt ihm Vertrauen zu schenken. Als aber der Lange am vierten Tage nachmittags unvermutet ins Zimmer trat: „Na, wie geht’s denn unserm Patienten? Und fühlt er sich kräftig genug, mit mir nach meiner Klitsche ’raus zu marschieren?“, da war aller Unmut verflogen. Peter stimmte freudig zu, nur ein Bedenken war dabei: Am Abend war er in die Familie des Herrn Amtsgerichtsrats geladen, um mit Fräulein Trudchen vierhändig Chopin zu spielen. Da lachte der lange Heino fröhlich auf: „Recht geschieht Ihnen, Herr Kollege. Weshalb sollen Sie es gerade besser haben als alle Referendare, die vor Ihnen in Stradaunen wirkten? Und mir paßt es ebenfalls ausgezeichnet. Ich habe einen guten Vorwand, mich rechtzeitig zu drücken. Also bestellen Sie Ihr Auto auf sieben Uhr nach Przygorowen, und wir fahren zusammen nach Hause.“
Sie schritten selbander zum Städtchen hinaus, am schilfumrahmten Ufer des Stradauner Sees entlang, über eine kahle Hügelkette, auf der zwischen groben Findlingssteinen dürftige Wacholderbüsche grünten, bis sie nach dem Gange im heißen Sonnenbrand der schattige Hochwald aufnahm. Und da faßte Peter sich nach einigem Zögern ein Herz, beklagte sich über die stattgefundene Vernachlässigung und den Mangel an Vertrauen. Alle anderen hätten den Grund seines Fernbleibens gekannt, ihn allein aber hätte er mit einem Vorwande abgefertigt. Der Herr von Bergkem hörte verdrossen zu, kaute an seinem kurzen blonden Schnurrbärtchen und ging eine ganze Weile lang schweigend neben ihm her. Als er aber zu sprechen anfing, klang es wie Groll in seiner Stimme.
„Die Bande! Hat sie’s richtig wieder einmal ausspioniert? Das arme Ding wird natürlich böse Tage kriegen! Was aber den Vorwurf angeht, ich hätte Sie vernachlässigt“ — über sein bewegliches Gesicht flog schon wieder ein fröhliches Leuchten — „ja, sagen Sie mal selbst, Herr Kollege, und versetzen Sie sich in meine Lage: Was würden Sie vorziehen? Mit gleichgestimmten Jünglingen Grog zu trinken und die soziale Frage zu lösen, oder ein Paar rote Mädchenlippen zu küssen, wenn sich Ihnen zu letzterem reichliche Gelegenheit bietet?“
Peter wurde rot und erwiderte fast heftig: „Ich halte das Weib überhaupt für eine inferiore Spezies, würde also nie in die Lage kommen, vor eine solche Wahl gestellt zu werden!“
„Ach nee!“
Der lange Heino blieb stehen und schlug belustigt die Hände zusammen.
„Ist das wirklich Ihr Ernst? Und Sie haben noch nie ein herziges, liebes Mädel im Arme gehabt, um mal zu vergessen, daß der Mensch nicht bloß zum Studieren und Büffeln auf der Welt ist?“
„Niemals,“ sagte Peter stolz, „ich würde mich schämen, meine Zeit mit solchen Nichtigkeiten zu vertrödeln! Und mich betrübt es tief, daß ein Mann von Ihren Fähigkeiten sich mit solchem kläglichen Firlefanz abgibt, statt all seine Kräfte der Aufgabe zu widmen, die ihm vom Schicksal gestellt ist. Sehen Sie, Herr von Bergkem,“ fuhr er mit steigender Begeisterung fort, „wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich mit Händen und Zähnen daran arbeiten, den von meinen Vätern ererbten Besitz wieder in die Höhe zu bringen, statt auf dem Gericht Aktenbogen zu füllen. Das können andere auch. Sie aber haben einen von der Vorsehung bestimmten Platz, und es müßte doch herrlich sein, wenn Sie ihn sich wiedereroberten und in zäher Arbeit zu dem machten, was er einstmals gewesen ist, ein stolzer Herrensitz?!“ ...
Der lange Heino stieß einen leisen Pfiff aus.
„Sieh mal an, über meine pekuniären Verhältnisse hat man Sie auch schon informiert?! Nun, es ist ja kein Wunder. Ich ärgere die Herrschaften zu meinem Vergnügen so oft an, daß sie sich zuweilen revanchieren! Ehe ich aber dazu übergehe, Ihren schätzenswerten Ratschlag zu beantworten, eine kurze Bemerkung, Herr Kollege: Wenn wir gute Freunde werden wollen, geben Sie die Versuche auf, mich zu einem, in Ihrem Sinne vielleicht höheren Wesen zu erziehen, ich bin reichlich erwachsen, brauche keine Kinderfrau mehr! Zur Sache selbst aber folgendes. Wenn Sie sich auf den Stradauner Kirchturm stellen und in die Runde blicken, gehörte einst alles, so weit Sie sehen, und noch etliches mehr den Bergkems. Mehr als drei Quadratmeilen Boden war in unserem Besitz, und als im siebzehnten Jahrhundert einer meiner Vorfahren die Letzte aus dem gräflichen Hause der Przygorowski heiratete, kam ein gewaltiges Ende Land dazu. Was ist davon übrig geblieben? Eine armselige Klitsche von knapp zweitausend Morgen, auf der sich schon mein Vater vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht abmarachte — er war ein vorzüglicher Landwirt, aber er hatte keine glückliche Hand. Wissen Sie, ich besinne mich zum Beispiel, daß uns in einem einzigen Sommer allein über dreißig Stück Rindvieh fielen — na ja, also, und da soll ich an eine so verlorene Sache meine Kraft setzen? ... Und wissen Sie, was ich am liebsten geworden wäre, wenn ich nicht meinem verstorbenen Vater zuliebe die juristische Karriere eingeschlagen hätte? Ein Abenteurer, wie mein erster Vorfahr, der unter dem Kreuz der Deutschordensritter mit Schwert und Spieß in dieses Land einritt, und ich bin gewiß, ich hätte draußen in der Welt meine Fortune gemacht. Als Goldgräber vielleicht in Alaska, als Schafzüchter meinetwegen in Australien oder als eins der ganz großen Börsenraubtiere, die der liebe Gott von Zeit zu Zeit zum Schrecken der Völker in die Welt setzt! Hier aber? Im günstigsten Falle werde ich — sagen wir mal - in Lyck oder Allenstein ein gesuchter Rechtsanwalt, nähre mich von der Prozeßsucht der Bauern, mache den Herren vom Amts- und Landgericht das Leben schwer und verdiene im Jahre, hoch gerechnet, zwanzigtausend Mark!“
Er schlug mit dem Stocke einen sausenden Lufthieb und blickte ingrimmig zu dem Stückchen Himmel empor, das über dem schmalen Wege zwischen eng nebeneinander stehenden Tannenwipfeln blaute ...
„So sieht in Wirklichkeit der Platz aus, den mir die Vorsehung angewiesen hat, um Ihre Worte zu zitieren, lieber Brenitz. Aber begeistert bin ich gerade nicht, wenn ich an ihn denke!“ ...
Peter erwiderte darauf, weil ihm im Augenblick nichts Besseres einfiel, man brauchte auch im bescheidenen Wirkungskreise nicht auf seine Ideale zu verzichten, könnte in den Mußestunden der beruflichen Arbeit an irgendeinem, über die Alltagsinteressen hinaushebenden Werke schaffen, der lange Heino unterbrach ihn aber mit einer beinahe zornigen Bewegung.
„Unsinn, die Kleinstadt drückt. Ich habe schon heute mich zu wehren, daß ich nicht zum Philister werde, wie all die übrigen! Oder, wie einer, der alle Höhen und Tiefen des Menschentums kannte, es besser ausgedrückt hat, „im engen Kreise verengert sich der Sinn!“ Heulen könnte man vor Wut, wenn man daran denkt, daß man verkommen und versauern muß, weil ... weil ... na, ist gut!“
Er brach ab, denn eigentlich hatte er sagen wollen, „weil einem die Mittel fehlen, frei nach seinen Neigungen zu leben!“ Und das Wort mochte er nicht aussprechen, denn es hätte sich vielleicht ausgenommen, als wollte er dem andern an den wohlgefüllten Geldbeutel klopfen. Gleich danach aber lachte er wieder fröhlich auf und wirbelte seinen derben Eichenstock durch die Luft: „Das sind so die galligen Anschauungen, gut für Regenwetter und ähnliches Ungemach! In Wirklichkeit aber — ich kann mir nicht helfen — ist mir öfter zumute, als hätte der liebe Gott noch irgendwo für mich eine Extrawurst im Sack. Und wollen Sie wissen, worauf sich diese Hoffnung gründet? Auf ein Märchen aus der Kinderzeit!“
Peter blickte ein wenig verwundert auf.
„Auf ein Märchen?“
„Ja,“ nickte der andere, „und vielleicht schadet es Ihnen nichts, wenn Sie’s hören: es steckt immerhin eine kleine Nutzanwendung darin ... Meine alte polnische Amme hat es mir erzählt, und aus frühen Kindertagen ist’s mir haften geblieben.“
„Also: ein ehrsamer Müller hatte zwei Söhne. Der eine sang und sprang den ganzen Tag, dem andern aber war der schwere Mühlstein auf den Fuß gefallen. Er bewegte sich nur mühselig vorwärts und mußte immer darüber grübeln, weshalb ihm dieses Unglück geschehen wäre. Darüber aber sah er nicht, daß im Frühling die Bäume Blüten trugen und im Sommer Früchte, er wurde ein griesgrämiger Gesell, und als der Vater seine Söhne eines Tages anblickte, nannte er den einen „Leichtfuß“, den andern aber „Stein am Bein“, und diese Namen behielten sie, so daß sich niemand erinnern konnte, wie sie in Wirklichkeit geheißen hatten. So lebten sie dahin, jeder nach seiner Art. Als sie aber zwanzig Jahre alt geworden waren, berief sie ihr Vater vor sein Angesicht.
„Ihr seid jetzt groß und erwachsen, meine Mühle aber ist viel zu klein, um Euch ferner zu ernähren. Zieht in die weite Welt hinaus, sehet zu, Euer Glück zu machen, und Gottes Segen sei mit Euch!“
„Schön,“ sagte der Leichtfuß, „mit diesem guten Wunsche kann es uns nicht fehlen,“ packte sein Ränzel und war marschbereit. Stein am Bein aber mußte erst bedenken, was alles auf eine so lange Reise mitzunehmen wäre, und viel Kopfzerbrechens machte es ihm, den Weg in die weite Welt zu finden. Bis eine alte Muhme ihm erklärte, die weite Welt finge dort an, wo das Elternhaus aufhörte. Da wunderte er sich, daß der Weg so einfach wäre, und am dritten Tage nach dem Geheiß des Vaters wanderten sie fort.
„Als es gegen Abend ging, kamen sie an ein fremdes Königreich, zwei Wächter hielten eine Schnur über die Straße gespannt und sprachen, niemand dürfte die Grenze überschreiten, ehe er nicht zuvor ein Rätsel gelöst hätte. Dieses Rätsel aber lautete: „Was ist so hoch wie der Himmel und so tief wie das Meer?“ Wenn man es löste, durfte man das Königreich betreten, erhielt eine reichliche Wegzehrung ausbezahlt, im anderen Falle aber mußte man das Leben lassen. Ein Henker im roten Wams mit breitem Schwerte stand bereit, um alle Ankömmlinge, die das Rätsel nicht lösten, um eines Hauptes Länge kürzer zu machen, die meisten aber machten vorher kehrt, denn es dünkte sie unbillig, so harten Zoll zu zahlen.
„Stein am Bein ließ sich die Fassung des Rätsels wiederholen, setzte sich in den Grabenrand und begann zu grübeln. Bruder Leichtfuß aber tat so, als wenn er sich die schöne Gegend ansehen wollte, und als ihn ein Gebüsch vor den Augen der Wächter deckte, schwang er sich behend über den Grenzgraben, der an dieser Stelle nicht mehr als sieben Schuh maß. Am dritten Tage traf er seinen Bruder, und diese Begegnung war nur einem glücklichen Zufall zu danken, denn Stein am Bein hätte vielleicht noch ein Jahr am Grabenrand gesessen, wenn ihm ein mitleidiger Rabe nicht des Rätsels Lösung verraten hätte. „Was ist so hoch wie der Himmel und so tief wie das Meer?“ ... „Das Meer und der Himmel, denn nichts auf der Welt ist tiefer oder höher!“ Stein am Bein hatte diese Deutung schon in der ersten Stunde gefunden, aber sie erschien ihm zu einfach, um damit die Grenze eines fremden Königreiches zu überschreiten, und erst von dem weisen Vogel mußte er lernen, daß das Schwerste oft das Einfachste war.
„Nach einiger Frist kamen sie an die Hauptstadt des Landes, aber es war kein vergnüglicher Einzug, denn die Bewohner waren traurig und ließen die Köpfe hängen. Es bedrückte sie, daß die Königstochter an einer unheilbaren Krankheit litt. Viele Aerzte hatten sich schon an ihr versucht, aber keiner hatte das rechte Mittel gefunden. Und von dem betrübten Vater war eine hohe Belohnung ausgeschrieben worden, wenn einer sein Kind wieder gesund machte.
„Heißa,“ sagte Bruder Leichtfuß und sprang in die Luft, „mein Glück ist gemacht. Diese Belohnung werde ich mir verdienen!“
„Du Tropf,“ erwiderte darauf Stein am Bein, „bist Du vielleicht ein Arzt? Oder kennst Du die Natur dieser bösen Krankheit?“
„Nein,“ sagte Leichtfuß, „aber im Palast werden wir alles hören. Wenn ich kein Heilmittel weiß, bin ich noch immer so reich wie zuvor und ziehe meines Weges weiter!“
„Sie kamen in den Palast, und alles war mit Gold und Edelsteinen bedeckt von oben bis unten, nur den Untertanen war es bei Todesstrafe verboten, etwas abzubrechen. Der König saß auf seinem Thron aus Marmelstein, Tränen rannen ihm in den Bart, die Großen des Hofes aber schrien und wehklagten laut, denn ihr Amt bringt es mit sich, daß sie in allem königlicher sind als der König. Wenn ihr Herr weint, müssen sie schreien, wenn er aber lächelt, sich vor ausgelassener Freude am Boden wälzen.
„Neben dem König saß seine einzige Tochter, eine wunderschöne Prinzessin in edelsteingesticktem Gewande, aber ihre Augen schienen erloschen, und ihr Gesicht glich einem Bild aus Stein!
„Leichtfuß und sein Bruder warfen sich vor dem Throne nieder, der König aber putzte sich den Bart und sprach: „Heil Euch, Fremdlingen, wenn Ihr meiner Tochter Genesung bringt, sie leidet an einer Verstopfung der Leber und kann nicht lachen. Mein eigenes Herz aber ist darüber so betrübt geworden, daß ich meiner Krone nicht mehr froh bin: Kurz und gut, der soll mein Eidam und Nachfolger werden, der die Prinzessin von ihrem Leiden befreit.“
Da erhob sich Stein am Bein als erster.
„Herr König, ich bin kein Arzt, denn mein Vater war zu arm, mich an die Stätten der Bildung zu schicken. Wenn Du mir aber Frist gibst, will ich drei Jahre lang die Erkrankungen der Leber studieren, vielleicht daß ich einen Umschlag erfinde, der die Verstopfung löst und den Weg zum Lachen wieder frei macht!“
Der König wiegte sein Haupt, der Vorschlag schien ihm erwägenswert, denn seine Leibärzte hatten schon Unsinnigeres geraten. Bruder Leichtfuß aber lachte plötzlich laut auf. Ihn dünkte es schnurrig, daß eine Prinzessin, die doch alles haben konnte, was Menschenherzen begehrten, traurig sein sollte. Von goldenen Tellern durfte sie essen, was sie sich nur wünschte, Eier mit Speck, Bratwürste in Bier, ein Spansäulein mit Aepfeln und Beifuß gefüllt oder gar einen leckern Gänsebraten, und bei jedem Gerichte, das ihm einfiel, mußte er nur immer lauter und fröhlicher lachen, denn alle waren seine Leibspeisen. Die hohen Herren des Hofes wurden angesteckt, blickten jedoch unschlüssig drein, weil der König noch nicht seine Willensmeinung dem Fremdlinge gegenüber kund getan hatte. Da aber geschah ein Wunder. Ueber die starren Züge der Prinzessin lief ein Beben und Zucken, plötzlich kräuselten sich ihre Lippen, und mit einem Male lachte sie hell auf, daß es im ganzen Palaste klang wie von silbernen Glocken. Da lachte auch der König, daß sein Thronsessel wackelte. Die hohen Herren des Hofes aber warfen sich auf dieses Zeichen zu Boden, kugelten sich umeinander und strampelten mit den Beinen in der Luft. Und der König stieg die Stufen hinab, hielt sich den Bauch und sprach: „Sei mir gegrüßt, mein Eidam, Du hast mein Reich aus schwerer Not errettet!“ Da er aber kein Freund von langem Warten war, winkte er dem Hofprediger, damit er auf der Stelle die Trauung vornähme, und so wurde der Leichtfuß ein Königssohn. Stein am Bein aber grübelte noch lange darüber, wie die Prinzessin lachen konnte, ehe die Verstopfung ihrer Leber gelöst war, weil er jedoch durch die Heirat seines Bruders ein naher Verwandter der königlichen Familie geworden war, fand sich für ihn ein einträgliches Amt, und wenn er nicht gestorben ist, lebt er noch heute!“
„Nun, und die Nutzanwendung?“ fragte Peter Brenitz.
„Die Nutzanwendung?“ Der lange Heino reckte die Arme in die Luft. „Vielleicht finde ich auch mal eine Prinzessin mit verstopfter Leber, die von mir das Lachen lernt!“ Und mit einem Seitenblicke auf seinen Begleiter fügte er hinzu: „Aber auch andere Leute könnten aus dem Märchen lernen, daß es nicht gut ist, sich das Leben unnütz schwerer zu machen, als es schon ist. Wir alle schließlich tragen von unsern Vorfahren her irgendeinen Stein am Bein, aber — in drei Deuwels Namen — muß man denn jeden Augenblick daran denken?!“ ...
Er kappte im Vorübergehen den Stengel einer blauen Glockenblume, die am Wegrand blühte, Peter Brenitz aber seufzte auf. Wie gerne wollte er seinen Stein vergessen, wenn nur die anderen nicht gewesen wären, die sich immer an ihm stießen ...
Der Weg führte ins Freie, hinter den lichter werdenden Stämmen des Hochwaldes tat sich eine flache Feldmark auf. Schlecht stehender Roggen mit kurzen Aehren, fahl schimmernde Wiesen und Kartoffelbreiten, in denen die graue Ackerkrume durch das spärlich gewachsene Kraut sah.
Heino von Bergkem war stehen geblieben und deutete unmutig auf die kümmerlich bestandenen Felder.
„Da, sehen Sie her, Herr Kollege Brenitz, hier fängt Przygorowen an, der Platz, auf den mich Ihrer Meinung nach die Vorsehung gestellt hat! Und jetzt urteilen Sie, bitte, selbst, ob es verlohnt, daran ein Lebenswerk zu setzen! Mit gutem Willen und schönen Redensarten ist da nichts getan, solides Knochenmehl gehört in den Sand, Thomasschlacke und Superphosphat, und wenn’s mal einen Sommer nicht regnet, sieht’s auf den Feldern auch nicht viel anders aus als heute. Verkaufen ist das einzige, wenn sich nämlich ein Dummer findet. Glauben Sie ja nicht, daß ich kein Heimatsgefühl besitze, wenn ich so daherrede. Das Herz dreht sich mir im Leibe um, wenn ich daran denke, daß auf dem letzten Reste Bergkemscher Erde mal ein Fremder sitzen soll, aber was ist da zu machen?! Meine hochgeehrten Herren Vorfahren hätten weniger großspurig leben sollen, vielleicht daß für den letzten ihres Namens auf der Heimaterde Platz gewesen wäre! Aber wollen Sie wissen, was früher hier für eine Wirtschaft herrschte? Mein hochseliger Herr Urgroßvater, der so um das Jahr 1820 herum lebte, langweilte sich eines Tages und da ließ er anspannen, fuhr vierelang auf ein paar Wochen nach Paris. Fünfundachtzigtausend Reichstaler auf den Kopf betrugen die Kosten dieses Ausfluges, und in der Familienchronik findet sich eine eigenhändige Eintragung meines Herrn Urgroßpapas, das Kostspieligste wären die „Courtisanen“ gewesen, denn die „Ausverschämtheit dieser Personnagen hätte keine Gränzen gekannt.“ Mir kann es wohl niemand verdenken, daß ich diese Stelle meiner Familiengeschichte stets mit geteilten Empfindungen lese. Ich gönne meinem hochseligen Herrn Urgroßvater von Herzen das gehabte Amüsement, aber wenn er und außer ihm noch etliche andere es billiger getan hätten, müßte ich nicht wie ein Pracher auf einem Stück Heimaterde herumlaufen, wo die Bergkems mal wie Könige herrschten. Na, ist gut, reden wir nicht mehr davon!“
Er brach ab und sah mit schwimmenden Augen nach einem grauen Turme hinüber, der zwischen dunkeln Lindenwipfeln als ein Wahrzeichen seines alten Geschlechtes in die Lande ragte. Peter Brenitz aber überlegte in überströmendem Freundschaftsgefühle, wie da wohl zu helfen wäre. Und es hätte ein sehr einfaches Mittel gegeben, er brauchte nur einen groben Scheck auszuschreiben auf Samuel Brenitz sel. Witwe Söhne in Berlin, um hier dem Freunde eine klare Lebensbahn zu schaffen. Aber er traute sich mit diesem praktischen Vorschlage nicht hervor, denn er fürchtete eine schroffe Zurückweisung. Sein gutgemeinter Rat, über nichtigen Tändeleien nicht die Ziele eines hochgesinnten Strebens zu vergessen, war schon übel aufgenommen worden. Wie also sollte er für diese neue Aufdringlichkeit wohl die rechten Worte finden?! ...
Der scharfe Knall eines Büchsenschusses fiel reißend in die Stille des warmen Sommertages. Der lange Heino hob mit gespanntem Ausdrucke den schmalen Kopf:
„Nanu, was ist denn das, jetzt um diese Zeit? Und sie wird doch nicht etwa?“ ... Zur Erklärung aber fügte er hinzu: „Nämlich wir haben hier unter einer Anzahl guter Böcke einen einzigen, wirklichen Kapitalen, einen Kerl, der ein geradezu klotziges Gehörn aufhat. Schon ein dutzendmal bin ich auf ihn ausgewesen, ohne ihn vor die Büchse zu kriegen, denn er ist über die Maßen heimlich und schlau. Und da hat meine Schwester mit mir gewettet, sie würde ihn vor meinem nächsten Besuche auf die Decke legen. Zu lächerlich eigentlich so eine Frechheit von dem kleinen Frauenzimmer, manchmal aber findet auch ein blindes Hühnchen ein Korn ...“
Er kam nicht zu Ende, denn vom Felde her erklang eine helle Mädchenstimme:
„Tallihoh, Heino, er liegt! Und wenn Du ein braves Gehörn sehen willst, komm hierher!“
Hinter wogenden Kornähren reckte sich ein hochgehobener Büchsenlauf in die Luft, und der Herr von Bergkem schwang sich in weitem Satze über den Straßengraben, rannte querfeldein durch Hafer und Kartoffelbreiten. Peter folgte ihm, ein wenig verwundert und in gemächlichem Tempo: Wie konnte man um ein im letzten Grunde so unbeträchtliches Ereignis wie die Erlegung eines Rehbockes so in Eifer und Hitze geraten?!
Auf einem schmalen Wiesenraine neben einem Roggenschlag lag das gefällte Stück Wild, daneben aber stand ein schlank gewachsenes junges Mädchen in strapaziertem Lodenkleid, das Gewehr unter dem rechten Arm. Frei hob sich aus den Schultern ein herrlicher Kopf, die blauen Augen über dem feingeschnittenen Näschen blitzten, und jeder Nerv an dem jugendlich-blühenden Körper bebte vor Erregung nach der glücklich vollbrachten Weidmannstat.
Peter Brenitz blieb stehen, seine Augen weiteten sich, denn er erkannte in dem jungen Mädchen die Dame wieder, die ihm am ersten Tage auf dem Wege vom Bahnhof begegnet war, und der in heimlicher Sehnsucht sein letzter Gruß hatte gelten sollen ... Sie streckte ihm mit fröhlichem Auflachen die Hand entgegen: „Tag, Herr Brenitz. Wir sind ja eigentlich schon uralte Bekannte ...“
Da zog er mit verlegenem Gesichte den Hut, verneigte sich förmlich, und ihm war es, als empfinge er mitten gegen die Brust einen schweren Schlag. So jäh sprang ihn die Leidenschaft an für das holdselige Geschöpf, daß er fast einen körperlichen Schmerz verspürte ...
Der lange Heino blickte empor. „So, Ihr kennt Euch schon? Na, um so besser! Zur näheren Information aber, das kleine Scheusal da heißt Brigitte!“
Und er wandte sich wieder dem Bocke zu, dessen Gehörn er einer sachverständigen Prüfung unterzog. Nicht ohne einen gewissen Neid, denn er erklärte es für eine wahre Schande, daß ein so kapitaler Kerl sich von einem dummen kleinen Mädel hätte strecken lassen.
Brigitte aber widersprach lachend, erzählte voll Stolz und Eifer eine lange Geschichte, wie es ihr nach unsäglichen Mühen gelungen wäre, den Schlauen und über alle Maßen Vorsichtigen auf die Decke zu legen. Auf eine der hohen Tannen am Waldrand hatte sie klettern müssen, um mit dem Glase seinen Standplatz auszukundschaften, mitten in einem breiten Roggenschlag, den er nur zur Nachtzeit verließ, um sich auf der nahen Wiese satt zu äsen. „Und da war er natürlich geliefert,“ schloß sie mit leuchtenden Augen, „ich ging unter Wind geradenwegs auf ihn zu, scheuchte ihn mit lautem Zuruf hoch, als er mich verwundert anäugte, und wie er in langen Fluchten absprang, kriegte er die Kugel mitten aufs Blatt. Vorbeischießen gibt’s bei mir ja nicht so leicht, aber die Aufregung gönn’ ich keinem Hund, wie ich mit dem Finger an den Drücker ging ... na schön, es hat gefleckt und da liegt er!“
Sie wies triumphierend auf einen kreisrunden kleinen Fleck über einem der Vorderläufe des Rehbockes, aus dem ein paar purpurne Schweißtropfen über die rötlich-fahle Decke rieselten. Peter aber stand dabei und lauschte andächtig. Von den jagdlichen Auseinandersetzungen verstand er wenig, er hörte nur die wohllautende Stimme, sah die bei aller Lebhaftigkeit anmutigen Bewegungen, und in seinem Herzen regten sich allerhand unklare Wünsche und Träume ...
Heino hatte von einem niedrigen Erlenbusch am Wiesenrand einen kurzen Zweig gebrochen, zog ihn durch die Todeswunde des Bockes, so daß sich die grünen Blätter rötlich färbten, und überreichte ihn in feierlicher Haltung der Schwester.
„Weidmannsheil zum ersten Kapitalen!“
„Weidmannsdank,“ sagte sie stolz und schüttelte ihm mit einem Aufleuchten in den blauen Augen die Hand. Auch Peter bekam einen gnädigen Händedruck gespendet, und ein Schauer rieselte ihm durch die Nerven, als die warme kleine Hand einen Augenblick lang zwischen seinen scheu zufassenden Fingern ruhte ..
Der lange Heino packte den Bock am Gehörn, schleifte ihn hinter sich her, und sie gingen zu dritt einen schmalen Fußpfad entlang, der mitten durch die Felder nach dem Schlosse führte, einem weitgestreckten Bau mit ragendem Wartturme hinter grünen Lindenwipfeln.
Brigitte schritt voran, von Zeit zu Zeit streifte sie mit ihrer schlanken Hand durch die wogenden Kornähren ... blonde Locken ringelten sich über einem stolz getragenen Nacken, und wenn sie sich im Plaudern halb rückwärts wandte, schimmerte es auf ihrer leicht gebräunten Wange wie über der Haut eines reifenden Pfirsichs ...
Peter Brenitz folgte ihr wie im Rausche, sein Mund sprach gleichgültige Worte, in seinem Herzen aber war ein einziges Klingen und Singen. Von Zeit zu Zeit hielt er den Atem an, denn ihm war zumute, als müßte die Voranschreitende es vernehmen. Vor kurzem hatte er noch gelästert, unwürdig wäre es ihm erschienen, ein auf alles Ideale gerichtetes Streben mit läppischen Tändeleien zu verzetteln, jetzt aber vollzog sich an ihm ein Wunder, wie an einem Blinden, der plötzlich sehend wird ... Und mit einem gewissen Stolze erfüllte es ihn, daß er all seine Reinheit und Keuschheit aufgespart hatte bis zum heutigen Tag, denn noch niemals in seinem jungen Leben hatte ihm ein weibliches Wesen den Sinn beschwert ...
Auf der Freitreppe empfing sie die Mutter der beiden Geschwister, eine freundlich blickende Dame mit vorzeitig gebleichtem Scheitel und einem leidenden Zuge in dem sanften Gesichte. Und gleich nach der ersten Begrüßung führte sie ihren Gast in die weite Halle, die den langgestreckten Bau in zwei Hälften teilte. Sie hob die feine Hand mit dem Witwenring und deutete nach einem Bild in schwerem Eichenrahmen, das einen hochgewachsenen Offizier darstellte, in der Uniform des zweiten Garderegiments, auf der Brust das eiserne Kreuz.
„Der da, mein lieber Herr Brenitz, hat Ihnen hier einen ganz besonderen Empfang bereitet. Seien Sie in seinem Namen willkommen, und fühlen Sie sich bei uns zu Hause!“
Ihm aber wurden die Augen feucht, kaum daß er einen kurzen Dank stammeln konnte. Er neigte sich über die zarte Frauenhand, die sich ihm entgegenstreckte, und ihm war zumute, als müßte er „Mutter“ sagen ...
Zum Kaffee, den sie auf der Parkveranda einnahmen, mit dem Blicke auf weite Rasenflächen und dunkelgrüne Tannenhecken, erschien Brigitte in einem einfachen hellblauen Kleidchen, das Hals und Arme freiließ. Die kühne Jägerin hatte sich in das Haustöchterchen gewandelt. Sie reichte den Kuchen herum, schenkte die goldgerandeten alten Tassen voll und nötigte nach gut ostpreußischer Sitte zum reichlichen Zulangen. Peter mußte von seinem Elternhause erzählen, von der frühverstorbenen Mutter, die er kaum gekannt hatte, und von dem über alles geliebten Vater, der ihn von klein auf als einen Kameraden behandelte, an allem teilnehmen ließ, was ihm selbst das Herz bewegte. Von den Reisen erzählte er, die sie in den Ferien ausgeführt hatten, und wie sein Vater mit ihm gewissermaßen eine zweite Jugend durchlebte; die Aufgaben mitlernte, und, wenn es nicht gegen alles Herkommen gewesen wäre, am liebsten auch neben ihm die Schulbank gedrückt hätte. Wie in einer Vorahnung, daß ihm ein langes Zusammenleben mit seinem einzigen Jungen vom Schicksal nicht mehr vergönnt wäre ... Mitten im eifrigen Studium zum Abiturientenexamen raffte ihn eine hitzige Lungenentzündung fort, während sie beide schon hofften, daß der schlimmste Vorstoß der Krankheit überwunden wäre. Ganz leicht und froh fühlte er sich, sprach von seiner stolzesten Jugenderinnerung, dem glorreichen Sturme auf St. Privat, und weil in kurzer Frist der Tag sich wieder jährte, plante er eine Reise nach den blutgetränkten Feldern, auf denen das neue Deutsche Reich gewachsen war. Das neue Reich, das einstmals kommen mußte, und in dem es weder Haß noch Zwietracht gab ... Und mitten im fröhlichen Planen winkte ihm der Tod mit milder Hand, löschte ganz leicht und sanft ein Leben aus, das so rein gewesen war wie ein kristallklarer Bach und so hoffnungsfroh wie eine im Blütenschmuck prangende Flur ...
An dem runden Tische auf der Parkveranda war es still geworden. Die Dame mit dem weißen Scheitel weinte leise vor sich hin, der lange Heino sah ins Leere, und an den blonden Wimpern von Brigittes schönen Augen zitterte eine Träne ... Zwischen den dreien aber und dem Gaste wob sich ein Band der Sympathie, denn auch sie trauerten um einen, der ihren Herzen unvergeßlich war ... um einen, der in seiner Art ein echter Edelmann gewesen war, einen Aufrechten, der seinen eigenen Weg ging, wenn auch die Zeit um ihn sich gewandelt hatte. In dem Herzen des Gastes aber regte sich ein unsägliches Glücksgefühl. Er glaubte endlich die Stätte gefunden zu haben, von der der Vater immer geträumt hatte, die Stätte, an der niemand fragte, wer bist du und wo kommst du her, sondern was bist du wert? Und über ihr schwebten freundliche Geister, segneten den kommenden Bund, der sich leise zwischen den Nachkommen entspann. — — —
Am Spätnachmittag erschienen Gäste zu freund-nachbarlichem Besuche, die Gräfin Hellingen aus Hellingenau mit Sohn und Tochter, eine schier überlebensgroße Familie, die sich ausnahm wie ein aus vergangenen Märchenzeiten stammendes Riesengeschlecht. Die Mutter eine gewaltige Dame von mehr als sechs Schuh Höhe und einem Leibesumfange, der sich bequem mit dem einer mittleren Sprengtonne vergleichen ließ, der Sohn ein ungeschlachter Geselle mit schweren Gliedern, der den langen Heino reichlich um Kopfeshöhe überragte, und die Tochter eine walkürenhafte Erscheinung, neben der die schlanke Brigitte sich wie ein schmächtiger Backfisch ausnahm.
Als die drei, die Mutter voran, die Parkveranda betraten, lief durch den luftigen Bau ein Erzittern, und in den Dielen entstand ein bedenkliches Knacken. Der lange Heino sprang auf, um der Gräfinmutter die Hand zu küssen, vorher aber fand er noch Zeit, seinem Gaste rasch zuzuflüstern: „Die alte Hellingen, genannt die gräfliche Dampfwalze mit dem Elefantenküken und der Wunschmaid.“ Nach dieser respektlosen Bemerkung aber machte er seinen korrektesten Diener, half der Gräfin aus ihrem hellen Staubmantel, schüttelte dem „Elefantenküken“ herzlich die Hand und versicherte der „Wunschmaid“, sie sähe wieder einmal blendend aus, und es hätte ihm schon immer so geschwant, als sollte der Tag noch einen besonders festlichen Abschluß finden.
Das junge Mädchen errötete vor Vergnügen bis unter die flachsblonden Haare, gab dem langen Heino einen freundschaftlichen Klaps, der einen Schwächeren umgeworfen hätte, und der junge Graf lachte dröhnend auf.
„Geh, schabber nich, Heino, sonst erzähl ich hier öffentlich Deine allerneuesten Schandtaten. Aber ich bin ein christlicher Edelmann, ich kann schweigen!“
Peter Brenitz, der bei dem Eintritte der Gäste bescheiden in den Hintergrund getreten war, hatte bei dem Namen Hellingen argwöhnisch den Kopf gehoben; ein paar Worte fielen ihm ein, die er von dem redseligen Oberkellner des Hotels de Russie auf dem Wege vom Bahnhofe gehört hatte. Und jetzt glaubte er mit einem Male dafür die richtige Deutung zu haben ...
Eine jähe Eifersucht krampfte sich ihm ins Herz, gleich danach aber atmete er erleichtert auf, denn die blonde Brigitte erwiderte die geräuschvolle Begrüßung des jungen Grafen mit merklicher Zurückhaltung. Sie reichte ihm kaum die Fingerspitzen ihrer schlanken Hand, und als er sich hinabbeugte, um ihr irgend etwas zuzuflüstern, wich sie mit einer unmutigen Bewegung aus. Da mußte Peter Brenitz an sich halten, um nicht laut aufzulachen, ein übermütiges Glücksgefühl strömte ihm durch Nerven und Adern, er blickte zu Brigitte hinüber, und ein leises Blinzeln ihrer blauen Augen kam als Antwort zurück. Gleich als hätte sie ihm sagen wollen: geh, gräm dich nicht, der ungeschlachte Gesell ist mir genau so widerwärtig wie dir ...
Die Gräfin Hellingen hatte nach umständlicher Begrüßung der Hausherrin Platz genommen. Frau von Bergkem legte ihr leicht die Hand auf den umfangreichen Arm und lud Peter mit freundlichem Winke zum Näherkommen ein.
„Gestatte, liebe Irmgard, daß ich Dir Herrn Referendar Brenitz vorstelle! Ein Freund meines Heino, und von seinem lieben Vater her unserer Familie besonders verbunden.“
Die Gräfin hob eine langgestielte Lorgnette vor ihr breites Gesicht mit dem tief hinabhängenden Doppelkinn und warf einen zerstreuten Blick auf den schmächtigen Jüngling.
„Brenitz, Brenitz? Mit einem Brenitz habe ich mal in meiner Jugend getanzt. Ich glaube, er war so was wie Deutzer Kürassier, und, nicht wahr, Sie stammen auch aus dem schönen Rheinland?“
Peter wußte nicht recht, was er antworten sollte, aber der lange Heino sprang für ihn ein. In seinen blauen Augen lachte der Schalk, aber er verneigte sich ganz ernsthaft.
„Du irrst Dich, Tante Irmgard, mein Freund stammt aus der jüdischen Linie dieses alten Geschlechts. Sie hat sich hervorragend um die Eroberung des Kurfürstendammes verdient gemacht, der Papa aber meines Freundes und der meinige besaßen bei St. Privat eine kleine Versicherungsbank auf Gegenseitigkeit. Sie retteten sich immer umschichtig das Leben!“
„Sieh mal an,“ sagte die Gräfin Hellingen, „wie interessant!“ Sie hob von neuem die Lorgnette zu flüchtigem Blicke, gleich danach aber wandte sie sich zu der Frau von Bergkem. Der Fall Brenitz war für sie erledigt.
„Sag mal, liebe Mieze, ich bin da vorhin an einem Roggenschlag vorbeigekommen, er war wenig erfreulich, und wenn mir Dein Inspektor zur Hand gewesen wär’, hätte ich ihm gründlich den Marsch geblasen. Alle Spann’ lang einen Halm und oben statt Aehren lauter „Bremsenköppe“. Versteht der Mensch nichts von der Landwirtschaft, oder hat er im Herbst vielleicht nicht genug Dung gehabt?“
„Auch ’ne Gemeinheit, erklär’ Ihnen alles später,“ raunte Heino seinem Gaste zu und räusperte sich mit höflicher Verneigung.
„Du rührst da an ein Problem, liebe Tante, das mir auch schon schlaflose Nächte bereitet hat. Ich glaube, wir müßten zur Abhilfe der von Dir gerügten Mißstände öfter regnen lassen oder unser Vieh mit Rhabarber füttern. Jetzt aber verzeih, ich möchte meinen Freund auch Deinen Sprößlingen vorstellen!“ Er machte eine weit ausladende Handbewegung: „Komteß Hella von Hellingen, Herr Referendar Brenitz ... Herr Referendar Brenitz aus Berlin, Herr Burggraf Hanns von Hellingen auf Hellingenau!“
Die „Wunschmaid“ neigte kurz das mit flachsblondem Haar beschwerte Haupt, das „Elefantenküken“ hob sich ein wenig auf seinem Sitze an und schnarrte mit einem Zusammenklappen der Stiefelabsätze: „angenehm!“ Peter Brenitz aber wurde mit einem Male befangen und machte eine linkische Verneigung. Er empfand es dankbar, daß Heino vor der vornehmen Verwandtschaft sich so offen zu ihm bekannt hatte, aber ein bitteres Gefühl stieg ihm im Halse empor, und unwillkürlich mußte er denken, wie anders wohl die Vorstellung verlaufen wäre, wenn er wirklich zu diesem adligen Geschlechte der angeblich im Rheinlande ansässigen Brenitze gehört hätte.
Die Gräfin Hellingen machte ein ärgerliches Gesicht und richtete sich in ihrem Lehnsessel auf. Es war ihr nicht entgangen, daß Heino geflissentlich den Namen dieses kleinen Referendars vor dem ihres Sohnes genannt hatte ...
„Wir wollen nicht mehr lange stören, und ja, liebe Mieze, weshalb ich eigentlich zu Dir gekommen bin ... es hat sich da eine Person bei mir gemeldet, die früher bei Dir in Diensten stand ... meine bisherige Kammerzofe habe ich nämlich wieder einmal Knall und Fall entlassen müssen.“ ...
„Ach,“ sagte der junge Graf Hellingen plötzlich und stand auf, „Du sollst doch heute nachmittag einen ganz klotzigen Bock geschossen haben, Brigitte? Euer Gärtner erzählte vorhin was davon. Kann man ihn nicht mal sehen?“ Er bemühte sich, ein möglichst unbefangenes Gesicht zu machen, aber der Versuch gelang nur unvollkommen, denn in seinen gebräunten Wangen stieg eine verräterische Röte empor ...
„Meinen Bock“ fragte Brigitte, „mit Vergnügen! Kommt, Kinder, am Milchkeller irgendwo wird er hängen!“ Sie nahm die Wunschmaid unter den Arm und ging voran, gefolgt von dem erleichtert aufatmenden Elefantenküken. Der lange Heino aber verneigte sich erst höflich vor der Gräfinmutter: „Liebe Tante, darf ich für meinen Freund und mich ebenfalls um Urlaub bitten?“ Und draußen schlug er seinem Gaste kräftig auf die Schulter.
„Mann Gottes, jetzt machen Sie doch bloß nicht so’n miesepetriges Gesicht, die Leute verstehen’s eben nicht besser, und der Bann ist ja gebrochen. Sie sind der Gräfin Hellingen vorgestellt, und nachher werde ich’s schon deichseln, daß Sie von ihr aufgefordert werden, nächstens in Hellingenau einen Besuch zu machen. Dann aber sind Sie fein ’raus mit ’nem Freilos, denn sie ist immer noch nicht nur die dickste, sondern auch erste Dame des Kreises, und wer in ihrem Hause verkehren darf, ist für unsere hiesigen Begriffe so was ähnliches wie hoffähig.“
„Ich möchte Sie bitten,“ erwiderte Peter, „sich nach dieser Richtung hin nicht zu bemühen. Ich beabsichtige nicht, mich in eine Gesellschaft zu drängen, in der ich doch nur geduldet sein würde!“
Heino blieb stehen und schlug verwundert die Hände zusammen.
„Ja, Kind, liebes, was wollen Sie eigentlich?! Neulich, am Abend vor Ihrem sogenannten Duell, schwärmten Sie von den völkerbeglückenden Idealen Ihres seligen Herrn Papas, die natürlich auch die Ihrigen sind. Sie setzten mir in längerer Rede auseinander, all die beklagenswerten Mißverständnisse wären zum größten Teile darauf zurückzuführen, daß die beiden in Betracht kommenden Parteien viel zu wenig voneinander wüßten. Jetzt bringe ich Sie mit Leuten von der anderen Cotéseite zusammen, und Sie zoppen zurück! Woher sollen’s die denn lernen, daß hinterm Berg sozusagen auch Menschen wohnen, wenn ihr Gesichtskreis sich nur auf allerhand, auch in Ihren Augen nicht gerade sehr dekorative Objekte beschränkt? Auf die armseligen Gestalten, die mit gekrümmtem Rücken ihr Bündel von Dorf zu Dorf schleppen, auf Herrn Manufakturwarenhändler Pollnow am Markt, der mit den Bauern um ’ne Elle Kattun feilscht, oder, wenn’s hoch kommt, auf einen Königsberger Getreidehändler, der aber, weil er bei seinem Geschäft natürlich auch verdienen will, von vornherein ihr Feind ist? ... Also vorwärts, los, mein Jungchen! Und tun Sie mir einen Gefallen: Laufen Sie nicht immer mit so ’nem Entschuldigungszettel auf der Brust herum, in dieser unglückselig-schüchternen Haltung, als wenn Sie sagen wollten: „Verzeihen Sie, meine Herrschaften, ich bin zwar Jude, aber, Sie dürfen’s mir glauben, ein anständiger Mensch!“
Peter sah dankbar zu seinem Freunde hinüber. Dieser aber lachte, wie es seine Art war, kurz auf.
„Na also, abgemacht! Und haben Sie ’ne Ahnung von Orchideen?“
„Ein wenig,“ versetzte Peter leicht verwundert, „aber was hat das mit unserm Thema zu tun?“
„’ne Masse! Und können Sie auch, wenn Sie so ’ne Pflanze in die Hand kriegen, mit der gravitätischen Miene eines Sachverständigen Kohl darüber reden?“
„Ich denke doch! Mein seliger Vater war ein großer Blumenfreund, und auf einem unserer Terrains da draußen nach Lichterfelde zu stehen noch heute die Gewächshäuser!“
„Na, Menschenskind, dann ist ja alles in der schönsten Ordnung, denn die gräfliche Dampfwalze hat sich in neuerer Zeit auf die Orchideenkultur geworfen, weil ihr irgend jemand eingeredet haben mag, das wäre besonders vornehm. Zum nächsten Sonntag also lassen Sie sich aus Berlin einen dicken Strauß von diesen Dingern kommen, schwingen sich damit in Ihr Auto, und ich will zeitlebens Wasser trinken, wenn Sie nicht gleich zum Mittagessen dabehalten werden!“
Peter Brenitz blickte nachdenklich über den weiten Raum des Gutshofes. Langgestreckte Scheunen mit verwitterten Ziegeldächern rahmten ihn ein, allerhand Ackergerät lag und stand herum, drüben aber von der anderen Seite her leuchtete ein hellblaues Kleid ... Da lächelte er seinem Freunde zu: „Sie haben recht, ich muß wirklich mehr unter Menschen, und ich bin Ihnen von Herzen dankbar!“
Daß es ihm dabei im Augenblick weniger um seine Ideale ging, kam ihm vielleicht gar nicht zum Bewußtsein, aber wie sollte er die blonde Brigitte wiedersehen, wenn er sich selbst von der Gesellschaft abschloß, mit der sie verkehrte? Oder gar dem ungeschlachten Burschen den Platz räumte, der mit begehrlichen Augen um sie herumstrich ... Und aus dieser eifersüchtigen Regung entsprang ihm plötzlich die Frage: „Sagen Sie mal, Herr Kollege, wie ist die Familie Hellingen eigentlich mit Ihnen verwandt?“
„Die Hellingens mit uns?“
Der lange Heino blieb stehen und sah grübelnd auf den grünen Rasen hinab. „Warten Sie mal ... im siebzehnten Jahrhundert hat mal ein Hellingen eine Bergkem geheiratet, oder umgekehrt. Genau weiß ich’s nicht, dazu müßte ich erst die Familienchronik wälzen!“
„Aber Sie duzen sich doch untereinander?“ warf Peter ein.
„Ach so?! Nun, die Urgroßmütter sind schon zusammen aufgewachsen, mit dem großen Hanns haben wir uns gegenseitig die Nasen blutig geschlagen, da kommt das ganz von selbst. Die Gräfin aber ist meine Patin und genießt infolgedessen das Vorrecht, von mir von Zeit zu Zeit mit einem größeren Pump beehrt zu werden ... Autsch, Backe,“ sagte er plötzlich und sah besorgt nach dem Herrenhause zurück, „sie wird meiner alten Dame doch nichts erzählt haben?!“
„Um Gottes willen —“ Peter fuhr ordentlich erschrocken zusammen — „weshalb haben Sie mir denn nicht ein einziges Wort nur gesagt? Ich hätte doch so gerne ...“
Er brach ab, denn Heino legte ihm die schwere Hand auf die Schulter.
„Nee, mein Jungchen, das wollen wir lieber lassen! Unsere Freundschaft soll keinen metallischen Beigeschmack bekommen! Sie meinen es gut und ehrlich, ich weiß es, aber es soll niemand sagen dürfen, der Heino Bergkem hätte aus nicht ganz lauteren Gründen gehandelt ... na, ist gut!“ Er hatte ernster als sonst gesprochen, und gleich danach lachte er wieder lustig auf.
„Aber beruhigen Sie sich, sie tut’s nicht, denn sie fürchtet sich vor meinem losen Mundwerk. Und sie trägt den neuen Posten auf ein recht zweifelhaftes Konto, denn im stillen hofft sie, ich werde mal die Wunschmaid heiraten, dann zieht sie mir alles auf einmal von der Mitgift ab! Schließlich, das Dümmste wär’ es ja nicht, aber wir wollen es uns noch ’ne ganze Weile lang überlegen, trotz der ungemessenen Däuser, die sie mal von ihrer Mutter erbt! Und der große Hanns da drüben neben meiner Schwester? Der Kerl ist dumm wie Bohnenstroh, fast könnt’ man sagen, wegen allzu alten Adels des Lesens und Schreibens unkundig, aber mit vierundzwanzig Jahren Herr auf dreiundsechzigtausend Morgen Land! Dreiundsechzigtausend Morgen, über denen mal der weiße Wappenvogel meines Geschlechts flog. Na schön, kann vielleicht alles wieder werden. Und jetzt kommen Sie, sonst bilden sich die beiden Riesenkinder noch ein, wir hätten nichts Besseres gewußt, als über sie zu klatschen!“
Er ging mit weit ausgreifenden Schritten voran, und Peter folgte ihm mit angstvoll beklommenem Herzen. Die Worte „kann vielleicht mal alles wieder werden“ ließen doch nur eine einzige Deutung zu, aber gleich danach schalt er sich einen Toren. Der lange Heino wäre doch der letzte gewesen, an so schnöden Handel, bei dem es um das Schicksal der eigenen Schwester ging, überhaupt nur zu denken. Sie selbst aber, die blonde Brigitte, schien ihm viel zu stolz und hochgesinnt, um sich an diesen täppischen Burschen zu verkaufen, nur weil er eine Grafenkrone trug und Herr über drei Meilen Land war! Und schließlich war er ja auch noch da und gedachte nach dem Rate des Freundes von jetzt an auf den Plan zu treten. Ein stilles Werben und Dienen sollte anheben vom heutigen Tage, bis sie sich ihm in seliger Stunde neigte wie eine gnadenreiche junge Königin ...
Das Gehörn des Bockes war von allen Seiten besichtigt und sachverständig geprüft worden. Brigitte schlug vor, wieder nach der Parkveranda zurückzukehren, und da widerfuhr dem großen Hanns ein Mißgeschick. Aus den nahen Tagelöhnerwohnungen waren die Kinder herzugelaufen, standen scheu im Kreise herum und starrten die jungen Herrschaften aus dem Schlosse an. Eins der Kleinsten aber, das barbeinig im Hemdchen auf allen Vieren krabbelte, hatte sich vorwitzig zu nahe herangewagt, und im Umwenden trat ihm der junge Graf Hellingen unachtsam auf die winzige Hand.
„Ueberall wimmelt’s von dem kleinen Geschmeiß,“ sagte er ärgerlich und wollte seinen Weg fortsetzen, aber es gab einen unliebsamen Aufenthalt, Peter Brenitz eilte hinzu und hob den schreienden Kleinen auf. Er trug ihn zu dem nächsten Hause, setzte ihn in dem verräucherten Flure auf einen Schemel, und da geschah etwas Merkwürdiges, der strampelnde Schreihals wurde mit einem Male still, ließ sich geduldig das Blut von der Schramme wischen und die dicke Patschhand untersuchen.
Peter hob den Kopf, denn er hörte sich nähernde Schritte.
„Ich glaube, es ist nichts passiert, Herr Graf, er kann alle Finger bewegen, und das Schlimmste wird wohl der Schreck gewesen sein!“
„Nein, ich bin’s,“ sagte Brigitte, „der andere steht draußen und mokiert sich. Aber das ist famos, besser hätten Sie ihn gar nicht ärgern können.“
Ueber Peters schmales Gesicht huschte ein verlegenes Lächeln.
„Verzeihen Sie, daran hatte ich im Augenblick wirklich nicht gedacht, und ich muß um Entschuldigung bitten, daß ich mich da gewissermaßen vorgedrängt habe. Dem Herrn Grafen tut’s sicherlich auch recht leid, nur ...“
„Ja,“ fiel Brigitte feindselig ein, „nur er hat eine andere Art, sein Mitleid auszudrücken. Und Sie bekämen’s wahrhaftig fertig, ihn noch in Schutz zu nehmen!“
„Er hat’s gewiß nicht gerne getan, und das andere liegt wohl nur an seiner Erziehung. Wer in so bevorzugter Stellung aufwächst, lernt schwer einen richtigen Maßstab für all das Armselige, was zu seinen Füßen kriecht!“
„Sie sind ein komischer Mensch,“ sagte Brigitte, sah ihn groß an. „Und ist das wahr, was Heino eben draußen erzählte, daß Sie nämlich ...“ Sie stockte einen Augenblick, dann warf sie mit einer kurzen Bewegung den Kopf in den Nacken: „also, daß Sie noch nie ein Mädchen geküßt haben?“
Peter wurde rot bis unter die Haarwurzeln.
„Es ist sehr unrecht von Ihrem Herrn Bruder, daß er etwas, das nur für ihn bestimmt war, vor anderen weitererzählt. Die lachen vielleicht darüber! Aber weshalb soll ich es leugnen? Es ist ja wahr und wohl auch keine Schande. Früher hielt ich’s für unwürdig, heute aber“ — seine Brust dehnte sich unter einem tiefen Atemzuge — „heute wäre mir zumute, als würde ich damit ein Heiligtum entweihen, das ich in meinem Herzen trage.“
„Ich habe nicht gelacht,“ sagte Brigitte ernsthaft, gleich danach aber wurde sie verlegen. „Kommen Sie, bitte, die anderen warten draußen!“ Und sie wandte sich zur Tür.
Peter nickte freundlich.
„Bitte, gehen Sie voran, und entschuldigen Sie mich für einen Augenblick. Ich will nur zusehen, ob ich meinen kleinen Patienten hier irgendwo in sichere Hände abliefern kann.“
Die Tür hatte sich geschlossen, und Peter sah sich in dem dämmerigen Raume um. Feuchter Ruß klebte an den Wänden, in einer Ecke stand ein Lehmherd, auf dem ein Kohlenfeuer schwelte, irdene Töpfe hingen an einem Gestell, und über einem zerbrochenen Stuhl lag ein geflickter Kittel. Ihm aber war zumute, als stände er in einem goldschimmernden Palast, einem Palast, in dem eben sein Glück geboren war ...
Aus einer niedrigen Seitentür trat eine abgearbeitete Frauengestalt, trocknete sich die feuchten Hände an der Schürze und erging sich in demütigen Entschuldigungen.
„Ach Gott, gnädiger Herr, seien Se nich bös! Ich stand an der Waschtonn’, und da is er mir weggekrochen. Und hätten Se ihm man noch ordentlich eins drauf gegeben, dem naseweisschen Bengel! Was hat er da ’rumzukraufen, wo die gnädigen Herrschaften stehen?“
Der Kleine fing wieder an zu schreien, Peter aber sprach ihm beruhigend zu und glaubte mit einem Male zu verstehen, weshalb der junge Graf Hellingen achtlos weitergegangen war, als sein schwerer Fuß das am Boden liegende Kind gestreift hatte. Wie sollten die Herren anders sein, wenn rings um sie knechtische Demut war, die nach empfangener Wehtat unterwürfig um Verzeihung bat?!
Ein unsägliches Mitleid quoll ihm im Herzen empor, er griff in die Tasche und legte neben dem Kinde, was er an kleinem Gelde bei sich trug, auf den Schemel. Es schien ihm herzlich wenig, ein paar Goldstücke nur und etliches Silbergeld, das arme Tagelöhnerweiblein aber starrte ordentlich erschrocken hin.
„Gnädiger Herr, und das soll ich? ...“ Es haschte nach seiner Hand: „Trautester, goldenster gnäd’ger Herr, schön Dank, und der liebe Gott vergelt’s Ihnen hunderttausendmal. Was Sie sich man bloß wünschen, schon soll es da sein, und Glück soll immer bei Ihnen sein!“
Da lachte Peter wieder fröhlich auf.
„Glück, liebe Frau? Glück kann man immer brauchen, aber eben war es da, und so Gott will, werd’ ich’s draußen wiederfinden!“ — — —
Als Peter auf den Hofraum trat, sah er vor der Freitreppe sein Auto halten. Der brave Meltzer war abgestiegen, erklärte den Herrschaften in einem mit Fachausdrücken reichlich gespickten Berlinisch die Maschine, und auch die beiden alten Damen, die von der Parkveranda gekommen waren, hörten mit Interesse zu. Der lange Heino winkte mit der Hand und rief hinüber: „Brenitz, die Komteß und meine Schwester haben noch nie in so einem Ding gesessen! Darf Ihr Chauffeur sie mal ’n bißchen rumkutschieren?“
„Aber mit Vergnügen,“ rief Peter zurück und lief eilig hinzu, um seinem Wagenlenker die größte Vorsicht einzuschärfen. Herr Meltzer salutierte militärisch.
„Befehl, Herr Doktor, wird nischt passieren. So ’ne noble Fuhre schmeißt man nich um!“
Die jungen Damen stiegen lachend ein, auch das Elefantenküken folgte, und die Gräfinmutter richtete ihr Lorgnon auf Peter, als wollte sie sich diesen Referendarius in seiner Eigenschaft als Automobilbesitzer noch einmal genauer ansehen. Am liebsten wäre sie ebenfalls mitgefahren, aber ein prüfender Blick auf die schmalen Wagensitze hatte sie leider belehrt, daß die Ausführung dieses Vorsatzes auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen mußte ...
Der lange Heino kniff seinen Gast in den Arm.
„Ihre Aktien steigen riesig, der rotlackierte Kasten hat ihr mächtig imponiert, und nachher lass’ ich die Orchideen steigen. In fünf Minuten sind Sie eingeladen!“
Herr Meltzer kurbelte den Motor an, schwang sich in den Führersitz und fuhr mit erster Geschwindigkeit ab, um nach einigen Wagenlängen gleich die zweite einzustellen. Puffend und knatternd stob das Auto von dannen, um in wenigen Augenblicken am Hoftor hinter einer Staubwolke zu verschwinden. Die Gräfinmutter wehte begeistert mit einem Taschentuche, und Heino näherte sich ihr listig.
„Liebe Tante Irmgard, das wird Dich gewiß auch interessieren: Mein Freund Brenitz teilt eine Deiner Hauptpassionen. Er ist ebenfalls ein begeisterter Orchideenzüchter, und seine Gewächshäuser sind geradezu eine Sehenswürdigkeit von Berlin. Sie liegen auf seinen großen Terrains, nach Lichterfelde zu, und ja, ich sage Dir, es ist kolossal, was für Orchideen da wachsen! In allen Farben und wie Milchschüsseln so groß.“
„Mein lieber Junge,“ sagte die Gräfin belehrend, „bei Orchideen kommt es nicht auf die Farbe und Größe an, sondern auf die Seltenheit. Ich habe eine, die ist kaum wie ein kleines Nelkchen so groß, und sie kostet fünfhundert Mark! Lang’ aber werd’ ich sie nicht mehr züchten, denn sie fängt schon an, ziemlich gemein zu werden, auf der letzten Ausstellung in Königsberg waren schon sechs Stück!“ Und nach diesen, mehr für die Allgemeinheit gesprochenen Worten wandte sie sich mit einem wohlwollenden Lorgnettenschwunge zu Peter.
„Also Sie züchten auch Orchideen! Nun, es ist jedenfalls das Zeichen eines exquisiten Geschmacks. Es wäre mir interessant, gelegentlich Ihr Urteil über meine Gewächshäuser zu hören. Wenn Sie Ihr Weg einmal in die Nähe von Hellingenau führt, wird es mir ein Vergnügen machen, sie Ihnen zu zeigen.“
Peter verneigte sich höflich: „Es wird mir eine hohe Ehre sein, gnädigste Frau Gräfin,“ und der lange Heino sah triumphierend zu ihm hinüber. Die Gräfinmutter aber wandte sich zu Frau von Bergkem, denn sie fand, fürs erste hätte dieser dunkle junge Referendarius genug Huldbeweise empfangen.
Das Auto erschien wieder im Außentor, fuhr eine elegante Schleife im Hofraum, um vor der Freitreppe zu halten, Brigitte stieg als erste aus.
„Himmlisch,“ sagte sie und schüttelte Peter die Hand. Die Wunschmaid folgte ihr auf dem Fuße: „Gottvoll,“ und schließlich stellte sich auch der lange Hanns mit einem Händedruck ein: „Tadellos! Ich bin ja in Berlin schon oft genug gefahren, aber Ihr Chauffeur hat ein Tempo am Leibe: großartig! Hat mich auf die Idee gebracht, mir auch so’n Dings zuzulegen, und, pardon, was kostet so ’ne Maschine mit allem Klimbim per Jahr?“
Peter lächelte verlegen.
„Das müssen Sie gütigst meinen Chauffeur fragen, ich habe keine Ahnung.“
Er wußte es wirklich nicht, denn er hatte sich noch niemals die Mühe gemacht, die Rechnungen des Herrn Meltzer am Jahresschlusse zusammenzuzählen, mit dieser Antwort aber verstärkte er, ohne zu wollen, den bisher erzielten günstigen Eindruck um ein Bedeutendes. Der lange Heino hatte vorhin schon gelegentlich ein paar Worte über den immensen Reichtum seines Freundes fallen lassen, und das rote Gold übte wie überall seine Zauberwirkung, auch auf die stolze Gräfinmutter von Hellingenau ...
Als Peter nach kurzem Abschiede davongefahren war, um die amtsgerichtsrätliche Familie nicht durch unangemessenes Zuspätkommen zu kränken, äußerte sie wohlwollend:
„Ein recht sympathischer junger Mann, dieser Referendarius Brenitz, und ich finde, nicht nur im beschränkten Kreise präsentabel. Hätte Heino mich nicht darauf aufmerksam gemacht, wär’ es mir nicht im Traume eingefallen, ihn für einen Israeliten zu halten. Ueberhaupt, wer will heutzutage nach dem Aeußern eines Menschen urteilen? Ich kenne Prinzen, die von irgendeiner Urgroßmutter her in Zivil so aussehen, als wollten sie einem alte Hosen verkaufen. Auf das Innere kommt es bei ’nem Menschen an, und ich muß gestehen, auch in der Hinsicht hat dieser junge Mann auf mich einen recht vorteilhaften Eindruck gemacht. Liebenswürdig, bescheiden und zurückhaltend. Jedenfalls werde ich’s mir angelegen sein lassen, ihn zu protegieren, soweit es in meinen schwachen Kräften steht.“
So lobte die Gräfin von Hellingen vor Brigittens eifrig zuhörenden Ohren den abwesenden Peter Brenitz, und in ihrem allzeit auf Mehrung des Familiengutes bedachten Sinne regte sich der Gedanke, ob sich hier nicht eine Möglichkeit bieten könnte, ihren anwesenden Einzigen vor einer wenig vorteilhaften Verbindung zu bewahren. Frau von Bergkem aber blickte noch bedrückter drein als sonst und neigte sorgenvoll den vorzeitig gebleichten Scheitel, denn sie glaubte zu verstehen, was die andere dachte. Ein langgehegter Plan schien ihr ins Wanken zu geraten, auf den sie das Schicksal ihres Hauses gebaut hatte, ein Luftschloß vielleicht nur, aber in allen Nöten und Sorgen des Tages war es ihr immer für sich und die Ihrigen als letzte Zuflucht erschienen ...
Als jedoch am späten Abend der Hellingenauer Besuch nach Hause gefahren war, schlang Heino der Mutter seinen langen Arm um die Schulter.
„Sag, Mutti, hältst Du Deinen Aeltesten für dumm?“
„Nein, mein Kind, aber ...“
„Kein Aber! Ich weiß genau, was ich will! Es war höchste Zeit, dem langen Hanns mal ’ne kleine Aufmunterung zu geben, wie ’nem trägen Gaul ’nen Peitschenschmiß. Auf seine Art hat er unsere Brigitte recht lieb, aber er glaubt, mit ihren siebzehn Jahren läuft sie ihm nicht fort, und läßt sich Zeit wie ein Pascha, der nur die Hand auszustrecken braucht. Also da ist es recht gut, wenn ihn die Bremse der Eifersucht sticht. Glaub’ mir, in vierzehn Tagen tritt er hier mit ’nem Blumenstrauß an — trotz seiner hochgräflichen Mutter! ... Meinst Du, ich hätte sie nicht durchschaut, als sie heute nachmittag in Brigittes Gegenwart von ihrer weggejagten Kammerjungfer oder, implicite, von einem neuen Streiche ihres Herrn Sohnes zu erzählen anfing?“
Frau von Bergkem schmiegte sich an ihren Sohn und sah in neu erwachender Hoffnung zu ihm auf. Nur ihr streng christlicher Sinn wehrte sich gegen so unziemliche Beeinflussung des Schicksals.
„Ich glaub’ Dir, mein Kind, aber ist es nicht eigentlich ein frevles Spiel mit Menschenlosen? Wenn nun Brigitte ...“
„Mutter!“
Der lange Heino hob die Hand, und zwischen seine blonden Augenbrauen schob sich eine tiefe Falte:
„Ich hoffe, sie denkt ebenso wie ich, und wenn nicht, dann ist es Deine Pflicht, diesem siebzehnjährigen Gissel die Augen klar zu wischen. Ich glaube, im Sinne meines Vaters ein leidlich moderner Mensch zu sein, aber bei gewissen Dingen hört mein Horizont auf! Und glaub mir, eher würd ich in Dreck und Speck verkommen, als daß ich einem Juden, und wär er der edelste Mensch, der je diese Erde beschritten, meine Schwester zum Weibe gäbe.“
Die Mutter neigte zustimmend den feingeschnittenen Kopf.
„Mein Sohn, Du bist nach dem Hingang Deines Vaters der letzte Deines Geschlechts, Dir kommt es zu, in solchen Fragen zu bestimmen, und ich will Deinen Anweisungen getreulich folgen. Bangt es Dir aber nicht um Deinen Freund, und ist es nicht unchristlich, ihn ahnungslos in eine Gefahr treten zu lassen, die ihm vielleicht Kummer und Herzeleid bringt?“
Da lachte der lange Heino wieder lustig auf.
„I bewahre, Mama! Das heißt, versteh mich nicht falsch! Ich wollte sagen, der gute Peter Brenitz ist gegen diese Gefahr gepanzert und gefeit. Vor lauter himmelhohen Idealen hat er keine Zeit, sich hier unten auf der Erde umzuschauen, und ich wette mit Dir, er weiß trotz stundenlangen Beisammenseins noch nicht einmal, ob Brigitte blaue Augen hat oder braune. Sonst vielleicht“ — und seine Stimme klang unwillkürlich leiser — „wäre er mir doch zu schade, ihn als Puppe in mein Spiel zu stellen! In seiner Art ein prachtvoller Kerl, und — weshalb soll ich’s leugnen — in gewissem Sinne bin ich stolz darauf, ihn meinen Freund zu nennen ...“
So sprach der lange Heino, schritt mit der Mutter bis in den späten Abend hinein in den schweigenden Gängen des Parkes auf und ab, bedachte klüglich, wie die Beziehungen der Häuser Hellingen und Bergkem zu naher Vereinigung zu gestalten wären. Eines nur bedachte er nicht, daß ein großes Jungenherz längst schon lichterloh brannte, in dem eines kleinen Mädchens aber ein Funke glimmte, der mit rasch zufassender Hand ausgedrückt werden mußte, um nicht in heller Flamme emporzuschlagen ....
Peter Brenitz fuhr allein nach Hause, denn Heino hatte ihm erklärt, er müßte seines geplanten Finanzgeschäftes wegen mit der Gräfinmutter von Hellingen noch ein kräftiges Wörtlein im Vertrauen reden. Herr Meltzer drehte den Motor an, noch ein Winken und Grüßen, und der schöne Nachmittag in dem gastlichen Hause unter den grünen Lindenwipfeln war zu Ende. Als Peter im Hoftor sich noch einmal umwandte, war die Freitreppe leer, nur an einem Fenster der weiten Halle leuchtete noch ein bläulicher Schimmer ...
Aber das mochte vielleicht nur eine Einbildung sein, die ihm seine kurzsichtigen Augen vorspiegelten, oder sein von Glückseligkeit übervolles Herz ...
Da legte er sich im Wagensitze zurück und kostete in der Erinnerung alles noch einmal durch, was sich an diesem gesegneten Nachmittage zugetragen, von dem Augenblicke an, da er sie dort drüben auf dem schmalen Wiesenraine erblickt hatte, bis zu der flüchtigen Sekunde, in der sie ihm die kleine Hand zum Abschiede reichte. „Kommen Sie recht bald wieder, lieber Herr Brenitz,“ hatte sie gesagt und ihn freundlich angesehen, die blonde Brigitte. Nun wohl, das sollte geschehen, denn jede Minute, die er fern von ihr verbringen mußte, erschien ihm ein Raub an dem ihm zukommenden Glücke.
So träumte er glückselig vor sich hin, indes ihn der rasche Wagen den Weg zurückführte, den er am Nachmittag an der Seite des Freundes gegangen war. Himmelhoch ragten die grauen Stämme der Tannen empor, zwischen sandigen Hügeln wuchs dürftiges Wacholdergestrüpp, und über dem blauen Spiegel des Sees stand die abendliche Sonne, nur schien ihm das Bild der Landschaft gegen sonst ganz eigentümlich verändert. Alles rings um ihn her war viel farbiger und bunter geworden, noch nie glaubte er ein so prächtiges Blau, ein so leuchtendes Grün gesehen zu haben, als hier auf Schilf und Wasser, und noch niemals war es ihm aufgefallen, welche verschwenderische Pracht von Glanz und Gold die liebe alte Sonne über Wald und See zu streuen vermochte. Wohin ihr Strahl auch traf, überall ergleißte es von Purpur und Gold, bis ihm mit einem glücklichen Lächeln einfiel, daß diese Veränderung vielleicht an seinen Augen läge ... Und grüßend flogen seine Gedanken zu der Einzigen, Herrlichen zurück, die ihn zu neuem Leben erweckt hatte ...
Als er vor der Veranda des Grand Hotel de Russie ausstieg, um sich für den „gemütlichen Familienabend“ bei Amtsgerichtsrats in den schwarzen Rock zu werfen, gab er seinem braven Wagenlenker einen übermütigen Klaps auf die Schulter.
„Na, Meltzer, wie gefällt’s Ihnen hier im Städtchen?“
„Bedeutend, Herr Doktor! So ’ne Station ha’ck mir schon lange immer jewünscht. Stullen, wie Holzpantinen so jroß, un det Fleesch scheint hier ooch mächtig billig zu sein!“
„Na und sonst? Haben Sie auch schon wieder ’ne Braut?“
„Ick schwanke noch, Herr Doktor! De Mächen sind alle hier durch de Bank so sauber und appetitlich, det ick mir for ’ne einzelne noch nich hab entschließen können. Immer jefällt mir ’ne andere besser, und vorläufig lieb ick se alle mitenander!“
„Dann beeilen Sie sich aber, Ihre Wahl zu treffen,“ sagte Peter lächelnd. „Denn wie steht’s geschrieben? Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei!“
Damit begab er sich ins Haus, Herr Meltzer aber blickte ihm mit einiger Verwunderung nach. So aufgeräumt und lustig hatte er seinen Herrn noch niemals gesehen. Und mit einem Male kniff er das rechte Auge ein und pfiff vergnügt vor sich hin: „Hast’s endlich auch gemerkt, daß zweierlei Menschen auf der Erde wohnen?“ Nur wußte er nicht recht, an welcher der beiden jungen Damen, die er so behutsam hatte fahren sollen, sein Herr Feuer gefangen hatte, an der schlanken Zierlichen im hellblauen Kleid oder der Großen mit dem weißblonden Haar. Eins aber schien ihm auf jeden Fall sicher, daß er ihn noch manch liebes Mal von diesem Gutshofe abholen würde, dessen vertrackten Namen kein anständiger Christenmensch richtig aussprechen konnte ...
Bei Amtsgerichtsrats ging es hoch her. Die beiden Vorderzimmer erstrahlten im festlichen Lichte mehrerer Lampen, die Frau Rätin, eine stattliche Dame mit einem Schnurrbärtchen auf der Oberlippe und dunkeln Augen, hatte ihre vollen Formen in das Schwarzseidene eingezwängt, Fräulein Trudchen aber prangte in Rosa, weil ihrem brünetten Teint diese Farbe bei Abendbeleuchtung am besten zu Gesichte stand. Die sechs jüngeren Geschwister aber mußten in den Hinterzimmern bleiben, um den Gast nicht durch ihre große Zahl zu erschrecken und der ältesten Schwester keine unziemliche Konkurrenz zu bereiten.
Als Peter gegen halb neun in Gehrock und Zylinder erschien, empfing er den wohltätigen Eindruck eines wenn auch bürgerlich-einfachen, so doch harmonischen Familienlebens, und auch hier war die Begrüßung eine ausnehmend herzliche. Die Frau Rätin, die zur Erklärung ihrer harten Aussprache des Deutschen bemerkt hatte, sie wäre eine geborene von Zuchopolska aus dem alten Woiwodengeschlechte derer von Zuchopolski aus der Gegend von Grajewo, lud Peter neben sich aufs Sofa, und als sie in der üblichen Pause vor Tisch auf Befragen erfahren hatte, er besäße weder Vater noch Mutter mehr, schlug sie bedauernd die fleischigen Hände ineinander.
„Arrmer Herr Brenitz! Wie tun Sie mir leid, namentlich weggen Ihrer Frau Muter! Nun denn kommen Sie nurr recht oft, auch onne Einladung, und wenn Ihnen zumute ist, Ihr Cherz auszuschüten, hier ist iemer Platz!“ Dabei legte sie ihre Rechte auf den umfangreichen Busen und sah ihn mitleidig an, Fräulein Trudchen aber schüttelte ihm mit einem gefühlvollen Aufleuchten ihrer braunen Augen die Hand.
Und Peter bedankte sich herzlich, versprach, von der gütigen Aufforderung ausgiebigen Gebrauch zu machen. Am liebsten hätte er’s gleich schon getan, denn während des Umkleidens hatte er es als einen schmerzlichen Mangel empfunden, daß er es bisher verabsäumt hatte, sich darüber zu unterrichten, wie ein junger Mann in seiner Lage sich zu der Angebeteten seines Herzens wohl zu verhalten hätte; ob es zum Beispiel angängig wäre, der Baronesse Bergkem am nächsten Morgen einen schönen Blumenstrauß zu schicken, oder ob ihm diese Sendung als eine unziemliche Voreiligkeit ausgelegt werden könnte. Für die Entscheidung solcher und ähnlicher Fragen besaß er ja jetzt, Gott sei Dank, eine Stelle von sicherem Taktgefühl. Nur schien es ihm schicklich, die Erkundung erst nach Tisch vorzunehmen.
Die Köchin erschien in der Tür des Eßzimmers: „Frau Amtsgerichtsrat, es is angerichtet“, und Peter durfte der alten Dame den Arm bieten, während Fräulein Trudchen mit ihrem „lieben Papichen“ den Beschluß machte.
Bei Tisch fragte sie ihr Gegenüber, was er in all diesen langen Tagen seit ihrer ersten Begegnung getrieben hätte, und jetzt wurde Peter mit einem Male beredsam. Von den ungemütlichen Stunden seiner Erkältung sprach er aus naheliegenden Gründen nur wenig. Denn über das Duell hatten alle Beteiligten strengstes Stillschweigen gelobt, um so länger aber verweilte er bei der Schilderung seines Besuches im Schlosse Przygorowen. Er rühmte die gastliche Aufnahme, die er dort gefunden hätte, erzählte von dem Besuche der Familie Hellingen, dem von Brigitte erlegten Rehbocke und dem kleinen Bübchen, das er ins Haus getragen. Alles bunt durcheinander, aber für jeden schärfer Aufmerkenden wand sich ein leuchtender Faden hindurch, an dem sich all seine Schilderungen aufreihten: der Name Brigitte!
Als er endlich aufhörte, war die bis dahin so gemütliche Stimmung entschwunden. Die Frau Rätin bemerkte mit einer gewissen Schärfe, sie legten auf den Verkehr mit den adligen Häusern der Umgegend keinen Wert, wegen allzugroßer Verschiedenheit der geistigen Interessen, und Fräulein Trudchen fragte spitz: „Finden Sie die Baroneß Bergkem wirklich so blendend?“ Nur der Herr Rat hatte ihm freundlich zugehört, und wenn er seine Gattin anblickte, huschte über sein müdes Amtsgesicht ein ironisches Lächeln ... Da wandte Peter mit seiner Antwort sich natürlich an ihn.
„Nun, „blendend“ dürfte wohl kaum der richtige Ausdruck sein für dieses herrliche, mit allen äußeren und inneren Vorzügen geschmückte junge Mädchen! Ihren eigentlichen Reiz, ihr anmutiges und sanftes Wesen entfaltet sie doch erst bei näherer Bekanntschaft.“
„Darüber habe ich leider kein Urteil, Herr Kollege,“ sagte der Herr Amtsgerichtsrat, und mit einem Blicke auf seine Tochter fügte er hinzu: „Na also! Nun spielt noch Euren Chopin, und na ja ...“ Der Rest erstarb in einem unverständlichen Brummen. Fräulein Trudchen aber bat um Entschuldigung, sie hätte mit einem Male Kopfweh bekommen, wäre für Chopin auch heute nicht in der Stimmung.
Da fragte sich Peter, ob er wohl die Ursache dieses plötzlichen Umschlages wäre, und nicht ohne Beschämung mußte er sich eingestehen, daß er sich recht unschicklich benommen hätte, als er vor den Ohren dieses liebenswürdigen, aber häßlichen Mädchens die Schönheit einer anderen pries. Er hätte sie gerne um Verzeihung gebeten, aber die rechten Worte wollten sich nicht einstellen. Schließlich gab er’s auf. Vielleicht bot sich in den nächsten Tagen dazu noch einmal die Gelegenheit.
Von nun an schleppte sich die Unterhaltung nur recht langsam hin, und als der Herr Amtsgerichtsrat erklärte, er hätte am heutigen Tage eine zwar sehr interessante, aber recht anstrengende Sitzung gehabt, hielt Peter die Zeit für gekommen, sich mit kurzem Abschiede zu empfehlen. Fräulein Trudchen leuchtete ihm die Treppe hinab, unten aber, vor dem großen Tor des Amtsgerichts, blieb sie zögernd stehen.
„Ich möchte Ihnen gerne noch etwas sagen, Herr Brenitz, aber Sie werden es mir sicherlich mißdeuten ...“
„Wie sollte ich wohl,“ erwiderte er, „denn ich habe doch gesehen, daß Sie es gut mit mir meinen?“
„Nun denn: Fahren Sie nicht mehr nach Przygorowen hinaus, denn ich vermute nach allem, was ich von Ihnen und auch sonst gehört habe, Sie werden dort eine wenig beneidenswerte Rolle spielen. Vor allem aber trauen Sie einem nicht, der immer so tut, als wenn er sein Herz auf der Zunge trägt! In Wirklichkeit ist er falsch wie Galgenholz.“
„Mein liebes Fräulein,“ sagte Peter erregt, „Sie scheinen mit echt weiblichem Scharfsinn erraten zu haben, was in meinem innersten Herzen vorgeht. Sie werden es mir daher nicht verargen, wenn ich Sie bitte, ganz rückhaltlos zu sprechen?“
Fräulein Trudchen schüttelte den braunen Lockenkopf.
„Das kann ich nicht. Ich will nicht haben, daß es heißt, ich klatsche. Aber weil ich’s mit Ihnen besser meine als mit anderen, sag’ ich Ihnen das eine noch: Ein Keil treibt den anderen. Wenn der erste nicht mehr will, wird manchmal der zweite hinterhergesetzt. Denken Sie darüber nach, und in vier Wochen werden wir uns sprechen, ob ich recht hatte. Gute Nacht, Herr Brenitz!“ Sie blies das Licht aus und huschte eilig die Treppe hinauf.
Peter Brenitz aber schritt nachdenklich durch die dunkeln Gassen seiner Wohnung zu. Ein bitterer Tropfen war in sein junges Glück gefallen, und dem übermütigen Rausche war eine leichte Ernüchterung gefolgt. Wenn man sich’s recht überlegte, konnte die Warnung doch nur den einen Sinn haben, daß er in Przygorowen dazu benutzt werden sollte, als ein scheinbar ernsthafter Bewerber den jungen Grafen von Hellingen zur Eifersucht zu stacheln und zu raschem Entschlusse zu drängen. Wenn man so wollte, konnte man fast jedes Wort, das am Nachmittage gefallen war, in diesem Sinne deuten, von Heinos Bestreben an, ihn im Hause der Gräfinmutter einzuführen, bis zu Brigittes Abschiedsgruß: „Kommen Sie recht bald wieder, lieber Herr Brenitz!“ Und jetzt entsann er sich ganz deutlich, daß der junge Graf dazu ein seltsam finsteres Gesicht gemacht hatte ...
So grübelte und sann er noch einmal den Geschehnissen des Nachmittags nach. Plötzlich aber richtete er sich straff auf, schüttelte mit dem Kopfe und sprach laut vor sich hin: „O nein!“ Wenn ihn hier sein erstes Empfinden trog, hätte er ja an allem verzweifeln müssen, was ein Menschenleben erst lebenswert machte, an Liebe, Freundschaft und Vertrauen! So viel Menschenkenntnis traute er sich denn doch noch zu, um zu unterscheiden, was ehrlich war und was falsch, ein Edelmann vom Schlage des langen Heino Bergkem schmeichelte sich nicht in sein Vertrauen, um ihn hinterlistig zum Werkzeug seiner eigensüchtigen Pläne zu gebrauchen! Und mit einem Male lachte er hell auf, denn er glaubte des Rätsels Lösung gefunden zu haben, nur dünkte es ihn im Augenblicke schnurrig, daß er einem fremden jungen Mädchen ein Gefühl der Zuneigung eingeflößt haben sollte. Aus Eifersucht hatte des Herrn Amtsgerichtsrats Töchterlein ihm die dunkle Warnung angedeihen lassen, aus schnöder Eifersucht, und daher erklärte es sich auch, daß sie in ihren Worten wenig wählerisch gewesen war. „Falsch wie Galgenholz“ hatte sie den langen Heino genannt!
So ging er fröhlich dahin, bis aus dem Lachen plötzlich ein kurzes, wehes Aufschluchzen wurde: War es eigentlich nicht noch viel schnurriger, als selbstverständliche Voraussetzung all seiner Gedanken und Träume eine durch nichts bewiesene Annahme zu stellen? Die Annahme, daß die stolze Brigitte von Bergkem sich in ihn ebenso verliebt haben sollte wie er in sie ...
Er hatte die Absicht gehabt, den Rest des Abends am runden Stammtische der Masovia zu verbringen, weil er hoffte, dort noch vielleicht den aus Przygorowen heimgekehrten Heino zu finden. Jetzt aber ging er an dem dienernden Herrn Kalinski vorüber nach oben und setzte sich still in seinem Schreibzimmer ans offene Fenster.
Ein schwüler Hauch wehte vom Marktplatze her. Lautes Gelächter kam irgendwo aus dem Dunkel und gleich danach lustiges Aufkreischen einer Mädchenstimme. Das Jungvolk des Städtchens trieb vor den Haustüren sein uraltes verliebtes Possenspiel, er aber saß einsam mit wehem Herzen. Er hatte wieder nüchterne Augen bekommen und sah die Welt, wie sie war. Und da hob sich zwischen ihm und der Liebsten eine Mauer so hoch wie der Himmel, und dahinter ein Abgrund tief wie das Meer ... Der Bruder Leichtfuß hätte wohl mit lachendem Munde zum Sprunge angesetzt, er aber fühlte den Stein am Bein und gab das Wagnis auf ... Vielleicht daß es gegangen wäre, wenn die auf der anderen Seite ihm die Hand entgegengestreckt hätte, aber war es nicht töricht, auf ein paar freundliche Worte so verwegene Hoffnungen zu setzen? ...
So saß er im Dunkeln, marterte sein Hirn mit Zweifeln, und die von hämischem Munde gestreute Saat des Mißtrauens schlug in seinem Herzen unausrottbare Wurzeln. Und er beschloß, das Geheimnis seiner Liebe sorgsam zu wahren, am allersorgsamsten aber vor dem Freunde, dem er sich sonst doch zunächst hätte anvertrauen müssen ...
Am anderen Tage traf von Berlin her in einer langen Holzkiste das Geschenk ein, das Peter seinem Freunde für die geleisteten Sekundantendienste schuldete. Im allgemeinen begnügte man sich in solchen Fällen mit irgend einem kleinen Andenken, einer Zigarettendose oder einem Spazierstocke mit silbernem Griffe und eingeschnittener Widmung. Er aber gedachte dem Jägerherzen Heinos eine besondere Freude zu bereiten und hatte von einer Waffenhandlung, an der ihn sein Weg früher zuweilen vorbeiführte, eine kostbare Doppelbüchse verschrieben. Und weil er bei der Bestellung Herrn Meltzer in seiner Eigenschaft eines altgedienten Soldaten und Offiziersburschen als Sachverständigen hinzugezogen hatte, war etwas Ordentliches dabei herausgekommen, ein vortreffliches Gewehr mit gehöriger Schaftlänge und präzisen Schußleistungen. Auf dem festen Lederetui aber prangte inmitten eines kleinen silbernen Schildes die Widmung: „Peter Brenitz seinem lieben Heino von Bergkem zur freundlichen Erinnerung.“
Als sie mittags vom Gericht kamen, bat er seinen Begleiter, einen Augenblick nach oben zu kommen und beim Auspacken einer Kiste behilflich zu sein, die am Morgen früh aus Berlin eingetroffen wäre. Der lange Heino sagte: „Schön, meinetwegen“, als er aber die kostbare Doppelbüchse in Händen hielt und aus der Widmung sah, daß sie für ihn bestimmt war, führte er vor Freude einen wahren Indianertanz auf, umarmte den „edlen Spender“ und erklärte, selbst in seinen verwegensten Träumen hätte er an eine so prächtige Waffe nicht zu denken gewagt.
„Und gleich nach dem Essen fahren wir hinaus, schießen sie im Parke an, und dann geht’s auf den Rehbock. Herrgott, Mensch, Brenitz, haben Sie mir einen Festtag gemacht.“
Peter aber stand dabei und bemühte sich mit einigem Herzklopfen, ein möglichst gleichgültiges Gesicht zu zeigen.
„Muß ich denn dabei sein? Ich hatte heute eigentlich vor, den hiesigen Honoratioren meine pflichtschuldigen Besuche abzustatten. Dem Bürgermeister, dem Apotheker und den Herren der Masovia, die so freundlich waren, sich während meiner Krankheit nach mir umzusehen.“
„Unsinn,“ sagte der lange Heino, „schicken Sie den Stift Louis mit ’ner Handvoll Visitenkarten ’rum, das ist für die Bonzen reichlich gut genug. Sie halten’s für die neueste Berliner Mode und fühlen sich hochgeehrt. Wir beide aber sausen im Auto los, die alte Dame muß uns zum Kaffee Kartoffelflinsen backen lassen, und am Abend essen wir ein frisches Rehleberchen. Ich weiß noch ein Böckchen im grünen Klee, das würdig genug ist, aus dieser Büchse die erste Kugel zu kriegen.“ So sprach er mit leuchtenden Augen, und Peter gab alles scheinbare Widerstreben auf. Er willigte mit Freuden ein.
Leider aber entsprach der Verlauf des Nachmittags nicht ganz dem von Heino aufgestellten fröhlichen Programm! Als Herr Meltzer mit lautem Tuten sein Auto in den weiten Hofraum lenkte, stand nur Frau von Bergkem auf der Freitreppe. Sie erklärte nach der ersten Begrüßung, Brigitte wäre unpäßlich und hätte sich gleich nach dem Essen schon wegen heftiger Kopfschmerzen auf ihr Zimmer zurückgezogen. Der lange Heino tauschte mit seiner Mutter einen flüchtigen Blick und runzelte die Augenbrauen. Peter aber mußte sich zusammennehmen, um seine schmerzliche Enttäuschung hinter einer gleichgültigen Miene zu verbergen. Er sagte höflich: „Bitte, empfehlen Sie mich dem gnädigen Fräulein, ich ließe gute Besserung wünschen,“ und wandte sich an seinen Chauffeur mit der Weisung, den Wagen irgendwo unterzustellen. Wann sie zur Stadt zurückkehren würden, wäre noch unbestimmt.
Frau von Bergkem lud ihn freundlich zum Nähertreten ein, und Heino begab sich nach oben, um, wie er bemerkte: „’mal nachzusehen, was dem Küken eigentlich fehlte.“
Danach saß er mit der alten Dame auf der Parkveranda und sprach von diesem und jenem. Von Zeit zu Zeit jedoch richtete sie ihren sorgenvollen Blick nach der Tür, die zu der großen Halle führte, und Peter hatte das dunkle Gefühl, daß zwischen Brigittes plötzlicher Erkrankung und seiner Person irgendein seltsamer Zusammenhang bestehen müßte. Zwar schien es ihm wie eine Anwandlung von unziemlicher Selbstüberhebung, aber er wurde den Gedanken nicht los, daß hier zwischen gestern und heute sich etwas ereignet hatte, was man ängstlich vor ihm verbarg, und bei dem er selbst eine Rolle spielte ...
Endlich kam Heino wieder, er hatte zu der abendlichen Pirschfahrt schon hohe Stiefel und Jagdrock angezogen. Die Mutter trat ihm mit fragendem Blick entgegen, er aber lachte.
„Hat nichts auf sich, das gnädige Freifräulein wird sich wohl gestern abend an irgend ’was den Magen verdorben haben. Ich hab’ ihr den Puls gefühlt und geraten, sich kalte Umschläge auf den Kopf zu machen. Das wär’ gegen solche Kinderkrankheiten das allerbeste Mittel.“
„Und wird sie aufstehen?“ fragte Frau von Bergkem. Heino jedoch zuckte mit den Achseln.
„Abwarten, Mutti! Ich hab’ ihr von der neuen Doppelbüchse erzählt, die mir Herr Kollege Brenitz dediziert hat. Wenn’s unten im Park zu knallen anfängt, wird sie’s wohl oben nicht aushalten.“
Auch dies sprach er lachend, aber die finstere Falte zwischen seinen Augenbrauen ging nicht fort, und er musterte den Freund mit einem merkwürdigen Blicke. Da fühlte Peter deutlich, daß ihn seine Ahnung nicht getrogen hatte. Auch die Worte, die Heino sprach, schienen eine geheime, nur der Mutter verständliche Bedeutung zu haben, und er beschloß, doppelt auf der Hut zu sein, von all dem, was ihm das Herz bewegte, nichts zu verraten ...
Unten im Parke erschien ein halbwüchsiger Junge mit einem Brette, und Heino stand auf.
„Kommen Sie, Brenitz, wollen die Büchse anschießen. Du aber, Mutti, laß uns einen ordentlichen Kaffee kochen und Kartoffelflinsen backen. Aber gleich ’ne gehörige Portion, denn mir schwant so, wir bekommen heut’ noch Gäste!“ Und als sie den langen Gang zwischen den kurzgeschorenen Tannenhecken hinunterschritten, um hinten im Park eine starke Linde als Kugelfang zu suchen, hob er plötzlich den schmalen Kopf.
„Sagen Sie mal, Kollege, haben Sie eigentlich Schwestern? Nicht? ... Na, dann danken Sie Gott, es ist ein herzlich undankbares Geschäft! Gibt man ihnen Zucker, wollen sie Honig, und na überhaupt, es ist ein Unfug, daß solche kleinen Frauenzimmer ’ne eigene Meinung haben wollen. „Inferiore Spezies“, wie Sie sich gestern ausdrückten, das ist das einzig richtige Wort, und gar nicht erst fragen, sondern einfach kommandieren, das Allerbeste!“
Peter hatte auf den Lippen: „ich hab’ meine Ansicht seit gestern beträchtlich geändert,“ aber er hielt noch rechtzeitig inne. Nur da er doch irgend etwas sagen mußte, bemerkte er, er fühlte sich zu der Entscheidung einer anscheinend so schweren Frage nicht berufen. Aber auch ihm wollte es scheinen, als wenn siebzehnjährige junge Damen im allgemeinen wohl noch nicht die erforderliche Einsicht besäßen, um über die Tragweite ihrer Entschließungen ein zutreffendes Urteil zu haben.
„Großartig,“ sagte der lange Heino mit einem seltsam trockenen Auflachen und schlug seinen Begleiter kräftig auf die Schulter. „Mir ganz aus der Seele gesprochen, und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, sagen Sie’s ihr bei Gelegenheit wieder!“
Danach stellte er das Brett gegen einen dicken Lindenstamm, befestigte es mit einem kräftigen Nagel und schritt quer über eine Rasenfläche und reihenweise nebeneinander liegende Gemüsebeete eine passende Entfernung ab. Peter aber ging getreulich hinter ihm her und zerbrach sich den Kopf, was all die rätselhaften Worte wohl bedeuten mochten. Eine Lösung lag ja klar auf der Hand: Brigitte sollte sich mit dem jungen Grafen von Hellingen verloben und hatte zu Heinos großem Zorn sich anscheinend geweigert. Von da an aber führte der Weg ins Dunkle, denn der Gründe konnte es vielerlei geben. An den jedoch, der seine Seligkeit ausgemacht hätte, wagte er nicht zu denken. Ganz klein und nichtig kam er sich vor in diesem stolzen alten Hause, und was ihm gestern in einer überschwenglichen Stunde als selbstverständliche Fügung eines gütigen Schicksals erschienen war, dünkte ihn heute frevle Vermessenheit ...
Der lange Heino hatte einen schlanken Obstbaum gefunden, der ihm passend zum Anschlage schien, und widmete sich mit Eifer seinem Werke, die Treffsicherheit der Büchse zu erproben. Schuß für Schuß entsandte er in das vor dem breiten Lindenstamme lehnende Brett, und jedesmal, wenn der hinzuspringende Junge anzeigte, daß die Kugel das in der Mitte befestigte Blatt getroffen hatte, nickte er befriedigt. Und Peter sah ihm ernsthaft zu, nur bei jedem Schusse empfand er ein leises Schmerzgefühl, denn die Kugeln gruben sich tief in den Lindenstamm, und ihm schien es, als liefe jedesmal ein wehes Erschauern bis in die letzten Zweige der Krone ...
Ein leichter Schritt erklang hinter ihm, leises Rauschen von Frauengewändern. Er wandte sich um, und das Herz schlug ihm bis in den Hals. Brigitte stand vor ihm, in demselben hellblauen Kleidchen, das sie gestern getragen hatte. Nur ihr liebes Gesichtchen schien ihm verändert. Um die Mundwinkel lag eine kleine trotzige Falte, und in den großen blauen Augen leuchtete ein merkwürdiger Glanz, als wenn sie nach schwerem Kampfe zu einem festen Entschlusse gekommen wäre. Sie schüttelte dem Gaste schweigend die Hand, legte einen Finger auf die Lippen und deutete lächelnd auf den Bruder, der gerade zu neuem Schusse im Anschlage lag. Das konnte heißen, ich will ihn nicht stören, die Bewegung ließ aber noch eine andere Deutung zu: „Sei schweigsam und nimm Dich in acht!“ ... Das Blut drang ihm jählings zu Kopfe, und er mußte nach dem Gartenstuhle greifen, auf dem die Patronen lagen, um sich einen festen Halt zu geben ...
Der Schuß hatte wieder gesessen. Der hinzuspringende Junge hob das durchlöcherte Lindenblatt in die Höhe, und Heino wandte lachend den Kopf zurück.
„Na, Prinzeßlein auf der Erbse, wieder gesund? Und jetzt komm mal her, sieh Dir das Flintchen an! Zierlich und fein wie’n junges Mädchen, aber schießen tut’s wie der Deuwel. Mit beiden Läufen auf hundert Schritte Fleck. Willst es auch mal probieren?“
Da kam sie eifrig näher, wog das Gewehr prüfend in den Händen, und nachdem sie den Anschlag versucht hatte, trat sie in den Stand. Schoß mit geröteten Wangen zweimal hintereinander das Blatt vom Brette, lud von neuem und wandte sich mit blitzendem Auge um. Ein Krähenschwarm kam vom nahen Walde über die Parkwipfel gezogen, sie hob die Linke und deutete in die Höhe.
„Da die Erste! Paß auf!“
„Unsinn,“ lachte Heino, „es gibt nur ein Loch in der Luft!“
„Wetten, daß nicht?“
Der Schaft schmiegte sich an die Wange, aus der Mündung der Büchse brach ein heller Feuerstrahl. Der Vogel überschlug sich, ein Ende weit riß ihn der Schuß zur Seite, dann fiel er wie ein Stein herab, schlug dumpf auf den Boden.
„Donnerwetter noch mal, Mädel,“ sagte der lange Heino mit ehrlicher Bewunderung, und Brigitte gab ihm lachend das Gewehr zurück: „Da, kleiner Bruder, mach’s nach, wenn Du kannst!“
Peter Brenitz aber biß sich schweigend auf die Lippen. Der Narr, der er gewesen war, sich von seiner erregten Einbildungskraft allerhand törichte Trugbilder vorspiegeln zu lassen! Ein junges Mädchen, das an einem tiefen Seelenkummer litt, benahm sich wohl anders als die blonde Brigitte ...
Als sie zu der Parkveranda zurückkehrten, erhob sich von dem gedeckten Kaffeetische der große Hanns aus Hellingenau. Er wäre zufällig die Grenze entlang geritten und hätte einmal nachsehen wollen, was das viele Geschieße im Przygorower Parke bedeutete. Heino aber schlug ihn lachend auf die Schulter.
„Mensch, red’ Dich nicht unnütz aus, Du wirst Dich zu Hause gelangweilt haben!“ Und Brigitte fügte fröhlich hinzu: „Oder er hat mit seiner langen Nase gewittert, daß es hier heute ’was Feines gibt. Kartoffelflinsen mit Zucker und Kaffee!“
Danach lachten sie alle drei, sogar über das sorgenvolle Antlitz der Frau von Bergkem flog ein Lächeln, und jetzt wußte Peter ganz genau, daß er ein eitler Tor gewesen war, wenn er geglaubt hatte, diese harmlos heiteren Menschen hätten allerhand dunkle Geheimnisse vor ihm zu verbergen. Geheimnisse, in denen seine Persönlichkeit eine wichtige Rolle spielte ...
Und mit einem Male kam er sich ganz fremd vor in diesem Kreise, wie ein lästiger Eindringling, der am besten täte, sich still wieder zu entfernen. Am liebsten wäre er gleich aufgestanden, um ins Städtchen zurückzukehren, aber er fand keinen passenden Vorwand. Und es half wenig, daß die blonde Brigitte mit rührender Fürsorge auf sein leibliches Wohlergehen bedacht war, ihm eigenhändig den Teller mit duftenden Kartoffelpfannkuchen füllte und ihn, wie gestern, zu reichlichem Zulangen nötigte. Sie lachte und scherzte mit ihm, war von geradezu übermütiger Ausgelassenheit, ihm aber tat ihre Lustigkeit weh, denn sie schien ihm nur eine neue Bestätigung dessen, was ihm längst schon zur traurigen Gewißheit geworden war. Wenn sie nur eine Spur von Empfindung für all die Schmerzen gehabt hätte, die seine Seele durchwühlten, konnte sie unmöglich so rücksichtslos heiter sein! Oder genau besehen und mit dem richtigen Worte genannt: reichlich kindisch und albern ... Mit des Amtsgerichtsrats Trudchen neckte sie ihn, kopierte drollig deren schwärmerischen Augenaufschlag und fragte, ob er beim Chopinspielen sein Herz verloren hätte.
Am liebsten hätte er geantwortet: „mein gnädiges Fräulein, ich bin ein viel zu ernsthafter Mensch, um an solchen Späßen Gefallen zu finden,“ aber um Himmels willen sich nur nichts anmerken lassen, hier womöglich gar eine unglückliche Miene aufstecken, um hinterher verspottet und ausgelacht zu werden! Die schwere Kunst der Selbstbeherrschung hatte er ja schon in so mancher herben Enttäuschung gelernt, also vorwärts los, mit der gleichen Waffe geantwortet!
Und er legte die Hand auf die Brust, verneigte sich mit übertriebener Galanterie: „Mein gnädiges Fräulein, die Höflichkeit würde mir ja gebieten, jetzt zu sagen, neben Ihrem holden Bilde hätte hier kein anderes mehr Platz, aber, wenn ich der Wahrheit die Ehre geben soll, muß ich offen bekennen, daß Fräulein Trudchen in der Tat auf mich einen unauslöschlichen Eindruck gemacht hat!“
Und er schilderte mit komischem Pathos ihrer „braunen Locken Pracht“, die „lieblich nach einwärts geschwungene Nase mit den reizvollen Pünktchen der Sommersprossen“. Wie ein Bajazzo kam er sich vor, der mit wundem Herzen seine Possen trieb, aber nur zu gut gelang es ihm, alle Welt darüber zu täuschen, wie es in seinem Innern aussah, auch die blonde Brigitte ...
Und ganz allmählich gingen zwei Menschen wieder auseinander, die einen Augenblick lang drauf und dran gewesen waren, sich über alle trennenden Schranken hinweg die Hand zu reichen ... Ein großer dummer Junge, dem das Blut zu schwer in den Adern lief, und ein kleines Prinzeßlein, das vielleicht selbst nicht wußte, was es eigentlich wollte, und mit einem Male nach ein paar Stunden des Ueberschwangs eine beschämende Ernüchterung empfand. Gestern hatte er ausgesehen wie ein Befreier, der gekommen war, sie aus der Enge der heimischen Verhältnisse in die weite Welt hinauszuführen, in eine Welt mit neuen und nie gesehenen Wundern, und heute nahm er sich aus wie alle anderen ...
Der Diener trat in die Tür: „Herr Baron, der Pirschwagen ist vorgefahren.“
Brigitte stand auf und strich sich eine widerspenstige kleine Locke aus der Stirn.
„Kommen Sie, Herr Brenitz, Sie sollen neben mir sitzen und weiter von Fräulein Trudchen schwärmen!“ Sie sagte es lachend, aber ein leiser Ton des Aergers mischte sich ein.
Und Peter verneigte sich wieder mit der Hand auf der Brust: „Aber mit Wonne, mein gnädigstes Fräulein!“
Im Aufrichten sah er, wie das starkknochige Gesicht des jungen Grafen sich jählings verfinsterte. Da hätte er am liebsten gesagt: „Geh’, gräm’ Dich nicht, es ist doch bloß alles Komödie,“ aber er begnügte sich mit einem Achselzucken und schritt zur Tür hinaus.
Draußen neben dem leichtgebauten Wagen befestigte Brigitte das grüne Jagdhütchen, das ihr eine Kammerzofe reichte, auf dem vollen Haar, schlüpfte in einen bereit gehaltenen Mantel und zog langsam die Fahrhandschuhe an. Sie wartete auf irgendein Wort, das die Stimmung von gestern wiederbringen sollte, aber das Wort blieb ungesprochen. Peter Brenitz stand vor ihr, tausend sehnsüchtige Gefühle rangen in seinem Herzen nach Ausdruck, eine unklare Ahnung sagte ihm: „das jetzt ist der entscheidende Augenblick, nimm ihn wahr und halt ihn fest,“ aber er war mit einem Male wieder scheu und befangen. Und als er endlich den Mund öffnete, gab es eine glatte Phrase. Ob das Wetter sich wohl bis zum Abend halten würde, fragte er, denn hinter den Scheunen zöge eine dunkle Wolkenwand herauf.
„Möglich,“ erwiderte Fräulein Brigitte kurz angebunden, schwang sich leicht auf den Kutschsitz und versammelte die Zügel in ihrer nervigen kleinen Hand.
In der dämmerigen Halle aber faßte der große Hanns aus Hellingenau den Herrn von Bergkem mit festem Griffe am Arm.
„Du, Heino?!“
„Na, was denn?“
„Wenn das Rumgezerge noch lange so weitergeht, brech’ ich diesem schmachtlappigen Jüngling aus Berlin alle Knochen im Leibe entzwei!“
In Heinos Augen blitzte es auf, aber er neigte nur kühl den Kopf.
„Entschuldige, lieber Hanns, Herr Brenitz ist mein Gast. Und ich wüßte nicht, daß er Dir irgendwie zu nahe getreten sein sollte.“
„Unsinn, Du verstehst mich ganz gut. Der Kerl hat die Frechheit und macht Brigitte den Hof!“
Heino blieb stehen und lachte kurz auf.
„Was Du sagst?! Aber, ganz unter uns, was geht’s Dich an? Wenn wir — ich setze ’mal den Fall — diese stille Bewerbung nicht ganz ungern sehen sollten, wer gibt Dir das Recht, hier so ungeschlacht eingreifen zu wollen?“
Die Worte waren geschickt gewählt und verfehlten nicht ihre Wirkung. Der große Hanns blieb stehen und schlug mit der mächtigen Faust an die Brust:
„Heino, wahrhaftigen Gott, ich mein’ es ehrlich, wenn ich’s auch nicht immer so geläufig von mir geben kann! Aber, glaub’ mir, es lag so allerhand drum ’rum, daß ich bisher noch nicht hier mit offenem Visier antreten konnte!“
„Ich denke doch, Du bist majorenn und seit dem Tode Deines Herrn Papas der Chef Deiner Familie?!“
„Das war das rechte Wort!“ Der junge Graf Hellingen richtete sich auf und streckte die Rechte aus. „Also Handschlag! Morgen nachmittag fährt meine alte Dame hier vierelang in den Hof mit der Glaskutsche, und ich hoffe, sie wird von Deinen Damen mit dem nötigen Entgegenkommen empfangen werden.“
Heino schlug mit einem Lächeln ein.
„Kommt ganz drauf an, was die gnädigste Frau Gräfinmutter zu sagen haben! Inzwischen aber dürfte es sich vielleicht empfehlen, daß auch der Herr Graf sich in dieser Angelegenheit ein bißchen persönlich bemühen. Nicht bloß so: „hier steh’ ich, der Burggraf Hanns von Hellingen auf Hellingenau, und nun treten Sie mal an, Freifräulein Brigitte,“ sondern den Galanteriedegen eingesteckt und fein Komplimente gedrechselt: junge Mädels haben manchmal Flausen im Kopf und wollen erobert sein! Im übrigen aber brauch’ ich Dir wohl kaum zu sagen, daß Du in meinem Hause willkommen bist, also los und Weidmannsheil!“
„Weidmannsdank, Schwager Heino,“ erwiderte der Graf von Hellingen und schüttelte dem Freiherrn von Bergkem die Hand. — — — —
Am nächsten Tage aber, als es wieder auf den Abend ging, lag einer auf dem schmalen Wiesenrain neben dem Roggenfeld, krampfte die Hände in den weichen Grund und bäumte sich in lautlosem Weh. Ganz still hatte er sich aus der weiten Halle zurückgeschlichen. Den schmalen Pfad zwischen wogenden Kornhalmen entlang, den sie damals gewandert waren. Und an dem Flecke, an dem er die blonde Brigitte zum ersten Male gesehen hatte, übermannte ihn jählings der Schmerz, fiel ihm lähmend in die Glieder, so daß er sich kraftlos niedertun mußte, wie das armselige Stück Wild, dem ihr Weidwerken gegolten hatte ...
Am frühen Nachmittage hatte er sich aufgemacht, um endlich eine Entscheidung zu haben in all seiner Not und Pein, den wohlbekannten Weg entlang am Ufer des Stradauner Sees, über die kahlen Hügel mit den dürftigen Wacholderbüschen, durch hochstämmigen Tannenwald, bis endlich hinter dunkelgrünen Lindenwipfeln der verwitterte Turm des alten Hauses aufragte. Je näher er aber seinem Ziele kam, desto mehr verlangsamte sich sein Schritt. All die Skrupel und Zweifel, mit denen er in schlafloser Nacht gerungen hatte, drückten ihm die Schulter und hingen sich an seinen Fuß, eigentlich war die Entscheidung ja schon gestern gefallen! Als die blonde Brigitte ihm auf der Freitreppe die kühle Hand reichte: „Gute Nacht, Herr Brenitz!“ Tags zuvor die Abschiedsworte hatten anders gelautet ...
Er allein trug sicherlich die Schuld, irgend etwas hatte er bei ihr verfehlt, aber vielleicht war’s mit einem abbittenden Worte wieder gut zu machen, auch der Himmel verzieh ja einem reumütigen Sünder ... Oder ob er erst einmal mit der gütigen alten Dame sprach, ihr sein ganzes Herz ausschüttete, um aus ihren Händen sein Urteil zu empfangen? Was er eigentlich wollte, wußte er vielleicht selbst nicht, nur eine übermächtige Sehnsucht lenkte seinen Schritt, ein dumpfer Trieb, in der Nähe der Einzigen zu sein, die sein alles, sein Leben, sein Schicksal war ...
Der weite Hofraum lag wie ausgestorben, kein Mensch hielt ihn auf, als er in die weite Halle trat, und mit klopfendem Herzen blieb er stehen, denn irgend eine Entschuldigung mußte er sich doch ausdenken für sein ungeladenes Erscheinen ...
Draußen auf der Parkveranda waren Gäste, dieselben, die der lange Heino noch vor wenigen Tagen so lustig verspottet hatte. Jetzt aber stand er mit feierlichem Gesichte neben seiner Schwester, schüttelte dem, den er scherzend „das gräfliche Elefantenküken“ genannt hatte, die Hand und wandte sich mit einem aufleuchtenden Blicke zur Mutter. Der große Hanns aus Hellingenau aber strahlte übers ganze Gesicht, reckte die breite Hand nach Brigittes zarter Schulter und küßte sie mitten auf den roten Mund ...
Und Peter Brenitz stand hinter dem Fenster wie ein Zaungast, nickte bloß und sagte: recht so! Die breite Hand griff auch nach seinem Herzen, preßte es langsam zusammen, bis der letzte Blutstropfen verspritzte und alles taub und leer geworden war ...
Einen Augenblick lang wollte es ihm scheinen, als flöge über Brigittes zarte Schultern unter dem Griffe der breiten Hand ein jäher Schauer des Widerwillens, schon hob er den Fuß, um mit lautem „Halt ein“ dazwischen zu springen, aber seine kurzsichtigen Augen hatten ihm wieder mal einen Streich gespielt. Die blonde Brigitte bog lächelnd den Kopf in den Nacken, bot willig dem Verlobten den kirschroten Mund ...
Da blickte Peter mit wehem Lächeln zu einem Bilde auf, das zwischen vielen anderen in der weiten Halle hing. Einen aufrechten Herrn stellte es vor in der Uniform des zweiten Garderegiments mit dem Eisernen Kreuz auf der Brust, dem gleichen schwarzen Kreuze, das auch fern in Berlin ein anderes Bildnis schmückte. Und wie hatten die Worte gelautet, die an dieser Stelle vor ein paar kurzen Tagen gesprochen worden waren? „Der da dort oben, mein lieber Herr Brenitz, hat Ihnen hier einen ganz besonderen Empfang bereitet ...“ Ein leises Aufstöhnen kam aus seiner Brust, er wandte den Fuß und ging still den Weg zurück, den er gekommen war ...
Drei Tage später saß er wieder in Berlin, mit kurzem Urlaube nur vorläufig, „in dringenden Familienangelegenheiten,“ aber der Arm seines einflußreichen Oheims reichte weit. Vielleicht gelang es mit seiner Hilfe, den Urlaub in eine Versetzung zu wandeln. Irgend wohin, nur möglichst weit fort von der Stätte, an der er einen kurzen, jäh abgerissenen Glückstraum geträumt hatte ...
Und der alte Herr schien gar nicht erstaunt zu sein, ihn nach so kurzer Frist schon wiederzusehen. Er empfing ihn freundlich, hörte aber ein wenig zerstreut zu. Vielleicht, weil ihn eigene Sorgen beschäftigten, vielleicht aber auch, weil er längst schon aus zuverlässiger Berichterstattung die Erlebnisse des Neffen kennen mochte. Die Firma Samuel Brenitz sel. Witwe Söhne hatte ihren Sitz zwar in Berlin, ihre letzten Verästelungen jedoch liefen weit in die Welt hinaus. In das entlegenste Nest deutscher Erde ebenso gut wie nach London, Paris, New York und Shanghai; der alte Herr im kleinen Kontor der Behrenstraße brauchte nur auf einen Knopf zu drücken und eine vieltausendarmige, geheimnisvolle Maschinerie setzte sich in Bewegung, um ihm in gemessener Frist die gewünschte Auskunft zu bringen ..
„So so, mein Söhnchen, das Klima bekommt Dir nicht da unten in Ostpreußen? Ja, es weht dort manchmal ein rauher Wind, na, und wie ist’s nun? Möchtest Du bei der Gelegenheit nicht die Juristerei gleich ganz an den Nagel hängen? Da drüben an dem Pulte war mal der Platz Deines Vaters. Der Stuhl ist noch immer frei und wartet auf Dich.“
„Lieber Onkel,“ sagte Peter, „meine Unpäßlichkeit hat doch nichts mit meinem Berufe zu tun!“
„So, nichts? ... Schade! Die geborene Guggenheimer setzt mir so zu, daß sie mich wohl bald unter der Erde haben wird, und wenn ich dann da oben, fein in Oel, neben all den Brenitzen hänge, die seit Friedrich Wilhelm dem Zweiten hier für die Firma gearbeitet haben, hätte ich gerne hier wieder auf einen Brenitz gesehen ... na, ist gut!“
Der alte Geheimrat fuhr mit der gepflegten Hand leicht über die Augen und richtete sich lebhaft auf.
„Weißt Du das Neueste, was sie ausgeheckt hatte, um sich so recht in ihrem schwiegermütterlichen Glanze sonnen zu können? Ein großes Verlobungsdiner im Kaiserhof, zu dem von überallher alle irgendwie auffindbaren Krotthelme geladen waren. Es war sehr fein, sogar ein richtiggehender Hofmarschall wurde in den Zeitungen „unter den Anwesenden bemerkt“. Mich hatte die geborene Guggenheimer auch eingeladen, aber ich glänzte durch Abwesenheit.“
„Aber, Onkel,“ versetzte Peter vorwurfsvoll, „es handelt sich bei dem allen doch um Dein Kind!“
Der Geheimrat sah ihn mit seinen klugen Augen an und lächelte schmerzlich.
„Mein Kind? ... Mein Kind werde ich wiederhaben, wenn die Scheidung ausgesprochen ist! In vier Wochen ist die Hochzeit, da kann ich’s mir ungefähr ausrechnen. Und anderthalb Millionen von dem Guggenheimerschen Geld sind schon weg, ein Teil für die Schulden, der größere aber für das Rittergut im Kreise Templin, das ich meinem Herrn Schwiegersohn verkauft habe. Keine Ahnung hat der Kerl von der Landwirtschaft, denn er hat mir mehr als zweimalhunderttausend Mark über den reellen Wert gezahlt.“
„Wie,“ fragte Peter erstaunt, „Du hättest Deinem zukünftigen Schwiegersohn —?“
Und der Geheimrat Brenitz unterbrach ihn schmunzelnd. „Natürlich! Oder hätte ich bei dem Geschäft vielleicht einen anderen verdienen lassen sollen? Die geborene Guggenheimer hat selbstverständlich keine Ahnung, daß ich das Objekt an der Hand hatte, aber sie wird mir für die geretteten 200000 Mark noch mal von Herzen danken!“
So plauderte der alte Herr mit ingrimmigem Humor von den Sorgen, die sein Herz erfüllten, bis Peter ihn mit leiser Mahnung an die Erfüllung seiner Bitte erinnerte. Da sagte er: „Ja, richtig, fast hätte ich’s vergessen! Also schreib nur Dein Gesuch an die zuständige Stelle. Ich werde mich darum bemühen, daß es auch bewilligt wird. Und wo möchtest Du am liebsten hin? Nach Berlin?“
„Wenn’s möglich wäre, gerne,“ erwiderte Peter.
„Möglich ist alles, mein Sohn, man muß nur vor die rechte Schmiede gehen. Und mir wär’s auch das allerliebste. Man hat sich doch bei der Hand, wenn was passiert, oder wenn einen der Zorn überkommt, und man braucht einen vernünftigen Zuhörer, um sich Luft zu machen“ ...
Damit reichte der alte Herr seinem Neffen die Hand; als Peter aber schon in der Tür stand, winkte er ihn noch einmal zurück, denn er hatte noch eine kleine Bosheit auf dem Herzen.
„Die geborene Guggenheimer gibt nächsten Donnerstag in meiner Villa in Wannsee einen bal champêtre. Ich sag’s Dir bloß, falls Du vielleicht Lust dazu haben solltest, denn ich geh’ nicht hin. Die Gesellschaft ist mir zu antisemitisch!“
Damit war Peter entlassen und ging langsam nach dem alten Hause in der Wilhelmstraße zurück, das er, kaum mehr als zehn Tage war es her, verlassen hatte, und das ihm nun wieder, wenn nicht alle Zeichen trogen, zur dauernden Heimat werden sollte.
Ein Gefühl des Geborgenseins überkam ihn in den altvertrauten Räumen, in denen jedes Stück seine besondere Geschichte hatte, und wenn er in dem breiten Lehnsessel an seinem Schreibtische saß, drüben an der Wand die Bilder der Eltern, war ihm zumute, als wäre er nie fort gewesen. Die Ereignisse dieser letzten Tage waren nicht mehr als ein wüster Traum, der mit dem Erwachen sein Ende fand, bis ein jäh einsetzender Schmerz in der Brust ihn wieder eines Besseren belehrte. Dann litt er stets unter einer seltsamen Einbildung. Eine riesige Faust griff nach seinem Herzen, preßte es langsam zusammen, bis der letzte Blutstropfen entwichen war ..
Und wenn er, ein wenig ruhiger geworden, an diese letzten Tage zurückdachte, wunderte er sich darüber, wie gut es ihm gelungen war, alle Welt darüber zu täuschen, wie es in ihm aussah. Am nächsten Vormittage nach seinem letzten heimlichen Besuche in Przygorowen traf er mit dem langen Heino auf dem Gericht zusammen und erfuhr als neueste Neuigkeit, was er tags zuvor mit eigenen Augen gesehen hatte, die Verlobung Brigittes mit dem jungen Grafen von Hellingen.
Da bekam er’s fertig, mit einem Lächeln seinen Glückwunsch auszusprechen und zu bemerken, etwas ähnliches hätte ihm schon bei seinem ersten Besuche geahnt. Leider aber müßte er sich’s versagen, persönlich zur Gratulation zu erscheinen, denn eine dringliche Familienangelegenheit riefe ihn für einige Tage nach Berlin.
„Ach,“ sagte der lange Heino, „wie schade! Ich hatte mich schon so darauf gefreut, Sie heute nachmittag mit hinauszunehmen, denn mein Schwager Hanns hat eigentlich ein Anliegen an Sie. Er wollte sich bei Ihnen entschuldigen, weil er nämlich noch vorgestern die Absicht hatte, Ihnen aus Eifersucht ans Leder zu gehen!“
Peter lachte hell auf: „Aus Eifersucht auf mich?“ Und Heino stimmte fröhlich ein:
„Ja, denken Sie sich bloß, wie ulkig! Aber ich gemeiner Kerl ließ ihn in dem Glauben, denn er war in der letzten Zeit in seiner Werbung ein bißchen lasch geworden, meine Schwester grämte sich schon.“
„So, so,“ erwiderte Peter. „Ihr Fräulein Schwester grämte sich. Nun, dann bin ich wohl der ganz unschuldige Stifter ihres Glückes geworden?“
Und der lange Heino hieb ihn lustig auf die Schulter: „Unschuldig, das ist das rechte Wort! Na, das werden wir nach Ihrer Rückkehr gehörig begießen.“ Sie schüttelten sich die Hände, und Peter machte sich an die Abfassung seines Urlaubsgesuches. Mit der festen Ueberzeugung, daß er ein rechter Narr gewesen war, als er noch an allerhand dunkle Machenschaften glaubte, die sich um seine Persönlichkeit woben. Der lange Heino stand vollkommen entschuldigt da, und auch für die paar kurzen Augenblicke auf der Diele der armseligen Tagelöhnerwohnung, auf denen all seine verwegenen Hoffnungen emporgeschlagen waren, stellte sich jetzt eine angemessene und zwanglose Erklärung ein. Die blonde Brigitte grämte sich, also war es da ein Wunder, wenn sie den trägen Bewerber zu ärgern und durch ein wenig Eifersucht anzustacheln gedachte? ...
So entschuldigte er, wie es seine sanfte Art war, die Handlungen der anderen vor dem eigenen Gewissen, putzte mit verstehendem Erklären an ihrem Bilde herum, bis es in glänzender Reinheit erstrahlte. Er selbst aber erhoffte die Genesung von einem raschen Ortswechsel. Wenn nichts mehr um ihn war, was ihn an die törichten Träume erinnerte, würde es ihm leichter werden, zu vergessen ...
Und im allerletzten Grunde war es doch eigentlich eine recht alltägliche Geschichte, die ihm da passiert war. Er hatte sich in eine junge Dame verliebt, ohne zu wissen, daß sie halb und halb schon einem anderen versprochen war. Kein Mensch auf der Welt, am allerwenigsten aber die zukünftige Gräfin Hellingen, hatte eine Ahnung, daß der Doktor juris und Referendarius Peter Brenitz an einem Juninachmittag einen törichten Dummejungentraum geträumt hatte! Brigitte Edle und Freiin von Bergkem-Przygorowski aus dem Hause Bergheim und der jüdische Referendar Peter Brenitz ... Zum Lachen war es wahrhaftig, wenn es nur nicht so unsäglich wehe getan hätte!
Aber auch dagegen gab es ein Mittel. Man nahm sein Herz in beide Hände, schrie es gröblich an, und wenn es gehörig eingeschüchtert war, bewies man ihm mit klaren Vernunftgründen, wie albern es wäre und ganz und gar unwürdig, sich nun für alle Zeiten so töricht zu benehmen, wie damals an jenem Juninachmittag. Das half dann wohl für ein kurzes Weilchen. Ehe man sich aber recht versah, war es auf und davon, flog den altbekannten Weg entlang, der am schilfumrahmten Seeufer führte, über kahle Hügel und schweigenden Tannenwald bis zu dem schmalen Wiesenrain neben einem fahlgrünen, schütternen Roggenschlag. Und dort stand eine, das Gewehr unter dem Arm ... Frei hob sich der prächtige Kopf aus den Schultern, und die blauen Augen leuchteten in stolzem Triumph ... Da gab man als der Klügere natürlich nach und flog mit, vergaß alle törichte Vernunft und hob ein seliges Träumen an. Wie herrlich alles hätte kommen können, wenn es nicht eben anders gekommen wäre ...
Aber die Tage kamen und gingen, ganz allmählich wurden diese Ausflüge seltener, zu Zeiten gab es lange Stunden, in denen er sich einbildete, er wäre genesen: die Arbeit hatte sich als ein gar kräftiges Heilmittel erwiesen! Wenn er vormittags sein Pensum auf dem Gerichte abgesessen hatte und nachmittags all die vielfältigen Geschäfte der von seinem Vater begründeten Wohltätigkeitsanstalten besorgt, die ihm als ein selbstverständliches Erbteil zugefallen waren, sank er abends müde ins Bett, fand keine Zeit mehr zum Grübeln und Denken und Unglücklichsein. Im ewigen Einerlei der Tage aber fingen die Bilder der Erinnerung an zu verblassen, und ganz in der Ferne, wenn man sich einmal daran machte, den Blick in die Zukunft zu schicken, tauchten neue Bilder auf. Ein unscheinbares Mädchen ohne sonderliche Vorzüge, das aber von dem Schicksal der älteren Schwester gelernt zu haben schien, still und ernsthaft geworden war. Tausend vernünftige Erwägungen drängten zu dieser Verbindung, dann aber kamen wieder Zeiten, in denen das dumme Herz sich törichter gebärdete denn je, tage- und nächtelang ohne Urlaub abwesend war und um einen schmalen Wiesenrain gaukelte oder um ein altes Gemäuer mit ragendem Wartturm hinter grünenden Lindenwipfeln ... Sei es, daß an Herrn Meltzer ein Brief gekommen war mit dem Poststempel Stradaunen, oder daß sein Herr im Gewühl der Straßen einem jungen Mädchen begegnet war, das in Erscheinung und Haltung der blonden Brigitte glich ... Dann empfand er mitten gegen die Brust einen dumpfen Schlag, das Blut lief ihm heiß durch die Adern, und eine innere Stimme raunte ihm zu, daß die Stradauner Zeiten noch lange nicht abgetan und vergangen waren — — — — —
Es ging schon auf zwei Uhr nach Mitternacht, sie kamen aus dem Klub von 1898 und schritten quer über die Linden der stillen Wilhelmstraße zu. Das Wetter war umgeschlagen, der linde Vorfrühlingsabend hatte sich plötzlich wieder in kalten Winter gewandelt.
Vor einem alten Hause mit hohem Torbogen blieb Peter Brenitz stehen und zog den Schlüssel aus der Tasche. In sein schmales Gesicht trat ein eigentümlicher Ausdruck, halb Mitleid, halb zornige Verachtung.
„Na, gute Nacht, Kollege Bergkem, ich bin daheim! Und was nützt alles Reden? Morgen abend schießen Sie sich ja doch ’ne Kugel vor den Kopf!“
„Donnerwetter noch mal, Brenitz“ — der andere fuhr jählings zusammen und schleuderte seine Zigarette in weitem Bogen auf die Straße — „was fällt Ihnen ein? Sie waren doch früher nicht so bösartig! Sind Sie vielleicht plötzlich ein bißchen verrückt geworden?“
„Durchaus nicht! Sie haben heute Ihr letztes Geld verspielt. Morgen fallen Sie glatt im Examen durch und am Abend, schätze ich, werden Sie aus diesen beiden Prämissen die Schlußfolgerung ziehen!“
„Und das sagen Sie mir so brutal ins Gesicht?“
„Brutal?“ Peter kniff schmerzlich die Lippen zusammen. „Brutal dürfte nicht ganz der richtige Ausdruck sein. Vielleicht ist es Trauer und Zorn, daß ein Mensch von Ihren glänzenden Fähigkeiten und Anlagen rettungslos einem so unrühmlichen Ende zusteuert.“
Der lange Heino hatte seine Fassung wiedergefunden und lachte spöttisch auf:
„Ach nee! Dann hätte ich also Ihre düstere Prophezeiung gewissermaßen als Ausdruck einer übertriebenen Wertschätzung aufzufassen? Aber beruhigen Sie sich, gutes Peterlein, es stimmt nicht! Erstens verfüge ich noch immer über etliche Reserven auf der Deutschen Bank — entschuldigen Sie, daß ich mit meinen paar Däusern zur Konkurrenz gegangen bin, ja — und zweitens: Was wollen Sie wetten, daß morgen der Herr Präses der Prüfungskommission sein Tintenfaß ergreift, um auf meine stupenden Kenntnisse einen Hochachtungssalamander zu reiben?“
„Heino!“ Peter Brenitz war ganz entrüstet — „das ist doch geradezu frivol! Sie haben in den letzten Monaten ja kaum ein Buch aufgemacht!“
„Woher wissen Sie das so genau? Vielleicht habe ich zuweilen herzhaft gebüffelt. Das heißt, was ich so büffeln nenne: Der eine braucht mehr und der andere weniger, um im entscheidenden Augenblick die hochwohllöbliche Prüfungskommission in Embarras zu versetzen. Im übrigen aber trinken Sie das nächste Mal nicht wieder so viel Selterswasser, wenn Sie mir beim Kartenspielen zusehen! Es bekommt Ihnen nicht, Sie sehen hinterher Männerchen!“
Er lüftete lässig den glänzenden Zylinderhut über dem korrekt gezogenen Scheitel und wollte sich zum Gehen wenden, der andere aber hielt ihn ängstlich am Rockärmel fest.
„Heino?“
„Na, was denn noch?“
„Wollen Sie mir wenigstens versprechen, morgen nachmittag, wie es auch ausgeht, zu mir zu kommen?“
Der lange Heino war wieder stehen geblieben und lachte auf. Aber es war nicht mehr das harmlos lustige Lachen, wie in alten Zeiten ...
„Sagen Sie mal, Kleiner, das Kinderfrauspielen können Sie wohl immer noch nicht lassen? Und womit verdiene ich eigentlich diese rührende Fürsorge? Das bißchen Hedderei mit den Herren der Masovia — Gott hab’ sie selig — die Bonzen, und der Provisor trägt’s Ihnen, glaub’ ich, heut’ noch nach, daß Sie ihn durch Ihre plötzliche Versetzung um die feierliche Abschiedsrede gebracht haben — ja also, das war alles doch so unbeträchtlich?! Und Sie haben sich doch in so festlicher Weise revanchiert, mit der prachtvollen Doppelbüchse, mit der jetzt Brigitte daheim die Przygorower Böcke schießt?!“ ..
„Weil ... weil ...“ Peter griff nach seinem Klemmer und geriet vor plötzlicher Verlegenheit fast ins Stottern, „also weil ich mir persönlich die schwersten Vorwürfe mache. Hätte ich Sie nicht in meinen Klub eingeführt, damals nach unserem Wiedersehen und dem heftigen Frühschoppen, hätten Sie sich nicht so maßlos angeschossen. Wenn ich alles zusammenrechne, haben Sie in diesen paar Monaten über vierzigtausend Mark verloren, und so weit ich Ihre Verhältnisse zu beurteilen vermag, übersteigt dieser Betrag in jeder Hinsicht die Ihnen gezogenen Grenzen!“
Der andere hob spöttisch die schmale Oberlippe mit dem modisch gestutzten Schnurrbärtchen.
„Er steigt sogar über den alten Turm auf meiner heimatlichen Klitsche. Aber haben Sie Angst, ich mache Sie vielleicht im Sinne des mit Recht so beliebten Bürgerlichen Gesetzbuches ersatzpflichtig?“
„Herr von Bergkem?!“ Peter schrie fast auf, in sein Gesicht trat eine dunkle Röte. Und es dauerte eine ganze Weile, bis er wieder ruhig sprechen konnte.
„Sie hatten vorhin ganz recht, weshalb zerbreche ich mir eigentlich Ihren Kopf? Gewarnt habe ich Sie oft genug. Wer es nicht aushalten kann, soll nicht in einer Pokerpartie mitspielen, bei der man auf einen einzigen Sitz ein kleines Vermögen verlieren kann!“
Heino von Bergkem machte scheinbar ein ernstes Gesicht.
„Worte der Weisheit, edler Jüngling, und wahrhaftig, man soll es nicht! Vor allem aber nicht, wenn man, wie der ergebenst Unterfertigte, permanent schlechte Karten kriegt. Aber da unsere philosophischen Betrachtungen über die mangelhaften Einrichtungen der irdischen Weltordnung — ich finde es z. B. empörend, daß man beim Kartenspielen zuweilen auch verlieren kann — ja also, da unsere Betrachtungen doch irgendein praktisches Ergebnis haben müssen: Pumpen Sie mir bis morgen nach dem Examen dreihundert Mark! Ich lasterhaftes Individuum bin nämlich noch nicht gestimmt, schon jetzt in die Baba zu gehen. Ich möchte noch irgendwo einen Streifen Zigeunermusik hören und einige junge Damen mit Sekt auffüllen, bis sie nicht mehr können. Das ist dann immer sehr gemütlich, und ich finde, nichts bereitet so gut für geistige Anstrengungen vor, als der gänzliche Stumpfsinn. Na, und wie ist’s nun? Wollen wir uns wieder vertragen? Und kommen Sie mit?“
Peter zog seine Brieftasche.
„Ich bedaure, ich möchte lieber schlafen gehen!“
„Ah so, pardon, ich vergaß. Noch immer „inferiore Spezies des Menschengeschlechts“, und Sie haben’s gut! Können sich ausschlafen, so lange Sie lustig sind. Ich armes Huhn aber muß morgen früh ins Examen steigen!“
Der lange Heino steckte die zusammengeknüllten Banknoten lässig in die Westentasche, hob zwei Finger der Rechten an die Hutkrempe und ging mit hallenden Schritten die stille Straße entlang. Peter Brenitz aber sah ihm nach, bis die hohe Gestalt sich im Dunkeln verlor, und seufzte schwer auf.
„Sagen Sie mal, Kleiner, womit verdiene ich eigentlich all diese rührende Fürsorge?“ So oder ähnlich hatten die hochmütigen Worte gelautet. Er aber hatte dabei gestanden wie ein auf verbotenem Tun ertappter Schuljunge, statt frei und frank die Augen aufzuheben: „Sie haben recht, Herr von Bergkem, an Ihrem Schicksal liegt wenig, wer so frivol dahinlebt, ist wert, daß er zugrunde geht. Aber da unten tief im Ostpreußischen sitzt ein Mädel, das mir teurer ist als mein eigenes Herzblut, und dem stehlen Sie mit Ihrem bodenlosen Leichtsinn das bißchen Leben! Und der Teufel hat Sie mir wieder in den Weg geführt, ich hatte mich schon leidlich zurechtgefunden ... Verrückt, verrückt, verrückt! ...“
Er schrak zusammen, denn von der anderen Seite der leeren Straße kam der Widerhall seiner eigenen Worte zurück wie kicherndes Lachen aus hämischen Mäulern. Ein Frösteln zog ihm über den Rücken, er schloß die Haustür auf und stieg hastig die Treppe zu seiner Wohnung empor. Als er aber wieder in seinem hellen Schreibzimmer saß unter den gütigen Augen des Vaters, die von der Wand auf ihn herabsahen, fing er an zu grübeln und zu überlegen, wie er dem in Bedrängnis geratenen Freunde wohl helfen könnte, ohne sein empfindliches Zartgefühl zu verletzen ...
Sechs Monate waren es ungefähr her, seit er den langen Heino zum ersten Male wiedergesehen hatte nach dem kurzen Abschiede auf dem Amtsgericht in Stradaunen. Eines Mittags, als er in müßiger Stunde die Linden entlang schlenderte, legte sich ihm von hinten eine Hand auf die Schulter: „Tag, Brenitz, und wie geht’s denn immer, alter Kampfgenosse?“
Schon an der Stimme hatte er ihn wiedererkannt und wandte sich in freudiger Ueberraschung um. Aber es war nicht mehr der lange Heino von damals, mit den ein wenig schlaksigen Bewegungen und dem gutmütig-lustigen Jungengesicht, sondern ein ausgewachsener Mann, selbstbewußt und sicher, und um die früher so schalkhaften Augen ein müder, verdrossener Zug ...
„Herr von Bergkem! Was führt Sie denn nach Berlin?“
„Das leidige Examen! Und sehen Sie mich nicht so verwundert an, man kommt in die Jahre, wenn man das Tempo ein bißchen beschleunigt. Sie sind in den zwei Jahren seit Stradaunen ja auch nicht viel jünger geworden.“
Ein paar Minuten später stießen sie auf das frohe Wiedersehen an.
„Prosit, Herr von Bergkem!“
„Prost, Brenitz! Und, wenn ich bitten darf, nicht so förmlich. Wir sind uns in der kurzen Zeit damals doch ein bißchen näher gerückt?!“
„Allerdings. Wenn ich mir also gestatten darf: Prosit, Heino!“
„Prost! Aber jetzt sagen Sie mal, Menschenskind, weshalb haben Sie in den ganzen Jahren nichts von sich hören lassen? Immerzu hab’ ich auf irgend ’ne Nachricht von Ihnen gelauert, aber nichts, nicht ein Wort, nicht ’ne Silbe, na und da verstockte sich auch mein Herz. Ich dachte schließlich, Sie hätten irgend ’was übelgenommen.“
„Aber durchaus nicht!“ Peter spielte verlegen mit seinem Glase und stotterte ein paar dürftige Entschuldigungen. In der ersten Zeit wäre er zu sehr in Anspruch genommen worden, dann aber hätte er befürchtet, mit Berichten über sein Ergehen vielleicht nur lästig zu fallen.
„Unsinn!“ sagte der lange Heino, „Sie mußten es doch gemerkt haben, daß wir Sie alle recht gern hatten. Und meine alte Dame hat mir viele Grüße für Sie aufgetragen!“
„Herzlichen Dank! Und wenn ich fragen darf, wie geht es Ihrer verehrten Frau Mutter?“
„Danke, so leidlich. Plagt sich auf Przygorowen und ist noch ein bißchen weißer und hinfälliger geworden.“
„Und Ihrer Frau Schwester? ...“ Zu der Frage hatte er sich erst ganz besonders sammeln müssen, um sich nicht nachträglich noch zu verraten. Und der andere schien wirklich nichts gemerkt zu haben. Er runzelte die Stirn und nahm einen hastigen Schluck.
„Frau stimmt nicht ganz. Immer noch Fräulein!“
Das Herz drohte Peter still zu stehen vor freudigem Schreck.
„Ja, aber! ... Wenn ich mich recht entsinne, war Fräulein Brigitte damals doch verlobt?“
„Die Verlobung ist wieder zurückgegangen!“
„Was Sie sagen!“
Der lange Heino stürzte den Rest seines Glases hinab.
„Positiv auseinander und nicht mehr zu leimen! Wissen Sie, der große Hanns aus Hellingenau war natürlich kein Säulenheiliger, trieb’s vielleicht ein bißchen toller als die anderen. Ein forscher Kerl war er, kein großes Kirchenlicht, aber, Du mein lieber Gott, „Burggraf von Hellingen“ — na, Sie haben ihn ja damals gesehen — die Frauenzimmer liefen ihm nach, und mit einer gab’s ein Unglück, sie ging ins Wasser. ’ne kleine Gouvernante, die bei seinem Oberförster die Gören unterrichtete ... zu blöd! Also die Sache wurde ruchbar, irgend so ein vertrackter Dorfschulmeister schrieb sie der Hartungschen Zeitung, und, bems, war das Unglück fertig! Es gab einen großen Skandal. Fräulein Brigitte von Bergkem heulte sich erst ein paar Tage lang gründlich satt, dann aber schickte sie einen reitenden Boten nach Hellingenau mit ’nem Brieflein, in dem der gräfliche Verlobungsring lag, eingewickelt in ein paar geschwollene Redensarten. Und nichts war zu machen. Die Mutter redete ihr zu, ich sprach ein paar deutliche, der Veranlassung angemessene Worte, und der Hellingen, der Riesenkerl, kniete vor ihr, weinte wie ein kleines Kind, schlug sich mit der groben Ritterfaust gegen die Brust, schwor bei Tod und Teufel, er würde sich bessern. Alles umsonst, Fräulein Brigitte stand da wie ein Bild aus Stein, wandte sich schließlich mit ’ner Gebärde des Ekels ab und ging langsam auf ihr Zimmer! Na, reden wir nicht mehr davon! Die Galle steigt mir noch heute ins Blut, wenn ich nur daran denke.“
Es bedurfte gar nicht der Aufforderung, denn Peter hatte Mühe genug, den Sturm zu meistern, der in seinem Innern losgebrochen war. Der Tor, der er damals gewesen war. Der feige Narr, daß er sich versteckt hatte, um still sich einem weichlichen und weibischen Wehgefühl hinzugeben, statt die Faust auszurecken: „Hollah, hier steh ich! Und ich bin mehr wert als Du, denn meine Hand ist rein!“ Die gütige Vorsehung, die ihm bis dahin den Weg gewiesen, hatte ihm auch den Sieg bereitet. Der andere verstrickte sich selbst in seiner häßlichen Unreinheit, er aber war dem Kampfe feig ausgewichen ...
Der lange Heino saß mit finsterem Angesicht da, stürzte ein Glas Sekt nach dem andern hinunter, und nach einer Weile fing er wieder an zu sprechen.
„Sehen Sie, lieber Brenitz, Sie haben ja damals einen Blick in unsere Verhältnisse getan: es ging höllisch knapp zu, kaum das standesgemäße Sattessen war aus Przygorowen herauszuwirtschaften; jedes schlechte Jahr aber brachte eine neue Hypothek auf das alte Dach. Und das sollte mit einem Schlage anders werden, denn der Hellingen wollte unsere zweitausend Morgen, für einen Phantasiepreis natürlich, zur Abrundung seines Besitztums ankaufen. Wie früher schon immer die Hellingen, wenn die Bergkems schlecht gewirtschaftet hatten, aber bei ihm war es was anderes. Denn die letzte Bergkem trat ja in sein Haus. Die Mutter war einverstanden, ich war einverstanden, denn was konnte uns Besseres passieren? Die auskömmlichen Zinsen wären dagewesen, und ich hätte ein großes Tier in der Verwaltung werden können, womöglich Minister. Und lachen Sie nicht, denn was gehört dazu? Herkunft, Ehrgeiz, heller Kopf mit dem Blick für das Notwendige und Unabhängigkeit von dreckigen Sorgen. Die Zähne muß man zeigen können, wenn man sich durchsetzen will, um Gottes willen nur keinen krummen Buckel — der ist bloß für die kleinen Geister gut! Alles also wäre vorhanden gewesen, und da muß das Malheur passieren! Stellt sich hin, das kleine Freifräulein, und spielt nicht mehr mit. Ein Mädel, das auf dem Land aufgewachsen ist, bei uns in Ostpreußen. Will barmherzige Schwester werden, weil der Zukünftige einen Rückfall ins alte Herrenrecht gehabt — weiß der Teufel, was ihr den Kopf verdreht hat. Na, also aus, erledigt. Ich lern’ jetzt wieder auf Rechtsanwalt, weil’s zur Regierung natürlich nicht langt, und zu etwas muß das große Mundwerk doch gut sein, zum Geldverdienen! Na, prost, Brenitz, auf vergnügte Konkurrenz!“
Er hob sein Glas, und Peter tat mit zerstreuter Miene Bescheid. Sein Herz war schon längst wieder unterwegs, gaukelte irgendwo herum am schmalen Wiesenrain oder in einem alten Hause unter grünen Linden ... er glaubte zu wissen, was dem „kleinen Freifräulein den Kopf verdreht hatte“, ein paar kurze Minuten auf der Diele der armseligen Tagelöhnerwohnung standen ihm ja noch recht gut im Gedächtnis ...
Der lange Heino hatte eine neue Flasche bestellt, der zweiten folgte eine dritte, als sie endlich aufstanden, hatten sie heiße Köpfe. Weil sie sich aber noch nicht trennen mochten, faßten sie den Plan, gemeinschaftlich ein Theater zu besuchen, nur Peter hatte noch vorher in dem Klub, in dem er zu Mittag aß und seine Zeitungen zu lesen pflegte, eine kurze Besprechung zu erledigen. Als er aus dem Schreibzimmer trat und sich nach seinem Freunde umsah, saß dieser an dem runden Tische der hohen Pokerpartie und spielte mit: einer der Jeu- und Rennleutnants, der ihn von Königsberg her kannte, hatte ihn eingeladen! Da machte Peter sich Vorwürfe, daß er nicht an Heinos Leidenschaft gedacht hatte, aber das Unglück war einmal geschehen und nichts mehr daran zu ändern. Nur ging’s diesmal noch glimpflich ab, denn Heino gewann. Gewann unaufhörlich, und als er merkte, daß die Karte gegen ihn zu schlagen begann, hörte er auf. Aus dem gemeinschaftlichen Theaterbesuch war natürlich nichts geworden, als sie wieder auf der Straße standen, ging es schon auf Mitternacht.
Peter faßte seinen Freund unter den Arm.
„Ich schätze, Sie haben heute abend gegen fünftausend Mark gewonnen.“
„Ein Endchen mehr, gegen sieben.“
„Wollen Sie mir einen Gefallen tun, Heino?“
„Aber mit Vergnügen!“
„Niemals mehr da oben in den Klub hinaufgehen?“
Der lange Heino lachte hell auf.
„Nee, mein Jungchen, das wär’ ja blanker Unsinn. Ich gedenke unter den Jünglingen da oben noch öfter ein Blutbad anzurichten! Keine Ahnung haben die Kerle vom Pokerspiel, und ich wäre ein Narr, wenn ich diese Chance auslassen wollte!“
Da seufzte Peter nur auf, verabschiedete sich mit kurzem Gruße. Und er sah sich mit dem langen Heino noch manch liebes Mal hier unten stehen, nur das Blättlein hatte sich gewendet ...
Zu Hause, als er allein zwischen seinen vier Pfählen war, wollte er sich so recht von Herzensgrund freuen, die frohe Botschaft, die ihm der andere gebracht hatte, still für sich genießen, ehe er seine Entschlüsse faßte, aber der erste Rausch war verflogen, und das Grübeln setzte wieder ein. Gewiß, die blonde Brigitte war frei, aber waren der Hindernisse, die sie voneinander trennten, drum weniger? Hatte sich in der Zwischenzeit vielleicht seine Herkunft verbessert, oder war er mit einem Male ein in Kraft und Schönheit prangender Jüngling geworden, dem die Frauenherzen auf den ersten Blick zuflogen? Wie sollte er’s überhaupt anstellen, Brigitte wiederzusehen? Er konnte doch nicht einfach nach dem alten Hause hinausfahren: Hier bin ich!? Und bitte, gnädige Frau, gewähren Sie mir eine Zeitlang Gastfreundschaft, ich habe die Absicht, mich um Ihr Fräulein Tochter zu bewerben!? ...
Also was frommte ihm da die Nachricht, die der lange Heino gebracht hatte? Es gab nur Trübsal und Pein und neue Kämpfe zwischen der kühlen Vernunft und dem heißen Herzen. Und mit wehem Lächeln sah er den einzigen Weg, auf dem es vielleicht glücken konnte, die blonde Brigitte zu erringen: Wenn sie eines Tages zu ihm hier in die Stube trat: „Da bin ich! Und weil Du nicht zu mir kamst, mußte ich mich wohl aufmachen, Dich zu suchen!“ ...
Von dem wolkenverhangenen Himmel schwebten zarte Schneesterne hernieder, um auf dem im Laternenschein spiegelnden Asphalt zu vergehen, ab und zu knarrte es in dem Wipfel einer überständigen Eiche, wenn der Frühlingswind an die trockenen Aeste rührte, und von ferne her kam der Atem der nimmer rastenden Riesenstadt. Ein dumpfes Brausen, das sich in bestimmtem Rhythmus hob und senkte, wie Brandung am Meeresufer, wenn der Wind die Welle in ewiger Wiederkehr ans flache Gestade wälzt ...
Heino von Bergkem schritt unter den Bäumen des Tiergartens dahin, und unter dem an sein Ohr dringenden Gleichklang formten sich ihm die Gedanken ... verspielt, verlumpt ... mach Schluß, mach Schluß ...
Mit der Absicht, den Rest der Nacht in einem sinnlosen Gelage zu vertun, war es ihm nicht rechter Ernst gewesen. Besser schon mit ausgeschlafenem Kopfe ins Examen gehen, obwohl es ihm nichts verschlagen hätte, bis zu der entscheidenden Stunde wach zu bleiben und einigen Flaschen Sekt den Hals zu brechen. Sein eiserner Körper hatte schon mehr ausgehalten, die Prüfung selbst aber erschien ihm nicht mehr als eine überflüssige Zeremonie, nicht wert, sich darüber Sorgen zu machen; zu allem Ueberflusse hatte er ja zuweilen ganz gründlich gelernt, aber wenn sie glücklich bestanden war, was dann? ... was dann? ...
Als er sich von Peter Brenitz in der Wilhelmstraße trennte, war es ihm noch gar nicht recht zum Bewußtsein gekommen, was er eigentlich verspielt hatte. Die Erregung vom Kartentische jagte ihm das Blut durch die Adern, allerhand abgerissene Worte schwirrten ihm ans Ohr ... ich passe ... ich öffne ... drei Karten, bitte ... noch fünfzig besser ... und noch fünfzig ... Spielkombinationen bildeten sich in seinem Hirn, drei, vier hohe Karten standen gegeneinander, er aber hatte die allerhöchste und gewann ... gewann ohne Unterlaß wie damals an jenem ersten Abend. Und die Gewinne Nacht für Nacht häuften sich zu einem riesigen Vermögen, mit all dem mühelos erworbenen Gold aber kaufte er alles Land zurück, auf dem einstmals die Bergkems gesessen hatten. An dem Platze des alten Gemäuers, auf dessen moosgrünem Dache die Schulden sich häuften, erhob sich ein schimmernder Palast, leuchtete weit in die Lande hinaus als ein Wahrzeichen seines, im neuen Glanze aufblühenden Geschlechts ...
So ging er mit weit ausgreifenden Schritten dahin, schlug mit dem Stocke zuweilen einen sausenden Lufthieb, bis ihn ein unvermutetes Geräusch unter den nachtdunkeln Bäumen zusammenfahren ließ. Ein Waldkauz hatte im Schlafe aufgeschrien, oder das Gesindel, das vielleicht im Buschwerk neben ihm strich, gab sich ein Zeichen. Da blieb er stehen und sah sich um. Furcht kannte er keine, aber der aus dem Spielertraume geborene Rausch war vorüber, die nackte Wirklichkeit grinste ihn an. Vierzigtausend bare Mark hatte er in diesen kurzen sechs Monaten verspielt, und das Fürchterlichste: diese vierzigtausend Mark gehörten nicht ihm. Unter allerhand Vorspiegelungen hatte er die Mutter dahin gebracht, ihm das sichergestellte Erbteil der Schwester auszuliefern. Wie ein von allen guten Geistern Verlassener hatte er in seinem Wahne gehandelt, von einem Tage zum andern gehofft, das Verlorene wieder einzuholen, aber das Glück war eine feile Metze, verkaufte sich denen, die den größten Geldbeutel hatten. Und als er sich zu einem letzten Schlage sammelte, in einer Art von Aberglauben den Tag vor dem Examen auswählte, um noch einmal sein Heil am Spieltische zu versuchen, hatte es eine geradezu verhängnisvolle Niederlage gegeben. Ehe er eigentlich recht zur Besinnung kam, waren die letzten dreitausend Mark fort, über die er noch verfügen konnte, und in nicht allzu langer Frist zweitausend dazu, die er, unter Verpfändung seines Wortes, von dem vorsichtigen Klubkassierer entliehen hatte. Ohne diese im Spielerwahn eingegangene Verpflichtung wäre es vielleicht noch weiter gegangen, man hätte sich eben eingeschränkt und unter Sorgen und Entbehrungen die ersten paar Jahre nach dem Examen krumm gelegen, bis mit der wachsenden Praxis bessere Zeiten kamen, aber diese eine Schuld stand wie eine unübersteigbare Mauer vor allen guten Vorsätzen. Alle irgendwie verfügbaren Hilfsquellen waren erschöpft, und morgen abend waren zweitausend Mark fällig, die er zahlen mußte, wenn er nach allen landläufigen Begriffen nicht als ein Ehrloser herumlaufen wollte.
Viel nichtswürdiger aber noch der Augenblick, wenn er mit der Schamröte in den Wangen vor Mutter und Schwester hintreten mußte mit dem Bekenntnis: Ich hab’ Euch hintergangen, Euer Vertrauen schmählich getäuscht ... Also aus und erledigt. Ein Abenteurer hatte um Glück und Ehre gewürfelt und hatte verloren, verkroch sich am Straßenrain und machte ein rasches Ende ...
Leise Rufe und Zeichen kamen aus dem Dunkel, lichtscheues Gesindel sammelte sich auf der Straße und zog einem Ziele zu, einem Knäuel von Menschen, aus dessen Mitte erregtes Schreien und Kreischen und Streiten drang. Ein elegantes Privatautomobil, dessen Steuerung wohl versagt hatte, war über die Straßeneinfassung geraten, lag mit zertrümmerten Scheiben halb zur Seite, und der Chauffeur zankte mit einem langen Kerl, der drohend eine Entschädigung forderte, weil er angeblich samt seiner Braut von dem unsinnig daherrasenden Ungetüm beinahe überfahren worden wäre. Der lange Heino trat näher heran. Das war ein Spektakel nach seinem Herzen, im Nu waren all seine finstern Gedanken verflogen ...
Im Innern des Wagens kauerten ein paar Damen, halb ohnmächtig vor Schreck und Furcht, der Chauffeur beteuerte seine Unschuld, schrie dazwischen laut nach einem Schutzmann, das Gesindel aber johlte und strich herum, wie eine Schar hungriger Wölfe. Die Damen da in dem Wagen trugen kostbares Pelzwerk und darunter blitzendes Geschmeide, wenn der aufgeregte kleine Kerl in Livree noch ein Weilchen weiter schrie, war wirklich kein Schutzmann in der Nähe ... im Augenblick konnte alles vorüber sein, man hatte mit gierigen Händen zugegriffen, zerstreute sich wieder im schützenden Dunkel ...
Schon faßte einer nach dem Wagenschlag, die anderen drängten näher heran, da stand der lange Heino plötzlich zwischen ihnen, mit den Händen in den Paletottaschen und sagte ganz gemütlich:
„Erlauben Sie, meine Herrschaften, ich möchte auch gern von der Partie sein! Aber, ehe wir uns weiter unterhalten, ersuche ich Sie höflichst, ein paar Schritte zurückzutreten.“
Einen Augenblick lang gab es ein kurzes Stutzen, dann drängte sich der Kerl vor, der angeblich beinahe überfahren worden war, ein Frauenzimmer schrie irgendwoher aus der Menge ein gellendes Wort, das wie ein Peitschenhieb klang, eine Klinge blitzte im Laternenschein, da schlug der lange Heino zu, mitten zwischen ein Paar tückisch blickende Augen. Lautlos sank der Kerl zu Boden, der nächste flog wie ein Sturmklotz gegen den feststehenden Ring, noch ein paar gewaltige Maulschellen sausten wahllos nieder, schreiend und kreischend stob das Gesindel auseinander. Und plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, stand ein Schutzmann da, schnob mächtig gegen einen zerlumpten Strolch, der aus der Nase blutete, schrie den anderen an, der sich am Boden krümmte, und trillerte schließlich heftig auf einer schrillen Signalpfeife.
Da mußte Heino unwillkürlich laut auflachen. Er lüftete höflich den Zylinder und verneigte sich:
„Verehrter Herr Wachtmeister, Ihr zielbewußtes Auftreten läßt mich vermuten, Sie haben schon eine ganze Weile lang Gelegenheit gehabt, sich über die Schuldfrage bei diesem Renkontre ein zuverlässiges Urteil zu bilden. Bitte, nehmen Sie sich also auch der beiden Damen an, ich hab’s eilig, muß wieder ins Städtchen zurück!“
Der Schutzmann hatte eine grobe Erwiderung auf der Zunge, aber der lange Herr da im Zylinder sah ihm stark nach einem Offizier in Zivil aus, und da war es geratener, den Mund zu halten. Ein leeres Mietsauto kam vorübergefahren, er hielt es mit lautem Zurufe an und geleitete die verängstigten Damen mit der beruhigenden Versicherung über die Straße, daß ihnen unter polizeilichem Schutz nun nichts mehr geschehen könnte. Die kleinere der beiden Damen, ein junges Mädchen mit blassem Gesicht und dunklem Haar, blieb an dem Schlage des Mietsautos stehen und sah sich suchend um, aber von dem mannhaften Retter, der im Augenblicke der höchsten Gefahr furchtlos eine ganze Horde von Strolchen in die Flucht gejagt hatte, war nichts mehr zu erblicken.
Nachdem Heino gesehen hatte, daß auf den schrillen Ruf der Signalpfeife vom Großen Stern her ein paar blinkende Schutzmannshelme auftauchten, wandte er sich ab und ging rasch den Weg zurück, den er gekommen war. Dafür, daß die beiden Damen ungefährdet ihr Heim erreichten, war gesorgt, und mit allen Weiterungen wie Zeugenvernehmungen oder gar einer Gerichtsverhandlung mochte er nichts zu tun haben. Am allerwenigsten aber mit gerührten Danksagungen, nachfolgender Einladung zum Mittagessen und vielsagendem Händedruck des Herrn Papas: „Herr Baron, meine Frau hat mir alles erzählt, meine Tochter träumt bei Tag und Nacht von ihrem heldenmütigen Lebensretter, falls wir uns also irgendwie revanchieren können, bitte ich voll und ganz über uns zu verfügen ...“ Und er darauf: „Sie haben ganz recht, Herr Kommerzienrat, es war schon lange mein Wunsch, Ihr Fräulein Tochter kennen zu lernen, und eigens zu diesem Zwecke hab ich ihr gestern nacht im Tiergarten aufgelauert. Also pumpen Sie mir mal vorläufig zweitausenddreihundert Mark, die ich heute abend auf Parole d’honneur zurückzahlen muß. Das übrige, was ich sonst noch schuldig bin, können wir ja später von der Mitgift abziehen.“
Er lachte grimmig auf und schob den Hut aus der erhitzten Stirn.
So hätte es kommen können, ohne allzu ausschweifende Phantasie. Er hätte vielleicht nur an den Wagenschlag zu treten brauchen: „Gestatten Sie, meine Damen, Freiherr von Bergkem! Und darf ich mir erlauben, Sie zu Ihrer Wohnung zu begleiten?“ Alles übrige entwickelte sich dann von selbst, wie in dem Programm, das ihm vor Monaten einmal eine würdige Frau unterbreitet hatte, die ihn nachmittags in seiner Wohnung überfiel. „Wirklich und wahrhaftigen Gott, Herr Baron, die junge Dame ist rasend in Sie verliebt. Sie brauchen sich auf dem Donnerstagskränzchen nur vorstellen lassen, durch mich natürlich, und alles übrige ist Formsache. Fünfmalhunderttausend bar, die Terrains von dem seligen Vater her — wissen Sie, Herr Baron, er war bloß ein einfacher Rixdorfer Oekonom, aber sonst ein ganz anständiger Mensch, und wo er glücklich tot ist, kann er ja überhaupt nicht mehr störend wirken — ja also, die Terrains gar nicht gerechnet.“
Da hatte er scheinbar ganz ernsthaft zugehört und mit dem Kopfe genickt: „Hochverehrte gnädige Frau, es schmeichelt mir ungemein, daß ich der unbewußte Gegenstand einer so plötzlichen und heftigen Liebe bin. Leider liegt mir aber schon von anderer Seite ein ernsthaftes Kaufangebot vor, von dem hiesigen Anatomischen Institut, dessen Leiter durchaus und für siebenundzwanzig Mark fünfzig meinen Kopf von innen studieren will. Sie werden einsehen, daß ich diesem Offert den Vorzug geben muß, denn einmal handelt sich’s dabei nur um meinen Leichnam, und zweitens interessiert es mich lebhaft, ob ich zu Lebzeiten nicht vielleicht ein bißchen verrückt gewesen bin. Bitte, empfehlen Sie mich Ihrer scharmanten Rixdorferin, und es täte mir leid, wenn ihr nun das Herz brechen sollte. Aber Gottes Wege sind wunderbar, vielleicht wird sie wieder gesund und findet einen anderen Baron, der sich schon bei lebendigem Leibe verkauft“ ...
So hatte er damals gesprochen und, als die würdige Dame an der scherzhaften Abweisung nicht genug hatte, seiner Wirtin geklingelt. So niedergebrochen war er denn doch noch nicht, damals nicht und heute nicht, daß er sich verschachern ließ, nur um das Leben zu fristen. Selbst und mit eigener Hand gedachte er sich Schicksal und Glück zu schmieden. Was war denn Großes geschehen, daß er sich mit allerhand finsteren Gedanken trug? Er hatte kein Geld und sollte morgen abend zweitausend Mark zurückzahlen, die er heute auf Ehrenwort entliehen hatte! Nach dem Examen sah die Welt ganz anders aus. Wozu gab es denn Wucherer in Berlin, die auf Nimbus und Namen Tausende borgten? Oder noch besser, man erschlug den filzigen Onkel Reineke mit einem größeren Pumpe, trotzdem man mit ihm in arger Feindschaft lebte. Setzte ihm so lange zu mit gleißnerischen Worten, spielte wohl auch den reumütigen Sünder, bis er widerstrebend und laut jammernd den Geldbeutel auftat. Dann aber zog man unter das wilde Leben einen dicken Schlußstrich, verlegte sich auf die Arbeit und zeigte all dem mittelmäßigen Volk, das an den Berliner Gerichten sein Wesen trieb, den Herrn und Meister.
Warmer Brodem schlug ihm entgegen, Zigarettenqualm, Lärm und fiedelnde Musik; der dicke Wirt des Nachtlokals in der Jägerstraße begrüßte ihn mit vertraulicher Freundlichkeit auf der Schwelle. „Hab’ die Ehre, Herr Baron, ein feines Platzerl ist noch frei in der Lauben, und alles ist da, nicht wie bei armen Leuten!“ Ein schlankes Mädel in Balltoilette und riesigem Federhut schrie auf: „Der lange Heino ist da, Kinder, jetzt gibt’s Schampus,“ die Musik, mit der näselnden Ziehharmonika an der Spitze, schwenkte aus dem neuesten Operettenschlager mit kurzem Uebergang in seine Lieblingsmelodie, die schmachtende Weise der Paloma. Er aber stand da, den Zylinder im Genick und lachte. Kein Mensch sah ihm an, daß er vor einer knappen Stunde drauf und dran gewesen war, Schluß zu machen ... Blödsinn! Dazu war es immer noch Zeit, wenn alle Straßen, die nach oben führten, verrammelt waren. Heute lebte er noch. Wie ein Stück Borstenvieh, das sich im Schlamm wälzte, aber er lebte, und aus der mit lärmendem Leichtsinn erfüllten Luft wehte ihn etwas Aufreizendes an. Nicht umsonst floß ihm polnisches Blut in den Adern von jenem Grafen Przygorowski her, der in der Nacht vor seiner Hinrichtung auf dem Marktplatze von Thorn sich die Marketenderin ausgebeten hatte und den Stückpfeifer des Regiments ..
Der Sekt perlte in den Gläsern. Drei, vier Mädel drängten sich an Heinos Tisch. Er griff in die Westentasche und warf die letzten blauen Scheine auf den Tisch: „Da, Kinder! Zwei sind für Euch, teilt sie schwesterlich, der dritte wird vertrunken!“
„Heino,“ schrie die eine, „hast Du einen totgeschlagen?“
„Beinahe,“ sagte er lachend, „und hätte nicht viel gefehlt, mich selber! Aber trinkt, Kinder, es gilt einen Abschied, so oder so ... Nach unten oder oben, das wird sich morgen erweisen!“
Die anderen Mädchen taten fröhlich Bescheid, aber eine Blondine mit sanften Augen zog ihr Glas zurück.
„Lacht nicht, der hat etwas vor. Ich hab’ schon mal mit einem zusammengesessen, der sein letztes Geld verteilte. Fünf Minuten darauf zog er einen Revolver ’raus und schoß sich, bums, vor den Kopf!“
„Beruhigen Sie sich, meine Gnädigste,“ erwiderte Heino mit einem trockenen Auflachen, „ich bin viel zu edel veranlagt, um Euch, arme Würmer, im Vergnügen zu stören. Ich pflege mich immer im Tiergarten totzuschießen, möglichst zur Nachtzeit und ohne Beunruhigung harmloser Spaziergänger. Bei meinem fünfundzwanzigsten Jubiläum hoffe ich sehr stark auf eine öffentliche Belobigung von seiten des Herrn Polizeipräsidenten. Kellner, zahlen!“
Er ließ sich in der Garderobe Hut und Mantel reichen und ging auf die Straße. Ein jäher Ekel war ihm aufgestiegen und stand ihm wie ein Knäuel im Halse. Er drückte den Hut ins Gesicht und schritt hastig durch das schwärzliche Gewimmel der Friedrichstraße seiner Wohnung zu. Es war wirklich an der Zeit, mit diesem Luderleben ein Ende zu machen, so oder so ...
Heino von Bergkem kam geschlagen aus dem Examen zurück. Wie zu einer überflüssigen und bedeutungslosen Feier war er in die Prüfung gegangen, und als ein schmählich Durchgefallener kehrte er heim: ganz als wenn’s ihm einer verwünscht und berufen hätte, war es gegangen. Gleich die erste Frage hatte er verfehlt, und da wurde er unsicher, die Ruhe verließ ihn und die Kaltblütigkeit; bei dem mündlichen Vortrage aber, der seinem Schicksal vielleicht noch eine günstige Wendung hätte geben können, passierte ihm das Mißgeschick, daß er in der Vorbereitung eine Entscheidung des Reichsgerichtes übersehen hatte. Und da half ihm alle Beredsamkeit nichts, keine noch so elegante Verteidigung seines Standpunktes, denn dieses Uebersehen war ein Verbrechen, für das es keine andere Sühne gab als einen glatten Durchfall. Ganz gleichmütig verkündete der Vorsitzende das Ergebnis der Prüfung, alle anderen hatten bestanden, nur der Freiherr Heino von Bergkem war durchgefallen. Auf sechs Monate zurückgestellt, um die bei dem mündlichen Examen zutage getretenen Lücken seines Wissens auszufüllen, denn die schriftlichen Arbeiten wären leidlich zufriedenstellend gewesen. Die anderen stürmten die breite Treppe hinab, begrüßten freudig die draußen wartenden Freunde. Er allein ging ganz langsam hinterdrein, es eilte ihm nicht ..
Auf der anderen Seite der Straße stand der kleine Brenitz, spähte mit besorgter Miene zu dem hohen Portal hinüber. Da blieb Heino im Hausgange stehen, bis er sah, daß der andere nach einer Erkundigung bei einem der glücklich durchgekommenen Kollegen langsam weiter ging. Mit betrübtem Gesichte und nachdem er noch einmal zögernd nach dem Ausgange des Ministeriums hinübergeblickt hatte. War ja sehr rührend, daß der Kleine für einen schließlich doch Fremden so viel Interesse zeigte, aber jetzt war es ihm wohl klar geworden, daß es nichts zum Gratulieren gab. Und Mitleid brauchte er nicht, auch keine gutgemeinten Predigten, wie bei einigem Wohlverhalten das betrübende Ereignis zu vermeiden gewesen wäre. Außerdem aber gab es in der plötzlich so veränderten Lage gar manches zu bedenken. Es war nicht gerade anzunehmen, daß die Wucherer, an die er sich zu wenden gedachte, sich zur Hergabe eines erheblichen Darlehns besonders willfährig zeigen sollten, und auch der Gang zu Onkel Reineke erschien ihm heute in anderem Lichte. Mit dem glücklich bestandenen Examen in der Tasche hätte er sich’s schon zugetraut, dem hartgesottenen alten Fuchs ein ordentliches Stück Geld abzujagen. Wenn er aber mit der demütigen Miene eines kläglich Durchgefallenen antreten mußte, war das Spiel schon von vornherein verloren, ganz abgesehen von dem schweren Zerwürfnisse, das ihm monatelang den Weg in das Haus seines nächsten Verwandten verlegt hatte ..
Einen hätte es ja gegeben, dem er nur ein Wort zu sagen brauchte, um aller Bedrängnis und Not ein Ende zu machen, aber ehe er dieses Wort sprach, hätte er sich lieber die Zunge abgebissen vor Stolz. Sich mal von einem Tag zum andern mit einer Kleinigkeit aushelfen zu lassen, ging an, aber sich vor dem Freunde bis aufs Hemd auszuziehen und zu sagen: „Da sieh her, so ein erbärmlicher Kerl bin ich, daß ich im Spielerwahnsinn mein Wort verpfände, ohne zu wissen, ob ich’s am andern Tag auch einlösen kann“ ... ah, pfui Deuwel, das war nicht zu machen! Und noch etwas anderes war dabei, was er mehr fühlte, als daß er dafür einen bündigen Beweis gehabt hätte; eine Art von Schuldbewußtsein, daß er mit derb zufassender, plumper Faust einst in zwei Menschenschicksale gegriffen hatte, die in voller Freiheit des Gewährlassens vielleicht zueinander gefunden hätten ....
Auf der roten Plüschdecke des Sofatisches in seiner Wohnung lag ein Brief. Die mit Bleistift geschriebene Adresse zeigte eine merkwürdig zittrige Hand, die er noch niemals gesehen zu haben glaubte, und fast achtlos erbrach er den zerknitterten Umschlag. Nachdem er den Brief aber gelesen hatte, brach er zusammen ...
„Mein lieber Junge, mein Einzigster!
Ich schreibe Dir von meinem Krankenbette aus und möchte Dir manches sagen, was ich sonst wohl nicht herausgebracht hätte. Du bist nach dem Hinscheiden Deines Vaters das Oberhaupt der Familie, ich habe Dir Respekt zu erweisen, obwohl ich Dich unter dem Herzen trug, und vielleicht ist es deshalb besser, ich schreibe Dir. Wenn Du vor mir stehst mit den blauen Augen Deines Vaters, die ich so sehr geliebt habe, würde ich mir wohl nicht die rechten Worte zutrauen. Worte der Ermahnung und des Vorwurfs.
Ich wollte Dich in den Vorbereitungen zum Examen nicht ablenken noch beunruhigen, aber jetzt, wo der schwere Tag hinter Dir liegt, möchte ich einiges mit Dir besprechen. Vielleicht, daß Du Veranlassung nimmst, manches zu ändern. Ich setze voraus, daß Du das Examen bestanden hast, denn Du hast mir ja immer gesagt, es würde Dir nicht schwer fallen, weil Du Dich gewissenhaft vorbereitet hättest. Und ich hätte gewartet, bis Deine Nachricht kam, aber seit Wochen liege ich zu Bett, ich weiß nicht, wie lange das kärgliche Flämmchen noch flackern wird. Außerdem muß ich heimlich schreiben, denn Brigitte ist eine strenge Aufpasserin. Sie teilt meine Furcht, aber sie will nicht, daß wir uns gegen Dich auflehnen. Das will ich ja auch nicht, nur bitten möchte ich Dich, Du sollst daran denken, daß Du eine Schwester hast. Du hast ihr Vermögen eingefordert, um es in nutzbringenden Spekulationen anzulegen, aber mir zog sich schon bei Deinem ersten Briefe das Herz zusammen. Es waren unwahre Worte darin, wie ich sie vor Zeiten schon einmal gehört hatte, wenn einen anderen die unselige Leidenschaft gefaßt hatte. Einen herrlichen Mann, der sonst mehr tat als seine Pflicht, der in allen Tugenden eines Herrn ein nacheifernswertes Beispiel sein durfte, mit sehenden Augen aber die Früchte einer Jahresarbeit vernichtete, wenn die Leidenschaft über ihn kam. Wieviel Nächte habe ich durchweint, wieviel Tage verhärmt, aber es half nichts, ich mußte ihn gewähren lassen. Jedesmal, wenn im Herbst die Treibjagden kamen, fing es an. Er selbst wehrte sich dagegen, drei-, viermal sagte er ab, aber es riß und zerrte an ihm, so daß ich schließlich ihm selbst zuredete: „Geh’ und versuch’ es!“ denn mit der Zeit hatte sich in mir ein Aberglaube gebildet. Wenn ich ihm gut war, kam er ungeschlagen zurück, wenn ich ihm aber zürnte, verlor er ...
Ihr Kinder habt ihn nicht anders gekannt als einen gewissenhaften und treu sorgenden Vater, und ich komme mir wie eine Verbrecherin vor, wenn ich sein Andenken vor Dir entblöße, aber Gott helfe mir, ich kann nicht anders, denn Du, mein Sohn, spielst auch!
Ich mache Dir keine Vorwürfe, denn ich habe gesehen, wie diese unselige Leidenschaft alle edlen Gefühle niederwerfen kann, wie ein verheerendes Unwetter, Unglück und Reue läßt sie auf ihrem Weg. Nur bitten möchte ich Dich, gib Deiner Schwester zurück, was ich ihr in einer glücklichen Stunde gerettet habe, Deinem und ihrem Vater abgeschmeichelt, als er eines Morgens mit großem Gewinn heimkehrte und frohlockend vor mir auf und ab ging. Ein paar Tage danach war das übrige wieder verloren, aber das einmal Hergegebene war ihm ein Heiligtum, er rührte nicht daran.
Du hast mich vor langen Jahren, als Du einmal in der Dämmerstunde zu meinen Füßen saßest, gefragt: Mutti, woher hast Du nur Deine grauen Haare? Jetzt weißt Du’s, mein Sohn, und es tut mir leid, daß ich’s Dir offenbaren mußte, aber die Angst um Deine Schwester frißt mir am Herzen: Ich möchte wenigstens den einen Trost mitnehmen, daß sie nicht in Sorgen und Entbehrungen zurückbleibt. Seit der Lösung ihres Verlöbnisses hat sie einen schweren Stand, man spottet über sie und verdreht ihren Entschluß, der doch aus einem reinen Herzen geboren war, ins Lächerliche. Die Freier meiden unser Haus, und was soll aus ihr werden, wenn sie keinen Schutz mehr hat?
Meine Kräfte gehen zu Ende, der Brief muß noch heute zur Post, wenn ich hoffen soll, Deine Antwort zu sehen. Ich küsse und umarme Dich in Liebe als Deine treue Mutter ...“
Ganz vernichtet starrte Heino auf die von den Tränen seiner Mutter verwischten Zeilen, unfähig einen Gedanken zu fassen. Nur von Zeit zu Zeit stöhnte er auf, wenn Reue und Scham gar zu heftig brannten. Hätte die Mutter gezürnt und gescholten, wäre es vielleicht nicht so schwer zu tragen gewesen, so aber fraß es wie ätzende Säure, und jedes Wort der nachsichtigen Liebe bohrte sich wie ein Stachel in schwärende Wunden. Seit Wochen lag sie krank, keine Klage kam über ihre Lippen, sie sorgte nur, daß er’s nicht erführe, um ihm nicht die Ruhe zur Arbeit zu rauben, zur Arbeit! Erst, als sie zu fürchten begann, sie könnte ihn vielleicht nicht mehr sehen, entschloß sie sich zu einer mahnenden Bitte. Bat ihn, die Schwester nicht zu verlassen, deren Vermögen er vertan hatte ...
Und jählings sprang ihn eine Erinnerung an: Er sah sich als halbwüchsigen Knaben vor einem Bette knien, eine schwere Hand lag auf seinem Scheitel und eine Stimme, der sich nur mühsam noch die Worte formten, kam wie aus der Ferne zu ihm. „Es hat Rest gegeben, Heino, ich muß von Euch gehen, viel zu früh. Halt’ Dich aufrecht, mein Junge, und werd’ ein ganzer Mann! Du sollst einmal Mutter und Schwester die einzige Stütze sein“ ... Er hatte aufgeschrien: „Vater, bleib’ bei uns, lieber Vater!“ und, als die Hand von seinem Scheitel sank, unter Schluchzen einen Eid geschworen, er würde der empfangenen Mahnung immerdar eingedenk sein ...
Also irgend etwas mußte geschehen, nur durfte er natürlich hier nicht so untätig herumsitzen und jammern. Für sechs kurze Monate galt es Rat zu schaffen, sechs Monate nur, in denen er sich gewissenhaft vorbereiten mußte, um das Examen zu bestehen und Geld zu verdienen ...
Er hatte sich in fieberhafter Hast umgezogen. Als er auf die Straße trat, kam ein leeres Auto vorüber. Er sprang hinein: „Joachimsthaler 39“, und während der Chauffeur in kurzem Bogen wandte, um den Weg übers Schöneberger Ufer zu nehmen, überlegte er, was Onkel Reineke wohl sagen würde, wenn er nach mehr als einem Vierteljahr so plötzlich vor ihn hinträte. Damals nämlich hatte es einen vollkommenen Bruch gegeben, und heftige Worte waren gefallen zwischen ihm und dem Stiefbruder seiner Mutter, dem Oberverwaltungsgerichtsrate von Hegelingen, dem der Familienwitz den Beinamen Onkel Reineke angehängt hatte. Wegen der fuchsigen Perücke und seines hinterhältig-schlauen Wesens, das ihn überall seinen Vorteil finden ließ, bei seinen Vorgesetzten sowohl wie bei kleinen Spekulationen an der Börse oder auf dem Grundstücksmarkte, mit denen er sein Vermögen im Laufe der Jahre recht ansehnlich vergrößert hatte.
Und der Grund zu dem Zerwürfnisse hatte rein äußerlich darin gelegen, daß Heino sich eines Tages die salbungsvollen Vorwürfe verbat, zu denen Onkel Reineke sich jedesmal verpflichtet fühlte, wenn er dem Neffen mit einem kleinen Darlehen aushelfen mußte. Der wirkliche Grund aber lag tiefer, und zwar in der einfachen Tatsache, daß Heino keine Lust verspürte, sich von seiner Kusine Adelheid an den Traualtar führen zu lassen. Die nicht mehr ganz jugendliche Dame nämlich, die ungefähr im fünfzehnten Lawn-Tennis-Semester stand und seit ebensovielen Wintern jedes Wohltätigkeitsfest unsicher machte, hatte sich’s in den Kopf gesetzt, ihren Vetter Bergkem zu heiraten. Und als Heino ihren deutlichen Annäherungsversuchen hartnäckig auswich, hatte es eine wenig erquickliche Szene gegeben. Onkel Reineke sprach von schnödem Undank und dergleichen. Heino fragte, ob er’s von seinen anderen Geschäften her gewöhnt wäre, so hohe Wucherzinsen zu nehmen. Der Onkel gab zur Antwort, ein derartig verbummelter Mensch müßte überhaupt froh sein, in einer anständigen Familie unterzukommen, und der Bruch war fertig. Ein Bruch, wie er nur unter nahen Verwandten eintreten konnte. Denn fremde Menschen sagen einander die letzten Wahrheiten nicht so schonungslos ins Gesicht ...
Danach kostete es also ein großes Stück Selbstüberwindung, den Weg nach der Joachimsthaler Straße noch einmal einzuschlagen, aber es ging nicht anders, und auch Onkel Reineke mußte einsehen, daß in diesem Falle jeder kleinliche Groll zu schweigen hatte. So rachsüchtig war er denn doch wohl nicht, daß er ihn in der Not ein paar scharfe Worte entgelten ließ, die in der Erregung gefallen waren ...
Und zu Anfang ging es ganz leidlich. Die Kusine Adelheid war allein zu Hause, erzählte von ihren Balltriumphen in den letzten Monaten und machte ihre süßesten Augen, und nach einigen Minuten kam der Onkel aus dem Nebenzimmer. Verzog das faltige Gesicht mit den leicht geäderten Rotweinäuglein zu einer erstaunten Grimasse.
„Ei, sieh da, der Herr Neffe!“
Und als Heino aufstand, er bäte um die Erlaubnis, ihn ein paar Minuten lang allein sprechen zu dürfen, rieb er sich die Hände.
„So, so, ganz allein? Na, denn geh’ nur, mein Töchterchen, und hast Du dem Vetter schon Dein Geheimnis verraten?“ ...
„Noch nicht, Papa,“ erwiderte Fräulein Adelheid und verließ mit verschämtem Erröten das Zimmer.
Onkel Reineke aber ging erst ein Weilchen auf und ab und blieb schließlich stehen, die Hände auf dem sanft gerundeten Bäuchlein gefaltet.
„Also, lieber Heino, falls Du nach Deinem Mißgeschick im Examen — der Kollege Breidtschwert hat’s mir schon vor mehr als ’ner Stunde telephonisch nach dem Amte gemeldet, und Du erinnerst Dich vielleicht, daß er in Deiner Prüfungskommission saß — ja also, wenn Du vielleicht jetzt bezüglich meiner Tochter Deinen Sinn plötzlich geändert haben solltest, so bedaure ich, Dir mitteilen zu müssen, daß es dafür zu spät ist. Ein jüngerer, in mein Amt versetzter Kollege bewirbt sich ernsthaft um ihre Hand. Ich bin geneigt, diesem Liebesbunde meinen väterlichen Segen zu geben.“
Heino griff sich nach dem Halse, ein Ekel stieg ihm auf, aber er bezwang sich.
„Lieber Onkel, ich gratuliere. Aber Du irrst Dich, ich bin nicht hergekommen, um mir bei Adelheid einen Korb zu holen, ich brauche Deine Hilfe. Für heute handelt sich’s nur um eine verhältnismäßig geringfügige Summe, aber ich habe eine schwere Zeit vor mir, in der ich selbst noch nichts verdienen kann, und da wäre es mir eine rechte Beruhigung, wenn ich auf Deinen Beistand zählen könnte.“
Onkel Reineke zog die Augenbrauen in die Höhe, so daß die fuchsige Perücke sich an der Stirn leicht anhob.
„Ach, sieh mal an! Und ich hatte immer geglaubt, Du machtest in den Spekulationen mit dem Vermögen Deiner Schwester geradezu glänzende Geschäfte?!“
Da stöhnte Heino auf. Jetzt wußte er, wer bei seiner Mutter den heimtückischen Angeber gespielt hatte, aber er bekämpfte wacker den aufsteigenden Zorn.
„Onkel, höhn’ mich nicht noch dazu, Du weißt nicht, wie es in mir aussieht! Und sag’ ja oder nein. Mit Vorwürfen bin ich von mir selbst aus schon reichlich versehen!“
„Also denn nein!“ Der Oberverwaltungsgerichtsrat von Hegelingen richtete sich auf und schob den Zeigefinger mit dem Wappenring in die Weste. „Wer so ruchlos und freventlich ...“
Weiter kam er nicht, denn Heino fiel ihm mit einem bittern Auflachen ins Wort.
„Lieber Onkel, laß sein! Zum Wüstenprediger fehlt Dir jeder Beruf! Spielen tust Du auch, Deine patentierte Frömmigkeit hält Dich nicht davon ab, zuweilen ein leckeres Früchtchen von dem verruchten Giftbaum der Börse zu pflücken, und das übrige, der sogenannte lasterhafte Lebenswandel? Lieber Onkel Reineke, mancher treibt ihn noch in seinem hohen Alter, aber selbstredend nur zu Studienzwecken und um sich hinterher sittlich über das wohlgefällig Gesehene zu entrüsten! Und nun gehab’ Dich wohl, mehr haben wir uns in diesem Leben wohl nicht zu sagen!“
Onkel Reineke sprang erst zur Tür des Nebenzimmers, um sich zu vergewissern, daß seine Tochter wieder einmal gelauscht hatte, dann hob er die Hand mit dem Wappenring und donnerte so laut wie es sein Asthma zuließ: „Hinaus! Hinaus! Du schnöder Verleumder, der sich nicht entblödet, ernsten Männern unsittliche Motive unterzuschieben, wenn sie in den Höhlen des Lasters ...“
„Sich auch mal amüsieren wollen,“ vollendete Heino, als dem andern der Luftmangel die Stimme abschnitt, „und streng Dich nicht an! Pathos unter zweien, die sich gut kennen, ist unnütze Kraftverschwendung. Ich wünsche Dir herzlich, Du sollst auch mal irgendwo eine Viertelstunde lang um Dein Leben betteln, aber hab’ keine Angst, dieser Wunsch geht, wie alle frommen Wünsche, nicht in Erfüllung. Du bist ein braver Mann und wirst mal im Herrn sterben!“
Draußen vor der Tür spie er heftig aus, und es war ihm ordentlich leicht zumute, daß er nach der heimtückisch vorbereiteten Ablehnung sich nicht noch weiter in nutzlosen Bitten gedemütigt hatte. Lieber zu einem Wucherer gehen und Blutzinsen zahlen, als jeden Hundertmarkschein mit einer Erniedrigung zu erkaufen ...
Es dunkelte schon, als Heino die Treppe zu seiner Wohnung emporstieg. Müde und zerschlagen und in einer Art gleichgültigen Stumpfsinns, denn alle Versuche, wenigstens die Summe aufzutreiben, die er am Abend zurückerstatten mußte, waren vergebens gewesen. Den einen der in der Lebewelt bekannten Wucherer hatte er nicht zu Hause getroffen, der zweite mußte erst Erkundigungen einziehen, und der dritte wollte das Geld in emaillierten Kochgeschirren und einem fehlerfreien Damenreitpferd beschaffen, falls der Herr Baron für den Wechsel noch eine zweite, einigermaßen sichere Unterschrift beibrächte.
Damit war ihm nicht gedient, denn der Klubkassierer hatte ihm ja keine Kochgeschirre geliehen, sondern bare zweitausend Mark, und die waren gegen zehn Uhr abends, der üblichen Klubstunde, fällig auf Ehrenwort. Also blieb nichts anderes übrig, als mit einer plausiblen Ausrede einen Aufschub zu erbitten, um morgen früh die Jagd nach den paar tausend Mark von neuem zu beginnen. Der bequeme Weg aus allen Sorgen und Nöten, an den er noch vor wenigen Stunden leichtfertig gedacht hatte, war jetzt ja, nach dem Briefe der Mutter, verriegelt für alle Zeiten ...
In dem halbdunkeln Zimmer stand einer vom Sofa auf, der dort wohl auf ihn gewartet hatte. Er mußte erst näher hinzutreten, um das Gesicht zu erkennen: der Kollege Brenitz! Er drehte das Licht auf und sagte in einem Tone, der scherzhaft klingen sollte: „Na, Kollege, wollen Sie mir kondolieren? Und entschuldigen Sie mich gütigst, daß ich Ihnen die dreihundert Mark nicht zurückgeben kann, aber ich bin nach meinem Desastre vor der hohen Prüfungskommission noch nicht recht zu mir gekommen.“
Peter trat ein wenig näher.
„Verzeihen Sie, ich hätte Sie heute nicht mehr belästigt, aber ich habe einen Auftrag.“
Heino hob den Kopf.
„Nanu? Sollte ich vielleicht unwissentlich einen gekränkt haben, und Sie wollen’s wieder einrenken?“
Peter Brenitz faßte nach seinem ins Rutschen geratenen Klemmer.
„Es handelt sich nicht um solche Unbeträchtlichkeiten. Vielleicht entsinnen Sie sich, daß Sie einmal vor Wochen aus meiner Wohnung und auf einem meiner Briefbogen nach Hause schrieben. Daher hat Ihr Fräulein Schwester wohl meine Adresse, und daher mag der Auftrag stammen, mit Ihnen ein paar Worte zu sprechen.“
Heino griff in die Tasche und steckte sich eine Zigarette an.
„Verbindlichsten Dank, lieber Kollege, aber haben Sie Gnade! Mir ist schon ganz elend vor lauter Selbstvorwürfen, und alle irgendwie erdenklichen Beleidigungen habe ich mir bereits eigenhändig zugefügt. Wenn Sie mir also nichts anderes zu sagen haben?!“
„O doch! Nur sollte ich Sie meinem Auftrage gemäß erst schonend vorbereiten. Und jetzt nehmen Sie Ihr Herz in beide Hände, Heino ...“
Er schrie auf: „Meine Mutter?“
„Ja, Ihre Frau Mutter ist heute mittag gegen zwei Uhr sanft eingeschlafen. Wenn es Ihnen ein Trost ist, mit Ihrem Namen auf den Lippen. Vorne an der Freitreppe erklang die Glocke, und da richtete sie sich freudig auf: Horch, Brigitte, die Nachricht. Er hat’s bestanden, der Heino ...“
„Ah, pfui Teufel über mich!“
Der lange Heino griff in die leere Luft, schwankte einen Augenblick und stürzte wie ein gefällter Baumstamm zu Boden. Eine Weile lag er regungslos, dann schrie er auf und stoßweises Schluchzen erschütterte seinen mächtigen Körper. „Ich Lump, ich Vieh, und speit mich an, alle, die Ihr herumsteht, ich habe meine Mutter gemordet. Wie ein brünstiges Tier rannte ich hinter meiner Leidenschaft her, ihr aber brach langsam das Herz ...“
Wie von Sinnen gebärdete er sich, riß die Haare und krallte die Nägel in den Teppich. Peter Brenitz aber kniete ratlos daneben, streichelte ihm den Kopf und sprach allerhand Worte, von denen er annahm, daß sie dem andern ein Trost sein könnten. Er trocknete ihm die Augen, wischte ihm den Schaum vom Munde, tröstete und barmte, bis er den Verzweifelten allmählich vom Boden in einen Stuhl brachte. Dann aber rüttelte er ihn an der Schulter.
„Jetzt nehmen Sie sich zusammen, Heino, in anderthalb Stunden geht Ihr Zug. Ihre Schwester steht ganz allein da und hat außer Ihnen keine Hilfe!“
Heino stöhnte ratlos auf: „Ich ... ich ...“
„Ja, ich weiß. Sie haben mir’s schon vorhin gesagt, daß Sie in all dem Wirrwarr keine Zeit hatten, auf die Bank zu gehen, aber was liegt daran? Wenn Sie zurückkommen, geben Sie’s mir wieder. Die Geschichte mit dem Klubkassierer bringe ich gleich nachher in Ordnung, und hier sind zweitausend Mark — Sie müssen entschuldigen, aber mehr habe ich nicht bei mir. Ich schicke morgen einen Kranz, vielleicht haben Sie die Güte, ihn auf das Grab Ihrer Frau Mutter zu legen. Sie war gut und freundlich zu mir, und es tat mir damals von Herzen leid, daß die Verhältnisse mich nötigten, nach so kurzer Bekanntschaft wieder fortzugehen.“
Heino hatte mit einer mechanischen Bewegung das Geld in die Tasche geschoben, eine ganze Weile saß er schweigend, nur seine Brust hob und senkte sich in mächtiger Bewegung.
„Womit verdiene ich das alles bloß?“ Es klang fast wie ein Aufschrei. Peter Brenitz aber lächelte nur trübe.
„Das haben Sie mich, wenn ich mich recht erinnere, schon einmal gefragt, als ich mich wie ein Pharisäer über Sie erhob. Und da ist mir nachher eingefallen, es wäre vielleicht manches besser auf der Welt, wenn die Menschen einander nicht immer so viel nachrechnen wollten. Im guten nicht und nicht im bösen ...“
Der lange Heino atmete tief auf und zog den andern in seine Arme, sah ihm fest in die Augen.
„Es ist gut, Peter Brenitz, wollen nicht rechnen, sonst ständ’ ich vielleicht noch kläglicher da. Aber der Teufel hol’ mich, wenn ich Dir diese Stunde jemals im Leben vergesse!“ — — —
Peter hatte den Freund zur Bahn gebracht und, während sie in der weiten Halle auf und nieder schritten, um den Zug zu erwarten, manches mit ihm besprochen, was die nächste Zukunft anging. Heino, wie immer rasch von Entschluß, hegte die Absicht, den ihm ohnedies wenig zusagenden Beruf des Juristen an den Nagel zu hängen und sich der Bewirtschaftung des heimatlichen Gutes zu widmen. Diesen Entschluß hielt er in seiner Lage für den einzigen Weg, sich und der Schwester eine bescheidene Existenz zu gründen, während ein schleuniger Verkauf bei der Lage der Verhältnisse zu einem gänzlichen Zusammenbruche führen mußte. Peter jedoch widersprach eifrig und führte allerhand Gründe ins Feld, die diesen Plan wenig aussichtsvoll und verlockend erscheinen ließen. Zum ersten verstände Heino doch wohl nicht genug von der Landwirtschaft, um sich an eine so schwierige Aufgabe zu wagen, zum zweiten aber wäre er nicht der Mann, bei so mühseliger und wenig Ertrag verheißender Arbeit auszuharren. Anlage und Begabung wiesen ihm vielmehr den Weg zu einer anders gearteten Tätigkeit, zu irgendeinem freien Berufe, mitten im modernen, großzügigen Erwerbsleben, in dem er all seine reichen Gaben und Fähigkeiten voll entfalten könnte.
In Heinos blauen Augen leuchtete es auf, er sah sich schon an der Spitze eines riesenhaften Unternehmens, in dem er mit zäher Arbeit und frisch zupackender Energie ungemessene Werte schuf.
„Das wär’ schon was für mich, aber wo herkriegen und nicht stehlen?“
„Man müßte eben danach suchen,“ erwiderte Peter, „und wenn es zu Anfang vielleicht auch nur ein bescheidener Platz ist, so bietet er doch die Gelegenheit zu raschem Aufsteigen. Da geht’s danach, was einer leistet, nicht aber nach der Ochsentour der sogenannten Anciennität.“
Er hatte schon seinen Plan für die Zukunft des Freundes, nicht erst seit heute und gestern, ehe er aber seiner Sache selbst noch nicht sicher war, mochte er sich nicht näher darüber auslassen.
„Schön,“ sagte Heino, „aber meine Schwester? Ich kann das arme Ding mit seinem Kummer doch nicht in ein Pensionat sperren, wenn ich hier irgendwo als Lehrling anfange?“
Peter griff nach seinem Klemmer und sah ein wenig verlegen zur Seite, denn er wußte jetzt ganz genau, daß er in diesem Augenblicke höchst eigensüchtigen Zielen nachging.
„Fräulein Brigitte? Nun, was hindert Sie — entschuldige — was hindert Dich daran, mit ihr hier eine gemeinschaftliche Wohnung zu beziehen? Wenn ich mich recht erinnere, sprachst Du vor einiger Zeit davon, sie hätte die Absicht, sich der Krankenpflege zu widmen. Wo könnte sie diese Absicht besser verwirklichen als in Berlin? Niemand kennt sie hier, niemand fragt nach ihren Gründen, und falls ihr der Beruf eines Tages vielleicht nicht mehr zusagen sollte, wird’s ihr niemand verargen, wenn sie ihn wieder aufgibt.“
Und Heino hatte den Freund verstanden. Trotz allen schweren Kummers flog über sein Gesicht ein Lächeln.
„Das klingt nicht dumm und hat was für sich. Jedenfalls will ich’s ernsthaft mit ihr besprechen!“
Und unwillkürlich flogen seine Gedanken zu einer Stunde zurück, da er mit einer jetzt Dahingegangenen andere Pläne für Brigittes Zukunft geschmiedet hatte. Seither hatten sich die Zeiten gewandelt und sein Sinn mit ihnen. Was er damals mit schroffem Hochmute von sich gewiesen, erschien ihm heute als ein erstrebenswertes Ziel, denn der Kleine da neben ihm war ein herrlicher Mensch, ein besserer Edelmann vielleicht als mancher, der sich stolz mit den Verdiensten seiner Ahnen brüstete ...
Der Zug, der nach dem Osten führte, rollte donnernd in die weite Halle. Weißlicher Dampf erfüllte den hochgespannten Bogen. Gepäckträger und hastende Reisende drängten eilig zu den geöffneten Türen. Heino schlang dem Freunde den Arm um den Hals und küßte ihn auf den Mund.
„Leb wohl, kleiner Peter, Dank für alles! Und, wenn ich heimkomm’, darf ich grüßen?“
Er schwang sich auf das Trittbrett. Der andere aber suchte nach der passenden Erwiderung, bis der Zug sich schnaufend und fauchend in Bewegung setzte. Eine jäh aufsteigende Hoffnung war ihm ins Herz gedrungen und hatte ihm ein paar Augenblicke lang die Rede verschlagen. Nachdem er aber endlich die richtigen Worte gefunden hatte, war der Zug längst schon zur Halle hinaus, nur ein paar rote Laternen leuchteten noch im Dunkel auf, um bei der nächsten Biegung zu verschwinden. Der Bahnsteigbeamte zog an dem Signalmaste eine neue Tafel, neue Fahrgäste drängten sich in der Halle, jeder seinem Ziele zu. Peter aber stand noch geraume Zeit auf der Stelle, an der er von dem Freunde Abschied genommen hatte. Und seine Gedanken flogen dem eilenden Zuge voraus, an dem Ufer des Sees entlang, über kahle Hügel mit dürftigem Wacholdergestrüpp und schweigendem Tannenwald zu einem alten Hause unter ragenden Linden. Dort saß eine, lauschte dem Wehen des Frühlingswindes, der hier sein heimliches Werben trieb wie dort, und hielt mit bangem Herzen die Totenwacht am Bette der Mutter. Grämte sich und barmte in ihrer Verlassenheit und wußte vielleicht nicht, daß fern von ihr einer sich in Sehnsucht verzehrte, bereit, sein Leben hinzugeben, um auf das Gesicht der armen Prinzessin wieder ein Lächeln zu locken ...
Hinter einem der vergitterten Erdgeschoßfenster des Hauses Brenitz in der Behrenstraße war Licht. Der alte Herr Geheimrat saß einsam in seinem Privatkontor und sann irgendeinem weitausschauenden Plane nach. Aber die sonst so schaffensbereiten Gedanken fügten sich nur mühsam dem zwingenden Willen, ganz als wären sie müde geworden. Sie blieben schließlich an einem leeren Platze haften, zu dem einer trotz aller Mahnungen nicht den Weg finden wollte ..
Draußen im Flur erklang die Glocke. Der alte Herr hob überrascht den Kopf, und eine kurze Weile danach trat der auf die Schwelle, dem seine sehnenden Gedanken gegolten hatten. Und er nahm die plötzliche Erscheinung als ein gutes Zeichen für die Erfüllung seiner heimlichen Wünsche, aber er verbarg die unwillkürlich aufsteigende Bewegung hinter einem Scherzwort.
„Nanu, Peter? Wo brennt’s denn, daß Du so spät noch Deinen alten Onkel aufsuchst?“
Peter folgte nicht der einladenden Handbewegung, sondern blieb stehen. Und in einem Atem sprudelte er das Anliegen heraus, das ihn in das väterliche Stammhaus geführt hatte.
„Lieber Onkel, Du hast mich oft gefragt, ob ich nicht hier in diesem Kontor den Platz einnehmen wollte, an dem einmal vor Zeiten mein Vater gesessen hat. Ich selbst kann ihn nicht ausfüllen, denn mir fehlt alles, was dazu nötig wäre, aber ich wüßte Dir einen, der an meine Stelle treten könnte. Ein prächtiger Mensch, den der liebe Gott in einer besonders guten Stunde erschaffen hat, treu, offen und bieder, dabei aber von erlesener Klugheit. Wenn andere sich mühsam den Kopf zerbrechen, hat er längst schon die Lösung. Er war bisher Jurist, aber der eng umschlossene Beruf gewährt ihm wenig Befriedigung. Er sucht etwas anderes, wo er seine großen Fähigkeiten besser verwerten könnte.“
„So, so,“ sagte der alte Herr. „Das klingt ja sehr verlockend und kommt meinen Wünschen recht entgegen. Ich suche auch schon lange nach einem, auf dessen Schultern ich ein Teilchen von meinen Lasten abladen könnte. Nur vertrauen müßte ich ihm können wie Dir, denn hier in diesem Hause spinnt sich manches an, was verfehlt wäre, wenn man’s vorzeitig auf die Gasse tragen würde.“
„Vertrauen?“ Ueber Peters schmales Gesicht flog ein Lächeln. „Würde ich wohl für ihn eintreten, wenn ich für ihn nicht bürgen könnte, wie für mich selbst?“
Der Geheimrat Brenitz stand auf, der Fall fing an ihn zu interessieren.
„Wie heißt denn der Freund, für den Du Dich so ins Zeug legst?“
„Heino Freiherr von Bergkem!“
„Sieh mal an! Die Traditionen der Väter setzen sich also in den Söhnen fort! Der Name ist immerhin eine gewisse Empfehlung. Aber, verzeih, wenn ich in einer so wichtigen Frage ein wenig vorsichtig bin. Ein junger Herr aus altadligem Hause, der sein Fortkommen in einem Bankgeschäft sucht, ist eine etwas ungewöhnliche Erscheinung, Du wirst es mir also wohl nachsehen, wenn ich nach den Gründen forsche.“
Da senkte Peter, ein wenig beklommen, den Kopf.
„Er ist heute im Assessorexamen durchgefallen und hat gestern im Klub sein letztes Geld verspielt.“
Der alte Herr lachte belustigt auf.
„Das ist allerdings eine seltsame Empfehlung! Und wenn ich sie in einer trockenen Auskunft lesen würde, glaube ich nicht, daß ich mich mit diesem Herrn von Bergkem noch lange beschäftigen würde. Aber ich schätze, Du wirst nicht bloß in blinder Freundschaft gehandelt haben, sondern aus dem Gefühl heraus, Deinem alten Oheim und der väterlichen Firma einen Dienst zu erweisen?“
„Lieber Onkel,“ sagte Peter mit einem tiefen Aufatmen, „das ist das rechte Wort. Und wer weiß, ob mein Freund Heino ohne dieses doppelte Unglück sich bereit finden lassen würde, in irgend jemandes Dienste zu treten. Trotz seines Durchfalles ist er vielleicht ein besserer Jurist als alle, die neben ihm das Examen bestanden haben. Was aber seine Leidenschaft für das Kartenspiel anlangt, so glaube ich aus ganz besonderen Gründen, er ist geheilt für alle Zeiten. Seine Mutter hat sich’s so zu Herzen genommen, daß sie darüber vor Kummer und Gram gestorben ist.“
„Tut mir leid,“ erwiderte der Geheimrat Brenitz, aber es war ungewiß, was er damit meinte. Den Tod der alten Dame oder die Heilung des Freiherrn von Bergkem von seiner Leidenschaft. In der Schilderung des Neffen war manches, was ihn lockte, diesen jungen, so vielfältig begabten Menschen einmal anzusehen; wie es aber seine Art war, lenkte er das Gespräch in eine andere Bahn, um unterdessen Zeit zu reiflicher Ueberlegung zu finden. Und was hätte ihm wohl näher gelegen als die Ereignisse in der eigenen Familie?
„Apropos, hast Du in der letzten Zeit mal die geborene Guggenheimer gesehen? Nicht? ... Das tut mir leid, so klein ist sie nach der Scheidung geworden!“ Und er deutete mit der Rechten eine ganz unwahrscheinlich niedrige Entfernung vom Boden.
„Geht herum mit ’nem Gesicht, als wenn sie immer um Entschuldigung bitten wollte, und interessiert sich neuerdings für die Liste der unverheirateten Rechtsanwälte, was meiner Ansicht von vornherein das Richtige gewesen wäre. Leider um einiges zu spät, denn meine arme Aelteste hat erst den verfehlten Umweg über diesen adligen Herrn von Krotthelm nehmen müssen, um einzusehen, daß sie eine närrische Mutter hat, und ich bitte Dich — was ist das schon für ’ne Sorte Rechtsanwalt, unter der sie als Geschiedene jetzt noch die Auswahl hat? Keiner aus dem Tiergartenviertel und aus den alten Familien, denn die haben’s nicht nötig, ihre Frauen second hand zu kaufen. Also irgendeinen jungen Mann aus Breslau oder Posen oder noch weiter her. Und ich, der Geheimrat Brenitz, muß tief in den Geldschrank steigen, um seine Liebe zu wecken! ... Seit heute früh aber hat die geborene Guggenheimer einen neuen Sport. Sie sucht nach ’nem Lebensretter für meine Zweite, die Frida.“
„Verzeih,“ sagte Peter,„ aber das ist mir unverständlich.“
„Mir auch,“ erwiderte der Geheimrat, „aber sie sucht nach ihm und setzt mir zu, mich an diesen Recherchen zu beteiligen. Am liebsten hätte sie schon eine Annonce in ihrem Leiborgan losgelassen, aber ich hab’s ihr begreiflich gemacht, der, den’s angehen könnte, schiene mir seinem ganzen Verhalten nach kein gewerbsmäßiger Leser des Heiratsmarktes zu sein.“
„Nimm’s mir nicht übel, lieber Onkel, aber das Ganze ist mir ein Rätsel. Ist denn Frida irgendwie in Gefahr gewesen, daß Du von einem Lebensretter sprichst?“
„Mein Söhnchen,“ erwiderte der alte Herr, „die Gefahr — Gott behüte — würde vielleicht erst anfangen, wenn sie diesen sogenannten Lebensretter persönlich kennen lernte. Ganz trocken aber erzählt, liegt die Sache so. Meine Frau ist gestern nacht gegen zwei Uhr von einem Wohltätigkeitsfest bei Kroll durch den Tiergarten nach Hause gefahren. Unterwegs in der Lichtenstein-Allee hatten sie eine Panne, und allerhand Gesindel sammelte sich um den Wagen. Da kam mit einem Male ein elegant gekleideter junger Mann aus dem Dunkel, verdrosch das Gesindel und entfernte sich nach getaner Arbeit wie der Ritter im „Handschuh“ von Schiller. „Den Dank, Dame, begehr’ ich nicht!“ Das, muß ich sagen, hat mir sehr gefallen, denn sonst sind solche Herren meistens schnell bei der Hand, an der zuständigen Stelle die Quittung zu präsentieren.“
„Hm,“ sagte Peter nachdenklich, „wie sah denn dieser Lebensretter aus?“ Eine gewisse Uebereinstimmung in der Zeit hatte ihn stutzig gemacht und die nachträgliche Feststellung, daß der lange Heino ebenfalls gegen zwei Uhr nachts den Weg nach dem Tiergarten eingeschlagen.
„Wie er aussah?“ erwiderte der Geheimrat, „nun, da gehen die Schilderungen ziemlich weit auseinander. Meine Tochter Frida sagt einfach, wie ein „Held“, in der Erzählung der geborenen Guggenheimer ist’s ’ne Art Kreuzung des Apoll von Belvedere mit unserem Landsmann Simson, der seinerzeit die Philister schlug. Mein Chauffeur aber sagt, es wäre ein eleganter junger Mann gewesen in Zylinderhut und langem Paletot, und er hätte mit der Rotte Korah erst sein lustiges Späßchen getrieben, ehe er sich daran machte, sie zu verdreschen.“
Da lächelte Peter still vor sich hin, denn jetzt glaubte er’s ganz genau zu wissen, wer dieser geheimnisvolle Lebensretter war, aber er empfand fast ein Gefühl des Neides gegen den Bruder Leichtfuß, der sich wieder einmal, vielleicht ohne es zu wollen, für seine zukünftige Laufbahn das beste Bett bereitet hatte ...
Nach einer Weile fragte er: „Lieber Onkel, verzeih, aber Du bist mir noch immer die Antwort auf meine Frage schuldig. Würdest Du also vielleicht geneigt sein, den Herrn von Bergkem in Dein Geschäft aufzunehmen? In irgendeiner Stellung, in der er nach angemessener Vorbereitung seine besonderen Fähigkeiten zeigen könnte, als Volontär etwa oder meinetwegen als Dein Privatsekretär?“
Der alte Herr Geheimrat hob den klugen Kopf mit dem mächtigen Schädel.
„Ich denke, darüber waren wir uns doch schon einig? Also schick’ ihn her, Deinen Freund, und ich will ihn mir ’mal ansehen. Aber — verzeih, im Augenblick nämlich hab’ ich’s wieder vergessen — wie hieß die Schwester dieses Herrn von Bergkem mit Vornamen?“
„Brigitte,“ antwortete Peter rasch, und zu spät erst merkte er mit jähem Erröten, daß er in eine geschickt gelegte Falle getreten war.
„So, so,“ sagte der alte Herr, „Brigitte! Ein sympathischer Name, und ich erinnere mich jetzt, ihn mal vor Zeiten, ehe Du krank aus Ostpreußen zurückkamst, in einer Auskunft gelesen zu haben. Du aber, mein Söhnchen, nimm Dich in acht, daß er Dir nicht etwa auch hier das Klima verleidet. Vielleicht ist’s nicht gesund für Dich, mit diesem Fräulein Brigitte ein und dieselbe Luft zu atmen.“ — — —
„Przygorowen, am Ostermontag.
Mein lieber Peter!
All die gleichgültigen Menschen, die eine halbe Stunde lang die Hügel auf unserem kleinen Kirchhof zertrampelt haben, sind fort. Mein liebes Mütterchen liegt draußen in der kühlen Erde, und ich sitze allein mit Brigitte in dem alten Hause der Bergkems. Es geht ans Abschiednehmen.
Es waren schwere Tage, und mich drückten sie doppelt nieder, denn ich stand als ein Schuldbeladener an dem Sarge meiner Mutter, aber all meine Reue weckte sie nicht mehr auf. Auch kein Schwur, von jetzt an ein neues Leben zu beginnen. Ein einziger Trost hielt mich aufrecht: daß sie noch nicht allen Glauben an mich verloren hatte, als sie sanft hinüberging. Daß ich mein Examen nicht bestehen könnte, war ihr ein unmöglicher Gedanke, und den Verdacht, daß ich ein rettungslos in seine Leidenschaft verstrickter Spieler geworden wäre, hatte die gute Brigitte ihr wieder ausgeredet. Ich hab’ dem lieben Mädel die Hand geküßt, und ich glaube, ich bin in dieser Stunde ein anderer Mensch geworden. Auch vor Dir, lieber Peter, möchte ich mich nicht heftig verschwören, sondern nur sagen, Du darfst mich Deinem Herrn Oheim ruhig empfehlen. Ich will ihm ein treuer Mitarbeiter sein, soweit es in meinen Kräften steht, und hoffe, mir seine Zufriedenheit zu erwerben.
Zu dem Begräbnis war, was man so sagt, der gesamte Adel der Umgegend erschienen. Es war wenig echte Teilnahme dabei, aber viel Neugierde. Die meisten waren wohl gekommen, um zu sehen, was der durchgefallene Heino Bergkem für ein Gesicht machen wird bei dem gänzlichen Zusammenbruch seines Hauses. Da war mir Dein lieber Brief eine rechte Stütze, ich trug meinen Kopf hoch und konnte auf alle mitleidigen Fragen nach meinen Zukunftsplänen eine den Hörern mißliebige Antwort geben. Ich träte als nationalökonomischer und juristischer Beirat in ein großes Berliner Bankhaus, gegen Gehalt und Tantième, und hoffte, in nicht allzu langer Zeit eine ausnehmend einträgliche Stellung zu haben. Darauf sagten sie: „Sieh mal an, was es in diesem Berlin doch für dolle Sachen gibt, und gratuliere herzlich“. Du aber, Peterlein, verzeih, wenn ich nicht ganz der Wahrheit gemäß meine Lehrlingsstellung in dem Hause Deines Oheims mit so hochtrabendem Titel bezeichnete. Nichts ist mir verhaßter als geheucheltes Mitleid, hinter dem sich die Schadenfreude birgt, und sollte ich vor diesen Menschen, über die ich mich mein Leben lang lustig gemacht hatte, wie ein Bettler dastehen? Da ersetzte ich also, wie es in dem alten Studentenspruche heißt, den mangelnden Sommerüberzieher durch eine schneidige Haltung und schnurrte sie ein wenig an.
Unter den Leidtragenden befand sich auch die Gräfinmutter aus Hellingenau mit ihrer Tochter. Der große Hanns war aus Dir ja bekannten Gründen ferngeblieben. Die Wunschmaid ist womöglich noch größer und stärker geworden, sah mich freundlich an und schüttelte mir fast den Arm aus dem Schultergelenk. Ich glaube, ich würde noch heute bei ihr eine günstige Aufnahme finden, wenn ich fragen wollte: „na, Hella, wie ist’s mit uns beiden?“ Aber mir fehlt zu der Rolle einer Art von Prinzgemahl jeder Beruf. Ich möchte mir mein bißchen Geld selbst verdienen, habe außerdem ein viel zu schönheitsdurstiges Auge für das, was alle Tage um mich sein soll bis an mein seliges Ende, und wenn ich die Mutter ansehe, schaudert’s mich. Aber auch die Wunschmaid liebt mich wohl nur aus proportionalen Gründen. Wenn sie einen Jüngling findet, der zu ihrer Länge ebenso gut paßt wie ich, wird sie sich trösten.
Also der große Hanns war nicht gekommen, um meiner Schwester eine peinliche Begegnung zu ersparen. Dafür hat er seine Teilnahme anders gezeigt und sich dabei als ein anständiger Kerl erwiesen. Am Tage nach meiner Ankunft ließ er mich zu einer Unterredung entbieten. Wir trafen uns auf der Grenzscheide zwischen Przygorowen und Hellingenau und haben dort manches besprochen. Er will meine zweitausend Morgen kaufen und zahlt einen ordentlichen Preis. Meine Schwester und ich brauchen nicht ganz als Bettelleute in die Welt hinauszuziehen. Morgen vormittag ist die gerichtliche Auflassung, das letzte Stück Bergkemsche Erde geht den Weg seiner Vorgänger, und eins der altansässigen Geschlechter, die dieses Land einst erobern halfen, verliert wieder einmal seine Bodenständigkeit. Vielleicht daß der Letzte dieses Geschlechtes sich auf einem anderen Feld tüchtiger erweist. Und — lach nicht — ich habe mir einen Vorbehalt ausbedungen, das Recht, in einem Zeitraum von fünf Jahren dieses Stück Erde mit angemessenem Aufschlage für stattgehabte Meliorationen zurückzukaufen. Das klingt heute in meiner Lage sehr vermessen, aber ich habe ein Ziel und einen Ansporn. Und es tut zu wehe, hier von allem und für immer scheiden zu müssen.
Also meine Heimat will ich mir wiedererobern in fünf Jahren Arbeit, der weiße Wappenvogel meines Geschlechts, der Falke, der nach einer alten Familiensage einst über den Bergen Thüringens flog, soll in gemessener Frist den Platz wiederfinden, an dem er vierhundert Jahre lang und noch etliche mehr gehorstet hat. Und ich fühle, es wird mir gelingen. Arbeiten will ich von früh bis spät, aber ich weiß es gewiß, es wird auch ein Quentchen Glück dabei sein. Besinnst Du Dich noch auf das alte Märchen, das ich Dir erzählte, als ich Dir zum ersten Male das Stück kärglichen Sandbodens zeigte, von dem mir heute der Abschied so schwer wird? —
Mit Brigitte hab’ ich gesprochen. Sie kommt gern nach Berlin. Was soll sie anders tun? Wo ich meinen Zeltpfahl einstecke, ist ihre Heimat. In dem Berufe einer Krankenpflegerin hat sie sich in diesen schweren Wochen geübt, und er bedeutet für sie keine Entsagung. Ich aber stehe dabei und schüttle manchmal den Kopf, wenn ich denke, das soll der letzte Ausgang für ein Mädel sein, das einst mit lachenden Augen ins Leben sah. Aber ich mag ihr nicht dreinreden, denn ich habe schon einmal mit ungeschickter Faust in ihr Leben gegriffen. Wir gedenken eine bescheidene Vierzimmerwohnung zu nehmen — vielleicht hast Du die Güte, Dich nach einem passenden Losament mit guter Verbindung zur Behrenstraße umzusehen — und morgen geht von hier ein Möbelwagen mit dem Notwendigsten fort. Altes Gerümpel zum großen Teil, das kaum noch die Transportkosten verlohnt, und ein paar Bilder, aber man kann sich dazwischen vielleicht manchmal einbilden, man wäre immer noch zu Hause. Bei dem Preise der Wohnung bitte ich tausend Mark pro Jahr nicht zu überschreiten, wir leben vom Kapital und müssen sparsam sein. Nur etwas Grünes müßte vor den Fenstern sein, damit meiner Schwester der Uebergang nicht allzu schwer wird.
Auch in Stradaunen war ich in diesen Tagen, weil ich auf dem Amtsgericht wegen der Auflassung zu tun hatte. Fräulein Trudchen liebt nach wie vor den jeweilig jüngsten Referendarius, aber ich glaube nicht, daß sie bei dieser Tätigkeit den gewünschten Erfolg erzielen wird. Die jungen Juristen heutzutage sind flatterhaften Sinnes, schwärmen nicht mehr für Chopin und wissen ein gediegenes Herz unter unscheinbarer Hülle nicht zu schätzen. Ich glaube, sie wird ihre Tage als Klavierlehrerin beschließen.
Das Grand Hotel steht noch immer, und Herr Popiella läßt Dich in hochachtungsvoller Erinnerung an die trotz achttägigen Aufenthalts voll bezahlte Vierteljahrsmiete bestens grüßen. Er hat sich von dem Sündengeld eine neue Veranda gebaut.
An dem langen Stammtische der Mittagsgesellschaft lauter neue Gesichter, nur der Herr Provisor thront nach wie vor auf dem Präsidentensitz als letzte Säule entschwundener Pracht. Das Wiedersehen war schmerzlich bewegt, und seine erste Frage galt Dir! Du bist seine glorreichste Erinnerung, und ich glaube, er wartet nur auf das Hinscheiden des letzten lebenden Augenzeugen — Herr Popiella ist stark asthmatisch geworden von seinen ewigen Erwärmungsgrogs, aber erfreut sich immer noch eines ungetrübten Gedächtnisses — also Herr Kellmigkeit wartet auf sein seliges Ende, um seiner Erzählung von dem mit Dir ausgefochtenen Pistolenduell einen explosiven Schlußeffekt geben zu dürfen. Ich teilte ihm mit, ich hätte damals zur Verhinderung jedes blutigen Ausganges die Pistons der beiden Mordinstrumente feuersicher verstopft, und wir schieden in erheblicher Verstimmung. Aber ich vermute, nach einigen Jahren wird man Dich schwerverwundet von dem Schauplatze des Zweikampfes tragen, und nur seinem Edelmute wird es zu danken sein, daß er seine berühmte Schießfertigkeit nicht besser ausnützte, Dir die wohlverdiente Todesstrafe erließ. Ich habe selbst genug Jagdgeschichten erzählt in meinem Leben und glaube ihr allmähliches Wachstum aus schüchternen Anfängen zu kennen.
Ich bin ins Plaudern geraten, aber ich plaudere gern mit Dir, Peterlein, und ich meine, die Freundschaften sind nicht immer nach dem Scheffel Salz zu messen. Vielleicht wirst Du in Deinem ernsthaften Sinn denken, welche Unbeträchtlichkeiten in so schwerer Stunde! Aber wenn es ans Abschiednehmen geht, werden die Kleinigkeiten wertvoller als große Erlebnisse.
Brigitte läßt Dich herzlich grüßen und freut sich, Dich wiederzusehen. Eben tritt sie in Hut und Mantel an meinen Schreibtisch, um mich abzuholen. Wir wollen an einen frischen Hügel gehen, unserm Mütterchen gute Nacht sagen.
In Treue Dein Freund
Heino.“
Diesen Brief teilte Peter in bereits stark zerlesenem Zustande seinem Oheim mit, damit er sich daraus vielleicht ein besseres Bild seines künftigen Privatsekretärs entnähme als aus langatmigen Schilderungen. Aber der Erfolg entsprach eigentlich nicht recht seinen Erwartungen. Der alte Herr las zwar aufmerksam und lange, am Schlusse jedoch sagte er nichts weiter als:
„Du hast mich recht neugierig gemacht. Ein sehr sympathischer junger Mann, dem es anscheinend mit seinen Vorsätzen ernst ist, und ich liebe die Draufgänger, die an sich und ihren Stern glauben. Ob er aber ein tüchtiger Geschäftsmann wird, darüber wollen wir uns nach einem Jahre sprechen!“
Danach begab sich Peter auf die Wohnungssuche, lief treppauf und treppab, und wenn er sich prüfend in den Räumen umsah, zog er einen Brief aus der Tasche, anscheinend um nachzusehen, ob das Gelaß auch den gestellten Anforderungen entspräche. In Wirklichkeit war es ihm nur um zwei Zeilen zu tun, die er schier tausendmal wohl schon gelesen hatte, ohne sich an ihnen satt sehen zu können: „Brigitte läßt Dich herzlich grüßen und freut sich, Dich wiederzusehen.“ Sie freute sich darauf, ihn wiederzusehen, also hatte sie doch seiner zuweilen gedacht, die blonde Brigitte! ...
Und nichts war ihm gut genug, was er prüfte, als er aber endlich zu dem vorgeschriebenen Preise eine leidlich passende Wohnung gefunden hatte, weit draußen am Charlottenburger Bahnhofe mit dem Blicke auf buschbepflanzte Rasenböschungen, ließ er eine Wagenladung frischer Blumen in die Zimmer schleppen, um ihr im Augenblicke der Ankunft wenigstens einen Ersatz für die kümmerliche Aussicht zu bieten. Und unter Hangen und Bangen kam die Stunde heran, in der er sich endlich, viel zu spät für seine zehrende Ungeduld, an den Bahnhof begeben durfte.
Der Zug fuhr donnernd und dröhnend in die hohe Halle, er stand mit einem Blumenstrauß in der Hand auf dem Bahnsteig, und das Herz schlug ihm bis in den Hals vor banger und freudiger Erwartung. Ein langer Arm winkte aus einem offenen Fenster. „Halloh, Peter, hier sind wir,“ aber der Wagen rollte weiter, er mußte sich erst durch eine drängende Menge mühsam den Weg bahnen, um an den richtigen Platz zu gelangen. Und da kam er um einiges zu spät, die Geschwister waren schon ausgestiegen, und die Begrüßung verlief nüchterner, als er sich’s erhofft hatte. Der lange Heino umarmte ihn herzlich, Fräulein Brigitte jedoch hatte ein Gepäckstück im Coupé zurückgelassen, das sich hinterher zwar schon im Besitze des Trägers wiederfand, immerhin aber einige Aufregung verursachte. Und Peter vermehrte noch ihre Beschwerden, denn der mit einigen stotternden Worten überreichte Blumenstrauß war neben einigen Schirmen, einem Täschchen und vielerlei kleinen Paketen nur schwer unterzubringen.
Da streckte sie ihm bloß einen Finger entgegen im schwarzen Handschuh, „ich danke sehr, lieber Herr Brenitz,“ und der Augenblick, dem er mit Herzklopfen entgegengesehen hatte, war vorüber. Rührend sah sie aus in ihrem schwarzen Trauerkleidchen, wie eine holdselige Verkörperung allen Schmerzes, aber es verletzte ihn tief, daß sie in diesem feierlichen Momente keine andere Sorge kannte als die Wiedererlangung eines wertlosen Gepäckstückes.
In befangener Stimmung wurde die Fahrt nach dem Hotel zurückgelegt. Die Geschwister begaben sich nach oben, und Peter wunderte sich nicht weiter, als nach einiger Zeit Heino allein wieder herunterkam und die Schwester entschuldigte, sie wäre von der langen Fahrt zu müde. Da empfahl er sich nach einigen belanglosen Reden und ging still nach Hause. Schalt unterwegs sich einen Toren, der in dem Wirrwarr einer Ankunft nach anstrengender Reise Unmögliches erwartet hatte. Eines aber blieb trotz aller Beschönigungsversuche haften: Um eine kleine Spur herzlicher hätte die blonde Brigitte ihn wohl begrüßen dürfen, wenn es ihr ähnlich zumute war wie ihm! Und auf allerhand leise Wünsche, die in diesen Tagen des Wartens emporgerankt waren, fiel jählings ein erkältender Reif ...
Heino von Bergkem stand in dem kleinen altmodisch eingerichteten Privatkontor in der Behrenstraße, und die erste Musterung war zu gegenseitigem Wohlgefallen ausgegangen. „Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Baron,“ hatte der kleine Handelsherr gesagt, und der lange Abkömmling eines alten Rittergeschlechtes erwiderte in geziemender Haltung:
„Bitte, nur Bergkem, Herr Geheimrat. Ein Lehrling steht vor Ihnen, der zuweilen wohl einen groben Rüffel verdienen wird, und da wäre der Freiherrntitel vielleicht ein gänzlich unangebrachtes Hindernis.“
„So, so,“ sagte der alte Herr Geheimrat und ein Strahl von Wohlwollen blitzte in seinen klugen Augen auf. „Das ist ja sehr nett von Ihnen, aber Sie irren sich. Der Freiherrntitel würde mich durchaus nicht stören, falls ich Veranlassung hätte, mit Ihnen grob zu werden. Wollen beide hoffen, daß es nicht nötig sein wird! Na, und nun schießen Sie mal los, Herr Baron, wie haben Sie sich eigentlich Ihre Stellung in meinem Hause gedacht?“
Heino hob die Achseln.
„Keinen Schimmer, Herr Geheimrat. Ich will lernen und arbeiten. Ob ich Ihnen irgendwie nützlich sein kann, wird sozusagen der Sektionsbefund ergeben. Meine Freunde rühmen meinen gesunden Menschenverstand, daneben verfüge ich noch von meinem vergeblichen Jurastudium her über einige Kenntnisse im Handelsrecht, aber ich weiß nicht, ob das reichen wird.“
„Hm,“ sagte der Herr Geheimrat wohlwollend, denn der Lange in seinem herzhaft-unbekümmerten Wesen gefiel ihm mehr und mehr. „Für einen intelligenten Menschen sind die technischen Kniffe unseres Handwerks ein Kinderspiel, mancher freilich lernt sie nie. Einem andern aber fliegen sie zu, wenn er sechsmal durch ein ordentlich geführtes Bureau geht. Aber das ist nicht das Wesentliche. Ich habe da zum Beispiel in meinem Kontor einen Buchhalter, der sieht ’ne ellenlange Zahlenreihe bloß an, schreibt ohne Rechnen die Summe unter den Strich. Ich irr’ mich dreimal, wenn ich bei ’ner Bridgepartie — Sie können doch hoffentlich Bridge? — das Resultat ausrechnen soll, aber dennoch bilde ich mir ein, ein leidlicher Bankier zu sein, und würde mich immerhin bedanken, das Additionsphänomen von einem Buchhalter zu Rate zu ziehen, wenn sich’s um eine neue argentinische Anleihe handelt. Also ich werde Sie sechs Wochen unter meinen alten Markuse stecken, damit Sie lernen, ‚Geld‘ von ‚Brief‘ zu unterscheiden, die übrige Erziehung soll meine Sorge sein.“
Und ein wenig ernster fuhr er fort: „Herr von Bergkem, ich fange an, alt zu werden und sehne mich nach einem, der mir die schwere Last der Geschäfte ein wenig erleichtert. Der dazu am nächsten wäre, geht anderen Zielen nach, und die übrigen aus der entfernteren Verwandtschaft, die sich dazu drängen, mag ich nicht. Kaum daß sie recht auf allen Vieren kriechen können, fangen sie mit den hier aufgeschnappten Tips auf eigene Faust zu spekulieren an. Ich möchte einen haben, dem ich glauben könnte wie mir selbst, seine Brust müßte wie ein Grab sein. Ich will Ihnen vertrauen, denn mein Neffe empfiehlt Sie. Ehe Sie aber einschlagen, bedenken Sie sich noch einmal. Die Enttäuschung könnte mich nicht nur Geld kosten — das läßt sich verschmerzen — sondern vielleicht noch einiges mehr. Und dazu bin ich zu alt, das möchte ich nicht mehr erleben.“
Heino sah den alten Herrn voll an.
„Herr Geheimrat, was soll ich Ihnen darauf erwidern? Ich habe manchen dummen Streich gemacht in meinem Leben, aber keinen schlechten, und noch nie hat ein Bergkem die Treue gebrochen. Ich will mich ehrlich zu Ihnen halten, und mein Wort muß Ihnen genug sein. Andere Bekräftigungsmittel habe ich nicht. Wenn’s Ihnen also recht ist, schlagen Sie ein!“
Und er streckte dem kleinen, gewaltigen Handelsherrn in ehrfürchtiger Haltung die Hand entgegen. Der Geheimrat Brenitz aber ergriff die gebotene Hand, schüttelte sie herzlich, und in seinen Augenwinkeln schimmerte es feucht. Die Gesinnung war lobenswert, und wenn die Leistungen sich auf der gleichen Höhe hielten, konnte er vielleicht auf seine späten Tage einen Lehrling finden, bei dem das Unterrichten eine Freude war ...
Er wandte sich zum Fenster, sah eine Weile lang in Gedanken durch das schwere Eisengitter des Erdgeschosses hinaus und sagte schließlich:
„Es ist da noch ein Punkt zwischen uns zu erörtern. Aus den Erzählungen meines Neffen weiß ich nämlich, Sie haben sich durch das Spiel in schwere Ungelegenheiten gebracht, und ich möchte Ihnen meine Meinung darüber nicht verhehlen. Ein großer Teil dessen, was wir heut’ in unserem Geschäfte treiben, ist auch nichts anderes als Spiel, nur daß wir uns einbilden, wir könnten die Chancen besser berechnen als bei den Karten. Und ich sage, wer nicht ein wenig Spielerblut in den Adern hat, ist auch kein rechter Bänker. Nur muß man immer den klaren Kopf oben behalten, genau wissen, wie weit man zu gehen hat. Das haben Sie anscheinend eine Zeitlang vergessen und sich in schwere Ungelegenheiten gebracht. Das ist doch aber nicht der Zweck dabei, denn das Spiel soll doch immer ein Vergnügen bleiben. Wenn Sie mir also versprechen, in dieser Hinsicht vorsichtiger zu werden, bin ich zufrieden.“
„Ich verspreche es,“ sagte Heino und atmete erleichtert auf. Nicht ohne Herzklopfen war er zu diesem Examen hingegangen, aber der Gewaltige des Bankhauses Samuel Brenitz sel. Witwe Söhne erwies sich als ein wohlwollender Prüfer, dem nichts Menschliches fremd war ...
„Na schön,“ erwiderte der alte Herr Geheimrat, „und haben Sie heute vormittag noch was Besonderes vor? Nicht? ... Na, um so besser, dann können wir gleich anfangen. Da drüben ist Papier, Feder und Tinte, bitte, schreiben Sie. Es handelt sich nämlich um ein Projekt, bei dessen Finanzierung unter Umständen ein großer Nutzen abfallen kann. Also oben drüber: „Streng vertraulich“. Und dann die Adresse: „Herrn Salomon Eisenberg in Chrzánow, Galizien. Im Besitze Ihres Geehrten vom 17. ds. betreffend Vorkommen von Petroleumquellen auf den Gütern des Herrn Grafen von Chelminski auf Chelmien, bin ich auf Grund der beigefügten Gutachten von Sachverständigen nicht abgeneigt, der Angelegenheit näher zu treten. Eventuell wäre ich bereit, in nächster Zeit persönlich dorthin zu kommen, um mich an Ort und Stelle näher zu informieren“ ...
„Verzeihung, Herr Geheimrat,“ sagte Heino und hielt im Schreiben inne, „würden Sie vielleicht die Güte haben, mich auf diese Exkursion mitzunehmen?“
„Mit Vergnügen, aber Sie müßten vorher ‚Franzefuß‘ lernen, denn Bridge en deux ist für zwölf Stunden Bahnfahrt zu langweilig. Und glauben Sie, daß Sie mir da unten irgendwie von Nutzen sein könnten?“
„Vielleicht, Herr Geheimrat. Ich verstehe Polnisch und kenne etwas Aehnliches aus meiner Heimat her. Ein spekulativer Bauer, der seine Klitsche loswerden wollte, schüttete ein Dutzend Zentner Steinsalz in den Brunnen, zog auch einen Sachverständigen hinzu, der ihm bescheinigte, daß das Wasser stark salzhaltig wäre, und fand danach richtig einen Dummen, der ihm das Grundstück weit über den landläufigen Preis bezahlte. Ob er auch außerhalb des Brunnens Salz gefunden hat, weiß ich nicht. Vielleicht noch ein bißchen in der Speisekammer, aber nach dem Gutachten des Sachverständigen hatte er wohl mehr erwartet.“
„Nicht übel,“ meinte der alte Herr und sah seinen eben engagierten Geheimsekretär mit neuen Augen an. „Mir erschien bei der Sache auch noch nicht alles richtig, denn Chrzánow liegt von dem eigentlichen Petroleumdistrikt Galiziens ziemlich weit entfernt, die Sachverständigen aber erklärten das plötzliche Vorkommen von Oel mit einem unterirdischen Durchbruch. Na, dann wollen wir Herrn Salomon Eisenberg ein wenig anders schreiben. Wenn’s nicht stimmt, wird er schon schreien.“
Und mit einem Schmunzeln um den bartlosen Mund fing er wieder an zu diktieren: „näher zu informieren, aber ich würde mir gestatten, auch meinerseits einen Sachverständigen mitzubringen, der ... der ... na, nun machen Sie mal einen guten Witz, Herr Baron! Je niederträchtiger, desto besser.“
„Hm,“ sagte Heino eifrig, denn das versprach ein Brief nach seinem Herzen zu werden, „man könnte vielleicht so sagen: Einen Sachverständigen mitzubringen, der in unterirdischen Durchbrüchen eine große Erfahrung besitzt. Es wird ihm bei näherer Prüfung der geologischen Formation ein leichtes sein festzustellen, wohin der Ihrerseits angenommene Durchbruch führt, ob nach dem galizischen Oelgebiet oder nach einem mehr in der Nähe befindlichen Lager, das sich jedoch ebenfalls mühelos ermitteln lassen wird, wenn man aus der Topographie von Chrzánow die dortigen Petroleumhandlungen kennt.“
Der Geheimrat lachte laut auf.
„Ausgezeichnet, und ich sehe, wir werden uns verstehen. Nun nichts weiter als eine recht höfliche Schlußwendung ... Ihrer sehr geschätzten Rückäußerung gern entgegensehend, zeichne mit vorzüglicher Hochachtung ... Was gibt’s?“ unterbrach er sich selbst und hob den Kopf, denn der Bureaudiener war mit einem diskreten Räuspern in der Tür erschienen.
„Herr Geheimrat, die gnädige Frau sind draußen und wünschen den Herrn Geheimrat zu sprechen.“
„Bedaure, ich bin sehr beschäftigt.“
„Die gnädige Frau haben aber gesagt, es wäre sehr dringend.“
Der alte Herr seufzte leicht auf.
„Also ich lasse bitten!“
Heino hatte sich erhoben, ging ein wenig zur Seite und sah eine Dame das Allerheiligste des Privatkontors betreten, die ihm merkwürdig bekannt vorkam, ohne daß er sich im Augenblick zu entsinnen vermochte, wo und wann er sie getroffen hatte.
Sie mochte kaum älter als fünfundvierzig Jahre sein, sah noch immer auffallend hübsch aus und trug einen kostbaren Zobelpelz, der Heino ebenfalls sehr bekannt vorkam. Und mit einem Male wußte er, wen er vor sich hatte. Da trat er noch ein paar Schritte zurück, bis er im Schatten der breiten Fenstervorhänge leidliche Deckung fand, denn er wollte eine, womöglich dramatisch bewegte Wiedererkennungsszene vermeiden, ehe er dem alten Herrn nicht mit ein paar Worten erklärt hatte, daß er unwissentlich seiner Gattin in einem unangenehmen Abenteuer Beistand geleistet hatte.
Der Frau Geheimrätin folgten zwei jüngere Damen auf dem Fuße, offenbar die beiden Töchter. Die Kleinere blond und mit einem nichtssagenden, gutmütigen Gesichte, die Größere aber brünett, eine schlanke, biegsame Figur mit einem geradezu frappierend schönen Kopfe. Ein zierliches Näschen über einem vollen roten Munde, große dunkle Augen mit schweren Wimpern und über einer hohen weißen Stirn bläulich-schwarz schimmerndes Haar.
Das Reizvollste aber dünkte Heino ein Zug leiser Schwermut, der sich über das herrliche Gesicht breitete, und unwillkürlich sog er das Bild mit durstigen Augen ein. Gleich danach aber flog ihm ein lustiger Gedanke durch den Kopf, und er mußte wieder lächeln. Ja, wenn die Schwarze da mit in dem Auto gesessen hätte, wäre er wohl kaum von dannen gegangen, ohne auf der Stelle gebührenden Dank zu heischen! ...
Die Frau Geheimrätin war ohne Begrüßung nähergetreten.
„Sag’ mal, Brenitz, was soll das eigentlich bedeuten? Ich vergehe fast vor Aufregung, und Du gibst mir keine Nachricht? Eben telephoniert mir Dein Chauffeur, schon vor einer Stunde hätte er „ihn“ hier hineingehen sehen, und Du rufst mich nicht an?“
„Entschuldige, liebe Ada,“ erwiderte der alte Herr etwas kleinlaut, „aber ich habe keine Ahnung, was Du meinst!“
„Geh, verstell Dich doch nicht, Du weißt es sehr gut. Den heldenmütigen jungen Mann, der uns vor vierzehn Tagen im Tiergarten“ ...
Die Frau Geheimrätin brach ab, denn plötzlich bemerkte sie, daß noch jemand außer ihrem Gatten im Zimmer war. Und Heino trat hervor, machte seine korrekteste Verneigung.
„Verzeihung, gnädigste Frau, wenn ich jetzt erst nachhole, was vielleicht früher meine Pflicht gewesen wäre. Ich heiße Heino Bergkem, muß aber zu meiner Schande gestehen, es war mir bisher unbekannt, daß man hierzulande sich vorstellen muß, wenn man einer Dame einen zufällig aus der Hand geglittenen Schirm aufhebt. Mehr war’s wirklich nicht wert, was ich damals im Tiergarten für Sie tun durfte.“
Die Frau Geheimrätin stand ein wenig perplex da, der alte Herr aber schmunzelte. Im ersten Augenblicke, als der Herr von Bergkem so plötzlich, wie auf Verabredung hervortrat, war er mißtrauisch geworden, denn er kannte seine Gattin und wußte aus Erfahrung, daß sie in abgekarteten Intrigenspielen groß war. Gleich danach aber sah er, daß es diesmal ehrlich zuging, denn die „geborene Guggenheimer“ machte wirklich ein verlegenes Gesicht. Und deutlich las er darauf die Enttäuschung, die sie bei dem anscheinend bürgerlichen Namen des „Lebensretters“ empfand.
Nun aber konnte es sich der Geheimrat nicht mehr versagen, ihr einen kleinen Hieb zu versetzen.
„Siehst Du, Ada, was habe ich Dir gesagt? Der Herr Baron macht sich nichts aus Deinen Danksagungen! Und jetzt gestatte, daß ich richtig vorstelle: Meine Frau nebst Töchtern — Herr Edler und Freier Herr von Bergkem-Przygorowski aus dem Hause Bergheim. Seit heute vormittag aber Angehöriger des Hauses Brenitz. Wir wollen hoffen, daß es beiden Häusern zum Segen gereicht.“
Schon bei dem Worte Baron hatte die Frau Geheimrätin den Kopf gehoben, jetzt ging sie mit ausgestreckten Händen auf Heino zu.
„Welch eine freudige Nachricht, Herr Baron! Und lassen Sie sich endlich von Herzen Dank sagen für Ihre ritterliche Tat. Ihnen erscheint’s vielleicht wenig, hundert Räuber in die Flucht zu schlagen, wir aber verzagten schon an unserem Leben, und danach geht’s doch, nicht wahr?“
So sprach sie geläufig fort und fort, schloß mit einer dringlichen Einladung zum Mittagessen am selben Tage, und Heino konnte trotz aller Zurückhaltung nicht ablehnen, denn auf eine kurz zuvor gestellte geschickte Frage, ob er heute noch etwas Besonderes vorhätte, hatte er harmlos mit nein geantwortet.
Der alte Herr aber stand als stiller Beobachter dabei, und plötzlich fiel es ihm ein, daß er mit seinem neuen Geheimsekretär in leicht gerührter Stimmung über alles mögliche gesprochen hatte, nur nicht über die doch eigentlich recht naheliegende Gehaltsfrage. Bei dem stillen Beobachten jedoch fiel ihm ein Blick auf, mit dem der Herr von Bergkem bewundernd die schlanke Gestalt seiner ältesten Tochter Ilse umfaßte. Da seufzte er leicht auf, denn er glaubte zu wissen, daß diese Gehaltsfrage in absehbarer Zeit in anderer Weise geregelt werden würde ...
Die Damen empfahlen sich, der Herr Geheimrat gab ihnen das Geleit. Und während seine Gattin mit der Aelteren schon das Auto bestieg, schlang die Jüngere ihm im leeren Hausflur den Arm um den Hals, preßte ihr heißes Gesicht an seine Wange:
„Sag’, Pappi, sieht er nicht wirklich aus wie ein Held?“
Da streichelte er ihr leise den blonden Kopf, und das Herz zog sich ihm zusammen:
„Geh, mein kleines Schlemihlchen, geh! Und schluck’s ’runter! Dieser ‚Held‘ hat Dich wohl gerettet, aber den Dank wird er sich wo anders holen. Du und noch einer, der mir nahesteht, Ihr seid von der Sorte, die zusehen müssen, wenn die anderen sich zu Tisch setzen. Also da muß man sich beizeiten zusammennehmen, ein lustiges Gesicht machen und immer sagen: dank schön, ich bin satt, habe schon gegessen! Das tut manchmal sehr weh, aber was ist wohl besser? Sich bemitleiden, womöglich gar auslachen lassen, oder den Kopf hochtragen und sich ein Ansehen geben, als hätte man niemals auf die gedeckte Tafel der anderen einen begehrlichen Blick geworfen?“
So tröstete er mit sanftem Streicheln an seinem Töchterlein herum, bis es sich mit einem leichten Aufschluchzen seinem haltenden Arm entwand: „Ich will’s versuchen, Pappi!“ ...
Als der alte Herr in sein Privatkontor zurückkehrte, stand sein neuer Geheimsekretär am vergitterten Fenster, verneigte sich höflich und sah mit leuchtenden Augen dem davonfahrenden Auto nach. Da lächelte er freundlich, denn all diese Geschehnisse der letzten Minuten schienen ihm wie die Vorherbestimmung eines freundlichen Schicksals. „Herr von Bergkem, meine Stunde ist gekommen, in der ich in meinem Klub die mir unbedingt notwendige Partie Bridge spielen muß. Begleiten Sie mich und sehen Sie zu, Sie können auch dabei von mir etwas lernen. Außerdem aber beabsichtige ich, Sie mit ein paar älteren Herren bekannt zu machen, an deren Urteil mir ziemlich viel liegt, und bei denen ich Ihnen gleich von vornherein eine zukömmliche Stellung anweisen möchte.“
Da sprang Heino eifrig zu und half seinem Chef, der ihm in einer knappen Stunde aus einem Fremden ein gütiger Freund geworden war, in den Pelz. Draußen hatte sich der launische Apriltag eine finstere Wolke vorgezogen, die Regen und Hagel auf die Straßen stäubte. Ihm aber war zumute, als lachte die helle Sonne über Giebeln und Dächern, und eben dehnte sich vor ihm ein klarer Pfad, der nach allem Kummer und Ungemach in eine glückliche Zukunft führte.
Und unwillkürlich fiel es ihm ein: war es nicht ganz wie in dem alten Märchen? Der Bruder Leichtfuß brauchte nur herzhaft und lachend darauf loszugehen, um sich das Glück und die verzauberte Prinzessin zu gewinnen?! ...
Es ging auf den Mai, und die beiden Geschwister Bergkem hatten sich längst schon in der Charlottenburger Wohnung mit den aus der alten Heimat stammenden Möbeln behaglich eingerichtet. Peter Brenitz aber war ihr allabendlicher Stammgast, saß mit ihnen von neun bis halb elf um den runden Tisch unter der freundlichen Hängelampe, hörte zu, wie sie von ihrem Tagewerke plauderten, und wünschte sich nichts Besseres. Seine kühnen Hoffnungen hatte er an dem Tage begraben, als er mit dem kostbaren Blumenstrauße in der Hand auf dem Bahnsteige stand und die blonde Brigitte seiner so wenig achtete, daß ihr ein verloren gegangenes Gepäckstück wichtiger erschien als seine Begrüßung.
Und je mehr er darüber grübelte, desto klarer entschleierte sich ihm, wie alles gekommen sein mochte in der Zeit, nachdem er Brigitte nicht wiedergesehen hatte. Als einzige unbestreitbare Tatsache stand fest, daß sie ihrem Verlobten trotz aller Vorteile, die ihr aus dieser Verbindung winkten, den Abschied gegeben hatte. Aber wie unziemliche Selbstüberhebung kam es ihm vor, seine Person mit diesem Entschlusse in eine irgendwie geartete Verbindung zu bringen. Was war er denn in dem Leben dieses jungen Mädchens? Eine flüchtige Bekanntschaft von zwei kurzen Tagen ...
So disputierte er fast allnächtlich mit seiner Leidenschaft, nahm sich hundertmal vor, von nun an die Besuche in Charlottenburg aufzugeben, weil sie doch zu keinem Ergebnis führen könnten. Wenn es aber auf den Abend ging, saß er wieder an dem runden Tische unter der freundlichen Hängelampe und wünschte sich nichts Besseres! Denn zuweilen ging es recht lustig zu, so lustig, daß auch die blonde Brigitte mitlachte. Der lange Heino erzählte irgendeinen Scherz, den er in seinem neuen Berufe an der Börse gehört hatte, machte dem alten Prokuristen Markuse im Hause Brenitz nach, wie er schnupfte und mit der Nase schnüffelte, oder kopierte — frei nach den Fliegenden Blättern — den unglückseligen Lehrling, um den das gesamte Personal der Firma ratlos stand, weil er wegen allzuweit abstehender Ohren den Federhalter nicht an die vorschriftsmäßige Stelle stecken konnte.
Dann lachte auch Brigitte, obwohl sie sonst meistens schweigend am Tische saß, müde von der anstrengenden Tätigkeit, die sie tagsüber in Anspruch nahm.
Und es kam ein Abend, an dem auch sie lebhaft wurde, mit einem Male aus ihrem Berufe zu erzählen anfing, obwohl das geschilderte Ereignis eigentlich nichts Besonderes an sich hatte. Ein junger Reiteroffizier war auf der Rennbahn gestürzt — Peter hatte den Bericht schon in der Zeitung gelesen — man hatte ihn bewußtlos in die Abteilung der Klinik gebracht, in der sie ihre Lehrlingszeit durchmachte, und selbst der Herr Geheime Medizinalrat fürchtete für sein Leben. Am nächsten Abend aber lautete der Bericht schon viel hoffnungsvoller. Der junge Husar war für ein paar Augenblicke zu Bewußtsein gekommen, hatte seine hingebende Pflegerin, die unablässig die kühlenden Umschläge erneuerte, dankbar angelächelt. Und eifrig erörterte sie den ganzen Fall, schilderte die Besorgnis der Eltern, die vom Rheine her an das Lager ihres einzigen Sohnes geeilt waren, sprach und sprach von dem, was ihr Fühlen und Denken erfüllte. Peter aber saß dabei und hörte aufmerksam zu. Im Innersten seines Herzens jedoch wußte er, das war der letzte Abend, den er hier am runden Tische mit der blonden Brigitte verbrachte.
Oder sollte er vielleicht zum zweiten Male mit ansehen, wie eine grobe Faust ihm in die Brust nach dem Herzen langte und preßte und preßte, bis der letzte Blutstropfen entwichen war?! ... Er nahm sich zusammen bis zu der üblichen Zeit, zu der er schicklicherweise und ohne aufzufallen sich auf den Heimweg begeben konnte. Da küßte er Fräulein Brigitte wie immer die Hand und wünschte ihr eine gute Nacht nach all den gehabten Aufregungen. Seine Stimme klang ruhig wie sonst.
Der lange Heino geleitete ihn die Treppe hinab, unten im Flur schüttelte er ihm die Hand. Sie verstanden sich ohne viel Worte.
„Tut’s sehr weh, kleines Brüderchen?“
Peter griff nach seinem Klemmer, tupfte dabei unauffällig über die Augenwinkel, in denen sich ein paar dumme, dicke Tränen bilden wollten:
„Nicht mehr so arg wie beim erstenmal! Und es geschieht mir recht. Ich saß an der Grenze des Königreiches, grübelte und grübelte über dem Rätsel, indessen schwang sich ein anderer mit leichterem Fuß über den Graben!“ Und mit einem wehen Lächeln fügte er hinzu: „Wenn ich so klug gewesen wäre wie heute, hätte ich vor vier Wochen mich überfahren lassen. Vielleicht daß ich dann dem ... dem andern zuvorgekommen wäre!“ Der Schmerz übermannte ihn, er schluchzte laut auf und lehnte für einen Augenblick den Kopf gegen die Brust des Freundes. Heino aber schlang ihm den langen Arm um den Hals und sah besorgt zu ihm hernieder.
„Der Deuwel kennt sich in diesen kleinen Frauenzimmern aus! Manchmal in diesen Wochen hatte ich die stille Hoffnung, sie würde sich wieder zu Dir neigen, wie schon einmal, und da muß dieser kleine Husar sich unversehens dazwischen drängen! Aber sag’, armer Kerl, soll ich diese Nacht nicht lieber mit Dir zusammenbleiben? Meiner Schwester rede ich leicht was ein, damit sie keinen Argwohn schöpft.“
Da richtete Peter Brenitz sich auf und warf den Kopf in den Nacken zurück.
„Arm, sagst Du? Einen ganzen geschlagenen Tag damals bin ich glücklich gewesen! Reicht das nicht aus für ein kurzes Menschenleben?! Und Du, Heino von Bergkem, sagst mir, Du hättest mich, den Juden Brenitz, gern in Deinem Hause aufgenommen. Hab Dank dafür, dieses Wort war mir eine Wohltat. Es zeigt mir, daß der auf dem richtigen Wege war, der meine Schritte ins Leben lenkte!“
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloß, er trat aufrechten Hauptes in die stille Straße hinaus. Weit drüben, auf der Zinne des grünen Bahndammes, fuhr ein hell erleuchteter Zug irgendwohin in die Ferne .... Die Maschine ächzte und stöhnte, spie feurige Wolken empor, gegen den nachtdunkeln Himmel nahmen sie sich wie Zeichen der Morgenröte aus. Und Peter Brenitz sah hoffnungsfrohen Auges das kommende Deutsche Reich, das Reich, in dem es weder Hader, noch Haß, noch Zwietracht gab. — —
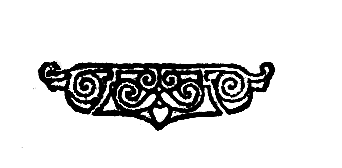
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.