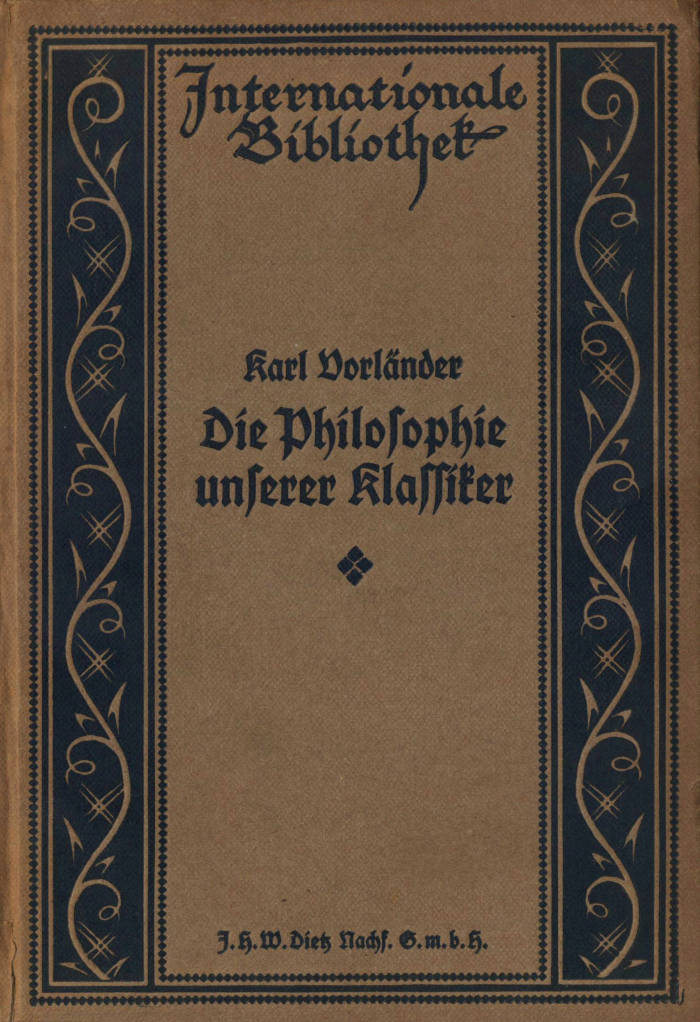
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert. Im Original fetter Text ist so dargestellt.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
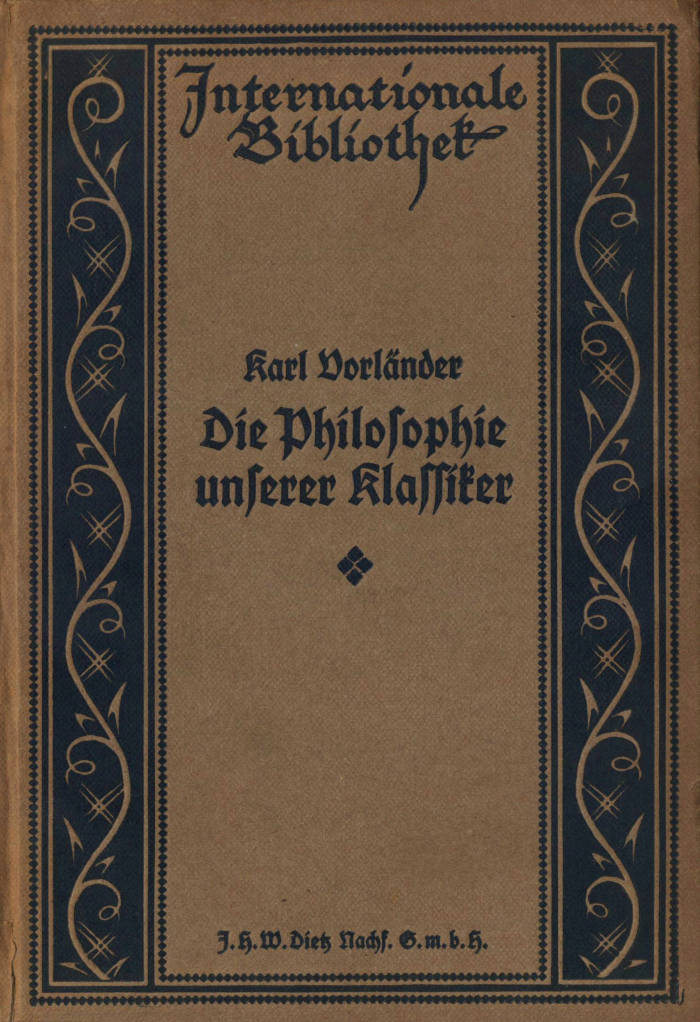
Lessing · Herder · Schiller · Goethe
Von
Karl Vorländer
1923
J. H. W. Dietz Nachf. G. m. b. H.
Berlin und Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Druck von J. H. W. Dietz Nachf. G. m. b. H. in Stuttgart
Goethe sagt einmal in einem seiner Sprüche in Prosa: Das Klassische ist das Gesunde, das Romantische ist das Kranke. Von der gleichen Ansicht ausgehend, habe ich im vergangenen Sommersemester die Philosophie unserer Klassiker Lessing, Herder, Schiller, Goethe meinen Zuhörern an der hiesigen Universität vorgetragen und lege sie nun hier, erweitert und ergänzt, einem breiteren Leserkreise vor. Ich tue das in der Überzeugung, daß es gerade in unserer Zeit und gerade auch in der Philosophie doppelt not tut, gegenüber aller ungesunden, sich auf unklare Gefühle stützenden Romantik (verkappe sie sich hinter dem Namen reiner Ästhetik oder Theosophie oder Lebensphilosophie oder Patriotismus oder sonstwie immer), auf die reinen Quellen des Wahren, Guten und Schönen, wie sie in dem Denken und Dichten unserer großen Klassiker fließen, nachdrücklichst hinzuweisen. Während der Arbeit habe ich meine Freude daran gehabt, mich wieder einmal in ihre unvergänglichen, ewig jungen und wahren Gedankengänge vertiefen zu können, und hoffe, daß es meinen Lesern ähnlich gehen wird.
Münster i. W., im September 1922
Karl Vorländer
| Seite | |
| Vorwort | III |
| Einleitung | VII |
| Lessing | |
| A. Jugendjahre 1729 bis 1760 (Meißen, Leipzig, Berlin) | 3 |
| Auf der Fürstenschule zu Meißen – Auf der Universität Leipzig – Nach Berlin – Stellung zur Religion um 1750 – Religionsphilosophische und religionsgeschichtliche Schriften der 50er Jahre – Mit Moses Mendelssohn und F. Nicolai. | |
| B. Das Jahrzehnt 1760 bis 1770 | 11 |
| Weitere religionsphilosophische Entwicklung – Von Christian Wolff zu Leibniz und Spinoza – Philosophie der Kunst (Ästhetik): Der »Laokoon« – Die Hamburger Dramaturgie. | |
| C. Das letzte Jahrzehnt 1770 bis 1780 | 26 |
| Wiederum Religionsphilosophie: Wolfenbütteler Funde – Die Fragmente eines Ungenannten (Reimarus) – Der Streit mit der Orthodoxie (Antigoeze) – Ergebnisse. | |
| D. Philosophische Weltanschauung überhaupt | 37 |
| 1. Toleranz und Vernunftreligion: Nathan der Weise. 2. Religions- und Geschichtsphilosophie: Erziehung des Menschengeschlechts. 3. Ansichten über den Staat: Lessings politische Entwicklung. 4. Staats- und Gesellschaftsphilosophie in: Ernst und Falk. 5. Letzter philosophischer Standpunkt: Determinismus, Pantheismus, Spinozismus. | |
| Schluß: Lessings Persönlichkeit | 60 |
| Herder | |
| A. Der junge Herder bis zur Übersiedlung nach Weimar 1776 | 65 |
| 1. Die Jugend (Mohrungen, Königsberg) 1744 bis 1764 – Kant und Hamann | 65 |
| 2. Vorherrschend literarisch-ästhetische Epoche 1765 bis 1772 | 69 |
| In Riga – Reisetagebuch – In Straßburg: Vom Ursprung der Sprache. | |
| 3. Vorherrschend religiöse Periode 1772 bis 1776 | 72 |
| Hofprediger in Bückeburg – Älteste Urkunde des Menschengeschlechts – Auch eine Philosophie usw. – Vom Erkennen und Empfinden. | |
| B. Die Höhezeit 1776 bis 1788 | 77 |
| In Weimar – Theologische Schriften – 1. Die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit – Politische Anschauungen – Kritik des Christentums – Wirkung des Werks – 2. Die Gespräche über »Gott« – Spinozismus. | |
| C. Das Ende 1789 bis 1803 | 91 |
| Altersjahre – Stellung zur Französischen Revolution – Goethes Abwendung – Der Kampf gegen Kant – Tod. | |
| Schiller[vi] | |
| A. Die Anfänge 1779 bis 1786 | 99 |
| Auf der Karlsschule – Die beiden medizinischen Dissertationen – Rousseaus Einfluß: »Räuber« und Jugendlyrik. | |
| B. Die Übergangszeit 1787 bis 1790 | 103 |
| Die Philosophischen Briefe – Die Götter Griechenlands und Die Künstler – Studium der Geschichte – Erste Bekanntschaft mit dem Kritizismus. | |
| C. Die Höhezeit: Schiller als Jünger Kants 1791 bis 1795 | 108 |
| Geschichtliche Entwicklung: Endgültige Bekehrung zu Kant – Die ersten ästhetischen Aufsätze – Anmut und Würde – Die ästhetischen Briefe – Naive und sentimentalische Dichtung. | |
| D. Schillers Philosophie in seiner Reifezeit | 113 |
| 1. Methodisches und theoretische Philosophie. 2. Ethik. 3. Ästhetische Ergänzung der Ethik: das Sittlich-Erhabene und das Sittlich-Schöne. 4. Stellung zu Griechentum und Christentum sowie zur Religion überhaupt. 5. Zusammenfassung und Ergebnisse. 6. Die Grundzüge von Schillers Ästhetik. 7. Schiller als Politiker. 8. Schiller, der Idealist. | |
| Goethe | |
| A. Anfänge 1774 bis 1776 | 151 |
| Im Elternhaus – In Leipzig – In Straßburg: Berührung mit der französischen Philosophie, mit Herder – Erste Bekanntschaft mit Spinoza – Philosophische Gedichte. | |
| B. Das erste Jahrzehnt in Weimar. Die italienische Reise 1776 bis 1788 | 160 |
| Pantheismus – Neues Spinoza-Studium – Nahe Freundschaft mit Herder – Naturwissenschaftliche Studien (Metamorphose der Pflanzen) – Einfluß Italiens auf seine Natur- und Kunstauffassung. | |
| C. Erstes Kant-Studium 1789 bis 1894 | 167 |
| Lektüre der Kritik der reinen Vernunft – Einfluß der Kritik der Urteilskraft. | |
| D. Der Freundschaftsbund mit Schiller 1794 bis 1805. Die Altersjahre 1805 bis 1832 | 172 |
| Das glückliche Ereignis vom Sommer 1794 – Das Jahrzehnt mit Schiller – Verhältnis zu andern Denkern (Schelling, Herder u. a.) – Spätere philosophische Studien u. Beziehungen. | |
| E. Goethes Philosophie in seiner Reifezeit | 179 |
| 1. Theoretische Philosophie. 2. Ethik. 3. Religionsauffassung. 4. Politische Stellung. Sozialismus in Wilhelm Meisters Wanderjahren? 5. Die Kunst. Schluß. | |
| Zur Literatur | 189 |
| Namenverzeichnis | 192 |
Die Philosophie unserer Klassiker
Wir wollen uns in diesen Vorlesungen mit der Philosophie unserer Klassiker, d. h. unserer klassischen deutschen Dichter beschäftigen. Wer sind diese Klassiker? Wir wurden in meiner Jugend gelehrt, drei Dichterpaare des achtzehnten Jahrhunderts als solche zu betrachten: Klopstock und Wieland, Lessing und Herder, Schiller und Goethe. Allein das erste Paar dürfte schon in der allgemeinen Schätzung längst aus deren Mitte ausgeschieden sein. Mögen noch so starke Wirkungen auch von Wieland und Klopstock auf die Steigerung des dichterischen Gefühls und der künstlerischen Einbildungskraft, auf die Fortbildung unserer Sprache und deren poetische Form, auf die Lyrik insbesondere und den Roman ausgegangen sein, mögen sie noch in den Schulstuben unserer Primaner an der herkömmlichen Stelle stehen: in die Masse unseres Volkes sind sie nicht eingedrungen, ja sogar in dem geistigen Leben der großen Mehrzahl unserer Gebildeten führen sie kein lebendiges Dasein mehr. Was Lessings bekanntes Epigramm von Klopstocks berühmtem Messias-Epos sagte:
das gilt heute nicht bloß von Klopstock überhaupt mit seiner Vereinigung von antiker Form und christlich-germanischem, zum Teil fast nordisch-germanischem Inhalt, den selbst unsere begeistertsten »Nationalen« kaum mehr bewundern, ja vielfach gar nicht mehr kennen. Das gilt erst recht von Wieland mit seiner dem französischen Geschmack im Zeitalter eines Ludwigs XV. nachstrebenden, vielfach ins Lüstern-Weichliche hinüberspielenden Denkweise und seiner geradezu abschreckenden Weitschweifigkeit des Stils. Vor allem aber, beide kommen als Philosophen, also für unser Thema überhaupt nicht in Betracht. Von dem frommen Sänger der Messiade oder der[viii] Erlöser-Oden brauche ich das gar nicht erst nachzuweisen: weder er selbst noch sonst jemand hat Klopstock jemals für die Philosophie reklamiert. Und Wieland hat sich zwar in seinen Romanen, sogar mit Vorliebe, mit Gestalten, die uns aus der griechischen Philosophie bekannt sind, von Pythagoras, Demokrit und Sokrates an bis zu dem Wundermann Peregrinus Proteus und dem Spötter Lucian, am meisten bezeichnenderweise mit solchen aus der Periode ihres Niedergangs, beschäftigt; indes mit seinen oberflächlich-breiten Erörterungen für philosophische Methode oder Wissenschaft, ja nur für die schärfere Erfassung philosophischer Probleme nicht das mindeste geleistet.
Also bleibt es für uns bei den beiden anderen Paaren: Lessing und Herder, Schiller und Goethe, die heute noch, abgesehen vielleicht von dem minder bekannten Herder, bei allen denen lebendig sind, die überhaupt von den ewigen Geistesschätzen unserer klassischen Literatur und Dichtung zehren. Allein selbst bei diesen vier Großen läßt sich die Frage aufwerfen: Sind sie wirklich »Philosophen« im engeren Sinne des Wortes zu nennen? Hat doch keiner von ihnen ein philosophisches System entworfen, keiner sich selbst für einen Philosophen ausgegeben, keiner, wenn wir von Herders »Ideen« absehen, ein größeres philosophisches Buch geschrieben. Und doch, so lange es, um mit Kantischen Worten zu reden, eine Philosophie nicht bloß nach dem Schul-, sondern auch nach dem Weltbegriff, mit anderen Worten eine Philosophie als Weltanschauung gibt, so lange werden auch Lessing und Herder, Schiller und Goethe in die Reihe der Philosophen gehören. Allerdings, und damit ergibt sich eine bestimmte Grenze für unsere Darstellung, nur, insoweit sie ihre Weltanschauung philosophisch zu begründen versucht haben.
Gleich der erste unserer vier Klassiker, Lessing, mutet uns so modern an, als wäre er einer der Unseren, mit seiner Mannhaftigkeit und Ehrlichkeit, seiner Geistesfreiheit und -klarheit. Und doch ist er vor beinahe zweihundert Jahren in einer kleinen hinterwäldlerischen Stadt der sächsischen Lausitz geboren, der Sohn eines rechtgläubigen lutherischen Pastors, der, ursprünglich auch gelehrten Studien zugewandt, in dem abgelegenen kleinen Nest immer mehr zum versauerten Orthodoxen und kirchlichen Eiferer geworden war. Sein Ältester, eben unser Gotthold, hat von ihm vielleicht die Heißblütigkeit im Kampfe für das als recht Erkannte geerbt, daneben eine gewisse Achtung vor ehrlicher Orthodoxie beibehalten.
Aus seinem sechsten Lebensjahr ist ein von einem herumziehenden Maler gefertigtes Bild von ihm und seinem Bruder Theophil erhalten: dieser streichelt ein Lämmchen, Gotthold wollte durchaus »von einem großen Haufen Bücher umgeben« gemalt sein. Kursachsen hatte seit der Reformation die besten höheren Schulen Deutschlands. So konnte der junge Lessing seiner Bücherliebhaberei genugsam frönen während der fünf Jahre 1741 bis 1746, die er auf der »Fürstenschule« Sankt Afra in Meißen – neben dem noch heute bekannten Schulpforta einem der ersten Gymnasien des Landes – zubrachte. So tyrannisch wie Schiller und seine Jugendgefährten auf der Karlsschule wurden die Meißener Fürstenschüler zwar nicht behandelt, und Lessing hat später gern an seine Schuljahre zurückgedacht. Aber der Drill war doch auch hier stark und die Abgeschlossenheit von allem Modernen, wie es damals die englische Aufklärung zu vertreten angefangen hatte. Ähnlich wie in dem Königsberger Friedrichskolleg, in dem Kant ein Jahrzehnt früher seine acht Lehrjahre verbrachte, waren Religion mit 25 (!) und Latein mit 15 Wochenstunden der Mittelpunkt des Unterrichts. Und doch, alles dort eingeprägte Massenwissen strengte Gottholds schnell fassenden[4] Geist nicht an, ja genügte ihm nicht. »Die Lektiones, die anderen zu schwer werden, sind ihm kinderleicht,« berichtete sein Rektor von ihm, »es ist ein Pferd, das doppeltes Futter haben muß.« Am meisten zog seinen verstandesscharfen Geist, der auch später die Begriffsoperationen bis zum Spielen mit ihnen geliebt hat, der daher auch, wie sein Saladin und sein Al-Hafi, stets ein eifriger Liebhaber des Schachspiels gewesen ist, die Mathematik an: er übersetzte den Euklid und wählte zum Thema seiner Abgangsrede (Juni 1746) »die Mathematik der Barbaren«, also der Nichtgriechen und -römer. Ins Philosophische schlägt die offizielle »Glückwunschungsrede«, die er zu Neujahr 1743 an den Vater schrieb, deren Thema der für einen noch nicht Vierzehnjährigen besonders altklug anmutende Satz ist, daß die Menschheit im Grunde weder einen besonderen Fortschritt noch einen Rückschritt zu verzeichnen habe, sondern daß jedes Jahr dem anderen gleich sei. Es ist eben eine im üblichen Geleise der herrschenden Leibniz-Wolffschen Schulphilosophie einhergehende rhetorische Schulübung eines besonders klugen Knaben, der den »deutlichen Ausspruch der Vernunft«, das »göttliche Zeugnis der Heiligen Schrift« und den »unverwerflichen Beifall« seiner – vierzehnjährigen »Erfahrung« auf seiner Seite zu haben behauptet.
Auch auf der Universität Leipzig, die der Siebzehnjährige im September 1746, nach dem Wunsche des Vaters als Studiosus der Theologie, bezieht, scheint er philosophisch keine besonderen neuen Einsichten gewonnen zu haben. Wohl gehen in seinem inneren und äußeren Leben große Umwälzungen vor. Er sieht ein, daß die bloße Bücherweisheit ihn »wohl gelehrt, aber nimmermehr zu einem Menschen machen« würde. Er lebt in der reichen, blühenden Stadt, wo man »die ganze Welt im kleinen sehen« konnte, dem »Klein-Paris« in Goethes »Faust«. Er lernt Tanzen, Reiten, Fechten, verkehrt mit Schauspielern und anderen leichten Gesellen, dichtet nach der Zeitsitte leichte »anakreontische« Liedchen über Liebe und Wein, schreibt seine ersten Dramen, gibt dann 1748 sein theologisches Studium auf, studiert kurze Zeit Medizin und geht zu Ende des Jahres, als der erste freie Literat, der bewußt auf Anstellung im Hof- und Staatsdienst verzichtet, nach der[5] preußischen Hauptstadt, die er nur vorübergehend verläßt, um 1750/51 in Wittenberg den Magistergrad, der ungefähr dem heutigen Dr. phil. entspricht, zu erwerben. Erst ein in ernster Auseinandersetzung mit dem Vater zur Rechtfertigung seines neuen Lebensplans geschriebener Brief vom 30. Mai 1749 zeigt, daß er auch eine religiöse Krisis hinter sich hat. »Die Zeit soll lehren,« schreibt er dem Vater mit der ruhigen Klarheit, die nur eine selbsterrungene feste Überzeugung verleiht, »ob der ein besserer Christ ist, der die Grundsätze der christlichen Lehre im Gedächtnis und oft, ohne sie zu verstehen, im Munde hat, in die Kirche geht und alle Gebräuche mitmacht, weil sie gewöhnlich sind; oder der, der einmal klüglich gezweifelt hat und durch den Weg der Untersuchung zur Überzeugung gelangt ist oder sich wenigstens noch dazu zu gelangen bestrebt. Die christliche Religion ist kein Werk, das man von seinen Eltern auf Treue und Glauben annehmen soll.« Und vom christlichen Handeln bekennt er offen und scharf: »Solange ich nicht sehe, daß man eines der vornehmsten Gebote des Christentums, seinen Feind zu lieben, nicht besser beobachtet, so lange zweifle ich, ob diejenigen Christen sind, die sich davor ausgeben …«
Diese festen und klaren Sätze des erst Zwanzigjährigen zeigen schon ganz den Lessing der Mannesjahre. Sie zeigen ihn ferner auf demjenigen Gebiet philosophierend, das bis zu seinem Tode das Hauptgebiet seines Philosophierens gebildet hat: dem der Religion. Und sie zeigen ihn in derselben Linie tätig, wie die Tendenzstücke unter seinen Jugenddramen, auf die wir hier nur hinweisen können; und, beiläufig gesagt, auf einem ähnlichen Wege, wie ihn der nur fünf Jahre ältere junge Kant ging. »Der junge Gelehrte« richtet sich gegen die Pedanterie und Schulfuchserei, »der Freigeist« gegen die oberflächlichen Aufklärer, welche alle Frömmigkeit als Beschränktheit oder Heuchelei verschreien, aber doch auch den irreligiösen Freigeist vom Vorwurf des Lasters freisprechend; und »die Juden«, wider die religiöse Unduldsamkeit gegen Andersgläubige, ein Vorläufer seines »Nathan«, den er übrigens schon um 1751 geplant hat.
Will man literarische Einflüsse geltend machen, so kann man auf den des berühmten französischen Skeptikers Pierre[6] Bayle hinweisen, jenes ersten Begründers der französischen Aufklärung, den schon der Student Lessing in den Vorlesungen des Professors Christ kennengelernt hatte, und dem er jetzt nähertrat. Mit Bayle, der überhaupt auf die erst allmählich sich aus den Fesseln der Theologie losringenden freieren Geister des damaligen Deutschlands: einen Winckelmann, einen Friedrich den Großen und andere mehr von nachhaltigem Einfluß gewesen ist, verbanden ihn mancherlei gemeinsame Geisteszüge: die ungeheure Belesenheit und Vielseitigkeit, die dialektische Meisterschaft, der Geist eindringender Kritik, aber auch die Duldsamkeit gegen anderer Überzeugung, die Kampfstellung infolgedessen nur gegen herrsch- und verdammungssüchtige Unduldsamkeit. Und neben Bayle stand dann bald sein Nachfolger und Fortsetzer Voltaire, mit dem Lessing ja in Berlin als sein zeitweiser Sekretär bekanntlich auch in persönliche, zuletzt recht unliebsame Berührung geraten ist; und neben ihm das Haupt der Enzyklopädisten, der feurige Diderot, der »durch Gänge voll Nacht zum glänzenden Throne der Wahrheit« führt.
Indes wir brauchen bei einem von Jugend auf so selbständigen Geist wie Lessing nicht einmal, jedenfalls nicht immer fremde Anstöße anzunehmen. Wie der dreiundzwanzigjährige Immanuel Kant in seiner Erstlingsschrift, deren etwas selbstbewußten Titel Lessing in einem später mit Grund gestrichenen Epigramm bespöttelte, das kühne Wort schrieb: »Ich habe mir die Bahn schon vorgezeichnet, die ich halten will; ich werde meinen Lauf antreten, und nichts soll mich hindern, ihn fortzusetzen«, so schreibt in demselben Alter auch der junge Lessing zu Wittenberg einem Bekannten den Vers ins Album:
Und in einem Gedicht des Jahres 1749 hatte bereits der Zwanzigjährige, unbewußt und ohne dabei an sich selbst zu denken, den stolzen Adlerflug des freien Genies beschrieben:
In diese Periode des Ringens mit sich selbst und den anerzogenen Vorstellungen, die jeder ernsthafte Mensch früher oder später in sich durchmachen muß, fallen mehrere Bruchstück gebliebene religionsphilosophische Lehrgedichte, wie »Die Religion« (veröffentlicht November 1751) und »Über die menschliche Glückseligkeit« (veröffentlicht 1753), auf die wir indes nicht näher eingehen: einmal, weil sie eben Fragmente geblieben sind und nicht viel mehr als Zeugnisse dieses inneren Ringens darstellen; dann auch, weil sie doch noch nicht den Lessing der Reifezeit enthalten, mit dem wir es vor allem zu tun haben. Es war wohl die Zeit, von der er später (um 1779) einmal rückschauend gesagt hat, daß er in ihr alle die verschiedenen neuerschienenen Schriften für und wider die Religion gierig verschlungen habe, ohne daß ihn eine ganz befriedigt hätte; sie hätten ihn vielmehr nur »von einer Seite zur anderen gerissen«. Und nun kommt eine Bemerkung, die so recht Lessings bis ans Ende seines Lebens ihm eigentümlich gebliebenes geistiges Verhalten kennzeichnet: »Je bündiger mir der eine das Christentum erweisen wollte, desto zweifelhafter ward ich. Je mutwilliger und triumphierender mir es der andere ganz zu Boden treten wollte: desto geneigter fühlte ich mich, es wenigstens in meinem Herzen aufrechtzuerhalten.« Es ist die Art des selbständigen Geistes, der in Dingen, die doch schließlich durch das persönliche Gefühl entschieden werden, gegen ihm von fremder Seite aufgezwungen werden sollende sogenannte Verstandes»beweise« sich wehrt; der Geist des Mißtrauens gegen sich aufblähende »Autoritäten« der einen oder der anderen Seite, gegen Systemmacherei überhaupt, die ihm einmal in einem scherzhaften Liede die Verse eingibt:
In diesen Zusammenhang gehören auch die bei ihm so beliebten »Rettungen« einzelner von der hergebrachten Theologie, sei es der liberalen oder der orthodoxen, verketzerter Persönlichkeiten oder ganzer Richtungen, deren »Recht auf Ewigkeit« er untersuchen, denen er »unverdiente Flecken abwischen, falsche Verkleisterungen ihrer Schwächen auflösen« will. Dahin gehören z. B. die Rettungen einzelner durch die Autorität eines Luther niedergekämpften, nur unseren gelehrten Kirchenhistorikern bekannten Männer wie Cochläus oder Lemnius im sechzehnten Jahrhundert; dahin die des italienischen Renaissancephilosophen Cardano oder des deutschen Predigers Adam Neuser, die als »Atheisten« verdammt worden waren, weil sie – das spätere Nathan-Problem! – den Schein der Gleichberechtigung oder gar der Minderwertigkeit des Christentums gegenüber dem Islam nicht ganz vermieden hatten. Dahin auch die »Gedanken über die Herrnhuter« (1750), die im Grunde genommen – sie sind freilich auch nur Fragmente geblieben – so gut wie gar nicht von »diesen Leuten« selbst handeln, sondern sie nur zum Ausgangspunkt seiner eigenen ketzerischen Sätze benutzen. Er gibt darin eine Geschichte der Weltweisheit wie der Religion auf wenigen Seiten, von »Adam bis zur Gegenwart«, d. h. von den sieben Weisen Griechenlands bis zu Leibniz und Wolff – Sokrates ist sein Held, Jesus ein von Gott erleuchteter Lehrer –, um daraus den Schluß zu ziehen: »Sie füllen den Kopf, und das Herz bleibt leer.« Man wird »durchgängig finden, daß die Menschen in der einen wie in der anderen nur immer haben vernünfteln, niemals handeln wollen«. Und doch »ward der Mensch zum Tun und nicht zum Vernünfteln erschaffen«. Das haben die Herrnhuter auf dem Gebiet der Religion zu ihrem Ziel gemacht. Lessing wünscht, daß auch in der Philosophie bald ein Mann mit ähnlichen Gedanken auftreten möge (wir denken dabei an J. J. Rousseau oder an Kants praktische Philosophie).
Bei diesem Stand der Dinge brauchen wir uns nicht lange mit einzelnen trotzdem »vernünftelnden« Aufstellungen Lessings selbst aus der nämlichen Zeit, dem Beginn der fünfziger Jahre, aufzuhalten: etwa dem »Christentum der Vernunft«, das in 27 Paragraphen aus den Leibnizschen[9] Begriffen der Vollkommenheit, der Harmonie, der allmählichen Stufenfolge aller Dinge und ähnlichem aufgebaut wird und, statt wie eine gesunde kritische Philosophie mit der Gottesidee etwa zu enden, sogleich mit Gott als dem »einzigen vollkommensten Wesen« einsetzt, während es mit einer mehr an Schleiermacher als an Kant erinnernden Formulierung des menschlichen Sittengesetzes schließt: »Handle deinen individualischen (wir sagen heute: individuellen) Vollkommenheiten gemäß!« Von der kirchlichen Religionsauffassung hat er persönlich sich um diese Zeit schon ganz frei gemacht: ein für die damaligen deutschen Verhältnisse und für seine eigene Entwicklung sehr vielsagendes Resultat. Das beweist unter anderem ein, wenigstens höchstwahrscheinlich, noch in die Berliner Zeit fallendes, in seinem Nachlaß gefundenes Bruchstück »Über die Entstehung der geoffenbarten Religion«. Und so konnte er beinahe ein Menschenalter später in einem, vielleicht eben dieser Offenheit wegen ungedruckt gebliebenen, Vorwortentwurf zum »Nathan« erklären: »Nathans Gesinnung gegenüber jeder positiven Religion ist von jeher die meinige gewesen.«
Dagegen hat er an einer, wie man in jener Zeit sagte, »natürlichen« Religion, mit dem Glauben an einen Weltschöpfer, nicht bloß damals, sondern anscheinend bis an sein Ende festgehalten. So tritt er gelegentlich für Albrecht v. Hallers, des auch von dem jungen Kant hochgeschätzten Schweizer Naturforschers und Dichters, Gottesglauben gegen den entschiedenen Materialismus eines Lamettrie ein, der in seinem »L'homme machine« den Menschen als ein mechanisches Uhrwerk aufgefaßt hatte. Und auch philosophisch entfernt er sich in den fünfziger Jahren noch wenig von der herrschenden Leibniz-Wolffschen, das heißt durch den trockenen Pedanten Christian Wolff verwässerten Leibnizschen Philosophie. Ganz seiner sonstigen, frischen, für alle reinen Gedanken aufgeschlossenen Art entgegen, meint er einmal 1752 in einer seiner Rezensionen in der damals schon bestehenden »Vossischen Zeitung« zu Berlin: »Das Neue sollte uns in den spekulativischen Teilen der Weltweisheit alle Zeit verdächtig sein.« Für unseren Zweck brauchen wir darum auch diese seine verhältnismäßig doch unbedeutenden Buchbesprechungen aus den[10] Jahrgängen 1751 bis 1754 der »Vossischen« nicht einzeln auf seinen philosophischen Standpunkt hin zu durchmustern.
Selbst nicht die ihrem Titel nach philosophischste seiner Abhandlungen: die 1755 aus Anlaß einer Preisaufgabe der Berliner Akademie der Wissenschaften erschienene: »Pope ein Metaphysiker!« Schon deshalb nicht, weil sie nicht von ihm allein, sondern gemeinsam mit dem in Berlin neu gewonnenen Freunde Moses Mendelssohn verfaßt ist. Und zweitens, weil wir uns heute auch wohl kaum noch für das Thema interessieren: 1. welches der wahre Sinn des Satzes »Alles ist gut« sei; der in des Engländers Pope (1689 bis 1744) seinerzeit vielbewundertem Lehrgedicht »Vom Menschen« (1729) vorkommt, 2. wieweit er mit Leibniz' Optimismus übereinstimme und 3. ob Popes System anzunehmen oder zu verwerfen sei. Sondern uns interessiert nur die Art von Lessings Behandlung, zu der ihm die Aufgabe der Akademie, über die er sich eigentlich mehr lustig macht, bloß den Anlaß gibt: seine reinliche Scheidung zwischen Dichter und Metaphysiker. Gewiß, im weitesten Sinne des Wortes ist jeder Metaphysiker ein Dichter; aber ein System in Reime bringen heißt noch nicht dichten. Ein philosophischer Dichter ist darum noch kein Philosoph, ebensowenig wie ein poetischer Weltweiser an sich schon ein wahrer Poet: dasselbe Problem, das Kant vierzig Jahre später von der anderen Seite her ebenso scharf in Angriff genommen hat (in seinem Aufsatz »Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie«, 1796).
Bei dieser Gelegenheit nur ein paar kurze Ausführungen über Lessings philosophisches Verhältnis zu den Berliner Freunden Moses Mendelssohn und Friedrich Nicolai; denn ihre persönlichen Beziehungen zu behandeln, ist hier nicht der Ort. Gemeinsam mit beiden ist ihm im Grunde nur ein Allerallgemeinstes: die Zugehörigkeit zu der großen Aufklärungsbewegung, die in England ihren Ursprung genommen, dann nach Frankreich sich verpflanzt hatte und jetzt, um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, anfangs noch recht bescheiden, auch in Deutschland, und hier wieder am stärksten in dem von jeher freigeistigen und zum Vorwitz neigenden Berlin, ihre Schwingen zu regen begann. Im übrigen[11] verdankt Lessing dem späteren Diktator der Berliner Aufklärung und langjährigen Herausgeber der Allgemeinen Deutschen Bibliothek von seiner philosophischen Eigenart so gut wie nichts; dem rührend anhänglichen jüdischen Freunde – das darf man sagen, ohne dem braven Moses Mendelssohn zu nahe zu treten – recht wenig. Wohl hat dieser ihm öfters, z. B. zu der Pope-Schrift und zum »Laokoon«, Material geliefert, sicherlich auch manche philosophische Einzelgedanken, namentlich auf ästhetischem Gebiet, in ihm angeregt. Aber bei aller warmen Empfindung, bei aller Klarheit des Stils fehlt ihm doch zu sehr die philosophische Kraft und Tiefe, als daß er dem großen Freunde eine wesentliche Förderung in seiner philosophischen Entwicklung hätte bieten können. Und schließlich auch der Mut des Genius. Wie hätte es einem Lessing begegnen können, daß er vor einem anderen Menschen, und wäre es auch der »Alleszermalmer« Kant, gleich Mendelssohn scheu sich zurückgezogen hätte!
Kant sagt einmal in seiner Anthropologie, daß die »Gründung eines Charakters«, d. h. in seinem Zusammenhang die endgültige Festsetzung einer Weltanschauung, bei den meisten Menschen sich erst in ihrem vierten Lebensjahrzehnt zu vollziehen pflege. Das dürfte wenigstens für die tieferen, nicht schnell mit sich fertigen Naturen zutreffen. Jedenfalls gilt es für Kant und für Lessing. Sei es, daß seine Versetzung in ganz andere äußere Lebensumstände, unter ganz andere Menschen, in ganz andere Beschäftigungen als die gewohnten, die seine Berufung als Sekretär des Generals Tauentzien nach Breslau und ins preußische Feldlager nach sich zog, ihn um so stärker auf sich selbst besinnen ließ, oder daß seine innere Entwicklung dahin drängte: er fühlt, daß er jetzt erst zum Manne herangereift, ganz er selbst geworden ist. Nach der Genesung von einer Fieberkrankheit schreibt am 5. August 1764 der bald Fünfunddreißigjährige an seinen Freund Ramler nach Berlin: »Die ernstliche Epoche meines Lebens naht heran; ich beginne, ein Mann zu werden.«
Lessings religionsphilosophische und kirchengeschichtliche Studien gehen fort. Aber sie werden jetzt methodischer. Er beginnt[12] die früheste Entwicklung des Christentums an der Quelle, das heißt in den Werken der Kirchenväter: eines Justin, eines Tertullian, eines Origenes und Augustin, zu studieren. Er schreibt eine Abhandlung über die von Plutarch erwähnte Richtung der »Elpistiker«, d. h. etwa »Hoffnungsfrohen«, und sucht bei dieser Gelegenheit nachzuweisen, daß ohne die Hoffnung auf ein zukünftiges Leben keine Religion gedacht werden könne. Eine Ansicht, die unseres Erachtens schon durch den Buddhismus und das Judentum (wenigstens dem größten Teil seiner Geschichte nach) widerlegt wird; weshalb, beiläufig gesagt, auch Kant letzterem einmal den Charakter einer Religion abspricht. Im übrigen bemerkt Lessing, jene Hoffnung habe unter den Christen der ersten Jahrhunderte »viele falsche Märtyrer gemacht, die für nichts besser als Selbstmörder zu halten« seien.
Eine zweite Abhandlung »Von der Art und Weise der Fortpflanzung und Ausbreitung der christlichen Religion« wendet sich gegen die Ansicht der Kirchenväter und die damit übereinstimmende ihrer zeitgenössischen Verteidiger, die darin die unmittelbare Hand Gottes erblickt, und macht demgegenüber auf die vielen »Menschlichkeiten«, die sich dabei zugetragen haben, überhaupt auf den ganz »natürlichen Lauf der Dinge« aufmerksam. Kurz, er unterstellt auch die Religionsgeschichte den Gesetzen wissenschaftlicher Kritik, die sich übrigens damals auch bereits innerhalb der protestantischen Theologie zu regen begann: »Sieh überall mit deinen eigenen Augen! Verunstalte nichts, beschönige nichts! Wie die Folgerungen fließen, laß sie fließen! Hemme ihren Strom nicht, lenke ihn nicht!«
Jetzt erst werden auch seine philosophischen Studien tiefer, eindringender. Er wendet sich von dem Nachahmer (Wolff) zur Quelle (Leibniz) zurück. Noch in der Pope-Schrift war der Begriff des Gedichts ganz im Sinne der Wolffschen Schulphilosophie bestimmt worden. Ähnliches war in der Abhandlung über die Fabel und in den Anmerkungen zu des Engländers Burke Schrift über das Schöne und Erhabene (1758) geschehen. Jetzt, in den sechziger Jahren, lernt er den echten Leibniz eigentlich erst kennen, dessen »Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand« (französisch) eben[13] (1765) ihrer Vergessenheit im Staube der Hannoverschen Bibliothek entrissen worden waren. Lessing hat sie zu übersetzen angefangen, auch Material zu einer Leibniz-Biographie gesammelt. Er hat nunmehr die Kluft zwischen Meister und Schüler so deutlich erkannt, daß er von der »Eingeschränktheit und Geschmacklosigkeit« Wolffs zu sprechen wagt.
Und, was vielleicht noch wichtiger, er lernt jetzt auch den fast noch allgemein verfemten großen Spinoza kennen und schätzen. Noch in dem Pope-Aufsatz hatte er zwar nichts dagegen gehabt, daß der ihm anscheinend durch Freund Mendelssohn näher gebrachte Shaftesbury das Wort »Natur« an die Stelle des Leibnizschen »Gott« gesetzt hatte; allein noch gar nicht daran gedacht, daß damit auch der Standpunkt des jüdisch-holländischen Weisen zusammenfällt, den er noch den »berufenen Irrgläubigen« nennt. Jetzt hat er den Spinoza zu würdigen gelernt. Er ist, eigentlich noch vor Herder, Goethe und F. H. Jacobi, der Wiederentdecker desselben geworden: was allerdings erst gegen Ende seines Lebens deutlicher hervortreten und erst fünf Jahre nach seinem Tode allgemein bekannt werden sollte; weshalb wir auf die ganze Frage seines »Spinozismus« noch einmal gegen Schluß im Zusammenhang zurückkommen werden. Wir werden ferner sehen, wie sich aus der besseren Würdigung des echten Leibniz und Spinozas auch eine vertieftere, seine Berliner Freunde überraschende Stellung in seinen theologischen Kämpfen der siebziger Jahre, im Streite zwischen der Orthodoxie und der Aufklärung, ergibt, wie er immer mehr auch über die letztere hinauswächst. Zunächst aber müssen wir jetzt eine ganz andere Seite seines Philosophierens ins Auge fassen: seine
zu der die beiden großen Schriften der sechziger Jahre: der »Laokoon« (1766) und die »Hamburger Dramaturgie« (1767 bis 1769) den Grund gelegt haben, hinter denen jetzt, mindestens schriftstellerisch, die religionsphilosophische Arbeit durchaus zurücktritt. Dies Jahrzehnt war vielmehr die Zeit, wo er nach dem Worte des Briten Macaulay zum ersten Kritiker Europas sich emporschwang. Freilich nicht diese Kritik im einzelnen können wir[14] zum Gegenstand unserer Erörterung machen, auch nicht auf ästhetische Einzelheiten eingehen, sondern bloß die großen philosophischen Grundzüge hervorheben.
Betrachtet man beide Schriften nur von ihrer Außenseite, die vom lebendigen Kunstbeispiel, im ersten Falle der Plastik, im anderen der Bühne ausgeht, so könnte man sie für zufällig hingeworfene Gelegenheitsschriften halten, wie es ja fast bei allen Werken Lessings der Fall zu sein scheint. Dringt man dagegen tiefer in sie ein, so merkt man auch hier, daß eine zusammenhängende Kunstansicht dahinter steckt: eine Kunstansicht, die auf einer ausgedehnten Kenntnis der zeitgenössischen Ästhetik, ja der Kunstschöpfungen aller Zeiten aufgebaut ist.
Das Nächste und Grundlegendste ist, daß er – was freilich schon der alte Aristoteles festgestellt und natürlich auch Platos Weisheit bereits entdeckt hatte, was aber erst durch Kants Begründung zum unverlierbaren Eigenbesitz der Philosophie geworden ist – das Gebiet der Kunst oder, persönlicher ausgedrückt, die gestaltende Tätigkeit des schaffenden Künstlers von der theoretischen des wissenschaftlichen, von der praktischen des sittlichen Menschen scheidet oder doch zu scheiden beginnt. Wir werden später bei Schiller und Goethe sehen, wie diese »reinliche Scheidung« der drei menschlichen Kulturgebiete: Wissenschaft, Ethik und Kunst unter dem Einfluß Kants schon weiter fortgeschritten ist. Der
setzt sie, wie schon sein Nebentitel »Über die Grenzen der Malerei und der Poesie« besagt, innerhalb der Künste zwischen »Poesie« und »Malerei«, d. h. dem künstlerischen Schaffen in Wort, Rhythmus und Melodie, wie es Dichtkunst und Musik betreiben, auf der einen, und dem Kunstschaffen in Form und Farbe, wie es den bildenden Künsten: Malerei, Bildhauerei und Baukunst, eigen ist, auf der anderen Seite fort. Lessing befand sich damit mitten in den Problemen und der Polemik, die über sie von den angesehensten Theoretikern der Gegenwart und letzten Vergangenheit, den Franzosen Dubos, Batteux und Diderot, den Engländern Hutcheson, Harris,[15] Burke und Home, den Schweizern Bodmer und Breitinger, den Deutschen Mendelssohn, Nicolai und anderen geführt worden war. Speziell mit den beiden letzteren hatte er schon ein Jahrzehnt zuvor lange teils mündliche, teils schriftliche Diskussionen über Ursprung und Natur der tragischen Empfindungen gepflogen; ja in gewissem Sinne hatten ihn Mendelssohns »Betrachtungen über die Quellen und die Verbindungen der schönen Künste und Wissenschaften« auf das Thema seines »Laokoon« überhaupt gebracht. Und außerdem wollte er Ordnung auch in der Praxis der bildenden und der Dichtkunst schaffen: den Hang zur Allegorie (z. B. Oeser) in jener, den Hang zur Schilderungssucht (Haller, Brockes, Ewald v. Kleist und Geßner) in dieser bekämpfen. Und das ist ihm denn auch, wenigstens für Poesie, so ziemlich gelungen: er hat der bis dahin fast allgemein geübten unkritischen Vermischung der Künste, die nach der blendenden Antithese des griechischen Dichters Simonides die Dichtkunst einfach zu einer »redenden Malerei«, die bildende zu einer »stummen Poesie« machen wollte, den kritischen Todesstoß versetzt. Dem Gebiet der bildenden Künste wies er die im Raume nebeneinander geordneten sichtbaren Körper, dem der redenden das in der Zeitfolge nacheinander geordnete Gebiet der Handlung zu.
Gewiß, viele seiner Einzelansichten sind durch die moderne Kunstentwicklung und Kunstanschauung, ja zum Teil schon durch die frühere Kunstpraxis überholt. Wir werden z. B. heute nicht mehr so einseitig wie Lessing der antikisierenden Anschauung Winckelmanns folgen und allein die Schönheit, nicht die Wahrheit des Ausdrucks für den höchsten Zweck der bildenden Kunst erklären. Wir werden nicht so einseitig wie er die Form vor der Farbe, die Plastik vor der Malerei bevorzugen. Und wenn er die Landschafts-, die Historien-, die Genre-, ja sogar die Porträtmalerei verwirft, wenn er infolgedessen die großen Niederländer, sogar einen Rembrandt geringschätzt, was bleibt dann schließlich von der Malerei noch übrig? Es rächt sich hier, daß Lessing, ähnlich wie Kant, obschon wohl in nicht so starkem Maße wie dieser, die lebendige Anschauung, ja wohl auch die warme Empfänglichkeit für die großen Werke der bildenden Künstler der Renaissance, der Spanier,[16] der Niederländer gemangelt hat. Ist er doch, als er endlich mit sechsundvierzig Jahren vom Frühjahr bis in den Winter 1775 Italien bereisen konnte, freilich als offizieller Reisebegleiter eines unreifen Prinzen und seines militärischen Gouverneurs, wenn anders wir nach den trockenen und dürftigen Notizen seines Tagebuches schließen dürfen, selbst dort von den Wundern der Natur und Kunst, die nach ihm so viele Nordländer entzückt haben, anscheinend wenig ergriffen worden. In ihm herrschte eben, ähnlich wieder wie bei dem ihm überhaupt in so mancher Hinsicht geistesverwandten Kant, auch in Kunstdingen die norddeutsche Reflexion, der eindringende Scharfsinn, die Neigung zum psychologischen Zergliedern vor, gegenüber der Gefühlswärme eines Herder, eines Goethe oder gar eines Heinse.
Auch in seinem eigentlichen Felde, der Poesie, wird man seiner Bevorzugung des Epos und des später noch besonders zu erörternden Dramas vor der Lyrik nicht zuzustimmen brauchen. Obwohl im Grunde doch auch für die Lyrik sein oberstes Kunstgesetz zutrifft, wenn man bloß für »Handlung« das sinnverwandte »Bewegung« einsetzt, die auch durch die zarteste Stimmungs- oder Liebespoesie, ja gerade durch diese (man denke etwa an Goethes Sesenheimer Lieder), wenn ebenso auch »Handlung« selbst durch Goethes, Schillers und Uhlands Balladen geht. Ja man könnte in Anwendung eines bekannten Wortes von Kant über Plato, daß man ihn besser verstehen könne, als er sich selbst verstand, untersuchen, ob nicht aus Lessings Gedanken noch andere und fruchtbarere Folgerungen zu ziehen sind, als er selbst sie in dem ja leider unvollendet gebliebenen »Laokoon« gezogen hat. So könnte man mit Schrempf aus dem Motiv der Liebe, die nach der Einleitung »den großen alten Meistern die Hand zu führen nicht müde geworden«, anknüpfend an den platonischen Eros, von der bildenden auch nach der Dichtkunst die Linien hinüberziehen und als deren eigentlichen Gegenstand den »menschlichen Helden« hinstellen, wie ihn der »Laokoon« in dem Philoktet des Sophokles zeichnet, der weder weichlich noch verhärtet ist, und von dem er sagt, er sei »das Höchste, was die Weisheit hervorbringen, die Kunst nachahmen kann«. Für das Auge der Liebe dürfte auch, wie Schrempf feinsinnig bemerkt,[17][1] der scharfe Gegensatz von Schönheit und Wahrheit des Ausdrucks, den Lessing selbst noch zieht, nicht vorhanden sein. Wir lieben doch einen Menschen und deshalb auch seine Nachbildung in der Kunst (man denke namentlich an die religiöse Malerei!), wenn aus seinen Zügen eine schöne Seele spricht, auch wenn er auf körperliche Schönheit keinen Anspruch machen kann. Auch der Bildner des Laokoon erregt mein ästhetisches Wohlgefallen doch nur dadurch, daß er mir dessen Seelengröße bei allen seinen Qualen zeigt. Lessing kann und will vielleicht auch nicht mehr behaupten, als daß die griechischen Künstler selbst in der Darstellung der Leidenschaft, mithin des Ausdrucks, die Rücksicht auf die schöne Form nie vergessen haben.
Es ist schade, daß der »Laokoon« ein Torso geblieben ist. Schon deshalb, weil Lessing sich in dem Vorliegenden fast ganz auf den Unterschied von Poesie und »Malerei« in der Darstellung sinnlich sichtbarer Gegenstände beschränkt hat. Wie er schon in seiner Abhandlung über die Fabel (1759) auch für deren Erzählung eine Handlung, d. h. eine Folge von Veränderungen, die ein Ganzes ausmachen, gefordert hatte, so wollte er, wie die in seinem Nachlaß enthaltenen Entwürfe zeigen, in der beabsichtigten Fortsetzung des »Laokoon« seine Haupt- und Grundsätze auf alle wichtigen Stilfragen ausdehnen und nicht bloß die redende und bildende Kunst (darunter gewiß auch die im »Laokoon« vernachlässigte Baukunst), sondern auch die Musik, ja sogar die Tanzkunst bis zu einem gewissen Grade in den Kreis seiner Untersuchung ziehen.
Seine Eigenart freilich und das Geheimnis seiner heute noch fortdauernden Wirkung auf uns liegt, wie wir es zum Teil schon sahen, nicht in dem systematischen Abschließen, sondern in dem stets lebendigen Forschen, das auch den Leser zum Mitphilosophieren zwingt. Er verschmäht absichtlich für seine im letzten Grunde sehr überdachten Untersuchungen die feste systematische Form. Er will, weder mit seinem »Laokoon« noch später mit seiner »Hamburger Dramaturgie«, ein ästhetisches Lehrbuch liefern, wie es nicht lange vorher, als erster in Deutschland, der Hallenser Professor Baumgarten mit seiner »Ästhetica«, trocken und pedantisch genug, der gelehrten[18] Welt gegeben hatte. »An systematischen Lehrbüchern«, bemerkt – auch für unsere Zeit noch sehr passend – gleich die Vorrede zum »Laokoon«, »haben wir Deutsche überhaupt keinen Mangel. Aus ein paar angenommenen Worterklärungen in der schönsten Ordnung alles, was wir nur wollen, herzuleiten, darauf verstehen wir uns trotz einer Nation der Welt.« Lessing dagegen wählt mit Absicht den scheinbar regellosen Weg des bald hierhin, bald dorthin ablenkenden Spaziergängers, geht von lebendigen Beispielen, sei es der bildenden Kunst oder der dichterischen Praxis des Sophokles und vor allem des ewig jungen Vaters Homer aus, um aus ihnen erst zum Schluß einige wenige allgemeine Gesetze abzuleiten. Erst der sechzehnte Abschnitt beginnt, nach einem in der Mitte abgebrochenen Satze, mit den Worten: »Doch ich will versuchen, die Sache aus ihren ersten Gründen herzuleiten.« Gerade darum eignen sich seine wichtigsten kunstphilosophischen Schriften, nicht zu vergessen auch die schöne Abhandlung »Wie die Alten den Tod gebildet«, noch heute so gut zur Lektüre unserer Primaner und Primanerinnen: nicht etwa als unantastbare Regel und Richtschnur, sondern als beständiger Anreiz zu eigenem Nachdenken, als Anknüpfungspunkt zu weiterführenden, vielleicht mit einem anderen Ergebnis oder besser noch mit der Aussicht auf neu sich auftuende Fragen schließenden Erörterungen. Sie sind zugleich ein treffliches Vorbild für den zukünftigen Schriftsteller oder Redner, daß er uns seine Gedanken nicht als fertige vortrage, sondern sie vor unseren Augen, ja in unserer Seele erst entstehen lasse, wie Homer den Schild des Achilleus.
Daß neben den entdeckten obersten Kunstgesetzen auch noch eine Fülle fruchtbarer ästhetischer Einzelbegriffe gefunden oder festgestellt wird, wie die Wahl des fruchtbarsten Augenblicks für den Dichter und den bildenden Künstler, die Bestimmung des Reizes als der »Schönheit in Bewegung«, die Behandlung des Lächerlichen und des Häßlichen, des Furchtbaren, des Gräßlichen und des Ekelhaften, sei nur nebenher erwähnt. Auch die Beziehungen der Kunst zum Staat, zur Religion werden, wie jeder Leser des »Laokoon« weiß, bereits in den einleitenden Erörterungen berührt. Und seine letzte kunstphilosophische Abhandlung »Wie die Alten den Tod[19] gebildet« – nämlich nicht als Knochengerippe wie die Nordländer, selbst ein Holbein, Dürer oder Rethel, sondern als den Bruder des Schlafes – schließt mit einer tiefempfundenen und sehr zu denken gebenden, gegen eine kunstfeindliche Richtung innerhalb des Protestantismus gerichteten Bemerkung über das Verhältnis von Kunst und Religion: »Nur die mißverstandene Religion kann uns von dem Schönen entfernen; es ist ein Beweis für die wahre, für die richtig verstandene wahre Religion, wenn sie uns überall auf das Schöne zurückbringt.«
So wirkte denn der »Laokoon« schon zur Zeit seines Erscheinens mächtig auf alle freieren Geister in der bildenden Kunst und der Dichtung. Ein neuerer Gelehrter hat sich die Mühe genommen, alle erreichbaren Urteile der Zeitgenossen über die einzelnen Schriften Lessings zusammenzutragen. Aber wir bedürfen für unseren philosophischen Zweck nicht solches philologischen Sammelns teilweise doch ganz wertloser Äußerungen von Krethi und Plethi. Uns genügt zu einer nochmaligen Schlußbeleuchtung von Lessings kunstkritischer Tat das Urteil des einen Goethe, wie es sich im achten Buche des zweiten Teiles von »Dichtung und Wahrheit« findet. »Man muß Jüngling sein,« so schreibt er noch nach vierundeinhalb Jahrzehnten und doch mit lebendigster Erinnerung an die eigene Jünglingszeit, »um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirkung Lessings ›Laokoon‹ auf uns ausübte.« Die »Wir«, das ist die junge Generation, die eine neue Blütezeit der deutschen Dichtung erstrebte und auch erreicht hat; nicht die alte, absterbende: die trockenen Gottschedianer auf der einen, die empfindsame und in breiten Beschreibungen sich ergehende sogenannte »Schweizer« Schule der Haller, Bodmer und Breitinger auf der anderen Seite, und doch auch die Männer des alten Geschmacks, die dem deutschen Dichtergenius noch nichts zutrauten, und zu denen selbst so große Geister wie Immanuel Kant und Friedrich der Große gehörten. Goethe fährt fort – und nun kommt der feinste und wichtigste Zug seiner Charakteristik –: »indem uns dieses Werk aus der Region eines kümmerlichen Anschauens in die freien Gefilde des Gedankens hinriß.« Mit dem kümmerlichen Anschauen wird er wohl weniger das Gebiet der[20] bildenden Kunst gemeint haben, denn hier hatte Johann Winckelmann bereits ein Jahrzehnt zuvor durch seine »Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in Malerei und Bildhauerkunst« (1755) und von neuem eben erst (1764) durch seine »Geschichte der Kunst des Altertums« revolutionierend gewirkt,[2] sondern die Poesie. Die »Anschauung« muß auch auf dem Felde der Ästhetik durch den »Gedanken« oder, wie es kurz vorher bestimmter heißt, durch den »Begriff« erst erleuchtet, gewissermaßen erst sehend gemacht werden. Denn, wie Kant an einer bedeutsamen Stelle seiner »Kritik der reinen Vernunft« es formuliert: Begriffe ohne Anschauungen sind freilich »leer«, aber Anschauungen ohne Begriffe sind »blind«. Die so lange aus Mißverständnis beider Kunstarten hervorgegangene Vermischung und Verwischung von bildender und redender Kunst, wie sie in jener glänzenden Antithese des Simonides von der Poesie als redender Malerei und der Malerei als der stummen Poesie lag, sie war nach Goethes Ausdruck nun durch die Tat Lessings »auf einmal beseitigt« worden; die Gipfel beider Künste »erschienen nun getrennt«, wie nahe auch ihre »Basen« in dem schöpferischen Urquell alles Kunstschaffens überhaupt »zusammenstoßen mochten«. Und wenn er dann zum Schlusse ausführt, daß sie, d. h. die junge Generation, daraufhin »alle bisherige anleitende und urteilende Kritik wie einen abgetragenen Rock weggeworfen« hätten, so hat er damit die epochemachende tatsächliche Wirkung der Lessingschen Kunstschrift noch nach 45 Jahren aufs stärkste gekennzeichnet. In der Tat hat denn auch der »Laokoon« in dem nächsten Vierteljahrhundert nach seinem Erscheinen nach dem Urteil Wilhelm Diltheys »alle ästhetische und literarische Kritik bestimmt«, bis 1790 ein noch Größerer kam, Kant mit seiner »Kritik der Urteilskraft«, die Schiller und Goethe, wie wir später sehen wollen, zusammenführen sollte. Allein nicht bloß die ästhetische Theorie, auch das dichterische Schaffen selbst hat der »Laokoon« nachhaltig beeinflußt. Das haben nicht bloß Herder und Wieland dankbar anerkannt (der letztere z. B. bemerkt[21] einmal an einer Stelle, wo er sich in eine längere poetische Beschreibung einlassen will: »Hier zupft mich Lessing am Ohr!«), das haben auch Schiller und Goethe selber praktisch beachtet. Denken wir nur an Schillers großes kulturphilosophisches Gedicht »Der Spaziergang« – welcher Unterschied gegen die trockenen Lehrgedichte eines Pope und Haller! – oder an »Hermann und Dorothea« mit dem Gang der Löwenwirtin durch ihr Besitztum. Und ihnen nach, bewußt oder unbewußt, unsere besten neueren Dichter: die Gottfried Keller, Konrad Ferdinand Meyer, Theodor Storm und andere.
Doch es wird Zeit, daß wir uns der zweiten großen ästhetischen Tat Lessings zuwenden, seiner
Wenn das Wesen der Poesie Handlung ist, so stellt ihren Höhepunkt die dramatische Dichtung dar, die ihren Namen ja vom griechischen Worte (drān) für »handeln« hat und in »Akte«, d. h. Handlungen, zerfällt. War dies Thema im »Laokoon« nur gestreift worden, so kehrte Lessing in seiner »Hamburger Dramaturgie« zu der theoretischen Behandlung seines alten Lieblingsfeldes, des Schauspiels, zurück, dem er inzwischen durch seine »Minna von Barnhelm« eine seiner unvergänglichsten Gaben geschenkt hatte.[3] Auch diesmal wieder geht er, ja in noch weit höherem Grade als beim »Laokoon«, von der Praxis aus: den Ausführungen des neugegründeten, als großes deutsches Nationaltheater geplanten, leider aber nach kaum zwei Jahren aus Mangel an Interesse der maßgebenden Kreise gescheiterten Hamburger Schauspielhauses, zu dessen dramatischem Berater er gewählt worden war. Aus seiner Besprechung dieser Aufführungen, die sich infolge äußerer Umstände immer mehr auf die theoretische Seite beschränkte, erwuchs die berühmte »Hamburger Dramaturgie« (1767 bis 1769): jenes Buch, dessen Verfasser dramatischer Theoretiker, erfahrener Theatermann und dramatischer Dichter zugleich war, also alle drei erforderlichen Eigenschaften in gleichem Maße besaß; jenes Buch, von dem Gervinus in seiner[22] »Geschichte der deutschen Dichtung« (IV, S. 399) sagt: er kenne »kein Buch, bei dem ein deutsches Gemüt über den Widerschein echt deutscher Natur, Tiefe der Erkenntnis, Gesundheit des Kopfes, Energie des Charakters und Reinheit des Geschmacks innigere Freude und gerechtfertigteren Stolz empfinden dürfte«.
Wenn das Drama nach Diltheys zutreffendem Wort eine vollendet vergegenwärtigte Handlung ist, die Form der Handlung aber nur in der Einheit gefunden werden kann, so bedarf gerade das Drama vor allem strengster Einheit der Handlung. Die von den französischen Ästhetikern und ihren Nachtretern, den deutschen Gottschedianern geforderten und dann in der dramatischen Praxis der Zeit fast ausnahmslos bis zur Schablone mit pedantischer Ängstlichkeit durchgeführten zwei weiteren »Einheiten« des Ortes und der Zeit, wonach die Handlung sich binnen vierundzwanzig Stunden womöglich in demselben Raume abspielen mußte, sind mithin unerheblich. Die stärkste Wirkung entfaltet die tragische Handlung. Wenn aber weiter alles menschliche Tun dem unterschiedslosen Gesetz von Ursache und Wirkung unterliegt, so muß auch die von dem genialsten und scheinbar regellosesten aller bisherigen Dramatiker, dem großen Shakespeare, geschaffene dichterische Welt ebenfalls einen lückenlosen Zusammenhang der inneren und äußeren Motivierung dieser Handlungen aufweisen. Eine jede von ihnen muß aus dem Charakter der handelnden Personen und der sie umgebenden Welt (ihrem »Milieu«) notwendig hervorgehen, genauer hervorzugehen scheinen. Die Tragödie insbesondere muß uns mitten in die tragischen Charaktere, in das Werden ihrer Leidenschaften versetzen, so lebendig, daß auch dem Zuschauer oder Leser alles klar und durchsichtig vor die Seele tritt. »Wir müssen bei jedem Schritt, den der Poet seine Personen tun läßt, bekennen: wir würden ihn in dem nämlichen Grade der Leidenschaft, bei der nämlichen Lage der Sache selbst getan haben.«
Unserem Ästhetiker scheint daher, wie schon dem alten Aristoteles in seiner »Poetik«, die Tragödie einen viel philosophischeren Charakter zu besitzen als die Geschichte. Denn »auf dem Theater sollen wir nicht lernen, was dieser oder jener[23] einzelne Mensch getan hat, sondern« – was Lessing offenbar für eine philosophische Einsicht hält – »was jeder Mensch unter gewissen gegebenen Umständen tun werde«. Man kann bestreiten, ob die recht verstandene Geschichte wirklich vom philosophischen Standpunkt aus dem Drama untergeordnet ist. Tiefere Geschichtschreiber und Geschichtsphilosophen werden es nicht zugeben. Sagt doch z. B. Auguste Comte, gerade die Geschichte lehre savoir pour prévoir, »wissen, um vorauszuwissen«! Diese Frage steht überhaupt auf einem anderen Blatte, und wir wollen ihr jetzt nicht weiter nachgehen. Die Hauptfrage ist für den Dichter wie für den Theoretiker der Tragödie eine andere, die rein subjektive: Welches Gefühl soll die echte Tragödie im Gemüt des Zuschauers erwecken?
Damit kommen wir zu der berühmten aristotelischen Begriffsbestimmung des Trauerspiels, von der uns hier nur der Schlußgedanke angeht, daß sie »vermittels des Mitleids und der Furcht die Reinigung derartiger Leidenschaften hervorbringt«. Wir wollen uns nicht mit den Einzelheiten dieser berühmten Definition, die bekanntlich eine ganze Literatur für sich hervorgebracht hat, aufhalten, z. B. mit der Frage, ob die »Reinigung« (Katharsis) eine Läuterung der genannten beiden Leidenschaften selbst oder eine Befreiung von ihnen bedeutet. Auch, ob »Furcht« bei Aristoteles in dem von Lessing angenommenen Sinne gemeint ist, sie sei »das auf uns selbst bezogene Mitleid«, mag zweifelhaft bleiben. Wir sind überhaupt nicht der von Lessing noch mit den meisten seiner Zeitgenossen geteilten Meinung, daß Aristoteles in diesen Dingen eine unfehlbare Richtschnur darstelle. Das Wesentliche scheint mir vielmehr mit Dilthey darin zu liegen, daß Lessing, ob mit oder ohne Aristoteles, das Mitleid in seiner ganzen Tiefe faßt, daß wir es uns erweitert denken müssen zum Mitempfinden überhaupt, gleichsam zum »Miterzittern unseres Innern«, wie wenn eine zweite Saite mit der zuerst angeschlagenen mitzutönen beginnt, so daß also neben der Mittrauer die Mitfreude mitumfaßt wird. So mußte Lessing den Kern der Handlung, den Kern der dramatischen Charaktere eines Shakespeare und anderer Großen in der freien, lebendigen Bewegung großer Leidenschaften[24] erblicken, wie er schon im »Laokoon« das Stoische als »untheatralisch« bezeichnet und die bloße Bewunderung einen »kalten Affekt« genannt hatte. Damit aber legt er den letzten Grund des dichterischen Schaffens in die Hand des Genies.
Man hat Lessing häufig der Genieperiode des achtzehnten Jahrhunderts schroff entgegengesetzt. Gewiß, er hat deren Ausartungen nicht gebilligt. Und er selbst hat in dem Epilog zu seiner »Dramaturgie« allzu bescheiden von sich behauptet, nicht einmal ein Dichter, viel weniger ein Genie zu sein: »Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt; ich muß alles durch Druckwerk und Röhren aus mir herauspressen.« Sicherlich, die kritische Ader war in ihm stärker als die produktive Schöpferkraft. Aber schon Goethe hat auf diese Selbstbezweifelung die richtige Antwort gegeben: »Lessing wollte den hohen Titel eines Genies ablehnen, aber seine dauernden Wirkungen zeugen wider ihn selber.« Erinnern wir uns auch seiner Jugendverse vom Adlerflug des Genies (S. 6 f.). Er ist jedenfalls nicht bloß selbst ein großes kritisches Genie gewesen, sondern hat vor allem auch das Wesen des Genies begriffen und seinen Alleinwert für die Dichtkunst gewürdigt. Ich gebe Ihnen im folgenden einige seiner Aussprüche wieder. Das Genie trägt nach ihm die Probe der Regeln in sich, es ist der geborene Kunstrichter und lacht über die Grenzscheidungen der Kritik. Es beweist durch die Tat, d. h. durch sein Werk, was möglich ist. Aus sich selbst, aus seinem eigenen Reichtum bringt es alle seine Schöpfungen hervor. Das höchste Genie, den göttlichen Schöpfer, im kleinen nachahmend, schafft sich seine eigene Welt. Freilich an anderen Stellen heißt es doch wieder im Geiste der alten Zeit: mit Absicht dichten, d. h. mit Absicht »nachahmen« sei eben das, was das Genie von den kleinen Dichtern und Künstlern unterscheide. Zu dem ganz freien Begriff des Genies, wie ihn Kants »Kritik der Urteilskraft« lehrt, ist Lessing mithin doch nicht völlig vorgedrungen.
Auch klebt er noch zu fest an den aristotelischen Begriffen: er hat sich von dem Einfluß der antiken Schicksalstragödie,[25] die er in Sophokles verehrte, zu der rein modernen Charaktertragödie, welche die Katastrophe einzig und allein aus der tragischen Schuld des Helden herleitet, noch nicht gänzlich durchgerungen. Im letzten Grunde darf doch die Tragödie sich nicht damit begnügen, bloß die Darstellung einer rührenden, unser Mitleid erregenden Handlung zu sein; sondern muß uns durch den in ihr sichtbar werdenden, wenigstens inneren Triumph der sittlich-vernünftigen Weltordnung befreien und erheben. Deshalb befriedigt uns z. B. der Ausgang von Schillers »Räubern« oder »Luise Millerin« mehr als der von Hauptmanns »Webern«, was ich übrigens zu meiner Freude schon in Abiturientenaufsätzen westfälischer Oberprimaner klar auseinandergesetzt fand.
Mit seiner im Winter 1771/72 verfaßten »Emilia Galotti«, sozusagen der praktischen Verkörperung seiner dramatischen Theorie, schließt Lessings ästhetische Epoche ab; denn sein »Nathan« von 1776 dient anderen Zwecken. Noch einmal legt er hier in deren erstem Aufzug dem Maler Conti geistvolle ästhetische Aussprüche in den Mund, wie die, daß »Raffael das größte malerische Genie gewesen wäre, auch wenn er unglücklicherweise ohne Hände wäre geboren worden«. Dann aber versiegt seine ästhetische Ader. Was er Ästhetisches der Welt zu sagen gehabt hatte, hatte er gesagt. Er wendet sich nun wieder den religiösen, zuletzt auch den geschichts-, staats- und allgemein-philosophischen Weltanschauungsfragen zu.
Seine dramatischen Theorien aber haben auf Dichter, Ästhetiker und die praktischen Vertreter der Schauspielkunst nachhaltig eingewirkt. Wie wir bei dem »Laokoon« uns auf des einen Goethe Ausspruch bezogen haben, so möchten wir hier auch nur auf das Urteil unseres größten klassischen Dramatikers hinweisen. Kein Geringerer als Friedrich Schiller schreibt am 4. Juni 1799 über die »Hamburger Dramaturgie« an Goethe: Lessing sei über das, was die Kunst betreffe, am klarsten gewesen, habe am schärfsten und zugleich am liberalsten darüber gedacht und das Wesentlichste, worauf es ankomme, am unverrücktesten ins Auge gefaßt. Und um zum Schlusse auch noch einen Mann der Praxis zu zitieren: der große Mime Eduard Devrient rühmt in seiner »Geschichte der deutschen Schauspielkunst« gerade Lessing auch als deren[26] Befreier: »Von nun an war der Schauspieler von allem Herkömmlichen, von allen Kunstmustern wieder unmittelbar an die Natur gewiesen. Er hatte Menschen, er hatte Leidenschaften, Schwächen und Tugenden darzustellen, Gedanken und Empfindungen auszusprechen; wie er sie kannte, wie er sie im eigenen Leben fand. Die Geschichte des deutschen Herzens war Gegenstand seiner Kunst geworden.«
Religionsphilosophie
Im Mai 1770 hatte Lessing seine erste und – letzte amtliche Stellung angetreten: die eines Bibliothekars an der berühmten Wolfenbütteler Bibliothek, bei deren reichen Bücherschätzen er sich zunächst, trotz aller Einsamkeit, ganz wohl fühlte. Unter ihren ungefähr sechstausend Handschriften hatte er bereits im selben Sommer eine längst verloren geglaubte Abhandlung des berühmten Frühscholastikers Berengar von Tours über die Abendmahlslehre entdeckt, über die er dann im Oktober desselben Jahres einen ausführlichen Vorbericht herausgab. Uns interessiert hier nicht die theologische Seite des Problems, insbesondere ob und wieweit Lessings Behauptung berechtigt ist, daß Berengars Auffassung derjenigen Luthers verwandt sei, wodurch er sich, wie er seiner späteren Gattin Eva König ironisch schreibt, bei »unseren lutherischen Theologen in den lieblichen Geruch von Rechtgläubigkeit setzte« und namentlich seinem alten Vater noch eine letzte Freude bereitete. Für ihn war das Ganze nur eine historisch-kritische Frage; denn er persönlich hatte längst der dogmatischen Auffassung Lebewohl gesagt, die Friedrich II. einmal gegen Voltaire »das empörendste und für das höchste Wesen beleidigendste Dogma« und zugleich »den Gipfel der Tollheit und des Blödsinns« erklärt hat, weil es darin bestehe: »seinen Gott zu essen«. Sondern uns interessieren auch hier wieder mehr seine beiläufigen Bemerkungen. Berengar war für sein zeitgenössisches elftes Jahrhundert ein Aufklärer und ein Ketzer gewesen. Dazu bemerkt der ihm geistesverwandte Lessing: »Das Ding, was man Ketzer nennt, hat eine sehr gute Seite. Es ist ein Mensch, der mit[27] seinen eigenen Augen wenigstens hat sehen wollen. Die Frage ist nur, ob es gute Augen gewesen, mit welchen er selbst sehen wollen. Ja, in gewissen Jahrhunderten ist der Name Ketzer die größte Empfehlung, die von einem Gelehrten auf die Nachwelt gebracht werden können.« Berengar hatte sich zuletzt freilich, wie so viele nach ihm, der Kirche »löblich unterworfen«. Dazu meint der Aufklärer des achtzehnten Jahrhunderts: »Ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, Glück und Leben der Wahrheit aufzuopfern … Aber das, weiß ich, ist Pflicht, wenn man Wahrheit lehren will, sie ganz oder gar nicht zu lehren, sie klar und rund, ohne Rätsel, ohne Zurückhaltung, ohne Mißtrauen in ihre Kraft und Nützlichkeit zu lehren …« Ewig denkwürdige, ewig nachahmenswerte Worte! Und er läßt auch den Einwurf nicht gelten, daß die Vorurteile und Eindrücke unserer ersten Erziehung doch nie auszurotten wären. Im Gegenteil, »die Begriffe, die uns von Wahrheit und Unwahrheit in unserer Kindheit beigebracht werden, sind gerade die allerflachsten, die sich am allerleichtesten durch selbsterworbene Begriffe auf ewig überstreichen lassen«.
Der zweite Fund (1773) betraf eine Vorrede Leibnizens zu der Abhandlung eines Altorfer Gelehrten »Von den ewigen Strafen«. Auch hier setzte sich Lessing zum Erstaunen seiner aufklärerischen Berliner Freunde dafür ein, daß die Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrafen konsequenter sei und deshalb auch von dem großen Leibniz, »der, wenn es nach mir ginge, nicht eine Zeile vergebens müßte geschrieben haben«, eher habe verteidigt werden können als die mildere Auffassung des rationalistischen Theologen Eberhard. Von dem »rohen und wüsten Begriff, in dem so mancher Theologe diese Lehre nimmt«, könne selbstverständlich bei einem Manne wie Leibniz keine Rede sein. Die »Hölle« ist »nichts anderes als der Inbegriff der natürlichen Strafen«. Seine bei dieser Gelegenheit verteidigte Unterscheidung von »exoterischer«, d. h. für die große Masse, und »esoterischer«, für die tiefer Denkenden bestimmter Lehre scheint freilich in geradem Widerspruch zu seinem vorhin zitierten schönen Worte von der Pflicht zur Wahrheit zu stehen.
Deutlicher drückt er sich darüber in einem Briefe vom 2. Februar 1774 an seinen Bruder Karl aus, der ihm offenbar[28] seine Gegnerschaft gegen die »Aufklärung« vorgeworfen hatte. »Ich sollte es der Welt mißgönnen, daß man sie mehr aufzuklären suche? Ich sollte es nicht von Herzen wünschen, daß ein jeder über die Religion vernünftig denken möge?« Er würde sich selbst verabscheuen, wenn er bei seinen »Sudeleien« einen anderen Zweck verfolgt hätte! Er wolle nur nicht, daß das »unreine Wasser, welches längst nicht mehr zu brauchen«, eher »weggegossen« würde, als »bis man weiß, woher reineres nehmen«. »Mit der Orthodoxie war man, Gott sei Dank, ziemlich zu Rande; man hatte zwischen ihr und der Philosophie eine Scheidewand gezogen, hinter welcher eine jede ihren Weg fortgehen konnte, ohne die andere zu hindern. Aber was tut man nun? Man reißt diese Scheidewand nieder und macht uns unter dem Vorwand, uns zu vernünftigen Christen zu machen, zu höchst unvernünftigen Philosophen.«
Gotthold Lessing ist also im letzten Grunde viel radikaler als sein jüngerer Bruder, der die neumodische Aufklärungstheologie in Schutz nimmt, welche den »gereinigten« christlichen Glauben beweisen will. Sein Widerspruchsgeist und seine dialektische Kunst verleitet ihn jedoch, auch in der folgenden Schrift, die sich wiederum mit einem Leibnizschen Aufsatz, diesmal gegen »des Andreas Wissowatius Einwurf wider die Dreieinigkeit«, also einem anderen Hauptdogma des Christentums, beschäftigt, allzu sehr die Partei der angegriffenen Orthodoxie zu nehmen. Er geht in dieser Dialektik sogar so weit, daß er einmal meint, »einer übernatürlichen geoffenbarten Wahrheit, die wir nicht verstehen sollen«, gereiche diese »Unverständlichkeit« gerade zum »undurchdringlichsten Schilde«; womit wir dann glücklich bei des alten Kirchenvaters Credo, quia absurdum (Ich glaube, weil es vernunftwidrig ist) angekommen wären. Daß das nicht seine wirkliche An- und Absicht war, sollte sich bald in einem größeren Waffengang zeigen.
Es trat schon hervor in einer seiner bereits (S. 8) erwähnten »Rettungen«: »Von Adam Neusern einige authentische Nachrichten« (1774): in gewisser Hinsicht einer unmittelbaren Ergänzung zu der Wissowatius-Schrift. Adam Neuser war ein in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts in[29] Heidelberg als Pfarrer wirkender Bekämpfer der Dreieinigkeitslehre, der dem Henkerschicksal seines Amtsbruders Sylvan und seines berühmteren Vorgängers Servet in Genf (der bekanntlich wegen seines Glaubens an einen Gott statt der offiziellen »Dreigötterei« [Tritheismus] von Kalvin, unter dem Beifall Luthers und Melanchthons, auf den Scheiterhaufen gebracht wurde) nur dadurch entging, daß er sich vor der Verfolgungswut seiner »christlichen« Amtsbrüder nach mancherlei Irrfahrten zu dem türkischen Großsultan rettete, unter dessen Schutz und in dessen Dienst als Dolmetscher er, Mohammedaner geworden, 1576 starb. Aus seinem von Lessing zum ersten Male veröffentlichten Schreiben an einen unbekannten Landsmann ergibt sich für einen Unbefangenen mindestens sein subjektiv gutes Bewußtsein. Allein, wie es sein Verteidiger bezüglich der leider zur Tat gewordenen Hinrichtung Sylvans ausführt, »die Theologen verlangten Blut, durchaus Blut«. Nicht einmal Zeit für »Besserung« zugestanden. »Nur erst den Kopf ab; mit der Besserung wird es sich schon finden, so Gott will!« Woran Lessing den Stoßseufzer schließt: »Welch ein Glück, daß die Zeiten vorbei sind, in welchen solche Gesinnungen Religion und Frömmigkeit hießen! Daß sie wenigstens unter dem Himmel vorbei sind, unter welchem wir leben! Aber welch ein demütigender Gedanke, wenn es möglich wäre, daß sie auch unter diesem Himmel einmal wiederkommen könnten!«
Den Aufsatz über Neuser veröffentlichte Lessing zusammen mit einem inhaltlich verwandten »Von Duldung der Deisten«, das er als »Fragment eines Ungenannten« bezeichnete. Dies Fragment, das er unter den neuesten Handschriften der Wolfenbütteler Bibliothek gefunden haben will, handelt, um mit Lessing zu reden, »von der Vortrefflichkeit und Hinlänglichkeit der natürlichen Religion« und fordert die Duldung für Anhänger, »welche sich«, wie der »Ungenannte« sich ausdrückt, »in der Erkenntnis und Verehrung Gottes bloß an die gesunde Vernunft halten«. Der Herausgeber beschränkt sich auf eine kurze Einleitung, in der er die Fragmente als »mit der äußersten Freimütigkeit, zugleich aber mit dem äußersten Ernst geschrieben«, kurz als die Schrift eines offen und »geradezu« redenden »wahren, gesetzten[30] Deutschen« charakterisiert; und auf einige angehängte Schlußseiten, auf denen er unter anderem die Gesinnung des Mohammedaner gewordenen Neuser mit der verwandten des »ungenannten« Deisten vergleicht, zum Schluß auch bereits sich ironisch über das heutige »vernünftige« Christentum äußert, von dem man nur »eigentlich nicht wisse, weder wo ihm die Vernunft noch wo ihm das Christentum sitzt«.
Der wirkliche Verfasser war der im März 1768 verstorbene Hamburger Gelehrte und Gymnasialprofessor Hermann Samuel Reimarus. Das von ihm hinterlassene, mehr als zweitausend Seiten starke Manuskript, das seine Tochter Elise dem ihr seit 1769 befreundeten Lessing anvertraut hatte, war betitelt »Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes«, womit die seit ihrem Aufkommen in England um 1700 so genannten »Deisten«, d. h. Anhänger eines allweisen und allgütigen Gottes, der jedoch die Welt bloß geschaffen hat, aber sie nachher ihren eigenen Gesetzen gemäß sich entwickeln läßt, gemeint sind. Das gründliche Buch des überaus ehrlichen, rechtschaffenen und selbständigen Verfassers stellt den vielleicht konsequentesten und scharfsinnigsten Angriff dar, der gegen das biblische Christentum und seine jüdische Vorstufe – der erste Teil kritisiert das Alte, der zweite das Neue Testament – bisher unternommen worden war. Reimarus bestreitet die Glaubwürdigkeit religiöser Offenbarungen, d. h. Mitteilung religiöser Wahrheiten an einzelne Personen bestimmter Zeiten und Völker, schon weil eine solche Ausnahmebehandlung Gottes Güte und Weisheit widersprechen würde. Zudem trage weder das Alte noch das Neue Testament den Charakter einer solchen Offenbarung. Sein Standpunkt ging also über den des damals den öffentlichen Geist beherrschenden sogenannten »aufgeklärten« oder »vernünftigen« Christentums an Folgerichtigkeit und Ehrlichkeit weit hinaus.
Gerade deshalb hatte er unseren allen halben Wahrheiten abgeneigten Lessing angezogen, obschon dieser sich durchaus nicht mit ihm identifizierte, und er entschloß sich trotz des Abratens seiner Berliner Freunde, des weltklugen Nicolai und des zaghaften oder mindestens vorsichtigen Mendelssohn, zu der Veröffentlichung. Da aber die Berliner Zensur die Druckerlaubnis[31] verweigerte, so benutzte er die Zensurfreiheit seines Bibliothekamtes, um wenigstens die ihm am wichtigsten erscheinenden Abschnitte desselben als »Beiträge« aus den Papieren eines »Ungenannten« herauszugeben. Es sind die berühmt gewordenen »Wolfenbütteler Fragmente«, die von ihm selbst zum Teil mit eigenen »Gegensätzen« versehen wurden. Das von uns bereits erwähnte 1774 veröffentlichte, inhaltlich noch sehr gemäßigte Fragment war ziemlich unbeachtet geblieben. Anders die fünf folgenden, 1777 zusammen herausgegebenen. Schon die Überschriften weisen auf den Inhalt. Sie lauten: 1. Von der Verschreiung der Vernunft auf den Kanzeln. 2. Unmöglichkeit einer Offenbarung, die alle Menschen auf eine gegründete Art glauben könnten. 3. Durchgang der Israeliten durchs Rote Meer. 4. Daß die Bücher des Alten Testaments nicht geschrieben worden, eine Religion zu offenbaren. 5. Über die Auferstehungsgeschichte.
Wie verhält sich nun Lessings eigener Standpunkt dazu? Lessing hat seine »allgemeine« Antwort in einer Reihe schlagender Sätze zusammengefaßt, die er später, einen jeden einzelnen, in glänzender Form gegen die Angriffe des Hauptpastors Goeze verteidigte und die seinen Standpunkt gegenüber der biblischen Überlieferung mit außerordentlicher Klarheit und Knappheit wiedergeben: 1. Die Bibel enthält offenbar mehr, als zur Religion gehört. 2. Es ist bloße Hypothese (Vermutung), daß die Bibel in diesem Mehreren gleich unfehlbar sei. 3. Der Buchstabe ist nicht der Geist, und die Bibel ist nicht die Religion. 4. Folglich sind Einwürfe gegen den Buchstaben und gegen die Bibel nicht eben auch Einwürfe gegen den Geist und gegen die Religion. 5. Auch war die Religion, ehe eine Bibel war. 6. Das Christentum war, ehe Evangelisten und Apostel geschrieben hatten. Es verlief eine geraume Zeit, ehe der erste von ihnen schrieb, und eine sehr beträchtliche, ehe der ganze Kanon[4] zustande kam. 7. Es mag also von diesen Schriften noch so viel abhangen, so kann doch unmöglich die ganze Wahrheit der christlichen Religion auf ihnen beruhen. 8. War ein Zeitraum, in welchem sie bereits so ausgebreitet war, in welchem sie sich bereits so vieler[32] Seelen bemächtigt hatte und in welchem gleichwohl noch kein Buchstabe aus dem von ihr aufgezeichnet war, was bis auf uns gekommen ist, so muß es auch möglich sein, daß alles, was die Evangelisten und Apostel geschrieben haben, wiederum verloren ginge und die von ihnen gelehrte Religion doch bestände. 9. Die Religion ist nicht wahr, weil die Evangelisten und Apostel sie lehrten, sondern sie lehrten sie, weil sie wahr ist. Endlich 10. Aus ihrer inneren Wahrheit müssen die schriftlichen Überlieferungen erklärt werden, und alle schriftlichen Überlieferungen können ihr keine innere Wahrheit geben, wenn sie keine hat.
Man sieht, Lessings Standpunkt ist keineswegs radikal. Er wird heute von vielen protestantischen Theologen an Radikalismus weit überboten und muß eigentlich von jedem vernünftig denkenden Christen zugegeben werden. Aber Lessing geht in der Einleitung zu diesen Sätzen noch folgerichtiger vor und überwindet damit bereits – ähnlich wie später Kant und noch prinzipieller Schleiermacher – den Standpunkt der »Aufklärung«. Er, der Held des klaren Verstandes, gründet gleichwohl die Religion auf ihren wahren Quell: das Gefühl. Möchten auch sämtliche Einwände des »Ungenannten« dem kritischen Verstand unwiderlegbar erscheinen, so könnte nur der gelehrte Theologe darüber in Verlegenheit geraten, nicht der Christ. Denn »was gehen den Christen dieses Mannes Hypothesen und Erklärungen und Beweise an? Ihm ist es doch einmal da, das Christentum, welches er so wahr, in welchem er sich so selig fühlet«. Mag sein, daß Lessing für seine Person anders gedacht hat: jedenfalls hält er sich hier in den Grenzen der Verteidigung eines persönlichen, individuellen Christentums, das sich auf innere Erfahrung gründet: wie es innerhalb der evangelischen Theologie in neuerer Zeit die Ritschlsche Schule wieder erneuert hat.
Zu der Veröffentlichung der »Fragmente« gehörte damals ein gewaltiger Mut. Warf doch Lessing damit allen theologischen Parteien den Fehdehandschuh hin. Bald regnete es denn auch Artikel, Flugschriften, Bücher, am meisten natürlich seitens der Rechtgläubigen. Einer von ihnen, der Schuldirektor Schumann aus Hannover, hatte in den von Christus getanen[33] Wundern und in den in ihm »erfüllten« Weissagungen den »Beweis des Geistes und der Kraft« erblicken wollen. Ihm erwiderte Lessing in einem ebenso betitelten anonymen Aufsatz. Er will zwar – anscheinend aus bloß taktischen Gründen – die Tatsächlichkeit solcher Wunder nicht rundweg leugnen, bestreitet jedoch, daß sie, die wir doch nur auf Treu und Glauben anderer als wahr annehmen, für Jesu anderweitige Lehren beweisend sein könnten. Denn – und nun kommt eine Leibniz entlehnte wichtige Unterscheidung – »zufällige Geschichtswahrheiten (Leibniz sagt vérités de fait, d. h. Tatsachen-Wahrheiten) können der Beweis von notwendigen Vernunftwahrheiten nie werden«. Wir alle, führt Lessing aus, glauben, daß ein Alexander der Große gelebt und einen großen Teil Asiens erobert hat; aber wer wollte auf diese historische Wahrheit eine wichtige philosophische oder moralische Wahrheit gründen! »Das ist der garstige breite Graben, über den ich nicht hinüber kann, so oft und ernstlich ich auch den Sprung versucht habe. Kann mir jemand hinüberhelfen, der tu es; ich bitte, ich beschwöre ihn. Er verdient einen Gotteslohn an mir.«
Noch milder und versöhnlicher ist die in Gestalt eines formvollendeten Zwiegesprächs wiedergegebene hübsche Legende des Kirchenvaters Hieronymus von dem letzten Vermächtnis des Evangelisten Johannes gehalten, der seine Jünger immer wieder ermahnt haben soll: »Kinderchen, liebt euch!«, weil »das allein, wenn es geschieht, hinlänglich genug ist«. »Möchte doch alle,« so schließt Lessing, »welche das Evangelium Johannis trennt, das Testament Johannis wieder vereinigen!« Auch hier also wird das Praktische über das Theoretische, die Liebe über den Glauben gestellt. Ein Vorspiel zum »Nathan«! Und ein Vorbild für die Christenheit unserer Zeit, die in der Erfüllung dieses Testaments seitdem eher zurück- als vorwärtsgekommen ist.
Ein dritter, diesmal von Lessing mit seinem Namen gezeichneter Aufsatz, die »Duplik« (d. h. eigentlich zweite Antwort) war an den Superintendenten Reß in Lessings Wohnort gerichtet.
Sie enthält in ihrem ersten Abschnitt, mit dem sie den Charakter des edlen »Ungenannten« rechtfertigt, den berühmten[34] Satz, daß der ganze Wert des Menschen nicht auf dem vermeintlichen Besitz der Wahrheit beruhe, der vielmehr »ruhig, träge, stolz« mache, sondern auf der »aufrichtigen Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen«; denn nur »durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich alle seine Kräfte«. Worauf dann das noch berühmtere Gleichnis folgt: »Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatz, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: ›Wähle!‹, ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte: ›Vater, gib! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!‹« Vielleicht verleitet ihn auch hier seine Neigung zu glänzenden, die Gedanken scharf gegeneinander haltenden Antithesen zu einer überscharfen Formulierung der Gegensätze, so insbesondere durch den Zusatz »ewigen« Irrtums. Im übrigen ist wohl niemals der Wert reiner Wahrheitsforschung schöner formuliert worden.
In der Sache selbst, der Verteidigung der Ehrlichkeit seines »Ungenannten« in Sachen seines »Sturmangriffs« gegen die biblische Auferstehungsgeschichte, ist seine Taktik wiederum sehr zurückhaltend. Der Ungenannte behaupte: »Die Auferstehung Christi ist auch darum nicht zu glauben, weil die Nachrichten der Evangelisten darin sich widersprechen.« Sein theologischer Gegner: »Sie ist schlechterdings zu glauben; denn die Nachrichten widersprechen sich nicht.« Er (Lessing) sage nur: »Sie kann ihre gute Richtigkeit haben, obschon die Nachrichten sich widersprechen.«
Aber seine, sei es nun tatsächliche oder taktische, Versöhnlichkeit half ihm nichts. Ein neuer Gegner, angesehener und schärfer als die vorherigen, trat wider ihn auf den Plan. Es war der nur durch Lessing zur Unsterblichkeit gelangte Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goeze.
Im Kampfe gegen diesen Vertreter des rechtgläubigen Luthertums entstanden dann jene Meisterstücke der Polemik, die in der ganzen Weltliteratur kaum ihresgleichen besitzen. Zunächst, ihnen vorausgesandt noch, die verhältnismäßig noch friedliche »Parabel«: der Vergleich des Christentums mit einem unermeßlichen Palast von sonderbarer, namentlich nach außen hin sehr unregelmäßiger Bauart, zu dem vielerlei Eingänge[35] führen, und der sein Hauptlicht von oben empfängt. Anstatt sich aber an der inneren Helligkeit des Palastes, der ihn erfüllenden gütigen Weisheit und an der Schönheit und Ordnung zu erfreuen, die sich von ihm über das ganze Land verbreitete – mit anderen Worten: anstatt des Tatenchristentums, gerieten die vermeinten Kenner seiner Architektur in beständige Zwistigkeiten über seine Außenseite. Und zwar glaubte und behauptete ein jeder den allein richtigen Grundriß dazu von den ersten Baumeistern überkommen zu haben. Allmählich dachten sie nur noch an ihre Grundrisse und gaben die wenigen, die einmal einen von diesen geliebten Grundrissen etwas näher zu beleuchten wagten, für »Mordbrenner des Palastes selbst« aus. Als nun einmal der Wächter: »Feuer im Palast!« rief, da stürzte jeder – nur nach seinem Grundriß, um ihn als das Kostbarste zu retten. In Wahrheit hatte der Palast gar nicht gebrannt: die erschrockenen Wächter hatten ein Nordlicht für eine Feuersbrunst gehalten. Die Anwendung auf die christliche Religion, die mancherlei Zugänge zu ihr, ihre inneren Vorzüge, und im Gegensatz dazu die Beschränktheit und Rechthaberei der unduldsamen Konfessionellen ergibt sich von selbst.
Die der Parabel folgende »Bitte« vergleicht den Verfasser und seinen pastoralen Gegner mit einem Kräuterkenner und einem Schäfer. Der letztere braucht nur an das Wohl der ihm anvertrauten Schäflein zu denken. Der Botaniker dagegen, im weiteren Sinne der Mann der Wissenschaft, hat einen anderen Beruf. Er muß auch die giftigen Kräuter – und können Gifte nicht auch nützlich sein? – nicht bloß selbst kennenlernen, sondern auch andere damit bekannt machen. Lessing bittet den Gegner, sich dies klarzumachen und demgemäß sein übereiltes Verdammungsurteil wider ihn zurückzunehmen. Als jedoch statt dessen ein nur noch schärferer Angriff Goezes erfolgte, da ergeht sein »Absagungsschreiben«, das mit wahrhaften Keulenschlägen vernichtend über den »Herrn Pastor« herfährt, und das man Satz für Satz lesen muß, um einen Begriff davon zu bekommen. Ich nehme daraus nur diejenige Stelle, in der er Luthers Geist gegen seinen Nachtreter heraufbeschwört: »Sie, Herr Pastor, Sie hätten den allergeringsten Funken[36] Lutherischen Geistes? … Luther, Du! Großer, verkannter Mann! und von niemandem mehr verkannt als von den kurzsichtigen Starrköpfen, die, Deine Pantoffeln in der Hand, den von Dir gebahnten Weg schreiend, aber gleichgültig daherschlendern!« Und er appelliert weiter von dem geschichtlichen Luther an einen zukünftigen. »Du hast uns von dem Joche der Tradition erlöset, wer erlöset uns von dem unerträglicheren Joche des Buchstabens! Wer bringt uns endlich ein Christentum, wie Du es jetzt lehren würdest, wie es Christus selbst lehren würde!«
Die sich anschließenden »Axiomata (Grundsätze), wenn es deren in dergleichen Dingen gibt«, wider den Herrn Pastor Goeze in Hamburg haben wir bereits S. 31 kennengelernt. Und die dann folgenden »Anti-Goezes« bringen, trotz ihrer wunderbaren Form, inhaltlich, vor allem philosophisch, aber auch für die Kenntnis von Lessings religiöser Weltanschauung kaum etwas Neues mehr: man müßte denn die scharfe Wendung in dem ersten dieser zehn »notgedrungenen Beiträge« dahin zählen: »Herr Pastor, wenn Sie es dahin bringen, daß unsere Lutherschen Pastores unsere Päpste werden; daß diese uns vorschreiben können, wo wir aufhören sollen, in der Schrift zu forschen; daß diese unserem Forschen, der Mitteilung unseres Erforschten Schranken setzen dürfen: so bin ich der erste, der die Päpstchen wieder mit dem Papste vertauscht.« (Es gibt eben, wie Kant einmal sagt, wenngleich wenig, protestantische Katholiken und erzkatholische, vielleicht mehr, Protestanten.)
Auf Lessings spätere, zum Teil erst aus seinem Nachlaß bekanntgewordenen theologischen Arbeiten, die ihn in Streit mit den liberalen Theologen seiner Zeit verwickelten – den »großen Wespen«, die er damit aus ihrem Loche gelockt hatte, wie er spottet, wollen wir nur hinweisen. Denn sie interessieren letzten Endes doch mehr den Theologen als den Philosophen und sind überdies durch die kritische Bibelforschung der letzten anderthalb Jahrhunderte überholt. Dagegen möchte ich Ihnen ein auf nur zwei Blättern seines Nachlasses aufgezeichnetes, in sein letztes Lebensjahr (1780) fallendes Fragment: »Die Religion Christi« seiner Bedeutung wegen wörtlich mitteilen. Es besteht aus acht kurzen Paragraphen:
§ 1. Ob Christus mehr als Mensch gewesen, das ist ein Problem. Daß er wahrer Mensch gewesen, wenn er es überhaupt gewesen; daß er nie aufgehört hat, Mensch zu sein: das ist ausgemacht. § 2. Folglich sind die Religion Christi und die christliche Religion zwei ganz verschiedene Dinge. § 3. Jene, die Religion Christi, ist diejenige Religion, die er als Mensch selbst erkannte und übte; die jeder Mensch mit ihm gemein haben kann; die jeder Mensch um so viel mehr mit ihm gemein zu haben wünschen muß, je erhabener und liebenswürdiger der Charakter ist, den er sich von Christo als bloßem Menschen macht. § 4. Diese, die christliche Religion, ist diejenige Religion, die es für wahr annimmt, daß er mehr als Mensch gewesen und ihn selbst als solchen zum Gegenstand der Verehrung macht. § 5. Wie diese beiden Religionen, die Religion Christi sowohl als die christliche, in Christo als in einer und eben derselben Person bestehen können, ist unbegreiflich. § 6. Kaum lassen sich die Lehren und Grundsätze beider in einem und demselben Buche finden. Wenigstens ist augenscheinlich, daß jene, nämlich die Religion Christi, ganz anders in den Evangelisten enthalten ist als die christliche. § 7. Die Religion Christi ist mit den klarsten und deutlichsten Worten darin enthalten. § 8. Die christliche hingegen so ungewiß und vieldeutig, daß es schwerlich eine einzige Stelle gibt, mit welcher zwei Menschen, solange als die Welt steht, den nämlichen Gedanken verbunden haben.
Zur geplanten Vollendung seiner theologischen Arbeiten ist Lessing nicht mehr gekommen. Körperliche Krankheit, verbunden mit schwerem seelischem Druck, nicht zum wenigsten infolge des Todes seiner geliebten Frau nach kaum anderthalbjähriger glücklichster Ehe, raffte den kaum Zweiundfünfzigjährigen vor der Zeit dahin. Indes noch drei treffliche Gaben haben uns seine letzten Jahre beschert in drei Arbeiten, die uns zum Schlusse noch einmal seine
im Zusammenhang mit seiner Ethik und Religions- zugleich seine Geschichts- und Staatsauffassung vor Augen führen werden:
1. seinen »Nathan«, 2. seine »Erziehung des Menschengeschlechts« und 3. seine Freimaurergespräche »Ernst und Falk«. Dazu wird 4. zu berücksichtigen sein, was F. H. Jacobi von seinem bedeutsamen Gespräch mit Lessing im Jahre 1780 über den Spinozismus berichtet hat.
Als die Aufregung über die »Fragmente« und Lessings Beigaben dazu unter den Orthodoxen immer stärker geworden war, wurde auf Andringen des braunschweigischen Konsistoriums am 13. Juli 1778 Lessing vom Herzog unter Androhung »schwerer Ungnade« jede fernere Publikation »dieser Fragmente und anderer ähnlicher Schriften« strengstens verboten. Daraufhin meinte er: »Ich muß versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater, wenigstens noch ungestört will predigen lassen.« Im Mai des folgenden Jahres erschien sein »dramatisches Gedicht«: Nathan der Weise.
Ich setze hier den Inhalt des »Nathan« als bekannt voraus und gehe auch auf die massenhafte Literatur über das Stück mit keinem Worte ein. Über Sinn und Tendenz dieses seines letzten Dramas ist unendlich viel gestritten worden. Und doch ist beides, Sinn und Tendenz, im Grunde unendlich einfach und klar. Der Verfasser selbst hat es in einer anfangs beabsichtigten Vorrede in den Satz zusammengefaßt, sein Stück wolle lehren, »daß es nicht erst von gestern her unter allerlei Volk Leute gegeben, die sich über alle Religion« – will sagen: geoffenbarte Religion – »hinweggesetzt hätten und doch gute Leute gewesen wären«. Es ist die Religion, die allen sogenannten Religionen oder vielmehr, wie statt dieses im Grunde blasphemischen und auch von Kant und Schiller mit Recht getadelten Plurals richtiger zu sagen ist: Religionsbekenntnissen, als ihr echter Kern zugrunde liegt: die Religion der Menschlichkeit, die Religion, wie Kant es ausdrückt, »innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft«, oder, wie der Neukantianer Paul Natorp es formuliert, »innerhalb der Grenzen der Humanität«: gegen die auch der Bekenner der sogenannten »positiven« Religionen[39] nichts einwenden kann, wenn sie auch seinem religiösen Bedürfnis nicht genügen mag.
Ich begnüge mich, ihre Hauptzüge mit den unvergänglichen Versen Lessings Ihnen kurz vor Augen zu führen.
Zunächst ihre Übereinstimmung mit der wissenschaftlichen Erkenntnis der Natur:
Sodann die Begründung auf das Gefühl, die tröstende Lehre:
Und dennoch die Verwahrung gegen bloße gefühlsmäßige Schwärmerei:
Dieselbe Ansicht, die der treffliche deutsche Mystiker Meister Eckhart mit den Worten ausdrückt: »Wäre der Mensch in Verzückung, wie Sankt Paulus war, und wüßte einen siechen Menschen, der eines Süppleins von ihm bedürfte, ich achte es weit besser, daß du ließest aus Minne von der Verzückung und dientest dem Dürftigen in größerer Minne.«[5]
Nichts anderes als eine andere Anwendung seines »Testaments Johannis« (S. 33) ist das Fazit, was die berühmte Fabel von den drei Ringen zieht:
und, wie die Worte weiter lauten, genau dem neutestamentlichen Spruch entsprechend:
Unbedingteste Duldsamkeit für alle Meinungen ist Grundprinzip: »Ich habe nie verlangt, daß allen Bäumen eine Rinde wachse«, sagt Saladin.
Wer seine Religion, wer seinen Gott so auffaßt wie Nathan-Lessing, der muß einen Sondergott für bestimmte Nationen oder Individuen als eine Herabsetzung des Gottesbegriffs empfinden:
Damit hängt denn auch der dramatisch vielleicht nicht sehr geschickte, eher etwas enttäuschende, aber die Idee des Ganzen um so tiefer ausdrückende Schluß zusammen: daß die vorher einander gegnerisch gegenüberstehenden Nationen und Religionsbekenntnisse sich zu guter Letzt, ähnlich wie heute im Sozialismus, als Angehörige einer Familie erkennen.
Wenn man Lessings Humanitätsdrama mit unbefangenem, reinem Gemüt liest und auf sich wirken läßt, dann muß es einem wahrhaftig kläglich vorkommen, wenn ein Eugen Dühring oder – etwas gemilderter, aber vielleicht um so gefährlicher – Adolf Bartels in seinem Buche »Lessing und die Juden« mit antisemitischen Mätzchen gegen den »Juden« oder »judenhaften« Lessing zu Felde zieht. Wer so handelt, ist nicht wert, daß er dem Volke der Lessing und Kant, der Schiller und Goethe angehört. Gewiß, es ist nicht zu bestreiten, daß der Dichter die christlichen Gestalten seines Dramas, insbesondere den offiziellen Vertreter der Kirche, den Patriarchen, desgleichen die gutmütige, aber beschränkte Dajah entschieden ungünstiger geschildert hat als die Vertreter des Islam, des Judentums, der Parsi-Religion. Meiner Meinung nach war das eine logische Notwendigkeit, weil er sein Stück eben für ein christliches Publikum schrieb, dem er beweisen wollte, daß es in anderen Religionsbekenntnissen ebenso gute oder bessere Menschen geben könne. Hätte er es für Mohammedaner oder Juden geschrieben, so hätte er umgekehrt die Vertreter der beiden übrigen Konfessionen heben müssen; der[41] Patriarch wäre dann eben ein Rabbiner oder ein Mufti geworden. Von einer Herabsetzung des Christentums als solchem kann keine Rede sein. Ruft doch der Klosterbruder, übrigens eine sehr sympathische Christengestalt, Nathan gerade im entscheidenden Augenblick die das Christentum aufs höchste anerkennenden Worte zu, die jeder echte Christ Lessing selber zurufen könnte:
Die höchste sittliche Wahrheit freilich steht für den Dichter mit Recht über den Religionsbekenntnissen:
Woran sich der gerade unserem Lessing aus tiefster Seele kommende Ausruf Nathans an den Tempelherrn schließt:
Ein Wort, das gerade heute jedem Europäer, der sich zu einem sogenannten »Kultur«volk zählt, vor allem aber denen, die sich der Religion Jesu zurechnen, beschämend, mahnend, anfeuernd vor der Seele stehen müßte!
Ja, Dilthey, der sonst die Gefühlsworte nicht liebt, hat recht, wenn er in diesem »unvergänglichen Gedicht«, ebenso wie in Goethes »Iphigenie«, eine so »reine Seelengröße« verkündet sieht, daß kein ernster Forscher der menschlichen Natur es lesen könne, ohne daß sein Auge feucht werde. Und Lessing hatte recht, wenn er als Motto das Wort des antiken Dichters über sein Drama setzte: »Introite, nam et hic dii sunt!«, zu deutsch: »Tretet ein, denn auch hier sind Götter.«
Inhaltlich dem »Nathan« verwandt sind die letzten beiden – bezeichnenderweise beide ohne seinen Namen – erschienenen Schriften Lessings: 1. die »Freimaurergespräche« zwischen Ernst und Falk und 2. »Die Erziehung des Menschengeschlechts«. Der Zeitfolge nach ist es einerlei, welche von beiden wir zuerst behandeln. Von beiden ist ein erster Teil schon 1777 bezw. 1778 (gleichfalls anonym) und erst die zweite Hälfte in Lessings letztem Lebensjahr (1780) veröffentlicht worden. Wir ziehen es vor, mit der
zu beginnen, weil ihr teils religions-, teils geschichtsphilosophischer Inhalt dem »Nathan« näher steht als der teils geschichts-, teils staatsphilosophische der »Gespräche für Freimäurer«.
Die ersten dreiundfünfzig von den hundert Paragraphen der »Erziehung« waren bereits zusammen mit den fünf Fragmenten des »Ungenannten«, also 1777 herausgegeben worden: auch sie angeblich unter den Bücherschätzen seiner Bibliothek gefunden. Selbst dem Sohne von Reimarus stellt er sie noch in einem Briefe vom 6. April 1778 dar als herrührend »von einem guten Freunde, der sich gern allerlei Hypothesen und Systeme macht, um das Vergnügen zu haben, sie wieder einzureißen«, mit dem für sein innerstes Wesen bezeichnenden Schlußsatz: »Jeder sage, was ihm Wahrheit dünkt, und die Wahrheit selbst sei Gott empfohlen!«
Als Ganzes trägt die Schrift gleichwohl, wie mir scheint, einen etwas konservativeren Charakter als »Nathan der Weise« oder auch die ja nur zur Selbstverständigung niedergeschriebene »Religion Christi«. Der Verfasser sieht hier die Offenbarung als in einem göttlichen Erziehungsplan der Menschheit gelegen an. Wie die Erziehung, so gibt auch die Offenbarung ihm zufolge »nichts, worauf die menschliche Vernunft, sich selbst überlassen, nicht auch kommen würde«, sie gibt ihm das Wichtigste davon nur leichter und früher (§ 4); und zwar, gleich der Erziehung, nach einer bestimmten Ordnung. Nach dieser Einleitung, enthalten in § 1 bis 7, folgt dann von § 8 bis 52 die Erziehung des israelitischen Volkes durch das »Elementarbuch« des Alten Testaments. Für ein noch so rohes, auf noch so kindlicher Entwicklungsstufe stehendes Volk bedurfte es noch einer Erziehung durch unmittelbare, sinnliche Strafen und Belohnungen (§ 16). Es wußte noch nichts von einem zukünftigen Leben, von einer Unsterblichkeit der Seele (§ 17). Die meisten anderen Völker waren noch weit hinter ihm zurückgeblieben, einige glücklichere (Griechen, Römer) allerdings durch das bloße Licht ihrer natürlichen Vernunft ihm zuvorgekommen[43] (§ 20, 21). Während des Exils, im Verkehr mit den religiös höher stehenden (obwohl ohne Offenbarung!) Persern, bekamen die Juden dann einen reineren Gottesbegriff, die Offenbarung ward durch die Vernunft erhellt, ihr Glaube erhob sich von ihrem Nationalgott Jehova zu dem an einen Gott (§ 35 ff.). So entwuchsen sie allmählich ihrem Elementarbuch, insbesondere auch durch ihre Bekanntschaft mit der griechischen Philosophie in Ägypten (§ 42) und suchten nun in ihre kindlich-einfältigen heiligen Schriften allerlei Anspielungen und Fingerzeige, oft recht spitzfindig-rabbinisch, hineinzulegen (§ 43 bis 52). Ein besserer Pädagog mußte kommen und »dem Kinde das erschöpfte Elementarbuch aus den Händen reißen« – Christus erschien (§ 53).
Das Kind war zum Knaben geworden, der zum »zweiten großen Schritt der Erziehung reif war« (§ 57 ff.). Christus ward der erste »zuverlässige« und »praktische« Lehrer der Unsterblichkeit der Seele (§ 58). Als zuverlässig galt er seinen Zeitgenossen durch die in ihm erfüllt scheinenden Weissagungen, durch seine Wunder, durch seine Auferstehung. »Ob wir noch jetzt diese Wiederbelebung, diese Wunder beweisen können, das lasse ich dahingestellt sein … Alles das kann damals zur Annehmung seiner Lehre wichtig gewesen sein: jetzt ist es zur Erkennung der Wahrheit seiner Lehre so wichtig nicht mehr.« (§ 59.)[6]
Christus lehrte aber auch praktisch das Leben nach dieser Lehre einrichten durch »innere Reinigkeit des Herzens« (§ 61), die dann seine Jünger, wenn auch mit anderen weniger einleuchtenden Lehren vermischt, unter andere Völker verbreiteten (§ 62, 63). So ward das Neue Testament das zweite, bessere Elementarbuch für das Menschengeschlecht (§ 64) und hat es seit 1700 Jahren mehr als alle anderen Bücher beschäftigt und erleuchtet, wenn auch vielleicht »nur durch das Licht, welches der menschliche Verstand selbst hineintrug« (§ 65). Es war auch gewiß »höchst nötig«, daß man »eine Zeitlang« dies Buch für das Nonplusultra aller Erkenntnis hielt (§ 67). Und »Du, fähigeres Individuum, der[44] du an dem letzten Blatte dieses Elementarbuchs stampfest und glühest, hüte dich, es deine schwächeren Mitschüler merken zu lassen, was du witterst oder schon zu sehen beginnst«! (§ 68.) Lessing bemüht sich dann, in uns freilich etwas künstlich erscheinenden Ausführungen zu zeigen, was auch die menschliche Vernunft in den Geheimnissen der Dreieinigkeit, der Erbsünde, der Genugtuung des göttlichen Sohnes für sich finden könne (§ 73 bis 77). Es sei nicht wahr, meint er, »daß Spekulationen über diese Dinge jemals Unheil gestiftet und der bürgerlichen Gesellschaft nachteilig geworden«. Nicht den Spekulationen, sondern »dem Unsinn, der Tyrannei, diesen Spekulationen zu steuern, Menschen, die ihre eigenen hatten, nicht ihre eigenen zu gönnen«, sei dieser Vorwurf zu machen (§ 78).
Aber noch eine höhere Stufe, die Erziehung vom Knaben oder Jüngling zum Manne, der das Gute um seiner selbst, nicht um künftiger Belohnungen willen tut, stehe der Menschheit bevor. »Oder soll das menschliche Geschlecht auf diese höchste Stufe der Aufklärung und Reinigkeit nie kommen?« (§ 81.) Das wäre eine Lästerung des Allgütigen. »Nein, sie wird gewiß kommen,« so ruft er in gläubigem Vertrauen aus, »die Zeit eines neuen, ewigen Evangeliums« des Geistes und der Wahrheit, »die uns selbst in den Elementarbüchern des Neuen Bundes versprochen wird« (§ 86). Schon im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert haben Schwärmer – Lessing denkt wohl an Männer wie Joachim von Floris und Amalrich von Bene – ein »drittes Zeitalter« der Welt prophezeit. Er macht dabei eine sehr gute Bemerkung über die Schwärmer überhaupt, bei der wir unwillkürlich auch an unsere heutigen politischen Schwärmer denken: »Der Schwärmer tut oft sehr richtige Blicke in die Zukunft, er kann diese Zukunft nur nicht erwarten. Er wünscht diese Zukunft beschleunigt und wünscht, daß sie durch ihn beschleunigt werde. Wozu sich die Natur Jahrtausende Zeit nimmt, soll in dem Augenblick seines Daseins reifen.« Und er erkennt auch den egoistischen Nebengedanken darin: »Denn was hat er davon, wenn das, was er für das Bessere erkennt, nicht auch bei seinen Lebzeiten das Bessere wird?« (§ 90.) Demgegenüber traut er auf die »ewige Vorsehung«, wenn[45] auch manchmal ihre Schritte ihm »zurückzugehen scheinen sollten«! »Es ist nicht wahr, daß die kürzeste Linie immer die gerade ist.« (§ 91.)
Und nun kommt zum Schlusse der sonst anscheinend so verstandeskühle Lessing auf eine Hypothese, auf die, wie er auch schon früher gelegentlich geäußert hatte,[7] schon die ältesten Philosophen im Abend- wie im Morgenland gekommen seien: die Seelenwanderung (§ 93 ff.). Kann ich nicht schon einmal da gewesen sein, ohne daß ich es mir selbst bewußt bin, und »warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin« (§ 98, 99)?
Wir gehen nicht weiter auf diese Hypothese ein. Vielleicht war es eben nur ein Gedanke, den er einmal in das Publikum hineinwerfen wollte, ohne dafür öffentlich einstehen zu wollen, wie er ja auch die Schrift nicht mit seinem Namen gezeichnet hat. Aber ich habe sie Ihnen schon der Vollständigkeit wegen nicht vorenthalten wollen; schon um Ihnen zu zeigen, daß Lessing doch auch in Stunden ein wenig – Schwärmer sein konnte. Für die Praxis des Lebens hat er solche Hypothesen nicht benutzt, ja er warnt auch andere davor. Die Vernunft, sagt er einmal, habe doch mit Glück gegen die törichte Begierde der Menschen, ihr Schicksal in diesem Leben voraus zu wissen, geeifert: wann werde es ihr gelingen, ihnen die Neugier nach ihrem Schicksal in jenem Leben ebenso verdächtig, ebenso lächerlich zu machen? Toren seien die, welche aus lauter Sorgen um ein künftiges Leben das gegenwärtige verlieren: »Warum kann man ein künftiges Leben nicht ebenso ruhig abwarten als einen künftigen Tag?« Lessing war ein viel zu frischer, lebensvoller, diesseitsfroher Mensch, um sich unfruchtbaren Grübeleien hinzugeben.
Und so wenden auch wir uns jetzt seinen Gedanken über die diesseitige Gemeinschaft der Menschen, seinen Ideen von Geschichte und Staat zu, die, soviel ich weiß, noch nirgends im Zusammenhang behandelt worden sind und auf die wir freilich auch nur einige Streiflichter werfen können und wollen.
Schon der sechzehnjährige Fürstenschüler hat den Kriegslärm ganz aus der Nähe kennengelernt. Am 9. Dezember 1745 wurde die Stadt Meißen bombardiert, und wenige Tage später donnerte von dem nahen Kesselsdorf der Schlachtenlärm herüber; die Stadt glich bald einem großen Lazarett. Aber all das scheint dem Primaner Gotthold Lessing, in einem Briefe an den Vater Pastor, in erster Linie doch nur als willkommener Anlaß zu dienen, um eher von der Schule zur Universität zu kommen; was ihm ja auch, wie wir wissen, gelungen ist. Auch sonst ist nichts von besonderen politischen Interessen des Jünglings aus seiner Gymnasiasten- und Studentenzeit bekannt. Er wird wohl, was bekanntlich Bismarck als Ergebnis der humanistischen Erziehung von sich und anderen behauptet hat – und was, beiläufig gesagt, auch unsere heutigen Republikaner und Sozialisten sich merken sollten, anstatt gegen die Lektüre der antiken Klassiker zu eifern, die doch ein Karl Marx und ein Ferdinand Lassalle mit Vorliebe bis an ihr Ende gepflegt haben –, das Gymnasium mit republikanischen Gesinnungen verlassen haben. Damit steht unter anderem auch die Tatsache in Einklang, daß der Zwanzigjährige einen politischen Gegenwartsstoff zu einer republikanischen Tragödie verarbeiten wollte. Im Jahre 1749 hatte ein demokratischer Berner Patriot Samuel Henzi eine Verschwörung gegen das dortige verrottete Klassen- und Willkürregiment weniger patrizischer Familien angestiftet, war aber entdeckt und hingerichtet worden. Unter dem frischen Eindruck dieses Ereignisses dichtete der junge Lessing die anderthalb Akte seines Trauerspiels »Samuel Henzi«, die er dann auch in der ersten Sammlung seiner Schriften veröffentlichte: ein für seine Zeit ungewöhnliches Wagnis.
Daß er im folgenden Jahrzehnt ein antikes Drama »Das befreite Rom«, dessen Hauptheld der alte Königsstürzer Brutus war, und eine »Verginia«, in deren Titelheldin wir die Vorläuferin seiner späteren Emilia Galotti zu erblicken haben, entwarf, will vielleicht weniger besagen. Interessanter ist, daß er noch bis 1775 hin eine »antityrannische«[47] Tragödie geplant hat, deren Held der berühmte Sklavenführer Spartakus sein sollte. Während in seinem ersten Römerdrama das Volk noch, ähnlich wie bei Shakespeare, als ein wankelmütiger Pöbelhaufe dargestellt wird, wurde hier ein erklärter Proletarierführer zum Helden gemacht, der in einem (erhaltenen) Selbstgespräch den Ausspruch tut: »Sollte sich der Mensch nicht einer Freiheit schämen, die es verlangt, daß er Menschen zu Sklaven habe?« Lessing tadelt in diesem Zusammenhang auch die »fast lächerliche« Verachtung eben des Spartakus durch den römischen Geschichtschreiber, der die Gladiatoren noch unter die gewöhnliche »Untergattung von Menschen«, die Sklaven, stelle. Schade, daß er diesen Plan nicht ausgeführt hat.
Lessing ist bekanntlich schon als zweiundzwanzigjähriger junger Mann aus seiner sächsischen Heimat nach Preußen gegangen. Aber es ist unrichtig, ihn deshalb und etwa noch wegen seiner »Minna von Barnhelm« oder seines Sekretärverhältnisses zu dem preußischen General v. Tauentzien, wie es gewöhnlich geschieht, schlechtweg als Verehrer des Preußentums darzustellen. Gewiß, er besitzt eine Vorliebe für soldatische Gestalten: von dem jungen Helden des Trauerspiels »Philotas« an, auf das wir noch zurückkommen, über Tellheim, Just und Werner in der »Minna« bis zu dem alten Obersten Odoardo Galotti, ja bis zu Sultan Saladin und dem jungen Tempelherrn im »Nathan«. In jener Zeit ängstlichen Spießbürgertums war eben, wie selbst ein so radikaler Politiker wie Franz Mehring in seiner »Lessing-Legende« hervorhebt, der Soldatenstand der einzige, in dem sich, wenigstens zu Kriegszeiten, persönliche Tüchtigkeit entfalten konnte:
und
wie Schiller die Wallensteinschen Reiter singen läßt. So konnte Lessing denken, wenngleich er den Krieg grundsätzlich verwarf, wie er in einer Rezension Rousseaus bemerkt: »Sind wir deswegen auf der Welt, daß wir einander umbringen sollen?«
Aber ihn deswegen zum begeisterten Preußen und Verehrer Friedrichs des Großen zu erheben, wäre verkehrt. Liegen von ihm auch nicht ganz so feindselige Äußerungen wie[48] von dem berühmten Winckelmann vor, der das Preußen, dem er entstammte und entfloh, um nach Italien zu gehen, geradezu gehaßt hat, so schreibt doch noch der vierzigjährige Lessing im August 1769 an Nicolai nach Berlin: »Sagen Sie mir ja nichts von Ihrer Berlinischen Freiheit zu denken und zu schreiben. Sie reduziert sich einzig und allein auf die Freiheit, gegen die Religion so viel Sottisen (Dummheiten) zu Markte zu bringen, als man will. Lassen Sie es aber doch einmal einen in Berlin versuchen, über andere Dinge so frei zu schreiben, als Sonnenfels in Wien geschrieben hat; lassen Sie einen in Berlin auftreten, der für die Rechte der Untertanen, der gegen Aussaugung und Despotismus seine Stimme erheben wollte, wie es jetzt sogar in Frankreich und Dänemark geschieht: und Sie werden bald die Erfahrung haben, welches Land bis auf den heutigen Tag das sklavischste Land von Europa ist!« Ich denke, das ist deutlich genug. Freilich, die geliebten »Untertanen« Friedrichs II. waren selbst daran schuld, daß er gegen Ende seines Lebens von ihnen sagen konnte: »Ich bin es müde, über Sklaven zu herrschen.«
Also von einer speziellen Verehrung Friedrichs II., dem er zwar in der »Minna« einige hübsche Worte widmet, aber dessen eigenmächtiges Verfahren in militärischen Dingen doch auch dies Stück geißelt, oder gar des preußischen Staatswesens jener Zeit überhaupt kann keine Rede sein. »Die Dienste der Großen«, läßt er vielmehr gerade seinen Tellheim sagen, »sind gefährlich und lohnen der Mühe, des Zwanges, der Erniedrigung nicht, die sie kosten.« Ebenso ist selbstverständlich der Dichter über jeden sächsischen Partikularismus erhaben. Und wie er am Schlusse seines Stückes die Sächsin Minna mit dem Preußen Tellheim sich verbinden läßt, so will er auch nichts anderes sein als ein Deutscher. Freilich nicht von der Art, die wir heute so zahlreich vertreten finden, die von ihrem Deutschtum viele und große Worte macht; sondern von der Art Kants und Schillers, Herders und Goethes, für die Patriotismus und Weltbürgertum keine Gegensätze waren. Gibt es im übrigen ein schöneres Lob der deutschen Sprache, als wenn er den französischen Windbeutel Riccaut sie eine »arme und plumpe Sprak« schelten[49] läßt, weil sie Dinge wie das Betrügen ehrlich bei ihrem wahren Namen nennt? Und sind nicht Charaktere wie Tellheim, Werner, Minna Urbilder guter Deutscher?
Aber Lessing, werden seine und unsere Gegner sagen, hat sich ja selbst den Patriotismus abgesprochen. In der Tat, er hat am 16. Dezember 1758 seinem Freunde Gleim, dem Dichter der Kriegslieder eines preußischen Grenadiers, geschrieben, daß »das Lob eines eifrigen Patrioten« nach seiner Denkungsart das »Allerletzte« wäre, wonach er »geizen« würde: »des Patrioten nämlich, der mich vergessen lehrt, daß ich ein Weltbürger sein sollte.« Und am 14. Februar 1759 gar: »Ich habe überhaupt von der Liebe des Vaterlandes (es tut mir leid, daß ich Ihnen meine Schande gestehen muß) keinen Begriff, und sie scheint mir aufs höchste eine heroische Schwachheit, die ich recht gern entbehre.« Sätze wie den letzten würde heute wohl nur ein entschiedener Kommunist unterschreiben. Aber der Satz vorher bezeichnet als die Veranlassung dieser Äußerung Betrachtungen über »übertriebenen« Patriotismus, die nicht sowohl Gleims »Grenadiere« als »tausend ausschweifende Reden, die ich hier (in Berlin) alle Tage hören muß, bei mir rege gemacht hatten«. Und wenn er im weiteren Verlauf des Briefes von »kleinen Uneinigkeiten« spricht, die Gleims und seine Freundschaft nicht stören könnten und auch nicht gestört haben, so waren es offenbar nur Äußerungen eines übertriebenen preußischen Partikularismus gewesen, die er seiner deutschen und menschheitlichen Gesinnung gemäß nicht mitmachen konnte.
Daß Lessing vielmehr den Patriotismus sogar in seinem höchsten, dem Opfersinn zu würdigen versteht, beweist sein gleichfalls 1759 entstandenes Drama »Philotas«, dessen Kerngedanke darin besteht, daß der Held, ein kaum sechzehnjähriger antiker Königssohn, der in die Gefangenschaft des Feindes geraten ist, sich ähnlich dem Kodrus der Griechen-, dem Regulus der Römersage freiwillig den Tod gibt, um nicht als Geisel seinem Vaterland einen ungünstigen Frieden aufzunötigen. Und wie schmerzlich hat er es vermißt und am eigenen Leibe erfahren, daß »wir Deutsche noch keine Nation« waren! Weder in Berlin noch in Wien, weder in Hamburg noch in Mannheim konnte der größte Kritiker Deutschlands,[50] konnte einer seiner besten Dichter auf die Dauer festen Fuß fassen. Bittere Sarkasmen enthalten die letzten »Stücke« seiner »Hamburger Dramaturgie« über den »gutherzigen Einfall«, den sein nie zu ertötender Idealismus selber gehegt hatte, »den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen«, da wir Deutsche eben doch »keine Nation« seien. Er redet dabei nicht von der politischen Verfassung – obwohl das Monstrum des »Heiligen Römischen Reiches Teutscher Nation« jeden Vernünftigen zu dem Spott herausfordern mußte, den einer von den lustigen Gesellen in Auerbachs Keller (im »Faust«) darüber ergießt –, »sondern bloß von dem sittlichen Charakter«. Aber »fast sollte man sagen, dieser sei: keinen haben zu wollen«. Die reichen Hamburger und sonstigen deutschen Kapitalisten hatten eben für andere, materiellere Dinge mehr Geld übrig als für Lessings ideale Unternehmungen. Und so mußte dieser noch in seinem fünften Lebensjahrzehnt in die Dienste eines Kleinfürsten in einer einsamen deutschen Kleinstadt gehen.
Daß ein Mann wie Lessing ein abgesagter Gegner alles Höflingstums und aller Standesvorrechte war, ist eigentlich selbstverständlich. Mit Recht hat schon Franz Mehring auf die scharfe Kritik eines königlichen Hoffestes auf dem Berliner Schloßplatz, ein sogenanntes Karussell oder Ringelrennen, das von dem anwesenden Voltaire in glänzenden Versen gepriesen wurde, durch den einundzwanzigjährigen Dichter in dem sarkastischen Gedicht »Auf ein Karussell« hingewiesen. Er hat auch einmal einen Aufsatz über die »Deutsche Freiheit« geschrieben, die zu Tacitus' Zeiten und auch das ganze Mittelalter hindurch wenigstens in der Form der Landstände den Absolutismus der Fürsten eingeschränkt habe. »Sollten wir nicht wenigstens in unseren Schriften unaufhörlich gegen diese ungerechten Veränderungen protestieren« usw.? Und seine »Emilia Galotti«, ist sie etwas anderes als ein flammender, ingrimmiger Protest gegen fürstliche Willkür- und Mätressenwirtschaft, ein Stück, in dem sogar der gewiß doch maßvolle, selbst an einem Fürstenhof lebende Goethe den »entscheidenden Schritt zur sittlich erregten Opposition gegen die tyrannische Willkürherrschaft« erblickte, den dann des jungen Schiller »Kabale und Liebe« zuerst vom italienischen[51] auf einen deutschen Schauplatz zu übertragen wagte? So kann man in der Tat – es ist der eigentliche Grundgedanke von Mehrings »Lessing-Legende« – Lessing als ersten glänzenden Vertreter des aufstrebenden Bürgertums bezeichnen, das nur seines großen Vorkämpfers nicht würdig war, vielmehr durch wirtschaftliche und politische Rückständigkeit sich auszeichnete.
Allein Lessing geht über diesen Bourgeoisstandpunkt, mindestens an einzelnen Stellen seiner Schriften, noch erheblich hinaus. So in dem merkwürdigen, in der großen Lessing-Ausgabe von Lachmann und Muncker (XVI, 520 f.) in zwei Fassungen vorliegenden kurzen »Gespräch über die Soldaten und Mönche«. Man streite darüber, ob es mehr Soldaten oder Mönche in der Welt gebe. Aber wenn der Landmann seine Saat von Schnecken und Mäusen vernichtet sehe, frage er nicht danach, welcher von beiden es mehr seien. Und nun folgt in der längeren Fassung folgendes Zwiegespräch:
B. Was sind denn Soldaten?
A. Beschützer des Staats.
B. Und Mönche sind Stützen der Kirche.
A. Mit eurer Kirche!
B. Mit eurem Staate!
A. Träumst du? Der Staat! Der Staat! Das Glück, welches der Staat jedem einzelnen Gliede in diesem Leben gewährt.
B. Die Seligkeit, welche die Kirche jedem Menschen nach diesem Leben verheißt!
A. Verheißt!
B. Gimpel!
So starke Ketzereien in so zugespitzter Form hat unser Held allerdings vorsichtigerweise in seinem Schreibpult zurückgehalten. Aber in milderer Ausprägung erkennen wir doch die gleiche Anschauung auch im »Nathan« und in den Freimaurergesprächen wieder. Im »Nathan« in der eigenartigen Gestalt des Derwischs Al-Hafi, der es in der kapitalistischen Welt nicht mehr aushalten kann – denn »Borgen ist viel besser nicht als betteln, so wie Leihen, auf Wucher leihen nicht viel besser ist als stehlen«; und nun allerdings zum Kampf dagegen sich nicht stark genug fühlt, sondern, »um das Werkzeug beider nicht zu sein« – an den Ganges fliehen will. »Am Ganges, am Ganges nur gibt's Menschen!«, will[52] sagen: vom Kapitalismus, diesem »Plunder«, dieser »Plackerei« erlöste Menschen. Von dieser Lebensansicht fühlt selbst der weise und kaufmännische Nathan sich so ergriffen, daß er in den, prinzipiell aufgefaßt, anarchistischen Ausruf ausbricht: »Der wahre Bettler ist doch einzig und allein der wahre König!« – Und nun zu Lessings
seinen »Gesprächen für Freimäurer«, fünf an der Zahl, von denen die drei ersten 1778, die beiden letzten 1780, anonym auch sie unter dem Zwange der Zeit, erschienen sind. Lessing hatte sich im Jahre 1771 zu Braunschweig in die Loge aufnehmen lassen (der ja auch Herder, Schiller und Goethe beitraten), aber schon ziemlich bald enttäuscht wieder zurückgezogen. Wir sehen hier von allem auf die Geschichte der Freimaurerei Bezüglichen, das in einzelnen Gesprächen eine ziemlich bedeutende Rolle spielt, ab und beschränken uns auf das, was sich aus ihnen für Lessings philosophische, insbesondere staats- und gesellschaftsphilosophische Ansichten gewinnen läßt. Das Wichtigste in dieser Hinsicht findet sich im zweiten, einiges noch im vierten Gespräch.
Da ist es nun für den Sozialisten interessant, sozialphilosophischen Anschauungen zu begegnen, die der Verfasser zwar aus ihm vorangegangenen Denkern, wie den Franzosen Bodin und Montesquieu,[8] haben mag, die aber bis zu einem gewissen Grade schon an Karl Marx anklingen. Viele Staaten, läßt er im Verlauf des zweiten Gesprächs dessen Hauptwortführer (Falk) sagen, würden »ein ganz verschiedenes Klima, folglich ganz verschiedene Bedürfnisse und Befriedigungen, folglich ganz verschiedene Gewohnheiten und Sitten, folglich ganz verschiedene Sittenlehren, folglich ganz verschiedene Religionen haben«. Erinnert das »Klima« mehr an die beiden obengenannten Geschichtsphilosophen, so die »Bedürfnisse« und ihre »Befriedigungen« mit ihrem ganzen ideologischen Überbau an Marx-Engels' ökonomische Geschichtsauffassung. Daß[53] solche Anschauungen Lessings aber von lange her in ihm lagen, ergibt sich aus dem Umstand, daß er bereits im Januar 1753 in einer Rezension der »Vossischen Zeitung« die sogenannten »moralischen Ursachen« der Völkerverschiedenheit geradezu als nichts anderes denn »Folgen der physischen« (er sagt noch: physikalischen) bezeichnet.
Im übrigen ist freilich seine Staatsanschauung noch durchaus individualistisch, ja sein Staatsideal – wir streiften den Gedanken schon beim Al-Hafi des »Nathan« – beinahe anarchistisch. Die Ameisen werden als Vorbild hingestellt, weil sie die größte Geschäftigkeit und doch Ordnung zeigen und einander sogar helfen, obschon doch niemand sie zusammenhält und regiert. Und nun folgen in der bei Lessing so erfreuenden epigrammatischen Kürze Schlag auf Schlag die weiteren Fragen und Antworten: »Ordnung muß also doch auch ohne Regierung bestehen können.« – »Wenn jedes einzelne sich selbst zu regieren weiß, warum nicht?« – »Ob es wohl auch einmal mit den Menschen dahin kommen wird?« – »Wohl schwerlich!« – »Schade!« – »Jawohl!«
Des weiteren wirft Falk die Frage auf, ob die Menschen für die Staaten oder die Staaten für die Menschen da sind? Die Antwort wird dann in letzterem Sinne gegeben. Die Vereinigung der Menschen zu Staaten findet statt, damit durch diese und in ihnen jeder einzelne seinen Anteil von Glückseligkeit desto besser und sicherer genießen kann. Die Glückseligkeit des Staates besteht in der Summe der Einzelglückseligkeiten aller seiner Glieder. »Außer dieser gibt es gar keine.« Und nun folgt ein Satz, aus dem man allerdings auch eine sozialistische Folgerung ziehen könnte. »Jede andere Glückseligkeit des Staates, bei welcher auch noch so wenig einzelne Glieder leiden und leiden müssen, ist Bemäntelung der Tyrannei. Anders nichts!«
Und zwar ist das alles von der Natur so eingerichtet. Trotzdem entspringen auch aus der denkbar besten Staatsverfassung notwendig allerlei Übel. Vor allem ist ein Weltstaat, schon wegen seiner ungeheuren Größe, nicht möglich, sondern nur Nationalstaaten. Und innerhalb derselben entstehen notgedrungen wiederum verschiedene Stände. Selbst die anfänglich gleiche Verteilung des Besitzes vorausgesetzt,[54] würde doch diese gleiche Verteilung keine zwei Menschenalter hindurch bestehen bleiben. Einer wird sein Eigentum besser zu nutzen wissen als der andere, der es womöglich dennoch unter mehr Nachkommen zu verteilen haben wird. Es wird also reichere und ärmere Glieder geben, aus dem wohltätigen Feuer der unvermeidlich unangenehme Rauch entstehen. Aber sollte man deshalb keinen Rauchfang erfinden? Lessing denkt dabei nicht etwa an Sozialisierung, auf die ihn Plato oder Morus an sich gebracht haben könnten, sondern an – die Freimaurer! Es ist »recht sehr zu wünschen«, daß es in jedem Staate Männer geben möchte, die erstens »über die Vorurteile der Völkerschaft (also in unserer heutigen Sprache über einseitigen Nationalismus) hinweg wären und genau wüßten, wo Patriotismus Tugend zu sein aufhört«; die zweitens »den Vorurteilen ihrer angeborenen Religion nicht unterlägen, nicht glaubten, daß alles notwendig gut und wahr sein müsse, was sie für gut und wahr erkennen«; die endlich »bürgerliche Hoheit nicht blendet und bürgerliche Geringfügigkeit nicht ekelt, in deren Gesellschaft der Hohe sich gern herabläßt und der Geringe sich dreist erhebt«.
Solche Männer, die es »freiwillig über sich genommen haben, den unvermeidlichen Übeln des Staates entgegenzuarbeiten«, die jene vielleicht unentrinnbaren Trennungen in Nationen, Stände, Religionsbekenntnisse nicht noch stärker einreißen lassen wollen, als es die Notwendigkeit erfordert, und ihre Folgen so unschädlich als möglich zu machen sich bestreben, sind die Freimaurer, oder sollten es wenigstens sein. Die Mitglieder einer »unsichtbaren Kirche«, deren »wahre Taten dahin zielen, alles, was man gemeiniglich gute Taten nennt, größtenteils entbehrlich zu machen«, eine wahrhafte Internationale, die freilich – ebensowenig wie zurzeit die modernere Internationale der Arbeiter – ihrer Idee entspricht. Mit Schärfe tadelt der Freimaurer Lessing namentlich die unsozialen Inkonsequenzen der Logen schon seiner Zeit. Wenn ein aufgeklärter Jude, wenn ein ehrlicher Schuster, wenn ein erfahrener und treuer Dienstbote es sich einfallen läßt, sich zur Aufnahme zu melden, so weist man sie ab: »Wir sind unter uns so gute Gesellschaft … Prinzen, Grafen, Herren von, Offiziere, Räte von allerlei Beschlag, Kaufleute, Künstler.«[55] Dazu das »Kapitale haben, diese Kapitale belegen, sie auf den letzten Pfennig zu nutzen suchen, sich ankaufen wollen, von Königen und Fürsten sich Privilegien geben lassen« usw. Sie scheinen ihm auf dem besten Wege, von ihren ursprünglichen Zielen ganz abzukommen. Ob die heutigen Logen nicht auch manchen dieser Tadel verdienen? Etwas demokratischer mag ein Teil von ihnen ja geworden sein; aber grundsätzlich herrscht doch wohl noch immer bei ihnen das Prinzip der »guten« Gesellschaft; abgesehen davon, daß Atheisten und daß von der Vollmitgliedschaft auch Frauen heute noch ausgeschlossen sind.[9]
Aber das Bestehende verhält sich zum wahren Freimaurertum wie die bestehende, sehr mangelhafte Kirche, ja, man könnte erweiternd sagen: alle religiösen und politischen Parteien der Wirklichkeit, zu ihrer Idee. Und umgekehrt: man kann »die höchsten Pflichten der Maurerei erfüllen, ohne Freimaurer zu heißen«. Wahre Freimaurerei ist von jeher gewesen; sie ist so alt wie die bürgerliche Gesellschaft (hier natürlich im weitesten Sinne gemeint). Und ihr jetziges Schema, fügen wir hinzu: ihre Zeremonien und alles damit Zusammenhängende ist nur »Hülle« und »Einkleidung«. Die Hauptsache aber, die der Verfasser mit voller Deutlichkeit allerdings noch nicht ausspricht, liegt in dem aus seiner Gedankenreihe zu ziehenden Schlusse: Man soll das wahre Freimaurertum unter alle Welt verbreiten. Wie es zu Anfang in der kurzen Widmung an Ferdinand von Braunschweig heißt: »Das Volk lechzet schon lange und vergehet vor Durst!« Damit wäre freilich dem Freimaurer-Orden als Geheimbund das Urteil gesprochen.
Schon in der »Emilia Galotti« hatte die Gräfin Orsina ausgerufen: »Das Wort Zufall ist Gotteslästerung; nichts[56] unter der Sonne ist Zufall.« Die in diesen Sätzen sich ausprägende Anschauung von der notwendigen und ausnahmlosen Naturbedingtheit alles schon Geschehenen, jetzt Geschehenden, noch Geschehenwerdenden, welche die Philosophie »Determinismus«, das heißt Bestimmtheit zu nennen pflegt, und die sich in religiöser Gestalt besonders im Islam und im Kalvinismus wiederfindet, scheint Lessing von jeher geteilt zu haben. Bereits eine Rezension aus dem März 1753 meint, daß die Leugner der Willensfreiheit wenigstens keine Feinde der Religion zu sein brauchen; auch in seiner Lehre von dem Wesen des tragischen Charakters sehen wir diese Lehre aufleuchten. Deutlicher spricht sich seine Vorrede zu des braunschweigischen Abtes Jerusalem »Philosophischen Aufsätzen« (1776), also aus seinen letzten Jahren über dies Problem aus. »Was verlieren wir denn,« fragt Lessing hier, »wenn man uns die Freiheit abspricht?« Und er antwortet: »Etwas, wenn es etwas ist, was wir nicht brauchen … Etwas, dessen Besitz uns weit unruhiger machen müßte, als das Bewußtsein seines Gegenteils …« Fühlt sich doch auch der Religiöse, wie wir hinzusetzen möchten, im Schoße seines alles lenkenden und bestimmenden Gottes ruhig und befriedigt. Ebenso muß auch der Philosoph sich nach Lessing sagen: »Zwang und Notwendigkeit, nach welchem die Vorstellung des Besten wirket, wieviel willkommener sind sie mir als kahle Vermögenheit, unter den nämlichen Umständen bald so, bald anders handeln zu können!« Und er fährt fort: »Ich danke dem Schöpfer, daß ich muß, das Beste muß. Wenn ich in diesen Schranken selbst so viel Fehltritte noch tue, was würde geschehen, wenn ich mir ganz allein überlassen wäre? einer blinden Kraft überlassen wäre, die sich nach keinen Gesetzen richtet und mich darum nicht minder dem Zufall unterwirft, weil dieser Zufall sein Spiel in mir selbst hat?« Zufall bedeutet also Gesetzlosigkeit, Naturgesetzlichkeit Ausschließung jedes Zufalls, allgemeine Geltung des Kausalgesetzes (Gesetzes von Ursache und Wirkung), ohne das keine Naturwissenschaft, ja Wissenschaft überhaupt denkbar ist.
Gerade starke Naturen haben das von jeher anerkannt und gleichwohl aus dem unversiegbaren Quell ihrer Persönlichkeit heraus zu diesem Naturmechanismus ihr trotziges: »Und[57] dennoch!« gesprochen. Auf solche Weise löst sich auch der anscheinende Widerspruch zwischen jener Orsinaschen Verurteilung des Zufalls und dem bekannten: »Kein Mensch muß müssen« Nathans, dem dann das Wort Al-Hafis auf dem Fuße folgt: »Was er für gut erkennt, das muß ein Derwisch.«
Von der Seite der Ethik also oder der Moral, wie Lessing sagt, ist das System des Determinismus »geborgen«. Aber, fährt er fort: ob nicht die Spekulation Einwände dagegen erheben könnte, die sich nur durch ein zweites philosophisches System heben ließen? Mit diesem zweiten, »gemeine Augen ebenso befremdenden« System ist der Spinozismus gemeint.
Wir haben im Laufe unserer bisherigen Darstellung das Wirken Spinozas, der bis dahin in Deutschland nach Lessings eigenem Ausdruck wie ein »toter Hund« angesehen worden war, auf unseren Dichter nur angedeutet. Wir wollen zunächst einen merkwürdigen undatierten, aber wahrscheinlich aus der Breslauer Zeit stammenden kleinen Aufsatz von ihm nachträglich noch erwähnen: »Über die Wirklichkeit der Dinge außer Gott.« Dort wird geradezu gesagt: »Es gibt kein Dasein außer Gott«, »alle Dinge sind in ihm wirklich«. »Die Begriffe, die Gott von den wirklichen Dingen hat, sind diese wirklichen Dinge selbst.« Auch der § 73 der »Erziehung des Menschengeschlechts«, der von der göttlichen Dreieinigkeit handelt, führt den nämlichen Gedanken aus. Das ist völliger Pantheismus (All-Gott-Lehre) oder, vielleicht noch genauer ausgedrückt, Panentheismus (All-in-Gott-Lehre). Ganz zu Spinoza durchgedrungen aber ist Lessing, wie wir jetzt bestimmt wissen, spätestens in seinem letzten Lebensjahr.
Am 5. Juli 1780 war Goethes und Hamanns Freund, der also philosophisch von ganz anderer Seite herkommende Düsseldorfer Friedrich Heinrich Jacobi, zum Besuch in Lessings einsamer Bibliothek eingetroffen.[10] Da erklärte dieser, dem Jacobi Goethes berühmtes philosophisches Gedicht »Prometheus«[58] zu lesen gegeben, dem Gaste zu dessen Erstaunen: Er nehme durchaus kein Ärgernis an der Anschauung Goethes; er habe im Gegenteil den Gesichtspunkt, von dem aus das Gedicht verfaßt sei, »schon lange aus der ersten Hand«, nämlich aus Spinoza. Und nun die Hauptäußerung: »Die orthodoxen Begriffe von der Gottheit sind nicht mehr für mich Ἓν καὶ πᾶν (d. h. es gibt nur ein All). Ich weiß nichts anderes.« Sie werden durch einen Besuch gestört. Am folgenden Morgen kommt Lessing zur Fortsetzung des Gesprächs auf Jacobis Zimmer. Er bekennt sich von neuem als Anhänger des Pantheisten: »Es gibt keine andere Philosophie als die des Spinoza.« Und weiter als entschiedenen Deterministen: »Ich begehre keinen freien Willen«, worein »der helle Kopf Ihres Spinoza sich doch auch zu finden wußte«.
Auffallenderweise bekennt er sich bei dieser Gelegenheit auch, ganz im Gegensatz zu der Philosophie seiner Zeit, als Gegner des erkenntnistheoretischen Idealismus, wie er von Parmenides und Plato begründet, von Descartes über Leibniz bis zu Kant und seinen Nachfolgern verkündet worden und unseres Erachtens unabweislich ist. Er erklärt es für ein menschliches Vorurteil, daß »wir den Gedanken als das Erste und Vornehmste betrachten und aus ihm alles herleiten wollen«: während doch »alles, die Vorstellungen mit inbegriffen«, also »Ausdehnung, Bewegung, Gedanke« offenbar von »höheren« Prinzipien abhänge, in einer »höheren Kraft gegründet« sei, die »noch lange nicht damit erschöpft ist«. Er bedenkt dabei nicht, daß dies Ausgehen von einer »alle Begriffe übersteigenden«, gänzlich unbestimmten »höheren« Kraft uns in alle Dunkelheiten der Metaphysik und Theologie, ja unter Umständen Theosophie (oder, wie Rudolf Steiner es moderner umtauft: »Anthroposophie«) hineinführt. Zur weiteren Begründung dieser pantheistischen Metaphysik bezieht er sich auf einen merkwürdigen Gedanken von Leibniz, wonach die Gottheit sich in einem Zustand beständiger Expansion (Ausdehnung) und Kontraktion (Zusammenziehung) befände, womit zugleich Leben und Tod der Individuen in der Welt zusammenhängen soll; muß aber selbst zugeben, daß diese Stelle mit der sonstigen Überzeugung des Leibniz von einem persönlichen, außerhalb der Welt[59] existierenden Gott in Widerspruch stehe. Lessing selbst, setzt Jacobi hinzu, konnte sich mit dem Gedanken eines unendlichen persönlichen Wesens, das unaufhörlich im Genuß seiner eigenen »Vollkommenheit« schwelge, nicht vertragen. »Er verknüpft mit demselben eine solche Vorstellung von unendlicher – Langeweile, daß ihm angst und weh dabei werde.«
Von Lessings Freunden wollte, als Jacobi vier Jahre nach dessen Tode in seiner Schrift »Über die Lehre des Spinoza, in Briefen an Moses Mendelssohn« dies Gespräch veröffentlichte, niemand an eine solche Änderung seiner Ansichten, die in der Tat ein völliges Abweichen von den Grundsätzen der »Aufklärung« darstellt, glauben. Und es entspann sich darüber 1785/86 ein äußerst heftiger Philosophenstreit, der bei Mendelssohns ohnehin kränklichem Körper dessen Tod beschleunigt hat. Wir werden bei Herder und Goethe darauf zurückzukommen haben.
Ob Lessing im ganzen mehr Leibniz oder Spinoza zugeneigt habe, läßt sich schwer entscheiden. Zu Leibniz zogen ihn sicherlich dessen Hauptgedanken von der Entwicklung alles Lebendigen, von der ununterbrochenen Stetigkeit des Weltzusammenhanges, von der Verknüpfung kleinster vorstellender mit kleinsten körperlichen Einheiten in den »Monaden«; zu Spinoza – zuletzt doch, wie es nach Jacobis bestimmtem Zeugnis scheint, entscheidend – die streng monistische Folgerichtigkeit von dessen Lehre. Schulmäßiger Anhänger eines bestimmten Systems, also Spinozist oder Leibnizianer zu werden, lag seiner unabhängigen Natur überhaupt nicht. Auch Jacobi gegenüber hatte er eigentlich bloß erklärt: »Wenn ich mich nach jemand nennen soll, so weiß ich keinen anderen.« Völlig einem, und sei es auch der scharfsinnigste, Denker sich zuzuschwören, hinderte ihn sein lebhaftes Selbständigkeitsgefühl.
Damit kommen wir zum Schlusse noch einmal zu Lessings philosophischer und menschlicher
zurück. Mögen seine Einzeltheorien auf den verschiedenen Gebieten, auf denen er gearbeitet hat, in Religions-, Kunst-, Geschichts- und Staatsphilosophie, heute in mancherlei Hinsicht überholt sein: was uns immer wieder zu ihm und seinen[60] Werken hinzieht, ist seine einzigartige Persönlichkeit. Schon seine Sprache, insbesondere seine Prosa, ist von großartiger Eigenartigkeit. »Solange Deutsch geschrieben ist, hat, dünkt mich, niemand wie Lessing Deutsch geschrieben«, hat schon einer, der doch auch etwas davon verstand, J. G. Herder, dem eben Verstorbenen nachgerühmt; und sein Hauptbiograph (Erich Schmidt) hat ihr im zweiten Bande seines Werkes über ein halbes Hundert Lexikonseiten gewidmet; auch ich habe Ihnen mit Absicht durch zahlreiche Zitate seine Stilart nahe zu bringen gesucht. Aber wenn ein Franzose gesagt hat: Der Stil ist der Mann, so kann man ebensogut sagen: Der Mann macht den Stil. Und so ist es bei Lessing: sein Stil geht aus seiner kraftvollen Persönlichkeit hervor. Diese Ehrlichkeit, diese Mannhaftigkeit, diese unbezähmbare Wahrheitsliebe, diese stete Kampfbereitschaft gegen alles Unrecht, der Haß gegen alle Unterdrücker, die Liebe zu den Unterdrückten, die Gleichgültigkeit gegen die eigene Leistung, sobald sie vollbracht ist, sein mit ungescheuter Selbstkritik verbundener echter Stolz, der Mut und die Selbstbeherrschung im Unglück: alle diese Charaktereigenschaften – von seinen intellektuellen Vorzügen ganz zu schweigen – haben sich selten in einem Menschen so vereinigt wie in Gotthold Ephraim Lessing.
Gewiß, alle menschlichen Handlungen sind naturbedingt. Jeder von uns wird unter bestimmten Verhältnissen auch notwendig so handeln, wie er es tut. Aber zu den Beweggründen, und zwar den allerstärksten, eben dieses Handelns gehört auch sein freilich wieder durch Tausende von Umständen so oder so gewordener innerer Mensch, sein »Dämon«, wie schon der alte Heraklit gesagt hat. So berichtet denn auch derselbe Jacobi, der Lessings Determinismus bezeugt, einen scheinbar ganz entgegengesetzten Ausspruch von ihm: »Wo keine Selbstbestimmung ist, keine Freiheit, da ist keine Menschheit.« Ja, Lessing, der »Determinist« ist zugleich ein radikaler Prediger der Freiheit auf allen Gebieten gewesen: in Religion und Staat, Ethik und Erziehung. Und er hat sie, hat seinen vollendeten Unabhängigkeitssinn vor allem auch in sein eigenes Leben hineingetragen. Er war gegen alles Sektenmachen, gegen alle Engigkeit und Beschränktheit. Er hat auch keine »Schule« gegründet, ja er wollte keine gründen. Er hat[61] sich nicht in das Universitäts-, das Hof-, das Beamtenleben hineinbegeben. Er trat auch nie mit sogenannter »Würde« auf. Im Gegenteil, »er warf die persönliche Würde gern weg, weil er sich zutraute, sie jeden Augenblick wieder aufnehmen zu können« (Goethe). Nur ein Pedant und Philister von Kopf und Herz wird sich »nie gehen lassen«.
Freilich solche Menschen stehen dann in ihrer Stärke – »der Starke ist am mächtigsten allein« – und Höhe oft auch vereinsamt da, wie Lessing es einmal in seinen »Antiquarischen Briefen« in einem wundervollen Selbstvergleich mit einer einsam ihr Tagewerk vollziehenden Windmühle ausgeführt hat: »Da stehe ich auf meinem Platze ganz außer dem Dorf auf einem Sandhügel allein und komme zu niemandem und helfe niemandem und lasse mir von niemandem helfen. Wenn ich meinen Steinen etwas aufzuschütten habe, so mache ich es ab, es mag sein mit welchem Winde es will. Alle zweiunddreißig Winde sind meine Freunde. Von der ganzen weiten Atmosphäre verlange ich nicht einen Finger breit mehr, als gerade meine Flügel zu ihrem Umlauf brauchen. Nur diesen Umlauf lasse man ihnen frei … Wen meine Flügel in die Luft schleudern, der hat es sich selbst zuzuschreiben.«
Nun, Lessing hat sein Tagewerk wahrlich in reichlichem Maße getan. Und er hat stets zu seinen Taten gestanden: »Was ich tat, das tat ich!«, wie er seinen Tempelherrn sagen läßt. Und dabei, welch frischer Lebensmut in ihm: »Wer gesund ist und arbeiten will,« schreibt er einmal an seine Eltern, »der hat nichts zu fürchten; Krankheiten aber und dergleichen Umstände zu befürchten, die außerstand setzen könnten zu arbeiten, zeigt ein schlechtes Vertrauen auf die Vorsehung. Ich habe ein besseres und habe Freunde.« Aber er will sich nur an Stellen festsetzen, für die er sich der geeignete Mann fühlt: »Wenn wir nicht versuchen, welche Sphäre uns eigentlich zukommt, wagen wir uns öfters in eine falsche, wo wir uns kaum über das Mittelmäßige erheben, während wir uns in einer anderen zu einer bewundernswerten Höhe hätten schwingen können.« Indessen wo er seiner Meinung nach etwas Edles und Großes zu fördern vermag, geht er, wie oft auch enttäuscht, stets wieder darauf ein. Und wenn er dann wiederum scheitert, so merken wir an der Art seines Rückzugs, daß auch[62] »in ihm dieselbe Überlegung wie in uns« vorhanden gewesen, daß jedoch in ihm »eine größere Wärme des Herzens war als in uns« (Gervinus).
Und er bewährte diesen Mut, diese wahrhaft philosophische Gesinnung auch im schwersten Unglück und bis ans Ende. Als ihm, der nach langer Wartezeit zum späten Glück einer vortrefflichen Frau gelangt ist, diese Frau samt dem Neugeborenen nach kurzer Krankheit wieder entrissen wird, da schreibt er nur das freilich bittere Wort: »Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen, aber es ist mir schlecht bekommen.« Und weiter an einen Freund: »Meine Frau ist tot, und diese Erfahrung habe ich nun auch gemacht. Ich freue mich, daß mir viele dergleichen Erfahrungen nicht mehr übrig sein können zu machen, und bin ganz leicht.« Einige Tage darauf: »Wenn ich noch mit der einen Hälfte meiner übrigen Tage das Glück erkaufen könnte, die andere Hälfte in Gesellschaft dieser Frau zu verleben, wie gern wollt' ich es tun! Aber das geht nicht, und ich muß nur wieder anfangen, meinen Weg allein so fort zu duseln.« Und ein halbes Jahr später, nach allerlei anderem Mißgeschick, an die Freundin Elise Reimarus: »Doch ich bin zu stolz, mich unglücklich zu denken, knirsche eins mit den Zähnen und lasse den Kahn gehen, wie Wind und Wellen wollen. Genug, daß ich ihn nicht selbst umstürzen will.« Er sollte ihn noch zweiundeinhalb Jahre treiben sehen, mannhaft und unerschrocken wie immer, bis ihm der Tod das stets kampfbereite Schwert des Geistes aus der Hand schlug.
Man hat uns zu verschiedenen Zeiten Rembrandt, Goethe, Nietzsche, Fichte, Schopenhauer als Erzieher gepriesen. Wir finden: gerade Lessing, von dem wir nun Abschied nehmen, kann uns, dem einzelnen und dem ganzen Volke, gerade in heutiger Zeit ein Vorbild, ein Erzieher sein. Denn er vereinigte mit der Klarheit des Kopfes, die uns heute auch in der Philosophie gegenüber allen Schwärmereien und Rückwärtsereien so not tut, die Wärme des Gefühls, da wo sie am Platze ist, und die Fähigkeit des Willens zu festem, entschlossenem Handeln.
Herders Persönlichkeit steht zu derjenigen Lessings im schärfsten Gegensatz. Lessing erscheint uns heute noch beinahe wie ein Mitstreiter unserer Geisteskämpfe, wenigstens der religiös-philosophischen. Und auch in denjenigen von ihm behandelten Gegenständen, die uns Modernen ferner liegen, bleibt er, allein durch seine unübertreffliche Fragestellung, immer fesselnd, frisch und lebendig. Dem Namen Herders gegenüber regt sich dagegen bei den meisten Heutigen nicht viel mehr als eine mehr oder weniger verschwommene Erinnerung, daß man einmal im Schulunterricht von ihm gehört, daß er unter anderem Goethe beeinflußt hat. Und doch hat auch Herder mächtig auf Zeitgenossen und Nachwelt gewirkt, war er vor allem in seiner Jugend ein Schriftsteller von geradezu erstaunlicher Schaffenskraft, auch im Mannesalter noch bedeutend, um dann freilich rasch zu einem verbitterten und grämlichen Alter herabzusinken.
Gleich Lessing ist auch der anderthalb Jahrzehnte nach ihm, am 25. August 1744 in dem zwischen Sumpf, Wald und See gelegenen ostpreußischen Städtchen Mohrungen geborene Johann Gottfried Herder ein großer, ja ein unbändiger Leser gewesen: schon daheim im elterlichen Lehrer- und Küsterhaus oder noch lieber auf einem Baume des Gartens oder am See und im Wald der Heimat. Und dann, während und nachdem er die höhere Stadtschule des rauhen, pedantischen Rektors Grim durchlaufen, in der dürftigen Schlafkammer im Hause des harten Diakonus Trescho, der die Arbeitskraft des stillen und träumerischen angehenden Jünglings in geisttötendem Abschreiberdienst ausbeutet, bis der bald Achtzehnjährige durch die Freundlichkeit eines russischen Regimentswundarztes namens Schwartz-Erler[11] aus dieser Fron erlöst und mit nach Königsberg[66] genommen wurde. Hier erst atmet er geistig auf, läßt sich auf eigene Faust als Studiosus der Theologie einschreiben und lernt in dem Buchladen des Verlegers Kanter die Gelehrtenwelt der Hauptstadt kennen, während er sich sein Brot als junger, anregender Lehrer an demselben, heute noch bestehenden, »Friedrichskolleg« verdient, in dem ein Menschenalter zuvor Immanuel Kant acht unfruchtbare Schuljahre verbracht hatte.
Dieser selbe Kant, jetzt achtunddreißigjähriger Magister an der Akademie, also noch nicht Mitglied der Fakultät, aber »für sich allein eine ganze Fakultät«, wie Rudolf Haym sagt, ist der erste große Geist gewesen, der einen nachhaltigen Einfluß auf das begeisterungsfähige Gemüt des jugendlichen Herder geübt hat. Wie gerade begabtere Jünglinge auf der Universität oft von einem einzigen hervorragenden Lehrer mehr Anregung empfangen als von allen anderen zusammen, so war es auch hier. Elf Tage nach seiner Immatrikulation, am 21. August 1762, sitzt er zum erstenmal zu den Füßen des schon damals beliebten Magisters, der gerade über den Zusammenhang von Geist und Körper spricht, sich über den Gespensterglauben in behaglicher Ironie ergeht und schließlich das Problem vom Dasein Gottes behandelt. Von Stund' an hörte er alle Vorlesungen des geliebten, auch poetisch von ihm gefeierten Weltweisen: Logik, Metaphysik, Moral, Mathematik, physische Geographie. Kant gewährte dem talentvollen, aber armen Studenten, der einmal auch des Philosophen Ideen über Zeit und Ewigkeit in Verse setzt, die dieser dann am nächsten Morgen mit Anerkennung seinen Zuhörern vorlas, den unentgeltlichen Besuch aller seiner Vorlesungen. Noch nach mehr als einem Menschenalter, in seinen Humanitätsbriefen (1795), hat der Dichter dankbar dieser Lehrstunden Magister Kants gedacht: »Ich habe«, sagt er dort, »das Glück genossen, einen Philosophen zu kennen, der mein Lehrer war. Er, in seinen blühendsten Jahren, hatte die fröhliche Munterkeit eines Jünglings, die, wie ich glaube, ihn auch in sein greisestes Alter begleitet. Seine offene, zum Denken gebaute Stirn war ein Sitz unzerstörbarer Heiterkeit und Freude. Die gedankenreichste Rede floß von seinen Lippen; Scherz und Witz und Laune standen ihm zu Gebot, und sein lehrender Vortrag war der unterhaltendste Umgang. Mit eben dem Geist, mit dem er Leibniz, Wolff, Baumgarten,[67] Crusius, Hume« – die angesehensten Philosophen der Zeit – »prüfte und die Naturgesetze Keplers, Newtons, der Physiker verfolgte, nahm er auch die damals erscheinenden Schriften Rousseaus, seinen Emil und seine Heloise, sowie jede ihm bekannt gewordene Naturentdeckung auf, würdigte sie und kam immer zurück auf die unbefangene Kenntnis der Natur und auf moralischen Wert des Menschen. Menschen-, Völker-, Naturgeschichte, Naturlehre, Mathematik und Erfahrung waren die Quellen, aus denen er seinen Vortrag und Umgang belebte. Nichts Wissenswürdiges war ihm gleichgültig; keine Kabale, keine Sekte, kein Vorteil, kein Namensehrgeiz hatte je für ihn den mindesten Reiz gegen die Erweiterung und Aufhellung der Wahrheit. Er munterte auf und zwang angenehm zum Selbstdenken; Despotismus war seinem Gemüt fremde. Dieser Mann, den ich mit größter Dankbarkeit und Hochachtung nenne, ist Immanuel Kant; sein Bild steht angenehm vor mir.«
Diese Charakteristik des einstigen Lehrers ist für unseren Zweck auch deshalb von besonderem Wert, weil sie uns schon hier einen hervorstechenden Zug von Herders eigenem Philosophieren zeigt. Weniger die systematische Philosophie zieht ihn an, als die geistreiche, über alle Gegenstände des geistigen Lebens der Menschheit und die Natur in freier Rede sich ergehende Art des Lehrers, wie er denn schon damals sich selbst das Philosophische ins Dichterische übersetzte. So waren und blieben ihm denn auch von Kants Schriften diejenigen am liebsten, die am wenigsten philosophische Systematik enthielten: wie die populär geschriebenen »Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen« (1764) und die von ihm in einer Königsberger Zeitung besprochenen »Träume eines Geistersehers« (1766). Daneben ließ er sich durch Kant zu Hume und Rousseau leiten, von denen ihn der letztere in seiner Natur- und Gefühlsbegeisterung, der schottische Skeptiker in seiner Abneigung gegen metaphysische Spekulation bestärkte. Indessen schon in zwei 1767 zwischen beiden gewechselten Briefen macht sich, bei aller Wärme in der Form, für ein feineres Auge doch bereits die allmählich zwischen Lehrer und Schüler sich öffnende Kluft – dort Vernunft, hier Gefühl – bemerkbar.
So sollte denn auch schon in der ostpreußischen Hauptstadt eine ihm kongenialere Persönlichkeit von völlig entgegengesetzter[68] Natur einen noch stärkeren Einfluß auf des jungen Herder rasch aufloderndes Gemüt gewinnen. Es war der damals noch ohne festen Beruf in seinem Elternhause lebende sogenannte »Magus des Nordens« Johann Georg Hamann (1730 bis 1788). In geradem Gegensatz zu seinem Landsmann Kant, stellt Hamann die Leidenschaft über die Vernunft, das persönliche Gefühl über den besonnenen Willen, Tradition und Geschichte über philosophische Abstraktion und den vieldeutigen Begriff des »vollen, strömenden Lebens« über den »leeren Wortkram«, die trockene »Schulfuchserei« und das »scholastische Geschwätz« der Philosophen. Dieser Herder rasch ans Herz gewachsene wunderliche Mensch sucht nicht, sondern flieht, wie Kühnemann treffend sagt, den Zusammenhang der Gedanken, bewegt sich grundsätzlich in Gedankensprüngen. »Wahrheiten, Grundsätzen, Systemen«, so schreibt er selbst 1759 an seinen Freund Lindner, »bin ich nicht gewachsen.« Seine Sache sind vielmehr nach seinem eigenen Geständnis »Brocken, Fragmente, Grillen, Einfälle«. Gott verlangt von uns »keine Kopfschmerzen, sondern Pulsschläge«. So lebt und webt er in den oft willkürlichsten Einfällen, Ahnungen, Gefühlen. Demgemäß ist auch sein zwar geistvoller, aber durchaus sprunghafter, absichtlich in Dunkelheiten sich ergehender Stil.
Im Mittelpunkt des Hamannschen Denkens steht, nicht ohne daß eine auf ein ziemlich übles Weltleben in London erfolgte plötzliche Bekehrung dazu beigetragen hätte, die rein gefühlsmäßig aufgefaßte Bibel. Daneben die Offenbarung Gottes in Natur und Geschichte. Beide sind ihm nichts anderes als »verborgene« Chiffern, deren »Schlüssel« wir in der Heiligen Schrift finden, und schließlich auch in der Sprache. Voll seherischen Tiefblicks zeigt sich Hamanns Genie, wenn er in die Ursprünge des geistigen Lebens bei dem einzelnen wie bei ganzen Völkern, in die Anfänge und das Wachstum der Sprache, insbesondere der Poesie, dieser »Muttersprache des menschlichen Geschlechts«, hineinleuchtet. Er will, wie ein Jahrhundert später sein religiöser Gegenfüßler Friedrich Nietzsche, seine Leser nicht überzeugen, sondern erregen, unter sich zwingen.
Und dieser Mann ist mehr als irgendein anderer fortan – mit Ausnahme einer kurzen Zeit, von der wir noch sprechen werden – von Einfluß auf den leicht erreg- und entzündbaren[69] Herder geworden. In ihm fand er, wie seine Gattin in den »Lebenserinnerungen« bezeugt, »was er suchte und bedurfte: ein mitempfindendes, liebevolles, glühendes Herz, … einen an Gemüt und Geist hohen, geweihten Genius. So trug er seinen Hamann im Herzen, die innigste Sympathie verknüpfte sie beide für Zeit und Ewigkeit.« Noch später in Weimar war es für ihn stets ein Festtag, so oft er einen Brief seines geliebten Hamann aus Königsberg, zuletzt aus Münster erhielt; »seine ganze Seele war bewegt, Freudentränen standen in seinen Augen.«
1765 bis 1772 (Riga, Reiseleben, Straßburg)
Zu Ende des Jahres 1764 begleitete der »Magus« den scheidenden jungen Freund bis zum Tore. Denn dieser hatte sich entschieden, eine Lehrstelle an der Domschule zu Riga anzunehmen, wurde später dort auch ein gern gehörter Prediger, der echtes Deutschtum und echtes Menschentum – auch heute noch keine Gegensätze! – zu vereinen wußte und, in diesem Falle doch mit Hamann nicht identisch, ein Christentum von durchaus freier, humaner Form vertrat. Daneben aber begann jetzt seine, bisher nur in einzelnen Gedichten und Selbstniederschriften geübte, Schriftstellerei. Im Jahre 1767 (kleinere Aufsätze müssen wir übergehen) erschienen, noch ohne seinen Namen, seine »Fragmente über die neuere deutsche Literatur«, 1769 seine »Kritischen Wälder«. Diese beiden Schriften, die Herders Namen zuerst in den literarischen Kreisen bekannt machten, haben zwar große Bedeutung für die Literaturgeschichte, nicht in gleichem Maße aber für die Philosophie. Erinnert die erste schon in ihrem Titel an die Literaturbriefe Lessings, mit dem überhaupt Herder fast sein ganzes Leben hindurch in Zustimmung und Widerspruch sich beschäftigt hat, so sind die »Kritischen Wälder« in ihrem wichtigsten Teile eine Kritik und Weiterbildung des »Laokoon«. Gegenüber dem Allgemeingültigen, das für Lessing wie später für Kant die Hauptsache ist, betont Herder schon hier mit Vorliebe die Berechtigung des Individuellen und historisch Gewordenen. Lessings Zweiteilung in Malerei und Poesie stellt er die Dreiteilung in bildende Künste, Tonkunst und Dichtkunst entgegen, die den drei Grundbegriffen: Raum, Zeit und Kraft entsprechen. Von der Malerei wird bestimmter[70] die Plastik abgegrenzt, der er auch eine besondere, freilich erst ein Jahrzehnt später veröffentlichte, Schrift gewidmet hat. Die Malerei ist die Kunst des Gesichts-, die Musik die des Gehör-, die Plastik die des Tastsinns, die Dichtkunst die der Phantasie.
Schon aus diesen kurzen Andeutungen sehen wir, daß Herder reich an anregenden, zum Teil auch neuen Gedanken ist, ohne doch im eigentlichen Sinne selbstschöpferisch zu sein. Übrigens hält es seine unruhige, bewegliche und auch – selbstbewußte Natur auf die Dauer nicht in der immerhin doch abgelegenen Baltenstadt. Er tritt im Mai 1769 eine große Seereise nach dem Westen mit zunächst noch unbestimmtem Ziele an. Auf dieser Fahrt gibt er sich nun aber nicht etwa bloß, wie man denken könnte, dem Naturgenuß des freien Meeres hin, sondern schreibt in seinem noch erhaltenen Reisetagebuch – der »Meister« der gegenwärtigen »Schule der Weisheit« in Darmstadt Graf Keyserling hat also einen berühmten Vorgänger – allerlei Bekenntnisse, Selbstschilderungen, Rückblicke in die Vergangenheit und Vorblicke in die Zukunft nieder, die nicht nur eine noch heute anziehende Lektüre bilden, sondern auch für das Verständnis seines innersten Wesens von Bedeutung sind. Einen besonders breiten Raum nimmt darin, seiner bisherigen praktischen Wirksamkeit entsprechend, das Problem der Erziehung ein. Er entwirft mancherlei, für seine Zeit sehr fortgeschrittene Volksbildungspläne und Zukunftsschulentwürfe, die zum Teil heute noch unsere Gedanken beschäftigen: wie die stärkere Betonung der damals noch ganz zurücktretenden Realien, insbesondere Geschichte, Geographie und Naturkunde, Beginn mit französischem Unterricht an Stelle des alten scholastischen Lateinbetriebs. Er fordert lebendigen Lektüre- und anregenden Philosophieunterricht, dessen Methode, wie bei Rousseau und Kant, eine natürliche sein soll. Er träumt davon, der Bildungsreformator der Ostseeprovinzen, ja Rußlands zu werden, denkt auch an eine gründliche Reform der philosophischen Wissenschaften und »einen lebendigen Unterricht darin im Geiste Kants«. Und daneben an das, was dann auch wirklich seine philosophische Haupttat werden sollte: an eine zusammenfassende, auf völkerpsychologischer Unterlage ruhende Philosophie der Menschheitsgeschichte; Montesquieu soll dabei sein Vorbild sein. In Paris lernt er den ihm in mancher Beziehung geistesverwandten[71] Diderot kennen, studiert er bildende Kunst und Theater. Dann reist er über Holland und Hamburg, wo er vierzehn anregende Tage im Umgang mit Lessing verlebt und mit Matthias Claudius Freundschaft schließt, nach Eutin, um für drei Jahre Reisebegleiter eines dortigen sechzehnjährigen Prinzen zu werden. Mit ihm reist er über Darmstadt, wo er seine spätere Frau, die zwanzigjährige Karoline Flachsland, kennenlernt, nach Straßburg.
Sein Straßburger Aufenthalt, der ihn bald von der lästigen Reisebegleiterstellung löst, aber durch eine nötig gewordene Augenkur sich noch über ein halbes Jahr in die Länge zog, ist, seitdem Goethe ihn zum erstenmal in »Dichtung und Wahrheit« erzählt, mehr als hundertmal in seiner Wichtigkeit für unsere literarische Entwicklung, vor allem für die des jugendlichen Goethe, geschildert worden. Er ist in der Tat in dieser Hinsicht kaum zu überschätzen. War in der Schätzung Homers und Shakespeares Lessing schon vorangegangen, so hat doch erst Herder ihr freie Bahn gebrochen, vor allem aber im Volkslied und der Volksdichtung überhaupt den Keim aller echten Poesie enthüllt. Der »Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und der Lieder alter Völker«, denen dann später die epochemachenden »Stimmen der Völker in Liedern« folgten, sowie die »Abhandlung über Shakespeare«, die beide 1773 in dem berühmten Hefte »Von deutscher Art und Kunst« veröffentlicht wurden, sind in jener Straßburger Zeit entstanden.
Ins philosophische Gebiet gehört aus jener Zeit nur die aus Anlaß eines Preisausschreibens der Berliner Akademie Ende 1771 in wenigen Wochen niedergeschriebene Abhandlung »Über den Ursprung der Sprache«. Bis dahin gab es über diesen Gegenstand drei Theorien: 1. die orthodox-kirchliche, daß die Sprache dem Menschen von Gott unmittelbar anerschaffen sei; 2. die seit Aristoteles bei den meisten Philosophen übliche, daß sie von den Menschen durch willkürliche Übereinkunft (»Konvention«) behufs gegenseitiger Verständigung eingeführt worden sei; dazu war neuerdings 3. die von dem französischen Sensualisten Condillac aufgestellte gekommen, wonach sie aus der tierischen sich allmählich entwickelt habe. Demgegenüber vertritt nun Herder einen neuen, vermittelnden Standpunkt. Der Ursprung der Sprache ist auch ihm kein willkürlich künstlicher, sondern[72] ein natürlicher. Rein menschlich aber auch darin, daß die Sprache im engeren Sinne des Worts sich doch grundsätzlich von den uns mit den Tieren gemeinsamen bloßen Empfindungslauten unterscheidet. Sie ist erst mit der »Besinnung« des Menschen auf sich selbst, also mit dem Denken entstanden, wenn auch in allen ursprünglichen Sprachen noch Reste reiner Naturlaute sich finden. Ferner: je näher der Mensch noch dem Naturzustande steht, desto sinnlicher, aber auch poetischer ist seine Sprache; je stärker das bewußte Denken sich in ihm entwickelt, desto abstrakter (begriffsmäßiger) wird sie. Unter dem Einfluß des verschiedenen Klimas und der verschiedenen Lebensweise bildeten sich dann verschiedene Sprachen auf der Erde aus. Und so findet denn die Sprachenentwicklung und damit die gesamte Bildung der Menschheit im Zusammenhang mit der nach einem höheren Plane fortschreitenden Entwicklung des Menschengeschlechts überhaupt statt. Damit geht die Sprachphilosophie in die später von uns besonders zu behandelnde Herdersche Geschichtsphilosophie über. Seine Abhandlung von 1772 aber hat in Deutschland den ersten Grund zu einer brauchbaren Sprachtheorie gelegt, auf der dann, mit Wilhelm von Humboldts Forschungen beginnend, allmählich die moderne Sprachwissenschaft sich aufbauen konnte.
Unterdessen hatte ihres Verfassers wechselvoller äußerer Lebensgang eine neue Wendung erfahren. Der Siebenundzwanzigjährige war im April 1771 als Oberpfarrer und Konsistorialrat nach Bückeburg übergesiedelt. Damit beginnt eine neue Epoche seiner geistig-seelischen Entwicklung, eine
1772 bis 1776
In der kleinen Residenzstadt Bückeburg, zwischen einem aufgeklärten, aber donquichotteartigen Grafen, der sich durch seine Soldatenspielerei bekannt gemacht hat, und seiner gemütstiefen, pietistischen Gemahlin, seinen Amtspflichten noch fremd gegenüberstehend, ohne Freund, bis er im Mai 1773 seine Karoline als Gattin heimführt, fühlt sich Herder in den zwei ersten Jahren äußerlich wie innerlich vereinsamt. So macht er denn jetzt eine neue innere Wandlung durch. Der Aufsatz »Über den Ursprung der Sprache« hatte ihn der Aufklärung[73] nahe gezeigt und deshalb auch das Mißfallen Hamanns erregt, mit dem daher ein beinahe dreijähriges Stocken des Briefwechsels eingetreten war. Jetzt wendet er sich zu ihm zurück und dem gleichgearteten Lavater in Zürich zu. Von nun an gründet er seine Weltanschauung ganz auf religiöse Gedanken, die ihn von der strengen Wissenschaft abführen, seinen Schriften einen rein persönlichen Charakter geben, ihn oft in sich selbst sich zurückziehen lassen. Er entscheidet sich endgültig für den geistlichen Beruf, stellt gegenüber der »herzensarmen« und »gedankenlosen« Zeit sein Leben auf Gott, schreibt eine Reihe – bezeichnenderweise sämtlich unvollendet gebliebener – theologischer Schriften.
Wir lassen die rein theologischen, wie die fünfzehn »Blätter an Prediger« (1774), die »Erläuterungen zum Neuen Testament« durch Vergleichung mit der Lehre des altpersischen Zendavesta (1775) und »Maran Atha, das Buch der Zukunft des Herrn« (1779), eine Arbeit über die Offenbarung Johannis, beiseite und beschränken uns auf die merkwürdige »Älteste Urkunde des Menschengeschlechts« (1774 bis 1776), womit die ersten Kapitel des ersten Buches Mose gemeint sind. Herder deutet sie nicht etwa rationalistisch, wie ein Jahrzehnt später Kant in seinem »Mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte« und Kant nachfolgend Schiller es getan haben, sieht sie aber auch nicht als absolute göttliche Heilswahrheit an, sondern – als ein wundervolles Beispiel morgenländischer Naturempfindung und zugleich urältester Offenbarung Gottes in der Natur. In Wahrheit liegt ihm zufolge dieser Moses zugeschriebenen, aber einer orientalischen Gesamtanschauung entstammenden Schöpfungsgeschichte das Bild eines – werdenden Tages zugrunde und ist in den Anordnungen des uralten »Schöpfungslieds« eine geheime Bilderschrift, geteilt nach der heiligen Siebenzahl, versteckt! Wir gehen nicht weiter auf diese und andere Phantasien ein, die natürlich auch damals nur bei Hamann und seinem Kreise Bewunderung fanden, darunter auch bei dem jungen Goethe, der begeistert über den Verfasser schrieb: »Er ist in die Tiefen seiner Empfindung hinabgestiegen, hat darin alle die hohe, heilige Kraft der simpeln Natur aufgewühlt und führt sie nun in dämmerndem, wetterleuchtendem, hier und da morgenfreundlich lächelndem orphischem[74] Gesang vom Aufgang herauf über die weite Welt, nachdem er vorher die Lasterbrut (!) der neueren Geister, De- und Atheisten, Philologen, Textverbesserer, Orientalisten usw. mit Feuer und Schwefel und Flutsturm ausgetilgt!« Übrigens sind auch Herders übrige theologische Schriften dieser Epoche gegen die liberale Zeittheologie gerichtet.
Ja, selbst seine ihrem Titel nach ins philosophische Feld schlagenden Schriften der siebziger Jahre sind tief in diesen Geist getaucht. So die 1774 anonym erschienene Abhandlung »Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit«, nur daß sie in der Form der Denkweise »ungläubiger« Leser angepaßt ist. Im Gegensatz zu der sonstigen Geschichtsphilosophie des Jahrhunderts faßt sie den Gesamtgang der geschichtlichen Entwicklung als einen »Gang Gottes durch die Nationen«, als einen göttlichen Erziehungsplan auf; in letzterem Bilde mithin Lessings »Erziehung des Menschengeschlechts« verwandt, aber viel gefühlsmäßiger als dieser. Ein fruchtbarer Gedanke aber ist jedenfalls darin enthalten. Gegenüber einem Skeptizismus, der überhaupt jeden tieferen Sinn in der historischen Entwicklung vermißte, und der Ansicht der Aufklärer andererseits, die sozusagen prinzipiell einen Fortschritt in ihr erblicken wollte, vertritt Herder, obwohl auch er einen Fortschritt durchaus nicht leugnet, den wahrhaft geschichtlichen Gedanken: Jedes Volk und jede Zeit hat seinen (ihren) Mittelpunkt in sich selbst und ist nur um ihrer selbst willen da. Die verschiedenen Epochen werden, wobei es freilich ohne Künstlichkeiten nicht abgeht, mit den Lebensaltern des Einzelmenschen: Kindheit, Knaben-, Jünglings-, und Mannesalter, verglichen. Auch das von der Aufklärung, ja selbst Kant, durchweg als »finster« betrachtete Mittelalter wird zum erstenmal nach seinen wertvollen Seiten (»Andacht und Ritterehre, Liebeskühnheit und Bürgerstärke«) gewürdigt; während gegen die Gegenwart der Vorwurf der Mechanisierung des gesamten Daseins, der Erstickung alles wahrhaft Menschlichen erhoben wird. Gebt uns statt der bloßen Ausbildung des Verstandes, der Papierkultur: »Herz! Wärme! Blut! Menschheit! Leben!« Dabei alles im echten Sturm- und Drangstil, in abgerissenen Sätzen, mit dunklen Andeutungen, ahnenden Ausblicken und vielen Ausrufungszeichen geschrieben. Ein Vorläufer des späteren[75] großen geschichtsphilosophischen Werks, aber noch in durchaus schwärmerischem Gewande.
Endlich entwirft Herder in diesem Jahr auch eine allerdings erst 1778 abgeschlossene Psychologie: »Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele«, mit dem bezeichnenden Untertitel: »Bemerkungen und Träume«. Äußerlich ist sie wieder, wie so manche bedeutsame Abhandlung der Zeit (von Rousseau, Kant, Lessing, Mendelssohn), durch eine akademische Preisfrage veranlaßt. Natürlich wird das Empfinden als das allein ursprüngliche, daher innige und tiefe Element über die daraus nur abgeleitete Erkenntnis gestellt. Zwischen Körper und Seele existiert keine Scheidewand; beide stellen eine nur immer feinere »Hinaufläuterung« der Gotteskraft dar. Auf diese ganz Hamannsche Weise wird – für uns auf den ersten Blick sehr auffallend – eine fast mystisch begründete Seelenlehre dennoch mit der Physiologie verbunden, wie damals der berühmte, zugleich fromme und poetische Albrecht von Haller sie lehrte. Von den einfachsten Elementen, den Reizen, aufsteigend, verfolgt dann Herder den gesamten Aufbau des seelischen Lebens, freilich nach seiner uns nun schon bekannten Art ohne jede Schärfe der Grundbegriffe. Vielmehr sind ihm Sinnlichkeit, Anschauung, Glaube, Gefühl die eigentlichen Grundkräfte der menschlichen Seele; Biographien, vor allem Selbstbiographien, und Dichter die besten Fundgruben psychologischer Erkenntnis. Denken, Wollen und Fühlen – welche eine kritische, wissenschaftliche Psychologie auseinanderzuhalten sich bemüht –, ihm sind sie alles dasselbe, alle drei bloß Stufen einer einzigen Kraft: der Energie unserer Seele. Von »reinen Grundsätzen«, wie kurz darauf Kant sie aufstellte, hält Herder nichts. Die höchste Vernunft und, was damit gleichgesetzt wird, das »reinste göttliche Wollen« stellt die »Liebe« dar. Und dann folgt, am Schluß des ersten Teiles, der ihn plötzlich als – Spinozisten enthüllende Satz: »Wollen wir dieses nicht dem heiligen Johannes, so mögen wir's dem ohne Zweifel noch göttlicheren (!) Spinoza glauben, dessen Philosophie und Moral sich ganz um diese Achse beweget.«
Der zweite Teil bringt verhältnismäßig wenig Neues hinzu. Bloßes Spekulieren, heißt es dort, stumpft die Seele, bloßes Sentimentalisieren das Herz ab; beide gehören vielmehr zusammen[76] und müssen sich unterstützen, wie es im klassischen Altertum gewesen sei.
Gewiß, auch Lessing hatte sich, wie wir wissen, auf das klassische Altertum, auf das Testament Johannis und auf Spinoza berufen, aber auf ganz anderem Untergrund als dem des bloßen Gefühls. Für Herder dagegen sind sogar Charakter und Genie dasselbe. »Genie oder (!) Charakter« heißt ihm jede lebendige, eigenartige Menschenart. Kurz, er hat, zusammen mit Hamann, in diesen Schriften eigentlich das theoretische Programm der Genieperiode jener siebziger Jahre, in der sie entstanden ist, entwickelt. Sie tragen, wie Kühnemann richtig bemerkt, einen durchaus »faustischen« Charakter, erinnern an den Faust der ersten Monologe, die ja wohl auch in ihrer Urgestalt ungefähr zur selben Zeit entstanden sind, mit seinem Überdruß gegenüber der bloßen Wortgelehrsamkeit, mit seinem Drängen nach urwüchsiger Natur und Schöpferkraft, zum Schauen und Gefühl. Ja, man kann sogar deutliche Parallelen im Ausdruck zwischen jenen ersten Faustszenen und den Herderschen Schriften dieser Jahre feststellen. Trotzdem ist von solchen Ähnlichkeiten in Gedanken und Ausdruck immer noch ein weiter Weg bis zu der merkwürdigen These Günther Jacobys, der in einem beinahe 500 Seiten zählenden Buche »Herder als Faust« (Leipzig 1911, F. Meiner), übrigens mit viel Geist und Belesenheit zu begründen versucht hat: nicht etwa bloß (was auch wir vielleicht zu unterschreiben geneigt wären) Herdersche Gedanken seien in weitem Maße in jenen Teilen des Urfaust enthalten, sondern geradezu Herder sei Faust, d. h. seine inneren und äußeren Erlebnisse seien in dem Faust des ersten Teils, wenigstens bis zur Szene in Auerbachs Keller, enthalten. Ich empfehle, obschon ich die These selbst ablehne, doch den Lesern, die sich für das Problem interessieren, das wenig bekannt gewordene Buch zum Studium.
Beide letztbesprochenen Schriften Herders aber, »Auch eine Philosophie« und »Vom Erkennen und Empfinden«, sind trotz ihres rein philosophischen Titels im letzten Grunde religiöser Art: nur daß in der ersten die allem Erdgeschehen zugrunde liegende Gottheit in der geschichtlichen Entwicklung, in der zweiten im menschlichen Einzelwesen und seinem Denken und Fühlen sich offenbart. Beide sind sie jünglinghafte Vorläufer[77] der beiden Hauptwerke aus Herders Reifezeit, die ihn philosophisch auf der Höhe seiner Entwicklung zeigen: der »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« (1784 ff.) und der Gespräche über »Gott« (1786).
Am 1. Oktober 1776 waren Herders in die Stadt an der Ilm eingezogen. Aber er fühlte sich in der neuen Umgebung in den nächsten Jahren noch wenig wohl: vielmehr mannigfach eingeengt durch die zeitraubenden Geschäfte seines Generalsuperintendentenamtes wie durch die Rücksichten auf den Hof. Auch zu dem jungen Herzog, der ihn gerufen, ergab sich keine erquickliche Stellung, vor allem aber nicht zu Goethe, der doch diesen Ruf bewirkt, und der ihm jetzt in seinem kraftgenialischen Treiben allem Lebensernste abgewandt schien, während Goethe in Herder den ewig krittelnden Theologen erblickte.
In die ersten Weimarer Jahre fallen nur literarische Aufsätze, die wir hier übergehen müssen. 1780/81 erscheinen seine bedeutsamen »Briefe, das Studium der Theologie betreffend«, ein Erziehungsbuch für künftige Geistliche. Sie wollen keinen Wissensstoff vermitteln, sondern zur religiösen Persönlichkeit heranbilden. Die beiden ersten der vier Teile des Buches handeln vom Alten und Neuen Testament, aber in durchaus undogmatischem Sinne. Man soll die Bibel »menschlich« lesen, d. h. so einfach und natürlich wie irgend ein anderes Buch. Zugleich nähert er sich wieder der Wissenschaft: die jungen Theologen sollen die Hilfsmittel der Sprachwissenschaft und der historischen Kritik nicht verachten; freilich wird auch ihr Einklang mit dem wahren Glauben hervorgekehrt. Dessen Kern ist die Persönlichkeit Jesu, der die volle Offenbarung von Gottes Erziehungsplan mit der Menschheit und zugleich das unendliche, vor jedem vor uns liegende Ziel darstellt. So ist denn auch der dritte Teil, die »Dogmatik«, ganz undogmatisch, der Geist des Christentums steht über allem Streit und Hader, erweist sich in Taten der Liebe.
In den beiden nächsten Jahren (1782 und 1783) folgt dann das glänzende Buch »Vom Geist der hebräischen Poesie«, das man nicht ohne Grund als ein Seitenstück zu Winckelmanns[78] Würdigung des Griechentums, nämlich als erste tiefere Würdigung des morgenländischen Geistes bezeichnet hat. Die Rückwendung zur Philosophie aber und zugleich sein bedeutendstes philosophisches Werk wird veranlaßt durch das an Goethes vierunddreißigstem Geburtstag (28. August 1783) neu beginnende Freundschaftsverhältnis zu diesem. Goethe steckte damals tief in naturwissenschaftlichen Studien, von dem Streben getragen, die gesamte Natur in ihrer lebendigen Einheit zu erfassen, bis sie zuletzt im Menschen zum Bewußtsein ihrer selbst und ihres Schaffens gelangt. Das paßte so recht zu Herders Grundgedanken. Und so kann man wohl verstehen, wie beide sich in jener Zeit durch gegenseitiges geistiges Geben und Nehmen täglich gefördert fühlten; wie denn Goethe von ihren damaligen Unterhaltungen noch nach Jahren mit Wohlgefallen berichtet: »Unser tägliches Gespräch beschäftigte sich mit den Uranfängen der Wassererde und der darauf von alters her sich entwickelnden organischen Geschöpfe. Der Uranfang und dessen unablässiges Fortbilden ward immer besprochen und unser wissenschaftlicher Besitz durch wechselseitiges Mitteilen und Bekämpfen geläutert und bereichert.« Aus solchen Gesprächen entstand dann Herders größtes und reifstes Werk, dessen erster Teil bereits im folgenden Jahre (1784) herauskam, die
Es liegt in der Natur der Dinge, daß jemand, der eine Entwicklungsgeschichte der gesamten Menschheit in großem Stile zu entwerfen versucht, weiter ausholt und der Menschheitsgeschichte eine solche der belebten und unbelebten Natur vorausschickt. So hat Kant seine Philosophie der Entwicklung – denn eine solche verbirgt sich trotz alledem hinter seiner kritischen Philosophie – mit seiner bekannten großartigen Weltentstehungslehre begonnen, um von da zu geologischen und geographischen Studien fortzuschreiten, von ihnen zur Anthropologie und zuletzt erst zu geschichtsphilosophischen Abhandlungen überzugehen. Ähnlich beginnt ein Jahrhundert später Herbert Spencer seine großgedachte Entwicklungslehre mit der Philosophie des Unorganischen, um daran nacheinander die Prinzipien der Biologie, Psychologie, Soziologie und Ethik zu schließen.
So setzt denn auch Herder mit astronomischen Betrachtungen ein; sein erster Satz lautet: »Unsere Erde ist ein Stern unter Sternen«. Immerhin ist es doch etwas stark, daß der ganze erste Teil mit seinen fünf Büchern noch nichts vom eigentlichen Thema enthält, ja selbst die weiteren fünf Bücher des zweiten Teils nur eben bis zur wirklichen Menschheitsgeschichte heranführen. Vielmehr behandelt Buch 1 astronomische, geologische und physisch-geographische Fragen, Buch 2 und 3 solche der Biologie des Pflanzen- und Tierreichs, wie man damals auch in der Sprache der Wissenschaft noch sagte. Allerdings von vornherein im Vorausblick auf die »Krone der Schöpfung«, den Menschen. Wie die Erde ein Mittelgeschöpf unter den Planeten, so stellt der Mensch ein Mittelgeschöpf unter den Tieren der Erde dar. Keine Frage, daß dieser das Ganze durchziehende Grundgedanke der Entwicklung äußerst fruchtbar ist, daß auch im einzelnen reiche gedankliche Anregungen gegeben, daß insbesondere der zu seiner Zeit im Grunde ja noch gar nicht bestehenden geographischen Wissenschaft neue, fruchtbare Aufgaben gestellt werden. Auch der modernen Abstammungslehre, dem Darwinismus, steht Herder bis zu einem gewissen Grade nahe. Er betont immer wieder, daß die Pflanzen und die Tiere nach einem Urtypus gebildet seien, somit ein Exemplar das andere erkläre, daß eine Stufenleiter der auftretenden Unterschiede bestehe – man erinnere sich der gleichzeitigen »Metamorphose der Pflanzen« und Entdeckung des Zwischenkieferknochens durch Goethe –, und daß die verschiedenen Lebewesen nacheinander aufgetreten seien. Er nimmt auch, wie übrigens schon der alte Grieche Heraklit und unser Walter von der Vogelweide, einen Kampf ums Dasein an: »alles ist im Streit gegeneinander, weil alles selbst bedrängt ist«. Und er teilt auch den Gedanken der Anpassung: daß nämlich die Formen des Lebenden den gegebenen Bedingungen sich umwandeln. Indessen halten sich nach seiner Meinung doch die durch äußere Einflüsse bewirkten Abänderungen in verhältnismäßig engen Grenzen. Vor allem wird, trotz gelegentlicher poetischer Sätze, wie: »der Menschen ältere Brüder sind die Tiere«, der Mensch vom Tiere scharf abgegrenzt. Als der grundlegende Unterschied wird übrigens nicht etwa, mit der heutigen Naturwissenschaft, das verschiedene Gehirngewicht[80] (das auch Herder schon kannte), angegeben, sondern die aufrechte Stellung, die ihm die Hände frei machte und somit zu aller Kultur führte.
Denn auf den Menschen und seine Kultur ist doch durch die »Vorsehung« von Anfang an alles abgezielt. Der Mensch ist, wie die sieben Kapitel des vierten Buches nacheinander ausführen, zur Vernunfttätigkeit, zur Kunst und Sprache, zu feineren Trieben und zur Freiheit, zu längerer Lebensdauer und stärkster Verbreitung über die Erde organisiert, zur Humanität, Religion und Hoffnung auf Unsterblichkeit gebildet. Ja, der heutige Mensch bildet höchstwahrscheinlich keinen Abschluß, sondern bloß einen Anfang. Denn, wie auf unserer Erde eine Reihe aufsteigender Formen und Kräfte herrscht, die auf einen zusammenhängenden Fortschritt hinzielen, so ist selbst unsere Humanität nur die »Knospe zu einer zukünftigen Blume«, und der jetzige Zustand der Menschheit »wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweier Welten«.
Was den modern denkenden Naturwissenschafter von heute außer dem poetischen Stile an diesen Gedanken stört, ist das beständige vorzeitige Hineintragen von teleologischen, d. h. Zweckgedanken, des Wozu? in die naturwissenschaftliche Forschung, die doch zunächst nach Ursache und Wirkung der Dinge zu fragen hat. Aber diese teleologischen Gedankengänge lagen in der Zeit; von ihnen, von dem beständigen Einmischen der »Vorsehung« in den Natur- und Geschichtsverlauf, sind auch Lessing, Schiller und Goethe nicht frei. Mehr noch stört, mich wenigstens, die allzu gefühlsmäßige Art, die Herders ganzes Werk durchzieht und, wie wir es freilich nach allem Bisherigen von ihm erwarten mußten, Empfindungen allzuoft an Stelle von Gedanken setzt.
Das hielt doch auch schon ein zeitgenössischer Denker dem »geistreichen Verfasser« entgegen. Es war kein Geringerer als Immanuel Kant, der (zunächst anonym) am 4. Januar 1785 in der »Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung« eine ausführliche Besprechung des ersten Teils von Herders Werk veröffentlichte.[12] Er gab dem Leser – wie es Pflicht jedes wahrheitsliebenden[81] Rezensenten ist – ein objektives Bild des Herderschen Gedankenganges. Er ließ auch den schriftstellerischen Vorzügen seines einstigen Schülers alle Gerechtigkeit widerfahren, rühmte den »vielumfassenden Blick«, ja das »Genie« des »sinnreichen und beredten« Verfassers, seinen Scharfsinn in Auffindung von Ähnlichkeiten, die Kühnheit seiner Phantasie, den »großen Gedankengehalt«, die bei einem Theologen seltene Vorurteilslosigkeit des Denkens und im einzelnen »manche ebenso schön gesagte als edel und wahr gedachte Reflexionen«. Allein er vermißt, wie uns dünkt mit Recht, die von einem Philosophen zu erwartende »logische Pünktlichkeit in Bestimmung der Begriffe« und »sorgfältige Unterscheidung und Bewährung der Grundsätze«. Er kennzeichnet die Hauptzüge von Herders Wesen: das warme Gefühl, die durchaus persönliche Art, den dichterischen Stil, das Schwelgen in Bildern und Gleichnissen als ebensoviel Schwächen des Philosophen.
Herder aber empfand die Kritik Kants als hämisch und platt, als »schief« und »umkehrend«. Und diese Empfindung wurde durch die lehrhafte Schlußermahnung, er möge »seinem lebhaften Genie« künftig »einigen Zwang auferlegen«, da die Aufgabe der Philosophie »mehr im Beschneiden als im Treiben üppiger Schößlinge« bestehe, er solle daher weniger durch Winke, Mutmaßungen und Gefühle als durch wissenschaftliche Beobachtung und behutsame Vernunft zu wirken suchen, keineswegs in ihm abgeschwächt. Wütend schrieb er einem Freunde: »Ich bin vierzig Jahre alt und sitze nicht mehr auf seinen metaphysischen Schulbänken.« Und die begeisterte Zustimmung seiner Freunde bestärkte ihn darin. Nur Hamann nahm den ihm persönlich bekannten Königsberger Denker dem Freunde gegenüber in Schutz, während Knebel in dem Rezensenten einen »gelehrten Esel« und eine »lichtscheue Fledermaus« erblicken wollte! Mit einer »Widerlegung« Kants in Wielands Teutschem Merkur sprang auch ein Anonymus ihm bei, der sich dann als Wielands Schwiegersohn K. L. Reinhold entpuppte und bald darauf in einen begeisterten Anhänger Kants verwandelte.
Im Herbst 1785 erschien dann der zweite Teil der »Ideen«. Auch er beschäftigt sich, mit Ausnahme des einleitenden sechsten Buches, das eine Art »Physiognomik«, also äußere Charakterisierung der verschiedenen Menschenzweige (von Rassen will er[82] nichts wissen) entwirft, durchaus noch mit allgemeinen Problemen: insbesondere mit der Wechselwirkung der inneren (Herder: »genetischen«) Kräfte der Völker und ihrer äußeren, namentlich klimatischen Lebensbedingungen. Jedes Volk besitzt einen einheitlichen Charakter, der eine besondere Offenbarung der überall wirkenden göttlichen Kraft darstellt. Je nach Klima und Bedürfnissen verändern sich auch der Gebrauch der Sinne, die Phantasie, der praktische Verstand, die Empfindungen und Triebe, die Begriffe von der Glückseligkeit, dazu tritt überall der überwiegende Einfluß von Überlieferung und Gewohnheit. Das alles wird mit zahlreichen anschaulichen Beispielen vom Naturzustand an bis zur geschichtlichen Entwicklung belegt. Die Philosophie der Menschheitsgeschichte besteht nicht in der Betrachtung der äußeren Weltbegebenheiten, sondern in der Philosophie der Kultur und der bildenden Kräfte der Menschheit, so wie sie sich geschichtlich entfaltet haben. So setzt Herder hier seine sprachphilosophischen Erörterungen (S. 71 f.) fort und untersucht die Entstehung der Künste und Wissenschaften.
Besondere Mühe hat ihm – wir kommen damit zu Herders
– das Kapitel vom Staate (den »Regierungen«, wie er es nennt) gemacht; er hat es unter Goethes Einfluß nicht weniger als dreimal umgearbeitet, auch in seinen übrigen Schriften sich am seltensten darüber geäußert. Die Politik lag seinem gefühlsmäßigen Denken offenbar nicht. Auf diesem Gebiet ist er auch in den extremsten, ja wir dürfen sagen: rückständigsten individualistischen Vorstellungen befangen. Die Natur, und sie ist für ihn das Bestimmende, erschafft bloß Familien und Völker, keine Staaten. Alle Regierungen verdanken der Not und dem Krieg ihren Ursprung und sind lediglich um dieser Not willen da. Es wird unseren Lesern vielleicht nicht unsympathisch sein, wenn er bei dieser Gelegenheit gegen die einseitige, aber bis in die jüngste Zeit auch bei uns noch vorherrschend gewesene Bewunderung der Kriegshelden zu Felde zieht; so sagt er in starker Übertreibung einmal: die berühmtesten Namen der Welt sind Würger des Menschengeschlechts, gekrönte oder nach Kronen ringende Henker gewesen! Ebenso werden wir seinen Kampf gegen jede Art von Despotismus, sein wahrhaft christliches Eintreten[83] für die Idee des ewigen Friedens, seine Auslegung des »Gottesgnadentums«, wonach die Fürsten sich der ihnen von der Vorsehung verliehenen Herrscherstellung durch eigene Mühe erst würdig machen müssen, voll anerkennen. Auch sein, des Theologen, Eintreten für die völlige Freiheit der wissenschaftlichen, künstlerischen und religiösen Betätigung, gegen jede Art von Knebelung der Wissenschaft durch »Inquisition« oder Zensur. Manche Theologen von heute könnten sich ein Muster daran nehmen!
Um so mehr zu bedauern und höchstens durch die damaligen politischen Zustände erklärlich ist es, daß er den Wert des Staates noch so wenig erkennt, daß er ihm bloß als eine künstliche Maschine erscheint. Wenn Herder in der Glückseligkeit der einzelnen den Endzweck der Menschheit sah, so fragte ihn Kant in seiner Besprechung des zweiten Teils der »Ideen« mit Grund: ob er denn etwa das Wohlbehagen der im bloßen Genusse, wie glückliche Rinder oder Schafe, dahinlebenden Bewohner der schönen Südseeinsel Tahiti als höchstes Ziel der Menschheit betrachte? Ein Ziel, dem Kant sein eigenes Ideal einer »nach Begriffen des Menschenrechts geordneten Staatsverfassung« gegenüberstellte. Von einer Antwort Herders auf diese Frage ist uns nichts bekannt. Dieser hatte seinerseits, ohne Kants Namen, dessen in seiner ersten geschichtsphilosophischen Schrift »Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht« (1784) aufgestellten Satz angegriffen, daß die Naturanlagen des Menschen nicht im Individuum, sondern in der Gattung zu vollständiger Entwicklung zu kommen bestimmt seien. Auch dies weist der kritische Philosoph in seiner Besprechung mit überlegener Ruhe zurück.
Wir werden auf Herders politische Ansichten bei seiner Stellung zur Französischen Revolution noch einmal kurz zu sprechen kommen. Hier sei nur um der Vollständigkeit willen noch erwähnt, daß das letzte (zehnte) Buch des zweiten Teiles die mehr geographische Frage der Urheimat des Menschengeschlechts erörtert, die er in Asien findet. Auch kommt er bei dieser Gelegenheit auf seine »Älteste Urkunde« (S. 73) und deren Zuverlässigkeit zurück. Er geht sogar so weit, mit der mosaischen Überlieferung als Tatsache anzunehmen, höhere Geister (die Elohim) hätten den ersten Menschen die Sprache gelehrt!
Erst der dritte, Ostern 1787 erschienene Teil des Werkes geht dann zur eigentlichen Geschichte über. Er beschäftigt sich zunächst mit den Völkern Ost- und Südasiens, sodann mit Vorderasien und Ägypten, darauf mit der griechischen Kultur und zum Schluß mit der ihm weniger liegenden römischen Geschichte. Mit jener genialen Nachempfindung, die von jeher seine Stärke war, die Lücken der damaligen Geschichtsforschung und Völkerkunde ersetzend, weiß er von jedem dieser Völker ein charakteristisches Bild zu entwerfen. Die Hebräer treten in diesen Jahren des Geistesbundes mit Goethe gegenüber ihrer früheren Vorzugsstellung zurück. Im vollen Glanze seiner Schönheit erscheint dagegen das Griechentum. Das farbenreiche Gemälde der altgriechischen Sprache, Religion, Kunst, Sitte und Politik gehört zu den glänzenden Partien des Werks.
Seinen Abschluß erhält der dritte Band wieder durch eine Reihe allgemeiner Ausführungen (Buch 15), welche die Ergebnisse des Bisherigen und so eigentlich die Summe seiner Geschichtsphilosophie ziehen. Die gesamte Menschheitsgeschichte erscheint hier als »eine reine Naturgeschichte menschlicher Kräfte, Handlungen und Triebe nach Ort und Zeit«. Die Philosophie der Endzwecke, die Frage des Wozu? statt des Woher? wird jetzt ausdrücklich abgewiesen. Trotz alledem waltet in der Geschichte ein tiefer Sinn und Zweck. Dieser Zweck ist, wir wissen es schon und hören es hier aufs neue, die Humanität. Wie in der äußeren Natur, so dienen auch in der Geschichte die zerstörenden Kräfte letzten Endes den erhaltenden. Der Gang der Geschichte ist zwar voll abgerissener Ecken, voll aus- und einspringender Winkel, aber er führt im ganzen doch vorwärts. »Es ist«, so schließen diese Betrachtungen, »keine Schwärmerei, zu hoffen, daß, wo irgend Menschen wohnen, einst auch vernünftige, billige und glückliche Menschen wohnen werden; glücklich nicht nur durch ihre eigene, sondern durch die gemeinschaftliche Vernunft ihres ganzen Brudergeschlechts.«
Damit wird freilich, wie Herders Biograph Rudolf Haym (II, 236) richtig bemerkt, die Geschichtsphilosophie zum frommen Glauben, das Naturgesetz zum moralischen Gebot, das Herder denn auch etwas verschwommen also formuliert: »Der Mensch sei Mensch, er bilde sich seinen Zustand nach dem, was er für das Beste erkennt.« So wird der letzte Zweck der Geschichte, den[85] Herder ja freilich nur in der Glückseligkeit der einzelnen erblickt, sittliche Aufgabe des Menschen: eine an sich richtige Erkenntnis, die nur nicht, wie es in den »Ideen« geschieht, mit der naturwissenschaftlichen Darstellung dieser Geschichte vermischt werden darf.
Über den erst 1791 veröffentlichten vierten und letzten Teil der »Ideen« können wir uns kurz fassen. Er leitet zu der Geschichte des Mittelalters über, die er dann in knapper Übersicht schildert. Das Bedeutendste darin ist die außerordentlich scharfe Kritik des Christentums und seiner Hierarchie im 17. bezw. 19. und die Schilderung des Endes dieser Zeit im 20. Buche. Das Christentum erscheint, offenbar wieder unter Goethes Einfluß, in wesentlich anderer, ungünstigerer Beleuchtung als in der Bückeburger Periode. Es ist fast, als ob ein Aufklärer diesen Abschnitt geschrieben hätte. Vorangestellt wird die Person Jesu in ihrer rein menschlichen Größe. Dann aber in den stärksten Gegensatz zu der Religion Jesu die »Religion an dich« (Lessing und Kant: die Religion über Christus) gestellt, die an die Stelle »deines lebendigen Entwurfs zum Wohl der Menschen« die »gedankenlose Anbetung deiner Person und deines Kreuzes« setzte: der »trübe Abfluß deiner reinen Quelle«. Die berühmte dunkle Schilderung der mittelalterlichen Kirche, die ein Jahr später Kant zu einem anderthalb Seiten langen Satze seiner »Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« formte, wird in dem ausführlichen Kapitel des Generalsuperintendenten der evangelischen Kirche Sachsen-Weimars noch überboten. Schon in der ersten christlichen Zeit die »jüdische Dialektik« des Apostels Paulus, die Auffassung der Welt als eines großen Hospitals und der Kirche als Almosenkasse. Dann die Folgsamkeit der unmündigen Laienschaft, die endlosen elenden Lehrstreitigkeiten, die Konzile und Synoden, vielfach »eine Schande des Christentums und des gesunden Verstandes«, der »fromme Betrug« zum Prinzip erhoben, die Ausartung der Taufe in eine Teufelsbeschwörung, des Abendmahls zum »sündenvergebenden Mirakel«, zum »Reisegeld in die andere Welt«. Später das dem Geist Christi ganz fremde widersinnige Mönchs- und Nonnentum; schließlich das »zweiköpfige Ungeheuer« des Staatschristentums (das ja erst zu unseren Zeiten allmählich aus Europa zu weichen beginnt. K. V.).
Sodann wird die Vermischung des Christentums mit einem Meer andersartiger Anschauungen: der morgenländischen, griechischen, lateinischen und zuletzt dem Geiste der germanischen Barbaren verfolgt, wodurch es in der Tat jedesmal eine andere Form angenommen hat (was man bis zur Gegenwart fortsetzen könnte. Wo bleibt da das »Wesen« des Christentums? K. V.). Gewiß, er bedauert es, sein früheres Lob des Mittelalters – man denke an die Bückeburger Zeit! – einschränken zu müssen. Er erkennt auch den relativen Wert mancher hierarchischen Einrichtungen an; er weilt gern in der »schauerlichen« Dämmerung der ehrwürdigen mittelalterlichen Dome. Allein er schätzt sie im besten Falle doch nur als eine »grobe Hülse der Überlieferung«, die von der Kraft und dem überlegenden Verstand derer (die großen Päpste des Mittelalters!) zeugen, die »das Gute in sie legten«. Aber einen bleibenden Wert besitzt sie nicht: »wenn die Frucht reif ist, zerspringt die Schale«.
Und so schildert denn das letzte Buch (20) das Heraufziehen einer neuen Zeit: nach dem Rittergeist und der »heiligen Narrheit« der »tollen« Kreuzzüge das Erwachen des Handelsgeistes in den Städten Norditaliens und der Hansa, das Entstehen eines Bürgerstandes, das Aufkommen der Landessprachen, das allmähliche Wiedererstehen der Wissenschaften, die Erfindungen und Entdeckungen: kurz den Beginn einer neuen europäischen Kultur durch Betriebsamkeit, Wissenschaften und Künste. Freilich, »an eine allgemeine durchgreifende Bildung aller Stände und Völker« war damals noch nicht zu denken, und »wann wird daran zu denken sein?« »Indessen«, mit diesem tröstlichen Ausblick schließt das Werk, »geht die Vernunft und die verstärkte gemeinschaftliche Tätigkeit der Menschen ihren unaufhaltbaren Gang fort.« So ist denn doch noch etwas anderes möglich als ein Zerfallen in Einzelindividuen und deren Wohlbehagen: es gilt eine Vernunft und eine gemeinsame Tätigkeit der Menschen, die vielleicht dermaleinst eine »durchgreifende Bildung aller Stände und Völker« herbeiführen wird.
In Herders Nachlaß hat sich noch ein Entwurf für einen folgenden fünften Teil (21. bis 25. Buch) gefunden. Allein auch er führt nur bis ins siebzehnte Jahrhundert. So wäre also das Werk sowieso ein Torso geblieben. Ein vollendetes[87] geschichtsphilosophisches System wollte ja der Verfasser ohnehin nicht geben, sondern nur Ideen zu einem solchen.
In einem knappen Gesamturteil Herders »Ideen« wirklich gerecht zu werden, ist schwer. Vielleicht darf man zu seinem Lobe rühmen, daß niemand vor ihm die Menschheit »so einheitlich, so allumfassend und in so tiefen Perspektiven gesehen hat« (E. Kühnemann) oder, wenn man bescheidenere Worte vorzieht, sagen, daß er den von Leibniz zuerst zu nachdrücklicher Geltung gebrachten Entwicklungsgedanken von der Natur auf die Geschichte übertragen und sie in selbständiger Tat, übrigens auch mit großer Belesenheit und einer Fülle von Anregungen, durchgeführt hat. Diesen bedeutsamen Vorzügen stehen freilich auch bedeutende Schwächen gegenüber. Schon die ihm von manchen Kritikern als Lob angerechnete Methode, daß er die Natur als Geschichte, die Geschichte als Natur behandelt, hat doch auch eine gewisse begriffliche Verschwommenheit und Unbestimmtheit im Gefolge, die wir schon in Kants Besprechung hervorgehoben sahen. Mit seiner ganzen Art hängt auch das immer wieder hervortretende Überwiegen der Empfindung über den Verstand, des Gefühls über den Begriff; der Phantasie über die Wissenschaft zusammen.
Und ebenso die mangelnde Nachwirkung des Werks. Während Lessing, ganz männlich-kräftig in seinem Wesen, uns heute noch anzieht, so hat Herder etwas frauenhaft Weiches an sich, was den modernen Leser auf die Dauer nicht zu fesseln vermag. Ich wenigstens fühle mich, muß ich offen bekennen, außerstande, stundenlang hintereinander der oft zerfließenden und zudem heute wissenschaftlich veralteten Darstellung der »Ideen« mit Aufmerksamkeit zu folgen. Auf seine Zeit dagegen hat ihr Verfasser stark gewirkt. Nicht nur sein engerer Freundeskreis, darunter Männer von der Bedeutung eines Hamann und Goethe, sondern auch Naturforscher von dem Rang eines Blumenbach, Forster, Sömmering haben mit Begeisterung davon gesprochen. Von Philosophen haben sie besonders auf Schelling und Hegel eingewirkt, und aus uns näher liegender Zeit hat Hermann Lotze bekannt, daß sein »Mikrokosmus« eine mit den fortgeschrittenen wissenschaftlichen Anschauungen der Gegenwart begonnene Wiederholung[88] des Herderschen Unternehmens sei. Von unseren Geschichtschreibern erinnert Ranke am meisten an ihn. Aber in der heutigen Geschichtswissenschaft und im geistigen Leben der Gegenwart spielt Herders reifstes Werk keine Rolle mehr, und die realistisch-wirtschaftliche Geschichtsauffassung, wie sie Marx und Engels vertreten haben, hat ihm kaum etwas zu verdanken. Trotz alledem kann man mit einem gewissen Recht mit Gundolf Herder als »den ersten Mensch mit historischem Sinn bezeichnen, der Griechentum oder Bibelwelt, Naturvölker oder Shakespeare als geschichtliche Erscheinungen in ihrer individuellen Besonderheit und Mannigfaltigkeit faßte und darstellte«. Darin besteht sein unvergängliches historisches Verdienst.
Diejenige Schrift Herders, welche die seinen »Ideen« zugrunde liegenden philosophischen Anschauungen seiner Reifezeit vielleicht am konzentriertesten zusammenfaßt, ist das 1787 erschienene, nur wenige Druckbogen umfassende kleine Buch »Gott. Einige Gespräche«, auch wohl das Spinoza-Büchlein genannt.
Herder war philosophiegeschichtlich von Leibniz ausgegangen. Schon Magister Kants Vorlesungen hatten ihn auf diesen bis dahin größten deutschen Philosophen aufmerksam gemacht. Christian Wolff hat ihn, der fünfzehn Jahre jünger als Lessing war, schon nicht mehr beeinflußt. Dagegen studierte er mit Eifer Leibniz an der Quelle, d. h. dessen 1765 bekannt gewordene, gegen den englischen Empiristen Locke gerichtete »Neue Versuche über den menschlichen Verstand«. In Leibniz fand er den seinen eigenen Grundanschauungen verwandten Gedanken von der auf lebendige, göttliche Kräfte zurückgeführten, zweckbeherrschten Entwicklung im Reiche der Natur und des Geistes, welche beide sich zuletzt zu einer großen, vorausbestimmten Harmonie des gesamten Weltalls zusammenschließen. Damit verband er dann die damit leicht zu vereinende, ihm gleichfalls sympathische Gefühlsphilosophie des »liebenswürdigen Platos Europas«: des Engländers Shaftesbury mit seinem Optimismus und seiner, freilich die Wirklichkeiten des Lebens stark verkennenden poetischen[89] Schönheitsphilosophie, derzufolge die Schönheit und Harmonie des Alls auf das Dasein eines weisen und gütigen Weltgeistes führt. Shaftesbury aber wurde für ihn schließlich nur ein dichterischer Dolmetsch des großen Spinoza, auf den ihn, wie wir sahen, eigene Studien schon früher geleitet hatten, und der ihm dann seit 1783 durch F. H. Jacobi noch näher gebracht worden war.
Schon um die Mitte der siebziger Jahre hatte er eine Schrift über diese seine drei philosophischen »Schutzheiligen« geplant. Nun kam Lessings Bekenntnis zu der All-Eins-Lehre Spinozas und der durch Jacobi angefachte große Philosophenstreit über Lessing-Spinoza hinzu. In diesen fühlt nun auch Herder sich veranlaßt, durch seine fünf Gespräche über »Gott« einzugreifen. Das heißt: er wollte sich eigentlich nicht an dem Streit beteiligen. »Gespräche sind keine Entscheidungen, noch minder wollen sie Zank erregen, denn über Gott werde ich nie streiten,« so erklärt er von vornherein in seiner Vorrede.
Das erste Gespräch stellt eine Ehrenrettung des so lange verkannten niederländischen Weisen dar: sowohl seines Charakters als seiner Lehre. Ein Spinozist im strengen Sinne will zwar auch Theophron, der offenbar Herders Standpunkt vertritt, nicht heißen. Er gibt vielmehr eine Auslegung des Spinozismus, wie sie Herders eigener Persönlichkeit entspricht, und das bedeutet bei Herders Subjektivismus etwas noch ganz anderes als bei Lessing. Vor allem wird die ihm nicht passende streng logische Seite desselben als »kartesianische« Schlacken beseitigt, das Religiöse hervorgehoben. Spinoza ist nicht der Atheist, als den ihn haßerfüllte Gegner ausgegeben haben. Vielmehr ist die Gottheit für ihn sogar der Urquell alles Denkens und Seins, andererseits auch das Ziel alles Denkens und Fühlens. Er ist im Gegenteil, wie Herder mit Goethe sagt, der stärkste Gottesgläubige und beste Christ (theissimus et christianissimus), eher ein Schwärmer für Gottes Dasein als ein Leugner desselben zu nennen. Freilich ist dieser Gott nicht außerhalb, sondern in der Welt, die er – was freilich nicht bei Spinoza, sondern bei Leibniz steht – mit seiner alles durchdringenden Kraft erfüllt, indem er, die Urkraft, sich in unendlichen Einzelkräften auf unendliche Weisen offenbart. Und diese Urkraft stellt, wie das[90] dritte Gespräch beweisen will, zugleich die höchste Weisheit und Güte dar. Spinozas »Gott« ist für Herder gleichzeitig ein denkendes, wollendes und wirkendes Wesen. Und doch kein Gott der Willkür. Deshalb bedeutet die Naturgesetze erforschen ebensoviel als: Gottes Gedanken nachdenken. Was den Streit zwischen Jacobi und Mendelssohn betrifft, so sucht das vierte Gespräch beide Standpunkte, den der Glaubens- und der Aufklärungsphilosophie, miteinander zu verbinden. Gottes Dasein ist schon durch den gesunden Verstand erweisbar. Die einzige Richtung, gegen die er sich wendet, ohne sie ausdrücklich beim Namen zu nennen, ist der Kritizismus. Auch zustimmende Aussprüche von Dichtern aller Zeiten werden zitiert; wie denn überhaupt die Gespräche, an deren letztem auch eine Frau (Theano) – zu denken ist wohl an Karoline, Herders Gattin – teilnimmt, die Herder eigentümliche poetische Stilfärbung tragen.
Schließlich wird das Ergebnis, in dem die drei Unterredner zuletzt übereinstimmen, in zehn Sätzen formuliert. Das Wichtigste davon ist folgendes: Da Gott selbst Macht, Weisheit und Güte ist, so besitzt auch alles von ihm Geschaffene diese Eigenschaften. Alle die unzähligen Organismen sind Systeme lebendiger Kräfte, die der Weisheit, Güte und Schönheit einer Hauptkraft nach ewigen Regeln dienen. Jedes Wesen beharrt in sich selbst, vereinigt sich mit Gleichartigem, scheidet sich von Entgegengesetztem und verähnlicht sich in Abdrücken, die eine stetige Reihe bilden. Es gibt in der gesamten Schöpfung keinen Tod, sondern nur Verwandlung, keine Ruhe, sondern nur lebendiges Wirken von Kräften, die aus dem Chaos Ordnung, aus schlafenden wirkende Fähigkeiten schafft. Alles »Böse« ist nur Schranke und Gegensatz. Auch die Fehler der Menschen sind in den Augen eines verständigen Geistes gut; denn sie helfen ihm, als Kontraste, zu mehr Licht, Güte und Wahrheit.
Alles in allem, wie der Kenner sieht, in der Tat eine Vereinigung von Spinoza mit Leibniz und Shaftesbury. Von den eigentlich und naiv Frommen: Lavater, Jacobi, Matthias Claudius hatte sich Herder damit gelöst. Um so enger war der Bund mit Goethe, der Herders Büchlein zu seinem Geburtstag 28. August 1787 in Rom empfing und sich in wahrhaft begeisterter Weise darüber äußerte, da er seine eigenen[91] Gedanken darin wiederfand. Er sah in dem damit besonders verwandten dritten Teil der »Ideen« sein »liebwertestes Evangelium«, fand das neue Büchlein »voll würdiger Gottesgedanken«; er werde es in seiner »Einsamkeit noch oft lesen und beherzigen«, auch – was ja den inneren Anteil eines Lesers am besten zeigt – »Anmerkungen dazu machen, welche Anlaß zu künftigen Unterredungen geben können«. Herder aber hatte mit seinem Herzblut oder, wie er an seinen Schweizer Freund G. Müller schrieb, »mit sonderbarer innerer Überzeugung daran geschrieben«. Es enthielt, wie er sich zu Schiller äußerte, seine eigene, vollständig überzeugende Idee von Gott. Er hatte es (nach Karolinens »Lebenserinnerungen«) »mit der frömmsten Seele« verfaßt, und sie teilte beim Vorlesen des Manuskripts, wie auf gemeinsamen Spaziergängen, das Glück der Empfindungen und Vorstellungen, die Spinoza in ihm erweckt, in dem Grade, daß »Himmel und Erde ihnen neu waren«! Und als ein Göttinger Rezensent von den »bedenklichen Folgen« gesprochen hatte, die Herders Spinozismus für fromme Gemüter haben könnte, da fuhr Herder mit berechtigtem Grimme und im Vollgefühl seiner tiefreligiösen Weltanschauung los: Solche »Altweibertröstungen« seien keine Wahrheiten, »so wenig sie einen vernünftigen Menschen trösten werden«. »Die Leute wollen keinen Gott als in ihrer Uniform, ein menschliches Gabeltier, dem sie höchstens den Reichsapfel in die Hand geben; und dabei verkleistern sie sich die Vernunft, die einzige hohe Idee wahrzunehmen, die ihnen überall entgegenstrahlt, an der alles hängt und die alles, was man hoffen kann, gibt: Trost, Heiterkeit, Wahrheit, Gewißheit, ernstes, ewiges Dasein. Wer einen Tropfen dieses Wassers gekostet hat, der wird nicht dürsten in Ewigkeit.«
Altersjahre. Der Kampf gegen Kant. Tod
Herders allzufrüh zur Reife gelangtem Geist entspricht ein frühes Veralten. Man merkt es schon an der Wirkung seiner 1788/89 angetretenen italienischen Reise. Dasselbe Ereignis, das Goethe erst zur vollen Mannes- und Dichterreife entwickelte,[92] läßt bei dem erst vierundvierzigjährigen Herder, obwohl auch er sich von Jugend auf nach Italien gesehnt, bereits den Beginn des Greisentums hervortreten. Er fühlt sich durch die neuen Eindrücke weder beglückt noch gefördert. Auch die innere Differenz mit Goethe fängt wieder an sich zu regen.
Sie wird verstärkt durch Herders Enthusiasmus für die Französische Revolution. Eigentlich politisches Verständnis hat ja diese ganze gefühls- und empfindungsmäßig eingestellte Natur nie besessen. Aber er begeisterte sich anfangs mehr als die übrigen Weimarer Größen für die Erhebung des Nachbarvolkes, in der sein Humanitätsideal zum ersten Male sich ihm zu verwirklichen schien. Starke antimonarchische Äußerungen, die sogar in seinen Predigten zuweilen einen gewissen Nachhall fanden, wurden über ihn kolportiert. Er, der sonst das Recht der Tradition so hochgehalten hatte, bekannte sich jetzt in seinen »Briefen, die Humanität betreffend«, die 1792 entworfen, freilich erst später zur Ausführung kamen, zur uneingeschränkten Demokratie, der gemäß im Staate »nur ein einziger Stand, das Volk, existiert, zu dem der König sowohl als der Bauer gehört«. Die Französische Revolution erklärte er für das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte seit Völkerwanderung und Reformation. Er sieht in ihrem Gefolge – sehr unprophetisch! – ein neues Zeitalter der Literatur, Philosophie und Religion für Deutschland heraufkommen.
Allein sein Feuer ist nur ein Strohfeuer. Wie so viele andere, wie Klopstock und Wieland und leider auch – Schiller, fühlt er sich durch die Gewalttätigkeiten, die der Verlauf der Dinge in Frankreich brachte, ebenso rasch wieder abgestoßen und pflegte später zu sagen: die Revolution habe uns ein Jahrhundert zurückgebracht. Und die Humanitätsbriefe (1793 bis 1794), anfangs ein Stück Zeitgeschichte, verlieren sich immer mehr ins Breite und verwandeln sich allgemach in uferlose Betrachtungen über alle möglichen Dinge: Literatur, Kunst, Religion, Erziehung, Recht, Geschichte und Völkerkunde. Daneben gibt er in den Jahren 1794 bis 1798, zu den theologischen Interessen seiner Bückeburger Periode zurückkehrend, eine Reihe »Christlicher Schriften« heraus, auf die wir nicht weiter einzugehen brauchen.
Zu dem vorzeitigen Altern Herders tragen auch eine Reihe äußerer Umstände bei: zunehmende Kränklichkeit, finanzielle Sorgen, die durch die anwachsende und heranwachsende Familie immer drückender wurden. Vor allem aber das Gefühl steigender Vereinsamung. Schon 1788 war ihm im fernen Münster sein geliebter Hamann gestorben. Und die neuen Freundschaften, die in den neunziger Jahren kamen, wie die des jungen Jean Paul, oder das zeitweise nähere Verhältnis zu einem Vertreter der alten Generation wie Wieland, gaben ihm, abgesehen davon, daß sie vorübergehender Natur waren, keinen Ersatz: während doch gerade seine weiche Natur für die Entfaltung ihres Innenlebens von jeher der Anregung durch andere bedurft hatte.
Vor allem aber war es die endgültige Abwendung Goethes, die ihn seine Isolierung am bittersten empfinden und ihn immer grämlicher und verbitterter werden ließ: Goethes, der im Jahre 1794 seinen Geistesbund mit Friedrich Schiller schloß. Ich kann diese Ihnen ja aus der Literaturgeschichte bekannten Dinge hier nicht im einzelnen erzählen, zumal da wir auf ihre philosophische Seite eben bei Schiller und Goethe noch einmal zurückkommen werden, und begnüge mich daher mit der kurzen Zusammenfassung, daß in der geistigen Entwicklung Goethes Herder-Nähe Schiller-Ferne und wiederum Schiller-Nähe Herder-Ferne bedeutet. Gewiß, äußerlich bleibt der Bruch zunächst noch verschleiert. Im Jahre 1795 arbeiten alle drei noch gemeinsam an der vornehmsten literarischen Zeitschrift, die Deutschland wohl je besessen hat, an Schillers »Horen«, zusammen. Indes er läßt sich auf die Dauer nicht hintanhalten. Vor allem begriff Herder, der ja selbst nie ein schaffender Dichter, sondern stets nur ein feiner Nachempfinder fremder Poesie gewesen ist, den tief künstlerischen Standpunkt der beiden anderen nicht, der sie die Aufgabe der Kunst nicht in Moralpredigt und -lehre, sondern in freiem, schöpferischem Gestalten, ihren Wert nicht in irgendwelchem bürgerlichen oder erzieherischen Nutzen, sondern in der Tiefe des Schauens erblicken ließ, mit der echte Dichterkraft das Leben erfaßt. So fällt Schiller später, bei Gelegenheit einiger besonders schwacher Erzeugnisse des immerfort weiterschreibenden Herder, das scharfe Urteil: »Herder verfällt[94] wirklich zusehends, und man möchte sich zuweilen im Ernst fragen, ob einer, der sich jetzt so unendlich trivial, schwach und hohl zeigt, wirklich jemals außerordentlich gewesen sein kann.« Und Goethe erklärte ebenfalls den ihm einst so nahe Stehenden für eine »pathologische«, d. h. krankhafte Natur.
Noch einmal rafft sich dann in den letzten Jahren vor seinem Tode Herders einst so reger, jetzt müde gewordener Geist zu zwei wenigstens quantitativ größeren Leistungen auf, die beide gegen diejenige Philosophie gerichtet sind, der er seinen eigenen Rückgang in der Schätzung des Publikums zuschrieb, die kritische. Wir meinen die »Metakritik« von 1799 und die »Kalligone« von 1800. Heute ist man sich wohl in allen, auch den nicht kantfreundlichen Kreisen darüber einig, daß diese beiden ziemlich umfangreichen Schriften – die »Metakritik« umfaßte zwei, die »Kalligone« gar drei Bände – mit ihrem trockenen und geschmacklosen Stil, ihrer anmaßlichen Selbstgefälligkeit und ihrer giftig-hämischen Kritik des großen Königsberger Philosophen einen beklagenswerten Abfall von den Leistungen des jungen und des reifen Herder darstellen. Nur der Inhalt wird, zum Teil wenigstens, von einigen, z. B. dem schon von uns genannten G. Jacoby,[13] verteidigt. Wir können uns darüber kurz fassen.
Das erste Werk, die Meta-, also eigentlich Nachkritik – der Titel ist einer gleichartigen Schrift Hamanns nachgeahmt – richtet sich gegen Kants Kritik der reinen Vernunft. Aber Herder hat den Kern des Kantischen Problems überhaupt nicht verstanden. Selbst ein ihm günstig gesinnter Schriftsteller wie C. Siegel erklärt: »Herder hatte keinen Sinn und konnte keinen haben für das eigentliche Kantische Problem: er ist nicht Erkenntnistheoretiker, sondern Erkenntnispsychologe.« (S. 89.) Für den erkenntniskritischen Standpunkt Kants fehlt ihm jedes Verständnis. Man darf ihm zufolge die Natur, also auch die daraus[95] hervorgegangene Vernunft nicht kritisieren, sondern höchstens psychologisch untersuchen. Daraus erklärt sich alles Weitere. Hier und da findet sich gewiß einmal ein geistreicher, wenn auch nicht durchschlagender Gedanke, wenn er z. B. bei der ersten Antinomie Kants die Unendlichkeit des Raumes der Einbildungskraft, seine Endlichkeit dem Verstand zuschreibt. Bezeichnend für Herder wie für alle Dogmatiker (Spinoza, Schelling, Hegel!) ist auch, daß für ihn die »Gottheit« nicht das Ende, sondern den Ausgangspunkt, nicht die oberste Spitze, sondern die unantastbare Grundlage aller Erkenntnis darstellt.
Wie die Metakritik gegen die erste, so ist die 1800 veröffentlichte Kalligone gegen die dritte Kritik Kants, die Kritik der Urteilskraft, d. h. gegen den ästhetischen Teil gerichtet. Sie will also Herders ästhetische Theorie geben. Allein das »schöne Kind des Himmels«, wie er selbst den Titel verdeutscht, verdient seinen Namen keineswegs. Sie gibt höchstens bezüglich der einzelnen Künste, z. B. über ihren Zusammenhang mit den praktischen Bedürfnissen des Menschen, hier und da einen anregenden Gedanken, hat aber ebenso wie das erste Buch das Kantische Problem überhaupt nicht erfaßt, reißt vielmehr den Gegner nur einfach herunter. Schon der Grundgedanke der kritischen Methode, die begriffliche Scheidung und Abgrenzung des Nichtzusammengehörigen voneinander, z. B. die des Schönen vom bloß Angenehmen und vom Guten oder die zwischen Schönem und Erhabenem, erregt Herders Mißfallen. Er versteht nicht, was der feine Begriff der »Zweckmäßigkeit ohne Zweck« für das Ästhetische bedeutet. Er faßt einen anderen ästhetischen Grundbegriff Kants, den des freien »Spiels« der Empfindungen, den Schillers ästhetische Schriften so meisterhaft ausgelegt und weiter ausgebildet haben, einfach in dem kindischen Sinne von Willkür und Tändelei, im Gegensatz zu seinem eigenen »Ernst der Notwendigkeit«. Darüber ist natürlich kein Wort zu verlieren. Am bedauerlichsten ist, daß er, der selbst einst ein anerkannter Führer der jungen Genies der siebziger Jahre in der deutschen Literatur gewesen, jetzt nicht einmal die glänzende Bestimmung der Merkmale des Genies durch seinen einstigen Lehrer anerkennt, sondern aus reiner Oppositionslust bemäkelt.
Natürlich hat Herder in seinem engeren Kreise und darüber hinaus bei einzelnen aus der Reihe der allmählich zahlreicher gewordenen Gegner der Kantischen Philosophie, zum Teil begeisterte, Zustimmung gefunden, von der ich eine Anzahl heute nur humoristisch anmutender Beispiele in meinem kürzlich in zweiter Auflage erschienenen Buche »Kant – Schiller – Goethe« (S. 180 bis 185) gesammelt habe. Aber an den größten Zeitgenossen, an Goethe und Schiller, ging seine im Grunde nur aus ohnmächtiger Wut entsprungene heftige Opposition gegen die erkenntnistheoretischen und ästhetischen Grundlagen der kritischen Philosophie, die in Privatbriefen von geradezu abstoßenden Wendungen noch überboten wurde, ebenso wirkungslos vorüber wie an der ganzen Folgezeit. Diese letzten Schriften bilden eines der traurigsten und beschämendsten Kapitel im literarischen Lebensweg Herders, der am 18. Dezember 1803, nicht ganz zwei Monate vor Immanuel Kant, seinen letzten Atemzug getan hat.
Doch nicht mit diesem trüben Eindruck wollen wir von ihm Abschied nehmen. Sondern lieber an dasjenige denken, was er in seinen jüngeren und seinen Reifejahren für das deutsche Schrifttum und für deutsches Wesen, für eine tiefere und freiere Auffassung der Poesie und der Religion und vor allem der Natur und der Geschichte geleistet hat. Und wenn seine Verdienste um die strengere Philosophie auch nicht so groß sind wie die unserer anderen Klassiker, wenn er auch im Geistesleben unserer Gegenwart keine bedeutsame Rolle mehr spielt, so wollen wir an die edle Gesinnung denken, aus der sein bestes Wirken hervorgewachsen ist, und an den sie zusammenfassenden Wahlspruch der auch auf seinem Grabe steht und »Licht! Liebe! Leben!« lautet.
Kommt man von Johann Gottfried Herder zu Friedrich Schiller, namentlich dem jungen Schiller, so ist es einem, als sei man von einem friedlich leuchtenden Lichte geschieden und nahe sich einer hell lodernden Flamme. Schiller, der schon als sechsjähriger Knabe in Lorch gern vor seinen Geschwistern den Prediger auf der Kanzel gespielt hat, ist in Wahrheit dem ganzen deutschen Volke ein feuriger Prediger der Freiheit geworden. Darum ist er auch von jeher ein Liebling des Volkes und der Jugend gewesen. Dem tut die Tatsache keinen Eintrag, daß mancher von uns, vielleicht weil er auf der Schule mit Schillers Gedichten und Dramen gewissermaßen überfüttert worden ist, vielleicht auch, weil das unseren Dichter kennzeichnende Pathos den reifer Gewordenen von sich abstößt, eine Zeitlang seiner überdrüssig geworden ist: um so sicherer kehrt er später, wenn er, älter und reifer geworden, sich von neuem in seine Weltanschauung vertieft, dauernd und endgültig zu ihm zurück. Vor allem der, welcher im allgemeinsten Sinne des Wortes philosophisch angelegt ist. Denn Friedrich Schiller ist der philosophischste unter unseren Dichter-Klassikern.
(1779 bis 1786)
Schon als »Eleve« auf der von dem Württemberger Herzog gegründeten »Karlsschule«, welche die Söhne seiner Beamten bekanntlich zwangsweise besuchen mußten, hat der heranwachsende Knabe und Jüngling weit mehr als unsere Primaner, mehr auch als vor ihm Lessing, Kant oder Herder, von Philosophie erfahren. Wurde doch bereits der Vierzehnjährige mit sechs Wochenstunden Logik, Metaphysik und Philosophie-Geschichte, der Sechzehnjährige sogar mit nicht weniger als fünfzehn Stunden Philosophie und Rhetorik geplagt! Trotzdem, ja vielleicht eben wegen solcher Massenzufuhr philosophischen Stoffes trug dieser Unterricht, selbst unter einem so anregenden Lehrer, wie ihn die Karlsschüler zu Schillers Zeit in Professor[100] Abel bekamen, noch dazu unter dem herrschenden Zwangssystem, verhältnismäßig wenig Frucht. Die ersten philosophischen Produkte des Neunzehn- bezw. Zwanzigjährigen sind zwei dem rhetorisch begabten jungen Manne von dem alten Sünder von Herzog »gnädigst auferlegte« Lobreden zum Preise der Tugend »im Tempel der Tugend«, d. h. zum Geburtstag der freilich leidlich tugendhaft gewordenen herzoglichen Mätresse Franziska von Hohenheim. Die eine betitelt sich: »Gehört allzuviel Güte, Leutseligkeit und große Freigebigkeit im engsten Verstand zur Tugend?«, die zweite: »Die Tugend, in ihren Folgen betrachtet.« Wir gehen am besten über diese freilich schon von dem glänzenden Formtalent ebenso wie von der üppigen Phantasie ihres Verfassers zeugenden rhetorischen Stilübungen mit Schweigen hinweg.
Gedanklich höher stehen die beiden fast zur selben Zeit entstandenen medizinischen Dissertationen, die der Zwanzigjährige als Probestück seiner medizinischen Kenntnisse bei dem Abgang von der Akademie einreichen mußte. Die erste, eine »Philosophie der Physiologie«, die uns nur zu etwa einem Viertel (11 von 41 Paragraphen) erhalten geblieben ist, enthält von wirklicher Physiologie ziemlich wenig. Wurde doch auf der Akademie die Medizin fast ohne jedes Demonstrationsmaterial betrieben. Es sind eben nur phantasievolle Gedanken, die ein begabter Dilettant ohne den soliden Untergrund von genauen Fachkenntnissen oder fester Methode entwickelt. Das Urteil der Professoren tadelte an der Arbeit den »gefährlichen Hang zum Besserwissen«, der sich in der verwegenen Sprache »auch gegen die würdigsten Männer« äußere, den teils zu freien und schwulstigen, teils zu blühenden und witzigen Stil, der den Sinn oft dunkel lasse; sie wurde deshalb auch nicht zum Druck zugelassen und der Verfasser, um »sein Feuer doch ein wenig zu dämpfen«, noch zu einem weiteren Jahr Aufenthalt auf der Akademie verurteilt. Mehr Gnade fand im folgenden Jahre (1780) die in allen Ausgaben der »Sämtlichen Werke« abgedruckte Dissertation: »Über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen.« Beide Abhandlungen betreffen im Grunde das gleiche Thema: das Verhältnis zwischen Seele und Geist. In der ersten glaubt er,[101] bezeichnend für die Philosophie des reifen Schiller, in dem von dem berühmtesten Physiologen der Zeit Albrecht v. Haller angenommenen »Nervengeist« eine »Mittelkraft« zwischen Geist und Materie, Seelischem und Sinnlichem gefunden zu haben. Die zweite kommt dem Materialismus mehr entgegen.
Aber nicht in diesen Schülerarbeiten, auch nicht in der schulmäßigen Beschäftigung mit dem deutschen Popularphilosophen Garve und dem englischen Popularphilosophen Ferguson, die beide einen verdünnten Aufguß von Shaftesburys Schönheitsphilosophie darstellten, fand die Seele des jungen Philosophen ihren wahren Ausdruck. Wohl hat der englische Philosoph der Schönheit und der Harmonie des Eindrucks auf sein dichterisches Gemüt nicht ganz verfehlt. Aber weit mächtiger war der Einfluß des die ganze junge Dichtergeneration jener Tage befeuernden Jean Jacques Rousseau. In Rousseau fand nach seinem eigenen Geständnis »die Indignation« seiner in der Tyrannei der Karlsschule beständig verletzten »Menschenwürde Gehalt und Gestalt, Erfüllung und Ziel«. Seiner Verherrlichung als eines »Riesen« gegenüber den »Zwergen« seiner Splitterrichter, »denen nie Prometheus' Feuer blies«, gilt eines seiner frühesten Gedichte. Und ein späteres, in die Sammlung der »Werke« aufgenommenes begrüßt Rousseaus Grab als »Monument von unserer Zeiten Schande«, als das Grab dessen, »der aus Christen Menschen wirbt«. Rousseaus »Zurück zur Natur!« beim einzelnen und im Staat gibt überhaupt Schillers ganzer Jugendzeit das Gepräge.
Insbesondere auch seinen ersten Dramen. Denn wie Lessing in seinem »Nathan« noch einmal seine »alte Kanzel«, das Theater bestieg, so hat der junge Schiller, wie die Überschrift seines bekannten Aufsatzes zeigt, »die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet«. Gewiß, seine »Räuber« sind noch stark von religiös-biblischen Gedanken durchsetzt: wir brauchen nur an die erschütternde Schilderung des Jüngsten Gerichts in der Szene zwischen Franz Moor und dem alten Daniel zu erinnern. Und eben diesem Bösewicht Franz legt er mit Vorliebe materialistische Gedankengänge in den Mund: einmal sogar eine Stelle aus seiner eigenen Dissertation. Aber den Hauptton gibt doch Rousseaus Natur- und[102] Freiheitsbegeisterung an, Rousseaus, der ihn hingewiesen gegenüber dem »tintenklecksenden Säkulum« auf Plutarchs »große Menschen«, Rousseaus, dessen Opposition gegen die sogenannte Zivilisation sich in dem Munde seines Karl Moor erweitert zu einer Art genialen Anarchismus: »Da verrammeln sie die Natur mit abgeschmackten Konventionen … Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust und meinen Willen schnüren in Gesetze. Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus.« Freilich, zum Schluß des Dramas kommt sein Held zu einem anderen Ergebnis: »O über mich Narren, der ich wähnte …, die Gesetze durch Gesetzlosigkeit aufrechtzuhalten«, und der jetzt einsieht, daß »zwei Menschen wie ich den ganzen Bau der sittlichen Welt zugrunde richten würden«, der sich sodann ganz folgerichtig der Justiz ausliefert, um sich aufs Rad flechten zu lassen.
Aus den Gedichten des ersten Jahrzehnts greifen wir drei zur Kennzeichnung seiner weiteren philosophischen Entwicklung heraus. Zunächst die beiden einander verwandten: »Freigeisterei der Leidenschaft« (später gekürzt unter der Überschrift »Kampf«) und »Resignation«: beide aus seinem leidenschaftlichen Verhältnis zu Charlotte von Kalb entsprungen und beide nicht mit Unrecht in Franz Mehrings »Schiller« (1905) zugleich als die einzigen wirklichen Liebesgedichte Schillers bezeichnet (wenn man etwa von Theklas »Der Eichwald brauset« absieht. K. V.); denn die überspannten Oden an »Laura« können ebensowenig als solche zählen wie gelegentliche spätere Albumverse an seine Frau und andere Damen. Beide Gedichte, namentlich das zweite, zeigen eine Weltanschauung, die sich bereits der Kantischen nähert, ohne daß er Kant schon näher kennt oder gar nennt: die Kluft zwischen Pflicht und Sinnlichkeit. Im ersten bäumt sich die Sinnlichkeit auf gegen die grausame Härte des Sittengesetzes; im zweiten siegt das moralische Reich, freilich nur so, daß für den entgangenen Genuß des Diesseits die Hoffnung auf einen Lohn im Jenseits in Aussicht gestellt wird. Später sucht er die Versöhnung zwischen beiden, die Überbrückung jener Kluft.
Schon das berühmte Lied an die Freude (Ende 1788), im Kreise seiner Dresdener Freunde gedichtet, zeigt ihn in ganz anderer Stimmung und Weltauffassung. Die Freude ist es jetzt, welche die Menschen verbindet, einander gleich macht, sie zur Güte und zu Gott, dem liebenden Vater des Alls, erhebt, sie, die Urkraft und zugleich das Endziel der Natur. »Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!«, so klingt es jetzt zu uns und dringt vertiefter noch in den freudevollen Tönen von Beethovens unsterblicher Neunten – vielleicht dem Schönsten, was Musik je geschaffen hat – in unsere Seele.
(1787 bis 1790)
»Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein!« – Schiller war es gelungen: er hatte in Gottfried Körner (dem Vater Theodors) einen Freund fürs Leben gefunden. Man kann nicht leicht den Einfluß überschätzen, den Körner während des Jahrzehnts 1784 bis 1794 auf die philosophische Entwicklung des jüngeren Freundes gewonnen hat. Er spiegelt sich zunächst wider in den bis 1786 entstandenen »Philosophischen Briefen« zwischen Julius (Schiller) und Raphael (Körner).
Eingeschoben ist in sie ein wahrscheinlich schon aus Schillers Stuttgarter Zeit herrührendes Stück: die »Theosophie des Julius«, die sich in poetisch-gefühlsmäßigen Betrachtungen über das Universum als Gedanke Gottes, über unser Verstehen der anderen Geister durch Philosophie und Dichtung, über die Liebe als »allmächtigen Magnet in der Geisterwelt«, als Quelle der Andacht und erhabensten Tugend und über Aufopferung ergeht, um schließlich wieder zu der Gleichung Gott-Universum-Natur zurückzukehren. Diese ganze Art zu philosophieren wird von Julius-Schiller selbst später sehr gut dadurch charakterisiert, daß er von ihr sagt: »Mein Herz suchte sich eine Philosophie, und die Phantasie unterschob ihre Träume. Die wärmste war mir die wahre.«
Von dieser Gefühlsphilosophie hat ihn Raphael-Körner befreit. Ehe wir das schildern, müssen wir jedoch eines neuen Momentes gedenken, das gegen Ende der achtziger Jahre entscheidend[104] in Schillers geistige Entwicklung eingreift: des Griechentums. Er liest, wie er im August 1788 an Freund Körner schreibt, »fast nichts als Homer« (den er leider, weil des Griechischen unkundig, nicht an der Quelle genießen kann) und will in den nächsten zwei Jahren keine modernen Schriftsteller mehr lesen, weil sie ihn nur »von sich selbst abführen«. Er bedarf nach seinem Bekenntnis der Alten »im höchsten Grade«, um seinen eigenen Geschmack zu reinigen, ihn von Spitzfindigkeit, Künstlichkeit und Witzelei zur wahren Einfachheit, zur »Klassizität« zu führen. Der poetisch-philosophische Ertrag dieser Zeit sind vor allem die beiden großen Gedichte »Die Götter Griechenlands« (1788) und »Die Künstler« (1789).
Das erste, das übrigens, abgesehen von seinen in der Tat großen Längen, auch den Beifall des eben aus Italien zurückgekehrten Goethe bei seinem ersten Zusammentreffen mit Schiller zu Rudolstadt fand, repräsentiert zwar nicht eigentlich den antiken Geist selber; dafür ist es, um zwei spätere Schillersche Begriffe zu brauchen, zu wenig »naiv«, zu sehr »sentimentalisch« gedacht. Es ist ein Sehnsuchtslied, der Sehnsucht nach Poesie und Natur, darum gegen die bloß »mechanische« Wissenschaft gerichtet, die »knechtisch dem Gesetz der Schwere« dienende, »entgötterte« Natur:
Und nicht minder wider – das Christentum:
der statt »finsteren Ernstes und traurigen Entsagens« einzig und allein »das Schöne heilig war«.
In demselben Geiste, dem Schiller fortan treu blieb, sind »Die Künstler« gehalten, welche die Kunst an die höchste Stelle unter allen geistigen Mächten setzen, höher selbst als Erkenntnis, Moral und Religion. »Nur durch das Morgentor des Schönen drangst du in der Erkenntnis Land«, mit dem mahnenden Schlußwort an die Künstler selbst:
Die Kunst ist ihm nunmehr Anfang und letzte Vollendung der Menschenbildung. Ja, sie kann dem damaligen Schiller selbst Ethik und Religion ersetzen. »Kann man«, so schreibt im Einklang mit solcher Anschauung der todkranke Friedrich Albert Lange, dieser große Sozialist, »den christlichen Gedanken der Ergebung schöner auf philosophisch ausdrücken« als mit jenen prachtvollen Versen aus den »Künstlern«:
Noch ein weiteres Moment endlich gehört in die Entwicklung Schillers zu Ende der achtziger Jahre: das Studium der Geschichte, das er bisher fast völlig verabsäumt hatte. »Täglich wird mir die Geschichte teurer,« schreibt er am 15. April 1786 an Körner. »Ich wollte, daß ich zehn Jahre hintereinander nichts als Geschichte studiert hätte. Ich glaube, ich würde ein ganz anderer Kerl sein.« Aus diesen seinen eifrigen historischen Studien sind dann seine »Geschichte des Dreißigjährigen Krieges«, »Der Abfall der Niederlande« und einige kleinere Arbeiten hervorgegangen. Trotzdem war die Geschichtschreibung nicht das Feld, auf dem sein Geist glänzen konnte. Um Geschichtsforscher zu sein, war er zu sehr Dichter und Philosoph. Seine historischen Dramen sind vielmehr der eigentliche Spiegel seiner Geschichtsauffassung, wo es um »der Menschheit große Gegenstände« geht, geworden.
Immerhin gaben seine geschichtlichen Arbeiten wenigstens den äußeren Anlaß, ihn als Professor nach Jena zu berufen. Am 26. und 27. Mai des Revolutionsjahres 1789 eröffnete er dort sein Kolleg, dessen beide ersten Vorlesungen unter dem Titel »Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?« in Wielands »Teutschem Merkur« erschienen. In der ersten entwarf er sein Vorlesungsprogramm: er wollte nicht für »Brotgelehrte«, sondern für »philosophische Köpfe« lesen. Und so hat er sich auch[106] ferner als wahrer Professor der Philosophie in seinen Geschichtsvorlesungen bewährt.[14]
Körner, zu dem wir jetzt wieder zurückkehren, wollte darin Spuren kantischen Philosophierens spüren. Damit kommen wir zu unseres Helden allmählicher Bekehrung zu Kant, die eben unter Körners vorherrschendem Einfluß erfolgt ist, der ihm schon früh, aber anfangs »immer vergebens von Kant vorgepredigt« hatte. K. L. Reinhold zwar, der aus einem Kloster entsprungene österreichische Barnabitermönch, der in Weimar Wielands Schwiegersohn geworden war und soeben durch seine gut geschriebenen »Briefe über Kantische Philosophie« Wesentliches zur Verbreitung der neuen Lehre beigebracht hatte, hat ihn zuerst, als er im August 1787 eine Woche bei ihm wohnte, zur Lektüre einiger kleiner Aufsätze Kants in der Berliner Monatsschrift veranlaßt, unter denen ihn namentlich die »Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht« befriedigte, so daß er Körner schrieb: »Daß ich Kant noch lesen und vielleicht studieren werde, scheint mir ziemlich ausgemacht.« Bis dahin hatte Schiller überhaupt, seiner Dichternatur folgend, aus den »wenigen« philosophischen Schriften, die er gelesen, sich »nur das genommen, was sich dichterisch fühlen und behandeln läßt« (so an Körner am 15. April 1788). Aber der spießbürgerlich-ängstliche Reinhold war ihm nicht sympathisch. »Reinhold« – so lautet eine Schillers Eigenart noch weit mehr als diejenige Reinholds charakterisierende Bemerkung gegen Körner – »wird sich nie zu kühnen Tugenden oder Verbrechen, weder im Ideal noch in der Wirklichkeit (!), erheben, und das ist schlimm.« So beruht denn Schillers Wendung zur kritischen Philosophie weniger auf dem Einfluß des begeisterten neuen Kantjüngers Reinhold, der damals erklärte, daß Kant »nach hundert Jahren die Reputation (den Ruf) von Jesus Christus haben« werde, als auf dem des kritischeren Körner.
Schon in dem ersten der »Philosophischen Briefe« hatte er seinen Julius dem Raphael schreiben lassen: »Was hast Du aus mir gemacht, Raphael? Was ist seit kurzem aus mir geworden! … Ich empfand und war glücklich. Raphael hat mich denken gelehrt, und ich bin auf dem Wege, meine Erschaffung zu beweinen.« Wenn er ihn dann weiter klagen läßt: »Du hast mir den Glauben gestohlen, der mir Frieden gab; Du hast mich verachten gelehrt, wo ich anbetete«, so haben wir das letztere schwerlich auf Körner und Schiller zu beziehen.
Denn von schweren religiösen Kämpfen bei letzterem besitzen wir sonst nirgends das geringste Zeugnis, weder in seinen Tausenden von Briefen noch in seinen Werken. Aber das erstere wird zutreffen. Durch Körners Einfluß war an die Stelle der bloßen Empfindung, die sein bisheriges Philosophieren beherrschte, immer mehr das Denken getreten. Den Abschluß der »Philosophischen Briefe« nun bildet ein letzter Brief des Raphael, der wirklich von Körner an Schiller am 4. April 1788 geschrieben worden ist und, noch ohne Kants Namen zu nennen, ganz in dessen Sinne darauf hinweist, daß aller Philosophie eine anscheinend »etwas trockene Untersuchung über die Natur der menschlichen Erkenntnis« vorangehen müsse.
Schiller vermutet in seiner Antwort vom 15. April richtig, daß des Freundes Wendung von den »demütigenden Grenzen des menschlichen Wissens« eine »entfernte Drohung mit dem Kant« enthalte! Noch sträubt sich seine Dichternatur gegen diese Nüchternheit. Und äußere Hindernisse (Berufung nach Jena, Verlobung, Heirat) verhindern zunächst weiteres philosophisches Studium, auch die geplante Antwort des »Julius« auf Raphaels letzten Brief. Aber im Novemberheft 1790 der »Thalia« erscheint ein Abschnitt seiner Vorlesung über Universalgeschichte als Aufsatz unter der Überschrift »Etwas über die erste Menschengesellschaft« mit der Bemerkung: »Es ist wohl bei den wenigsten Lesern nötig zu erinnern, daß diese Ideen auf Veranlassung eines Kantischen Aufsatzes in der Berliner Monatsschrift entstanden sind.« Es war dies Kants geistreiche und durchaus allgemeinverständliche Abhandlung »Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte« (Januar[108] 1786).[15] Wenige Monate später erfolgte die entscheidende Wendung zu dem kritischen Philosophen.
(1791 bis 1795)
Das erste Bekenntnis Schillers zu Kant stammt vom 3. März 1791. Er überrascht Freund Körner mit der Nachricht, daß er sich Kants »Kritik der Urteilskraft« angeschafft habe und sie eifrig studiere. Sie »reiße ihn hin durch ihren lichtvollen, geistreichen Inhalt«, der ihm als Ästhetiker ja schon ziemlich vertraut sei, und er lerne bei dieser Gelegenheit auch die übrige Kantische Philosophie kennen. Sie erscheine ihm als kein »unübersteiglicher Berg« mehr; er hege das größte Verlangen, sich nach und nach in sie hineinzuarbeiten!
Ich will nun nicht, wie ich es im ersten Teil meines Buches »Kant – Schiller – Goethe« getan, die ganze Reihe der in den nächsten fünf Jahren entstehenden philosophischen Aufsätze Schillers in chronologischer Folge durchmustern, sondern lieber seine Philosophie im ganzen, d. i. in sachlichem Zusammenhang zu schildern versuchen. Vorausschicken möchte ich allerdings doch im folgenden eine Reihe besonders wichtiger persönlicher Bekenntnisse Schillers über seine philosophische Entwicklung in diesen Jahren. Die Titel seiner Abhandlungen werden dabei, mit einigen zwanglosen Bemerkungen dazu, von selbst erwähnt werden.
Seit Mitte Dezember 1791 war Schiller durch ein Jahresgehalt schleswig-holsteinischer Verehrer, eines Prinzen von Augustenburg und eines Grafen Schimmelmann, zum ersten Male in seinem Leben instand gesetzt, ohne Nahrungssorgen ganz seinem inneren Drange zu leben. »Ich habe endlich einmal Muße,« schrieb er seinem Körner, »zu lernen und zu sammeln und für die Ewigkeit zu arbeiten.« Und wie ernst betrieb er diese Arbeit! Er studierte – Kantische Philosophie. »Mein Entschluß ist unwiderruflich gefaßt, sie nicht eher zu verlassen, bis ich sie ergründet habe, wenn mich dieses[109] auch drei Jahre kosten könnte,« schreibt er am Neujahrstag 1792. Er hat sich kurz vorher die beiden anderen Kritiken Kants angeschafft. Und er hat Wort gehalten. So sehr, daß er sich in den folgenden drei Jahren aller dichterischen Produktion enthält, um nur endlich einmal philosophisch mit sich selbst ins reine zu kommen.
Im Januar 1792 erscheint in der »Thalia« die erste jener durch Gedankengehalt wie durch glänzende Sprache gleich ausgezeichneten Abhandlungen meist ästhetischen Inhalts, die gleichmäßig den Dichter wie den Philosophen verraten: »Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen«, im folgenden Monat eine zweite »Über die tragische Kunst«. Beide sind in streng Kantischem Geiste geschrieben. Noch im Oktober des Jahres, kurz vor Beginn seines Privatissimums über Ästhetik, »steckt er bis an die Ohren« in Kants Urteilskraft. Gegenüber Körner haben sich jetzt die Rollen umgetauscht: Schiller ist jetzt der eifrigere Kantianer, der den Freund kritisch zurechtweist. Auch in Kants theoretische Philosophie hat er jetzt einzudringen begonnen. Aus einem großen Briefe vom 18. Februar 1793 stammt sein begeistertes Bekenntnis: »Es ist gewiß von einem sterblichen Menschen kein größeres Wort noch gesprochen worden als dieses Kantische, was zugleich der Inhalt seiner ganzen Philosophie ist: Bestimme dich aus dir selbst! Sowie das in der theoretischen Philosophie: Die Natur steht unter dem Verstandesgesetz.« Und an seinen nach Bonn übergesiedelten jungen Freund Fischenich schreibt er fast zur selben Zeit auf die frohe Kunde hin, daß Kants Philosophie dort bei Lehrern und Lernenden gute Aufnahme finde: »Bei der studierenden Jugend wundert es mich übrigens nicht sehr, denn diese Philosophie hat keinen anderen Gegner zu fürchten als Vorurteile, die« – ach, könnte man das von der heutigen studierenden Jugend doch auch sagen! – »in jungen Köpfen doch nicht zu besorgen sind.« Die neue Philosophie sei zudem, fügt er am 20. März desselben Jahres hinzu, viel poetischer als die Leibnizsche und habe einen weit größeren Charakter!
In »Anmut und Würde« (Februar 1793), die zum ersten Male Schillers eigene ästhetische Theorie, wenn auch[110] nur als eine Art Vorläufer der »Ästhetischen Briefe« entwickelt, wendet er sich zum ersten Male in seinen Schriften ausdrücklich an den »unsterblichen Verfasser der Kritik«, dem der Ruhm gebühre, »die gesunde Vernunft aus der philosophierenden wiederhergestellt zu haben«, und unter dem die Moral »endlich aufgehört habe, die Sprache des Vergnügens zu reden«. Freilich der Zustimmung folgen jetzt auch die Einwände, die unsere systematische Darstellung später zu schildern haben wird. Im folgenden Jahre (1794) kam dann Kant, der übrigens schon im Jahre 1789 durch einen gemeinsamen Bekannten dem Dichter einen Gruß hatte zugehen lassen, in der zweiten Auflage seiner »Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« in einer neu hinzugefügten Anmerkung (S. 22 meiner Ausgabe) ausführlich und in sehr freundlicher Weise auf Schillers Einwände gegen ihn zurück, was den letzteren natürlich mit großer Freude erfüllte.
Im März und April erschien weiter die Abhandlung »Vom Erhabenen« in zwei Teilen, deren erster später (1801) in einer umgearbeiteten, von Kant stärker abweichenden Gestalt unter dem Titel »Über das Erhabene« in die Sammlung seiner »Kleinen prosaischen Schriften« aufgenommen wurde, während der zweite die Überschrift »Über das Pathetische« erhielt. Sehr kantisch sind auch die vom Februar 1793 bis Anfang 1794 an den Prinzen von Augustenburg gerichteten zehn Briefe gehalten. Kants Philosophie, heißt es z. B. im ersten dieser Briefe, »die sich so oft nachsagen lassen müsse, daß sie nur immer einreiße und nichts aufbaue« – was man bekanntlich auch so und so oft vom Sozialismus behauptet hat –, sei so fruchtbar, daß sie die festen Grundsteine zu einem System der Ästhetik darbiete. Und der zweite unterscheidet das eigentliche Gebäude (Kants) von dem »Gerüst«, das die Handwerker (die Kantianer) darum gelegt. Im sechsten, zu Anfang Dezember 1798 verfaßten bekennt er, daß er »im Hauptpunkte der Sittenlehre vollkommen kantisch denke«.
Das Jahr 1794 bringt am gleichen Tage (13. Juni) die Einladung zur Mitarbeit an den »Horen« an Goethe und – Kant nebst einem dankbar bescheidenen Begleitschreiben an den letzteren, der freilich erst am 1. März des folgenden Jahres mit[111] nicht allzu großem Verständnis seinem berühmtesten Jünger erwidert hat. Wieder läßt dieser im Sommer 1794 eine Zeitlang »alle Arbeiten liegen, um den Kant zu studieren«. Er steht jetzt auf dem Höhepunkt seiner Abwendung von der Poesie, so daß ihm sogar vor der Arbeit am eigenen Entwurf zu seinem »Wallenstein« graut (!), »denn ich glaube mit jedem Tage mehr zu finden, daß ich eigentlich nichts weniger vorstellen kann als einen Dichter (!)« – eine seltsame, aber für diese Zeit bezeichnende Selbsttäuschung –, »und daß höchstens da, wo ich philosophieren will, der poetische Geist mich überrascht«! Er habe »im Poetischen seit drei oder vier Jahren« – also genau seit seiner Wendung zur kritischen Philosophie! – »einen völlig neuen Menschen angezogen«. Vor allem aber gibt er in einem bedeutsamen Briefe vom 28. Oktober dieses Jahres dem neugewonnenen Freunde Goethe gegenüber seinem »Kantischen Glauben« einen so lebendigen Ausdruck, daß wir seine Sätze wörtlich hierhersetzen müssen: »Die Kantische Philosophie übt in den Hauptpunkten selbst keine Duldung aus und trägt einen viel zu rigoristischen (strengen) Charakter, als daß eine Akkomodation (Anpassung) mit ihr möglich wäre. Aber dies macht ihr in meinen Augen Ehre, denn es beweist, wie wenig sie die Willkür vertragen kann. Eine solche Philosophie will daher auch nicht mit bloßem Kopfschütteln abgefertigt sein. Im offenen, hellen und zugänglichen Felde der Untersuchung erbaut sie ihr System, sucht nie den Schatten und reserviert dem Privatgefühl nichts, aber so, wie sie ihre Nachbarn behandelt, will sie wieder behandelt sein, und es ist zu verzeihen, wenn sie nichts als Beweisgründe achtet. Es erschreckt mich gar nicht zu denken, daß das Gesetz der Veränderung, vor welchem kein menschliches und kein göttliches Werk Gnade findet, auch die Form dieser Philosophie sowie jede andere zerstören wird; aber die Fundamente derselben werden dies Schicksal nicht zu fürchten haben, denn so alt das Menschengeschlecht ist und solange es eine Vernunft gibt, hat man sie stillschweigend anerkannt und im ganzen danach gehandelt.«
Im Jahre 1795 endlich erscheint die philosophische Hauptschrift Schillers, seine »Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen«, die Goethe »wie einen[112] köstlichen, seiner Natur analogen Trank« hinunterschlürfte, und die gleichzeitig auch Kant »vortrefflich« fand. Lagen ihnen doch nach Schillers eigenem Bekenntnis »größtenteils Kantische Grundsätze« zugrunde. Wie denn überhaupt »über diejenigen Ideen, welche in dem praktischen Teil des Kantischen Systems die herrschenden sind, nur die Philosophen entzweit, die Menschen von jeher einig gewesen« seien. Schade, daß der einundsiebzigjährige Kant nicht mehr zu der von ihm geplanten Besprechung der »Ästhetischen Briefe« gekommen ist, zu der er sich schon Notizen gemacht hatte, die ich zuerst in dem Nachlaßwerk des großen Königsbergers entdeckt habe (vergl. »Kant – Schiller – Goethe«, S. 36, Anmerkung). Wie sehr übrigens damals Kants Philosophie in alle möglichen Kreise eingedrungen war, davon gibt der Schillersche Briefwechsel dieser Zeit zwei hübsche Belege. Nach einer Mitteilung Goethes wurden Kantische Ideen von Künstlern in allegorischen Bildern dargestellt. Und Schillers »Ästhetische Briefe« wurden zusammen mit Kants und Reinholds Schriften von einem Zirkel – preußischer Husarenoffiziere, die am Rhein gegen die Franzosen zu Felde lagen, eifrig studiert, demselben Kreise, in dem später auch Schillers prächtiges Reiterlied aus »Wallensteins Lager« »mit Enthusiasmus gesungen« wurde.
Neben dem umgearbeiteten Aufsatz »Über das Erhabene« (S. 110) erschien dann Ende 1795 und Anfang 1796 in den »Horen« als letzte ästhetische Abhandlung Schillers die »Über naive und sentimentalische Dichtung«, die für ihn eine »Brücke« zu der über dem Philosophieren der letzten Jahre gänzlich zurückgetretenen »poetischen Produktion« darstellen sollte. Diese regt sich nun endlich wieder, und zwar, gewissermaßen zum Abschied von seiner philosophischen Epoche, in jenen philosophischen Gedichten, die eine Vereinigung von tiefstem Gedankengehalt mit schwungvoller, formvollendeter Sprache darstellen, wie sie seit Platos Tagen nicht dagewesen war und vielleicht nur von Nietzsche, wenigstens was die formale Seite betrifft, wieder erreicht worden ist. Philosophische Lektüre und Erörterungen über sie, namentlich mit dem neugewonnenen Freunde Goethe, der jetzt immer mehr an die Stelle Körners tritt, kommen zwar auch in Zukunft noch vor, sind aber nicht mehr das Ausschlaggebende. An[113] den Grundgedanken der kritischen Philosophie hat er auch in diesem seinem letzten Lebensjahrzehnt, sowohl gegenüber den älteren Gegnern Kants (Herder und seinem Kreis) als auch den neuesten, über ihn hinausgewachsen sich dünkenden (Fichte, Schelling, der Romantik überhaupt) festgehalten. Wir wenden uns nun einer zusammenhängenden systematischen Betrachtung von Schillers Philosophie zu, soweit eine solche möglich ist.
Die erste Aufgabe der Philosophie muß eine methodische sein: reinliche Scheidung der drei Gedankenwelten, die dem Erkennen, dem Wollen und der schaffenden Phantasie in unserer Seele entsprechen und seit Platos Zeiten unter den populären Namen des Wahren, Guten und Schönen jedem von uns bekannt sind; mit anderen Worten: der Wissenschaft, Sittlichkeit und Kunst. Dieser von Kant an den Anfang aller philosophischen Arbeit gestellten methodischen Scheidung stimmt auch Schiller sogleich in seiner ersten ästhetischen Abhandlung »Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen« zu. Auch er will die Kunst von ihren »ernsteren Schwestern« unterscheiden: der durch den Verstand geleiteten Wissenschaft, der durch die Vernunft geleiteten Sittlichkeit. Ebenso hat er von Kant gelernt, daß der »Transzendental«-, also der kritische Philosoph »sich keineswegs dafür ausgibt, die Möglichkeit der Dinge selbst zu erklären, sondern sich damit begnügt, die Kenntnisse festzusetzen, aus welchen die Möglichkeit der Erfahrung begriffen wird« (19. ästhetischer Brief). Er hat ferner den idealistischen Kern von Kants Philosophieren wohl erfaßt, wenn er dessen ganze theoretische Philosophie in den Satz zusammenfaßt: »Die Natur steht unter dem Verstandesgesetz«, demnach weiß, daß die sogenannten Naturgesetze von unserem Verstand selbst gefunden und »gemacht« werden. Und er hat in seiner ersten großen und folgenreichen philosophischen Unterredung mit Goethe, die wir bei diesem noch näher kennenlernen werden, auch den grundlegenden[114] Unterschied zwischen Erfahrung und Idee in seiner ganzen Tiefe begriffen.
So hat sich Schiller auch theoretisch auf den Boden der kritischen Philosophie gestellt. Allein für die genauere Aus- und Durchbildung dieser allgemeinen Grundgedanken, für die Philosophie der Wissenschaft hat er sich, wohl schon infolge seiner Dichternatur, weniger interessiert. Stand er doch namentlich den sichersten und exaktesten Wissenschaften, die in Kants System eine so große Rolle spielen, der Mathematik und der mathematischen Naturwissenschaft, ziemlich fremd gegenüber. Kants Philosophie ist ihm vielmehr in erster Linie »geläuterte Lebensphilosophie« gewesen. Er würde daher wohl auch den bekannten Satz Fichtes unterschrieben haben: »Was für eine Philosophie man wähle, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist.«
Jedenfalls ist sein stoffliches Interesse in der Philosophie in erster Linie auf deren praktischen Teil, d. h. auf die Ethik und Ästhetik gerichtet; daneben werden wir seine politisch-philosophischen Gedanken und seine, freilich stark in den Hintergrund tretende, Religionsphilosophie zu betrachten haben.
Die Ethik oder wissenschaftliche Lehre der Sittlichkeit hat sich allezeit vor ihrer Vermischung mit dem Gefühl zu hüten gehabt. So eng auch jedes sittliche Wollen mit einem Gefühl, sei es der Kraft oder der Freiheit, sei es der Lust oder auch der Unlust, verbunden ist: es darf nicht davon abhängig sein. Gewiß, ohne die Wärme und Weichheit des Gefühls erscheint der Wille, und gerade der reinste und energischste am meisten, hart und kalt; man spricht dann von einem eisernen oder rauhen Willen, von starren, kalten, nüchternen Grundsätzen. Ebenso wie man von bitteren oder grausamen Wahrheiten redet, wenn sie langgehegte Lieblingsträume zerstören. Und so drängt sich denn echt menschlich das Lustgefühl – am verlockendsten in seinen feinsten Gestalten, den geistigen Freuden und religiösen Gefühlen – an das reine, sittliche Wollen mit einer fast unwiderstehlichen Macht heran, sucht ihm die Reinheit und Selbständigkeit zu rauben, die als etwas Eingebildetes,[115] Hohles, Unwirkliches hingestellt wird, das sich der lebendigen Wirklichkeit der Gefühle beugen müsse. Oder auch es zu überbieten, zur moralischen oder religiösen Schwärmerei zu übertreiben, der auch der Schlaffste zuweilen gern sich hingibt, um nur, wie Lessing seinen Nathan sagen ließ, »gut handeln nicht zu dürfen«. Diesem Andringen des Gefühls und damit der Gefährlichkeit einer bloßen Lust- oder Glückslehre gegenüber, die schließlich von den individuellen und beliebigen Gefühlen jedes einzelnen abhängt, muß die Ethik ihre Selbständigkeit zu wahren bestrebt sein, auf die Gefahr hin, als »rigoristisch«, d. h. überstreng verschrien zu werden.
Das ist denn auch der Kantischen Ethik, welche diese Züge trägt, bis zum heutigen Tage oft genug, ja meist begegnet. Und es heißt gewöhnlich, das philosophische Verdienst Schillers bestehe darin, den schroffen, sittlichen »Rigorismus« Kants »ästhetisch gemildert« zu haben. Wir sind anderer Meinung, und wir können uns auch nicht der Ansicht Kuno Fischers (allerdings nur in der ersten Auflage seines »Schiller als Philosoph«) anschließen, daß unser Dichter-Philosoph den ästhetischen Gesichtspunkt anfangs unter, dann neben, zuletzt aber über den moralischen gestellt habe. Er hat vielmehr nicht bloß in den ersten Zeiten seiner Kantbegeisterung, sondern auch später Kants ethischen »Rigorismus« in dem von uns bezeichneten methodischen Sinne durchaus gebilligt.
So behauptet er dem anders gearteten Goethe gegenüber in seinem großen Bekenntnisbrief vom 28. Oktober 1794, daß der »rigoristische« Charakter der kritischen Philosophie ihr in seinen Augen gerade Ehre mache. Und dem Gefühlsphilosophen Schlosser, Goethes Schwager, der Kants strenge Methode angegriffen hatte, liest er in einem Briefe an Goethe vom 9. Februar 1798 gründlich genug den Text. Es sei unverzeihlich, »daß ein Schriftsteller, der auf eine gewisse Ehre hält, auf einem so reinlichen Feld«, wie es das philosophische durch Kant geworden sei, »so unphilosophisch und unreinlich sich betragen darf«. Er und Goethe wüßten doch auch, daß der Mensch auf der höchsten Stufe seiner seelischen Tätigkeit selbst als ein »verbundenes Ganze« handle; darum würde es ihnen aber doch niemals einfallen, dem Zergliedern und Unterscheiden, »worauf alles Forschen beruht«, in der Philosophie den[116] Krieg zu machen, wie ja auch der Chemiker die Synthesen der Natur absichtlich und künstlich aufhebe. Aber »diese Herren Schlosser« wollen sich auch durch die Metaphysik hindurch »riechen und fühlen«, wollen »das Physische vergeistigen und das Geistige vermenschlichen«. Und bald darauf, am 2. März, wird auch die Anwendung auf Ethik und Ästhetik gemacht. Es sei bemerkenswert, daß »die Schlaffheit über ästhetische Dinge immer sich mit der moralischen Schlaffheit verbunden zeigt«, und daß umgekehrt »das reine Streben nach dem hohen Schönen«, also reine und strenge Ästhetik, bei aller Duldsamkeit gegen die menschliche Natur, dennoch »den Rigorismus im Moralischen, mithin reine und strenge Ethik« mit sich führen werde.
Die Entgegensetzung von Sinnlichkeit und Sittlichkeit, das »Heroische« (Kühnemann), lag ja eigentlich von Anbeginn in Schillers Natur. Schon die Schulrede des Neunzehnjährigen hatte den stoischen Gedanken vertreten, daß das Sittliche im Kampfe sich am besten bewähre. Wir erinnern ferner an die Gedichte »Kampf« und »Resignation« (S. 102). Auch in seinen ästhetischen Abhandlungen tritt sie von Anfang an hervor. Gleich in der ersten vom Januar 1792 finden sich Gedanken wie: Das Prinzip der Sittlichkeit erfordert eine von jeder Naturkraft, also auch von moralischen Trieben unabhängige Vernunft; das sittliche Verdienst nimmt in umgekehrtem Grade ab, wie Lust und Neigung zunehmen; das höchste moralische Vergnügen wird jederzeit von Schmerz begleitet sein. Ebendeshalb seine Vorliebe für die Tragödie! Aber die gleiche methodische Anschauung bleibt auch späterhin herrschend. Wir verweisen auf die zahlreichen Belegstellen in unserem »Kant – Schiller – Goethe« und heben hier nur die wichtigsten hervor.
In dem noch nicht von uns erwähnten Aufsatz »Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen« erklärt er, daß die moralische Bestimmung des Menschen »völlige Unabhängigkeit des Willens von allem Einfluß sinnlicher Antriebe erfordere«, während die, noch heute von so vielen Über-Modernen verkündete, ästhetische Moral die »große Gefahr« in sich berge, daß der Ernst der moralischen Gesetzgebung sich nach dem Interesse der Einbildungskraft richte und so – ein Kantischer Ausdruck! – »die[117] Sittlichkeit in ihren Quellen vergiftet« werde. Die Sinnlichkeit wird als der »natürliche innere Feind aller Moralität« bezeichnet (»Über den moralischen Nutzen ästhetischer Sitten«), vor dem wir uns in die heilige Freiheit der Geister (»Über das Erhabene«) in die unbezwingliche Burg unserer moralischen Freiheit (»Über das Pathetische«), in den heiteren Horizont der sittlichen Ideen (»Über die tragische Kunst«), in die Freiheit der Gedanken (»Ideal und Leben«) flüchten müssen. Ja, der letzte (24.) der »Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen«, die doch gewiß den ästhetischen Gesichtspunkt so hoch wie möglich stellen, bezeichnet ausdrücklich »alle … Glückseligkeitssysteme, sie mögen den heutigen Tag oder das ganze Leben oder, was sie um nichts ehrwürdiger macht, die ganze Ewigkeit zu ihrem Gegenstand haben«, als »bloß« einem »Ideal der Begierde« entsprungen, »mithin einer Forderung, die nur von einer ins Absolute strebenden Tierheit kann aufgeworfen werden«. Hier wird sogar Kants »Rigorismus« von dem Dichter-Philosophen noch übertroffen!
Kurz, wir dürfen als das Ergebnis dieser Erörterungen über Schillers Stellung zu Kants reiner Ethik seinen Satz aus »Anmut und Würde« bezeichnen: »Über die Sache selbst kann nach den von Kant geführten Beweisen unter denkenden Köpfen, die überzeugt sein wollen, kein Streit mehr sein, und ich wüßte kaum, wie man nicht lieber sein ganzes Menschensein aufgeben, als über diese Angelegenheit ein anderes Resultat von der Vernunft erhalten wollte.«
Freilich, das ganze und volle Menschentum ist mehr als bloße Ethik. »Die menschliche Natur«, sagt der Dichter in Schiller, »ist ein verbundeneres Ganze in der Wirklichkeit, als es dem Philosophen, der nur durch Trennen etwas vermag, erlaubt ist, sie erscheinen zu lassen.« Die reine Ethik, das hat Schiller nirgends verhehlt, bedarf in ihrer Anwendung auf den wirklichen, vollen Menschen einer Ergänzung nach der Seite des Gefühls. Diese Gefühlsergänzung kann auf zweierlei Weise erfolgen: durch die Ästhetik und durch die Religion. Die letztere Lösung hat er nur angedeutet, die erstere dagegen, die seiner Dichternatur zumeist am Herzen lag, in breiter Ausführung gegeben. Ihr wenden wir uns zunächst zu.
Wenn strenge methodische Scheidung der verschiedenen Richtungen menschlichen Bewußtseins auch die erste Aufgabe einer Philosophie als Wissenschaft ist, so darf es doch dabei nicht sein Bewenden haben. Wenn und nachdem Selbständigkeit und Eigentümlichkeit der einzelnen Gebiete durch ihre methodische Isolierung gesichert sind, können, ja müssen nunmehr die Verbindungsbrücken geschlagen werden. Das verbindende Element aber, das zunächst ferngehalten werden mußte, damit sie, damit Wissenschaft, Sittlichkeit und Kunst ihre Reinheit nicht verloren, ist das Gefühl. Ein Sittenwesen ohne Gefühl wäre ein leerer Schemen ohne Fleisch von unserem Fleisch und Blut von unserem Blut. Und mag es auch das Vorrecht des Dichters sein, diesen »Quell aus verborgenen Tiefen« in seiner ganzen Allgewalt darzustellen, so ist es doch nicht, wie Schiller einmal sagt, »die Dichtung beinahe allein, welche die getrennten Kräfte der Seele wieder in Vereinigung bringt, welche … gleichsam den ganzen Menschen in uns wiederherstellt«. Die Philosophie hat vielmehr dasselbe Interesse daran. Ist doch ohne das Gefühl keine Anwendung des durch die rein formale Methode gefundenen obersten Sittengesetzes auf den wirklichen Menschen, dies sinnlich-vernünftige Mischwesen, kurzum keine angewandte Ethik möglich. Schon indem wir es als Triebfeder unseres Handelns denken, wird notwendig ein Gefühl mitgedacht. Dadurch nun, daß die Sittlichkeit gefühlt wird, tritt sie in den Bereich der Ästhetik. Die beiden ästhetischen Grundbegriffe aber, wenigstens zu Kants und Schillers Zeiten, waren das Erhabene und das Schöne.
Die Form, unter der das Sittliche unserem Gefühl zunächst erscheint, ist das
Mit Recht konnte Kant unserem Dichter an jener einzigen Stelle, wo er ihn in seinen Schriften behandelt hat,[16] zurufen: daß das Gefühl des Erhabenen unserer eigenen Bestimmung[119] »uns mehr hinreiße als alles Schöne«, und daß Herakles »erst nach bezwungenen Ungeheuern« in den Olymp emporsteige, um hier Führer der Musen zu werden. Wem konnte eine solche Lehre sympathischer sein als Schiller, dem »Prediger der Freiheit«, wie Goethe ihn einmal, in bewußtem Gegensatz zu sich selber, charakterisiert. Und wenn derselbe Goethe an anderer Stelle von dem toten Freunde sagt: »Die Kantische Philosophie, die den Menschen so hoch erhebt, indem sie ihn einzuengen scheint, hatte er mit Freuden in sich aufgenommen«, so hatte er gerade dasjenige mit einem treffenden Worte gekennzeichnet, was die Ähnlichkeit beider Persönlichkeiten, die auch Körner auffiel, ausmacht, die auf ihrem vorzugsweise sittlichen Charakter beruht. Daher auch Schillers Vorliebe für die Tragödie, deren Begriff er ausdrücklich aus der Lust am moralisch Zweckmäßigen abgeleitet und im Zusammenhang mit dem Erhabenen entwickelt hat. Goethes Lieblingscharaktere (wir denken dabei etwa an Gretchen und Klärchen, Egmont und Faust) handeln nach dem Affekt, sagt Gervinus einmal, diejenigen Schillers (Verrina, Posa, Max Piccolomini) nach dem kategorischen Imperativ der Pflicht.
Dieser Grundrichtung des Dichters Schiller, im Sittlichen den würdigsten Stoff für die vollendete Kunstform zu suchen, entspricht auch sein philosophisches Verhalten. Wie stark er gerade von Kants Begriff des Erhabenen gepackt wurde, beweist schon die äußere Tatsache, daß die Mehrzahl seiner ästhetischen Aufsätze mit ihm, und zwar vorzugsweise dem Sittlich-Erhabenen, sich beschäftigt. Die beiden Abhandlungen über das Tragische, die beiden Vom und Über das Erhabene, der größte Teil der »Zerstreuten Betrachtungen über verschiedene ästhetische Gegenstände«, der zweite Teil von »Anmut und Würde« gehören hierher: während der Entwicklung des Begriffs des Schönen eigentlich nur die »Anmut« und die »Ästhetischen Briefe« dienen, die hier nicht genannten Aufsätze aber beide Begriffe ungefähr gleich stark berücksichtigen. Wir begnügen uns daher vorläufig mit diesen kurzen Ausführungen, zumal da wir später noch einmal auf die Vereinigung beider zurückzukommen haben.
Schon im Erhabenen liegt, wie widerspruchsvoll es im ersten Augenblick auch klingen möge, das Schöne verborgen.[120] Denn in das demütigende Gefühl unserer Unterwerfung unter das Sittengesetz mischt sich bereits ein Gefühl des Stolzes und der Lust darüber, daß wir selbst in unserem eigenen Inneren die Idee dieses obersten Gesetzes unseres Handelns erzeugt haben, daß wir somit unsere eigenen Gesetzgeber (»autonom«), daß es unsere eigene Persönlichkeit, unser »besseres Selbst« ist, dem wir nach Kant im »freien Selbstzwang« gehorchen. Jetzt steht das Göttliche, d. i. das Gute, nicht mehr in feierlicher Majestät vor unseren Augen, sondern es steigt hernieder von seinem Weltenthron in die Tiefe unseres Herzens.
Nunmehr werden Sittlichkeit und »Natur« einander vermählt, die Natur ist sittlich geworden und das Sittliche erscheint als Natur: beide zusammen machen erst den ganzen vollendeten Menschen aus. Das ist das Ideal des
das zwar, wie wir an anderem Orte nachgewiesen haben, bei Kant nicht völlig fehlte, aber erst von Schiller in seiner ganzen Herrlichkeit uns vor Augen gestellt worden ist. Es erinnert an das altgriechische »Schön-und-Gute«, aber die dort – außer bei Plato – und dann wieder in der Renaissance hervortretende Vermischung beider ist jetzt vermieden, die unbewußte Naivität vertieft durch das sittliche Bewußtsein. Die Kultur soll uns – ein von Kant übernommener Gedanke! – auf dem Wege der Vernunft und Freiheit zurückführen zur wahren und echten Natur und Menschlichkeit: ein Gedanke, der übrigens in der ganzen, von Rousseau durchtränkten Zeit liegt und dem wir ja auch bei Herder begegneten.
Wie der Gegensatz, so lag auch das Streben nach einer Harmonie zwischen Sinnlichkeit und Sittlichkeit von Anfang an in Schillers Natur. Wir haben es schon in seiner »Philosophie der Physiologie«, in seinem Begriff der »Mittelkraft« kennengelernt. Und ebenso klingt es aus zahlreichen Gedichten, dramatischen Stellen und Briefen wieder. Von seinen philosophischen Abhandlungen behandelt »Anmut[121] und Würde« eben dieses Problem. Die sinnliche Natur des Menschen, heißt es hier, ist seiner »reinen Geistesnatur« beigesellt nicht als Last, die er abwerfen, oder als »grobe Hülle«, die er abstreifen soll – wie es oft genug mystische Verzückung oder mönchische Askese gefordert und zu üben versucht hat –, sondern »um sie aufs innigste mit seinem höheren Selbst zu vereinbaren«. An dieser Stelle glaubt er denn auch zum ersten Male Kant entgegentreten zu müssen, dessen Moralphilosophie »die Idee der Pflicht mit einer Härte vorgetragen habe, die alle Grazie davon zurückschreckt und einen schwachen Verstand leicht versuchen könnte, auf dem Wege einer finsteren und mönchischen Asketik die moralische Vollkommenheit zu suchen«. Sicherlich würde eine solche »Mißdeutung« dem »heiteren und freien Geist« des »großen Weltweisen« unter allen »die empörendste« sein; indes habe doch er selbst durch die »strenge und grelle Entgegensetzung« beider Prinzipien (Pflicht und Lust) einen »starken, obgleich bei seiner Absicht vielleicht kaum zu vermeidenden Anlaß dazu gegeben«.
Schon die beschränkenden Zusätze zeigen, daß er Kant persönlich in Schutz nehmen will, der überdies die teils in »grobem Materialismus«, teils in »nicht weniger bedenklichen Perfektionsgrundsätzen« (»Vervollkommnungs«-Moral) aufgehende Zeitmoral unnachsichtlich habe angreifen und deshalb der harte »Drako« seiner Zeit habe werden müssen, weil sie ihm des weisen und milden »Solon« »noch nicht wert und empfänglich schien«. Aber, fährt er fort, »womit hatten es die Kinder des Hauses verschuldet, daß er nur für die Knechte sorgte?« Weil der moralische Weichling dem Gesetz der Vernunft gern eine Laxheit geben möchte, die es zum Spielball seines Beliebens macht, mußte ihm deshalb eine Starrheit beigelegt werden, welche »die kraftvolle Äußerung moralischer Freiheit nur in eine rühmlichere Art von Knechtschaft verwandelt«? Wir wollen hier nicht näher auf Kants Verteidigung eingehen, der gerade auf diesen Punkt in seiner »Religion innerhalb usw.« erwiderte und auch seinerseits eine frohe und mutige, nicht ängstlich-sklavische Gemütsstimmung als das der Tugend eignende Temperament angesehen wissen wollte. Inwieweit auch er das Sittlich-Schöne anerkennt,[122] haben wir an anderem Orte (»Kant – Schiller – Goethe«, S. 94 bis 107) ausführlich dargelegt. Hier haben wir es nur mit Schillers Entwicklung der sittlichen Schönheit zu tun, die sich auf die Beschaffenheit des Menschen als »vernünftig-sinnlichen Wesens« gründet.
Nach Schiller muß des Menschen sittliche Denkart aus seiner »gesamten« Menschheit hervorquellen, sie muß ihm zur Natur geworden sein. Denn »der bloß niedergeworfene Feind kann wieder aufstehen, aber der versöhnte ist wahrhaft überwunden«. Hiergegen läßt sich meines Erachtens der Einwand machen, daß der wirkliche Mensch, wie er ist, mit allen seinen Schwächen, eben immer wieder jenes »Aufstehens« bedarf, weil er das Ideal der »schönen Seele«, die Schiller als das »Siegel der vollendeten Menschheit« preist, in der Tat nie erreicht. Wie denn Schiller selbst am Anfang des Abschnitts über »Würde« zugesteht, daß jene »Charakterschönheit, die reifste Frucht seiner Humanität, bloß eine Idee« ist, »welcher gemäß zu werden er mit anhaltender Wachsamkeit streben, aber die er bei aller Anstrengung nie ganz erreichen kann«. Also ist doch auch die schöne Seele bloß ein schönes Ideal, und es ist vom methodischen Standpunkt aus gesehen sogar gefährlich, wenn Schiller in diesem Zusammenhang zugunsten der Sinnlichkeit anführt, sie erst leihe dem sittlichen Menschen »das ganze Feuer ihrer Gefühle« zu dem »Triumph, der über sie selbst gefeiert wird«. Denn was ist nicht schon alles in der Weltgeschichte, namentlich in Religion und Politik, mit dem »Feuer der Gefühle« gerechtfertigt worden!
Aber ein tiefer und schöner Gedanke liegt sicher im Begriff der »schönen Seele«, nämlich, daß der Mensch »nicht dazu bestimmt ist, einzelne sittliche Handlungen zu verrichten, sondern ein sittliches Wesen zu sein«, wie Schiller es in dem bekannten Doppelvers ausgedrückt hat:
Eine solche Seele weiß auch gar nicht um ihre eigene Schönheit: »mit einer Leichtigkeit, als wenn bloß der Instinkt (!) aus ihr handelte« – freilich wieder ein gefährlicher Vergleich –, »übt sie der Menschheit peinlichste Pflichten aus«.[123] Die Sinnlichkeit sieht jetzt nicht mehr am Vernunftgesetz schwindelnd empor, sondern der Gesetzgeber selbst, nämlich der »Gott in uns«, hat sich zum Sinnlichen herabgeneigt und sieht sich befriedigt durch »die Übereinstimmung des Zufälligen der Natur mit dem Notwendigen der Vernunft«. Das in dem aus Lust und Unlust gemischten Gefühl der Achtung angespannte Gemüt kommt zur Auflösung, Ruhe und Harmonie in dem ungemischten Gefühl der Liebe.
Soweit die philosophische Erörterung in »Anmut und Würde«. Es würden sich dazu selbstverständlich noch zahlreiche Parallelstellen aus anderen Abhandlungen, namentlich aus den Briefen über ästhetische Erziehung, die ja gerade diesen ästhetischen Zustand zum pädagogischen Endziel machen, sowie aus den Bruchstücken der Vorlesungen über Ästhetik, aus den Gedichten und den Briefen beibringen lassen. Unter den letzteren möchten wir den Leser besonders auf zwei hinweisen. Einmal auf den schon in anderem Zusammenhang erwähnten vierzehn Seiten langen Brief an Körner vom 18. Februar 1793, wo unter anderem in Anknüpfung an eine der Geschichte vom barmherzigen Samariter verwandte Erzählung der Unterschied einer gutherzigen, nützlichen, rein moralischen, großmütigen und sittlich-schönen Handlung beleuchtet wird. Und auf den zehn Tage später an denselben Freund gerichteten Brief, der ein wundervolles Gleichnis, das wir ähnlich auch in Vischers »Auch einer« gefunden zu haben uns erinnern, zu unserem Thema bringt. Einen Vogel im Fluge nennt dort der Dichter »die glücklichste Darstellung des durch die Form bezwungenen Stoffes, der durch die Kraft überwundenen Schwere«. Die Schwerkraft verhalte sich nämlich »ungefähr ebenso gegen die lebendige Kraft des Vogels, wie sich bei reinen Willensbestimmungen die Neigung zu der gesetzgebenden Vernunft verhält«. Der Adler also, der durch den reinen Äther, die Wolken unter sich (bei Vischer: nunc pluat, jetzt möge es regnen!) der Sonne zuschwebt, ist an sich das Symbol des Erhabenen, und Flügel werden als »Symbol der Freiheit« gebraucht. Er stellt aber zugleich auch den Sieg der reinen Schönheit dar, denn »Schönheit nehmen wir überall wahr, wo die Masse von der Form und … von den lebendigen Kräften … völlig beherrscht wird«.
Dem entspricht dann genau, um von anderen Gedichten zu schweigen, die vielleicht durch jenes Kantische Gleichnis von Herakles als »Musaget« (Führer der Musen) im Olymp angeregte herrliche Schlußstrophe der Krone von Schillers Gedankenlyrik »Das Ideal und das Leben«, welche die »Himmelfahrt« des von seinen Erdenleiden erlösten Herakles und seine Begrüßung durch Hebe, die Göttin der ewigen Jugend, schildert:
Mit Gedankengängen wie dem letzten befinden wir uns ganz im Banne griechischer, genauer allerdings neuhellenischer Anschauungen, wie sie der Humanitätsstandpunkt unserer Klassiker: Lessing und Herder, Schiller und Goethe, wenn auch bei den einzelnen in verschiedenem Maße und verschiedener Färbung, enthält. Wie sollen wir Heutigen uns dazu stellen?
Gewiß, auch das Sittliche darf den Menschen nicht von seiner natürlichen Grundlage lösen wollen. Weltflüchtiges, sinnen- und schönheitsfeindliches Mönchtum, sei es buddhistisches oder christliches, das in allem Sinnlichen nur Sünde sieht und daher einen aufs schärfste zu bekämpfenden Feind in ihm erblickt, kann nicht das Ideal eines mit Fleisch und Blut bekleideten Wesens sein, das eine gleichmäßig harmonische Ausbildung aller seiner Fähigkeiten erstrebt. Noch nie ist, nach einem bekannten Spruche des römischen Dichters Horaz, die Natur gewaltsam unterdrückt worden, ohne sich dafür zu rächen. So gesehen, war es eine Art Akt geschichtlicher Notwendigkeit, daß aus der Mönchszelle selbst Luther, der Befreier vom Mönchtum,[125] erstand. Die natürlichen Neigungen sind, auch nach dem Urteil eines so strengen Ethikers wie Kant, an sich keineswegs etwas Böses; sie müssen nur in die Bahn des Guten gelenkt werden, damit das Gefühl, das zur wahren Freudigkeit des sittlichen Handelns unentbehrlich ist, um mit Schiller zu sprechen, »eifrige Teilnehmerin an der reinen Sittlichkeit« wird.
Trotz alledem vermögen wir, scheint mir, heute zu jenem hellenischen Harmoniegefühl, jenem optimistischen Glauben an die Güte alles Natürlichen, jener lebensfrohen Schönheitsreligion, wie sie das Zeitalter des Perikles beseelte, dann nach zwei Jahrtausenden noch einmal im lebensfrohen Geiste der Renaissance und des Humanismus zum Ausdruck kam und auch noch in einzelnen philosophischen Nachzüglern des achtzehnten Jahrhunderts, wie Shaftesbury, lebendig wurde, ebensowenig zurückkehren wie zu der glücklichen Naivität unseres Kindesalters. Und wenn selbst in dem schönheitsdurstigen Volke der alten Griechen – wobei wir von der Volks- und Mysterienreligion ganz absehen wollen – ein Xenophanes, ein Sokrates und vor allem, bei all seinem Schönheitsgefühl, ein Plato zur reinen Geistigkeit hinstreben, so ging es mit jenem naiven Sich-eins-fühlen von Natur und Sittlichkeit erst recht zu Ende, seitdem das Christentum mit seinem Sündenbewußtsein in die Welt trat, das nun kaum mehr auszurotten ist.
Und hat es, auch von einem ganz undogmatischen und unkirchlichen Standpunkt aus, der für uns selbstverständlich ist, wirklich so unrecht damit? Wir verstehen dabei unter der »Sünde« freilich kein mystisch-religiöses Gefühl, sondern den Egoismus, der nur den eigenen Vorteil sucht, anstatt sich dem Ganzen hinzugeben, den Eigenwillen, den »zu bändigen« Schiller selbst im »Kampf mit dem Drachen« als »der Pflichten schwerste« bezeichnet hat. Trotzdem gibt er doch in einem Brief an Goethe vom 9. Juli 1796, im Anschluß an seine Beurteilung von dessen »Wilhelm Meister«, Goethe recht: »Die gesunde und schöne Natur braucht keine Moral« und, wie er hinzusetzt, auch keinen Gott und keine Unsterblichkeit, die für die »ästhetische Geistesstimmung« seines Erachtens »nie zu ernstlichen Angelegenheiten[126] und Bedürfnissen werden können«. Aber wo gibt es, fragen wir, solche Naturen, die ohne inneren Kampf durch den bloßen Instinkt des Gefühls in allen Fällen von selber das Richtige treffen? Sagt doch Schiller selbst zu Anfang seines »Ideal und Leben«, daß die »Vermählung« von »Sinnenglück« und »Seelenfrieden« nur dem olympischen Zeus gegeben sei, während dem Menschen zwischen beiden »nur die bange Wahl« bleibe. Und hat gerade er doch in seinen Dramen keine rein harmonische »schöne Seele«, wie Goethe in seiner Iphigenie oder der Prinzessin im »Tasso«, zu schaffen vermocht, sondern gerade in seinen hervorragendsten Frauengestalten, wie Maria Stuart, Johanna, Thekla, die Erhebung des »schönen« Charakters zu sittlicher Größe dargestellt. Die reine Harmonie mag uns als schönes Ideal vorleuchten, fürs Leben taugt der sittliche Kampf.
Schiller und noch stärker, wie wir gleich hinzufügen können, Goethe stehen jedenfalls mehr auf der Griechenseite und gegen das Christentum. Daher auch ihre Unzufriedenheit mit dem von Kant angenommenen »Hang zum radikalen Bösen in der Menschennatur«. Die Griechen dagegen erscheinen ihm als Muster jener ungebrochenen Einheit und Ganzheit des Menschenwesens: »Zugleich voll Form und voll Fülle, zugleich philosophierend und bildend, zugleich zart und energisch, sehen wir sie die Jugend der Phantasie mit der Männlichkeit der Vernunft in einer herrlichen Menschheit vereinigen.«
Bei dieser Gelegenheit einige Bemerkungen über Schillers Verhältnis zur Religion überhaupt. Wir haben schon früher bemerkt, daß von einem mit schweren inneren Kämpfen verbundenen schroffen Bruch mit den biblischen Jugendanschauungen in des Dichters religiöser Entwicklung nichts zu merken ist. Die Stellung des reifen Schiller zur Religion kennzeichnet sich am kürzesten durch sein bekanntes Distichon, das »Mein Glaube« überschrieben ist:
Daraus ergibt sich eine Ablehnung aller sogenannten »positiven« Religionsbekenntnisse aus reinem, das »Göttliche« mit dem Guten gleichsetzendem Religionsgefühl, stärker fast noch als bei Lessing und Herder. Es ist daher auch unglaublich[127] töricht, wie es zuweilen geschieht, aus seiner »Jungfrau von Orleans« oder »Maria Stuart« – im ersten Falle aus der sympathischen Charakterisierung der frommen Titelheldin, im zweiten aus der schwärmerischen Schilderung des katholischen Kultus durch den jungen Fanatiker Mortimer – eine »Verherrlichung« der römischen Kirche herauszulesen. Gerade so töricht, nebenbei bemerkt, wie die der mittelalterlich-feudalen Anschauung des Ritters Dunois entsprechende:
als Schillers persönliche politische Ansicht auszugeben.
Er stand seiner ganzen Bildung und Gesinnung nach hoch über konfessionellen Gegensätzen und wußte daher beiden ihr historisches und ästhetisches Recht zu geben, wobei in letzterem Falle der englisch-schottische Kalvinismus natürlich ungünstig abschneiden mußte.
Bezeichnend für seine ablehnende Stellung zum kirchlichen Christentum waren schon seine »Götter Griechenlands«, ist aus der späteren Zeit sein Urteil über Kants Religionsschrift von 1792, die aus Rücksichten auf die preußische Zensur in Jena gedruckt und von dem eifrig interessierten Dichter schon vor Vollendung des Drucks eingesehen wurde. Mit Kants freier, sinnbildlicher bezw. moralischer Auslegung der christlichen Lehren von der Erlösung, vom Logos, von Himmel und Hölle, vom Reiche Gottes erklärt er sich zwar einverstanden. Aber radikaler als Kant und sein Freund Körner, hegt er Bedenken gegen den pädagogischen Zweck, den der Philosoph in dieser Schrift mit ihrer Anknüpfung der »Resultate des philosophischen Denkens an die – Kindervernunft (!)« verfolge: nämlich »das Vorhandene nicht wegzuwerfen, solange noch ein Nutzen davon zu erwarten sei, sondern es vielmehr zu veredeln«. Die sogenannten »Religionsverteidiger« würden bei ihrer bekannten Beschaffenheit, wie er sich recht sarkastisch äußert, seine »Unterstützung annehmen«, seine »philosophischen Gründe aber wegwerfen«; so habe »Kant dann weiter nichts getan, als das morsche Gebäude der Dummheit geflickt«. So scharf stand Schiller der Orthodoxie gegenüber.
Auch über das Verhältnis der Religion zur Ethik äußert er sich zur selben Zeit in der Abhandlung »Vom Erhabenen«[128] ziemlich absprechend: »Nur die Religion, nicht aber die Moral stellt Beruhigungsgründe für unsere Sinnlichkeit auf. Die Moral befolgt die Vorschrift der Vernunft unerbittlich und ohne alle Rücksicht auf das Interesse unserer Sinnlichkeit; die Religion aber ist es, die zwischen den Forderungen der Vernunft und dem Anliegen der Sinnlichkeit eine Aussöhnung, eine Übereinkunft zu stiften sucht.« Ebenso in einer aus 1794 stammenden Äußerung zu einer Kritik seines auch von uns bereits (S. 102) berührten Jugendgedichts »Resignation«: »So (d. h. sich in ihrer Rechnung betrogen zu sehen) kann und soll es jeder Tugend und jeder Resignation ergehen, die bloß deswegen ausgeübt wird, weil sie in einem anderen Leben gute Zahlung erwartet. Unsere moralischen Pflichten binden uns nicht kontraktmäßig, sondern unbedingt. Tugenden, die bloß gegen Assignation an künftige Güter ausgeübt werden, taugen nichts. Die Tugend hat innere Notwendigkeit, auch wenn es kein anderes Leben gäbe. Das Gedicht ist also nicht gegen die wahre Tugend, sondern nur gegen die Religionstugend gerichtet, welche mit dem Weltschöpfer einen Akkord schließt und gute Handlungen auf Interessen ausleiht, und diese interessierte Tugend verdient mit Recht jene strenge Abfertigung des Genius.«
Entgegenkommender spricht sich ein Brief an Goethe vom 17. August 1795 im Anschluß an eine Besprechung der »Bekenntnisse einer schönen Seele« in »Wilhelm Meister« aus: »Ich finde in der christlichen Religion virtualiter die Anlage zu dem Höchsten und Edelsten, und die verschiedenen Erscheinungen derselben im Leben scheinen mir bloß deswegen so widrig und abgeschmackt, weil sie verfehlte Darstellungen dieses Höchsten sind. Hält man sich an den eigentümlichen Charakterzug des Christentums, der es von allen monotheistischen Religionen unterscheidet, so liegt er in nichts anderem als in der Aufhebung des Gesetzes oder des Kantischen Imperativs, an dessen Stelle das Christentum eine freie Neigung gesetzt haben will. Es ist also in seiner reinen Form Darstellung schöner Sittlichkeit oder der Menschwerdung des Heiligen und in diesem Sinne die einzige ästhetische Religion.« Worauf dann freilich die beißende Schlußbemerkung folgt: »Daher ich es mir auch erkläre, warum diese Religion[129] bei der weiblichen Natur so viel Glück gemacht und nur in Weibern noch in einer gewissen erträglichen Form angetroffen wird.«
Doch kehren wir noch einmal zu unserm Hauptthema zurück: Genügt die bloß ästhetische Gemütsstimmung »schöner« Sittlichkeit wirklich zu einer uns völlig befriedigenden Weltanschauung? Können Sittlichkeit und Menschennatur in der Tat restlos ineinander aufgehen? Wir meinen: Auf die Dauer nein!, und berufen uns dabei auf das Urteil aller erfahrenen Menschenkenner, unter anderem auch auf das in Kants »Anthropologie« zitierte eines so wenig christlich Denkenden wie Friedrich der Große »von der verfluchten Rasse, der wir angehören«. Der Riß zwischen Sein und Sollen, Wirklichkeit und Ideal besteht nun einmal, so gewiß wie das Schlechte, andere sagen: die Schwachheit der menschlichen Natur. Und solange das Böse nicht ausstirbt, darf auch der Kampf dagegen nicht aufhören, ist immer neue Erhebung, tägliche »Wiedergeburt« des Guten in uns notwendig. Mögen wir uns zeitweise in jenen Zustand vermählter Natur (»Sinnenglück«) und Sittlichkeit (»Seelenfrieden«) versetzen können: er hält nicht dauernd stand vor den tausend Widerwärtigkeiten des Lebens. In Lagen, wo wir die moralische Feuerprobe bestehen müssen, reicht das Natürliche, auch in seiner veredelten Gestalt als Sittlich-Schönes nicht aus; das Sittlich-Erhabene muß hinzutreten, uns emporziehen in die unbezwingliche Burg unseres besseren Selbst. Schönheit ist, im Körperlichen wie im Seelischen, allzu häufig nicht gepaart mit Stärke.
Lassen sich ferner mit schöner Sittlichkeit, mit den edlen Neigungen des Mitleids (Schopenhauer) und der Sympathie (Shaftesbury) allein die großen öffentlichen Aufgaben in Staat und Gesellschaft lösen? Nein. Der reine »Ästhet« neigt zur ruhigen Betrachtung der Dinge anstatt zur Tat, zu beschaulichem Selbstgenuß statt des Wirkens für andere, trägt daher einen ausgesprochen geistesaristokratischen, dagegen unpolitischen und unsozialen Charakter. Doch wir werden auf Schillers Verhältnis zum Staat noch besonders zu sprechen kommen. Jedenfalls fordert das Sittengesetz der Pflicht andere[130] Taten von uns als das Schwelgen in Gefühlen. Das Ideal der Pflanze, das der lyrischen, am liebsten in sich selbst ruhenden Natur Herders so zusagte, eignet sich nicht zum Vorbild für den Menschen, der nicht zum Vegetieren, sondern zum Handeln geboren ist. Schiller, der in Kants Schule gegangen war, setzt darum in seinem Distichon »Das Höchste« bezeichnenderweise ein »wollend« hinzu; denn er wußte, daß im Gegensatz zur »ganzen Natur« der Mensch »das Wesen ist, welches will«. Auch die Tatsache, daß er in »Anmut und Würde«, übrigens auch darin Kant folgend, Anmut als besonderen Ausdruck der weiblichen Tugend darstellt, die sich nach seiner Meinung »selten zu der höchsten Idee sittlicher Reinheit erhebt und es selten weiter als zu affektierten (gefühlsmäßigen) Handlungen bringt«, beweist, daß sie dem Dichter nicht als Kennzeichen des vollen Menschen gilt, wie andererseits freilich auch nicht allein die »Würde« des Mannes.
Mit einem Worte: Erhabene und schöne Sittlichkeit besitzen beide ihren eigenen Wert. Keine Harmonie ohne voraufgegangenen Kampf, aber das Ziel des Kampfes Harmonie! Will dagegen ein jedes von beiden für sich allein alles bedeuten, so wird es notwendig einseitig, wie das die großen geschichtlichen Erscheinungen gezeigt haben. Der christliche Dualismus traut der menschlichen Natur zu wenig zu und ist deshalb oft sinnen-, ja menschenfeindlich geworden. Selbst ein Luther, der doch ein neues, weltförmiges Christentum stiften wollte, verzweifelt an der eigenen Vernunft und Kraft. Das alte Griechentum dagegen und seine Wiedergeburt in der Zeit der Renaissance des fünfzehnten Jahrhunderts und wiederum in der Zeit unserer klassischen Dichtung traut ihr zuviel zu, wenn es allen Halt und Maßstab in das souveräne Belieben des Einzelmenschen verlegt. Was soll nun unser sittliches Zukunftsideal sein? Um es einmal mit F. A. Lange in religiös-ästhetischem Bilde auszudrücken: erhabene Domeshallen mit himmelanstrebenden Türmen oder die klassisch-schönen Säulenordnungen hellenischer Tempel? Ich denke, viele von uns werden doch mit dem Sozialisten Lange neben jenem heiteren Tempel der Freude wenigstens eine »gotische Kapelle« für »bekümmerte Gemüter« schon im Hinblick auf das soziale[131] Elend nicht entbehren wollen. Die moderne Ethik sollte meines Erachtens beide Elemente, das antike Harmoniegefühl und den sittlichen Idealismus der Tat, der sich umsetzt in kräftiges politisch-soziales Handeln, in sich aufzunehmen und womöglich zu einer höheren Einheit zu verbinden suchen.
In dem Grundstandpunkt, daß das künstlerische Schaffen und Genießen eine besondere, von denen der Wissenschaft und Sittlichkeit grundsätzlich geschiedene Provinz des menschlichen Geistes darstellt, sahen wir unseren Dichter-Philosophen dem Verfasser der »Kritik der Urteilskraft« folgen. Desgleichen teilt er mit ihm die Ansicht, daß das künstlerische Erleben eine Bewegung des Gefühls darstellt und die Lust am Schönen weder durch logische Begriffe vermittelt noch durch sittliche Gebote beeinflußt ist.
Aber er sucht, über Kant hinausgehend, einen objektiven Maßstab der Schönheit festzustellen und glaubt ihn in einem langen Schreiben an Körner vom 18. Februar 1793, das er zu einer besonderen Schrift »Kallias« auszuarbeiten gedachte, in dem Satze: »Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung« gefunden zu haben. Dieser an und für sich etwas dunkle Satz soll besagen: Im ästhetischen Urteil erscheint uns die ganze Natur, einschließlich des Menschen, als die Darstellung von freien, ihr eigenes Leben und Gesetz erfüllenden Wesen.
Den Ausdruck dieses eigentümlichen Wesens einer jeden Person, eines jeden Dinges nennt Schiller, vielleicht durch Aristoteles und seine modernen Nachfolger, vielleicht auch schon durch Fichte beeinflußt, dessen Form. Schon auf dem theoretischen und dem ethischen Gebiet des Kritizismus spielt die Form eine sehr bedeutsame Rolle, wie ich in meiner Doktor-Dissertation[18] nachgewiesen habe. Schiller überträgt das nun auch auf das ästhetische Gebiet.
Er unterscheidet drei Begriffe: die gestaltende Form, den zu gestaltenden Stoff und den schaffenden Künstler. Künstlerisch arbeiten heißt eben: dem Stoffe Form geben, den Stoff durch die Form vertilgen, wie es in der neunten Strophe von »Ideal und Leben« von den »heiteren Regionen, wo die neuen Formen wohnen«, beschrieben wird:
Ein weiterer Begriff der Schillerschen Ästhetik ist der ästhetische oder schöne Schein. In der Wissenschaft wollen wir das Wirkliche erkennen, in der Ethik dem Guten durch unser Handeln Wirklichkeit verschaffen; der Gegenstand des ästhetischen Triebes dagegen ist der bloße Schein der Dinge, an dem nur »der Blick sich zu weiden« vermag, der Blick auf eine nur der »dichtenden« Seele wahrnehmbare eigene Welt. Im Gegensatz zu der Arbeit der Wissenschaft, dem Tun des Guten erweist der ästhetische Schein sich als bloßes Spiel: ein Spiel jedoch, das die Gesamtheit der menschlichen Gemütskräfte in Anspruch nimmt. Die Kunst versetzt sie in ein freies Spiel miteinander, d. h. eine rein sich selbst genügende Bewegung, die an keinen bestimmten Zweck gebunden ist, wie denn Kant die ästhetische Zweckmäßigkeit, im Gegensatz zur praktischen, als »Zweckmäßigkeit ohne Zweck« bezeichnet hatte. Mit dem Angenehmen, Guten und Wahren ist es dem Menschen ernst; mit dem Schönen spielt er, d. h. er erfreut sich an ihm mit seiner vollen Menschennatur. »Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.« (15. ästhetischer Brief.)
Die Wirkung des Schönen ist entweder eine schmelzende (auflösende) oder eine energische (anspannende). Auflösend wirkt die Schönheit, indem sie uns im Spieltrieb von der einseitigen[133] Spannung des Stoff- (Sach-) oder des Formtriebs befreit und fühlen lehrt, sobald wir Gefahr laufen, zu verknöchern, denken, wenn wir verdumpfen. Anspannend dagegen, wenn sie beide Teile in ihrer Kraft erhält, der Erschlaffung entgegenwirkt. So belebt das Schöne samt dem Erhabenen (denn nichts anderes ist eigentlich die »energische« Schönheit) alle Kräfte unserer Seele und stellt uns in der vollen Einheit unseres lebendigen Wesens dar.
Wenden wir uns nun zum Schlusse Schillers Anwendung der ästhetischen Theorie auf sein eigenstes Schaffensgebiet, die Dichtung, zu. Die Hauptschrift, zugleich diejenige, nach deren Vollendung er von der Philosophie wieder zum poetischen Schaffen übergeht, ist die große Abhandlung von 1795/96
die man wohl »ein einziges Zwiegespräch mit Goethe« genannt hat, der dem naiven, so wie Schiller dem sentimentalen, Dichter entspricht. Sie geht aus von dem Reiz, den das Naive, Natürliche auf den Kulturmenschen ausübt. Die Naivität eines Kindes oder eines Naturmenschen erfreut und rührt uns als ein Sieg der Natureinfalt über die Künstelei der Zivilisation. Auch das Genie ist naiv, reine Naturkraft; wobei Natur als das Dasein der Dinge nach eigenen und unabänderlichen Gesetzen verstanden wird. In der Blume, der Quelle, dem bemoosten Stein, dem Vogelsang, der Kindheit lieben wir das ruhige Wirken aus sich, die ewige Einheit mit sich selbst. »Sie sind, was wir waren und was wir wieder werden sollen.«
Bewahrer der Natur sind nun in erster Linie die Dichter, sei es, daß sie »Natur« sind oder die verlorene suchen. Das dichterische Genie ist gleichsam der zur Person gewordene Spieltrieb, der ja ebenfalls nach seelischen Einfällen und Gefühlen, nicht nach logischen Begriffen verfährt. Naive Dichter sind Homer und Shakespeare; sentimental (gefühlvoll) ist Werther, der den Homer liest. Dem Naiven ist die Natur eine Selbstverständlichkeit, dem Sentimentalen ist sie ein Ziel seiner Sehnsucht. Naiv ist deshalb die Antike in ihrer Blütezeit, ihrer ungebrochenen Einheit von Natur und Kultur; sentimental das Christentum, in dem sich dieser Bruch vollzogen[134] hat, aber auch der moderne Mensch überhaupt. Und ferner kehrt in dem Kontrast »naiv-sentimental« der uns bekannte Gegensatz der harmonischen schönen Seele auf der einen, des sittlich-erhabenen Charakters auf der anderen Seite wieder.
Die Hauptgattungen der sentimentalen, mithin spezifisch modernen Poesie sind die Satire, die Elegie und die Idylle, über die sich dann der Verfasser im einzelnen geistreich und mit anschaulichen Beispielen aus der ganzen Weltliteratur ergeht. Alle drei betreffen das Verhältnis zwischen Ideal und Wirklichkeit: die Satire, die strafende wie die spottende, stellt den Abstand beider voneinander, die Elegie das Ideal als ein verlorenes, die Idylle dasselbe als erreicht dar. Groß und echt ist die Dichtung nur, wo Gedanken und Gefühle von allgemeinmenschlicher Bedeutung, nicht bloß subjektives Fühlen des Dichters den Stoff beseelt. So muß aus der scherzhaften Satire die Überlegenheit der schönen Seele, aus der strafenden oder pathetischen der erhabene Charakter sprechen; muß die Sehnsucht der Elegie nach einem verlorenen Ideal gehen, die Idylle uns nicht in ein arkadisches Schäferleben, sondern in den Zukunftsstand einer neuen, harmonisch vollendeten Menschheit – also das, was der Sozialist Utopie nennt – führen. Schillers »Sentimentalität« bedeutet jedenfalls keine Rousseau-Klopstock-Ossiansche Empfindsamkeit, im Gegenteil herben Lebensrealismus.
Er unterscheidet auch »wirkliche« und »wahre« Natur. Wir wollen in dem Werk des Dichters nicht die Zufälligkeiten der Wirklichkeit, etwa die natürlichen Ausbrüche der Leidenschaft, dargestellt sehen, wenigstens nicht als sein eigentliches Ziel, sondern »eine innere Notwendigkeit des Daseins«. Mit dem »Affentalent gemeiner Nachahmung«, wie es auch heute noch der extreme Naturalismus predigt, ist es nicht getan; nur in Kopf und Herz von künstlerisch-menschlich ausgebildeten Dichterpersönlichkeiten formt sich auch der niedere Stoff zu edlem Gebilde. Die Gefahr für den naiven Dichter besteht im Herabsinken zum Platten, Geistlosen, Gewöhnlichen; die für den sentimentalen in der Überspannung zum Gehalt- und Gestaltlosen einer schwärmerisch schrankenlosen Einbildungskraft. Die Aufgabe der Poesie ist weder angenehme Erholung[135] im gewöhnlichen Sinne des Wortes noch moralische Besserung und Belehrung. Der Geisteszustand der meisten Menschen ist – wie wahr trifft Schillers tief sozialer Blick hier auch noch die Gegenwart! – »auf der einen Seite anspannende und erschöpfende Arbeit, auf der anderen erschlaffender Genuß«. Die Dichtkunst aber verlangt einen ganzen und vollen Menschen, »einen offenen Sinn, ein erweitertes Herz, einen frischen und ungeschwächten Geist«. Darum – das Wort behält auch heute noch seine volle Geltung – die Seltenheit wirklich guten Geschmacks und entsprechenden Urteils in Fragen der Poesie, die nur aus feinster und edelster Bildung des Herzens und des Geistes hervorgehen können.
Endlich: dem naiven Dichter entspricht der Realist, dem sentimentalen der Idealist. Der erste läßt sich in seinem Denken und Tun durch die bloße Erfahrung bestimmen, der zweite durch die Vernunft. Während der Realist nur an das Nächste, an den Einzelfall denkt, strebt der Idealist bis zu den obersten Voraussetzungen aller Erkenntnis vorzudringen, worüber er freilich oft das Besondere vernachlässigt, so daß er an Einsicht verliert, was er an Übersicht gewinnt. Des letzteren Charakter wird eine Hoheit und Größe zeigen, deren der Realist nicht fähig ist. Dieser redet in Sachen des Geschmacks dem Vergnügen, in Sachen der Moral der Glückseligkeit das Wort; ja selbst in der Religion vergißt er seinen Vorteil nicht gern, wenn er ihn auch durch den Begriff des höchsten Gutes zu veredeln und zu heiligen sucht. Der Idealist erstrebt die Freiheit selbst auf Kosten seines Wohlstandes. Er vergißt freilich über seinem Säen und Pflanzen für die Ewigkeit häufig die Gegenwart, über dem Ganzen, für das er leben möchte, den einzelnen. Der Realist wird oft würdiger handeln, als es seine Theorie zuläßt, während der Idealist öfters erhabener denkt, als er handelt. Beide unterliegen noch besonderen Gefahren: der Realist der einer blinden und wahllosen Ergebung in die Macht der Umstände, der Idealist derjenigen, ein Phantast zu werden. Auch hier liegt das wahre Ideal in der Vereinigung: beide sind notwendige Menschentypen, aber beide ergänzen einander.
Wie wahr der Dichter hier die Wirklichkeit gesehen, wird jeder Leser mit uns gefühlt haben. So mündet auch Schillers,[136] des »Idealisten« Ästhetik wie seine Dichtung, wie sein ganzes Schaffen schließlich in eine Philosophie des Lebens aus.
Es würde uns etwas an unserem Schiller fehlen, wollten wir nicht von seinem Verhältnis zu demjenigen reden, was auf der großen Weltbühne vor sich geht,
mit anderen Worten von seiner Stellung zur Politik. Schiller ist von Anfang an politisch interessiert gewesen. Freilich besteht ein großer Unterschied zwischen dem jungen und dem älteren Schiller. Uns ist leider nur ein kurzer Überblick möglich.[19]
Die politische Stimmung des aus kleinen, engen Verhältnissen stammenden, dann in der Karlsschule unter härtestem Druck und Drill gehaltenen Jünglings ist leidenschaftliche Opposition, repräsentiert durch »Die Räuber«, über deren allgemeine Bedeutung wir uns schon auf Seite 101 f. ausgesprochen haben, und die schon in ihrem Motto In tyrannos (gegen die Tyrannen) und mit ihrer Titelvignette, dem aufsteigenden, grimmig seine Pranken erhebenden Löwen die revolutionäre Gesinnung ihres Dichters ausdrücken. Dasselbe Gesicht zeigen die gleichzeitig entstandenen leidenschaftlichen Gedichte der »Anthologie auf das Jahr 1782«, z. B. »Die schlimmen Monarchen«. Kein Wunder, wenn ein zeitgenössischer, anscheinend etwas größenwahnsinnig angelegter Fürst über den von der Jugend vergötterten jungen Dichter-Revolutionär die Äußerung getan haben soll: Wenn ich mit dem Gedanken umgegangen wäre, die Welt zu erschaffen, und vorausgesehen hätte, daß Schillers »Räuber« darin würden geschrieben werden, so hätte ich die Welt nicht erschaffen! – Der »Fiesko« ist zwar schon wesentlich zahmer, aber doch ein »republikanisches Trauerspiel«, das den Pfälzer Philistern, in deren Adern »kein römisches Blut floß«, schon zu weit ging.
»Kabale und Liebe« dagegen ist wieder eine soziale Tragödie, in der selbst nach dem Urteil eines politisch so gemäßigten Mannes wie H. Hettner »Fäulnis und Verderbnis« als »der Grundzug aller unserer staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen« zum Vorschein kommen. Kühner als Lessing in seiner »Emilia Galotti« wagt der Dichter es, die Handlung nach Deutschland zu verlegen. Die gewissenlose Kabale der Hofkreise gegenüber den natürlichen Rechten des Herzens, die Mätressenwirtschaft, die Klassenjustiz, der Verkauf der Landeskinder: das alles wird mit solcher Lebenswahrheit und in so glühenden Farben geschildert, daß das Drama auch heute, nach 140 Jahren, noch wie ein Blitz in ein empfängliches, natürlich empfindendes Publikum einschlägt, wenn es mit Feuer gespielt wird, wie ich es selbst bei einer Aufführung durch Schüler im Jahre nach der Revolution erlebte.
In einer öffentlichen Vorlesung vor der »Kurpfälzischen Deutschen Gesellschaft« zu Mannheim am 26. Juni 1784 – später unter dem Titel »Über die Schaubühne, als moralische Anstalt betrachtet« unter seine Werke aufgenommen – verkündet Schiller es geradezu als den Beruf der Bühne, ihre Gerichtsbarkeit da auszuüben, »wo das Gebiet der weltlichen Gesetze sich endigt«. »Wenn die Gerechtigkeit für Gold verblindet und im Solde der Laster schwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Ohnmacht spotten und Menschenfurcht den Arm der Obrigkeit bindet, übernimmt die Schaubühne Schwert und Wage und reißt die Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl.« Wie stark in jenen Zeiten sein politisches Interesse war, geht unter anderem auch daraus hervor, daß ihm damals ein zukünftiges Wirken als Staatsmann als Wunsch vorschwebte. Einer seiner Jugendfreunde hat einmal geäußert: Wenn Schiller nicht ein großer Dichter geworden wäre, so hätte er gewiß eine bedeutsame Rolle im politischen Leben gespielt, freilich mit dem bezeichnenden Zusatz: er würde sie dann wohl als Festungsgefangener geendet haben. Und der Musiker Andreas Streicher, der 1782 mit ihm aus Stuttgart floh, berichtete von ihrer Trennungsstunde im März 1785: wie er (Streicher) Kapellmeister, so hätte Schiller damals – Minister werden wollen!
Vielleicht hängt damit innerlich schon der Keim zu dem späteren »Don Carlos« zusammen, in dem ja Marquis Posa seine völkerbeglückenden Pläne als Minister König Philipps verwirklichen will. Anfangs war bekanntlich das Stück anders gedacht: als ein tragisches »Familiengemälde im königlichen Hause« und zugleich als ein Tendenzstück gegen die Jesuiten: »eine Menschenart, welche der Dolch der Tragödie bisher nur gestreift hat«, und gegen die Inquisition, deren »Schandfleck« er, um die »prostituierte Menschheit zu rächen«, »fürchterlich an den Pranger stellen« wollte. Während der jahrelangen Ausarbeitung änderte sich dann, mit der inneren Entwicklung des Dichters, auch der Plan des Dramas. So wie es jetzt vorliegt, stellt es eine Anwendung der ethischen Zeitgedanken: Humanität, Weltbürgertum, Glaubens- und Gedankenfreiheit auf den Staat dar, verkündet durch den begeisterten Mund des idealistischen und dabei doch als weltklug geschilderten Malteserritters. Mit »Kabale und Liebe« verglichen, haben wir freilich nur einen stark abgeblaßten Liberalismus vor uns: nicht mehr Rousseau, sondern Montesquieu, dessen »Geist der Gesetze« er ungefähr gleichzeitig studiert. Gewiß wird »Männerstolz vor Königsthronen« – »ich kann nicht Fürstendiener sein!« – und Kampf gegen den Despotismus gepredigt. Aber von der Masse des Volkes ist kaum, von einem sozialen Untergrund gar nicht mehr die Rede. Das Ganze spielt sich in der Sphäre des Hoflebens ab. Auf den Thronfolger setzt Posa seine Hoffnung. Also Kronprinzenliberalismus!
Immerhin ist Schiller in dieser und der zunächst folgenden Zeit noch lebhaft politisch interessiert. »Was ist den Menschen wichtiger als die glücklichste Verfassung der Gesellschaft, in der alle unsere Kräfte zum Treiben gebracht werden sollen?« schreibt er an die Schwestern von Lengefeld am 4. Dezember 1788. Auch seine »Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande« (1788) ist, wie der einleitende Abschnitt zeigt, von der ja schon im »Don Carlos« hervortretenden Sympathie für den Freiheitskampf eines kleinen, bedrängten Volkes um sein Recht »gegen die furchtbaren Kräfte der Tyrannei« diktiert.
In diesen Zusammenhang gehören auch die schon unter dem Einfluß Kants geschriebenen kleinen geschichtsphilosophischen Aufsätze; vor allem aber die bereits behandelte[139] Antrittsrede über das Studium der Universalgeschichte, welche Sätze enthält wie den folgenden: »Alle denkenden Köpfe verknüpft jetzt ein weltbürgerliches Band.« Oder: »Unser menschliches Jahrhundert« – an einer anderen Stelle heißt es statt dessen: »Das Zeitalter der Vernunft« – »herbeizuführen, haben sich alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt.« Und zum Schlusse den Appell an seine jugendlichen Zuhörer, auch ihrerseits zu diesem weltgeschichtlichen Ergebnis beizutragen.
Fast zur selben Zeit, als Friedrich Schiller vom Jenaer Universitätskatheder diese Worte sprach (Mai 1789), hatte man jenseits des Rheins den Staat der Vernunft in die Wirklichkeit zu übersetzen begonnen: in der Französischen Revolution. Sie hat in ihren ersten Jahren, wie wohl alle großen Geister des damaligen Deutschlands, darunter sogar den alten Messiassänger Klopstock und den konservativen Minister Goethe, selbstverständlich auch Schiller in ihren Bann gezogen. Aber nur wenige dieser Größen, darunter der alte Immanuel Kant, blieben diesem politischen Idealismus auch über die sogenannte Schreckenszeit hinaus treu. Auch Schiller fühlte sich durch die terroristischen Handlungen des Konvents, vor allem die Hinrichtung des Königs, dermaßen abgeschreckt, daß er an Körner am 8. Februar 1793 die entsetzten Worte schrieb: »Ich kann seit vierzehn Tagen keine französische Zeitung lesen, so sehr ekeln diese elenden Schindersknechte mich an!« Das schrieb der einstige »Stürmer und Dränger«, den der Konvent selbst im August 1792 zusammen mit Washington, Klopstock und Pestalozzi zum »Ehrenbürger« der französischen Republik ernannt hatte. Und diese ablehnende Stimmung hat er dann beibehalten. Sie spiegelt sich wider in den bekannten abschreckenden Schilderungen des »Aufruhrs« und der weiblichen »Hyänen« in der »Glocke«; wo der Dichter des Idealismus sich sogar dahin versteigt, von »ewig Blinden« zu sprechen, denen man »des Lichtes Himmelsfackel« nicht leihen dürfe, hingegen als höchstes staatliches Gut die »heilige« bürgerliche »Ordnung« preist. Man kann zur psychologischen Erklärung dieser Tatsache auf seine veränderten äußeren Lebensverhältnisse hinweisen. Er war nicht mehr der »literarische Vagabund« von ehedem, sondern ein seßhaft gewordener[140] Jenaer Professor, ein ehrsamer Ehemann und Familienvater, ein Weimarischer Hofrat, der sich schließlich mit Rücksicht auf die höfischen Beziehungen seiner Frau auch die sogenannte »Erhebung« in den Adelstand gefallen ließ. Für uns ist es wichtiger, die innere, die philosophische Wandlung zu verfolgen, die dieser politischen Wandlung zugrunde lag.
Wir haben dafür seit einigen Jahrzehnten eine ausgezeichnete Quelle in den ursprünglichen, 1793 geschriebenen philosophischen Briefen an den Prinzen von Augustenburg, von denen die spätere Fassung der gedruckten »Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen« (1795) in sehr wesentlichen Stücken abweicht. Ohne hier auf alle Einzelheiten eingehen zu können, müssen wir doch das für unser Thema Wichtigste, schon weil es manche Ähnlichkeiten mit der Gegenwart aufweist, herausheben. Es findet sich namentlich in dem ausführlichen zweiten Briefe vom 18. Juli 1793, wobei ich allerdings eine andere, rein sachlich bestimmte Reihenfolge einzuschlagen mir gestatte.
Vor den in der Revolution gemachten Erfahrungen, schreibt er hier an den übrigens freidenkenden Prinzen, »konnte man sich allenfalls mit dem lieblichen Wahne schmeicheln, daß der unmerkliche, aber ununterbrochene Einfluß denkender Köpfe, die seit Jahrhunderten ausgestreuten Keime der Wahrheit, der aufgehäufte Schatz von Erfahrung die Gemüter allmählich zum Empfang des Besseren gestimmt und so eine Epoche vorbereitet haben müßten, wo die Philosophie den moralischen Weltbau übernehmen und das Licht über die Finsternis siegen könnte«. Man sei in der »theoretischen Kultur«, also in der Erkenntnis schon so weit vorgedrungen gewesen, daß »auch die ehrwürdigsten Säulen des Aberglaubens zu wanken anfingen und der Thron tausendjähriger Vorurteile erschüttert ward«. Und als nun »eine geistreiche, mutvolle, lange Zeit als Muster betrachtete Nation« daran ging, ihren »positiven« Gesellschaftszustand gewaltsam zu verlassen, um sich in den »Naturstand« zurückzuversetzen, »für den die Vernunft die alleinige und absolute Herrscherin ist«, da mußte »jeder, der sich Mensch nennt«, vor allem jeder »Selbstdenker« den lebhaftesten Anteil daran nehmen. Denn wenn ein Gesetz des weisen Solon denjenigen Bürger verdammt, der bei einem Aufstand keine[141] Partei nimmt, wie konnte man in diesem Falle, »wo das große Schicksal der Menschheit zur Frage gebracht ist«, neutral bleiben, »ohne sich der strafbarsten Gleichgültigkeit gegen das, was dem Menschen das Heiligste sein muß, schuldig zu machen«! Denn hier ist »eine Angelegenheit, über welche sonst nur das Recht des Stärkeren und die Konvenienz zu entscheiden hätte, vor dem Richterstuhl reiner Vernunft anhängig gemacht«, die, wie es an einer anderen Stelle im Anschluß an Kants Ethik heißt, »den Menschen als Selbstzweck respektiert und behandelt«.[20] Und bei den Gesetzen hat ein jeder Selbstdenker, als Beisitzer jenes Vernunftgerichts, mitzusprechen, indem er sie »als mitbestellter Repräsentant der Vernunft zu diktieren berechtigt und aufrechtzuerhalten verpflichtet ist«.
Aber, wie es in einem Distichon von 1797 heißt, »der große Moment fand ein kleines Geschlecht«. Der Gebrauch, den das französische Volk von diesem großen Geschenk des Augenblicks machte, bewies, »daß das Menschengeschlecht der vormundschaftlichen Gewalt noch nicht entwachsen ist, daß das liberale Regiment der Vernunft da noch zu frühe kommt, wo man kaum damit fertig wird, sich der brutalen Gewalt der Tierheit zu erwehren, und daß derjenige noch nicht reif ist zur bürgerlichen Freiheit, dem noch so vieles zur menschlichen fehlt«. »Rohe, gesetzlose Triebe« – man hört den Dichter der »Glocke« –, die »nach aufgehobenem Band der bürgerlichen Ordnung … mit unlenksamer Wut ihrer tierischen Befriedigung zueilen« in den niederen, und der »noch niedrigere« Anblick der Erschlaffung und Entartung des Charakters in den »zivilisierten« Klassen: das ist die Signatur der Gegenwart. Wir wollen diesen Sätzen nicht entgegenhalten, was Immanuel Kant in demselben Jahre 1793 in seiner Religionsschrift über die angeblich mangelnde »Reife zur Freiheit« schreibt. Schiller jedenfalls stellt sich auf einen pessimistischen Standpunkt. Auch für ihn bleibt gewiß »politische und bürgerliche[142] Freiheit immer und ewig das heiligste aller Güter, das würdigste Ziel aller Anstrengungen und das große Zentrum aller Kultur«. Und wenn das Vernunftgesetz auf den Thron erhoben und wahre Freiheit zur Grundlage des Staatsgebäudes gemacht wäre, schreibt er, »so wollte ich auf ewig von den Musen Abschied nehmen und dem herrlichsten aller Kunstwerke, der Monarchie der Vernunft, alle meine Tätigkeit widmen«. Allein »jeder Versuch einer Staatsverfassung aus Prinzipien« – und jede andere ist »bloßes Not- und Flickwerk«! – kann für ihn nur in Frage kommen, wenn »der Charakter der Menschheit von seinem tiefen Verfall wieder emporgehoben ist«, und das sei – »eine Arbeit für mehr als ein Jahrhundert«!
Daraus zieht nun unser Dichter die Folgerung: weniger die Aufklärung des Verstandes, für die schon genug geschehen sei, als die sittliche Reinigung und Stärkung des Willens, vor allem aber die Veredlung der Gefühle sei für jetzt das Wichtigste. Es ist das Programm der ästhetischen Kultur, das dann die »Ästhetischen Briefe« von 1795 in reicher Begründung und Ausführung weiter entwickeln. Hierauf näher einzugehen, zu zeigen, wie nach Schillers Auffassung die ästhetische Erziehung den Menschen aus dem »Notstaat« der Wirklichkeit allmählich zum »Vernunftstaat« emporführt, dürfen wir uns um so eher versagen, als wir ja die ganze Frage von Schillers ethisch-ästhetischem Ideal schon oben ausführlich genug behandelt haben und – diese ganze, ihm als Dichter freilich naheliegende und durch den Verkehr mit gleichgesinnten Geistern wie Goethe und Wilhelm v. Humboldt sicherlich noch gestärkte ästhetische Auffassung mit Bezug auf politische Dinge sich doch eigentlich als ein großer Trugschluß erwiesen hat. Rein ästhetische Kultur vermag nicht einmal den einzelnen politisch reif und mündig zu machen, geschweige denn ein ganzes Volk. Gewiß, eine starke Beimischung ethisch-ästhetischer Kultur würde dem deutschen Machtstaat von 1866 bis 1918 nichts geschadet haben und auch unserem heutigen angeblichen Kulturstaat nichts schaden. Indes, das ist nicht die erste Frage. Die Vorbedingung für einen wahrhaften Staat der Vernunft, wie ihn ja[143] auch Schiller letzten Endes erstrebt, ist, wie wir inzwischen gelernt haben, die politisch-ökonomische Befreiung der Massen.
Und da können wir mit Befriedigung feststellen, daß der »Idealist« Schiller in dieser Beziehung, d. h. hinsichtlich der ökonomischen Grundlage alles staatlichen Lebens, wenigstens nicht ganz blind gewesen ist.[21] Sie alle werden seine bekannte Strophe aus dem Erscheinungsjahr der »Ästhetischen Briefe« (1795) kennen:
Und vielleicht auch den noch deutlicheren Doppelvers, den er den bloßen Moralpredigern von »Menschenwürde« entgegenhält:
Genau dasselbe sagt er im vierten Briefe an den Prinzen (November 1798): »Der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und sich satt gegessen hat; aber er muß warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll.« Schon der zweite Brief hatte ausgeführt, daß »das Bedürfnis und der Drang der physischen Lage, die Abhängigkeit des Menschen von tausend Verhältnissen, die ihm Fesseln anlegen«, seinen Aufflug in die »Regionen des Idealischen«, speziell auch die der Kunst, verhindern, womit die wirtschaftliche Grundlage jenes in den »Briefen« von 1795 gepredigten idealen Reiches der ästhetischen Kultur zugegeben ist. »Mit der Verbesserung ihres physischen Zustandes«, heißt es demgemäß im vierten Briefe ganz marxistisch, »muß man das Aufklärungswerk bei einer Nation beginnen.« Denn »der zahlreichere Teil der Menschen wird durch den harten Kampf mit dem physischen Bedürfnis viel zu sehr ermüdet und abgespannt, als daß er sich zu einem neuen und inneren Kampfe mit Wahnbegriffen und Vorurteilen aufraffen sollte«.[144] Er ergreift daher mit hungrigem Glauben die Formeln, mit denen es Staat und Priestertum »von jeher« – wie nicht bloß die französischen Materialisten, sondern auch Kant und Heinrich Heine sagen – »gelungen ist, das erwachte Freiheitsbedürfnis ihrer Mündel abzufinden«.
Auch die seelische Verstümmelung des Menschen durch geisttötende Fabrik- oder Facharbeit hat Schiller bereits klar gesehen: »Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus; ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft.« So müssen die Individuen »unter dem Fluche dieses Weltzwecks«, nämlich des (aus Kants Geschichtsphilosophie übernommenen) Widerstreits der menschlichen Kräfte, leiden und ihre Natur durch jahrtausendelange Sklavenarbeit »verstümmeln« lassen, bis dereinst einmal der »freie Wuchs der Menschheit« sich entfalten kann. Und nicht mit Unrecht hat es Mehring auf den modernen Klasssenkampf der Lohnarbeiterschaft angewandt, wenn Schiller ein anderes Mal erklärt, daß zwar Sklaverei »niedrig« und eine sklavische Gesinnung in der Freiheit gar »verächtlich« ist, eine bloße »sklavische Beschäftigung« dagegen, falls sie mit Hoheit der Gesinnung verbunden ist, ins Erhabene übergehen kann. Wieder an einer anderen Stelle kritisiert er schon vor Fichte, wenn auch nicht so scharf wie dieser, den bürgerlichen Eigentumsbegriff: »Eine solche Ausdehnung des Eigentumsrechts, wobei ein Teil der Menschen zugrunde gehen kann, ist in der bloßen Natur nicht gegründet.«
Wir haben diese Stellen zitiert, um Schillers soziale Einsicht zu beweisen. Aber es liegt uns fern, unseren Dichter deshalb zum Sozialisten stempeln zu wollen. Im Gegenteil, in den auf 1795 folgenden Jahren zieht er sich mehr und mehr, wie von der Philosophie, so erst recht von aller Politik, ja überhaupt aus der rauhen Wirklichkeit in das schöne Reich des Ideals zurück. »Glühend für die Idee der Menschheit, gütig und menschlich gegen den einzelnen Menschen«, aber »gleichgültig gegen das ganze Geschlecht, wie es wirklich[145] vorhanden ist«, bezeichnet er dem jungen kant- und menschheitsbegeisterten Mediziner Erhard im Mai 1795 als seinen »Wahlspruch« und rät auch ihm, sich von dem Weltbürgertum »ganz und gar zurückzuziehen«, um »mit Ihrem Herzen sich in den engeren Kreis der Ihnen zunächst liegenden Menschheit einzuschließen, indem Sie mit Ihrem Geist in der Welt des Ideals leben«!
Damit hängt seine völlige Rückwendung zur Poesie in seinem letzten Lebensjahrzehnt (1795 bis 1805) zusammen. Seinen deutschen Mitbürgern aber rief er die Worte zu:
Und doch hat ihn auch in der Dichtung das Politische nie losgelassen. Zeugnis seine historischen Dramen: der »Wallenstein«, »Maria Stuart«, »Die Jungfrau von Orleans«, der »Tell« und der »Demetrius«. Auch das Schicksal seiner Nation hat ihn nicht gleichgültig gelassen, wie aus den Fragmenten des Nachlasses zu ersehen ist, auf die vor allen Tönnies aufmerksam gemacht hat. Wie auf unsere Gegenwart gemünzt erscheinen Sätze wie die folgenden: »Darf der Deutsche in diesem Augenblick, wo er ruhmlos aus seinem tränenvollen Kriege geht, wo zwei übermütige Völker ihren Fuß auf seinen Nacken setzen und der Sieger sein Geschick bestimmt – darf er sich fühlen? Darf er sich seines Namens rühmen und freuen?« Und er antwortet: »Ja, er darf's. Er geht unglücklich aus dem Kampfe; aber das, was seinen Wert ausmacht, hat er nicht verloren … Die Majestät des Deutschen ruhte nie auf dem Haupte seiner Fürsten … Die deutsche Würde ist eine sittliche Größe, sie wohnt im Charakter der Nation, die von ihren politischen Schicksalen unabhängig ist.« Und schließlich können und wollen wir, in der inneren wie in der äußeren Politik, die auch von Franz Mehring als »herrliches Bekenntnis« gepriesenen Worte Stauffachers in der Rütliszene als sein politisches Testament an uns betrachten:
Schillers philosophische Gedankenwelt ist eigentlich unerschöpflich, denn ihr innerster Lebenskern, die Idee, kann ihrer Natur nach nie versiegen. Das empfinden wir immer wieder, so oft wir in seine philosophischen Aufsätze, in den Ideengehalt seiner Dramen und nicht zum wenigsten auch in seine vortreffliche Gedankenlyrik uns versenken. Werfen wir auf diese zum Schluß noch einen kurzen Blick! Wir haben schon seine »Resignation«, seinen »Kampf«, seine »Götter Griechenlands«, seine »Künstler« und vor allem die herrlichste und auch von ihm selbst am höchsten gestellte Schöpfung dieser Art: »Das Ideal und das Leben« berührt. Ich erinnere des weiteren an das Goethe besonders wohlgefallende »Die Ideale«, die den schwärmerischen Idealismus des Jünglings zu dem scheinbar nüchternen, aber gehaltvolleren und bleibenderen des reifen Mannes vertiefen: dem Idealismus der nie ermattenden und rastlos, obzwar mit kleinen Schritten vorwärtsdringenden Arbeit (»Beschäftigung«, sagt Schiller) und der Freundschaft, die wir uns erweitert denken können zur Gesinnungsgemeinschaft überhaupt. Oder an den »Spaziergang«, der, von der Einzelpersönlichkeit ablenkend, in der anspruchslosen Form eines Spazierganges uns ein Bild des kulturgeschichtlichen Werdeganges der Menschheit entwirft und von der ersten Einfalt der Natur durch die Spannungen und den Streit des Kulturlebens uns zuletzt in den Schoß der reinen Natur wieder zurückführt. Oder an seine in köstlicher Fülle vorhandene, in der Regel in die antike Form des Distichons (Hexameter mit Pentameter) gegossene Spruchdichtung. Hervorgehoben seien hier nur die unsere früheren Ausführungen über des Dichters ethische Anschauungen erläuternden: »Die moralische Kraft«, »Die Führer des Lebens«; die zum Politischen hinüberleitenden: »Pflicht für jeden« und »An einen Weltverbesserer«, sowie das fein psychologische kurze Distichon[147] über die »Sprache«. Und an das Wort von der »Philosophie«, das uns zum Schlusse noch einmal so recht Schillers allem pedantischen Richtungs- und Schulwesen abgewandte philosophische Art vor Augen zu führen geeignet ist:
So wird denn auch der Dichter Schiller, solange deutsche Philosophie besteht, d. h. hoffentlich noch für lange Zeiten, als ihr zugehörig betrachtet werden. Und was für eine Philosophie war, besser ist das? Das hat er uns in den letzten Zeilen seiner »Worte des Wahnes« gesagt. Das Schöne, das Wahre und (wir dürfen in seinem Sinne hinzusetzen) auch das Göttliche oder Gute,
Es ist mit anderen Worten die Philosophie des Idealismus von Platon bis Kant und Schiller und über sie hinaus bis zu uns, die »ewig bestehen« wird und soll.
Denn der Mensch bedarf einer Erhebung über die alltägliche Wirklichkeit. Er wird sich nie völlig befriedigt fühlen allein durch die »Erfahrung«, d. h. durch die auch noch so vollständig bis in alle Einzelheiten erforschte Welt der Wissenschaft. Er wird sich immer aus der Tiefe seines eigenen Innern noch eine andere, eine ideale Welt schaffen, die allerdings keine logisch oder naturwissenschaftlich benennbare Welt des Seienden sein wird, sondern eine von ihm selbst »gedichtete« Welt der Werte. Es kommt nur darauf an, was man unter »Dichten« versteht, und ob diese Werte haltbar sind. Eine solche Welt aber hat uns Friedrich Schiller gelehrt, wenn er uns »die Angst des Irdischen von uns werfen«, wenn er uns »aus dem engen, dumpfen Leben« fliehen heißt »in des Ideales Reich«, in das Gedankenland der Idee, wo alle Arbeit ihre Ruhe, aller Kampf seinen Frieden, alle Not ihr Ende findet. Damit steht er dem ursprünglichen Christentum vielleicht näher als die Dogmatik der Aufklärung seiner Zeit, die zwar den Gottes- und Unsterblichkeitsbegriff festhielt, aber die Lehre von der Erlösung als vernunftwidrig fahren ließ.
Freilich diese Erlösung ist nicht die kirchliche, von außen an uns herangetragene, und durch das Blutopfer eines Gottes uns erkauft, sondern, wie bei Kant, eine Selbsterlösung des wahrhaft »glaubenden« Menschen, der das Überirdische, Unaussprechliche, »Göttliche« als sein wahres Wesen wieder erkennt und es deswegen »in den eigenen Willen aufzunehmen« vermag. Gewiß, solche Augenblicke reinster religiöser Erhebung können bei der Natur unserer Seele nicht beständig andauern. Dennoch wirken sie, so oft sie wiederkehren, befreiend und läuternd auf das Gemüt. So hat unter anderen einer der edelsten Jünger und Dolmetscher unseres Dichter-Philosophen, Friedrich Albert Lange (1828 bis 1875), seinen Schiller aufgefaßt. Und ebenso steht es mit der Kunst. Denn wer will, um ein Wort desselben Lange zu variieren, die Neunte Sinfonie Beethovens oder die Lyrik Goethes »widerlegen« oder Raffaels Madonna des »Irrtums« zeihen?
Unser praktisches Handeln aber stelle sich, damit Schillers »Staat der Vernunft« einst heraufgeführt werde, unter das Banner jener Wille und Herz erhebenden großen Idee, die, wie Lange sagt, »den Egoismus hinwegfegt und menschliche Vollkommenheit in menschlicher Genossenschaft an die Stelle der rastlosen Arbeit setzt, die allein den persönlichen Vorteil ins Auge faßt«. Auch das ist, wenngleich nicht mit den Worten des geschichtlichen Schiller, ja vielleicht nicht einmal genau in den Grenzen seines in der Hauptsache noch individualistisch befangenen politischen Sinnes, wohl aber in der Richtung seiner weltumspannenden Liebe – »Seid umschlungen, Millionen!« –, seines Glühens für die Idee der Menschheit gedacht, den wir uns nur auf die sozialen Verhältnisse der Gegenwart übertragen denken, wenn wir für die Verwirklichung des weltumspannenden Gedankens eintreten, den Schiller noch nicht gekannt hat: den des Sozialismus.
Goethe sagte einmal gegen Ende seines Lebens, am 4. Februar 1829, von sich: »Von der Philosophie habe ich mich selbst immer frei gehalten; der Standpunkt des gesunden Menschenverstandes war auch der meinige.« Und ein andermal gesteht er sogar, daß ihm »für Philosophie im eigentlichen Sinne« das Organ gefehlt habe. Er hat auch in seinem langen Leben nie eine philosophische Abhandlung geschrieben, geschweige denn ein philosophisches System entworfen. Und dennoch, ein so allumfassender nicht bloß Dichter-, sondern auch Denkergeist wie er muß ein positives Verhältnis zur Philosophie besessen haben: wenn nicht im Schulsinne, so doch im Sinne einer Weltanschauung. Nicht minder als Lessing oder Herder. Freilich, der Philosoph in ihm war, wie er selbst sagt, nur eine der »verschiedenen Richtungen seines Wesens«, und er nahm aus der Philosophie immer nur, »was seiner Natur gemäß war«. Noch weniger als Lessing, Herder und Schiller konnte Goethe je ein -ist oder -aner, etwa der Spinozist, als der er früher vielfach angesehen wurde, oder ein Kantianer werden. Mit dieser Einschränkung also wollen wir seinen philosophischen Entwicklungsgang betrachten. Denn vor allem bei ihm, der eine so entwicklungsfähige Natur besaß, der immer beflissen war, zu lernen und Neues seinem geistigen Ich anzugleichen, der mit der wechselnd ihn umgebenden geistigen, wissenschaftlichen, politischen Welt sich auch vielfach gewandelt hat, müssen wir den Weg der entwicklungsgeschichtlichen Darstellung einschlagen. Der jugendliche Goethe ist auch philosophisch ein anderer als der reife Mann, und von diesem ist wieder der alte Goethe unterschieden.
1764 bis 1776 (Leipzig, Frankfurt, Straßburg)
Wolfgang Goethe war ein frühreifer Knabe. Schon der Fünfzehnjährige wirft sich, wie er uns im sechsten Buche von »Dichtung und Wahrheit« erzählt, angeregt von einem älteren[152] Freunde, teils um sich von seinem ersten Liebeskummer zu zerstreuen, teils um sich zur Universität vorzubereiten, auf das ihm bis dahin »ganz neue und fremde« Feld der Philosophie. Aber die theoretische Philosophie stößt ihn schon damals ab. Er findet, eine »abgesonderte« Philosophie sei gar nicht nötig, sie sei vielmehr bereits in Religion und Poesie vollkommen enthalten. Dagegen unterhält ihn die Geschichte der Philosophie mit ihren wechselnden Meinungen. Aber auch hier eigentlich nur die Praktiker: der weise Sokrates, der ihn an Christus erinnert, der wackere Stoiker Epiktet aus dem ersten Jahrhundert der römischen Kaiserzeit, der bekanntlich in seiner Ethik ebenfalls vieles mit dem Christentum gemein hat, obwohl er es noch nicht gekannt hat, wie ich vor Jahren einmal in einem besonderen Aufsatz nachgewiesen habe.[22] Später vertieft er sich auch zeitweise in das große Diktionnaire des französischen Skeptikers Pierre Bayle, das er in seines Vaters Bücherei entdeckt hat.
Im Herbst 1765 bezieht dann der eben Sechzehnjährige – ein Abiturientenexamen war damals ja noch nicht nötig – die Leipziger Universität. Aber auch hier stößt ihn das übliche Collegium Logicum ab, wie es der Mephisto dem Schüler in der berühmten Faustszene so ergötzlich beschreibt:
Das »Auseinanderzerren, Vereinzeln und gleichsam Zerstören« der von uns in Wirklichkeit so leicht und bequem vollzogenen Geistesoperationen, das die Logik notwendig betreiben muß, widerstrebt dem jungen Dichtergeist, der aufs Schauen gerichtet war. Kein Wunder, daß ihm die damalige Wolffsche Schulphilosophie mit ihrem dürren, nichtssagenden Gerede über alles mögliche mißfiel, deren Verdienst, wie er in »Dichtung und Wahrheit« sehr richtig sagt, in dem Ordnen unter bestimmte Rubriken und einer »an sich respektabeln« Methode bestand, während »das oft Dunkle und unnütz Scheinende ihres Inhalts«, die unzeitige Anwendung jener Methode[153][23] und die »allzu große Verbreitung über so viele Gegenstände« sie dem Publikum »fremd, ungenießbar und endlich entbehrlich« machte. Unter den Philosophen des »gesunden Menschenverstandes«, die dieser gelehrten Schulphilosophie schließlich den Garaus machen, hebt er als vielbewunderte Schriftsteller Moses Mendelssohn und Garve, später, in einer Rezension der »Frankfurter Gelehrten Anzeigen« 1773, auch Kant hervor. Mehr zogen Lessing, daneben der Kunsthistoriker Winckelmann und Oeser, der ausübende Künstler und Direktor der Leipziger Zeichenakademie, seinen künstlerischen Sinn an.
Nachdem er dann in der Frankfurter Heimat (1768 bis 1770) eine Zeitlang unter dem Einfluß des frommen Fräuleins von Klettenberg die Schriften der Herrnhuter gelesen und mystisch-chemische Beschäftigungen getrieben, geriet er während seines Straßburger Aufenthalts 1770/71, wie wir bereits wissen, in den geistigen Bann Herders; jedoch zunächst mehr in literarischer Beziehung. Von den französischen Enzyklopädisten fühlten er und sein engerer Freundeskreis, die jungen »Stürmer und Dränger« sich wenig angezogen, am ehesten noch von dem der deutschen Art verwandteren Diderot. Religiös glaubten sie sich selbst schon genügend aufgeklärt zu haben. »Auf philosophische Weise erleuchtet und gefördert zu werden«, hatten sie überhaupt »keinen Trieb noch Hang«. Insbesondere das sehr konsequent materialistische, aber sehr trocken und weitschweifig geschriebene Système de la nature erschien ihnen »so grau, so kimmerisch (d. h. nebelhaft-finster), so totenhaft, daß wir … davor wie vor einem Gespenst schauderten«. Und wenn sie von den Enzyklopädisten reden hörten oder einen Band ihres ungeheuren Werkes aufschlugen, so war es ihnen zumute, »als wenn man zwischen den unzähligen[154] bewegten Spulen und Weberstühlen einer großen Fabrik hingeht und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor allem Aug' und Sinn verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreiflichkeit einer auf das mannigfaltigste ineinandergreifenden Anstalt in Betrachtung dessen, was alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu fertigen, sich den eigenen Rock selbst verleidet fühlt, den man auf dem Leibe trägt«. Wieder eine Auflehnung des Gefühls gegen das Abstrahieren der Wissenschaft!
Mehr mußte dem gefühlsmäßigen Denken der jugendschäumenden Genossen natürlich Rousseau zusagen, dessen Geist ja Werther entflammt, während seine eigentliche Philosophie auf Goethe keinen besonders tiefen Eindruck gemacht zu haben scheint. Auch Voltaire, »das Wunder seiner Zeit«, imponierte ihnen bis zu einem gewissen Grade. Überhaupt dürfen wir nicht verschweigen, daß Goethe sein abfälliges Urteil von damals später doch selbst korrigiert hat. Am 3. Januar 1830 erklärte er Eckermann: »Es geht aus meiner Biographie (er meint »Dichtung und Wahrheit«) nicht deutlich hervor, was diese Männer (Voltaire und seine großen Zeitgenossen) für einen Einfluß auf meine Jugend gehabt und was es mich gekostet, mich gegen sie zu wehren und mich auf eigene Füße in ein wahres Verhältnis zur Natur zu stellen.«
Gegenüber stand er den französischen philosophischen Hauptwortführern also doch. Gefesselt dagegen fühlte er sich von einem Philosophen, der in »Dichtung und Wahrheit« nicht erwähnt wird, dem italienischen Pantheisten und Wahrheitsmärtyrer Giordano Bruno, der bekanntlich um seiner Überzeugung willen am 17. Februar 1600 öffentlich zu Rom von der Inquisition verbrannt wurde: wie Goethe ein Dichter und Denker zugleich, wie Goethe auf die Einheit von Gott und Natur, als den Urquell alles Wahren, Guten und Schönen, gerichtet. Der Einundzwanzigjährige hat schon damals Brunos Hauptschrift »Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen« gelesen und ihn in den Notizen seines Tagebuchs gegen die Angriffe Bayles verteidigt. Er ist auch später (1812) aus anderem Anlaß wieder auf ihn zurückgekommen. Übrigens bemerkt Goethe von seinem Wissen um 1773, daß es »noch sprunghaft und ohne eigentlichen Zusammenhang gewesen sei«.
(1774 ff.)
Durch sein frühes Bruno-Studium, aber auch durch seine Naturanschauung und seine ganze bisherige Entwicklung war Goethe für das Verständnis eines größeren, wenn auch scheinbar ihm ganz entgegengesetzten Denkers herangereift, desselben, den wir auch auf Lessing und Herder einwirken sahen: Baruch Spinozas.
Zunächst muß freilich seine Hinneigung zu dem Amsterdamer Weisen auffallen. Hatte er doch als das Ergebnis jener Straßburger Berührung mit der französischen Philosophie die Tatsache festgestellt, »daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik, recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufs lebendige Wissen, Erfahren, Tun und Dichten uns nur desto lebhafter und leidenschaftlicher hinwarfen«: der Metaphysik, von der er seinen Mephisto dem Schüler sarkastisch vororakeln läßt:
Und nun war Spinoza ein Metaphysiker, und sogar ein recht dogmatischer, dessen »Ethica« alles andere als eine Ethik in unserem Sinne, vielmehr ein in sich geschlossenes System von streng logischem Aufbau nach »geometrischer«, ja beinahe scholastischer Methode darstellt. Wie reimt sich das zusammen?
Wir können in Goethes Spinoza-Studium zwei auseinanderliegende Perioden unterscheiden: die erste um die Mitte der siebziger Jahre, die zweite von 1783 bis 1786. Zunächst hatte er »das Dasein und die Denkweise« des »außerordentlichen Mannes« nur »unvollständig und wie auf den Raub« in sich aufgenommen. Und was fesselte ihn an dieser der seinen so entgegengesetzten Persönlichkeit? Nun, hier bewährte sich einmal der bekannte Satz, daß die Gegensätze sich anziehen. Nach seinem eigenen Geständnis zog ihn zu Spinoza gerade die zu dem eigenen »alles aufregenden« Streben in stärkstem Gegensatz stehende, »alles ausgleichende« Ruhe, die das »Widerspiel« seiner poetischen Sinnes- und Darstellungsweise bildende[156] mathematische Methode, die auch die Welt des Sittlichen eben dieser Methode unterwerfende Behandlung. Gerade das machte ihn zum »leidenschaftlichen Schüler«, zum »entschiedensten Verehrer« des jüdischen Denkers. Er fand hier, was er suchte: Beruhigung seiner Leidenschaften und »eine große und freie Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt«. Ganz besonders fesselte ihn Spinozas »grenzenlose Uneigennützigkeit«, wie sie sich in dessen Satze aussprach: »Wer Gott recht liebt, muß nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe.«[24]
Zunächst freilich sieht es in Goethes Innerem noch wie »ein siedendes und gärendes Chaos« aus. Der auf einer Reise an den Niederrhein neugewonnene Freund Fritz Jacobi in Düsseldorf, in philosophischem Denken und auch in der Kenntnis Spinozas ihm schon weit voran, sucht es zu klären. Wir hören von leidenschaftlicher Freundschaftsverbindung in stillen Mondscheinnächten.
Später in Frankfurt, nachdem er längere Zeit nicht an Spinoza gedacht, treibt ihn das zufällige Auffinden eines gegen diesen gerichteten Pamphlets in der väterlichen Bibliothek sowie die Lektüre von Bayles Artikel »Spinoza« von neuem zu den nachgelassenen Werken des großen Denkers. »Dieselbe Friedensluft wehte mich wieder an.« Nie glaubte er »die Welt so deutlich erblickt zu haben«, wie durch diese von der öffentlichen Meinung der damaligen Zeitphilosophie noch »so gefürchtete, ja verabscheute Vorstellungsart«. Vor allem befriedigte ihn aufs tiefste Spinozas Lehre vom gelassenen Entsagen gegenüber dem Ewigen, Notwendigen, Gesetzlichen, also der sittliche Kern im Spinozismus, wie er selbst ihn später dichterisch ausgedrückt hat in den Versen:
Neben der friedlichen Wirkung, die Spinoza auf sein Inneres übte, fühlt er sich in seinem Zutrauen auf ihn auch dadurch bestärkt, daß auch seine ihm von der Klettenberg her (S. 153) »werten Mystiker«, ja sogar Leibniz des Spinozismus verdächtigt worden waren und der berühmte holländische Anatom Boerhave aus demselben Grunde von der Theologie zur Medizin hatte übergehen müssen. Aber auch für seine religiöse und Naturanschauung wird ihm Spinoza der Führer, oder besser gesagt: kam Spinozas Pantheismus seinem innersten Drang entgegen. Von Kindheit an war er mit einem tiefinnerlichen Gefühl für das Walten der Natur, vom Kleinsten bis zum Größten, insbesondere in allem Lebendigen, begabt gewesen. Die ganze Welt ist ihm Werden, Bewegen, Wirken einer allmächtigen Kraft, das er in der Entfaltung der Blume ebenso erblickt wie in dem Kreisen der Wandelsterne um den Sonnenball. Daher – worauf Gundolf (S. 106) aufmerksam macht – auch seine Vorliebe für Wortverbindungen mit »All«: allgegenwärtig, alliebend, allsehnend, Allumfasser, Allerhalter und ähnliche, und für die damit verbundene religiöse Grundstimmung sein Lieblingswort »heilig«. Nur daß der Allgott, der bei Spinoza sozusagen in mathematischer und doch auch wieder mystischer Ruhe erscheint, bei ihm zu lauter Kraft, Wirksamkeit und Leben wird. Ganz diesem pantheistischen Naturgefühl ist auch sein »Ganymed« entsprungen. In die Zeit seines ersten Spinoza-Studiums fällt auch sein berühmtes pantheistisches Glaubensbekenntnis, das er dem von Gretchen gefragten Faust in den Mund legt. Zuerst die ehrfürchtige Demut vor dem Unendlichen:
Dann die kurze Formulierung:
Darauf das astronomische All:
Gewandt zum Menschlichen, Körperlich-Seelischen:
Und zuletzt das ganz gefühlsmäßige Ende:
Trotz alledem wollte auch er, ebenso wie Herder und Lessing, kein Spinozist heißen: »Denke man aber nicht, daß ich seine Schriften hätte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen.« Denn man werde »dem Verfasser von Faust und Werther« wohl zutrauen, daß er nicht »den Dünkel gehegt, einen Mann vollkommen zu verstehen, der als Schüler von Descartes durch mathematische und rabbinische Kultur sich zu dem Gipfel des Denkens hervorgehoben«.
Den besten Beweis dafür, daß auch ganz andere, entgegengesetzte Gefühle mit dieser ergebungsvollen Resignation in seinem Innern rangen, beweist sein beinahe gleichzeitig (Ende 1774) entstandenes wundervolles »Prometheus«-Gedicht, in dem der uralte Titanentrotz sich auflehnt gegen die vermeinten Götter da droben, die nur in der Hoffnung törichter Kinder und Bettler leben. Es stimmt allenfalls noch mit Spinozas Denkart, wenn die alte Gottesvorstellung tapfer aufgegeben wird, als wenn jenseits der Sonne »ein Ohr« wäre, »zu hören meine Klage«, und »ein Herz wie meins, sich der Bedrängten zu erbarmen«, und ein »ewiges, als Herr über Menschen und Göttern« gleichmäßig waltendes Schicksal angenommen[159] wird. Aber ganz anders gestimmt ist doch die trotzige Zuversicht auf das eigene »heilig glühende Herz«, das »alles selbst vollendet hat«, und die Ablehnung jedes weltflüchtigen Entsagens, weil »nicht alle Blütenträume reiften«. Ein Symbol festen, bewußten, tatenfreudigen Manneswillens und Persönlichkeitsbewußtseins ist vielmehr dieser Prometheus, der »Menschen formt nach seinem Bilde«:
Hier haben wir nicht den in das All aufgehenden, sich selbst aufgebenden, sondern den sich selbst behauptenden Menschen vor uns. Wir können hier leider nicht die Wirkung dieses Gedichts auf die bedeutenderen Zeitgenossen – Lessings haben wir bereits gedacht – verfolgen, sondern erwähnen nur noch das gleichgeartete bekannte von 1777:
Während »Die Grenzen der Menschheit« (1781) im Gegensatz dazu, wieder mehr die Beschränktheit menschlichen Wollens und Wirkens gegenüber dem ewig flutenden Schicksalsstrom betonen:
Endlich das dritte im Bunde jener herrlichen Gedankendichtung mit der Überschrift »Das Göttliche«, entstanden 1783, das in gewissem Sinne beide Gedanken miteinander verbindet. Gegenüber der »unfühlenden« Natur, der über Böse und Gute gleichmäßig leuchtenden Sonne, gegenüber dem blind unter die Menge tappenden Glück steht der Mensch, der »unterscheidet, wählet und richtet«, der allein dem Augenblick[160] Dauer zu verleihen vermag und diese Kraft dazu benutzen soll, »edel, hilfreich und gut« zu sein und »unermüdet das Nützliche und Rechte zu schaffen«.
(1776 bis 1788)
Mit diesen philosophischen Gedichten – eine Gedankenlyrik von ganz anderer Art wie diejenige Schillers und doch nicht minder philosophisch als sie – sind wir bereits in die Weimarer Epoche unseres Dichters getreten, deren erste Jahre in jenem jugendlich-genialen Treiben, das uns allen aus seinem Leben bekannt ist, dahinflossen, um dann einer fleißigen und gewissenhaften Beamtenarbeit im Dienste des kleinen Landes zu weichen, die man oft allzusehr als etwas Besonderes gerühmt hat, während Franz Mehring über sie sarkastisch, aber nicht ohne Grund gemeint hat, daß »jeder passable preußische Landrat« sie auch heute noch leiste »ohne jeden Anspruch auf die Lorbeeren der Mit- und Nachwelt«. Die philosophische Entwicklung unseres Helden tritt zwar in diesen Jahren (1776 bis 1784) zurück, aber sie bleibt nicht stehen. Zeugnis davon die eben besprochenen drei Gedichte, dann aber ein interessantes und bedeutsames philosophisches Fragment, betitelt »Die Natur«, das als Manuskript für einen engeren Kreis zuerst im »Tiefurter Journal« von 1782 erschien; ein »dichterischer Hymnus und ein philosophisches Bekenntnis« zugleich (Gundolf), das wir den Leser Satz für Satz – sie sind alle ebenso voll Lebens wie einfach und allgemeinverständlich – zu lesen bitten.
Wir heben eine Reihe daraus hervor: »Wir leben mitten in der Natur und sind ihr fremd. Wir wirken beständig auf sie und haben doch keine Gewalt über sie. Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben und macht sich nichts aus den Individuen. Jedes ihrer Werke hat ein eigenes Wesen, und doch macht alles eins aus. Sie spielt ein Schauspiel, ob sie es selbst sieht, wissen wir nicht, und doch spielt sie's für uns, die wir in der Ecke stehen. Sie hüllt den Menschen in Dumpfheit ein und spornt ihn ewig zum Lichte. Sie[161] hat keine Sprache noch Rede, aber sie schafft Zungen und Herzen, durch die sie fühlt und spricht. Sie ist ganz und doch immer unvollendet. Sie verbirgt sich in tausend Namen und ist immer dieselbe. Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Sie mag mit mir schalten. Ich vertraue mich ihr.«
Das ist in der Tat, wie Goethe 44 Jahre später davon gesagt hat, eine Stufe zum Pantheismus, und so kehrt er denn auch bald darauf zu dessen philosophischem Vertreter Spinoza zurück. Den äußeren Anstoß hatte wohl der Besuch Fritz Jacobis in Weimar von Mitte bis Ende September 1784 gegeben, der ihm von seinem uns bekannten Spinoza-Gespräch mit Lessing erzählt hatte. Wie Lessing, hatte auch Goethe schon früher (Juni 1784) gegen Charlotte v. Stein erklärt: »Ich begehre keinen freien Willen.« Und: »Wie eingeschränkt ist der Mensch, bald an Verstand, bald an Kraft, bald an Gewalt, bald an Wille!« Diesmal treibt er sein Spinoza-Studium zusammen mit Herder. Im November des Jahres 1784 liest er nun mit Frau v. Stein gemeinsam von neuem Spinozas Ethik, die er am 19. von Jena in einer lateinischen Ausgabe mitbringt, »wo alles viel deutlicher und schöner ist«. »Ich fühle mich ihm sehr nahe,« schreibt er am 11. November an Knebel, »obgleich sein Geist viel reiner als der meine ist.« Die Lektüre Spinozas bildet den ganzen Winter 1784/85 hindurch, neben Herders »Ideen«, einen Teil der vertrauten Abendunterhaltungen mit dem Ehepaar Herder und Charlotte Stein. Herder schreibt darüber am 20. Dezember an Jacobi: »Goethe hat, seit Du weg bist, den Spinoza gelesen, und es ist mir ein großer Probierstein, daß er ihn ganz so verstanden, wie ich ihn verstehe.« Und am 27. desselben Monats meldet Goethe selbst Charlotte, seiner »Seelenführerin«: »Ich las noch zuletzt in unserem Heiligen.«
Noch bedeutsamer spricht sich sein Briefwechsel mit Jacobi aus. Nach einem Briefe vom 12. Januar 1785 liest Goethe den Spinoza immer wieder und »übt sich an ihm«. In seinem Urteil über ihn ist er mehr mit Herder als mit Jacobi einverstanden. Am 9. Juni wird der jüdische Denker von Goethe lebhaft gegen den alten Vorwurf des Atheismus verteidigt, im Gegenteil als theissimus et christianissimus gepriesen.[162] »Er beweist nicht das Dasein Gottes, das Dasein ist Gott«, das man freilich nur in den Einzeldingen und aus ihnen erkennen könne, zu deren näherer und tieferer Betrachtung er sich gerade durch Spinoza aufgemuntert fühle, obwohl vor dessen Blick alle einzelnen Dinge zu verschwinden scheinen. Allerdings – und nun kommen für seine philosophische Sinnesart wieder sehr charakteristische Bemerkungen – habe er nie »die Schriften dieses trefflichen Mannes in einer Folge gelesen«; auch habe ihm nie dessen ganzes Lehrgebäude »völlig überschaulich vor der Seele gestanden«. »Meine Vorstellungs- und Lebensart erlauben's nicht.« Aber wenn er in ihn hineinsehe, glaube er ihn zu verstehen; er stehe für ihn nie mit sich selbst in Widerspruch; was Jacobi über ihn schreibe, scheine ihm nicht im eigensten Sinne Spinozas gedacht. Übrigens habe er (Goethe) nie auf »metaphysische Vorstellungsart Ansprüche gemacht«. Herder werde es demnächst besser ausdrücken. Er (Goethe) suche jetzt auf Bergen und in den Bergwerken Ilmenaus das Göttliche »in Kräutern und Steinen«!
Am 21. Oktober 1785 äußert er nochmals gegenüber Jacobis Spinoza-Büchlein, den Spinozismus dürfe man nur aus sich selbst erklären, und bezeichnet sich selbst wiederum in der ihm eigenen Weise als dessen Anhänger: daß er nämlich, »ohne seine Vorstellungsart von Natur zu haben, doch, wenn die Rede wäre, ein Buch anzugeben, das unter allen, die ich kenne, am meisten mit der meinigen übereinkommt, die Ethik des Spinoza nennen müsse«. Die Briefe von Ende 1785 und Anfang 1786 drehen sich um den bekannten Philosophenstreit Jacobi-Mendelssohn über Lessings Spinozismus, der Goethe, wie aus einem Februarbrief 1786 an Frau v. Stein zu schließen, gegenüber Spinozas Größe recht kleinlich und armselig erscheint.
Bei dieser Gelegenheit nun predigt ihm Jacobi zum ersten Male von – Kants Philosophie vor, natürlich wie er ihn auffaßt: den »wahren Kern« derselben, den Kant selbst noch nicht gekostet habe! So ist der Glaubens- und Gefühlsphilosoph F. H. Jacobi einer der ersten in der zahlreichen Reihe derer, die Kants »wahren Kern« besser als dieser selbst begriffen zu haben beanspruchten. Leider existiert eine Antwort Goethes auf diesen Brief nicht. Einen nachhaltigen Eindruck[163] hat er jedenfalls nicht hervorgerufen; denn in dem nächsterhaltenen Briefe Goethes vom 14. April 1786 berichtet dieser fast nur von seinen mancherlei naturwissenschaftlichen Studien, um bloß einmal die bezeichnende Frage dazwischen zu werfen: »Was machst Du alter Metaphysikus? Was bereitest Du Freunden und Feinden?« (Homerische Wendung. K. V.)
Der letzte Brief Goethes aus dieser ganzen Zeit (5. Mai 1786) geht sogar ziemlich aggressiv gegen Jacobis eigentümliche Glaubensmetaphysik vor mit den Worten: »Gott hat Dich mit der Metaphisik (so!) gestraft und Dir einen Pfahl ins Fleisch gesetzt, mich mit der Phisik (so!) gesegnet.« Und weiter recht antitheologisch: »Ich halte mich fest und fester an die Gottesverehrung des Atheisten (gemeint ist natürlich Spinoza) und überlasse Euch alles, was Ihr Religion heißt und heißen müßt.« Im Gegensatz zu Jacobis »Glauben« will er sich an Spinozas »Schauen« (scientia intuitiva, eigentlich anschauendes Wissen) halten und sein ganzes Leben der Betrachtung der »Dinge« widmen, einerlei, wie weit er damit kommt.
Einverstanden dagegen war er in diesen Jahren ganz mit Herder, wie wir schon in unserem Herder-Abschnitt und soeben wieder an verschiedenen Stellen gesehen haben. Herder überträgt er, weil ihm selbst die nötigen Vorkenntnisse fehlen, die weitere philosophische Verteidigung Spinozas gegen Jacobi. Herders »Ideen« findet er »köstlich«, sagt zu ihrem ganzen Inhalt »Ja und Amen« (20. Februar 1785). Und noch am 17. Mai 1787 schreibt er ihm aus Rom: »Wir sind so nah in unseren Vorstellungsarten, als es möglich ist, ohne eins zu sein, und in den Hauptpunkten am nächsten.« Am 12. Oktober 1787 von ebendort: »Sie (d. h. der dritte Teil der »Ideen«) sind mir als das liebenswerteste Evangelium gekommen, und die interessantesten Studien meines Lebens laufen alle da zusammen. Woran man sich so lange geplackt hat, (das) wird einem nun so vollständig vorgeführt. Wieviel Lust zu allem Guten hast Du mir durch dieses Buch gegeben und erneut.« Und auch vierzehn Tage später, nachdem er den ganzen dritten Teil zu Ende gelesen, findet er alles »durchaus köstlich gedacht und geschrieben«, auch den Schluß »herrlich, wahr und erquicklich«. Weiter kann man doch in Anerkennung und Lob[164] nicht gehen! Und auch anderen gegenüber äußert er sich mit der nämlichen Begeisterung. Auch Herders Büchlein über »Gott« gefiel ihm aufs beste, wie wir bereits S. 91 sahen; es leistete ihm »die beste Gesellschaft«, zusammenstimmend mit dem spinozistischen »Eins und Alles«, dem er gerade jetzt auch in der Botanik auf der Spur war.
Schon mehrmals sind wir in unseren letzten Betrachtungen auf die naturwissenschaftlichen Studien Goethes gestoßen, die dem bisherigen Städter (Frankfurt, Leipzig, Straßburg) ganz natürlich aus der »Land-, Wald- und Gartenatmosphäre« des kleinen Weimar, desgleichen aus seiner amtlichen Beschäftigung mit dem weimarischen Forst- und Bergwesen erwachsen waren, während ihn zur Anatomie und Osteologie (Knochenlehre) unter anderem die zeitweise Teilnahme an den physiognomischen Bestrebungen seines Freundes Lavater anregte. Wissenschaft »auf dem Papier und zum Papier« hat ihn nie gereizt, sondern immer nur die Beziehung zum Lebendigen. Deshalb sind auch seine Sätze nie ganz abstrakt, losgelöst von der sinnlichen Wirklichkeit. Aber seine Naturbetrachtung ist zugleich auch immer philosophisch. Ihm lag stets bloß daran, wie er in seinem Alter einmal zu Eckermann gesagt hat, »die einzelnen Erscheinungen auf ein allgemeines Grundgesetz zurückzuführen«. So sucht er in den verschiedenartigen Organen der Pflanze ein einheitliches Gebilde zu erkennen, das er Blatt nannte, und dessen mannigfaltigen Umbildungen er nun nachspürte, bis er zu seiner, ihm erst in Italien völlig aufgegangenen Lehre von der Metamorphose der Pflanze gelangte, die er bekanntlich auch dichterisch dargestellt hat, die wir jedoch inhaltlich hier nicht näher behandeln können. Lesen Sie über alles das seine vortreffliche »Geschichte meines botanischen Studiums« (1817) nach. Und ähnlich in der Zoologie. Hier entdeckt er, von seinem Glauben an die Einheitlichkeit der Natur zu aufmerksamster Beobachtung des einzelnen getrieben, im Frühjahr 1784 das Dasein des bei den übrigen Tieren vorhandenen Zwischenkieferknochens auch beim Menschen, der damit, dem Affen noch näher verwandt, in die große Ordnung der Natur eingereiht wurde. Er jubelte darüber, daß sich ihm »alle Eingeweide bewegen«. Bis er dann zuletzt in einem Aufsatz »Über[165] einen aufzustellenden Typus zur Erleichterung der vergleichenden Anatomie« (1796) zu einer die heutige Deszendenzlehre in ihrem Grundgedanken schon völlig vorausnehmenden Formulierung gelangt: »Daß alle vollkommenen organischen Naturen, worunter wir Fische, Amphibien, Vögel, Säugetiere und an der Spitze der letzteren den Menschen sehen, alle nach einem Urbild geformt seien, das nur in seinen sehr beständigen Teilen mehr oder weniger hin und her weicht und sich noch täglich durch Fortpflanzung aus- und umbildet.«
So ist Goethe nicht bei jener fast mystischen, jedenfalls pantheistischen Metaphysik, wie sie das Fragment von 1782 mit seiner Unendlichkeit und Tiefe, aber auch Unbestimmtheit des Gefühls enthielt, stehengeblieben, sondern den schwierigen Weg der beobachtenden, rechnenden und vergleichenden Wissenschaft gegangen, um zur klaren und bestimmten Einheit des Naturgesetzes zu gelangen, wie er es dichterisch in die Worte gefaßt hat:
Oder:
Gerade in der keuschen und reinen Hingabe an das einzelne, wie Ernst Cassirer einmal in seinem schönen Buche »Freiheit und Form« sagt, gestaltet sich ihm eine neue Anschauung vom Zusammenhang des Ganzen.
Indem sich der Dichter durch Spinoza in seinem Glauben einerseits an die Einheitlichkeit der gesamten Natur, anderseits an die Notwendigkeit alles Geschehens bestärkt sah, war auch sein innerer Sturm und Drang einigermaßen zur Ruhe gelangt. Ende 1775 schon schreibt er: »Ich lerne täglich mehr steuern auf der Woge der Menschheit. Bin tief in der See.« Die neue Weltfrömmigkeit löst ihn im letzten Grunde schon jetzt von den Neuchristen von der Art Hamanns, F. Jacobis und Lavaters. An den letzteren schreibt er z. B. um diese Zeit: »Alle Deine Ideale sollen mich nicht irreführen.« Er will vielmehr vor allem »wahr sein, gut und böse wie die Natur«.
Die italienische Reise (1786 bis 1788) hat mehr Bedeutung für den Dichter und Künstler Goethe gehabt als für den Philosophen. Für die Weiterbildung seiner philosophischen Anschauungen dürfte das Wichtigste gewesen sein, daß ihm hier der tiefe innere Zusammenhang zwischen Kunst und Natur aufging. Die Natur in der Kunst, die Kunst in der Natur zu entdecken, war in der Tat auch kein Ort so geeignet wie Rom, wo nicht bloß die Denkmäler der Antike, sondern selbst die Landschaft, die Bäume, die Sitten stilisiert erscheinen. So schreibt er denn auch von dort: »Die hohen Kunstwerke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden: alles Willkürliche, Eingebildete fällt zusammen. Da ist die Notwendigkeit, da ist Gott.« Nicht, wie früher, die Kraft des leidenschaftlich bewegten Künstlers oder Dichters, sondern Maß und Regel, kurz die Form wird jetzt als das entscheidende Moment hervorgehoben. Auch in der Kunst dringt er nunmehr, wie schon vorher in der Natur, auf das »Urbildliche« und »Typische«. Das in voller Freiheit, nach seinen eigensten Bedingungen (wie bei Schiller!) wirkende Gesetz bringt das objektiv Schöne hervor.
In einer in Italien entstandenen Abhandlung unterscheidet er als die drei Stufen, die der echte Künstler durchlaufen müsse, die einfache Nachahmung der Natur, die Manier, den Stil. Unter der »einfachen Nachahmung« versteht er die ruhige, treue, sorgfältige und reine Hingabe an den Stoff, den die Natur uns darbietet. Die »Manier« bedeutet in dem »hohen und respektablen« Sinne, in dem Goethe das Wort gebraucht, die Unterwerfung des bloß Stofflichen unter den einheitlichen, persönlichen Künstlerwillen. Der »Stil« endlich stellt den höchst erreichbaren Grad der Kunst durch Überwindung des bloß Stofflichen der Natur einer-, des subjektiven Künstlerbeliebens andererseits dar. Er »ruht auf den tiefsten Grundfesten der Erkenntnis, auf dem Wesen der Dinge, insofern uns erlaubt ist, es in sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen«.
So war Goethe fast als ein antiker Mensch aus Italien zurückgekommen. Und so stammen denn auch, beiläufig gesagt, aus den Jahren nach dieser Rückkehr die stärksten Äußerungen[167] gegen das Christentum, die wir bei ihm gelesen zu haben uns erinnern. Sie finden sich namentlich in den Briefen an Herder. So schreibt am 4. September 1788 der erste Minister an den – Generalsuperintendenten Sachsen-Weimars das oft zitierte Wort von dem »Märchen von Christus« und erklärt, daß er das Christentum »auch von der Kunstseite« recht erbärmlich finde. Am 15. März 1790 will er nach Venedig, um am Palmsonntag »als ein Heide von den Leiden des guten Mannes (!) auch einigen Vorteil zu haben«!
Sittlich und theoretisch aber war aus dem »Gefühls«-Goethe ein »Gedanken«-Goethe geworden, wie Gundolf sich einmal in prägnanter Zusammenfassung ausdrückt. Dem jungen Werther war das Gefühl noch alles gewesen: »Dies Herz, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit und – alles Elends.« Jetzt war diese Werther-Stimmung endgültig überwunden. Fortan herrscht in seiner Seele – von einzelnen Rückfällen vielleicht abgesehen – ein unbezwingliches Vertrauen auf die eigene Kraft zur Lebenssteuerung, wie es der wundervolle Schluß des schon in den ersten Weimarer Jahren entstandenen Gedichts »Die Seefahrt« ausdrückt:
Aber es fehlte noch eine tiefere philosophische Begründung. Diese sollte ihm – Kant geben.
(1789 bis 1794)
Als Goethe 1788 aus Italien heimkehrte, fand er, dank ihres eifrigen Verkünders Reinhold Bemühungen, Jena voll von der neuen Kantischen Lehre und mußte schon deshalb notwendig »von ihr Notiz nehmen«. Aber wichtiger war der innere Drang. Immer schon hatte er sich seine eigene »naturgemäße« Methode gebildet, allein er suchte nach einer »metaphysischen«[168] Grundlage, der seine Denkweise sich angleichen könnte; denn er hatte gemerkt, daß er in einer, wenn auch noch so »fruchtbaren«, Dunkelheit dahinlebte. Nun studierte er, wie durch Wieland bezeugt ist, seit etwa Beginn 1789 mit großem Eifer Kants »Kritik der reinen Vernunft«,[25] wollte auch mit Reinhold »eine große Konferenz darüber« halten, zu der es indes nicht gekommen zu sein scheint. Freilich nur einzelnes sagte ihm zu. So gefiel ihm gleich der Eingang des Werkes, und seinen vollkommenen Beifall fand Kants Satz: Wenngleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung angeht, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Aber ins »Labyrinth« selbst konnte und wollte er sich nicht wagen: »Bald hinderte mich die Dichtungsgabe, bald der Menschenverstand, und ich fühlte mich nirgend gebessert.« Und er versteht manches, z. B. die wichtigen Begriffe Analytisch und Synthetisch, ganz anders wie Kant. Als die Hauptfrage erscheint ihm die psychologische: »Wieviel unser Selbst und wieviel die Außenwelt zu unserem geistigen Dasein beitragen«, während für Kant das Wesentliche die erkenntniskritische Frage nach der Gewißheit unseres Erkennens und damit nach einer Philosophie als Wissenschaft ist. Immerhin glaubt er einzelne Kapitel besser als andere zu verstehen und »gewann gar manches zu seinem Hausgebrauch«.
Er macht sich ein Inhaltsverzeichnis dazu, mit dem er allerdings nicht zu Ende gekommen ist,[26] und dem er eine knapp zusammenfassende und populäre »Kurze Vorstellung der Kantischen Philosophie« von der Hand des Wittenberger Theologieprofessors Reinhard beigelegt hat. Daß er mit kritischem Auge gelesen hat, ergibt sich aus einzelnen im Nachlaß darüber gefundenen Bemerkungen, von denen wir allerdings nicht mit Sicherheit wissen, ob sie schon aus dieser ersten Zeit seines Kant-Studiums stammen. Noch interessanter war mir es, aus Goethes eigenem Handexemplar, das ich mit Erlaubnis des[169] damaligen Direktors des Goethe-National-Museums (d. h. des Goethe-Hauses) zu Weimar Dr. Ruland auf längere Zeit mit mir nehmen durfte, an der Hand seiner zahlreichen Anstreichungen und Unterstreichungen festzustellen, was ihn darin am meisten interessierte. Ich habe darüber im Anhang zu meinem »Kant – Schiller – Goethe« (S. 272 bis 279) einen genauen Bericht gegeben und verweise alle diejenigen Leser darauf, die sich für diese Einzelheiten interessieren. Hier, wo ich keine eingehendere Kenntnis des Kantischen Systems voraussetzen darf, muß ich mich näheren Eingehens enthalten.
Die im Jahre 1788 erschienene ethische Hauptschrift Kants, die »Kritik der praktischen Vernunft«, scheint Goethes Interesse in geringerem Grade erregt zu haben. Er hat sie auch nicht selbst besessen; wohl dagegen die in Kants Ethik am besten einführende populär geschriebene »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« (1785), und zwar, was für die Zeit seiner Kant-Studien bezeichnend ist, erst in der Auflage von 1792.[27]
Weit tiefer wirkte, und zwar alsbald nach ihrem Erscheinen (1790) die »Kritik der Urteilskraft« auf ihn ein. Ihr hat er noch nach 27 Jahren bekannt »eine höchst frohe Lebensepoche schuldig zu sein«. Während die Kritik der reinen Vernunft seinen philosophischen »Dämmerzustand« noch nicht völlig zu heben vermocht, während er die »Metamorphose der Pflanzen« 1790 noch geschrieben hatte, ohne zu wissen, daß sie ganz im Sinne der Kantischen Lehre sei, fand er das neue Werk des kritischen Philosophen in seinen Hauptgedanken seinem eigenen »bisherigen Schaffen, Tun und Denken ganz analog«. Das Wichtigste aus seiner höchst lebendigen Selbstschilderung scheint uns in einer dreifachen Übereinstimmung zu liegen. Einmal, daß auch nach Kant, der ja in seinem[170] Werk die Kritik der ästhetischen mit derjenigen der teleologischen vereinigt hatte, Kunst und vergleichende Naturkunde miteinander nah verwandt seien, sich derselben Urteilskraft unterwerfen. Zweitens (was noch wichtiger), daß jede von beiden, Kunst und Natur, um ihrer selbst willen da sei und beide »unendliche Welten« doch füreinander existierten.[28] Und drittens, daß er seine alte Abneigung gegen die »Endursachen«, d. h. die Verwischung des Kausalitäts-(Ursache-)Prinzips durch den Zweckbegriff nun »geregelt und gerechtfertigt« sah.
Freilich faßte er auch jetzt wieder den Philosophen nach seiner Dichter- und Künstlerart auf, die er schon bezüglich seiner Lektüre der Kritik der reinen Vernunft mit den Worten charakterisiert hatte: »Wenn ich nach meiner Weise über Gegenstände philosophierte, so tat ich es mit unbewußter Naivität und glaubte wirklich, ich sähe meine Meinungen vor Augen.« Er sprach dann auch bloß aus, »was in mir aufgeregt war«, nicht, was er gelesen hatte. Damit stimmt genau, was Schiller über seine erste vertrautere philosophische Unterhaltung mit dem ihm damals noch kühl gegenüberstehenden Nebenbuhler am 1. November 1790 an Freund Körner berichtet. Es ist zugleich für die Wesensart beider Männer so bezeichnend, daß wir das Wichtigste davon hierhersetzen müssen: »Goethe war gestern bei uns, und das Gespräch kam bald auf Kant. Interessant ist's, wie er alles in seine Art kleidet und überraschend zurückgibt, was er las … Ihm ist die ganze Philosophie subjektivisch, und da hört denn Überzeugung und Streit zugleich auf. Seine Philosophie mag ich auch nicht ganz; sie holt zuviel aus der Sinnenwelt, wo ich aus der Seele hole. Überhaupt ist seine Vorstellungsart zu sinnlich und betastet mir zuviel. Aber sein Geist wirkt und forscht nach allen Direktionen und strebt, sich ein Ganzes zu erbauen, und das macht ihn mir zum großen Manne.«
Auch Körnern war Goethe »zu sinnlich in der Philosophie«, was freilich für sie beide (Schiller und Körner) als Gegengift gegen ihre vorherrschend intellektuelle Anlage ganz heilsam sei. Er bezeugt übrigens, daß Goethe, im Unterschied von Schiller, nicht der ästhetische, sondern der teleologische Teil des Werkes zuerst gefesselt habe. Gerade, weil Goethe nun bei den strengeren Kantianern (zu denen allerdings Schiller damals noch nicht zählte) mit seiner eigenartigen Auffassung Kants wenig Anklang fand, studierte er, »auf sich selbst zurückgewiesen«, dessen Buch immer aufs neue. Auch in diesem Falle hat er sein Exemplar mit zahlreichen Strichen – besonders im zweiten, naturphilosophischen Teil – versehen, die ihn »später noch erfreuten«; ja auch mit einzelnen Randbemerkungen. Durch ein Fragezeichen am Rande protestiert er gegen Kants Herabsetzung des Kunst- zugunsten des Naturschönen; außerdem interessieren ihn namentlich die Bestimmung des Kunstzwecks, das Verhältnis der Kunst zur Moral und die Vergleichung der einzelnen Künste in bezug auf ihren Wert. In dem zweiten, die organische Naturwissenschaft behandelnden Teile erregten vor allem die Definition des Naturzwecks, die Selbstorganisation der Natur, das Problem eines »anschauenden« Verstandes und ganz besonders der interessante achtzigste Paragraph vom Verhältnis des mechanischen zum Zweckprinzip mit seiner berühmten Vorausahnung darwinistischer Ideen sein Interesse.
Das nähere Studium der »Kritik der Urteilskraft« führte ihn dann auch wieder zu demjenigen der theoretischen Vernunftkritik zurück. »Beide Werke, aus einem Geist entsprungen, deuten immer eins aufs andere.« Auch Kants »Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft« (die er in den beiden ersten Auflagen von 1786 und 1787 besaß) hatte er damals schon studiert und daraus den Satz gezogen, daß Anziehungs- und Abstoßungskraft zum Wesen der Materie gehören, so daß er beruhigt war, seine Weltanschauung nach dieser Seite hin »unter Kantischer Autorität fortsetzen zu können«.
Dagegen stößt Kants religionsphilosophischer Standpunkt, jedenfalls seine Annahme eines radikalen Hanges zum Schlechten seine damals, wie wir schon von Herder her wissen,[172] besonders antichristlich-hellenisch gestimmte Natur entschieden ab. In einem Briefe an Herder (7. Juni 1793) geht er so weit, zu schreiben, Kant habe »seinen philosophischen Mantel, nachdem er ein langes Menschenleben gebraucht hat, ihn von mancherlei sudelhaften Vorurteilen zu reinigen, freventlich mit dem Schandfleck des radikalen Bösen beschlabbert, damit doch – auch Christen herbeigelockt werden, den Saum zu küssen«. Und einen Monat später gebraucht er dasselbe ebenso unästhetische wie ungerechte Bild.
Trotz allen Interesses, trotz aller Hochschätzung steht indes bis Sommer 1794 zwischen Goethe und dem Kritizismus, ja zwischen ihm und der Philosophie überhaupt noch etwas Fremdes, Unausgeglichenes, wie es noch am 24. Juni dieses Jahres in einem Brief an Fichte zum Ausdruck kommt, dem er sich zum größten Danke verpflichtet fühlen würde, wenn er ihn »endlich mit den Philosophen versöhne, die ich nie entbehren und mit denen ich mich niemals vereinigen konnte«. Diese Versöhnung, soweit sie bei seiner Eigenart überhaupt möglich war, sollte ihm nun zwar nicht von der seinem Wesen ganz entgegengesetzten Person Fichtes kommen, aber von anderer Seite. Er stand unmittelbar vor dem »glücklichen Ereignis« seiner dauernden Verbindung mit Schiller.
(1794 bis 1805)
Unter den Ursachen, die bis zum Jahre 1794 ein näheres Verhältnis zu Schiller nicht aufkommen ließen, führt Goethe in seinen »Annalen« zu eben diesem Jahre als eine der wichtigsten Schillers Begeisterung für die Kantische Philosophie an. Bei Schiller und Kant scheinbar alles Vernunft, Geist, Wille – bei ihm und Herder Erfahrung, Natur, Gefühl. Eine »ungeheure Kluft« schien zwischen den zwei »Geistesantipoden« befestigt zu sein. Und doch sollte es anders kommen. Hatte nicht zum wenigsten gerade Kant sie bisher getrennt, so sollte der nämliche Kant sie nunmehr zusammenführen zu jenem »Bunde«, der bis zu Schillers frühzeitigem[173] Tode »ununterbrochen gedauert und für uns und andere manches Gute gewirkt hat« (Goethe).
Es geschah durch eine wahrscheinlich Ende Juni oder Anfang Juli 1794[29] stattgefundene Unterredung, die uns Goethe selber erzählt hat. Gelegentlich einer zufälligen gemeinsamen Heimkehr aus einer Sitzung der Jenaer Naturforschenden Gesellschaft trägt Goethe dem bisherigen Gegner seine »Metamorphose der Pflanze« vor, läßt vor seinen Augen eine symbolische Pflanze entstehen. Als er geendet, schüttelt Schiller den Kopf und sagt: »Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee.« Goethe, als »hartnäckiger Realist«, ist erstaunt, dann verdrießlich, widerstreitet. Schließlich wird für den Abend Waffenstillstand geschlossen. Aber der »Realist«, der sich nach seinem eigenen Geständnis bei den Einwürfen des »gebildeten Kantianers« Schiller anfangs ganz unglücklich fühlte, ahnt bald, daß zwischen seiner »Erfahrung« und Kants »Idee« etwas »Vermittelndes, Bezügliches« obwalten müsse, ohne es schon klar zu erkennen. Diese Erkenntnis hat ihm in den folgenden Jahren Kants Philosophie gebracht, die nun erst durch einen ihrer geistvollsten Jünger voll und eindringlich auf ihn zu wirken begann.
»Nach diesem glücklichen Beginnen«, um wieder Goethes eigene Worte zu gebrauchen, »entwickelten sich in Verfolg eines zehnjährigen Umganges die philosophischen Anlagen, inwiefern meine Natur sie enthielt, nach und nach.« Und noch deutlicher sprechen die Annalen von 1795 es aus, daß er mit der Kantischen Philosophie und »daher auch« ihrer damaligen Hauptpflanzstätte Jena »durch das Verhältnis zu Jena immer mehr zusammenwuchs«. »Wir wissen nun,« schreibt Goethe nach einer »vierzehntägigen Konferenz« am 1. Oktober an den neugewonnenen Freund, »daß wir in Prinzipien einig sind und die Kreise unseres Empfindens, Denkens und Wirkens teils koinzidieren (zusammenfallen), teils sich berühren.«
Ich bin weit entfernt davon, wie mir es von mehreren Seiten angedichtet worden ist, Goethe um solcher Selbstäußerungen[174] willen zum »Kantianer« machen zu wollen. Dafür sind und bleiben die Naturen beider zu verschieden. »Intuitive« Geister wie Goethe haben, nach der berühmten Charakteristik Schillers in den ersten großen Briefen vom 23. und 31. August desselben Jahres an den neuen Freund, »wenig Ursache, von der Philosophie zu borgen, die nur von ihnen lernen kann«. Philosoph im strengen Sinne des Wortes ist Goethe auch jetzt nicht geworden. Ihm ging das Scheiden und Trennen, das Abstrahieren und Zergliedern, das die Philosophie notwendig betreiben muß, in weit stärkerem Grade als Schiller wider seine Dichternatur. Er fühlt sich auch weiterhin, nach mehrfachem eigenen Bekenntnis, in der speziell philosophischen »Denkart« nicht bewandert. Ja, gegenüber seinem Kunstfreund Heinrich Meyer versteigt er sich einmal zu der Äußerung: »Für uns andere, die wir doch eigentlich zu Künstlern geboren sind, bleiben doch immer die Spekulation sowie das Studium der elementaren Naturlehre« – womit die theoretische Physik im Gegensatz zu der von Goethe bevorzugten Biologie gemeint ist – »falsche Tendenzen.« Auch braucht er öfters Kantische Begriffe in seinem eigenen, von Kant abweichenden Sinne. Und gegenüber Schiller fühlt und bekennt er sich stets gewissermaßen als das philosophische Naturkind, dem jener als der theoretische Helfer und Lenker, Autorität und Richter in allen philosophischen Fragen gilt, wie Schiller mit Stolz einmal seinem Kollegen Fichte meldet (3. August 1795).
Allein die Philosophie wird ihm doch »immer werter«, weil sie ihn »täglich immer mehr lehrte, mich von mir selbst zu scheiden«, und weil sie »durch die höhere Vorstellung von Kunst und Wissenschaft, welche sie begünstigte«, ihn »vornehmer und reicher« machte. Er ist nicht mehr der alle Philosophie abweisende »steife Realist« von früher (an Jacobi, 17. Oktober 1796), sondern bekennt, daß er durch »treues Vorschreiten und bescheidenes Aufmerken« von jenem »steifen Realismus« und einer »stockenden Objektivität« dahin gekommen sei, Schillers philosophische Ausführungen vom Tage vorher als »mein eigenes Glaubensbekenntnis unterschreiben« zu können (an Schiller 13. Januar 1798). Und diese »Ausführungen« sind eben doch kritische Philosophie, wenn auch[175] mit Schillerscher Färbung. Vor allem erregen sein höchstes Wohlgefallen die »Ästhetischen Briefe«, in denen er, was er »für recht sei langer Zeit erkannt, was ich teils lebte, teils zu leben wünschte, auf eine so zusammenhängende und edle Weise vorgetragen fand«. Mit Eifer wird alles Neue von Kant gelesen und besprochen; ja Goethe ist es jetzt zuweilen, der den Freund auf eine neu erschienene Schrift des Königsberger Philosophen aufmerksam macht.
Natürlich werden auch andere, alte und neue, Philosophen besprochen und studiert. So zum Beispiel im April 1797 Aristoteles' Politik. Anfangs häufig gemeinsam mit den Brüdern Humboldt. Später auch in einer Art philosophischem Kränzchen, an dem die in Jena habilitierten jungen Philosophen Niethammer, Schelling und Hegel teilnehmen, von denen der Erstgenannte ihm in der zweiten Hälfte des Jahres 1800 auch die neueste Philosophie in sogenannten Colloquiis (Unterredungen) vorträgt. Von den neuesten Philosophen ist ihm der durch und durch subjektive Fichte am unsympathischsten. Er bekennt, dessen Denkweise »nur mit Mühe und von ferne folgen« zu können. »An eine engere Verbindung mit ihm ist nicht zu denken,« meint er 1798 ähnlich wie Schiller. Das bezeugt auch Goethes Handexemplar von Fichtes »Begriff der Wissenschaftslehre« (1794), das von dem Dichter mit zahlreichen Bleistiftstrichen, Fragezeichen und einzelnen Randbemerkungen versehen ist. Bedenklich erscheint ihm besonders, daß alles mögliche menschliche Wissen in der »allgemeinen Wissenschaftslehre« schon enthalten sein soll; unter Fichtes »ersten Grundsatz«: »Ich bin Ich« schreibt Goethe spöttisch: Alles ist alles; neben Fichtes Wendung: »die von uns unabhängige Natur« die Worte: »aber doch mit uns verbunden, deren lebendige Teile wir sind« u. ä.
Auch von Schelling hatten die Freunde anfangs mehr erhofft. Schiller war freilich von dieser neuen Art Idealismus noch mehr enttäuscht als Goethe, der z. B. am 31. Dezember 1798 entschuldigend bemerkt, Schellings Ideen müßten »freilich noch manchmal durchs Läuterfeuer«. Schellings Philosophie ist bekanntlich aus dem Läuterfeuer überhaupt nicht herausgekommen! Bei Gelegenheit von dessen Naturphilosophie gibt unser Dichter übrigens einmal eine gute[176] Charakteristik seines eigenen naturphilosophischen Standpunktes. Während die Naturphilosophen à la Schelling und Hegel alles »von oben herunter«, die Naturforscher im engeren Sinne alles »von unten hinauf« leiten wollten, so finde er selbst als Naturschauer sein Heil »nur in der Anschauung, die in der Mitte liegt« (an Schiller, 27. und 30. Juni 1798); wie er denn schon sechs Jahre vorher einen in derselben Richtung gehaltenen Aufsatz »Der Versuch als Vermittler zwischen Subjekt und Objekt« geschrieben hatte. – Hegel, der zur Zeit von Schillers Tod allein noch von dem spekulativen Dreiblatt (Fichte, Schelling, Hegel) in Jena war, wurde es, wie Goethe klagt, schon damals schwer, sich anderen mitzuteilen, und er hatte sein erstes bedeutendes Werk noch nicht geschrieben.
Von Herder entfernt sich, wie wir schon in unserem Herder-Abschnitt sahen, Goethe durch seine Freundschaft mit Schiller immer mehr. Überhaupt fühlt er mit Schiller und den wenigen anderen Freunden (den Humboldts, H. Meyer) sich als eine geschlossene Partei gegenüber den Streithändeln Kants mit dem gesamten Herderschen Kreise, den Geschichtsphilosophen von der Art Jacobis und Goethes eigenem Schwager Schlosser und den Berliner Aufklärern à la Nicolai auf der einen, der beginnenden Romantik auf der anderen Seite. Es sind die unseren beiden Dichter-Klassikern mit der klassischen Philosophie (Kants) gemeinsamen Gegner, denen der lustig-scharfe Xenienkrieg des Jahres 1796 gilt. Noch stärker fast tritt das gelegentlich der letzten gehässigen Angriffe Herders gegen den Kritizismus hervor, weshalb denn auch die Wut des gesamten Herderschen Kreises gegen unsere beiden Weimarer Dioskuren ging.
Aus den letzten mit Schiller gemeinsam zu Weimar verlebten Jahren sind begreiflicherweise nur wenige briefliche Zeugnisse über ihre Stellung zur Philosophie erhalten. Wennschon bei Schiller, so tritt erst recht bei Goethe der spezielle Kantianismus in diesen bei beiden überhaupt mehr dem dichterischen Schaffen gewidmeten Jahren zurück. Aber das neue philosophische Fundament, das ihm gegenüber seinem früheren teils Spinozismus, teils »Realismus« der kritische Idealismus gegeben hatte, ist geblieben.
Die ungeheure Lücke, die Schillers Hinscheiden in Goethes geistige Existenz riß – er verlor mit ihm, wie er am 1. Juni 1805 an Zelter schreibt, »die Hälfte seines Daseins« –, machte sich natürlich in philosophischer Hinsicht besonders fühlbar. Trotzdem ist seine Bemerkung in den Annalen von 1817, daß er sich seitdem »von aller Philosophie entfernt« habe, nicht buchstäblich aufzufassen. Gewiß, zahlreiche andere Interessen nehmen ihn wieder mehr als in dem stark philosophischen Jahrzehnt 1790 bis 1800 in Beschlag. Aber das philosophische Interesse verschwindet doch fortan nie völlig mehr. Ich habe an anderer Stelle[30] – zum ersten Male in der Geschichte der Goethe-Literatur – Jahr für Jahr genau zusammengestellt, was an Goethes philosophischen Studien, Äußerungen und Beziehungen aus den 27 Jahren von Schillers Tod bis zu seinem eigenen Ende (1805 bis 1832) bezeugt ist, weil nur so ein begründetes, nicht phrasenhaft und ins Blaue hinein phantasierendes Urteil über seinen philosophischen Standpunkt in diesen Jahren zu gewinnen war. Allein ich will mich hier nicht wiederholen und schon der Kürze halber nur eine summarische Zusammenfassung der wichtigsten dort gewonnenen Ergebnisse geben.
Goethe fährt auch in diesem Zeitraum fort, neue philosophische Erscheinungen von Belang zu lesen, studiert z. B. von 1807 bis 1809 für seine »Geschichte der Farbenlehre« zahlreiche ältere und neuere Philosophen an der Hand von Buhles (eines Göttinger Professors) »Philosophiegeschichte« und hebt in seiner Schrift, außer der berühmten vergleichenden Schilderung der beiden antiken Philosophenhäupter Plato und Aristoteles, namentlich die Bedeutung des lange verkannten mittelalterlichen Neuerers Roger Baco kräftig hervor. Er bildet sich ein selbständiges Urteil in dem von 1811 bis 1813 währenden Philosophenstreit zwischen der Glaubensphilosophie seines alten Freundes Jacobi und dem damaligen Pantheismus des wandlungsfähigen Schelling zugunsten des letzteren, wobei er sich zeitweise wieder von seiner alten Liebe Spinoza und von Giordano Bruno beeinflußt zeigt. Er steht in den Jahren 1815 bis 1819 in näheren[178] Beziehungen zu dem damals in Weimar lebenden jungen Schopenhauer und liest im letztgenannten Jahre dessen eben erschienene »Welt als Wille und Vorstellung«. Wobei sich jedoch, bei aller »wechselseitigen Belehrung«, die innere Verschiedenheit beider bald so stark bemerkbar macht, daß sie wie zwei Freunde, von denen »der eine nach Norden, der andere nach Süden will«, einander »schnell aus dem Gesicht« kommen. Über den inzwischen zu immer größerer Berühmtheit aufgestiegenen Hegel hat er sich zu verschiedenen Zeiten verschieden, im ganzen aber doch mehr ablehnend als zustimmend ausgesprochen. Auch die Entwicklung der auswärtigen Philosophie, z. B. den Eklektizismus des Franzosen Viktor Cousin und die Nützlichkeitslehre des Engländers Bentham, verfolgt er mit Teilnahme.
Die Vorarbeiten zu der höchst lesenswerten »Geschichte meines botanischen Studiums« führen ihn dann im Jahre 1817 noch einmal zu erneutem Kant-Studium zurück. Dem verdanken wir eine Reihe kleinerer, später unter seine Schriften »Zur Naturwissenschaft im allgemeinen« aufgenommene Aufsätze: »Einwirkung der neueren Philosophie«, »Anschauende Urteilskraft«, »Bedenken und Ergebung«, »Bildungstrieb«. Der erste gibt uns nächst einem anderen, »Glückliches Ereignis« betitelten, der seine Verbindung mit Schiller behandelt und später den Annalen von 1794 eingefügt wurde, die reichsten, in unserer Darstellung benutzten historischen Aufschlüsse. Der zweite gewährt das meiste systematische Interesse. Wir gewahren hier den Punkt, wo der Dichter und »Naturschauer« über die verstandesmäßige Erkenntnis des reflektierenden Philosophen zum »schauenden« Urteil des Künstlers hinstrebt.
Allein Goethe hat nicht vergessen, was er der kritischen Philosophie verdankt. Gerade in seinem letzten Lebensjahrzehnt gedenkt er ihrer häufig mit dankbarer Wärme. Er betitelt den »Alten vom Königsberge« mit den lobendsten Ausdrücken wie: unser Meister, der köstliche Mann, unser herrlicher, unser vortrefflicher Kant. Wir wollen aus den von uns an anderer Stelle wiedergegebenen Zeugnissen über ihn nur die beiden letzten, aus seinem letzten Lebensjahr stammenden anführen. Am 8. Juli 1831 gibt er in einem Brief an[179] den Musiker Zelter den Künstlern der Gegenwart den Rat, wenn anders sie sich »Natur und Naturell« bewahren wollten, zu Kant zurückzukehren und dessen Kritik der Urteilskraft zu studieren. Und am 18. September des gleichen Jahres zieht der mehr als Zweiundachtzigjährige in einem Brief an Staatsrat Schultz gleichsam die Summe dessen, was die Philosophie des klassischen deutschen Idealismus ihm gewesen, mit den Worten: »Ich danke der kritischen und idealistischen Philosophie, daß sie mich auf mich selbst aufmerksam gemacht hat; das ist ein ungeheurer Gewinn.« Freilich vermißt er an ihr, an der »idealistischen« der Fichte, Schelling, Hegel wohl noch mehr als an der kritischen Kants, das unmittelbar anschauliche Ergreifen des Gegenstandes: »Sie kommt aber nie zum Objekt; dieses müssen wir so gut wie der gemeine Menschenverstand zugeben, um vom unwandelbaren Verhältnis zu ihm die Freude des Lebens zu genießen.«
Suchen wir uns nun, nach dieser langen geschichtlichen Entwicklung, in einem letzten Abschnitt in knapper Zusammenfassung klarzumachen, was von philosophischen Gedanken in Goethes Weltanschauung dauernd haften geblieben ist.
Bei Lessing und Herder, ja auch noch bei Schiller ließ sich ihre philosophische Weltanschauung in wenigen großen Zügen zusammenfassen; bei Goethe ist das nicht möglich. Selbst nicht, wenn wir – seine von uns bereits geschilderte frühere Entwicklung beiseite lassend – auf den reifen, auf den alten Goethe, auf den Dichter »in der Epoche seiner Vollendung«, wie Otto Harnack es in dem Titel seines gleichnamigen Buches ausgedrückt hat, uns beschränken. Dafür ist Goethe zu vielseitig, man möchte beinahe sagen: zu allseitig. Außerdem hat er seine philosophischen Gedanken noch weniger als die anderen systematisch oder auch nur zusammenhängend entwickelt; sondern nur gelegentlich in Briefen, Gesprächen, Dichtungen, Tagebüchern und sonst hingeworfenen Gedanken, in zahllosen »Maximen und Reflexionen« ihnen Ausdruck gegeben. Wir können also mit unserem folgenden Versuch nur die allgemeine Richtung angeben, die seinen allgemein-philosophischen,[180] ethischen, politischen, religiösen, ästhetischen Anschauungen zugrunde liegt; und auch dies nur in groben Umrissen. Der aufmerksame Leser des Bisherigen wird sich danach hoffentlich doch ein einigermaßen anschauliches Bild von Goethes »Philosophie« machen können.
1. Von dem, was uns heute als die unentbehrliche Grundlage jeder haltbaren Philosophie erscheint, von einer allem Darauflos-Philosophieren voraufgehenden eindringenden Erkenntniskritik, ist bei ihm sehr wenig zu spüren. Philosophie ist für ihn nicht, wie für Kant, in erster Linie Wissenschaft, die auf das Faktum von Mathematik und mathematischer Naturwissenschaft sich gründet. Er steht vielmehr der ersteren gleichgültig, der letzteren, zumal in ihrer von den Zeitgenossen fast allgemein akzeptierten Verkörperung in Newtons Methode, sogar beinahe feindlich gegenüber. Das Zerlegen in Berechenbares und Meßbares, welches das Ziel der modernen Physik ist, widerstrebt seiner durchaus auf das Organische gerichteten, nicht dem Allgemeinen, sondern dem Einzelnen, nicht dem Sein, sondern dem Werden zugewandten Natur. Und wenn er auch durch Schiller, den Gundolf einmal den »Gesandten« aus dem »Reiche Kants« an Goethe nennt, für den idealistischen Grundgedanken von der Spontaneität, d. h. selbständigen Zeugungskraft des menschlichen Geistes, gewonnen wurde, so blieb doch sein Denken, vor allem in der äußeren Natur, aufs engste mit den Gegenständen verbunden, weshalb es denn auch unter seinem Beifall der Anthropologe Heinroth 1823 geradezu als »gegenständlich« bezeichnen konnte.
Oder vielmehr, er sucht eine Verbindung zwischen beiden. In dem für die Kenntnis seiner philosophischen Methode besonders wichtigen, 1799 für die »Propyläen« verfaßten Aufsatz »Der Sammler und die Seinigen« heißt es z. B. ganz idealistisch: »Es gibt keine Erfahrung, die nicht produziert, hervorgebracht, erschaffen wird.« Selbst das Göttliche würden wir nicht kennen, »wenn es der Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte«. Und in den »Sprüchen in Prosa« sagt er: »Suchet in euch, so werdet ihr alles finden, und erfreuet euch, wenn da draußen, wie ihr es immer heißen möget, eine Natur lieget, die ja und amen zu allem sagt,[181] was ihr in euch selbst gefunden habt.« Daher auch, nebenbei bemerkt, sein Spott gegen die »Philister«, die das »Innere der Natur« für ein undurchdringliches Geheimnis hielten. Rudolf Steiner in seinem Büchlein »Goethes Weltanschauung« will darin einen Gegensatz zum Kritizismus erblicken. Das Gegenteil ist der Fall. Vielmehr wendet sich gerade Kant in der »Kritik der reinen Vernunft« (2. Auflage, S. 333 f.) gleichfalls ausdrücklich gegen die »ganz unbilligen und unvernünftigen« Klagen mancher Leute, daß »wir das Innere der Dinge gar nicht einsehen«, und erklärt dazu: »Ins Innere der Natur dringt Beobachtung und Zergliederung der Erscheinungen, und man kann nicht wissen, wieweit dieses mit der Zeit gehen werde.« Diesen vielsagenden Satz hat Goethe in seinem Handexemplar doppelt angestrichen: so daß vielleicht anzunehmen ist, daß er gerade durch ihn zu seinem »heiteren Reimstück« vom »Inneren der Natur« angeregt wurde. In gleichem Sinne erklärt er an einer anderen Stelle: »Aber wie weit und wie tief der Menschengeist in seine und der Welt Geheimnisse zu dringen vermöchte, werde nie bestimmt noch abgeschlossen.«
Mit dieser Voraussetzung eines immer weiteren Vorwärtsdringens echter wissenschaftlicher Forschung ist die von Anfang an in Goethes Natur liegende, aber durch Kant in ihm bestärkte Neigung zu kritischer Selbstbescheidung gegenüber dogmatischem Allwissenheitsdünkel durchaus vereinbar, wie sie sich vor allem in dem berühmten Spruche (Nr. 1019) ausprägt: »Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren.« Wozu man jedoch die beiden ihn umrahmenden Sprüche hinzunehmen muß: »Je weiter man in der Erfahrung fortrückt, desto näher kommt man dem Unerforschlichen; je mehr man die Erfahrung zu nutzen weiß, desto mehr sieht man, daß das Unerforschliche keinen praktischen Nutzen hat.« (1018.) Und andererseits: »Derjenige, der sich mit Einsicht für beschränkt erklärt, ist der Vollkommenheit am nächsten.« (1020.) Auch dies letzte Wort ist gesund kritisch gedacht und durchaus nicht im Sinne skeptischen Verzichts auf die Wissenschaft aufzufassen. Oder gar im Sinne der Mystik. Denn wie wenig auch Goethe, schon als Dichter, geneigt ist,[182] das Rätselhafte, das Geheimnisvolle, das »Wunder« in uns und der äußeren Natur einfach wegzuleugnen, so bedeutet es doch für ihn niemals ein Durchbrechen der Naturgesetze, sondern höchstens eine Grenze, bis zu der unser Erkennen hinanführt.
Die eben zitierte Wendung vom »praktischen Nutzen« endlich, die sich in anderen Sprüchen zu allgemeineren Sätzen erweitert, wie: »Was fruchtbar ist, ist wahr«, »Ich halte für wahr, was mich fördert«, »Wir sind aufs Leben, nicht auf die Betrachtung angewiesen«, scheinen freilich Goethe ganz in die Nähe des heutigen »Pragmatismus« eines James und Bergson oder, wenn man will, auch Nietzsches zu rücken. Allein dem stehen doch genug Aussprüche anderer Art gegenüber, wie der aus dem »Faust«, daß »Vernunft und Wissenschaft« des Menschen »allerhöchste Kraft« darstellen, die beweisen, daß ihm der Geist über das Blut, das apollinisch-klare Element, um mit Nietzsche zu reden, über das dionysisch-trunkene geht. Wir bekennen uns, sagt er einmal, zu »dem Geschlecht, das aus dem Dunklen ins Helle strebt«. Und derselbe Gundolf, der ihn eben jenem Pragmatismus annähern will, hat, wir sahen es S. 167, von seiner Läuterung aus dem Gefühls-Goethe der jungen in den Gedanken-Goethe der reiferen Jahre gesprochen, hat mit der Neigung zur Übertreibung, die sein geistvolles Werk kennzeichnet, erklärt, daß Goethe, »der Anlage nach einer der dunkel-drangvollsten, gefühlsüberschwenglichsten, widerrationalsten Menschen, sich zur Heilung in die intellektuelle Klarheit begab, sich zur vollkommensten Denkordnung erzog und es fertig brachte, die ganze dunkle angeborene Tiefe seiner Lebensfülle in helle Begriffe, Einsichten, Reflexionen, Maximen, Sentenzen heraufzuholen«, so daß er in ein ganz anderes geistiges »Klima« kam, das der »Ideale und Grundsätze« statt der »Qualen und Wonnen«. Diese größere »Helligkeit« der Begriffe hat ihm eben die Philosophie, hat ihm, wenn es Gundolf auch nicht Wort haben will, in erster Linie Kants Kritizismus gegeben; wie es sich auch einmal in Goethes Gelegenheitsäußerung zu dem jungen Schopenhauer widerspiegelt: »Wenn ich eine Seite im Kant lese, wird mir zumute, als träte ich in ein helles Zimmer.«
2. Die »Ideale und Grundsätze« führen uns auf ein anderes Gebiet: das der Ethik. Auch hier läßt sich der Unterschied zwischen dem Prediger der Natur (Goethe) und denen der Freiheit, die zugleich sittliche Gebundenheit unter die Pflicht ist (Kant, Schiller), natürlich nicht verwischen. Wir erinnern an des ersteren entschiedene und fortdauernde Abneigung gegen den radikalen Hang zum Bösen, der dem Christentum und Kant zufolge in der Menschennatur unausrottbar liegen soll. Demgegenüber bekennt Goethe bis zum letzten Augenblick, und das denn doch wieder in Übereinstimmung mit Kant, im Gegensatz dagegen zu dem Nirwana des Buddhismus, der Maja der Brahminen und dem irdischen Jammertal des Christentums: »Wie es auch sei, das Leben, es ist gut.« Goethe ist und bleibt überhaupt ein durchaus diesseitsfroher Mensch.
»Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt«, ist seine theoretische Weltansicht, und daraus entspringt unmittelbar sein praktischer Glaube: »Das Drüben kann mich wenig kümmern«; vielmehr:
Die Beschäftigung mit Unsterblichkeitsfragen ist seiner Meinung nach »für vornehme Stände und besonders für Frauenzimmer, die nichts zu tun haben. Ein tüchtiger Mensch, der schon hier etwas Ordentliches zu sein gedenkt, und der dafür täglich zu streben, zu kämpfen und zu wirken hat, läßt die künftige Welt auf sich beruhen und ist tätig und nützlich in dieser.«
Gewiß, Goethe verkörpert das sittliche Ideal am liebsten in weiblicher Gestalt: Iphigenie, Leonore, Natalie und anderen. Aber es muß doch jedem Unbefangenen auffallen, wie stark und häufig er sich, seit seiner Freundschaft mit Schiller, namentlich aber in seinen späteren Jahren, zu den großen Grundgedanken von Kants Ethik bekannt hat. So zu dem Pflichtbegriff: »Erfüllte Pflicht empfindet sich immer noch als Schuld, weil man sich nie ganz genug getan« (Spruch 44), zum kategorischen Imperativ, der in der Naturforschung ebenso am Platze sei wie im Sittlichen (915), zur Anerkennung des guten Willens als »Hauptfundaments[184] des Sittlichen«. Und vor allem auch zum Gedanken der sittlichen Autonomie (Selbstgesetzgebung): Pflicht ist, »wo man liebt, was man sich selbst befiehlt« (565). Denn
das Gewissen, »das keines Ahnherrn bedarf«, mit dem »alles gegeben ist«, das »nur mit der inneren eigenen Welt zu tun hat«.
Sicherlich, die Motive sind vielfach bei Kant und Goethe, ihrer völlig entgegengesetzten Naturanlage entsprechend, sehr verschieden, und die methodische Begründung fehlt bei dem Dichter-Denker durchaus. Aber in ihrem Ergebnis kommen sie doch, wie man sieht, mannigfach überein.
3. Das stimmt denn auch bis zu einem gewissen Grade für ihre Religionsauffassung. Gewiß sind auch hier grundlegende Unterschiede, ja Gegensätze vorhanden. Goethes vielseitigem Wesen entspricht es recht, wenn er sie auf einem Zettel seines Nachlasses einmal in die Worte kleidet: »Wir sind naturforschend Pantheisten, dichtend Polytheisten, sittlich Monotheisten.« Von Spinoza her, aber auch aus seinem innersten Gefühl heraus hat er sich auch später gegen einen Gott gewehrt, der nur »von außen stieße, das All im Kreis am Finger laufen ließe«. Sein Gott lebte und webte in der Natur, war schließlich nichts anderes als deren geistiger Inbegriff. Aber daneben ist ihm doch die Gottheit auch Verkörperung der höchsten Sittlichkeit. In seinem Handexemplar der »Kritik der Urteilskraft« schreibt er zu einer Stelle des § 86, wo ihr Verfasser den Gottesglauben rein auf die Moral baut, ein optime (»sehr gut!«) an den Rand, und wenige Seiten später: »Gefühl von Menschenwürde« objektiviert (zum Gegenstand gemacht) = Gott.
Im übrigen hat er in »Wilhelm Meisters Wanderjahren« das schöne Wort von den drei Stufen der Ehrfurcht gesprochen: der Ehrfurcht vor dem über uns, vor dem unter uns und vor uns selbst, also vor dem in uns. In jenem Wort von der ruhigen Verehrung des »Unerforschlichen« sprach sich die erste Ehrfurcht aus; mit ihr verwandt ist auch das Gefühl dankbarer Hingabe in den bekannten Zeilen des Vierundsiebzigjährigen:
Aber die höchste Art der Ehrfurcht ist ihm doch eben die vor dem Göttlichen in uns selbst. Und darum ist auch der Grundgedanke seiner größten Dichtung, des Faust, ganz Kant und Schillers Denkart entsprechend, der der Selbsterlösung: der Erlösung nicht durch irgendeine von außen kommende Gnade, sondern durch die eigene Tat: sei es die Tat des Gedankens (»Wer immer strebend sich bemüht …«), sei es die des tätigen Wirkens für andere, womit der alte Faust sein Leben beschließt. Und ebenso in der Iphigenie: »Alle menschlichen Gebrechen Sühnet reine Menschlichkeit.«
4. Obwohl Goethe als einziger unter unseren vier Klassikern jahrzehntelang, offiziell oder inoffiziell, ein höheres Staatsamt bekleidet hat, ist gerade sein Wesen im Grunde doch unpolitisch. Das tritt schon in der in der Hauptsache lyrischen Art seiner Dichtkunst und vielleicht noch mehr in seinen historischen Dramen wie »Götz« und »Egmont« hervor, die zwar vielerlei politischen Stoff enthalten, aber letzten Endes doch unpolitischen Charakter tragen. Auch in der Geschichte ist ihm das Individuelle und Biographische interessanter als das Politische und Kulturgeschichtliche. Die größten politischen Ereignisse seiner Zeit: die große Revolution von 1789, die Knechtung Europas durch Napoleon und die Wiederbefreiung von ihm haben ihn verhältnismäßig kalt gelassen. Auffallend ist insbesondere, wie wenig die weltgeschichtliche Französische Revolution, im Vergleich mit Kant, Schiller, aber auch dem ihm in der historischen Anschauung sonst wesensverwandteren Herder (vergl. S. 92) ihn innerlich gepackt hat. Denn sein vielzitiertes Wort gelegentlich der Kanonade von Valmy, daß mit diesem Tage eine neue Epoche der Weltgeschichte beginne, oder der sechste Gesang von Hermann und Dorothea können doch nicht entschuldigen, daß ein so weltbewegendes Ereignis ihn nur zu so kläglichen dichterischen Erzeugnissen wie »Der Großkophta«, »Die Aufgeregten« und »Der Bürgergeneral« veranlassen konnte. Im Grunde ist er eben in politischen Dingen eine durchaus konservative Natur, wenn auch natürlich nicht im landläufigen Sinne[186] geistigen Rückschritts, sondern etwa im Sinne eines aufgeklärten Absolutismus gewesen. Politische Zielsetzungen, Forderungen, »Lockrufe« (Gundolf) wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder auch Patriotismus, Befreiungskampf, haben für ihn, den im wesentlichen bloß Betrachtenden, keine Schlagkraft besessen. Unordnung erscheint ihm unerträglicher als selbst Ungerechtigkeit. Die politische Geschichte hat er gelegentlich als einen bloßen »Mischmasch von Irrtum und Gewalt« bezeichnet. Die große Revolution seiner Tage hatte in seinen Augen nur den Nachteil, gleich der religiösen des sechzehnten Jahrhunderts: »ruhige Bildung zurückzudrängen«.
Über sein Weltbürgertum brauchen wir uns nicht weiter zu verbreiten. Das ist ihm mit Lessing, Herder und Schiller gemein. Dagegen hat man ihn neuerdings wohl mit Bezug auf die »Pädagogische Provinz« in »Wilhelm Meisters Wanderjahren« zum Sozialisten machen wollen. Diese seine pädagogisch-soziale Utopie, etwas seinem sonstigen auf die unmittelbare Wirklichkeit gerichteten Wesen ganz Widerstrebendes, erinnert ihrer Gattung nach vielleicht am ehesten an Platos »Staat«, ist aber weit unlebendiger, schemenhafter und nüchterner als dieser. Im Grunde ist sie wohl, ähnlich wie Hegels gleichzeitige Staatsphilosophie, eine Mahnung an die in fast reinem Individualismus aufgehende Zeit, sich des Gemeinschaftlichen zu erinnern, wie er schon in dem bekannten Distichon von 1797 gemahnt hatte:
Jeder soll sich in einem Fache, am besten in einem Handwerk, aufs beste ausbilden, das gibt »höhere Bildung als Halbheit im Hundertfältigen«; und dann warten, welche Stelle im Gemeinleben ihm zugeteilt wird. Die Leitung seiner in letzter Linie zu einem »Weltbund« sich zusammenschließenden idealen Gesellschaft sollen, ähnlich wie bei Plato, weitschauende, das Ganze der gesellschaftlichen Zusammenhänge überblickende, über Sonderwünsche und -interessen erhabene Greise haben. Schon der Nebentitel »Die Entsagenden« zeigt das Unfrische, Resignierende des Entwurfs. Von wirtschaftlichen Grundlagen[187] des neuen Gemeinwesens ist keine Rede, nur von Religion und Sitte, Obrigkeit und Polizei wird einiges gesagt.
Die Hauptsache ist die Erziehung, die in einer großen Anstalt gemeinschaftlich stattfindet, damit der Knabe frühzeitig »selbstische Vereinzelung« aufgebe. Auf körperliche Ausbildung und praktische Arbeit wird großer Wert gelegt, der ganze Unterricht auf Anschauung gegründet, auch die Sprachen lebendig-praktisch übermittelt, alles tote Wortwissen vermieden; Willkür und Laune übrigens nicht geduldet. Das eigentliche Leitmotiv des »Weltbundes« ist Gemeinnützigkeit, »trachte jeder überall sich und anderen zu nützen« sein Wahlspruch. Nur nach dem, was einer leistet, wird gefragt, jeder Standesunterschied soll aufgehoben sein. Alles, auch das äußere Milieu: Landschaft, Wohnung, Kleidung, Gerät wird von oben herab bestimmt. Interessant ist das Voraussehen eines wesentlich sozialen, technischen und werktätigen Zeitalters.
Daß Goethe auch in seinen jüngeren Jahren nicht ohne soziales Empfinden war, zeigt eine noch wenig bekannte Stelle aus einem Briefe vom März 1779 an Frau von Stein, wo er klagt, er komme in der Arbeit an seinem Humanitäts-Drama, der »Iphigenie«, nicht recht vorwärts, weil ihn dabei beständig die Gedanken an die – hungernden Weber in Apolda störten. Ebendahin gehört ja auch das: »Wer nie sein Brot mit Tränen aß« und, in anderem Zusammenhang, das: »Vom Rechte, das mit uns geboren, von dem ist leider nie die Frage.« So finden wir auch in dem Plane der »Wanderjahre« nicht bloß, wie es bei einem Goethe selbstverständlich, allerlei anregende, sondern auch sozialistische Gedanken, die er zum Teil mit dem gleichzeitigen Saint-Simonismus in Frankreich gemein hat. Aber als Ganzes wirkt doch die in Romanform weitläufig, oft bis ins Pedantische ausgeführte Utopie schemenhaft und weltabgewandt, daher auf die Dauer – langweilig. Wäre nicht Goethe der Verfasser, man würde sie nicht lesen. An eine praktische Wirkung des Romans, den er übrigens erst in seinem achtzigsten Lebensjahr vollendete, hat der Dichter ohnehin nicht gedacht; er läßt zum Schlusse die Mitglieder seiner Gesellschaft, des zähen Schlendrians in der Alten Welt müde, zur Fortsetzung ihrer Arbeit – nach Amerika auswandern.
Wir erblicken das sozialistische Ideal, wenn wir es denn einmal mit Goethe in inneren Zusammenhang bringen wollen, viel schöner formuliert in den letzten Worten des sterbenden Faust:
5. Das oberste und eigenste Gebiet ist und bleibt indes für Goethe doch schließlich die Kunst. Auch hier hat er – von einzelnem zu sprechen, ist nicht der Raum vorhanden – je länger je mehr der Philosophie die Ehre gegeben, die ihr gebührt. »Wer gegenwärtig über Kunst schreiben oder gar streiten will, der sollte einige Ahnung haben von dem, was die Philosophie in unseren Tagen geleistet hat und zu leisten fortfährt.« (Spruch 704.) Auch hier hat sich sein philosophisches Denken letzten Endes zu dem schöpferischen Idealismus des selbsterzeugenden menschlichen Geistes bekannt: »Kein Porträt kann etwas taugen, als wenn es der Maler im eigentlichen Sinne erschafft« (Der Sammler). Und verallgemeinert: »Es gibt einen allgemeinen Punkt, aus welchem alle ihre (der Kunst) Gesetze ausfließen: das menschliche Gemüt.« »Die Kunst ist nur durch den Menschen und für ihn.«
Die Kunst und ihr philosophischer Ausdruck, die Ästhetik, bildet aber nur ein für sich bestehendes Gebiet des menschlichen Bewußtseins neben Natur und Sittlichkeit: gleich diesen in letzter Linie der Gesetzgebung des Menschen untergeordnet, der überall, »wo er bedeutend auftritt« – in Wissenschaft und Staat, Sittlichkeit, Kunst und Religion –, »gesetzgebend sich verhält«. Diese Gesetze aufzusuchen ist die Aufgabe der Philosophie; und insofern er sich darum sein Leben lang bemüht, hat auch Wolfgang Goethe seinen Anteil zur deutschen Philosophie beigetragen. So gehört auch er – neben Lessing, Herder und Schiller – als vierter und letzter, aber mit nicht minderem Recht als sie, in die Reihe
unserer Klassiker-Philosophen.
Es wäre unangebracht, unseren Lesern an dieser Stelle eine möglichst vollständige Zusammenstellung aller Schriften, die über die philosophischen Anschauungen unserer Dichter-Klassiker oder irgendeine Seite derselben handeln, zu geben. Wir verweisen diejenigen, die sich dafür interessieren, auf den bibliographischen Anhang zu Ueberwegs »Grundriß der Geschichte der Philosophie«, 3. Band, dessen neueste (11.) Auflage (besorgt von Professor M. Frischeisen-Köhler, Berlin 1914) allein über Lessing nicht weniger als 52 Schriftentitel anführt. Der Leser würde dabei nur vor einem Heere von Namen und Titeln stehen, mit denen er wenig anzufangen wüßte. Wir beschränken uns vielmehr im folgenden auf eine Angabe derjenigen literarischen Hilfsmittel, die wir für die wichtigsten und förderndsten halten.
Von den allgemeinen literaturgeschichtlichen Darstellungen halten wir noch immer für eine der besten Hermann Hettners »Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts«, 3. Teil; daneben ist, namentlich für Lessing, auch des alten Gervinus »Geschichte der deutschen Dichtung« (1842) noch sehr brauchbar.
Über Lessing besitzen wir, nachdem die beiden früh verstorbenen Danzel und Guhrauer mit einer für ihre Zeit (1850 bezw. 1854) sehr verdienstlichen Darstellung vorangegangen waren, seit 1884 eine vorläufig abschließende biographische Darstellung in dem zweibändigen Werke von Erich Schmidt »Lessing. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften«, 3. Auflage 1909, die freilich gerade philosophisch nicht ausreicht. Eine gute Ergänzung dazu bietet die knappe, aber bedeutende Darstellung, die Wilhelm Dilthey 1867 in den »Preußischen Jahrbüchern« gab, und die erweitert seit 1905 in Diltheys »Das Erlebnis und die Dichtung« (4. Auflage 1912) aufgenommen ist. Die eindringendste Monographie über »Lessing als Philosoph« hat bis jetzt Christoph Schrempf, der eigenartige schwäbische Theologe und Philosoph, in Band 19 von Frommanns »Klassikern der Philosophie« (Stuttgart 1905) geliefert. Vom marxistischen Standpunkt aus hat Franz Mehring ein umfassendes Gemälde der Zeit Friedrichs des Großen und Lessings gegeben in seiner »Lessing-Legende« (Stuttgart 1922, Dietz, 8. Auflage), in der Lessing als der literarische Wortführer des aufstrebenden Bürgertums gezeichnet wird.
Für Herder hat eine hervorragende große und grundlegende Gesamtdarstellung in zwei mächtigen Lexikonbänden von zusammen über 1600 Seiten Rudolf Haym, »Herder nach seinem Leben und seinem Wirken« (Berlin 1880 bis 1882), geliefert. Eine knappere, darum vielen unserer Leser vielleicht willkommenere Darstellung in einem immerhin noch starken Bande gibt Eugen Kühnemanns »Herder« (zweite, neu bearbeitete Auflage, München 1912, O. Beck): geistreich, freilich auch stark subjektiv, das Seelische stark herausholend. Eine noch kürzere Sonderdarstellung von »Herder als Philosoph«, an Umfang der Schrempfschen von Lessing entsprechend, enthält die Arbeit des österreichischen Gelehrten C. Siegel (Stuttgart 1907, Cotta), sorgfältig und klar, freilich auch etwas trocken. In unserem Text haben wir außerdem auf das eigenartige Buch von Günther Jacoby »Herder als Faust« (Leipzig 1911) hingewiesen, der auch den letzten Kampf Herders gegen Kant und beider Begründung der Ästhetik in besonderen Schriften behandelt hat.
Über Schiller liegt eine große Biographie, die auch philosophisch völlig befriedigte, nicht vor. Die kürzere von E. Kühnemann (München 1906) steht in dieser Beziehung hinter seiner eben genannten Herder-Biographie zurück. Tiefer philosophisch geht seine kleinere Schrift »Kants und Schillers Begründung der Ästhetik 1895«. Aus der Masse der bei Ueberweg (11. Auflage 1914) S. 105 bis 107 zitierten Arbeiten über Schillers Philosophie ragen hervor: Kuno Fischer, Schiller als Philosoph, 1858, 2. Auflage, Heidelberg 1892; K. Tomaschek, Schiller in seinem Verhältnis zur Wissenschaft, Wien 1862; F. A. Lange, Einleitung und Kommentar zu Schillers philosophischen Gedichten, aus dem Nachlaß herausgegeben von O. A. Ellissen, Leipzig 1897. Ferner das Festheft der Kant-Studien: »Schiller als Philosoph und seine Beziehungen zu Kant«, Berlin 1905; Karl Vorländer, Kant – Schiller – Goethe, 1. Teil, Leipzig 1907, 2. Auflage 1922.
Mit Goethe als Philosoph hat man sich eingehender erst viel später zu beschäftigen begonnen. Früher wurde er in der Regel bloß als Spinozist betrachtet (z. B. von Danzel, »Über Goethes Spinozismus«, Hamburg 1843). Erst ich selber habe seit 1897 in verschiedenen, später erweiterten und zu meinem ebengenannten Buche »Kant – Schiller – Goethe«, 2. Teil zusammengefaßten, Aufsätzen auf den nachhaltigen Einfluß Kant-Schillers auf den reifen Goethe (von 1790 an) hingewiesen. Siebecks Monographie »Goethe als Denker« (Stuttgart 1902) dringt nicht tief; Christoph Schrempf ist über »den jungen Goethe« (Stuttgart 1908) nicht hinausgekommen. Manche wertvolle Einzelbeiträge sind natürlich auch in der langen[191] Reihe der von der »Goethe-Gesellschaft« (Weimar) herausgegebenen »Jahrbücher« enthalten. So hat, wie ich selbst einst auf Wunsch des Herausgebers in dem von 1898 eine kurze zusammenfassende Darstellung von »Goethe und Kant« gab, in dem neuesten (1922) der kürzlich aus dem Leben geschiedene Otto Braun einen Aufsatz »Goethe und Schelling« veröffentlicht, der allerdings nichts wesentlich Neues bringt. Ein anderer (W. Hertz) sucht ebendort wahrscheinlich zu machen, daß der übermütige Baccalaureus im zweiten Teil des »Faust« nicht auf den jungen Fichte, sondern auf den jungen Schopenhauer gehe. Ein dritter (Hartung) behandelt das interessante Thema »Goethe als Staatsmann«, O. Marcuse »Goethe als Rechtsbildner«. Von den großen allgemeinen Darstellungen sind philosophisch am wertvollsten diejenigen Chamberlains und namentlich Gundolfs (Goethe, 1916). Als gut unterrichtende Einführung ist auch die Einleitung Heynachers in seiner Ausgabe (s. unten) zu empfehlen.
Die Philosophische Bibliothek (Leipzig, Verlag F. Meiner) hat sich das Verdienst erworben, die wichtigsten philosophischen Stücke aller von uns behandelten vier Klassiker in guten Auswahl-Ausgaben mit Einleitungen der Herausgeber zu veröffentlichen. So: Lessings Philosophie von P. Lorentz, 1909, Herders Philosophie von Horst Stephan, 1906, Schillers Philosophische Schriften und Gedichte von E. Kühnemann, 2. Auflage 1909, Goethes Philosophie aus seinen Werken von M. Heynacher, 2. Auflage 1922.
[1] Seite 101 seiner im Anhang zitierten Schrift.
[2] Wir besitzen über Winckelmann ein vortreffliches Werk in Karl Justi: Winckelmann, sein Leben, sein Werk und seine Zeitgenossen (2 Bände, 1866 und 1872, 2. Auflage 3 Bände 1898).
[3] Wir sehen hier, um die ohnehin reiche Stoffülle nicht noch zu vergrößern, von seinem ersten Eintreten für Shakespeare gegen Gottsched in den »Literaturbriefen« der fünfziger Jahre ab.
[4] Das heißt die später als maßgebend angesehene, die heutigen neutestamentlichen Schriften umfassende Sammlung.
[5] Wenn Lessing die Recha von Moses sagen läßt: »Wo er stand, stand er vor Gott«, so fühlt man sich gleichfalls an Eckharts Gedanken erinnert: daß man Gott beim Herdfeuer oder im Stalle ebenso gegenwärtig haben könne als in der Einöde oder in der Klosterzelle. Und Eckharts Ansicht, daß das wahre Gebet keiner Worte bedürfe, hat Lessing in der Minna von Barnhelm in dem schönen Satze Ausdruck gegeben: »Ein einziger dankbarer Gedanke gen Himmel ist das vollkommenste Gebet.«
[6] Denselben Gedanken finden wir in Kants Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (in meiner Ausgabe, Bd. 45 der Philosophischen Bibliothek) S. 96 f.
[7] In einem handschriftlichen Bruchstück: »Daß mehr als fünf Sinne für den Menschen sein können.«
[8] Über beide siehe meine »Volkstümliche Geschichte der Philosophie«. 2. Auflage. Dietz Nachf., Stuttgart 1922.
[9] Lessing ist übrigens gegen eine Einmischung des Ordens in die Politik. Selbst das Eintreten mit bewaffneter Hand für Menschenrechte, wie es die Nordamerikaner in ihrem gleichzeitigen Freiheitskampf wider England taten, weist sein konsequenter Pazifismus ab. Denn »was Blut kostet, ist ganz gewiß kein Blut wert«.
[10] Die folgende Darstellung fußt auf dem eingehenden und einen durchaus zuverlässigen Eindruck machenden Bericht Jacobis, den er 1785 veröffentlicht hat. Wir beschränken uns natürlich auf das, was Lessings philosophische Anschauungen betrifft.
[11] So ist der Name durch den bekannten Kantkenner Artur Warda in Königsberg jetzt festgestellt.
[12] Abgedruckt mit ihrer Fortsetzung unter anderem in meiner Kantausgabe in der Philosophischen Bibliothek Band 47 I, S. 21 bis 46. Wir benutzen zu unserer obigen Darstellung einen Teil der Gedanken unserer dortigen Einleitung.
[13] Herders und Kants Ästhetik, Leipzig 1907. Vergl. außer Siegels Monographie (siehe Anhang) ferner E. Kühnemann, Herders letzter Kampf gegen Kant, in »Aufsätze zur Literaturgeschichte«, M. Bernays gewidmet. Hamburg 1893. Die beiden bedeutendsten Herderbiographen, Haym und Kühnemann, lehnen den Herderschen Standpunkt ab.
[14] Ein Neidhammel unter seinen Kollegen, der Professor der Geschichte Heinrich, hatte den Anschlag der Antrittsvorlesung in den Buchläden durch den Pedell herunterreißen lassen, weil sich Schiller darauf als Professor der Geschichte (statt der Philosophie) bezeichnet hatte, was damals mehr galt. Schiller schrieb dazu: »Ist das nicht erbärmlich? Mit solchen Menschen habe ich zu tun.«
[15] Abgedruckt in meiner Ausgabe in der »Philosophischen Bibliothek« Band 47 I, S. 47 bis 64; vergl. meine Einleitung dazu S. XXI bis XXIV.
[16] Religion innerhalb der Grenzen usw. S. 22, Anmerkung.
[17] Vergl. Eugen Kühnemann, Kants und Schillers Begründung der Ästhetik, 1895; auch desselben Einleitung zu seiner Auswahl-Ausgabe.
[18] K. Vorländer, Der Formalismus der Kantischen Ethik in seiner Notwendigkeit und Fruchtbarkeit. Marburg 1893.
[19] Näheres siehe unter anderem bei Ferdinand Tönnies, Schiller als Zeitbürger und Politiker. Berlin 1905. Auch Mehrings im Anhang zitiertes Schiller-Büchlein vom gleichen Schiller-Jubiläumsjahr gibt wertvolle Gesichtspunkte.
[20] Zu seinem Jugendfreunde v. Hoven äußerte er während seines Aufenthalts in der schwäbischen Heimat 1793: »Die eigentlichen Prinzipien, die einer wahrhaft glücklichen bürgerlichen Verfassung zum Grunde gelegt werden müssen, sind noch nirgends anders als hier«, indem er auf Kants Kritik der Vernunft, die eben auf dem Tische lag, hinwies.
[21] Ich habe auf diese noch wenig beachtete Seite Schillers bereits in meinem Schriftchen »Kant, Fichte, Hegel und der Sozialismus« (1920 bei P. Cassirer, jetzt Vorwärts-Verlag) hingewiesen.
[22] Christliche Gedanken eines heidnischen Philosophen. Preußische Jahrbücher 1897.
[23] Die Geschichte ist Wolff nur zur moralischen Belehrung da. Die Poeten dienen »zur Belustigung der Ohren«, müssen aber unter Staatsaufsicht gestellt werden, auf daß sie nicht »durch verliebte und unzüchtige Verse gute Sitten verderben«. In der Politik gilt das Wort vom »beschränkten Untertanenverstand«. In einem der acht Quartbände seines »Naturrechts« behandelt Wolff unter anderem ausführlich die Frage, ob lautes Schmatzen beim Essen gegen das Naturrecht sei. Vergl. meine Volkstümliche Geschichte der Philosophie S. 194 bis 197.
[24] Was Goethe dann bekanntlich in seinem Wilhelm Meister auch auf die Geschlechterliebe in dem, wie er selbst sagt, »frechen« Wort der losen Philine ausgedehnt hat: »Wenn ich dich liebe, was geht's dich an!«
[25] Er besaß sie übrigens erst in der dritten Auflage von 1790.
[26] Es findet sich, wie alles von Goethes Hand Stammende, in der großen Weimarer Ausgabe seiner Werke, Briefe usw. Einen ausführlichen Bericht gebe ich in meinem »Kant – Schiller – Goethe« S. 146 bis 149.
[27] Ich habe a. a. O. S. 268 bis 271 auch einen genauen Bericht über Goethes philosophische Bücherei gegeben. Sie zählte 186 Nummern mit etwa 220 Bänden. Neben vielen unbedeutenden Widmungsexemplaren philosophischer Zeitgenossen finden sich von bekannteren Denkern: Einzelnes von Giordano Bruno, Plato, Aristoteles, Epiktet, Campanella, Hobbes, Malebranche, Baumgarten, Lambert; alles von Spinoza; das Wichtigste von Fichte, Schelling, Hegel und Schopenhauer.
[28] Während seiner Kampagne in Frankreich (Oktober 1792) setzte er einem jungen in Kants Schriften beschlagenen Lehrer in Trier als Sinn der kritischen Lehre auseinander: ein Kunstwerk solle wie ein Naturwerk, ein Naturwerk wie ein Kunstwerk behandelt und der Wert eines jeden aus sich selbst entwickelt, an sich selbst betrachtet werden.
[29] Über das Datum vergl. meine genaue Untersuchung in »Kantstudien« I, S. 316 f., kürzer wiederholt in »Kant – Schiller – Goethe« S. 158 f.
[30] Kant – Schiller – Goethe S. 196 bis 245.
Verlag von J. H. W. Dietz Nachf. G. m. b. H. in Stuttgart
Wir empfehlen:
Volkstümliche Geschichte der Philosophie
Von Karl Vorländer
Internationale Bibliothek Band 62
In der Vorrede zu diesem Werk schreibt der Verfasser: Schon lange war es mein Wunsch, neben meiner zweibändigen Geschichte der Philosophie, die sich hauptsächlich in den Kreisen der Studierenden eingebürgert zu haben scheint, eine kürzere Darstellung desselben Stoffes für den freidenkenden Mann aus dem Volke zu schreiben, der für die großen Weltanschauungsfragen interessiert ist. Das ist allerdings keine leichte Aufgabe und ist wohl deshalb bisher noch nie versucht worden. Denn ein solches Buch soll kurz sein und doch die Hauptprobleme der Philosophie klar herausarbeiten, ihre Hauptgestalten lebensvoll schildern; allgemeinverständlich, ohne doch an der Oberfläche zu bleiben. Nun, »ich hab's gewagt!« Eine Aufforderung von Professor Ferdinand Jakob Schmidt in der Neuen Zeit vom 12. März 1920 bestärkte mich in dem Entschluß. Jahrelanger geistiger Verkehr mit bildungsdurstigen Männern der verschiedensten Kreise läßt mich hoffen, daß ich den Ton im allgemeinen getroffen habe.
Marx, Engels und Lassalle als Philosophen
Von Karl Vorländer
I. Marx' Anfänge.
II. Die Sturm- und Drangperiode: 1. Marx 1842 bis 1845. – 2. Engels' philosophische Anfänge. – 3. Marx und Engels 1845.
III. Die Entstehung des historischen Materialismus: 1. Die Thesen über Feuerbach. – 2. Die »Deutsche Ideologie«. – 3. Der Anti-Proudhon. – 4. Das Kommunistische Manifest.
IV. Die Ausbildung der dialektischen Methode: 1. Zur Kritik der politischen Ökonomie. – 2. Engels über Marx (1859). – 3. Marx und Hegel. – 4. »Das Kapital«.
V. Engels' Anti-Dühring und Feuerbach: 1. Der Anti-Dühring. – 2. Der »Feuerbach«.
VI. Engels' letzte Modifikationen des historischen Materialismus.
VII. Lassalle als Philosoph: 1. Jugend- und Universitätsjahre. – 2. Der »Heraklit«. Die fünfziger Jahre. – 3. Lassalle und Fichte (1860 bis 1862). – 4. Das »System der erworbenen Rechte«. – 5. Das »Arbeiterprogramm«.
Verlag von J. H. W. Dietz Nachf. G. m. b. H. in Stuttgart
Internationale Bibliothek
1 Tschulok, Entwicklungstheorie (Darwins Lehre).
2 Kautsky, Marx' Ökonomische Lehren.
5 Kautsky, Thomas More und seine Utopie.
6 Bebel, Charles Fourier. Sein Leben und seine Theorien.
8 Stern, Die Philosophie Spinozas.
9 Bebel, Die Frau und der Sozialismus. Mit einem Porträt Bebels.
10 Lissagaray, Die Geschichte der Kommune 1871. Illustriert.
11 Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentum und des Staats. Nach Lewis H. Morgans Forschungen.
12 Marx, Das Elend der Philosophie.
13 Kautsky, Erfurter Programm. In seinem grundsätzlichen Teil erläutert.
14 Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England.
17 Mehring, Die Lessing-Legende. Eine Rettung.
21 Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft.
24 Marx, Revolution und Konterrevolution in Deutschland.
26a Dodel, Aus Leben und Wissenschaft. 1. Leben und Tod.
26b Dodel, Aus Leben und Wissenschaft. 2. Kleinere Aufsätze.
26c Dodel, Aus Leben und Wissenschaft. 3. Moses oder Darwin?
29 Plechanow, Beiträge zur Geschichte des Materialismus.
30 Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie.
33 Deutsch, Sechzehn Jahre in Sibirien. Erinnerung eines Revolutionärs.
35 bis 37a Marx, Theorien über den Mehrwert. 4 Bände.
38 Kautsky, Ethik und materialistische Geschichtsauffassung.
40 Pashitnow, Die Lage der arbeitenden Klasse in Rußland.
41 Deutsch (Verfasser von »Sechzehn Jahre in Sibirien«), Viermal entflohen.
44 Bernstein, Sozialismus und Demokratie in der großen englischen Revolution.
45 Kautsky, Der Ursprung des Christentums. Eine historische Untersuchung.
47–48b Kautsky, Vorläufer des neueren Sozialismus. 4 Bände.
50 Kautsky, Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft.
52 Salvioli, Der Kapitalismus im Altertum. Studien über die römische Wirtschaftsgeschichte. Aus dem Französischen übersetzt von Karl Kautsky jun.
53 Adler, Marxistische Probleme. Beiträge zur Theorie der materialistischen Geschichtsauffassung und Dialektik.
57 Noske, Kolonialpolitik und Sozialdemokratie.
58 Hepner, Josef Dietzgens Philosophische Lehren.
61 Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie.
62 Vorländer, Volkstümliche Geschichte der Philosophie.
63 Reimes, Ein Gang durch die Wirtschaftsgeschichte. Sechs Vorträge.
64 Kautsky, Die proletarische Revolution und ihr Programm.
65 Beyer, Dr. med. Alfred, Menschenökonomie.
66 Vorländer, Die Philosophie uns. Klassiker (Lessing, Herder, Schiller, Goethe).
Die fehlenden Nummern sind vergriffen. Die Sammlung wird fortgesetzt.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.