
The Project Gutenberg EBook of Gespräche im Zwielicht, by
Karin Delmar [pseud.] and Terese Robinson
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
Title: Gespräche im Zwielicht
Author: Karin Delmar [pseud.]
Terese Robinson
Release Date: August 23, 2020 [EBook #63021]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GESPRÄCHE IM ZWIELICHT ***
Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net
*
Gebrüder Enoch / Verlag / Hamburg
Alle Rechte, auch das der Übersetzung, vorbehalten
Amerikanisches Copyright 1924 by Gebrüder Enoch,
Hamburg. Printed in Germany
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig

Die Leute, die Kurt Georgi nicht näher kennen und ihm seine tadellose Erscheinung mißgönnen, werfen gerne die nachlässige Bemerkung hin, daß er doch in der Hauptsache nur dekorativ wirke und eine fatale Ähnlichkeit mit den unsäglich vornehmen Dandys habe, wie sie die englischen Familienblätter und die Plakate unserer Zigarettenfirmen schmücken.
Ja, ich darf nicht verschweigen, daß eine junge Dame, die ihn in einem Konzert mit verschränkten Armen an einer Säule lehnen sah, in den erstaunten Ruf ausbrach: »Also den gibt es wirklich!«
Aber ich darf auch nicht verschweigen, daß Kurt Georgi, als ich ihm diese frohbewegten Worte hinterbrachte, mit einem gar nicht dandyhaften, sondern sehr herzlichen und lauten Lachen den Kopf im Sessel hintenüberwarf und ein übers andere Mal »Reizend!« rief.
Denn er ist in Wirklichkeit gar kein Dandy.
Alles dies gehört natürlich durchaus nicht hierher, es soll nur einen Eindruck von dem jungen Manne geben, der, soeben zu mir ins Zimmer tretend, mir mit etwas übertriebener Feierlichkeit das Manuskript der Gespräche im Zwielicht überreicht, das ich ihm zur Durchsicht geliehen hatte.
Die Feierlichkeit hält nicht lange stand, er streift mit einem spitzbübischen Blick den kleinen Tisch, auf dem Kuchen und Zigaretten aufgebaut sind und fragt mit einer leisen, aber betonten Ängstlichkeit in der Stimme:
»Soll ich am Ende auch unter die Zwielichtfreunde in dem Buch eingereiht werden?«
»Keine Sorge,« antworte ich, »der Kreis ist geschlossen. Sie müssen zugeben, elf Freunde sind genug, das Publikum könnte die Geduld verlieren.«
»Und was schlimmer ist,« setzt er hinzu, »es könnte zwölf als ein Dutzend auffassen.«
Ich nicke. »Aber nicht wegen dieser furchtbaren Möglichkeit allein sind Sie ausgeschaltet worden. Es mußte ja auch einer außerhalb bleiben, um unbefangen urteilen zu können und mir dann –«
Georgi prallt einen Schritt zurück und hebt die Hände mit einer entsetzten Abwehrgeste hoch. Aber ich fahre unbeirrt fort: »Sie wissen doch, was vom Merker geschrieben steht: Er werde so bestellt, daß weder Haß noch Lieben das Urteil trüben, das er fällt. – Und ich dachte, Ihre wohltuend kühle Sachlichkeit –«
»Sachlichkeit!« wiederholt er empört, »für dieses harte und ungerechte Wort will ich mich bösartig rächen, und zwar am liebsten auf der Stelle durch eine peinlich sachliche Kritik.«
»Erst Kaffee trinken,« bitte ich, und er setzt schnell hinzu, während er zufrieden den Tisch überblickt: »Wobei ich nur nebenbei bemerken möchte, daß ich jeder Art von Bestechung zugänglich bin.«
»Ich weiß,« antworte ich, »und habe deshalb Ihre Lieblingskeks backen lassen, die ganz dünnen, die hauchzarten und zerbrechlichen, mit einem Wort, die Ästheten unter den Keks.«
»Reizend!« lacht Kurt Georgi, und seine länglich geschnittenen Augen werden ganz schmal vor Vergnügen:
»Diese Erzeugnisse einer überraffinierten Kultur sind gewiß so bekömmlich, daß selbst die zarteste Dame ein Dutzend davon verschlingen kann.«
»Nur elf, wie Sie wissen,« berichtige ich, »und außerdem – verschlingen, wie vulgär! Genießen sagt man, oder auf der Zunge zergehen lassen, wenn es sich um etwas so Ästhetisches und Delikates handelt.«
»Wie um Ihre Gespräche hier zum Beispiel,« bemerkt er mit einer Bewegung nach dem Manuskript hin. »Die haben entschieden etwas, was auf der Zunge zergeht, und außerdem –«
»O weh,« unterbreche ich ihn, »wir kommen nicht drum herum, Sie müssen erst Ihre Kritik loswerden, vorher schmeckt's Ihnen nicht. Aber hüten Sie sich, wer weiß, ob Sie nachher noch etwas bekommen.«
»Ich werde nicht zu ehrlich sein,« versichert er schnell.
»Darum möchte ich auch energisch bitten,« sage ich, »denn Sie wissen, ich gehöre zu den seltenen Menschen, die ehrlich genug sind, einzugestehen, daß ihnen Ehrlichkeit in den Tod verhaßt ist.«
»Wundervoll, wie Sie mir die Aufgabe erleichtern,« antwortet Georgi. »Aber ich hätte mir auch im anderen Fall kein Gewissen aus meiner Unehrlichkeit gemacht. Denn es ist doch wahrhaftig ganz und gar gleichgültig, was man in solchen Fällen sagt. Die Kritik kann noch so verneinend sein, der andere hört von allem nur das Ja. Noch dazu, wenn der andere eine Frau ist.«
»Der Anfang ist verheißungsvoll,« sage ich, und decke die Mütze über die Kaffeekanne, »kommen Sie also zur Sache!«
»Also,« holt Kurt Georgi aus, bequem zurückgelehnt und mit beiden Händen die Lehnen des Sessels umspannend, »fürs erste: Ich finde die Idee des Buches nett und originell. In elf zwanglosen Plaudereien sind elf junge Männer geschildert, die nur durch die Freundschaft zu einer Frau, also sozusagen durch eine Art Personalunion, miteinander verbunden sind.«
Ich nicke dankbar und er fährt fort: »Vor allem bewundere ich dabei, wie geschickt und zartfühlend Sie es verstanden haben, in diesen Gesprächen jede allzu prägnante Charakterschilderung der Freunde zu vermeiden. Das Buch hätte im anderen Fall leicht die Art eines Schlüsselromans, wenigstens für Ihren Kreis, annehmen können, und das wäre natürlich höchst unfair gewesen.«
Da ich diesmal kein Zeichen des Einverständnisses gebe, setzt er mit einem schnellen Blick nach den Keks und einer kleinen Neigung des Kopfes hinzu: »Wie gesagt, ich achte Ihre Zurückhaltung.«
»Sehr fein,« lobe ich. »Reden Sie nur weiter. Es ist geradezu ein exquisites Vergnügen, von Ihnen massakriert zu werden.«
Kurt Georgi lehnt den Kopf im Sessel hintenüber und schaut einen Augenblick sinnend zur Stubendecke hinauf. Dann spricht er vorsichtig, beinah tastend weiter:
»Nun könnte man ja auch sagen, und der intelligente Leser wird es zweifellos tun und damit das Verdienst Ihrer Zurückhaltung schmälern, man könnte sagen, daß Sie die Freunde nicht schärfer charakterisieren konnten. Zum Teil schon deshalb nicht, weil Sie sich darauf kapriziert haben, sie fast ohne jede Beziehung zur Außenwelt zu zeigen und alle in der gleichen Atmosphäre und vom gleichen Gesichtswinkel aus gesehen. Dieser Umstand hat unbedingt etwas, nun ja, sagen wir etwas Nivellierendes, und die jungen Männer, so verschiedenartig sie sein mögen, erscheinen daher alle wie Glieder einer –« Georgi deutet mit einer seiner überlebensgroßen Gesten einen weiten Kreis an – »wie Glieder einer großen Familie.«
»Die sie ja in einer gewissen geistigen Art auch wirklich sind,« werfe ich ein, doch er achtet nicht darauf und spricht lebhaft weiter, den Zeigefinger hebend:
»Nun kommt aber eine merkwürdige Erscheinung: Zwischen all diesen Köpfen schaut wie im Vexierbild ein Kopf hindurch; das eine Porträt wird sichtbar, das Sie wahrscheinlich nicht zu zeichnen beabsichtigten, und das nun, ich sage beileibe nicht ›deshalb‹, das nun das einzige von zwingender Ähnlichkeit geworden ist: das Porträt der Frau.«
»Lieber Freund,« sage ich, »wie ist das möglich? Nicht ein einziges Wort spricht die Frau in dem Buch über sich und ihre Empfindungen. Sie schweigt sich und ihr Leben ja geradezu tot, und mir scheint es jetzt sehr bezeichnend für das Wesen der Freundschaft zu sein, daß keiner der Freunde je diese Verschwiegenheit bemerkt.«
»Drollig,« lächelt Kurt Georgi und streift die Asche vorsichtig von seiner Zigarette, »drollig, daß wir oft am Schluß Tiefen in unseren Werken finden, von denen wir selbst nichts geahnt haben. – Aber hoffentlich ist Ihnen diese unvermutete Tiefe nicht peinlich, gnädige Frau, denn es ist ja sonst in dem Buch jede Spur von Gründlichkeit aufs Sorgsamste vermieden. Alle Dinge sind nur im Flug berührt, alle Fragen nur mit den Fingerspitzen angefaßt, alles schwebt sozusagen in der Luft. In einer sehr angenehmen, wohltemperierten, nur wenig parfümierten Luft, in der nicht gelacht und nicht geschrien wird, in der man nur lächelt und plaudert. – Und dann, gnädige Frau –«
Er setzt sich plötzlich im Sessel aufrecht und streckt mir mit einer verzweifelt flehenden Gebärde die Hände entgegen: »Was haben Sie sich um Gottes willen dabei gedacht, nicht eine Spur von Pikanterie in diese Gespräche zu mischen! Wie in aller Welt glauben Sie, ein Publikum zu finden, wenn Sie die erotischen Probleme mit einer so geradezu minutiösen Sauberkeit behandeln? Mein Gott, der Titel verpflichtet doch schon beinah! Ja, wenn Sie schon berühmt, oder wenigstens auf irgendeine sensationelle Art gestorben wären! – Man liest ja schließlich auch die Droste und Eichendorf und Hölderlin, und neuerdings ist bei den Obersnobs Klopstock wieder modern geworden und wird bald so bedeutend sein wie Goethe – aber lebend und unberühmt und weder pikant noch pervers! – Unmöglich!«
Und Kurt Georgi macht eine abschließende Handbewegung, die mich erledigt, und lehnt sich mit allen Zeichen der empörten Hoffnungslosigkeit im Sessel zurück.
»Vielleicht lockt der Titel,« versuche ich einzuwenden. »Oder wenn man einen himmelschreiend neuartigen Buchdeckel machte –«
»Nein, nein,« wehrt er ab, »uns bleibt nur zu hoffen, daß der eine oder der andere Ihrer eventuellen Leser in dem Umgehen jeder erotischen Pikanterie eine besonders prickelnde Nuance entdeckt. Ja, sehen Sie,« setzt er wie neubelebt durch diesen Hoffnungsstrahl hinzu, »das halte ich noch nicht für ganz ausgeschlossen.«
»Diesem verständnisvollen Leser möchte ich schon im voraus dankbar die Hand drücken,« sage ich lachend, »und ihn unter meine Freunde einreihen, denn er hat richtig erkannt, daß die ungesprochenen Worte meist die bedeutungsvolleren sind, daß sie noch wahrer zu reden verstehen und –« Ich stocke, denn Kurt Georgi blickt mir, den Kopf in die Hand gestützt, mit einem forschenden Blick in die Augen.
»Und noch feiner zu lügen,« setzt er langsam hinzu.
»Nein, nein,« winke ich ein bißchen nervös ab, »ehrlich werden ist gegen die Abrede und in dieser Atmosphäre so wenig angebracht wie Schreien oder große Worte machen in diesem Buch. Die Frau hier und dort ist nun einmal nicht für die großen Worte geschaffen, ebensowenig wie für die großen Erlebnisse.«
»Das weiß Gott,« nickt Georgi elegisch. »Dazu ist sie leider nicht trivial genug. Sie sitzt lieber wie die besonders kostbaren und zerbrechlichen Kunstwerke in den Museen unter einer Glasglocke oder von einer roten Schnur umgeben, die sie kaum bemerkbar, aber unüberwindlich von der Welt abschließt. Und da sie gewohnt ist, jede Arbeit im Leben von anderen für sich verrichten zu lassen, so läßt sie natürlich auch die anderen für sich erleben. – Was übrigens sicher der höchste Grad von Vornehmheit ist.«
»Lieber Georgi,« sage ich, »was heißt denn erleben? Müssen wir denn immer leibhaftig mitagieren und die Bombenrolle in dem Stück spielen? Muß es nicht auch Zuschauer geben, die entzückt oder schaudernd miterleben, was sich auf der Bühne begiebt?«
»Nein,« antwortet er, »auch der Zuschauer da unten muß ein eigenes Leben haben, wie könnte er sonst Schauer und Entzücken fühlen? Nur die Wonnen, die in unserem eigenen Empfindungsbereich liegen, können uns erregen, und nur der Schmerz, der unserem eigenen verwandt ist, rührt uns zu Tränen.«
»Und so weint im Grunde genommen jeder nur um sich selbst.«
»Und wenn ich eine Minute lang ehrlich sein darf,« fährt Georgi fort, »ich glaube auch gar nicht an dies vollkommen selbstaufgegebene Miterleben und an die lächelnde Gleichmäßigkeit der Frau in Ihrem Buch. Viel eher glaube ich, daß sie in diesen Gesprächen eine schwere Enttäuschung nicht totschweigt, wie Sie meinten, sondern totplaudert, was ja manchmal dasselbe bedeutet. Und noch eher glaube ich, und sage es, selbst auf die Gefahr hin, bei der Verteilung der Ästhetenkeks leer auszugehen, noch eher glaube ich, daß sie ein ganz raffinierter kleiner Racker ist. – Ja, ich würde vorschlagen,« und Kurt Georgi deutet das Folgende in seiner lebhaften Gebärdensprache an, »ich würde vorschlagen, an der roten Schnur in Manneshöhe eine Warnungstafel für geistreiche und gemütvolle junge Leute anzubringen: ›Hier liegen Fußangeln‹ –«
»Scht! Scht!« winke ich erschrocken ab, und er setzt schnell hinzu: »Es war natürlich von der Frau in dem Buch die Rede.«
»Das versteht sich,« antworte ich, »und ich bin glücklich über Ihr Urteil, so hart es ist. Denn daß diese Frau es vermocht hat, Furcht und Mitleid in Ihnen zu erregen, genau nach der altgriechischen Vorschrift für Kunstwerke, das spricht doch ungeheuer für mich und mein Buch. Es ist der kleine süße Kern, den ich aus Ihrer bitteren Kritik herausschäle, das Ja, daß ich trotz aller Verneinung höre. – Und nun sollen Sie doch unter die Freunde hier aufgenommen werden, und zwar nicht als letzter, sondern als erster im Dutzend. Ich will unser heutiges Gespräch als Einleitung in das Buch setzen, denn nach einem Vorwort habe ich schon lange verzweifelt gesucht. Da weiß der Leser doch gleich, woran er ist, und die Sache hat noch das Gute, daß die Einleitung zugleich als Schlußwort gelten kann.«
»Gott bewahre,« sagt Kurt Georgi entsetzt, »auf so etwas hätte man doch wenigstens vorbereitet sein müssen. – Aber,« setzt er nachdenklich hinzu, »wenn ich auf die ökonomische Ausschlachtung meiner geistigen Arbeit eingehe, welche Belohnung haben Sie mir zugedacht?«
Ich sehe ihm in die vor Schelmerei ganz schmal gewordenen Augen und muß unwillkürlich lächeln.
»Ja, ja,« nickt er, »hier wäre die beste Gelegenheit, eine Pikanterie anzubringen, wenn ich Ihnen diesen literarischen Rat erteilen darf.«
»Unmöglich!« sage ich und schiebe den kleinen Tisch mit Kaffee und Kuchen zwischen uns. »Was sollte der Leser von uns denken!«

Wir haben lange geschwiegen, und es ist so still im Zimmer, daß das Ticken der Uhr schon anfängt, aufdringlich zu werden. Endlich hebt Frank Meinert den Kopf mit dem zerwühlten schwarzen Haar, und über sein blasses, meist etwas verdrossenes Gesicht geht langsam das halb verlegene, halb selbstironische Lächeln, das ich sehr an ihm liebe.
»Weiß der Himmel,« sagt er und wirft mit einer bei ihm ungewohnt lebhaften Bewegung das Zigarettenrestchen in die Aschschale, »in dieser fabelhaften Feiertagsstille kann ich mich unmöglich auf meine Leiden besinnen.«
»Schade,« antworte ich und schiebe ihm die Pralinés näher, »ich werde auf diese Weise nie erfahren, was Sie bedrückt und weshalb Sie sich seit ein paar Wochen so in den Wirbel des Weltlebens gestürzt haben, daß es fast keine festliche Veranstaltung in Hamburg gibt, bei der nicht Frank Meinert bleich, mürrisch und zerwühlt, ein Miniatur-Beethoven, in einer Saalecke hockt. – Oder sollte zwischen diesen Dingen kein Zusammenhang bestehen?«
Das Lächeln um Franks großen und nervös-beweglichen Mund wird lebhafter. »Ja,« sagt er und sucht sich bedächtig seine Lieblingspralinés heraus, »so ist meine Art zu leiden.«
»Vernünftig,« lobe ich, »aber leider nicht neu. Jeder, der etwas auf seine Leiden hält, führt sie an fashionable Betäubungsstätten. Ich hätte von Ihnen etwas Originelleres erwartet.« – »Ihr alter Fehler!« bemerkt er mürrisch und fährt nach einem kurzen Schweigen mit überraschend einsetzender Beredsamkeit und nervös flackerndem Gesicht fort:
»Sie leiden an einem fundamentalen Mangel an Menschenkenntnis. Ich bin kein Originalitätsfex, wie Sie hartnäckig annehmen. Und es spricht auch wieder einmal bedauerlich wenig für Ihren psychologischen Blick, wenn Sie glauben, daß ich im Trocadero oder beim Bösen-Buben-Ball oder etwa bei den Massenmorden der Harvestehuder Gesellschaft Betäubung gesucht habe.«
Und da ich ihn erwartungsvoll ansehe, fährt er langsamer fort: »Sie haben es wohl noch nie erfahren, wie innig man seinen Schmerz lieben kann, gerade inmitten der Vielen, denen man so unendlich überlegen ist.« Und leise setzt er hinzu: »Weil man zu den Auserwählten gehört, die leiden.«
»Lieber Freund,« sage ich und stütze den Kopf in die Hand, »selbst auf die Gefahr hin, Ihnen eine Glücksquelle zu verschütten: Glauben Sie wirklich, daß es nur die Auserwählten sind, die leiden?«
»Gewiß,« antwortet er eifrig, »denn zum wirklichen Unglücklichsein gehört ein Maß von seelischer Tiefe, das nur wenigen eigen ist. Wie natürlich zu jedem großen Gefühl. Nicht nur der Schmerz, auch das Glück will getragen sein.« Ich nicke: »Insbesondere das der anderen. An dem schleppen wir oft unglaublich schwer. Das eigene Glück soll sich nicht schwer tragen, sagt man.«
Frank Meinert ist aufgestanden und geht, seiner Gewohnheit nach heftig rauchend und ein wenig schlurfend, im Zimmer auf und ab.
»Aber die Fähigkeit zum Glück muß da sein,« sagt er vor sich hin, »die ganz gemeine Begabung dazu, und die ist es, die mir fehlt. – Das ist das merkwürdige bei mir, und ich habe schon unendlich viel darüber nachgedacht: Warum habe ich nur so gar kein Talent zum Leben?«
»Nicht so schlurfen!« bitte ich ein bißchen nervös und sage dann, während ich mir eine frische Zigarette anzünde: »Sie haben ja so viele andere Talente,« – und nach einer kleinen Pause – »wie weit ist eigentlich Ihr –.« – »Ä!« unterbricht er mich mit einer Gebärde des Ekels, »glauben Sie vielleicht, daß ich jetzt arbeiten kann?« Und mit ironisch übertriebenem Pathos die Arme reckend: »Ich bin augenblicklich in der Periode des Erlebens!«
»Natürlich,« nicke ich ihm zu, »die muß erst überwunden sein, und ich bin mir schon lange darüber klar, daß Arbeit wirklich nur etwas für die Leute ist, die nichts zu tun haben.«
Frank lächelt nachsichtig und läßt sich auf dem Klavierstuhl nieder, den er trotz seiner eminenten Unbequemlichkeit allen anderen Sitzgelegenheiten vorzieht, wie überhaupt sein Wesen zwischen Trägheit und dem Hang zur Selbstquälerei hin und her schwankt.
»Ihr Sarkasmus trifft mich nicht,« sagt er und öffnet langsam und zerstreut den Flügel, »es war natürlich nur von innerem, nicht von äußerem Erleben die Rede.« – »Ich kenne diese Unterscheidung gar nicht,« antworte ich, »was wir nicht innerlich erleben, erleben wir doch überhaupt nicht.« – »Erlauben Sie, wenn ich nächstens infolge der mangelhaften Treppenbeleuchtung in meiner Bude abstürzen und ein Bein brechen werde, dann nenne ich das ein äußeres und kein inneres Erlebnis.«
»Und ich nenne das einen Beinbruch, aber ein Erlebnis nenne ich es noch lange nicht. Dazu könnte es nicht einmal durch eine seelische Beziehung erhoben werden, wie zum Beispiel durch die Tatsache, daß Sie sich gerade auf den Weg nach einer gewissen kleinen Konditorei –«
Frank, der, wie es seine Gewohnheit ist, mit gesenkten Lidern gesessen hat, hebt plötzlich den Blick, und seine graugrünen Augen schillern feindselig zu mir herüber. Er greift ein paar harte Akkorde und wendet sich, plötzlich abbrechend, mit seinem spöttischsten Lächeln zu mir:
»Ihre diplomatischen Übergänge, fabelhaft geschickt! – Übrigens danke ich Ihnen für die Notbrücke, denn ich bin ja natürlich gekommen, um Ihnen zu erzählen.«
Er nimmt seine Wanderung durchs Zimmer wieder auf, und ich warte eine Weile vergebens.
»Nicht nur heute,« sagt er endlich hastig, »ich war in der letzten Woche schon ein paarmal deshalb hier. Sie wissen das natürlich! Frauen wissen bekanntlich immer alles. – Aber es ist jedesmal wie verhext, wenn ich hier sitze. So, als hätte ich das alles gar nicht erlebt, wovon ich sprechen will, oder irgendwo drüben an einem anderen Ufer. – Die Dinge werden ja immer unwirklich, sobald man sie ausspricht. Und ich habe auch schon geglaubt, damit fertig zu sein. Ich konnte schon darüber lächeln. – Ä, das sagt nichts, man lächelt immer darüber, aber es kam schon vor, daß ich eine Stunde lang nicht mehr daran dachte, und das ist weiß Gott schon viel. Da sagen Sie jetzt das eine Wort von der kleinen Konditorei, und alles ist wieder da, als wäre es niemals weg gewesen. Und es hilft kein Sichdagegenwehren, und es macht einen schwach und muskellos, und man fragt sich, ob man die verfluchte Quälerei nie los wird sein Leben lang.«
Und Frank Meinert steht einen Augenblick still und starrt vor sich hin, dann setzt er sich plötzlich ruhig und wie ausgelöscht auf seinen Stuhl.
»Frank,« sage ich leise, »schelten Sie nicht so auf Ihre Schmerzen, Sie fühlen doch daran, daß Sie leben.«
»Weiß Gott, ich fühl's!« stößt er heraus. »Aber glauben Sie vielleicht, daß ich großen Wert darauf lege?«
Ich antworte nicht und reiche ihm die Zigaretten hinüber, und er sagt mit einem träumerischen Blick, der sein häßliches Gesicht plötzlich schön erscheinen läßt: »Den hätte ich kennen mögen, der zuerst von allen Menschen den Entschluß gefaßt hat, freiwillig zu gehen. Welche unbegreifliche Erhabenheit lag in dieser Tat, als sie zum erstenmal geschah!«
Ich nicke, und wir sehen beide schweigend in die Wolken unserer Zigaretten. Endlich fährt er fort:
»Ich muß manchmal geradezu vor mich hinlächeln, wenn ich daran denke, daß der große Baumeister bei all seiner Klugheit eine Lücke in seinem Gebäude gelassen hat, ein kleines Loch, durch das wir still hinausschlüpfen können, wenn es uns da drinnen nicht mehr gefällt.«
»Ja, Frank,« sage ich nachdenklich, »das wäre eine schöne Einrichtung, wenn sie nicht so unvollkommen wäre. Wenn nicht die zweite Lücke fehlte, durch die wir still wieder hineinschlüpfen können, wenn es uns da draußen nicht gefällt.«
»Natürlich,« antwortet er, »Sie verlangen für jede Hintertür noch ein Hintertürchen! Ich finde, es ist schon fabelhaft tröstlich, daß man einfach weggehen kann, wie man von einem Ball geht, der anfängt langweilig zu werden, oder so.«
»Ach lieber Frank Meinert,« sage ich lachend, »wann hätten Sie das je getan? Wer sitzt bei jedem Fest bis zum Kehraus gähnend und fröstelnd und gelangweilt in einem Klubsessel und ist nicht wegzukriegen?«
»Nun ja,« gibt er mit einem nachsichtigen, fast zärtlichen Lächeln zu, »ich muß mich einer Art Trägheit schuldig bekennen, eines Mangels an körperlicher Initiative, wenn Sie wollen.« – »Ja,« seufze ich, »daher auch das Schlurfen. Und in Gesellschaften da sitzt sich's immer so gut im Klubsessel und draußen ist vielleicht scheußliches Wetter, da bleibt man eben. Und eigentlich tun Sie auch ganz recht daran, zu bleiben, denn wer kann wissen, ob nicht am Schluß etwas unglaublich Schönes, etwas fabelhaft Anregendes und Sensationelles kommt. Und deshalb, – sehen Sie, auch deshalb schon ist's besser, man wartet bis zum Schluß.«
Wir schweigen beide, und dann sage ich in die Dämmerung hinein, die inzwischen gekommen ist:
»Ist es denn wirklich zu Ende mit Margot und Ihnen? Ist's nicht wieder nur ein Hinziehen, wie schon so oft?« Er schüttelt den Kopf, und ich spüre es wieder einmal deutlich bis zum Schmerz, daß wir nie ärmer und hilfloser und verlogener sind, als wenn wir mit Worten trösten wollen. Und es ist ganz still im Zimmer, bis ich endlich sage:
»Wir erleben es alle einmal, und in jedem von uns wird etwas dadurch geknickt oder zerschlagen. Bei den Durchschnittsmenschen da heilt es schwer, es blutet nach innen, weil kein Ventil da ist. Aber bei Ihnen gibt es ein Ventil, Ihr Schmerz wird ausströmen und tönen, und dann wird aus Ihrer Arbeit erst das Werk geworden sein, das Sie uns schuldig sind. Und Sie wachsen über Ihre Schmerzen hinaus und fühlen doch, daß es die Schmerzen sind, die Ihr Leben reich gemacht haben.«
Er sieht mich zerstreut an und sagt nach einem kurzen Schweigen gequält: »Wenn ich nur wüßte, warum es immer so kommen muß.«
Und ich weiß, daß ich umsonst geredet habe. Und versuch's doch noch einmal: »Vielleicht gibt es einen Grund dafür, der tiefer liegt, als Sie ihn suchen. Vielleicht sollen Sie jetzt nicht glücklich sein, Frank Meinert, vielleicht sollen Sie nie auf die Art glücklich sein, weil Sie zu anderem bestimmt sind als zu einem bißchen Rausch, und dann im besten Fall zu lebenslänglichem, spießbürgerlichem Behagen. Dazu sind Sie dem Schicksal zu schade. Und mir auch, trotz Ihrer Sauertöpfigkeit und der verdrießlichen Grimassen, die Sie sich nicht abgewöhnen wollen.«
Er brütet noch immer vor sich hin, aber ein bißchen wetterleuchtet's schon in seinem unruhigen Gesicht. »Ich weiß, daß ich nie glücklich sein werde,« sagt er, »und ich weiß, daß ich einsam bleiben muß. Das ist merkwürdig bei mir, daß ich es von jeher gefühlt habe, schon als Kind zwischen all den Geschwistern. Und dies immer und immer wieder Enttäuscht- und Einsamwerden, das wird mein Schicksal bleiben, ich weiß es. Es ist mein typisches Erlebnis, wie Nietzsche sagt.«
Ich nicke und bin nun schon ganz beruhigt: Fürs erste hat Frank Meinert sein Spielzeug gefunden.
»Ob ich die Einsamkeit werde tragen können?« sagt er vor sich hin, »nur die Größten haben es gekonnt.«
»Es ist doch nur das äußere Einsamsein,« antworte ich. »Innerlich sind wir ja immer allein, nur daß wir's oft nicht wissen. Aber in den lichten Momenten, in denen wir das ganze Dasein als sinnlos, dunkel und verworren empfinden – denn das sind unsere lichten Momente, Frank Meinert –, da wissen wir, daß wir einsam sind, wie ein Wanderer in sturmdunkler Nacht. Da wissen wir auch, daß aus zweien niemals eins werden kann.«
»Ja,« nickt Frank langsam vor sich hin, »auf uns trifft das zu, weil wir Ganze sind. Halbe können vielleicht zu einem Ganzen verschmelzen, unsere Bestimmung ist es, allein und wir selbst zu bleiben. –
Weshalb lächeln Sie?« fragt er plötzlich mißtrauisch und gereizt. Ich bestreite, gelächelt zu haben und drehe das Licht an, um ähnlichen Irrtümern vorzubeugen. Und Frank sagt leise, den Kopf in die Hand gestützt: »So kommt man also früh zur Resignation.«
Jetzt lächle ich wirklich: »Ach nein, lieber Freund, so leicht kommt man nicht zur Resignation, wie Sie in diesem Augenblick glauben. Da müssen noch viele bittere Schmerzen durchgebissen und überwunden werden, ehe Sie dahin gelangen. Resignation, das ist die reifste Frucht an unserem Lebensbaum.«
»Und doch die bitterste,« sagt er, und wir schweigen beide.
Plötzlich sieht er nach der Uhr, steht mit einem Ruck auf und streckt mir seufzend die Hand hin: »Ich muß gehen. Es ist fabelhaft, wie in diesem Zimmer die Zeit versinkt! Schon die Tapete hat so etwas unglaublich Wohltuendes. Aber ich muß an die Arbeit.«
Ich nicke. »Man muß sich rühren, wenn man über Wasser bleiben will.«
Wir stehen einen Augenblick, und dann sagt Frank:
»Ob wohl alle Menschen ihr typisches Erlebnis haben?«
»Ich glaube wohl,« antworte ich, »aber die wenigsten sind sich dessen bewußt. Und es gibt auch viele Menschen, deren typisches Erlebnis ›Nichterleben‹ heißt.«
Und da er mich fragend ansieht, setze ich hinzu: »Das will ich Ihnen noch sagen, Frank, weil es vielleicht ein Trost für Sie ist: Nicht das Unglück, das uns trifft, schafft uns das bitterste Leid. Viel schwerer als das traurigste Erlebnis belasten uns die unerlebten Dinge, die Ahnung der tausend Möglichkeiten, für die wir uns bestimmt und gerüstet fühlen, und die sich uns niemals ereignen.«
Es ist eine Weile still im Zimmer, dann fragt Frank Meinert:
»Wann darf ich wiederkommen?«
»Sobald Sie wollen,« antworte ich.
»Dann darf ich Ihnen morgen ausführlich erzählen, wie das alles kam, mit Margot und mir?«
»Gewiß,« antworte ich und lächle erst, nachdem die Tür sich hinter ihm geschlossen hat.

»Gnädige Frau,« sagt der sehr hübsche junge Mann, »ich möchte Ihnen für mein Leben gerne etwas sagen. Es quält mich, seit ich hier sitze und Sie ansehe, aber ich wage es nicht.«
»Ist es etwas so Schlimmes?« frage ich, »dann verschweigen Sie es lieber. Sie wissen, ich lasse mir meine Kaffeestunde nicht gerne stören.«
»Es ist nichts Schlimmes,« antwortete er, »aber es brennt mir auf der Zunge.«
»Dann hoffe ich, daß es eine brennend pikante Geschichte ist. Aber ich warne Sie, je amüsanter sie ist, um so schwerer werde ich sie für mich behalten können. Verschwiegenheit gehört nun einmal nicht zu den Tugenden, die ich von mir verlange, denn man muß auch sich selbst gegenüber in seinen Ansprüchen maßvoll sein.«
Georg Wendringer lacht: »Zum Glück beansprucht das, was ich Ihnen sagen will, keine Diskretion. Es ist nicht einmal neu, und eigentlich ist es nur ein Satz: – Gnädige Frau, Sie sind unglaublich schön.«
Ich muß hell herauslachen. »Ist das alles?«
»Ja,« sagte er, »das ist alles, und es ist eine wundervolle Befreiung, es gesagt zu haben. Und Sie sind nicht böse?«
»Ich weiß noch nicht,« antworte ich. »Es liegt natürlich eine Beleidigung darin, besonders in dem ›unglaublich‹, das eine böse Nebenbedeutung haben kann. Aber diesmal will ich's nicht so nehmen und Ihnen sogar gestehen, daß es für eine Frau nichts Wohltuenderes und Erwärmenderes gibt, als das Bewußtsein, schön gefunden zu werden. Alle Bewunderung für unsere Tugenden, ja sogar für unsere Liebenswürdigkeit und unseren Geist läßt uns kalt, denn sie ist nicht das Primäre.«
»Ich sehe, Sie sind nicht böse,« sagt er vergnügt, »dann darf ich mehr sagen.«
»Davon möchte ich abraten,« antworte ich, »jedes Mehr müßte den guten Eindruck stören, den Sie bis jetzt gemacht haben.« –
»So finden Sie also wirklich, daß für eine Frau Schönheit das Höchste und Begehrenswerteste ist?« fragt er kopfschüttelnd, »von Ihnen hätte ich das nicht gedacht.«
»Warum nicht von mir?« frage ich ein wenig erstaunt.
»Nun,« erklärt er mir, indem er versucht, seine langen Glieder in eine etwas bequemere Lage zu bringen, »ich hatte bis jetzt immer gefunden, daß nur die mehr klugen als schönen Frauen dieser Ansicht waren, während umgekehrt die mehr schönen lieber für klug –.« Hier lache ich so herzlich, daß er erschrocken innehält.
»Und da komme ich nun, mehr dumm als häßlich und doch immer noch klug genug, nicht klug sein zu wollen und werfe Ihr ganzes schönes Schema über den Haufen.«
»Habe ich wirklich so was Dummes gesagt?« fragte er kleinlaut.
»Ach nein,« beruhige ich ihn, »wenn ich von dem zweifelhaften Kompliment für mich absehe, war es sogar eine sehr feine Beobachtung; Sie dürfen sie aber nicht jeder Frau verraten, denn sie ist ein Messer, das auf beiden Seiten schneidet. Wahr ist es übrigens schon, die Frauen, die sich ihrer Schönheit bewußt sind, wollen für klug gelten, denn zwei Vorzüge sind mehr als einer, und man überschätzt bekanntlich den Wert dessen, was man nicht hat. Die Klugen sind klüger und wollen gern schön sein, denn sie wissen, was das bedeutet und welche Macht darin liegen kann. Kann – sage ich, denn es gibt sehr viel Schönheit, die ungenutzt verlorengeht.«
»Ja,« antwortet er nachdenklich, »ich kenne zum Beispiel eine junge Frau, die jeden Abend, wenn sie vorm Spiegel steht und ihr Haar bürstet, ›Schade, schade!‹ sagt.«
»Ich will nicht indiskret sein,« versichere ich, »welche Bemerkung man übrigens immer voraus schickt, wenn man eine große Indiskretion beabsichtigt, aber ich möchte mir doch die Frage gestatten: Hat die junge Frau Ihnen das selbst erzählt?«
»Ich muß mit Oskar Wilde antworten,« sagt Georg Wendringer, »eine Frage ist niemals indiskret, nur die Antwort kann es sein.«
»Gut geantwortet, Georg Wendringer und Oskar Wilde,« sage ich. »Und da das Fragen nicht indiskret sein kann, so frage ich also getrost weiter: Hat sie wirklich so schöne Schultern?«
»Ich glaube, ja,« antwortet Georg mit seinem verschmitzten Lächeln und setzt, plötzlich ernst werdend, hinzu: »Übrigens sind wir nur sehr gut befreundet ohne jeden erotischen Beigeschmack.«
Ich muß ein wenig ungläubig dreingeschaut haben, denn er fragt schnell: »Aber Sie glauben vielleicht nicht an Freundschaft zwischen Mann und Frau?«
»O Gott!« seufze ich, »seit meinem sechzehnten Jahr quält man mich mit dieser Doktorfrage.«
»So haben Sie gewiß genügend darüber nachgedacht und können mir das Resultat mitteilen.«
»Nein,« sage ich, »das werde ich nicht tun, denn ich habe mir geschworen, auf diese Frage nicht mehr einzugehen, seitdem ein vorlauter Jüngling mir auf meine Antwort hin die noch heiklere Frage gestellt hat: Und was ist es also, was zwischen uns beiden besteht?«
Georg lacht: »Ich hatte nicht die Absicht, Sie in eine solche Falle zu locken, aber ich möchte für mein Leben gern wissen, welche Antwort der naseweise junge Mann bekam.«
»Die Antwort, die ich allen jungen Männern gebe, sobald sie anfangen, naseweis zu werden. Ich habe gelacht, ihm die Zigaretten gereicht und gefragt, ob er sich nicht zum Abschied noch bedienen wolle.«
»Das war hart,« sagt Georg, »denn seine Frage lag so nah, die Gelegenheit war so günstig.«
»Was wäre denn Takt,« antworte ich, »wenn es nicht die Fähigkeit und der Wille wäre, gute Gelegenheiten ungenützt zu lassen.«
Georg seufzt: »Schweigen ist aber oft sehr schwer!« und sieht so bekümmert aus, daß ich lachen muß. – »Ja, es muß sehr schwer sein. Allein wenn ich bedenke, wie früh man sprechen lernt und wie spät erst schweigen.«
Georg schüttelt den Kopf: »Das stimmt nicht ganz, so hübsch es klingt. Denn es kann sich ja nur um das richtige Sprechen und das richtige Schweigen handeln, und das lernt sich wohl gleich schwer und ist im Grunde genommen dasselbe, denn eins ohne das andere ist wertlos und eben nicht das Rechte.«
»Natürlich,« stimme ich bei, »Ihre Gründlichkeit hat wieder mal recht, und ich muß es zugeben, trotzdem Sie mir damit meine schöne Sentenz einfach totgeschlagen haben. Es muß auch das rechte Schweigen sein, denn es gibt Menschen, die nur darum für verschlossen und abgründig tief gelten, weil sie einfach nichts zu sagen haben, und weil man sich gar nicht vorzustellen vermag, daß jemand wirklich so gar nichts zu sagen haben kann. Ihre ganze Klugheit besteht darin, zu verbergen, daß sie nichts zu verbergen haben, und es kann lange dauern, bis man dahinter kommt, daß nichts dahinter ist, und daß sie durch und durch oberflächliche Geschöpfe sind. Denn, so paradox es klingen mag, es gibt wirklich Menschen, die durch und durch oberflächlich sind.«
Georg lacht: »Sie haben heute Ihren paradoxen Tag, aber es klingt wieder sehr hübsch, und ich werde mich diesmal hüten, Ihre schönen Sentenzen zu zerstören, so leicht und verlockend es wäre.«
»Ich kenne aber noch eine andere Art von falschen Schweigsamen,« fahre ich fort, »das sind die, die in Gesellschaft mürrisch und verschlossen sind und selten den Mund auftun, außer zum Gähnen, weil es nur ein einziges Thema für sie gibt, und das ist ihre eigene Person. Wie gesprächig werden sie aber, wenn sie auf dies Thema kommen! Es ist ihnen gleichgültig, wer zuhört, es liegt ihnen auch nichts daran, sich in ein besonders gutes Licht zu setzen, ja, sie verleumden sich lieber, ehe sie eine Gelegenheit vorbeigehen lassen, von sich zu sprechen, und sie können in einer Viertelstunde mehr von sich preisgeben, als andere gerne plaudernde Menschen in Jahren.«
Georg zieht nachdenklich den Rauch seiner Zigarette ein, bläst ein paar Ringe und fragt dann: »Steckt nicht in den meisten von uns etwas von dieser Leidenschaft? Und bedeutet sie nicht eigentlich nur eine übergroße Ehrlichkeit?«
»Nun ja,« sage ich, »insoweit ein gewisser Mangel an Schamgefühl Ehrlichkeit bedeutet.« – »So meinte ich's nicht,« unterbricht er mich, »ich meinte die Ehrlichkeit, die darin liegt, kein Interesse heucheln zu wollen. Und ist es nicht fast immer Heuchelei, wenn wir vorgeben, es könne uns irgend etwas auf der Welt mehr interessieren als unsere eigene Person?«
Ich muß lachen, »eine Unterhaltung zwischen mehreren solcher Ehrlichkeitsfanatiker stelle ich mir sehr reizvoll vor. Übrigens müssen sie doch bedenken, daß wir mit jedem Wort, das wir sprechen, von unserer eigenen Person ausgehen und deshalb, streng genommen, immer nur von uns reden. – Das sollte selbst dem unersättlichsten auf diesem Gebiet genügen.«
Wir schweigen eine Weile, und ich sehe, daß Georg, trotzdem er scheinbar seine Rauchringe aufmerksam verfolgt, mit einem Entschluß kämpft. Plötzlich blickt er auf und sagt: »Verzeihen Sie, daß ich so zerstreut bin – aber – ich habe eine Bitte.«
»Zerstreutheit ist bekanntlich immer der höchste Grad von Aufmerksamkeit, nämlich für eine andere Sache,« antworte ich, »und deshalb dachte ich mir's gleich, daß Sie etwas auf dem Herzen haben. Also – herunter damit.«
»Ja,« sagt er ein bißchen stockend, »es ist vielleicht eine sonderbare Bitte, aber Sie werden mich nicht mißverstehen: Ich möchte Sie für mein Leben gern mit meiner Freundin bekannt machen.«
Ich schweige einen Augenblick und frage dann, um Zeit zu gewinnen: »Ist es die junge Frau mit den schönen Schultern?«
Er nickt und seine blauen Augen blicken mich treuherzig ernsthaft an.
»Lieber Freund,« sage ich und drücke mein Zigarettenstümpfchen langsam aus, »was versprechen Sie sich für Ihre Freundin und mich davon?«
»Oh, sehr viel,« antwortet er lebhaft, »vor allem für Lilly. Sehen Sie, sie hat nicht den richtigen Verkehr, – wenigstens ich finde das, sie ist ja leider ganz zufrieden damit, aber ich hoffe, wenn sie Sie kennenlernt –«
»Hat sie denn den Wunsch geäußert?« frage ich und sehe, wie eine kleine Verlegenheit über sein ehrliches Gesicht schleicht.
»Das nun gerade nicht,« sagt er, »es ist eigentlich mehr ein Wunsch von mir. Aber ich bin sicher –«
»Ganz gewiß,« antworte ich, »aber wenn die junge Frau mit ihrem Verkehr zufrieden ist –«
»Aber ich sage Ihnen ja, ihr Verkehr ist nicht der richtige,« unterbricht mich Georg erregt. –
»Der Verkehr, mit dem man zufrieden ist, ist eigentlich immer der richtige,« antworte ich, »und vielleicht wäre ich ganz und gar der unrichtige. Sie überschätzen mich sicher, trotzdem Sie mir vor ein paar Minuten den Verstand so ziemlich abgesprochen haben.« – »Das habe ich nicht getan,« verteidigt er sich, »Sie wissen es recht gut, und was Sie jetzt sagen, entspringt wieder Ihrer übergroßen Bescheidenheit!«
»Bescheidenheit ist ein Ding, das ich überhaupt nicht kenne, weder bei mir noch bei anderen,« antworte ich, »und ich behaupte, es ist ein Wort, dessen Inhalt nicht existiert.«
»Das ist eine kuriose Behauptung,« kopfschüttelt Georg.
»Sehr einfach,« erkläre ich ihm, »entweder ein Mensch kennt seine Vorzüge nicht, dann ist seine Bescheidenheit nicht Bescheidenheit, sondern die selbstverständliche Folge seiner Selbsteinschätzung. Oder ein Mensch kennt seine Vorzüge, dann kann seine Bescheidenheit nichts anderes sein, als Heuchelei, im besten Falle Anstandsgefühl oder Rücksichtnahme auf Schwächere, alles, nur keine Bescheidenheit.«
»Auf diese Weise läßt sich alles aus der Welt wegdisputieren,« sagt Georg verstimmt, »aber ich bin optimistisch genug zu behaupten, –« – »Ich muß Sie noch weiter ärgern,« unterbreche ich ihn lachend, »und behaupte, daß es mit dem Optimismus fast dieselbe Sache ist. So sicher Sie nämlich in dem Moment unbescheiden sind, in dem Sie sich Ihrer Bescheidenheit bewußt werden, so sicher sind Sie nicht mehr optimistisch in dem Augenblick, in dem Sie sich so nennen. – Ich will das erst beweisen,« fahre ich fort, da er versucht, Einwendungen zu machen.
»Optimistisch sind Sie, solange Sie die Welt schöner und besser sehen, als sie ist. Sobald Sie aber wissen, daß Sie die Welt besser sehen, als sie ist, wissen Sie auch, daß sie eigentlich schlechter ist, als Sie sie sehen, und mit diesem Wissen stehen Sie schon auf der anderen Seite der Weltanschauung und können fast für einen Pessimisten durchgehen. – Und jetzt dürfen Sie antworten.«
Aber Georg ist verdrießlich: »Daß ich kein Pessimist bin, weiß ich, trotz Ihrer philosophischen Purzelbäume, und ich verwahre mich entschieden dagegen.«
»Weshalb denn?« frage ich, »mir sind die Pessimisten sehr viel lieber als die frischfröhlichen ›Lebensbejaher‹, wie es jetzt modern aber etwas unklar heißt. Nur über eins habe ich manchmal nachgegrübelt und weiß es nicht: Ist es das traurige oder das tröstliche Moment im Leben der Pessimisten und Skeptiker, daß Sie zum Schluß immer recht behalten?«
Georg sieht mich einen Augenblick schweigend an, dann sagt er:
»Sie haben mir noch keine endgültige Antwort auf meine Bitte gegeben, und ich müßte dümmer sein als ich bin, wenn ich nicht gemerkt hätte, daß all Ihr Philosophieren nur den Zweck hatte, mich davon abzulenken. Aber ich bestehe darauf, daß Sie –«
»Lieber Herr Wendringer,« sage ich ein wenig gedehnt und greife nach dem Zigarettenetui, das ich ihm langsam hinüberreiche, »wollen Sie nicht –.«
Georg ist rot geworden, er springt auf.
»Jawohl – zum Abschied, ich verstehe.«
Aber schon im nächsten Augenblick geht ein spitzbübisches Lächeln über sein Gesicht. »Liebe gnädige Frau, ich war naseweis; aber ich hoffe, Sie machen mir das nicht zum Vorwurf, denn da bekanntlich die Bescheidenheit ins Reich der Fabel gehört, wäre es doch unbescheiden, zu verlangen, daß gerade ich –« – »Jawohl,« sage ich lachend, »und ich werde bis zu Ihrem nächsten Besuch darüber nachgrübeln, wie es kommt, daß es zwar keine Bescheidenheit gibt, daß sich aber an Dreistigkeit vorerst noch kein Mangel fühlbar gemacht hat.«
»Wann darf ich annehmen, daß Sie die Frage gelöst haben?« erkundigt sich Georg.
»Das kommt darauf an, wie hoch Sie meinen Verstand einschätzen,« antworte ich, und er verbeugt sich tief und sagt galant:
»Fast so hoch wie Ihre Schönheit.«

Ich komme von Franz Lindners Trauung und steige langsam und nachdenklich die Treppe der eleganten schwiegerelterlichen Villa hinunter. Neben, vor und hinter mir drängt sich die Schar der übrigen Gäste, und plötzlich sagt jemand halblaut in der Nähe meines Ohres: »Eine schöne Leich'.«
Ich blicke ein wenig empört zur Seite und gerade in Doktor Paulsens blasses und scharfes Gesicht.
»Noch nicht auf der Treppe,« wehre ich ab. »Wissen Sie nicht, daß es guter Ton ist, erst vor dem Haus anzufangen?«
»Wohin gehen wir?« fragt er unten angelangt und sieht mir durch seinen Kneifer ernst und erwartungsvoll ins Gesicht. Ich muß lachen.
»Ich hatte die Absicht, allein zu gehen. Hab' allerlei durchzudenken und durchzufühlen. Ein Freund, der einem soeben endgültig aus der Hand geglitten ist, Sie verstehen –«
Paulsen zuckt die Achseln. »Ich erlaube mir zu bemerken, daß uns die Dinge meist nur aus der geöffneten Hand gleiten.«
»Nun ja,« antworte ich, »aber manchmal rät der Verstand, die Hand rechtzeitig zu öffnen.«
Paulsen verzieht das Gesicht zu einer wehmütig-spöttischen Grimasse. »Tja, ja, der Verstand!« bemerkt er tiefsinnig, und ich fahre fort:
»Übrigens können Sie auch mitkommen, denn wenn ich mir's recht überlege, sind Sie einer der wenigen Menschen, mit denen sich's fast ebensogut geht wie allein.«
Er zieht den Hut und streckt mir abschiednehmend die Hand hin: »Nach diesem Hymnus auf die Einsamkeit –«
»Ach, keine Fissimatenten,« sage ich und schiebe ihn mit dem Ellenbogen vorwärts, »kommen Sie mit. Sie wissen ja, es ist ein schönes Ding um die Einsamkeit, aber man muß einen haben, dem man sagen kann: ›Es ist ein schönes Ding um die Einsamkeit‹!«
»Gut und weise!« lobt er und geht langsam neben mir weiter. »Nur daß Sie mich damit zum Spiegel Ihrer schönen Gefühle erniedrigen! Und außerdem hätten Sie an Stelle des unpersönlichen Fürworts unbedingt ›die Frau‹ sagen müssen, denn wir Männer ertragen die Einsamkeit auch ohne Spiegel.«
»Das ist ein unliebenswürdiger Zug von euch,« behaupte ich, »und außerdem glaube ich's nicht. Ihr braucht euer Publikum so gut wie wir.«
»Ja,« antwortet er, »aber nur von Zeit zu Zeit. Verhältnismäßig selten. – Eine Frau kann aber nicht leben ohne Spiegel. Sie kann weder Kunst noch Natur allein genießen, sie braucht immer einen, der ihre Bewunderung bewundert. Ja, ich behaupte sogar, eine Frau allein in einem Zimmer, in dem sie weder gehört noch gesehen werden kann, hört auf zu existieren. Sie erlischt wie eine Kerze im luftleeren Raum.«
»Hören Sie, Paulsen,« sage ich und bleibe stehen, »wirken Trauungen immer so beunruhigend auf Sie? Dann hätten Sie mich doch lieber allein gehen lassen sollen, selbst auf die Gefahr hin, daß ich wie eine Kerze im luftleeren Raum verlösche.«
»Man muß sich austoben,« brummt er.
»Und damit scheint einer der seltenen Momente gekommen zu sein, in denen selbst der Mann ein Publikum braucht. Was hat Sie übrigens, wenn ich fragen darf, in diese erfrischende Stimmung versetzt? Vielleicht der famose Geistliche, gegen den Franz sich noch bis zum letzten freien Atemzug gewehrt hat und von dem er mir eben noch schnell und mit seiner wütendsten Grimasse zuflüstern mußte, daß er ein idiotischer Wanderprediger sei! Wobei mir nur eines unklar geblieben ist: warum gerade Wanderprediger?«
»Es fiel ihm wohl im Moment nichts Beschimpfenderes ein,« vermutet Paulsen. »Aber der ist ja nur nebenbei, gewissermaßen als ein Symbol dieser ganzen irrsinnigen Heiraterei.«
»Wieso irrsinnig?« frage ich sanft. »Ich habe noch nie eine Heirat gesehen, die – wenigstens von einer Seite aus – von so idealer Vernünftigkeit getragen war wie diese. Man könnte sagen, Herz und Verstand halten sich bei Franz die Wage, und sieht fast die zwei gleichstehenden Schalen vor sich. Von Gertruds Seite muß übrigens wirklich nur leidenschaftliche Liebe vorliegen, denn soviel ich mir auch den Kopf zerbreche, sogenannte Verstandesgründe für diese Heirat sind nicht aufzufinden.
Aber Paulsen, Sie können sagen, was Sie wollen und lächeln, wie Sie wollen, für euch Männer gibt es ja allerlei Glücksmöglichkeiten und allerlei Arten von Vernunftheiraten, aber für uns gibt es nur eine Art von Glück und nur eine Vernunftheirat, und das ist die Heirat aus Liebe.«
Paulsen lächelt grimmig: »Es gibt für euch Frauen nur einen absolut sicheren Weg zum Unglücklichwerden: das ist eine Heirat aus sogenannter leidenschaftlicher Liebe. Mit einem ungeliebten oder gleichgültigen Mann kann eine Frau ja ein ähnliches Ziel erreichen, aber der Weg ist nicht halb so sicher. Da gibt es noch Seitenpfade, in die sie abbiegen kann, womit ich nicht allein die illegitimen gemeint haben will. Frauenstimmrecht und Wohlfahrtspflege sind sogar extra dazu angelegte, gesellschaftlich sanktionierte Nebenstraßen. Für die leidenschaftlich liebende Frau gibt es aber keine Nebenstraßen, ihr Weg führt direkt und unbedingt in die Hölle.«
»Ja, Paulsen, denn eure Unzulänglichkeit schreit zu Himmel und Hölle. Aber selbst wenn Sie die Liebe als Vernunftgrund verwerfen, so müssen Sie doch zugeben, daß sie das einzig anständige Motiv zur Eheschließung ist.«
Aber Paulsen ist heute durchaus nicht in der Zugebelaune und erklärt verbissen:
»Ich will Ihnen etwas sagen, gnädige Frau, es gibt nur eine anständige Art von Liebe, und das ist die, von der's im Volksliede heißt: ›Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß‹, nämlich die heimliche, von der ›niemand nichts weiß‹. – Und wenn zwei Menschen es über sich gewinnen, mündlich und schriftlich und mit Blicken und Mienen stolz vor aller Welt zu verkünden, daß sie einander leidenschaftlich lieben und deshalb heiraten wollen, so nenne ich das eine unanständige Handlung. Von geschmackvollen Menschen sollte man verlangen dürfen, daß sie, wenigstens der Welt gegenüber, die Komödie der Vernunftehe aufrechterhalten.«
Hier muß ich so herzlich lachen, daß Paulsen mich durch seinen Kneifer erstaunt betrachtet, denn ihm ist's, wie immer, bitter ernst.
»Paulsen,« sage ich, »haben Sie wirklich keine Ahnung davon, wie viele Komödien uns durch diese Komödie erspart blieben? – Aber bis jetzt haben Sie nur um die Sache herumgeredet und mir immer noch nicht erzählt, warum Sie gerade heute Ihre Grantigkeit so wenig bändigen konnten, daß sie schon auf der Treppe mit Ihnen durchging? Und was sollte das heißen: ›Eine schöne Leich'‹?«
»Nun, das soll heißen, daß wir heute unseren guten Franz Lindner mit Harmoniumklängen und Feierreden sanft eingesargt und begraben haben. Nicht nur für uns, was selbstverständlich und nicht von Bedeutung ist, sondern auch für die Welt, und – wie ich fürchte, für ihn selbst.«
»Für einen Toten fand ich ihn unverhältnismäßig zufrieden und glücklich aussehend,« bemerke ich etwas trivial, und Paulsen fährt denn auch auf: »Ein Mann und noch dazu ein Künstler, der mit fünfundzwanzig Jahren zufrieden und glücklich aussieht, der gehört unbesehen zu den Toten, denn er ist das jämmerlichste von allen Geschöpfen.«
»Lieber Freund,« sage ich beschwichtigend, »ich hoffe, daß das nur einer Ihrer bekannten rethorischen Superlative ist, die wirklich immer superlativischer und rethorischer werden.«
Aber Paulsen schüttelt den Kopf. »Alles darf ein Künstler wollen,« sagt er nachdrücklich, »das Höchste und das Niedrigste, das Edelste und das Gemeinste, nur das armselige Glücklichsein, das darf er nicht wollen, das muß er den Philistern und den Weibern überlassen, sonst hat er ausgespielt – versungen und vertan.«
»Ich verstehe das nicht,« antworte ich. »Sollte eines Mannes großes, vielleicht überschwängliches Glück nicht auch Kunstwerke schaffen helfen?«
»Glück!« sagt Paulsen und verzieht das Gesicht, als habe er unversehens auf ein Pfefferkorn gebissen. »Nehmen Sie bitte das Wort einmal in die Hand, wie Schnee wird's darin zerfließen.«
Ich schüttle langsam den Kopf, aber er fährt fort: »Jawohl, ich kenne allerlei angenehme Dinge, die dem Glück zum Verwechseln ähnlich sehen. Erstens und vor allem befriedigte Eitelkeit, dann vielleicht noch Sorglosigkeit und Behagen. Ich kenne auch allerlei Räusche, aber immer, wenn man Glück dazu sagen will, zerfließen sie wie Schnee zu Wasser und zu Dreck. – Nein, das sogenannte überschwängliche Glück hat noch keine großen Werke geschaffen, und wenn dazu überhaupt ein Empfinden helfen kann, dann kann es nur ein überschwängliches Leid. Aber im allgemeinen bin ich der prosaischen Ansicht, daß die großen Werke keine Stimmungsprodukte sind, sondern Arbeitsprodukte.«
Wir schweigen einen Augenblick, dann fügt er hinzu: »Und wer arbeiten will, muß die Arme frei haben und ohne Verantwortung sein oder ohne Gewissen. Und wenn Kraft dazu gehört, die Einsamkeit zu ertragen, so gehört Größe dazu, sich als Künstler in der Zweisamkeit zu behaupten, die man bürgerliche Ehe nennt, und die meist alles andere als nur Zweisamkeit bedeutet.«
»Mag sein,« antworte ich nachdenklich. »Aber glauben Sie nicht, daß die Unzufriedenheit und innere Einsamkeit, die Ihnen zum Künstlertum unerläßlich scheinen, bei Franz schnell wieder die Oberhand gewinnen werden, sobald das Neue, das ihn jetzt noch berauscht wie alles Neue, alltäglich geworden ist?«
»Vielleicht,« nickt Paulsen. »Nur daß es dann nicht mehr die rechte Unzufriedenheit ist und nicht mehr die rechte Einsamkeit. Nicht mehr das Leid, das den Menschen erhebt, indem es ihn zermalmt. – Es wird die ganz alltägliche Qual sein, die einen feinnervigen Menschen im Zwang des immerwährenden Beisammenseins mit einem anderen zerreiben muß. Wie ja überhaupt die Frage, ob jemand in der Ehe unglücklich wird oder nicht, immer nur die Frage ist, wieviel er aushalten kann, im letzten Grund also nichts anderes als eine Nervenfrage.«
Ich nicke und lächle vor mich hin, denn Paulsens Art, die kompliziertesten Dinge auf die einfachste Formel zu bringen, amüsiert mich immer von neuem.
»Übrigens,« fährt er fort, »ist diese Frage absolut nebensächlich, und es ist möglich, daß wir Franzens Anpassungsgabe und Nervenstärke unterschätzen; vielleicht wird er sich bald wohl fühlen in der Philisterei, die er dann vornehmes Bürgertum nennen wird oder so ähnlich. Denn Leute, die ein bißchen journalistisch verseucht sind, finden bekanntlich immer ein rettendes Wort.«
Wir sind an der Alster angelangt und gehen eine Weile schweigend nebeneinander her, bis ich endlich ein wenig kleinlaut frage: »So wäre also für den Künstler die Frage, glücklich oder unglücklich verheiratet? immer nur die Frage nach dem kleineren Übel und eine ungelöste, wie mir scheint.«
Paulsen nickt zerstreut und deutet nach der sonnenglitzernden Alster und den Gärten rechts und links, von denen der Duft herüberstreift.
»Da ist er wieder, der große Betrüger,« sagt er, »dem wir in unserer Dummheit jedes Jahr von neuem auf den Leim gehen.«
Ich sehe ihn fragend an, und er fährt grimmig fort: »Oder hat Ihnen der Frühling vielleicht schon einmal gehalten, was er Ihnen versprochen hat?«
»Nein, Paulsen,« sage ich, »er hat mir noch nie gehalten, was er mir versprochen hat. Aber vielleicht nur deshalb nicht, weil ich nie dumm genug war, ihm ganz zu glauben.«
»Tja, ja,« nickt Paulsen, und sein Gesicht verzieht sich wieder zu der wehmütig-spöttischen Grimasse, und nach einer kleinen Pause noch einmal langsam: »Tja, ja.«
»Ich weiß, Paulsen,« sage ich seufzend und reiche ihm die Hand zum Abschied, denn wir sind vor meinem Hause angelangt. »Ich weiß es schon lange, das Dümmste, was wir haben, ist allemal unser Verstand!«

Dufaure und ich laufen durch den Wald, das heißt wir laufen nicht so, wie die Kinder laufen, obwohl wir's gerne möchten, aber wir gehen auch nicht so kur- und promenadenmäßig, wie sich's für verheiratete und ernst zu nehmende Leute ziemt. Denn wir sind beide ungeduldig. Wir haben schon viel zu lange bei der Table d'hote stillsitzen müssen, und während die anderen Gäste in ihren Liegestühlen schmökern und gähnen, kommt über uns beide manchmal das fast unbezwingliche Verlangen, ziellos in der Welt herumzulaufen.
»Fast so, als ob wir vor etwas davonrennen müßten, dem wir doch nicht entgehen werden,« sagt Dufaure, und ich nicke nur und spreche dann weiter über das vorher begonnene Thema und höre plötzlich ganz erstaunt mir selbst zu, als wär's ein fremder Mensch, der da voll Eifer Vorträge über Kindererziehung und Volksaufklärung hält.
Und mitten drin fragt Dufaure ruhig und sanft: »Wollen wir nicht lieber von etwas sprechen, was Sie interessiert?«
Da lache ich und sage: »Sie sind ein feiner Seelenkenner, Hänschen Dufaure. Mir ist's wirklich im Moment vollkommen gleichgültig, ob das Volk aufgeklärt wird oder dumm bleibt.«
»Mir nicht,« sagt er, »aber ich glaube, selbst wenn Ihnen ernstlich darum zu tun wäre, kämen wir der Lösung nicht näher, solange Sie solchen Kuddelmuddel darüber reden wie eben jetzt. Denn – Verzeihung, das haben Sie wirklich getan.«
»Ach Hänschen,« seufze ich, »es ist doch unglaublich gleichgültig, was man redet. Wenn man nur nicht zu denken braucht.«
»Merkwürdig,« sagt er kopfschüttelnd, »diese Maßnahme der meisten, selbst der klügsten weiblichen Wesen, beim Sprechen das Denken auszuschalten! Übrigens begreife ich nicht, was es für Gedanken sein können, die Sie so quälen, denn daß Sie sich über die Kinder- und Volkserziehung keine Sorge machen, ist mir soeben klar geworden, während Sie so leidenschaftlich darüber sprachen.«
Und da ich schweige, fährt er fort: »Wenn ich ganz ehrlich sein soll, glaube ich überhaupt nicht, daß Sie sich über irgend etwas in der Welt Kummer machen. Mir scheint es so, als ob das Leben vor und hinter Ihnen läge wie ein schöngepflegter Park, durch den Sie in wundervollen himmelblauen Gewändern wandeln. Und über Ihnen schwebt so etwas wie ein Schutzgeist, der paßt auf Ihre himmelblauen Gewänder auf.«
»Hänschen,« sage ich, »Sie sind wirklich nicht dumm.«
»Wie hübsch, daß Sie das finden,« antwortet er, »noch hübscher, daß Sie's so überzeugend sagen, denn ich halte mich manchmal für verzweifelt dumm. Ja, wenn ich uns zwei so betrachte, scheint mir's immer, als wären wir die lebendige Illustration zu der Geschichte von der klugen Jungfrau und dem dummen Hans. – Sie kennen doch die Geschichte?«
»Nein,« sage ich, »aber mir scheint, Sie werden sie gleich erzählen, sie brennt Ihnen schon auf der Zunge.«
»Nur den Anfang,« sagt er zögernd, »denn die Geschichte hat noch keinen Schluß.«
»Sie wird auch keinen bekommen,« sage ich.
Und dann sehen wir uns einen Augenblick an, und dann frage ich, ob er gute Nachrichten von zu Hause habe.
»Ich danke,« sagt er, »die Kinder kommen täglich an die Luft und sehen gut aus. Und Baby hat jetzt den zweiten Zahn, und die Amme will fortgehen. Und der Große hat gestern zweimal gehustet, aber der Doktor sagt, es ist nichts. – Ich nehme an, daß Sie sich hierfür brennend interessieren.« – »Nicht so sehr für die Details,« antworte ich, und wir gehen eine Weile schweigend nebeneinander her, bis er plötzlich fragt:
»Wird Ihnen das Kleid nicht über, wenn Sie es immerfort tragen?« – »Welches Kleid?« frage ich erstaunt. – »Das himmelblaue,« antwortet er.
»Mein Gott, ob es mir über wird!« seufze ich. »Aus dem himmelblauen Gewand ist ja schon richtig eine Zwangsjacke geworden! Aber was nützt's, wenn ich auch heraus will, mein Schutzgeist zieht mir's immer wieder über den Kopf, und so hab' ich mich abgefunden und werde himmelblau ins Grab steigen, verlassen Sie sich darauf, Hänschen.«
»Daran glauben Sie also wie an ein unabwendbares Fatum, das Ihr Leben bestimmt?«
»Ich glaube, daß unsere Natur das Fatum ist, das unser Leben bestimmt, – ein unentrinnbares Fatum.«
»Wenn man's so hört, möcht's leidlich scheinen,« zitiert er, »aber wie wird es, wenn unsere Natur in Konflikt gerät mit der Natur und dem tiefsten Wesen eines anderen, das doch für ihn ebenso lebenbestimmend sein muß wie unseres für uns? Wenn zum Beispiel ein Mensch, der, sagen wir, vom Gesetz der Trägheit regiert wird, – ja, jetzt lachen Sie –,« unterbricht er sich, »aber seien Sie ehrlich: Heißt das, was wir Schutzgeist und Natur und Fatum nannten, nicht wirklich so ähnlich wie Trägheit?«
»Nennen Sie es so, wenn Sie wollen,« antworte ich, »und wenn Sie noch einen Namen dafür brauchen. Die meisten Menschen finden sich ja leichter mit einer Erscheinung ab, sobald sie erst einen Namen dafür gefunden haben. Und so hoffe ich, daß Sie sich endlich mit meiner Trägheit abfinden werden.«
»Hoffen Sie das ernstlich?« fragt er, und wir stehen einen Augenblick still und sehen einander in die Augen.
»Ja,« sage ich.
»Nein,« sagt er, »Sie hoffen es nicht, und Sie glauben es auch nicht. Denn Sie wissen, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich abfinden und sich abfinden lassen. –«
»Ich hoffe es doch,« antworte ich, »denn niemand kann mit dem Kopf durch die Wand, – es sei denn, er gehörte zur Kategorie derer, mit denen man Wände einrennt, und dazu habe ich Sie nie gezählt. – Aber jetzt sagen Sie mir bitte, wann wir heute Tennis spielen wollen. Vor sechs Uhr ist es gewiß zu heiß und um sieben geht es schon wieder zu Tisch.«
Statt aller Antwort fragt Dufaure: »Haben Sie eigentlich nie geritten?«
»Nein,« antworte ich, ein bißchen erstaunt, wie immer über seine sprunghafte Art. »Sie wissen ja, daß ich eine unnatürliche, ich möchte fast sagen eine traumartige Angst vor Pferden habe.« –
»Dann kennen Sie vielleicht auch nicht die eigentümliche Scheu, die manchmal ganz plötzlich und aus unaufgeklärten Gründen so ein Tier befällt. – Stellen Sie sich vor: es geht seelenruhig und brav bis zu einer bestimmten, ganz harmlosen Stelle. Aber an dieser Stelle macht es plötzlich kehrt, und keine Mühe, kein Schmeicheln und Drohen kann es bewegen, weiter als bis zu diesem Punkt zu gehen.«
»Ich habe schon davon gehört,« antworte ich, »und die Lösung dieses Rätsels wäre vielleicht ein wertvoller Beitrag zur Erforschung des pferdlichen Seelenlebens. Mir scheint sie übrigens nicht so schwierig wie Ihnen. Vielleicht ist der Punkt, vor dem die Scheu besteht, doch nicht ganz so harmlos wie Sie glauben. Es ist ja nicht gesagt, daß zwei Wesen darin gleich empfinden müssen.«
»Und wenn es nun gerade die Gefahr ist, die den Reiter lockt, wenn er nun gerade den Widerstand überwinden und diese – meinetwegen nicht harmlose Stelle erreichen will. Was dann?«
»Ja, was dann?« sage ich, »Sie sind ja Reiter, lieber Freund, nicht ich. Wäre ich der Reiter, dann umginge ich vielleicht die gefährliche Stelle – vielleicht, sage ich.«
»Das ist kein Heldenstück,« spottet er, »weder das Umgehen noch das Vielleichtsagen. Und wenn nun das andere ›Vielleicht‹ einträte, und Sie nicht so besonnen und weise wären, nicht so ganz kluge Jungfrau, was machten Sie dann?«
»Dann, ja dann machte ich wahrscheinlich eine große Dummheit, bei der ich den Kopf riskierte, oder doch wenigstens den Kragen, was auch peinlich sein kann.«
»Und das schöne himmelblaue Gewand, – ja, das wäre bitter.«
»Nein, Hänschen,« sage ich, »bitte zu bedenken, daß ich als Reiter kein himmelblaues Kleid trüge und also weit weniger zu riskieren hätte als die kluge Jungfrau, die außerdem bekanntlich noch eine kleine Öllampe in der Hand trägt, deren Licht sie treulich hütet. Ich glaube, so etwas kommt in der Bibel vor, und ich habe diese klugen Öllampenjungfrauen von jeher verabscheut.«
»Ja, nicht wahr?« sagt Dufaure ordentlich glücklich, »Sie finden also auch, daß Lampen, die nicht im richtigen Augenblick verlöschen, so recht eigentlich ihren Zweck verfehlt haben.«
»Ich möchte mir hierüber noch kein abschließendes Urteil gestatten,« antworte ich, »besonders deshalb nicht, weil der rechte Augenblick immer eine strittige Frage sein wird. Was aber die klugen Jungfrauen im Leben betrifft, so bin ich unbesorgt, denn ich habe die tröstliche Erfahrung gemacht, daß es gar keine gibt. Sogar unsere Tischgenossin, die alte und magenleidende Tante, die es so genau mit ihrer Diät nimmt, und die ich deshalb für das Ideal einer klugen und enthaltsamen Jungfrau hielt, hat neulich, als ihr der Lachs gereicht wurde, tief und schmerzlich aufgeseufzt: ›Einmal im Leben möchte ich mit gutem Gewissen sündigen dürfen.‹«
Wir lachen beide, und Dufaure behauptet, daß er das gute Gewissen von jeher für eine Erfindung der alten und magenleidenden Tanten gehalten habe.
»Haben Sie noch nicht bemerkt, daß es immer und ewig recht haben will, genau so wie die alten Tanten?« fragt er.
»Es hat auch immer recht,« antworte ich, »denn es spricht nur, wenn es recht hat, und das unterscheidet es von allen alten Tanten der Welt.«
Und nach dieser Feststellung setzen wir uns auf einen kleinen Rasenabhang und rauchen und starren in die Luft.
Auf einmal fragt Dufaure: »Spricht Ihr Gewissen nicht schon seit drei Wochen unaufhörlich mit Ihnen?«
»Nein,« sage ich und starre weiter in die Luft.
»Dann muß es recht gut erzogen sein,« behauptet er.
»Finden Sie, daß ich so in Sünden wate?«
»Nun,« antwortet er, »die äußere Korrektheit bedeutet oft nichts als die Inkorrektheit des Herzens. Aber vielleicht reagiert Ihr Gewissen nicht auf Unterlassungssünden.«
Ich muß unwillkürlich lächeln: »Worunter also in diesem Fall meine unterlassenen Sünden zu verstehen wären.«
Und da er mich schweigend und mit einem eigensinnigen Ausdruck ansieht, kann ich nicht anders, als ein altes Kinderlied zitieren, und ich sage leise in seine flackernden Augen hinein: »Hänschen, Hänschen, sei gescheit!«
»Ja,« antwortet er zwischen den Zähnen und, plötzlich aufspringend: »Weiß auch nicht, welcher Teufel mich manchmal packt und Ihnen den Spaziergang durch die himmelblauen Gärten stört.«
Mir kommt plötzlich eine drollige Kindheitserinnerung, und während wir weitergehen erzähle ich ihm:
»Als meine Schwestern und ich noch klein waren, hatten wir mal ein sonderbares Spielzeug. Daran muß ich jetzt denken, vielleicht weil Sie gerade vom Teufel sprachen. Es war ein sehr hübscher, harmlos aussehender Kasten, dessen Schloß schwer zu finden war. Und während man danach suchte, berührte man jedesmal eine geheime Feder, der Kasten sprang auf, und ein kleiner Teufel flog heraus. – Und wir erschraken jedesmal zu Tod, und einmal habe ich sogar vor Schrecken geweint. Und wir hatten es doch vorher gewußt, daß der Teufel darin saß und hätten doch die Hände von dem gefährlichen Spielzeug lassen können.«
»Ja,« sagt Dufaure, »wir hätten ja die Hände von dem gefährlichen Spielzeug lassen können. – Daß es nicht geschah, trotz des besseren Wissens, bestätigt mal wieder meinen schönen, aber traurigen Satz: ›Klugheit schützt vor Dummheit nicht.‹ Übrigens vermute ich, daß Ihre Tränen schnell getrocknet waren. Es gibt ja so viele Spielsachen auf der Welt, und der Teufel sitzt nicht in allen.«
»Sicher war ich schnell getröstet,« antworte ich, »besonders, weil ich als Kind oberflächlich genug war, nicht hinter jeder harmlosen Sache eine tiefe Symbolik zu wittern.«
»Verzeihen Sie,« sagt Dufaure, »die Symbolik lag hier so nahe. Aber um Sie zu versöhnen, will ich Ihnen auch etwas aus meinem Kinderleben erzählen, wenn Sie es hören wollen.« Ich nicke und er erzählt:
»Ich hatte als Kind neben vielen schlechten Gewohnheiten eine, die besonders fatal und gefährlich war, nämlich die Gewohnheit, mich immer selbst zu sehen und zu hören. Ich ging immer gleichsam neben mir her und beobachtete mich. Anfangs mag es eine gewollte Spielerei gewesen sein, aber dann wurde es zur Gewohnheit und schließlich zum Zwang. – Auch daß ich mich beobachtete, beobachtete ich und so immer weiter, so daß es war, als stünde ich zwischen zwei Spiegeln, die sich ineinanderspiegeln und in denen man sich unheimlicherweise in einer endlosen Reihe sitzen, stehen und bewegen sieht. Sie können sich nicht denken, wie qualvoll das war – und noch ist, denn es ist noch nicht vorbei. Noch keine Erregung, noch kein Erlebnis war stark genug, mich in mir selbst zu verlöschen, mich von mir selbst zu erlösen.«
Dufaure schweigt einen Augenblick und setzt dann langsam hinzu:
»Und ich sehne mich nach dieser Erlösung. Ich möchte mich selbst verlieren, – einmal im Leben.«
Wir stehen auf der kleinen Brücke und sehen hinunter, und unsere Hände liegen auf dem Gitter nahe beieinander, aber nicht so nahe, daß sie sich berühren. Und plötzlich sage ich in die Stille hinein, fast ohne es zu wissen und zu wollen, und meine Stimme klingt wie dünnes Glas, das im nächsten Augenblick zerbrechen kann:
»Ich möchte mich selbst finden, – einmal im Leben.«
Und dann sprechen wir gar nichts mehr. –

Ein unbeschreiblicher Reiz liegt über der Alster, wenn sie an warmen Sommerabenden mit unzähligen kleinen Fahrzeugen übersät ist, wenn die Ruder- und Segelboote, Punts und Kanus lustig durcheinanderschießen, und junge Gestalten in bunten Sportgewändern einander zurufen und nicken und plaudern und lachen und flirten, als wäre die Welt ein großer Festplatz und Leben der entzückendste Sport.
Aber ein anderer, feinerer Reiz liegt über der Alster, wenn man an lieben Sommermorgenden langsam durch ihre stillen Kanäle fährt. Gärten rechts und links, Weiden, deren Zweige bis ins Wasser hängen, Schwäne, die sich langsam dem Boot nähern, und die ein leichter Ruderschlag wieder vertreibt. Hier und da Kinder in den Gärten und ein kleiner Hund, der ans Ufer kommt und bellt. Und wir gleiten an all dem vorbei, und es ist wie im Märchenland.
»Andersens Märchen,« sage ich, und Erich Halpern sieht nach dem Ufer hinüber und nickt. Er sitzt an der Spitze des Punts, in weißem Sportanzug mit bunter Krawatte und braunem Wildledergürtel, frisch, klug und hamburgisch aussehend. Langsam und wie zum Spiel läßt er das leichte Ruder durchs Wasser gleiten, während ich mir am Boden des Fahrzeuges zwischen den unzähligen bunten Kissen und Polstern mein bequemes Lager hergerichtet habe. –
»Hier müßte man Märchen erleben,« sagt er lächelnd.
»Märchen erlebt man nicht,« antworte ich ein bißchen faul und blicke den Wölkchen meiner Zigarette nach, »man erzählt sie höchstens seinen Freunden.«
»Womit Sie hoffentlich nicht sagen wollen, daß alle Erlebnisse, die man seinen Freunden erzählt, Märchen sind?« – »Das will ich doch hoffen,« entgegne ich, »denn sobald sie aufhören, Märchen zu sein, sind sie schon Indiskretionen.«
»Müssen es denn immer Liebesgeschichten sein?« fragt er lachend.
»Ach bitte ja,« antworte ich, »alle anderen sind doch wirklich gar zu langweilig. Oder können Sie sich etwas Tödlicheres denken, als wenn jemand seine Abenteuer auf anderem Gebiet zum besten gibt. Beispielsweise Reiseerlebnisse: Man kann mir die Besteigung des Montblanc in den glühendsten Farben schildern, man kann mir die Kämpfe mit Buschmännern und Moskitofliegen noch so reizvoll ausmalen, es wird mich alles gleichgültig lassen der Frage gegenüber, ob die unglückliche Liebe, der man auf seiner Reise um die Welt entfliehen wollte, erkaltet ist oder nicht. Aber leider ist es die traurige Eigentümlichkeit der unglücklichen Lieben, daß sie auch in der Entfernung nicht erkalten.«
»Haben Sie diese betrübliche Erfahrung aktiver- oder passiverweise gemacht?« fragt Erich, »wenn es nicht indiskret ist, sich danach zu erkundigen.«
»Es ist indiskret,« antworte ich, »aber ich will Ihnen trotzdem antworten, daß ich in unglücklichen Liebesfällen meistens die leidende Form bevorzugt habe.«
»Bei der Sie anscheinend nicht allzuviel litten,« meint er trocken.
»Ach, ein Vergnügen ist auch das Unglücklichgeliebtwerden nicht,« antworte ich, »und vor allem ist es bedeutend schwerer, jemanden heraus als hinein zu verlieben.«
»Vielleicht weil man sich dieser Arbeit nicht mit der gleichen Hingabe unterzieht,« vermutet er, und ich kann ihm nicht ganz unrecht geben. »Es ist eine zu langweilige und trübselige Arbeit,« nicke ich. –
»Und zudem eine, die mir die moralischen Kräfte einer Frau bedeutend zu übersteigen scheint,« sagt Erich und beugt sich einen Augenblick nieder, um unter den Weidenzweigen durchzuschlüpfen, die fast bis ins Wasser hängen.
»Ach, man kann es schon, wenn man ernstlich will,« antworte ich zerstreut, denn es ist zu herrlich in der grüngoldnen Dämmerung, durch die wir fahren, als daß ich so recht zur Unterhaltung aufgelegt sein könnte.
»Ja,« entgegnet Erich, »man kann bekanntlich alles, was man ernstlich will, es fragt sich immer nur, ob man es ernstlich wollen kann. Und – ich muß gestehen – ich traue einer Frau jede Selbstlosigkeit und Opferfreudigkeit zu, nur die eine nicht, einen Anbeter wissentlich und willentlich zu ernüchtern. Es wäre fast übermenschlich.«
»Wenn er uns ganz gleichgültig ist,« werfe ich dazwischen; aber Erich antwortet: »Ein Mensch, der uns anbetet, ist uns nie ganz gleichgültig, und außerdem sind wir so eitel, daß uns sogar an der Schätzung der Menschen, an denen uns gar nichts liegt, noch viel gelegen ist. Ich weiß nicht, wer das einmal gesagt hat, aber es wird wohl eine Frau gewesen sein.«
Ich nicke. »Die Ebner-Eschenbach, und sie hatte recht. Aber unbesorgt, die Ernüchterung wird schon selbsttätig eintreten, denn die Eitelkeit der Männer ist so stark, daß ihre heißeste Liebe der Gleichgültigkeit gegenüber erlischt. Und wenn es schon schwer ist, den Haß oder die Liebe zu verkleiden, – die Gleichgültigkeit zu verbergen, ist uns einfach unmöglich.«
»Heil, heil!« ruft Erich vergnügt, »eine der schwierigsten Menschheitsfragen ist gelöst, und unglücklich liebende Männer laut Beschluß von heute aufgehoben. O du glückliche Welt, in der sich alles so spielend löst.«
Ich liege auf dem Rücken, die Hände unterm Kopf, und schaue in den Himmel und die ziehenden weißen Wolken hinein.
»Mir scheint alles so spielend leicht, wenn ich auf dem Wasser bin,« sage ich, »fast als ob dies Gleiten und Wiegen die Körper- und Seelenschwere zugleich aufgehoben hätte. Und dann all die Schönheit ringsum. Nein, es ist mir heute schlechterdings unmöglich, unglücklich liebende Männer tragisch zu nehmen.« – Erich lacht. »Wenn ich gewußt hätte, daß der Wassersport auch seelisch abhärtend wirkt, dann hätte ich Ihnen nicht so leidenschaftlich zur Anschaffung dieses Punts geraten.«
»Was verlieren Sie dabei?« frage ich und drehe den Kopf nach ihm hin, »Sie sind ja Gott sei Dank der einzige meiner Freunde, der nicht unglücklich liebt, und Sie glauben nicht, wie wohltuend das auf mich wirkt.«
»Und auf mich erst!« lacht er. »Übrigens verspreche ich Ihnen, falls mich das Malheur doch mal ereilen sollte, meinen Seelenschmerz männlich vor Ihnen zu verschließen. Denn erstens sind Sie mitleidslos –« – »Nur auf dem Wasser,« werfe ich dazwischen.
»Nun, Sie werden nicht leugnen, daß Sie auch auf dem festen Land die Leiden anderer, und wären es die schmerzlichsten, mit bedeutend mehr Fassung tragen als zum Beispiel –« – »Als zum Beispiel meine eigenen, und wären sie auch viel geringfügiger. Aber ich behaupte, damit keine unrühmliche Ausnahme zu machen, denn – wenn Sie mir ein unpoetisches Wort in dieser poetischen Umgebung gestatten wollen, – der eigne Rock ist uns allen immer noch bedeutend näher als andrer Leute Hemd. – Übrigens, lieber Erich, glauben Sie ja nicht, mir jemals Ihre Seelenstimmung oder Verstimmung verbergen zu können. Sie sind durchsichtig wie Glas –«
»Ich werde eine undurchdringliche Maske wählen,« verspricht er.
»Ungefähr so, wie einer meiner Bekannten, der immer wenn er Unannehmlichkeiten erlebt hat, fröhlich trällernd zu seiner Frau ins Zimmer kommt, um sie über seinen Seelenzustand zu täuschen. Sie erschrickt denn auch jedesmal zu Tod, wenn sie sein Trällern hört.«
»Wie schade,« sagt Erich, »auf diesen liebenswürdigen Trick werde ich also schon verzichten müssen. Und ich bin nun wirklich selbst neugierig, welche Maske ich mir vorbinden muß, um Sie zu täuschen. Was meinen Sie, wenn ich das Raffinement so weit triebe, mir die Durchsichtigkeit als Maske zu wählen?«
»Eine gewisse kühle Durchsichtigkeit, ja. Das wäre ein sehr feiner Zug, der besondere Schlauheit verrät. Sie müssen nämlich wissen, daß der wahre Psychologe den Menschen am besten an der Maske erkennt, die er sich wählt. Und man könnte daher den sehr veralteten Spruch mit Recht dahin umändern: ›Ich weiß, wer du scheinen willst und sage dir, wer du bist‹.«
»Und damit wäre die Maske wieder nur ein Teil von uns selbst, und es bedürfte einer zweiten und dritten, um die erste zu verbergen. Nein,« sagt Erich energisch, »da bin ich doch schon aus Klugheits- und Ventilationsgründen für offenes Visier.«
»Das nützt auch nichts,« entgegne ich bekümmert, »denn es gibt Menschenkenner, die so niederträchtig fein sind, daß sie uns selbst ohne Maske durchschauen.«
Erich lacht. »Sie rechnen sich dazu?«
»Ach nein,« sage ich, »ich weiß mich frei von der Schwäche psychologischer Neugier und danke Gott täglich, daß er den Menschen die Gabe verliehen hat, ihre wahren Gesichter zu verbergen. Denn Erich, wirklich, bei Licht besehen, es ist ein Pack.«
»Und nur wir beide nicht?« fragt er.
»Ach, wir beide auch,« antworte ich, »aber von den Anwesenden spricht man nicht gern, und deshalb sagt man auch immer, sie sind ausgeschlossen.«
Wir fahren eine Weile schweigend weiter, endlich sagt Erich, wie mir scheint, etwas verdrossen: »Eins begreife ich nicht und ärgere mich darüber, – nämlich, was Sie zu dem abfälligen Urteil über Ihre Mitmenschen berechtigt. Die Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben, sollten doch gerade danach angetan sein –«
»Lieber Freund,« unterbreche ich ihn, »was wissen Sie von meinen Erfahrungen, da Sie nur die Seite von mir und meinem Leben kennen, die Ihnen zugekehrt ist? – Aber selbst, wenn Sie recht hätten, wäre es doch nichts als Bestechlichkeit, wenn ich Welt und Menschen deshalb im rosigen Schein sehen wollte, weil mir's gut geht, und weil man mich nach mancherlei Richtung hin verwöhnt hat. Es wäre eine ziemlich oberflächliche Bestechlichkeit, deren ich mich nicht schuldig machen will; trotzdem ich mich ganz gewiß nicht für unbestechlich halte. – Ebensowenig wie irgendeinen Menschen auf der Welt.«
Erich schüttelt ungeduldig den Kopf: »Ich weiß, daß es Ihre Gewohnheit ist, große Worte gelassen auszusprechen, aber ich glaube, dies große Wort von der Bestechlichkeit aller Erdenkinder werden Sie doch nicht aufrechterhalten können. Sie werden trotz Ihrer pessimistischen Weltanschauung zugeben müssen, daß es Menschen unter uns gibt, die niemand bestechen kann.«
»Ja,« sage ich, »das gebe ich ohne weiteres zu. Niemand kann sie bestechen, weil niemand ihnen den Preis bieten kann, für den sie zu haben wären. Ich spreche natürlich nicht von Geld, denn es gibt ja Leute genug, die so viel Geld haben, daß sie damit nicht zu ködern sind. – Aber wir alle haben Wünsche, die so brennend und tief sind, daß wir für ihre Erfüllung unsere Ehre und unsere sogenannte Seligkeit über Bord würfen. – Da aber ein Mensch dem anderen niemals das geben oder auch nur versprechen kann, was dieses Opfer lohnt, so bleiben wir unbestochen bis an unser Lebensende, Gott sei's geklagt. –«
»Vielleicht Gott sei gelobt,« meint Erich altklug, »denn wir wissen es ja, daß erfüllte Wünsche meist eine grausame Strafe sind. – Und doch,« fährt er nachdenklich fort, »Sie haben recht. Trotzdem wir es wissen, wir gäben Ehre und Seligkeit und ein paar Jahre unseres Lebens für die Erfüllung.«
»Ja,« antworte ich zögernd, »Ehre und Seligkeit gewiß, – aber ein paar Jahre meines Lebens? – Oder,« füge ich plötzlich ganz erleichtert hinzu, »wenn es vielleicht ein paar aus meiner Vergangenheit sein dürften?«
Erich lacht herzlich. »So fassen Frauen das selbstverständlich immer auf, wenn sie für irgend etwas Jahre ihres Lebens zu opfern bereit sind. – Aber sind Sie wirklich so ängstlich besorgt um die zukünftigen?«
»Ach ja, Erich, denn es ist ohnehin immer schon später als wir glauben.«
Erich hat das Ruder eingezogen, und wir treiben jetzt in dem kleinen, fast ganz von Gärten eingeschlossenen See langsam im Kreise. Ich habe die Zigarette über Bord geworfen und die Hände um die Knie geschlungen.
»Wissen Sie, Erich,« seufze ich, »es ist sonderbar mit dem Altwerden, es ist das leichteste und das schwerste Ding zugleich.« Er nickt. – »Aber mir ist's doch immer so, als müßte es nicht sein, daß fast alle Menschen vom dreißigsten Jahr an geistig zu schrumpfen anfangen,« sagt er, »denn leider tun sie das.«
»Nun ja,« antworte ich, »man hält zu oft für Temperament oder Begabung, was nur Jugend ist und schnell verschwindet, sobald der Mann Amt und Brot, und die Frau einen Mann gefunden hat. Erst wenn ein Mensch darüber hinaus den Schwung seines Wesens bewahrt hat, kann man sagen, daß er echt gewesen ist. Wie ja auch die körperliche Anmut einer Frau erst dann mehr ist als etwas zufällig Angeflogenes, wenn sie die Jugend überdauert, weil sie sich immer wieder von innen heraus durch seelische Kräfte erneut.«
»Ja,« sagt Erich seufzend, »wenn es so eine Art seelische Kosmetik oder Massage gäbe –«
»Die gibt es sicher,« tröste ich ihn, »eine sehr gute Seelenmassage ist zum Beispiel schon die Liebe. Aber um Himmels willen keine glückliche, denn die bewirkt gerade das Gegenteil –, führt leicht zu Ehe, Schlafrock und Kinderkriegen, und unmerklich aber sicher ins Himmelreich der Philister. Aber so eine recht unglückliche Liebe, sehen Sie –«
Ich breche erschrocken ab, denn Erich lächelt gar zu wehmütig und schelmisch zugleich.
»Erich,« sage ich und starre ihn entsetzt an, »um Himmels willen, Sie auch?«
Er wendet mir langsam sein liebes und ehrliches Gesicht zu und nickt ...
»Wie habe ich meine Maske getragen?« fragt er leise.

Die Mittagstafel im Sanatorium für Nervöse und Überarbeitete geht ihrem Ende zu. Ja, der Doktor ist sogar schon aufgestanden, und während ein Teil der Gäste noch mit dem Pudding beschäftigt ist, steht er, die Hände auf die Lehne gestützt, hinter seinem Stuhl im Gespräch mit dem großen Dichter und der interessanten Frau, die ihm täglich gegenüber sitzen. Er spricht lebhaft und angeregt, bricht aber plötzlich mittendrin ab, überfliegt die Tafel mit einem zerstreuten Blick, der scheinbar nichts aufnimmt und zieht sich zurück, ohne sich von jemandem zu verabschieden. Gleich darauf erheben sich auch die Gäste, und während man sich dem Ausgang zudrängt, vermischen sich die zwei sonst streng geschiedenen Tische, der Tisch der Geistigen und der Tisch der Harmlosen, und das Stimmengeschwirr geht lauter hin und her.
»Hie weise Reden, hie Gelalle, – ich leg' mich in die Liegehalle,« sagt jemand neben mir, und da ich den Schüttelreimfimmel des sehr gesprächigen kleinen Assessors schon seit Wochen kenne, sage ich nur gewohnheitsmäßig: »Schauderhaft!« und füge gleich hinzu: »Ich komme aber mit hinauf, muß jetzt auch liegehallen.«
Bald darauf haben wir's uns mit Hilfe von Kissen und Decken in unseren Liegestühlen bequem gemacht, und Fritz Burmeister sagt: »Na, bei Ihnen da drüben am Tisch der Berufenen und Auserwählten ging's ja heute wieder mal verflucht kriegerisch zu. Mir dröhnen noch die Ohren. Um welche heiligsten Güter wogte denn der Kampf so geräuschvoll hin und her?«
»Sie hatten heute Dostojewsky vor,« berichte ich seufzend und streife die Asche von meiner Zigarette. »Die Brüder Karamasow waren dran, und sie stritten darüber, ob das Buch mehr typisch russisch oder mehr typisch menschlich sei. Und dabei kamen sie auf das typisch Menschliche im allgemeinen zu sprechen, und der große und der kleine Dichter gerieten einander in die Haare, und da ich gerade zwischen den beiden sitze, geriet ich in die Gefahr, im Interesse der typischen Menschlichkeit zerquetscht oder erschlagen zu werden.«
»Traurig, traurig,« sagt der kleine Assessor, »aber warum krakehlen Sie nicht mit? Das ist gewöhnlich die einzige Rettung. Ich könnte es ja natürlich nicht, denn ich lese keine russischen Romane. Nicht etwa aus irgendeinem patriotischen oder moralischen Prinzip heraus, nein einfach nur, weil ich die Namen darin nicht behalten kann. Wenn nämlich der eine Fedor Alexandrowitsch heißt und ein anständiger Mann ist, dann heißt der andere unfehlbar Alexander Fedorowitsch und ist ein Schurke, und ich bin mir am Schluß des Buches immer noch unklar darüber, wer der eine und wer der andere war. Aber Sie mit Ihrem glänzenden Namengedächtnis –«
»Ach, darauf kommt es nicht an,« sage ich, »und Sie hätten ruhig mitreden können. Man kann nämlich das Blödsinnigste sagen, ohne daß einer es merkt. Heute tat ich nur deshalb nicht mit, weil ich essen wollte.«
»Was sicher das typisch Menschlichste an der Sache war,« entscheidet er und fährt fort: »Ich begreife überhaupt nicht, wie man die Geschmacklosigkeit haben kann, bei Tisch Welträtsel zu lösen!«
»Ach, wenn die Beefsteaks so hart sind wie gestern abend, dann löse ich gern mit,« erkläre ich ihm. »Es war einfach unerhört, die reinen Schuhsohlen! Der große Dichter war auch empört und mußte kohlensaures Natron hinterher nehmen.«
Burmeister schweigt einen Augenblick, und ich sehe ihn erstaunt ob der ungewohnten Pause an. Da hebt er aber auch schon den Zeigefinger und deklamiert pathetisch:
»Er sprach, ich bin kein Sohlenkauer, drauf nahm er Natron kohlensauer.« – »Schauderhaft,« sage ich, und er antwortet mit dem treuherzigen Sanatoriumspruch, der hier all unsere Sünden decken muß:
»Das ist nun mal mein Fimmel, deshalb bin ich hier! –
Übrigens,« fährt er fort, »zeigt es sich nach Ihrer Aussage wieder einmal deutlich, daß die Lösung des Welträtsels nur eine Magenfrage ist, und wer weiß, wie nahe wir morgen mit Hilfe des Beefsteaks der endgültigen Entscheidung kommen. – Wie verhält sich aber Ihre Tischgesellschaft zu dem schwierigen Problem der gleichzeitigen geistigen und leiblichen Ernährung?«
»Sie löst es spielend,« antworte ich. »Der große Dichter spricht immer kauend, wodurch der Sinn seiner Reden nicht klarer wird, der kleine ist für sehr reichliche Nahrungsaufnahme, aber er beeilt sich kolossal, schiebt mir oder seiner Nachbarin zur Linken schnell seine abgegessenen Teller hin und stürzt sich kopfüber ins Gespräch. Der Doktor ißt ja überhaupt fast nichts aus lauter Zerstreutheit und ist zufrieden und glücklich, wenn er, wie jener sagenhafte Heinrich, jeden Mittag wenigstens einen Dichter im Topf hat.«
»Erlauben Sie,« wendet Burmeister höflich ein, »es war ein Huhn, das jener sagenhafte und ziemlich weltfremde Heinrich jeden Sonntag im Topf seiner Untertanen zu sehen wünschte; und ich hege einen zu großen Respekt vor allem, was sich dichtend betätigt, um diese Verwechslung gutheißen zu können. – Ich als simpler Bürger –«
»Ich bitte Sie, ein preußischer Regierungsassessor,« erinnere ich ihn, aber er wehrt nervös ab: »Ach bitte, bitte! Ich bin, wie Sie wissen, ohne jeden Standeshochmut. Und überhaupt, preußischer Assessor, das höre ich gern! Welche gräßlichen Vorstellungen knüpfen sich an dieses Wort! Ein unsympathischer und streberhafter Geselle ohne Gemüt und Idealismus, so leben wir in jedem deutschen Roman, so laufen wir durch jedes deutsche Drama.
Immer müssen wir die undankbaren Episodenrollen spielen, sind sozusagen die Schlagschatten, durch die die Lichtgestalt des Helden um so leuchtender erscheint. Und ich weiß nicht einmal, warum die Volksseele auf diese frevelhafte Weise vergiftet wird. – Wir sind eben die Stiefkinder der Literatur,« setzt er in so tragischem Ton hinzu, daß ich gerührt werde und ihm verspreche, demnächst ein Drama zu schreiben, das eine Ehrenrettung sämtlicher Assessoren der Welt mit besonderer Berücksichtigung Preußens werden solle.
»Ich danke Ihnen,« antwortet er und verbeugt sich, soweit der Liegestuhl es zuläßt. »Es wird eine befreiende Tat sein. – Apropos befreiende Tat,« fährt er lebhaft fort, »hat sich denn immer noch niemand im Sanatorium dazu bereit finden können, die interessante Frau, die an Ihrer Tischecke da oben sitzt und in eminenter Geistigkeit macht, geräuschlos aus der Welt zu schaffen?«
»Ach nein,« antworte ich, »Sie vergessen, daß wir leider alle noch nicht in dem vorgeschrittenen Stadium sind, in dem der Staatsanwalt und die Geschworenen auf Freisprechung erkennen müssen.«
»Traurig, traurig!« sagt er und überlegt. »Was ist denn alles hier an schönen Sachen? Vollkommene Geistesgestörtheit? Nein. Totaler Stumpfsinn? Schon eher, aber das gibt höchstens lumpige mildernde Umstände. Vielleicht ginge es mit sinnlosen Wutanfällen. Und ich bin sicher, vor jedem Gerichtshof der Welt Verständnis zu finden, wenn ich behaupte, daß diese Trägerin eminenter Geistigkeit und noch eminenterer Dummheit mich täglich in sinnlose Wut versetzt, wenn sie ihre unkontrollierbaren indischen und chinesischen Weisen in den Himmel hebt und mit verächtlich herabgezogenen Mundwinkeln von dem langweiligen Moralphilister Kant, dem verwirrten Schwätzer Nietzsche und dem salbadernden Geheimrat Goethe spricht. Kein Gerichtshof der Welt –«
»Tun Sie's trotzdem nicht,« unterbreche ich ihn. »Ihr Klaps ist leider noch nicht vorgeschritten genug, um vor den Sachverständigen zu bestehen. Und schließlich, was tut sie Schlimmes? Wenn sie nicht gerade ihre Verachtung für alles Europäische kundgibt, oder mit dem kleinen Dichter über Fragen des Unterbewußtseins diskutiert, ist sie harmlos. Sie spielt die Kosmopolitin, seitdem sie mit ihrem Mann ein paar Wochen in China war oder in Australien, was ja schließlich dasselbe ist. –«
»Erlauben Sie mal!« fährt er entsetzt in seinem Stuhl hoch. »Ich meine ja nur, was den Effekt betrifft,« beruhige ich ihn. – »Und das Unterbewußte, das ist nun einmal des kleinen Dichters Steckenpferd.«
»Ich weiß,« sagt Burmeister bekümmert, »Ihr Tischgenosse Janssen hat mir erzählt, daß er ihn schon zweimal mit der Frage nach seinem unterbewußten Empfinden in die tödlichste Verlegenheit versetzt hat. Janssen fand das gemein und anstößig, noch dazu in Gegenwart von Damen und nennt den kleinen Dichter seitdem nur noch ›Mayer mit dem Unterbewußten‹.«
Hier muß ich so laut herauslachen, daß eine der Hausdamen den Kopf zur Tür hereinsteckt und daran erinnert, daß Ruhezeit ist, und daß man uns im ganzen Haus hören könne.
»Das spricht für die Harmlosigkeit unserer Unterhaltung,« versichert Burmeister treuherzig, schiebt aber mit Rücksicht auf das ganze Haus unsere Stühle so dicht wie möglich zusammen und fragt mich im Flüsterton, ob ich Janssens Auffassung nicht sehr berechtigt fände.
»Mir scheint,« sage ich, »der Gute sucht sich an der ganzen Literatur dafür zu rächen, daß die Worte ›Meine Ruh' ist hin, mein Herz ist schwer‹ nicht in der Jungfrau von Orleans vorkommen, wie er neulich behauptet und beinahe beschworen hat.«
»Sie könnten auch ganz gut da vorkommen,« verteidigt der Assessor seinen Freund. »Und überhaupt, Schiller oder Goethe, so feine Nuancen braucht man wirklich nicht zu kennen. Mich quält aber schon seit Wochen eine andere Frage und zwar, welchen Befähigungsnachweis Janssen erbracht hat, um an Ihrem Tisch aufgenommen zu werden.«
»Es war wohl hohe Protektion dabei im Spiel, wie bei mir auch,« antworte ich. »Der Doktor glaubte, mir damit gutzutun, und dabei blicke ich doch immer voll Sehnsucht zu Ihnen hinüber –«
Burmeister verneigt sich. »Ich meine natürlich zu Ihrem Tisch, dem Tisch der Harmlosen, dem Tisch der holden Gewöhnlichkeit, wie Thomas Mann alias Tonio Kröger sagen würde. Es ist oft so abspannend bei uns.«
»Ach, glauben Sie ja nicht, daß es bei uns leichter ist,« warnt er eifrig. »Es ist ein aufreibendes Stück Arbeit, bis zum Beispiel jeder Kurgast jeden Kurgast davon überzeugt hat, was für eine vornehme Persönlichkeit er in Berlin oder Stettin oder Frankfurt ist, und ich weiß nicht, ob die Sache dadurch einfacher oder komplizierter wird, daß jeder nur zuhört, solange er selber redet und voll Sehnsucht diesem Moment entgegenlebt, solange ein anderer das Wort hat.«
»Ich finde, Sie sind ein bißchen überheblich, Burmeister,« sage ich. »Sie müssen doch immer bedenken, daß wir uns in einem Sanatorium für Nervöse und Überarbeitete aufhalten.«
»Ja richtig,« antwortet er, »und dabei fällt mir ein, daß ich Sie schon lange etwas fragen wollte, und zwar etwas sehr Plumpes und Taktloses, wie ich vorausschicken muß. Ich fühle mich dabei lebhaft in die Zeit meiner ersten Kinderkostümfeste versetzt, bei denen ich es, trotz mütterlicher Ermahnungen, nie unterlassen konnte, an alle mich umgebenden Masken mit der taktlosen Frage heranzutreten: ›Als was bist du eigentlich hier?‹ Was die verschiedenen Spanier, Rotkäppchen und Schornsteinfeger jedesmal in peinliche Verwirrung versetzte. Also, gnädige Frau, nehmen Sie's nicht übel, Sie sind so staunenswert unnervös, eine Wortbildung, die es eigentlich nicht gibt, und für die demnach kein starkes Bedürfnis vorzuliegen scheint, und vor dem Gedanken, daß Sie sich jemals im Leben überarbeitet haben, schreckt die kühnste Phantasie zurück. Also, ich kann nicht anders: Als was sind Sie eigentlich hier?«
»Lieber Herr Burmeister,« sage ich, »ich wußte natürlich, daß diese Frage kommen würde, und habe mir während Ihrer schönen Einleitung überlegt, ob ich sie beantworten darf. Es ist nämlich ein Geheimnis dabei im Spiel.«
»Oh, ein Geheimnis?« fragt er eifrig. »Rätsel zu lösen, war von jeher meine Spezialität. Hat man etwa die Absicht, Sie langsam durch kohlensaure Bäder, Hypnose und schwedische Heilgymnastik aus der Welt zu schaffen, um einer ungeheuren Erbschaft oder gemeingefährlicher Dokumente willen? Oder sind Sie vielleicht als Polizeispitzel tätig und beauftragt, einer Eheirrung aus allerhöchsten Kreisen auf die Spur zu kommen? Oder in diplomatischer Mission, um etwas über die Stärke unserer Militärmacht oder über den Stand unserer auswärtigen Beziehungen auszukundschaften? Oder hat man –«
»Um Gottes willen Schluß!« rufe ich, »ich hänge den Hörer an. Und ich will's Ihnen lieber anvertrauen, ehe Sie sich ganz und gar ins Reich der unbegrenzten Möglichkeiten verlieren: Ich bin wirklich partiell gesund, ich bin nur hier, um Studien zu machen –«
»Ah,« macht er verständnisvoll, »für das Drama, das eine Ehrenrettung der preußischen Justizbeamten werden soll. Ich muß gestehen, Sie hätten sich für Ihre Studien keinen besseren Platz wählen können. Und jetzt begreife ich auch, warum Ihr alter Freund, der Doktor, Sie mitten zwischen die Dichter und Denker gesetzt hat. Er nimmt an, daß die Dichtkunst eine Art ansteckender Krankheit sei, vielmehr ein Bazillus, der bei häufiger Berührung der Ellenbogen, oder so, von einem zum anderen überspringt und eine verheerende Wirkung ausübt. Traurig, traurig! Mich tröstet nur die Gewißheit, daß es Menschen gibt, die gegen die entsetzlichsten Krankheiten immun sind, und – ohne Ihnen schmeicheln zu wollen – ich halte Sie für immun gegen alles, was mit Dichtkunst zusammenhängt.«
»Traurig, traurig!« sage ich. »So könnte ich also mit Domingo aus dem Don Carlos, oder wenn Sie lieber wollen aus der Iphigenie sprechen: ›Wir sind vergebens hier gewesen‹.«
Burmeister nickt: »Vergebens vielleicht, – umsonst sicherlich nicht.«
Und ich kann nicht umhin, diesen mehr humor- als trostvollen Ausspruch seufzend zu bestätigen. –
Aber dann deute ich nach den Bergen drüben und dem sonntagstillen Tal unten und sage: »Doch nicht vergebens, und wenn es nichts weiter war als das.«
»Das ist so weit,« murrt Burmeister, »und dann immer nur ansehen!« – »Ja,« gebe ich zu, »man fühlt sich übergroßer Schönheit gegenüber immer so hilflos und hat das Gefühl, daß es nur zwei Arten von Erlösung gibt: man müßte sich in das Schöne hineinstürzen oder es auffressen können.«
Burmeister hat den Arm auf die Lehne meines Sessels gestützt und blickt mir von unten her ernsthaft in die Augen.
»Sie haben recht,« antwortet er, »und ich empfinde es mit aller Entschiedenheit, deren ich fähig bin: Der Kuß wäre augenblicklich die einzige Lösung.«
Ich muß lachen: »Ich glaube, in der Juristensprache nennt man so etwas eine Unterschiebung; aber ich zweifle nicht daran, daß Sie hier im Sanatorium allerlei Verständnis für Ihre Auffassung finden.«
»Die Sie nicht teilen?«
»Die ich teile, – unter Vorbehalt natürlich.«
»Nun, erstens natürlich unter dem Vorbehalt der Legitimität.«
»Legitime Küsse!« Er schüttelt sich. »Aber zweitens?« drängt er. »Auf erstens muß doch immer ein zweites folgen.«
»Zweitens,« antworte ich und lehne mich soweit in meinem Liegestuhl zurück wie es irgend möglich ist, »zweitens will ich Ihnen mal was sagen, Burmeister: Sie sind neugierig. Ich habe Ihnen heute schon ein Geheimnis anvertraut und diese Erinnerung macht Sie kühn, um wieder mal aus dem Don Carlos zu zitieren.«
»Du lieber Gott, kühn!« seufzt Burmeister. »Wenn Sie wüßten, wie wenig kühn ich in diesem Augenblick bin!«
»Na also, dann ist's ja gut,« sage ich, »dann setzen Sie sich wieder bequem zurück, wie sich's gehört und bedenken Sie, daß nach Tisch von Gottes und Doktors wegen Ruhezeit ist. Und dann will ich Ihnen das zweite Geheimnis anvertrauen.«
»Das Geheimnis Ihrer Unnahbarkeit?« fragt er.
»Ja,« antworte ich, »und nun hören Sie gut zu: Die Unnahbarkeit ist nämlich mein Fimmel –«
»Und deshalb sind Sie hier!« stößt er mit einem so herzlichen und lauten Jubelton heraus, daß ich ihm unbedingt den Mund zuhalten muß.

»Herein,« sage ich ein wenig erstaunt und sehe nicht gerade angenehm überrascht vom Buch auf, denn meine Kaffee- und Besuchsstunde ist längst vorbei, und in diesem, vielleicht einzigen Punkt bin ich ein bißchen Pedant.
Und es schießt mir durch den Kopf, ob Karl Gerhard wirklich nur darum so unsicher und zerknirscht aussieht, wie er da in der Türe steht, oder ob noch etwas anderes –? Ich habe allerlei Fatales gehört in letzter Zeit – –
»Kommen Sie nur näher, wenn Sie schon mal da sind,« sage ich, »und drehen Sie das Licht an, zum Lesen ist's schon ein bissel dunkel geworden.«
»Das finde ich nicht,« antwortet er, an der Tür stehenbleibend, »ich lese sogar schon von hier aus in Ihrem Gesicht mit den hochgezogenen Augenbrauen mein – nun, sagen wir wenigstens – mein gesellschaftliches Todesurteil.«
Ich schüttle den Kopf. »Ich habe keinerlei Urteile, am wenigsten Todesurteile auszusprechen.«
Er kommt langsam näher, bleibt aber beim Flügel stehen und sagt, die Arme auf das Instrument gestützt:
»Es sind nicht nur die ausgesprochenen Todesurteile, die töten. Und ich habe in den letzten Tagen manchmal denken müssen, daß die Menschen auch nicht immer an ihren eigenen Gebrechen sterben. Es ist schon mancher an der Herzensträgheit eines anderen zugrunde gegangen.«
»Gerhard!« sage ich.
»Es ist nur eine theoretische Abhandlung, gnädige Frau,« antwortet er, »und ich will Sie nicht mit Details quälen. – Darf ich ein paar Minuten bleiben?«
Ich nicke. »Aber setzen Sie sich und nehmen Sie sich etwas zu tun, denn ich möchte dies Kapitel gern noch zu Ende lesen.«
»Darf ich mich so lange am Klavier nützlich machen, bis Sie erfahren haben, ob der Graf sein schändliches Ziel erreichen und die Unschuld zu Fall bringen wird?« Und er sitzt schon am Flügel und spielt aus Mahlers Achter »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis«.
Ich klappe seufzend das Buch zu.
»Ich weiß zwar noch nicht, ob der Graf sein schändliches Ziel erreichen wird,« sage ich, »aber daß Sie's erreicht haben, ist sicher. Also lassen Sie Mahler und das Vergängliche und erzählen Sie mir, was Sie heut so spät noch hertreibt.«
»Ich hoffe, Sie haben ein Zeichen ins Buch gelegt oder sich wenigstens die Seitenzahl gemerkt,« sagt er bedächtig. »Oder vielmehr, ich hoffe es nicht, denn es stände im Widerspruch mit meiner Anschauung von der weiblichen Psyche. Ehe eine Frau nämlich ein Zeichen ins Buch legt oder im Register nachsucht, blättert sie lieber eine halbe Stunde lang seufzend hin und her.«
»Es wird auch Frauen geben, die es anders machen,« antworte ich, »wenn ich auch leider von mir zugeben muß –«
»Sehen Sie,« triumphiert er mit aufgehobenem Zeigefinger, »das Zeichen ins Buch legen ist eben ein männlicher Zug, und wenn es Frauen gibt, die es dennoch tun, so beweist das nur, daß sie männliche Züge aufweisen und sich vom Zwang des Geschlechts befreit haben.«
»O Gott,« stöhne ich, »lassen Sie Weininger ruhen, wenn Sie auf meine Freundschaft auch nur den geringsten Wert legen.«
»Gut,« lacht Karl Gerhard, »legen wir also Weininger zu Mahler, da es Ihnen heute so beliebt, und da die Wahl zwischen einem toten Philosophen und einer lebendigen Freundin keine nennenswerten Kämpfe in mir weckt. – Was haben Sie aber ernstlich gegen den guten Weininger einzuwenden? Der Umstand, daß man ihm mit der Bezeichnung eines modernen Frauenlob bitter unrecht täte, dürfte doch bei Ihnen nicht schwer wiegen, da Sie eingestandenermaßen Ihr eigenes Geschlecht nur bis zum Backfischalter erträglich finden?«
»Vielleicht ist der weibliche Korpsgeist doch stärker in mir als man denken sollte,« antworte ich, »vielleicht ist's aber auch nur die Weiningersche Beweisführung, die Sie soeben auch anwandten; die erscheint mir oft so billig, daß sie eines klugen Mannes, also auch Ihrer, nicht würdig ist.«
Er verbeugt sich: »Dank für die gute Meinung. – Ich tue leider in letzter Zeit so vielerlei, was eines klugen Mannes nicht würdig ist, daß der harmlose Weiningersche Trick mit unterlaufen mag.«
»Ja, ich habe so etwas gehört,« sage ich und schiebe ihm die Zigaretten hin, da die Zöpfchen, die er aus den Fransen meiner Tischdecke flicht, schon anfangen mich zu irritieren. Und nach einer kurzen Pause setze ich langsam hinzu: »Gerhard, warum machen Sie auch so dumme Geschichten?«
Er bläst ein paar Ringe in die Luft, blickt ihnen nach und fragt:
»Sie wissen es nicht, gnädige Frau?«
Und dann plötzlich den Kopf zu mir wendend: »Sie haben keine Ahnung, warum ich neulich abend von Wartenbergs fortlief wie – na, sagen wir wie ein wildgewordener Esel, wenn es so was gibt, – und geradeswegs in die Bar, wo ich mit einem anderen Esel in einen etwas deutlichen Wortwechsel geriet.«
»Sie sollen ihn so verprügelt haben, daß der Wirt Sie hinauswerfen ließ.« – »O nein,« widerspricht Gerhard und drückt bedächtig seine Zigarette aus, »ich ging ganz von selbst, nachdem ich mir ein bißchen Luft gemacht hatte. Und ich ging stolz.« – »Gestützt auf Emmi,« unterbreche ich ihn.
»Hieß sie Emmi?« fragt er, »ja richtig, gestützt auf Emmi, denn ein Stuhlbein hatte ich doch bei der Diskussion abgekriegt. Sie sind gut unterrichtet, gnädige Frau.« – »Nicht besser als alle Welt,« versichere ich ihn.
»Und Sie wissen auch nicht besser als alle Welt, was die Veranlassung zu all meinen Dummheiten ist?« fragt er vorgebeugt und nach seiner Gewohnheit die Hände ums Knie geschlungen.
»Vielleicht doch,« antworte ich, »soweit Sinnlosigkeit eine Veranlassung haben kann. – Aber ich habe schon zu viele Kinder gesehen, die wild um sich schlugen und sich selbst Beulen in den Kopf rannten, weil man ihnen einen Wunsch versagen mußte oder ihnen ein gefährliches Spielzeug aus der Hand nahm, als daß mich Ihre Erlebnisse in der Bar und anderswo gewundert hätten. Ich ahnte fast so etwas, als Sie so plötzlich bei Wartenbergs verschwanden.«
»Sie sind ja auch so klug,« lächelt er mit ironisch verzogenen Mundwinkeln. »Aber ob es so klug war, mir mein Spielzeug aus der Hand zu nehmen, – ich weiß doch nicht. Denn darin haben Sie recht, wir sind alle nur einfältige Kinder, die immer etwas zum Spielen haben müssen, damit wir nicht schreien. Fällt uns ein Spielzeug aus der Hand, schnell ein neues hineingesteckt, damit wir nicht schreien. Niemand von uns kann ohne ein Spielzeug leben.«
»Und da ging Karl Gerhard zur Bar und kaufte sich ein neues.«
»Mein Gott,« antwortet er, »man nimmt, was man gerade findet. Wählerisch ist man in solchen Momenten nicht.«
»Nun, Gott sei Dank,« sage ich, »ich sehe, daß es Äquivalente für alles gibt.« – »Es gibt keine Äquivalente auf der Welt,« bemerkt Gerhard, »es gibt höchstens Surrogate.«
»Mag sein,« gebe ich zu, »aber Surrogate tun ja auch ihre Schuldigkeit.« – »Nein,« ruft er plötzlich heftig, steht auf und läuft quer durchs Zimmer.
»Nein?« frage ich ganz naiv erstaunt und sehe ihm nach.
»Nein,« wiederholt er, »und ich will nicht, daß wir uns in diese Bitterkeit hineinreden, aus der wir nachher nicht wieder herauskönnen. Sie wissen so gut wie ich, daß ich kein Äquivalent und kein Surrogat gesucht habe, daß ich einfach –« – »Ja, ich weiß,« sage ich und wundere mich, wie weich meine Stimme klingt.
Er bleibt plötzlich stehen, kommt dann näher an den Tisch und fragt:
»Darf ich noch einen Augenblick bleiben?« – »Ja,« sage ich, und er setzt sich und starrt vor sich hin.
»Und ich hatte mir geschworen, nie mehr hierherzukommen!«
»Du lieber Himmel!« sage ich, »wenn es einen Gerichtshof für all die Meineide gäbe, die wir uns selber schwören! – Aber vielleicht wäre es doch besser gewesen, Sie hätten diesmal Ihren Schwur gehalten, wenigstens ein paar Wochen lang –«
Er sieht mich an und schüttelt langsam den Kopf.
»Denn sehen Sie,« fahre ich fort, »es gibt außer diesem Zimmer noch so viel Schönes auf der Welt, das zu sehen und zu genießen lohnt.«
»Ach, ich verstehe,« sagt er, »eine kleine Reise oder so etwas, was bessere Leute in meinem Fall immer zu unternehmen pflegen. Wenigstens steht es so in allen schlechten Romanen der Weltliteratur, daß der unglückliche Held eine Reise um die Welt unternimmt und gereinigt und herrlicher denn je an die Stätte seiner früheren Leiden zurückkehrt. Manchmal bringt er sich ein Mädchen von den Fidschiinseln mit, das an Holdheit alles Lebende überstrahlt und die schnöde, heimische Kokette bis auf die Knochen blamiert. – Es kann auch eine Geisha sein, aber das ist veraltet und sentimental, und die Fidschiinseln und Neuseeland sind sozusagen noch unberührter Boden. Vielleicht gestatten Sie, daß ich Ihnen von da aus eine Ansichtskarte –«
»Gerhard,« sage ich, »wer bringt jetzt den bitteren Ton hinein?« Und nach einer kleinen Pause: »Ich finde übrigens auch, daß eine Reise als seelisches Heilmittel veraltet und literarisch ist. Man denkt an Goethe und Italien, und die ganze Literaturstunde steht vor einem auf. Und ich glaube auch, es ist gleichgültig, ob man da oder dort ist, solange man sich selber überall mit hinschleppt.« – »Jawohl,« sagt Gerhard, »einmal aus der Haut fahren, das wäre noch das einzige.«
»Nein, über sich selbst hinauswachsen, oder vielmehr bis zu sich selbst hinwachsen, – denn Sie wissen es ja, unser wahres Selbst liegt nicht tief verborgen in uns, sondern hoch über uns –«
Gerhard nickt langsam: »Nietzsche, und ein großes Wort. – Aber, Gott sei's geklagt, sie helfen uns nicht, die großen Worte.«
»Nun, dann ein kleines, wenn Sie die großen nicht lieben. Wir müssen versuchen, das In-uns zu ändern, wenn wir das Außer-uns nicht ändern können. Wir müssen versuchen, uns anders einzustellen und an den kleinen Dingen des Lebens Freude zu gewinnen. Glauben Sie mir, wir leben alle von der Hand in den Mund und müssen uns aus lauter kleinen Stücken und Stückchen etwas zurechtschneidern, was vor der schlimmsten Kälte schützt.«
Karl Gerhard lehnt sich im Sessel zurück, stützt die Fingerspitzen gegeneinander und sagt bedächtig: »Gestatten Sie mir, zu bemerken, was schon der alte Fritz Reuter richtig herausgefunden hat, daß nämlich die Armut allemal von der Pauvreté herrührt. Wenn ich die kleinen Freuden des Lebens genießen könnte, dann wäre ich gesund und brauchte Ihnen nicht mit Jammertönen lästig zu fallen. – Aber das ist's ja,« fährt er heftig fort, »von jeher haben die satten Leute den armen hungrigen Teufeln gesagt: ›Was klagt ihr über Hunger! Seht doch um euch und genießt die herrliche Natur und die Schönheiten des Lebens und der Kunst!‹ – Und von jeher haben die armen Teufel dagegen geschrien: ›Macht uns erst satt!‹ – Denn wer kann Michelangelo genießen und Schuberts Unvollendete und den Lago Maggiore, solange ihm der Hunger die Eingeweide zerreibt!«
Und er legt den Kopf im Sessel hintenüber und schließt die Augen.
Ich sehe ihn eine Weile schweigend an und sage dann: »Immer muß ich doch denken, wieviel Glückliche man machen könnte mit dem Glück, das in der Welt ungenutzt verlorengeht. Da sitzen Sie nun, jung und gesund und unabhängig und begabt wie wenige –«
»Wie hübsch,« unterbricht mich Gerhard lächelnd, »daß sich auch bei Ihnen einmal weiblich ökonomische Instinkte melden! Nichts umkommen lassen, ist ja die erste Hausfrauenregel, mögen es nun Brotkrumen sein oder Glücksmöglichkeiten, die unter den Tisch gefallen sind.« – »Sie sollen nicht unter den Tisch fallen,« sage ich heftig. »Wo ist Ihr Ehrgeiz und Ihr Glaube an sich selbst, der Glaube, von dem Sie einmal sagten, daß es der einzige sei, der Berge versetzen könne.«
»Ich will keine Berge mehr versetzen,« sagt Gerhard müde und steht auf. »Ich will jetzt nur noch eins: irgendwo hingehen, wo es warm ist. Mir ist in diesem Augenblick so erbärmlich kalt zumut. Und darin haben Sie recht, wir müssen uns aus den Fetzen des Lebens etwas zurechtschneidern, was vor der bittersten Kälte schützt.«
»Ja,« antworte ich, »wir alle. Aber die Fetzen, die wir zu dem schützenden Mantel verwenden, die zeigen, wer wir in Wahrheit sind. Der eine geht zur Bar, um sich zu erwärmen, der andere schafft ein unsterbliches Werk. Denn was sind alle großen Werke anderes als ein Mantel, den ein armer frierender Mensch um seine zitternde Blöße gedeckt hat und um seine Wunden und Male? Und was ist alle Tollheit und aller Rausch und alle Niedrigkeit anderes, und was alles Insichversinken und Träumen anderes als ein Schutz gegen die Kälte da draußen? Aber das Material, das wir zu dem Mantel wählen, Gerhard, das ist's, das über uns entscheidet.«
Gerhard kommt plötzlich einen Schritt näher und streckt mir die Hand hin. »Ich will wieder arbeiten,« sagt er mit so eindringlicher Plötzlichkeit, daß ich wider Willen lächeln muß.
»Fein,« sage ich und reiche ihm die Hand. »Ehrenwort?«
Er zuckt die Achseln. »Für einen anständigen Menschen ist jedes gegebene Wort ein Ehrenwort.«
»Hören Sie, Gerhard, mit dieser Sentenz auf den Lippen müßten Sie gehen, es wäre ein vorzüglicher Abgang.«
Er lächelt. »Ich bin zwar nicht so effektsüchtig wie Sie glauben, aber trotzdem, wenn es denn sein muß, – leben Sie wohl!«

Man hat mir so lange vorgeredet, ich müsse mich malen lassen, bis ich selber von ungeduldigem Verlangen nach meinem Bildnis erfaßt wurde und die Sache mit Karl Gerhard besprach. Von dem naheliegenden Gedanken, daß er der Maler des Bildes werden solle, haben wir schnell abgesehen, denn unsere Freundschaft ist uns zu heilig, um sie leichtsinnigerweise einer so harten Probe auszusetzen.
Er hat mir aber einen jungen Künstler aus seinem Bekanntenkreis empfohlen, der sich schon mit viel Glück im Porträtieren versucht habe, ganz modern und ein Werdender sei. Von jeher waren mir die Werdenden interessanter als die Gewordenen, und als mir Gerhard noch erzählte, daß Artur Vollmer es besonders gut verstehe, die Seele seines Modells zu versinnbildlichen, da war mein Entschluß gefaßt.
Wie wird er meine Seele malen? Diese Frage hat mich tagelang aufs angenehmste beschäftigt.
Auch jetzt, während ich zur Besprechung in Artur Vollmers Atelier bin, verläßt sie mich nicht, sie hat aber inzwischen etwas leicht Beängstigendes angenommen.
Wir haben ein paar nebensächliche Fragen bereits erledigt, er hat mir eine Zigarette gereicht, und ich habe versucht, mit ihm zu plaudern, da ich mir einrede, daß er bei dieser Gelegenheit meine Seele kennenlernen will. Vorerst scheint es ihm noch nicht sehr darum zu tun zu sein, denn er hat bis jetzt jedes meiner Worte nur mit einem leisen Lächeln quittiert, das genau die Mitte zwischen Höflichkeit und Unverschämtheit innehält. Ich ziehe es daher vor, schweigend die Bilder zu betrachten, die bunt und wirr an den Wänden hängen, und mein Blick bleibt an einem kauernden, etwas unproportionierten Mädchen haften, das so angestrengt bemüht ist, sich ein Strumpfband ums Bein zu binden, daß ihm die Haare wild übers Gesicht hängen.
Und ich kann die Frage nicht unterdrücken, warum dieses junge Mädchen sich so leidenschaftlich um sein Strumpfband bemüht, da es doch weder Strümpfe noch sonst etwas an Kleidung Erinnerndes auf dem Leibe hat.
»Es ist eine Studie,« beantwortet Vollmer meine unkünstlerische Frage, und ich bin zufrieden.
»Dies Ding ist übrigens eines der ersten, die ich gemacht habe,« spricht er zu meinem Erstaunen weiter, sich mit einem schwermütigen Lächeln zu mir wendend. »Es stammt noch aus der Zeit, als ich ein junger Springinsfeld war und mir wer weiß was vom Leben versprach.«
Er spricht langsam und in einem sehr weichen Dialekt eigner Erfindung und erzählt nun, einmal in Gang gekommen, ausführlich von den Enttäuschungen des Künstlerlebens, den Intrigen der stümpernden Kollegen, der Parteilichkeit der Ausstellungsdirektoren und der Verlogenheit der Kunsthändler. – Ich höre schweigend zu, und während sein sanft sonores Organ mich weich umspült, gerate ich langsam in jenen fast hypnotischen Zustand, der mich jedesmal überkommt, wenn die Maniküre die Fingerspitzen meiner einen Hand sanft streichelt, während die der anderen im lauwarmen Seifenwasser ruhen.
»Ja,« schließt er jetzt sein Gespräch, »wenn man nicht als Künstler geboren wäre! Lieber hätte man in seiner Jugend Holzhacken lernen sollen, es wäre damit besser für das Alter gesorgt.«
Ich schüttle den hypnotischen Bann so gut es geht von mir und sage, noch ein wenig benommen: »Es ist gewiß sehr traurig, daß so viele Menschen die erste Hälfte ihres Lebens dazu benutzen, die zweite unglücklich zu machen.«
Vielleicht, daß dieser sonst gute Ausspruch nicht hierhin paßt, vielleicht auch, daß Vollmer die Abstecher ins Allgemeine nicht liebt, jedenfalls geht er mit einem leisen, etwas unbehaglichen Räuspern darüber hinweg, und ich setze schnell hinzu:
»Aber die Kämpfe, die Sie mir geschildert haben, sind ja kein Unglück zu nennen und sie bleiben wohl keinem erspart, der seine Persönlichkeit durchsetzen will.« – »Gewiß,« bestätigt Vollmer, »und je neuartiger und origineller die Persönlichkeit sich äußert, um so härter sind heutzutage die Kämpfe mit der Lauheit und der Bequemlichkeit des Publikums.«
»Man sagt das allgemein,« antworte ich und sehe mit Schrecken, daß wieder ein leises Unbehagen über seine etwas verschwommenen Züge geht, »aber ich finde, gerade das Gegenteil ist heute der Fall. Noch zu keiner Zeit lief eine neue und eigenartige Begabung so wenig Gefahr, übersehen oder verlacht zu werden, wie heutzutage. Wir verehren und lobhudeln ja alles Schrullenhafte, und je absurder sich ein Künstler in seinen Werken gebärdet, um so eifrigere Anhänger und Förderer wird er finden. Gefahr, übersehen zu werden, laufen eigentlich nur die Stillen im Land, die einfach schaffen, wie sie können und müssen, ohne sich um Richtungen und Moden zu kümmern, die unliterarischen, möchte ich sagen.«
»Die Langweiligen mit einem Wort,« lächelt Vollmer.
»Nun ja,« antworte ich lachend, »zur Gesellschaft sind mir auch die anderen lieber, die vielseitig Interessierten, die lebhaft Bewegten, die eigenartig Schillernden. Aber ich glaube bestimmt, die wirklichen Künstler kommen aus der anderen Sphäre, aus der Sphäre der Einseitigen und Schwerfälligen, die darum in Gesellschaft langweilig sind, weil sie in ihrer Seele zuviel Kunst haben und zuwenig Literatur.«
Vollmer schweigt ein paar Sekunden. »Ja, ja, die Seele,« bemerkt er dann sinnend, und mir fällt plötzlich wieder der Zweck meines Besuches ein.
»Sie sollen ja ein ganz besonders feiner Forscher auf diesem Gebiet sein,« sage ich, »wenigstens hat man mir berichtet, daß Ihre Bilder wahre Seelenporträts seien, und ich muß sagen, ich bin gespannt –.«
Artur Vollmer lächelt zurückhaltend und weist mit der Hand auf ein großes Bild, das gleich beim Eintritt meinen Blick auf sich gelenkt hat und das ich jetzt aufmerksam betrachte. »Porträt von H. K.« steht darunter, und es stellt einen sorgsam und elegant gekleideten jungen Mann von phantastischer Häßlichkeit dar, der in einer romantischen Landschaft im Profil steht und einen Apfel, den er zwischen Daumen und Zeigefinger hält, entsetzt betrachtet.
»Sehr eigenartig,« sage ich höflich und überzeugt. »Ist es wirklich ein Porträt?«
»Sie kennen das Modell,« antwortet er und setzt nachlässig hinzu: »Auf die äußere Ähnlichkeit haben wir allerdings verzichtet, aber Sie müßten ihn schon an der Art erkennen, wie er den Apfel hält.«
Ich will schon bedauernd den Kopf schütteln, denn mir fällt keiner meiner Bekannten ein, der die Gewohnheit hat, einen Apfel mit zwei Fingern zu halten, doch da kommt mir der rettende Gedanke: – Seelenmalerei! Und ich sage stolz und glücklich: »Vielleicht ist es einer, der alle Dinge im Leben sehr vorsichtig anfaßt?« – »Ja,« nickt Artur Vollmer, »mit einem gewissen Abscheu sogar. Betrachten Sie den Ausdruck von Ekel in seinem Gesicht.«
»Nun ja,« sage ich etwas zaghaft, »aber genügt dieser eine Zug, um das Bild Porträt zu nennen? Und warum, wenn Sie H. K. schon malen wollten, haben Sie so vollkommen auf die Ähnlichkeit verzichtet?«
Vollmer schweigt einen Augenblick und sagt dann mit einem zerstreuten Blick aus dem Fenster: »Ähnlichkeit bekommen Sie für zwanzig Mark das Dutzend beim Photographen.«
Und so stark ist die Suggestionskraft seiner Worte, daß mir in diesem Augenblick die Photographen als eine durchaus minderwertige Menschengattung erscheinen. Aber dann erwacht mein besseres und mutiges Selbst und ich riskiere die Schreckensfrage, die Banausenfrage, die Frage, mit der man jungen Malern das Gruseln beibringt:
»Kann ein Porträt nicht künstlerisch und doch ähnlich sein?«
Und Artur Vollmer antwortet denn auch mit einem leisen Klang von Gereiztheit in seiner milden Stimme: »Sie sprechen immer von Ähnlichkeit, gnädige Frau, und das ist in der Kunst ein so ganz verfehlter Standpunkt. Die Hauptsache, daß das Bild ein Kunstwerk ist. Wer fragt in den Galerien und Museen heute danach, ob die Porträts von Dürer und Rembrandt und Van Dyk dem Modell auch ähnlich waren. Es sind Kunstwerke, und sie bleiben bestehen, während die Ähnlichkeit von heute schon morgen nicht mehr wahr ist.«
»Das ist sehr richtig,« antworte ich, »nur ist es dann nicht nötig, sich selbst malen zu lassen. Ich kann mir statt dessen irgendein berühmtes Bild eines berühmten Meisters kaufen, dessen Wert anerkannt ist, während es doch bei aller Hochachtung vor Ihrer Kunst noch nicht völlig sicher ist –«
»Daß ich Rembrandt oder Van Dyk erreiche,« unterbricht er mich, und die Stimme umspült mich wieder sanft wie Seifenwasser. »Nein, gnädige Frau, das ist sogar sehr unsicher, aber Sie vergessen, daß es noch eine andere Ähnlichkeit gibt, als die rein äußerliche, von der Sie reden. Die Ähnlichkeit, die vielleicht nur der Künstler sieht. – Kennen Sie den hier?«
Und er nimmt ein Bild vom Boden, das bis jetzt mit dem Gesicht nach der Wand gestanden hat, und stellt es auf eine Staffelei.
»Mein Gott!« sage ich entsetzt, »Frank Meinert.«
Es ist wirklich Frank Meinert, der mir aus einem blutigroten Hintergrund entgegenstarrt. Frank Meinert mit einer blutigroten Krawatte, die eine Backe geschwollen, die Züge nicht ganz unähnlich, aber ins brutal Verbrecherische verzerrt, und mit dem bösartig lauernden Ausdruck, mit dem die Shakespeareschen Meuchelmörder über die Bühne zu schleichen pflegen.
»Mein Gott!« wiederhole ich nur, aber in meinem Innern setze ich hinzu: Was wird er aus meiner Seele machen? Gott sei meiner armen Seele gnädig!
Und nach diesem Stoßgebet frage ich gefaßt:
»Sie sind befreundet mit Frank Meinert?«
»Ja,« sagt er, »wir treffen uns oft des Abends im Café und auch sonst –«
»Und so erscheint Ihnen seine Seele?«
»So sehe ich ihn,« antwortet er einfach.
»Nun,« sage ich, »dann bewundere ich aufrichtig Ihren Mut. Fürchten Sie denn gar nicht, daß er Ihnen eines Abends Strichnin oder Zyankali in den Kaffee schüttet, oder daß er Sie auf dem Heimweg mit einem Schlagring überfällt?«
Vollmer lächelt melancholisch. »Nein,« sagt er, »was Sie da auf dem Bild sehen, ruht ja ungewußt und ungehoben in den tiefsten Gründen seines Wesens. Es wird nie zutage kommen.«
»Das wollen wir zu Gott hoffen!« antworte ich inbrünstig. »Lebenslängliches Zuchthaus wäre das wenigste. – Übrigens maße ich mir kein Urteil darüber an, ob nicht wirklich brutale Triebe in Franks Seele schlummern. Er deutet selbst gern so etwas an, aber das ist kein Grund dafür, es nicht zu glauben. Kein Mensch kann dem anderen bis auf den Grund der Seele blicken, schon darum nicht, weil die Seele keinen Grund hat. Es geht immer noch tiefer und tiefer. Und wahrscheinlich könnten Sie jeden von uns mit dem gleichen Recht zum Verbrecher stempeln. – Zum mindesten freundschaftlich kann ich das Bild nicht finden.«
»Und wie würden Sie an meiner Stelle Frank gemalt haben?« fragt Vollmer lächelnd, indem er das Gemälde, diesmal richtig herum, an die Wand lehnt.
»Nun,« sage ich, »da Sie die Bilderrätsel lieben, hätten Sie ihn für mein Gefühl am besten als Narziß gemalt, schwermütig am Bach ruhend, verliebt und versunken in sein Spiegelbild. – Darf ich mir aber noch die Frage erlauben, welche Bedeutung die geschwollene Backe auf dem Bild hat?«
»Da ist doch keine geschwollene Backe,« widerspricht er zum erstenmal wirklich gereizt und holt das Bild wieder herbei. »Ich bitte Sie, das scheint doch nur so durch die Haltung und die Beleuchtung.« – »Ach so,« sage ich, froh, daß keine Beziehung zwischen Franks Seele und dieser Schwellung besteht.
»Und wie denken Sie sich mein Bild?« frage ich dann etwas ängstlich und setze mich vorsichtshalber.
»Tja,« sagt er, mich nachdenklich betrachtend, »ich dachte zuerst, als ich Sie sah, an die Franzosen. Renoir oder so etwas. Aber ich bin davon abgekommen. Ich möchte Sie jetzt am liebsten als Daphne malen.« – »Daphne?« wiederhole ich und wühle verzweifelt in den Untergründen meiner mythologischen Erinnerungen. Leider umsonst. »Es wird nur seine Schwierigkeiten haben,« fährt er fort, »wegen der Bekleidung und auch sonst.«
Ich blicke unwillkürlich zu dem Mädchen mit dem Strumpfband hinüber und bitte dann etwas verschüchtert um Aufklärung über Daphne.
»Daphne,« erklärt er, auf der Tischkante sitzend, mit weicher Stimme, »war die Tochter der Gäa, zu deutsch Erde, und des arkadischen Flußgottes Ladon. Andere behaupten zwar, daß Amyklas ihr Vater war und noch andere nennen Pennios, aber –« – »Lassen wir die Frage offen,« schlage ich vor, »Sie wissen La recherche de la paternité –« Er lächelt und fährt fort:
»Apollo liebte Daphne, aber er hatte einen Nebenbuhler an Leukippos, der ihr als Jungfrau verkleidet folgte und auf Apollos Veranlassung hin von den Nymphen getötet würde. Nun floh Daphne auch vor Apollo, sie wurde von ihrer Mutter aufgenommen und in einen immergrünen Lorbeerbaum verwandelt.«
Ich sitze ein paar Sekunden lang still, fasse mich aber allmählich und sage: »Also alles in allem ein Mädchen von Charakter. – Nun gestatten Sie mir aber bitte noch ein paar Fragen: Zuerst, in welchem Stadium ihres ereignisreichen Lebens wollen Sie Daphne malen? Zweitens, woran soll man mich als Daphne erkennen? Und drittens und letztens, warum überhaupt Daphne?«
»Ich sagte es ja schon,« antwortet Artur Vollmer, »die Sache wird ihre Schwierigkeiten haben. Aber die Idee wird mir lieb und lieber, je mehr ich darüber nachdenke. Es liegt eine tiefe Symbolik darin: Die Frau, die sich, vor dem Geliebten fliehend, in Lorbeer verwandelt. Man müßte natürlich diesen Moment festhalten, noch halb Weib, halb schon Baum –.«
Ich habe plötzlich das Gefühl, als ob ich schon halb zum Baum erstarrt wäre und mache heimlich ein paar schlenkernde Bewegungen mit den Beinen, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Dann stehe ich auf und sage:
»Ihre Idee ist wirklich sehr interessant und sogar geistreich wie alle Ihre Bilder. Aber ich weiß doch nicht, ob ich mich dazu entschließen kann, Ihnen als Daphne zu sitzen. Ich glaube, daß mein tiefstes Wesen in Ihrem Daphnebild nicht zum Ausdruck käme. Ich mache Ihnen daher einen anderen Vorschlag: Malen Sie mich ganz einfach hier im Sessel sitzend, möglichst bequem, das entspricht am besten einem Grundzug meines Wesens. Und machen Sie das Bild so ähnlich wie möglich, dann wird ganz gewiß auch etwas von meiner Seele in Ihre Farben fließen, denn ich bilde mir ein, daß meine Seele meinem Gesicht gar nicht so unähnlich ist. – Und wann wollen wir anfangen?«
Wir bestimmen die Zeit, und ich verabschiede mich von dem etwas frostig gewordenen Künstler, und dann sitze ich im Auto und überlege mir den Fall.
Und je mehr ich darüber nachdenke, über die ausgeklügelt geistreichen Bilder und über das unproportionierte Mädchen mit dem Strumpfband und über Frank Meinerts geschwollene Backe, um so deutlicher steigt ein schwarzer Verdacht in mir heraus, der sich nach und nach zur Gewißheit verdichtet.
Und ich nehme mir vor, morgen zu Karl Gerhard zu sagen: »Lieber Freund, Ihr Protegé ist ein interessanter junger Mann, wenigstens versteht er mit herzlich wenig Unkosten darauf zu posieren. Er hat eine einschmeichelnde Stimme und sehr gepflegte Hände. Er ist in der Mythologie erstaunlich gut bewandert und hat die eigenartigsten symbolischen Ideen. Er versteht, sehr nüanciert zu lächeln, und ich bin überzeugt, daß er auch sonst noch allerlei kann. Nur ein einziges kann er ganz bestimmt nicht, und das ist eigentlich sehr schade: er kann nicht malen.«

Wir haben uns gezankt und sitzen uns nun gegenüber wie Kinder, die beide ihre Heftigkeit bereuen und doch zu eigensinnig sind, das erste gute Wort zu sprechen. Wir sehen einander nicht an, aber ich merke, daß seine Hand, die die Zigarette hält, ein bißchen zittert, und wieder einmal, wie nach jedem Streit mit Herbert Arndt, steigt in mir das Mitleid auf.
Vielleicht habe ich ihm doch unrecht getan, als ich ihn oberflächlich genannt, denke ich, und weiß doch zugleich, daß der scheinbar tiefe Eindruck, den der Wortwechsel auf ihn gemacht hat, wie der Eindruck ist, den man einem Gummiball beibringen kann. Sobald du den Finger zurückziehst, ist alles, wie es war.
Und dieses Wissen um Herbert Arndts stets veränderliche Unveränderlichkeit ist es vielleicht, was mich ihm gegenüber oft zu einer Heftigkeit hinreißt, die mir sonst ganz fremd ist und die mich im Augenblick weit über den zufälligen Anlaß hinaus erbittert.
Was konnte es mich zum Beispiel kümmern, daß Herbert Arndt heute fast verächtlich von einem Menschen sprach, den er vor kurzem voll Begeisterung einen bedeutenden Mann von seltener geistiger Anmut genannt, und für dessen vornehm künstlerische Lebensgestaltung er eine andachtvolle Bewunderung gezeigt hatte.
Heute entsann er sich dessen kaum und nannte das Wesen des vor ein paar Tagen so hoch Gepriesenen unmännlich und affektiert, im Gegensatz zu der kraftvollen und knorrigen Einfachheit, mit der alle wirklich Großen ihr Leben geführt. Und ich wurde gereizt und nannte es Haltlosigkeit, nie bei einer Empfindung und einem Urteil beharren zu können und, wie die Snobs, immerfort seine Geschmacksrichtung zu ändern, sobald von den Obersnobs eine neue Parole ausgegeben wird. Und er nannte es Sentimentalität oder Indolenz, an alten Erinnerungen und alten Wertschätzungen zu kleben, und wir steigerten uns in immer größeren Zorn, und plötzlich schwiegen wir beide, weil wir fühlten, daß wir nicht weitergehen durften.
Und jetzt sitzen wir da und möchten uns versöhnen und wissen nicht wie. Endlich steht Herbert auf und sagt mit etwas rauher Stimme, der man noch die Erregung anhört:
»Ich will Sie lieber jetzt von meiner Gegenwart befreien. Ich kann mir denken, wie peinlich Ihnen der Anblick eines so charakterlosen und minderwertigen Menschen ist.«
Nun muß ich doch lachen. »Ich finde, Ihre Zerknirschung geht zu weit.« Er verzieht den Mund: »Ich habe mich augenblicklich nur mit Ihren Augen gesehen.«
»Ich habe diese Worte nicht gebraucht,« antworte ich, »und Sie wissen sehr gut, daß ich mit einem Menschen, den ich für charakterlos und minderwertig halte, nicht fünf Minuten lang sprechen, wieviel weniger mich in einen Streit einlassen würde.«
»Ach so,« bemerkt er, »dann habe ich es vielleicht als Ehre aufzufassen, daß Sie sich die Mühe nahmen, mich einen Snob und einen Menschen ohne inneren Halt zu nennen.«
»Mindestens als einen Beweis sehr herzlicher Freundschaftsgefühle,« antworte ich und sehe, wie ihm wider Willen ein Lächeln um die Mundwinkel zuckt. Und ich sage:
»Seien Sie kein Frosch, Herbert Arndt, und setzen Sie sich noch mal hin, denn gewöhnlich machen Sie's doch wie Wotan im letzten Akt der Walküre und nehmen stundenlang Abschied. Und in der Zeit kann man ebensogut vernünftig reden.«
Er setzt sich zögernd, denn trotz des Lächelns ist sein Ärger noch nicht überwunden, und ich schiebe ihm seine Tasse und den Kuchen näher, weil ich finde, daß es fast nichts auf der Welt gibt, das nicht gleich ein bißchen weniger schlimm aussieht, sobald man Kaffee und Kuchen vor sich hat.
Wir schweigen einen Augenblick, dann sagt Herbert: »Was mich am meisten beleidigt, ist ja gar nicht, daß Sie meine Art, die Dinge zu sehen, verachten. Ich kann Ihnen das nicht verwehren, denn jeder schätzt im Grunde genommen nur seine eigene Lebensanschauung, und wenn wir von jemandem sagen, daß er vernünftige Ansichten habe, dann hat er sicherlich die gleichen Ansichten wie wir. Was mich beleidigt, ist, daß Sie an meine Art, die Dinge zu sehen, überhaupt nicht glauben, daß Sie annehmen, ich rede nur so oder so, um mich interessant zu machen, oder aus Affektiertheit oder aus irgendeiner anderen Verlogenheit heraus.«
»Nein,« unterbreche ich ihn, »das ist ganz gewiß nicht der Fall. Und das ist eigentlich das Traurige an der Sache, das Hoffnungslose, möchte ich sagen, daß Sie immer ehrlich sind.«
»Und gerade deshalb ist der Fall hoffnungslos?« fragt er. »Wie soll ich das verstehen?«
»Es ist ganz einfach,« antworte ich, »und ich will's Ihnen erklären, selbst auf die Gefahr hin, Sie noch einmal zu beleidigen und auf die Gewißheit hin, daß es nichts nützt, denn ein Mensch, der sich immerfort ändert, der kann sich niemals ändern.«
Herbert hebt erstaunt den Kopf. »Und ich ändere mich immerfort,« fragt er.
»Und Sie wissen das gar nicht?« frage ich dagegen. »Sie wissen es gar nicht, daß bei Ihnen immerfort ein Eindruck den anderen verwischt und auslöscht, und daß Sie immerfort wie auf einem dünnen Seil gehen, nichts rechts, nichts links, so daß man ordentlich schwindelig wird, wenn man Ihnen zusieht.« – »Ich verstehe das nicht,« sagt Herbert schroff.
»Nun also,« antworte ich, »dann will ich Ihnen aus der leider übergroßen Fülle der Beispiele nur eines nennen: Waren Sie nicht vor kurzem noch ganz berauscht von den Versen Stefan Georges, den Sie nach Goethe den einzigen deutschen Dichter nannten? Und sprachen Sie nicht ein paar Tage darauf sehr abfällig von seiner hypermodernen Pathetik, die doch im Grunde genommen hohl sei, wenn man einen einzigen Mörikeschen Vers damit vergleicht? Und war nicht wieder ein paar Tage darauf Mörike spießbürgerlich und deutsch-borniert und veraltet, weil Sie gerade bei irgendeinem dekadenten französischen Absinthlyriker angelangt waren? – Und ist es nicht so auf jedem Gebiet? Die fanatische Ausschließlichkeit, mit der Sie jeden Tag eine andere Sache anbeten und jeden Tag mit der gleichen überzeugenden Ehrlichkeit, als gäbe es nur die eine auf der Welt, die macht mich müde und ungeduldig zugleich.«
Herbert schüttelt den Kopf. »Ich verstehe nicht, was Sie mir vorwerfen. Gefühl ist doch nichts, was ein für allemal feststeht, Empfindungen, selbst die wärmstem schwanken auf und ab. Und wären wir Menschen, wenn wir nicht Stimmungen unterworfen wären?«
»Ja,« nicke ich, »oft denke ich, Sie haben gar keine Empfindungen, sondern nur Stimmungen, oder besser gesagt: Anwandlungen, und Anwandlungen kommen nicht aus dem Gemüt, sondern aus den Nerven und der Phantasie.« – »Und was ist Gefühl denn anderes als Betätigung der Nerven und der Phantasie?« fragt Herbert lebhaft und schnell. »Können wir irgend etwas empfinden, Liebe, Haß, Mitleid, Begeisterung, Freude oder Schrecken, ohne daß unsere Nerven zucken und unsere Phantasie die Flügel hebt? Der phantasieloseste Mensch ist der gefühlloseste zugleich, und – so paradox es klingen mag – die Verstandsmenschen sind die dümmsten von allen.«
Ich nicke ihm langsam zu: »Es ist wahr, wir sind alle nur bauernschlau, solange es uns nicht gegeben ist, weise zu sein. Und auch das andere, was Sie sagten, ist wahr: Es gibt kein wertvolles Gefühl ohne Phantasie. Aber die Phantasie muß in unserem Gemüt ihren Ursprung haben, sonst ist der Mensch wie ein Ofen, der von außen erwärmt wird statt von innen, der heiß, vielleicht sogar überheizt erscheint, aber niemals Wärme abgibt und verströmt.«
»Ein sinnfälliger Vergleich!« sagt Herbert, und sein Mund verzieht sich spöttisch. »Ich gebe allerdings zu, daß ich wenig Talent zum traulich wärmenden Ofen habe, und offen gesagt, mein Ehrgeiz geht nicht dahin. – Ich gebe auch zu,« fährt er nach einem kurzen Schweigen fort, »daß ich leicht von diesem oder jenem Eindruck überwältigt werde und leicht alles andere darüber vergesse, aber ich schäme mich dessen nicht, im Gegenteil, ich bin froh und glücklich darüber, denn ich selbst liebe nur Menschen, die impulsiv und warm und stark empfindend sind.«
»Ach, lieber Freund,« sage ich, »heute! Heute lieben Sie die Impulsiven, vielleicht weil heute morgen oder gestern abend ein liebes Mädel in schöner Impulsivität Ihnen die Hand hingestreckt und etwas Herzliches gesagt hat. Und morgen lernen Sie eine interessante Frau kennen, die kühl und geheimnisvoll und verschlossen ist, und dann erzählen Sie mir, daß alles Impulsive doch eigentlich recht vulgär sei, und daß der wahre Reiz eines Menschen in seiner geheimnisvollen Verschlossenheit läge.«
»Ja,« antwortet Herbert, »und Sie erzählen mir dann, was ich Ihnen gestern erzählt habe, und werfen mir meine Treulosigkeit gegen das liebe Mädel vor. Aber der Reiz des Lebens liegt doch gerade darin, daß ich heute die Impulsiven lieben darf und morgen die Verschlossenen.«
»Ach, lassen wir's,« sage ich ein bißchen müde, »ich merke schon, wir reden aneinander vorbei und werden uns nicht verstehen.«
»Das ist weibliche Kriegstaktik,« antwortet Herbert, »sobald sie nichts zu antworten wissen, ziehen sie sich hinter die männliche Begriffsstutzigkeit zurück. Aber ich möchte jetzt meine Sache bis zu Ende verfechten und erbitte mir Antwort darauf, weshalb es ein, – nun sagen wir, ein verächtlicher Zug sein soll, jeder Art und Gattung Geschmack abgewinnen zu können.« – »Das ist's ja nicht,« sage ich seufzend, »und ich möchte Ihnen gerne noch einmal antworten, aber ich fürchte, die Anklagerede wird lang.«
»Wenn ich als Delinquent einen letzten Wunsch äußern darf,« sagt Herbert, »dann möchte ich mir noch ein Stück Kuchen erbitten.«
»Gewährt,« antworte ich, »und möge Ihnen das letzte Stück Kuchen leicht werden!« – »So leicht wie Ihnen mein Todesurteil,« erwidert er mit einer höflichen Verbeugung und zieht sich den Teller mit Kuchen näher heran.
Mein Ärger ist längst verflogen, und ich muß lachen.
»Mir scheint, Sie weiden sich an meiner Todesqual?« fragt er kauend, »oder hat meine sieghafte Liebenswürdigkeit so schnell die Wolken von Ihrer Stirne verjagt? – Es wäre eigentlich schade,« setzt er hinzu, »denn ich hatte mein ganzes Wesen schon auf Bußfertigkeit eingeschaltet, und außerdem war es von jeher meine Leidenschaft, zuzuhören, wenn von mir die Rede war.« – »Ja,« sage ich, »es ist die einzige Leidenschaft, der Sie bis jetzt treu geblieben sind.«
Er sieht mich einen Augenblick schweigend an und sagt dann: »Über diesen Punkt dürften Sie besser orientiert sein.«
»Ich weiß,« antworte ich nach einer kleinen Pause, »aber ich finde immer, das erotische Gebiet, denn darauf spielen Sie ja an, liegt so abseits, daß es nicht in Betracht kommen kann, wenn von dem Charakter eines Menschen die Rede ist. Und selbst wenn jemand hartnäckig an seiner ersten Liebe hängen sollte –«
»Erste Liebe,« unterbricht er mich lächelnd.
»Oder an seiner dritten oder vierten,« antworte ich, »denn eine erste Liebe gibt es ja eigentlich nicht, weil immer schon eine vorher dagewesen ist. Aber es handelt sich jetzt gar nicht um die Treue gegen andere, sondern um die Treue, die wir uns selbst schuldig sind.«
»Uns selbst, uns selbst,« sagt Herbert ungeduldig, »wie einfach klingt das! Aber wer von uns kennt sich und wertet sich richtig? Wir sind doch viel zu sehr in uns selbst gefangen, um unbefangene Richter über uns zu sein.«
»Aber lieber Freund,« sage ich, »was hat die Treue mit der Erkenntnis zu tun, da sie doch nichts Bewußtes ist, sondern so selbstverständlich wie das Atemholen, und da sie aufhört zu existieren, sobald sie bewußt und ein Willensakt geworden ist. Und wer wir selbst sind, fragen Sie? Nun, wir sind nicht nur die, die jetzt hier sitzen und reden. Zu uns gehört alles, was wir vor Jahren und Monaten, und was wir gestern und heute erlebt und gefühlt haben. Und wenn wir das täglich und stündlich von uns werfen können wie alte Kleider, dann werfen wir uns täglich und stündlich selber weg. Wie ein Mensch ohne Schatten sind wir dann, und ich begreife jetzt, was ich als Kind nie verstanden habe, weshalb Chamisso es als so traurig und als so schmachvoll hinstellt, keinen Schatten zu haben.«
Herbert ist blaß geworden. »Traurig und schmachvoll,« wiederholt er, während er mit nervöser Hand seine Zigarette in der Schale zerdrückt.
Dann hebt er den Kopf, und seine Augen haben den eigensinnig fanatischen Blick, den ich kenne.
»Vielleicht haben Sie Chamisso doch falsch verstanden,« sagt er leise, »vielleicht war es nur deshalb so traurig und schmachvoll, keinen Schatten zu haben, weil alle Welt einen Schatten hat, und weil alle Welt die haßt und verachtet, die anders sind als alle Welt.
Und jetzt will ich gehen,« sagt er aufstehend, und setzt mit einem sonderbaren, etwas hilflosen Lächeln hinzu: »Diesmal nicht wie Wotan.«
»Und doch wie Wotan,« sage ich und strecke ihm die Hand hin, die er einen Augenblick sehr fest in seiner hält. »Leben Sie wohl, einäugiger Wanderer!«
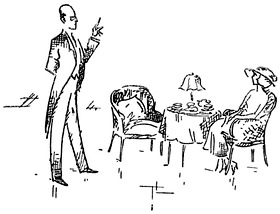
Der Fünfuhrtee im Kaiserhof ist in vollem Gang, und ich sitze an einem der kleinen, mit Blumen und Lampen geschmückten Tische und erwarte meinen Berliner Freund, den Professor, den ich fast ein halbes Jahr lang nicht gesehen habe.
Ich behalte die Eingangstür im Auge, um ihm gleich zuwinken zu können, denn ich weiß, daß es ihm, trotz einer absichtlich betonten Nonchalance, peinlich ist, sich erst lange zwischen den eleganten Gästen und den unsagbar vornehmen Kellnern durchwinden zu müssen.
Und dann sehe ich doch mal nach dem sehr feschen Paar am Nebentisch hinüber, und gerade in diesem Augenblick sagt jemand neben mir: »Guten Abend,« und der Professor setzt sich an den Tisch, als habe er mich gestern zuletzt gesehen. Ich reiche ihm die Hand hinüber und frage statt aller Begrüßungszeremonien:
»Hoffentlich hat Sie mein telephonischer Anruf gestern nicht gestört?«
»Natürlich hat er mich gestört,« antwortet er, indem er die Blumen vom Tisch nimmt und daran riecht. »Ich hatte gerade meinen Mittagsschlaf angefangen.« – »Das schadet nichts,« sage ich kühl, »welcher ausgewachsene Mensch schläft auch am hellichten Tage?«
»Nun, zum Beispiel ich und zum Beispiel Sie,« erwidert er, »denn Sie wollen mir doch nicht einreden, daß heut vormittag um zehn Uhr, als ich Sie vergeblich zu sprechen wünschte, Mitternacht war. – Und übrigens – ausgewachsener Mensch! Wer ist ausgewachsen? Welche Anmaßung! Wollen Sie etwa von sich behaupten, daß Sie ein ausgewachsener Mensch seien?«
»Lieber Professor,« sage ich, »ich höre gern meine Jugend preisen, aber ich finde, augenblicklich geht Ihre Höflichkeit zu weit.«
»Und wer weiß,« fährt er fort, »ob wir nicht gerade im Schlaf am besten wachsen?« – »Jawohl,« werfe ich ein, »von den Säuglingen wird das allgemein behauptet.«
»Dummes Mädel,« fährt er mich an, »muß denn immer von körperlichen Funktionen die Rede sein? Es ist ein echt weiblicher Zug von Ihnen, daß Sie nie das Geistige ins Auge fassen können.«
»Verzeihen Sie, aber der Gedanke lag mir zu fern, daß Sie als Lehrer der Jugend den Schlaf für das beste geistige Förderungsmittel ansehen könnten. Es sei denn, Ihre Vorlesungen – –«
Er schlägt mit der Hand auf den Tisch, daß das Nachbarpaar erstaunt herübersieht und der Kellner nervös zusammenzuckt.
»Herrgott, hat dieses Mädel ein Mundwerk! Ein wahres Glück, daß ich Sie nicht geheiratet habe!«
»Warum?« frage ich, »ich kann mir das reizend vorstellen, und es wäre uns beiden sicher sehr gesund gewesen.«
»Gesund?« antwortet er, »das wäre möglich, etwa nach der Methode, daß man den einen nimmt und den anderen damit verprügelt.«
»Ja, so dachte ich mir's,« bestätige ich und sehe vergnügt zu, wie er sich zum Entsetzen des Kellners den Teller mit Kuchen belädt. Nachdem der Befrackte endlich entlassen ist, sage ich:
»Es ist ein echt weiblicher Zug von Ihnen, daß Sie so gern Kuchen essen.«
»Wer sagt Ihnen, daß ich gern Kuchen esse?« fragt er gereizt, »und wenn Sie mich übrigens deshalb gestern am Telephon mit allen Mitteln weiblicher Verführungskunst hierhergelockt haben, um mir anzudeuten, daß Ihnen mein Appetit unsympathisch ist –.« – »Wieso unsympathisch?« frage ich, »mir ist jeder menschliche Zug an Ihnen willkommen. Ich habe Sie aber nicht deshalb hierherbeordert –.« – »Gefleht haben Sie.« – »Hierherbeordert,« wiederhole ich. – »Auf den Knien haben Sie gelegen.«
»Nein,« sage ich, »dazu war die Schnur zu kurz. Aber Sie sehen, ich habe es versucht, und das genügt Ihnen hoffentlich. Also lassen Sie mich gefälligst ausreden. Nicht deshalb, um mich an Ihrem Appetit zu erfreuen, sondern um festzustellen, ob Sie noch immer so ein Grobian sind wie früher. Und ich muß sagen, mein Wissensdurst ist gestillt.«
»Nun, dann kann ich ja Gott sei Dank nach Hause gehen, wenn ich den Kuchen aufgegessen habe, denn wenn Sie etwa glauben –«
»Ja, das können Sie,« unterbreche ich ihn, »eine Stunde werden Sie reichlich damit zu tun haben, und mehr Zeit habe ich ohnehin nicht für Sie vorgesehen.«
»Kellner!« ruft er. – »Um Gottes willen,« flehe ich, »Sie blamieren mich, wenn Sie sich noch mehr Kuchen nehmen. Wir werden hinausgeworfen.« – »Werden Sie jetzt artig sein?« fragt er. »Sie sehen, ich habe Sie in der Hand, ich kann Sie aufs tödlichste blamieren, wenn ich will. Also geben Sie jetzt zu, daß Sie mich angefleht haben, hierherzukommen?« – »Ja, ja,« sage ich, denn der Kellner steht schon neben uns.
»Reichen Sie der Dame den Kuchen,« sagt der Professor großartig.
Ich lasse den Kellner unverrichteterdinge abziehen und sage: »Ich habe mich vorhin schon bedient, während Sie wahrscheinlich noch mit Ihrem geistigen Wachstum beschäftigt waren.«
Er schnippt mit Daumen und Mittelfinger nach meiner Hand, die ich erschrocken zurückziehe.
»Sie haben die körperliche Züchtigung verdient,« sagt er, »denn Sie hätten merken können, daß ich jetzt vernünftig mit Ihnen sprechen will.« – »Es ist mir nichts aufgefallen.« – »Ruhig! – Also, wie geht es Ihnen?«
»Auf eine so originelle Frage kann ich nur ebenso originell antworten. Es geht mir natürlich sehr gut.« – »Wieso natürlich?« fragt er, »ach so, Sie meinen, einer so entzückenden Dame gegenüber kann das Schicksal natürlich gar nicht anders als zart und galant verfahren. Sie stehen ja auf einem so hohen Piedestal, Sie schweben so hoch über allen Erdendingen –.« – »Um Gottes willen,« sage ich, »was haben Sie auf einmal?« – »Warum?« fragt er, »war ich etwa nicht grob?« – »Geradezu unverschämt,« versichere ich.
»Na also,« sagt er, »was ist da zu erschrecken! Mir scheint, Sie sind etwas verwöhnt und verzärtelt worden seit unserem letzten Zusammensein. – Was machen übrigens Ihre vierzig Freunde?«
»Sie verwechseln das,« belehre ich ihn, »bei unserem letzten Zusammensein war von Ihren dreiundvierzig Freundinnen die Rede.«
»Nun ja, warum sollte ich nicht drei mehr haben als Sie?« fragt er, »gönnen Sie mir die etwa nicht?«
»Von Herzen,« sage ich. »Don Juan hatte noch mehr.«
»Don Juan war auch kein feiner Genießer wie ich,« erklärt er. »Ich bin nur für Auslese, und deshalb kann auch der Kreis unmöglich vergrößert werden, so sehnsüchtig Sie darauf warten, aufgenommen zu werden.«
»Weshalb sind Sie so grausam?« frage ich, »gehen mir vielleicht ein paar Tugenden ab, die notwendig sind, um unter die Göttinnen eingereiht zu werden?«
»Alle,« erklärt er, »zuerst die wichtigste, Bescheidenheit. Sie sind von einem ebenso unberechtigten wie unerträglichen Hochmut geradezu geschwellt. Sie halten sich für unausstehlich gescheit –.« – »Ganz im Gegenteil,« versichere ich, »ich halte mich für sehr angenehm begabt.«
»Sie sind überzeugt, daß Sie keine Fehler haben –.« – »Auch das nicht,« antworte ich, »aber ich habe gerade meine kleinen Untugenden von jeher sehr reizvoll und sympathisch gefunden. – Fahren Sie übrigens nur fort, es gibt für mich nichts Wohltuenderes, als wenn sich jemand so eingehend mit meiner Person beschäftigt.«
»Für diese niedrige Eitelkeit verdienen Sie meine Verachtung,« antwortet er, »oder ist Ihnen eine körperliche Züchtigung lieber?«
»Ach nein,« sage ich erschrocken und verstecke die Hände unterm Tisch, »wenn ich dann lieber um Ihre Verachtung bitten dürfte.«
»Dacht ich mir's doch,« sagt er, »man hat Sie entsetzlich verweichlicht im letzten halben Jahr. – Aber jetzt ernstlich: Was machen die vierzig? Oder sind's seitdem mehr geworden oder gar weniger?«
Ich nicke: »Einer weniger.«
»Verkracht?« fragt er und strahlt geradezu teuflisch. – »Ach, wenn's nur das wäre,« sage ich.
»So, so, also ernstlich,« überlegt er. »War's Ihr bester?«
»Ich weiß nicht,« antworte ich, »aber ich glaube, der, den man verloren hat, war immer gerade der beste.«
»Na ja,« brummt er, »das hat dann gleich so etwas vom verlorenen Sohn an sich. Aber mit Freunden sollte es anders sein. Die man ohne eigene Schuld verliert, an denen ist meistens nichts verloren. Und so streitsüchtig Sie sind, ich nehme an, es war nicht Ihre Schuld.«
Ich muß lachen. »Ach nein,« sage ich, »ich war ganz und gar unschuldig, der Junge hat sich verheiratet.«
»O weh, o weh!« sagt der Professor und schlenkert die Hand durch die Luft, als habe er sich verbrannt. »Also ein fast unheilbarer Fall. Wie konnte der Trottel nur?«
»Trottel?« sage ich empört. »Er hat sehr vernünftig geheiratet, ideal und nützlich zugleich.«
»Also ein idealer Nützlichkeitstrottel,« nickt er. »Und er hat Ihnen versprochen: Zwischen uns bleibt alles, wie es war, und unsere Freundschaft besteht jede Probe, und so weiter?«
»So ähnlich,« antworte ich.
»Und Sie Schaf haben's geglaubt?«
»Lieber Professor,« sage ich, »ich bin vielleicht geistig etwas unter dem Durchschnitt, aber für so ein Schaf dürfen Sie mich nun doch nicht halten.«
»Na also,« sagt er, »und trotzdem beklagen Sie sich jetzt.«
»Ich glaube, ich kann Ihnen mit gutem Gewissen die ehrenvolle Anrede zurückgeben. Denken Sie Schaf vielleicht, uns schmerzen nur die Dinge, die wir nicht vorausgesehen haben?«
»Es war dumm, natürlich,« brummt er. »Sie haben recht. Es gibt allerdings Menschen, denen das Vorhergewußthaben jeden Schmerz versüßt, aber dazu gehören Sie anscheinend nicht. Wieso kam es aber zum Bruch? Hat man Sie etwa beleidigt?«
»Es ist gar kein Bruch, und mit Absicht hat man mich wohl nicht beleidigt,« antworte ich, »aber haben Sie nicht schon bemerkt, daß uns die Kränkungen am tiefsten treffen, die uns unabsichtlich zugefügt werden?«
»Natürlich,« sagt er, »die verfluchte Eitelkeit! Wir ertragen's eher, daß man uns haßt und verabscheut, als daß man uns gleichgültig gegenübersteht. – Übrigens vermute ich, Sie verlieren nicht mehr viel an dem Verkehr, denn wir waren uns ja von jeher darüber einig, daß glücklich verheiratete Leute kein Umgang für Menschen von Geschmack sind. Ob sie's wollen oder nicht, sie bringen ihr Familiensofa überall mit hin, und man kann sie noch so entfernt voneinander placieren, immer hat man das Gefühl, als säßen sie Hand in Hand. – Ist übrigens noch kein Ersatz in Sicht?«
»Ersatz?« wiederhole ich. »Jeder ist doch ein Mensch für sich, und einer kann den anderen nicht ersetzen.«
»Nun,« antwortet er, »meistens ist es doch im Leben so, daß uns die Dinge schon halb verloren sind, während wir sie noch zu halten glauben, und während von uns ungeahnt, irgendwo aus der Flut der Erscheinungen schon das Neue aufsteigt, das den Ersatz in sich trägt.«
Wir schweigen eine Zeitlang, und ich schaue ein wenig gedankenlos in die kleine rosa Lampe vor mir. Endlich sage ich:
»Drollig, mir ist ein Wort im Ohr hängen geblieben, das Sie vorhin sprachen. Vielleicht, weil's so widerspruchsvoll klingt. Was ist das, ein idealer Nützlichkeitstrottel?«
»Na,« antwortet er, »widerspruchsvoll klingt das Wort nun ganz und gar nicht, oder doch nur für den Trägen im Geist. Im allgemeinen drücke ich mich allerdings höflicher aus und sage: ideale Nützlichkeitsmenschen. Das Trottel sollte vorhin nur die weitverbreitete Trottelei des Heiratens treffen.«
»Meine geistige Trägheit schreit wahrscheinlich zum Himmel,« antworte ich, »aber ich kann mir auch unter der milderen Form nichts vorstellen. Also bitte, Herr Professor –«
Er fährt sich seufzend über den, trotz seiner Jugend, schon recht kahlen Schädel. »Gräßlich, wenn man durch die verfluchte Galanterie auch noch außerhalb der Vorlesungen zum Dozieren gezwungen wird. Aber nun passen Sie wenigstens auf, sonst setzt's was. Noch einmal kommen Sie nicht mit meiner Verachtung davon, diesmal knipse ich.«
»Mein Denkapparat wird nur so rasseln,« versichere ich und verstecke die Hände unterm Tisch.
»Na also,« er denkt einen Augenblick nach, »wissen Sie noch etwas von Lessings Hamburgischer Dramaturgie?«
»Ja,« sage ich stolz, »sie handelt hauptsächlich von Laokoon.«
»Ganz recht,« lobt er. »Sie meinen zwar den Laokoon von Lessing, aber das schadet nichts.« –
»Nein,« sage ich, »es schadet sicher nichts. Was hat es aber mit den idealen Nützlichkeitsmenschen zu tun?«
»Komische Frage,« antwortet er, »was soll es ausgerechnet damit zu tun haben? Ich muß morgen einen Vortrag über die Hamburgische Dramaturgie halten und wollte mich von Ihnen inspirieren lassen.«
»Und ist es geglückt?« frage ich. – »Vollkommen,« antwortet er, »ich bin nun so im Zug, daß ich Ihnen meinen Vortrag sofort halten werde.«
»Ich hoffe, Sie sind nicht böse, wenn ich dabei die Augen schließe,« frage ich, »das ist nämlich meine Gewohnheit bei Vorträgen und vielleicht der Grund zu meiner geistigen Fortgeschrittenheit.«
»Meinetwegen,« sagt er, »es ist mir ohnedies peinlich, wenn Sie mich so mit den Blicken verzehren und mir jedes Wort von den Lippen saugen.«
Ich überwinde einen krampfartigen Lachanfall, und er beginnt:
»Lessing war der Ansicht, daß in Hamburg das Prinzip der Nützlichkeit das überwiegende und ausschlaggebende sei. Davon steht zwar nichts in seiner Hamburgischen Dramaturgie, aber wir dürfen das dem Mann nicht zum Vorwurf machen, denn warum hätte er das gerade da hineinschreiben sollen? Er war trotzdem dieser Ansicht, und wir sind es mit ihm. Nun gibt es sowohl in, als auch außerhalb Hamburgs verschiedene Arten von Nützlichkeitsmenschem. Ad 1: Die gewöhnliche Feld-, Wald- und Wiesenpflanze, die jeder sofort erkennt, ad 2: die verfeinerte Sorte, die zwar auch nicht ganz selten ist, aber nur von Denkenden und geistig Hochstehenden erkannt und richtig eingereiht wird.
Es sind die Glücklichen, die nie eine Überzeugung, nie eine Neigung opfern müssen, weil ihre Überzeugung und ihre Neigung sich immer nach dem ihnen Nützlichen dreht, wie die Magnetnadel nach Norden. So leben sie unbeschwert von Sentiments, die nicht gerade der Augenblick in ihnen weckt, unbeschwert vor allem von retrospektiven Störungen, denn alles ist in ihrem Gedächtnis, oder sagen wir in dem Gedächtnis ihres Herzens ausgelöscht, was ihnen nicht mehr nützen kann. Und man darf von ihnen als ideal veranlagten Naturen nicht verlangen, daß sie sich nach etwas anderem als dem Zug ihres Herzens richten.
Sie sehen denn auch mit Verachtung auf den gewöhnlichen Nützlichkeitsmenschen herab, der der Stimme seines Herzens zuwider handelt und sich oft erst nach hartem Kampf mit sich selbst und mit bewußter Kraft und Rohheit das erringen muß, was ihnen eine besonders glückliche Veranlagung schenkt. Ihre Entschuldigung, wenn sie einer bedürfen, ist, daß sie nichts von dieser glücklichen Veranlagung wissen und ihrer wirklichen Überzeugung nach als ideal geartete Menschen durch die Welt gehen. – Kapiert?«
»Jawohl,« sage ich.
»Also kurz rekapitulieren!« Er sieht mich streng an, und ich sage, die Hände krampfhaft unterm Tisch:
»Lessings Hamburgische Dramaturgie gipfelt in der Erkenntnis, daß es gewöhnliche und ideale Nützlichkeitsmenschen gibt. Die ersten werden zum Beispiel nie ein armes Mädchen heiraten, die zweiten werden sich nie in ein armes Mädchen verlieben.«
»Basta punktum!« sagt der Professor grinsend, »da hat sich's der Weiberkopf Gott sei Dank in seine Weibersprache übersetzt. Vom Verlieben und Heiraten muß bei euch die Rede sein, da seid ihr zu Hause und geborgen, da könnt ihr mitschwimmen und plätschern wie ein Fisch im Wasser.«
»Weshalb verallgemeinern Sie so?« frage ich sanft. »Sollten Ihre dreiundvierzig Freundinnen am Ende ebenso trivial sein wie ich?« – »Die werden sich hüten,« antwortet er, »wer mit mir vom Heiraten spricht, hat ausgespielt.«
»Erzählen Sie ein bißchen von den dreiundvierzig,« schlage ich vor, um ihn wieder milder zu stimmen. »Sind sie alle sanft und bescheiden oder sind auch Wilde und Feurige dabei oder herb Verschlossene oder hinreißend Kluge? Daß sie alle berückend schön sind, setze ich als selbstverständlich voraus.«
»Alles ist da,« antwortet er stolz.
»Das muß ja unglaublich interessant und spannend sein,« schmeichle ich ihm, und er lächelt in teuflischer Verschlagenheit vor sich hin.
»Sie sind so verschwiegen,« beklage ich mich, »und ich habe Ihnen heute schon so viel von mir erzählt, daß Sie sich freundschaftlicherweise revanchieren dürften.«
»Ja,« sagt er nach einer kleinen Pause, »ich will Ihnen erzählen: Sie ist sanft und feurig und schelmisch und ernst und verschlossen und mitteilsam und stolz und bescheiden und alles zugleich. Und schön ist sie –«
»Sie, sie!« sage ich ganz fassungslos, »ich denke, es sind dreiundvierzig!«
»Quatschkopf!« sagt er und schnippt nach meiner Hand. »Sie wissen doch schon lange, daß es nur eine ist.«

»Der kleine Dichter« hieß er im Sanatorium, wo ich ihn kennenlernte, zur Unterscheidung von dem großen, der ihn sowohl an Körperlänge, als an Berühmtheit überragte. Aber hier in Hamburg, wo er nicht im Schatten seines größeren Kollegen lebt, nennen wir ihn den Dichter schlechthin, und wenn mir doch mal das Beiwort entschlüpft, dann hat es nichts mit einer Wertung zu tun, sondern ist ein Kosewort, und er läßt sich's behaglich schnurrend wie eine Katze gefallen.
Er hat mich gelehrt, daß ein Genie es unsagbar schwer im Leben hat und unter tausend Qualen leidet, von denen wir anderen nichts ahnen, und daß es daher unsere Pflicht ist, die Genies auf jede erdenkliche Art zu verwöhnen und ihnen so die Last ihrer Sendung zu erleichtern. Und ich habe damit angefangen, daß ich eine eierschalendünne Tasse gekauft habe, die er als seine Stammtasse betrachtet und aus der er ungeahnte Fluten von Kaffee schlürft, denn er bedarf starker Stimulanzen.
Auch Kuchen und Zigaretten sind Stimulanzen, deren er in hohem Maße bedarf.
Heute ist sein schmales Gesicht von Wind und Kälte gerötet, wie er bei mir eintritt. Er reibt sich heftig die auffallend schönen Hände, so daß das schmale goldene Armband ein wenig sichtbar wird, und dehnt sich dann behaglich im Sessel.
»Geradezu niederschmetternd ist es draußen,« berichtet er, »und ich weiß wirklich nicht, ob wir es uns gefallen lassen müssen, daß man uns unausgesetzt von oben herab mit kaltem Wasser begießt.«
»Ganz und gar nicht,« antworte ich und reiche ihm seine Tasse. »Sie haben ja auch Ihre Gegenmaßregel schon getroffen, die einzig wirksame, die es gibt.«
»Ja, ich bin hierhergeflüchtet,« sagt er, »übrigens nicht nur vor dem Regen, denn ich habe ja auch zu Hause gewissermaßen ein Dach über dem Kopf. Aber dies hier ist kein Dach, es ist eine Art Baldachin, eine Tempelwölbung, wenn Sie wollen, und nach so etwas sehnt man sich von Zeit zu Zeit geradezu elementar.«
Ich blicke ihn prüfend an und entdecke, daß er müde aussieht und daß sein schöngeschnittenes Gesicht noch etwas hagerer als sonst erscheint.
»Sie haben zu viel gearbeitet,« sage ich. – »Ja,« antwortet er seufzend, »ich habe mich geschunden und abgerackert, hundert Pferdekräfte habe ich vorgespannt, weil ich es zwingen wollte. Äh, lassen wir's jetzt! Hier ist es schön, und der Gedanke an Arbeit liegt in nebelhafter Ferne. – Denn sehen Sie,« fährt er lebhaft fort, »trotzdem Sie oft über meinen irrsinnigen Fleiß schelten, und trotzdem ich manchmal arbeite wie ein Tier, im Grund meines Wesens bin ich faul, – ohne jede Beschönigung, schlechthin faul.«
»Ich weiß,« antworte ich, »und kann Sie mir sehr gut als leidenschaftlichen Anhänger meines Lieblingsgottes vorstellen, des göttlichsten Gottes, der das absolute Nichtstun lehrt und das süße Versinken in sich selbst.«
»Ja,« antwortet Robert Helström mit einer großen Geste, »und hier ist der Tempel des Gottes Tao und seine fanatischste Priesterin. Und mir ist fast so, als kennten wir einander von Urzeiten her, und unsere Lotosblumen hätten einmal nahe beieinander geblüht. Ja wahrhaftig,« er stützt den Kopf in die Hand und betrachtet mich aufmerksam, »wenn ich mich recht besinne, gnädige Frau, Sie haben sich in den letzten zweitausend Jahren nicht im geringsten verändert.«
»Kleiner Dichter,« sage ich und sehe ihm in die necklustigen Augen. »Was wollen Sie eigentlich heute von mir? Ihre Redensarten sind so süß und glupschig wie Pralinés und haben auch das mit Pralinés gemein, daß man nicht recht weiß, was darin steckt. Also sagen Sie's gleich: muß ich wieder bei der Abfassung eines knifflichen Briefes an Ihren Verleger helfen, der so ungefähr haarscharf an einer Injurienklage vorbeiführt? Oder habe ich Sie heute mit eigener Lebensgefahr aus einer verzwickten Liebesaffäre zu erretten? Oder was ist es sonst?«
Aber in Robert Helströms Kopf scheint nur ein Wort haften geblieben zu sein, er macht einen langen Hals und blickt suchend auf dem Tisch umher.
»Apropos Praliné?« murmelt er.
Ich zeige ihm meine geöffneten Hände. »Alle,« antworte ich.
»Unerhört,« sagt er und lehnt sich entrüstet im Sessel zurück. »Ich werde mich beschweren!«
»Tun Sie das,« nicke ich. »Wer sich beschwert, erleichtert sich merkwürdigerweise, und das ist auch meist der einzige Erfolg, den er dabei aufzuweisen hat.«
»Gut,« sagt Robert Hellström, »diesen Splitter aus dem Auge Ihrer Nächsten sollten Sie den Fliegenden Blättern übersenden und für den Erlös neue Pralinés kaufen. – Übrigens ist doch sicher nur Marke zwei und drei ausgegangen, während Nummer eins noch beinahe unangetastet im Schokoladenschrank ruht.«
»Selbstverständlich,« antworte ich. »Nummer eins ist streng persönlich und unübertragbar. Nur zur Aufheiterung meiner einsamen Stunden bestimmt und hie und da im Theater zur geistigen Anregung.«
Robert Helström schweigt empört, aber die tausend Qualen, die ein Genie zu erdulden hat, stehen so deutlich auf seinem Gesicht geschrieben, daß ich gerührt aufstehe und zum Schokoladenschrank gehe. Er bemerkt es scheinbar nicht, sondern blickt schweigend nach der Stubendecke. Erst wie ich mit der kleinen Schachtel an den Tisch zurückkomme, sagt er lebhaft:
»Wir wollen sie ausschütten, der besseren Übersicht halber,« und leert die Schachtel vorsichtig auf einen Glasteller. Dann sitzen wir ein paar Minuten still und einträchtig zusammen, wie Kinder, die auf die angenehmste Art beschäftigt sind.
Endlich sage ich: »Etwas muß auch für das nächste Mal bleiben,« und stelle den Teller aus seiner Reichweite.
»Mir fällt übrigens ein, daß wir uns lange nicht gesehen haben.«
»Vier Wochen fast,« antwortet er, »und es spricht weder für Sie noch für mich, daß Ihnen das jetzt erst einfällt. Ich will zu Ihrer Entschuldigung annehmen, daß Sie von anderer Seite genügend mit geistiger Kost versehen wurden.«
»Es muß wohl ausreichend gewesen sein,« antworte ich. »Meine Freunde haben ja alle viel Zeit, und so kommt es –«
»Ja, ja,« macht er nachdenklich und fährt dann lebhaft und mit etwas affektierter Leichtigkeit fort:
»Ja, das wäre doch interessant zu wissen, gnädige Frau, und ich hoffe, Sie antworten mir ehrlich: Ist Ihnen noch nie der eine oder der andere Ihrer Freunde gefährlich geworden? Es läge doch so nahe –«
Ich kann's nicht ändern, ich muß dem kleinen Dichter einmal mit der Hand übers Gesicht streichen und ihm dann einen Nasenstüber versetzen.
»Einer?« sage ich. »Oder der andere? Was denken Sie eigentlich? Jeder einzelne ist mir schon gefährlich gewesen, der eine auf Tage, der andere auf Stunden und manchmal waren's auch nur Minuten, aber zum Glück hat immer einer den anderen wieder aufgehoben, so daß die Sache hübsch im Gleichgewicht blieb, – balance of power nennt man so etwas, glaube ich.«
Der kleine Dichter sieht unzufrieden aus, und ich beuge mich ein wenig zu ihm hinüber und frage:
»Also weshalb habe ich Sie solange nicht gesehen?«
Er weicht meinem Blick aus: »Ich wollte arbeiten, ich sagte es ja.«
»Früher war das ein Grund mehr, zu kommen.«
»Ja, früher!« antwortet er rätselhaft und fragt dann, unbeweglich in den blauen Rauch starrend, der seiner Zigarette entsteigt:
»Kennen Sie das, was einen nicht arbeiten und nicht ausruhen läßt, nicht wachen und nicht schlafen, die Qual, die einen auffrißt bei lebendigem Leib?«
»Wer kennt das nicht?« antworte ich, und dann ist's eine Weile still im Zimmer.
Und dann frage ich: »Wissen Sie denn so genau, daß sie einen anderen liebt?«
»Sie ist verheiratet,« sagt er leise, und da ich ihn schweigend ansehe, fährt er hastig fort: »Ich weiß, was Sie sagen wollen. Aber er ist der Mann, und er hat das Recht, und ich kann den Gedanken nicht ertragen –«
Er steht so heftig auf, daß der kleine Tisch ins Schwanken gerät, und die eierschalendünne Tasse klirrt.
»Und er, der Ehemann?« frage ich. »Hat er nicht mehr Grund zur Eifersucht als Sie?«
»Der?« lacht er. »Weshalb denn? Er ist ja seiner Sache sicher; sie ist vernünftig, denkt er, sie wird mir schon keine Dummheiten machen. Und darin hat er recht, Gott sei's geklagt!«
Ich schweige, und es geht mir durch den Kopf, daß hier ein fundamentaler Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Empfinden sein muß. Mag sie lieben, wen sie will, denkt der Normalmann, wenn sie mir nur keine Dummheiten macht! Mag er Dummheiten machen, wenn er will, denkt die Normalfrau, wenn er nur keine andere so liebt wie mich!
Und ich will schon ein bißchen stolz auf mein eigenes Geschlecht werden, denn unser Standpunkt scheint mir der geistigere und vornehmere zu sein, aber ehe ich dazu komme, fallen mir schon wieder hundert Für und Wider ein, und aus diesen Erwägungen heraus frage ich Robert Helström, der mit langen Schritten das Muster meines Teppichs auf und ab schreitet und dabei gewisse Ornamente ängstlich zu vermeiden scheint:
»Weshalb sagt man eigentlich, ein Mann sinkt und eine Frau fällt?«
Er steht still und sieht mich einen Augenblick zerstreut an, dann sagt er: »Das ist doch sehr einfach. Wir Männer sind schon unten, wir leben sozusagen im Sumpf und können nur noch tiefer sinken und versumpfen, langsam und allmählich. Die Frau steht auf einer stolzen Höhe, aber ein Schritt zur Seite stürzt sie in den Abgrund.«
»Kinder!« sage ich, »warum habt ihr uns nur auf ein so gräßlich gefährliches Postament gestellt? Hat eine von uns vielleicht jemals nach dieser schwindelnden Höhe verlangt?«
Der kleine Dichter lacht. »Meiner bescheidenen Erfahrung nach nicht. Aber Sie haben recht, wir haben die Frau auf das ehrenvolle Piedestal erhoben. Im Manne ist eine Sehnsucht nach Reinheit, eine Andacht und Ehrfurcht vor der Unbeflecktheit des Weibes, die ihn trotz allem der Frau gegenüber zu dem ethisch höherstehenden Wesen macht. Bedenken Sie nur, daß selbst guterzogene und gut veranlagte Mädchen den berüchtigten Don Juan dem Tugendhelden vorziehen, während wir, trotz aller Verirrungen, das reine, das jungfräuliche Weib am meisten lieben.«
»Ja, ja,« sage ich nachdenklich, »aber wie läßt sich diese rätselhafte, höchst widerspruchsvolle Tatsache erklären, denn mit einer höheren ethischen Veranlagung des Mannes hat sie sicher nichts zu tun.«
»Ich finde das unrecht,« schmollt er, »nicht mal das bißchen höhere Ethik gönnen Sie uns, doch sicher einer der am wenigsten begehrten menschlichen Vorzüge. Oder halten Sie es vielleicht für ein Vergnügen, moralisch zu empfinden?«
»Sicher nicht,« antworte ich. »Ihr würdet euch sonst stärker damit belasten. Aber ich glaube, ich habe des Rätsels Lösung gefunden: Aus Egoismus liebt der Mann das jungfräuliche Weib, nicht aus Ehrfurcht vor ihrer Reinheit, sondern aus dem rohen Verlangen heraus, der Erste zu sein, der diese Reinheit besitzt und der sie zugleich zerstört. Und aus tief ethischem Empfinden liebt die Frau den gesunkenen Mann, aus Opfer- und Schmerzbereitschaft und aus dem Trieb heraus, ihn zu heben und zu erlösen –«
Ich sehe den kleinen Dichter stolz an, aber der schüttelt baß verwundert den Kopf.
»Ei du liebes Herrgöttle!« sagt er, »seit wann sind Sie denn so begeistert weiblich gesinnt? Und wer sagt denn, daß wir partout eure Reinheit zerstören wollen? Daß wir's tun, ist eine bedauerliche Nebenerscheinung, aber doch nicht Zweck und Ziel. Im Gegenteil, es stimmt uns traurig und läßt uns immer von neuem nach neuer Reinheit und Unberührtheit suchen. Daher der Typ des Don Juan, der rastlos sucht und der erst zur Ruhe kommen kann, wenn er das Ideal gefunden hat, die Frau, deren Reinheit unzerstörbar ist, Mutter und Jungfrau zugleich. Denn das ist nicht allein das Ideal der katholischen Kirche, der Madonnenkult lebt in jedem Mann.«
»Nun,« antworte ich, »ich bin sicher, sämtliche Lebejünglinge und -greise werden Ihnen Dank wissen, daß Sie aus ihrer Unersättlichkeit die Sehnsucht nach einem Ideal, sozusagen also aus ihrer Not eine Tugend gemacht haben. Wie auch alle abenteuerlustigen Backfische mir dankbar die Hand küssen sollten, wenn ich ihre Sensationsgier in Opferfreudigkeit umdichte. – Denn man kann bekanntlich alle Dinge so und anders sehen, das Gegenteil ist meistens ebenso richtig.«
Der kleine Dichter hat sich wieder an den Tisch gesetzt und raucht mit Hingebung seine Zigarette.
»Die Weisheit der Temperamentlosen,« bemerkt er und fährt plötzlich mit nervöser Gereiztheit fort: »Sie sollten sich nicht zu ihr bekennen. Wer alles so und anders sehen kann, der mag sehr weise sein, aber er kann nichts hassen und nichts lieben. Er liebt einmal hier und einmal da, und vielleicht gibt es sogar Menschen, die hier und da zugleich lieben können. Wer weiß es?«
»Ja, wer weiß es?« wiederhole ich und zünde mir eine Zigarette an. Und dann, in unseren gewohnten Neckton verfallend, füge ich lächelnd hinzu: »Kleine Dichter müssen nicht so viel fragen. Sie kennen ja bekanntlich die Welt durch Antizipation und brauchen unsere Weisheit nicht.«
Aber er fährt in seinem heftigen Tone fort, und seine Augen blitzen mich böse an:
»Beneidenswerte Leute, die so weise sind, daß sie über alles lächeln können. Verspielte Leute, die das Leben zwischen ihren schmalen Händen und spitzen Fingern halten wie ein drolliges und seltsames Spielzeug und es hin und her drehen und lächelnd betrachten. Leute, denen alles zum Spielzeug wird, Worte und Empfindungen und Dinge und Menschen. – Ja, Menschen auch!«
Er schweigt, und ich nehme seine Hand und streichle sie leise.
»Nicht schelten,« sage ich. »Lassen Sie uns spielen! Und lassen Sie uns die Augen wegwenden von dem Abgrund, der überall neben uns klafft, wo wir gehen und stehen, und in den wir versinken müssen, wenn wir hinunterschauen. Lassen Sie uns am Rand spielen, wie Kinder, die von nichts wissen.«
Wir schweigen einen Augenblick, dann sagt er leise, seine Wange an meine Hand gelehnt:
»Wissende Kinder sind es, die die Augen vor dem Abgrund verschließen und mit ihrem eigenen Herzen spielen wie mit der ganzen Welt. – Aber vielleicht ist es doch wahr, daß nichts auf Erden uns so nötig ist wie ein Frauenlächeln, und daß nichts im Leben so ernst und so heilig ist wie das Spiel.«
»Lieber kleiner Dichter,« sage ich und reiche ihm den Rest der Pralinés hinüber, »weise oder nicht, für mich sind Sie ein großer Dichter.«
Das Originalbuch ist in Frakturschrift gedruckt.
Darstellung abweichender Schriftarten: gesperrt, Antiqua.
Bei direkter Rede wurden sowohl Komma als auch Punkt vereinheitlichend jeweils vor dem schließenden Anführungszeichen angeordnet.
Der Text des Originalbuches wurde grundsätzlich beibehalten, mit folgenden Ausnahmen,
Seite 43:
"sie" geändert in "Sie"
(recht gut, und was Sie jetzt sagen)
Seite 44:
"« –" eingefügt
(optimistisch genug zu behaupten, –« –)
Seite 44:
"»" entfernt vor "Ich"
(so nennen. – Ich will das erst beweisen)
Seite 55:
"»" entfernt vor "Aber"
(Aber Paulsen schüttelt den Kopf.)
Seite 81:
"»" eingefügt
(sagt Erich, »auf diesen liebenswürdigen Trick)
Seite 114:
"»" eingefügt
(»daß sich auch bei Ihnen einmal)
Seite 127:
"»" eingefügt
(»wir treffen uns oft des Abends im Café)
Seite 127:
"«" eingefügt
(Es wird nie zutage kommen.«)
End of the Project Gutenberg EBook of Gespräche im Zwielicht, by
Karin Delmar [pseud.] and Terese Robinson
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GESPRÄCHE IM ZWIELICHT ***
***** This file should be named 63021-h.htm or 63021-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/3/0/2/63021/
Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.