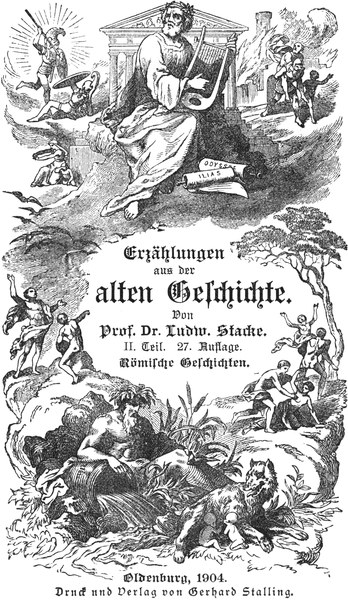
Original-Titelkupfer
The Project Gutenberg EBook of Erzählungen aus der Römischen Geschichte in biographischer Form, by Ludwig Stacke This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Erzählungen aus der Römischen Geschichte in biographischer Form Author: Ludwig Stacke Release Date: May 1, 2020 [EBook #61988] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ERZÄHLUNGEN AUS DER *** Produced by the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1904 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts dadurch nicht beeinträchtigt wird. Rechtschreibvarianten wurden nicht vereinheitlicht, wenn die jeweiligen Formen mehrmals bzw. gleich oft im Text vorkommen.
Personennamen werden bei ihrer ersten Erwähnung oft mit Betonungs- und ggf. mit Aussprachezeichen versehen und erscheinen dann in der Regel gesperrt gedruckt, später meist nicht mehr.
Die Buchwerbung wurde vom Bearbeiter der Übersichtlichkeit halber am Ende des Texts zusammengefasst.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift werden im vorliegenden Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
Erzählungen
aus der
alten Geschichte.
Von
Prof. Dr. Ludw. Stacke.
II. Teil. 27. Auflage.
Römische Geschichten.
Oldenburg, 1904.
Druck und Verlag von Gerhard Stalling.
Von
Prof. Dr. Ludwig Stacke.
Siebenundzwanzigste, verbesserte Auflage.
Oldenburg.
Druck und Verlag von Gerhard Stalling.
1904.
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage.
Dieses zweite Bändchen meiner Erzählungen enthält eine Auswahl derjenigen Momente der römischen Geschichte, welche für den biographischen Unterricht geeignet schienen. Die eigenen Worte der Quellen anzuführen, wie ich es im ersten Bändchen, namentlich mit den aus Herodotos gewählten Erzählungen getan habe, war hier fast ganz unstatthaft; dagegen sind angemessene Darstellungen aus neueren quellenmäßigen Bearbeitungen, wenn sie sich für meinen Zweck eigneten, ganz oder teilweise aufgenommen worden. — Über Marc Aurel hinaus mochte ich die Erzählungen nicht fortsetzen; auch die Zeiten des Unterganges des Reiches sind in dem angehängten Schluß nur sehr übersichtlich berührt, weil man mit dem Auftreten der Germanen zweckmäßiger die Geschichte des Mittelalters eröffnet.
Dr. Stacke.
Vorwort zur 25. Auflage.
Nach denselben Gesichtspunkten, wie bei der letzten Auflage der „Erzählungen aus der römischen Geschichte“, ist auch bei der Bearbeitung des vorliegenden Bändchens verfahren worden. Man wird die Tätigkeit der nachbessernden, ergänzenden oder berichtigenden Hand auf jeder Seite gewahren. Unverändert dagegen ist die Grundanlage und die Auswahl des Stoffes geblieben, mit der einen, schon bei dem griechischen Teil der Erzählungen eingeführten Ausnahme, daß die seit der 8. Auflage zugefügte „Geographische Überschrift des alten Italiens“ durch eine kurze historisch geographische Einleitung in die Geschichte Roms ersetzt worden ist.
Oldenburg, im März 1898.
Dr. H. Stein.
Vorwort zur 27. Auflage.
Die erneuerte Durchsicht hat bei dieser Auflage, außer vielfachen kleineren, meist formalen Nachbesserungen, auch einige erhebliche Erweiterungen und Ergänzungen zur Folge gehabt, durch welche der Umfang des Bändchens um zehn Seiten gewachsen ist.
Oldenburg, im Juni 1904.
Dr. H. Stein.
|
Seite.
|
||
| Einleitung | ||
| Rom unter Königsherrschaft. | ||
|
I.
|
Gründung Roms. König Romulus (754–717 v. Chr.) | |
|
II.
|
König Numa Pompilius (716–673 v. Chr.) | |
|
III.
|
König Tullus Hostilius (673–641 v. Chr.) | |
|
IV.
|
König Ancus Marcius (641–617 v. Chr.) | |
|
V.
|
König Tarquinius Priscus (617–578 v. Chr.) | |
|
VI.
|
König Servius Tullius (578–534 v. Chr.) | |
|
VII.
|
König Tarquinius Superbus (534–510 v. Chr.) | |
| Rom als Republik. | ||
|
VIII.
|
Brutus, erster Konsul der Römer (506 v. Chr.) | |
|
IX.
|
Krieg mit König Porsenna | |
|
X.
|
Innerer Zwist. Menenius Agrippa und C. Marcius Coriolanus | |
|
XI.
|
Untergang der Fabier (477 v. Chr.) | |
|
XII.
|
Appius Claudius und die Decemvirn (451–449 v. Chr.) | |
|
XIII.
|
M. Furius Camillus. Einbruch der Gallier | |
|
XIV.
|
Titus Manlius Torquatus. Marcus Valerius Corvus. — M. Curtius | |
|
XV.
|
Die Tribunen Licinius und Sextius. Gleichstellung der Plebs | |
|
XVI.
|
Die zwei ersten Samniterkriege. — P. Decius. — Papirius Cursor. — Der Samniter Pontius | |
|
XVII.
|
Der Krieg mit den Latinern und der dritte Samniterkrieg. Titus Manlius. Die beiden Decius Mus | |
|
XVIII.
|
Pyrrhus, König von Epirus | |
|
XIX.
|
Der erste punische Krieg (264–241). Gajus Duilius. M. Atilius Regulus | |
|
XX.
|
Der zweite punische Krieg (219–201). Hannibal. | |
| 1. Hannibals erstes Auftreten | ||
| 2. Hannibals Zug nach Italien | ||
| 3. Hannibals Siege am Ticinus und an der Trebia | ||
| 4. Schlacht am trasimenischen See | ||
| 5. Hannibal gegen Fabius Cunctator | ||
| 6. Die Schlacht bei Cannä (216) | ||
| 7. Hannibal und Marcellus | ||
| 8. Hannibal und Scipio. Schlacht bei Zama (202) | ||
| 9. Hannibals und Scipios Ausgang | ||
|
[S. viii]
XXI.
|
Kriege gegen Makedonien. — Ämilius Paulus. — Scipio Africanus der Jüngere. — Karthagos Zerstörung | |
|
XXII.
|
Die beiden Gracchen | |
|
XXIII.
|
Gajus Marius. — Jugurtha. — Cimbernkrieg | |
|
XXIV.
|
Der erste Bürgerkrieg. Sulla und Marius. | |
| 1. Sulla, Feldherr gegen Mithridates, vertreibt den Marius | ||
| 2. Flucht des Marius | ||
| 3. Sullas Krieg gegen Mithridates | ||
| 4. Cinna in Rom. Marius’ Rückkehr und Tod | ||
| 5. Sullas Rückkehr und Proskriptionen. Sein Tod | ||
|
XXV.
|
Pompejus Magnus. | |
| 1. Sein erstes Auftreten | ||
| 2. Pompejus gegen Sertorius | ||
| 3. Pompejus besiegt die Reste des Sklavenaufstandes | ||
| 4. Pompejus besiegt die Seeräuber | ||
| 5. Pompejus in Asien | ||
|
XXVI.
|
Cicero | |
|
XXVII.
|
Julius Cäsar. Der zweite Bürgerkrieg. | |
| 1. Cäsar bis zum Kampfe gegen Pompejus | ||
| 2. Cäsars Kampf gegen Pompejus (49–48) | ||
| 3. Cäsar in Afrika. Catos Tod | ||
| 4. Cäsars fernere Taten und Tod | ||
|
XXVIII.
|
Der dritte Bürgerkrieg. Marcus Antonius und Cäsar Octavianus | |
|
XXIX.
|
Cäsar Octavianus als Augustus. | |
| 1. Augustus’ Regierung (30 v. Chr.–14 n. Chr.) | ||
| 2. Kriege gegen die Deutschen. Arminius, Deutschlands Befreier | ||
|
XXX.
|
Kaiser Tiberius (14–37 n. Chr.) | |
|
XXXI.
|
Die Kaiser Gajus Caligula (37–41) und Tiberius Claudius Cäsar (41–54) | |
|
XXXII.
|
Nero (54–68) | |
|
XXXIII.
|
Flavius Vespasianus (69–79). Seine Söhne Titus (79–81) und Domitianus (81–96) | |
|
XXXIV.
|
Die glücklichste Periode der römischen Kaiserherrschaft: Nerva, Trajanus, Hadrianus und die beiden Antonine (96–180) | |
|
XXXV.
|
Bis zum Ausgange des weströmischen Reiches (180–476) | |
Das römische Reich (imperium Romanum), das zur Zeit der Geburt Christi alle Länder am Mittelmeer umfaßte und später sich noch weiter nach Norden und Osten ausdehnte, ist benannt nach der Stadt Rom (Roma), in der es seinen Ursprung und bis zum Beginn des Mittelalters seine Hauptstadt hatte. Wann und wie diese Stadt entstanden ist, weiß man nicht mit Gewißheit. Die Römer selber setzten die Zeit ihrer Gründung in das Jahr 754 vor Christi Geburt, und nannten ihren Gründer und ersten Beherrscher Rómulus.
Ihre Lage war trefflich gewählt, sowohl zum Verkehr mit dem Binnenlande als mit dem Meere. Da wo die Tiber (Tiberis), der an sich nicht bedeutende, aber unter allen Flüssen des mittleren und unteren Italiens bedeutendste Fluß, seinen raschen Lauf zwischen Bergen und Hügeln beendet und in den flachen Küstenrand hinaustritt, an einer Stelle, die in alter Zeit auch Seeschiffe erreichen konnten, drei Meilen vom Meer, lagen die ältesten Teile der Stadt auf den Hügeln an der linken Flußseite. Ihr Gebiet gehörte zu der fruchtbaren teils hügeligen, teils ebenen Landschaft Látium, der heutigen Campagna, über welche sie zuerst ihre Herrschaft ausdehnte. Diese Landschaft bewohnten die Latiner (Latini), ein Volksstamm, der nach Abstammung, Sprache und Sitten verwandt war mit den andern umwohnenden Stämmen des mittlern Italiens, den Umbrern, Marsern, Sabinern, Volskern, Samniten oder Sabellern, Oskern. Alle diese Stämme, unter denen neben dem latinischen der samnitische der angesehenste war, gehörten einem Volke an, das mit dem hellenischen oder griechischen stammverwandt war und ein Glied jener alten Völkerfamilie bildete, zu der die Inder, Perser, Germanen, Kelten und Slaven gezählt werden.
Aber nicht alle Nachbarn Roms waren gleichen Stammes. Nordwestlich von Latium, zwischen dem Meer und den umbrischen Bergen, im heutigen Toskana, und jenseits des Apennin bis in die Ebenen des Po (Padus) saß das mächtige, betriebsame Volk der Etrusker oder Etrurier (Tusci), über dessen Sprache und Herkunft man noch nichts sicheres weiß.
An den Küsten des südlichen Italiens, in den fruchtbaren Landschaften Campanien, Lucanien, Bruttium und Calabrien, hatten sich seit alter Zeit zahlreiche griechische Einwanderer angesiedelt, deren Städte zu solcher Blüte gelangten, daß man diesen Teil Unteritaliens als das „Große Griechenland“ (Graecia magna) bezeichnete.
Der Name Italien (Italia) selbst war ursprünglich auf die kleine Landspitze beschränkt, welche der Insel Sicilien gegenüber liegt, und wurde erst allmählich auf die nördlichen Landschaften, zuletzt auch auf das Gebiet zwischen Apennin und Alpen ausgedehnt.
Rom blieb in den ersten Jahrhunderten seiner Geschichte den Griechen fast unbekannt. Um die Zeit, da Athen die Welt mit dem Glanz seiner Macht und seiner Bildung erfüllte, wußten die griechischen Geschichtschreiber noch nichts von der zukünftigen Beherrscherin der Welt zu berichten. Und da die Römer selber erst verhältnismäßig spät, seit dem dritten Jahrhunderte vor Christi Geburt, anfingen sich eine höhere Bildung anzueignen und Schriften über ihre Geschichte zu verfassen, so sind die Nachrichten über die früheren Zeiten lückenhaft und unsicher geblieben. Insbesondere ist das meiste von dem, was spätere römische und griechische Geschichtschreiber über die Gründung der Stadt und die Jahrhunderte der Königsherrschaft zu erzählen wußten, teils dunkle und ungewisse Sage, teils willkürliche Erdichtung.
ei der Zerstörung Trojas war Änēas, der Sohn des Anchīses und der Göttin Venus, dem allgemeinen Verderben entronnen. Göttersprüchen vertrauend, durchsegelte er mit seinen Gefährten das weite Meer, um sich im fernen Westen eine neue Heimat zu suchen. Nach jahrelangen Irrfahrten, auf denen er wunderbare Abenteuer und Mühseligkeiten aller Art zu bestehen hatte, landete er endlich an der Westküste Italiens, südlich von der Tibermündung, in der Landschaft Latium. Hier wohnten die Aboriginer (d. h. Ureinwohner), über welche König Latīnus herrschte. Die göttliche Abkunft des Äneas, sein mit Heldenmut und frommer Zuversicht ertragenes Geschick, die wackere Haltung seiner Genossen, und ihre Bitte im Lande bleiben zu dürfen, bewogen den König die Fremdlinge freundlich aufzunehmen und nicht lange nachher dem Äneas seine Tochter Lavinia zur Gattin zu geben. Dieser baute eine Stadt, die er nach dem Namen seiner Gattin Lavinium nannte. Aber der Bund des Königs mit den Fremden hatte alsbald eine harte Probe zu bestehen. Turnus, König der benachbarten Rútuler, dem Lavinia früher verlobt gewesen, ertrug es nicht, daß ihm der heimatlose Äneas vorgezogen worden, und beschloß Rache zu nehmen. Es kam zum Krieg, auf der einen Seite stand Turnus mit seinen Rutulern, auf der andern die Aboriginer und Trojaner unter Latinus und Äneas. Turnus ward geschlagen, aber die Trojaner und Aboriginer hatten den Verlust des Latinus, der im[S. 4] Treffen geblieben war, zu beklagen. Nun ward Äneas König und verband Trojaner und Aboriginer, die einander an Treue und Liebe zu ihrem Herrscher nichts nachgaben, zu einem einzigen Volke unter dem Namen Latiner. Im Vertrauen auf die Zuneigung seines Volkes konnte Äneas der Erneuerung des Kampfes ruhig entgegensehen. Denn Turnus, an seiner eigenen Kraft verzweifelnd, hatte sich mit Mezentius, dem König der damals mächtigen Etrusker, verbunden, und beide drohten dem neuen Staate den Untergang. Auch in diesem Kriege waren die Latiner siegreich; aber wiederum hatten sie den Sieg mit dem Verlust ihres Königs erkauft: Äneas war im Kampfe gefallen.
Sein Volk erwies ihm göttliche Ehren; sein Sohn Ascánius folgte ihm in der Herrschaft. Unter ihm kam der Friede zwischen Latinern und Etruskern zustande, und die Tiber bildete fortan die Grenze beider Völker. Die von Äneas gegründete Stadt Lavinium blühte herrlich auf und faßte bald die Menge ihrer Bewohner nicht mehr. Da überließ Ascanius Lavinium seiner Mutter und gründete am Fuße des Albanerberges eine neue Stadt, die er Alba Longa nannte, wo seine Nachkommen als Könige über die ganze ringsum sich ausbreitende Landschaft herrschten.
Einer dieser Könige von Alba Longa, Procas, hinterließ zwei Söhne, von denen der ältere Númitor, der jüngere Amúlius hieß. Numitor folgte anfangs seinem Vater in der Regierung; doch bald verdrängte Amulius seinen Bruder, ließ dessen Sohn töten, die Tochter Rhea Silvia zur Priesterin der Göttin Vesta wählen, in deren Dienst sie unvermählt bis zum Lebensende verbleiben sollte. Denn er besorgte, daß ihre Kinder einst den Verlust des Thrones an ihm rächen könnten. Doch Rhea Silvia gebar zwei Knaben, Rómulus und Remus, als deren Vater die Sage den Kriegsgott Mars nannte. Auf diese Kunde befahl Amulius die Priesterin in den Fluß Anio zu stürzen, in dessen Fluten sie zur Göttin ward, die Zwillinge aber in die nahe Tiber zu werfen. Allein damals war gerade die Tiber über ihre Ufer getreten, und die königlichen Diener setzten die Knaben in einer Wanne in das ausgetretene Wasser am Fuße des Berges Palatium. Als sich das Wasser verlaufen hatte, blieb die Wanne auf dem Trockenen stehen. Da kam, durch das Gewimmer der Kinder herbeigelockt, eine Wölfin, die sich ihrer erbarmte und sie säugte,[S. 5] während ein Specht, des Mars heiliger Vogel, ihnen Speise zutrug. Dieses seltsame Schauspiel gewahrte Faústulus, ein Hirt der königlichen Herden, er sah darin eine göttliche Fügung, nahm die Kleinen und brachte sie seiner Frau, Acca Larentia, um sie zu ernähren und aufzuziehen. Er forschte ihrer Herkunft nach, erkannte, daß sie die Enkel des Numitor seien, schwieg aber aus Furcht vor der Rache des Königs.
So wuchsen Romulus und Remus unter den Hirten am Ufer der Tiber zu rüstigen Jünglingen heran, und übten gemeinsam mit den Hirtensöhnen ihre Kraft in der Jagd auf wilde Tiere, bald auch in Angriffen auf die in der Nachbarschaft hausenden Räuber, denen sie ihre Beute entrissen. Darüber aufgebracht, stellten die Räuber den Brüder nach, und eines Tages, als die Hirten sich den Freuden eines Festes hingaben, gelang es ihnen beide zu überfallen. Romulus schlug sich durch; den Remus führten sie gefangen zum König, unter der Anklage, daß er mit seinem Bruder die Herden des Numitor beraubt habe. Der König übergab deshalb den Gefangenen seinem Bruder, dem Numitor, den er einst vom Thron gestoßen hatte, zur Bestrafung. Diese Gelegenheit benutzte Faustulus, um das über der Herkunft der beiden Jünglinge ruhende Geheimnis ihrem Großvater zu offenbaren.
Als Numitor seine Enkel anerkannt hatte, faßten diese den Entschluß, an Amulius Rache zu nehmen. Sie drangen auf verschiedenen Wegen in die Stadt Alba Longa, griffen die Königsburg an, erschlugen den Amulius, und setzten ihren Großvater wieder als König ein.
Nun beschlossen beide Brüder auf dem Palatium, dem Orte, wo sie ausgesetzt und erzogen worden waren, eine neue Stadt zu gründen. Zahlreiche Jünglinge aus Alba Longa und anderen latinischen Städten, auch ihre Gespielen unter den Hirten sammelten sich unter ihrer Führung. Aber schon bevor die Stadt erbaut war, erhob sich über ihre Benennung und Beherrschung zwischen beiden Brüdern ein heftiger Streit, dessen Entscheidung sie den Göttern anheimstellten. Aus dem Fluge der Vögel suchten sie, nach landesüblichem Brauche, den Willen der Götter zu erkennen. Zu diesem Zwecke begab sich Romulus auf den palatinischen, Remus auf den nahe gelegenen aventinischen Berg. Zuerst erschienen dem Remus sechs Geier. Allein kaum hatte er dieses Zeichen dem Romulus gemeldet, als diesem zwölf Geier erschienen und zugleich Blitz und[S. 6] Donner folgten. Da entstand ein neuer Streit, weil jeder sein Zeichen für das bessere hielt; Remus, weil er zuerst sechs Geier gesehen hatte, Romulus, weil ihm die doppelte Anzahl erschienen war. Von Worten kam es zum Kampf, und Remus fiel im Getümmel. Eine andere Sage berichtet, Remus sei, um seinen Bruder zu verhöhnen, über die noch niedrigen Mauern der neuen Stadt gesprungen, und deshalb habe ihn Romulus mit den Worten erschlagen: „So geschehe jedem, der über meine Mauern springt!“
Als Jahr der Gründung Roms galt bei den späteren Römern das Jahr 754 vor Christi Geburt, und der 21. April, an dem das Hirtenfest der Palilien gefeiert wurde, als der Stiftungstag.
Um die Bevölkerung der neuen Stadt zu vermehren, eröffnete Romulus eine Freistätte (Asyl) für heimatlose Leute jeder Art, und nun strömten zahlreiche Haufen von Verbannten, Verbrecher und Schuldlose, Freie und Knechte, nach Rom. Aus der ganzen Bevölkerung wählte der König die hundert Ältesten und Angesehensten und bildete aus ihnen einen Senat (senatus, „Rat der Alten“), um mit ihm die gemeinsamen Angelegenheiten zu beraten und zu leiten. Auch sorgte er für die notwendigsten Gesetze und für Einrichtung des Götterdienstes.
Aber noch fehlte es der neuen Stadtgemeinde an Frauen. Um diese zu erhalten, schickte Romulus an die benachbarten Gemeinden Gesandte und ließ sie bitten mit seinem Volke eheliche Verbindungen einzugehen. Allein die Gesandten wurden überall mit Hohn abgewiesen und gefragt, warum zu Rom nicht auch eine Freistätte für heimatlose Frauen eröffnet würde. Diese Zurückweisung kränkte den Romulus; er beschloß durch List und Gewalt zu rauben, was man seinen Bitten abgeschlagen hatte. Er ließ ein Fest mit Kampfspielen zu Ehren des Meergottes Neptūnus veranstalten und alle Nachbarn dazu einladen. Und sie kamen, von der Schaulust getrieben, in großen Haufen mit ihren Weibern und Kindern, besonders zahlreich die Sabiner aus den benachbarten Tälern und Bergen des Apennin. Aber mitten unter den Spielen fielen die römischen Jünglinge mit bloßen Schwertern über die Fremden her, und während diese überrascht und erschrocken von dannen eilten, griff sich ein jeder der Römer eines der[S. 7] Mädchen und trug es als sein zukünftiges Weib nach seinem Hause.
Die verwegene Tat brachte alle Städte, die davon betroffen waren, unter die Waffen gegen die Räuber. Sie verbanden sich zu gemeinsamer Rache. Aber noch ehe die Sabiner völlig gerüstet waren, begannen die übrigen vereinzelt den Krieg, und Romulus schlug sie nach einander mit überlegener Macht.
Viel schwerer war der Kampf mit Titus Tatius, dem König der Sabiner. Dieser fiel nicht nur mit einem Heere von 25000 Mann zu Fuß und 1000 Mann zu Pferde in das römische Gebiet ein, sondern bemächtigte sich auch der auf dem Kapitolium gelegenen Burg durch folgende List. Tarpeja, die Tochter des Befehlshabers der Burg, war ausgegangen, um Wasser zu holen, und den Feinden in die Hände gefallen. Sie versprach ihnen die Burg zu öffnen, wenn ihr die Sabiner das gäben, was sie am linken Arm trügen. Sie meinte damit die goldenen Armbänder und Spangen. Nun trugen aber die Sabiner nicht nur diese, sondern auch ihre Schilde am linken Arm. Als daher Tarpeja den Feinden die Tore geöffnet hatte, sollen diese, um Betrug durch Betrug zu bestrafen, ihre Schilde über die Verräterin geworfen und sie so getötet haben. Von dieser Tarpeja ward in der Folge der steilste Teil des kapitolinischen Hügels der tarpejische Fels genannt, und noch heutzutage herrscht zu Rom der Volksglaube, die schöne Tarpeja hause tief im Berge verzaubert, mit Gold und Geschmeide bedeckt.
Am Tage nach der Besetzung des Kapitoliums rückten die Römer heran, die verlorene Burg wieder zu erobern; auch die Sabiner stiegen herab, und der Kampf begann. Nach heftigem Widerstand wichen endlich die Römer, und Romulus selbst ward von den Fliehenden fortgerissen. Da erhob er seine Hände gen Himmel und gelobte dem Jupiter, wenn er die Flucht der Seinigen hemme (Jupiter Stator), einen Tempel. Sofort standen die Römer und erneuerten das Treffen; der Sieg wandte sich auf ihre Seite. Da kamen die geraubten Sabinerinnen mit fliegenden Haaren und zerrissenen Kleidern herbei, stellten sich zwischen ihre Männer und Väter und machten durch ihre Tränen und Bitten dem Krieg ein Ende. Es kam zwischen beiden Völkern nicht nur zum Frieden, sondern auch zu einer festen Verbindung. Fortan sollten[S. 8] Römer und Sabiner zu einem Volke vereinigt sein, hundert Sabiner in den Senat aufgenommen werden und beide Könige gemeinschaftlich regieren. Die Bürger der so vereinigten Gemeinde hießen nun Quiriten (Quirītes). Sie bildeten nach ihrer Abkunft zwei Stämme (tribus), die römischen Ramnes und die sabinischen Tities, zu denen später ein dritter Stamm kam, die Lúceres, welcher die Bürger anderer Herkunft enthielt. Jeder der drei Stämme teilte sich in zehn Curien, jede Curie in zehn Decurien, und jede Decurie enthielt eine Anzahl Familien (gentes). Jede der dreihundert Decurien stellte einen „Vater“ (pater) in den Senat und einen Reiter (eques). Väter und Reiter (Ritter) bildeten die beiden vornehmsten Klassen der Bürgerschaft.
Doch bald war Romulus wieder Alleinherrscher, da Tatius bei einem Aufstand in Lavinium erschlagen ward. Nach dessen Tode hatte der kriegerische Romulus noch manchen Kampf mit den Nachbarn zu bestehen. In allen blieb er siegreich, und seine Stadt nahm stetig zu an Landbesitz und Kriegsmacht. Sein Ende hat die Sage wunderbar ausgeschmückt. Als er eines Tages Heerschau über das Volk hielt, da erhob sich plötzlich ein Sturm mit Donner und Blitz, eine schwarze Wetterwolke umhüllte den König und entzog dem Volke seinen Anblick, und fortan war Romulus auf Erden nicht mehr sichtbar. Der Kriegsgott selber, so hieß es, hatte den ruhmgekrönten Sohn auf feurigem Wagen gen Himmel gehoben. Dem Volke wußte nachher einer der Senatoren zu erzählen, wie ihm Romulus in göttlicher Gestalt erschienen sei und zu ihm, der anbetend dagestanden und nicht gewagt die Augen zu ihm zu erheben, gesagt habe: „Künde den Römern, daß ich unter die Himmlischen aufgenommen bin und fortan nicht mehr Romulus, sondern Quirīnus heiße. Die Götter wollen, daß meine Roma dereinst die Hauptstadt der Welt werde. Darum sollen die Römer den Krieg üben und gewiß sein, daß keine menschliche Macht ihren Waffen widerstehen kann.“ Mit diesen Worten habe er sich wieder zum Himmel erhoben.
Eine andere Nachricht erzählt, daß Romulus von den Senatoren, denen seine Herrschaft verhaßt gewesen, durch heimlichen Mord beiseite geschafft worden sei.
Nach des Romulus Tode dauerte es ein volles Jahr, bis die Wahl eines Königs zustande kam. Die Leitung des Staates führte inzwischen in wechselnder Folge je einer der Senatoren. Die Wahl fiel endlich auf einen Mann sabinischen Stammes, aus der sabinischen Stadt Cures, den Eidam des Königs Tatius, Numa Pompilius, der in dem Ruf großer Weisheit und Gerechtigkeit, friedliebenden Sinnes und tiefer Einsicht in alle göttlichen und menschlichen Dinge stand.
Wie Romulus den jungen Staat mit Waffengewalt gegründet und befestigt hatte, so gedachte Numa ihn auf der festen Grundlage göttlichen und menschlichen Rechtes gleichsam neu zu gründen.
Nachdem er zuvörderst mit allen Nachbaren Frieden und Freundschaft hergestellt, war seine vorzüglichste Sorgfalt darauf gerichtet, die durch steten Krieg verwilderten Sitten der Römer zu mildern und ihren kriegerischen Sinn zu besänftigen. Das beste Mittel, um dies zu erreichen, sah er in einer neuen Ordnung des Götterdienstes. Dabei bediente er sich geschickt des verbreiteten Gerüchtes, daß er sich der besonderen Gunst einer vor den Toren der Stadt in einer Grotte hausenden weisen Nymphe, der Egéria, erfreue, die ihm bei allen seinen Einrichtungen ratend zur Seite stände. Als Aufseher und Leiter des ganzen Götterdienstes bestellte er das Kollegium der Priester (pontífices), an deren Spitze der König selbst als Oberpriester (póntifex máximus) stand. Den Vogelschauern (aúgures) erteilte er das Amt, aus dem Fluge der Vögel, aus Donner und Blitz und dem Fressen der heiligen Hühner die Zukunft und den Willen der Götter zu erforschen. Die Eingeweideschauer (harúspices) untersuchten die Eingeweide der Opfertiere und deuteten daraus auf Glück oder Unglück. Die Zahl der Vestalinnen, der heiligen Jungfrauen, denen die Sorge für das Herdfeuer im Tempel der Vesta oblag, vermehrte er auf vier. Dem Janus, einem Gotte, der mit doppeltem, nach entgegengesetzten Seiten gewandtem Gesicht und einem Schlüssel in der Hand dargestellt wurde, baute er einen Tempel, der in Kriegszeiten offen stehen, im Frieden aber geschlossen sein sollte. Unter Numa selbst, dessen 43jährige[S. 10] Regierung in ungestörtem Frieden verlief, blieb er stets geschlossen. Nach Numa ist dies während der ganzen Dauer der römischen Republik nur zweimal wieder der Fall gewesen, das eine Mal nach Beendigung des ersten punischen Krieges, und dann wieder im Anfang der Regierung Augustus, des ersten Kaisers. Auch für das bürgerliche Leben traf Numa zweckmäßige Einrichtungen, wie er denn das Jahr, das bis dahin nur zehn Monate hatte, in zwölf Mondmonate einteilte und es durch Einführung von Schalttagen mit dem Sonnenlaufe in Übereinstimmung brachte.
Hochgeehrt und geliebt nicht nur von seinem eigenen, sondern auch von den umwohnenden Völkern, starb der fromme König im 84. Lebensjahre.
Kurze Zeit nach seinem Tode wählte das Volk wieder einen König aus römischem Stamme, den kriegerischen Tullus Hostilius. Unter seiner Regierung ward Alba Longa, Roms Mutterstadt, zerstört. Die Veranlassung zu diesem Kriege war folgende.
Albanische Hirten hatten im römischen, römische im albanischen Gebiete Raub begangen. Von beiden Seiten wurden Gesandte abgeordnet, um Genugtuung zu fordern. Aber mit dieser Forderung kamen die römischen Gesandten den albanischen zuvor, sodaß, da die Albaner die Genugtuung verweigerten, die Schuld des Krieges ihnen zur Last fiel. Beide Teile rüsteten sich dazu mit aller Macht. Als die Heere einander in Schlachtordnung gegenüber standen, machte Mettius Fuffétius, der Führer der Albaner, dem römischen König den Vorschlag, den Krieg durch einen Kampf Weniger entscheiden zu lassen. Beide Teile stimmten zu. Nun traf es sich, daß in jedem Heere Drillingsbrüder standen, drei Horatier im römischen, drei Curiatier im albanischen. Diese wurden für den entscheidenden Kampf bestimmt und waren dazu freudig bereit. Zuvor aber ward ein feierlicher Vertrag abgeschlossen, daß dasjenige Volk, dessen Vorkämpfer siegen würden, über das andere herrschen sollte.
Zwischen beiden Heeren wurde eine Ebene zum Kampfplatz bestimmt, und mit Blumen bekränzt und unter lautem Zuruf der Ihrigen gingen die jungen Vorkämpfer mit dem Schwerte in der Faust aufeinander los. Nicht die eigene Gefahr, nur das Schicksal ihres Vaterlandes schwebte ihnen vor Augen. Bei beiden Heeren herrschte bange Furcht und allgemeine Stille. Kaum aber waren sie handgemein, kaum hatten die Bewegungen mit den Schilden und Schwertern und das aus den Wunden strömende Blut die Augen der Zuschauer auf sich gezogen, als schon zwei Römer, einer über den andern, tot zur Erde stürzten. Bei ihrem Fall erhob das albanische Heer ein Freudengeschrei, während die römische Legion, fast hoffnungslos, das Schicksal ihres einzigen noch übrigen Kämpfers mit steigender Angst erwartete. Zum Glück war dieser noch unverwundet, und also zwar den Gegnern, obwohl sie alle drei verwundet waren, wenn sie vereinigt blieben, nicht gewachsen, aber noch siegesmutig genug, um es mit jedem besonders aufzunehmen. Um sie also zu trennen, nahm er die Flucht, indem er voraussah, daß ihm jeder nur so geschwind folgen würde, als es seine Wunden gestatteten. Schon hatte er sich etwas aus den Grenzen des Kampfplatzes entfernt, als er sich umwandte und seine Gegner in weiten Zwischenräumen ihm nacheilen sah. Einen aber erblickte er nicht weit hinter sich und ging sofort auf ihn los. Bald hatte er ihn erlegt und drang auf den zweiten ein. Da erhoben die Römer ein Freudengeschrei, um ihren Vorkämpfer zu ermuntern, der denn auch den zweiten Curiatier zu Boden streckte, noch ehe ihm der dritte zu Hilfe kommen konnte. Nun waren die Parteien zwar noch an Zahl, aber nicht mehr an Hoffnung und Kräften gleich: der eine noch unverwundet, zwiefach Sieger, eilte voll Mut in den dritten Kampf, der andere aber, der seinen von Wunden und vom Lauf ermatteten Körper kaum fortschleppte, sah sich seinem Feinde als ein gewisses Schlachtopfer preisgegeben. Frohlockend rief der Römer: „Zwei habe ich dem Schatten meiner Brüder geopfert, den dritten weihe ich dem Preis dieses Kampfes, auf das Rom über Alba herrsche!“ Sprachs und stieß seinem Feinde, der kaum noch den Schild halten konnte, das Schwert in die Kehle, streckte ihn zu Boden und nahm ihm seine Rüstung. So wurde durch diesen Kampf Alba Longa der Herrschaft der Römer unterworfen.
Horatius kehrte an der Spitze des Heeres, mit den Rüstungen der erschlagenen Feinde als Beute und Zeichen seines Sieges, nach Rom zurück. Am Capenischen Tor begegnete ihm seine Schwester, die mit einem der Curiatier verlobt gewesen war. Als sie unter der Beute ihres Bruders auch das Gewand erblickte, das sie für ihren Bräutigam gewebt hatte, brach sie in laute Klagen und Verwünschungen gegen ihren Bruder aus. Darüber geriet Horatius in solche Wut, daß er die eigne Schwester niederstach. Wegen dieser blutigen Tat wurde er vor Gericht geladen und von den Richtern zum Tode verurteilt. Nur die Bitten, mit denen sich sein Vater an das Volk wandte, retteten den Schuldigen, und der König bestrafte ihn bloß dadurch, daß er ihn unter dem Schandjoch hergehen ließ.
Die Albaner aber unter Mettius Fuffetius ertrugen die Abhängigkeit von Rom mit Unwillen. Um ihre Selbständigkeit wieder zu gewinnen, suchten sie den König Tullus in einen Krieg zu verwickeln und reizten die Stadt Fidénä zum Abfall von Rom. Den Fidenaten leistete die etrurische Stadt Veji offene Hilfe, die Albaner aber versprachen heimlich, sie würden während der Schlacht zu ihnen übergehen. Als Tullus gegen die Fidenaten zu Felde zog, entbot er auch die Albaner zum Heerbann. Das römische Heer stellte er den Vejentern, das albanische den Fidenaten gegenüber. Aber Mettius Fuffetius zeigte sich im Kampfe untätig und schwankend, indem er zu denen überzugehen gedachte, auf deren Seite sich der Sieg neigen würde. So sahen denn die Albaner ruhig zu, wie die Römer allein, unter unaufhörlichem Gefecht, erst die Fidenaten, dann die Vejenter schlugen und einen vollständigen Sieg errangen. Als Fuffetius dem siegreichen Tullus Glück wünschte, empfing ihn der König scheinbar mit Güte und stellte sich, als habe er dessen treuloses Spiel nicht bemerkt, bestellte aber beide Heere auf den folgenden Tag zu einer Versammlung. Zuerst erschienen unbewaffnet die Albaner; das römische Heer stellte sich bewaffnet ringsum. Darauf enthüllte Tullus in einer an beide Heere gerichteten Rede den Verrat des Fuffetius und verkündigte seine und seines Volkes Strafe. Fuffetius selbst ward auf zwei Wagen festgebunden, deren Gespanne, nach verschiedenen Richtungen getrieben, seinen Körper in zwei Stücke zerrissen. Die Stadt aber der Albaner wurde zerstört, ihre Bewohner mußten nach Rom ziehen, wo ihnen der cölische[S. 13] Hügel (mons coelius), nahe dem palatinischen südwärts gelegen, zu Wohnstätten angewiesen wurde.
Auch in einem Kriege gegen die Sabiner focht Tullus glücklich; aber das Ende seiner Regierung ward durch manche unheilverkündende Zeichen und Unfälle getrübt. Auf dem Albanerberge regnete es Steine, und aus dem dortigen Hain erscholl eine Stimme, die über die Vernachlässigung des Gottesdienstes klagte. Eine Seuche brach aus, an der Tullus selbst erkrankte. Voll Mißmut ergab er sich allen Arten von Aberglauben. Einst fand er in den Büchern des Numa einen Zauberspruch, mit dem man den Jupiter vom Himmel herabzubannen glaubte. Aber der König beging in der Anwendung des Spruches einen Fehler; der empörte Gott fuhr in einem Wetterstrahl herab, der den König samt seinem Hause verbrannte.
Der vierte König der Römer war Ancus Marcius, ein Tochtersohn des Numa Pompilius. Wie sein Großvater im Innern, so war er darauf bedacht nach außen, in den Verhältnissen zu den meist feindlichen Nachbarvölkern, eine feste, auf Recht und Gerechtigkeit gegründete Ordnung herzustellen. Kein Krieg wurde erklärt und begonnen, ohne zuvor dem Feinde Gelegenheit und Frist zu friedlichem Austrage des Streites zu geben, kein Friede geschlossen ohne Beobachtung bestimmter heiliger Gebräuche. Für beides hatten die sogenannten Fetialen zu sorgen, angesehene Männer, welche mit dem Rechte des Krieges und Friedens wohl vertraut waren. Auch auf die innere Wohlfahrt verwandte dieser König eifrige Sorge. Er legte die Hafenstadt Ostia an der Mündung der Tiber an, baute eine Pfahlbrücke über diesen Fluß zum Janiculum hinüber, und siedelte auf dem Aventinus die Plebejer (die Plebs) an, die aus der Menge der zugewanderten oder aus den besiegten Ortschaften verpflanzten Bewohner bestanden und den altbürgerlichen Geschlechtern, den Patriziern, gegenübertraten, aber keinen Anteil an der Verwaltung des Staates besaßen. Somit waren schon fünf Hügel bebaut, der[S. 14] palatinische von den ersten Ansiedlern, der quirinalische von den Sabinern, der coelische von den Albanern, der aventinische von den Plebejern, während das Capitolium, zwischen dem Palatinus und Quirinalis, als Burg der Stadt und Stätte der Haupttempel, nicht bewohnt werden durfte.
Unter der Regierung des Ancus Marcius kam ein gewisser Lúcumo nach Rom. Er war der Sohn des Korinthiers Damarātus, der, aus seiner Vaterstadt vertrieben, sich nach Tarquinii, einer Stadt in Etrurien, begeben und daselbst durch seine Reichtümer Ansehen erlangt hatte. Von Jugend auf durch das Glück begünstigt, hatte Lúcumo, der einzige Erbe aller Reichtümer seines Vaters, die Tochter eines vornehmen Bürgers seiner neuen Heimat, die Tanaquil geheiratet, die, wie viele ihres Volkes, der Weissagung kundig war. Indessen konnte er doch als Ausländer in Tarquinii zu keinen hohen Ehrenstellen gelangen. Dies schmerzte die stolze Tanaquil so sehr, daß sie ihren Gemahl bat die Stadt zu verlassen und nach Rom zu ziehen. Lucumo, selbst von Ehrgeiz und Ruhmsucht gespornt, willfahrte ihr, und so machten sich beide auf die Reise nach Rom.
Als sie nicht mehr weit von dieser Stadt entfernt waren, fuhr ein Adler herab, nahm dem Lucumo den Hut vom Haupte, erhob sich in die Lüfte und setzte ihn ihm bald nachher wieder auf. Tanaquil sah in diesem Ereignis eine glückliche Vorbedeutung und erfüllte ihren Gemahl mit der Hoffnung, daß ihm in Rom die Herrschaft zufallen würde. Und diese Hoffnung täuschte sie nicht. Denn Lucumo, der in Rom den Namen Lucius Tarquinius angenommen hatte, erwarb sich bald durch Leutseligkeit und Freigebigkeit die Liebe und Achtung seiner neuen Mitbürger. Die Kunde von ihm gelangte auch an den Hof. Der König Ancus Marcius gewann den reichen Etrusker lieb und bediente sich seines Rates und Beistandes in allen Angelegenheiten; ja er bestellte ihn sogar vor seinem Tode zum Vormund seiner Kinder. Als aber Ancus starb, sandte Tarquinius dessen beide Söhne zur Zeit, als die Wahl des neuen Königs vollzogen werden sollte, auf die Jagd; er selbst bat in der Versammlung das Volk, das er an die vielen von ihm erhaltenen Wohltaten erinnerte, um die Königswürde. Das Volk willfahrte seiner Bitte, und Tarquinius ward König. Er erhielt später, zum Unterschied von seinem gleichnamigen Nachfolger, den Beinamen Priscus (der Alte).
Um sich zum Kriege gegen die Sabiner zu rüsten, wollte Tarquinius den bisherigen drei Abteilungen (Centurien) der Reiter noch drei neue Centurien mit neuen Namen hinzufügen. Aber einer der Augurn, Attus Navius, erklärte, dies könne nicht eher geschehen, als bis die Augurn mit ihrer Kunst den Willen der Götter erforscht hätten, denn jede Einrichtung des Staates, welche unter Befragung der Vogelzeichen (Auspicien) getroffen sei, dürfte nicht ohne neue Befragung geändert werden. Dieser Ausspruch des Augurn verdroß den eigenmächtigen Sinn des Königs, und er beschloß seine Sehergabe auf eine Probe zu stellen. Spöttisch fragte er ihn: „Kann das geschehen, was ich in diesem Augenblicke denke?“ „Gewiß“, antwortete der Augur, nachdem er darüber die Auspicien befragt hatte. „Wohlan“, rief der König, „so zerschneide mir diesen Kiesel mit einem Schermesser.“ Und ohne Zögern — so berichtet die Sage — vollbrachte der Augur das Wunder, und der König sah sich genötigt von seinem Vorhaben abzustehen. Indessen verdoppelte er doch die Anzahl der vorhandenen Reiter, obgleich er keine neuen Centurien bildete, sondern die alten Namen beibehielt. Dieser Vorfall erhob das Ansehen der Augurn außerordentlich, und noch in späteren Zeiten sah man zu Rom die Bildsäule des Attus, unter welcher der zerschnittene Stein vergraben liegen sollte. — Auch den Senat vermehrte der König auf 300 Mitglieder.
Die reiche Beute aus seinen glücklichen Kriegen gegen die Sabiner und Latiner, sowie die Einnahmen aus dem ihnen entrissenen Landbesitz verwandte der König auf großartige Bauten. Durch mächtige unterirdische Kanäle (Kloaken), von denen der größte noch heute benutzt wird, ließ er die sumpfigen Niederungen zwischen den Hügeln trocken legen und eine derselben, zwischen Palatin und Capitol, zum Markt- und Gerichtsplatz (forum) einrichten. In einer anderen, auf der westlichen Seite des Palatin bis zum Aventin, legte er den Circus Maximus an, einen weiten, ovalen, rings von Bühnen für die Zuschauer umgebenen Platz für Wagen- und Pferderennen und Gladiatorenkämpfe. Die Stadt schloß er mit einer Mauer[S. 16] von Backsteinen ein und begann den Bau des Tempels des capitolinischen Jupiter.
Aber ein blutiges Ende beschloß seine Regierung. Die Söhne des früheren Königs konnten es nicht vergessen, daß er sie durch List um ihr väterliches Erbe gebracht hatte. Ja, sie mußten sogar fürchten, daß der Schwiegersohn des Königs, Servius Tullius, nach ihm zur Regierung gelangen würde. Sie machten deshalb den Anschlag, den König zu töten und sich des Thrones zu bemächtigen. Sie stifteten zwei Hirten zum Meuchelmorde an. Diese gingen mit Äxten, die sie zu tragen gewohnt waren, in den königlichen Palast, fingen daselbst Streit an und verlangten, daß der König ihn schlichten sollte. Tarquinius ließ sie vor sich kommen, um ihre Sache zu hören. Anfangs suchten beide durch ihr Geschrei den König zu verwirren, doch Tarquinius befahl, daß einer nach dem anderen reden sollte. Als sich nun der König, ohne etwas Arges zu ahnen, aufmerksam zu dem einen hinwandte, versetzte ihm der andere mit der Axt einen tödlichen Schlag, daß er entseelt zu Boden sank.
Allein die Söhne des Ancus erreichten ihre Absicht nur halb. Sobald nämlich der König getötet worden war, ließ Tanaquil, die Königin, die königliche Burg verschließen und forderte den Servius Tullius auf sich der Herrschaft zu versichern. Darauf öffnete sie das Fenster und kündete selber dem Volke, das sich auf die Nachricht von dem Mordanfall vor dem Palaste versammelt hatte, Tarquinius lebe noch und befehle dem Volke, inzwischen seinem Eidam zu gehorchen. Darauf trat dieser in königlicher Kleidung und von Amtsdienern (Lictoren) umgeben hervor, um, wie er vorgab, die Stelle des noch lebenden Königs zu vertreten. Als nach einigen Tagen der Tod des Königs bekannt wurde, fiel es dem Servius nicht schwer den Thron zu behaupten, den er zwar mit Bewilligung des Senats, aber nicht mit Beistimmung des Volkes in Besitz nahm. Die Söhne aber des Ancus waren bereits von den ergriffenen Mördern als Anstifter der Tat verraten und, mutlos geworden, aus der Stadt entflohen und fanden in der Fremde ein ruhmloses Ende.
Der neue König war von unfreier Herkunft. Unter der Regierung des Tarquinius Priscus, so wird erzählt, eroberten die Römer die sabinische Stadt Corniculum. Hierbei ward Tullus, einer der angesehensten Bürger der Stadt, getötet, und seine Frau als Gefangene nach Rom abgeführt. Im Hause des Königs gebar sie einen Knaben, der wegen der Knechtschaft, in welche seine Mutter geraten war, Servius (von servus „Knecht“), nach seinem Vater aber Tullius genannt wurde und unter dem Gesinde der Königin aufwuchs. Da geschah es, daß in einer Nacht, während das Kind schlief, plötzlich ein heller Flammenschein sein Haupt umloderte. Tanaquil, die solche Dinge zu deuten verstand, verbot den Dienern das Feuer zu löschen, und es verschwand von selbst, als der Knabe erwachte. Von dieser Zeit an glaubten der König und die Königin, der junge Servius sei zu hohen Dingen berufen, und nahmen ihn an Kindes Statt an. Er ward in allen edlen Künsten unterrichtet, und da sich seine Gaben vortrefflich entwickelten, gab ihm der König seine eigene Tochter zur Ehe. Wie er nach dem Tode des Tarquinius Priscus selbst König wurde, ist bereits erzählt worden.
Unter seiner Regierung erhielt die Stadt ihre letzte Erweiterung und einen neuen Mauerring. Er zog die zwei letzten der sieben Hügel, von denen Rom die „Siebenhügelstadt“ genannt wird, den Esquilinus und den Viminalis, die auf der Ostseite der Stadt lagen, in ihren Umkreis, und umgab das Ganze mit einer Mauer aus mächtigen Quadersteinen, wovon noch heute einzelne Reste das Staunen der Beschauer erregen.
Nach außen wußte er durch kluge und friedliche Verhandlungen mit den anderen noch selbständigen latinischen Städten für Rom die erste Stelle in ihrem Bunde zu gewinnen, und sie zu bewegen auf dem Aventin einen gemeinsamen Tempel der Göttin Diana zu erbauen. Ja, durch eine List des Priesters dieses Tempels gelang es, wie eine Sage ging, auch den Anspruch auf die Oberherrschaft über ganz Latium für Rom zu gewinnen. Ein Sabiner nämlich trieb einst ein Rind von ungewöhnlicher Größe und Schönheit nach Rom, um es[S. 18] daselbst im Tempel der Diana zu opfern, in der festen Überzeugung, daß er dadurch, nach dem Ausspruch der Seher, seiner Vaterstadt die Obergewalt verschaffen würde. Denn die Augurn hatten gesagt, daß dasjenige Volk die Oberherrschaft erhalten sollte, dessen Bürger jenes Rind der Diana opfern würden. Allein dieser Ausspruch war auch zu den Ohren jenes römischen Priesters gekommen, und dieser suchte sich des Opfers zu bemächtigen. Er befahl dem Sabiner sich vor dem Opfer in fließendem Wasser zu baden, aber während der Sabiner dies tat, opferte der Priester selber das Rind.
Die größte Tätigkeit wandte Servius den inneren Angelegenheiten zu. Er ordnete eine allgemeine Schatzung (Census) und Musterung des Volkes an, welche fortan alle fünf Jahre vollzogen werden sollte. An dem dazu bestimmten Tage erschienen alle wehrfähigen Bürger auf der vor dem Capitol sich nordwärts erstreckenden Ebene vor der Stadt, dem später sogenannten Marsfelde (campus Martius). Da mußte jeder seinen und seines Vaters Namen, Alter, Wohnort und Vermögen eidlich angeben. Nach der Verschiedenheit des Vermögens wurde die gesamte Bevölkerung Roms, Patrizier und Plebejer, in fünf Klassen, diese wieder in eine Anzahl Centurien eingeteilt, so daß auch die Plebejer das Recht erhielten die Waffen zu führen und in der nach Centurien geordneten und stimmenden Volksversammlung (comitia centuriata) mitzustimmen. Mit dem 17. Jahre wurde der Bürger in die Bürgerlisten eingetragen. Nach geendigter Schatzung stellte sich die ganze Bürgerschaft bewaffnet auf dem Marsfeld zur großen Heerschau; dann wurden unter Gebeten drei Tiere, ein Schwein, ein Schaf und ein Rind, um das ganze Volk dreimal herumgeführt und darauf geopfert, zur Sühne aller Sünden, die das Volk in den letzten fünf Jahren begangen hatte.
Nach der Schatzung richtete sich die Steuer, die jeder Bürger zu entrichten hatte, und der Kriegsdienst. Alle Bürger waren kriegspflichtig; vom 17. bis 46. Jahre dienten sie im Felde, vom 46. bis 60. Jahre als Besatzung der Stadt. Die Bürger der ersten Klasse waren mit einem Helme, Panzer, großem Schilde und Beinschienen von Erz gerüstet, und führten als Waffen Speer und Schwert. In der Schlacht standen sie, als die am schwersten Bewaffneten, in der ersten Linie. Die Bürger der zweiten Klasse hatten keinen Panzer und einen kleinen Schild, sonst alles wie jene; sie standen in der zweiten[S. 19] Linie. Die in der dritten Klasse, welche in der dritten Linie standen, waren gerüstet wie die in der zweiten, nur fehlten die Beinschienen. Die Bürger der vierten Klasse hatten außer einem kleinen Schilde gar keine Schutzwaffen, sie führten Speer und Wurfspieß und standen in der letzten Linie. Die der fünften endlich dienten als Schleuderer und standen außerhalb der Linie. Alle mußten sich Rüstung, Waffen und Unterhalt aus eigenen Mitteln beschaffen; nur den Rittern gab der Staat Geld zum Ankauf eines Streitrosses, sowie zum Unterhalt desselben und eines Reitknechts nebst dessen Pferde.
Durch alle diese Einrichtungen, die neue Ordnung und Einigung des Volkes, die Erweiterung und Befestigung der Stadt, die Stellung, welche Rom an der Spitze der latinischen Städte einnahm, erwarb sich der König die Liebe und Dankbarkeit der Römer und machte den unberechtigten Ursprung seiner Herrschaft vergessen. Gleichwohl traf ihn, nach 44jähriger glücklicher Regierung, ein schreckliches Ende.
Seine beiden Töchter hatte er mit den beiden Söhnen seines Vorgängers und Schwiegervaters, des Tarquinius Priscus, vermählt. Diese waren an Denkungsart und Sitten ebenso verschieden als des Königs Töchter. Lucius Tarquinius war wild, ungestüm und herrschsüchtig, und ebenso die jüngere Tullia. Aruns Tarquinius hingegen und die ältere Tullia waren sanft und gutherzig. Darum hielt es Servius für das Beste, wenn er die entgegengesetzten Charaktere mit einander verbände, damit die Sanftmut des einen die Heftigkeit des anderen mäßigen könnte. Er gab daher die ältere Tullia dem Lucius Tarquinius, die jüngere Tullia aber dem Aruns Tarquinius zur Ehe. Aber der Erfolg fiel ganz gegen seine Hoffnung aus.
Die Ähnlichkeit der Gemüts- und Denkungsart, die zwischen dem Lucius Tarquinius und der jüngeren Tullia stattfand, brachte zwischen beiden bald eine Vertraulichkeit zuwege, die sie zu den schändlichsten Handlungen verführte. Beide töteten, er seine Gattin, sie ihren Gatten. Dies konnte Servius nicht nur nicht verhindern, sondern mußte sogar erlauben, daß sie sich einander heirateten. Aber damit nicht zufrieden, suchten sie den Servius der Regierung zu berauben. Tarquinius warb sich eine Partei unter den Bürgern und gewann besonders die Vornehmen, die sich durch die neuen[S. 20] Einrichtungen des Königs in ihren alten Vorrechten gekränkt fühlten. Eines Tages erkühnte er sich, angetan mit den Abzeichen der Königswürde, in königlichem Schmuck in das Rathaus zu gehen, sich auf den Königsstuhl zu setzen und, als wäre er bereits König, den Senat zu berufen. Sie kamen in großer Anzahl, und er hielt eine Rede an sie, worin er ihnen seine Absicht, sich auf den Thron zu setzen, entdeckte. Inzwischen kam auch Servius Tullius voll Zorn herbei und wollte sogleich seinen Eidam vom Throne herabziehen. Allein dieser, an Kräften dem alten König überlegen, ergriff und stürzte ihn von der obersten Stufe des Rathauses auf den Markt hinab. Verwundet wollte Servius sich nach Hause begeben, allein die Boten des Tarquinius holten ihn unterwegs ein und töteten ihn auf der Stelle.
Indessen war Tullia herbeigekommen und hatte den Vorgang gehört. Frohlockend ließ sie ihren Mann aus dem Rathause rufen und begrüßte ihn zuerst als König. Als sie wieder nach Hause fuhr, führte der Weg durch eine enge Straße, wo der Leichnam des ermordeten Königs lag. Bei diesem Anblick hielt der Wagenführer an und wollte ausweichen, aber die gottlose Tullia befahl ihm über den Leichnam ihres Vaters hinwegzufahren. So kam sie, mit dem Blute ihres Vaters bespritzt, nach Hause.
Tarquinius hat sich durch seine eigenmächtige und gewalttätige Herrschaft den Beinamen Superbus (Tyrann) zugezogen. Er hatte sich des Königsamtes bemächtigt, ohne vom Volke gewählt und durch die Auspicien bestätigt zu sein. Die Reichen drückte er durch willkürliche Auflagen, die Armen durch Frohndienste. Viele Vornehme, die treu zum vorigen Könige gehalten hatten oder die ihm verdächtig schienen, bestrafte er mit Hinrichtung, Verbannung oder Verlust des Vermögens. Er berief den Senat nicht mehr, und entschied allein über Krieg und Frieden und über Bündnisse mit anderen Völkern. Nach außen aber nahm der Staat unter seinem klugen und unternehmenden Regiment an Größe, Macht und[S. 21] Ansehen stetig zu. Er entriß den latinischen Städten ihre Selbständigkeit und machte Rom zum herrschenden Haupte des latinischen Bundes.
Eine derselben, die große und feste Stadt Gabii, belagerte Tarquinius sieben Jahre lang vergebens, bis er sie endlich durch List eroberte. Sein jüngster Sohn, Sextus Tarquinius, flüchtete, scheinbar in Zwist mit seinem Vater, nach Gabii, wo er über dessen unerträgliche Härte klagte, und dadurch das Mitleid der Gabinier erregte. Sie nahmen ihn gern auf, und bald wußte er ihr volles Vertrauen zu erwerben. Mit einem gabinischen Heerhaufen trieb er die Kriegsmannen seines Vaters zurück; die sich der Verabredung gemäß schlagen lassen mußten. Durch diese Arglist betrogen, übertrugen ihm die Gabinier bald den Oberbefehl über Stadt und Heer. Nun schickte er einen vertrauten Boten an seinen Vater, mit der Frage, was er nun, da die Götter ihn zum Herrn von Gabii gemacht hätten, dort tun sollte. Der König führte schweigend den Boten in den Garten, schlug mit einem Stabe die höchsten Mohnköpfe ab, und hieß ihn dann dem Sohne sagen was er gesehen hätte. Sextus verstand seines Vaters Wink und schaffte die vornehmsten Gabinier teils durch heimlichen Mord, teils durch falsche Anklagen und Verbannung beiseite. Nachdem er auf diese Weise die Stadt ihrer Häupter beraubt, und das gemeine Volk durch Verteilung der Güter der Verurteilten gewonnen hatte, lieferte er sie ohne jeden Widerstand in die Hand seines Vaters.
Der kriegerische König war zugleich prachtliebend und verschönerte Rom durch großartige Bauten, die er durch kunstgeübte etrurische Werkmeister ausführen ließ. Die Kosten bestritt er aus den Gütern der verbannten Reichen und der angesammelten Kriegsbeute, während das ärmere Volk zu harten Frondiensten herangezogen wurde. Von diesen Bauten waren am berühmtesten die „große Kloake“ und das Capitolium mit dem dreifachen Tempel des Jupiter, der Juno und der Minerva, der mit ehernen Götter- und Königsbildern geschmückt war. Als man bei dem Bau dieses großen capitolinischen Tempels die vielen älteren Altäre und kleinen Tempel, welche den Ort bedeckten, wegräumte, ließen sich die des „Grenzgottes“ (Terminus) und der Göttin der „Jugend“ (Juventus) nicht wegrücken. Diese Wunderzeichen deutete man dahin, daß die Jugend des römischen Staates nie verblühen[S. 22] seine Grenzen nie zurückweichen würden. Man schloß daher diese Götter mit in die Mauer des Tempels ein. In einem unterirdischen Gewölbe des Tempels wurden in bleiernem Kasten die drei sibyllinischen Bücher verwahrt, in deren Besitz Tarquinius auf folgende Weise gelangt war.
Einst kam eine unbekannte Alte von seltsamem Ansehen zum König und bot ihm neun Bücherrollen zum Kauf an. Aber der Preis, den sie forderte, war dem König zu hoch, und die Frau wurde abgewiesen. Alsbald ging sie fort und verbrannte drei von ihren Büchern, kam dann wieder und bot die übrigen sechs dem Könige zu demselben Preise an. Wiederum zurückgewiesen, verbrannte sie abermals drei Bücher. Als sie dann zum dritten Male erschien und die drei letzten Bücher zu verbrennen drohte, wenn sie jenen Preis nicht erhielte, wurde der König aufmerksam und ließ die Bücher von den Augurn untersuchen. Auf ihren Rat kaufte er die Bücher, und sofort verschwand die Fremde. Die Abfassung dieser mit dunklen, rätselhaften Sprüchen und Weissagungen in griechischer Sprache angefüllten Bücher schrieb man einer Sibylle zu, mit welchem Namen man in alten Zeiten geheimnisvolle, mit Sehergabe ausgestattete Frauen bezeichnete, und davon hießen fortan diese wundersamen Schriftrollen die sibyllinischen Bücher. Der besondern Obhut zweier Priester anvertraut, wurden sie fortan zu Rate gezogen, so oft auffällige Naturerscheinungen die Gemüter erschreckten, oder der Staat, durch innere oder äußere Not bedrängt, eines göttlichen Rates zu bedürfen schien.
Nicht lange, so ängstigten böse Zeichen und Träume das Gemüt des Königs. Eine Schlange schlüpfte aus dem Altar des königlichen Hauses und raubte das dargebrachte Opferfleisch. Der König beschloß das delphische Orakel, welches damals im größten Ansehen stand, über dieses Wunder zu befragen und sandte seine beiden Söhne Titus und Aruns, denen er den Junius Brutus als Begleiter gab, mit kostbaren Weihgeschenken dahin ab. Dieser, obgleich ein naher Verwandter des Königs, war der Grausamkeit des Tyrannen, der schon seinen Vater und Bruder getötet hatte, nur dadurch entgangen, daß er sich blödsinnig stellte. Tarquinius hatte ihn wirklich für dumm gehalten, ihm den Namen Brutus (der Dumme) gegeben und ihn der Kurzweil wegen an seinen Hof[S. 23] genommen. Doch äußerte Brutus bisweilen Spuren der in ihm versteckten Klugheit. In Delphi machte er dem Orakel einen Stab von Kornelkirschholz zum Geschenk, aber der hölzerne Stab war hohl und mit Gold gefüllt, und so ward er das Sinnbild des Brutus selbst.
Als die Jünglinge den Auftrag des Vaters vollzogen hatten, trieb sie die Neugier das Orakel zu befragen, wer nach dem Vater in Rom herrschen würde, und es geschah die Antwort: „Der, welcher zuerst von euch seine Mutter küssen wird.“ Die Königssöhne, welche meinten, das Orakel weise auf ihre Mutter, die Königin, die Gattin des Tarquinius, machten unter sich aus ihre Mutter zu gleicher Zeit zu küssen, um später gemeinschaftlich zu regieren. Brutus aber verstand unter der Mutter die Erde, die gemeinsame Mutter aller Menschen. Darum tat er, als sie heimkehrten und aus dem Schiff ans Land stiegen, mit Absicht einen Fehltritt, fiel nieder zur Erde und berührte sie mit seinen Lippen, und erfüllte so das Geheiß des Orakels.
Bald darauf geschah es, daß bei einer Belagerung von Ardĕa, der Hauptstadt der Rútuler, sich die Söhne des Königs die Langeweile im Lager durch Gastmähler und Trinkgelage zu vertreiben suchten. Als sie so einst bei ihrem Bruder Sextus, dem Eroberer von Gabii, schmausten, fiel die Rede auch auf ihre Frauen, und sie stritten, wer von ihnen die preiswürdigste hätte. Da jeder seine eigene dafür hielt, rief Collatinus Tarquinius, ihr Vetter: „Wozu all dies Streiten? Laßt uns unsere Rosse besteigen und unsere Frauen besuchen! Womit wir eine jede beschäftigt finden, darnach mag der Preis zuerkannt werden.“ Alle waren mit dem Vorschlage zufrieden. Beim Anbruch der Dunkelheit gelangten sie nach Rom, wo die Frauen der Königssöhne die Zeit in Lust und Wohlleben verbrachten; von da ging ihr Ritt nach Collatia, zum Landgute des Collatinus. Hier fanden sie die ebenso schöne wie züchtige Lucretia, die Gattin desselben, noch in später Nacht unter ihren Mägden sitzen und mit Wollarbeit beschäftigt. Ihr wurde der Preis zuerkannt. Freundlich bewirtete sie den Mann und die mitgebrachten Gäste, bis sie ins Lager zurückkehrten.
Einige Tage nachher erschien Sextus Tarquinius diesmal allein und ohne Wissen des Collatinus, wieder in Collatia.[S. 24] Er ward von der arglosen Lucretia gastlich aufgenommen, vergalt aber diese Aufnahme damit, daß er der tugendhaften Frau eine rohe und entehrende Gewalt antat. Als der Verräter sie verlassen, ließ sie ihren Vater Lucretius und ihren Gemahl zu sich nach Collatia entbieten. Sie kamen, der Gatte begleitet von jenem Junius Brutus, der Vater von seinem Freunde Valerius. Jammernd erzählte sie ihnen den erlittenen Schimpf, und nachdem sie ihnen den Schwur abgefordert, den Sextus Tarquinius, ihren Beleidiger, zu bestrafen, stieß sie sich vor ihren Augen einen Dolch in die Brust. Während die anderen vor Schreck wie gelähmt dastanden, trat Brutus hervor, zog den Dolch aus der Leiche und schwur bei dem Blute des unschuldigen Opfers, daß er nicht ruhen und rasten wolle, bis er dies gottlose Königsgeschlecht aus Rom verjagt und der Königsherrschaft ein Ende gemacht hätte. Und den gleichen Schwur ließ er den beleidigten Gatten und den Vater nebst Valerius auf den blutigen Dolch leisten. Darauf hoben sie die Tote und trugen sie auf den Markt, wo sie dem herzueilenden Volke die Schandtat des Tarquiniers erzählten. Die Bürger von Collatia bewaffneten sich, besetzten die Tore ihrer Stadt und zogen, von Brutus und den anderen geführt, nach Rom. Hier berief Brutus das Volk zusammen und zählte ihm alle Freveltaten auf, die der König, sein Weib und seine Söhne vom Morde des Servius Tullius an bis zu dieser letzten Schandtat verübt hätten. Das Volk erklärte den Tarquinius der Königswürde verlustig und beschloß seine und seines Geschlechtes Verbannung. Darauf zog Brutus mit einer Schar von Jünglingen in das Lager von Ardea, jedoch auf einem Umwege, sodaß er dem Könige, der auf die erste Nachricht von dem Aufruhr nach Rom geeilt war, nicht begegnete. Freudig nahm das Heer den Brutus auf und verjagte die Königssöhne. In Rom aber ließ man den König nicht herein, sondern verschloß ihm die Tore und kündigte ihm seine Verbannung an. So von Volk und Heer verlassen, floh er mit seiner Familie nach der Stadt Cäre in Etrurien. Sextus ging zu den Gabiniern, die ihn, eingedenk des früheren Verrates, erschlugen.
An Stelle des einen Königs traten von jetzt an zwei oberste Beamte, die Konsuln, die, vom Volke gewählt, beide zwar dieselbe Machtbefugnis als oberste Heerführer und Richter übten, wie bisher die Könige, aber ihr Amt nur ein Jahr lang bekleideten und sich gegenseitig an Ausschreitungen hindern konnten. Die ersten Konsuln waren Brutus und Collatinus.
Obschon die Vertreibung der Könige von den alten Geschlechtern, den Patriziern, ausgegangen war, so waren doch nicht alle Patrizier damit zufrieden. Zumal die jüngeren unter ihnen, welche den Glanz und die Freuden eines königlichen Hofes vermißten, fanden sich nicht leicht in den neuen Zustand, und warteten nur auf eine Gelegenheit, um den König zurückzuführen. Als der König von dieser Stimmung Kunde erhielt, schickte er alsbald Gesandte nach Rom, unter dem Vorwande, daß sie die Herausgabe seiner Güter fordern sollten, in der Tat aber, um eine Empörung zum Sturz der Konsuln zuwege zu bringen. Mehrere junge Patrizier, unter ihnen sogar die Söhne des Konsuls Brutus, ließen sich dafür gewinnen und warben unter ihren Freunden zahlreiche Genossen. Man verabredete an einem bestimmten Tage die Konsuln zu töten und zugleich dem König die Tore der Stadt zu öffnen, und schrieb einen Brief an ihn, um ihn zu eiliger Rückkehr aufzufordern. Allein, ehe noch die Gesandten mit dem Briefe Rom verlassen konnten, wurde die Verschwörung entdeckt. Ein Sklave hatte eine Zusammenkunft der Ver[S. 26]schworenen belauscht und ihren Plan den Konsuln angezeigt. Diese ließen sofort die Gesandten und die Verschworenen ergreifen, und der vorgefundene Brief bezeugte unwidersprechlich ihre Schuld. Die Gesandten wurden, dem Völkerrechte gemäß, unverletzt entlassen, die ganze Habe des Königs aber dem Volke preisgegeben, sein großer Landbesitz nordwärts der Stadt bis zur Tiber dem Kriegsgott geweiht und seit der Zeit Marsfeld (campus Martius) genannt.
Die Verschworenen wurden in Fesseln vor die Konsuln geführt, welche auf ihren Amtsstühlen zu Gerichte saßen. Da sie nichts zu ihrer Verteidigung vorbringen konnten, so verurteilte sie Brutus, der Vater die eigenen Söhne, zum Tode. Diese Strenge machte auch dem Collatinus, dessen Neffe unter den Verschworenen war, ein milderes Urteil unmöglich. Mit fester Miene und unverwandtem Blick sah Brutus seine Söhne mit Ruten geißeln und dann mit dem Beil hinrichten. Darauf bewog er das Volk zu dem Beschluß, daß auch alle Verwandten des Königshauses verbannt sein sollten. Da zu diesen auch der Konsul Collatinus gehörte, so legte er sein Amt nieder und ging in die Verbannung. An seine Stelle trat der oben erwähnte Publius Valerius.
Tarquinius suchte von nun an mit Waffengewalt die verlorene Herrschaft wiederzugewinnen. Er rückte mit einem Heere, das ihm die etruskischen Städte Veji und Tarquinii gestellt hatten, gegen Rom. Die Bürger zogen ihm entgegen. Am Walde Arsia kam es zum Treffen. Als Brutus und Arnus, beide an der Spitze ihrer Reiterei, einander ansichtig wurden, sprengten sie, von gleichem Haß und Kampflust getrieben, gegen einander an. Beide fielen, jeder vom andern zu Tode getroffen. Darauf entbrannte die Schlacht allgemein und dauerte ununterbrochen bis gegen Mitternacht. Plötzlich erscholl aus dem Forste die Stimme des Waldgottes: „Bei den Etruskern ist ein Mann mehr gefallen, der Sieg gehört den Römern!“ Da gaben die Etrusker die Sache verloren und wandten sich zur Flucht, und die Römer kehrten als Sieger nach Hause. Den Brutus bestatteten sie auf das ehrenvollste, und die römischen Frauen betrauerten ihn ein ganzes Jahr wie einen Vater.
Tarquinius ließ die Hoffnung, die Königswürde wieder zu erlangen, noch nicht fahren. Er begab sich in den Schutz Porsennas, des mächtigen Fürsten der Stadt Clusium in Etrurien. Der Krieg, den dieser deshalb mit Rom begann, erreichte zwar nicht das eigentliche Ziel, die Herstellung des Tarquinius als römischen Königs, aber die Römer mußten, trotz heldenhafter Gegenwehr, einen Teil ihres Gebietes an Porsenna abtreten. Von diesen Heldentaten berichtet die Sage folgendes.
Da die kleine Festung auf dem Berge Janiculum, auf der rechten Seite der Tiber, der Stadt gegenüber, beim ersten Angriff vom Feinde erobert ward, so zog sich die Besatzung vor der Übermacht in die Mauern der Stadt zurück. Nun wäre Porsenna unaufhaltsam über die schmale hölzerne Tiberbrücke nachgedrungen, wenn nicht Horatius Cocles durch seine Unerschrockenheit und Tapferkeit es verhindert hätte. Als er sah, daß seine Genossen nicht mehr standhielten, riet er ihnen selbst über die Brücke zu eilen und sie so schnell als möglich abzutragen. Während dies geschah, wehrte Horatius mit zweien seiner Gefährten das feindliche Heer von dem Zugang zur Brücke ab. Als dieselbe beinahe abgetragen war, entließ er auch seine Gefährten, um sich über die Reste in die Stadt zu retten. Hierauf stellte er sich allein dem Feinde entgegen, und erst, als die letzten Balken krachten, sprang er, den Stromgott um Schutz anflehend, mit Schild und Wehr in die Fluten. Unter einem Hagel feindlicher Pfeile schwamm er unversehrt an das andere Ufer.
Die festen und hohen Mauern der Stadt schützten sie zwar gegen einen stürmischen Angriff; aber der Feind begann ihr von allen Seiten die Zufuhr abzuschneiden und ihr Gebiet zu verwüsten, sodaß bald Mangel an Nahrung entstand. Um Rom von dieser Bedrängnis zu befreien, beschloß Mucius Scävŏla, ein mutiger Jüngling, den feindlichen König zu töten. In etruskischer Kleidung, einen Dolch unter dem Gewande, schlich er ins feindliche Lager, wo eben ein Schreiber neben dem König saß, der mit den Kriegern verhandelte, die ihren Sold erhalten sollten. Weil sich dieser in seiner Tracht gar nicht vom König unterschied, so hielt ihn Mucius für den[S. 28] König selbst und stieß ihn mit dem Dolche nieder. Ergriffen und vor den König geführt, bekannte er unerschrocken sein Vorhaben. Als ihn Porsenna mit dem Feuertode bedrohte, streckte er, um zu zeigen, daß er alle Drohungen verachte, seine Rechte in die Flamme des nahestehenden Opferherdes, ohne das geringste Zeichen von Schmerz zu verraten. Da verwandelte sich des Königs Zorn in Bewunderung, er schenkte dem Mucius das Leben, und dieser erklärte nun, gleichsam um den König für seine Milde zu belohnen, daß nicht er allein, sondern dreihundert römische Jünglinge sich zu gleichem Zwecke verschworen hätten, um durch den Tod des Königs ihre Vaterstadt zu befreien. Der junge Held, der später von dem Verluste seiner rechten Hand den Beinamen Scävola (Linkhand) erhielt, ward entlassen; der König aber, der sich jetzt von steten Gefahren bedroht glaubte und für sein Leben fürchtete, ward zum Frieden geneigt, der auch bald zustande kam. Er hob die Belagerung auf und verzichtete auf die Wiedereinsetzung des Tarquinius; dagegen traten die Römer das rechte Tiberufer an ihn ab und stellten zehn Jünglinge und ebenso viele Jungfrauen als Geiseln.
Unter diesen Jungfrauen befand sich die edle Clölia. Sie täuschte die Wächter und schwamm mit den übrigen Jungfrauen über die Tiber. Vergebens schossen die Feinde ihre Pfeile auf sie ab; sie kam mit ihren Gefährtinnen glücklich nach Rom. Aber der römische Konsul schickte sie auf die drohende Forderung Porsennas in das etruskische Lager zurück. Doch hatte der Heldenmut der Jungfrau des Königs Bewunderung erregt; er vergab ihr nicht nur und schenkte ihr die Freiheit, sondern er erlaubte ihr sogar einige von den römischen Jünglingen, die als Geiseln im Lager waren, mit nach Hause zu nehmen. Sie wählte die jüngeren, deren zartes Alter ihr im Feindeslande am meisten der Kränkung ausgesetzt schien. In Rom aber errichtete man, zu dauerndem Andenken an den Heldenmut der Clölia, ein ehernes Denkmal, eine Jungfrau zu Roß.
So war denn auch dieser Versuch des Tarquinius, die Herrschaft wiederzugewinnen, mißlungen. Er nahm hierauf seine Zuflucht zu den Latinern, die er zu einem Kriege gegen die Römer aufreizte, der im Jahre 496 v. Chr. zum Ausbruch kam. Am See Regillus trafen beide Heere aufeinander; es war ein Heldenkampf, in dem die Führer selber sich im Zwei[S. 29]kampf begegneten, während die Menge ohne Entscheidung focht, und der Sieg bald hierin, bald dorthin sich wandte. Selbst der hochbejahrte Tarquinius nahm an der Schlacht Anteil und ward verwundet. Endlich siegten die Römer und nahmen das feindliche Lager; Tarquinius ging hoffnungslos zu Aristodémus, dem Fürsten der griechischen Stadt Cumä, nahe dem heutigen Neapel, wo er im folgenden Jahre starb.
Die Bürgerschaft Roms zerfiel in zwei an Herkunft, Recht und Ansehen verschiedene Klassen, unter denen nicht einmal ein gemeinschaftliches Verkehrsrecht (commercium) und Eherecht (conubium) bestand. Die eigentliche Gemeinde bildeten nur die Patrizier, die Nachkommen der alten Geschlechter, aus denen die ursprüngliche Bevölkerung Roms bestanden hatte. Sie besaßen alle Vorrechte; aus ihrer Mitte wurden die Beamten und Senatoren gewählt, sie allein bildeten das „Römische Volk“ (populus Romanus) und beschlossen in ihrer Versammlung (comítia curiāta) über die Angelegenheiten des Staates. Die Plebejer dagegen, die Nachkommen derjenigen Zuwanderer, welche sich, freiwillig oder gezwungen, nach und nach in Rom niedergelassen hatten, an Zahl weit überlegen und zu allen Diensten für das Gemeinwesen, zu Kriegsdienst und Steuern verpflichtet, entbehrten alles Anteils an der Regierung, welche die patrizischen Beamten mit stolzer Härte gegen die rechtlose Menge ausübten. Die plebejischen Bauern konnten oft wegen der häufigen Kriege, zu denen sie eingerufen wurden, ihr Land nicht rechtzeitig bestellen, gerieten in Schulden, und wenn sie die hohen Zinsen nicht bezahlen konnten, so verfielen sie, nach dem harten römischen Schuldrecht, mit ihrer Person der Gewalt der Gläubiger, die sie als Knechte fronden lassen oder sogar in die Fremde verkaufen durften. So waren schon viele in Armut und Knechtschaft geraten, und die Unzufriedenheit über die ungerechte Bedrückung stieg unter den Plebejern immer höher.
Schon hatten sie einige Male den Kriegsdienst verweigert; aber den Patriziern war es noch immer gelungen, bald durch[S. 30] Drohungen, bald durch leere Versprechungen, den Ausbruch der Unzufriedenheit zu unterdrücken. Einst geschah es, daß das Volk, von einem beutereichen Feldzuge zurückkehrend, zum Lohn eine Erleichterung seiner drückenden Lage erwartete. Allein die Patrizier suchten es aufs neue zu täuschen, indem sie es sogleich zu einem neuen Kriege führen wollten. Da aber kam die lang verhaltene Wut der Plebejer zu offenem Ausbruch. Bewaffnet, wie sie waren, rotteten sie sich zusammen, verließen die Stadt und zogen, unter einem selbstgewählten Anführer, auf eine nicht weit von Rom gelegene Anhöhe, die man den „heiligen Berg“ nannte, wo sie ein festes Lager aufschlugen und sich dauernd niederzulassen drohten. (494 v. Chr.)
Darüber entstand zu Rom eine allgemeine Bestürzung. Das zurückgebliebene Volk fürchtete die Härte der Patrizier, diese die völlige Auswanderung des Volks. Endlich beschloß der Senat eine Gesandtschaft abzuschicken, um das Volk zur Rückkehr zu bewegen. An der Spitze derselben stand ein kluger und beredter, als Volksfreund bekannter und beliebter Mann, Menénius Agrippa. Auf dem heiligen Berge angekommen, begann er seine Rede damit, daß er dem Volke folgende Fabel erzählte.
„Die Glieder des Leibes empörten sich einst wider den Magen, weil er allein untätig sei, während sie alle für ihn arbeiten mußten. Sie versagten ihm daher den Dienst. Die Hände wollten keine Speise mehr in den Mund bringen, der Mund sie nicht aufnehmen und die Zähne sie nicht zerreiben. Eine Zeitlang führten die Glieder diesen Vorsatz aus. Bald aber fühlten sie, daß sie sich selbst dadurch schadeten. Sie erkannten, daß es der Magen sei, der die empfangene Speise verdaue, das damit genährte Blut durch alle Glieder verbreite und ihnen allen Leben und Kraft verleihe. Sie gaben daher ihr Vorhaben auf und söhnten sich wieder mit dem Magen aus. So ist es auch, fuhr Agrippa fort, mit den Gliedern eines Staates. Keiner von ihnen vermag für sich allein zu bestehen; nur auf ihrer Eintracht beruht das Wohl des Ganzen.“
Durch solche Rede soll Agrippa das Volk zur Rückkehr geneigt gemacht haben. Sie erfolgte jedoch nicht eher, als bis die Patrizier das feierliche Versprechen gaben, die Schuldgefangenen in Freiheit zu setzen und den Plebejern die Wahl[S. 31] einer eigenen unverletzlichen Obrigkeit zu gestatten. Von dieser Zeit an wählte das Volk aus seiner Mitte jährlich zwei Beamte, Tribunen genannt, deren Zahl später bis auf zehn vermehrt ward. Sie hatten das Recht die Gemeinde der Plebejer zu berufen und mit ihr zu beraten, und die Pflicht jeden einzelnen derselben gegen eine Härte oder Ungerechtigkeit der Konsuln und anderen Beamten zu schützen. Auch durften sie gegen jeden Beschluß des Senats, vor dessen Tür sie ihren Sitz hatten, Einsprache (veto „ich verbiete“) tun und ihn dadurch ungültig machen.
Doch schon in den ersten Jahren liefen die Plebejer Gefahr diese Rechte, welche sie durch die Auswanderung (secessio) auf den heiligen Berg errungen hatten, wieder zu verlieren. Damals nämlich wurde Rom durch eine furchtbare Hungersnot heimgesucht. Der Senat hatte auswärts Vorräte an Getreide aufkaufen lassen, und fast alle Senatoren waren der Meinung, man solle dieses Getreide den Plebejern entweder umsonst oder um einen sehr geringen Preis überlassen. Nur C. Marcius stimmte ihnen nicht bei. Dieser Marcius hatte durch seine Tapferkeit Corioli, eine Stadt der den Römern benachbarten, aber immer feindlichen Volsker, eingenommen und sich dadurch den Beinamen Coriolanus erworben. Er war ein erbitterter Gegner der Plebejer, denen er ihre neue Obrigkeit zu entreißen suchte. Daher machte er jetzt im Senate den Vorschlag, man solle dem Volke das Getreide nur unter der Bedingung geben, daß es seine Tribunen wieder abschaffe.
Kaum hatte das Volk von diesem Vorschlage Kunde, als es in die größte Wut geriet und den Coriolanus zerrissen hätte, wenn es die Tribunen nicht gehindert hätten. Diese bestimmten darauf dem Coriolanus einen Tag, wo er vor dem Gerichte des Volkes erscheinen und sich verantworten sollte. Die Patrizier flehten um Gnade für ihn, er selbst aber zeigte Trotz und Hohn und verachtete die Anklage. Als er jedoch sah, daß er verurteilt werden würde, wartete er den Gerichtstag nicht ab, sondern entfernte sich aus Rom. Das Volk verurteilte ihn, da er sich nicht zu Gericht gestellt hatte, zu lebenslänglicher Verbannung.
Coriolanus war nach Antium, einer Stadt der Volsker, gegangen, wo ihn sein Gastfreund Attius Tullius bereitwillig aufnahm. Hier brachte er es dahin, daß die Volsker gegen[S. 32] die ihnen verhaßten Römer aufs neue zu den Waffen griffen. An der Spitze eines volskischen Heeres drang Coriolanus bis in die Nähe von Rom und lagerte sich eine Meile weit von der Stadt. Weit und breit verwüstete er die Güter der Plebejer, verschonte aber die der Patrizier, entweder um seinen Haß gegen jene an den Tag zu legen, oder um beide Parteien gegen einander aufzureizen.
Rom befand sich in der größten Gefahr. Von außen wütete der Feind, im Innern der Streit zwischen Volk und Senat. Endlich ward eine Gesandtschaft der vornehmsten Patrizier an ihn abgeordnet, kehrte aber unverrichteter Sache zurück. Dann wurden Priester mit allen Zeichen ihrer Würde abgeschickt. Coriolanus empfing sie mit großer Ehrerbietung, doch auch sie richteten nichts aus. Endlich gingen Vetúria, die Mutter des Coriolanus, und dessen Gemahlin Volúmnia mit seinen Kindern nebst anderen römischen Matronen ins volskische Lager. Als Coriolanus von ihrer Ankunft hörte, eilte er auf seine Mutter zu, um sie zu umarmen. Allein Veturia wies seine Umarmung ab, voll Zorn und Schmerz brach sie in laute und bittere Klagen aus über des Sohnes frevelhaften Krieg, über des Vaterlandes Not und das eigene Unglück die Mutter eines solchen Sohnes zu sein. Tief erschüttert gab Coriolanus nach. „Mutter,“ rief er, „das Vaterland hast du gerettet, aber deinen Sohn verloren!“ Er verließ mit dem Heer der Volsker das römische Gebiet und kehrte nach Antium zurück. Dort soll er bald darauf von dem erzürnten Volk erschlagen worden sein, nach einer anderen Sage aber als Verbannter ein hohes Alter in der freudelosen Fremde erreicht haben.
Auch nach dem Abzuge des Coriolanus hörten die inneren Kämpfe zwischen Patriziern und Plebejern in Rom nicht auf; jene suchten ihre Vorrechte unverkürzt zu behaupten, diese forderten, unter der Führung ihrer Tribunen, immer lebhafter eine rechtliche Gleichstellung. Insbesondere erbitterte es die Plebejer, daß alles Land, welches den besiegten Feinden ent[S. 33]rissen und Eigentum des römischen Volkes ward (ager publicus „Gemeinland“), ausschließlich den Patriziern gegen eine geringe Abgabe in Erbpacht gegeben wurde. Gegen ihre billige Forderung, daß der Vorteil aus solcher Kriegsbeute allen Bürgern gleichmäßig zufallen sollte, sträubte sich besonders das adelstolze zahlreiche Geschlecht der Fabier, und gegen sie war der Unwille des Volkes vorzugsweise gerichtet. Sieben Jahre nach einander, von 485–479 v. Chr., bekleidete jedesmal ein Fabier das Konsulat. Nun brach im Jahre 483 ein Krieg mit Veji, einer benachbarten Stadt Etruriens, aus. In den beiden ersten Jahren geschah nichts Erhebliches, aber im dritten ereignete sich Schmachvolles. Das größtenteils aus Plebejern bestehende Heer folgte seinem Feldherrn, dem Käso Fabius, mit Ingrimm; ihm zum Trotze wich es im Kampfe, gab das Lager dem Feinde preis und floh in größter Unordnung nach Rom. Da beschlossen die Fabier, ohnmächtig gegen des Volkes Haß und Starrsinn, sich mit ihm auszusöhnen. So gelobten die Soldaten dem Marcus Fabius Gehorsam und Sieg; sein Bruder Quintus fiel in einer Schlacht gegen die Etrusker, und ebenso der andere Konsul, aber Marcus trug einen glänzenden Sieg davon. Der Senat bewilligte ihm einen Triumph, den er jedoch wegen des Todes seines Bruders und seines Kollegen ablehnte. Die verwundeten Plebejer verteilte er in die patrizischen Häuser, viele nahm sein eigenes Geschlecht auf und verpflegte sie aufs beste. Seitdem waren die Fabier des Volkes Lieblinge, und Käso Fabius wurde zum dritten Male Konsul.
Dieser Mann forderte die Patrizier auf, einen Teil des jüngst gewonnenen Gemeinlandes unter die armen Bürger zu verteilen, aber vergeblich; er zog sich dadurch nur den Haß seiner Stammesgenossen zu. Um so mehr vertrauten ihm die Plebejer. Noch immer dauerte der Kampf mit den Vejentern fort, die, wenn ihnen gerade kein Heer gegenüberstand, Streifzüge in das römische Gebiet unternahmen. Da faßten Käso Fabius und sein ganzes Geschlecht den Entschluß mit ihren Schützlingen und Anhängern (Klienten) die Vaterstadt zu verlassen und für das Wohl des Staates auf eigene Hand den Grenzkrieg gegen Veji zu übernehmen. Als sich die Kunde von diesem Entschlusse durch die Stadt verbreitete, entstand ein allgemeiner Jubel, und das Volk erhob die Fabier bis in den Himmel. Unter Gebeten und Segenswünschen zogen[S. 34] nun die Fabier, 306 Helden, alle Patrizier, alle aus einem Geschlecht, jeder des Feldherrnamtes würdig, mit ihrem Gefolge von etwa 4000 Männern, durch das carmentalische Tor bis an das Flüßchen Crémera, wo sie sich niederließen und verschanzten (479 v. Chr.).
Drei Jahre lang führten sie dort den Grenzkrieg gegen die Etrusker mit Glück; die ganze vejentische Landschaft bis in die fernsten Winkel wurde von ihren Streifzügen heimgesucht, und manches Treffen im offenen Felde von ihnen gewonnen. Das Glück machte sie kühn und sicher, zuletzt sorglos. Einst wurden Rinderherden unter schwacher Bedeckung an ihnen vorbeigetrieben. Durch diese ließen sie sich auf eine Bergweide locken, wo aus den Waldhöhen umher viele Tausende bewaffneter Feinde sich verborgen hatten. Die Hüter des Viehes entflohen zum Schein; die Römer, den Rindern nachjagend, zerstreuten sich und gerieten immer tiefer in die verderbliche Talenge, als plötzlich von allen Seiten Schlachtruf erscholl, und ein Hagel von Wurfgeschossen auf sie niederfiel. Die Übermacht der Feinde umdrängte sie und immer enger ward der Kreis, in den sie sich zusammenziehen mußten. Nachdem sie lange gegen den von allen Seiten andringenden Feind gefochten hatten, wandten sie sich endlich insgesamt in keilförmiger Aufstellung nach einer Richtung hin und bahnten sich, durch die Macht ihrer Leiber und Waffen, den Weg nach einer nahen Anhöhe. Hier bestanden sie den Kampf gegen die nachstürmenden Feinde, bis diese auf einem Umweg den Gipfel des Berges im Rücken der Römer erstiegen, von wo sie, Steinblöcke und Geschosse hinabschleudernd, die Helden alle bis auf den letzten erschlugen. Der Tag, an dem dies geschah, war der 18. Juli des Jahres 477 v. Chr. und blieb im Andenken der Römer auf immer ein Unglückstag, der in stiller Trauer begangen ward. Auch das carmentalische Tor, durch welches die Fabier aus Rom gezogen waren, galt fortan für unheilbringend. Nur ein Sprößling des Geschlechts, ein noch unmündiger Knabe, soll in Rom zurückgeblieben sein, von dem das spätere fabische Geschlecht abstammte.
Die Römer hatten bis zu dieser Zeit noch keine geschriebenen Gesetze. Die patrizischen Richter sprachen Recht nach altem Herkommen oder nach Gutdünken, wobei sie sich oft Begünstigung ihrer Standesgenossen zum Nachteile der Plebejer zuschulden kommen ließen. Um sich gegen solche ungerechte Urteilssprüche zu sichern, setzten es die Plebejer unter ihrem Tribunen Terentilius Harsa durch, daß zu ihrem Schutze gegen die Willkür der Patrizier geschriebene Gesetze aufgestellt werden sollten (453 v. Chr.). Nun wurden Gesandte in die griechischen Städte Unteritaliens und nach Athen geschickt, um dort die weisesten Gesetze zu sammeln. Nach ihrer Rückkehr wurde ein Ausschuß von zehn Männern (decemvirn) ernannt, der aus diesen Gesetzen diejenigen auswählen sollte, welche dem römischen Staate angemessen wären und zu gleicher Zeit auf ein Jahr mit der unumschränkten Regierungsgewalt betraut, sodaß alle anderen Obrigkeiten inzwischen aufhörten. Unter diesen Zehnmännern oder Decemvirn war Appius Claudius der angesehenste und einflußreichste.
Die Decemvirn regierten anfangs zu völliger Zufriedenheit des Volkes. Am Ende ihres Amtsjahres stellten sie auf zehn Tafeln eine Reihe von Gesetzen auf, bezeigten aber keine Lust, nun auch ihr Amt niederzulegen. Besonders wünschte der stolze Appius Claudius seine Herrschaft noch fortzusetzen. Durch erheuchelte Milde und Leutseligkeit hatte er das Volk für sich gewonnen und bewirkte ohne Mühe, daß die Decemvirn auch für das folgende Jahr im Amte blieben. Am Schluß des zweiten Jahres stellten sie noch zwei Gesetztafeln auf. Aber auch jetzt legten die Decemvirn ihr Amt nicht nieder, sondern mißbrauchten es zu Gewalttätigkeiten gegen das Volk, besonders gegen diejenigen Plebejer, die ihrer Herrschaft gefährlich schienen. Nun geschah es, daß die benachbarten Äquer und Sabiner in die römische Landschaft einbrachen und die Decemvirn gegen sie zwei Heere ins Feld führen mußten. Beide Heere wurden durch die Schuld der Krieger, welche absichtlich ihre Pflicht versäumten aus Unwillen[S. 36] gegen die Decemvirn, geschlagen. Als der erste Schreck vorüber war und von Rom Verstärkung anlangte, rückte das eine Heer in das Gebiet der Sabiner vor. In diesem Heere befand sich ein alter Hauptmann, Siccius Dentatus, der in vielen Schlachten gefochten, acht Feinde im Zweikampfe erlegt und vierzehn Bürgern im Kampf das Leben gerettet hatte, dessen Brust zahlreiche Narben schmückten und dem eine Menge von Bürgerkränzen, goldenen Ketten, Armbändern und anderen Ehrenzeichen als Lohn seiner Heldentaten zuteil geworden waren. Dieser Mann, über die Gewaltherrschaft der Decemvirn empört, forderte seine im Felde stehenden Mitbürger zu einer zweiten Auswanderung nach dem heiligen Berg auf, um die verlorenen Rechte wiederzugewinnen. Als die Decemvirn davon Kunde erhielten, beschlossen sie seinen Tod. Sie sandten ihn, begleitet von einer Schar gedungener Meuchelmörder, in die Umgegend, um den Platz für ein neues Lager zu suchen. Diese überfielen in einem einsamen Hohlwege den ahnungslosen Helden. Aber es ward ihnen schwer den gewaltigen Mann zu fällen, und um seine Leiche lagen viele der Verräter, die er in seiner Notwehr hingestreckt hatte. Die übrigen berichteten im Lager Siccius sei mit einigen seiner Leute in einen Hinterhalt der Feinde geraten und tapfer kämpfend gefallen. Man eilte hin, seine Leiche zu holen: da wurde der Verrat offenbar, denn es lagen keine Feinde, sondern nur Römer um ihn her. Das Heer drohte Aufstand und wollte die Leiche nach Rom tragen, ließ sich aber für diesmal noch dadurch beschwichtigen, daß die Decemvirn dem Gefallenen ein prächtiges Leichenbegängnis mit allen kriegerischen Ehren anordneten.
So nachteilig auch diese Tat für den Ruf der Decemvirn war, so gelang es diesen doch sich in der Gewalt zu behaupten, bis endlich der Frevelmut des Appius Claudius eine allgemeine Empörung gegen sie veranlaßte. Appius hatte die schöne Virginia, die Tochter eines Plebejers, des Virginius, und Braut des Icilius gesehen und strebte nach ihrem Besitze. Anfangs suchte er sie durch lockende Versprechungen zu gewinnen. Da ihm dies nicht gelang, so bewog er einen seiner Klienten die Virginia für die Tochter seiner Sklavin auszugeben und als sein Eigentum zurückzufordern.
Ihr Vater Virginius stand im Lager, als der Klient die Virginia auf offener Straße ergriff und vor den Richterstuhl des Appius Claudius führte, von dem er sie sich nun als[S. 37] Eigentum zusprechen ließ. Auf das Geschrei des um Hilfe stehenden Mädchens strömte eine Menge Volkes herbei. Auch Icilius war herbeigeeilt, und nur mit Mühe vermochte er den Appius zu bewegen, bis zur Ankunft des Vaters die Sache anstehen und die Jungfrau in den Händen derer zu lassen, welche sich für sie verbürgten. Alsbald schickte Appius heimlich einige Diener ins Lager an die Decemvirn, die dort den Oberbefehl hatten, mit dem Auftrage, sie sollten dem Virginius keinen Urlaub gewähren. Doch die Boten des Icilius waren früher gekommen. Virginius hatte bereits Urlaub und war auf dem Wege nach Rom.
Am folgenden Tage erschien er vor dem Richterstuhle des Decemvirn mit seiner Tochter, beide in Trauergewand, von vielen Matronen und Freunden begleitet. Der ganze Marktplatz war von Menschen angefüllt, die das traurige Schauspiel herbeigelockt hatte. Appius bestieg die Richterbühne; sein Klient wiederholte seine Klage, und abermals wurde die Jungfrau ihm als Eigentum zugesprochen. Als er sie ergreifen wollte und der Vater ihn drohend abwies, die Umstehenden aber in ihrer Entrüstung einen schützenden Kreis um Vater und Tochter schlossen, da befahl Appius seinen mit Beilen bewehrten Amtsdienern, den Liktoren, den Haufen zu sprengen und das Mädchen zu ergreifen, und bedrohte mit schwerer Strafe alle diejenigen, die sich gestern und heute gegen seine Richtergewalt gesträubt hätten. Dadurch eingeschüchtert wich die Menge auseinander. Virginius aber, der keine Rettung mehr sah, bat nur noch um die Gunst von seiner Tochter Abschied nehmen zu dürfen. Dies ward ihm gewährt. Da führte er sie zu einer nahen Fleischerbude, ergriff ein Messer und stieß es ihr in die Brust, indem er ausrief: „Hiermit allein, mein Kind, kann ich deine Ehre retten!“ Darauf wandte er sich gegen Appius und schrie: „Bei diesem Blute weihe ich dein Haupt den Göttern der Unterwelt!“, bahnte sich mit dem Messer in der Hand einen Weg durch das Gedränge und gelangte bis ans Tor, um zurück ins Lager zu eilen. Icilius aber zeigte dem Volke den blutenden Leichnam seiner Verlobten und forderte zum Sturz der Decemvirn auf; die Liktoren des Appius wurden übermannt und er selbst floh mit verhülltem Haupte in sein Haus. Auch im Lager brach der Aufruhr los. Das Volk zog zum zweiten Male auf den heiligen Berg und kehrte erst dann nach Rom zurück,[S. 38] als der Senat verordnete, daß die Decemvirn ihr Amt niederlegen und wieder Konsuln an ihre Stelle treten sollten.
Appius Claudius aber, der ruchloseste der Decemvirn, ward in den Kerker geworfen und nahm sich dort selbst das Leben.
Nicht weit von Rom, auf etrurischem Gebiet, lag die mächtige Stadt Veji, die mit den Römern seit lange in Fehde lag und schon oft blutige Kämpfe geführt hatte. Nun geschah es, daß die Vejenter römische Gesandte ermordeten, wofür die Römer Genugtuung verlangten und mit neuem Kriege drohten. Im Vertrauen auf ihre Macht und die Festigkeit ihrer Stadt nahmen ihn die Vejenter an, und es begann ein zehnjähriger Kampf (405–396 v. Chr.), der mit der völligen Zerstörung der Stadt Veji endete. Der Ruhm dieses Sieges gebührte dem Marcus Furius Camillus.
Zehn Jahre lang ward die Stadt von den Römern belagert, aber nicht ohne Unterbrechung. Ihr Heer zog gewöhnlich nur im Sommer und lagerte einige Monate um die Stadt, die übrige Zeit begnügte es sich ihr durch Streifzüge die Zufuhr abzuschneiden. Erst im zehnten Jahre schritt man zu einer förmlichen Belagerung, wobei das römische Heer zum ersten Male den Winter über im Felde blieb und die Mannschaften für ihren Unterhalt einen Sold aus der Staatskasse erhielten.
In diesem letzten Jahre aber erlitten die Römer eine so schwere Niederlage, daß banges Zagen das Heer und auch die Bevölkerung Roms ergriff, und man schon den Feind vor den Mauern erwartete. In dieser Not ward M. Furius Camillus zum Diktator gewählt. So hieß bei den Römern der Beamte, den sie in Zeiten großer Bedrängnis ernannten, und mit unumschränkter höchster Gewalt ausstatteten, um den Staat zu retten, und mit dessen Ernennung die Amtsgewalt aller anderen Obrigkeiten aufhörte.
Camillus sammelte eine bedeutende Streitmacht und rückte, nach einem glücklichen Treffen gegen die Falisker, welche auf Seite der Vejenter standen, vor Veji, schloß die[S. 39] Stadt ein und erbaute rings umher eine Reihe fester Schanzen. Auch ließ er einen unterirdischen Gang graben, welcher in das Innere der Burg von Veji hineinführen sollte. Tag und Nacht wurde ohne Unterlaß an diesen Werken gearbeitet; man hoffte zuversichtlich, daß Vejis Untergang nahe sei. Unter vielen anderen Wunderzeichen hatte es sich im Jahre vorher ereignet, daß der Albanersee, südlich von Rom, im trockenen Hochsommer ungewöhnlich anschwoll und die umliegende Landschaft überschwemmte. Man schickte nach Delphi, um über die Bedeutung der seltsamen Erscheinung den Gott zu befragen. Um Veji war um diese Zeit Waffenruhe, und die Vorposten auf beiden Seiten führten Gespräche mit einander. So hörten die Belagerten von dem Wunder des Sees, und ein etruskischer Seher verkündigte, Veji sei nicht einzunehmen, so lange das Wasser nicht abgeleitet sei. Bald nachher lud ein römischer Hauptmann den Wahrsager zu sich, unter dem Vorwande, er wolle sich einige Zeichen, die ihn allein beträfen, von ihm deuten lassen. Er kam, aber der starke Hauptmann ergriff den schwachen Alten und schleppte ihn mit Gewalt zu dem Feldherrn, der ihn nach Rom abführen ließ. Hier vor dem Senat bekannte der Seher: „Die Schicksalsbücher von Veji verkünden, solange der See überströme, könne Veji nicht eingenommen werden, und wenn sein Wasser das Meer erreiche, werde Rom untergehen.“ Damit stimmte die Antwort des delphischen Orakels überein.
Nun wurde ein Kanal gegraben und das Wasser des Sees auf die Felder geleitet. Vejis Untergang hielt man jetzt für so gewiß, daß Camillus, ehe er die Stadt bestürmen ließ, den Senat befragte, wie er mit der Beute verfahren solle. Der Senat beschloß, daß jeder, der daran teilhaben wollte, ins Lager ziehen möge, und jung und alt strömte hin. Als nun der unterirdische Gang in die Burg bis unter dem Boden des Junotempels vollendet war, gelobte Camillus den Zehnten der Beute den Göttern zu weihen, zur Göttin Juno aber betete er, sie möge den Siegern nach Rom in ein prächtigeres Wohnhaus folgen. Zur bestimmten Stunde wurde der Gang mit Kriegern gefüllt, die Camillus selbst anführte, während das übrige Heer ringsum den Sturm auf die Mauern begann, wo allein die Belagerten ihren Angriff erwarteten. Im Junotempel opferte inzwischen der König der Vejenter, und der Seher erklärte, der werde siegen, welcher der Göttin das[S. 40] Opferfleisch zerlege. Kaum hörten dies die Römer in dem Gange, so brachen sie aus demselben hervor, raubten das Opferfleisch und trugen es zu dem Diktator. Zugleich verbreiteten sich von der Burg aus die aus dem Gange Eingedrungenen in die Stadt, um den Stürmenden die Tore zu öffnen. In allen Straßen wurde gekämpft und unter den Einwohnern ein furchtbares Gemetzel angerichtet, bis der Diktator verkünden ließ die Wehrlosen zu verschonen. Die dem Blutbade entronnen waren, wurden als Sklaven verkauft, und so überschwänglich war die übrige Beute, daß der Diktator, als er sie überschaute, mit gen Himmel gehobenen Händen zu den Göttern gebetet haben soll, daß, wenn ihnen dies Glück übergroß erschiene, das römische Volk nur mit einem kleinen Unfall büßen möge. Bei der Rückkehr nach Rom feierte der Sieger einen prächtigen Triumph, wobei er auf einem mit vier weißen Rossen bespannten Wagen das Kapitol hinauffuhr.
Auch die Stadt Falerii, die es mit den Vejentern gehalten hatte, unterwarf Camillus der Botmäßigkeit der Römer. Zwar trotzten anfangs die Einwohner, die Falisker, auf die Festigkeit ihrer auf steilen Felsen gelegenen Stadt vertrauend, und die Belagerung zog sich in die Länge; bis der hochherzige Sinn, den Camillus hier zu zeigen Gelegenheit hatte, die Falisker zur Unterwerfung geneigt machte. Eines Tages nämlich führte ein Schulmeister eine Schar Kinder aus den vornehmsten Familien der Stadt, wie zur Friedenszeit, zu einem Spaziergange aus der Stadt und zog mit ihnen weit vor die Mauern, bis er zu den Vorposten der Feinde und an das Zelt des Camillus kam. „Diese Knaben sind die Söhne der vornehmsten Bewohner der Stadt. Behalte sie als Geiseln, so bringst du ihre Stadt ohne weitern Kampf in deine Gewalt.“ So sprach der Arglistige, in Hoffnung auf einen großen Lohn. Aber der hochgesinnte Römer ließ dem verräterischen Lehrer die Hände auf den Rücken binden und übergab ihn den Kindern, die ihn unter Rutenschlägen in die Stadt zurücktrieben. Diese Ehrlichkeit des Feindes verwandelte den Haß der Falisker in Bewunderung; sie suchten und fanden in Rom einen billigen Frieden.
In den folgenden Jahren verlor indes der um Rom so hochverdiente Mann die Gunst des Volkes. Ja, ein Volkstribun klagte ihn an einen Teil der vejentischen Beute unterschlagen zu haben. Verlassen von Freunden und Klienten,[S. 41] ging er in die Verbannung, mit dem Gebete an die Götter, daß, wenn man ihm Unrecht tue, bald eine Zeit kommen möge, wo das Vaterland seiner bedürfe. Sein Wunsch ging bald in Erfüllung, wie die folgende Geschichte lehrt.
Aus den Ländern jenseits der Alpen hatten sich nicht lange vor dieser Zeit zahlreiche Schwärme des großen keltischen oder gallischen Volkes in Bewegung gesetzt, um in den fruchtbaren Gefilden der apenninischen Halbinsel neue Wohnsitze zu erobern. Sie besetzten die vom Padus (Po) durchströmte reiche Landschaft zwischen den Alpen und dem Apennin, welche dann nach ihnen Gallia cisalpina (Gallien diesseits der Alpen) genannt und damals noch nicht als zu Italien gehörig betrachtet wurde. Aber mit dieser Eroberung nicht zufrieden, drangen sie bald in neuen Scharen unter König Brennus über das Gebirge südwärts in das Land der Etrurier ein, und belagerten dort die Stadt Clusium, wo einst Porsenna geherrscht hatte. Die Clusinier baten in ihrer Bedrängnis die Römer um Hilfe, und diese ordneten drei Gesandte ab, welche den Galliern mit Krieg drohten, wofern sie nicht das von ihnen ohne alles Recht besetzte Gebiet räumten. Aber die Gallier antworteten: „Zum ersten Male hören wir den Namen der Römer und halten sie für tapfere Männer; unser Recht jedoch beruht auf unsern Waffen, alles gehört den Tapfern!“ Die Gesandten nahmen darauf sogar an dem Kampfe gegen die Gallier teil und töteten dabei einen ihrer Heerführer. Für diese Verletzung des Völkerrechts forderten die Gallier Genugtuung und drangen, da sie ihnen verweigert ward, gegen Rom vor. Am Flüßchen Allia stießen sie auf das römische Heer, das sie in ihrer großen Überzahl und ihrer ungewohnten stürmischen Angriffsweise in jähe Flucht warfen und mit solchem Schreck erfüllten, daß ein großer Teil der Flüchtlinge nicht nach Rom, sondern nach dem näheren Veji und anderen Orten sich rettete. In Rom selbst geriet alles in die größte Bestürzung und Verwirrung. Man fand es unmöglich die Stadt gegen den vorrückenden Feind zu verteidigen und beschloß sie zu verlassen. Nur das Kapitol blieb besetzt; der Senat und etwa tausend Krieger waren entschlossen diese heilige Tempelburg gegen die Barbaren zu verteidigen. Das übrige Volk, darunter auch die Vestalinnen und Priester mit den Heiligtümern, die sie mit sich nehmen konnten, flohen nach[S. 42] dem seit seiner Eroberung verlassenen und leeren Veji und in andre benachbarte Städte. In der Angst und Verwirrung schloß man nicht einmal die Tore. Nur die ältesten Senatoren blieben unten in der Stadt zurück; geschmückt mit den Zeichen ihrer Würde, saßen sie auf ihren Amtssesseln auf dem Markte, des Todes durch Feindeshand gewärtig.
Nicht lange, so erschienen die ersten Gallier vor den Mauern. Da sie die Tore der Stadt offen und unverteidigt fanden, fürchteten sie anfangs einen Hinterhalt. Endlich aber wagten sie sich mit aller Vorsicht hinein. Da fanden sie niemanden als jene alten ehrwürdigen Senatoren, die still und unbeweglich auf ihren Stühlen saßen. Ihr Anblick flößte zugleich Furcht und Verwunderung ein, sodaß sie anfänglich von den Galliern für die Bildsäulen der Schutzgötter Roms gehalten wurden. Erst nach einiger Zeit trat ein kühner Gallier an einen der ältesten, Marcus Papirius, heran und zupfte ihn am Barte, um zu sehen, ob er lebte. Erzürnt hob Papirius sein elfenbeinernes Szepter und schlug damit den Gallier aufs Haupt. Da fielen die Gallier über die Greise her und töteten sie alle. Hiernach verbreiteten sie sich über die ganze Stadt, schleppten alle Beute heraus und steckten die Häuser in Brand. Das ganze Rom, mit Ausnahme des Kapitols, ging in Flammen auf (389 v. Chr.).
Während nun Brennus mit seinen Galliern das Kapitol belagerte, um die Besatzung auszuhungern, unternahm ein anderer Teil seines Heeres einen Streifzug, um Lebensmittel zu holen. Diese Schar kam in die Nähe von Ardea, wo Camillus in der Verbannung lebte. Eilig sammelte er die Ardeaten und überfiel mit ihnen die Gallier, von denen viele niedergemacht wurden, die übrigen sich in wilder Flucht zerstreuten. Durch diesen Erfolg ermutigt, beschloß das nach Veji geflüchtete Volk den Camillus aus der Verbannung zu rufen und zum Diktator zu ernennen. Dazu war die Zustimmung des Senats nötig, der sich auf dem Kapitol befand. Um die Genehmigung einzuholen, erbot sich ein kühner Jüngling, Pontius Cominius. Nachts schwamm er die Tiber hinab, betrat nahe am Kapitol das Ufer, erkletterte die steile Burghöhe und kam, nachdem er seinen Auftrag ausgerichtet, unbemerkt wieder durch die Posten der Feinde hindurch. Am andern Morgen entdeckten die Gallier aus den Fußspuren den Weg, wo jener hinauf- und herabgekommen war, und beschlossen,[S. 43] auf demselben einen Versuch auf die Burg zu machen. In einer mondhellen Nacht, als alles auf dem Kapitole schlief, kamen sie in tiefster Stille, da selbst die Hunde oben sich nicht regten, bis an den Rand der Höhe, als plötzlich das Schnattern der Gänse, die im Heiligtum der Juno gehalten wurden, den M. Manlius aus dem Schlafe weckte. Eiligst lief er der unbewachten Stelle zu und stieß den vordersten Gallier, der eben den äußersten Felsenrand erklommen hatte, in die Tiefe. Sein Sturz riß auch alle ihm Nachfolgenden hinab. So wurde die Burg gerettet. Manlius ward von allen gepriesen und belohnt, die achtlosen Wächter aber zur Strafe über die Felsen in die Tiefe gestürzt.
Schon währte die Belagerung bis in den sechsten Monat, und der Mangel an Nahrung nahm auf der Burg mit jedem Tage zu; schon zwang der Hunger selbst das Leder von den Schuhen und Schilden zu verzehren, und noch immer erschien Camillus nicht zum Ersatz. Aber auch von den Galliern wurden viele durch Seuchen weggerafft. Unter solchen Umständen wurden beide Teile zum Frieden geneigt. Brennus versprach die Stadt und ihr Gebiet zu verlassen, wenn man ihm tausend Pfund Goldes zahle. Als es hierzu gewogen werden sollte, ließ Brennus falsches Gewicht anwenden, und auf die Beschwerde der Römer warf er sein Schwert und Wehrgehäng auf die Wagschale und rief: „Wehe den Besiegten!“ In diesem Augenblicke kam die Nachricht, daß Camillus mit dem Heere von Veji heranziehe, und als er zur Stelle war, erklärte er den ohne seine, des Diktators, Genehmigung geschlossenen Vertrag für ungültig, hieß die Römer das Gold wegtragen, die Gallier aber sich zur Schlacht bereiten: mit Eisen, nicht mit Golde wolle er seine Vaterstadt befreien. In zwei Schlachten schlug er die Gallier und vernichtete sie bis auf den letzten Mann. Brennus wurde gefangen und hingerichtet, wobei man ihm die Worte: „Wehe den Besiegten!“ höhnend wiedergab. Camillus zog triumphierend in die Stadt zurück; das Volk nannte ihn Romulus und pries ihn als Roms zweiten Gründer.
Aber die wiedergewonnene Stadt war, mit Ausnahme des Kapitols, eine öde Brandstätte. Viele der Bürger wünschten nach Veji zu ziehen und sich in den leerstehenden Häusern anzusiedeln; Camillus und der Rat widerrieten. Eines Tages war der Senat versammelt, als gerade ein Hauptmann eine[S. 44] Rotte Krieger über das Forum führte und ihnen zurief: „Halt, hier bleiben wir am besten!“ Dies Wort nahmen die Senatoren für eine glückliche Vorbedeutung; das Volk gab seinen Beifall, und der Wiederaufbau der Stadt wurde beschlossen. Aber noch lange nachher ließen die engen und unregelmäßigen Straßen erkennen, mit welcher Eile der Neubau geschehen war.
Camillus führte noch mehrere glückliche Kriege gegen benachbarte Völker. Bei einem neuen Einfall der Gallier übernahm er in einem Alter von achtzig Jahren noch immer die Diktatur und schlug die Feinde abermals. Kurz darauf raffte ihn die Pest hinweg. Er hatte im ganzen vier Triumphzüge gefeiert und fünfmal die Diktatur bekleidet.
Nach der Vertreibung der Gallier gerieten die Römer noch öfters mit ihnen in Krieg, weil immer neue Schwärme ihre Einfälle in das römische Gebiet wiederholten. In diesen Kämpfen zeichneten sich unter allen Titus Manlius und Marcus Valerius durch Heldenmut und Heldentaten aus.
Einst trat aus den Reihen der Gallier ein riesiger Streiter in prunkender Rüstung hervor und forderte den tapfersten Römer zum Zweikampf heraus. Da kein anderer Römer die Herausforderung anzunehmen wagte, erklärte sich Titus Manlius dazu bereit. Mit Genehmigung des Diktators trat er dem prahlenden Gallier entgegen, und der Kampf begann im Angesicht beider Heere. Mit wuchtigen Hieben seines gewaltigen Schwertes fiel der Riese auf den viel kleineren Römer, aber dieser wich gewandt zur Seite, drang dann dicht an den Leib und hinter den großen Schild des Gegners und durchbohrte ihm mit seinem kleinen Schwerte die Weichen, daß er totwund niederfiel. Weil er dem so erlegten Feinde den aus Draht gewundenen Halsring (torques), den jener nach gallischer Sitte trug, abnahm und selber als Siegeszeichen anlegte, bekam er den Beinamen Torquatus. Die Gallier aber wurden durch diesen Ausgang des Zweikampfes so mutlos,[S. 45] daß sie in der folgenden Nacht ihr Lager verließen und nach Campanien abzogen.
Ein ganz ähnlicher Vorfall ereignete sich bei einem späteren Einbruche der Gallier in das römische Gebiet. Beide Heere hatten sich in einer sehr sumpfigen Gegend gelagert, und keines wollte das andere zuerst angreifen. Auch hier trat ein gallischer Krieger hervor und forderte den tapfersten Römer zum Kampfe. Diesmal nahm ihn Marcus Valerius an und bestand ihn, wie es heißt, unter dem besonderen Schutze der Götter. Denn gleich beim Anfang des Kampfes setzte sich ein Rabe auf den Helm des Valerius, der dies für eine gute Vorbedeutung ansah. Während des Kampfes blendete der Rabe den Gallier durch seinen Flügelschlag und hackte nach ihm mit seinen Krallen. Dadurch wurde dieser so außer Fassung gebracht, daß ihn der Römer mit leichter Mühe erlegte. Um den Leib des getöteten Galliers entstand ein allgemeiner Kampf der beiden Heere, in welchem die Gallier geschlagen wurden. Valerius aber erhielt von diesem Vorfall den Beinamen Corvus (Rabe).
Im Jahre 362 v. Chr. soll mitten auf dem Forum, wahrscheinlich durch ein Erdbeben, ein tiefer und breiter Spalt im Boden entstanden sein, den man vergeblich auszufüllen versuchte; denn alle Erdmassen, die man hineinschüttete, verschwanden spurlos in der Tiefe. Da erklärten die Weissager, er werde sich nur schließen, wenn Rom das Kostbarste, was es habe, hineinwerfe. Alsbald trat, wie die Sage berichtet, Marcus Curtius, ein junger berühmter Krieger, in vollem Waffenschmuck hervor, mahnte die Römer, daß Waffen und tapferer Mut Roms beste Kleinode seien, und weihte sich selbst den Göttern der Unterwelt als Opfer. Darauf schwang er sich auf sein Schlachtroß und sprang in den Abgrund, während das Volk, Männer und Frauen, Früchte und andere Gaben ihm nachwarfen. Und sofort schloß sich der Abgrund über ihm.
Obschon sich die Plebejer durch die Auswanderung auf den heiligen Berg das Recht, Tribunen als ihre Schützer und[S. 46] Vertreter zu wählen, erzwungen hatten, so blieben doch die Patrizier noch immer im Besitze bedeutender Vorrechte. Namentlich konnten zu den höheren Ämtern nur Patrizier gewählt werden, obgleich doch schon viele plebejische Familien an Reichtum und Ansehen hinter keiner patrizischen mehr zurückstanden, und in den häufigen Kriegen zahlreiche plebejische Führer sich durch Tapferkeit und Einsicht hervorgetan hatten. Um den immer dringenderen Forderungen der Plebs auf Anteil an der Regierung auszuweichen, hatte man schon Jahre hindurch an Stelle der Konsuln sogenannte Kriegstribunen gewählt, aber selbst dieses den Plebejern zugängliche Amt war meist den patrizischen Bewerbern zugefallen. Dieser lange erbitterte Streit endete damit, daß immer der eine von den beiden Konsuln aus den Plebejern gewählt werden sollte. Die beiden Tribunen Licinius Stolo und Lucius Sextius waren es, welche den Plebejern dieses Recht erwarben. Der Hergang wird in folgender Weise erzählt.
Der vornehme Patrizier Fabius Ambustus hatte zwei Töchter, von denen die eine mit einem Patrizier, die jüngere mit dem Plebejer Licinius Stolo vermählt war. Einst besuchte die Frau des Licinius, als dieser Volkstribun war, ihre Schwester, deren patrizischer Gatte damals einer der Kriegstribunen war, als sie plötzlich erschrocken zusammenfuhr: die Trabanten des Kriegstribunen, die sogenannten Liktoren, hatten durch Schläge auf das Tor seine Heimkehr verkündigt. Sie verriet dadurch, daß ihr dieser Gebrauch nicht bekannt war, und mußte den Spott der älteren, vornehmeren Schwester über diese Unkenntnis ertragen. Aber sie konnte es nicht verwinden, daß sie der Schwester an Stand und Ehre soweit nachstehen sollte, und ruhte fortan nicht, bis ihr Gatte und selbst der Vater ihr versprachen, sie würden alles aufbieten, daß ihrem Hause und Stande die gleiche Ehre zuteil werde.
Nun brachte Licinius zusammen mit Sextius den Antrag vor das Volk, daß der eine der beiden Konsuln immer aus den Plebejern gewählt werden solle. Diesen Vorschlag bekämpften die Patrizier aus allen Kräften, und bestachen von den zehn Tribunen die acht übrigen, damit diese durch ihren Einspruch den ganzen Antrag vereiteln sollten. Aber Licinius und Sextius hielten fest zusammen und hinderten ihrerseits durch ihre Einsprache die Wahl aller höheren Obrigkeiten fünf Jahre hindurch, während sie selbst vom Volk immer wieder[S. 47] von neuem zu Tribunen gewählt wurden. Mit der Zeit wurde der Widerstand der Patrizier schwächer, da es ihnen nicht mehr gelang die übrigen Tribunen durch Bestechungen für sich zu gewinnen. Endlich, nach einem zehnjährigen Kampfe (376 bis 367 v. Chr.), wurde der Antrag zum Gesetz erhoben. Von da an waren auch die Plebejer zum Konsulat berechtigt, und Lucius Sextius, der mit Licinius so beharrlich um das Recht gestritten hatte, ging aus der Wahl als der erste plebejische Konsul hervor (366).
Doch nicht bloß dieses, sondern noch ein anderes Recht setzten die beiden Tribunen für die Plebejer durch. Bis dahin hatten sich nämlich die Patrizier allein das Recht angemaßt, das Gemeinland des Staates, das durch die fortdauernde Unterwerfung italischer Gemeinden immer größer geworden war, in billiger Erbpacht zu erhalten. Zugleich mit seinem Antrage über das Konsulat brachte deshalb Licinius auch das Gesetz durch, daß kein Patrizier mehr als 500 Morgen des Gemeinlandes besitzen, das übrige aber in Teilen von je sieben Morgen an arme Plebejer verteilt werden sollte.
Durch diese Gesetze, welche die Gleichstellung der Plebejer mit den Patriziern sehr beförderten, erwarben sich die beiden Tribunen ein großes Verdienst um den römischen Staat, der nur durch vollkommene Einheit und Eintracht der beiden Stände zu jener Größe und Macht sich entwickeln konnte, die ihm in der Folgezeit zur Weltherrschaft verhalf. Denn auch zu den drei übrigen höheren Ämtern, welche zum Eintritt in den Senat befähigten, wurden die Plebejer nach und nach zugelassen. Das waren 1. die Prätur, die im Jahre 366 von dem Konsulat abgetrennt wurde. Die Prätoren, anfangs nur einer, später bis acht, leiteten die Gerichte und vertraten die abwesenden Konsuln. 2. Die Ädilen übten die Aufsicht über Handel, Verkehr, Straßen- und Staatsbauten. 3. Die Quästoren verwalteten, als Gehilfen der Konsuln und Prätoren, die Einnahmen und Ausgaben des Staates. Alle diese Beamten wurden nur auf je ein Jahr gewählt. Außerdem wurden alle fünf Jahre aus den angesehensten früheren Konsuln, den Konsularen, zwei Zensoren gewählt, denen es oblag die Listen der drei Bürgerklassen (Senatoren, Ritter, Bürger) zu prüfen und festzustellen, das Einkommen der Bürger einzuschätzen, und damit zugleich eine Oberaufsicht über das sittliche Verhalten jedes einzelnen zu üben und[S. 48] Unwürdige durch Ausstoßung aus ihrer Klasse zu bestrafen. Hatten sie diese Schätzung und Musterung der Bürger (census, daher ihr Name censōres) beendigt, so legten sie ihr Amt nieder. Aus den Familien aber, deren Angehörige eines der hohen Ämter bekleidet hatten, bildete sich mit der Zeit, an Stelle des Patriziats, das ein Geschlechts- oder Geburtsadel gewesen, eine neue Adelsklasse, die einen Dienst- oder Amtsadel darstellte.
Nachdem sich die Römer ganz Latium und die Nachbarstädte im sabinischen und etrurischen Lande untertänig gemacht und die Kämpfe mit den Schwärmen der Gallier siegreich bestanden hatten, gerieten sie in einen langen und wechselvollen Krieg mit dem stammverwandten, großen und streitbaren Bergvolk der Samniter. Diese waren aus ihren rauhen Bergtälern in die fruchtbaren Gefilde Campaniens vorgedrungen, um sich dort festzusetzen. Die Stadt der Sidiciner, Teānum, von ihnen hart bedrängt, wandte sich an die mächtigste Stadt Campaniens, Capua, um Hilfe, und diese hinwieder rief den Beistand der Römer an. So kam es zwischen den Samnitern und Römern zu einem Kampf, der, mit mehrjährigen Unterbrechungen, über fünfzig Jahre, von 343–290 v. Chr. dauerte.
In dem ersten Kriege gegen die Samniter (343–340) zogen zwei Heere unter den beiden Konsuln M. Valerius Corvus und A. Cornelius Cossus ins Feld, von denen das eine den Marsch nach Campanien nahm, das andere bestimmt war in Samnium selbst einzurücken. Valerius schlug sein Lager in der Nähe der griechischen Seestadt Cumä, am Berge Gaurus, auf, und kampflustig rückte ihm der Feind entgegen. In der Schlacht standen seine Reihen unerschüttert und wiesen alle Stürme der Römer zurück. Schon war der Tag weit vorgerückt, als der Konsul selbst an der Spitze seines Heeres mit einem letzten ungestümen Angriff die Samniter endlich zum Weichen brachte. Auf der Flucht wurden viele erschlagen und gefangen, bis die Nacht der Verfolgung ein Ende machte.
Inzwischen war das Heer des andern Konsuls in große Not geraten. Von der Grenze Samniums führte Cornelius Cossus sein Heer über die Gebirge auf einem Wege, der nach der Stadt Beneventum lief. Nirgends zeigten sich Feinde, und die Römer wurden sorglos. So kamen sie durch einen Paß in eine tiefe Talschlucht, wo die Samniter die Höhen ringsum besetzt hatten. Doch nicht eher gewahrte man sie, als bis schon der Rückweg abgeschnitten war. In dieser Gefahr erbot sich der Kriegstribun P. Decius mit den beiden ersten Schlachtreihen einer Legion, 1600 Mann, einen Gipfel zu besetzen, der den Weg, aus dem die Samniter vordrangen, beherrschte. Es gelang ihm denselben vor dem Feinde zu erreichen. Von hieraus griff er diese an und zog ihren Angriff auf sich, sodaß das übrige Heer den Bergpaß wieder erreichen und in einiger Entfernung von da eine bessere Stellung nehmen konnte. Decius behauptete sich indessen mit den Seinen in unaufhörlichem Gefecht bis in die Nacht. Während sich nun die Samniter um die Höhe lagerten und sich dem Schlafe überließen, machte sich der kleine Haufe der Römer nach der zweiten Nachtwache in aller Stille auf, um sich einen Weg zu ihrem Heere zu bahnen. Sie waren schon in der Samniter Mitte, als einer von ihnen an einen Schild stieß und dieses Geräusch die zunächst liegenden Samniter aufweckte. Allein ehe die schlaftrunkenen und verwirrten Feinde sich zu gehörigem Widerstande geordnet hatten, gelang es den Römern zu entrinnen. In der Nähe des römischen Lagers ließ Decius sie Halt machen, bis es tage; denn es gezieme sich nicht, daß so tapfere Männer unter dem Dunkel der Nacht ins Lager einrückten. Auf die Kunde, daß die, welche sich für die Rettung aller dem Tode dargeboten, wohlerhalten und in der Nähe wären, zog ihnen fast das ganze Heer aus dem Lager entgegen. Unter allgemeinem Jubel rückte die tapfere Schar ins Lager. Als dort der Konsul anhub ihm eine Lobrede zu halten, unterbrach ihn Decius mit der Mahnung lieber sofort den Feind zu überraschen, bevor er sich von dem nächtlichen Schrecken erholt und in sein festes Lager zurückgezogen hätte. Und so geschah es. Ungesäumt wurden die Legionen über die Berge geführt, die Feinde zerstreut, verfolgt und alle, die sich in ihr Lager gerettet, niedergehauen und das Lager geplündert. Decius erhielt als Belohnung von dem Konsul einen goldenen Kranz, hundert Rinder und einen weißen Stier mit vergoldeten[S. 50] Hörnern; seine Leute empfingen auf immer doppelte Portionen, jeder zwei Mäntel und einen Ochsen. Das Heer überreichte dem Decius einen aus Gras gewundenen Kranz, den gewöhnlichen Ehrenlohn dessen, der eine Schar aus Feindes Gewalt und Belagerung befreit hatte.
Ein nochmaliger Sieg des Valerius bei Suéssula führte den Frieden herbei, in dem die Römer Campanien behielten. Aber nach Beendigung eines Kampfes mit den Latinern (s. XVII) veranlaßte die Anlage einer römischen Kolonie in der Grenzstadt Fregellä den zweiten Samniterkrieg (326–304).
Im vierten Jahre dieses Krieges hatten die Römer, da die Zahl der Feinde sich durch den Beitritt mehrerer Stämme im Süden Italiens vermehrt hatte, den Papirius Cursor zum Diktator gewählt. Allein abergläubische Furcht hielt den Fortgang seiner Unternehmungen auf. Da man glaubte, daß bei der feierlichen Wahl des Diktators ein Fehler vorgekommen sei, so eilte Papirius nach Rom, um sie von neuem anstellen zu lassen, befahl aber seinem Unterfeldherrn, dem Reiterobersten (magister equitum) Fabius Rullianus während seiner Abwesenheit ruhig im Lager zu bleiben. Allein durch Ehrgeiz und Kampflust angetrieben, lieferte dieser dennoch den Samnitern ein Treffen, und das Glück war ihm so günstig, daß er den Feinden eine schwere Niederlage beibrachte. Alle freuten sich dieses Sieges. Als aber der Diktator ins Lager zurückkehrte, ließ er sogleich die Legionen zusammenberufen und den Fabius vor sich fordern. Vergebens suchte sich dieser wegen seines Ungehorsams zu verteidigen. Der Diktator befahl ihn zu entkleiden und hinzurichten. Aber Fabius entfloh den Händen des Liktors, der ihn ergriffen hatte, und barg sich unter die Haufen der umherstehenden Krieger. Es entstand ein lautes Murren; die Befehle des Diktators wurden nicht mehr gehört, und der Tumult dauerte, bis die anbrechende Nacht die Versammlung zu entlassen nötigte. In der Nacht floh Fabius aus Furcht vor der unerbittlichen Strenge des Diktators nach Rom. Auf Betreiben seines Vaters, eines sehr angesehenen Mannes, wurde sogleich der Senat berufen. Hier klagte er über die Härte des Diktators und beschwor den Senat das Leben seines Sohnes zu retten. Dieser war dazu geneigt, aber er vermochte es nicht. Denn plötzlich erschien der Diktator selbst in seiner Mitte, fest entschlossen den Ungehorsam seines Untergebenen kraft seines[S. 51] Amtes nach Kriegsrecht zu bestrafen. Umsonst baten ihn alle Senatoren um Milde. Papirius befahl den Fabius zu ergreifen. Nun blieb dem alten Fabius nur noch ein Ausweg übrig: er wandte sich an die Versammlung der Volksgemeinde. Dies war zwar eine gesetzwidrige Handlung, denn gegen die Entscheidung des Diktators gab es keine Berufung (provocatio) an das Volk. Gleichwohl gestattete sie Papirius. Er ging in die Versammlung und zeigte dem Volke, wie nötig es sei die Strenge der Kriegszucht aufrecht zu halten und die Amtsgewalt des Diktators unverletzt zu wahren. Obschon nun das Volk geneigt war, den Fabius zu retten, konnte es doch das Recht des Diktators nicht mißachten. Es wagte daher keine Entscheidung, sondern legte nur seine Fürbitte für das Leben des Reiterobersten ein. Eben dies taten auch seine Verwandten, indem sie sich zu den Füßen des Diktators niederwarfen. Da erst ließ Papirius Milde walten. Nachdem er das Ansehen des Oberbefehls vor Senat und Volk behauptet hatte, konnte er den Ungehorsam verzeihen, nicht weil er mußte, sondern weil er wollte. Und er tat es zur Freude des ganzen Volkes.
In demselben Kriege erlitten die Römer unter der Anführung des Veturius Calvinus und Spurius Postumius in den caudinischen Engpässen eine bittere Schmach (321). Beide Konsuln lagerten bei Calatia in Campanien. Darauf gründete Gavius Pontius, der Feldherr der Samniter, einen Kriegsplan. Er ließ das Gerücht verbreiten, daß er jenseits des Gebirges die Stadt Lucéria, eine von den Römern in Apulien angelegte Festung, belagere. Um dieser wichtigen Stadt schleunige Hilfe zu leisten, schlugen die Konsuln den kürzesten Weg ein, der durch die caudinischen Pässe führte. So nannte man ein tiefes Wiesental, nicht weit von Caudium, einer Stadt der Samniter, das rings von hohen bewaldeten Bergzügen eingeschlossen war und nur einen schmalen Eingang und Ausgang hatte. Um dieses Tal herum hatte Pontius sein Heer in den Wäldern versteckt, und ohne Arges zu ahnen, gingen die unvorsichtigen Konsuln in die ihnen gelegte Falle.
In langem Zuge rückten die Legionen mit allem Troß durch das Tal hin zum jenseitigen Ausgang, fanden ihn aber mit gefällten Bäumen und vorgewälzten mächtigen Felsblöcken verschlossen. In demselben Augenblick bemerkten sie, daß die[S. 52] Höhen ringsum von bewaffneten Samnitern wimmelten, welche die Anrückenden hohnlachend erwarteten. Sie kehrten daher eilig zurück, aber nun war auch schon der Eingang von den Samnitern besetzt. In dieser verzweiflungsvollen Lage schlugen die Römer, 20000 Mann stark, ein enges dürftiges Lager auf. Ein Versuch sich durchzuschlagen mißlang; ihre Not ward von Tag zu Tag größer; endlich zwang sie der Hunger Gesandte an den samnitischen Heerführer Pontius zu schicken und um Frieden zu bitten. Pontius ließ seinen Vater, einen wegen seiner Einsicht und Erfahrung hochgeachteten Greis, um Rat fragen. Dieser antwortete: „Laßt alle Römer frei und ungekränkt abziehen.“ Pontius, verwundert über diese Antwort, glaubte, daß der Bote falsch gehört hätte. Er schickte daher zum zweiten Male an seinen Vater. Jetzt gab der Alte die Antwort: „Tötet alle Römer ohne Unterschied.“ Niemand verstand den Sinn dieser so verschiedenen Bescheide. Pontius ließ daher seinen Vater selbst herbeiholen. Nun gab der Greis die Gründe seiner Ratschläge an: „Ihr müßt“, sagte er, „entweder alle Römer töten, um ihre Kraft auf lange Zeit zu schwächen, oder ihr müßt sie alle schonen, um durch solche Großmut ihren Dank und Freundschaft zu gewinnen.“ Aber Pontius verwarf beides und wählte einen Mittelweg. Er ließ den Römern durch ihre Gesandten erwidern: Rom solle Frieden schließen, ganz Samnium räumen, die dort angelegten Kolonien aufgeben, das Heer aber Mann für Mann waffenlos durchs Joch gehen und sechshundert aus dem Ritterstande als Geiseln stellen.
Über diese schimpflichen Vorschläge gerieten die Römer in die größte Bestürzung. Keiner wagte zur Annahme zu raten, und doch konnten sie in ihrer äußerst bedrängten Lage nicht länger ausharren. Sie mußten sich darein fügen; die Konsuln und die Führer der Kohorten bestätigten den Friedensvertrag mit ihrem Eide. Entwaffnet und halb entkleidet gingen erst sechshundert Ritter, die als Geiseln ausgeliefert werden mußten, dann die Konsuln und Hauptleute, endlich die übrigen Mannschaften unter dem Joch, das durch einen quer über zwei Ständer gelegten Speer gebildet wurde, hindurch. Es war der größte Schimpf, der einem freien Kriegsmann angetan werden konnte; denn er erniedrigte die Freien zum Knecht. Mit Hohn und Spott schauten die ringsum aufgestellten Samniter diesem Vorgange zu. Waffen, Pferde,[S. 53] Knechte, alle Habe außer dem Kleide, das jeder trug, blieben dem Sieger. Voll Scham und stiller Wut zogen die Römer über Capua, wo sie liebreich aufgenommen wurden, nach Rom, das sie erst im Dunkel der Nacht zu betreten wagten. Der römische Senat aber bestätigte den geschlossenen Vertrag nicht; er beschloß, daß alle, die den Frieden beschworen hatten, den Samnitern ausgeliefert werden sollten. Damit glaubte er aller Verbindlichkeit, den Frieden zu halten, überhoben zu sein. Es wurden also die beiden Konsuln und die anderen, welche den Vertrag geschlossen hatten, gefesselt nach Caudium vor den Amtsstuhl des Pontius geführt. Dieser jedoch lehnte ihre Annahme ab, indem er sagte: „Entweder muß das römische Heer, das sich in der Gewalt der Samniter befunden hat, in seine vorige Lage zwischen den Bergpässen zurückkehren, oder das römische Volk muß den Frieden halten.“ Zugleich ließ er den Überlieferten die Fesseln lösen und schickte sie unverletzt nach Rom zurück. Hier rüstete man in Eile ein neues Heer, das im zweitfolgenden Jahre (319), unter der Führung des bewährten Papirius Cursor, nach dem von den Samnitern eroberten Luceria vordrang, dem samnitischen Heere eine schwere Niederlage beibrachte, Luceria und die dort verwahrten römischen Geiseln zurückgewann, und die samnitische Besatzung nun ebenfalls durchs Joch gehen ließ. So löschten die Römer ihre Schande in blutiger Wiedervergeltung aus.
Gleich nach Beendigung des ersten Samniterkrieges, im Jahre 340, brach ein Kampf zwischen den Römern und den ihnen seit alters verbündeten Latinern aus. Die Latiner hatten Gesandte nach Rom geschickt und verlangten, daß fortan die Hälfte des Senats und der eine Konsul aus ihnen gewählt und alle latinischen Städte in die volle Gemeinschaft des römischen Staates aufgenommen werden sollten. Solche Forderung erschien dem römischen Senate als freche Anmaßung, und der Konsul T. Manlius rief den Jupiter, in[S. 54] dessen Tempel die Sitzung stattfand, zum Zeugen der schmachvollen Zumutung an. Da soll der latinische Gesandte Annius dem römischen Jupiter Trotz und Hohn geboten, aber sofort auch des Gottes Zorn erfahren haben. Denn als er die Stufen des Tempels hinabeilte, strauchelte er, fiel hinab und lag in Ohnmacht. Kaum entgingen die Gesandten der Wut des Volkes. Der Senat aber beschloß den Krieg gegen die Latiner.
Die Konsuln Titus Manlius und Decius Mūs zogen mit zwei Heeren ins Feld. Am Fuß des Vesuvius kam er zur entscheidenden Schlacht. Als die Heere einander gegenüber standen, verkündeten die Konsuln, bei Todesstrafe sollte sich kein Römer bei den Vorposten in ein Gefecht einlassen. Doch der eigene Sohn des Manlius handelte dem Befehle zuwider. Abgeschickt mit einem Geschwader Reiter, um die Feinde zu beobachten, begegnete er einem tusculanischen Befehlshaber, der ihn zum Zweikampf forderte. Um dem Vorwurf der Feigheit zu entgehen, nahm Manlius den Kampf an und hatte das Glück den Gegner zu erlegen und ihn seiner Waffen zu berauben. Frohlockend kehrte er als Sieger ins Lager zurück. Allein sein Vater ließ diese Verletzung der Kriegszucht nicht ungeahndet: er ließ den eigenen Sohn im Angesichte des ganzen Heeres durch den Liktor enthaupten.
Vor der Schlacht am Vesuv sahen beide Konsuln zu gleicher Zeit im Traume eine übermenschliche Gestalt, welche ihnen verkündete, daß von dem einen der kämpfenden Heere einer der Führer, das andere Heer aber ganz den Todesgöttern und der Mutter Erde verfallen sei. Sie kamen deshalb überein, daß derjenige von ihnen, dessen Flügel zuerst weichen würde, sich selber und damit zugleich das feindliche Heer den unterirdischen Göttern weihen sollte. Bald nach dem Anfang der Schlacht ward der linke Flügel, den Decius Mus befehligte, zurückgedrängt. Da rief dieser einen Priester herbei, der ihm den Spruch vorsagte, mit dem er, über einem Schwerte stehend und das Haupt verhüllt, sein Leben den Göttern der Unterwelt weihte. Dann bestieg er von neuem sein Schlachtroß und stürzte sich mitten in die Feinde, Tod und Verderben um sich her verbreitend, bis er von Geschossen durchbohrt niedersank. Diese heldenmütige Aufopferung belebte seine Truppen mit neuem Mut; sie stellten sich aufs neue dem Feinde entgegen und erfochten endlich durch die geschickte Führung des[S. 55] Manlius einen vollständigen Sieg. Noch zwei Jahre widerstanden die Latiner; dann mußten sie sich den harten Friedensbedingungen Roms unterwerfen (338).
Wie damals Decius Mus, der Vater, so weihte sich sein Sohn Publius Decius, im dritten samnitischen Kriege (298–290), den Todesgöttern. In der Schlacht bei Sentinum (295) hatte er schon zweimal die Reitergeschwader der Gallier, die mit den Samnitern verbunden waren, zurückgeworfen, als diese einen dritten Angriff mit ihren Streitwagen machten, und durch das Ungewöhnliche der Kampfart die Römer in Schrecken und Verwirrung brachten. Da ließ Publius Decius durch den Priester sich und die Feinde den Todesgöttern weihen. Nachdem er die Weihung in derselben Weise, wie sein Vater in der Schlacht am Vesuv, erhalten hatte, fügte er noch die Fluchformel hinzu: „Vor mir her treibe ich Angst und Flucht, Mord und Blutvergießen, der himmlischen und der unteren Götter Zorn. Todesgrausen bringe ich auf die Feldzeichen, auf Wehr und Waffen der Feinde. Ein und derselbe Ort soll mein und der Feinde Grab sein!“ Darauf spornte er sein Roß in die dichtesten Scharen der Feinde und fiel unter ihren Geschossen. Ihm nach die Römer mit neuem Mute, und die Schlacht endigte mit der vollständigen Niederlage des Feindes.
Schon hatten die Römer die mächtigsten Völker Italiens unterjocht; Etrusker, Latiner, Campaner, Samniter und viele andere Völkerschaften standen unter ihrer Herrschaft, als sie in Kampf gerieten mit der griechischen Stadt Tarent, in Unteritalien, die sich durch Schiffahrt, Handel und Kunstfleiß zu Reichtum und Macht emporgeschwungen hatte.
Zwischen Römern und Tarentinern bestand ein alter Vertrag, der den Römern nicht gestattete über das lacinische Vorgebirge in Unteritalien hinauszusegeln. Als nun einst eine römische Flotte durch einen Sturm über dieses Vorgebirge hinaus in den Hafen von Tarent getrieben wurde, erklärten dies die Tarentiner für einen Friedensbruch. Sie saßen gerade im Theater, von dem man die Aussicht auf das Meer hatte,[S. 56] und bemerkten die heraufsegelnden Schiffe. Von einem Redner aufgehetzt, eilte eine Menge bewaffnet auf ihre Schiffe und machte auf die unvorbereiteten römischen Fahrzeuge einen Angriff. Vier Schiffe wurden versenkt, der Anführer und die Mannschaft ermordet. Für diesen blutigen Friedensbruch forderte der römische Senat Genugtuung; aber seine Gesandten, in das Theater vor das versammelte Volk geführt, wurden mit Spott und Hohn empfangen. Ihr Führer Postumius redete in griechischer Sprache zur Menge, ohne daß diese auf den Inhalt seiner Worte achtete, aber so oft er einen Fehler gegen die Aussprache beging, lachte das Volk laut auf und schalt ihn einen Barbaren. Ein gemeiner Possenreißer drängte sich an ihn und besudelte sein Gewand. Postumius zeigte dem Volke das beschmutzte Gewand, und neues Hohngelächter erhob sich. Da sprach der Gesandte: „Lacht, so lange ihr mögt, ihr werdet auch lange genug weinen!“ Als das Volk heftig dagegen schrie, rief Postumius: „Damit ihr euch noch mehr erzürnt, so sage ich euch, dies Gewand wird in Strömen eures Blutes rein gewaschen werden.“ Kurze Zeit darauf begannen die Römer den Krieg. Da aber die Tarentiner ein weichliches, unkriegerisches Volk waren, so riefen sie Pyrrhus, den König von Epirus, zu Hilfe. Dieser kriegskundige und kampfliebende Fürst, der sein Geschlecht von dem vielgefeierten Helden Achilleus ableitete, wurde von seinem unruhigen Geiste immer zu neuen Kriegsfahrten und Abenteuern getrieben und strebte ein zweiter Alexander der Große zu werden. Er ging daher gern auf den Antrag der Tarentiner ein.
Im Frühling des Jahres 281 setzte Pyrrhus mit einem kriegsgeübten Söldnerheere von 22000 Mann zu Fuß, 3000 Reitern und 20 zum Kriege abgerichteten Elefanten nach Italien über. Zwar verlor er bei der Überfahrt durch einen Sturm einen Teil seiner Schiffe und Mannschaft; aber in Tarent angelangt, begann er alsbald mit großer Umsicht den Kampf gegen das mächtige Rom zu rüsten. Er hoffte alle unterworfenen Stämme Italiens unter seiner Fahne zu vereinigen. Zunächst führte er in dem an üppiges Leben gewöhnten Tarent ein strenges kriegerisches Regiment ein, was ihn bei den Bürgern keineswegs beliebt machte. Er hob die tüchtigsten von ihnen für den Kriegsdienst aus und untersagte ihnen Gelage und sonstige Lustbarkeiten.
Die erste Schlacht mit den Römern erfolgte bei Heraklea in Lucanien (280). Als Pyrrhus vorher das Lager der Römer betrachtete, soll er ausgerufen haben: „Die Lagerordnung dieser Barbaren ist durchaus nicht barbarisch; bald werden wir auch ihre Taten kennen lernen.“ Die heiße Schlacht, welche nun entbrannte, in der dem König selbst ein Roß unter dem Leibe getötet ward, wurde endlich durch den Ungestüm der auf die Römer eindringenden Elefanten zum Vorteil des Pyrrhus entschieden. Als er das Schlachtfeld in Augenschein nahm und die Leichen der Römer betrachtete, die alle mit Wunden auf der Brust dalagen, soll er gesagt haben: „Mit solchen Kriegern wäre die Welt mein, und sie gehörte den Römern, wenn ich ihr Feldherr wäre!“ Auch ließ er ihre Toten zusammen mit den seinigen bestatten; den Gefangenen bot er an unter ihm zu dienen, und als sie sich weigerten, behandelte er sie dennoch mit großer Milde.
Obschon der König den Sieg errungen hatte, sandte er doch den Kineas, einen Mann von großer Klugheit und Beredsamkeit, nach Rom, um die Römer zum Frieden zu stimmen. Dieser bot alle Kraft seiner Rede auf; der Senat war schwankend und verbrachte mehrere Tage mit Beratungen. Da ließ sich der alte blinde Appius Claudius, der seit Jahren den Senat nicht mehr besucht hatte, auf einer Sänfte in den Senat tragen, wo er die Ratsherren wegen ihrer Unschlüssigkeit und Neigung zum Frieden heftig anließ. „Bis heute,“ sagte er, „habe ich immer den Verlust meiner Augen beklagt, jetzt aber wünsche ich auch noch taub zu sein, um so Unwürdiges nicht hören zu müssen.“ Da schlug die Strömung um. Dem Kineas wurde befohlen, die Stadt zu verlassen und seinem König zu sagen, daß an Frieden und Freundschaft mit ihm nicht zu denken sei, bevor er nicht Italien verlassen hätte. Erstaunt über so stolze Antwort der Besiegten, soll der König den Kineas gefragt haben, welchen Eindruck die Stadt Rom und der Senat auf ihn gemacht hätten. „Mir erschien“, antwortete jener, „die Stadt gleichwie ein Tempel, der Senat aber gleich einer Versammlung von Königen.“
Nach der Schlacht bei Heraklea war Pyrrhus bis in die Nähe von Rom vorgedrungen, zog sich dann aber, ohne einen Angriff auf die Stadt zu wagen, wieder nach Tarent zurück. Um diese Zeit schickten die Römer drei Gesandte zu ihm, um über eine Auswechselung der Gefangenen zu unterhandeln,[S. 58] unter ihnen den Gajus Fabricius Luscínus, einen zwar armen, aber stolzen und unbeugsamen Senator. Der König empfing die Gesandten sehr freundlich und hoffte, daß sie ihn um Frieden bitten würden; doch sie sprachen nur von der Auslösung der Gefangenen. Dieses Begehren schlug er ihnen zwar ab, unterredete sich aber insgeheim mit Fabricius, den er seiner Armut wegen zu bestechen hoffte. Allein der Römer wies des Königs Versprechungen und Geschenke mit stolzer Verachtung zurück. Am folgenden Tage gedachte Pyrrhus seinen Mut auf eine Probe zu stellen. Er verbarg seinen größten Elefanten hinter einem Vorhang des Zeltes, worin er den Römer empfing. Auf ein gegebenes Zeichen mußte das ungeheure Tier ein Gebrüll erheben und seinen Rüssel über den Kopf des Fabricius ausstrecken. Aber Fabricius blieb unerschüttert. Lächelnd sagte er zum König: „So wenig mich gestern dein Gold verlockt hat, so wenig schreckt mich heute dein Tier.“ Erfüllt von Bewunderung eines so reinen und so unerschrockenen Charakters, und um ihm einen Beweis seiner Hochachtung zu geben, gewährte der König allen Gefangenen einen Urlaub, um nach Rom zu gehen und dort das Fest der Saturnalien zu feiern. Wenn der Senat seine Friedensbedingungen annehme, sollten sie frei sein, wo nicht, so sollten sie geloben, in die Gefangenschaft zurückzukehren. Und keiner von ihnen blieb aus, als der Senat die Bedingungen verworfen hatte.
Auch die zweite Schlacht bei Askulum in Apulien (279) gewann Pyrrhus, erlitt aber so starke Verluste, daß er denen, welche ihm zu seinem Siege Glück wünschten, erwiderte: „Noch einen solchen Sieg, und ich bin verloren!“ Abermals sandte er den Kineas nach Rom, um über den Frieden zu unterhandeln, und mit ihm alle Gefangenen reichlich beschenkt und bekleidet. Aber vergeblich machte dieser bei angesehenen Männern und Frauen die Runde und bot Geschenke von Gold und kostbarem Schmuck, um die Gemüter für den Frieden zu stimmen. Der Senat beharrte bei dem Entschlusse nicht eher mit Pyrrhus zu unterhandeln, als bis er Italien verlassen hätte.
Im folgenden Jahre (278) gab Gajus Fabricius als Konsul abermals einen Beweis seines edlen Sinnes. Er erhielt eines Tages einen Brief vom Leibarzte des Königs, worin sich dieser erbot gegen eine ansehnliche Belohnung seinen Herrn zu vergiften. Aber Fabricius, voll Abscheu über[S. 59] solchen Verrat, entdeckte die Sache dem König. Über diese Redlichkeit erstaunt, rief Pyrrhus aus: „Es ist schwerer den Fabricius von seiner Rechtschaffenheit abzubringen, als die Sonne von ihrem Laufe!“ Sogleich gab er alle römischen Gefangenen, die er noch hatte, ohne Lösegeld frei, und die Römer, um sich nicht an Großmut übertreffen zu lassen, schickten ihm ebenso viele Gefangene zurück.
Da Pyrrhus keine Hoffnung mehr hatte den Krieg auf eine für ihn rühmliche Weise zu beendigen, so war ihm eine Einladung der Syrakusaner, die ihn gegen die Karthager zu Hilfe riefen, sehr willkommen. Auch in Sizilien war er anfangs glücklich; zuletzt aber nahm der Krieg eine für ihn so ungünstige Wendung, daß er auf den Ruf der Tarentiner gern nach Italien zurückkehrte (276).
Damals führte Curius Dentatus den Oberbefehl über das römische Heer. Dieser Mann war ein vollkommenes Muster von Mäßigkeit und freiwilliger Armut. Einst kamen Gesandte der Samniter zu ihm, um ihn durch eine große Geldsumme für ihre Sache günstig zu stimmen. Sie fanden ihn, als er gerade am Herde saß und sich selbst sein Rübengericht bereitete. Trotz seiner Armut wies er das Angebot zurück, indem er sagte, es sei angenehmer über solche, welche Gold besäßen, zu herrschen, als es selbst zu besitzen. Nur zwei Reitknechte begleiteten ihn ins Feld, und seine Töchter mußten auf Staatskosten ausgestattet werden. Diesem Feldherrn gelang es endlich den Pyrrhus zu schlagen und aus Italien zu vertreiben. Er hatte bei Beneventum eine feste Stellung eingenommen, als ihn Pyrrhus angriff (275). Diesmal ließen sich die Römer durch die Elefanten nicht schrecken. Sie empfingen die anrennenden Ungetüme mit Brandpfeilen, wodurch diese gereizt und verwirrt sich rückwärts auf die Reihen der Feinde warfen und in völlige Unordnung brachten. Damit war der Sieg der Römer entschieden. Das Lager des Königs mit vieler Beute, darunter vier Elefanten, fiel in ihre Hände. Jetzt mußte sich Pyrrhus entschließen Italien zu verlassen; er kehrte mit wenigen Reitern nach Tarent zurück und schiffte bald nachher nach Epirus über.
Sein unruhiger, kampflustiger Sinn trieb ihn bald in neue Kriege. Einst drang er bei dunkler Nacht in die Stadt Argos im Peloponnes ein; da ward er im Straßenkampf von einem Stein, den eine alte Frau auf ihn schleuderte, tödlich[S. 60] getroffen (272). In dem Jahre seines Todes mußte sich Tarent an die Römer ergeben. Nachdem diese in den nächsten Jahren auch das übrige Süditalien sich unterworfen hatten, waren sie die Herren der ganzen Halbinsel bis nordwärts zum Gebiet der Gallier.
Kaum war ganz Italien der Herrschaft der Römer untertan, so kamen sie mit den Karthagern auf Sizilien in feindliche Berührung. Auf dieser Insel hatten sich seit zwanzig Jahren campanische Söldner, die sogen. Mamertiner (Marsmänner), die vorher dem Fürsten von Syrakus gedient hatten, der Stadt Messāna bemächtigt und sich dort sowohl gegen die Syrakusaner, wie gegen die Karthager, die beiden Herren der Insel, behauptet. Diese baten nun, von den Karthagern hart bedrängt, in Rom um Hilfe, und der Senat beschloß sie zu gewähren. So wurde denn das erste römische Heer auf schlechten Fahrzeugen nach Sizilien übergesetzt, und es entbrannte der langwierige und blutige Krieg, der, weil er gegen die Karthager oder Punier geführt ward, der erste punische Krieg genannt wird.
Im Fortgange dieses Kampfes, den die Römer zunächst auf Sizilien mit großem Erfolge begonnen hatten, erkannten sie doch bald das Bedürfnis einer Seemacht, und mit bewundernswürdiger Raschheit erbauten sie in sechzig Tagen eine Flotte von 100 größeren und 20 kleineren Schiffen, wobei ihnen ein gestrandetes karthagisches Kriegsschiff zum Muster diente. Den Oberbefehl über die Flotte erhielten die Konsuln Gajus Duilius und Cornelius Scipio. Da diese einsahen, daß ihre Schiffe mit der noch ungeübten Mannschaft von den feindlichen an Geschwindigkeit der Bewegungen übertroffen wurden, so versuchten sie diesen Nachteil dadurch auszugleichen, daß sie Enterbrücken an ihren Schiffen anbrachten. Auf jedem Schiff nämlich ward vorn ein 24 Fuß hoher Mast aufgerichtet und an dessen Fuß eine drehbare, 36 Fuß lange und 4 Fuß breite Leiter befestigt, die man mittels eines Taues am Mast emporzog und, sobald man einem feindlichen Schiffe nahe[S. 61] genug gekommen war, niederfallen ließ, wobei sie mit ihrer hakenförmigen eisernen Spitze in das feindliche Verdeck einschlug, und so eine Brücke bildete, auf der die Besatzung hinüber gelangen und dort wie zu Lande kämpfen konnte.
Nachdem die römische Flotte mit dieser Vorrichtung versehen und, nach einem glücklichen Treffen mit einem feindlichen Geschwader, in Messana eingelaufen war, ging sie, unter dem Konsul Duilius — der andere war mit den ersten Schiffen, die er in See geführt, von den Puniern überrascht und gefangen worden — der karthagischen Flotte, die von Pánormos (heute Palermo) heranfuhr, kühnlich entgegen. Bei Mylä, nordwestlich von Messana, trafen sich die beiden Flotten. Sobald die Punier ihrer Gegner ansichtig wurden, gingen sie ihnen in solcher Siegeszuversicht entgegen, daß sie nicht einmal eine Schlachtordnung bildeten. Fünfzig ihrer Schiffe, darunter das des Admirals, wurden von den Enterhaken ergriffen und gewonnen oder versenkt, die übrigen zur Flucht genötigt (260). Der siegreiche Konsul feierte unter großem Jubel des Volkes seinen Triumph wegen der ersten gewonnenen Seeschlacht. Auch wurde ihm für sein ganzes Leben die Auszeichnung bewilligt, daß er sich abends, wenn er von Gastmählern heimkehrte, mit einer Fackel vorleuchten und von einem Flötenspieler begleiten lassen durfte, was damals noch keinem Römer gestattet war. Auf dem Forum ward eine marmorne, mit den Schnäbeln der eroberten Schiffe verzierte Denksäule aufgestellt, deren Reste noch jetzt erhalten sind.
Im weiteren Verlaufe des Krieges zeichnete sich der Konsul Marcus Atilius Régulus durch Kühnheit und seltene Charakterstärke in Glück und Unglück aus. Nachdem er beim Berge Eknŏmos an der Südküste von Sizilien die Karthager geschlagen hatte (256), setzte er nach Afrika über, um die Feinde in ihrem eigenen Lande zu bekriegen. Er landete glücklich und drang siegreich vor. Er eroberte viele feindliche Städte und bedrängte die Karthager so sehr, daß sie Frieden geschlossen haben würden, wenn nicht die Bedingungen des Regulus zu hart gewesen wären. Als die Gesandten um mildere Bedingungen flehten, antwortete er ihnen, sie sollten siegen oder den Siegern gehorchen, und an den römischen Senat schrieb er: „Ich habe die Tore Karthagos mit Schrecken versiegelt.“
Aber plötzlich änderte sich die Lage der Dinge. Xánthippus, ein erfahrener griechischer Heerführer, war den[S. 62] Karthagern von Sparta aus zu Hilfe gekommen, und diesem gelang es, das Kriegsglück Karthagos einigermaßen wieder herzustellen. In einem hartnäckigen Treffen bei Tunes (255) überwand er den Regulus, nahm ihn gefangen und führte ihn nach Karthago, wo er fünf Jahre lang im Kerker schmachten mußte.
Mittlerweile wurde der Krieg zwischen Rom und Karthago mit abwechselndem Glücke fortgesetzt, bis endlich die erschöpften Karthager den Frieden wünschten. In der Person des Regulus glaubten sie einen passenden Vermittler zu besitzen. Sie schickten ihn daher nach Rom, um über den Frieden zu verhandeln, vorher aber ließen sie ihn schwören, daß er zurückkehren werde, wenn er nicht imstande wäre, den Frieden herbeizuführen. Regulus kam nach Rom und trug dem Senat seinen Auftrag vor. Aber weit entfernt davon, dem Senat zum Frieden zu raten, riet er vielmehr das Gegenteil. Er verwarf den Frieden, weil Karthago jetzt schon so geschwächt wäre, daß es bald gänzlich zugrunde gerichtet werden könnte. Der Senat billigte diese Meinung, wünschte aber zugleich den hochgesinnten Mann zu retten. Allein dieser gedachte seines Eidschwures. Vergebens baten ihn seine Freunde zu bleiben, vergebens sprachen ihn die Priester von seinem Eide los. Ja, er vermied sogar seine Frau und seine Kinder zu sehen, um nicht von ihren Tränen erweicht zu werden. Er kehrte, getreu seiner Eidpflicht, nach Karthago zurück.
Als die Karthager hörten, daß Regulus selbst gegen ihre Aufträge gesprochen hatte, wurden sie äußerst aufgebracht und töteten ihn, wie später in Rom erzählt wurde, durch die schrecklichsten Martern. Sie schnitten ihm zuerst die Augenlider ab, warfen ihn so in einen finsteren Kerker und führten ihn dann in die Sonne. Hierauf legten sie ihn in einen hölzernen Kasten, der mit scharfen Nägeln inwendig ausgeschlagen war, und ließen ihn darin langsam sterben. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß dies alles eine Erdichtung der Römer war, die dadurch ihre eigenen Grausamkeiten zu beschönigen, oder ihren unversöhnlichen Haß gegen Karthago zu rechtfertigen suchten.
Der Krieg zwischen Rom und Karthago dauerte hiernach noch neun Jahre. In dieser Zeit hatten die Karthager einen ausgezeichneten Feldherrn an Hámilkar mit dem Beinamen Barkas („Blitz“), der sich im Nordwesten Siziliens sieben[S. 63] Jahre lang gegen alle Anstrengungen der Römer siegreich behauptete, bis der Seesieg des Lutatius Cátulus bei den ägatischen Inseln die erschöpften Karthager zum Frieden zwang (241). Sie traten Sizilien ab, welches die erste römische Provinz ward, und zahlten 3200 Talente Silber (13½ Millionen Mark).
Während bald darauf die Römer mitten im Frieden das erschöpfte Karthago zur Abtretung von Sardinien und Corsica nötigten, dann die seeräuberischen Illyrier und die Gallier im Gebiete des Po zu unterwerfen begannen, hatte Hamilkar Barkas in Karthago die Empörung der unbezahlten Söldnerhaufen zu dämpfen, die den karthagischen Staat dem Untergange nahe brachte. Nach Beendigung dieses Kampfes ging Hamilkar, ein unversöhnlicher Feind der Römer, nach Hispanien (Spanien), um durch die großen Hilfsmittel dieser damals noch freien und von den kriegerischen Stämmen der Ibēren bevölkerten Halbinsel seiner Vaterstadt wieder aufzuhelfen und neue Kräfte gegen Rom zu gewinnen. Als er im Begriff war abzureisen, bat ihn Hannibal, sein Sohn, ein Knabe von neun Jahren, ihn auf diesem Zuge begleiten zu dürfen. Der Vater versprach es und suchte zugleich das Herz seines Sohnes mit unaustilgbarem Hasse gegen Rom zu erfüllen. Er führte ihn vor den Altar, auf welchem er eben opferte. Alle Zeugen wurden entfernt, dann hieß er seinen Sohn den Altar umfassen und schwören, daß er zeitlebens ein Feind der Römer sein wolle. Das tat Hannibal, und nie ist ein Schwur treuer gehalten worden.
Neun Jahre focht Hamilkar in Spanien mit glücklichem Erfolg, unterwarf sich einen großen Teil der Einwohner mit Gewalt oder Klugheit, und gründete dort eine Herrschaft, welche den Verlust der Inseln reichlich ersetzte. Nachdem er in einer Schlacht gefallen war, übernahm sein Eidam Hásdrubal den Oberbefehl. Dieser setzte die kriegerischen Unternehmungen mit großem Glücke fort und gab dem neuerworbenen Lande in der[S. 64] von ihm gegründeten Stadt Neukarthago (heute Cartagena) eine trefflich gelegene Hauptstadt. Die Römer wurden über diese Fortschritte so besorgt, daß sie in einem Vertrage mit Hasdrubal den Fluß Ibērus (Ebro) als Grenze der karthagischen Eroberungen feststellten und die griechischen Handelsplätze, darunter die Stadt Saguntum (nördlich von Valencia), in ihren Schutz nahmen.
Hannibal war nach des Vaters Tode nach Karthago zurückgekehrt; Hasdrubal ließ ihn wieder zu sich kommen und vollendete seine kriegerische Erziehung. Acht Jahre hatte Hasdrubal den Oberbefehl in Spanien geführt, als er von einem Eingeborenen ermordet wurde. Jetzt rief das Heer den jungen Hannibal als Feldherrn aus, und Senat und Volk zu Karthago bestätigten die Wahl.
Im Lager aufgezogen, war Hannibal der Liebling des Heeres; die alten Krieger sahen in ihm des Vaters Ebenbild. Wenn eine Unternehmung Mut und Ausdauer erforderte, stellte schon Hasdrubal ihn am liebsten an die Spitze, und unter keinem Führer hatten die Krieger mehr Vertrauen und Siegeszuversicht. Mit der größten Kühnheit ging er in Gefahren, mit der größten Besonnenheit benahm er sich mitten in denselben, durch keine Beschwerde konnte sein Körper ermüdet, sein Geist gebeugt werden, Hitze und Kälte ertrug er mit gleicher Ausdauer, in Speise und Trank war er mäßig, und zum Schlafe gönnte er sich nur die Zeit, die ihm die Geschäfte übrig ließen. Dazu bedurfte er keines weichen Lagers, noch der Stille der Nacht, oft sahen ihn seine Krieger, nur mit einem kurzen Feldmantel bedeckt, zwischen den Wachen und Posten auf dem Boden liegen. Seine Kleidung war von der seiner Waffengenossen in nichts unterschieden, nur Waffen und Rosse kündigten den Feldherrn an. Er war bei weitem der beste Reiter, wie der beste Fußgänger. Als vorderster ging er ins Treffen, als letzter kehrte er zurück. Unerschöpflich in klugen Anschlägen, stets wohl unterrichtet von den Plänen der Feinde, fand er in jeder Not und Gefahr einen rettenden Ausweg. Einer der größten Feldherren aller Zeiten, ein weitschauender Staatsmann, ein tapferer Krieger, ließ er sich im Glück nicht zum Übermut verleiten, und trug er das Unglück mit zäher Geduld und festem Sinn. Milde lag nicht in seiner Art; hart und grausam gegen die Feinde, scheute er keine Arglist und Untreue, wenn sein Vorteil dazu riet.
Er war erst 28 Jahre alt, als er an die Spitze des hispanischen Heeres trat (221 v. Chr.). Sofort entschloß er sich mit Rom zu brechen.
Hasdrubal hatte den Vertrag mit den Römern, die Stadt Saguntum nicht anzugreifen, treulich gehalten. Hannibal kümmerte sich nicht darum, sondern schritt alsbald zu ihrer Belagerung. Als die Römer von der Bedrängnis der mit ihnen verbündeten Stadt hörten, ordneten sie eine Gesandtschaft an Hannibal ab, um ihn an den Vertrag zu erinnern. Der aber ließ sie gar nicht ins Lager, sondern befahl sie zu bescheiden, daß er mitten im Kampfe keine Zeit habe Gesandtschaften anzuhören. Ebenso erfolglos war die Gesandtschaft in Karthago. Inzwischen erfuhren die Saguntiner alle Schrecken einer Belagerung. Unter dem heldenmütigsten Widerstand der Einwohner und erst nach einer achtmonatlichen Einschließung und Bestürmung konnte Hannibal sich der Stadt bemächtigen (219). Als den Saguntinern alle Hoffnung geschwunden war, hatten die Vornehmsten alles Silber und Gold aus ihren Häusern auf dem Markt auf einen brennenden Scheiterhaufen geworfen und sich dann selber hinein gestürzt. Alle Wehrhaften wurden getötet, viele hatten sich mit Weib und Kind in ihre Häuser verschlossen und diese in Brand gesteckt. Alle übrigen wurden in die Knechtschaft verkauft (219).
Als die Kunde von dem schrecklichen Untergang der ihrem Schutze anvertrauten Stadt nach Rom kam, war die Entrüstung über solchen Friedensbruch unbeschreiblich. Sofort ging eine Gesandtschaft nach Karthago, an deren Spitze Quintus Fabius stand. Sie sollte die Auslieferung des vertragsbrüchigen Feldherrn fordern, oder, wenn diese verweigert würde, den Krieg ankündigen. Der karthagische Senat, in zwei Parteien geteilt, konnte zu keinem Entschluß kommen. Er suchte Ausflüchte zu machen und die Sache hinzuziehen, allein Qu. Fabius forderte eine bestimmte Erklärung. Indem er seine Toga zu einem Bausche faltete und dem Senate hinhielt, sagte er: „Hier liegt Krieg und Frieden: nehmt was ihr wollt!“ — „Wir nehmen,“ rief man ihm entgegen, „was ihr uns gebt.“ — „So nehmt den Krieg!“ erwiderte Fabius und entfaltete seine Toga mit einer drohenden Geberde, als ob er Waffen und Krieger herausschüttete.
So begann der zweite punische Krieg, der achtzehn Jahre (219–201) hindurch Italien, Spanien und Afrika ver[S. 66]wüstete, Rom an den Rand des Verderbens brachte, und zuletzt mit der völligen Niederlage Karthagos endete.
Hannibal hatte sich nach der Eroberung von Sagunt in die Winterquartiere begeben. Hier entbot er die Hauptleute der auf der Halbinsel geworbenen Krieger zu sich und machte sie mit seinem Plan, in fernes Land zu ziehen, bekannt. Um ihnen aber Zeit zu geben, sich von den Beschwerden des letzten Krieges zu erholen und ihre Familien wiederzusehen, erteilte er allem Kriegsvolk einen Urlaub, mit dem Befehl, beim Anbruch des Frühlings sich wieder einzustellen. Nachdem er dann im Frühjahr die Truppen gemustert hatte, ließ er, um Spanien zu behaupten, ein Heer von 15000 Mann und eine Flotte von 50 Schiffen unter dem Befehl seines Bruders Hasdrubal zurück. Ein anderes, größtenteils aus Ibérern bestehendes Heer von nahe an 20000 Mann schickte er nach Afrika, um teils als Besatzung von Karthago zu dienen, teils im karthagischen Gebiet verteilt zu werden. Er selbst brach im Frühjahr 218 mit 90000 Mann Fußvolk, 12000 Reitern und 37 Elefanten nordwärts nach dem Ibérus (Ebro) auf (218).
Auf diesem Zuge erschien ihm einst, wie die Sage erzählt, im Schlaf ein Jüngling von göttlicher Gestalt, welcher sagte: „Ich bin von Jupiter als dein Wegweiser nach Italien gesandt; mache dich auf und folge mir unverwandten Auges.“ Hannibal folgte anfangs schüchtern, nirgends um oder hinter sich blickend; dann aber konnte er aus menschlicher Ängstlichkeit, was das wohl sein möge, wonach er sich nicht umsehen solle, seine Augen nicht mehr beherrschen. Er blickte hinter sich und gewahrte eine Schlange von wundersamer Größe, die hinter ihm herschoß, Bäume und Sträucher weithin niederschlagend, und hinter der Schlange einen Platzregen mit Donnerschlägen. Auf seine Frage, was das für ein Ungetüm sei, und was das Zeichen bedeute, erhielt er die Antwort, daß es die Verwüstung Italiens sei; er solle aber nur vorwärts gehen, nicht weiter fragen und das fernere Schicksal in seinem Dunkel ruhen lassen.
Froh über dieses Gesicht setzte er über den Ebro und bezwang die noch unabhängigen Völkerschaften zwischen diesem Fluß und den Pyrenäen. Um die Pässe des Gebirges und die neu eroberten Landschaften zu hüten, ließ er eine Truppe[S. 67] von 11000 Mann zurück, während er noch andere 11000 Mann, welche die Furcht vor einem Kriege mit Rom entmutigt hatte, nach Hause entließ. Ihm selbst blieben damals 50000 Mann zu Fuß und 9000 Reiter, alle bewährte Krieger, zum größeren Teil Libyer aus dem Gebiete Karthagos, zum kleineren Teil Hispanier (Ibérer). Die Völker des südlichen Galliens gewann er durch List und Geschenke, und als man in Rom vernahm, er habe den Ebro überschritten, stand er bereits am rechten Ufer der unteren Rhódanus (Rhone), an der Stelle des heutigen Avignon.
Die dort seßhaften Gallier standen auf seiten der Römer, fühlten sich aber zu schwach, um den Anmarsch des punischen Heeres in offenem Felde aufzuhalten. In der Hoffnung auf die Hilfe des römischen Heeres, das bereits bei Massilia (Marseille) an der Rhonemündung eingetroffen war, nahmen sie auf dem linken Flußufer eine feste Stellung ein. Aber Hannibal ließ sich nicht aufhalten. Er ließ alle Schiffe und Kähne aufwärts und abwärts des Flusses zusammenholen, Bäume fällen und Flöße bauen, und traf alle Anstalten zu raschem Übergang. Aber auf der anderen Seite standen die Feinde, die zu Pferd und zu Fuß das ganze Ufer innehatten. Um sie von dort zu vertreiben, befahl Hannibal dem Hanno mit einem Teil des Heeres zwei Tagereisen weit am Flusse hinaufzuziehen und dort an einer geeigneten Stelle überzusetzen. Pünktlich führte Hanno den Befehl aus. Auf Flößen und verkoppelten Baumstämmen brachte er Roß und Mann und alles übrige hinüber. Die Hispanier steckten ihre Kleider in Schläuche, legten sich darauf und schwammen ohne weitere Vorkehrung über den Fluß. Von dort zog er eilends stromabwärts in den Rücken der Feinde, und bereits am dritten Tage seit seinem Aufbruch meldete er durch Rauchsignale dem Feldherrn seine Ankunft. Sofort gab Hannibal den Befehl zum Übergang. Die Gallier anderseits stürzten gegen das Ufer mit vielstimmigem Geheul, ihrem gewohnten Schlachtgesange, die Schilde zusammenschlagend und in der Rechten den Speer schwingend. Da plötzlich loderte in ihrem Rücken das eigene Lager in hellen Flammen auf. Hanno hatte es überfallen und bedrohte ihre Rückseite. Zwar suchten die Gallier anfangs nach beiden Seiten das Feld zu halten, gaben aber bald den hoffnungslosen Widerstand auf und zerstreuten sich in ihre Dörfer. So konnte Hannibal sein ganzes Heer[S. 68] mit allem Troß ungefährdet über den reißenden Strom führen und jenseits ein Lager schlagen.
Ganz eigentümlich war die Art, wie Hannibal die Elefanten hinübersetzen ließ. Er ließ ein 200 Fuß langes und 50 Fuß breites Floß vom Lande aus in den Fluß hineinbauen und damit es nicht vom Strome fortgerissen würde, durch starke Taue am Ufer festbinden. Dann ließ er es mit Erde beschütten, damit es die Tiere ohne Scheu gleich wie festes Land betreten könnten. Ein zweites Floß, ebenso breit, 100 Fuß lang und zur Überfahrt eingerichtet, wurde an jenes angebunden. Wenn nun die Elefanten über das feststehende Floß, wie auf einer Straße, auf das zweite kleinere Floß hinübergegangen waren, so wurden sogleich die Bindetaue gelöst und dies Floß an das andere Ufer gezogen. So lange sie auf dem ersten Floß wie auf einer breiten Brücke gingen, blieben sie ruhig; dann erst zeigten sie Angst, wenn das zweite Floß abgelöst war und mit ihnen in die Mitte des Flusses trieb. Da drängten sie sich vom Wasser weg zusammen und verursachten ziemliche Störung, bis endlich die Furcht selbst sie ruhig machte.
Um die Zeit, da Hannibal über die Rhone ging, stand der römische Konsul P. Cornelius Scipio an der Mündung dieses Stromes. Er hatte mit seinem Heere nach Spanien übersetzen sollen, um dort den Krieg zu beginnen, während der andere Konsul, Titus Sempronius Longus, von Sicilien aus Karthago selbst angreifen sollte. Als er aber auf dieser Fahrt nach Massilia kam, mußte er zu seiner großen Überraschung erfahren, daß der Feind bereits in der Nähe stände und sich anschickte über die Rhone zu gehen. Statt nun sofort dem Hilferufe der Gallier zu folgen, zauderte er, bis es zu spät war. Ein Reitergeschwader, das er darauf den Fluß hinaufsandte, um Erkundigungen über den Standort und die Stärke des feindlichen Heeres einzuziehen, traf auf eine zu gleichem Zwecke abgeschickte Abteilung Numider (aus Nordafrika). Es kam zu einem sehr hitzigen Gefecht, in dem sich der Sieg endlich auf die Seite der Römer neigte. Doch als Scipio in eiligem Marsche nach der Übergangsstelle hinaufzog, war das feindliche Heer schon in weiter Ferne, und es blieb ihm nichts übrig als nach Italien zurückzukehren und dort den Feind zu bestehen.
Für Hannibal aber begann jetzt erst der schwierigste Teil seiner kühnen Unternehmung. Es galt den Marsch zu wagen[S. 69] mitten durch zahlreiche Feinde, über die schnee- und eisbedeckten Alpen, auf ungebahnten, vielleicht noch nie betretenen Wegen, die selbst für Fußgänger kaum gangbar waren, viel weniger noch für Elefanten, Rosse und schwerbeladene Karren und Saumtiere. Kein Wunder, daß beim Anblick der steilen Gebirge selbst die abgehärtesten Krieger zu zagen begannen. Nur ihr Feldherr blieb festen Mutes und verstand es auch seinen Truppen neue Zuversicht einzuflößen. Er schilderte ihnen die reichen Gebiete, die sie jenseits des Gebirges erreichen, die große Beute, die sie dort gewinnen, und die Hilfe, die sie im Tale des Po bei den kriegstüchtigen und von Römerhaß erfüllten gallischen Stämmen finden würden. Er führte ihnen sogar einen eben von dort eingetroffenen gallischen Fürsten vor, Magilus mit Namen, der dies alles bestätigte.
Man kannte damals nur zwei Pässe zum Übergang von Gallien nach dem oberen Italien. Der eine kürzere aber rauhere führte durch das Tal der Dürance über die cottischen Alpen (Mont Genèvre) in das Gebiet der Tauriner (Turin), der längere aber weniger schwierige im Tal der Isère aufwärts zu den graischen Alpen und über den kleinen St. Bernhard ins Tal der Doria (Baltéa). Diesen zweiten wählte Hannibal auch deshalb, weil die an seinem jenseitigen Ausgange wohnenden Gallier nur auf seine Ankunft warteten, um sich mit ihm gegen die Römer zu verbinden.
Der Marsch ging zuerst sechzehn Tage lang durch das fruchtbare Gebiet der Allóbroger zwischen Isère und Rhone, bis zum Fuße des Hochgebirges. Der von den Bewohnern gesperrte nächste Paß wurde genommen; aber auf dem steilen und glatten Abstieg von der Höhe geriet das Heer in harte Not: feindliche Haufen brachen in die Reihen, ein wildes Getümmel entstand, Menschen und Tiere stürzten in die Tiefe. Erst als man ins Tal der Isère gelangte, ward der Marsch gefahrlos, bis man in das Gebiet der Centronen hinaufstieg, welche das Heer mit allen Zeichen der Freude gastlich empfingen und aus dem Tale zum Fuß der Paßhöhe des kleinen St. Bernhard geleiteten. Da plötzlich griffen sie die nächste durch eine Schlucht emporklimmende Abteilung von allen Seiten an. Unter blutigen und verlustvollen Kämpfen gelangte man am folgenden Tage auf die Hochfläche des Passes.
Den erschöpften und durch die schweren Verluste an Menschen und Tieren entmutigten Truppen gewährte hier der[S. 70] Feldherr eine kurze Rast, die er benutzte, um alle Nachzügler und Versprengte zu sammeln und durch den Hinweis auf die Nähe des ersehnten Zieles, durch den Ausblick auf die in der Ferne sich breitende Ebene Italiens die gesunkene Stimmung wieder zu heben. Man näherte sich zwar den befreundeten Galliern, aber die vorgerückte Jahreszeit — es war schon Anfang September — brachte neues Ungemach. An den engen und steilen Talrändern der Dora, auf denen der Abstieg geschah, lag frischer Schnee, der die Pfade verdeckte; haufenweise stürzten Menschen und Tiere in die Abgründe. An einer Strecke von nur 200 Schritt Länge mußte vier Tage lang mit Aufgebot aller Kräfte gearbeitet werden, um die Elefanten und das Gepäck über die glatten Eismassen hinüber bringen zu können. Nach weiterem dreitägigen Marsch bergab gelangte man endlich in die Talebene, wo die Dörfer der Gallier, in der Gegend des heutigen Ivréa, Rast und Pflege boten.
So war das Ziel endlich erreicht, aber mit welchen Opfern! Mehr als die Hälfte des Heeres, die meisten Pferde und Elefanten waren auf den Märschen und in den Kämpfen zugrunde gegangen, und was hinübergelangt war, bedurfte längerer Erholung, um sich zu den bevorstehenden harten Kämpfen zu stärken und neu auszurüsten. Hätte Hannibal beim Austritt aus dem Gebirge ein römisches Heer kampfbereit sich gegenüber gefunden, so wäre er dem Untergang schwerlich entronnen.
Anfangs hatten die Römer, wie oben berichtet ist, die Absicht den Krieg gegen Karthago in Spanien und Afrika zu führen. Sie hatten daher den Konsul T. Sempronius Longus mit der größeren Heeresmacht, 24000 Mann zu Fuß, 1800 Reitern und 160 Kriegsschiffen, nach Sicilien gesandt; der andere Konsul, P. Cornelius Scipio, sollte mit 22000 Mann zu Fuß, 1600 Reitern und 60 Schiffen einen Angriff auf Spanien unternehmen. Aber Hannibal war den Römern zuvorgekommen. Schon stand er an der Rhone, als Scipio auf seiner Fahrt erst an der Mündung derselben angekommen war, wo er dann die Nähe des Feindes erfuhr und das bereits erwähnte Reitergefecht vorfiel. Nun änderte Scipio seinen Plan, er sandte seinen Bruder Gnaeus mit dem größeren[S. 71] Teile des Heeres nach Spanien, während er selbst mit dem übrigen zurück in die Ebene des Po eilte, um sich dort an die Spitze des römischen Heeres zu stellen, welches dort die aufrührerischen Gallier niederzuhalten bestimmt war, und dem anrückenden Feinde die Stirn zu bieten. Hannibal hatte inzwischen seinem Heere die nötige Rast gegönnt, hatte den Widerstand der Tauriner durch Erstürmung ihrer Hauptstadt gebrochen, und war dann rasch bis an den Ticīnus (Tessin), einen Nebenfluß des Po, vorgedrungen. Scipio ließ eine Brücke über den Po schlagen und rückte ihm entgegen. Nicht lange, so kam es dort in der Ebene am Ticinus zu einem ersten Zusammenstoß. Beide Feldherren zogen eines Tages an der Spitze ihrer Reiterei, Scipio auch von leichtem Fußvolk begleitet, aus, um die Stellung der Feinde auszukundschaften. So stießen sie aufeinander. Gleich nach Beginn des Kampfes floh das leichte römische Fußvolk, das Scipio in die vorderste Reihe gestellt hatte, vor dem Anprall der schweren punischen Reiter, warf sich unter die eigene Reiterei und brachte sie in Verwirrung. Gleichwohl nahm diese den Kampf auf und bestand ihn eine Zeitlang, unerschüttert durch die feindlichen Angriffe. Als dann aber die leichten numidischen Geschwader sie auf den Flanken und im Rücken anfielen war die Niederlage und Flucht der Römer nicht mehr aufzuhalten. Der Konsul selbst ward im Getümmel verwundet und nur durch die Entschlossenheit seines siebzehnjährigen Sohnes, des später als Besieger Hannibals berühmt gewordenen Scipio Africanus, aus dem feindlichen Gedränge herausgehauen und gerettet.
In der folgenden Nacht führte Scipio sein Heer ungestört über den Po zurück und nahm an dem rechten Ufer des Trébia, eines kleinen Nebenflusses des Po, eine feste Stellung, wo sein rechter Flügel sich an den Po bei der Koloniestadt Placentia (Piacenza), sein linker an die Vorberge des Apennin lehnte, in einem hügeligen Gelände, das die Bewegung der überlegenen feindlichen Reiterei hinderte. Hier stieß auch der andere Konsul, Sempronius, der auf die erste Nachricht von dem Erscheinen Hannibals aus Sicilien zurückberufen worden war, mit seinem Heere zu ihm. Aber zwischen den beiden Konsuln herrschte keine Eintracht: Sempronius drang auf eine entscheidende Schlacht, während Scipio, durch seine Wunden an der Führung behindert, sich von einer bloß abwehrenden[S. 72] Haltung mehr Vorteil versprach. Ihre Uneinigkeit blieb Hannibal nicht unbekannt. Er war den über den Po zurückweichenden Römern alsbald nachgezogen und hatte ihnen gegenüber auf der linken Seite der Trebia sein Lager genommen. Als er durch seine Kundschafter erfahren, daß die Römer zum Kampf bereit wären, wählte er einen Ort zum Hinterhalt. In der Nähe seines Lagers war ein Bach, auf beiden Seiten von einem sehr hohen Ufer eingeschlossen und rings mit Gesträuch und Dorngebüsch dicht besetzt, wo ein Reitertrupp eine ganz verdeckte Aufstellung nehmen konnte. Darin versteckte Hannibal tausend auserlesene Reiter und ebenso viel Fußvolk unter Führung seines Bruders Mago.
Früh am folgenden Tage ließ er seine numidischen Reiter über die Trebia setzen, sich vor den Toren des feindlichen Lagers tummeln, um den Feind zum Kampfe herauszulocken und, wenn ihnen dies gelungen war, langsam über den Fluß zurückzuweichen. Kaum hatten sie sich gezeigt, so führte Sempronius, der an diesem Tage den Oberbefehl auch über Scipios Legionen führte, erst seine ganze Reiterei, darauf 6000 Mann Fußvolk, endlich sein ganzes Heer zum Kampfe heraus. Es war ein kalter schneeiger Dezembertag; Roß und Mann wurden, ohne vorher durch Speise gestärkt zu sein, ungeschützt gegen die Kälte, ins Treffen geführt. Als sie aber auf der Verfolgung der fliehenden Numider sogar ins Wasser gingen, das ihnen bis an die Brust reichte, erstarrten ihnen vollends die Glieder, daß sie kaum die Waffen zu halten vermochten und bald der Ermattung und dem Hunger erlagen.
Dagegen hatten Hannibals Truppen vor ihren Zelten Feuer angezündet, ihre Glieder mit Öl geschmeidig gemacht und in Ruhe gegessen. Rüstig an Leib und Seele ergriffen sie die Waffen und standen zur Schlacht gerüstet, als der Feind über den Fluß gegangen war. Ins Vordertreffen stellte der karthagische Feldherr als Plänkler 8000 leicht bewaffnete balearische Schleuderer und Speerwerfer; hinter diesen das schwere Fußvolk, den Kern seines Heeres; die Flügel umgab er mit seinen zahlreichen Reitern und an die beiden Flügelspitzen stellte er zu gleichen Teilen die wenigen Elefanten, welche ihm geblieben waren. Vergebens ließ jetzt Sempronius seinen hitzig verfolgenden Reitern zum Rückzug blasen; er mußte die Schlacht annehmen und ordnete die Seinen. Die ermüdeten leichten Truppen wichen gleich anfangs zurück;[S. 73] dann kam die römische Reiterei ins Gedränge und wurde von einer Wolke von Schleuderkugeln und Speeren, welche die Balearen warfen, überschüttet. Der Anblick und der ungewohnte Geruch der Elefanten brachte die Pferde in Verwirrung und verursachte allgemeine Flucht. Das Fußvolk hielt länger stand; aber die Punier waren, zuvor durch Speise gestärkt, in das Treffen gezogen; den ermüdeten, hungrigen, vor Kälte starrenden Römern versagte der Körper den Dienst. Da brach endlich Mago mit seinen Numidern aus dem Hinterhalt hervor und fiel den Römern zu ihrem großen Schrecken in den Rücken, so daß diese nach allen Seiten hin zu kämpfen hatten. Eine Abteilung von 10000 Römern durchbrach in fester Haltung die Mitte der feindlichen Linie und wandte sich nach Placentia; die übrigen suchten sich an verschiedenen Stellen und unter blutigem Gemetzel einen Ausweg. Die nach dem Lager ihren Rückzug nahmen, deren ertranken viele in dem Fluß oder wurden von den verfolgenden Feinden erschlagen; die meisten entrannen ohne Ordnung nach Placentia. Eben dorthin führte der verwundete und im Lager zurückgebliebene Konsul Scipio den Rest des Heeres. Sempronius, der sich mit wenigen Reitern gerettet hatte, begab sich bald darauf nach Rom, wohin er berufen war, um die Wahl der neuen Konsuln zu leiten.
Aber auch die Punier hatten starke Verluste erlitten, und die rauhe Jahreszeit nötigte sie in Winterquartieren Ruhe und Erholung zu suchen. Inzwischen bedrängten ihre Reiter und leichten Truppen fortwährend die Römer in den festen Städten Placentia und Cremona, und die gallischen Stämme folgten großenteils dem Rufe des siegreichen Puniers und kündigten den verhaßten Römern den Gehorsam.
Kaum begann der Frühling, so brach Hannibal gegen Italien auf. Ansehnliche gallische Hilfsvölker begleiteten ihn, teils aus Kampf- und Beutelust, teils um den Krieg aus ihren Gebieten entfernen zu helfen, alle aber, um mit den Puniern die ihrer Unabhängigkeit gefährliche römische Übermacht zu vernichten. Von den beiden Straßen, von denen die eine von Rom über den Apennin bei Ariminium das Meer erreichte, die andere bei Arretium, diesseits des Gebirges, endete, waren[S. 74] von den beiden neuen Konsuln Gaius Flaminius und Gnaeus Servilius mit vier während des Winters vom Po fortgeführten und ergänzten Legionen besetzt. Hannibal wählte den Weg deshalb mehr westlich in das Tal des Arno, der nicht besonders schwierig, damals aber durch die Schneeschmelze und die Frühlingsregen auf weite Strecken überschwemmt war. Vier Tage und drei Nächte marschierte das Heer fortwährend durch Wasser und Morast, aller Erquickung entbehrend. Die, welche ausruhen wollten, warfen Haufen von Gepäck ins Wasser, um sich damit ein Lager zu bereiten, oder legten sich auf die Leiber der gefallenen Lasttiere. Hannibal, der auf dem einzigen noch übrigen Elefanten ritt, erlitt eine Augenentzündung, in deren Folge er ein Auge verlor. Als er endlich nach Verlust vieler Tiere und Menschen auf das Trockene gekommen war und das erste Lager auf etruskischem Boden bei Fäsulä (Fiésole) bezogen hatte, meldeten Kundschafter, das römische Heer unter dem Konsul Flaminius stehe ostwärts in der Gegend von Arretium (Arezzo). Um diesen Mann, dessen Unbesonnenheit ihm bekannt geworden, zum Angriff zu reizen, verwüstete Hannibal die schönen Gefilde zwischen Fäsulä und Arretium durch Raub und Brand. Umsonst mahnte man den Flaminius erst die Ankunft des andern Konsuls, der noch jenseits des Gebirges am adriatischen Meere stand, abzuwarten. Er gab das Zeichen zum Aufbruch, weil er die Verheerungen des Feindes nicht länger dulden mochte.
Hannibal war auf seinem Marsche zu dem schmalen Landstrich gekommen, wo der trasimenische See (lago di Perugia) nahe an die Berge von Cortona herantritt. Ein ganz enger Weg führt zwischen dem See und den Hügeln in eine breitere Fläche, an deren Ende, dem Eingange der Landenge gegenüber, eine Anhöhe emporragt. Auf dieser Anhöhe lagerte sich Hannibal mit dem Kern seines Heeres, dem spanischen und afrikanischen Fußvolk. Die Balearen und die übrigen leichten Truppen stellte er in langer Reihe hinter den Hügeln auf, welche jene Fläche auf einer Seite begrenzten; die Reiterei und die Gallier verbarg er neben den Waldhöhen, die dem engen Eingang am See gegenüberlagen. Bei diesem Eingange langte am Abend des folgenden Tages Flaminius an. Gleich am nächsten Morgen, als ein dicker Nebel auf den Wassern des Sees lag und Berg und Tal verhüllte, zog er, ohne vorher die Gegend ausgekundschaftet zu haben, durch die enge[S. 75] Straße in die mittlere Fläche, indem er nur die ihm gegenüber liegende Anhöhe von den Puniern besetzt glaubte. So wie er sich derselben näherte und die letzten seines Zuges an dem äußersten Hinterhalt der Feinde vorüber waren, erfolgte der Angriff der Punier von allen Seiten und mit solchem Ungestüm, daß sich die Römer nicht einmal in Schlachtordnung aufstellen konnten. Kaum drei Stunden währte die Schlacht, und so hitzig ward auf beiden Seiten gekämpft, daß man das furchtbare Erdbeben nicht gewahr wurde, das um diese Zeit die Landschaft heimsuchte. Der Konsul selbst fiel unter den ersten und 15000 der Seinen mit ihm. Viele wurden in den See gejagt und ertranken, oder wurden von den verfolgenden Reitern erschlagen. Nur einer Abteilung von 6000 Mann gelang es sich durchzuschlagen; sie retteten sich auf eine nahe Anhöhe, von wo sie, als der Nebel sich zerstreut hatte, das Schicksal der Ihrigen erkannten. Ihre eilige Flucht setzten sie auch noch den nächsten Tag fort, bis sie der Hunger zwang, sich dem Maharbal, der sie mit seiner Reiterei verfolgte, zu ergeben. Viertausend Reiter, die der andere Konsul zu Hilfe geschickt, wurden ebenfalls teils vernichtet, teils gefangen. Die Zahl der Gefangenen belief sich auf 15000. Hannibal ließ von ihnen die römischen in Fesseln legen, die italischen Bündner (socii) aber frei in ihre Heimat ziehen. Ebenso hatte er schon nach der Schlacht an der Trebia getan; denn er gedachte als der Befreier Italiens von der Römerherrschaft aufzutreten, und hoffte dabei auf den Beistand der bündnerischen Städte Mittel- und Unteritaliens.
Auf die erste unbestimmte Nachricht von der unglücklichen Schlacht und der Vernichtung der zwei Legionen geriet das Volk in unbeschreibliche Aufregung. Keiner wußte Genaues, selbst die obersten Beamten nicht; Männer und Weiber bestürmten sie mit Fragen. Erst gegen Abend erhielt der Senat sichere Kunde, und der Prätor teilte sie auf dem Markte mit: „Wir haben eine große Schlacht verloren, das Heer ist vernichtet, der Konsul tot, die Stadt in Gefahr.“
Man war darauf gefaßt den Sieger alsbald vor den Toren der Stadt erscheinen zu sehen, und traf in höchster Eile alle Vorkehrungen zur Abwehr. Vor allem galt es die Verteidigung des Vaterlandes, da der eine Konsul tot, der andere fern war, in eines Mannes Hand mit unbeschränkter Machtbefugnis zu legen, das heißt einen Diktator zu ernennen. Die[S. 76] Wahl fiel auf Fabius Maximus, der sich den Minucius Rufus als Reiterobersten zugesellte.
Aber Hannibal zog nicht gegen Rom, sondern wandte sich von Etrurien ostwärts nach Umbrien und drang bis zur Stadt Spoletium, die er vergebens bestürmte, da sie von einer tapferen Besatzung verteidigt ward. Von da ging er in die fruchtbare picenische Landschaft hinüber, ließ die Truppen einige Tage ausruhen und drang dann, unter schrecklichen Verwüstungen, südwärts die Küste entlang bis nach Apulien. Aber seine Hoffnung, daß sich die Bundesgenossen Roms, der römischen Herrschaft überdrüssig, auf seine Seite schlagen würden, blieb unerfüllt. Alle Städte schlossen ihre Tore und behandelten ihn als Feind.
Inzwischen hatte der alte bedächtige Diktator Fabius zwei neue Legionen gebildet und die beiden des Konsuls Servilius sowie den versprengten Rest des geschlagenen Heeres an sich gezogen. Er folgte dem Feinde auf seinem Marsche, nicht um im offenen Felde eine neue und vielleicht letzte Schlacht zu schlagen, sondern um seine neuen Truppen zu üben und zu ermutigen, die Bündner in Treue zu halten und dem Gegner keine Rast zu lassen. Bei Arpi in Apulien bekam er ihn zuerst zu Gesicht. Hannibal bot ihm gleich die Schlacht an; aber Fabius wich vorsichtig aus und hielt sein Heer im festen Lager, das er immer auf den Höhen der Berge und in ziemlicher Entfernung vom Feinde aufschlug. Da Hannibal den vorsichtigen Gegner zu keiner Schlacht bewegen konnte, so brach er endlich auf und zog unter steten Verwüstungen durch Samnium, um wieder auf die Westseite des Gebirges nach Campanien zu gelangen.
Auf dem Wege dorthin kam er in eine von Bergen und Flüssen eingeschlossene Talebene. Fabius war ihm auf dem Fuße gefolgt, hielt die Höhen ringsum besetzt und hatte auch den Rückweg nach Samnium verlegt. Schon schienen die Karthager verloren zu sein, als Hannibal sich der Umschließung durch folgende List zu entziehen wußte. Er befahl gegen zweitausend Ochsen aus den erbeuteten Herden zusammenzutreiben, ließ ihnen dürre Reisbündel an die Hörner binden und, nachdem diese angezündet waren, den ganzen[S. 77] Haufen mit Anbruch der Nacht gegen die Anhöhen jagen, die der Feind besetzt hielt. Die römischen Truppen, die unten am Ausgange des Tales standen, sahen mit Staunen die eilenden Feuerlinien über sich auf den Bergen, und da sie glaubten, die Karthager hätten sie umgangen und zögen bei Fackelschein ab, so wichen sie seitwärts auf die Anhöhen, während die, welche oben standen, vor dem Ansturm der wütenden Tiere flohen. Selbst Fabius wagte es nicht seine Stellung auf der andern Seite des Tales zu verlassen. Indessen zog Hannibal durch die geöffneten und unbewachten Pässe und entkam so der Falle, die ihm Fabius gelegt hatte.
In Rom aber war man über die Weise, wie Fabius den Krieg führte, unwillig, und auch im Lager erhob sich lautes Murren über den Feldherrn, den sie wegen der Art seiner Kriegsführung spöttisch den Zauderer (cunctator) nannten. Am meisten suchte sein Reiteroberst Minucius den Diktator in ein ungünstiges Licht zu stellen, und als er nun gar eines Tages, während der Diktator in Rom beschäftigt war, ein glückliches Gefecht geliefert hatte, brachte er es wirklich dahin, daß die Diktatur und der Heerbefehl zwischen ihm und Fabius geteilt ward. Sie bezogen, jeder mit zwei Legionen, getrennte Lager. Eines Tages reizte Hannibal, der die Zwietracht seiner Gegner kannte, das Heer des Minucius in einem engen Tale zum Gefecht. Eine plötzlich aus einem Hinterhalte hervorbrechende Schar von 5000 Puniern faßte es in Seite und Rücken; schon schien seine Vernichtung unvermeidlich, als Fabius, der den ganzen Hergang von seinem nahe gelegenen Lager aus beobachtet hatte, mit seinen Legionen ausrückte und die bereits siegreichen Feinde so bedrängte, daß nicht nur das Heer des Minucius entsetzt wurde, sondern auch Hannibal den Rückzug antrat und sich für besiegt erklärte. „So habe ich doch einmal,“ sagte er zu den Seinen, „diese Wetterwolke, die immer um den höchsten Berggipfel schwebt, in die Tiefe herab und zur Entladung gebracht.“ Den Fabius aber begrüßte der beschämte Minucius als Vater, und seine Legionen die des Diktators als ihre Patrone (Beschützer). Die beiden Lager wurden wieder vereinigt, und Minucius verzichtete gern auf den ihm eingeräumten Mitbefehl.
Von da an wurde das Verfahren des Fabius, der den Krieg in die Länge zu ziehen und den Feind zu ermüden suchte, als weise anerkannt, der Spottname Cunctator ward ihm jetzt[S. 78] zu einem Ehrennamen und der größte Dichter jener Zeit, Quintus Ennius, pries ihn mit dem Verse:
Die hinhaltende Kriegführung des Diktators hatte auch ihre Nachteile; sie erschöpfte die Hilfsmittel des Landes und drohte die Treue der darunter leidenden Bundesgenossen ins Wanken zu bringen. Deshalb beschloß der Senat, nach Ablauf der Amtszeit des Diktators, wieder Konsuln an die Spitze des Heeres zu stellen und dieses in solcher Stärke ins Feld zu schicken, daß man hoffen konnte den Krieg mit einem Schlage zu beendigen. Statt der bisherigen vier wurden acht überstarke Legionen aufgestellt und eine gleiche Anzahl bündnerischer Truppen einberufen. Außerdem wurde eine neunte Legion ins Po-Tal geschickt, um die bei Hannibal stehenden Gallier zum Abzuge in ihre bedrohte Heimat zu bewegen. Niemals hatte Rom eine solche Kriegsmacht aufgestellt. Aber die Wahl der neuen Konsuln war nicht glücklich. Neben dem besonnenen und kriegserfahrenen L. Ämilius Paullus stand der beim Volk beliebte, aber ebenso anmaßende wie unfähige G. Terentius Varro.
Hannibal, der im ganzen über 10000 Reiter und etwas mehr als 40000 Mann Fußvolk verfügte, hatte im Frühjahr 216 eine starke Stellung in der kornreichen apulischen Ebene eingenommen, bei Cannä (zwischen den heutigen Städten Canōsa und Barletta), südlich des Flusses Aufĭdus (Ofanto). Nordwärts standen die beiden Konsuln in gesonderten Lagern zu beiden Seiten des Flusses. Hannibal wünschte nichts mehr als eine entscheidende Schlacht; denn die Ebene gestattete ihm den unbehinderten Gebrauch seiner überlegenen Reiterei, und die Nähe des feindlichen Heeres erschwerte ihm die Verpflegung des eigenen. Eben deshalb wollte Paullus, der die Lage des Gegners richtig beurteilte, den entscheidenden Kampf noch hinausschieben und auf ein den Römern günstigeres Schlachtfeld verlegen. Aber der hitzige Varro achtete nicht auf seine Vorstellungen, und da sie im Heerbefehl einen Tag um den andern wechselten, so führte er an seinem Tage das Heer, gegen 80000 Mann, zur Schlacht hinaus auf das rechte Flußufer, während ein kleiner Teil, 10000 Mann, auf dem linken im Lager zurückblieb.
Beide Schlachtlinien lehnten sich mit einem Flügel an das rechte Flußufer, so daß der römische nach Süden stand, der punische nach Norden gewandt war. Varro hatte die römischen Reiter am Flusse, die der Bundesgenossen auf dem andern Flügel, in der Mitte das Fußvolk in tiefen Massen aufgestellt; vor der ganzen Linie standen in mäßigen Zwischenräumen die Leichtbewaffneten. Auf dem rechten Flügel befehligte Ämilius Paullus, auf dem linken Varro, in der Mitte Servilius, der Konsul des vorigen Jahres. Auch Hannibal stellte seine Leichtbewaffneten vor die Front, links zunächst am Flusse die schwere gallische und spanische Reiterei, auf der andern die leichte numidische. Dazwischen bildete das schwerbewaffnete Fußvolk eine weite halbmondförmige Linie, in deren Mitte die Gallier und Spanier am meisten nach vorn, die Afrikaner nach beiden Seiten mehr zurück standen. Diese mittleren Truppen befehligte Hannibal selbst mit seinem Bruder Mago, den linken Flügel Hasdrubal, den rechten Hanno.
Es war ein heißer Junitag; glühend blies der Südwestwind den Römern ins Gesicht und wirbelte ihnen große Staubwolken entgegen. Die Leichtbewaffneten begannen die Schlacht, jedoch auf beiden Seiten ohne Entscheidung. Dann aber erfolgte ein blutiger Kampf zwischen den am Flusse stehenden Reitern, die in dem engen Raum zum Teil absprangen und zu Fuß Mann gegen Mann stritten. Die Römer, völlig geworfen, wurden teils niedergemacht, teils in den Fluß getrieben und zersprengt. Paullus, schwer verwundet, rettete sich zu dem Fußvolk. Dieses hatte inzwischen den Angriff auf die feindliche Mitte siegreich begonnen. Die Gallier und Spanier, überwältigt von dem ersten Stoße der Legionen, wichen zurück und öffneten die Linie, während die Afrikaner etwas weiter seitwärts unbewegt feststanden. Die römische Schlachtlinie, die Weichenden verfolgend, drang immer tiefer in den offen gelassenen Raum hinein und sah sich auf einmal von den Afrikanern in ihren Flanken angegriffen. Indes währte das Gefecht auf dem andern Flügel unentschieden fort, bis Hasdrubal von der linken Seite den Puniern zu Hilfe kam und auch hier die römische Reiterei zum Weichen brachte. Das Verfolgen der Geschlagenen überließ er den Numidern; er selbst schwenkte mit seinen Reitern nach der Mitte hin und griff das römische Fußvolk im Rücken an. Dieses, nunmehr von allen Seiten eingeschlossen, wurde fast bis auf den letzten Mann[S. 80] niedergemacht. Von den 76000 Mann, die in der Schlachtlinie gestanden hatten, lagen 70000 auf der Walstatt, darunter ein Konsul des vorigen Jahres, über dreißig, die andere hohe Staatsämter bekleidet hatten, achtzig Senatoren und auch der Konsul Ämilius Paullus selbst. Auch die Besatzung des Lagers, 10000 Mann, mußte sich großenteils ergeben. Viel geringer war der Verlust auf punischer Seite, kaum 6000 Mann.
Als Paullus sich ins Lager zu retten suchte, hatte er sich, von seiner Wunde ermattet, auf einen Stein gesetzt und hier den Tod erwartet. So traf ihn Lentulus, ein Kriegsoberster, der selbst verwundet aus der Schlacht floh, und bot ihm sein eigenes Pferd zur Flucht. Aber Paullus schlug es aus und sagte: „Rette dich, edler Freund, sage den Vätern, sie sollten Rom verrammeln und stark besetzen, und dem Fabius, ich hätte seine Lehren im Leben befolgt und im Tode noch gebilligt. Mich laß unter diesen Leichenhaufen meiner Krieger den Tod finden, damit ich nicht als Ankläger meines Amtsgenossen aufzutreten brauche.“ Kaum hatte er dies gesagt, so naheten die Feinde. Lentulus entkam durch die Schnelle seines Rosses, der Konsul wurde niedergemacht. Und gleichsam als wollte das Schicksal Roms sich in diesem Unglücksjahre ganz vollenden, geriet auch jene neunte Legion in einen Hinterhalt der Gallier und wurde völlig vernichtet.
Varro entkam mit wenigen Reitern nach Venusia, wohin sich auch eine Anzahl der Versprengten und ein kleiner Teil der im Lager Gebliebenen rettete. Als er von dort, tief gedemütigt, auf Einladung des Senats nach Rom kam, zog ihm dieser vor das Tor entgegen und dankte ihm, daß er am Vaterlande nicht verzweifelte.
Die Folge dieser furchtbaren Schlacht war, daß nunmehr viele Städte und Landschaften Unteritaliens, sowie alle cisalpinischen Gallier von Rom abfielen. Rom war am Rande des Untergangs; stündlich erwartete man den Sieger vor den Toren. Aber die Römer zeigten wiederum, daß sie niemals größer waren, als im Unglück, und bewiesen eine Stärke der Seele, welche die höchste Bewunderung verdient. Niemand sprach von Frieden, und die Abgeordneten Hannibals, welche Friedensanträge brachten, ließ man nicht einmal in die Stadt, ja sogar den Loskauf der Gefangenen lehnte man ab. Hannibal aber marschierte nicht sofort gegen Rom, wie ihm Maharbal riet, und mußte deshalb von diesem den Vorwurf hören:[S. 81] „Zu siegen verstehst du, aber den Sieg auszunutzen verstehst du nicht.“
Mit dem Siege bei Cannä hatte Hannibal den Gipfel seines Glückes erstiegen; von nun an sehen wir ihn, obgleich den Römern noch immer furchtbar, keine so glänzenden Taten mehr verrichten. Sein Heer legte er zum Winterquartier in die große und reiche Stadt Capua, deren Bewohner ihn als einen Befreier vom römischen Joche zu sich eingeladen hatten. Unter dem milden Himmel Campaniens und durch die üppigen Genüsse, die dieses ihm bot, soll das Heer verweichlicht worden sein und die alte Kriegszucht und Manneskraft eingebüßt haben. Dazu kam, daß Hannibal von Karthago aus ohne Unterstützung blieb, weil ihm eine feindliche Partei entgegenarbeitete, obschon zwei Scheffel goldener Ringe, die in der Schlacht bei Cannä von den Händen römischer Ritter gezogen und nach Karthago geschickt worden waren, eine große Begeisterung für den Sieger erweckt hatten.
Dagegen zeigten die Römer bei den härtesten Schlägen des Schicksals eine große, unerschütterliche Standhaftigkeit. Neue Legionen wurden ausgehoben, und der Prätor Claudius Marcellus war der Erste, unter dem die Römer wieder siegen lernten. Der alte Mut kehrte allmählich zurück, und wie sie Fabius ihren Schild nannten, so den Marcellus ihr Schwert. Er stand mit einem Teil des neuen Heeres bei Nola in Campanien und hinderte Hannibal an der Eroberung dieser Stadt. Anfangs hielt er seine noch ungeübten Truppen innerhalb der Mauern, dann machte er Ausfälle und übte es in kleinen Gefechten; zuletzt überfiel er die Feinde in ihrem Lager und erschlug ihrer mehrere Tausende. Im folgenden Jahre (215) kam es vor Nola zu einer förmlichen Schlacht, in welcher Marcellus den ersten vollständigen Sieg über die Punier erfocht.
Nach diesem Siege ward Marcellus von Italien nach einem andern Schauplatz des Krieges abgesandt. In Sicilien war die mächtige und blühende Stadt Syrakus nach dem Tode ihres Königs Hiero, des treuen Bundesgenossen der Römer, von ihnen abgefallen, und Marcellus hatte den Auftrag sie wieder zu unterwerfen. Allein die Belagerung zog sich bis ins dritte Jahr hin (214–212). Von zwei Seiten, vom Lande[S. 82] und vom Hafen aus, versuchte er sie zu erstürmen; aber ein Bürger der Stadt, der große Mathematiker Archimēdes, erfand Maschinen, durch die er die Schiffe und Sturmwerke der Römer vernichtete und alle ihre Versuche vereitelte. Die Mauern versah er mit jeder Art von Geschützen, welche die feindlichen Schiffe mit Steinkugeln bewarfen; in die Mauer brach er von unten bis oben breite Schießscharten, durch welche die Verteidiger mit Pfeilen und Handgeschossen den Feind ungesehen überschütteten. Wenn römische Schiffe in die Nähe kamen, so ließ er eiserne Ketten mit Haken herab, zog durch Hebelkräfte die Schiffe in die Höhe und stürzte sie dann wieder ins Meer hinab. Auch soll er Brennspiegel erfunden haben, um die feindlichen Schiffe anzuzünden. Durch diese Maschinen fügte er den Römern furchtbare Verluste zu und setzte sie so in Angst, daß zuletzt alle, wenn nur ein Seil oder Holz sich auf der Mauer zeigte, eiligst die Flucht ergriffen. Aber endlich wurde Marcellus doch auf folgende Weise Herr der Stadt.
Einst unterhandelten die Syrakusaner von einem Turme herab mit den Römern. Einer von diesen zählte dabei die Quadersteine der Mauer und merkte sich ihre Größe. Daraus berechnete man ihre Höhe an dieser Stelle und verfertigte Leitern zum Ersteigen. Als nun das dreitägige Fest der Göttin Artĕmis (Diána) in der Stadt gefeiert wurde, und die Bürger nach den Festmahlen des Tages sich zur Ruhe gelegt hatten, erstiegen tausend der kühnsten Krieger die bezeichnete Mauerstelle, töteten die hier aufgestellten Wachen und erbrachen das nächste Tor, durch welches Marcellus mit dem Heere eindrang. Den Bürgern ward Leben, Freiheit und Wohnung gesichert und nur das bewegliche Gut geplündert. Eine Menge von Kunstwerken und Schätzen ward nach Rom geschleppt. Der große Archimedes soll im Getümmel seinen Tod gefunden haben. Ein Krieger, der ihn nicht kannte, stürmte in sein Haus und fand ihn in das Zeichnen von Sandfiguren vertieft. „Zertritt mir meine Kreise nicht!“ rief er ärgerlich dem Manne zu, worauf dieser ihn erschlug. Gern hätte ihm Marcellus das Leben erhalten; den Toten ehrte er durch ein Denkmal.
Inzwischen hatte der Krieg auch in Italien nicht geruht. Zwar hatte Hannibal die wichtige Seestadt Tarent durch[S. 83] Verrat genommen (212), dagegen mußte er sehen, wie Capua von einem römischen Heere aufs härteste bedrängt wurde. Um diese Stadt von dem Belagerungsheere zu befreien, unternahm er einen Zug gegen Rom, und schlug eine Meile vor der Ostseite der Stadt sein Lager auf (211). Von einer Anhöhe herab betrachtete er die Lage und die Mauern der Stadt, und eine Sage ging, er habe eine Lanze in eine der nächsten Straßen geschleudert. Zweimal stand er dem römischen Heere kampfbereit gegenüber, und zweimal nötigte ein Ungewitter mit furchtbarem Hagel- und Regenguß die Heere in ihre Lager zurückzukehren, während das heiterste Wetter eintrat, sobald sie sich getrennt hatten. Darin erkannten selbst die Punier einen Götterwink, und Hannibal trat den Rückweg an. Aber noch lange nachher erhielt sich im Volke der Eindruck des Schreckensrufs: „Hannibal vor den Toren!“
Nun gab Hannibal die Stadt Capua ihrem Schicksal preis. Die Belagerten erkannten ihren hoffnungslosen Zustand und beschlossen die Übergabe; da trat ein Mann, namens Vibius Virrius, der am meisten zum Abfall von Rom geraten hatte, hervor und sagte: „Von dem erbitterten Feinde ist keine Gnade zu hoffen; retten kann uns nur der Tod. Wer von euch den Mut hat dies Ende auf sich zu nehmen, der komme heute zu mir als Gast. Habt ihr euch da an Speise und Trank gelabt, so will ich euch einen Becher bieten, der von aller Schmach erretten soll.“ Siebenundzwanzig folgten ihm zu diesem Totenmahle, bei dem sie sich erst mit Wein berauschten, dann das Gift, das er ihnen reichte, tranken, sodaß sie vor dem Einzuge der Feinde den Geist aufgaben. Die Stadt aber erfuhr eine furchtbare Züchtigung. Siebzig Ratsherren wurden hingerichtet, dreihundert der edelsten Campaner starben im Kerker, eine Menge Bürger wurde verkauft, und Capua fortan als ein untertäniger, des Stadtrechts entkleideter Ort behandelt. Gleiche Strenge erfuhren mehrere kleinere Städte Campaniens als Strafe für ihren Abfall, und die treu gebliebenen fühlten sich in ihrem Widerstand gegen den Feind eines glücklichen Ausgangs sicher.
Dieser Kampf dauerte in den südlichen Teilen Italiens mit wechselndem Glück noch Jahre lang fort, ohne eine Entscheidung herbeizuführen. Marcellus, der Eroberer von Syrakus, wiederholt zum Konsul gewählt, führte ihn mit der ihm eigenen Umsicht und Zähigkeit, bis er in einem ihm gelegten Hinter[S. 84]halt den Tod fand (208). Zwei Jahre nach Capuas Fall ward auch Tarent von dem Konsul Q. Fabius — es war das fünfte Konsulat des 80jährigen Helden — erstürmt und mit furchtbarer Härte für den Abfall gestraft. Hannibals Versuch, die unglückliche Stadt zu schützen, kam zu spät.
Da Hannibal ohne Unterstützung von Karthago blieb, so setzte er seine Hoffnung auf das an Hilfsmitteln unerschöpfliche Spanien, von wo ihm seine Brüder Hasdrubal und Mago zu verschiedenen Malen neue Truppen zuzuführen suchten. Aber auch diese Hoffnung täuschte ihn. Hasdrubal war schon mit einem starken Heere, dem letzten, das er in Spanien hatte sammeln können, über die Alpen nach Italien und am östlichen Apennin entlang bis in die Landschaft Picenum gelangt, wo ihm der Konsul Livius Salinator entgegentrat. Auf die Kunde hiervon eilte auch der andere Konsul Claudius Nero, der in Unteritalien Hannibal gegenüber im Lager stand, bevor dieser von der Ankunft seines Bruders Nachricht erhalten, in raschem Zuge seinem Amtsgenossen zu Hilfe. Vereinigt schlugen und vernichteten sie bei Sena Gallica am Flusse Metaurus, im Jahre 207, das feindliche Heer. Als Hasdrubal die Niederlage der Seinen erkannte, stürzte er sich unter die Feinde und kämpfte, bis er den Tod fand. Darauf kehrte Nero in sein altes Lager zurück und ließ, wie erzählt wird, das blutige Haupt Hadrubals unter die feindlichen Vorposten schleudern. Als Hannibal seines Bruders Kopf erkannte und seine letzte Hoffnung geschwunden sah, soll er in bitterem Schmerze ausgerufen haben: „Daran erkenne ich Karthagos Schicksal!“
In den letzten Jahren behauptete sich Hannibal nur noch im Gebiete der ihm treuen Bruttier und verfuhr nur verteidigungsweise. Endlich ward er vom Rate zu Karthago zum Schutze der Vaterstadt zurückgerufen, da die Römer in Afrika gelandet waren und Karthago selbst bedrängten. Hannibal zögerte nicht dem Ruf zu folgen; denn seine Rolle in Italien war ohnehin zu Ende. In Kroton (Cortona) bestieg er mit dem Reste seines Heeres die Schiffe und verließ den Schauplatz seines sechzehnjährigen Kampfes (203). Ebenso wurde sein jüngster Bruder Mago, der seit drei Jahren in Nord[S. 85]italien sich festgesetzt und behauptet hatte, heimgerufen, starb aber auf der Fahrt an einer Verwundung.
In Rom atmete man auf, als der gewaltige „libysche Löwe“ endlich den italischen Boden freiwillig verließ. Bei diesem Anlaß ward dem einzig überlebenden der Feldherren, die gegen ihn gefochten hatten, dem bald 90jährigen Quintus Fabius von Senat und Bürgerschaft die höchste Ehre erwiesen, die ein Bürger erreichen konnte. Er empfing den Graskranz, den nach alter Sitte das Heer seinem Feldherrn darbrachte, dem es seine Rettung zu verdanken hatte. Noch in demselben Jahre starb der alte Held.
Der Feldherr aber, der den Krieg nach Afrika verlegt hatte, war Publius Cornelius Scipio, der Sohn jenes Scipio, der im Treffen am Ticinus verwundet worden war. Sein Vater und sein Oheim hatten, nachdem sie fast ganz Spanien erobert hatten, zuletzt im Kampfe gegen Hannibals Bruder Hamilkar schwere Niederlagen erlitten und selber den Tod gefunden (211), und so hoffnungslos schien damals die Lage der Römer auf dieser Halbinsel, daß in Rom jeder den Oberbefehl in diesem gefahrvollen Kriege ablehnte. Nur der erst siebenundzwanzigjährige Publius Scipio bot dem Vaterlande seine Dienste an. Er hatte noch nicht das zu Staatsämtern erforderliche Alter erreicht, aber der aus schönem Körper hervorleuchtende hohe und stolze Geist, seine Begierde den Tod des Vaters zu rächen und seine schon bewährte Tapferkeit bestimmten den Senat dem edlen Jüngling den Heerbefehl zu übertragen. Im Jahre 211 ging er, den die Römer mit dem Kriegsgott selber verglichen, nach Spanien, um dieses wichtige Gebiet dem Feinde zu entreißen.
Hier fand er ein niedergeschlagenes und zerrüttetes Heer, dem er erst Mut und Vertrauen einflößen mußte. Schon 210 eroberte er Neukarthago und gewann unermeßliche Beute. Die Geiseln, welche die Karthager für die Treue der Spanier hier aufbewahrten, behandelte er mit großer Freundlichkeit und Schonung. Unter ihnen befand sich eine Jungfrau von ausgezeichneter Schönheit. Er fragte sie nach ihren Eltern und ihrer Heimat. Sie sagte ihm, sie sei die Tochter eines keltiberischen Häuptlings und die Braut des Allucius, eines keltiberischen Fürsten. Sogleich ließ Scipio ihre Eltern und ihren Bräutigam herbeikommen. Sie naheten sich in banger Ungewißheit, aber Scipio beruhigte sie: „Hier ist deine Braut“,[S. 86] sprach er zu Allucius, „nimm sie unverletzt und ohne Lösegeld zurück, und werde ein Freund der Römer!“ Da ergriff Allucius, von Dankgefühl und Freude hingerissen, die Rechte des Scipio und bat die Götter solchen Edelmut würdig zu belohnen. Auch die Eltern des Mädchens waren tief gerührt. Sie hatten ein großes Lösegeld mitgebracht und baten ihn dies als ein Zeichen ihrer Dankbarkeit anzunehmen. Scipio nahm das Geld, wandte sich noch einmal an Allucius und sagte: „Zu der Mitgift, die du von deinem Schwiegervater erhalten wirst, nimm von mir dieses Hochzeitsgeschenk.“ Freudig kehrte der glückliche Bräutigam mit den Seinigen zurück, und indem er überall das Lob des Scipio verbreitete, brachte er seine Mitbürger auf die Seite der Römer. „Ein Jüngling,“ sagte er zu den Keltiberern, „ist nach Spanien gekommen, ganz den Göttern ähnlich, der nicht bloß durch Waffen, sondern auch durch Milde und Wohltun alles besiegt.“
Nachdem Scipio in sechsjährigem Kriege die karthagische Macht in Spanien völlig vernichtet und die Einwohner teils mit Waffengewalt, teils durch kluge Großmut und Milde unter römische Botmäßigkeit gebracht hatte, kehrte er sieggekrönt nach Rom zurück (205), wo ihm das Konsulat für das folgende Jahr übertragen wurde. Er ging nach Sizilien und traf hier gewaltige Zurüstungen zu einem Zuge nach Afrika, an dessen Küste er im Jahre 204 landete. Die Karthager hatten ein bedeutendes Heer unter Hasdrubal und Syphax, dem König von Westnumidien. Aber Scipio wußte durch eine List ihr Lager auszukundschaften, steckte es bei einem nächtlichen Überfall in Brand und rieb fast das ganze Heer auf. Auch in einer zweiten Schlacht schlug er die Feinde. Da riefen die Karthager, im eigenen Lande gefährdet, ihren Feldherrn Hannibal zurück.
Der gefürchtete Held erschien in Afrika und bezog bei Zama, fünf Tagereisen von Karthago, ein Lager (202). Vor der Schlacht wünschte er, da er wohl einen unglücklichen Ausgang voraussah, eine Unterredung mit Scipio, um über den Frieden zu verhandeln. Sie ward ihm gewährt. Auf einer Ebene unweit von Zama kamen beide Feldherrn zusammen. Sie gerieten beim ersten Anblick in solches Erstaunen, daß sie sich eine Zeit lang schweigend betrachteten. Beide hatten sich noch niemals gesehen und doch schon so viel von einander gehört. Beide waren die größten Feldherrn ihrer Zeit, aber in[S. 87] ihrem Äußeren weit verschieden. Hannibal, damals fünfundvierzig Jahre alt, zeigte ein finsteres, schwermütiges Antlitz; die Mühseligkeiten seiner langen und wechselvollen Feldzüge hatten ihre tiefen Spuren darin zurückgelassen. Scipio hingegen, damals in einem Alter von fünfunddreißig Jahren, war ein Muster männlicher Schönheit. Nach langem Schweigen fing endlich Hannibal die Unterredung an. Er sprach zuerst von der Veränderlichkeit des Glücks und seinen eigenen Schicksalen; dann riet er Scipio, er möge dem Glücke, das ihm jetzt lächele, nicht zu sehr vertrauen, und einen sicheren Frieden einem ungewissen Kampfe vorziehen. Hierauf legte er ihm seine Friedensbedingungen vor; er versprach im Namen der Karthager Spanien, Sardinien und alle anderen Inseln zwischen Afrika und Italien den Römern abzutreten. Scipio aber verwarf diese Bedingungen und forderte vollständige Unterwerfung der Karthager. Da Hannibal diese nicht versprechen wollte noch konnte, so schied man ohne Ergebnis von einander, um sich zum Entscheidungskampfe zu bereiten.
Am folgenden Tage stellte Scipio die drei Linien seines Fußvolkes in die Mitte, und zwar in durchbrochenen Gliedern, um den achtzig Elefanten, welche Hannibal vor seiner Schlachtlinie aufstellte, Raum zum Durchbrechen zu lassen. Auf dem linken Flügel stand die italische Reiterei, auf dem rechten Massinissa, der mit den Römern verbündete König von Ostnumidien, an der Spitze seiner numidischen Reiter. Auch Hannibal ordnete sein Fußvolk in drei Linien. Vorn, gedeckt durch die Reihe der Elefanten, die karthagischen Soldtruppen, hinter diesen die libyschen Truppen, und darauf die Veteranen, die er aus Italien hergeführt hatte. Auf den beiden Flügeln standen wie üblich die Reitergeschwader.
Gleich beim Beginn des Treffens wurden die Elefanten durch das Kampfgeschrei und die Feldmusik der Römer, dann durch einen Hagel von Geschossen scheu, brachen durch die Lücken der römischen Aufstellung und warfen sich auf die Reiterei des eigenen Heeres. Diese geriet in Unordnung und ergriff, als jetzt die römische zum Angriff vordrang, die Flucht. So wurden gleich anfangs die Flügel des punischen Heeres entblößt. Aber auch die Leichtbewaffneten in der ersten und zweiten Linie der Karthager wurden nach kurzem Gefecht auf die Hauptkolonne zurückgeworfen. Ganze Haufen von Erschlagenen lagen der vordringenden ersten Linie der Römer[S. 88] im Wege und hinderten sie im weiteren Vorrücken. Da ließ Scipio die zweite und dritte Linie eine Schwenkung machen und in die Flanken des Feindes vordringen. Gleichwohl hielt das punische Heer, von Hannibal rasch wieder gesammelt und geordnet, und zumal seine italischen Kerntruppen noch tapfer stand, bis die römische Reiterei von der Verfolgung der punischen zurückkam und dem Fußvolk in den Rücken fiel. Dies entschied die Niederlage der Punier; 20000 lagen tot auf dem Schlachtfelde, etwa ebenso viele wurden gefangen. Hannibal selbst entkam mit wenigen Reitern. Er erkannte, daß fortan jeder Widerstand vergeblich sei, und riet in Karthago dringend zum Frieden.
Der Friede kam auf folgende Bedingungen zustande (201): die Karthager behalten nur ihr Gebiet in Afrika, bezahlen 10000 Talente (über 47 Mill. Mark) in 50 Jahren, liefern ihre 500 Kriegsschiffe bis auf 10 aus, ebenso die Elefanten, und dürfen ohne Roms Genehmigung keinen Krieg anfangen. Damit war die Macht und die Vorherrschaft Karthagos im westlichen Mittelmeer gebrochen. Sicilien und die iberische Halbinsel standen fortan als die ersten Provinzen des erstehenden römischen Reiches (imperium) unter der Verwaltung römischer Statthalter. Nicht lange, so gerieten auch die Küstenländer des östlichen Mittelmeeres unter die Hoheit dieses Reiches.
Nach seiner Rückkehr feierte Scipio in Rom einen Triumph, der alle früheren an Bedeutung und Glanz übertraf, und erhielt den Ehrennamen Africanus.
Nach Abschluß des Friedens war Hannibal rastlos bemüht die durch den langen Krieg erschöpften Kräfte seiner Vaterstadt wieder herzustellen und einer besseren Zeit, auf die er immer noch hoffte, vorzusorgen. Vor allem verwaltete er die Einkünfte und Ausgaben des Staates so weise und sparsam, daß nicht nur die außerordentliche Kriegssteuer regelmäßig an die Römer bezahlt wurde, sondern sogar noch ein Überschuß blieb. Aber unter den Bürgern fehlte es ihm nicht an mächtigen Feinden, die, von den Römern heimlich ermuntert, auf sein Verderben sannen. Um ihren Nachstellungen zu entgehen, verließ er nach vier Jahren sein Vaterland und ging[S. 89] zu Antiochus, dem König von Syrien, mit dessen Hilfe er aufs neue einen Kampf gegen Rom zu beginnen hoffte. Dieser mächtige König geriet einige Jahre später in Krieg mit Rom, den er auf Hannibals Rat in Griechenland und Italien zu führen beschloß. Aber statt mit aller Macht nach Italien zu gehen, zögerte er in Griechenland, bis ein römisches Heer dort erschien und ihn bei Thermopylä besiegte, worauf er eiligst nach Asien zurückkehrte (191). Hier trat ihm im folgenden Jahre der römische Konsul Lucius Cornelius Scipio entgegen, dem sein Bruder Publius, der Sieger von Zama, als Berater und eigentlicher Leiter des Feldzugs beigegeben war. Die entscheidende Schlacht erfolgte in Lydien bei Magnesia am Berge Sípylos (190).
Den Angriff machten die Syrer mit ihren furchtbaren Sichelwagen. Aber die römischen Schleuderer und Bogenschützen scheuchten die Pferde derselben durch ihre Geschosse und ihr Geschrei, sodaß sich diese mit den Wagen wendeten und auf den einen syrischen Flügel einstürmten, und als hier durch die Fliehenden eine Lücke entstand, drangen die römischen Reiter ein und brachten denselben samt dem ganzen Mitteltreffen in Verwirrung. Auf dem rechten Flügel dagegen war Antiochus schon nahe daran das römische Lager zu erobern, als er von der dort aufgestellten Besatzung so empfangen wurde, daß er sein Pferd zur Flucht wandte und den Römern das Schlachtfeld überließ. Von den Syrern waren 50000, von den Römern nur einige hundert Mann gefallen.
Antiochus, gänzlich geschlagen, mußte in einem schimpflichen Frieden Kleinasien bis an das Gebirge Taurus abtreten und 15000 Talente (über 70 Millionen Mark) zahlen. Auch gehörte zu den Friedensbedingungen Hannibals Auslieferung. Dieser floh aber zu Prúsias, dem König von Bithynien, der ihn sehr freundlich aufnahm und mit einer Burg beschenkte. Hier lebte er eine Zeitlang in Frieden, richtete aber seine Wohnung so ein, daß sie nach jeder Seite einen Ausgang hatte; denn er zweifelte ebenso sehr an der beharrlichen Treue des Königs, als er von dem Hasse der Römer gegen sich alles fürchtete. Und er irrte sich nicht.
Als die Römer von dem Aufenthalte ihres größten Feindes Nachricht erhalten hatten, schickten sie eine Gesandtschaft zu Prusias, an deren Spitze Flaminius stand. Dieser bat den König um die Auslieferung Hannibals. Der König[S. 90] scheute sich das Gastrecht zu verletzen, er fürchtete aber nicht minder das Gesuch abzuschlagen. Er ließ daher die Römer selbst hingehen, um sich Hannibals zu bemächtigen. Eines Tages sah dieser sein Haus auf allen Seiten von Bewaffneten umringt und keinen Ausweg zur Flucht mehr übrig. Eingedenk seiner großen Vergangenheit wollte er sich nicht lebendig gefangen geben. „So will ich denn endlich die Römer“, rief er aus, „von ihrer Angst befreien, da sie den Tod eines alten Mannes doch nicht erwarten können!“ Darauf nahm er das Gift, das er schon längst bei sich zu führen gewohnt war, und starb, wie er gelebt hatte, voll Haß gegen die Römer (183), einer der größten Feldherrn der alten wie der neuen Zeit, der furchtbarste Feind, den Rom je zu bestehen hatte.
In demselben Jahre endete auch das Leben seines großen Gegners Publius Scipio, des Siegers von Zama. Auch dieser war dem Neide und der Mißgunst seiner Mitbürger nicht entgangen. Er war als Unterfeldherr seinem schwächlichen und wenig begabten Bruder Lucius im Krieg gegen Antiochus nach Asien gefolgt, nach dessen siegreichem Ausgang jener den Ehrennamen Asiaticus erhielt. Nach seiner Rückkehr wurde er nebst seinem Bruder, auf Anstiften des Cato, angeklagt, sie wären von Antiochus bestochen worden, um ihm einen milden Frieden zu gewähren, und hätten einen Teil der Beute unterschlagen. Viele ehrliche, aber allzu argwöhnische Bürger mißbilligten zwar eine solche Anklage gegen einen so verdienstvollen Mann; dennoch ward Scipio von den Tribunen vor das Volksgericht geladen. Und er erschien am bestimmten Tage, aber wie ein Triumphator, das Haupt bekränzt, von zahlreichen Freunden und Anhängern begleitet. Mitten durch die Versammlung schritt er zur Rednerbühne. Aber anstatt sich gegen den schmählichen Vorwurf der Bestechlichkeit und der Unterschlagung zu verteidigen, zerriß er vor den Augen des Volkes die Rechnungen über seine und des Bruders Amtsführung, und rief: „An diesem Tage habe ich einst Hannibal bei Zama geschlagen und Karthago euch zinsbar gemacht. Laßt uns nicht undankbar gegen die Götter sein! Auf! gehen wir aufs Kapitol, um ihnen zu danken!“ Mit diesen Worten verließ er die Bühne und stieg zum nahen Kapitol hinan. Alles Volk brach in Beifall aus und folgte ihm, nur die Tribunen blieben, beschämt und verhöhnt, allein auf dem Platz zurück. Scipio wurde von dem Volke zuerst auf das Kapitolium, dort zum[S. 91] Tempel des Jupiter und endlich in seine eigene Wohnung zurückbegleitet. So ward dieser Tag der Anklage für ihn fast noch ehrenvoller als der Tag seines Triumphes.
Da aber die Anfeindungen seiner Neider und Gegner gleichwohl nicht nachließen, so erfüllte sich das Gemüt des stolzen Mannes mit solcher Bitterkeit, daß er nicht mehr inmitten so vieler Undankbarkeit weilen mochte: er verließ Rom und zog sich auf sein Landgut Liternum in Campanien zurück. Aber der Haß der Tribunen verfolgte ihn auch hier. Sie erneuerten ihre Anklage; vergebens entschuldigte ihn sein Bruder durch eine Krankheit. Erst als Tiberius Gracchus, sonst ein Feind der Scipionen, eine solche Anklage für eine des römischen Staates unwürdige Handlung erklärte, ließen die Tribunen davon ab. Scipio aber verlebte den Rest seiner Tage in Liternum, ohne je nach Rom zurückzukehren. Ja der Groll gegen seine Vaterstadt war so groß, daß er seiner Gattin befahl seinen Leichnam nicht in dem Grabmal der Scipionen an der appischen Straße, nahe vor Rom, sondern in Liternum beizusetzen und dort auf sein Grab die Worte zu schreiben: „Undankbare Vaterstadt, auch meine Gebeine sollst du nicht haben!“
Nachdem die Römer aus dem zweiten punischen Kriege, der anfangs ihren Staat mit dem Untergang bedroht hatte, siegreich hervorgegangen waren, dehnten sie ihre Eroberungen auch nach Osten aus, wo sie den Kampf mit den aus Alexanders des Großen Weltmonarchie entstandenen Reichen begannen. Schon ehe Lucius Scipio, wie bereits erwähnt, Antiochus, den König von Syrien, bei Magnesia besiegte, war Philippus III. von Makedonien, der im punischen Kriege auf Hannibals Seite getreten war, in der Schlacht bei Kynosképhalä in Thessalien, wo die berühmte makedonische Phalanx den römischen Legionen gegenübertrat, von Quinctius Flamininus geschlagen worden (197). Im Frieden mußte Philippus[S. 92] alle seine Eroberungen in Griechenland herausgeben, worauf Flamininus, für griechische Bildung begeistert, bei den isthmischen Spielen Griechenlands Freiheit verkündigte. Die Griechen sollten fortan nach eigenen Gesetzen leben, keine fremde Besatzung im Lande haben und keinen Tribut bezahlen.
König Philipp suchte zwar den Frieden mit dem stetig vordringenden Rom solange als möglich zu erhalten, erkannte aber die seinem Reiche von dort dräuende Gefahr und traf alle Vorbereitungen zu einem neuen Kriege, der auch bald nach seinem Tode unter seinem Sohne Perseus zum Ausbruch kam. Die Römer führten diesen Krieg in den ersten Jahren sehr lässig, und erst Ämilius Paullus erzwang durch den entscheidenden Sieg bei Pydna die Unterwerfung Makedoniens (168).
Kurz vor dieser Schlacht trat eine Mondfinsternis ein, die ein römischer, der Astronomie kundiger Oberst, Sulpicius Gallus, dem Heere vorhergesagt und erklärt hatte, damit sie dieselbe nicht für ein böses Vorzeichen halten möchten, während die Makedoner sie für ein Unglückszeichen hielten und vor Angst laut schrieen. Als die Schlacht begann, bot der starre Lanzenwald der dichtgeschlossenen makedonischen Phalanx den Römern einen so furchtbaren Anblick dar, daß es lange Zeit nicht gelingen wollte die Legionen zum Angriff heranzubringen. Erst als Ämilius hier und da Lücken bemerkte, befahl er in Keilstellung sich in die Lücken einzudrängen, und während die Elefanten den einen seiner Flügel zum Weichen brachten, sprengte er selbst mit einer Legion die Mittelstellung des Feindes. So ward der Sieg in einer Stunde entschieden; 20000 Makedoner bedeckten das Schlachtfeld, 11000 wurden gefangen. Bald darauf war Perseus genötigt sich mit den Seinigen den Römern zu ergeben.
Ämilius Paulus feierte zu Rom einen dreitägigen Triumph und brachte eine unermeßliche Beute heim. In allen Straßen und auf allen freien Plätzen waren Schaugerüste für das Volk errichtet; alle Tempel waren geöffnet und strömten, mit Kränzen geschmückt, den Duft des köstlichsten Weihrauchs aus. Am ersten Tage wurden die erbeuteten Gemälde, Bildsäulen, Vasen und sonstiges Kunstgerät auf 250 Wagen aufgeführt. Am zweiten Tage wurden die eroberten Waffen und Rüstungen im hellsten Glanze und in kunstreicher Anordnung umhergefahren, darauf 750 Gefäße mit gemünztem Silber, zuletzt[S. 93] die kunstvollsten Silbergeräte der verschiedensten Art, von zahlreichen Trägern vorübergetragen. Am dritten Tage eröffneten 120 bekränzte Opferstiere den Zug; ihnen folgten festlich geschmückte Knaben und Jünglinge mit Opfergefäßen; dann kam des Perseus Schatz und sein Wagen mit dem Diadem und Waffenschmuck, endlich seine Kinder, Perseus selbst mit verstörtem Gesicht, samt seiner Gemahlin und Verwandtschaft. Alsdann wurden 400 goldene Ehrenkronen, welche die griechischen Städte dem Sieger gewidmet hatten, vorbeigetragen. Den Schluß machte Ämilius selbst auf einem mit vier weißen Rossen bespannten Triumphwagen in goldgesticktem Purpurgewand, einen Lorbeerzweig in der Hand, und hinter ihm das siegreiche Heer.
Perseus endete in römischer Gefangenschaft. Makedonien wurde in vier gänzlich von einander getrennte Gemeinwesen geteilt. Mit dem Siege bei Pydna war Roms Oberherrschaft auf der Balkanhalbinsel entschieden.
Bei all diesen Erfolgen aber blieb die Aufmerksamkeit der Römer auch auf Karthago gerichtet, das, an günstigster Stelle der afrikanischen Nordküste gelegen, durch seinen Handel, durch die Fruchtbarkeit und den Reichtum des Landes sich von neuem zu einem Wohlstand erhoben hatte, welcher den Neid und das Mißtrauen der Römer erregte. Sie ruhten nicht eher, als bis die alte Nebenbuhlerin gänzlich vernichtet war. Der Ruhm, Rom von dieser noch immer nicht ungefährlichen Stadt befreit zu haben, fiel dem Publius Cornelius Scipio Ämilianus zu.
Dieser Mann war der Sohn jenes Ämilius Paullus, der den makedonischen König Perseus überwunden hatte. Er war ein tapferer und einsichtiger Soldat, wenn auch kein großer Feldherr, von reiner edler Sinnesweise, von einer Bildung, die ihn über alle seine Standesgenossen erhob, ein Kenner und Freund hellenischer Kunst, Literatur und Wissenschaft. Er war von dem kinderlosen Sohne des großen Scipio an Sohnes statt angenommen, führte deshalb nach römischer Sitte dessen Namen und außerdem, zur Erinnerung an sein väterliches Geschlecht den Beinamen Ämilianus. Nachdem er während der Belagerung Karthagos sich als der tüchtigste Offizier des Heeres bewährt hatte, wurde ihm der Oberbefehl übertragen. Dieser Krieg aber hatte folgende Veranlassung.
Massinissa, König von Numidien, den die Römer den Karthagern zum Nachbar und Aufseher hingestellt hatten, beunruhigte diese unaufhörlich und nahm ihnen Provinzen und Städte weg. Die wiederholten Klagen der Karthager fanden in Rom kein Gehör. Als sie endlich gegen ihn zu den Waffen griffen, sah der römische Senat darin eine Verletzung des Friedens. Der Mann, der fortwährend im Senate zur Zerstörung Karthagos aufreizte, war der schon oben (S. 90) erwähnte Marcus Porcius Cato.
Dieser Mann übte in Rom einen großen Einfluß auf den Senat wie auf das Volk. Als Bauer im Sabinerlande geboren, war er Zeit seines Lebens von derben bäuerischen Sitten geblieben, und ein erbitterter Feind der feineren griechischen Bildung und der damit verbundenen Sittenänderung. Wie er im punischen und makedonischen Kriege sich in vielen Schlachten hervorgetan, so war er auch im Frieden unermüdlich im Dienste des Staates und erreichte die höchsten Ämter. Als Zensor übte er gegen alle Bürger, selbst die vornehmsten, welche sich ihres Standes unwürdig benommen hatten, eine unnachsichtige Strenge. Man nennt ihn deshalb, zum Unterschiede von dem gleichnamigen Gegner Cäsars, Censorius. Zur Prüfung einer Streitsache zwischen Karthago und Massinissa war er nach Afrika geschickt worden, und sah mit Erstaunen und Sorge, wie sehr sich die Stadt in dem halben Jahrhundert des Friedens wieder gehoben hatte. Handel und Verkehr blühten, die Volkszahl war so groß wie ehemals, der Kriegshafen voll von Schiffen und die Zeughäuser angefüllt mit Waffen und aller Art von Kriegsgerät. Seit dieser Zeit stimmte Cato für die Zerstörung Karthagos und fügte jedem Vortrage, den er im Senat hielt, die Worte hinzu: „Übrigens bin ich der Meinung, daß Karthago zerstört werden muß.“ Einst brachte er einige Feigen in die Senatsversammlung. Als die Senatoren deren Größe und Schönheit bewunderten, sagte er: „Diese Feigen sind erst vor drei Tagen in Karthago gepflückt worden; so schöne Frucht trägt dies feindliche Land, und so nahe sind wir ihm.“ Durch solche und ähnliche Künste suchte Cato den Senat für seinen Vorschlag zu gewinnen.
Vergeblich erhob sich im Senat ein lebhafter Widerspruch gegen ein so ungerechtes und zugleich unkluges Verfahren. Man besorgte mit Recht, daß die Kräfte der Römer erschlaffen[S. 95] oder sich gegen den Staat selbst richten würden, wenn sie nicht mehr durch Furcht vor der Nebenbuhlerin angespannt oder nach außen geleitet würden. Endlich drang jedoch Cato mit seiner Meinung durch. Als bald darauf Karthago, durch die unablässigen Übergriffe Massinissas gereizt, sich mit Waffengewalt gegen ihn erhob, benutzte der römische Senat diesen Anlaß, um die Stadt des Friedensbruches anzuklagen, und die Konsuln erhielten den Befehl, von Sicilien aus nach Afrika zu gehen und den Krieg gegen Karthago zu beginnen (149).
Als die Karthager davon hörten, gerieten sie in die größte Bestürzung. Im Gefühl ihrer Schwäche schickten sie zu wiederholten Malen Gesandte nach Rom und unterwarfen sich gänzlich dem Willen der Römer. Der Senat nahm ihre Unterwerfung an und befahl ihnen dreihundert Geiseln, Söhne ihrer vornehmsten Bürger, nach Sicilien zu bringen und den Konsuln Folge zu leisten. Die Geiseln wurden gestellt, aber die Konsuln segelten gleichwohl mit ihrem Heere nach Afrika. Bei der Ankunft eines so großen Heeres schickten die Karthager von neuem eine Gesandtschaft an die Konsuln, um sie zu fragen, was sie tun sollten, und mit dem Versprechen, daß sie alles zu tun bereit wären. Die Konsuln verlangten, die Karthager sollten ihre vorrätigen Schiffe, Waffen und Kriegsmaschinen ausliefern. Die Karthager stellten ihnen vor, daß sie von inneren und äußeren Feinden umgeben wären und also ihrer Waffen bedürften. Allein die Konsuln antworteten in stolzem Tone: „Rom wird für eure Sicherheit sorgen.“ Und Karthago gehorchte noch einmal. Die Schiffe wurden verbrannt, die Kriegsgeräte ausgeliefert. Ihre Zahl soll sich auf 200000 schwere Rüstungen und 3000 Katapulten (Wurfmaschinen) belaufen haben. Hierauf riefen die Konsuln die vornehmsten Senatoren der Karthager zu sich, um ihnen die letzten Befehle des römischen Senats zu eröffnen. Sie erschienen, ein ehrwürdiger Zug von dreißig Greisen, denen eine nicht minder ehrwürdige Anzahl von Priestern und vornehmen Männern folgte. Jetzt verlangten die Konsuln im Namen des Senats: die Karthager sollten ihre Stadt verlassen und eine andere bauen, die über 10000 Schritte weit vom Meer entfernt wäre Und keine Mauern hätte; denn das jetzige Karthago müsse dem Erdboden gleich gemacht werden.
Mit Entsetzen hörten die Abgeordneten diese furchtbaren Befehle, und brachen in so herzergreifendes Wehklagen aus,[S. 96] daß selbst das umstehende Kriegsvolk dadurch gerührt wurde. Aber die Konsuln blieben erbarmungslos, sie bestanden auf ihrer Forderung, und die Gesandten kehrten ganz entmutigt nach Karthago zurück. Hier aber, als sich die Schreckenskunde verbreitete, bemächtigte sich des Volkes eine rasende Wut und Verzweiflung. Die Wut wendete sich zuerst gegen diejenigen der Senatoren, die zur Auslieferung der Geiseln und Waffen geraten hatten. Andere ergriffen die Abgeordneten, steinigten sie und schleiften ihre Körper durch die Straßen der Stadt. Noch andere ermordeten alle anwesenden Italiker oder zogen mit Hohngelächter in die Tempel der Götter, die, wie sie sagten, nicht einmal Kraft genug zu ihrer eigenen Verteidigung hätten. Nur wenige behielten bei der allgemeinen Aufregung einige Besonnenheit. Diese verschlossen die Tore der Stadt und trugen eine große Menge Steine auf die Mauern, um damit wenigstens den ersten Angriff zurückzutreiben.
Als die Heftigkeit des ersten Schmerzes vorüber war, versammelten sich die Senatoren von neuem. Alle waren entschlossen ihre Stadt aufs äußerste zu verteidigen und entweder zu siegen oder zu sterben. Eine rastlose Tätigkeit begann und setzte alles in Bewegung. Die Verbrecher wurden aus den Gefängnissen erlöst, die Sklaven freigelassen, die Verbannten zurückgerufen und alle Einwohner zum Waffendienst verpflichtet. Aber nun fühlte man den Mangel an Waffen. Da wandelten sich alle Tempel und öffentlichen Gebäude in Werkstätten. Alle, ohne Unterschied des Standes und Alters, Männer und Weiber, arbeiteten Tag und Nacht an der Verfertigung von Waffen. Überall suchte man Eisen und Erz zusammen und nahm sogar den Gold- und Silberschmuck von den Bildnissen der Götter. Die Weiber schnitten ihre Haare ab, um daraus Stricke zu drehen. Bei einem solchen Eifer wurden täglich 140 Schilde, 300 Schwerter, 500 Lanzen und 1000 Wurfspeere verfertigt. Sogar fünfzig neue Kriegsschiffe wurden gebaut.
Die Konsuln hatten indessen mit ihrem Angriff gezögert. Als sie endlich heranrückten, um die Stadt mit Sturm zu nehmen, wurden sie zurückgeschlagen. Außerdem war Hasdrubal, ein verbannter Karthager, mit 20000 Vertriebenen zurückgekehrt. So verteidigten sich die Karthager zwei Jahre lang (149–147) mit verzweifeltem Mute, und alle Anstrengungen der römischen Feldherren blieben ohne Erfolg.
Da wählten die Römer, des langen Zauderns müde, den P. Cornelius Scipio zum Konsul und übertrugen ihm den Oberbefehl gegen Karthago. Scipio fand ein zuchtloses und träges Heer; die Herstellung der Kriegszucht war daher seine erste Sorge. Dann legte er große Wälle und Dämme an, um den Karthagern die Zufuhr vom Lande und von der Seeseite her abzuschneiden. Aber die Karthager gruben auf der inneren Seite des Hafens eine neue Mündung ins Meer hinaus. Da sie die Arbeit ganz geheim betrieben hatten, so erstaunten die Belagerer nicht wenig, als sie eines Tages die Feinde mit 50 Kriegsschiffen heranfahren sahen. Scipio schlug sie jedoch in einem Seegefechte, und machte nun Anstalt zur Bestürmung der Stadt und rückte an die Mauer. Im Frühling des Jahres 146 erstürmte er zuerst den unteren Teil der Stadt, der an die Häfen stieß, während die Burg Byrsa und die zunächst anstoßenden Straßen noch von Feinden besetzt blieben. Hier waren die Häuser am höchsten und ein jedes mußte von den Römern, während die Punier Geschosse jeder Art schleuderten, mit stürmender Hand genommen werden. In den Straßen, in den Häusern, sogar auf den Dächern wurde gekämpft. Und als nun die äußerste Häuserreihe genommen war, befahl Scipio das ganze Quartier anzuzünden, um einen freien Raum für die Bestürmung der Burg selbst zu gewinnen. Sechs Tage vergingen, ehe die entsetzliche Verwüstung vollendet und die Trümmer- und Leichenhaufen weggeräumt waren. Am siebenten Tage kamen 25000 Frauen aus der Burg herab und baten um Schonung ihres Lebens. Scipio bewilligte ihre Bitte. Darauf kamen 30000 Männer und verlangten dieselbe Gnade. Noch wollte Hasdrubal, der Befehlshaber der Burg, nichts von Übergabe wissen. Mit Weib und Kind und mit 900 römischen Überläufern zog er sich zuletzt in das hohe Tempelgebäude des Äsculapius (des Gottes der Heilkunst) zurück. Als aber die Römer auch bis zu dieser äußersten Höhe herangerückt waren, verließ ihn der Mut. Ohne Mitwissen der anderen kam er mit einem Ölzweige in der Hand und bat zu Scipios Füßen um Frieden. Seine Gattin und die übrigen zündeten den Tempel an und stürzten sich in die Flammen. Die noch nicht zerstörten Teile der Stadt wurden darauf zur Plünderung den Truppen preisgegeben; nur die Beute der Tempel an Gold, Silber und Kunstwerken behielt Scipio für den öffentlichen Schatz. Die meisten Einwohner wurden als Sklaven verkauft;[S. 98] viele, unter ihnen auch Hasdrubal, wurden als Gefangene an einzelne italische Städte verteilt und von diesen bis zu ihrem Tode in Haft gehalten. Der Senat beschloß, daß Karthago dem Erdboden gleich gemacht und jeder verflucht sein sollte, der je die Stätte desselben wieder bebauen würde. Nach diesem Beschluß wurden auch die noch stehenden Reste der Stadt angezündet. Siebzehn Tage brannte die vorher von 700000 Menschen bevölkerte, über 700 Jahre alte gewaltige Stadt. Eines Tages beschaute Scipio an der Seite seines Freundes, des griechischen Geschichtschreibers Polybios, von einer Anhöhe aus die rauchenden Trümmer der Stadt, deren Flotten einst die Meere beherrscht hatten. Eine tiefe Wehmut ergriff ihn, da er der Hinfälligkeit aller Menschenmacht und Menschenglückes gedachte, und er erinnerte sich und die Freunde jener Worte, die der Dichter Homer dem Priamos in den Mund legt:
Scipio erhielt von der Zerstörung Karthagos den Ehrennamen Africanus, und wird, um ihn von dem älteren Scipio, dem Sieger bei Zama, zu unterscheiden, der jüngere Afrikaner (Africanus minor) genannt. Das Gebiet Karthagos ward unter dem Namen Afrika eine römische Provinz.
In demselben Jahre, als Karthago fiel, wurde auch Makedonien in eine römische Provinz verwandelt, und auch das freie Griechenland infolge einer Empörung unter den Statthalter von Makedonien gestellt, nachdem die große und reiche Stadt Korinth durch den Konsul Mummius erobert und zerstört worden war (146).
Nachdem Scipio zwölf Jahre in Ruhe und Muße, mit den Wissenschaften beschäftigt, gelebt hatte, wurde ihm eine neue Gelegenheit zu kriegerischer Auszeichnung zuteil. Die Veranlassung zu diesem neuen siegreichen Feldzug bot der Kampf gegen die Stadt Numántia in Spanien.
In dieser Provinz hatte die Habsucht, die Willkür und rohe Grausamkeit der römischen Statthalter, von denen einer sogar wehrlos versammelte Einwohner, die sich unterwarfen, niederhauen ließ, eine allgemeine Empörung erregt. An die Spitze stellte sich Viriáthus, ein kühner Lusitanier. Gewöhnt an ein freies Leben im Gebirge, abgehärtet, gewandt, kräftig von Körper, keine Gefahr scheuend, geliebt von seinen Lands[S. 99]leuten, vertraut mit dem Boden seines bergigen Vaterlandes, verstand er sein Volk zum Kampf für die Freiheit zu begeistern. So verteidigte er sich acht Jahre lang (148–140) gegen die römischen Feldherren, bis er endlich durch Meuchelmord fiel.
Aber auch nach seinem Tode dauerte der Freiheitskampf der Spanier fort. Den heftigsten Widerstand leistete zuletzt die Stadt Numántia. Sie lag auf der altkastilischen Hochebene, am Flusse Durius (Dūero), auf steiler Höhe, von Talschluchten und Wäldern umgeben; Wälle und Gräben schützten den einzigen Zugang aus der Ebene. Die keltiberischen Einwohner, unter ihnen gegen 8000 wehrhafte Männer, waren wegen ihrer kriegerischen Tüchtigkeit bekannt. Schon sieben Jahre lang hatten sie sich gegen die römischen Angriffe behauptet, und in Rom begann man unruhig und besorgt zu werden. Man zieh die bisherigen Führer der Unfähigkeit oder des Verrats und meinte, nur Scipio, der Zerstörer Karthagos, könne hier helfen. So übertrug ihm das Volk den Heerbefehl in Spanien (134).
Bei seiner Ankunft im Lager fand er die Kriegszucht im Heere gänzlich erschlafft; im Lager wimmelte es von Krämern, Schenkwirten und Gesindel; die Soldaten lebten nur in Lust und Spiel. Die Herstellung der alten Mannszucht beschäftigte ihn daher ein ganzes Jahr. Er übte die der Arbeit entwöhnten Soldaten unaufhörlich und mit unerbittlicher Strenge im Lagerbau, Lasttragen, Marschieren, in Manövern und Streifzügen. Da er die Stadt auszuhungern gedachte, so vermied er einen Sturm, rückte aber immer näher an sie heran, schloß sie mit Wall und Graben ein und schnitt ihr so von allen Seiten die Zufuhr ab. Da der reißende Strom des Duero die Linie der Einschließung unterbrach und den Bau einer Brücke nicht zuließ, so baute er an beiden Ufern Kastelle, von denen aus schwere, mit Seilen aneinander hangende Balken, die rundum von Sicheln und eisernen Spitzen starrten, über das Wasser von einer Seite zur andern gespannt wurden, so daß man weder schwimmend noch fahrend den Fluß hinabkommen konnte. Das Heer hatte Scipio bis auf 60000 Mann gebracht und die Belagerten bei mehrmaligen Ausfällen mit großem Verlust zurückgeschlagen. Schon währte die Belagerung fünfzehn Monate; die Hungersnot wütete unter den Numantinern; Gras und das Lederwerk von den Waffen dienten zur Nahrung; man verzehrte Leichname, und die Mütter schlachteten zuletzt ihre Kinder. Endlich baten die Belagerten um Frieden.[S. 100] Aber Scipio verlangte Übergabe auf Gnade oder Ungnade. Die Gesandten, welche diesen Bescheid brachten, wurden von den verzweifelten Einwohnern erschlagen; dennoch blieb ihnen nichts anderes übrig. Sie öffneten die Tore, baten aber die Römer erst am dritten Tage einzuziehen. Diese Frist benutzte ein Teil der Einwohner sich durch freiwilligen Tod der Knechtschaft zu entziehen. Der kleine Rest, von Elend und Krankheit furchtbar entstellt, ergab sich dem Sieger. Sie wurden als Sklaven verkauft; nur fünfzig sparte Scipio für seinen Triumph auf. Die Stadt wurde gänzlich zerstört. Scipio erhielt von dieser Eroberung einen zweiten Beinamen, Numantīnus.
Als er nach Rom zurückgekehrt war, stand er in den dort ausgebrochenen blutigen Parteikämpfen auf der Seite des Adels gegen die von den Gracchen geführte Demokratie, bis er, wahrscheinlich ein Opfer des Parteihasses, starb. Nachdem er in einer Volksversammlung eine dem Volkswillen abgünstige Rede gehalten, fand man ihn am folgenden Tage tot im Bette; der Dolch eines Meuchelmörders hatte ihn getroffen (129). Wer die Tat verübt und auf wessen Anstiften, ist niemals aufgehellt worden.
Jener Tiberius Sempronius Gracchus, der sich des älteren Scipio gegen seine Ankläger angenommen hatte (S. 91), vermählte sich in der Folge mit dessen Tochter Cornelia. Einst, erzählt man, ergriff er auf seinem Lager ein Paar Schlangen. Die Wahrsager, über dies schreckhafte Zeichen befragt, erklärten, daß, wenn das männliche Tier getötet würde, dies dem Tiberius, der Tod des weiblichen aber der Cornelia den Tod bringen werde. Da ließ Tiberius, in edler Gattenliebe, das männliche töten, das andere aber verschonen, und nicht lange hernach starb er. Cornelia aber gab ihren beiden Söhnen Tiberius und Gajus, und ihrer Tochter Sempronia, die sich später mit dem jüngeren Scipio Africanus vermählte, die sorgfältigste Erziehung. Einst erhielt sie den Besuch einer vornehmen Campanerin, welche ihren reichen Schmuck von Gold und kostbaren Steinen vor ihr ausbreitete. Als sie dann Cornelia bat, sie möchte ihr nun auch den ihrigen zeigen,[S. 101] da ließ die stolze Römerin ihre beiden Söhne kommen und sagte, auf sie hinweisend: „Diese sind mein Schmuck, meine Kleinodien.“
Zum Jüngling herangewachsen, machte der ältere, Tiberius Sempronius Gracchus, mit seinem Schwager Scipio als dessen Zeltgenosse den Kriegszug gegen Karthago mit. Er zeichnete sich hier durch Pflichttreue und Tapferkeit aus und erstieg zuerst von den Römern die Mauer der Stadt. Später ging er als Quästor (Schatzmeister) mit dem Konsul Mancīnus nach Spanien in den Krieg gegen die Numantiner. Als dieser ungeschickte Feldherr einst, nach vielen großen Verlusten, aufbrechen und das Lager verlassen wollte, wurde er mit seinem ganzen Heere von den Numantinern eingeschlossen und in Gegenden gedrängt, die keine Flucht zuließen. Mancinus, an aller Rettung verzweifelnd, schickte Gesandte an die Numantiner um Waffenstillstand und Friedensunterhandlungen. Die Numantiner erklärten, daß sie allein zu Tiberius Vertrauen hätten und nur mit ihm unterhandeln wollten. So ward denn Tiberius gesandt, und er schloß mit den Feinden einen Friedensvertrag, der dem römischen Staate 20000 Bürger rettete. Als er aber nach Rom zurückkehrte, ward der ganze Vertrag vom Senate verworfen, und der Beschluß gefaßt, daß alle Befehlshaber, die sich an dem Abschluß des schmachvollen Vertrages beteiligt hätten, dem Feinde ausgeliefert werden sollten. Doch des Tiberius menschenfreundliche Denkungsart, sein leutseliges Wesen und seine Rechtlichkeit hatten ihm bereits die Volksgunst in solchem Grade gewonnen, daß seine Auslieferung abgelehnt wurde. So wurde nur der Konsul Mancinus ausgeliefert, aber die Numantiner waren edelmütig genug dieses Sühnopfer des Vertragsbruchs nicht anzunehmen und den unglücklichen Mann unverletzt zu entlassen.
Doch nicht seine Taten im Felde, sondern seine Wirksamkeit im Staate war es, die den Tiberius berühmt gemacht hat. Schon früh hatte Cornelia den Ehrgeiz ihrer Söhne geweckt und genährt. „Warum rühmt man mich“, sagte sie zu ihnen, „immer nur als die Schwiegermutter des Scipio und nicht auch als die Mutter der Gracchen? Den Kriegsruhm eures Schwagers werdet ihr einst übertreffen oder erreichen; aber eine andere nicht minder ehrenvolle Laufbahn steht euch offen, durch weise Gesetze für das gemeine Wohl des Volkes zu sorgen.“
Diesen von der Mutter angedeuteten Weg schlug jetzt Tiberius ein. Erbittert durch den ihm in der numantinischen Sache angetanen Schimpf, wandte er sich von seinen adligen Standesgenossen ab, um fortan die Sache des Volkes zu vertreten und die Vorherrschaft des Adels im Staate und in der Ausnutzung des Staatsgutes zu bekämpfen. Zu diesem Zwecke bewarb er sich um das Volkstribunat für das Jahr 133, und ward unter großem Beifall des Volkes gewählt, das seit langer Zeit von gärender Unzufriedenheit erfüllt war.
Der Grund bestand darin, daß bei weitem der größte Teil alles Landes in Italien in den Besitz der reichen herrschenden Familien, der Optimaten, gekommen war, während die große Masse der eigentlichen Bauern mehr und mehr verarmt war und ihre kleinen Höfe verkaufen oder ihren harten Gläubigern überlassen mußten. Und doch waren sie es, die in den unaufhörlichen Kriegen Roms den Kern des Heeres bildeten und ihr Blut für die Eroberungen des Staates vergossen. Um nun dieser für den Bestand des Staates so wichtigen Klasse von Bürgern einen neuen Grundbesitz zu verschaffen, erneuerte Tiberius als Volkstribun jenes alte licinische Gesetz (S. 47), daß kein Bürger mehr als 500 Morgen des ursprünglich dem Staate gehörigen Landes (ager publicus) besitzen sollte. Dies Land war nämlich den unterworfenen Städten und Gemeinden Italiens abgenommen und als Eigentum des römischen Staates gegen geringen Pachtzins an vornehme römische Bürger vergeben worden und bildete einen großen Teil alles anbaufähigen Landes der Halbinsel. Der Staat hatte demnach das Recht diesen Besitz zurückzunehmen oder einzuschränken, zumal er nur den großen Familien zugute kam. Jedoch erlaubte das neue Gesetz, daß ein Familienvater für jeden Sohn, der noch unter seiner Aufsicht lebte, 250 Morgen mehr besitzen dürfe. Alles übrige Land sollte eingezogen und, zu kleinen Gütern vermessen, unter die besitzlosen Bürger verteilt werden. Um dieses Gesetz durchzuführen, verband sich Tiberius mit einer Anzahl der angesehensten und wohlmeinendsten Männer, welche seine politischen Ansichten teilten; unter ihnen war sein Schwiegervater Appius Claudius, der Oberpriester Crassus und der große Rechtsgelehrte Mucius Scävola.
Es war natürlich, daß Tiberius durch seinen Vorschlag die Gunst des Volkes in vollstem Maße gewann, dagegen aber[S. 103] auch den Haß und den Widerstand der herrschenden Partei aufs heftigste reizte. Mit hinreißender Beredsamkeit schilderte er die traurige Lage des armen Volkes: „Die Tiere des Feldes und Waldes haben ihre Gruben und Nester, und jedes findet eine Stätte zum Ruhen. Aber die Männer, die für Italien bluten und sterben, haben nur Anteil an Luft und Licht; ohne Häuser, ohne feste Wohnsitze irren sie umher mit Weib und Kind. Was will es noch bedeuten, daß der Heerführer seine Krieger, wenn es in die Schlacht geht, ermahnt, für Haus und Herd und die Gräber ihrer Väter zu fechten? Keiner von all den Tausenden besitzt mehr die Stelle, da einst die Hausgötter seiner Vorfahren standen, oder wo ihre Väter begraben liegen. Für anderer Wohlleben und Reichtum kämpfen und fallen sie, und werden Herren der Welt genannt, die doch selbst keine Scholle mehr zu eigen besitzen.“
Gegen den Vorschlag des Tiberius erhob sich, wie zu erwarten gewesen, der heftigste Widerstand, und die Erbitterung der Gemüter stieg auf beiden Seiten, bis endlich der Tag herannahte, an welchem in der Volksversammlung über das Gesetz abgestimmt werden sollte. Als Tiberius an diesem Tage seinen Vorschlag noch einmal dem Volke vortrug, trat plötzlich ein anderer Tribun, Octavius, auf und hinderte durch seine Einsprache die Verlesung des Vorschlags und die Abstimmung darüber. Diesen Tribunen hatten die Optimaten für sich gewonnen, da sie sonst kein Mittel hatten, das Gesetz, das ihrer schrankenlosen Habsucht Grenzen setzte, zu hintertreiben. Denn nach dem geltenden Rechte konnte kein Vorschlag Gesetzkraft erhalten, wenn auch nur einer der zehn Tribunen dagegen Einspruch tat.
Vergebens suchte Tiberius den Gegner umzustimmen. In der Meinung, jener befürchte selbst bei der Verteilung des Landes Verlust an seinem Eigentum, bot er ihm Ersatz aus seinem eigenen Vermögen an. Als auch dies nichts fruchtete, verließ ihn seine bisherige Geduld. Die milden Bestimmungen seines Vorschlages zugunsten der Söhne nahm er weg; von jetzt an sollte jeder Reiche nur 500 Morgen und ohne alle Entschädigung für das, was er verlor, behalten. Die Reichen legten Trauerkleider an und suchten Mitleid bei der Bürgerschaft zu erregen; aber heimlich sollen sie Meuchelmörder gedungen haben, um den tödlich gehaßten Mann aus dem Wege zu räumen. Dieser trug fortan einen Dolch, sprach vor dem[S. 104] Volke von seiner Gefahr, und ging nicht mehr ohne Geleit seiner Anhänger aus dem Hause. Oft war eine Schar von 3–4000 Menschen um ihn.
In der nächsten Volksversammlung befahl Tiberius von neuem die Verlesung seines Vorschlags, und Octavius wiederholte seine Einsprache. Die Volksmenge geriet in Aufruhr. Als Tiberius dennoch zur Abstimmung schreiten wollte, bemerkte man, daß die Urnen, worein die Stimmtäfelchen geworfen wurden, weggenommen waren. Wie nun die Volksmenge immer heftiger tobte und Octavius nicht nachgeben wollte, rief Tiberius: „Ich weiß kein anderes Mittel als dies, daß einer von uns sein Amt niederlege. Laß du das Volk über mich zuerst abstimmen; wenn es mich meiner Würde entsetzt, so gehe ich als Privatmann nach Hause.“ Da Octavius auch dies versagte, so beschied Tiberius das Volk auf den anderen Tag wieder, um über die Absetzung zu entscheiden.
Am anderen Tage wiederholte Octavius abermals seinen Widerspruch. Da ließ Tiberius über seine Absetzung stimmen. Als nahezu der größere Teil des Volkes sich gegen Octavius ausgesprochen hatte und seine Absetzung schon fast gewiß war, trat Tiberius vor aller Augen auf Octavius zu, umarmte ihn und bat ihn flehentlich, er möge nachgeben. Octavius, zu Tränen gerührt, war einige Augenblicke unschlüssig. Als er aber seine Augen auf die nahe Schar der Optimaten warf, da befiel ihn Scham, und er hieß den Gracchus tun was er wolle. So ward Octavius seines Amtes entsetzt, und kaum entging er den Händen des erbitterten Volkes. Das Gesetz des Tiberius ward nun genehmigt, und drei Männer zu seiner Ausführung gewählt: er selbst, sein Bruder Gajus und sein Schwiegervater Appius Claudius. Aber Tiberius hatte durch die Amtsentsetzung des Octavius, dessen Person als Tribun heilig und unverletzlich war, eine gesetzwidrige Handlung begangen, durch welche die Verfassung verletzt ward, und damit zuerst den Weg betreten, der endlich zum Untergang der Republik führen mußte.
Es war bereits um die Mitte des Sommers, und es nahte die Zeit, wo die neuen Volkstribunen gewählt wurden. Die Reichen gedachten sich an Tiberius zu rächen, sobald er seine Würde niedergelegt hätte, und machten vorher alle seine Schritte gehässig. Und in der Tat, die gesetzwidrige Absetzung des Octavius war beispiellos und befremdete sogar manchen[S. 105] aus dem Volke. Um sich nun in der Gunst des Volkes zu erhalten, machte er den Vorschlag, daß die Schätze des letzten Königs von Pérgamon, des Attălus, der das römische Volk zum Erben seines Reiches eingesetzt hatte, unter das Volk verteilt werden, und daß dieses über jenes Reich verfügen sollte. Durch diesen Vorschlag verletzte er den Senat, der bisher allein über solche Angelegenheiten zu beschließen gewohnt war auf das tiefste, und seine Feinde verbreiteten mit Arglist das Gerücht, daß er selber nach der königlichen Würde strebe und ein Mann aus Pergamon ihm bereits Diadem und Purpurmantel überbracht habe.
Unter solchen Umständen bewarb sich Tiberius um das Tribunat für das folgende Jahr. Die Wahl fiel in die Erntezeit, wo nur der besitzlose städtische Pöbel in Rom anwesend, die Landbewohner aber auf dem Felde beschäftigt waren. An dem Wahltage aber kam es zu Streit und Einspruch und Tiberius, der die Wahl leitete, verlegte die Versammlung auf den folgenden Tag, den übrigen Teil des Tages ging er in Trauerkleidern, seinen Knaben an der Hand, auf dem Forum umher und bat die Bürger für die Sicherheit seines Lebens zu sorgen. Eine große Schar armen Volkes begleitete ihn und bewachte während der Nacht sein Haus. Am folgenden Morgen besetzten große Haufen Volks das Kapitolium; in der Nähe versammelte sich der Senat in einem Tempel. Schlimme Vorzeichen, erzählte man, schreckten den Tiberius, als er sein Haus verließ. Aber die Freunde machten ihm Mut, und als er die Stufen des Kapitols hinanstieg, begrüßte ihn das Volk mit lautem Freudengeschrei. Allein die Versammlung blieb auch diesmal ohne Ergebnis. Inzwischen brachte ihm ein Freund die Nachricht, daß die Gegner beschlossen hatten ihre Sklaven und Klienten zu bewaffnen. Als dies ruchbar wurde, erhob sich unter seinen Anhängern ein wilder Lärm. Tiberius wollte reden; da er aber bei diesem Getümmel sich nicht hörbar machen konnte, zeigte er mit der Hand nach seinem Kopfe, um dem Volke seine Lebensgefahr anzudeuten. Von dieser Bewegung des Tiberius erhielten die Senatoren sogleich Nachricht und legten sie boshafter Weise so aus, als habe Tiberius die Krone gefordert. Da sprang Scipio Nasīca, ein harter und leidenschaftlicher Aristokrat, auf und verlangte von dem Konsul, er solle Gewalt gegen den Hochverräter gebrauchen. Der Konsul Mucius Scävola aber, ein Mann von strengem[S. 106] Rechtsgefühl und der Reform geneigt, weigerte sich die geheiligte Person des Tribunen zu verletzen. Darauf rief Scipio: „Weil denn der Konsul die gemeine Sache verläßt, so folge mir jeder, der sie retten will!“ So stürmte er, von seinen Anhängern begleitet, aus dem Tempel und viele schlossen sich ihm auf dem Wege an. Das Volk erstaunte bei der Ankunft der Senatoren und machte ehrerbietig Platz. Diese aber ergriffen was sie von Beinen und Stücken zerbrochener Bänke und Gerätschaften vorfanden, und schlugen auf das Volk los, das nach allen Seiten hin die schleunigste Flucht ergriff. Auch Tiberius floh, stürzte aber über einige vor ihm liegende Leichen. Da erschlug ihn einer der Wütenden — der Tribun Publius Saturnejus und Lucius Rufus stritten sich später um diese Heldentat — durch einen Knüttelschlag auf die Schläfe, vor den Bildsäulen der sieben Könige beim Tempel der Fides (Treue). Seine Leiche und die der übrigen Erschlagenen, deren über dreihundert waren, wurden am Abend durch die Gassen geschleift und in die Tiber geworfen. Vergebens bat sein Bruder Gajus sie bestatten zu dürfen.
Das Ackergesetz des Tiberius und der Ausschuß von drei Männern (triumviri), die mit der Ausführung betraut waren, blieben auch nach dem Tode ihres Urhebers bestehen, obgleich die Optimaten alles aufboten, um die Verteilung des Gemeinlandes zu hintertreiben. Zu diesen gehörte selbst der Schwager des Ermordeten, Scipio Africanus, der, als er vor Numantia die Nachricht von dem Tode des Gracchus erhielt, des homerischen Verses gedachte:
Wie dieser dann einige Jahre nachher selber als ein Opfer des Parteihasses fiel, ist bereits oben erzählt worden. Die an Tiberius und seinen Anhängern verübte Freveltat, die in der ganzen bisherigen Geschichte Roms nicht ihres gleichen hatte, ward zwar von den Gemäßigten auch unter den Optimaten verurteilt, aber der Senat suchte sie als die Strafe eines nach der Krone strebenden Verräters zu rechtfertigen, und ließ sogar gegen seine Anhänger im Volke mit blutigen Richtersprüchen vorgehen, während der Hauptschuldige, Scipio Nasica, um ihn der Rache der Menge zu entziehen, mit einem Auftrage nach Asien gesendet wurde. Seine Bluttat aber wirkte wie eine böse Saat in den folgenden Parteikämpfen.
Gajus Sempronius Gracchus, neun Jahre jünger als sein Bruder Tiberius — er war im Jahre 153 geboren — lebte nach dessen Untergang in stiller Zurückgezogenheit. Er glich dem älteren Bruder an strenger Sitte und hochstrebender vornehmer Gesinnung, übertraf ihn aber an Geist und Beredsamkeit, und war viel feuriger und leidenschaftlicher, dabei trotz seiner Jugend bereits im Felde bewährt und in allen Staatsgeschäften sicher und gewandt, unermüdlich, unbeugsam in seinem ererbten Kampfe gegen die volksfeindliche Optimatenpartei. Einst, da er einen Freund vor Gericht verteidigte, erregte er durch seine hinreißende stürmische Rede eine solche Bewunderung, daß der Adel in Sorge geriet, es möchte in ihm ein Rächer seines Bruders erstehen, und deshalb einen Vorwand suchte, um ihn von Rom zu entfernen. Er wurde als Quästor nach Sardinien geschickt und dort über die gesetzliche Frist festgehalten. Aber Gajus merkte die Absicht des Senats. Plötzlich verließ er seine Stelle, eilte nach Rom zurück und bewarb sich um das Tribunat (124). Man sagte, er sei dazu durch einen Traum aufgefordert worden. Sein ermordeter Bruder sei ihm nämlich im Traum erschienen und hätte gesagt: „Umsonst sträubst du dich, Gajus, dir bleibt doch ein Tod wie der meinige beschieden.“
Als seine Mutter Cornelia von seiner Bewerbung um das Tribunat hörte, suchte sie ihn davon abzubringen. Zwar hatte sie selbst vordem ihre Söhne angetrieben nach Ehren und Ruhm zu streben, aber das traurige Ende ihres älteren Sohnes hatte ihren stolzen Sinn gebeugt. Sie kannte die Feuerseele des hochbegabten und früh zum Manne gereiften Sohnes, seinen unauslöschlichen Haß gegen die herrschende Aristokratie, die ihm den geliebten Bruder gemordet und seinen unbändigen Drang die Schäden der öffentlichen Zustände zu heilen. In ihren Briefen bat sie ihn mit den rührendsten Ausdrücken von einem Unternehmen abzulassen, das für ihn höchst gefährlich werden könnte. Aber Gajus beharrte auf seinem Vorhaben und erreichte seine Wahl für das folgende Jahr.
Zwei Jahre hintereinander, 123 und 122, bekleidete er das Tribunat. Er erneuerte nicht nur das Ackergesetz seines Bruders, sondern schwächte, um sich die Gunst der großen Volksmenge zu verschaffen, durch eine ganze Reihe von Vorschlägen und Gesetzen die Macht des Senates. Sein Getreide[S. 108]gesetz, wonach regelmäßig Getreide unter die ärmeren Bürger zu sehr billigen Preisen abgegeben werden sollte, legte der Staatskasse bedeutende Kosten auf, und konnte nur dazu dienen die ohnehin schon bestehende Trägheit und Genußsucht des großstädtischen Pöbels zu nähren. Besonders einschneidend war das Gesetz, durch welches er den Senatoren die Gerichtsbarkeit entzog, indem es bestimmte, daß die Gerichte fortan nicht mehr mit Männern aus dem Senatoren-, sondern aus dem Ritterstande besetzt werden sollten, der zwischen dem Senats- und dem Bürgerstande die Mitte bildete. Die Absicht war dem Unfug zu steuern, daß die dem ersten Stande angehörigen Angeklagten von ihren Standesgenossen, aller Schuld ungeachtet, häufig freigesprochen wurden. Nun gehörten aber dem Ritterstande die zahlreichen Steuerpächter (publicani) an, welche in großen Gesellschaften vereinigt, in den Provinzen die Steuern erhoben, wobei sie durch Erpressungen aller Art die Provinzialen auszubeuten gewohnt waren. Wenn sich nun die ausgesogenen Provinzen gezwungen sahen die Steuerpächter in Rom vor Gericht zu ziehen, so fanden sie bei den neuen Richtern, die eben aus Rittern, den Standesgenossen der Angeklagten, bestanden, noch weniger Schutz als früher, als die Richterstellen mit Senatoren besetzt wurden. Außerdem gewann Gajus das Volk durch den Bau von Landstraßen, durch Herabsetzung der Kriegsdienstzeit, durch Ausrüstung der Soldaten auf Staatskosten, und stellte den Antrag eine römische Kolonie auf der Stätte des zerstörten Karthago zu gründen.
Aber seine Gegner fanden ein Mittel, um dem unermüdlichen Tribunen die Volksgunst zu entziehen. Sie gewannen einen seiner Kollegen, Livius Drusus, der durch Vorschläge, welche den Wünschen des Volkes entsprachen, namentlich durch Beantragung von Kolonien in Italien selbst statt der überseeischen in Afrika, jenen noch bei weitem überbieten, und für diese Vorschläge schon im voraus die Genehmigung des Senats versprechen sollte. Durch dieses Verfahren suchte der Senat im Volke die Meinung zu erwecken, daß er nur aus Abneigung und Mißtrauen gegen den persönlichen Ehrgeiz des Gracchus den Wünschen des Volkes widerstrebe, und daß er diese befriedigen werde, sobald jener vom Tribunate entfernt sei. So verlor Gracchus allmählich die schwankende Gunst des Volkes; er erlangte das Tribunat nicht zum dritten[S. 109] Mal, während sein erbittertster Gegner Opimius Konsul ward.
Eines Tages, als seine Unverletzlichkeit bereits aufgehört hatte, erschien er mit einem Haufen der Seinigen auf dem Kapitol, als eben Opimius die gewöhnlichen Opfer verrichtete. Gerade trug der Liktor Antyllius die Eingeweide des Opfertieres heraus, ein stolzer und trotziger Mensch. Als dieser zu den Anhängern des Gracchus kam, rief er ihnen zu: „Hinweg, ihr schlechten Bürger, macht braven Leuten Platz!“ Diese Worte brachten einen Begleiter des Gracchus in so heftigen Zorn, daß er den Beleidiger auf der Stelle niederstieß. Das war ein schweres Vergehen gegen die Heiligkeit des Ortes und der Opferhandlung, das man in dem entstehenden Auflauf dem Gracchus selber zu Lasten legte und vom Konsul benutzt wurde, um gegen ihn und seinen Anhang mit Gewalt einzuschreiten. Als Gracchus heimkehrte, führte ihn sein Weg über das Forum an der Bildsäule seines Vaters vorbei. Er blieb stehen, betrachtete sie eine Zeitlang in düsterem Schweigen, dann brach ein Strom von Tränen aus seinen Augen. Seine Freunde, tief gerührt, schwuren ihn niemals zu verlassen, und wachten die ganze Nacht vor seiner Wohnung.
Inzwischen hatte der Senat, der früher den Mord des Tiberius ungeahndet gelassen hatte, nicht nur die strengste Ahndung des an dem Liktor begangenen Frevels beschlossen, sondern wie bei einem hochverräterischen Aufstande den Konsuln den Auftrag erteilt, „vorzusorgen, daß das Gemeinwesen keinen Schaden nähme“ (videant consules ne quid respublica detrimenti capiat): was die Befugnis bedeutete, nach eigenem Ermessen und ohne auf Gesetz und Herkommen zu achten, gegen die Feinde des Staates zu verfahren.
Darauf bewaffnete der Konsul Opimius die Senatoren und Ritter und ließ sie das Kapitol besetzen, während die Anhänger des Gracchus, unter Führung seines Freundes Fulvius Flaccus, sich auf dem Aventin versammelten. Als er selbst am nächsten Morgen, nur mit einem kleinen Dolch versehen, eben im Begriff war, mit einigen Freunden das Haus zu verlassen, trat ihm seine Gattin Licinia entgegen. Mit der einen Hand führte sie ihren kleinen Sohn, mit der andern ergriff sie die Toga ihres Gatten und rief: „Wohin eilst du, mein Gajus? Willst du dich unbewaffnet deinen Feinden preisgeben? Erinnerst du dich nicht an das Schicksal[S. 110] deines Bruders? Ach, ich Unglückliche, wer weiß, ob ich nicht bald das Meer oder die Tiber bitten muß, mir deinen Leichnam wiederzugeben, um ihn bestatten zu können.“ Gajus, tief erschüttert, zögerte, aber er sollte seinem Verhängnis nicht entgehen. Seine Freunde winkten, und er riß sich aus den Umarmungen seiner Gattin und entfernte sich, ohne ihr zu antworten. Licinia folgte ihrem Mann und suchte ihn zu halten; aber vergebens. Ohnmächtig sank sie auf der Straße nieder; ein Diener trug sie ins Haus zurück.
Gajus kam indessen zum Fulvius auf den aventinischen Berg. Von hier aus suchten beide mit dem Konsul zu unterhandeln. Fulvius schickte einen seiner Söhne mit dem Friedensstab in der Hand an ihn ab; der schöne Knabe trat mit bescheidenem Anstand vor den Konsul und meldete tränenden Auges seines Vaters Anerbieten. Opimius aber gab ihm harten Bescheid: nicht durch Boten sollten sie den Senat angehen, sondern sich selber als schuldbeladene Bürger zum Gericht stellen und den Zorn der Senatoren zu besänftigen suchen. Dem Boten aber befahl er auf diese Bedingung oder gar nicht wieder zu kommen. Gleichwohl schickte Fulvius seinen Sohn zum zweiten Mal; Opimius aber, der den Kampf zu beginnen eilte, ließ diesen ergreifen und ins Gefängnis werfen. Darauf zog er gegen den Aventin mit Schwerbewaffneten und mit Bogenschützen, durch deren Pfeile viele verwundet wurden und die Menge in Verwirrung geriet. Bei der allgemeinen Flucht verbarg sich anfangs Fulvius, ward aber entdeckt und niedergehauen. Gajus floh über die Tiber in einen der Furina geheiligten Hain. Als er keinen Ausweg mehr sah, ließ er sich von einem treuen Sklaven töten. Sein Leichnam fiel in die Hand eines vornehmen Mannes, des Septumulejus; dieser schnitt ihm den Kopf ab, füllte ihn mit Blei und brachte ihn zum Konsul; denn Opimius hatte versprochen, demjenigen, der den Kopf des Gracchus brächte, so viel Gold zu geben, als der Kopf wiegen würde (121).
Nach dem Tode des Gracchus wurden fast alle seine Gesetze aufgehoben und die Herrschaft der Senatspartei mit blutiger Strenge wieder hergestellt. Aber auf die von den Gracchen versuchte Revolution folgten bald neue Unruhen und zerrüttende Bürgerkriege, die Rom an den Rand des Untergangs brachten, und mit dem Verlust der republikanischen Freiheit enden sollten.
Marius war der Sohn eines Landmanns aus Arpinum im Lande der Volsker. Aus niederem Stande entsprossen, wuchs er ohne allen Unterricht auf und war von rohen, derben Sitten. Frühzeitig entwickelte er eine ungewöhnliche Begabung für das Kriegswesen, sodaß er in der Folge einer der tüchtigsten Feldherren wurde. War er auch ohne gelehrte Bildung, so besaß er doch viel Verstand, rasche Fassung, große Rednergabe und eine glühende Begierde nach Ruhm. Seine ersten Kriegsdienste tat er vor Numantia unter dem Oberbefehl des Scipio, und schon damals erregte er durch seine militärische Begabung dessen Aufmerksamkeit. Als einst einige Freunde des Scipio fragten: „Wer wird dich uns ersetzen, wenn das Schicksal dich uns entreißen sollte?“ antwortete er, indem er Marius auf die Schulter klopfte: „Dieser hier!“ Nach Rom zurückgekehrt, erhielt Marius das Amt eines Volkstribunen und verteidigte als solcher die Rechte seiner Standesgenossen gegen die Partei der Optimaten, die er tödlich haßte, und die schon damals in ihm einen furchtbaren Gegner erkannten. Die erste Gelegenheit, selbständig als Feldherr aufzutreten und sich um sein Vaterland hochverdient zu machen, gab ihm der Krieg, den die Römer gegen Jugurtha, König von Numidien, führten. Zugleich zeigte dieser Krieg die Entartung der damaligen Römer, besonders die Habsucht und Bestechlichkeit der Optimaten.
Des Königs Massinissa Sohn Micipsa hatte vor seinem Tode das numidische Reich, das sich westlich von der römischen Provinz Afrika, die Küste entlang und südwärts bis zur Wüste erstreckte, unter seine beiden Söhne Adherbal und Hiémpsal und seinen Bruderssohn Jugurtha geteilt. Aber der herrschsüchtige Jugurtha, der nach dem Besitz des Ganzen trachtete, tötete bald darauf den Hiempsal und nötigte den Adherbal zur Flucht nach Rom. Hier aber hatte Jugurtha durch sein Gold schon viele Senatoren bestochen, sodaß an seine Bestrafung nicht gedacht, vielmehr das Reich in zwei Hälften geteilt ward, von denen Jugurtha die bessere erhielt. Auch damit noch nicht zufrieden, bekriegte er ohne alle Veranlassung den Adherbal und ließ ihn, nach Übergabe seiner Hauptstadt, ermorden. Da erst, nachdem bei dem Blutbad[S. 112] auch eine Anzahl römischer Bürger umgekommen waren, entschloß sich der Senat, durch die wachsende Erbitterung des Volkes geängstigt, den frechen Missetäter zu bestrafen (111).
Aber der Konsul Calpurnius Piso Bestia, der mit einem Heere nach Afrika übersetzte, und sein Legat, der vornehmste aller Senatoren, Ämilius Scaurus, ließen sich durch Jugurthas Gold gewinnen und bewilligten ihm einen Frieden, der den Besiegten nur zur Auslieferung seiner Elefanten und zur Zahlung einer Geldbuße verpflichtete. Solchem Beispiel des Konsuls folgten die unteren Führer der Truppen: einige lieferten dem Jugurtha die abgenommenen Elefanten wieder aus, andere verkauften ihm die Überläufer, und noch andere plünderten die Bewohner der Provinz Afrika. Als die Nachricht von diesem Vertrage nach Rom kam, erkannte man ohne Mühe den schmählichen Betrug, und ein Sturm des Unwillens erhob sich. Mit flammender Rede erwirkte der Tribun Gajus Memmius bei dem Volke den Beschluß, daß die Sache untersucht, die Schuldigen bestraft und Jugurtha selber in Rom erscheinen sollte, um sich vor dem Volke zu rechtfertigen. Unter der Zusage persönlicher Sicherheit kam Jugurtha nach Rom, ohne königlichen Schmuck, im Trauergewand, wie ein demütiger Angeklagter. Aber im geheimen begann er sofort seine Bestechungen von neuem. Da er wußte, daß jedes Unternehmen eines Tribunen vereitelt werden konnte, wenn sich ein anderer Tribun widersetzte, so brachte er den Tribunen Bäbius durch große Geldsummen auf seine Seite. In der Volksversammlung hielt ihm Memmius alle seine Verbrechen vor. Als er ihn aber aufforderte, seine Mitschuldigen zu nennen, fuhr Bäbius dazwischen und verbot dem König auf diese Frage zu antworten. So wurde das Volksgericht vereitelt.
Durch diesen Erfolg ermuntert, und im Vertrauen auf die Macht seines Goldes, trieb Jugurtha seine Frechheit noch weiter. In Rom hielt sich damals ein Enkel des Massinissa, Massiva, auf, der nach dem Sturze Jugurthas selber König von Numidien zu werden hoffte. Diesen ließ er durch einen seiner Vertrauten meuchlings beseitigen, und als der Mörder bestraft werden sollte, verhalf er ihm zur Flucht. Nun war auch die Geduld des Senates zu Ende. Der geschlossene Friede ward für ungültig erklärt, dem König aufs neue der Krieg angekündigt und befohlen sofort Rom und Italien zu verlassen. Als er die Stadt verließ, soll er sich wiederholt nach ihr um[S. 113]gewendet und zuletzt gesagt haben, die ganze Stadt wäre käuflich und dem Untergang verfallen, wenn sich nur ein Käufer fände, reich genug den Preis zu zahlen.
Aber der Wiederbeginn des Krieges brachte den Römern eine bittere Enttäuschung. Der neue Konsul Postumius Albinus war unfähig oder bestochen, das Heer zuchtlos und entartet. Und als während einer Abwesenheit des Konsuls sein Bruder den Oberbefehl führte, ließ er sich von dem schlauen Gegner in einen Hinterhalt locken, und wurde gezwungen mit dem Heere unter dem Joche abzuziehen und sogar die Räumung Numidiens zu versprechen (109).
Diese Schmach ertrug das römische Volk nicht. Der frühere und der damalige Führer des Heeres und viele mitschuldige Senatoren wurden wegen Landesverrat vor Gericht gestellt und in die Verbannung geschickt. Gegen Jugurtha aber sandte man den Konsul Q. Cäcilius Metellus, und G. Marius begleitete ihn als Legat (Unterfeldherr). Der unbestechliche Metellus stellte die Zucht des Heeres wieder her, führte den Krieg zwei Jahre lang mit allem Nachdruck, trieb den Jugurtha in die Enge und eroberte eine Stadt nach der andern, aber den Ruhm, den Krieg zu beendigen, wußte ihm der ehrgeizige Marius zu entziehen. Marius wollte sich um das Konsulat bewerben, und da er zu diesem Zwecke in Rom anwesend sein mußte, suchte er beim Oberfeldherrn um Urlaub nach. Der adelsstolze Metellus, über diese Absicht des Emporkömmlings erstaunt und entrüstet, riet ihm, nicht über seinen Stand hinauszustreben. Als aber jener nicht abließ um Urlaub zu bitten, sagte Metellus mit bitterem Spotte: „Du wirst noch früh genug nach Rom kommen, wenn du dich zugleich mit meinem Sohne zum Konsulate meldest.“ Der junge Metellus war aber erst zwanzig Jahre alt, und da zum Konsulat ein Alter von dreiundvierzig Jahren erforderlich war, hätte Marius nach den höhnischen Worten des Konsuls noch dreiundzwanzig Jahre warten können. Marius, durch diesen Hohn schwer gekränkt, erzwang den Urlaub und zeigte sich von jetzt an bei jeder Gelegenheit als Gegner des stolzen Aristokraten. In Rom gab er zu verstehen, daß jener den Krieg absichtlich in die Länge ziehe; und zum Konsul gewählt, erhielt er auch den Oberbefehl gegen Jugurtha (108). Bis dahin war es noch keinem Manne von niederer Herkunft gelungen diese höchste Würde zu erlangen.
Als Marius im nächsten Jahre (107) als Konsul die Leitung des Krieges übernahm, änderte er die Kampfweise gegen Jugurtha, der sich inzwischen mit seinem Schwiegervater Bocchus, dem König von Mauretanien (Marokko), verbunden hatte. Statt die flüchtigen Reiterscharen des Feindes zu verfolgen, suchte er ihm alle festen Orte und Hilfsquellen zu entreißen. Er eroberte Burgen und Städte und machte große Beute. Dann griff er die im Südosten Numidiens gelegene Stadt Capsa an. Dorthin führte er sein Heer mit solcher Eile, daß seine Reiter schon die nächsten Tore der Stadt besetzten, ehe die Einwohner seine Ankunft erfuhren. Sie ergaben sich ohne Widerstand; dennoch ließ Marius alle Waffenfähigen umbringen und die Stadt anzünden. Im folgenden Jahre (106) erschien er auf der Westseite Numidiens vor der Stadt Mulucha, in der Jugurtha seine meisten Schätze verwahrte. Sie lag am gleichnamigen Flusse auf einem steilen Bergkegel, der nur einen einzigen Zugang bot, und wurde von einer zahlreichen, mit allem Nötigen versehenen Besatzung geschützt. Alle Versuche die Burg zu erstürmen mißlangen. Und schon dachte Marius sein Vorhaben aufzugeben, als eines Tages ein Soldat ihm anzeigte, wie er an der entgegengesetzten Seite des Berges beim Schneckensammeln einen Weg entdeckt habe und auf die Höhe des Felsens gekommen sei, wo die Burg unbesetzt wäre. Schon am nächsten Tage mußten vier Centurien mit fünf Trompetern unter Leitung jenes Soldaten den Fels erklettern. Sie fanden keine Gegenwehr, zumal da um dieselbe Zeit die ganze Besatzung auf der andern Seite beschäftigt war, den heftiger als je anstürmenden Feind zurückzudrängen. Plötzlich ertönten die Trompeten der Römer und das Angstgeschrei der Weiber und Kinder, die zuerst den eindringenden Feind erblickten. Bestürzt wich die Besatzung in die Stadt zurück; Marius verdoppelte seine Anstrengung und drang zugleich mit den Gegnern in die Festung ein.
Im Laufe des Jahres 106 geriet beinahe das ganze numidische Land in die Hände der Römer. Noch in zwei Treffen besiegte Marius den Jugurtha und den Bocchus. Letzterer zeigte sich endlich zum Frieden geneigt. Die Unterhandlungen mit ihm betrieb L. Cornelius Sulla, der im Heere des Marius Quästor war und bei Freund und Feind durch seine Tapferkeit und kluge Führung zu großem Ansehen gekommen war. Er bewog den König Bocchus seinen Schwiegersohn[S. 115] auszuliefern. Jugurtha wurde zu einer Unterhandlung eingeladen, und als er am bestimmten Orte und Tage erschien, von den Leuten des Königs ergriffen, gefesselt und dem Sulla überliefert. Aber Marius kränkte es tief, daß es nicht ihm, sondern dem Sulla gelungen war die Person des Jugurtha in seine Gewalt zu bekommen; vor allem aber erweckte es seinen unversöhnlichen Groll, daß sich Sulla einen Siegelring verfertigen ließ, auf dem die Auslieferung Jugurthas dargestellt war. Die Feindschaft, die von jetzt an zwischen beiden Männern bestand, sollte in der Folge dem römischen Staate großes Unheil bringen.
Am ersten Tage des Jahres 104 ward Jugurtha in Rom beim Triumph des Marius einhergeführt. Dabei riß ihm der rohe raubsüchtige Pöbel die Kleider und Ohrringe samt den Ohrläppchen ab. Dann ward er nackt in eine unterirdische Felskammer am Kapitol, ein ehemaliges Brunnengewölbe, das als Gefängnis diente, hinabgestoßen. „Hu, wie kalt ist euer Bad!“ rief der Unglückliche beim Hinabfallen. Dort ließ man ihn sechs Tage ohne Nahrung, worauf man ihn aus Gnaden erdrosselte (104). Sein Königreich ward geteilt: den westlichen Teil erhielt König Bocchus als Lohn seines Verrates, den östlichen ein Enkel des Massinissa und Halbbruder des Jugurtha.
Marius war inzwischen, während er noch als Prokonsul in Afrika an der Spitze des Heeres stand, und ohne daß er sich darum beworben hatte, gegen alles Herkommen abermals zum Konsul für 104 erwählt worden. Das römische Reich nämlich und Rom selbst war an anderer Stelle in Gefahr des Untergangs geraten, und Marius sollte es retten. Ein furchtbarer Feind stand plötzlich an der Grenze Italiens.
Schon vor Beginn des jugurthinischen Krieges vernahm man in Rom, daß unter den Völkern nördlich der Alpen eine große Bewegung entstanden sei; in großen Haufen zögen sie gegen die Alpen, um im Süden neue Wohnsitze zu erobern. In der Tat erschienen im Jahre 113 v. Chr. an den Ostalpen, im heutigen Krain, die Cimbern, ein germanischer Volksstamm, der wahrscheinlich bis da im Norden Germaniens gesessen hatte. Zu ihnen gesellten sich später die Teutonen, Ambronen und andere Stämme. Sie zogen mit Weibern und Kindern und aller fahrenden Habe, ein ungeheurer Schwarm von mehr[S. 116] als 300000 Kriegern. Bei Aquileja stellte sich ihnen der Konsul Papirius Carbo entgegen, erlitt aber eine völlige Niederlage. Doch wandte sich der feindliche Zug für diesmal von Italien ab nach Westen, wo er Gallien und Spanien raubend und verwüstend heimsuchte. Dort begegneten sie den Römern abermals im südöstlichen Gallien, in der römischen Provinz (Gallia transalpina, der heutigen Provence), und brachten ihnen in den Jahren 109–105 mehrere vernichtende Niederlagen bei.
Italien zitterte vor den gewaltigen Scharen des Nordens, wie in den Tagen Hannibals: der Schrecken war zu Rom so groß, daß sich niemand um das Konsulat des Jahres 104 zu melden wagte. Da hoffte das Volk von Marius, dem Bezwinger Jugurthas, Rettung. Es wählte ihn zum Konsul und übertrug ihm die Leitung des Krieges in Gallien. Nachdem er im Beginn des Jahres, wie oben erzählt, seinen Triumph über Jugurtha gefeiert hatte, begab er sich in die Provinz jenseits der Alpen, zum Kampf gegen die Germanen, fand sie aber dort nicht mehr: sie waren durch Südgallien über die Pyrenäen nach Spanien gezogen, und kehrten von dort erst nach zwei Jahren zurück. Diese durch die Torheit der Gegner gewährte Frist benutzte Marius, um ein neues Heer zu bilden und die erschlaffte Kriegszucht durch unerbittliche Strenge und harten Dienst herzustellen, und in Gallien alles vorzubereiten, was für den neuen Kampf erforderlich schien. So groß war die Furcht in Rom und die Zuversicht auf Marius, daß ihm, bis zur Beendigung des Krieges, das Konsulat noch vier Mal erneuert wurde; eine Auszeichnung, die noch nie einem Römer widerfahren war.
Im Jahre 102 kehrten die Feinde aus Spanien, wo sie hartnäckigen Widerstand gefunden hatten, nach Gallien zurück, um nunmehr mit aller Macht in Italien einzudringen. Sie teilten sich in zwei Haufen; die Cimbern gingen über den Rhein, um von Rhätien (Tirol) aus in Italien einzufallen; die Teutonen und Ambronen gedachten an der Küste entlang durch Ligurien einzudringen.
Marius hatte am Zusammenfluß der Rhone und Isère ein Lager errichtet und erwartete hier die Teutonen und Ambronen. Er vermied die offene Schlacht, obschon die Feinde drei Tage lang sein Lager bestürmten, und seine eigenen Leute ungeduldig den Kampf forderten. An der Festigkeit der[S. 117] Schanzen scheiterte alle Tapferkeit, aller Ungestüm der Germanen. Da beschlossen sie nicht länger zu zaudern, sondern geradeswegs am römischen Lager vorüber nach Italien zu ziehen. Höhnisch riefen sie den römischen Soldaten zu, sie zögen nach Italien; ob sie Aufträge an ihre Frauen und Kinder zu bestellen hätten? Kaum bändigte Marius den Zorn seiner Krieger. So groß war die Menge der Barbaren, so gewaltig ihr Troß an Wagen und Lasttieren, daß sie sechs Tage lang an dem Lager vorbeimarschierten. Kaum waren sie vorüber, so folgte ihnen Marius auf dem Fuße nach und gelangte auf kürzerem Wege zugleich mit ihnen an einen kleinen Fluß, an dem Aquä Sextiä (Aix en Provence) lag. Hier wählte Marius einen Hügel zum Lagerplatz, von welchem herab er die Gegend ringsum zu übersehen vermochte. Die Germanen lagerten sich an beiden Seiten des Flusses. Durch diese Lagerung wurden die Römer vom Wasser abgeschnitten. Diese, von Durst gequält, klagten und murrten. Marius aber wies auf den Fluß hin: „Ihr seid Männer“, sprach er, „dort ist Wasser für Blut feil, und ihr klagt, daß es fehle?“ Da gingen römische Troßknechte mit ihren Tieren zum Fluß hinab und vertrieben einige Feinde; als aber mehr Barbaren erschienen, eilten auch römische Soldaten hinzu. Die Teutonen aber und ihre Bundesgenossen fühlten sich in voller Sicherheit; sie aßen, badeten und freuten sich des schönen fruchtreichen Landes. Wie nun von beiden Seiten Hilfe erschien, wurden zuletzt die Hauptheere selbst in den Kampf hineingezogen. Der Ambronen waren 30000 Mann. In dem Augenblick, wo sie über den Fluß setzten, ließ sie Marius von allen Seiten angreifen und zwar mit solchem Erfolg, daß die meisten auf dem Platze erschlagen wurden. Die Flüchtlinge drangen gleich den Römern bis an die Zelte und Wagen der Teutonen, die am Kampf noch nicht teilgenommen hatten; hier wurden sie auch von den Weibern mit Beilen und Schwertern empfangen, und erst die Dunkelheit brachte die Kämpfenden auseinander.
Nun folgte eine grauenhafte Nacht. Die Totenklagen der Teutonen um die gefallenen Brüder, dazwischen die Wehrufe der Verwundeten, und ihr wilder Schlachtgesang wiederhallten in den Wäldern und klangen in das römische Lager hinüber, daß es den Römern durch Mark und Bein ging. Marius, der 3000 Mann unter Claudius Marcellus in einen Hinterhalt gelegt hatte, stellte mit Anbruch des Tages sein[S. 118] Heer vor dem Lager in Schlachtordnung und reizte die Teutonen durch abgesandte Reiterscharen zur Schlacht. In dicht geschlossenen Massen stürmten diese die beschwerlichen Höhen hinan und die Römer ihnen entgegen. Noch vor Mitte des Tages waren die Angreifer in die Ebene zurückgedrängt, und schon begannen ihre Reihen sich zu lösen, als auch Marcellus aus seinem Hinterhalt hervorbrach und ihre Verwirrung vermehrte. Ordnungslose Flucht kam über ihr ganzes Heer und nun erst begann ein entsetzliches Morden unter den fliehenden Scharen. Der Erschlagenen und Gefangenen waren an 100000. Der ganze Stamm war vernichtet bis auf einen geringen Rest, der sich nach dem nördlichen Gallien rettete. Von den gefangenen Frauen und Mädchen hatten viele nach verzweifelter Abwehr, um der Schmach der Knechtschaft zu entgehen, sich selber den Tod gegeben. Teutobod selber, der König, geriet in Gefangenschaft (102).
Inzwischen waren die noch unbesiegten Cimbern über den Brennerpaß vorgedrungen, hatten das Heer des Lutatius Catulus an der unteren Etsch geschlagen und südwärts über den Po zurückgedrängt. Ihr Plan war, sich mit den Teutonen, deren Schicksal ihnen noch unbekannt war, zu vereinigen und dann gegen Rom zu ziehen. Darüber versäumten sie die günstige Gelegenheit, sofort nach ihrem Siege über den Po vorzurücken und das wehrlose Italien zu erobern. Im Frühlinge des folgenden Jahres (101) verband sich Marius mit Catulus. So rückten sie, 50000 Mann stark, wieder über den Po und stießen bei Vercellä auf den Feind, nahe der Mündung der Sesia in den Po, wo einst Hannibal seine erste italische Schlacht geschlagen hatte. Die Cimbern aber schickten Abgeordnete an die römischen Feldherren und ließen um Land für sich und ihre Brüder, die Teutonen, bitten. Sie erhielten die Antwort: für ihre Brüder sei bereits gesorgt; sie hätten ein Land bekommen, wo sie ewig bleiben würden. Dabei ließ Marius, um ihnen die Vernichtung der Teutonen glaublich zu machen, den gefangenen Teutobod in Ketten vorführen. Jetzt rückten die Cimbern vor das Lager der Römer, und Bojorix, ihr König, forderte, nach dem Brauche seines Volkes, den Gegner auf Ort und Zeit zur Schlacht zu bestimmen. Marius bezeichnete den folgenden Tag und das raudische Feld, das der überlegenen römischen Reiterei einen günstigen Kampfplatz bot.
Die Cimbern erwarteten den Angriff in einer viereckigen Schlachtstellung, die sich dreiviertel Meilen in Breite und Tiefe erstreckte. In den äußeren Gliedern hatten sich die Kämpfer mit eisernen Ketten aneinander gebunden, um das Eindringen der Feinde zu verhindern. Bei den Römern stand das Heer des Catulus im Mitteltreffen, das des Marius bildete die Flügel. Im Morgennebel ward die cimbrische Reiterei von der römischen überrascht und auf ihr Fußvolk zurückgetrieben, das sich eben erst ordnete. Schon aber rückte das römische Fußvolk, Sonne und Wind im Rücken, aus der staubigen Ebene heran. Der Tag war schwül; die Cimbern hatten Sonne und Wind gegen sich und ertrugen nicht lange die ungewohnte Hitze. So errangen die Legionen mit geringen Verlusten einen völligen, mit der Vernichtung des cimbrischen Volkes endigenden Sieg. Nachdem ein Teil der Feinde dem römischen Schwerte erlegen war, floh der Rest der Wagenburg zu, wo auch die Frauen sich zur Wehr stellten. Hier begann ein neues Gemetzel, dem nur wenige Haufen durch die Flucht entgingen. Auch hier geschah es, daß viele der Frauen, um nicht in Gefangenschaft zu geraten, erst ihre Kinder, dann sich selbst töteten. Dennoch betrug die Zahl der Gefangenen 60000; die der Gefallenen 120000.
Die Römer aber erwiesen dem Marius als dem Retter Italiens die höchste Ehre. Sie nannten ihn den dritten Gründer der Stadt und erteilten ihm zum sechsten Male das Konsulat. Am Triumphe aber ließ Marius den Catulus teilnehmen. Vor dem Triumphwagen mußte der gefangene Teutobod einherschreiten, ein Mann von so riesigem Wuchse, daß er noch über die Siegeszeichen emporragte.
Lucius Cornelius Sulla stammte aus einem patricischen Geschlechte. Ein stattlicher Mann, von vornehmer stolzer Haltung, hochbegabt, mit griechischer Sprache, Kunst und Wissenschaft gründlich vertraut, dabei ein tapferer Soldat und geschickter Heerführer, im Verkehr gesprächig, witzig,[S. 120] liebenswürdig und einnehmend, war er in Tugenden und Fehlern das Muster der damaligen römischen Aristokratie. Ausschweifend im Genuß, sittenlos und verschwenderisch, bewies er doch in Amt und Dienst, in den Kämpfen des Krieges und der Politik eine unermüdliche Kraft des Geistes und Leibes, und wo es den Sieg seiner Partei, der Optimaten, galt, schreckte er vor keiner blutigen Gewalttat zurück. So war er fast in allen Stücken das Gegenteil des Marius; nur in maßloser Ruhmbegier und in der Kunst der Heerführung waren beide Männer einander gleich. Schon seit dem Ende des jugurthinischen Krieges, wo Sulla dem Marius die Ehre, sich der Person des Jugurtha zu bemächtigen, entrissen hatte, lebten beide in bitterer Feindschaft, die dadurch unversöhnlich wurde, daß Marius, nach seinen glorreichen Siegen, in Rom bald offen an die Spitze der allmählich wieder erstarkten Volkspartei trat. Aber zu offenem Kampfe steigerte sich dieser Gegensatz erst, als Rom in einen neuen großen Krieg verwickelt wurde.
Mithridátes, der König von Pontus, an der Südküste des schwarzen Meeres, war ein Mann von ungewöhnlichen Eigenschaften. Körperlich ungemein stark und abgehärtet gegen alle Beschwerden, kühn und rastlos in Gefahren und Wagnissen, enthaltsam im Sinnengenuß, wilden, unbeugsamen Sinnes, doch nicht ohne alle Großmut, dabei von großem Verstand und außerordentlichem Gedächtnis, herrschsüchtig, mißtrauisch und grausam, war er ein unversöhnlicher, erbitterter Feind der Römer. Nicht zufrieden mit seinem Reiche Pontus, erweiterte er seine Macht durch Eroberung anderer Staaten Kleinasiens, wobei ihm der Umstand zu großem Vorteil gereichte, daß er, der zweiundzwanzig asiatische Sprachen redete, mit jedem Volke in seiner eigenen Sprache unterhandeln konnte. Er hatte die Absicht sich zum Herrn von ganz Asien zu machen. Schon hatte er einen römischen Feldherrn, den Manius Aquillius, geschlagen, und als er ihn in seine Gewalt bekommen, gefesselt auf einem Esel durch die Städte Kleinasiens führen und ihm zuletzt geschmolzenes Gold in den Hals gießen lassen, um in ihm die römische Habgier zu verhöhnen und zu strafen. Mit Freuden öffneten ihm die griechischen Städte, als dem Erretter vom römischen Druck, ihre Tore. Daran erließ er an alle Städte Kleinasiens den greulichen Befehl, an einem bestimmten Tage alle römischen Bürger, ohne Unterschied des Standes, Alters und Geschlechts zu töten.[S. 121] Mit schrecklicher Pünktlichkeit erfüllten die Obrigkeiten aller Orte den Befehl, und 80000 Italiker erlagen an einem Tage der Wut des Volkes. Nachdem Mithridates den Römern in Asien ihre Provinz entrissen hatte, streckte er seine Hände auch nach Griechenland aus, und es war hohe Zeit für die Römer gegen diesen Eroberer entscheidende Maßregeln zu ergreifen.
Kurz vorher hatte sich Sulla in dem gefährlichen Kriege der Römer mit ihren aufständischen italischen Bundesgenossen (90–88), die sich die völlige politische Gleichstellung erkämpfen wollten und auch größtenteils erlangten, ausgezeichnet und wegen seiner überall siegreichen Erfolge den Ehrennamen des Glücklichen erhalten. Während seines Konsulats (88) wurde der Krieg gegen Mithridates beschlossen, und da ihm für das folgende Jahr, bei der üblichen Verlosung der Provinzen, die Verwaltung der Provinz Asia (des westlichen Kleinasiens) zufiel, so übertrug ihm der Senat auch den Oberbefehl gegen Mithridates. Dadurch fühlte sich der alternde Marius, dessen Ehrgeiz trotz seiner 68 Jahre noch nicht gesättigt war, zurückgesetzt und gekränkt. Wenn auch kränklich, besuchte er täglich das Marsfeld und machte dort unter den jungen Männern alle körperlichen Übungen mit, um den Verdacht der Hinfälligkeit zu entfernen. Er verband sich mit dem verwegenen Volkstribunen Sulpicius Rufus, der ein ihm ergebenes Gefolge von 600 Rittern hatte, die er ihrer dem Adel feindlichen Gesinnung wegen seinen Gegensenat nannte, und außerdem noch eine Schar von 3000 Bewaffneten in seinem Sold hatte.
Mit Hilfe dieses Sulpicius und seines Anhanges wußte Marius einen Volksbeschluß zu erzwingen, durch den der Oberbefehl gegen Mithridates dem Sulla genommen und ihm, dem Marius, übertragen wurde. Unter solchen Umständen verließ der Konsul Sulla nicht ohne persönliche Gefahren die Stadt und begab sich nach Nola in Campanien, wo die ihm angewiesenen Legionen standen. Diesen stellte er die ihm widerfahrene Unbill und Gewalt vor, worauf sie ihn mit stürmischem Eifer aufforderten sie ungesäumt nach Rom zu führen, um sich sein Recht zu holen. Als daher die von Marius abgeschickten Kriegstribunen kamen, um das Heer für ihn zu übernehmen, wurden sie von Sullas erbitterten Soldaten gesteinigt. Bald rückte dieser an der Spitze von sechs Legionen gegen Rom vor. Als seine Soldaten anfangs von der Partei[S. 122] des Marius zurückgeschlagen wurden, befahl Sulla den Bogenschützen Brandpfeile auf die Dächer zu schießen, und ergriff selbst eine brennende Fackel. Darauf drangen seine Legionen aufs neue vor, und umsonst riefen die Anhänger des Marius Bürger und Sklaven zu den Waffen. Sulla zog siegreich in Rom ein, vertrieb den Marius, Sulpicius und zwölf ihrer Genossen aus der Stadt und brachte es dahin, daß sie als Feinde des Vaterlandes in die Acht erklärt wurden. Hierauf schickte er Reiter aus, um die Flüchtigen aufzusuchen und zu töten. Sulpicius wurde gefunden und ermordet, aber Marius entging mit seinem Sohne und einigen Freunden den Verfolgern.
Er hatte sich an der Tibermündung nach Ostia begeben, wo er ein Boot fand, das ihn aufnahm, aber durch einen Sturm genötigt wurde, bei Circeji zu landen. Von den Anstrengungen der Fahrt erschöpft, von Hunger gequält und auf allen Seiten von Gefahren umgeben, irrte Marius mit seinen Begleitern in der Gegend umher. Gegen Abend stieß er auf einige Kuhhirten, die er um Lebensmittel ansprach; allein sie waren selbst arm und konnten ihm nichts geben. Indessen rieten sie ihm doch sich eilig zu entfernen, denn eben wären Reiter dagewesen, die nach ihm geforscht hätten. Marius verließ daher die Landstraße und floh mit den Seinigen tief in den Wald. Am folgenden Morgen ging er, von Hunger genötigt, wieder an die Küste, um Unterhalt und Mittel zur ferneren Flucht zu suchen. Er war sehr ermattet, dennoch aber bestrebte er sich seine Begleiter zu erheitern. Er bat sie nicht zu verzweifeln, und erzählte ihnen folgendes Geschichtchen. Einst wäre er als Knabe auf dem Felde gewesen, da wäre ihm ein Adlernest mit sieben Jungen in den Schoß gefallen. Seine Eltern hätten die Wahrsager darüber befragt und von diesen die Antwort erhalten, er werde einst unter den Sterblichen sehr berühmt werden und siebenmal die höchsten Würden bekleiden. Durch solche und ähnliche Unterhaltungen stärkte Marius den Mut seiner Gefährten und zeigte ihnen, daß er selbst mitten im Unglück die Hoffnung hegte, noch einmal Konsul zu werden; denn schon hatte er sechsmal diese Würde bekleidet.
Marius war mit seinen Gefährten nicht mehr weit von der Küstenstadt Minturnä entfernt, als er auf der einen Seite einen Haufen Reiter erblickte, die auf ihn zueilten, und zugleich auf der andern Seite zwei Fahrzeuge gewahr wurde, die nicht weit von der Küste hinsegelten. Ohne sich lange zu bedenken, warf er sich mit den Seinen ins Meer und kam, durch zwei seiner Diener unterstützt, in eines jener Schiffe; seine übrigen Gefährten gelangten zu dem andern. Inzwischen kamen die Reiter heran und schrieen den Schiffern zu, sie sollten landen und den Marius entweder ausliefern oder über Bord werfen. Lange Zeit schwankten die Schiffer, endlich ließen sie sich durch die Bitten des alten Mannes rühren und riefen zurück, sie würden den Flüchtling schützen. Aber kaum hatten die Reiter sich entfernt, so änderten die Schiffer ihre Gesinnung. Sie fuhren zur Mündung des Liris zurück. Hier rieten sie dem Marius ans Land zu gehen, einige Nahrung zu sich zu nehmen und ruhig zu schlafen, so lange sie hier am Ufer verweilten. Er folgte ihnen, schlief ein, und sogleich entfernten sich die Schiffer. Als Marius erwachte und sich allein, von allen verlassen sah, blieb er lange Zeit entmutigt am Ufer liegen. Traurige Betrachtungen mochten sein Herz erfüllen und seinen Mut beugen. Erst nach einiger Zeit faßte er sich wieder. Er schleppte sich durch unwegsame und sumpfige Gegenden fort und kam zur einsamen Hütte eines Greises, den er um Schutz und Beistand bat. Der Greis wurde durch den Anblick des Unglücklichen gerührt und verbarg ihn unter dem gehöhlten Ufer des Liris. Aber nicht lange darauf kamen die Reiter des Sulla und verlangten die Auslieferung des Marius. Das hörte dieser; er verließ das Ufer und eilte zu den Morästen bei Minturnä. Hier zog er seine Kleider aus, tauchte sich bis ans Kinn ins Wasser und verhüllte den Kopf mit Rohr. Dennoch ward er von einigen Reitern entdeckt. Diese warfen ihm einen Strick um den Hals, zogen ihn aus dem Wasser und führten ihn nach Minturnä ins Gefängnis.
Die Obrigkeit von Minturnä war entschlossen den Befehlen des Senats zu folgen und den Marius zu töten. Sie schickte deshalb einen cimbrischen Sklaven von riesigem Wuchs ab, um durch diesen das Todesurteil vollziehen zu lassen. Als der Sklave in das Gefängnis des Marius trat, sah ihn dieser mit grimmem Blick und feuersprühenden Augen an und rief ihm mit donnernder Stimme zu: „Sklave, du unter[S. 124]stehst dich den Gajus Marius zu töten?“ Voll Schrecken und Entsetzen warf der Riese sein Schwert weg, lief hinaus auf die Straße und rief: „Ich kann den Marius nicht töten!“ Da wurden auch die Minturnenser unsicher in ihrem Vorhaben; sie glaubten in der Furcht des Sklaven vor dem hilflosen Greise einen Wink der Götter zu erkennen, ließen den Marius frei, versahen ihn mit Geld und Kleidung und halfen ihm zur Flucht nach Afrika.
Unterwegs hörte Marius, daß sich sein Sohn und einige seiner Anhänger in Numidien befanden und segelte daher nach dem alten Hafen von Karthago. Aber kaum war er daselbst angekommen, als ihm der Statthalter Sextius durch einen Liktor befehlen ließ Afrika zu verlassen. Marius war eben in düstere Betrachtungen versunken. Der Platz, auf welchem sonst Karthago gestanden hatte, erinnerte ihn lebhaft an den Wechsel seines eigenen Glückes. So blieb er eine Zeitlang stumm, bis ihn der Liktor fragte, ob er ihm keine Antwort an den Prätor erteilen wollte. Da sprach er die bedeutsamen Worte: „Melde dem Sextius, du habest den alten Marius auf den Trümmern von Karthago sitzen sehen.“ Bald darauf fand er seinen Sohn und dessen Gefährten. Mit diesem begab er sich auf eine Insel unweit der Küste von Afrika, wo er den Winter hindurch lebte und auf Rache sann.
Mittlerweile hatte Sulla in Rom die Wahl des ihm treu ergebenen Octavius zum Konsul durchgesetzt, neben welchem das Volk den eifrigen Marianer Cornelius Cinna wählte. Diesen ließ Sulla schwören, daß er an der Ordnung und Verfassung des Staates nichts ändern würde, und zog im folgenden Jahre (87) mit seinem Heere gegen Mithridates, dessen Feldherr Archelaos sich inzwischen Makedoniens und des größten Teils von Griechenland bemächtigt und besonders in der Stadt Athen einen festen Stützpunkt für sein Heer und seine Flotte gefunden hatte.
Sulla landete in Epirus und drang durch Thessalien und Böotien gegen Athen vor, dessen Bewohner es mit Mithridates hielten. Da seine Versuche, die von Archelaos verteidigte Stadt zu erstürmen, mißlangen, so mußte er sich zu einer langen und mühseligen Belagerung entschließen. Um sich[S. 125] Geld zu verschaffen, nahm er die Tempelschätze zu Delphi, und um Holz für die Belagerungswerke zu bekommen, ließ er die Bäume im Haine der Akademie fällen, wo einst der große Philosoph Platon gelebt und gelehrt hatte. Unter diesen und anderen Zurüstungen, wie sie die Belagerung erforderte, verging der Winter. Mit Beginn des Frühlings (86) wurden Stadt und Hafen enger eingeschlossen und die Versuche sie zu erstürmen mehrmals, obgleich vergeblich, erneuert. In der Stadt aber erreichte die Hungersnot einen so hohen Grad, daß die Einwohner sich entschließen mußten, mit Sulla des Friedens wegen zu unterhandeln. Ihre Gesandten hielten vor Sulla eine abgeschmackte Rede, in der sie alle Herrlichkeiten des alten Athens aufzählten und in stolzem Tone Schonung ihrer Stadt verlangten. Sulla aber schickte sie mit den Worten zurück, solche Dinge sollten sie die Schüler in den Redeschulen vortragen lassen. Endlich wurde die Stadt durch einen Zufall verraten. Spione meldeten, daß einige alte Männer in einer Barbierstube sich unwillig darüber geäußert hätten, daß eine Stelle der Stadt nicht gehörig bewacht wäre. Diese Stelle wurde in der nächsten Nacht erstiegen und die Stadt eingenommen. Raubend und mordend drangen die sullanischen Soldaten ein und richteten ein furchtbares Blutbad an. Erst am andern Tage tat Sulla der zerstörenden Wut seiner Truppen Einhalt. Er gedachte der ruhmvollen Vergangenheit der Stadt, ihrer vielen großen Männer, welche als Staatsmänner, Dichter, Künstler und Schriftsteller die Welt mit dem Glanze ihrer Namen erfüllt hatten, und rief: „Ich will vielen um weniger willen, und den Lebenden der Toten wegen verzeihen.“
Nach der Eroberung Athens zog Sulla nach Böotien, wo der Sohn des pontischen Königs und der aus Athen entkommene Archelaus mit 120000 Mann standen, denen er kaum 40000 Mann entgegenzustellen hatte. In der Nähe von Chäroneia, wo einst die Freiheit Griechenlands den Makedonern unter König Philipp und seinem Sohne Alexandros erlegen war, trafen beide Heere zusammen. Sullas Soldaten, der anstrengenden Arbeiten müde, forderten laut eine Schlacht. Ihr Wunsch ward erfüllt, und so vollständig war ihr Sieg, daß Archelaus nur mit 10000 Mann entkommen sein soll. Noch blutiger und entscheidender war die Schlacht bei Orchomenos, wo Archelaus, durch ein neues von seinem König geschicktes[S. 126] und besonders an Reiterei überlegenes Heer verstärkt, eine feste Stellung genommen hatte (85). Schon neigte sich der Sieg auf die Seite des Gegners, als Sulla vom Pferde sprang, einem Fahnenträger den Adler aus der Hand riß und mit den Worten: „Hier will ich sterben, und wenn man euch fragt, wo ihr euren Feldherrn verlassen habt, so sagt: bei Orchomenos!“ sich auf die Feinde stürzte. Da warfen sich seine Truppen von neuem in den Kampf und schlugen den Feind mit einem Verlust von 15000 Mann zurück. Am folgenden Tage sollen noch 30000 Mann in den nahen Sümpfen umgekommen sein. Archelaus selbst hielt sich zwei Tage lang in einem Sumpfe versteckt und entkam am dritten Tage nach der Insel Euböa hinüber.
In demselben Jahre unterhandelte Archelaus persönlich mit Sulla über den Frieden. Zu Delion in Böotien kamen beide Feldherren zusammen. Als Archelaus die Bedingungen Sullas zu hart fand, rief dieser: „Mithridates sollte es mir auf den Knieen danken, daß ich ihm die rechte Hand lasse, mit der er so viele Römer getötet hat.“ So wurden die Unterhandlungen abgebrochen. Mithridates knüpfte sie aber von neuem wieder an, als Sulla in Asien erschien. Hier hatte er mit dem König selbst eine Unterredung zu Dardanos (in der Nähe des alten Troja) wo jener in alle Forderungen Sullas einwilligte. Bei dieser Zusammenkunft schwieg Mithridates anfänglich und schien Sulla die Eröffnung der Unterredung überlassen zu wollen, doch dieser sagte: „Sprich du zuerst, da du den Frieden nötig hast; der Sieger hat das Recht zu schweigen und zu hören.“ Mithridates begann nun seine früheren Taten zu rechtfertigen, aber Sulla versetzte: „Wohl hatten diejenigen recht, die mir deine Beredsamkeit rühmten; denn es gehört in der Tat ein großer Redner dazu, solche Schandtaten zu beschönigen.“ — Der König mußte alle seine Eroberungen herausgeben, 2000 Talente (gegen 10 Millionen Mark) bezahlen und 80 Schiffe ausliefern. Die kleinasiatischen Städte, die jetzt wieder unter römische Gewalt kamen, mußten ungeheure Kriegssteuern zahlen, zusammen 20000 Talente (fast 100 Millionen Mark) und außerdem die römischen Truppen lange Zeit auf ihre Kosten unterhalten. Nie hat die Provinz Asia sich von dem Druck dieser Lasten ganz erholt. Denn um die großen Summen aufzubringen, wurden sie die Schuldner römischer Kapitalisten, denen sie hohe Wucherzinsen zahlen[S. 127] mußten. Sulla selbst kehrte alsbald nach dem Friedensschluß nach Rom zurück, wo seine Gegenwart dringend notwendig war, wenn nicht seine Partei den Marianern völlig erliegen sollte.
Kaum hatte nämlich Sulla im Jahre 87 Italien verlassen, als der eine der neuen Konsuln, L. Cornelius Cinna, eine Volksversammlung berief, um die Zurückberufung des Marius und der übrigen Geächteten zu bewirken. Hierbei kam es zu blutigen Kämpfen. Der andere Konsul Octavius eilte mit seinen Scharen herbei und drängte Cinna bis an die Tore der Stadt zurück; 10000 Anhänger Cinnas sollen bei dem Gemetzel das Leben verloren haben. Hilflos floh dieser, seiner Konsulwürde verlustig erklärt, nach Campanien. In Nola gewann er die Kriegstribunen der dortigen Legionen und trat dann vor den versammelten Truppen auf. Von Liktoren umgeben, mit allen Zeichen seiner konsularischen Würde angetan, begann er seine Anrede, ließ dann aber plötzlich die Liktoren abtreten und erzählte weinend, wie ihn der Senat seiner Würde entsetzt habe; er zerriß seine Kleidung, sprang von der Rednerbühne und warf sich auf die Erde. Die Soldaten ließen sich durch dieses Schauspiel zu Mitleid hinreißen, sie führten ihn zur Rednertribüne zurück, gaben ihm alle Zeichen seiner Würde zurück und versprachen den dem Konsul gebührenden Gehorsam. Nach diesem Erfolge rief er alle Anhänger der senatsfeindlichen Partei zu seinen Fahnen, lud den geächteten Marius zur Rückkehr ein, und erschien mit einem gewaltigen Heere vor Rom.
Die Zeit der Rache war für Marius gekommen. Er landete in Etrurien und brachte dort 1000 Reiter und außerdem eine Bande von mehreren Tausend Sklaven zusammen, und an der Spitze dieser wilden Rotte stieß er zum Heere Cinnas. Der Senat war außerstande, die Stadt zu verteidigen, und da zudem noch Hungersnot ausbrach, so suchte er die erbitterten Gegner durch Unterhandlungen zu gewinnen. Als die Gesandten zum Cinna kamen, fragte er sie, ob sie zu ihm als ihrem Konsul kämen. Darauf konnten sie nicht antworten und gingen unverrichteter Sache zurück. Nun erkannte ihn der Senat als Konsul an und schickte von neuem Abgeordnete an ihn. Sie fanden ihn auf seinem Amtssessel sitzend und[S. 128] mit allen Zeichen der konsularischen Würde angetan. Marius stand schweigend neben ihm, aber sein finsterer Blick verriet die grimmige Rachgier seines Herzens.
Die beiden Verbündeten kamen hierauf zum Stadttor. Cinna zog ein; Marius aber blieb am Tore stehen und sagte mit bitterem Lächeln: „Verbannte dürfen ja die Stadt nicht betreten.“ Cinna ließ daher sogleich das Volk zusammenkommen, um die Aufhebung des Beschlusses zu bewirken, durch welchen Marius geächtet worden war. Allein kaum hatten drei Abteilungen des Volkes für seine Rückkehr gestimmt, so konnte sich dieser nicht länger halten. Er brach in die Stadt, ließ mit wütender Grausamkeit alles, was ihm in den Weg kam, niederstoßen, befahl Sullas Haus dem Erdboden gleich zu machen, und erlaubte seinen wilden Horden die schrecklichsten Ausschweifungen. Als das Morden fünf Tage und fünf Nächte lang gedauert hatte, ward Cinna dessen überdrüssig; aber der alte Marius hatte seinen Blutdurst noch nicht gesättigt; wem er den Gruß weigerte, der wurde getötet, darunter die vornehmsten und verdienstvollsten Männer des Staates, unter anderen der Konsul Octavius, die Konsulare M. Antonius, der größte römische Redner seinerzeit, Q. Catulus, der Mitsieger bei Vercellä (S. 118). Da überfiel endlich Cinna mit einer Schar Bewaffneter diese Mordsklaven in ihrem nächtlichen Lager und ließ sie niedermetzeln.
Als die erste Wut vorüber war, ernannten sich Cinna und Marius eigenmächtig zu Konsuln. Marius bekleidete dieses Amt nun zum siebenten Male, aber nur auf wenige Tage. Sulla hatte den Senat von seinen Siegen über Mithridates benachrichtigt und zugleich versichert, er werde bald kommen, um an seinen Feinden Rache zu nehmen. Diese Nachricht erfüllte den alten Wüterich, der selbst seinen Parteigenossen ein Greuel und Schrecken geworden war, mit Unruhe und Angst, und vergebens suchte er den fliehenden Schlaf in maßlosem Weingenuß. In solchem Taumel befiel ihn ein hitziges Fieber, dem er nach sieben Tagen erlag. Er starb im Januar 86, am siebenzehnten Tage seines Konsulats.
Drei Jahre hindurch behauptete sich Cinna im Konsulat, als er aber dem zurückkehrenden Sulla entgegen ziehen wollte,[S. 129] ward er in einem Aufstand von seinen eigenen Leuten, die nicht gegen Sulla fechten wollten, getötet. Sulla erschien an der Spitze eines siegreichen Heeres von 40000 Mann, das er überschwenglich belohnt hatte, in Italien (84), wo ihm die Marianer eine Macht von 200000 Mann entgegenstellen konnten. Aber von den sie führenden Konsuln ward der eine geschlagen, der andere von seinen Truppen, die zu Sulla übergingen, verlassen. Sulla wußte sogar das Heer des jungen Marius durch geschickte Überredung auf seine Seite zu bringen, sodaß Papirius Carbo, einer der marianischen Parteihäupter, sagte: „In Sulla steckt ein Löwe und ein Fuchs, und dieser ist noch mehr zu fürchten als jener.“ Der junge Marius warf sich in die hochgelegene feste Stadt Präneste, nicht weit von Rom, wo er sich heldenmütig verteidigte. Als aber Sulla vor den Toren Roms ein großes Heer der Samniter, den letzten Rest der aufständischen Italiker, geschlagen und vernichtet hatte, ließ sich Marius, am glücklichen Erfolge verzweifelnd, durch einen Sklaven töten. Seinen Kopf stellte Sulla auf der Rednerbühne aus und sagte spottend: „Das Bürschchen hätte erst Ruderer werden sollen, zum Steuermann war es noch zu jung.“
Nach einer Reihe von Siegen zog Sulla in Rom ein, und jetzt verwandelte er sich in den blutgierigsten Wüterich, den Rom jemals gehabt hat. Er hatte in der letzten Schlacht 6000 Gefangene gemacht. Diese ließ er in der großen Rennbahn, dem Zirkus Maximus, auf einmal niederhauen. Während dies geschah, versammelte er den Senat nicht weit vom Zirkus im Tempel der Bellōna. Hier hielt er eine drohende Rede, worin er die Senatoren nicht als Häupter eines freien Staates, sondern als pflichtvergessene Untertanen eines stolzen Gebieters behandelte. Während dieser Rede hörten die Senatoren das klägliche Geschrei jener Gefangenen, die eben im Zirkus ermordet wurden. Alle erschraken und sprangen bestürzt von ihren Sitzen auf. Nur Sulla blieb unbewegt. Ohne eine Miene zu verändern, sagte er bloß: „Laßt euch nicht stören, versammelte Väter! Was ihr hört, ist das Geschrei einiger Aufrührer, die auf meinen Befehl gestraft werden.“ Dann setzte er seine Rede fort, bis das Geschrei verstummte. Nicht lange nachher hielt er eine Rede vor dem Volk, worin er deutlich sagte, daß er keines Menschen schonen würde, der gegen ihn die Waffen getragen hätte. Der Grausame hielt[S. 130] Wort. Denn nun erfolgte das fürchterlichste Blutbad in Rom und ganz Italien. Vierzig Senatoren, sechzehnhundert Ritter und viele tausend Bürger wurden getötet, viele italische Städte zerstört, und jeder konnte ungestraft den ermorden, den er haßte oder dessen Vermögen er zu besitzen wünschte.
Als das Morden schon einige Tage gedauert hatte, sprach Metellus, ein Haupt der Optimaten und Parteigenosse Sullas, in der Senatssitzung zu ihm: „Wir bitten dich nicht diejenigen leben zu lassen, die du zu töten beschlossen hast, sondern nur diejenigen nicht durch Angst zu töten, die du erhalten willst.“ Sulla ward durch diese Freimütigkeit nicht beleidigt. Er erwiderte bloß, daß er selbst noch nicht wisse, wen er verschonen wolle. Hierauf sagte Metellus weiter: „Nun, so nenne uns diejenigen, die du zu töten entschlossen bist.“
Dies geschah. Sulla ließ die Namen derjenigen in Listen verzeichnen, die ihre Güter und ihr Leben verlieren sollten. Mit solchen Verzeichnissen, den sogenannten Proskriptionen, gab Sulla das erste und schrecklichste Beispiel politischen Massenmordes. Die Listen der zum Tode Bestimmten wurden öffentlich auf dem Forum ausgestellt und zugleich durch ein Gesetz bekannt gegeben, daß mit der Ächtung auch der Verlust des Vermögens verbunden sei. Sulla schickte ganze Scharen gallischer Reiter aus, um die Verurteilten aufzusuchen und umzubringen. Wer den Kopf eines Geächteten brachte, erhielt zwei Talente (fast 10000 Mark) zur Belohnung; wer einen Verurteilten aufnahm, verbarg oder ihm zur Flucht verhalf, ward mit dem Tode bestraft. Diese Achtserklärungen erzeugten die greulichsten Schandtaten. Sklaven verrieten ihre Herren, Kinder gaben ihre Eltern preis, Brüder und Gatten gerieten in Streit und tödlichen Haß. Tempel und Altäre wurden mit dem Blute der Verfolgten befleckt. Nicht nur Rom, sondern fast alle Städte Italiens waren der Schauplatz solcher unerhörten Greuel. Verrat, Undank, Meuchelmord, Bosheit, Raub und Habsucht wüteten allenthalben. Die Zahl der Getöteten ließ sich nicht genau bestimmen; in Rom sollen nahe an 5000 gefallen sein. Sulla hörte nicht eher auf durch Achtserklärungen seine wirklichen oder angeblichen Gegner zu verfolgen, als bis die Rache und die Habsucht aller seiner Anhänger gesättigt war. Ein gewisser Furfidius mahnte ihn doch einige seiner Feinde leben zu lassen, damit Menschen übrig blieben, über die er herrschen könnte.
Als Sulla seine Rache endlich gesättigt hatte, ließ er sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen und begann durch eine Reihe von Gesetzen die Verfassung und Verwaltung des Staates umzugestalten, wobei sein Absehen vor allem darauf gerichtet war, die Macht und das Ansehen der Optimaten und des Senates zu verstärken, die Geltung und den Einfluß der Tribunen zu schwächen, und überhaupt der verhaßten Volksherrschaft enge Schranken zu setzen. Wegen seiner Siege über Mithridates hielt er einen glänzenden Triumph, und belohnte alle Soldaten und seine Anhänger mit Geld und Landgütern.
Aber schon im zweiten Jahre legte er die Diktatur nieder (79), nachdem er noch einmal in einer Rede vor dem Volke seine Taten und sein Glück gepriesen hatte. Er lebte dann noch ein Jahr als Privatmann, dem Vergnügen und der Jagd ergeben. Seine letzten Tage wurden ihm durch eine sehr schmerzhafte und Ekel erregende Krankheit verbittert. Er starb im Jahre 78. In seiner Zurückgezogenheit hatte er die Denkwürdigkeiten seines Lebens in griechischer Sprache geschrieben. Sein Leichnam ward auf dem Marsfeld verbrannt. In der Grabschrift, die er selber verfaßt hatte, rühmte er sich, daß er alles gute oder schlimme, daß er von Menschen erfahren hätte, ihnen reichlich vergolten habe.
Gnaeus Pompejus, geboren 106, war der Sohn des Pompejus Strabo, der im Kriege der Römer gegen ihre aufständischen italischen Bundesgenossen (91–88 v. Chr.) mit Auszeichnung gefochten und einen Triumph gefeiert hatte. Während aber der Vater wegen seiner Geldgier und seines zweideutigen politischen Verhaltens beim Volk und beim Heer mißliebig war, wußte der junge Pompejus durch Vorzüge des Geistes und Charakters, durch persönliche Anmut und leutseliges Benehmen die Liebe und Gunst des Volkes zu gewinnen. Schon als Jüngling gab er Beweise von Mut und Unerschrockenheit. Während des Bürgerkrieges hatte Cinna einen[S. 132] Mörder gegen den älteren Pompejus gedungen, allein der Anschlag ward verraten und durch die wachsame Umsicht des Sohnes vereitelt. Ein andermal, als die Truppen dem verhaßten Feldherrn den Gehorsam weigerten und dieser aus Furcht nicht hervortrat, stellte sich der Sohn mitten unter die Soldaten, die bereits das Lager verlassen wollten, und suchte sie durch geschickte Rede zu ihrer Pflicht zurückzuführen. Als seine Vorstellungen nichts fruchteten, warf er sich vor dem Tor des Lagers zur Erde und hieß diejenigen, die abziehen wollten, zuvor seinen Körper zertreten. Bei diesem Anblick kehrten die beschämten Soldaten zurück und versöhnten sich mit ihrem Feldherrn.
Im Bürgerkriege nahm er entschiedene Partei für Sulla und die Sache der Optimaten. Solange die Herrschaft der Marianer dauerte, lebte er auf seinen Gütern, trat aber, als Sulla nach Italien zurückgekehrt war, offen für diesen auf. Siegreich kämpfte er mit seiner Truppe, die er selbst geworben, gegen die Marianer, sodaß Sulla dem erst 23jährigen jungen Krieger den Ehrennamen Imperator beilegte. Als Sulla seinen Einzug in Rom gehalten hatte, sandte er den Pompejus nach Sizilien und Afrika, um auch dort die Marianer zu vernichten. In Sizilien schlug er Papirius Carbo, nahm ihn gefangen und ließ ihn hinrichten. Nach Afrika übergesetzt, gelang es ihm in nur vierzig Tagen diese Provinz zu beruhigen. Als dann seine Legionen, nach Beendigung des Krieges, auf Sullas Befehl sich auflösen sollten, wollten diese die Waffen nicht eher niederlegen, als bis man sie auf gleiche Weise wie die Sullanischen belohnt hätte; ja sie forderten sogar den Pompejus auf sie gegen Sulla zu führen, und nur durch die Drohung, er werde lieber sich selbst töten, wußte dieser die Meuterer zu ihrer Pflicht zurückzuführen. Diese selbstlose Hingebung setzte ihn bei dem Diktator in die höchste Gunst. Dieser gab ihm den ehrenden Beinamen des Großen (Magnus) und zeichnete ihn noch besonders dadurch aus, daß er sich bei seinem Eintritt vom Amtssessel erhob. Als aber Pompejus auch die Ehre des Triumphes verlangte, eine Ehre, die nur siegreichen Prätoren und Konsuln zuteil zu werden pflegte, schlug ihm Sulla seine Bitte ab und verwies ihm seinen allzu großen Ehrgeiz. Da hatte der junge Sieger die Kühnheit zu erwidern: „Die aufgehende Sonne hat mehr Anbeter als die untergehende!“ Sulla, durch diese kecke Äußerung[S. 133] betroffen, gewährte ihm zwar die Bitte und rief zweimal: „So triumphiere denn!“ Aber von der Zeit an waren beide Männer keine Freunde mehr.
Dennoch blieb Pompejus der Partei des Sulla getreu. Die eigentliche Zeit seines Ruhmes brach aber erst nach Sullas Tode an, als er Gelegenheit fand eine Reihe glücklicher Kriege zu führen. Freilich waren es seine glänzenden Eigenschaften nicht allein, die ihn solche Erfolge erringen ließen; nicht selten war es die besondere Gunst der Umstände, die ihn dabei unterstützten, und die Kunst sich die Siege anderer und ihre Früchte anzueignen.
Quintus Sertorius stammte aus dem Sabinerlande, aus einer bislang namenlosen Familie. In seiner Vaterstadt erlangte er einigen Ruf durch seine Beredsamkeit; bald aber widmete er sich einzig und allein dem Waffendienste. Er machte die Feldzüge gegen die Cimbern und Teutonen mit und kämpfte später im Bundesgenossenkrieg. Er verrichtete so bewunderungswürdige Taten, daß das Volk ihn mit lautem Freudengeschrei begrüßte, so oft er zu Rom im Theater erschien. Bei dem Ausbruche des Bürgerkrieges zwischen Marius und Sulla schloß er sich jenem an, und als die Sache der Marianer in Italien verloren war, ging er nach Spanien, wo er sich acht Jahre lang, 80–72, als Haupt der in Italien unterlegenen Volkspartei gegen die Übermacht der gegen ihn vom Staat geschickten Heerführer siegreich behauptete. Unermüdlich in allen Anstrengungen des Krieges, abgehärtet und bedürfnislos wie ein einfacher Kriegsmann, dabei mit List und Gewandtheit allen Gefahren sich entziehend, mit immer neuen Anschlägen die Gegner überraschend, ward er ein Abgott seiner Anhänger und des spanischen Volkes, das ihn den zweiten Hannibal nannte.
Anfangs, als sein Heer noch klein und ungeregelt war, wurde er von dem ersten Heere, das Sulla gegen ihn geschickt hatte, genötigt, Spanien zu verlassen. Da fuhr er denn mit seinen 3000 Mann eine Zeitlang abenteuernd an den spanischen Küsten umher, und schon kam ihm der trübe Gedanke, aus der zerrütteten römischen Welt auszuscheiden und sich auf den „glücklichen Inseln“ (den kanarischen), deren paradiesische Schönheit die überlieferten Erzählungen griechischer Seefahrer[S. 134] nicht genug rühmen konnten, eine neue Heimat zu suchen. Aber seine Truppen hatten dazu keine Lust, und so führte er sie nach Afrika hinüber zu den Mauretaniern, denen er in einem Aufstande gegen ihren König half. Hier erwarben ihm seine Taten einen solchen Ruf, daß eine Einladung der noch immer freiheitsstolzen Lusitaner (im heutigen Portugal) an ihn erging, sie gegen die Heere der römischen Statthalter anzuführen. Nun ging er wieder nach Spanien. Hier wußte er durch Mut und Tapferkeit, durch Klugheit und erfindsamen Geist, sowie durch milde und rücksichtsvolle Behandlung der Eingeborenen die Hälfte aller spanischen Völkerschaften auf seine Seite zu ziehen. Sie räumten ihm volle Feldherrngewalt ein und ließen sich sogar die Strenge des römischen Kriegsdienstes gefallen. Um die Eingeborenen im Gehorsam zu erhalten, kam ihm ein Aberglaube zustatten. Die Spanier standen nämlich in der Meinung, eine Gottheit tue ihm ihren Willen durch die weiße Hindin kund, die er sich gezähmt hatte, und die ihn überall begleitete, selbst mitten im Kriegslärm.
So bildete er aus Lusitanern und Celtiberern waffengeübte Heerhaufen, mit denen er, verstärkt durch die aus Italien ihm zuströmenden marianischen Flüchtlinge, lange Zeit im kleinen Gebirgskrieg den römischen Legionen widerstand. Zwei Prokonsuln waren schon im Kampf gegen ihn gefallen. Die ganze Provinz schien bereits dem römischen Reiche verloren und Italien selber und die Herrschaft der Optimaten in Rom bedroht, zumal auch der Prokonsul Metellus Pius wenig gegen ihn ausrichtete. Perpenna, ein aus Italien vertriebener Marianer, der im Jahre 77 mit dem Rest der marianischen Truppen in Spanien erschienen war, ward von seinen Soldaten genötigt sich mit Sertorius zu vereinigen und ihm unterzuordnen. Dieser bildete nun einen eigenen Senat von 300 Mitgliedern, den er für den eigentlichen römischen Senat erklärte, während der Senat zu Rom nur aus Sullas Sklaven bestände. Auch errichtete er zu Oska auf seine Kosten eine Schule, wo die vornehmsten Hispanier ihre Söhne nach Art der jungen Römer erziehen und in der lateinischen und griechischen Sprache unterrichten ließen.
Sertorius vermied auch nach seiner Verstärkung durch Perpenna fortwährend offene Feldschlachten, sondern beschränkte sich auf den kleinen Krieg, den er in dem bergigen Lande mit Glück führte. Einst verlangten seine eigenen Soldaten, kühn[S. 135] geworden durch die immer zunehmende Zahl ihres Heeres, mit Ungestüm eine förmliche Schlacht. Sertorius gab nach. Bald aber wurden sie von den Feinden so bedrängt, daß ihr Untergang unvermeidlich gewesen wäre, wenn nicht Sertorius im rechten Augenblick zu ihrem Schutz herbeigeeilt wäre und sie sicher ins Lager zurückgeführt hätte. Als sie durch diesen Unfall mutlos geworden waren, ließ er einige Tage später zwei Pferde vorführen. Das eine war alt und schwach, das andere stark und jung mit einem dicken Schweif. Hinter jenes stellte er einen starken, hinter das andere einen kleinen schwächeren Soldaten. Auf ein gegebenes Zeichen mußten beide versuchen, den Pferden die Schweife auszuziehen. Der starke Soldat ergriff mit einem Mal den ganzen Schweif des schwachen Pferdes, um ihn mit einem Zuge auszureißen; aber er zog und zog, immer vergeblich. Indeß riß der kleine Soldat dem starken Pferde ein Haar nach dem andern aus, bis er zuletzt den ganzen Schweif in Händen hielt. So lehrte er sie, wie sie durch Ausdauer und kleine Gefechte auch einen überlegenen Feind schwächen könnten.
Die Fortschritte des Sertorius erregten endlich in Rom solche Besorgnisse, daß man den Pompejus mit einem neuen Heere nach Spanien schickte. Pompejus führte sein Heer von 30000 Mann zu Fuß und 1000 Reitern durch Gallien über die Pyrenäen (76). Jahrelang focht er, aber ohne Glück und Entscheidung gegen den unbesiegbaren Marianer, der sich sogar mit König Mithridates von Pontus in ein Bündnis einließ, bis endlich schnöder Verrat und Meuchelmord den Helden zu Fall brachte.
Als nämlich die Römer einen Preis von 100 Talenten und 20000 Morgen Landes auf den Kopf des Sertorius setzten, da ließen sich viele zum Abfall bewegen. Gefährlicher noch ward daher im eigenen Heer der ehrgeizige Perpenna, der, weil er dem Sertorius den Oberbefehl mißgönnte, die Gemüter vieler Untergebenen von ihm abwendig machte. Er stiftete Zwietracht im Senat des Sertorius und machte auch die Treue der Eingeborenen wankend. Da wurde Sertorius mißtrauisch und grausam und ließ sich zu einer furchtbaren Tat hinreißen: er ließ die Söhne der vornehmsten Spanier, welche er des Abfalles bezichtigte, in der Schule zu Oska töten. Die tiefe Mißstimmung und Erbitterung, die solches Verfahren auch bei den bisher treuesten Anhängern hervorrief, be[S. 136]nutzte sein Legat Perpenna als Gelegenheit zu seinem Untergang. Er stiftete eine Verschwörung an und lud seinen arglosen Feldherrn zu einem Gastmahl ein, zu dem dieser mit zweien seiner Geheimschreiber erschien. Auf ein gegebenes Zeichen erhoben sich die Mitverschworenen des Gastgebers und töteten Sertorius mit den beiden Schreibern (72).
Perpenna stellte sich nun selbst an die Spitze des Heeres und hoffte die Sache der Marianer weiter zu führen. Bald aber ward er von Pompejus geschlagen und gefangen genommen. Vergebens erbot er sich die in seinen Händen befindlichen Briefe auszuliefern, durch die viele römische Senatoren in Gefahr gekommen wären. Pompejus ließ die Briefe ungelesen verbrennen und den Verräter hinrichten. Die überlebenden Marianer flüchteten übers Meer nach Mauretanien oder warfen sich auf den Seeraub. Die beiden spanischen Provinzen kehrten unter die römische Herrschaft zurück.
Da Metellus inzwischen schon nach Italien zurückgekehrt war, konnte sich Pompejus rühmen dem langjährigen und gefährlichen Kriege ein Ende gemacht zu haben, und mit jenem zusammen im folgenden Jahre einen glänzenden Triumph feiern. Sein Glück sollte ihm bald Gelegenheit bieten, neue kriegerische Lorbeern zu ernten.
Während des letzten Jahres, in welchem Pompejus in Spanien focht, wurde Italien durch einen schrecklichen Sklavenaufstand überrascht, der in der grausamen Behandlung der Sklaven seine Ursache hatte. Schon längst hatte bei den Römern das blutgierige Vergnügen Eingang gefunden, Menschen bei öffentlichen Festlichkeiten auf Leben und Tod mit einander fechten zu sehen. Solche Fechter nannte man Gladiatoren (vom lat. gladius „Schwert“). Anfangs nahm man dazu Gefangene und Verbrecher; allein die Sucht des römischen Volkes, sich an solchen Fechterspielen zu ergötzen, nahm so zu, daß ganze Sklavenhorden von gewinnsüchtigen Unternehmern gekauft, in eigenen Fechterschulen abgerichtet und an die hohen Beamten, welche dem Volke solche Spiele auf ihre Kosten zu geben pflegten, vermietet wurden. So fochten oft viele Hunderte von Fechterpaaren vor dem Volke und gaben zur Belustigung desselben ihr Leben hin.
Um diesem unmenschlichen Zustand zu entgehen, entfloh aus einer solchen Fechterschule zu Capua der Thraker Spartacus mit einer Anzahl seiner thrakischen und gallischen Unglücksgenossen. In diesem Manne fand sich bei einer ungemeinen Körperstärke eine unbändige Freiheitsliebe, kühner Wagemut und eine seltene kriegerische Begabung. Anfangs der Hauptmann einer Räuberbande, erwies er sich bald als ein wirklicher Feldherr und erneuerte in Italien den „hannibalischen Schrecken“. Der Zulauf zu seiner kleinen Schar war so gewaltig, daß er nicht nur ein römisches Heer nach dem andern schlug, sondern auch Rom selbst zittern machte.
Anfangs setzte er sich mit seinen Gefährten in der Umgegend des Vesuvs fest. Bald sammelten sich mehr und mehr Fechter und Sklaven aus Süditalien um ihn, die er militärisch ordnete; Raub und Kriegsbeute verschafften Unterhalt und Waffen, und seine Erfolge begeisterten die wilden Haufen bald zu unbedingtem Gehorsam gegen den kühnen Führer. In Rom verkannte man anfangs die Größe der Gefahr. Die schwachen Kohorten, die man gegen den Aufstand sandte, wurden geschlagen. Erst als der Übermut und die Grausamkeit des täglich anwachsenden Heerhaufens die Städte Unteritaliens in Not und Schrecken setzte, rückten größere Truppen gegen ihn aus, die einen regelrechten Feldzug eröffneten.
Einst hatte Spartacus mit seinen Truppen eine Höhe besetzt; der römische Befehlshaber konnte sie hier nicht angreifen und lagerte sich vor der Höhe, da, wo ein einziger schmaler Weg zu ihr hinaufführte, um die Feinde auszuhungern. Allein diese verfertigten aus wilden Weinranken, mit denen die Höhe besetzt war, möglichst starke Ketten, an denen sie sich nachts an der steilsten Stelle herabließen, ohne daß die Römer auf der andern Seite das Mindeste merkten. Ja, sie wurden sogar von den um den Berg herumgekommenen Fechtern so plötzlich überfallen, daß sie die Flucht ergriffen und das Lager preisgaben. Dieser Sieg verschaffte dem Spartacus einen solchen Ruf, daß ihm weitere Tausende von Sklaven zuliefen.
Ein andermal hatte ihn der römische Prätor schon eingeschlossen, sodaß er entweder sich ergeben oder durch Hunger umkommen mußte. Da ließ er nachts vor dem Lager Leichname, die an Pfähle gebunden waren und Waffen in den Händen hielten, in gehörigen Zwischenräumen aufstellen; alle Wachtfeuer brannten, ein Trompeter blies dann und wann;[S. 138] dies alles, damit die Römer ihr Lager fortwährend besetzt halten sollten. Inzwischen entwischte Spartacus mit seinem ganzen Heere an einer wenig bewachten Stelle.
So schlug er nach einander drei Prätoren und zwei Konsuln. Da er jedoch fühlte, daß er seine aus 70000 Mann angeschwollene Masse wilder Thraker, Gallier und Germanen nicht lange werde zusammenhalten können, so suchte er nach Oberitalien zu dringen, um sie von da über die Alpen in ihre Heimat zu führen. Allein das Raubleben in Italien gefiel den meisten, und ein Unterbefehlshaber des Spartacus, namens Crixus, trennte sich mit 30000 Galliern von ihm, erlitt aber bald eine völlige Niederlage. Spartacus selbst ward von seinen Leuten gedrängt sie gegen Rom zu führen.
Hier wurde der durch seinen Reichtum bekannte Licinius Crassus zum Feldherrn gegen Spartacus ernannt. Er stellte zuerst die verfallene Kriegszucht wieder her, ließ in zwei Legionen seines Unterfeldherrn den zehnten Mann zur Strafe für ihre schimpfliche Flucht hinrichten, und schloß dann den Feind durch einen meilenlangen Wallgraben ein. Spartacus aber durchbrach den Wall und ward dann von Crassus zur Schlacht am Flusse Silārus in Lucanien (71) genötigt. Er kämpfte mit dem Mute eines Löwen; er hatte sein Pferd selbst erstochen, denn er wollte siegen oder sterben. Er stürzte sich in den Feind und suchte den Crassus zu treffen, jedoch vergebens; dagegen sanken viele andere unter seinen Streichen. Als er, schwer an der Hüfte verwundet, nicht mehr stehen konnte, schlug er knieend um sich, bis er aus der Ferne mit Wurfspießen getötet wurde. In der Schlacht kamen 60000 Sklaven um, 6000 wurden gefangen und an der Landstraße von Capua nach Rom ans Kreuz geschlagen, und nur einem Reste von 5000 Mann gelang es sich nach Oberitalien durchzuschlagen.
Aber hier stießen sie auf die Legionen, mit denen Pompejus aus Spanien heimkehrte. Er vernichtete den Haufen mit leichter Mühe bis auf den letzten Mann, und schrieb großprahlend an den Senat, Crassus habe zwar die Sklaven in geordnetem Treffen geschlagen, er aber habe diesem Sklavenkrieg erst die Wurzel ausgerissen! Gepriesen von seinen Schmeichlern, erhielt er nach seinem Triumph über Spanien das Konsulat, in dem er eben jenen Licinius Crassus, der ihm natürlich nicht hold war, zum Amtsgenossen hatte. Diese[S. 139] beiden Männer strebten jetzt nach der Gunst des Volkes und dadurch nach der Herrschaft. Crassus bewirtete das Volk an 10000 Tafeln und spendete ihm Getreide auf drei Monate; Pompejus stellte die Macht der Volkstribunen, die Sulla beschränkt hatte, wieder her, um mit ihrer Hilfe seine ehrgeizigen Pläne zu fördern (70).
Am Schluß dieses Jahres vermittelten Freunde zwischen beiden Konsuln eine Versöhnung, wobei sich der gutmütigere Crassus zuerst von seinem Sitze erhob und dem Pompejus die Hand reichte. Dieser liebte es mit erkünstelter Bescheidenheit aufzutreten. Als in dem Jahre seines Konsulats die Censoren die übliche Musterung über die Ritter hielten, erschien auch Pompejus, als ob er dem Ritterstande angehörte, sein Pferd am Zügel führend. Alles staunte; und als er auf die Frage, ob er auch die den Angehörigen des Ritterstandes obliegenden Feldzüge mitgemacht habe, mit lauter Stimme antwortete: „Ja, alle, und zwar immer als Oberbefehlshaber!“ da brach die Menge in lauten Beifall aus und gab ihm jubelnd das Ehrengeleit nach seinem Hause.
Schon seit vielen Jahren befanden sich die östlichen Provinzen des römischen Reiches in fortgesetzter Bedrängnis durch das überhandnehmende Unwesen der Seeräuber, die namentlich seit dem Kriege mit Mithridates durch die Söldnerscharen, welche in seinen Diensten gestanden, außerordentlichen Zuwachs erhalten hatten. Sie hatten ihren Sitz hauptsächlich an den rauhen Küsten Ciliciens in Kleinasien und auf Kreta, und betrieben ihre Raubzüge in planmäßiger Ordnung. Alle Küstenländer und Küstenstädte, sowie die Inseln von der Küste Asiens bis zur spanischen Meerenge wurden durch Plünderungen, Menschenraub und Erpressungen in Not und Schrecken gesetzt. Sie befuhren mit weit über tausend trefflich bemannten und schnell segelnden Schiffen das Meer, erschienen in ganzen kriegsmäßig geleiteten Geschwadern, geboten über 400 eroberte Städte und hatten allenthalben ihre festen Plätze, wo sie ihren Raub verbargen und verpraßten. Sie liefen in die Mündungen der Flüsse ein und überall, wo sie landeten, wagte man es nicht mehr das Feld zu bestellen. Dabei hatten sie immer ihre Hehler und Helfer in den Provinzen wie in Italien[S. 140] selbst. Vorzüglich gingen sie darauf aus, angesehene Personen aufzufangen, um hohe Lösegelder für sie zu bekommen; wer sich nicht löste, verlor Freiheit oder Leben. Besonders suchten sie die Küsten Italiens heim, wo sie bald da, bald dort landeten und einmal sogar die Tochter eines Senators, ja selbst zwei Prätoren samt ihren Liktoren fortschleppten. So waren die Herren der Welt nicht mehr Herren an ihrem eigenen Herde.
Schon seit dem Jahre 78 v. Chr. führten die Römer Krieg gegen die Seeräuber; aber wenn diese auch einmal geschlagen und ihre Raubnester zerstört wurden, so war doch das Unwesen nicht ausgerottet, ja es trat nach einiger Zeit noch stärker hervor, sodaß Handel und Verkehr allgemein stockte, die Getreideschiffe aus Sizilien und Afrika ausblieben, in Rom die Teuerung immer höher stieg, und Hungersnot und Aufruhr des Stadtvolkes drohte. Als nun endlich sogar vor Ostia, wenige Meilen von der Hauptstadt, eine römische Flotte von den Seeräubern geschlagen und versenkt wurde, da erkannte man die Notwendigkeit entscheidende Maßregeln zu ergreifen (67). Der Volkstribun Aulus Gabinius, ein Anhänger des Pompejus, trat mit dem Vorschlage auf, man solle einen der gewesenen Konsuln mit der Führung des Krieges gegen die Seeräuber betrauen und ihm auf drei Jahre mit den nötigen Truppen und Geldmitteln die unumschränkte Gewalt, Verfügung über die ganze Seemacht und über alle Küstenländer des römischen Reiches bis auf zehn Meilen landeinwärts übertragen.
Da jedermann einsah, daß unter dem Einen, dem man auf diese Weise den Befehl über fast das halbe römische Reich in die Hände legen sollte, kein anderer als Pompejus gemeint sein konnte, so setzte der Senat den ernstesten Widerstand entgegen. Bei den Beratungen über den Antrag des Gabinius ging es so stürmisch und gewalttätig zu, daß dieser selbst in Lebensgefahr geriet; aber auch die Senatoren würden vom Volke, das dem Tribunen zu Hilfe in den Sitzungssaal eingedrungen war, erschlagen worden sein, wenn sie nicht geflohen wären. Pompejus selbst gab sich zwar in einer Rede vor der Volksversammlung den Anschein, als wünsche er dieser großen Aufgabe, die so vielen Neid und Widerspruch errege, überhoben zu sein; er habe schon so viel im Kriege ausgestanden, daß er (der kaum 40 Jahre alt war) sich selbst als[S. 141] ein abgebrauchter alter Mann vorkäme; man sollte daher einen Tüchtigeren wählen. Das Volk ward dadurch nur noch bestärkt in dem Entschlusse den Vorschlag des Tribunen durchzusetzen, und es erhob sich ein solcher Lärm, daß ein oben vorbeifliegender Rabe, von dem Geschrei betäubt, zur Erde fiel.
Der Antrag ging durch, und Pompejus erhielt 500 Schiffe, 120000 Legionssoldaten mit 7000 Reitern und 25 Unterfeldherren (Legaten), dazu 144 Millionen Sesterze (33 Millionen Mark) aus dem Staatsschatz, nebst der Vollmacht über alle Mittel der Provinzen zu verfügen. Eine solche Macht hatte gesetzmäßig vor ihm noch kein römischer Feldherr besessen.
Nun teilte Pompejus das ganze Mittelmeer in dreizehn Bezirke, über deren jeden er einen Legaten mit den nötigen Streitmitteln setzte, und befahl sodann die Piraten zunächst aus dem westlichen Meere, also aus allen Schlupfwinkeln an den Küsten Italiens, Spaniens, Afrikas und der dazwischen liegenden Inseln aufzuscheuchen und nach dem östlichen Meere zu treiben. Als dies geschehen war, wendete er sich mit der Hauptmacht nach Osten. Schon auf dem Wege dorthin ergaben sich ihm viele auf Gnade und Ungnade, und er behandelte sie mit schonender Milde, um durch diese Mäßigung den andern die Rückkehr zur Ordnung zu erleichtern. Die meisten aber suchten ihre Zuflucht in den cilicischen Buchten und Bergfesten. Pompejus schlug dort ihre Flotte in einer regelmäßigen Schlacht gänzlich, zerstörte ihre Burgen, nahm ihnen alle ihre Städte, Schiffe, Vorräte, Waffen, und verpflanzte die Gefangenen, über 20000, tief in das Land hinein, um sich dort anzubauen und des Piratenlebens zu entwöhnen.
Auf diese Weise hatte er in drei Monaten das Seeräuberwesen vertilgt und Rom die Herrschaft zur See wiedergegeben.
Die rasche und glückliche Beendigung dieses Krieges versetzte das römische Volk in solche Freude, daß es den Freunden des Pompejus leicht wurde, dem Gefeierten ein noch größeres Feld des Ruhmes zu verschaffen, auf dem er abermals die Frucht der Arbeit anderer ernten sollte.
Während Pompejus diese schnellen Siege erfocht, hatte sich Mithridates, der den Römern so furchtbare König von[S. 142] Pontus, zu einem neuen Kampfe gerüstet. Er hatte seine Land- und Seemacht verstärkt und durch römische Hauptleute, die ihm nach der Unterdrückung der Marianer in Menge zuströmten, in römischer Weise einüben lassen. Mit seinem Eidam, dem König Tigránes von Armenien, und mit Sertorius in Spanien schloß er ein Bündnis und suchte die kriegerischen Völker im Norden des schwarzen Meeres und an der Donau zum Kampfe gegen die Römer aufzureizen. Nach dem Tode des Königs Nikomédes von Bithynien, der die Römer zu Erben seines Reiches ernannt hatte, fiel Mithridates in Bithynien ein mit einem Heer von 120000 Mann zu Fuß, 16000 Reitern und 100 Sichelwagen (74 v. Chr.). Allenthalben ward er als Befreier vom römischen Druck gern aufgenommen. Die Römer aber beauftragten die beiden Konsuln dieses Jahres, L. Licinius Lucullus und M. Aurelius Cotta, mit der Führung des Krieges, von denen dieser hauptsächlich die Leitung der Flotte, ersterer die des Hauptheeres zu Lande erhielt.
Nachdem Cotta in der Propontis unglücklich gegen Mithridates gekämpft und dabei seine ganze Flotte eingebüßt hatte, gelang es Lucullus, der von Cilicien her eben dorthin vorgerückt war, das weit zahlreichere Heer, womit der König die große Seestadt Kyzikos hart bedrängte, völlig zu schlagen, die Stadt zu entsetzen, und bald darauf auch die Flotte des Königs zu vernichten (73). Noch sieben Jahre, bis 67, dauerte der Krieg, der sich allmählich ostwärts bis in die Gebirge Armeniens und Mediens zog und den Gegner immer härter bedrängte. Schon gab Mithridates sein Reich verloren und ließ in seiner Hauptstadt seine Schwestern und Frauen töten, um sie vor römischer Gefangenschaft zu bewahren; er selbst floh zu seinem Schwiegersohn Tigranes von Armenien, der eben im Begriff stand, das Königreich Syrien mit dem seinigen zu vereinigen. Lucullus ließ ihn auffordern, den Flüchtling auszuliefern. Da er aber sein Schreiben an den „König“ Tigranes richtete, statt an den „König der Könige“, wie sich jener hochmütig nannte, so fühlte sich Tigranes gekränkt und gab eine abschlägige Antwort. Da zog Lucullus auch gegen ihn und schlug das zwanzigmal stärkere armenische Heer bei seiner Hauptstadt Tigranokerta in die Flucht (69). Dieser Sieg gewährte unermeßliche Beute. Lucullus gedachte noch weiter vorzudringen, allein der Ungehorsam seiner meuterischen[S. 143] Soldaten, deren Genuß- und Beutegier er nicht genug frönte, hemmte ihn in seinen Unternehmungen, und mitten im glücklichsten Lauf seiner Siege riefen ihn Neid und Mißgunst und boshafte Verleumdungen seiner Gegner vom Schauplatze des Krieges ab.
Diese Feinde hatte sich Lucullus durch seine rücksichtsvolle und menschliche Behandlung der kleinasiatischen Städte zugezogen. Die ihnen von Sulla auferlegten 20000 Talente waren durch die Schulden, die sie bei den römischen Wucherern hatten machen müssen, zu der entsetzlichen Höhe von 120000 Talenten angewachsen, und die unvermögenden Schuldner wurden durch Kerkerstrafen und Martern aufs schrecklichste gepreßt. Lucullus setzte die Schuld auf 40000 Talente herab und gewährte den Städten noch andere Erleichterungen. Dafür ward er denn von den römischen Wucherern daheim auf das heftigste angegriffen und verleumdet. Diese und die Anhänger des Pompejus brachten es dahin, daß ihm der Oberbefehl genommen und auf den Antrag des Volkstribunen Manilius, den Cicero in einer Rede verteidigte, dem Pompejus übertragen wurde (67). Nun ging Pompejus nach Kleinasien, wo er in Galatien mit Lucullus eine Unterredung hatte. Anfangs spendeten sich beide die größten Lobsprüche; zuletzt überhäuften sie sich gegenseitig mit Vorwürfen, indem Lucullus dem Pompejus seinen unersättlichen Ehrgeiz, dieser dem Lucullus seine unersättliche Habgier vorhielt.
Lucullus ging nach Rom, wo er nach langem Warten einen Triumph erhielt, und dann sein weiteres Leben in der Beschäftigung mit Kunst und Literatur und im Genuß seiner ungeheuren Reichtümer hinbrachte. Seine reichen Sammlungen von kostbaren Gemälden, Bildsäulen, Büchern, seine prächtigen Paläste, Landhäuser, Lustgärten, seine Fischteiche und künstlichen Seen, seine Prachtgeräte und Kleinodien, seine üppigen Gastmähler, wozu er die seltensten Speisen und Weine aus allen Weltgegenden herbeischaffen ließ, machten lucullischen Luxus zum Sprichwort. Kostete ihm doch ein einziges Prunkmahl im Apollo (so hieß einer seiner Speisesäle) an 30000 Mark nach unserem Gelde! Durch ihn wurden die Kirschen und andere aus Asien eingeführte edle Obstarten in Europa einheimisch Sein Beispiel blieb natürlich nicht ohne verderbliche Nachahmung; fast alle reichen und vornehmen Männer Roms wetteiferten seitdem in der Pracht ihres Haushalts und ihrer[S. 144] Lebensführung, und je größer ihre Verschwendung ward, um so gieriger suchten sie sich in den Provinzen durch Erpressungen und Bestechlichkeit zu bereichern.
Pompejus, dem sein Vorgänger schon durch große Erfolge vorgearbeitet hatte, setzte nun den Krieg gegen Mithridates fort. Dieser hatte sich inzwischen wieder erholt und mit rastloser Tätigkeit ein neues Heer von 33000 Mann aufgestellt. Vor dem andringenden Pompejus zog er sich in das Innere seines Landes zurück und suchte den Euphrat zu gewinnen. Hier holte ihn Pompejus ein, umging ihn unbemerkt und besetzte die umgebenden Höhen eines Engtals, durch welches die Gegner ihren Marsch nehmen mußten. Mithridates schlug, ohne Ahnung von der Nähe der Feinde, in diesem Tal sein Lager auf. Die Nacht kam und alles lag in tiefer Ruhe. Plötzlich schmetterten auf allen Seiten die römischen Trompeten; die römischen Legionen erhoben ihren gefürchteten Schlachtruf und schlugen mit den Waffen an die Schilde, daß die Schluchten widerhallten. Hierauf ergoß sich ein Pfeil- und Speerregen von den Anhöhen herab über die Aufgeschreckten, die in wildestem Gedränge den Ausweg im Dunkeln suchten. Dann verließen die Römer die Berge; der Feind sah sie nicht, aber er fühlte ihr Schwert; alles flüchtete und drängte nach der Mitte, wo man sich erdrückte und zertrat. Endlich ging der Mond auf und beleuchtete das gräßliche Nachtstück. Mithridates selber entkam mit zwei Begleitern und einer seiner Frauen, die ihn in persischer Reitertracht zu begleiten und alle Gefahren zu teilen pflegte. Sein ganzes Heer war vernichtet.
Pompejus wandte sich darauf gegen Tigranes nach Armenien, das er ohne Schwertstreich einnahm. Der alte Tigranes, von dem eigenen Sohne verraten und an seinem Glücke verzweifelnd, kam in das Lager des Pompejus, legte ihm sein Diadem zu Füßen und bat um Schonung. Er behielt sein Erbreich und zahlte 6000 Talente.
Während Mithridates in die fernsten Teile seines Reiches am Kaukasus und auf die taurische Halbinsel (Krim) geflohen war, um sich zu neuem Widerstande zu rüsten, drang Pompejus durch die Kaukasusländer bis nach Kolchis am schwarzen Meere vor. Bald aber begab er sich wieder in das Reich Pontus, wo zwölf Fürsten der benachbarten Länder demütig vor ihm als ihrem Gebieter erschienen, um seine Be[S. 145]fehle zu empfangen. Dann brach er auf, um südwärts nach Syrien zu ziehen, das, seit dem Erlöschen der Dynastie der Seleukiden (312–64), in völlige Zerrüttung geraten war, und machte auch dies große Reich mühelos zur römischen Provinz. Von da wandte er sich westwärts nach Palästina (63).
In Palästina stritten damals zwei Brüder aus dem Heldengeschlechte der Makkabäer um die Herrschaft, und beide hatten den Pompejus zu Hilfe gerufen. Dieser entschied zu Gunsten des älteren Bruders, Hyrkānos, dem er die Regierung und das Hohepriestertum, aber nicht den Königstitel bewilligte. Der zurückgesetzte Aristobūlos zog sich darauf mit seinen Anhängern auf den Tempelberg in Jerusalem zurück und verteidigte sich dort mit der äußersten Tapferkeit. Erst im dritten Monat eroberten die Römer an einem Sabbat, als die Juden die Waffen ruhen ließen, den Tempel; 12000 Juden, darunter die Priester, die sich im Opferdienst nicht irre machen ließen, verloren hierbei das Leben. Nichts schmerzte aber die Juden mehr, als daß Pompejus sich nicht scheute, mit seinem Gefolge in das Allerheiligste des Tempels einzudringen, das doch bei ihnen niemand als der Hohepriester und auch dieser nur einmal im Jahre betreten durfte. Pompejus tat dies in der neugierigen Erwartung, daß er hier den einzigen Gott der Juden sehen werde. Allein, wie erstaunte er über das Volk der Juden, als er darin kein Götterbild wahrnahm, sondern nur den goldenen Leuchter, den goldenen Tisch mit den Schaubroten und die heiligen Schriften. Dem heidnischen Römer mußte dies alles ein verschlossenes Geheimnis sein. Pompejus legte den Juden eine schwere Kriegssteuer auf und machte das Land zinspflichtig; Aristobulus aber und seine Kinder führte er gefangen fort, um sie in Rom beim Triumphe aufzuführen.
In Palästina erfuhr Pompejus auch den Tod des Mithridates. Dieser hatte zuletzt in seiner eigenen Familie Verrat erfahren müssen. Auch sein liebster Sohn Phárnakes empörte sich wider ihn und gewann sein Heer. Der alte, sogar von seinen Leibwachen verlassene König flüchtete sich in eine Burg, wo ihn sein Sohn belagerte, um ihn den Römern auszuliefern. Aber Mithridates, als er das seiner harrende Los erkannte, nahm er das Gift, das er stets im Knaufe seines Schwertes trug, und mischte für sich, seine Frauen und Töchter, unter diesen die beiden Bräute der Könige von Ägypten und Cypern,[S. 146] den Giftbecher, den er selber als der letzte trank. Da er aber seinen Körper, um sich gegen Vergiftung zu schützen, seit lange an alle Arten von Gift gewöhnt und dagegen abgehärtet hatte, so wirkte der Trank nur schwach und langsam. Da bot der König einem seiner keltischen Söldner den Nacken zum Todesstreich. So endete dieser große Feind der Römer sein Leben im 68. Lebensjahre, nach 56jähriger Regierung und 26jährigem Kampf gegen die römische Weltherrschaft (63).
Jetzt eilte Pompejus in das Reich Pontus und traf hier umfassende Anordnungen über die eroberten asiatischen Länder. Er setzte Könige und Fürsten ab und ein, löste Königreiche und Fürstentümer auf und schuf neue, ordnete die neuerworbenen Provinzen nach seinem Gutdünken, und kehrte dann, überreich an Erfolgen, Ruhm und Beute, nach Italien zurück. In Brundisium, wo er landete, entließ er sein Heer und begab sich, wie ein einfacher Bürger, nach Rom. Auf dem ganzen Wege begrüßte ihn das Volk unter stetem Beifallrufen bis zu den Toren Roms, wo ihn der ganze Senat erwartete. In Rom feierte er als Sieger über den dritten Weltteil und zweiter Alexander seinen dritten Triumph, der zwei Tage dauerte und alles, was man bisher in dieser Art in Rom gesehen hatte, an Pracht und Glanz weit hinter sich ließ. Voran trug man Tafeln mit den Namen von sechzehn besiegten Ländern und Völkern, mit der Angabe von 1000 Burgen, 900 Städten, 800 Schiffen, die er genommen, und von 39 Städten, die er gegründet oder bevölkert hatte. Unter den Siegeszeichen und erbeuteten Schätzen und Kostbarkeiten, die er zur Schau stellte, befanden sich 33 Kronen mit Perlen, 3 goldene Götterbildnisse, 9 Schenktische voll goldener Trinkgeschirre, die unermeßlichen Schätze des Mithridates, darunter eine kostbare Sammlung geschnittener Steine, sein goldenes, 8 Ellen hohes Brustbild, sein Thron, sein 4 Fuß breites und 3 Fuß langes Brettspiel von 30 Pfund Gold an Gewicht, mit Würfeln von Edelsteinen, ein Musentempel mit einer Sonnenuhr im Giebel u. s. w. Die Menge der Kostbarkeiten war so groß, daß sie nicht alle in diesen beiden Tagen aufgeführt werden konnten. Unter den 324 vornehmen Gefangenen aus den verschiedensten Völkerschaften, die ungefesselt vor dem Triumphwagen einhergingen, befanden sich fünf Söhne und zwei Töchter des Mithridates. Endlich folgte auf einem von Edelsteinen schimmernden Triumphwagen Pompejus selbst,[S. 147] angetan mit einer Rüstung Alexanders des Großen, die er in der königlichen Schatzkammer des Mithridates gefunden hatte. In den römischen Staatsschatz lieferte er 20000 Talente (fast 10 Millionen Mark).
Marcus Tullius Cicero wurde im Jahre 106 v. Chr. im südlichen Latium, nahe bei Arpinum, der Vaterstadt des Marius, geboren. Er stammte aus einem wohlhabenden Rittergeschlechte und empfing von seinem Vater seine erste Bildung. Früh zeigte er den Ehrgeiz „immer der Beste zu sein und emporzustreben vor allen.“ Seine weitere Vorbildung erhielt er zu Rom, wo er schon in der Schule durch Wißbegierde, schnelle Auffassung und rasche Fortschritte allgemeine Bewunderung erregte. Dann machte er sich mit den Werken der besten griechischen Dichter, Redner und Philosophen vertraut, und ließ sich in die römische Rechtskunde einführen. Durch fleißiges Übersetzen griechischer Dichtungen und Reden erlangte er eine große Gewandtheit auch im Gebrauch der lateinischen Sprache. Nachdem er im marsischen oder Bundesgenossenkriege (S. 121) einen Feldzug mitgemacht hatte, lebte er drei Jahre in Rom als Anwalt, indem er die Verteidigung von Angeklagten übernahm. Dann ging er, um seine Gesundheit herzustellen und sich weiter auszubilden, nach Athen, Kleinasien und Rhodus, wo er die berühmtesten Lehrer der Beredsamkeit hörte. In Rhodus, erzählt man, forderte ihn eines Tages sein Lehrer, der berühmte Apollonios Molon, auf, einen griechischen Vortrag zu halten. Cicero tat es und wußte seine Zuhörer so hinzureißen, daß sie in Lobsprüchen über ihn wetteiferten; nur Molon saß lange Zeit nachdenkend da und sprach endlich: „Dich, o Cicero, preise und bewundere ich, aber Griechenlands Geschick bedauere ich, da ich sehe, daß auch der einzige Vorzug, der uns Griechen noch übrig blieb, Bildung und Beredsamkeit, durch dich den Römern zuteil wird.“ Einige Jahre nach seiner Rückkehr ward er Quästor in Sicilien, wo er durch seine menschenfreundliche und gerechte Amtsführung sich allgemeine Achtung erwarb.[S. 148] Deshalb übertrugen ihm hernach die Städte dieser Provinz die Anklage gegen Gajus Verres, der sie als Prätor drei Jahre lang durch unersättliche Habgier, schamlose Erpressungen von Geld und Kunstwerken aller Art, durch ungerechte und grausame Urteilssprüche in Verzweiflung gebracht hatte. Cicero führte diese Anklage mit solchem Erfolge, daß Verres noch vor Beendigung des Prozesses seine Sache verloren gab und in die Verbannung ging. Dieser Erfolg begründete den Ruf Ciceros als des ersten Redners in Rom und erwarb ihm so allgemeine Anerkennung, daß er die nächsthöheren Ämter, die Ädilität und Prätur, mühelos erreichte und endlich auch, obgleich wie sein Landsmann Marius ein „Neuling“ (homo novus), das höchste Ziel seines Ehrgeizes, das Konsulat, für das Jahr 63 erlangte. Als Konsul erwarb er sich um sein Vaterland dadurch ein großes Verdienst, daß er die Verschwörung des Catilina entdeckte und vernichtete.
Lucius Sergius Catilina war aus dem altpatrizischen Geschlechte der Sergier entsprossen. Von Jugend auf von allen Lastern jener Zeit befleckt, durch Verschwendung verarmt und verschuldet, war er vertraut mit allen durch Ausschweifung und Leichtsinn zugrunde gerichteten jungen Adligen, die er zu Meineid und Betrug, zu Gewalttat und Mord verführte. Schon zur Zeit der sullanischen Proskriptionen hatte er durch Ermordung des eigenen Bruders seine Verworfenheit gezeigt. Dennoch wußte er sich so zu verstellen, daß er hohe Ämter erlangte und sich sogar um das Konsulat bewarb. Da er aber als Proprätor in Afrika wegen Erpressungen angeklagt wurde, mußte er von dieser Bewerbung abstehen. Aus Erbitterung über diesen Fehlschlag seiner Hoffnung und aus Furcht vor weiteren gerichtlichen Verfolgungen faßte er den Entschluß die neuen Konsuln und die ihm verhaßten Senatoren zu ermorden, und sich so das Konsulat mit Gewalt zu verschaffen und die herrschende Aristokratie zu stürzen.
Da sein Versuch, diesen Plan auszuführen, zweimal mißlungen war, stiftete er eine weit verbreitete Verschwörung zum Umsturz des Staates an. Er gewann in Rom selbst zehn Senatoren, eine Anzahl Ritter, außerdem noch viele Unzufriedene in den übrigen Städten, Leute, die, wie er selbst, durch eine völlige Umwälzung aus Armut, Schuldennot oder Unehre wieder emporzukommen hofften. Diesen allen verhieß er Ämter, Tilgung ihrer Schulden und Reichtümer.
Zur Ausführung seines ruchlosen Planes bewarb er sich von neuem um das Konsulat, diesmal zugleich mit Cicero, für das Jahr 63. Zwar er selbst fiel durch, aber neben Cicero wurde ein heimlicher Gesinnungsgenosse Catilinas, Antonius Pätus, gewählt. Durch seinen neuen Mißerfolg nicht abgeschreckt, sondern zum äußersten gereizt und entschlossen, betrieb Catilina seinen Verrat mit erhöhter Kraft. Er ließ in aller Stille in allen Teilen Italiens seine Anhänger sich sammeln und bewaffnen, und traf in Rom selbst alle Anstalten, um die Stadt auf ein gegebenes Zeichen in Brand stecken und den neuen Konsul Cicero mit allen Häuptern der herrschenden Partei ermorden zu lassen. Aber er fand in Cicero einen wachsamen und unerschrockenen Gegner, der alle seine Schritte beobachtete und rechtzeitig zu vereiteln wußte. So verging ein großer Teil des Jahres. Endlich gelang es dem Konsul durch den Verrat einer Frau und durch die Aussagen eines Teilnehmers einen Beweis für Catilinas Hochverrat zu erhalten. Da trat er im Senat offen mit seiner Anklage gegen Catilina hervor. Vergebens suchte dieser sich zu verteidigen. Als er die ihm feindliche Stimmung erkannte, rief er mit drohendem Trotz: „Aus zwei Körpern besteht unser Staat: der eine ist hinfällig und hat ein schwaches Haupt; der andere ist kräftig, jedoch ohne Haupt. Es soll ihm, wenn ich am Leben bleibe, nicht lange mehr fehlen!“ Dann stürzte er hinaus.
Inzwischen hatten seine Anhänger unter der Führung eines gewissen Manlius bei Fäsulä (heute Fiesole, nahe bei Florenz) ein Lager bezogen. Da Catilina auch bei der Konsulwahl dieses Jahres wieder durchgefallen war, so versammelte er in der darauf folgenden Nacht die Verschworenen und wies jedem sein Geschäft zu. Die vornehmsten Gegner sollten getötet, die Stadt an verschiedenen Stellen zugleich angezündet, vor allem aber Cicero vor Anbruch des Tages ermordet werden. Dieser erfuhr den Plan, ließ die beiden Verschworenen, die ihn ermorden wollten, vor seiner Tür abweisen und berief den Senat. Auch Catilina erschien. Jetzt enthüllte Cicero das ganze ruchlose Treiben des Mannes in gewaltiger Rede, richtete dann sein Wort unmittelbar an diesen selbst und forderte ihn auf mit seiner Rotte Rom zu verlassen, wo für seine heimlichen Anschläge kein Raum mehr sei, wo der Konsul und die Staatsgewalt ihn auf Schritt und Tritt bewache und das Volk ihn verabscheue; draußen möge er den offenen Kampf[S. 150] gegen die Vaterstadt beginnen. Und Catilina folgte dieser höhnischen Aufforderung: in der folgenden Nacht eilte er aus der Stadt ins Lager zu Manlius.
Die Mitverschworenen aber, die er in Rom zurückließ, bestimmten die Feier der Saturnalien (im Dezember) zur Ausführung ihres Planes; die Stadt sollte an zwölf Ecken angezündet, die Häupter des Senats und die Konsuln durch bestimmte Verschworene ermordet werden, und Catilina in der allgemeinen Verwirrung mit seinem Heere einrücken. Auch eine Gesandtschaft der Allóbroger, einer Völkerschaft in der gallischen Provinz, welche gekommen war, um über ungerechte Behandlung Beschwerde zu führen, wurde mit in die Verschwörung gezogen und zum Aufstande aufgefordert; aber dies beschleunigte nur den Untergang der Frevler. Da diese Gesandten schwankten, was sie tun sollten, so teilten sie die Sache einem Senator mit, durch den Cicero alles erfuhr. Sie erhielten den Rat, sich von den Häuptern der Verschwörung Briefe an ihr Volk geben zu lassen. Dies geschah; aber Cicero ließ die abreisenden Gesandten, bei denen sich auch ein Verschworener befand, nahe bei der Stadt aufheben und bekam durch die Briefe nun auch schriftliche Beweise gegen die Verschworenen in die Hand.
Die Schuldigen wurden darauf überführt und in Haft gegeben. Cicero erhielt den Dank des Senats und den Namen Vater des Vaterlandes. Von den neun Hauptschuldigen waren vier entflohen, die übrigen fünf, an ihrer Spitze der Stadtprätor Lentulus, wurden vom Senat zum Tode verurteilt und dieser Beschluß sogleich im Gefängnis vollzogen. Mit den Worten: „Sie haben gelebt!“ verkündigte Cicero dem Volke die Vollstreckung der Strafe und ward von ihm, wie im Triumphe, nach seinem Hause begleitet.
Gegen Catilina selbst aber wurde mit Waffengewalt vorgeschritten. Der Feldzug gegen ihn fiel ins folgende Jahr (62). Bei Pistoria in Etrurien kam es zum Treffen. Catilina und seine 3000 Gefährten fochten mit verzweifelter Tapferkeit; sie fielen bis auf den letzten Mann.
Wiewohl Cicero durch die Entdeckung der Verschwörung den Staat gerettet hatte, so wurde doch der Umstand, daß er die Verbrecher wider das herkömmliche Rechtsverfahren, ohne gerichtliche Untersuchung und Verurteilung, bloß auf einen Senatsbeschluß hin, hatte hinrichten lassen, die Ursache, daß[S. 151] er später heftig angegriffen wurde, wobei er von seinen politischen Freunden nur schwach unterstützt wurde. Der Volkstribun Clodius beantragte einige Jahre nachher ein Gesetz, daß jeder, der einen römischen Bürger ohne Richterspruch hingerichtet habe, geächtet sein solle. Dieses Gesetz, das unverkennbar gegen Cicero gerichtet war, fand die Zustimmung des Volkes, und so mußte dieser, um seinen Feinden zu entgehen, freiwillig in die Verbannung wandern (58). Er ging nach Thessalonike in Makedonien. In Rom zog man seine Güter ein und zerstörte sein Haus. Doch schon im folgenden Jahre (57) wurde er durch Volksbeschluß zurückgerufen. Seine Rückkehr glich einem Triumphzuge. Sein Haus und seine Güter wurden ihm wieder hergestellt.
Gajus Julius Cäsar wurde im Jahre 100 v. Chr. zu Rom als Sprößling eines der vornehmsten alten Adelsgeschlechter, dem der Julier, geboren. Von seiner Mutter Aurelia mit der größten Sorgfalt erzogen, zeigte er schon als Knabe eine ganz ungewöhnliche Begabung des Geistes und eine Willenskraft, die vor keinem Widerstande, vor keiner Schwierigkeit zurückwich. Von seinem Gedächtnis und seiner Geisteskraft erzählte man Erstaunliches: er sei imstande und gewohnt, zu gleicher Zeit zu schreiben, zu lesen und zu hören, und auf einmal vier bis sieben Briefe zu diktieren. Bei so seltenen Gaben, die mit rastloser Tätigkeit verbunden waren, erwarb er sich eine reiche Fülle von Kenntnissen aller Art und erreichte die volle Bildungshöhe seiner Zeit.
Zur Zeit der Diktatur Sullas stand Cäsar auf Seiten des Marius. Schon durch Verwandtschaft war er mit dieser Partei verbunden, da Marius mit Cäsars Tante vermählt war und er selbst eine Tochter Cinnas, Cornelia, zur Gemahlin hatte. Dadurch zog er sich die Feindschaft des allgewaltigen Diktators zu. Sulla verlangte, Cäsar sollte sich von seiner Gemahlin scheiden; dieser aber weigerte sich standhaft, während Pompejus, an den Sulla eine gleiche Forderung gestellt hatte,[S. 152] sich dem Willen des Diktators nachgiebig fügte. Durch diese Weigerung erbittert, ließ Sulla Cäsars Namen auf die Liste der Geächteten (Proskribierten) setzen. Dadurch verlor dieser das Heiratsgut seiner Frau und sein väterliches Erbe, mußte Rom verlassen und eine Zeitlang unter den größten Gefahren umherirren. Fast jede Nacht war er genötigt sich an einem anderen Orte zu verbergen, und hatte unter solchen Umständen um so schwerer zu leiden, als zugleich ein Fieber seine Kräfte verzehrte. Als er dennoch zuletzt entdeckt wurde, mußte er sich von den Häschern mit vielem Gelde loskaufen. Endlich verzieh ihm Sulla und begnadigte ihn auf Fürbitten einiger vornehmen Freunde und besonders der Vestalinnen, dabei sprach er aber die merkwürdigen Worte: „So nehmt ihn denn hin, aber wisset, daß dieser Jüngling uns einst zum Verderben gereichen wird; denn in dem einen Cäsar stecken viele Marius!“
Aber auch nach seiner Begnadigung mochte sich Cäsar noch nicht für ganz sicher gehalten haben, denn bald verließ er Rom und begab sich nach Rhodus, um sich dort in der Beredsamkeit auszubilden. Auf der Fahrt dorthin geriet er in die Hände von Seeräubern, die damals noch ihr Unwesen trieben. Während der vierzig Tage, die er bei ihnen bleiben mußte, bis er das verlangte Lösegeld herbeischaffen konnte, wußte er sich so in Achtung zu setzen, daß er nicht ihr Gefangener, sondern ihr Herr zu sein schien. So hatten sie für seine Auslösung zwanzig Talente verlangt, da rief er: „Wie? für einen Mann, wie ich bin, nur zwanzig Talente? Ihr sollt fünfzig haben.“ Während der Gefangenschaft beschäftigte er sich mit der Abfassung von Reden und Gedichten, die er dann wohl den Piraten vorlas. Kargten sie dabei mit ihrem Beifall, so schalt er sie und drohte, er werde sie alle ans Kreuz schlagen lassen. Wenn er schlafen wollte, verbot er ihnen jedes Geräusch, und sie gehorchten. So mächtig erwies sich seine geistige Überlegenheit selbst auf die verwilderten Gemüter dieser rohen Gesellen. Kaum war er frei, so brachte er einige milesische Schiffe zusammen, überfiel damit die Seeräuber und ließ sie wirklich, wie er ihnen im Scherze gedroht, in Pergamon ans Kreuz schlagen.
Nach Rom zurückgekehrt, schloß er sich an Pompejus an, den er bei Herstellung der Gewalt der Tribunen unterstützte, und wußte durch seine Beredsamkeit und Leutseligkeit die Gunst des Volkes zu gewinnen. Besonders erwarb er sich den Beifall[S. 153] der noch zahlreichen Anhänger des Marius dadurch, als er seiner Tante, der Witwe des Marius, bei ihrer Bestattung eine Grabrede hielt, worin er die Verdienste des den Optimaten so verhaßten Mannes zu preisen wagte und sein Bildnis, dem Verbote trotzend, unter den Ahnenbildern seines eigenen Geschlechtes einhertragen ließ. Auch ließ er auf dem Kapitolium die Bildsäule desselben und seine Siegeszeichen aus dem jugurthinischen und cimbrischen Kriege, die von Sulla zerstört waren, wieder herstellen.
Im Jahre 67 wurde er Quästor in der spanischen Provinz Lusitanien. Als er dort zu Gades im Herkulestempel ein Standbild Alexanders des Großen sah, rief er unter Tränen aus: „Der hatte in meinem Alter schon die Welt erobert, und ich habe noch gar nichts getan!“ Als Ädil gewann er durch ungemein prachtvolle und kostbare Spiele, wobei er unter anderem 320 Fechterpaare in silbernen Rüstungen auftreten ließ, die Gunst der Volksmenge in hohem Grade, stürzte sich aber auch in große Schulden. Im Vertrauen auf diese Volksgunst bewarb er sich, obwohl noch sehr jung, um die erledigte Würde des Oberpriesters, die bislang nur die ältesten und geehrtesten Konsulare zu bekleiden pflegten. Als ihn am Tage der Wahl seine Mutter nicht ohne Tränen zur Tür geleitete, sagte er: „Heute, Mutter, siehst du deinen Sohn entweder als Oberpriester oder als Verbannten wieder!“ Und in der Tat hatte er das Glück dem an Alter und Amtswürde weit überlegenen Catulus bei der Wahl vorgezogen zu werden. Als Prätor bekam er die Verwaltung desselben Spaniens, in dem er Quästor gewesen war. Doch hätte er Schulden halber nicht abreisen können, wenn nicht Crassus für ihre ungeheure Summe (18 Millionen Mark) seine Bürgschaft gewährt hätte. Als er auf dieser Reise durch ein kleines Städtchen jenseits der Alpen kam, warf einer aus seiner Begleitung die Frage auf, ob man sich in diesem Örtchen wohl auch um Rang und Ämter streite. „Gewiß“, antwortete Cäsar, „ich wenigstens will lieber hier der erste als in Rom der zweite sein!“ In seiner Provinz Spanien erwarb er übrigens so viel, und machte in glücklichen Kriegen solche Beute, daß er nicht nur seine Schulden bezahlen, sondern auch noch eine große Summe in den Staatsschatz legen konnte.
Als Cäsar nach Rom zurückkehrte, stand gerade die Konsulwahl für das Jahr 59 bevor. Um das Konsulat zu erlangen,[S. 154] verband er sich mit Pompejus, der durch seine Taten und Erfolge der angesehenste Mann in Rom war, und mit Crassus, der einen ungeheuren Reichtum besaß. Diesen Bund der drei Römer nannten ihre Gegner spöttisch ein Triumvirat (Dreimännerschaft). Sie versprachen sich einander, in den Kämpfen mit ihren politischen Gegnern bei Wahlen und im Senat mit allen Mitteln zu unterstützen. Denn auch Pompejus war mit dem Senat zerfallen, der die Einrichtungen, die er aus Eigenmacht in Asien getroffen hatte, nicht bestätigen wollte. Diese Bestätigung versprach ihm Cäsar beim Volke durchzusetzen. Cäsar erlangte das Konsulat, erhielt aber als Kollegen in diesem Amte den Kandidaten seiner Gegner, M. Calpurnius Bibulus.
Als Konsul fuhr er fort sich um die Gunst des Volkes zu bewerben und die Macht der Senatspartei zu schwächen. Dazu diente ihm besonders ein Gesetz, das armen römischen Bürgern Landbesitz in Campanien anwies. Als Bibulus sich diesem Gesetze entgegenstellte, entstand eine solche Bewegung in der Volksversammlung gegen ihn, daß er nur mit Mühe sein Leben rettete. Seit dieser Zeit wagte der eingeschüchterte Mitkonsul überhaupt keinen Widerstand mehr; ja, er hielt sich fortan, aus Furcht vor Cäsars gebieterischem Auftreten, während des Restes seines Amtsjahres in seinem Hause verschlossen. Daher nannten die Spötter dieses Konsulat nicht das des Cäsar und Bibulus, sondern das des Julius und des Cäsar.
Am Schlusse des Jahres ließ sich Cäsar die Provinzen Illyrien und das diesseitige Gallien (Gallia cisalpina) als Statthalterschaft auf fünf Jahre zuweisen, worauf der Senat noch die Provinz des jenseitigen Galliens (Gallia transalpina) hinzufügte, in der geheimen Hoffnung, er werde dort in allerlei Verlegenheiten verwickelt und auf diese Weise am besten von Rom ferngehalten werden. Um seine Verbindung mit Pompejus zu befestigen, gab Cäsar ihm seine Tochter Julia zur Gemahlin. Sodann wußte er noch zwei Männer aus Rom zu entfernen, die seine geheimen Absichten durchschaut hatten und seinen Plänen gefährlich werden konnten. Diese Männer waren Cato und Cicero; Cato ward nach der Insel Cypern gesandt, um dieselbe in eine römische Provinz zu verwandeln, Cicero aber durch den Volkstribunen Clodius genötigt in die Verbannung zu gehen (S. 151).
Im Frühjahr des Jahres 58 eilte Cäsar hinüber nach Gallien, dem Lande der Kelten. Von diesem Lande besaßen die Römer damals nur den südöstlichen Teil (s. S. 116); das übrige Gallien war von den Römern noch nicht bezwungen. Hier fand Cäsar in achtjährigem Kriege (58–51) Gelegenheit, das römische Reich um drei große Provinzen zu vergrößern, sich selber aber den Ruhm eines der größten Feldherrn zu erwerben und ein ihm treu ergebenes großes Heer zu bilden, mit dessen Hilfe er sich bald der Reichsherrschaft selber bemächtigen konnte.
Gleich im ersten Jahre seiner Statthalterschaft geriet er in Kampf mit den gefürchteten Germanen. In einem Zwiste der gallischen Äduer und Sequaner hatten die letzteren den Sueben Ariovist vom rechten Rheinufer her zu Hilfe gerufen. Dieser besiegte die Äduer und setzte sich mit seinen Scharen, die allmählich auf 120000 Mann anwuchsen, im Lande der Äduer fest. Auch die Sequaner zwang er ein Dritteil ihres Landes ihm zu überlassen, und ein zweites Dritteil nahm er gerade für neue Ankömmlinge in Anspruch, als Cäsar von Äduern und Sequanern zu Hilfe gerufen ward. Ariovist war unter Cäsars Konsulat mit dem Ehrentitel „Freund und Bundesgenosse des römischen Volkes“ ausgezeichnet worden und stand mit diesem bis dahin in gutem Vernehmen. Dennoch glaubte Cäsar die fortwährenden Zuzüge der Germanen nach Gallien, die auch für die römische Provinz gefährlich werden konnten, hindern zu müssen, und forderte den Ariovist zu einer Unterredung auf. Dieser aber gab die stolze Antwort: wenn er selbst von Cäsar etwas begehren sollte, so würde er selbst ihn aufsuchen; so möge Cäsar das Gleiche tun und zu ihm kommen. Übrigens begreife er nicht, was die Römer in diesem seinem Gallien zu tun und zu sagen hätten. Hierauf ließ ihn Cäsar auffordern den Galliern ihre Freiheit wiederzugeben und keine Germanen mehr über den Rhein kommen zu lassen. Dagegen erklärte Ariovist: es sei Brauch des Krieges, daß die Sieger über die Besiegten nach Gutdünken herrschten; auch die Römer herrschten über die Besiegten nach eigenem und nicht nach fremdem Ermessen. Wie er den Römern nicht vorschreibe, wie sie ihr Recht gebrauchen sollten, so wollte auch er in seinem Rechte vom römischen Volke nicht behindert sein. Wenn übrigens Cäsar Krieg wolle, möge er nur kommen; dann werde er einsehen, was seine noch nie besiegten Germanen, die in[S. 156] vierzehn Jahren harten Kriegsdienstes unter kein Dach gekommen wären, auszurichten vermöchten.
Als hierauf Cäsar die Hauptstadt der Sequaner Vesontio (Besançon) besetzte und eine Schlacht bevorstand, wurde das römische Heer von gewaltiger Furcht und Mutlosigkeit überfallen. Die Gerüchte von der Wildheit und Unüberwindlichkeit der Germanen, deren Mienen und feuriger Blick nicht zu ertragen seien, hatten ein Zagen und Klagen unter den Legionen erregt. Viele Offiziere, meist junge vornehme und des Krieges noch ungewohnte Männer, verlangten unter allerlei Vorwänden Urlaub, um nach Hause zu gehen; andere machten ihr Testament. Aber durch eine kräftige Rede wußte Cäsar die Verzagten zu beschämen und den Mut seiner Legionen wieder aufzurichten. In der bald darauf folgenden Schlacht, in der Gegend zwischen Vesontio und dem Rhein, wahrscheinlich in der Nähe von Mülhausen im Elsaß, siegte die römische Kriegskunst über die Germanen, die völlig geschlagen wurden. Ariovist rettete sich auf einem Kahne über den Rhein.
In den folgenden Jahren zwang Cäsar, unter blutigen Kämpfen und nach wiederholten Aufständen, fast alle gallischen Stämme sich der römischen Herrschaft zu unterwerfen. Auch war er der erste Feldherr, der zweimal nach Germanien (55 und 53) und Britannien (55 und 54) übersetzte, nicht um auch diese Länder dauernd zu behaupten, sondern um ihre kriegslustigen Völker von Einfällen in Gallien und Unterstützung der Gallier abzuschrecken.
Gallien schien endlich beruhigt, als sich im Jahre 52 noch einmal alle gallischen Völkerschaften zwischen Seine, Loire und Garonne zu einem Kampfe um ihre Freiheit erhoben. An der Spitze derselben stand der kräftige und kluge Vercingétorix, ein Fürst der Arverner. Allein die Geistesgegenwart und Feldherrnkunst Cäsars, sowie die Tüchtigkeit seiner Legionen, insbesondere auch die Tapferkeit germanischer Söldner trug einen entschiedenen Sieg davon. Der Krieg zog sich endlich um die Stadt Alesia (heute Alise St. Reine, zwischen Dijon und Chatillon) zusammen. In diese hochgelegene feste Stadt warf sich Vercingetorix mit 80000 Mann, worauf Cäsar Stadt und Lager der Feinde mit 60000 Mann einschloß, indem er eine Umwallung von fast zwei Meilen an Umfang errichtete und dann eine zweite noch ausgedehntere Reihe von Befestigungen aufwarf, um sich gegen ein Heer von[S. 157] 257000 Mann zu schützen, welches heranzog, um Alesia zu entsetzen. Aber sowohl gegen die Ausfälle der Belagerten als gegen die Angriffe der Gallier, die von außen seine Werke umzingelten, behauptete sich Cäsar mit Beharrlichkeit und Glück. Die Heerhaufen der Gallier wurden geschlagen und zogen einzeln wieder davon; Vercingetorix sah keine Hilfe mehr, und in der Stadt nahm Hunger und Elend immer mehr zu. Da faßte er den Entschluß durch Aufopferung seiner selbst die Eingeschlossenen zu retten. In voller Rüstung, auf seinem besten Roß, erschien er vor dem Sieger, umritt dessen Tribunal, gab dann Roß und Waffen ab und ließ sich schweigend auf den Stufen zu Cäsars Füßen nieder. Fünf Jahre später ward er bei Cäsars Triumph durch die Straßen Roms geführt und dann enthauptet. Nach der Übergabe von Alesia baten die abgefallenen Völker um Frieden. Der Widerstand der Gallier war gebrochen, und nur wenige Stämme versuchten noch, aber ohne allen Erfolg, das Glück der Waffen. Cäsar konnte die Unterwerfung Galliens als vollendet betrachten. Er hatte in diesen Kriegen 800 Städte erobert, 300 Völkerschaften unterworfen und im ganzen eine Million Streiter vernichtet, zwei Millionen aber zu Gefangenen gemacht.
Während Cäsar Gallien unterjochte, blieb Pompejus fortwährend in Rom, um durch seine Gegenwart seine Macht zu behaupten und zu erhöhen. Im Jahre 55 bekleidete er mit Crassus zum zweiten Male das Konsulat, nach dessen Ablauf dem Crassus Syrien, ihm selber Spanien und Afrika als Provinzen zufielen. Cäsar hingegen erhielt die Erneuerung seiner Statthalterschaft auf weitere fünf Jahre.
Crassus eilte nach Syrien, um von dort aus einen Feldzug gegen die Parther, die Nachbarn der Meder und Perser, welche mit ihren zahlreichen Reiterscharen von Osten her die römischen Provinzen in Vorderasien seit mehreren Jahren heimsuchten, zu unternehmen. Aber in unersättlicher Habsucht brachte er seine Zeit damit zu allenthalben Geld zu erpressen und die Tempelschätze zu plündern, wie er denn im Tempel zu Hierapolis tagelang mit Abwägen des Goldes beschäftigt war. Inzwischen gewannen die Parther Zeit zu mächtigen Rüstungen, und als es dann in Mesopotamien bei Karrhä[S. 158] zur Schlacht kam, wurde er gänzlich geschlagen. Auf dem Rückzug ließ er sich durch den parthischen Feldherrn in einen Hinterhalt locken, in dem er verräterisch getötet ward (53).
Durch den Tod des Crassus hatte sich das sogenannte Triumvirat in ein Duumvirat, d. h. in eine Verbindung zweier Männer verwandelt. Da aber im Jahre 52 Julia, die Tochter Cäsars und Gemahlin des Pompejus, welche bis dahin die Eintracht zwischen den beiden Machthabern erhalten hatte, starb, so wurde die Verbindung zwischen ihnen, die ja nie aufrichtig gemeint war, noch mehr gelockert. Pompejus war nach Ablauf seines Konsulates nicht in seine Provinzen gegangen, sondern ließ sie durch Legaten verwalten, um nur immer in Rom zu sein, wo es ihm gelang für das Jahr 52 gegen alles Herkommen, zum alleinigen Konsul ernannt zu werden. Dagegen unterließ aber auch Cäsar nicht durch Bestechungen die einflußreichsten Männer in Rom zu gewinnen, darunter den talentvollen und beredten Volkstribunen Curio. Als nun der Zeitpunkt herannahte, wo die feindselige Spannung zwischen beiden Männern in offenen Kampf ausbrechen sollte, überließ sich Pompejus einer großen Sorglosigkeit, ohne an Gegenrüstungen zu denken. Als ihn jemand daran erinnerte, äußerte er in stolzer Zuversicht: „Wo ich nur in Italien mit dem Fuße auf die Erde stampfe, da werden Legionen hervorkommen.“
Cäsar gedachte sich um das Konsulat für das Jahr 49 zu bewerben, wollte aber nicht, nach der herkömmlichen Ordnung, ein halbes Jahr vor dem Antritt des Amtes sich persönlich in Rom bewerben. Denn dann hätte er seine Stellung als Statthalter der ihm übertragenen Provinzen zuvor verlassen und seine Legionen abgeben müssen, und wäre als Privatmann gegen die Angriffe seiner Gegner machtlos geworden. Aber eben deshalb bestand auch der Senat hartnäckig auf der Forderung, daß er nur persönlich, nicht aus der Ferne, und als Privatmann, ohne Amt und Heerbefehl, als Bewerber um das Konsulat auftreten solle. An dieser Frage entzündete sich der seit lange drohende Kampf. Denn Cäsar forderte, daß dann auch Pompejus auf seine Provinzen und Legionen verzichten müsse. So wurde eine Zeit lang über die Frage, hin und her gestritten. Endlich beschloß der Senat, daß Cäsar seine Kriegsmacht abgeben sollte, wo nicht, so werde er als Feind des Vaterlandes betrachtet werden. Die dem Cäsar[S. 159] treu ergebenen Tribunen M. Antonius und C. Cassius erhoben leidenschaftlichen Einspruch. Da schritt der Senat zu dem äußersten Mittel: er erteilte den Konsuln unbeschränkte Vollmacht mit der alten Formel, „die Konsuln sollten darauf achten, daß das Gemeinwesen (res publica) keinen Schaden nehme“, und gegen Cäsars Unbotmäßigkeit mit Waffengewalt einzuschreiten. Jetzt flohen die beiden Tribunen, als wären sie ihres Lebens nicht mehr sicher, als Sklaven verkleidet, nach Ravenna, einer nahe an der Grenze gelegenen Stadt der gallischen Provinz, wo sich Cäsar damals aufhielt, und meldeten ihm, daß der Krieg gegen ihn beschlossen sei. Er war seit lange auf diesen Ausgang seines Streites mit Pompejus und der Senatspartei vorbereitet, und handelte nun mit seiner gewohnten Raschheit.
Er führte die Tribunen in derselben entwürdigenden Kleidung, in der sie zu ihm geflohen waren, vor die Reihen der Legion, mit der er nach Ravenna vorgerückt war, stellte ihnen das ihm widerfahrene Unrecht vor und schloß seine Rede mit der Frage, ob sie die Ehre ihres Feldherrn verteidigen wollten, unter dessen Anführung sie so viele glückliche Schlachten geliefert hätten. Freudig riefen alle, sie wären bereit ihn zu verteidigen, und gelobten ihn niemals zu verlassen, wohin er sie auch führen würde. Kaum war er der Treue seiner Legionen gewiß, so schickte er sie heimlich an den Fluß Rúbico, der seine Provinz von dem eigentlichen Italien trennte. Er selbst blieb bis zu Ende des folgenden Tages in Ravenna. Um sein Vorhaben zu verbergen und keinen Verdacht zu erregen, besuchte er früh ein öffentliches Schauspiel, besah zur Mittagszeit die Anlage einer Fechterschule, die er zu Ravenna bauen lassen wollte, und gab gegen Abend seiner Gewohnheit gemäß ein großes Gastmahl. Erst nach Sonnenuntergang stand er von Tische auf, unter dem Vorwand, daß er durch ein kleines Geschäft abgerufen werde, und mit dem Versprechen sobald als möglich wiederkommen zu wollen. Aber er kam nicht zurück. Er reiste vielmehr mit seinen vertrautesten Freunden zum Fluß Rubico, den er vor Tagesanbruch erreichte. Und nun stand er im Begriff den Krieg gegen sein Vaterland zu beginnen, denn mit dem Übergang über den Grenzfluß überschritt er zugleich seine amtliche Befugnis und erhob die Fahne der Empörung gegen die bestehende Staatsordnung. Es war der Beginn des Bürgerkriegs. Ein solches Beginnen mußte,[S. 160] wenn auch seit lange von Cäsar erwogen und beschlossen, ihm in letzter Stunde noch einmal alle damit verbundenen Bedenken und Gefahren vor die Seele führen. Wohl möchten diese Gedanken auch eines Cäsars Geist erschüttern. „Noch ist es Zeit zurückzukehren“, sagte er zu seinen Freunden, „sind wir aber einmal über diese Brücke gegangen, dann muß alles mit den Waffen entschieden werden.“
Lange, so erzählt man, stand er und sann. Endlich rief er: „Wohlan, die Götter wollen es, die Feinde fordern uns, der Würfel sei geworfen!“ Und sogleich ließ er seine Truppen hinübergehen, rückte in größter Eile vor Ariminum (Rimini) und nahm diese Stadt noch am Morgen des Tages ein.
Zu spät erwachte jetzt Pompejus aus dem Schlummer der Sorglosigkeit. Auf seine Soldaten, die, wenn auch 30000 Mann stark, keine Lust hatten sich mit Cäsars sieggewohnten Legionen zu schlagen, konnte er sich nicht verlassen. Jetzt mußte er sogar den Vorwurf hören, er möge doch nun die verheißenen Legionen aus der Erde hervorstampfen! Dagegen rückte Cäsar in raschem Siegeslauf die Küste entlang und nahm ohne Schwertstreich eine Stadt nach der anderen. Da verlor Pompejus den Mut; er verließ Rom mit den Konsuln, den meisten Senatoren und allen seinen Anhängern, und ging nach Capua, wo seine Legionen standen. So übereilt war die Flucht, daß die Konsuln den gefüllten Schatz in Rom zurückließen und sich begnügten nur die Schlüssel mitzunehmen. Von Capua eilte Pompejus nach Brundisium (Bríndisi), um von da über das Meer nach Griechenland zu gehen. Ohne Kampf überließ er Italien seinem Gegner.
Cäsar, von dessen Siege man die Wiederkehr der Schreckenszeiten unter Marius und Sulla befürchtete, verfuhr allenthalben mit unerwarteter Milde und zuvorkommender Großmut. Auch Sardinien und Sizilien kamen ohne Kampf in seine Gewalt. Den Zugang zum Schatz in Rom ließ er erbrechen und erklärte dem Tribunen Metellus, der dies verhindern wollte, daß er ihn bei fortgesetztem Widerstande werde hinrichten lassen, indem er hinzufügte: „Wisse, junger Mann, daß es mir schwerer fällt dies zu sagen als zu tun.“ Im Schatze fand er 26000 Barren Goldes und 40 Millionen Sesterzen. In 60 Tagen ward er Herr von Italien und hatte alle Gemüter durch Freundlichkeit und Wohlwollen beruhigt. Die Bewachung der Stadt übergab er dem Lépidus, das Kommando[S. 161] in Italien dem Marcus Antonius, und zog dann nach Spanien, um dort „das Heer ohne Feldherrn“ und nach seiner Rückkehr „den Feldherrn ohne Heer“ zu bekämpfen. Bald nötigte er die Legaten des Pompejus in Spanien sich zu ergeben, und reiste dann nach Rom zurück, wo er sich zum Diktator ernennen ließ, aber schon nach elf Tagen diese Würde mit dem Konsulat vertauschte. Jetzt erst gedachte er den Pompejus selbst zu verfolgen und zu bekämpfen.
Dieser hatte indessen großartige Rüstungen betrieben. Aus den östlichen Provinzen des römischen Reiches und von verbündeten Fürsten hatte er Truppen, Schiffe und Geld zusammengebracht, und stand jetzt an der Spitze eines Heeres von 63000 Mann zu Fuß und mehr als 10000 Reitern, wozu eine Flotte von 800 Schiffen kam. Zugleich gab er durch den Glanz seines Hauptquartiers, wo ein großer Teil des römischen Adels versammelt war, und durch die Einrichtung eines eigenen Senates zu erkennen, daß er sich als den eigentlichen Machthaber und seinen Senat als den eigentlichen Sitz der Reichsregierung betrachtete. Cäsar fuhr mit sieben Legionen von Brundisium ab und landete an der Küste von Epirus; die leeren Schiffe sandte er zurück, Antonius sollte die übrigen fünf Legionen auf ihnen hinüberführen. Aber von diesen Schiffen wurden 30 von einem Legaten des Pompejus abgefangen, die übrigen durch die Stürme des Winters an der Überfahrt gehindert. Ungeduldig vor langem Warten bestieg Cäsar selbst in einer stürmischen Nacht in Sklavenkleidung eine Barke, um nach Brundisium zu segeln und die Einschiffung seiner Truppen zu beschleunigen. Aber das Meer war so ungestüm, daß der Steuermann wieder umkehren wollte. Um ihn zu neuer Anstrengung zu ermuntern, wagte Cäsar sich ihm zu entdecken: „Sei guten Mutes!“ rief er, „du fährst Cäsar und Cäsars Glück!“ Dennoch mußte er den allzu mächtig tobenden Elementen weichen und in den Hafen zurückkehren. Endlich landete Marcus Antonius mit den übrigen Legionen.
Anfangs ließ sich der Krieg in Epirus für Cäsar ungünstig an. Bei Dyrrháchion (Durazzo) durchbrach Pompejus seine Verschanzungen und brachte ihm einen großen Verlust bei. Darauf zog Cäsar, dessen Heer den Mangel an den notwendigsten Bedürfnissen nicht länger tragen konnte, über das Gebirge nach dem fruchtbaren Thessalien hinüber.
Hier kam es in der Ebene von Pharsálos zur entscheidenden Schlacht (9. August 48). Das Heer des Pompejus betrug 47000 Mann zu Fuß und 7000 Reiter, und bildete eine zehn Mann tiefe Linie. Von Cäsars Heer waren nur 22000 Mann zu Fuß und 1000 Reiter zur Stelle und in dreifacher Schlachtreihe aufgestellt. Da Pompejus mit seiner Reiterei den linken Flügel hielt, weil sein rechter von einem Fluß gedeckt war, so stellte sich Cäsar mit seiner treuen, in vielen Schlachten bewährten zehnten Legion und sechs Kohorten kräftiger Germanen, jenem gegenüber, hinter seinem rechten Flügel auf.
Pompejus befahl seinen Soldaten den feindlichen Angriff ruhig zu erwarten. Cäsar dagegen ließ, um den Stoß auf den Feind zu verstärken, sein Heer anlaufen, dann mitten im Anlauf ein wenig halten und sich ordnen, und so auf den noch immer ruhigen Feind anstürmen. Zwar warf des Pompejus Reiterei die des Cäsar, wurde aber mitten im Vorstürmen plötzlich von der zehnten Legion und den deutschen Kohorten so empfangen, daß sie die Flucht ergriff, worauf die verfolgenden Kohorten Cäsars dem linken Flügel des feindlichen Fußvolkes in den Rücken fielen und durch dessen völlige Versprengung den Sieg herbeiführten. Am meisten Ruhm erntete im Heere Cäsars der Centurio Crástinus. Dieser rief seinen Kameraden zu: „Wohlan, ihr Kriegsgefährten! Mir nach und leistet eurem Feldherrn den Dienst, den ihr ihm verheißen habt; dieser eine Kampf ist noch übrig, dann wird er seine gebührende Würde und wir unsere Freiheit erlangen.“ Dann sagte er mit einem Blick auf Cäsar: „Heute, Feldherr, will ich mir deinen Dank verdienen, ob ich falle oder am Leben bleibe!“ Nach diesen Worten stürzte er sich an der Spitze von 120 Auserlesenen auf den Feind, in deren Mitte er aufs tapferste kämpfend den Tod fand.
Die geschlagenen Truppen des Pompejus flohen ins Lager, wohin sich dieser schon gleich nach der Flucht seiner Reiter begeben hatte. Noch saß er wie betäubt und sprachlos in seinem Zelte, als man ihm meldete, der Feind habe schon die äußeren Schanzen genommen. „Also gar bis in unser Lager!“ rief er bestürzt und fassungslos, vertauschte sein purpurnes Feldherrngewand mit einem schlichten Kleide, warf sich auf ein Roß und floh, von wenigen Getreuen begleitet, in der Nacht durch das Tal Tempe dem Meere zu.
Indessen eroberte Cäsar das feindliche Lager mit Sturm; 15000 Feinde lagen tot oder verwundet. Der Rest des feindlichen Heeres, der sich gerettet hatte, gegen 20000 Mann, ergab sich am folgenden Morgen, während Cäsar nur 30 Hauptleute und 200 Gemeine verloren hatte. Allen Gefangenen schenkte der Sieger Leben, Freiheit und Eigentum. Die Gemeinen nahm er in sein eigenes Heer auf. Die gefangenen Senatoren dagegen und Ritter wurden fast alle mit dem Tode bestraft, nur wenige fanden Schonung und Gnade; die übrigen suchten ihr Heil in der Flucht nach den westlichen Provinzen, denn der ganze Osten fiel alsbald in die Gewalt des Siegers.
Als Pompejus auf seiner Flucht an das Meer gelangt war, bestieg er ein Schiff und segelte nach der Stadt Amphípolis in Makedonien, wo er den Befehl ausgehen ließ, daß alle junge Mannschaft dieser Provinz sich zur Werbung einstellen sollte. Wahrscheinlich tat er dies, um den Plan seiner ferneren Flucht zu verbergen; denn nur eine Nacht blieb er bei Amphipolis vor Anker, dann segelte er weiter nach der Insel Lesbos, um seine Gattin Cornelia, die sich dort aufhielt, zu sich zu nehmen. Durch einen Boten ließ er ihr die Nachricht von seiner Niederlage mitteilen. Die unglückliche Frau, welche in dem süßen Wahn lebte, daß Cäsar seit dem Verluste bei Dyrrhachion schon völlig besiegt sei, sank bei dieser Kunde sprachlos zu Boden, und als sie sich wieder aufgerichtet hatte, stürzte sie, einer Rasenden gleich, aus der Stadt dem Hafen zu; Pompejus kam ihr hier entgegen; sie fiel kraftlos in seine Arme. Pompejus, selbst des Trostes bedürftig, suchte sie zu ermutigen und stellte ihr vor, daß das Glück den, welchen es stürzt, auch wieder erheben könne.
Nach einigen Tagen segelte er mit seiner Gemahlin von Lesbos ab. Er hatte nach reiflicher Überlegung beschlossen sich in den Schutz des Königs Ptolemäos von Ägypten zu begeben. Denn er durfte mit vollem Recht auf die Dankbarkeit und das Wohlwollen desselben hoffen, weil er selbst einst dessen Vater wieder auf den Thron gesetzt hatte. Er segelte also nach Pelusion, einer Stadt an der östlichen Mündung des Nils. Als er nicht mehr weit vom Ufer entfernt war, ließ er den König von seiner Ankunft benachrichtigen und um Schutz und Zuflucht bitten. Ptolemäos, erst dreizehn Jahre alt und noch unfähig selbst zu regieren, ließ sich von Achillas, dem Obersten seines Heeres, von seinem Vormund Potheinos und seinem[S. 164] Lehrer, dem Rhetor Theódotos, leiten. Diese drei Männer berieten über die Bitte des Pompejus. Anfangs waren sie in ihren Meinungen geteilt, zuletzt sagte Theodotos: „Nehmen wir ihn auf, so werden wir ihn zum Herrn und den Cäsar zum Feinde haben; weisen wir ihn zurück, so werden wir ihn beleidigen, weil wir ihm die Aufnahme versagt haben, und Cäsar nicht gewinnen, weil wir jenen haben entwischen lassen. Der beste Rat ist daher den Pompejus kommen zu lassen und sogleich zu töten; so beweisen wir uns dem Cäsar gefällig und brauchen uns vor Pompejus nicht zu fürchten! denn“ — setzte er hohnlachend hinzu — „die Toten beißen nicht mehr.“
Der Vorschlag des Theodotos wurde genehmigt und Achillas zur Vollstreckung ausersehen. Dieser, ein Mann von außerordentlicher Verwegenheit, bestieg mit Septimius, einem geborenen Römer, der einst unter des Pompejus Fahnen gedient hatte, nebst drei bis vier Ägyptiern ein kleines Fahrzeug und fuhr auf das Schiff des Pompejus zu. Das schlechte Aussehen dieses Fahrzeuges und die geringen Anstalten, die man zum Empfange des Pompejus traf, machten seine Freunde unruhig. Sie fingen an Verdacht zu schöpfen und waren schon willens sich wieder zu entfernen, als Achillas an Bord kam und den Pompejus einlud in sein Fahrzeug zu steigen, dessen dürftiges Aussehen er damit entschuldigte, daß das Meer an dieser Küste zu flach sei, um es mit größeren und schwereren Schiffen zu befahren. Pompejus war nicht ohne Argwohn; denn schon sah er, daß an der Küste einige königliche Schiffe bemannt wurden. Allein, um die Ägyptier nicht durch Mißtrauen zu reizen, zeigte er sich sogleich bereit dem Achillas zu folgen. Er nahm daher gefaßten Mutes von seiner Gemahlin und seinem Sohne Abschied und stieg mit vier Personen seines Gefolges in das ägyptische Boot.
Schon waren sie eine beträchtliche Strecke weit gefahren, und noch immer herrschte düsteres Schweigen in dem Boote. Pompejus wurde unruhig und suchte seine Unruhe durch Sprechen zu unterdrücken. Er wandte sich daher zu Septimius und sagte: „Mich dünkt, mein Freund, ich kenne dich. Sind wir nicht einmal Kriegsgefährten gewesen?“ Septimius nickte nur mit dem Kopfe, ohne ein Wort zu sprechen, und es herrschte abermals die vorige Stille. Da nahm Pompejus seine Schreibtafel zur Hand, um die griechische Anrede zu lesen, die er darin aufgezeichnet und die er an den jungen König richten[S. 165] wollte. Cornelias Blicke begleiteten indes die Fahrt in angstvoller Spannung bis zum Lande, wo sich eben viele Hofleute wie zu feierlichem Empfange sammelten. Schon begann sie zu hoffen. Aber in dem Augenblick, als Pompejus den Arm seines Freigelassenen Philippus ergriff, um sich vom Sitze zu erheben, stieß ihm Septimius sein Schwert in den Rücken, und Achillas fiel ihn von vorn an. Pompejus sah, daß er seinem Tode nicht entrinnen konnte, und suchte nun wenigstens die würdevolle Haltung, die er im Leben stets gezeigt hatte, auch noch im Tode zu bewahren. Er zog seine Toga über das Haupt, sprach kein Wort, sondern stöhnte nur bei jedem weiteren Stoß, bis er tot am Ufer zusammenbrach. So starb der große Pompejus im 58sten Jahre seines Alters, am 28. September 48, am Tage vor seinem Geburtstage. Auf den Schiffen, welche ihn hergebracht hatten, erscholl lauter Jammerruf beim Anblick dieses schrecklichen Vorgangs, dann eilten sie ins offene Meer zurück, vergeblich verfolgt von den ägyptischen Kriegsgaleeren.
Die Mörder des Pompejus wüteten noch gegen den Leichnam. Sie schnitten ihm den Kopf ab und warfen den Rumpf nackt an das Ufer, wo er von einer Menge neugieriger Menschen begafft ward. Darauf erwies Philippus, der Freigelassene des Pompejus, seinem Herrn den letzten Dienst. Er wusch den verstümmelten Leichnam im Meere ab, wickelte ihn in eins seiner Gewänder und brachte dann einige Trümmer von einem alten Fischerkahn zusammen, um einen Scheiterhaufen zu errichten. Während er damit beschäftigt war, trat ein alter Römer, der einst unter Pompejus gedient hatte, mit den Worten zu ihm: „Wer bist du, der du den großen Pompejus zu bestatten suchst?“ — „Sein Freigelassener“, antwortete Philippus. — „Wenn du der bist“, erwiderte der Alte, „so teile die Ehre der Beerdigung mit mir, damit ich in dem Elend, das mich drückt, doch wenigstens das eine Glück genieße, den Leichnam des größten römischen Feldherrn mit meinen Händen zu begraben.“ Philippus willfahrte ihm, beide verbrannten den Leichnam, vergruben die Asche und setzten auf den Grabhügel eine Tafel mit der Inschrift: „Hier ruht Pompejus der Große!“
Drei Tage nach des Pompejus Tode erschien Cäsar vor dem Hafen von Alexandria, der damaligen Hauptstadt Ägyptens. Alsbald kamen die Mörder in der Hoffnung auf eine Belohnung an Bord seines Schiffes und überreichten des Pompejus Haupt und Siegelring. Cäsar wandte sich mit Abscheu von dem Anblick des blutigen Hauptes, aber tränenden Auges empfing er den Siegelring des Mannes, der einst so groß und mächtig und durch Freundschaft und Verwandtschaft mit ihm verbunden gewesen.
Weit entfernt die Schandtat zu belohnen, bewies er sich milde und freundlich gegen die Anhänger des Pompejus, die man in Ägypten ergriffen hatte und in seine Gewalt lieferte. Denn Großmut und Nachsicht gegen besiegte Feinde bildeten den schönsten Zug seines Charakters. Er fand das ägyptische Volk gespalten und aufgeregt durch einen Zwist zwischen dem unmündigen König Ptolemäos und seiner älteren Schwester Kleópatra, die ihm den Thron streitig machte. Cäsar befahl beiden Teilen ihre Heere zu entlassen, und entschied dann zu gunsten der schönen Kleopatra, die ihn durch ihre verführerischen Reize geblendet hatte. Da brach plötzlich, durch die Ratgeber des Königs, Potheinos und Achillas, angestiftet, ein gewaltiger Aufstand in Alexandria aus, gegen den sich Cäsar mit den wenigen Truppen, die er mitgebracht, kaum zu behaupten vermochte. Er zog sich vor der Übermacht in das Brucheion, den schönsten und festesten Teil der Stadt, zurück. Hier bestand er, von jeder Verbindung mit Rom und den Provinzen abgeschnitten, unter der größten Bedrängnis neun Monate lang den Kampf gegen die empörte, vielmal überlegene Menge der Feinde. Um sich den Zugang zum Meere zu öffnen, verbrannte er die ägyptische Flotte im alexandrinischen Hafen, weil er nicht hoffen konnte sie zu erobern. Der Brand ergriff aber auch das Brucheion selbst, und die Hälfte jener berühmten alexandrinischen Bibliothek, die sich hier befand, ward ein Raub der Flammen. Während dieses traurige Schauspiel die Aufmerksamkeit der Einwohner beschäftigte, besetzte Cäsar die kleine Insel Pharos, die vor dem Hafen lag und den berühmten Turm, der als eins der sieben Wunderwerke der alten Welt galt. Von da an drehte sich der Kampf um die Behauptung des Hafens. Die Ägyptier schnitten den Römern das Trinkwasser ab und leiteten Meerwasser in ihre Cisternen.[S. 167] Um der Not abzuhelfen, ließ Cäsar neue Brunnen graben. Bald aber geriet auch die Insel Pharos, die durch einen Damm mit dem Brucheion zusammenhing, in die Hände der Feinde. Vergebens suchte Cäsar sie wiederzunehmen. Er wurde zurückgeschlagen und kam dabei selbst in Lebensgefahr. Denn als er vom Damm in ein Schiff sprang, drohte dieses wegen Überfüllung zu sinken. Da sprang er ins Meer und schwamm unter einem Pfeilregen einige hundert Schritte weit nach einem andern Schiffe, wobei er mit der einen Hand wichtige Schriften emporhielt, um sie nicht vom Wasser verderben zu lassen, und erreichte glücklich das Ufer. Endlich kam die langersehnte Hilfe, die ihm Mithridates, ein angeblicher Sohn des Königs dieses Namens, aus Kleinasien und Syrien zuführte. Dieser eroberte Pelusion; der König Ptolemäos wurde geschlagen und ertrank auf der Flucht im Nil. Nun ergab sich Alexandria dem Sieger (47); Kleopatra ward zwar als Königin von Ägypten anerkannt, das Land aber von einem römischen Heer besetzt gehalten.
Bevor jedoch Cäsar nach Rom zurückkehrte, mußte er noch einen Feldzug gegen Phárnakes, den Sohn des großen Mithridates, unternehmen. Dieser hatte, unzufrieden mit dem kleinen Königreiche, das ihm Pompejus gelassen, das väterliche Reich wieder erobert und gegen alle Römer grausam gewütet. Cäsar brach mit einer Legion gegen ihn auf; durch Syrien und Cilicien gelangte er nach Pontus, wo er den listigen Pharnakes überfiel und ihm in der entscheidenden Schlacht bei Ziéla eine vollständige Niederlage beibrachte (47). Er selbst war von seinem schnellen Sieg so überrascht, daß er an seine Freunde in Rom die berühmten Worte schrieb: „Ich kam, sah, siegte!“ (Veni, vidi, vici.) Pharnakes verlor alle Besitzungen und bald darauf durch einen treulosen Diener das Leben.
Jetzt erst kehrte Cäsar nach Rom zurück, wo seine Gegenwart dringend notwendig war, da ein unruhiger Volkstribun einen Aufstand verursacht hatte, der vielen Bürgern das Leben kostete. Cäsar stellte sogleich die Ruhe wieder her und überhäufte seine Anhänger mit Ehrenstellen und Belohnungen, dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf Afrika, wo sich die Anhänger des Pompejus gesammelt und eine bedeutende Macht an sich gezogen hatten. Noch war er mit den Rüstungen zu diesem Kriege beschäftigt, als eine Meuterei unter seinen Legionen ausbrach. Diese standen in Capua und warteten[S. 168] mit Ungeduld auf ihren Abschied, sowie auf die Belohnungen, die er ihnen versprochen hatte. Als er ihnen noch größere Belohnungen versprechen ließ, wenn sie ihm nach Afrika folgen wollten, empörten sie sich und brachen in ihrer Wut nach Rom auf, um sich ihren Lohn mit Gewalt zu holen. Nachdem sie auf dem Marsfelde angekommen waren, trat Cäsar unerwartet unter sie und fragte sie mit fester Stimme, was sie wollten. „Unsere Entlassung“, riefen sie. „Ihr sollt sie haben“, antwortete er, „und auch die versprochenen Geschenke, wenn ich an der Spitze anderer Legionen gesiegt habe und sie zum Triumphe nach Rom führe.“ Hiermit entfernte er sich und überließ die Bestürzten dem quälenden Gedanken, daß nun andere an ihrer statt Ruhm und Lohn neuer Siege ernten würden. Doch noch einmal wandte er sich an sie, aber nun nicht mehr mit der Anrede „Kameraden“ (commilitones), sondern mit der Anrede: „Bürger!“ (Quirītes). Da riefen alle, sie seien keine Bürger sondern Soldaten, und baten ihn sie nach Afrika zu führen.
In Afrika bestand die Macht der Pompejaner aus zehn Legionen, 20000 afrikanischen Reitern und 120 Elefanten; dazu kamen noch die Hilfstruppen des mit ihnen verbundenen Königs Juba von Numidien. Dieser furchtbaren Macht konnte Cäsar nur sechs Legionen und 2000 Reiter entgegenstellen, mit denen er noch in demselben Jahre (47) von Sicilien aus unter Segel ging, um seine Gegner, die ihn in der ungünstigen Jahreszeit nicht erwarteten, zu überraschen. Die Herbststürme jedoch zerstreuten seine Flotte, und er selbst erreichte nur mit 3000 Mann zu Fuß und 150 Reitern die afrikanische Küste. Als er in der Nähe von Adrumetum landete, fiel er dabei zur Erde, aber mit gewohnter Geistesgegenwart rief er aus: „Ich halte dich, Afrika!“ und verwandelte dadurch die schlimme Vorbedeutung, die seine Soldaten leicht in diesem Falle hätten sehen können, in eine gute. Bald auch fand sich die ganze Flotte wieder bei ihm ein, sodaß er im Anfang des Jahres 46 mit 15000 Mann einen Streifzug ins Innere unternehmen konnte. Da wurde er plötzlich von Labiēnus, der einst in Gallien sein bester und erfolgreichster Legat gewesen, und von Petrejus, den er vorher in Spanien besiegt und verschont hatte, mit einer solchen Übermacht angegriffen, daß er nur durch einen geschickt geleiteten Rückzug einer völligen Niederlage entging. Nicht lange darauf aber nötigte er seine Gegner zu[S. 169] der entscheidenden Schlacht bei Thapsus, welche mit der gänzlichen Vernichtung des pompejanischen Heeres endigte (46).
Unter den Häuptern der pompejanischen Partei, die bei Thapsus besiegt wurde, nahm der edle M. Porcius Cato, ein Urenkel jenes Cato, der die Zerstörung Karthagos zu fordern pflegte, den ersten Rang ein. Nach der Schlacht bei Pharsalos war er nach der Provinz Afrika gegangen und hatte dort die Verteidigung der Hauptstadt Utĭca übernommen. Als Cäsar heranzog, um durch die Eroberung dieser Stadt den Krieg zu beendigen, suchte er anfangs die Einwohner zum Widerstande zu bewegen. Da er aber sah, daß sie in ihren Meinungen geteilt waren, so änderte er seinen Plan. Zunächst war er vielen Senatoren mit Geld und Schiffen zur Flucht behilflich; ja, er riet sogar seinem eignen Sohn Marcus zur Flucht; dieser aber weigerte sich standhaft den Vater zu verlassen. Für ihn selbst hatte das Leben ohne den Bestand einer freien Republik keinen Wert mehr, und darum hielt er sich, nach den Grundsätzen der stoischen Lehre, deren eifriger Anhänger er war, für berechtigt sich selbst den Tod zu geben.
Gegen Abend ging er ins Bad und nahm dann mit seinen Freunden ein Mahl ein. Nach dem Essen trank er mit seinen Gästen und unterredete sich mit ihnen über den Satz, daß nur der Weise wahrhaft frei sei. Diese Behauptung verteidigte er mit solcher Wärme, daß allen seine Absicht klar wurde. Es folgte eine ängstliche Stille. Kaum merkte dies Cato, so lenkte er das Gespräch auf einen anderen Gegenstand. Dann nahm er mit besonderer Herzlichkeit Abschied und begab sich in sein Schlafgemach. Hier las er den Phädon, eine Schrift des griechischen Weisen Plato, welche von der Unsterblichkeit der Seele handelt und zugleich den Tod des edlen und weisen Sokrates schildert, zweimal durch, und wollte dann nach seinem Schwerte greifen. Er fand es aber nicht, denn sein Sohn hatte es heimlich entfernt. Er forderte es mit Ungestüm und ließ nicht eher ab, bis man es ihm brachte. Ohne sich an die Bitten und Tränen der Seinigen zu kehren, rief er: „Nun bin ich Herr über mich!“ entließ die Weinenden, las noch und schlief dann bis Mitternacht. Dann erkundigte er sich, ob seinen Freunden die Flucht gelungen sei. Auf die Nachricht, daß sie alle entkommen seien, verschloß er die Tür, stürzte sich in sein Schwert und fiel zu Boden, wobei er einen Tisch mit umriß. Auf das Geräusch eilten die Seinen herbei[S. 170] und verbanden seine Wunde; er aber, wieder zu sich gekommen, riß sie wieder auf und starb an Verblutung.
Als Cäsar bei seinem Einzug in Utica, welches ihm die Tore öffnete, Catos Tod vernahm, sagte er mit aufrichtigem Schmerz: „Cato, ich mißgönne dir deinen Tod, weil du mir deine Erhaltung nicht gegönnt hast!“ Auch verzieh er dem jungen Cato und ließ ihm das väterliche Vermögen. Catos Beispiel folgend gaben sich auch Metellus, Scipio, Juba und Petrejus den Tod. Labienus aber und Sextus Pompejus verzweifelten noch nicht, sondern flohen nach Spanien, um dort den Krieg zu erneuern.
Als Cäsar nach Rom zurückgekehrt war, wetteiferten der Senat und das ihm ergebene Volk, ihn mit den höchsten Ehren und Würden zu überhäufen. Die Diktatur, mit welcher die unumschränkte Macht über den ganzen Staat verbunden war, wurde ihm auf zehn Jahre übertragen; auf goldenem Sessel saß er neben den Konsuln, und 72 Liktoren, sechsmal mehr als den Konsuln, schritten ihm voran, so oft er sein Haus verließ. Für seinen Sieg bei Thapsus ordnete der Senat ein vierzigtägiges Dankfest an, und seine Siege über Gallien, Ägypten, Pontus und Afrika feierte Cäsar durch einen vierfachen Triumph. Neben dem Tempel der Fortuna, der Göttin des Glücks, brach, ein schlimmes Vorzeichen, die Achse seines Triumphwagens, und er mußte einen andern besteigen, dann stieg er die Stufen des Jupitertempels auf den Knieen hinauf. Bei dieser Gelegenheit legte er die Kriegsbeute über 200 Millionen Mark an Gold und 2822 goldene Kränze im Werte von mehr als 15 Millionen Mark in den öffentlichen Schatz. Seinen Feinden verzieh er großmütig und bewies überall die größte Milde. Bei dem öffentlichen Festmahle, das er gab, wurde das Volk an 22000 Tischen aufs köstlichste bewirtet, wobei sogar die bei den Römern so beliebte Fischart der Muränen und die berühmten Falerner- und Chierweine nicht fehlten. Außer dieser allgemeinen Speisung beschenkte er noch 50000 arme Bürger mit Getreide und Öl und je 60 Mark an Geld. Von seinen Kriegern bekam jeder gemeine Soldat 3000 Mark, ein Hauptmann das Doppelte, ein Oberst das Dreifache.
Während Cäsar noch damit beschäftigt war durch eine Reihe von Gesetzen und Anordnungen die Ruhe und Ordnung des tief erschütterten Staates herzustellen, rief ihn die Besorgnis vor der drohenden Macht der Pompejaner in Spanien zu neuem Kampfe ab. Dort hatten Gnaeus und Sextus, die Söhne des großen Pompejus, wieder ein Heer von dreizehn Legionen gesammelt. Cäsar zog mit acht Legionen gegen diese letzten Verteidiger der Republik, und bei der Stadt Munda kam es zu dem erbittertsten und blutigsten Kampf dieses ganzen Bürgerkrieges (45). Schon schwankten seine Legionen und das Glück schien ihn zu verlassen; schon focht er, wie er später gestand, mehr um sein Leben als um den Sieg. Da sprang er vom Pferde und warf sich, entblößten Hauptes um von den Seinigen erkannt zu werden, und mit den Worten: „Wollt ihr mich diesen Knaben überliefern?“ in die vordersten Reihen. So hitzig focht er, daß viele unter seinen Streichen sanken und sein Schild von mehr als hundert Geschossen durchbohrt wurde, bis er mit seiner zehnten Legion und seiner Reiterei das Gleichgewicht wieder herstellte. Schon neigte sich der Tag, und die Schlacht war noch unentschieden, als Cäsar bemerkte, wie der pompejanische Anführer Labiēnus fünf Kohorten zum Schutze seines Lagers absandte, und im Augenblick rief er: „Seht, die Feinde fliehen!“ Dies glückliche Wort, das schnell durch die Reihen lief, erhöhte den Mut der Seinen so sehr, daß sie mit hellem Siegesrufe vordrangen und die Pompejaner, bestürzt durch die plötzliche Wendung, nun wirklich die Flucht ergriffen. Nun erst begann, wie gewöhnlich in jenen Zeiten, das eigentliche Gemetzel unter den aufgelösten Scharen der Besiegten. Über 33000 Erschlagene bedeckten das Schlachtfeld. Gnaeus Pompejus fiel auf der Flucht, als er eben die Küste erreicht hatte und Spanien verlassen wollte. Nur sein Bruder Sextus, der der Schlacht nicht beigewohnt hatte, blieb allein von den Häuptern der pompejanischen Partei am Leben.
Dieser Sieg machte dem Bürgerkrieg, der 170000 Menschen hingerafft hatte, ein Ende. Als Cäsar nach Rom zurückkehrte, überhäufte ihn der Senat mit neuen Ehren, wie sie noch nie einem Römer zuteil geworden waren. Er erhielt den Titel Imperator oder Oberbefehlshaber der gesamten Kriegsmacht, und dieser Titel wurde ihm auf Lebenszeit beigelegt und sollte auch auf seine Nachkommen forterben können; ebenso ward er[S. 172] auf zehn Jahre Konsul, auf Lebensdauer Diktator, „Vater des Vaterlandes“, „Befreier“ ward er genannt, und unter einem der zahlreichen Standbilder, die man ihm errichtete, war geschrieben: „Dem unbesiegten Gotte“. So war er denn in Wahrheit Alleinherrscher des römischen Reiches, wenn ihm auch dieser Name fehlte, und als solcher suchte er die Erinnerung an die Zeit der freien Republik im Volke allmählich auszulöschen, und die Amtswürden des herrschenden Adels sanken zu bloßen Titeln herab. Er vermehrte den Senat auf 900 Mitglieder, von denen er die Hälfte selbst ernannte; bei der Wahl der andern Hälfte nahm das Volk auf seine Vorschläge Rücksicht. Auch ein neues Forum legte er an, und errichtete daselbst der Venus Victrix, der „siegreichen Venus“, die er als Stammmutter seines Geschlechts ausgab, einen herrlichen Tempel. Auf die Einweihung dieses Tempels folgten glänzende Volksspiele: in einem künstlichen See wurden Schiffsgefechte geliefert, im Circus wurden 400 Löwen gejagt, wilde Stiere erlegt und endlich eine förmliche Landschlacht dargestellt.
Um die Verwaltung des Staates und der Provinzen, die von Grund auf neu zu ordnen war, erwarb Cäsar sich große Verdienste. Neben vielen anderen Gesetzen dieser Art ist besonders zu nennen die gründliche Verbesserung des römischen Kalenders, die er mit Hilfe des alexandrinischen Mathematikers Sosígenes durchführte. Es war darin eine solche Verwirrung eingerissen, daß damals die Abweichung der Monats- und Tagesrechnung von der wahren Zeit bereits 67 Tage betrug und sich die Feste um ebensoviel Tage aus ihrer ursprünglichen Lage verschoben. Die Ursache lag darin, daß man sich dabei nicht nach dem Laufe der Sonne und der Dauer des Sonnenjahres, sondern nach den Mondumläufen richtete, deren zwölf ein Jahr von 354 anstatt von 365 Tagen ergaben. Und doch hatten schon längst die Ägyptier das Jahr nach dem Sonnenlaufe auf 365 Tage 6 Stunden festgesetzt, während die Griechen und Römer noch immer ihre Jahresrechnung auf den Mondlauf gründeten und dadurch zu ungleichen Einschaltungen genötigt waren. Der neue, dem ägyptischen nachgebildete Kalender, der nach seinem Urheber der julianische genannt wird, machte allen diesen Ungleichheiten und Schwankungen ein heilsames Ende. Zwar war auch er noch nicht ganz der wirklichen Zeit entsprechend. Denn indem er dem[S. 173] Jahre 365 Tage und jedem vierten Jahre mit einem Schalttage 366 gab, wich er von der wahren Jahreslänge des Sonnenumlaufs um ein Zuviel von mehreren Minuten ab, ein Fehler, der im Laufe der folgenden Jahrhunderte auf etwa 10 Tage anwuchs und erst durch den gregorianischen Kalender (1582 n. Chr.) ausgeglichen wurde. Auch verlegte Cäsar den Anfang des Kalenderjahres vom 1. März auf den 1. Januar. Die Namen der römischen Monate behielt er bei, nur daß durch Senatsbeschluß der bisherige Quinctīlis dem Cäsar zu Ehren fortan Julius genannt wurde.
Doch so sehr auch Cäsar seine Feinde durch Milde und Gnade gewonnen zu haben glaubte, so große Verdienste er sich um die Vergrößerung und den Ruhm des Staates erworben hatte, so vermochte er doch nicht den tiefen Haß aller derjenigen zu versöhnen, welche bisher gewohnt waren den Staat zu regieren und zu ihren Vorteilen auszubeuten. Auch schonte er nicht in allem seinem Tun die ehrwürdigen alten Überlieferungen der Republik, an denen das Volk mit zäher Beharrlichkeit hing. Nicht zufrieden mit königlicher Macht, strebte er auch nach dem königlichen Titel und beleidigte das Volk durch die Äußerung, daß die Republik nur ein leerer Name sei. Seine Freunde beeiferten sich ihm den Titel „König“ zu verschaffen, der den Römern seit der Vertreibung der Könige ein Gegenstand des Abscheus war. Einst bekränzten sie heimlich seine Bildsäule mit dem Diadem, aber die Tribunen rissen es ab und schickten die Täter unter dem Beifall des Volkes ins Gefängnis. Ein anderes Mal mischten einige in den Zuruf des Volkes den Königsgruß, aber die Menge stimmte nicht ein, und Cäsar mußte erklären, er heiße Cäsar, nicht König. An einem Fest trat einst sein Mitkonsul Antonius mit einer Rede auf und wollte ihm dann eine Krone mit den Worten überreichen: „Dies sendet dir das römische Volk durch mich!“ aber das Volk brach in lautes Wehklagen aus, Cäsar wies das Geschenk zurück, und als Antonius fortfuhr ihm knieend das Diadem darzubieten, sagte er: „Nur Jupiter ist König!“ und schickte es auf das Kapitol.
Wenn nun auch diese Versuche, den königlichen Titel zu erhalten, mißlangen, so war doch sein Streben nach der Königswürde unverkennbar. Die Furcht vor der Gewaltherrschaft eines Königs, Cäsars beleidigender Stolz gegen vornehme Römer, der Haß einzelner Großen, die seine unumschränkte[S. 174] Macht nur mit tiefem Ingrimm ertrugen, brachten endlich eine Verschwörung zuwege, deren Zweck war den großen Diktator zu ermorden und die alte Ordnung wieder herzustellen.
Der Plan zu diesem Morde entsprang aus dem finsteren Gemüte des Gajus Cassius, der Cäsars Gnade das Leben verdankte. Er merkte aber bald, daß kein angesehener Mann seinem Anschlage beitreten werde, wenn nicht der damalige erste Prätor Marcus Brutus, Cäsars Liebling, ein wegen seiner reichen Bildung und strenger Sinnesweise hochangesehener Mann, sich seinem Plane anschlösse. Diesen suchte er daher vor allem dafür zu gewinnen. Bald legte er Zettel auf seinen Prätorstuhl mit den Worten: „Brutus, du schläfst!“ — oder „Du bist wahrlich kein Brutus!“ Bald schrieb er an die Bildsäule des alten Brutus, der vorzeiten das Königtum gestürzt und die Freiheit begründet hatte (S. 24): „O daß du noch lebtest, oder daß von deinen Nachkommen einer dir gleich wäre!“ Lange blieb Brutus unentschlossen. Als er endlich der Verschwörung beitrat, wirkte sein Beispiel so mächtig, daß bald sechzig andere, teils begünstigte Freunde Cäsars, teils begnadigte Feinde, sich anschlossen. Es fehlte ihnen nur noch die Gelegenheit zur Ausführung ihres Planes, und diese bot ihnen Cäsar selbst.
Damals, im Jahre 44, trug er sich mit dem großen Gedanken eines Kriegszugs gegen die Parther, um die noch nicht gesühnte Niederlage bei Karrhä (S. 157) an ihnen zu rächen und die Ostgrenzen des Reiches gegen diese mächtigen Feinde zu sichern. Sobald ihm dieses gelungen wäre, gedachte er längs den Küsten des kaspischen Meeres um den Kaukasus herum zu ziehen, in Skythien einzudringen und von da wieder westwärts durch die weiten Gebiete der Sarmaten, Daken, Germanen nach Italien zurückzukehren. Während er zu diesem Zuge die nötigen Anstalten traf, verbreiteten seine Freunde das Gerücht, daß nach einem Spruch der sibyllinischen Bücher (S. 22) die Parther nur von einem König besiegt werden könnten. Darum verlangten sie, daß Cäsar bloß in Italien Diktator heißen, in den Provinzen aber den Königstitel führen sollte. An den Iden des März (15. März, idibus Martiis, denn idus hieß nach römischem Sprachgebrauch der 15. oder 13. Tag eines Monates), sollte über diese Frage im Senate verhandelt werden, und so beschlossen denn die Verschworenen[S. 175] ihn an diesem Tage in der von Pompejus gebauten Kurie (Ratshalle), wohin der Senat berufen war, zu ermorden.
Vergebens warnten ihn drohende Anzeichen. Man fand, wie erzählt wird, eine alte eherne Tafel mit einer griechischen Inschrift, die auf seinen gewaltsamen Tod deutete; in der Nacht vor dem Morde gaben die heiligen Schilde auf dem Kapitol einen klingenden Ton; Cäsars Pferde wollten nicht fressen, und in den Tieren, die er opferte, fand sich kein Herz. Der Seher Spurinna warnte ihn gerade vor den Iden des Märzes. Doch Cäsars großes Herz war der Furcht und Sorge um sein Leben verschlossen. Am Abend des 14. März speiste er bei Lépidus, der als „Reiteroberst“ (magister equitum) dem Diktator als Gehilfe zur Seite stand. Während er dort einige Briefe unterschrieb, warf einer von den Gästen die Frage auf, welcher Tod der beste sei. Cäsar antwortete schnell: „Der unerwartete.“ Die Nacht darauf verbrachte er in großer Unruhe. Aufgeschreckt durch ein plötzliches Geräusch sah er bei hellem Mondlicht die Türen seines Gemachs von selbst geöffnet und hörte seine Gemahlin Calpurnia im Schlafe wehklagen. Ihr träumte, man hätte ihren Gemahl ermordet, und sie halte den Toten weinend in ihren Armen. Als der Morgen kam, bat sie, erschreckt durch diesen Traum, ihren Gemahl inständig zu Hause zu bleiben. Cäsar war bereit ihren Bitten zu willfahren, und gab schon dem Konsul Antonius den Auftrag den versammelten Senat wieder zu entlassen.
Inzwischen warteten bereits in der Kurie des Pompejus die Verschworenen, mit versteckten Dolchen bewaffnet, ungeduldig ihres Opfers, und besorgten schon, da Cäsar nicht kam, ihr Geheimnis wäre verraten. Sie schickten daher den Décimus Brutus, einen vertrauten Freund Cäsars, um sich nach der Ursache seines Säumens zu erkundigen. Cäsar erzählte ihm Calpurnias Traum. Aber Brutus stellte ihm vor, wie unklug es sei, seine Ernennung zum König verschieben zu wollen, bis ein Weib bessere Träume habe, und zog ihn an der Hand mit sich fort.
Noch hätte Cäsar dem Tode entgehen können, denn selbst auf dem Wege nach der Kurie wurde er auf mannigfache Art gewarnt. Kaum hatte er sein Haus verlassen, so drängte sich Artemidōros, ein gelehrter Grieche, zu ihm heran und überreichte ihm eine Schrift, in der die ganze Verschwörung entdeckt war. „Lies diese Schrift“, sprach er eifrig, „lies sie[S. 176] sogleich, sie enthält wichtige Dinge, die dich betreffen.“ Cäsar versuchte sie zu lesen, aber das Gedränge der Menschen um ihn her war zu groß; ungelesen nahm er die Schrift mit in die Kurie. Nicht mehr weit davon sah er den Spurinna und rief ihm lachend zu: „Die Iden des Märzes sind gekommen!“ — „Aber sie sind noch nicht vorüber“, antwortete Spurinna. Ohne sich an das Wort zu kehren, ging Cäsar in die Kurie. An der Tür wurde er noch durch ein Bittgesuch aufgehalten, dann schritt er sorglos zu seinem goldenen Sessel, der am Fuße der Bildsäule des Pompejus stand. Alle Verschworenen standen auf, um ihn zu empfangen; nur Trebonius stand am Eingang der Kurie, um den Konsul Marcus Antonius, den treuesten und kühnsten Anhänger Cäsars, von dessen Körperkraft und Geistesgegenwart alles zu befürchten war, zurückzuhalten.
Kaum hatte sich Cäsar auf seinen Sessel niedergelassen, so drängten sich die Verschworenen an ihn heran. Voran stand Tullius Cimber, um von Cäsar die Begnadigung seines verbannten Bruders zu erbitten. Die Verschworenen unterstützten sein Gesuch. Cäsar aber, unwillig über ihren zudringlichen Eifer, verwies sie auf eine andere Zeit. Da ergriff Cimber die Toga Cäsars und riß sie ihm von den Schultern. „Das ist ja Gewalt!“ schrie Cäsar. In demselben Augenblick stieß der hinter seinen Stuhl getretene Casca mit dem Dolche nach seinem Hals, verwundete ihn aber nur leicht. „Verruchter Casca, was machst du?“ ruft Cäsar und durchbohrt mit seinem silbernen Schreibgriffel des Mörders Arm; aber im Nu stoßen ihm alle Verschworenen ihre Dolche mit solcher Wut in den Leib, daß mehrere von ihnen sich selbst an der Hand verwundeten. Als Cäsar auch den Marcus Brutus unter den Mördern sieht, ruft er klagend aus: „Auch du, mein Sohn!“ und nun sagt er kein Wort mehr, sondern verhüllt sein Haupt und gibt sich ohne Widerstand allen Stößen preis. Von 23 Wunden durchbohrt, von denen aber nur eine tödlich war, sank er an der Bildsäule des Pompejus nieder (44).
Überrascht und entsetzt von dem schaudervollen Auftritt flohen die Senatoren auseinander. Brutus wollte sie anreden, aber niemand hörte auf ihn. Auch das Volk, unter das die Mörder mit dem Rufe der Freiheit traten, floh bestürzt. Eine Zeitlang lag der Ermordete allein in seinem Blute, bis ihn[S. 177] drei Sklaven in einer Sänfte in die Wohnung der Calpurnia trugen.
In Cäsar ging der größte Mann unter, den Rom je hervorgebracht hatte. Er war als Feldherr, Staatsmann und Gesetzgeber ohnegleichen, aber auch hervorragend als Redner, Geschichtsschreiber, Sprachforscher, Mathematiker und Architekt. Auch seine Persönlichkeit und Haltung ließ den geborenen Herrscher erkennen. Seinen von Natur etwas schwächlichen Körper hatte er so abgehärtet, daß er an Ausdauer keinem seiner Krieger nachstand. Er ertrug Hitze und Kälte, Hunger und Durst und alle Beschwerden und Anstrengungen des Krieges. In allen Leibesübungen zeichnete er sich aus und suchte als Reiter, Schwimmer und Fechter seinesgleichen. Seine Soldaten, denen er in jeder Hinsicht als Muster vorleuchtete, verehrten ihn mit abgöttischer Liebe und Treue.
Nachdem die Verschworenen die blutige Tat vollbracht hatten, waren sie durchaus ratlos, was sie nun weiter tun sollten. Sie hatten geglaubt, das Volk würde ihrem Werke der Befreiung zujubeln, begegneten aber fast überall einer feindlichen oder gleichgültigen Stimmung. Denn Cäsar hatte die Menge durch den Glanz seiner Taten und seine freigebige Großmut für sich gewonnen, und die „Freiheit“, welche Brutus und seine vornehmen Genossen gegen Cäsar zu verteidigen schienen, war in Wahrheit nur das bisherige Regiment der Großen und Reichen. Bald sollten die Mörder erfahren, daß sie einen milden Herrscher mit einem furchtbaren Tyrannen vertauscht hatten.
Der Konsul Antonius, ein entschiedener Anhänger Cäsars, der sich in der ersten Bestürzung versteckt hatte, trat nun hervor und beschloß die Rolle des Herrschers, die Cäsar gespielt hatte, selber weiter fortzuführen Er bemächtigte sich heimlich des öffentlichen Schatzes und erhielt von Calpurnia, der Gemahlin des Gemordeten, dessen schriftlichen Nachlaß. In einer Senatssitzung, der auch Antonius beiwohnte, wurde[S. 178] zwar den Mördern Verzeihung bewilligt, aber auch beschlossen, daß Cäsars Anordnungen fortbestehen sollten. In einer zweiten Sitzung wurden sogar den Häuptern der Verschwörung nach einer Anordnung, die Cäsar selbst schon getroffen hatte, die ihnen bestimmten Provinzen zugewiesen: Marcus Brutus erhielt Makedonien, Decimus Brutus das cisalpinische Gallien, und Cassius Syrien.
Bisda hatte Antonius seine herrschsüchtigen Absichten mit großer Schlauheit verborgen; nun aber trat er offener auf, und bei der Leichenfeier Cäsars offenbarte er, was die Mörder von ihm zu erwarten hatten. Um das Volk gegen diese aufzubringen, machte er zuerst das Testament Cäsars bekannt, in dem er dem Volke seine großen parkartigen Gärten jenseits der Tiber zu allgemeinem Gebrauch und jedem einzelnen Bürger 45 Mark vermachte. Dann folgte die Leichenfeier, die den Abscheu des Volkes gegen die Mörder, die ihm seinen Wohltäter entrissen hatten, auf den höchsten Grad steigern sollte.
Auf einem Gerüste, neben der Rednerbühne auf dem Forum, stand eine vergoldete Kapelle, eine Nachbildung des von Cäsar erbauten Venustempels; innerhalb der Kapelle, deren Dach auf Säulen ohne Wände ruhte, war ein mit Elfenbein ausgelegtes, mit Purpurteppichen bedecktes Ruhebett sichtbar. Auf dieses wurde nach vollendetem Trauerzuge der Sarg mit der Leiche, unter dem Wehklagen des Volkes und der Soldaten Cäsars, niedergesetzt. Sodann hielt Antonius eine Rede, worin er Cäsars unsterbliche Taten und Verdienste um Reich und Volk mit überschwenglichen Worten pries, und dann den an ihm verübten greulichen Mord in grellen Farben schilderte, und zugleich, die Augen voll Tränen, das blutige, von Dolchstichen zerstoßene Gewand des Ermordeten emporhob. Dabei stieg ein aus Wachs verfertigtes Bild Cäsars mit den 23 Wunden, unter denen die entstellende Wunde des Gesichts und die tödliche Brustwunde besonders auffielen, aus dem Sarg in die Höhe.
Bei diesem Anblick verwandelte sich das Wehklagen des Volkes in helle Wut gegen die Mörder, und man hätte sie zerrissen, wenn sie sich nicht rechtzeitig entfernt hätten. Als dann das Leichengerüst angezündet wurde, warf jedermann, was ihm an Geräten, Waffen und Schmuck zur Hand war, in das Feuer, das dadurch so gewaltig um sich griff, daß[S. 179] ein Haus in der Nähe in Brand geriet, und eine Feuersbrunst mit Mühe verhütet ward. Kaum konnte Antonius das wütende Volk zurückhalten, das mit Fackeln durch die Straßen der Stadt tobte und die Häuser der Mörder anzünden wollte.
Als Antonius das Volk für sich gewonnen hatte, brachte er es bald dahin, daß ihm der Senat eine Schutzwache bewilligte, die er selbst auf 6000 Mann vermehrte. Im Vertrauen auf diesen Schutz gab er, angeblich aus dem Nachlaß Cäsars, eine Verordnung nach der andern heraus, um sich Anhänger und besonders Geld zu verschaffen. Er verkaufte Ämter und Würden, verhandelte Königreiche und wußte sich dadurch Geld in solcher Menge zu verschaffen, daß er und Fulvia, seine schändliche Gemahlin, zuletzt das Geld nicht mehr zählten, sondern in Masse abwogen. Den Mördern Cäsars nahm er ihre Provinzen, indem er Makedonien, das Marcus Brutus hatte, für sich nahm und Syrien, das dem Cassius bestimmt war, dem Dolabella gab.
Doch auch gegen Antonius erhob sich bald ein Nebenbuhler, der schließlich den Sieg über ihn davontragen sollte.
Dies war der junge Octavius, der damals zu Apollonia in Illyrien sich aufhielt, wo ein Teil der Truppen stand, die Cäsar für den parthischen Krieg bestimmt hatte, und mit denen er an dem Feldzuge teilnehmen sollte. Als Enkel von Cäsars jüngerer Schwester Julia war er im Testamente Cäsars, seines Großoheims, der keinen eigenen Sohn hinterlassen, an Sohnes Statt angenommen und zum Haupterben eingesetzt. Er nannte sich deshalb fortan Gajus Julius Cäsar Octavianus.
Nach dem Tode Cäsars eilte er nach Italien, um sein Erbe anzutreten. Vor den Toren Roms strömten ihm die Freunde und Anhänger Cäsars entgegen. Ein farbiger Ring, der in dieser Stunde die Sonne umgab, ward als ein Zeichen seiner aufgehenden Größe gedeutet. Aber seine Lage war schwierig. Auf der einen Seite drohte ihm die Feindschaft der Mörder, die in ihm den Rächer ihrer Freveltat fürchteten, auf der anderen sperrte ihm die gewalttätige Herrschaft des Antonius den Weg zur höchsten Gewalt. Aber der achtzehnjährige Jüngling verfolgte gleich von Anfang an mit ungewöhnlicher Klugheit und Selbstbeherrschung das Ziel, das er sich steckte, Rache an den Mördern und Besitznahme der ersten Stelle im Staate. Er suchte deshalb zunächst eine enge Ver[S. 180]bindung mit Antonius. Er verlangte von ihm die Herausgabe des Geldes, das Cäsar hinterlassen, um es nach den Bestimmungen des Testamentes unter die Bürger zu verteilen. Dies verweigerte Antonius unter allerlei Vorwänden, und behandelte überhaupt den „jungen Menschen“ mit hochfahrendem Stolze und Geringschätzung. Octavianus, obgleich tief erbittert, vermied es mit dem Gewaltigen zu brechen. Er ließ seine väterlichen Güter versteigern und zahlte aus dem Ertrag die Vermächtnisse aus, mit denen Cäsar das Volk bedacht hatte. Die Folge davon war, daß, während sich Antonius beim Volke verhaßt machte, Octavianus in dessen Gunst stieg, zumal da er nun auch der Menge kostbare Spiele gab. Während dieser Spiele zeigte sich sieben Tage lang am Himmel ein Komet, den Cäsars Partei als seinen Geist deutete, der unter die Götter versetzt sei.
Während Antonius den Senat mit steigender Anmaßung und trotzigem Übermut behandelte, bewies ihm der schlaue Octavianus die größte Ehrerbietung. Unter den alten Soldaten Cäsars hatte er viele Anhänger, die zu Tausenden seinen Fahnen zuströmten. An der Spitze dieser Truppen gelang es ihm den Antonius aus Rom zu verdrängen. Dieser ging, nach dem Ablauf seines Konsulates, in das diesseitige Gallien, welche Provinz er dem Decimus Brutus entreißen wollte; aber von den beiden neuen Konsuln und Octavianus bei Mútina (Módena) geschlagen, mußte er ins jenseitige Gallien fliehen (43).
Als die nächste Sorge vor Antonius vorüber war, glaubte der Senat den Octavianus entbehren zu können und begann ihn mit Kälte zu behandeln. Aber dieser wandte sich an seine treuen Legionen und stellte ihnen vor, daß ihnen in Rom der Lohn ihrer Taten verweigert würde. Da sandten die Truppen aus ihrer Mitte Abgeordnete an den Senat und forderten für Octavianus das Konsulat. Als man dies abschlug, rief einer der Abgeordneten, an sein Schwert schlagend: „Dieses wirds ihm geben!“ worauf Cicero erwiderte: „Wenn das bitten heißt, so wird man es ihm gewähren müssen.“ Nach dieser Weigerung des Senats rückte Octavianus mit acht Legionen gegen Rom vor, wo das Volk ihn mit Jubel aufnahm und der Senat sich in alle seine Forderungen fügen mußte. Seine Soldaten belohnte Octavianus aus dem öffentlichen Schatze; dann ließ er sich zum Konsul wählen und das Verbannungs[S. 181]urteil über Cäsars Mörder aussprechen. Um aber nachdrücklich an ihnen Rache nehmen zu können, hielt er es für zweckmäßig sich wieder mit Antonius zu verbinden.
Dieser hatte sich inzwischen in Gallien mit Lépidus vereinigt und eine Macht von 23 Legionen und 10000 Reitern zusammengebracht. Octavianus zog beiden entgegen, und Antonius ergriff die dargebotene Hand zu einer Vereinigung. Sie wählten eine kleine Insel auf dem Flusse Rhenus, unweit Bononia (Bologna) zum Orte ihrer Zusammenkunft. Beide Parteien, Antonius und Lepidus einerseits und Octavianus anderseits, rückten mit fünf Legionen an die Ufer dieses Flusses und schlugen von beiden Seiten eine Brücke nach der Insel zu. Lepidus, ein gemeinschaftlicher Freund der beiden andern, ging zuerst hinüber, um ihre Sicherheit zu prüfen; dann kamen auf ein gegebenes Zeichen Octavianus und Antonius, jeder mit 300 Mann, herbei. Diese blieben am Ende der Brücken zurück; sie selbst aber gingen auf eine Anhöhe, wo sie von ihren beiderseitigen Heeren gesehen werden konnten. Als sie beisammen waren, durchsuchten sie erst ihre Kleider, aus Furcht, daß irgend einer einen Dolch bei sich tragen möchte. Dann setzten sie sich nieder, um den Plan ihres Bündnisses zu entwerfen. Die Verhandlung dauerte drei Tage. Endlich kam nach manchem heftigen Streit ein Vergleich zustande. Der erste Punkt desselben betraf die höchste Gewalt im Staate; diese sollten alle drei gemeinschaftlich fünf Jahre lang ausüben unter dem Titel „Triumvirn zur Einrichtung des Gemeinwesens“. Dann verteilten sie die Provinzen unter sich; Italien als das gemeinsame Mutterland und die morgenländischen Provinzen, die damals noch Brutus und Cassius innehatten, wurden von dieser Teilung ausgenommen. Die Abendländer aber wurden auf folgende Art verteilt: Octavianus bekam Afrika, Sicilien und Sardinien, Antonius das diesseitige und jenseitige Gallien, Lepidus Spanien und einen Teil des jenseitigen Galliens. Hierauf verteilten sie die Geschäfte unter sich. Octavianus und Antonius sollten jeder mit zwanzig Legionen vereinigt den Krieg gegen Cäsars Mörder, namentlich gegen Brutus und Cassius, führen, während Lepidus als Konsul des nächsten Jahres (42) mit drei Legionen Rom und Italien in Gehorsam halten sollte. Der vierte Punkt ihrer Verabredung betraf die Belohnung der Legionen. Die Triumvirn machten aus, daß, nach Beendigung des Kampfes[S. 182] im Osten, achtzehn Städte in den reichsten und blühendsten Gegenden Italiens als Kolonien unter die Soldaten verteilt werden sollten, denen sie übrigens noch ansehnliche Geschenke baren Geldes versprachen. Zur Ausführung aller dieser Pläne brauchten sie unermeßliche Geldsummen, zu denen ihnen die Achtserklärung (Proskription) ihrer Gegner die Mittel liefern sollte. 300 Senatoren und 2000 Ritter wurden von der Ächtung betroffen, von denen jeder Triumvir einen Teil vorschlug und dabei selbst seine eigenen Freunde und Anhänger dem Haß der beiden andern preisgeben mußte. Endlich verpflichteten sich die Triumvirn zur Erfüllung dieses Vertrages durch einen feierlichen Eid und kehrten mit ihren Legionen nach Rom zurück, wo alsbald die Ächtungen ihren Anfang nahmen.
Überall in Italien wüteten Verrat und Mord; nur wenige der Geächteten retteten sich durch die Flucht, die meisten wurden von den Verfolgern ereilt, ihre Köpfe auf der Rednerbühne ausgestellt. Jedem Freien wurde der Kopf eines Verurteilten mit 12000, jedem Sklaven mit beinahe 6000 Mark bezahlt; die Angeber erhielten den gleichen Lohn; der Tod traf den, der einen Geächteten verbarg. Die Schreckenszeit Sullas kehrte wieder, aber die Zahl der Opfer war noch größer.
Unter den Opfern dieser Proskriptionen befand sich auch der große Redner Cicero, der einst, zur Zeit der Verschwörung des Catilina, sein Vaterland gerettet hatte. Er hatte sich den Antonius dadurch zu einem unerbittlichen Feinde gemacht, daß er gegen dessen eigenmächtiges und gewalttätiges Auftreten seine berühmten „philippischen Reden“ (Philippicae) hielt, und Octavian, von dem er bisher wie ein Vater verehrt worden war, hatte ihn herzlos dem Hasse des Verbündeten geopfert. Als die Listen der Geächteten in Rom bekannt wurden, auf denen auch sein Name stand, befand sich Cicero auf einem seiner Landgüter. Um sich zu retten, beschloß er nach Makedonien zu Marcus Brutus zu fliehen, allein körperliche Schwäche, Ängstlichkeit und Unentschlossenheit hinderten ihn an der Ausführung seines Entschlusses; zweimal ging er zu Schiffe und zweimal landete er wieder. Endlich drängten ihn seine Diener, die schon einen Haufen Soldaten gesehen hatten, welche nach ihrem Herrn spähten, die Flucht fortzusetzen. In einer Sänfte trugen sie ihn zur Küste. Aber mitten auf dem Wege begegneten sie den Häschern. Da Cicero sah, daß er nicht[S. 183] entrinnen konnte, ließ er die Sänfte niedersetzen und steckte den Kopf hinaus. An der Spitze der Soldaten stand Popilius Länas, ein Kriegstribun, dem Ciceros Beredsamkeit einst vor Gericht das Leben gerettet hatte. Eben dieser Mann eilte seinen Leuten zuvor, um selber den Blutlohn zu verdienen, und schlug seinem greisen Wohltäter, nach dem besonderen Auftrage des Antonius, des Todfeindes Ciceros, nicht nur das Haupt ab, sondern auch die Hände, mit denen er den Vortrag seiner Reden eindrucksvoll zu begleiten pflegte. Dies geschah am 7. Dezember des Jahres 43. Das abgehauene Haupt wurde dem Antonius überbracht, und nachdem Fulvia in ihrer Rachsucht die Zunge mit ihren Haarnadeln durchstochen hatte, nebst den Händen auf derselben Rednerbühne am Forum ausgestellt, wo Cicero so oft das Volk zu stürmischem Beifall hingerissen hatte. Er stand erst im 64. Lebensjahre.
Nachdem sich die Triumvirn auf so blutige und habgierige Weise eines großen Teiles ihrer Gegner im Senat und in der Ritterschaft entledigt hatten, beschlossen Octavianus und Antonius gegen Brutus und Cassius zu Felde zu ziehen, die inzwischen in Makedonien und Asien eine große Streitmacht und alle noch übrigen Anhänger der Republik um sich gesammelt hatten. Als diese von dem nahen Anzuge der beiden Triumvirn hörten, eilte Brutus nach Asien, um gemeinschaftlich mit Cassius über die Führung des Krieges zu beraten. Bei dieser Gelegenheit war es, wo, wie man sagt, dem Brutus ein Gespenst erschien. Einst saß er nämlich, wie er gewohnt war, bis tief in die Nacht in seinem Zelte, beschäftigt mit den Gedanken an den ungewissen Ausgang des bevorstehenden Krieges. Seine Diener schliefen, das Licht brannte düster, nichts regte sich, er war allein. Da hörte er plötzlich ein Geräusch; die Zelttür öffnet sich, und eine gespenstische Gestalt tritt auf ihn zu, ohne zu reden. Brutus richtet sich erschrocken auf und fragt: „Wer bist du, ein Gott oder ein Mensch, und was begehrst du?“ — „Ich bin dein böser Geist,“ antwortet die Gestalt, „bei Philippi sehen wir uns wieder.“ Furchtlos erwiderte Brutus: „Wohl, ich werde dich dort wiedersehen!“ Da verschwand die Gestalt. Gleich darauf rief Brutus seine Diener und fragte sie, ob sie etwas gesehen oder gehört hätten. Sie verneinten beides. Sobald der Morgen graute, ging Brutus zum Cassius und erzählte ihm den Vorfall der ver[S. 184]gangenen Nacht. Cassius, der nicht an die Wirklichkeit eines Gespenstes glauben mochte, suchte sich die Erscheinung aus der erregten Gemütsstimmung seines Freundes zu erklären.
Von Sardis aus, wo sie ihre Legionen vereinigt hatten, brachen Brutus und Cassius nach dem Hellespont auf und setzten nach Thrakien über, wo bereits acht Legionen der Triumvirn standen. Bald kamen diese mit ihrer gesamten Macht hinzu und nötigten die Gegner, welche bei Philippi ein festes Lager bezogen hatten, zur Schlacht. Es kam dort zu einer Doppelschlacht, die aber den ganzen Krieg entscheiden sollte; sie endete mit der Niederlage der Mörder Cäsars (42). Die Triumvirn befehligten ein Heer von 100000 Mann zu Fuß und 13000 Reiter, ihre Gegner 80000 Mann zu Fuß und 20000 Reiter. Auf beiden Seiten siegten die rechten Flügel; Brutus drang siegreich vor und eroberte das Lager des Octavianus, der sich damals wegen Krankheit aus dem Lager entfernt hatte; dagegen schlug Antonius den Cassius vollständig zurück. Der geschlagene Cassius wußte noch nichts von des Brutus Sieg, als dieser eine Abteilung Reiter mit der Siegesbotschaft absandte. Cassius hielt sie in der Dunkelheit für Feinde und glaubte schon die Seinigen gefangen; da ließ er, um der Gefangenschaft zu entgehen, sich durch einen Sklaven töten. Als Brutus von seinem Tode hörte, rief er unter Tränen aus: „So ist der letzte Römer gefallen!“
Nach dieser Schlacht beschloß Brutus ein zweites Treffen zu vermeiden und sich in seiner vorteilhaften Stellung zu behaupten. Allein der Ungestüm seiner Soldaten, der weder durch Bitten noch durch Geschenke und Versprechungen zu bändigen war, forderte eine Schlacht, und so kam es denn ungefähr zwanzig Tage nach dem ersten zu einem zweiten Treffen bei Philippi. In der Nacht vor dieser Schlacht soll dem Brutus dieselbe Gestalt erschienen sein, die sich ihm vor seinem Übergange über den Hellespont gezeigt hatte; stumm ging sie diesmal vor ihm vorüber und verschwand.
Auch dieses zweite Treffen entschied gegen Brutus. Von beiden Seiten ward mit der größten Erbitterung gestritten; abermals drang Brutus in das Lager des Octavianus, da sprengte Antonius die Mitte des ihm gegenüberstehenden Flügels und trieb die Feinde in ihr Lager zurück. Dadurch bekam Octavianus Luft, drang auch wieder vor und half den Sieg vollenden.
Brutus wandte sich mit vier Legionen nach dem Gebirge und hoffte in der einbrechenden Dunkelheit zu entkommen, aber alle Ausgänge waren schon besetzt. Da seine Legionen keine Lust zeigten sich durchzuschlagen, gab er alle Hoffnung auf und stürzte sich in sein Schwert. Seine Truppen streckten die Waffen. Seine Gemahlin Porcia folgte ihm in den Tod, indem sie durch den Dunst glühender Kohlen ihr Leben endete.
Nach diesen Siegen nahmen die beiden Triumvirn eine neue Teilung des Reiches unter sich vor, wobei Octavianus den Westen, Antonius den Osten erhielt. Lepidus, der wegen seiner Unbedeutendheit von den beiden andern verachtet wurde, mußte sich mit der Provinz Afrika abfinden lassen.
In Kleinasien überließ Antonius sich ganz und gar seinem maßlosen Hange zur Schwelgerei, mit der er ungeheure Reichtümer in kurzer Zeit verschwendete. Einst schenkte er einem Zitherspieler die Steuern von vier Städten, und Köchen gab er für ein gutes Gericht reiche Häuser und Güter. Seine Lust an ausschweifenden Genüssen erreichte aber den höchsten Grad, als es der ägyptischen Königin Kleópatra gelungen war ihn, wie einst den Cäsar, in ihre Netze zu ziehen.
Diese Königin hatte es mit Brutus und Cassius gehalten und wurde deshalb von Antonius zur Rechenschaft gezogen. Sie kam, aber nicht als Angeklagte, sondern, um Antonius durch ihre Reize zu gewinnen, in dem Aufzuge der Göttin Venus. Auf einem vergoldeten Schiffe mit silbernen Rudern und purpurnen Segeln fuhr sie an der Küste Ciliciens, bei der Stadt Tarsos, den Kydnosfluß herauf. Als Venus gekleidet, saß sie in der Blüte der Schönheit unter einem goldgewirkten Zelte; zierliche Knaben als Liebesgötter fächelten ihr Kühlung zu, schöne Jungfrauen bedienten sie, während andere als Meergöttinnen die Ruder unter dem Klange von Flöten und Harfen bewegten, und angezündetes Räucherwerk den lieblichsten Duft verbreitete. Anstatt vor Antonius zu erscheinen, lud sie ihn zu sich zum Mahle. Er kam, und von dieser Zeit an lebte er mit Kleopatra in einem steten Taumel von Lüsten und ließ sogar die Parther ungestraft in Syrien einbrechen.
Durch solche Aufführung gab Antonius gegründeten Anlaß zu Klagen und Beschwerden, und sein Verhältnis zu Octavianus, das nie aufrichtig gewesen war, da jeder nur den[S. 186] andern zu verdrängen und sich zum Alleinherrscher zu machen suchte, wurde immer gespannter und feindseliger. Nur die Vermählung des Antonius mit des Octavianus tugendhafter Schwester Octavia vermochte die Eintracht auf kurze Zeit wieder herzustellen.
Während Antonius die Zeit am üppigen Hofe Kleopatras vergeudete, war Octavianus in rastloser Tätigkeit. Sextus Pompejus, der Sohn des großen Pompejus, Octavians tüchtigster Helfer in Krieg und Frieden, der an der Spitze einer Piratenflotte Italien und das westliche Meer jahrelang beunruhigte, ward endlich von Agrippa in der Seeschlacht bei Messāna völlig besiegt und zur Flucht nach Asien gezwungen, wo er gefangen und hingerichtet wurde. Auch den unbedeutenden Lepidus wußte Octavianus auf die Seite zu schieben, als dieser an der Spitze von zwanzig Legionen Sicilien verlangte. Er ging nach Messana und begab sich in das Lager des Lepidus, wo es ihm bald gelang dessen Heer abwendig zu machen. Als nun Lepidus sah, wie sein ganzes Heer zu Octavianus überging, warf er sich diesem zu Füßen und flehte um Gnade. Octavianus verachtete ihn zu sehr; er schenkte ihm Leben und Freiheit und ließ ihm die Würde des Oberpriesters bis an sein Lebensende.
Nun war das Triumvirat zu einem Duumvirat geworden; aber auch die Verbindung zwischen Octavianus und Antonius eilte ihrer Auflösung entgegen und verwandelte sich bald in offenen Bürgerkrieg. Die Veranlassung dazu war, daß Antonius, der mit Kleopatra fortwährend ein schwelgerisches Leben führte, seine edle Gemahlin Octavia verstieß. Da erklärte der Senat den Krieg gegen Kleopatra, der Antonius natürlich Beistand leistete. Dieser Krieg wurde durch die Schlacht bei Aktium (am Eingange des Meerbusens von Arta) entschieden (31 v. Chr., am 2. September), und dadurch der Untergang der Republik in eine Monarchie eingeleitet, an deren Spitze der Sieger, Cäsar, trat.
Die Kriegsmacht des Antonius bestand aus 100000 Mann zu Fuß nebst 12000 Reitern, sowie aus einer Flotte von 500 Schiffen, die von ungewöhnlicher Größe und deshalb für den Kampf in engen Gewässern zu schwerfällig waren. Octavians Landheer betrug 80000 Mann zu Fuß mit 12000 Reiter, und seine Flotte bestand aus 250 kleinen Schiffen, die aber leicht beweglich und trefflich bemannt waren. Vor allem kam[S. 187] es ihm sehr zustatten, daß der bewährte Seeheld Agrippa sie befehligte. Des Antonius Schiffe bildeten einen dichten Wall, den die Feinde lange Zeit vergeblich zu durchbrechen suchten. Endlich gelang es doch und es entstand eine Öffnung in die Octavians Schiffe eindrangen. Bei diesem Anblick fuhr Kleopatra, die mit ihren Schiffen hinter der Schlachtreihe gehalten hatte, davon, und Antonius, der ihr Schiff an dem Purpursegel erkannte, segelte ihr eiligst nach. Die Flotte kämpfte noch fort; zuletzt aber mußten sich die Schiffe, ihres Führers beraubt, ergeben. Das dem Antonius treu ergebene Landheer wartete noch sieben Tage auf seine Rückkehr, dann streckte es auch die Waffen und ergab sich dem Sieger. Dieser gründete später an der Stelle, wo sein Lager gestanden hatte, zu dauernder Erinnerung an den entscheidenden Sieg, die Stadt Nikópolis (Siegstadt) und stiftete in Rom zu jährlicher Feier die Aktischen Kampfspiele.
Im folgenden Jahre zog Octavianus gegen Ägypten, wo Antonius und Kleopatra ihr üppiges Leben fortgeführt hatten. Von allen seinen Truppen verlassen, empfing jetzt Antonius von der Königin, die sich seiner zu entledigen wünschte, die Nachricht, sie habe sich getötet. Da wollte auch er nicht länger leben und durchbohrte sich mit seinem Schwert. Als er aber, in seinem Blute liegend, hörte, daß sie noch lebte, verlangte er zu ihr gebracht zu werden. An Stricken wurde er in das obere Stock des Grabgebäudes hinaufgezogen, in das sie sich begeben hatte, und starb in ihren Armen. Nun versuchte die listige Kleopatra auch den siegreichen Cäsar durch ihre Reize zu berücken. Als ihr dies nicht gelang und er merken ließ, daß er sie zu seinem Triumph aufspare, beschloß sie zu sterben. Man fand sie entseelt auf einem Ruhebette liegend, im königlichen Schmuck; an ihrem Arme wollte man feine Stiche bemerken, die entweder von Nadeln oder von giftigen Nattern herrührten. Octavianus ließ sie mit königlichen Ehren bestatten.
Der Sieger machte Ägypten zu einer römischen Provinz und feierte nach seiner Rückkehr in Rom einen dreifachen Triumph (29). Er bezahlte seine Schulden, belohnte seine Krieger mit Land und Geld, und suchte auch das Volk durch reiche Gaben für seine neue Herrschaft zu gewinnen.
Wenngleich nun Octavianus durch die Siege über alle seine Gegner und an der Spitze eines erprobten und unbedingt ergebenen Heeres der wirkliche Beherrscher des römischen Reiches war, so war er klug genug die bisherigen Rechte des Senates und des Volkes wenigstens der Form nach bestehen zu lassen, und mit dem Senat eine Verfassung zu vereinbaren, die ihm selbst zwar nicht den Namen, aber die Gewalt eines wirklichen Monarchen verlieh. Anfangs zwar hatte er im Senate erklärt die Obergewalt niederlegen zu wollen, aber nur zum Schein. Der Senat, den er von allen unwürdigen oder feindlich gesinnten Mitgliedern gereinigt und auf die Zahl von 600 Senatoren beschränkt hatte, war auf dieses Gaukelspiel vorbereitet; er drang mit Bitten in ihn die Regierung doch länger zu behalten und Oberhaupt des Reiches zu bleiben. Lange sträubte sich Octavianus, endlich versprach er, auf inständiges Bitten der Senatoren, die Regierung über den Staat auf zehn Jahre weiter zu übernehmen. Dieses Spiel, wobei er sich seine Macht alle zehn oder fünf Jahre erneuern ließ und sie mit scheinbarem Widerstreben annahm, wiederholte Augustus in der Folge noch mehrmals. So schien es, als habe er die Alleinherrschaft nicht in gewaltsamer Weise an sich gerissen, sondern auf gesetzmäßigem Wege erlangt. Die Würden und Ämter der Republik ließ er zwar bestehen, wußte aber alle mit ihnen verbundene Gewalt auf sich zu übertragen. Als Imperator führte er allein den Oberbefehl über die bewaffnete Macht; als dauernder Inhaber der tribunicischen Amtsbefugnis (tribunicia potestas) hatte er allein das Recht das Volk zu versammeln und ihm Gesetze vorzuschlagen und wurde persönlich unverletzlich; als erstes und vornehmstes Mitglied des Senates (princeps senatus) hatte er die erste und maßgebende Stimme bei allen Beschlüssen dieses höchsten Staatsrates. Als diese neue Ordnung nach längeren Verhandlungen am 1. Januar 27 in Kraft trat, erhielt er vom Senat und Volk den Beinamen Augustus (der Erhabene) und wurde damit als erhaben über alle Bürger[S. 189] und göttlicher Verehrung würdig feierlich anerkannt. Er besaß überdies die Würde des Oberpriesters (póntifex maximus) und übernahm wiederholt das Amt des Konsuls. Der Monat Sextīlis erhielt ihm zu Ehren den Namen Augustus. So kam er in den Besitz einer unumschränkten Macht, seine Person war heilig und unverletzlich und den jährlichen Konsuln blieb wenig mehr als die damit verbundene äußere Würde und Ehre. Auch das Volk behielt noch seine Versammlungen, lernte aber unter Festen, Spielen und Getreidespenden seine Freiheit vergessen.
Unter Augustus war das römische Reich zu einer ungeheuren Ausdehnung gelangt, die fast alle Länder des damals bekannten Erdkreises umfaßte. Außer Italien gehörten dazu Gallien, Spanien, Griechenland, Makedonien, Thrakien, Kleinasien, Syrien, Ägypten und die ganze Nordküste Afrikas bis zur Grenze Mauretaniens. Alle diese Völker erkannten Roms Oberherrschaft an, nur die Parther im Osten und die Stämme der Germanen hatten sich noch nicht unter das römische Joch gebeugt. Die Statthalter dieser Provinzen, Prokonsuln oder Proprätoren, wurden teils von Augustus, teils vom Senat ernannt. An Stelle der alten Bürgerheere waren allmählich Söldnertruppen getreten, die von nun an zu stehenden Heeren wurden und an den von Feinden gefährdeten Grenzen, besonders am Rhein, an der Donau und am Euphrat ihre dauernden Lager hatten. Im ganzen unterhielt das Reich etwa 25 Legionen von je 6–7000 Mann. Außerdem standen in und bei Rom 9000 Mann als Leibgarde des Herrschers, die sog. prätorischen Kohorten, die zum Teil aus Germanen bestanden. Zwei mächtige Flotten sicherten das Meer, von denen die eine bei Ravenna im adriatischen, die andere bei Misēnum, nahe bei Neapel, ihren Standort hatte.
Nachdem sich Augustus in seiner Macht befestigt hatte, war sein Streben darauf gerichtet, durch die Wohltaten eines ungestörten Friedens die Greuel der Bürgerkriege und seine eigenen Grausamkeiten in Vergessenheit zu bringen. Die Bevölkerung des weiten Reiches begann sich, dank einer umsichtigen und gerechten Verwaltung, von den Leiden der langen verwüstenden Kriege zu erholen; Ackerbau, Gewerbe, Handel blühten auf, und mit dem steigenden Wohlstand gediehen auch wieder die Künste und Wissenschaften. Die Stadt Rom verschönerte er durch Aufführung der prachtvollsten Bauten so sehr, daß er sich mit Recht rühmen konnte, er habe das aus[S. 190] Backsteinen gebaute Rom in ein marmornes verwandelt. In den Werken der Baukunst wetteiferte mit ihm der edle Agrippa, sein Feldherr, Berater und Schwiegersohn; er erbaute unter andern prachtvolle Bäder und inmitten derselben einen riesigen Kuppeltempel, das Pantheon, so genannt, weil er dem Dienste aller Götter zusammen geweiht wurde. Außer Agrippa war es besonders der kunstliebende Mäcēnas, der Berater und Freund des Kaisers, der Gelehrte, Geschichtsschreiber und Dichter unterstützte und ihre Werke belohnte. Dieser Kreis von hochgebildeten Männern, der den Hof des Kaisers umgab, hat besonders dazu beigetragen, dem augustinischen Zeitalter den Charakter einer Hochblüte der römischen Literatur und Kunst zu verleihen.
Obschon sich Italien unter Augustus des tiefsten Friedens erfreute, der nach den zerrüttenden Bürgerkriegen dem erschöpften Lande die größte Wohltat gewährte, so gemahnten doch einige Verschwörungen, die gegen des Augustus Leben gerichtet waren, diesen an das Schicksal seines Großoheims Cäsar. Um so mehr war er darauf bedacht allen Schein des Machthabers von sich zu entfernen und in allen seinen Handlungen Mäßigung und Leutseligkeit zu beweisen. Den Senat behandelte er mit der größten Achtung; in der Stadt sah man ihn nur in der Tracht eines Senators, ohne daß irgend eine Auszeichnung an den weltgebietenden Imperator erinnerte. Bei der Rückkehr von einer Reise vermied er alles Aufsehen und hielt seinen Einzug gewöhnlich zur Nachtzeit. Er bewohnte ein einfaches Haus auf dem palatinischen Hügel; erst als dieses abgebrannt war, erbaute er das sogenannte Palatium, wovon das Wort Palast zur Bezeichnung fürstlicher Wohnungen abstammt. Es bleibt freilich zweifelhaft, ob die Tugenden, die Augustus als Kaiser entfaltete, in seinem Charakter begründet, oder eine Folge kluger Berechnung und des heilsamen Rates seiner Freunde waren. Soviel aber ist gewiß, daß ihn das Volk als seinen Wohltäter liebte, weshalb seine Zeitgenossen von ihm sagten: „Augustus hätte entweder nie sterben oder nie geboren werden sollen!“
Der viel gepriesene Beherrscher des Reiches mußte, wie um die Unbeständigkeit alles Menschenglückes zu bestätigen, in seiner Familie schweren Kummer und Herzeleid erfahren. Seine einzige Tochter Julia aus seiner dritten Ehe führte[S. 191] ein lasterhaftes Leben, und seine vierte Gemahlin Livia, die ihm zwei Stiefsöhne, den Tiberius und Drusus, zubrachte, ward für ihn die Ursache mancher häuslichen Sorgen. Die Nachfolge in der Regierung hatte er dem Marcellus, einem hoffnungsvollen Jüngling, dem Sohne seiner Schwester Octavia aus ihrer ersten Ehe und Gemahl der Julia, zugedacht, aber der Tod raffte diesen in der Blüte seiner Jahre dahin. Auch zwei Enkel aus der zweiten Ehe der Julia mit Agrippa sah der Kaiser vor sich ins Grab sinken, während ein dritter, Agrippa Pósthumus, ihn zwar überlebte, aber blödsinnig und zur Nachfolge unfähig war. So schwand ihm die Hoffnung die Herrschaft in seinem eigenen Geschlechte zu erhalten. Er nahm deshalb seinen Stiefsohn Tiberius, den älteren Sohn der Livia aus ihrer früheren Ehe mit Tiberius Claudius Nero, an Sohnes statt an, und erfüllte damit einen von Livia lange gehegten und eifrig betriebenen Plan. Tiberius war ein im Krieg und Staatsgeschäften rühmlich bewährter Mann, und da er zugleich auf Wunsch des Augustus die Julia, nach dem Tode ihres zweiten Gatten Agrippa, geheiratet hatte, so stand jetzt niemand der Thronfolge näher.
Inzwischen hatten Alter und häusliches Unglück die Kräfte des Kaisers aufgerieben. Um seine zerrüttete Gesundheit wieder zu stärken, unternahm er eine Reise nach Campanien. Anfangs war er ungemein munter, bald aber nahm die Schwäche seines Körpers zu, und er beschloß nach Rom zurückzukehren. Doch schon zu Nola in Campanien ereilte ihn der Tod. Als er sein Ende herannahen fühlte, forderte er einen Spiegel, ließ seine Haare in Ordnung bringen und seine gerunzelten Wangen glätten. Dann fragte er seine umstehenden Freunde: „Was dünkt euch, habe ich die Rolle meines Lebens gut gespielt?“ Als sie dies bejahten, fuhr er fort: „Nun, so klatscht Beifall, denn sie ist ausgespielt!“ Darauf verschied er, am 18. August, im 76. Jahre seines Lebens und im 41. seiner Regierung (14 n. Chr.). Sein Leiche ward nach Rom gebracht und daselbst feierlichst bestattet.
Das Land der Germanen war zu den Zeiten des Kaisers Augustus im Norden von der Nord- und Ostsee, im Osten von der Weichsel und den Karpathen, im Süden von der[S. 192] Donau und im Westen vom Rhein begrenzt. Das Land war rauh und von undurchdringlichen Waldungen durchzogen. Der magere Boden trug nur Gerste, Hafer und Hanf. In den Urwäldern hauste zahlreiches Wild, Auerochsen, Renn- und Elentiere, Bären und Wölfe; auf den Felsen horsteten Adler und Falken. Die Bewohner dieses Landes, die Germanen oder Deutschen, waren durch blaue Augen und langes blondes Haar vor anderen Völkern kenntlich und überragten an Leibesgröße und Gliederbau die Bewohner der südlichen Völker. Schon von früher Jugend an übten sie sich Schwert, Lanze und Schild zu führen, und der Krieg war ihre liebste Beschäftigung, an deren Stelle im Frieden die Jagd trat. Ackerbau und Hauswesen überließen sie den Frauen und Knechten. Obschon dem Trunk und Spiel leidenschaftlich ergeben, zeichneten sie sich doch durch die Tugenden der Tapferkeit, Freiheitsliebe, Keuschheit, Gastlichkeit und vor allem durch Treue aus. Ihre Götter verehrten sie nicht in Tempeln, sondern im stillen Dunkel heiliger Eichenhaine; dorthin wallfahrtete das Volk; dort opferte der Oberpriester im Namen des gesamten Volks, und großes Gewicht legte man auf die Weissagungen kluger Frauen.
Da die Germanen beständige Einfälle in das den Römern unterworfene, an Wohlstand und Gütern aller Art viel höher entwickelte Gallien machten, so ließ Augustus endlich seinen jüngeren Stiefsohn Drusus sie in ihrem eigenen Lande angreifen. Vier Jahre nach einander, 12–9 v. Chr., machte Drusus Heerzüge in das Land der Germanen, legte jenseits des Rheines eine Reihe von Kastellen an, und drang von dort bis zur Elbe vor. Als er schon im Begriff stand diesen Fluß zu überschreiten, soll ihm eine germanische Wole oder weise Frau von übermenschlicher Gestalt auf dem jenseitigen Ufer zugerufen haben: „Wohin, Unersättlicher? Nicht alles zu sehen ist dir vom Schicksal beschieden. Kehre um, denn schon bist du am Ziele deiner Taten und Tage.“
Nach Errichtung eines Siegeszeichens an diesem Strom beschleunigte Drusus seinen Rückweg. Auf diesem aber stürzte er mit dem Pferde, brach den Schenkel und starb dreißig Tage darauf in den Armen seines Bruders Tiberius, der auf die Nachricht von seinem Unfall herbeigeeilt war.
Nach seinem Tode übernahm Tiberius den Oberbefehl. Mehr durch Klugheit, indem er die Zwietracht unter den[S. 193] deutschen Stämmen nährte, als durch offene Schlachten suchte er die Deutschen allmählich zur Unterwerfung zu bringen. Und er tat dies mit solchem Erfolg, daß die Römer das Land zwischen dem Rhein und der Weser schon als eroberte Provinz betrachteten und alsbald auch römische Gesetze, Sprache und Sitten einzuführen begannen.
Von seinen Nachfolgern ließ es sich besonders der Statthalter Quinctilius Varus angelegen sein das römische Gerichtswesen in Anwendung zu bringen. Und weil er anfangs überall Willfährigkeit zu bemerken glaubte, so wähnte er die neuen Einrichtungen in aller Ruhe durchführen zu können. Aber mit tiefer Entrüstung sahen die Germanen, wie ihnen ihre altheimischen Volksgerichte und ihre freie Gauverfassung entzogen, wie sie nach fremdem Rechte in fremder Sprache und von fremden Richtern verurteilt, wie sie mit Rutenstreichen mißhandelt, ja mit der Todesstrafe belegt wurden.
Am meisten empört über die Herrschaft fremden Rechts und fremder Sitte waren die Cherusker und unter ihnen vorzüglich Arminius (Hermann?), der Sohn Segimers, eines Cheruskerfürsten. Er hatte in römischen Kriegsdiensten gestanden, wie viele seiner Volksgenossen, und dort als Anführer einer cheruskischen Söldnerschar das römische Bürgerrecht und die römische Ritterwürde erlangt, aber auch die unersättliche Eroberungssucht und die Unterjochungskünste der Römer kennen gelernt. Jetzt, da Roms Absicht, die freien Germanen dem Reiche einzuverleiben, nahezu erfüllt schien, fühlte sich Arminius zum Retter seines Volkes berufen, und entwarf mit andern cheruskischen Edlen den Plan der Befreiung.
Sorglos waltete Varus in Germanien; die scheinbare Willfährigkeit der deutschen Häuptlinge hatte ihn sicher gemacht, und am allerwenigsten besorgte er von seiten des Arminius eine Gefahr, dem er solches Vertrauen schenkte, daß nicht einmal die Warnungen des Segestes, eines andern Cheruskerfürsten und Oheims des Arminius, bei ihm Eingang fanden. Während er an dem linken Ufer der Weser ein vergnügliches Lagerleben führte, erhielt er plötzlich Kunde von dem Aufstande eines benachbarten Stammes. Sofort traf er Anstalten zum Aufbruch und ließ sich bei einem Gastmahl von den cheruskischen Häuptlingen das Versprechen des Zuzugs wiederholen. Zwar machte ihn Segestes noch am Tage vor dem Aufbruch mit der ganzen Gefahr bekannt; aber Varus,[S. 194] der wohl wußte, daß zwischen Segestes und Arminius bittere Feindschaft bestand, weil dieser jenem seine Tochter Thusnelda entführt und wider seinen Willen zu seiner Ehefrau gemacht hatte, schenkte ihm keinen vollen Glauben. Eine höhere, den Germanen günstige Macht schien seinen Sinn geblendet zu haben, daß er jählings in das bereitete Verderben fiel.
Unter dem Vorwande, dem Prokonsul ihre Scharen zuführen zu wollen, trennten sich die germanischen Fürsten von ihm; daheim aber riefen sie die Ihrigen zur Freiheit. Von Gau zu Gau erscholl der Ruf und riß alle mit sich fort. Selbst Segestes, der Römerfreund, mußte sich anschließen, während sein Sohn Segimund, ein Priester, die heilige Binde zerriß und zu dem Freiheitskampfe eilte.
Nichts schlimmes ahnend, zog das Römerheer unter Varus, ohne strenge Ordnung, mit großem Troß und Gepäck, in langem Zuge durch Wald und sumpfiges Gelände, wo erst Wege durch das Dickicht gebahnt und Gewässer überbrückt werden mußten. Bald lockerten anhaltende Regengüsse den Boden so sehr, daß Roß und Mann einsank und allgemeine Erschöpfung eintrat. Plötzlich brachen die Germanen, anfangs einzeln, dann in Haufen von allen Seiten aus dem Dickicht hervor und griffen die vom Wege und Wetter erschöpften Römer an. Unter schweren Kämpfen erreichte das Heer endlich eine lichte Stelle, wo der Angriff nachließ und ein Lager zur Nachtrast geschlagen werden konnte.
Am folgenden Morgen ging der Zug weiter. Kaum hatten die Legionen den Teutoburger Wald erreicht, so wurden sie von neuem auf allen Seiten angefallen, und mit Mühe gelangten sie am Abend wieder an einen Platz, wo einige Ruhe die Ermüdeten erquickte. Aber auch am dritten Morgen wiederholte sich der Regensturm und der Angriff der Feinde. Die vom Regen erschlafften Bogensehnen versagten, und die schwere Bewaffnung empfand man als verdoppelte Last, während die leichtbewaffneten, mit ihrem Boden und Klima vertrauten Deutschen weniger gehemmt waren. Zwischen den Quellen der Lippe und Ems war die germanische Hauptmacht versammelt; hier kam es zum letzten Kampfe. Vor dem ungestümen allgemeinen Angriff weichen die erschöpften Legionen; ihre Reiter werfen sich in Flucht; ihre Adler werden genommen. Varus selbst, als er alles verloren sah, stürzte sich in sein[S. 195] Schwert, um die Schande nicht zu überleben; die noch übrigen Römer erlagen dem Schwerte der Germanen, und nur wenige entkamen.
Die Rache der erbitterten Sieger schonte auch der Gefangenen nicht: die vornehmsten Kriegshauptleute wurden an den Altären der Götter geopfert. Vorzüglich aber kehrte sich die Wut der Germanen gegen die römischen Richter und Sachwalter, die unter grausamen Martern getötet wurden. Der Leichnam des Varus wurde zerfleischt, sein Kopf von Arminius an Marbod, dem Könige der Markomannen in Böhmen gesendet, der sich eigensüchtig von dem Freiheitskampf ferngehalten hatte. Von den Gefangenen, die zu Leibeigenen gemacht wurden, hat mancher ehemalige Ritter oder Senator als Hausknecht oder Viehhüter eines deutschen Bauern seine übrige Lebenszeit zubringen müssen.
Diese Hermannsschlacht, im Jahre 9 n. Chr., vernichtete eines der tapfersten und geübtesten römischen Heere, das mit den Hilfstruppen auf 40000 Mann geschätzt wird. Als die Schreckensnachricht von der Niederlage nach Rom gelangte, geriet alles in größte Bestürzung. Schon glaubte man das linke Rheinufer samt Belgien und Gallien verloren und Italien bedroht; selbst Augustus verlor anfangs die Fassung so sehr, daß er, im Schmerz sein Gewand zerreißend, ausrief: „Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder!“ Mit ängstlicher Hast, als ob der Feind schon gegen Rom heranzöge, wurden alle Germanen und Gallier aus der Stadt entfernt und die deutsche Leibwache auf Inseln abgeführt. Allein die Sieger dachten nicht an Eroberung; sie zerstörten alle Denkmale römischer Knechtschaft, und kehrten dann wieder an ihren Herd zurück.
Tiberius eilte an den Rhein, um dem erwarteten Einbruch der Germanen zu wehren, beschränkte sich aber klüglich auf die Befestigung der römischen Herrschaft an diesem Strom. Jedoch unmittelbar nach Augustus Tod begann des Drusus Sohn, Germánicus, der Nachfolger des Tiberius im Oberbefehl am Rhein, den Eroberungsversuch zu wiederholen. Viermal in drei Jahren drang er in Germanien ein (14–16 n. Chr.) Im zweiten dieser Feldzüge hatte er das Land der Chatten (Hessen) verwüstet und war schon auf dem Rückzuge begriffen, als ihn der alte Römerfreund Segestes zur Hilfe gegen Arminius rief.
Segestes nämlich hatte seine Tochter Thusnelda, des Arminius Gemahlin, in dessen Abwesenheit wieder in seine Gewalt gebracht, und ward deshalb von seinem Eidam hart bedrängt. Sogleich kehrte Germanicus um und zwang durch einen Überfall den Arminius zur Aufhebung der Belagerung, worauf sich Segestes samt seiner Tochter in den Schutz der Römer gab. Bei dieser Übergabe schritt Thusnelda, ihrem Gatten, nicht ihrem Vater ähnlich, ohne Tränen, ohne Worte, die Hände unter der Brust gefaltet, mit gesenktem Blicke einher. In der Gefangenschaft gebar sie den Thumélicus, der späterhin zu Ravenna erzogen ward und dessen weiteres Schicksal unbekannt blieb. Arminius und Thusnelda sahen sich nie wieder.
Auf die Nachricht von des Segestes Übertritt und Thusneldas Gefangenschaft durchflog Arminius mit der Wut der Verzweiflung die cheruskischen Gaue und rief alle seine Bundesgenossen zur Rache auf gegen die Römer, die, sagte er, sich nicht schämten den Krieg durch Verrat und gegen schwache Weiber zu führen. So gelang es ihm wieder einen großen Bund der nordgermanischen Stämme gegen die Römer zustande zu bringen.
Um einem Angriffskriege der Germanen zuvorzukommen, eröffnete Germanicus den dritten Feldzug, in dem er bis zum Teutoburger Walde vordrang. Mit seinem ganzen Heere langte er bei der Walstatt der Varusschlacht an, wo seit sechs Jahren die römischen Krieger noch unbegraben lagen. Mit Grauen sahen die Römer die bleichenden Gebeine der Gefallenen, dazwischen zerbrochene Waffen, Pferdegerippe, an den Baumstämmen angenagelte Schädel, auf Altären die Reste der Geopferten. Einige, die damals der Schlacht entkommen und jetzt zugegen waren, zeigten die Stellen, wo die Legaten gefallen, wo die Adler genommen, wo Varus verwundet, wo die Gefangenen geschlachtet worden waren. Germanicus ließ alle Gebeine in ein gemeinsames Grab sammeln und legte selbst den ersten Rasen zu dem Erdhügel, der es decken sollte.
Während er auf einen sicheren Sieg seiner von Rachedurst entflammten Legionen hoffte, zogen sich die Germanen in die Wälder zurück, aus denen sie dann hervorbrachen und den Rückzug der Feinde beunruhigten.
Auf seinem vierten Feldzuge rückte Germanicus bis an die Weser, auf deren rechtem Ufer die Cherusker standen.[S. 197] Hier forderte Arminius seinen Bruder Flavius, der im römischen Heere diente, zu einer Unterredung auf, die von beiden Ufern aus gehalten wurde. Zunächst suchte Flavius, der im Dienste der Römer reichen Lohn und Ehre erhalten, aber ein Auge verloren hatte, den Bruder durch Aufzählung aller Vorteile auf die Seite der Römer zu ziehen. Aber Arminius erinnerte den Entarteten an die uralte Freiheit, an die heimischen Götter, an den Schmerz der Mutter, an die Pflicht gegen sein Vaterland, und beschwor ihn nicht der Verräter, sondern der Führer seines Volkes sein zu wollen. So leidenschaftlich und vorwurfsvoll ward schließlich die hin- und herschallende Rede, daß Flavius nach Roß und Waffen rief und es zwischen den Brüdern, ungeachtet sie der Fluß trennte, zum Zweikampf gekommen wäre, wenn nicht ein römischer Befehlshaber ihn diesseits des Stromes zurückgehalten hätte.
Nachdem Germanicus den Übergang über die Weser bewerkstelligt hatte, traf er auf die vereinigte Macht der Germanen und brachte ihnen in einer Ebene, Idistavisus (Feenwiese?) genannt, oberhalb der heutigen Stadt Minden, unter eigenem schweren Verlust, eine Niederlage bei. Allein der Mut und die Kraft der Germanen war dadurch nicht gebrochen. Empört über den Anblick der römischen Siegeszeichen, stand alles Volk ringsum auf; hoch und niedrig, jung und alt griff zu den Waffen, und so kam es zu einer zweiten Schlacht am Steinhudermeer. Furchtbar wütete hier das Schwert der Römer; aber auch die Germanen fochten mit dem Mut der Verzweiflung; Arminius selber ward verwundet. Daß sie gewichen wären, wird nicht berichtet, obschon die Römer sich den Sieg zuschrieben.
Schon gedachte Germanicus im folgenden Jahre doch noch die stolzen Cherusker zu demütigen, als ihn Tiberius, nicht etwa aus Neid auf seinen Kriegsruhm, wie die Gegner des Kaisers raunten, sondern aus der Überzeugung von der Erfolglosigkeit dieser Unternehmungen, vom Oberbefehl abrief, mit der Bemerkung, es sei genug getan und gelitten, mit Klugheit richte man gegen diese Feinde mehr aus als mit Gewalt, man werde sie fortan besser ihrer eigenen Zwietracht überlassen.
Und in der Tat brach die Uneinigkeit derselben bald in einen offenen Krieg zwischen Arminius und Marbod aus.
Der Markomannenkönig Marbod hatte sein Volk in das heutige Böhmen geführt und von hier aus einen Bund mit den anwohnenden Stämmen gebildet, den er noch immer weiter auszudehnen suchte. Zwischen ihm, der sich stets von der gemeinsamen Sache der germanischen Freiheit ferngehalten hatte, und Arminius, der an der Spitze der nordwestlichen Völker stand, entstand Feindschaft. Es kam zu einer Schlacht, die unentschieden blieb; aber dennoch bat Marbod den römischen Kaiser Tiberius um Hilfe, der dann einen Frieden zwischen Cheruskern und Markomannen zustande bringen ließ. Aber nicht lange, so wußte der schlaue Tiberius einen gotischen Fürsten zu einem Einfall in das Land der Markomannen aufzumuntern, der für Marbod so unglücklich endete, daß er, von allen verlassen, über die Donau fliehen und den Kaiser um eine Zuflucht bitten mußte. Die Stadt Ravenna wurde ihm als Aufenthalt angewiesen; dort lebte er noch achtzehn Jahre vom römischen Gnadenbrot und beschloß sein Leben als ein vergessener Mann.
Nicht lange nachher wurde auch Arminius ein Opfer der inneren Zwietracht. Er fiel durch den Verrat seiner Verwandten, die, eifersüchtig auf seinen Ruhm, ihm Streben nach Alleinherrschaft vorwarfen.
Von ihm urteilt der römische Geschichtsschreiber Tacitus: „Ohne Zweifel ist er der Befreier Germaniens gewesen. Er hat nicht, wie andere Könige und Feldherren, das römische Volk in seinen Anfängen, sondern in seiner ganzen Machtherrlichkeit bekämpft, und ist zwar in Schlachten nicht immer sieghaft, im Kriege aber unbesiegt gewesen. Er starb im 37. Jahre seines Lebens, im zwölften seiner Feldherrnmacht. Noch heute wird er bei seinem Volke in Liedern gefeiert.“ Ein kolossales ehernes Standbild, auf der Höhe der „Grotenburg“, südlich der Stadt Detmold, im Jahre 1875 in Gegenwart Kaiser Wilhelms I. eingeweiht, ist ein Zeichen, daß sein Andenken und sein Verdienst um die Erhaltung deutscher Freiheit und deutscher Stammesart noch heute vom deutschen Volke dankbar verehrt wird.
Augustus hatte dem Tiberius die Nachfolge gesichert. Als sich der Senat beeilte ihm die Herrschaft zu übertragen, weigerte er sich anfangs sie zu übernehmen, und lehnte mit anscheinender Bescheidenheit und Höflichkeit die dargebotenen Würden ab. Aber die Senatoren, welche die heuchlerische und versteckte Art seines Wesens und Redens kannten, ließen mit Bitten und Schmeicheleien nicht ab, bis er die Herrschaft übernahm. Nachdem die Vergötterung des Augustus, kraft welcher dieser den Beinamen „der Göttliche“ (Divus) erhielt, den oberen Göttern zugezählt und in eigenen Tempeln und durch eigene Priester verehrt ward, stattgefunden hatte, ward die Fülle aller Würden und Ehren, die jener besessen, auf den Tiberius übertragen. Unter ihm fielen die Volksversammlungen, die unter Augustus nur selten und bloß zum Schein berufen worden waren, völlig weg; ihre Befugnisse wurden dem Senate zugewiesen.
Tiberius führte die Regierung mit Kraft und Umsicht, und die ersten neun Jahre derselben verdienen volle Anerkennung; nur seiner Familie und dem Senate gegenüber zeigte er ein argwöhnisches und zurückhaltendes Wesen. Darin mochte ihn, außer früheren verbitternden Erfahrungen — er hatte sich auf Augustus’ Verlangen von seiner geliebten Vipsania, Agrippas Tochter, scheiden und die lasterhafte Julia, des Kaisers Tochter und Agrippas Witwe heiraten müssen — die heimliche Anfeindung bestärken, die er von den Anhängern des Germanicus und dessen stolzen und ehrgeizigen Gemahlin Agrippina erfuhr. Diese war als Tochter der Julia eine Enkelin, Germanicus, durch seine Mutter Antonia und Großmutter Octavia ein Großneffe des Augustus. Beide sahen den Tiberius als Eindringling in die ihnen gebührenden Thronrechte an. Zwar hatte dieser seinen Neffen Germanicus auf Wunsch des alten Kaisers als Sohn adoptiert und ihm dadurch die Nachfolge gesichert. Auch behandelte er ihn mit großer Nachsicht und Schonung. So hatte er ihn zwar aus Germanien abberufen, weil seine eigenmächtigen Feldzüge gegen die Deutschen ohne alle bleibenden Folgen waren, hatte ihm aber doch einen glänzenden Triumph bewahrt, bei welchem des[S. 200] Arminius Gattin Thusnelda mit ihrem dreijährigen Söhnlein mit aufgeführt ward. Da sich aber die Vorliebe des Volkes für den Germanicus zu deutlich kundgab, so suchte ihn der argwöhnische Tiberius aus den Augen des Volkes zu entfernen. Zu diesem Zweck übergab er ihm den Oberbefehl in Asien, um dort die gestörte Ruhe wieder herzustellen. Daneben beauftragte er den Calpurnius Piso mit der Statthalterschaft von Syrien, der dort, angeblich den geheimen Weisungen des Kaisers gemäß, den Befehlen des Germanicus stets zuwiderhandelte. Dieser reiste daher nach Syrien und bestrafte den ungehorsamen Piso mit Verweis und Entfernung. Als er gleich darauf in schweres Siechtum fiel, entstand der Verdacht, daß er durch Pisos und vielleicht sogar auf des Kaisers Anstiften ein zehrendes Gift getrunken habe. Seine Gattin Agrippina teilte und verbreitete diesen Verdacht. In ihren Armen starb Germanicus, fern von Rom, im Jahre 19 v. Chr. Ganz Italien wurde bei dieser Nachricht mit Trauer erfüllt, und die mit der Asche ihres Gatten zurückkehrende Agrippina zu Rom vom Volke mit der größten Teilnahme empfangen. Piso wurde zur Verantwortung gezogen, aber noch vor der Entscheidung seiner Sache ward er eines Morgens, von einem Schwert durchbohrt, auf dem Boden seines Gemachs gefunden. So blieb das Dunkel, das auf dem Tode des Germanicus ruhte, unaufgeklärt. Agrippina aber und die Freunde ihres Gatten ließen nicht ab in geheimen Umtrieben die Schuld seines Todes auf den Kaiser zu wenden.
Diese gehässige Feindschaft und Verleumdung trug dazu bei, des Kaisers angeborene Neigung zu Argwohn und Menschenverachtung zu steigern. Die Anklagen wegen Majestätsbeleidigung, die schon unter Augustus nicht selten gewesen waren, wurden seit dieser Zeit immer häufiger. Jede unvorsichtige Äußerung des Unwillens oder Tadels gegen die Person des Kaisers, jeder zweideutige Ausdruck wurde von dem immer gefügigeren Senat mit Verbannung oder Tod bestraft, und da die Angeber belohnt wurden, so warfen sich viele verworfene Menschen mit Eifer auf dies abscheuliche Gewerbe.
So mißtrauisch Tiberius war, so wußte ihn doch sein Günstling Älius Sejanus, der Befehlshaber der Prätorianer, mit listiger Schmeichelei und dem Schein unbedingter Treue zu umstricken. Auf seinen Vorschlag wurden sämtliche Abteilungen dieser Garden in einem festen Standlager, dicht[S. 201] unter den Mauern Roms, vereinigt. Von dieser Zeit an konnte sich der Kaiser dieser Truppen zur Durchführung jeder gewaltsamen Maßregel bedienen, und der Befehlshaber dieser Prätorianer ward nach dem Kaiser die wichtigste und mächtigste Person des Staates.
Acht Jahre lang (23–31) stand der sonst gegen jedermann argwöhnische Kaiser unter dem Einfluß dieses Günstlings, dem er auch die Leitung der Regierung vertrauensvoll überließ. Er selber, in stolzer Menschenverachtung, müde der niedrigen und eigensüchtigen Unterwürfigkeit des Senates und des Volkes, hatte sich auf der einsamen Felseninsel Capreä (Capri), am Eingang des herrlichen Busens von Neapel, prächtige Schlösser gebaut, und lebte dort, fern vom Gewühl der Hauptstadt, seinen Neigungen. Aber auch dorthin verfolgte ihn die hämische Verleumdung und erzählte von unerhörten Ausschweifungen, denen sich der alternde Kaiser auf seiner Insel ergäbe.
Inzwischen schaltete Sejanus in Rom mit unumschränkter Gewalt. Seine Bildsäulen standen allenthalben neben denen der kaiserlichen Familienglieder. Bereits hatte er des Kaisers Sohn und Nachfolger Drusus durch Gift aus der Welt geschafft, und gegen die Familie des verstorbenen Germanicus wütete er mit Verbannung und Einkerkerung. Agrippina ward mit einem ihrer drei Söhne auf eine öde Insel verbannt, ein anderer wurde in einem Kerker eingeschlossen. Als er aber endlich seine Hand auch nach dem Throne ausstreckte, da wurden dem Tiberius die Augen über seinen Günstling geöffnet. Er ernannte in der Stille einen neuen Befehlshaber der Garden, und dieser legte eines Tages dem Senat den kaiserlichen Befehl zur Verhaftung des ahnungslosen Sejanus vor. Nicht nur der gefallene Günstling ward hingerichtet, sondern Tiberius ließ auch seine Kinder, Verwandten und Anhänger in großer Zahl umbringen.
Denn nach dieser neuen bitteren Erfahrung verdüsterte sich der Sinn des Kaisers immer mehr. Jetzt erst ward er wirklich grausam und blutdürstig. Fast täglich fielen vornehme Männer und Frauen als Opfer schändlicher Angeberei; mancher nahm, um einer martervollen Hinrichtung zu entgehen, sich lieber selbst das Leben. Agrippina und zwei ihrer Söhne mußten im Kerker den Hungertod sterben. Von der Familie des Germanicus blieben, außer den Frauen, nur[S. 202] Claudius, sein Bruder, und sein jüngster Sohn, Gajus Caligŭla, übrig. Endlich erkrankte der 78jährige Tyrann auf seiner Insel und fiel in eine todähnliche Ohnmacht, worauf sogleich die ganze Umgebung den jungen Gajus den Tiberius an Sohnes Statt angenommen hatte, als neuen Kaiser begrüßte. Aber Tiberius kam wieder zu sich, und nun schien Gajus verloren. Da faßte Macro, wie erzählt wurde, der Befehlshaber der Prätorianer, einen raschen Entschluß; er ließ Polster und Decken auf den Kranken werfen und ihn darunter ersticken.
Gajus, der jüngste Sohn des Germanicus und der Agrippina, hatte, da er mit seiner Mutter als Kind im Feldlager seines Vaters am Rhein lebte, von den Soldatenstiefelchen (caligae), die er trug, von den Soldaten den Beinamen Caligula erhalten. Ihm allein war es gelungen durch den Schein kindlicher Demut und Liebe das Herz des Tiberius zu gewinnen, und als er nach dem Tode des alten Despoten als junger Kaiser in Rom erschien, jauchzte ihm alles Volk wie einem Erlöser aus harter Knechtschaft entgegen. In der Tat schien er anfangs die auf ihn gesetzte Hoffnung erfüllen zu wollen. Er stellte die Untersuchungen gegen die Verfolgten ein, wies die Angeber zurück, und machte sich durch Freigebigkeit beliebt. Aber schon nach wenigen Monaten zeigte er seine wahre Natur. Er erwies sich in Wirklichkeit als der schreckliche Tyrann und ausschweifende Lüstling, für den Tiberius so lange gegolten hatte. So sehr ging sein Tun und Denken gegen alle Vernunft, daß man ihn für wahnsinnig halten mußte. In solchem Wahnsinn verfiel er auf die grausamsten Handlungen. Den ungeheuren Schatz von 420 Millionen Mark, den sein sparsamer Vorgänger gesammelt hatte, verschwendete er gleich im ersten Jahre seiner Regierung. Über die Meeresbucht zwischen Bajä und Putéoli, unweit des heutigen Neapels, eine Stunde weit, baute er eine Schiffbrücke und legte auf derselben eine Kunststraße an mit[S. 203] Häusern auf beiden Seiten, bloß um einmal in einem Prachtzuge darüber fahren und sagen zu können, er habe das Meer in Land verwandelt. Seinem Leibpferde Incitatus, dem er die Würde eines Konsuls zugedacht hatte, ließ er einen Palast mit Hofhaltung einrichten, es mit vergoldetem Hafer füttern, ja sogar an seiner eigenen Tafel fressen. Als er durch solche wahnsinnige Streiche, durch Volksspeisungen und öffentliche Spiele den Schatz vergeudet hatte, zwang er, um wieder Geld aufzubringen, die Reichen die Kosten der öffentlichen Spiele zu tragen und ihm große Geschenke und Vermächtnisse zu machen. Viele ließ er hinrichten, um ihr Vermögen einzuziehen; er drückte die Reichen durch eine Menge von Steuern und errichtete endlich eine Spielbank, wobei er selbst den falschen Spieler machte. Seiner Grausamkeit wurden viele Menschen geopfert; manche ließ er lebendig zersägen, andere den wilden Tieren vorwerfen, ja bei den Tierhetzen, wenn gerade keine Verbrecher mehr da waren, Zuschauer ergreifen und den Tieren preisgeben. In seinem Blutdurste wünschte er, daß das ganze römische Volk nur einen Kopf haben möchte, um ihn mit einem Streich abschlagen zu können. Sein Wahlspruch war: „Mag man mich hassen, wenn man mich nur fürchtet!“ (Odĕrint, dum métuant!)
In seiner Eitelkeit wollte er auch als siegreicher Eroberer glänzen. Er unternahm deshalb sogenannte Feldzüge nach Germanien und Britannien. Er ließ nämlich von Gallien aus einige germanische Söldner über den Rhein setzen und sich dort verstecken; dann zog er mit einem Teil der Reiterei hinüber und brachte sie als Gefangene zurück: das war sein Sieg über die Germanen! Ebenso stellte er ein ungeheures Heer an Galliens Nordküste auf, angeblich zum Zuge gegen Britannien, fuhr dann auf einem Prachtschiff ein wenig ins Meer hinaus, und ließ nach seiner Rückkehr die Soldaten am Strande Muscheln sammeln, die er nachher als eine dem Ozean abgenommene Beute samt einer Anzahl Gefangener, die aus Galliern in germanischer Tracht bestanden, bei seinem Triumph in Rom aufführte.
Nachdem er so fast vier Jahre lang gewütet hatte, bildete sich unter seiner Umgebung, die zuletzt ihres eigenen Lebens nicht mehr sicher war, eine Verschwörung, und zwei Hauptleute seiner Leibwache ermordeten den Kaiser samt seiner Gemahlin und seiner Tochter (41).
Während der Ermordung Caligulas hatte sich sein Oheim Tiberius Claudius hinter einem Türvorhang versteckt. Ihn zogen jetzt die Soldaten der Leibgarde hervor und huldigten ihm als Kaiser, wofür er ihnen eine große Summe Geldes versprechen mußte. Der Senat ward genötigt ihn anzuerkennen. Wenn auch Claudius in Geschichte und Sprachen wohl unterrichtet war, so fehlten ihm doch alle Eigenschaften zur Regierung des Reichs. Er überließ sie Günstlingen und Frauen. Unter diesen hatten besonders die durch ihren sittenlosen Wandel berüchtigte Messalina, und nach ihrer Hinrichtung die, zwar nicht sittenlose, aber weit herrschsüchtigere Agrippina, eine Tochter des Germanicus und Schwester des Caligula, großen Einfluß. Da Agrippina den Sohn des Kaisers von der Messalina, den Britannicus, vom Throne zu verdrängen suchte, um ihrem eigenen Sohn aus erster Ehe, dem Domitius Nero, Platz zu machen, so bewog sie den alten willensschwachen Kaiser diesen als Sohn anzunehmen. Sobald ihr dies gelungen war, ließ sie den alten Kaiser durch vergiftete Pilze töten, welche die berüchtigte Giftmischerin Lacusta bereitet hatte. Daran ward Nero, als der ältere der beiden Söhne, auf den Thron gehoben.
Nero gelangte im Alter von siebzehn Jahren zur Regierung. Solange er sich der weisen Leitung des Burrus, des Obersten der Garde, und seines Erziehers, des beredten und geistvollen Séneca hingab, regierte er ohne Tadel und zeichnete sich durch Bescheidenheit und Milde, durch Wohltätigkeit und Enthaltsamkeit so sehr aus, daß man die ersten fünf Jahre (quinquennium) seiner Herrschaft das glückliche Quinquennium des Nero genannt hat. Doch alle diese Tugenden waren nur die Wirkung des Zwanges und der Verstellung. Länger vermochte der junge Monarch die Maske der Tugend nicht zu tragen, er warf sie ab und offenbarte alsbald einen solchen Hang zu Grausamkeit, Eitelkeit und Heuchelei, daß er ein wahres Ungeheuer von einem Tyrannen wurde.
Da ihm seine Mutter Agrippina Vorwürfe über seine Ausschweifungen machte und ihm drohte den jüngeren Stief[S. 205]bruder Britannicus, an dem sich treffliche Eigenschaften entwickelten, auf den Thron zu erheben, so beschloß Nero sofort dessen Tod. Eines Tages ward bei einem Festmahle ein warmes Getränk umhergereicht, dieses aber dem Britannicus so heiß gegeben, daß er es nicht trinken konnte. Eiligst wurde kaltes Wasser zugegossen, das die oben erwähnte Locusta vergiftet hatte. Kaum hatte Britannicus davon getrunken, als er vor Neros und aller Gäste Augen leblos niederfiel. „Es ist nichts als die Fallsucht, die er schon öfters gehabt!“ rief der heuchlerische Nero und ließ die Leiche wegschaffen, aber gleich in der Nacht auf einem Scheiterhaufen verbrennen, Agrippina mußte den kaiserlichen Palast räumen und verlor allen Einfluß. Bald ließ sich Nero durch die schöne, aber lasterhafte Poppäa Sabina bewegen seine tugendhafte Gemahlin Octavia, die Schwester des Britannicus, zu verstoßen und seine eigene Mutter zu ermorden. Burrus und Seneca bebten vor diesem Entschluß zurück, hatten aber nicht den Mut sich zu widersetzen. Auf den Vorschlag eines Günstlings wurde in der Nähe von Bajä eine Lustfahrt auf dem Meere veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit sollte Agrippina mit dem Schiffe versenkt werden. Doch der Anschlag mißlang, Agrippina rettete sich ans Land, ward aber gleich darauf von gedungenen Mördern in ihrer Wohnung umgebracht.
Seitdem von Gewissensangst verfolgt, suchte sich Nero durch den Taumel wilder Vergnügungen zu zerstreuen. Er scheute sich nicht, um seiner krankhaften Eitelkeit zu frönen, öffentlich als Wagenrenner, Zitherspieler, Sänger und Schauspieler aufzutreten, ohne auf die Mahnungen des Burrus und Seneca Rücksicht zu nehmen. Als Burrus starb und Seneca sich ganz vom Hofe zurückzog, konnte sich nun Nero ganz den Einflüsterungen elender Günstlinge hingeben. Seine Verschwendung war schrankenlos; oft warf er am Schlusse der Feste, die er dem Volke gab, kleine Kugeln unter dasselbe, auf denen Anweisungen auf Geld, Edelsteine, Gemälde, Pferde, Äcker und Landgüter standen, die dann dem glücklichen Erhascher ausgehändigt wurden. Darum mochte ihn sowohl das Volk, das er durch Spiele und Kornspenden befriedigte, als auch das Heer, das er reich besoldete, wohl leiden.
Die größte Greueltat in seiner Regierung war der Brand von Rom. Um sich eine schönere Hauptstadt bauen zu können, ließ er Rom an verschiedenen Stellen anzünden; seine Mord[S. 206]brenner durchzogen die Stadt, drangen mit Fackeln und Brandstoffen in die Häuser und hinderten die Leute mit Gewalt am Löschen. Während der Feuersbrunst stand er auf einem Turme und sah mit grausamer Lust dem furchtbaren Schauspiel zu, indem er dabei ein Gedicht von Trojas Untergang deklamierte. Durch diesen Brand ward ein großer Teil der Stadt in Asche gelegt und unsägliches Elend über die Bevölkerung gebracht, die damals bereits gegen eine Million betrug. Es war also natürlich, daß sich eine wütende Entrüstung gegen die Anstifter zu verbreiten begann. Darum suchte er mit teuflischer Arglist die Schuld auf die Christen zu schieben, die, weil sie sich von allen öffentlichen, mit heidnischen Gebräuchen verbundenen Festlichkeiten zurückhielten, dem Volke schon lange verdächtig und verhaßt waren. Viele derselben wurden als Mordbrenner angeklagt und verurteilt, ein Teil enthauptet oder gekreuzigt, ein anderer in Felle wilder Tiere genäht und den Hunden zum Zerfleischen vorgeworfen, andere mit Pech übergossen und angezündet, um wie Fackeln in langen Reihen bei nächtlichen Rennspielen zu leuchten. So ward Nero der Urheber der ersten Christenverfolgung.
Darauf ließ Nero die Stadt neu aufbauen, wobei er ein ganzes Quartier für sich nahm und daselbst mit verschwenderischer Pracht einen Palast, das sogenannte goldene Haus, bauen ließ, das mit Gärten, Bädern, Lusthäusern, sogar mit Seen und Wildbahnen umgeben ward. Um die ungeheuren Kosten zu decken und das Innere auszuschmücken, mußten alle Provinzen, besonders die Tempel Griechenlands und Asiens, einen Teil ihrer Geld- und Kunstschätze dazu steuern, und selbst die Heere ihren Sold entbehren. Dadurch machte er sich allgemein verhaßt, und es bildete sich eine Verschwörung von Senatoren und Rittern, um ihn zu stürzen und den edeln Gajus Piso auf den Thron zu setzen. Aber die Verschwörung wurde entdeckt, Piso gab sich selbst den Tod, und viele andere wurden hingerichtet Auch Neros Lehrer Seneca wurde, obschon unschuldig, zum Tode verurteilt. Da man ihm die Gunst gewährte sich selbst töten zu dürfen, so öffnete er sich die Adern; da aber bei dem Greise das Blut zu langsam floß, ließ er sich durch die Dämpfe eines Bades ersticken. Seine treue Gattin teilte freiwillig sein Schicksal.
Um die Angst seines Gewissens zu betäuben, stürzte sich Nero in immer neue Zerstreuungen. Er reiste nach Griechen[S. 207]land, wo er in den Spielen als Sänger und Wagenlenker auftrat. Als die Griechen seine Kunst bewunderten und ihm den Preis zuerkannten, verkündete er selber als Herold Griechenlands Freiheit, was ihn jedoch nicht hinderte die griechischen Tempel zu plündern. Mit 1800 Siegeskränzen geehrt, kehrte er nach Rom zurück und feierte wegen seiner Kunstsiege einen Triumph.
Vierzehn Jahre lang hatte Nero auf diese Weise regiert, als sich einige Statthalter gegen ihn empörten. Noch hätte der Aufstand unterdrückt werden können, wenn er sich zu entschlossenem Widerstande hätte aufraffen können. Als es zu spät war, als in Rom selbst der Aufstand siegte, machte er sich, von allen verlassen, auf die Flucht, um sich auf einem Landgut bei Rom zu verstecken. Dahin ritt er mit vier Begleitern in einer sturmvollen Nacht; der Beherrscher der Erde hatte sich in einen schlechten Mantel vermummt und hielt sich ein Tuch vor das Gesicht. Zuckende Blitze erleuchteten den Weg. Neros Pferd ward scheu. Reisende, die ihnen begegneten, fragten: „Was neues von Nero?“ Einen andern hörten sie sagen: „Die setzen gewiß auch dem Nero nach.“ So geängstigt erreichte er halbtot das Landgut. Er wagte es nicht durch den gewöhnlichen Eingang in das Haus zu kommen, und bis man ihm eine Öffnung durch die Mauer gebrochen hatte, versteckte er sich im Schilf und schöpfte sich, von Durst gequält, mit der Hand Wasser aus einer Pfütze. Am folgenden Tage erhielt er die Nachricht, der Senat habe ihn als einen Feind des Vaterlandes geächtet, der, wenn man ihn fände, nach der Sitte der Vorfahren hingerichtet werden sollte. Seine Begleiter forderten ihn dringend auf dieser Schande zuvorzukommen; er versuchte auch, unter unsäglichem Wehklagen, sich selbst zu töten, aber er fand nicht den Mut dazu. „Welch ein Künstler geht in mir unter!“ rief er einmal über das andere aus. Da sprengten Reiter heran. Nun ergriff er den Dolch und ein Freigelassener half beim Stoß in die Kehle. Die Reiter, die ihn gern lebendig fangen wollten, traten ein, als er sich fast verblutet hatte. Er stand im 32. Jahre, als er starb (68). Mit ihm war Cäsars Geschlecht gänzlich erloschen.
Nach Neros Tode ward der spanische Statthalter Galba, der an der Spitze der Empörung stand, zum Kaiser ausgerufen, ward aber in Kürze durch Otho gestürzt, wider den wieder der Befehlshaber der am Rhein stehenden Legionen, Vitellius, sich erhob und in blutigem Bürgerkriege obsiegte. Gegen Vitellius ward im Osten des Reiches der Statthalter Syriens, Flavius Vespasianus, aufgestellt, und erst diesem gelang es wieder eine dauernde Regierung herzustellen.
Vespasianus stand eben mit seinen Legionen in Palästina, wo er einen furchtbaren Aufstand der Juden gegen den Druck der römischen Herrschaft zu bekämpfen hatte. Die Juden wehrten sich als Verzweifelnde. So lag sechs Wochen lang ein römisches Heer von 60000 Mann vor der Stadt Jotápata in Galiläa, ehe es sie erobern konnte. Vierzigtausend Juden verloren dabei ihr Leben. Neben dem Krieg gegen den äußeren Feind wüteten furchtbare innere Zwistigkeiten unter den Juden selbst. In Jerusalem hatte sich eine wütende Rotte, Zeloten (Eiferer) genannt, vor welcher die Gemäßigten, die den Frieden wünschten, zitterten, der Tempelburg bemächtigt und führte eine furchtbare Schreckensregierung. Bald zerfielen auch die Zeloten in zwei Parteien, welche einander mit der größten Heftigkeit bekämpften, weshalb Vespasianus den Angriff auf Jerusalem verschob, weil er darauf rechnete, daß diese Wütenden selbst einander aufreiben würden.
Als die Nachricht von Neros Tode und von den neuen Machthabern Roms sich verbreitete, trugen die Statthalter der östlichen Provinzen dem Vespasianus die Kaiserwürde an. Er nahm sie an und überließ die Fortsetzung des Krieges seinem Sohne Titus.
Dieser rückte im Jahre 70 vor Jerusalem, wo die Zerrüttung und das Elend den höchsten Grad erreicht hatten. Die drei Parteien machten einander den Besitz der Stadt und des Tempels streitig, und taten alles, um sich gegenseitig zu verderben. Indes war Jerusalem so stark befestigt, daß es kaum mit Waffengewalt einnehmbar schien. Titus bot den Eingeschlossenen Verzeihung an, aber sie wollten sich durchaus nicht ergeben. Die Hungersnot stieg in der von Flüchtlingen[S. 209] vollgedrängten Stadt so hoch, daß eine Mutter ihr Kind schlachtete und aß. Als Titus das hörte, rief er mit Entsetzen über die Empörer aus: „Sie allein tragen die Schuld dieses Frevels! Ich will den Greuel des Kindesfraßes mit den Trümmern der Stadt bedecken; die Sonne soll nicht mehr eine Stadt bescheinen, in der Mütter also sich nähren!“
Neben dem Hunger wüteten Seuchen in der unglücklichen Stadt. Die Leichen wurden zu Tausenden über die Mauern geworfen. Nachdem die Römer den äußeren Mauerring erstürmt hatten, richtete sich ihre ganze Macht gegen den Tempel, der von einem Haufen todesmutiger Männer auf das tapferste verteidigt wurde. Aber dem unaufhaltsam vordringenden Angriff erlagen alle Widerstände. Mauer auf Mauer warfen die Sturmwidder der Römer nieder und erreichten endlich die den Tempel umgebenden Hallen. Titus wünschte dies Prachtgebäude zu erhalten, aber umsonst. Die Juden glaubten, ihr Tempel könne gar nicht erobert werden, Gott selber müsse ihn beschützen. Aber die römischen Soldaten warfen Feuer hinein, und bald bedeckte ein Flammenmeer den gewaltigen Bau. Es folgte ein allgemeines Blutbad, wobei weder Alter noch Geschlecht noch Stand geschont ward. Tausende fanden ihren Tod in den Flammen oder durch Absturz von den Mauern. Die obere Stadt ward erst mehrere Wochen später eingenommen, worauf Titus alles, was von Gebäuden noch stand, vollends der Erde gleichmachen ließ. Mehr als eine Million Juden sollen in diesem Vernichtungskriege ums Leben gekommen sein. Als Titus seinen Einzug in die rauchenden Trümmer der Stadt hielt, brach er in die Worte aus: „Wahrhaftig, mit Gott haben wir gesiegt! Gott hat die Juden aus diesen Bollwerken vertrieben, denn was vermöchten Menschenhände und Brechwerkzeuge gegen solche Steinmassen?“
Also ward das Wort Christi über Jerusalem erfüllt (Luk. 19, 44): „Sie werden dich schleifen und keinen Stein auf dem andern lassen.“
Noch zwei Jahre währten die Todeszuckungen des zertretenen Volkes, und erst im Jahre 72 war die völlige Bezwingung Judäas erreicht. Damit verloren die Juden ihren nationalen Mittelpunkt und den letzten Rest einer politischen Vereinigung, und es vollendete sich ihre Zerstreuung in alle Welt und unter alle Völker.
Unterdessen war Vespasianus in Rom mit der kaiserlichen Macht bekleidet worden und feierte im folgenden Jahre mit seinem Sohne Titus, den er zum Mitregenten erhoben hatte, einen glänzenden Triumph wegen der Beendigung des jüdischen Krieges. Noch steht im ganzen wohlerhalten der prachtvolle, innen und außen mit reichem Bildwerk geschmückte Triumphbogen, der nach dem Tode des Kaisers an der sogenannten „heiligen Straße“ (via sacra), nahe dem Forum, errichtet wurde.
Mit Vespasianus kehrte wieder Ordnung und Gesetz in das zerrüttete römische Reich zurück. Er stellte die verfallene Kriegszucht bei den Heeren wieder her; er reinigte den Senat von unwürdigen Mitgliedern und ersetzte sie durch würdige Männer aus den Provinzen des Reiches. Er beschränkte die Anklagen wegen beleidigter Majestät, die unter seinen Vorgängern so vielen das Leben gekostet hatten, und füllte durch Sparsamkeit und weise Verwaltung die gänzlich erschöpfte Staatskasse. Unter den neuen Steuern, die er einführte, befand sich auch eine, die er auf die Urinfässer legte, welche die Tuchwalker bei ihrem Gewerbe gebrauchten. Als sich sein Sohn Titus darüber abfällig äußerte, hielt er ihm ein aus dieser Steuer herrührendes Geldstück unter die Nase und fragte ihn, ob es übel rieche. An seinem Hofe herrschte eine soldatische Einfachheit, was nicht ohne einen günstigen Einfluß auf die durch Luxus und Schwelgerei entartete römische Gesellschaft blieb.
Auch verschönerte er Rom durch den Wiederaufbau des im Bürgerkriege niedergebrannten Capitoliums und der noch seit dem Neronischen Brande in Asche liegenden Stadtviertel. Außerdem ließ er an Stelle des Neronischen Goldenen Hauses einen Tempel der Friedensgöttin, den größten und prächtigsten Roms, bauen, und ein ungeheures Amphitheater, in dem 87000 Menschen Raum fanden. Hier wurden jährlich die blutigen Gladiatorengefechte und Tierhetzen vorgeführt, an deren Anblick sich das Volk nicht ersättigen konnte. Durch unterirdische Kanäle konnte Wasser eingelassen werden, das den ganzen Bodenraum in einen See verwandelte, worin Schiffsgefechte aufgeführt wurden. Noch jetzt machen die hochragenden Überreste dieses Riesenbaues, das den Namen Kolosséum führt, auf den Beschauer einen gewaltigen Eindruck. Bei den Einweihungsspielen wurden 5000 wilde Tiere erlegt. Es war dies der Ort, in welchem später Tausende von christ[S. 211]lichen Märtyrern unter den Zähnen der wilden Tiere verbluten mußten.
Dieser für das Reich so wohltätige Fürst starb als ein siebzigjähriger Greis (79). Als er zum ersten Male in seinem Leben erkrankte und den Tod herannahen fühlte, sprang er mit den Worten: „Ein Imperator muß stehend sterben!“ vom Lager auf und sank tot um.
Er hinterließ die Herrschaft seinem Sohne Flavius Vespasianus Titus, den er schon längst zum Mitregenten angenommen hatte. Wegen seiner unordentlichen Lebensart und Neigung zur Grausamkeit hegte man von ihm keine günstigen Hoffnungen, aber als Kaiser erschien er wie umgewandelt und offenbarte das edelste und wohlwollendste Gemüt. Als er sich einst bei der Mahlzeit erinnerte, daß er an dem ganzen Tage niemanden eine Wohltat erwiesen hatte, rief er aus: „Freunde, ich habe einen Tag verloren!“ Oft sagte er, von seinem Fürsten dürfte niemand traurig weggehen. Den Regierungsgeschäften widmete er sich mit der größten Gewissenhaftigkeit, behandelte jeden mit Milde und Güte, selbst seine Feinde mit Großmut, und suchte die Leiden der Menschheit durch Wohltätigkeit zu lindern, sodaß ihn das Volk die Liebe und Wonne des Menschengeschlechts nannte. Seine kurze Regierung gab ihm Gelegenheit genug, seine Freude am Wohltun in reichem Maße zu offenbaren. Eine schreckliche Feuersbrunst wütete drei Tage lang in Rom; eine verheerende Pest raffte Tausende hin. Furchtbarer noch war der ganz unerwartete Ausbruch des Vesuvs. Bis fast zum Gipfel reich angebaut, begann dieser Berg damals zum ersten Male und ganz plötzlich die in ihm schlummernden vulkanischen Kräfte zu offenbaren. Am Mittag des 24. August 79, unter gleichzeitigem Erdbeben und heftiger Bewegung des nahen Meeres, erhob sich eine himmelhohe pinienförmige Rauch- und Feuersäule, welche alles Land meilenweit mit einer mehrere Meter hohen Schicht von kleinen Bimssteinen und dann mit einer noch höheren von nasser Asche bedeckte. Mehrere Tage dauerte dieser Aschenregen, der die Luft mit erstickendem Qualm erfüllte und den Tag in tiefe Nacht verwandelte. Feurige Lavaströme brachen aus den Seiten des Berges und erhöhten das Entsetzen des Volkes. Drei blühende Städte am Meerbusen, Herculanum, Pompeji und Stabiä, wurden gänzlich[S. 212] verschüttet. Viele tausend Menschen verloren Gut und Leben. Unter den Toten war der Befehlshaber der Flotte im Hafen von Misēnum, der gelehrte Naturforscher Plinius, der das unerhörte Ereignis in der Nähe schauen wollte. Sein Neffe, Plinius der Jüngere, hat in Briefen an seinen Freund, den Geschichtschreiber Tacitus, den ganzen Vorgang geschildert.
Am 24. August, erzählt er, erhob sich plötzlich ein Geschrei, es steige aus dem Berge Vesuv eine ganz ungewöhnliche, fürchterliche Wolke auf. Der unerschrockene Oheim wollte ein so merkwürdiges Ereignis in größerer Nähe beobachten, bestieg ein Schiff und eilte der Gefahr entgegen. Schon auf dem Meere erreichte ihn fallende Asche und Bimsstein; der Steuermann bat ihn umzukehren. Vergebens. „Mit dem Tapfern ist das Glück!“ rief er und ließ sich nach Stabiä bringen, wo er die Nacht hindurch ruhig schlief, während die Flammen aus dem Vesuv hervorbrachen und alles, was fliehen konnte, floh. Am Morgen aber entstand die Besorgnis, daß der stärker strömende Aschenregen zuletzt den Ausgang aus der Stadt versperren, oder die von dem heftigen Erdbeben schwankenden Mauern einstürzen möchten. So zog man denn hinaus, auf das Meer zu, welches fürchterlich tobte. Eine stockfinstere Nacht überall, nur von den Fackeln, welche die Sklaven trugen, und den Flammen des Berges erhellt. Da sank Plinius plötzlich tot nieder. Er war von den bösen Dämpfen erstickt; seinen Leichnam fand man erst am dritten Tage, denn so lange dauerte die Finsternis. Sein Neffe war indes in Misenum geblieben, bis auch dort das entsetzliche Erdbeben die Gebäude zu verlassen zwang. Eine Menge Volks zog aus; da wandelte sich auch hier in so weiter Entfernung der Tag in Nacht, und die Asche begann zu stäuben. Das Rufen, das Geschrei und Gejammer der auf dem Felde umhertappenden, die Ihrigen suchenden Menschen war schrecklich. Endlich, als der lange und schwere Aschenregen nachließ, und die Sonne, wiewohl mit fahlem Scheine, wieder hervortrat, boten die Gegenstände umher den traurigsten Anblick dar; der Boden war hoch mit Asche wie mit Schnee bedeckt. — Aus dem, was bei Misenum geschah, kann man sich ungefähr vorstellen, wie die dem schrecklichen Ausbruch so viel näheren Städte Pompeji und Stabiä unter der Asche, Herculanum unter den Lavaströmen verschüttet wurden und gänzlich verschwanden. Erst seit der[S. 213] Mitte des 18. Jahrhunderts sind ihre Reste teilweise wieder aufgedeckt und zugänglich gemacht worden.
Titus, der Rom auch durch ein herrliches Werk der Baukunst, die nach ihm genannten Thermen (allem Volk zugänglichen Bäder), zierte, regierte zum Unglück für das Reich nur zwei Jahre und drei Monate. Er starb kinderlos nach kurzer Krankheit (81).
Sein Bruder Domitianus, der ihm in der Herrschaft folgte, schien anfangs die Regierungsweise seiner beiden Vorgänger fortsetzen zu wollen, bis allmählich die übermäßige Vorstellung von seiner persönlichen Bedeutung, mit der er schon dem Vater lästig und dem Bruder feindselig gewesen war, in eine Art Herrscherwahnsinn ausartete, und seine Regierung für alle gefährlich machte, welche seine Eifersucht oder seinen Argwohn weckten. Die Zeiten Caligulas und Neros schienen sich zu erneuern. Endlich bildete sich unter den Freigelassenen, seinen Günstlingen, welchen er die Verwaltung der Staatsgeschäfte anvertraut hatte, und Mitgliedern des Senates, die alle in steter Furcht für ihr Leben standen, eine Verschwörung, die ihm ein blutiges Ende bereitete (96). Selbst seine Gemahlin Domitia half den Wüterich zu beseitigen. Mit ihm erlosch die Dynastie der Flavier. Das Reich aber hatte unter ihm, wenn auch ohne sein Verdienst, eine ansehnliche Erweiterung erfahren. Die Eroberung Britanniens, die schon von Cäsar eingeleitet, aber erst unter Kaiser Claudius ernstlich begonnen war, wurde im Jahre 85, trotz des langen und heldenmütigen Widerstandes der Britanner, durch Julius Agricola, den Schwiegervater des Geschichtschreibers Tacitus, vollendet.
Auf die Flavier folgte, während einer fast hundertjährigen Zeitdauer, eine stetige Reihe trefflicher Fürsten, unter denen die Bewohner des Reiches sich einer einsichtigen und gerechten Verwaltung, ungestörten inneren Friedens und zunehmenden[S. 214] Wohlstandes erfreuten, sodaß man diesen Zeitraum das goldene Zeitalter des römischen Reiches genannt hat.
Zunächst wurde der alte würdige Senator Coccejus Nerva auf den Thron erhoben (96–98). Er gab dem Senat den ihm gebührenden Anteil an der Regierung zurück, bemühte sich durch Milde und Gerechtigkeit, den Leiden und Klagen der armen Bevölkerung abzuhelfen, den zerrütteten Staatshaushalt zu ordnen, erleichterte die Abgaben und ließ arme Kinder auf öffentliche Kosten erziehen. Da er aber fühlte, daß ihm, dem Übermut und den Ansprüchen der Leibgarden gegenüber, die nötige Kraft fehlte, so adoptierte er den kriegserprobten Statthalter des oberen Germaniens, Ulpius Trajanus, einen in Spanien geborenen römischen Bürger, und ernannte ihn zu seinem Mitregenten. Er starb einige Monate nach dieser Wahl, worauf ihm Trajanus als Alleinherrscher folgte (98–117).
Durch seine Kraft und Milde, Güte und Bescheidenheit, Einsicht und Gerechtigkeit erwarb er sich die Liebe und Bewunderung der römischen Welt in dem Grade, daß ihm der Senat den Beinamen der „Beste“ erteilte, und noch nach zweihundert Jahren die neugewählten Kaiser den Thron unter dem Glückwunsch bestiegen: „Sei glücklicher als Augustus und besser als Trajanus!“ Alle Tugenden, die den Herrscher, Feldherrn und Menschen zieren, übte er in gleichem Maße. Die Majestätsprozesse hörten auf; der Senat erhielt Freiheit der Beratungen. Der Kaiser selbst unterwarf sich den Gesetzen und förderte dadurch auch in allen Bürgern die Achtung vor Gesetz und Recht. Jedem Bürger gestattete er freien Zutritt; die Provinzen beschützte er vor Bedrückung der Beamten; die Armen unterstützte er, indem er in allen Teilen Italiens arme Kinder auf Kosten des Staates erziehen ließ. Das Christentum aber, in dem der heidnische Römer nichts anderes als einen jüdischen Aberglauben sah und verachtete, suchte dieser beste der Kaiser planmäßig zu unterdrücken. Wenn er auch geheime Anklagen und Verfolgungen der Christen nicht gestattete, so befahl er doch die gesetzmäßig angeklagten und überführten, wenn sie nicht widerrufen wollten, hinzurichten.
Auch glänzende Kriegstaten und eine erhebliche Ausdehnung des Reichs sind mit dem Namen dieses Kaisers verknüpft. Zur Sicherung der Provinz Moesia an der unteren[S. 215] Donau unternahm er einen Kriegszug gegen das unruhige Volk der Daken am jenseitigen linken Ufer des Stromes (im heutigen Rumänien und Siebenbürgen), deren König Decébalus dem römischen Reiche unter Domitianus gegen die jährliche Zahlung eines Tributes Frieden gewährt hatte. Trajanus befreite Rom von dieser schmählichen Abgabe; Decebalus mußte seine Hauptstadt erobert, seine Festungen geschleift und einen Teil seines Landes von den Römern besetzt sehen (103). Als er sich dann, dem Friedensvertrage zuwider, heimlich mit Nachbarvölkern gegen die Römer verband, zog Trajanus zum zweiten Mal gegen die Daken. Zu diesem Zwecke baute er, in der Nähe der heutigen Stadt Czernetz in der Walachei, über die Donau eine steinerne Brücke, die aus 20 steinernen Pfeilern ruhte und 2500 Fuß lang war. Dann drang er tief in das Land der Feinde und bedrängte den Decebalus so, daß dieser sich selbst das Leben nahm (106). Sein Land ward römische Provinz (Dacia) und nahm bald römische Sprache und Art so gründlich an, daß noch der Name und die Sprache der heutigen Rumänier davon zeugen.
Seine Siege über die Daken feierte Trajanus durch glänzende Triumphe und Festspiele, bei denen an 123 Tagen 11000 wilde Tiere getötet wurden. Das Andenken daran erhält noch heute die Trajanssäule in Rom. Sie erhebt sich auf dem vormals mit Säulenhallen umgebenen Platze des Trajanischen Forums, ist 117 Fuß hoch und aus hohlen Zylindern von weißem Marmor zusammengesetzt, welche einen unten 11, oben 10 Fuß starken Schaft bilden, an dessen Außenfläche Trajans Kriegstaten mit etwa 2500 menschlichen Figuren dargestellt sind. Die Säule, unter der sich des Kaisers Grabkammer befand, ist innen hohl, und 184 Stufen führen auf ihre Spitze, auf welcher eine 22 Fuß hohe eherne Bildsäule Trajans stand, die aber im Laufe der Zeit zerstört und im 16. Jahrhundert durch die Bildsäule des Apostels Petrus ersetzt worden ist.
Da die Parther die Grenze des römischen Reiches im Osten beunruhigten, so unternahm Trajanus auch einen Feldzug in die Morgenländer. Er unterwarf Armenien, Mesopotamien und Assyrien und machte diese Länder zu römischen Provinzen, deren Besitz jedoch von nur kurzer Dauer war. Mit einer Flotte fuhr er den Tigris hinab in den persischen Meerbusen und war schon nahe seinem Ziele, der Herstellung[S. 216] des Reiches Alexanders des Großen. Das Reich der Parther machte er, unter einem einheimischen, von ihm eingesetzten Fürsten, abhängig von Rom. Aber diese Eroberungen waren nicht von Bestand. Die Parther setzten ihren vertriebenen König wieder ein, und bevor er den Aufstand bezwingen konnte, starb Trajanus zu Selinus in Cilicien, das ihm zu Ehren Trajanopolis genannt ward. Seine Gebeine wurden nach Rom geschafft und unter der Trajanssäule beigesetzt.
Nach seinem Tode ließ sich T. Aelius Hadrianus, der vom sterbenden Trajan als Sohn angenommene Befehlshaber des Heeres und Statthalter von Syrien, sogleich von dem Heere zum Kaiser ausrufen, und der Senat bestätigte ihn in dieser Würde. Er war ein sehr gebildeter Mann und mit einem so außerordentlichen Gedächtnis begabt, daß er schon in seinem fünfzehnten Jahre die griechische Sprache so vollkommen wie ein Grieche sprach und jedes einmal gelesene Buch fast auswendig wußte. Als Kaiser wandte er den inneren Angelegenheiten seines Reiches die größte Sorgfalt zu. Er bereiste selbst fast alle Provinzen seines weiten Reiches, und zwar meistenteils zu Fuß, „denn ein Kaiser,“ sagte er, „muß wie die Sonne alle Teile seines Reiches beleuchten“. Auch die Literatur und die bildenden Künste gediehen unter ihm zu einer Art von Nachblüte. Von den zahlreichen Bauwerken, die er in allen Provinzen errichten ließ, verdient das sogenannte Mausoléum oder Grabmal des Hadrianus Erwähnung, das jetzt die Engelsburg heißt. Außer seinen glänzenden Eigenschaften besaß er aber auch grobe Fehler, und besonders waren Neid und Argwohn hervorstechende Züge seines Charakters, die ihn zuweilen zu grausamen Handlungen verleiteten. Er regierte von 117 bis 138.
Es folgte ihm sein Adoptivsohn T. Aelius Hadrianus Antoninus (138–161). Die kindliche Ehrfurcht, mit der er das Andenken seines Vorgängers in Ehren hielt, erwarb ihm den Beinamen Pius. Er regierte wie ein zweiter Numa, den er sich auch zum Muster genommen haben soll. Von ihm, den seine Zeit mit Recht den Vater der Menschen genannt, hat die Geschichte keine Kriegstaten, sondern nur wohltätige Einrichtungen zu melden. Selbst die unter früheren Kaisern verfolgten Christen konnten unter ihm ein ruhiges Leben führen. Er pflegte zu sagen: „Ich will lieber das Leben eines einzigen Bürgers erhalten, als tausend Feinde töten!“
Marcus Aurelius Antoninus, in Spanien geboren, war von Antonius Pius zusammen mit dessen zweitem Adoptivsohn zum Nachfolger ernannt worden. Mit edlen Anlagen des Geistes und Herzens begabt, hatten ihn ausgezeichnete Lehrer schon früh in die Lehren der griechischen Weisheit eingeführt, die auf seine Regierung von großem Einfluß wurden. Mit der ganzen sittlichen Kraft, die er aus der Beschäftigung mit dieser Weisheit schöpfen konnte, bestand er die mannigfachen Stürme, die während seiner neunzehnjährigen Regierung (161–180) über ihn und sein Reich kamen. Er sorgte für Recht und Gesetze und beobachtete eine weise Sparsamkeit in der Verwaltung. Besonders lag ihm die Besserung der Sitten am Herzen. In den Christen aber sah er eine staatsgefährliche Partei und ließ sie besonders in Kleinasien und Gallien grausam verfolgen. Seine Milde und Wohltätigkeit zeigte er, als Rom von einer Überschwemmung und Hungersnot heimgesucht ward. Zu derselben Zeit wurde das Reich durch die Einfälle der Germanen und Parther im Norden und Osten beunruhigt. Am furchtbarsten war der schwere und langwierige Krieg gegen die germanischen Markomannen (166–190), der das römische Reich an den Rand des Untergangs brachte und die Römerwelt in eine solche Angst versetzte, daß einer auf dem Markte zu Rom den Untergang des Erdballes verkündete. Alle Donauvölker erhoben sich wie in einem Bunde vereinigt, darunter besonders die Markomannen (in Böhmen) und Quaden (in Mähren und Ungarn), stürmten über die Donau in die römischen Provinzen und schleppten unter furchtbaren Verheerungen ganze Bevölkerungen hinweg. Zu diesem Unglück kam noch die Pest, welche die Legionen aus Asien mitbrachten und die nun auch Italien und andere westliche Provinzen verheerte. Zwar zog Marcus Aurelius gegen die Quaden und schlug sie mehrmals, feierte auch zu Rom einen Triumph, aber die Markomannen und ihre Verbündeten brachen immer wieder los und nötigten den Kaiser zu neuen Feldzügen. Um die Mittel dazu aufzubringen, verkaufte er seine Kostbarkeiten und Kunstschätze, bewaffnete Sklaven und Sträflinge, und nahm sogar zur Wahrsagerei seine Zuflucht. Auf den Rat eines ägyptischen Wahrsagers ließ er zwei Löwen über die Donau treiben, um die Barbaren durch diesen Anblick zu erschrecken. Allein die Germanen hielten die Löwen für große Hunde und schlugen sie mit[S. 218] Prügeln tot. In einer bald darauf folgenden Schlacht töteten sie 20000 Römer.
Auf einem seiner Feldzüge stand der Kaiser mit seinem Heere diesseits der Gran, eines Nebenflusses der Donau in Ungarn, in einer wasserlosen Gegend, rings von Feinden eingeschlossen. Er und alle die Seinen waren dem Verschmachten nahe, als plötzlich ein Gewitter mit Regengüssen erfolgte und die Erschöpften, die den Regen in ihren Schildern auffingen, erfrischte. Nach einer christlichen Legende war der Gewitterregen eine Folge des Gebets der zwölften Legion, die meist aus Christen bestand, während römische Berichte ihn dem Gebete des Kaisers zuschrieben. Es war dem Kaiser nicht vergönnt, den Krieg gegen die Markomannen und Quaden zu beendigen. Er starb zu Vindóbona (Wien). Sein unwürdiger Sohn Commodus (180–192) erkaufte von ihnen einen schimpflichen Frieden.
Mit Marcus Aurelius schließt die Reihe der guten Kaiser. Zwar folgte noch eine große Anzahl von Imperatoren nach ihm, von denen aber nur sehr wenige verdienen hier erwähnt zu werden. Die innere Zerrüttung des Reiches, der Verfall der Sitten, die Schwäche nach außen nahmen immer mehr zu, und es zeigte sich in jeder Beziehung, daß die römische Welt sich ausgelebt hatte. Ein anderes Volk war berufen an ihre Stelle zu treten, das morsche Gebäude des römischen Reiches zu zertrümmern und Träger des Christentums zu werden. Dieses Volk waren die Germanen.
Aber noch ehe die Germanen das alte Reich in den Staub traten, feierte das Christentum einen vollständigen Sieg über das Heidentum. Konstantinus der Große[1] (306–337)[S. 219] gewährte dem Christentum die staatliche Anerkennung. Damit hörten die Verfolgungen der Christen auf, und der Glaube an den Erlöser, zu dem sich Konstantinus selbst bekannte, verbreitete sich immer weiter. Auch ward die Regierung dieses Kaisers noch dadurch von großer Bedeutung, daß er die Residenz von Rom nach Byzantion verlegte, das ihm zu Ehren den Namen Konstantinopolis erhielt.
Nach seinem Tode waren noch nicht vierzig Jahre verstrichen, als durch die Ankunft der Hunnen, die aus Asien in Europa einfielen, der Anstoß zur sogenannten Völkerwanderung gegeben wurde (375). Seitdem hörten die Angriffe der Germanen gegen das römische Reich nicht mehr auf, und nur mit Mühe vermochte der römische Kaiser Theodosius der Große (378–395) die in das oströmische Reich eingedrungenen Westgoten zu beruhigen. Dieser Kaiser vereinigte noch einmal das ganze römische Reich unter seinem Szepter. Vor seinem Tode (395) teilte er das Ganze unter seine Söhne Honorius und Arkadius, von denen jener das weströmische oder lateinische Reich mit der Hauptstadt Rom, dieser das oströmische oder griechische Reich mit der Hauptstadt Konstantinopel erhielt. Die Feindschaft beider Brüder machte die Teilung zu einer dauernden. Gegen das weströmische Reich richteten sich jetzt die stürmischen Angriffe der Germanen, die nach und nach eine Provinz nach der andern, Spanien, Gallien, Afrika und Britannien, davon losrissen, bis endlich im Jahre 476 Odoáker, ein Anführer deutscher Soldtruppen, den letzten römischen Kaiser Romulus Augústulus absetzte und sich zum Könige von Italien machte. Dadurch ward dem weströmischen Reiche ein Ende gemacht, während das oströmische oder byzantinische Kaisertum im Laufe des Mittelalters zwar immer mehr an Umfang und Macht verlor, aber sich doch in der Hauptstadt erhielt, bis auch diese im Jahre 1453 von den Türken erobert wurde.
[1] Als Konstantin gegen Maxentius in den Streit zog, betete er eines Nachmittags voll Andacht zu dem Gott der Christen. Da erschien ihm ein Zeichen am Himmel in Gestalt eines glänzenden Kreuzes mit der Inschrift: In hoc vinces! (In diesem Zeichen sollst du siegen!) Nachts erschien ihm Christus im Traum und befahl ihm dieses Sinnbild zum Kreuzespanier zu machen. Er ließ nun eine Kriegsfahne anfertigen, die seine christlichen Streiter mit begeistertem Mute erfüllte und ihm in der Schlacht an den „roten Steinen“ (saxa rubra) in der Nähe Roms den Sieg über Maxentius verschaffte (312). So erzählt ein christlicher Schriftsteller.
Verlag von Gerhard Stalling, Oldenburg i. Gr.
Professor Dr. Ludwig Stacke’s Schriften.
Erzählungen aus der
Griechischen Geschichte. 30. Auflage. Gebd. 1 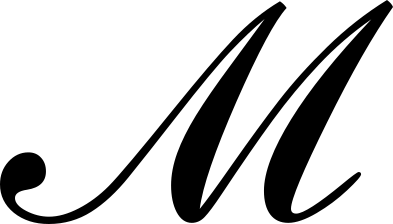 90
90  .
.
Römischen Geschichte. 27. Auflage. Gebd. 1 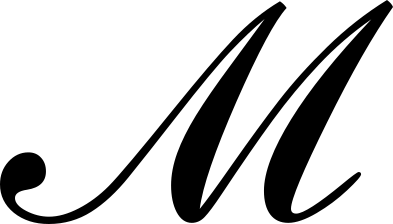 90
90  .
.
Mittelalter. 17. Auflage. Gebd. 1 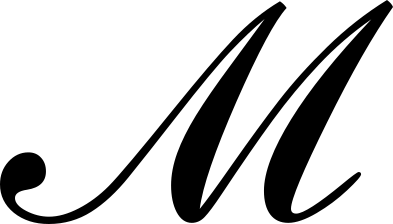 90
90  .
.
Neuen Geschichte. 14. Auflage 2 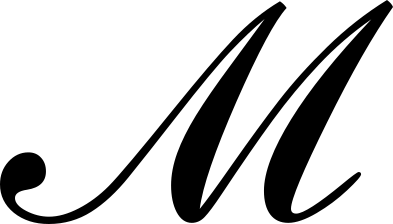 75
75  , gebd. 3
, gebd. 3 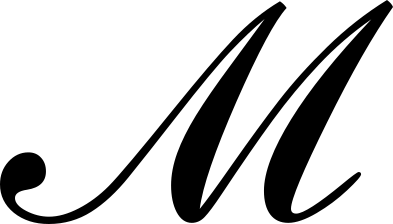 25
25
 .
.
Neuesten Geschichte (1815 bis zur Abberufung Bismarcks).
6. Auflage. 5 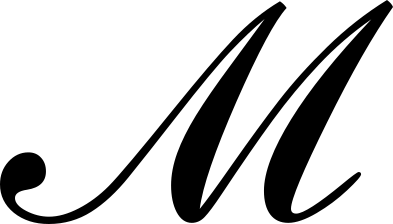 50
50  , eleg. gebd. 6
, eleg. gebd. 6 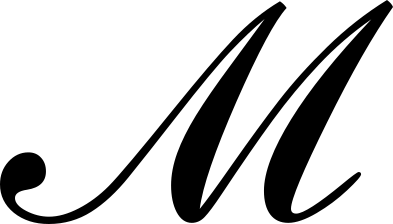 25
25  .
.
Über Stackes „Erzählungen aus der Geschichte“ schreiben in ihrem letzten Bande die in Berlin im Auftrage der historischen Gesellschaft erscheinenden „Jahresberichte der Geschichtswissenschaft“ gelegentlich der Besprechung von Volks- und Jugendschriften: „Hier sind in erster Linie die Stackeschen Schriften zu erwähnen, die sich auch, wie ihre hohen Auflagen zeigen, einer großen Beliebtheit erfreuen. An Rankes und Beckers Weltgeschichte angelehnt, verstehen sie es, durch korrekte Sprache und fesselnde Erzählungsform den Leser zu gewinnen und ihn in jene gehobene Stimmung zu versetzen, welche die schönste Frucht der Geschichtsbeschäftigung genannt worden ist.“
„Die fortgesetzten vielfachen Auflagen dieser vom echten Forschergeiste und warmer Empfindung getragenen Geschichten beweisen mehr als alle Anpreisungen den hohen Rang, welchen sie unter den zahlreichen literarischen Erscheinungen ähnlicher Art einnehmen. Die Darstellung ist in allen Richtungen anregend und frisch, die Form, meist klassischen Mustern angepaßt, tadellos. Die Gunst der Lehrer wird sicher diesen Büchern stets in steigendem Maße zu teil werden.“
(Schlesische Presse.)
„Die Verlagshandlung und der als Oberlehrer am Gymnasium zu Rinteln wirkende Verfasser sind zu diesem erfreulichen, wohlverdienten Erfolge, den diese „Erzählungen“ erzielt haben, zu beglückwünschen.“
(Wissenschaftl. Beilage d. Leipziger Zeitung.)
„Eine herrliche Lektüre, eingehend, belehrend und angenehm unterhaltend. Die Schilderungen fesseln nicht bloß 12–15jährige Knaben und Mädchen, sondern auch reifere Jünglinge und Jungfrauen, gebildete Männer und Frauen. Auswahl und Darstellung ist vortrefflich. Die zahlreichen Auflagen sind verdiente.“
(Repertorium der Pädagogik.)
Hülfsbücher fürs die erste Unterrichtsstufe in der Geschichte.
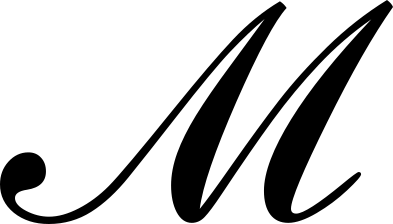 , geb. 1
, geb. 1 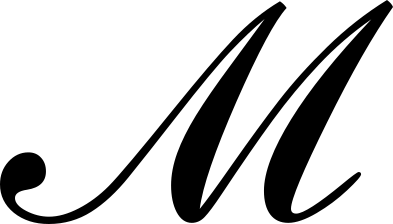 50
50  .
.
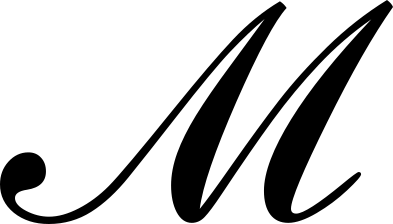 , geb. 1
, geb. 1 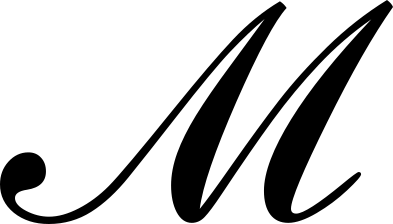 50
50  .
.
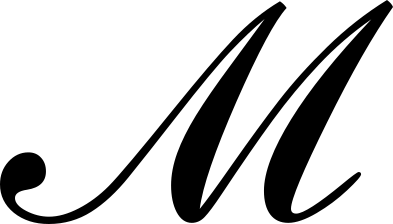 75
75  , geb. 2
, geb. 2 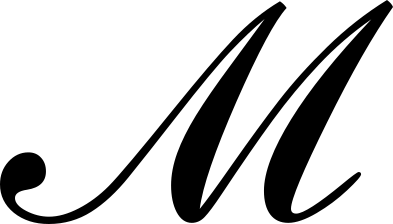 25
25  .
.
„Der Herr Verfasser hat aus seinen „Erzählungen“ einen Auszug zusammengestellt, der sich zur Einführung in die Schulen, in deren Unterklassen alte Geschichte behandelt wird, im hohen Maße eignet. Die Vorzüge dieses Buches vor allen andern der Art bestehen darin, daß nicht einzelne, für sich behandelte Erzählungen aus der alten Geschichte gegeben werden, sondern der Verfasser gibt uns stets ein Gesamtbild der alten Geschichte. Dabei ist der Einzelgeschichte und dem geographischen Elemente überall die nötige Berücksichtigung zu teil geworden. Wer längere Zeit in diesem Unterricht sich mit recht schwachen Hülfsbüchern hat behelfen müssen, wird das Buch mit großer Freude begrüßen; denn er findet in demselben alles das, was er als wissenswert dem Gedächtnis des Kindes eingeprägt sehen möchte. Möge das Buch den Schulen bestens empfohlen sein!“
(Magazin für Lehr- und Lernmittel.)
Verlag von Gerhard Stalling, Oldenburg i. Gr.
Das beste Buch für die deutsche Jugend und das deutsche Volk!
Nordisch-Germanische
Götter- und Heldensagen.
Für die deutsche Jugend und das deutsche Volk
von
Gustav Schalk
3. Auflage
(mit Illustrationen).
Preis gebd. 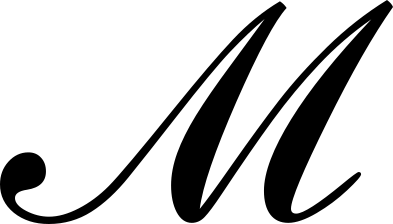 . 2.80.
. 2.80.
„Mit Freuden begrüße ich jedes Werk, welches deutsche Mythologie und Heldensage behandelt. — Seit den dornenvollen Arbeiten von Jak. Grimm, K. Simrock, W. Wägner u. a. hat sich das Interesse für die Religion unserer Altvordern, für ihre Sitten, Anschauungen und Gebräuche gesteigert. — Eine edlere Begeisterung für die längst entschwundene Welt unserer Altvordern ist es auch, der dieses Werk seine Entstehung verdankt, welches wir als ein wohlgelungenes bezeichnen können. Es wird sicher die Kenntnis der alten Vorzeit verbreiten und Begeisterung für die Helden erwecken und so wieder Heldenmut und Edelsinn erzeugen. Die Darstellung ist eine recht gewandte und die Gruppierung des Stoffes ebenso geschickt. Den Glanzpunkt des Ganzen bildet die bezaubernd schöne Frithjofsage, die nach Tegner erzählt ist. — Wer kennt nicht Ingeborg, die schönste Rose des Nordens, und Frithjof, die königliche Eiche auf Nordlands Bergen? Schon diese eine Sage macht das Buch jedem Leser lieb und wert. Die Sprache des Verfassers perlt hier gleichsam im Morgentau und Frühlingssonnenschein. — Möge das Buch zahlreiche Leser finden.“
Mainz.
Dr.
Heinrich Haskamp.
(Rhein.-Westf. Schulzeitung.)
„Was dieses Buch vor manchen seinesgleichen ganz besonders auszeichnet, das ist die durchweg knappe, klare und doch so poesievolle Darstellung, der einfache, naive, meisterhafte Märchenton. Aus diesem Grunde sei das vortreffliche, übersichtlich gehaltene Buch, welches sich für Schüler aller Schulen als Nachlesebuch ganz vorzüglich eignet, aufs Wärmste empfohlen.“
(Westfälische Lehrer-Zeitung.)
Se. Excellenz der General der Infanterie von Keßler, General-Inspekteur des Militär-Erziehungs- und Bildungswesens, schreibt der Verlagsbuchhandlung unterm 4. Dezember 1897 über das Buch: „Das Kommando des Kadettenkorps, welchem ich das Buch mitgeteilt habe, hat mit Anerkennung in Aussicht genommen, das Buch mit benutzen zu lassen.“
Verlag von Gerhard Stalling, Oldenburg i. Gr.
Harms, Prof. Chr., Rechenbuch für die Vorschule. Heft I. 12.
Aufl. kart. 50  . Heft II, 13. Aufl., kart. 80
. Heft II, 13. Aufl., kart. 80  .
.
Harms, Prof. Chr., Kopfrechenbuch. Eine Anleitung zur Lösung
vieler angewandter Kopfrechenaufgaben. 1 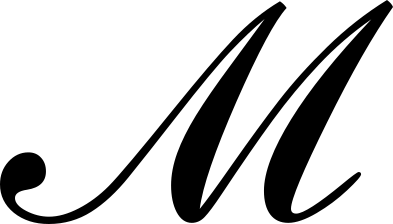 . 50
. 50  .
.
Harms, Zwei Abhandlungen über den Rechenunterricht. 80  .
.
Kallius, Prof. Dr., Die vier Species in ganzen
Zahlen, und Das Münz-, Maß- und Gewichtssystem im
Rechenunterricht. 4. Aufl. 1 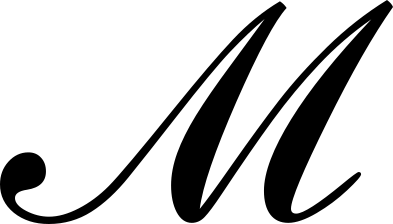 20
20  .
.
Lefèbre, Abriß der griechischen und römischen Geschichte für
Quarta. Preis 35  .
.
Rechenbuch für Unterklassen von H. Friedrichs, A. Klusmann, F.
Logemann. 23. Aufl. Bearbeitet von H. Friedrichs und C.
Krüder. 65  .
.
„Das angezeigte Rechenbuch ist eine methodisch geordnete Aufgabensammlung für die vier Species im Zahlenraume von 1–10000. Der betreffende Stoff ist reichhaltig und wohlgegliedert. — — Somit wird in den Unterklassen ein guter Grund gelegt, auf welchem der Lehrer der Oberklasse mit Erfolg weiter zu bauen vermag.“
(Schulblatt f. d. Provinz Brandenburg.)
Stacke, Prof. Dr. Ludwig, Abriß der Geschichte der
Preußischen Monarchie von den ältesten Zeiten bis auf die
Gegenwart. 2. Aufl. 1 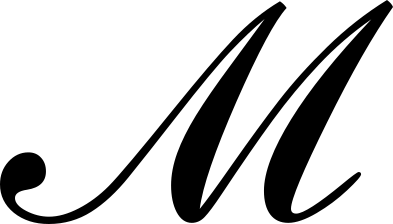 .
.
„Außerordentlich reich an Stoff, klar und lichtvoll in der Anordnung, anziehend und lebendig in der Sprache, anschaulich und malerisch in der Schilderung, kräftig und kernig in der Charakterisierung, durchdrungen von patriotischem Sinn und sittlichem Ernst, ist dieser „Abriß“ Lehrenden und Lernenden angelegentlichst zu empfehlen.“
(Deutsche Schulzeitung, herausg. v. F. E. Keller, Berlin.)
„Gleich den übrigen Geschichtsdarstellungen des Verfassers eine der ansprechendsten und gediegensten Arbeiten auf diesem Gebiete der Literatur.“
(Pädag. Jahresbericht.)
„Das Buch zeichnet sich durch allseitige Berücksichtigung der wichtigsten historischen Momente, durch volle Beherrschung des Stoffes, treffende und präzise Darstellung und durch warme Hingebung an die Sache des Vaterlandes ganz besonders aus, und wird für Schule und Haus, für Volksbibliotheken und als Prämie gleich gut empfohlen werden können.“
(National-Zeitung.)
Verlag von Gerhard Stalling, Oldenburg i. Gr.
Stacke, Prof. Dr. Ludwig, Die französische Revolution und
das Kaisertum Napoleons I. Geschichtliche Übersicht der Zeit
von 1789 bis 1815. 660 Seiten. Geh. 4 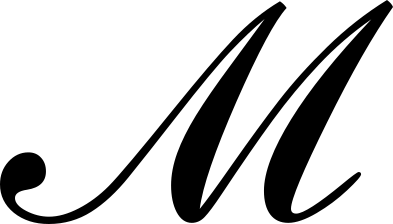 50
50  .
.
„Wir haben bereits eine große Menge Schriften aus den für Europa ewig denkwürdigen 26 Jahren gelesen, aber kaum eine unter ihnen gefunden, welche wie diese auf eine so weise und zweckmäßige Weise die gebotenen Quellen benutzt und den gegebenen reichhaltigen Stoff in so gründlicher Weise ausgearbeitet und mit einer so ruhigen Würde dem Publikum zur Beurteilung und Belehrung dargeboten hätte. Dabei ist der Stil prägnant und entschieden und die Darstellungsweise edel und männlich, würdig den großen, welterschütternden Begebenheiten der damaligen Zeit. Wir empfehlen darum auch das Buch, nicht als ob es etwas Neues, Unbekanntes enthielte, sondern vielmehr darum, weil wir das Bekannte und teilweise Miterlebte hier auf meisterhafte Weise wiedergegeben finden.“
(Münchener Neueste Nachrichten aus dem Gebiete der Politik.)
Müller, Prof. E. R., Leitfaden der unorganischen Chemie für
Gymnasien, Realgymnasien, höhere Bürgerschulen, Seminare etc.
Preis 60 
„Das Buch zerfällt in drei Abschnitte: A. Das Wichtigste aus den Hülfswissenschaften der Chemie, §§ 1–10, B. Methodischer Kursus der Chemie, §§ 11–23, C. Systematischer Kursus der Chemie, §§ 24–57. Diese Einteilung und die ihr entsprechende Durchführung machen das Buch zu einer vollkommen neuen Erscheinung in der chemischen Schulliteratur. Ganz besonders aber ist an ihm zu loben, daß die wichtigsten Lehren der Chemie in streng synthetischer Weise entwickelt sind. Die Darstellung ist präzis und klar.“
(Zeitung f. d. höhere Unterrichtswesen Deutschlands.)
Müller, Prof. E. R., Planimetrische Konstruktionsaufgaben nebst
Anleitung zu deren Lösung für höhere Schulen. 5. Aufl.,
kart. 1 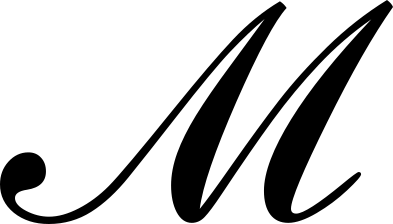
„Diese Sammlung ist trotz ihres geringen Umfanges recht reichhaltig und durchaus methodisch angelegt. — — Sie empfiehlt sich durch zweckmäßige methodische Behandlung, durch Gedrängtheit und Schärfe des Ausdrucks und durch Korrektheit, auch des Druckes. Wir zweifeln nicht, daß sich das kleine Buch neben einem Lehrbuche, welches, wie das Kamblysche, den Aufgaben nur geringe Beachtung schenkt, recht geeignet erweisen wird.“
(Zeitschrift f. d. Gymn.-Wesen.)
„Wir haben es hier mit einem Büchlein zu tun, das ebenso durch seine Kompendiosität, als durch die äußerst übersichtliche Gruppierung des behandelten Stoffes unstreitig die Sympathieen des Lesers wachruft. — — Der Referent kam bei der Durchsicht des Büchleins zu der Überzeugung, daß die Benutzung desselben in wirksamer Weise den planimetrischen Unterricht beleben und fördern dürfte.“
(Zeitschrift f. d. Realschulwesen.)
Müller, Prof. E. R., Lehr- und Übungsbuch der
Elementar-Geometrie. I. Teil (Quinta-Kursus). Geh. 40  .
.
Verlagsanträge
aus dem Gebiete der
Schulbücher-Literatur
sind
mir stets willkommen
und finden
gewissenhafte Prüfung.
End of the Project Gutenberg EBook of Erzählungen aus der Römisch
n Geschichte in biographische, by Ludwig Stacke
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ERZÄHLUNGEN AUS DER ***
***** This file should be named 61988-h.htm or 61988-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/1/9/8/61988/
Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.