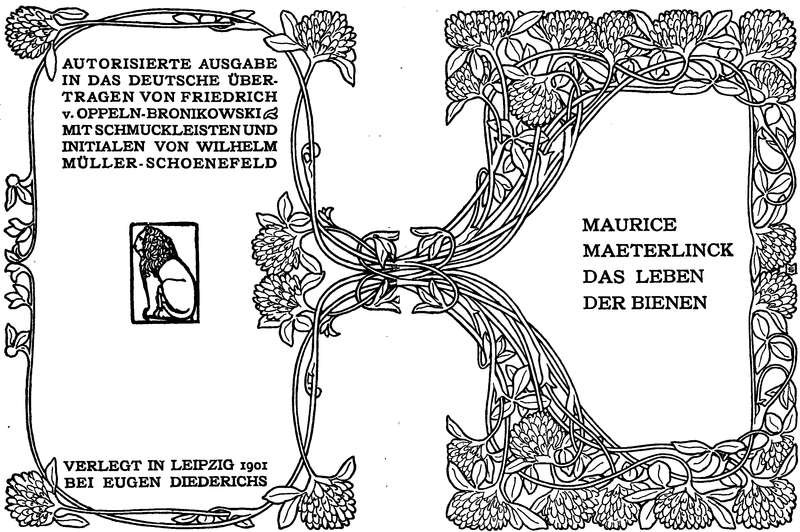
The Project Gutenberg EBook of Das Leben der Bienen, by Maurice Maeterlinck This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Das Leben der Bienen Author: Maurice Maeterlinck Illustrator: Wilhelm Müller-Schoenfeld Translator: Friedrich von Oppeln-Bronikowski Release Date: March 8, 2020 [EBook #61584] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DAS LEBEN DER BIENEN *** Produced by Jens Sadowski and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This book was produced from images made available by the HathiTrust Digital Library.
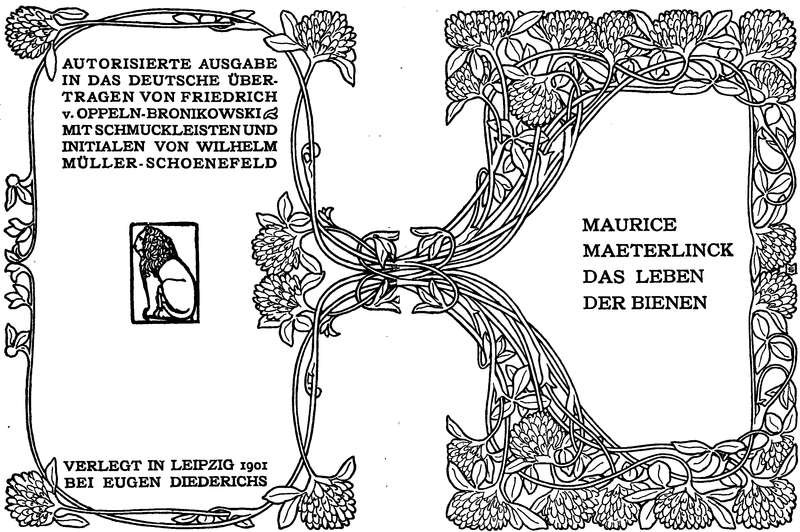
MEINEM FREUNDE
ALFRED SUTRO
GEWIDMET
AUTORISIERTE AUSGABE IN DAS DEUTSCHE ÜBERTRAGEN VON FRIEDRICH v. OPPELN-BRONIKOWSKI
MIT SCHMUCKLEISTEN UND INITIALEN VON WILHELM MÜLLER-SCHOENEFELD

VERLEGT IN LEIPZIG 1901
BEI EUGEN DIEDERICHS
MAURICE
MAETERLINCK
 Es ist kein Buch über Bienenzucht,
kein Handbuch für
Bienenzüchter, was ich hier
schreiben will. Jedes Land
besitzt treffliche Werke
dieser Art, und es wäre zwecklos, sie noch einmal
zu schreiben. In Frankreich hat man die Werke
von Dadant, Georges de Layens, Bonnier, Bertrand,
Hamet, Weber, Clément und Abbé Collin, auf englischem
Sprachgebiete die Schriften von Langstroth,
Bevan, Cook, Cheshire, Cowan und Root, in Deutschland
die des Pfarrers Dzierzon, des Barons von
Berlepsch, Pollmann, Vogel u. v. a.
Es ist kein Buch über Bienenzucht,
kein Handbuch für
Bienenzüchter, was ich hier
schreiben will. Jedes Land
besitzt treffliche Werke
dieser Art, und es wäre zwecklos, sie noch einmal
zu schreiben. In Frankreich hat man die Werke
von Dadant, Georges de Layens, Bonnier, Bertrand,
Hamet, Weber, Clément und Abbé Collin, auf englischem
Sprachgebiete die Schriften von Langstroth,
Bevan, Cook, Cheshire, Cowan und Root, in Deutschland
die des Pfarrers Dzierzon, des Barons von
Berlepsch, Pollmann, Vogel u. v. a.
Ebensowenig will ich eine wissenschaftliche Monographie über apis mellifica, ligustica, fasciata, dorsata u. s. w. schreiben, oder die Ergebnisse neuer Forschungen und Beobachtungen mitteilen. Ich werde fast nichts sagen, was nicht jedem, der sich ein wenig mit Bienenzucht befasst hat, geläufig wäre, und, um dieses Buch nicht unnütz zu beschweren, eine gewisse Anzahl von Beobachtungen und Erfahrungen, die ich in zwanzigjährigem Verkehr mit den Bienen gewonnen, mir für ein Spezialwerk vorbehalten, da sie nur von beschränktem, technischem Interesse sind. Ich will nur ganz einfach von den Bienen reden, wie man von einem vertrauten und geliebten Gegenstande redet, wenn man Nichtkenner darüber belehren will. Ich will weder die Wahrheit ausschmücken, noch, was Réaumur mit vollem Rechte allen seinen Vorgängern in der Bienenkunde vorwirft, ein hübsch erfundenes Märchen an die Stelle der ebenso wunderbaren Wirklichkeit setzen. Es giebt Wunder genug im Bienenstaat, und man braucht darum keine hinzu zu erfinden. Überdies habe ich schon lange darauf verzichtet, etwas Interessanteres und Schöneres auf dieser Welt zu finden, als die Wahrheit oder doch wenigstens das Trachten nach ihr. Ich werde im folgenden also nichts vorbringen, was ich nicht selbst erprobt habe oder was von den Klassikern der Bienenkunde nicht derartig bestätigt wird, dass jede weitere Beweisführung langweilig würde. Ich beschränke mich darauf, die Thatsachen ebenso zuverlässig wiederzugeben, nur etwas lebendiger und mit Weiterentwickelung einiger eingeflochtener, freierer Gedanken, sowie mit etwas harmonischerem Aufbau, als dies in den Handbüchern oder den wissenschaftlichen Monographien zu geschehen pflegt. Wer dies Buch ausgelesen hat, ist nicht gleich im stande, einen Bienenstock zu halten, aber er erfährt daraus nahezu alles Merkwürdige und Tiefe, alle feststehenden Einzelheiten über seine Bewohner, und zwar keineswegs auf Kosten dessen, was noch zu wissen übrig bleibt. Ich übergehe all die Fabeln, die auf dem Lande und in vielen Werken noch über die Bienen verbreitet sind. Wo Zweifel herrschen, die Meinungen auseinandergehen, etwas hypothetisch ist, wo ich zu etwas Unbekanntem komme, werde ich es ehrlich erklären. Wir werden oft vor dem Unbekannten innezuhalten haben. Ausser den grossen sichtbaren Vorgängen ihres Lebens weiss man sehr wenig über die Bienen. Je länger man sie züchtet, desto mehr wird man sich unserer tiefen Unkenntnis über ihr wirkliches Dasein bewusst, aber diese Art des Nichtwissens ist immerhin besser, als die bewusstlose und selbstzufriedene Unwissenheit.
Gab es bisher eine solche Arbeit über die Bienen? Ich glaube, nahezu alles gelesen zu haben, was über die Bienen geschrieben worden ist, aber ich kenne nichts ähnliches ausser dem Kapitel, das Michelet ihnen am Schlusse seines Werkes „Das Insekt“ widmet, und dem Essay von Ludwig Büchner, dem bekannten Verfasser von „Kraft und Stoff“, in seinem „Geistesleben der Tiere“.[1] Michelet hat den Gegenstand kaum gestreift; Büchners Studie ist ziemlich erschöpfend; aber liest man all die gewagten Behauptungen und längst widerlegten Fabeln, die er von Hörensagen berichtet, so kann man nicht umhin, zu glauben, dass er nie seine Bibliothek verlassen hat, um seine Heldinnen selbst zu befragen, und dass er nicht einen von den hundert summenden und flügelglänzenden Bienenstöcken geöffnet hat, die man vergewaltigt haben muss, bevor unser Instinkt sich ihrem Geheimnis anpasst, bevor wir mit dem Dunstkreise und dem Geiste des Mysteriums, das diese emsigen Jungfrauen bilden, vertraut werden. Das riecht weder nach Honig noch nach Bienen, und es hat denselben Mangel, wie viele unserer gelehrten Werke: die Schlüsse sind vielfach schon bekannt, und der wissenschaftliche Apparat besteht aus einer riesenhaften Anhäufung von unsicheren Geschichten aus jedermanns Munde. Indessen werde ich ihm in meiner Arbeit nicht oft begegnen; unsre Ausgangspunkte, Ansichten und Ziele liegen zu weit auseinander.
 Die Bibliographie der Bienenkunde
– denn ich möchte den Anfang
mit den Büchern machen, um sie
möglichst schnell zu erledigen und zu
der Quelle zu kommen, aus der sie
geschöpft sind – ist sehr umfangreich.
Von Urbeginn an hat dies kleine seltsame Gesellschaftstier
mit seinen komplizierten Gesetzen und seinen im
Dunkeln entstehenden Wunderwerken die Wissbegier
der Menschen gefesselt. Aristoteles, Cato,
Varro, Plinius, Columella, Palladius haben sich damit
beschäftigt, nicht zu reden von dem Philosophen
Aristomachos, der sie nach Aussage des Plinius
58 Jahre lang beobachtet hat, oder Phyliscus von
Thasos, der in öden Landstrichen lebte, um nur sie
zu sehen, und den Beinamen „der Wilde“ trug.
Aber das sind im Grunde Fabeln über die Bienen,
und alles, was der Rede wert ist, d. h. so gut wie
garnichts, findet sich zusammengefasst im vierten
Buche von Virgils „Georgica“.
Die Bibliographie der Bienenkunde
– denn ich möchte den Anfang
mit den Büchern machen, um sie
möglichst schnell zu erledigen und zu
der Quelle zu kommen, aus der sie
geschöpft sind – ist sehr umfangreich.
Von Urbeginn an hat dies kleine seltsame Gesellschaftstier
mit seinen komplizierten Gesetzen und seinen im
Dunkeln entstehenden Wunderwerken die Wissbegier
der Menschen gefesselt. Aristoteles, Cato,
Varro, Plinius, Columella, Palladius haben sich damit
beschäftigt, nicht zu reden von dem Philosophen
Aristomachos, der sie nach Aussage des Plinius
58 Jahre lang beobachtet hat, oder Phyliscus von
Thasos, der in öden Landstrichen lebte, um nur sie
zu sehen, und den Beinamen „der Wilde“ trug.
Aber das sind im Grunde Fabeln über die Bienen,
und alles, was der Rede wert ist, d. h. so gut wie
garnichts, findet sich zusammengefasst im vierten
Buche von Virgils „Georgica“.
Die Geschichte der Biene beginnt erst im 17. Jahrhundert mit den Entdeckungen des grossen holländischen Gelehrten Swammerdam. Jedoch, um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss vorausgeschickt werden, dass schon vor Swammerdam ein vlämischer Naturforscher Clutius gewisse wichtige Wahrheiten gefunden hat, z. B. dass die Königin die alleinige Mutter ihres ganzen Volkes ist und die Attribute beider Geschlechter besitzt, aber er hat dies nicht bewiesen. Swammerdam war der erste, der eine wissenschaftliche Beobachtungsmethode einführte; er schuf das Mikroskop, sezierte die Bienen zuerst und bestimmte endgültig, durch Entdeckung der Eierstöcke und des Eileiters, das Geschlecht der Königin, die man bisher für einen König („Weisel“) gehalten hatte. Er warf ein unerwartetes Licht auf die politische Verfassung des Bienenstockes, indem er sie auf die Mutterschaft begründete. Ausserdem hat er Durchschnitte entworfen und Platten gezeichnet, die so tadellos waren, dass man sie noch heute zur Illustration von Werken über Bienenzucht benutzt. Er lebte in dem geräuschvollen, trübseligen Amsterdam von ehemals, voller Sehnsucht nach „dem süssen Landleben“, und starb im Alter von 43 Jahren, von Arbeit erschöpft. In deutlicher, frommer Sprache, mit schönen, schlichten Sätzen, in denen er beständig Gott die Ehre giebt, hat er seine Beobachtungen niedergelegt; sein Hauptwerk „Bybel der Natuure“ wurde ein Jahrhundert später von Dr. Boerhave aus dem Niederländischen ins Lateinische übersetzt (unter dem Titel Biblia naturae, Leyden 1737).
Nach ihm hat Réaumur, derselben Methode getreu, in seinen Gärten in Charenton eine Menge merkwürdiger Experimente und Beobachtungen gemacht und den Bienen in seinen „Mémoires pour servir à l’Histoire des Insectes“ einen ganzen Band gewidmet. Man kann ihn noch heute mit Erfolg und ohne Langeweile lesen. Er ist klar, ehrlich, gerade, und nicht ohne einen gewissen verschlossenen und herben Reiz. Er hat es sich vor allem angelegen sein lassen, eine Reihe von alten Irrtümern zu zerstreuen, – wofür er freilich einige neue in Umlauf gesetzt hat –; er gewann einen Einblick in die Entstehung der Schwärme, die politischen Gewohnheiten der Königinnen, kurz, er fand verschiedene verwickelte Wahrheiten und wies den Weg zu anderen. Er heiligte durch seine Wissenschaft die architektonischen Wunder des Bienenstaates, und alles, was er darüber gesagt hat, kann nicht besser gesagt werden. Man verdankt ihm schliesslich den Gedanken der Kasten mit Glaswänden, der in seiner späteren Vervollkommnung das ganze häusliche Treiben dieser unermüdlichen Arbeiterinnen ans Licht gebracht hat, die, wenn sie ihr Werk in blendendem Sonnenschein beginnen, es doch nur im Finstern vollenden und krönen. Der Vollständigkeit halber wären noch die etwas späteren Untersuchungen und Arbeiten von Charles Bonnet und Schirach zu nennen, welch letzterer das Rätsel des königlichen Eis gelöst hat; aber ich will mich auf die grossen Züge beschränken und gehe darum zu François Huber über, dem Meister und Klassiker der heutigen Bienenkunde.
Huber wurde i. J. 1750 in Genf geboren und erblindete schon als Knabe. Durch Réaumurs Experimente angeregt, die er zunächst nur auf ihre Richtigkeit prüfen wollte, empfand er bald eine Leidenschaft für diese Dinge und widmete mit Hilfe eines treuen und verständigen Dieners, François Burnens, sein ganzes Leben dem Studium der Bienen. In den Annalen des menschlichen Leidens und Siegens ist nichts rührender und lehrreicher, als die Geschichte dieses geduldigen Zusammenarbeitens, wo der eine, der nur einen unstofflichen Schimmer wahrnahm, die Hände und Blicke des Anderen, der sich des wirklichen Lichtes erfreute, mit seinem Geiste lenkte, und obschon er, wie versichert wird, nie mit eigenen Augen eine Honigwabe gesehen hat, durch den Schleier dieser toten Augen hindurch, der jenen andren Schleier, in den die Natur alle Dinge hüllt, für ihn verdoppelte, dem Geiste, der diesen unsichtbaren Honigbau schuf, seine tiefsten Geheimnisse ablauschte, wie um uns zu lehren, dass wir unter keinen Umständen darauf verzichten sollten, die Wahrheit herbeizuwünschen und zu suchen. Ich will hier nicht aufzählen, was die Bienenkunde ihm alles verdankt, ich könnte leichter sagen, was sie ihm nicht verdankt. Seine „Nouvelles Observations sur les Abeilles“, von denen der erste Band i. J. 1789 in Form von Briefen an Charles Bonnet erschien – der zweite folgte erst 25 Jahre später – sind der unerschöpfliche, untrügliche Schatz für alle Bienenforscher. Gewiss enthält das Werk auch Irrtümer und Unzulänglichkeiten, es sind seit diesem Buche in der mikroskopischen Bienenkenntnis und praktischen Bienenzucht, der Behandlung der Königinnen u. s. w. manche Fortschritte gemacht worden, aber nicht eine seiner Hauptbeobachtungen ist widerlegt oder als irrig erwiesen worden; sie sind im Gegenteil die Grundlage unseres heutigen Wissens.
 Nach Hubers Entdeckungen
herrschte einige Jahre Schweigen,
aber bald entdeckte ein deutscher
Bienenzüchter, der Pfarrer Dzierzon,
von Karlsmarck in Schlesien, die jungfräuliche
Zeugung (Parthenogenesis)
und erfindet den ersten Kastenstock mit beweglichen
Waben, durch den der Imker befähigt wird, seinen
Anteil an der Honigernte zu gewinnen, ohne seine
besten Völker zu zerstören und die Arbeit eines ganzen
Jahres in einem Augenblick zu vernichten. Dieser
noch sehr unvollkommene Kastenstock ist dann von
Langstroth meisterhaft vervollkommnet worden. Er
erfand den eigentlichen beweglichen Rahmen, der
in Amerika Verbreitung fand und ausserordentliche
Erfolge erzielte. Root, Quinby, Dadant, Cheshire,
de Layens, Cowan, Heddon, Houward u. a. brachten
dann noch einige wertvolle Verbesserungen an.
Endlich erfand Mehring, um den Bienen Arbeit und
Wachs, also auch viel Honig und Zeit zu sparen,
Kunstwaben, die sie alsbald benutzten und ihren Bedürfnissen
anpassten, während Major von Hruschka
die Honigschleuder erfand, eine Centrifugalmaschine,
die den Honig ausschleudert, ohne dass die Waben
zerstört werden. Damit eröffnet sich eine neue
Periode der Bienenzucht. Die Kästen sind von dreifachem
Fassungsvermögen und dreifacher Ergiebigkeit.
Überall entstehen grosse, leistungsfähige Bienenwirtschaften.
Das unnütze Hinmorden der arbeitslustigsten
Völker und die „Auslese der Schlechtesten“,
welche die Folge davon war, hören auf. Der
Mensch bekommt die Bienen wirklich in seine Gewalt,
er kann seinen Willen durchsetzen, ohne einen
Befehl zu geben, und sie gehorchen ihm, ohne ihn
zu kennen. Er übernimmt die Rolle des Schicksals,
die sonst in der Hand der Jahreszeiten lag. Er
gleicht die Ungunst der einzelnen Jahreszeiten aus.
Er vereinigt die feindlichen Völker. Er macht reich
arm und arm reich. Er vermehrt oder verringert
die Geburten. Er regelt die Fruchtbarkeit der
Königin. Er entthront und ersetzt sie in schwer errungenem
Einvernehmen mit dem beim blossen Argwohn
einer unbegreiflichen Einmischung rasenden
Bienenvolke. Er versehrt, wenn er es für nützlich
hält, ohne Kampf das Geheimnis des Allerheiligsten
und kreuzt die kluge und weitblickende Politik des
königlichen Frauengemaches. Er bringt sie fünf
oder sechs Mal hintereinander um die Früchte ihrer
Arbeit, ohne sie zu verletzen, zu entmutigen und
arm zu machen. Er passt die Honigräume und
Speicher ihrer Wohnungen dem Ertrage der Blumenernte,
die der Frühling über die Berghänge ausstreut,
an. Er zwingt sie, die üppige Zahl der Bewerber,
welche auf die Geburt der Prinzessinnen
harren, herabzusetzen. Kurz, er thut mit ihnen,
was er will, und erreicht von ihnen, was er fordert,
vorausgesetzt, dass seine Forderungen mit ihren
Tugenden und Gesetzen übereinstimmen, denn sie
sehen über den Willen des unerwarteten Gottes hinaus,
der sich ihrer bemächtigt hat und der zu ungeheuer ist,
um erkannt, zu fremd, um begriffen zu werden,
weiter als dieser Gott selbst, und sind nur darauf
bedacht, in unermüdlicher Selbstverleugnung die
geheimnisvolle Pflicht gegen die Gattung zu erfüllen.
Nach Hubers Entdeckungen
herrschte einige Jahre Schweigen,
aber bald entdeckte ein deutscher
Bienenzüchter, der Pfarrer Dzierzon,
von Karlsmarck in Schlesien, die jungfräuliche
Zeugung (Parthenogenesis)
und erfindet den ersten Kastenstock mit beweglichen
Waben, durch den der Imker befähigt wird, seinen
Anteil an der Honigernte zu gewinnen, ohne seine
besten Völker zu zerstören und die Arbeit eines ganzen
Jahres in einem Augenblick zu vernichten. Dieser
noch sehr unvollkommene Kastenstock ist dann von
Langstroth meisterhaft vervollkommnet worden. Er
erfand den eigentlichen beweglichen Rahmen, der
in Amerika Verbreitung fand und ausserordentliche
Erfolge erzielte. Root, Quinby, Dadant, Cheshire,
de Layens, Cowan, Heddon, Houward u. a. brachten
dann noch einige wertvolle Verbesserungen an.
Endlich erfand Mehring, um den Bienen Arbeit und
Wachs, also auch viel Honig und Zeit zu sparen,
Kunstwaben, die sie alsbald benutzten und ihren Bedürfnissen
anpassten, während Major von Hruschka
die Honigschleuder erfand, eine Centrifugalmaschine,
die den Honig ausschleudert, ohne dass die Waben
zerstört werden. Damit eröffnet sich eine neue
Periode der Bienenzucht. Die Kästen sind von dreifachem
Fassungsvermögen und dreifacher Ergiebigkeit.
Überall entstehen grosse, leistungsfähige Bienenwirtschaften.
Das unnütze Hinmorden der arbeitslustigsten
Völker und die „Auslese der Schlechtesten“,
welche die Folge davon war, hören auf. Der
Mensch bekommt die Bienen wirklich in seine Gewalt,
er kann seinen Willen durchsetzen, ohne einen
Befehl zu geben, und sie gehorchen ihm, ohne ihn
zu kennen. Er übernimmt die Rolle des Schicksals,
die sonst in der Hand der Jahreszeiten lag. Er
gleicht die Ungunst der einzelnen Jahreszeiten aus.
Er vereinigt die feindlichen Völker. Er macht reich
arm und arm reich. Er vermehrt oder verringert
die Geburten. Er regelt die Fruchtbarkeit der
Königin. Er entthront und ersetzt sie in schwer errungenem
Einvernehmen mit dem beim blossen Argwohn
einer unbegreiflichen Einmischung rasenden
Bienenvolke. Er versehrt, wenn er es für nützlich
hält, ohne Kampf das Geheimnis des Allerheiligsten
und kreuzt die kluge und weitblickende Politik des
königlichen Frauengemaches. Er bringt sie fünf
oder sechs Mal hintereinander um die Früchte ihrer
Arbeit, ohne sie zu verletzen, zu entmutigen und
arm zu machen. Er passt die Honigräume und
Speicher ihrer Wohnungen dem Ertrage der Blumenernte,
die der Frühling über die Berghänge ausstreut,
an. Er zwingt sie, die üppige Zahl der Bewerber,
welche auf die Geburt der Prinzessinnen
harren, herabzusetzen. Kurz, er thut mit ihnen,
was er will, und erreicht von ihnen, was er fordert,
vorausgesetzt, dass seine Forderungen mit ihren
Tugenden und Gesetzen übereinstimmen, denn sie
sehen über den Willen des unerwarteten Gottes hinaus,
der sich ihrer bemächtigt hat und der zu ungeheuer ist,
um erkannt, zu fremd, um begriffen zu werden,
weiter als dieser Gott selbst, und sind nur darauf
bedacht, in unermüdlicher Selbstverleugnung die
geheimnisvolle Pflicht gegen die Gattung zu erfüllen.
 Nachdem uns die Bücher nunmehr
das Wesentlichste gesagt haben,
was sie uns über eine sehr alte Geschichte
zu sagen hatten, lassen wir
die durch andere erworbene Erfahrungsweisheit
fallen und sehen uns die
Bienen selbst einmal an. Eine Stunde im Bienenstock
sagt uns vielleicht Dinge, die zwar weniger gewiss,
aber ungleich lebendiger und fruchtbarer sind.
Nachdem uns die Bücher nunmehr
das Wesentlichste gesagt haben,
was sie uns über eine sehr alte Geschichte
zu sagen hatten, lassen wir
die durch andere erworbene Erfahrungsweisheit
fallen und sehen uns die
Bienen selbst einmal an. Eine Stunde im Bienenstock
sagt uns vielleicht Dinge, die zwar weniger gewiss,
aber ungleich lebendiger und fruchtbarer sind.
Ich habe den ersten Bienenstand, den ich zu Gesichte bekommen und an dem ich die Bienen lieben gelernt habe, noch nicht vergessen. Es ist manches Jahr darüber verflossen. Es war in einem grossen Dorfe im flandrischen Seeland, jenem reinlichen und anmutigen Erdenwinkel, der noch kräftigere Farben entwickelt, als das eigentliche Seeland, der Hohlspiegel Hollands, und das Auge gefangen nimmt mit dem allerliebsten, tiefernsten Spielzeug seiner Tauben und Türme, seiner bemalten Wagen, seiner Wandschränke und Stutzuhren, die aus dem Dunkel der Korridore hervorleuchten, seiner Grachten und Kanäle mit ihren Spalier bildenden kleinen Bäumen, die auf eine fromme, kindliche Zeremonie zu warten scheinen, seiner Barken und Marktschiffe mit geschnitztem Bug, seiner buntfarbigen Fenster und Thüren, seiner prächtigen Schleusen und schwarzgetheerten Zugbrücken, seiner schmucken Häuschen, die wie glänzende, zartgetönte Topfwaaren leuchten, und aus denen Weiber wie grosse Klingeln, mit Gold- und Silberschmuck behängt, heraustreten, um auf die weissumzäunten Wiesen zu gehen und die Kühe zu melken, oder Wäsche auf dem in Ovale oder schräge Vierecke geteilten und peinlich grünen, blumenreichen Rasenteppich auszubreiten.
Ein alter Weiser, an den Greis Vergils erinnernd,
„Ein Mann, den Kön’gen gleich, ein Mann, den Göttern nah,
Und ruhig und zufrieden gleich wie diese“.
würde Lafontaine sagen, hatte sich dorthin zurückgezogen, wo das Leben enger scheinen könnte, als wo anders, wenn es möglich wäre, das Leben wirklich einzuschränken, und hatte seinen Alterssitz dort aufgeschlagen, nicht lebensmüde zwar, – denn der Weise kennt keine Lebensmüdigkeit, – aber ein wenig müde, die Menschen zu befragen, denn sie antworten weniger einfältig als Tier und Pflanze auf die einzigen Fragen von Belang, die man der Natur über ihre wahren Gesetze stellen kann. Sein ganzes Glück, wie das des Philosophen Skytha, bestand in einem schönen Garten, und unter dessen Schönheiten liebte er am meisten und besuchte er am häufigsten einen Bienenstand von zwölf Strohglocken, die er mit hellem Gelb, Rosenrot und vor allem mit zartem Blau angestrichen hatte, denn er wusste schon lange vor den Experimenten von Sir John Lubbock, dass Blau die Lieblingsfarbe der Bienen ist. Der Bienenstand befand sich an der Hausmauer, im Winkel einer jener kühlen und leckeren holländischen Küchen mit Porzellanbrettern an den Wänden und leuchtendem Zinn- und Kupfergeschirr darauf, das sich durch die offene Hausthür in einem stillen Kanal spiegelte. Und der Blick glitt über den Wasserspiegel mit seinen häuslichen Bildern, die ein Rahmen von Pappelbäumen umschloss, und fand seinen Ruhepunkt am Horizont mit seinen Mühlen und Weidetriften.
Hier wie überall, wo man sie aufstellt, hatten die Bienenstöcke den Blumen, der Stille, der milden Luft, den Sonnenstrahlen eine neue Bedeutung verliehen. Man griff hier mit Händen das festliche Gleichnis der hohen Sommertage. Man ruhte unter dem funkelnden Kreuzweg, von welchem die luftigen Strassen ausstrahlen, die sie vom Morgen bis zum Abend, mit allen Düften der Fluren beladen, geschäftig durchsummen. Man lauschte der heiteren, sichtbaren Seele, der klugen, wohlklingenden Stimme, man sah den Brennpunkt der Freude der sommerlichen Gartenlust. Man lernte in der Schule der Bienen das geheimnisvolle Weben der Natur, die Fäden, die sich zwischen ihren drei Reichen knüpfen, die unermüdliche Selbstgestaltung des Lebens, die Moral der selbstlosen, eifrigen Arbeit, und was ebensoviel wert ist, wie diese: die heroischen Arbeiterinnen lehrten den Geschmack an der unbestimmten Süssigkeit der Musse, sie unterstrichen mit ihren tausend kleinen Flügeln wie mit Feuerzeichen die fast unstoffliche Wonne jener jungfräulichen Tage, die in ewig gleicher Reinheit und Klarheit wiederkehren, ohne Erinnerungen zu hinterlassen, wie ein zu reines Glück.
 Wir beginnen, um die Geschichte
des Bienenstaates im Kreislaufe
des Jahres so einfach wie möglich
zu erzählen, mit dem Erwachen im
Lenz und dem Wiederbeginn der
Arbeit, und wir werden die Hauptstadien
des Bienenlebens in ihrer natürlichen Reihenfolge
einander ablösen sehen: das Schwärmen und
was ihm vorangeht, die Gründung der neuen Stadt,
Geburt, Kämpfe und Hochzeitsausflug der jungen
Königinnen, die Drohnenschlacht und die Wiederkehr
des Winterschlafes. Jede dieser Episoden erfordert
die nötigen Erklärungen der Gesetze, Eigentümlichkeiten,
Gewohnheiten und Ereignisse, die
sie verursachen oder sie begleiten, sodass wir am
Ende des Bienenjahres, das vom April bis Ende
September reicht, alle Geheimnisse des Honigstaates
kennen werden.
Wir beginnen, um die Geschichte
des Bienenstaates im Kreislaufe
des Jahres so einfach wie möglich
zu erzählen, mit dem Erwachen im
Lenz und dem Wiederbeginn der
Arbeit, und wir werden die Hauptstadien
des Bienenlebens in ihrer natürlichen Reihenfolge
einander ablösen sehen: das Schwärmen und
was ihm vorangeht, die Gründung der neuen Stadt,
Geburt, Kämpfe und Hochzeitsausflug der jungen
Königinnen, die Drohnenschlacht und die Wiederkehr
des Winterschlafes. Jede dieser Episoden erfordert
die nötigen Erklärungen der Gesetze, Eigentümlichkeiten,
Gewohnheiten und Ereignisse, die
sie verursachen oder sie begleiten, sodass wir am
Ende des Bienenjahres, das vom April bis Ende
September reicht, alle Geheimnisse des Honigstaates
kennen werden.
Vorderhand, ehe ich einen Bienenstock öffne, um einen allgemeinen Blick darauf zu werfen, mag es genügen zu wissen, dass er sich aus einer Königin, der Mutter des ganzen Volkes, vielen tausend Arbeitsbienen, d. h. unentwickelten und unfruchtbaren Weibchen, und einigen hundert männlichen Bienen oder Drohnen zusammensetzt. Aus den letzteren geht der einzige unglückliche Auserwählte der künftigen Herrscherin hervor, welche die Bienen nach dem mehr oder minder unfreiwilligen Scheiden der alten Königin auf den Thron erheben.

 Wenn man zum ersten Male
einen Bienenstock öffnet, so verspürt
man etwas von der Erregung, die
einen stets befällt, wenn man etwas
Unbekanntes vergewaltigt, das voll
von furchtbaren Überraschungen sein
kann, wie z. B. ein Grab. Es spinnt sich um die
Bienen eine Fabel von Gefahren und Drohungen.
Man hat eine unbestimmte Erinnerung an die Bienenstiche,
die einen zu eigenen Schmerz verursachen,
als dass man wüsste, womit man ihn vergleichen
soll; es ist ein trockenes, zuckendes Brennen, eine
Art Wüstensonnenbrand, möchte man sagen, der
sich bald über den ganzen Körperteil verbreitet.
Es ist, als ob diese Sonnenkinder aus den glühendsten
Strahlen ihrer Mutter ein leuchtendes Gift gesogen
hätten, um die Schätze der Süssigkeit, die sie in
ihren segenspendenden Stunden sammeln, desto wirksamer
zu verteidigen.
Wenn man zum ersten Male
einen Bienenstock öffnet, so verspürt
man etwas von der Erregung, die
einen stets befällt, wenn man etwas
Unbekanntes vergewaltigt, das voll
von furchtbaren Überraschungen sein
kann, wie z. B. ein Grab. Es spinnt sich um die
Bienen eine Fabel von Gefahren und Drohungen.
Man hat eine unbestimmte Erinnerung an die Bienenstiche,
die einen zu eigenen Schmerz verursachen,
als dass man wüsste, womit man ihn vergleichen
soll; es ist ein trockenes, zuckendes Brennen, eine
Art Wüstensonnenbrand, möchte man sagen, der
sich bald über den ganzen Körperteil verbreitet.
Es ist, als ob diese Sonnenkinder aus den glühendsten
Strahlen ihrer Mutter ein leuchtendes Gift gesogen
hätten, um die Schätze der Süssigkeit, die sie in
ihren segenspendenden Stunden sammeln, desto wirksamer
zu verteidigen.
Freilich, wird ein Bienenstock ohne Vorsichtsmassregeln geöffnet, von einem, der weder Charakter noch Sitten seiner Bewohner kennt und achtet, so verwandelt er sich im Nu in einen feurigen Busch von Zorn und Heldenmut. Aber es lernt sich nichts leichter als das bischen Geschicklichkeit, das erforderlich ist, um ihn ungestraft zu vergewaltigen. Es genügt etwas Rauch, den man von Zeit zu Zeit hineinbläst, etwas Kaltblütigkeit und Sanftheit, und die wohlbewehrten Arbeiterinnen lassen sich ausplündern, ohne daran zu denken, ihren Stachel zu zücken. Sie erkennen ihren Herrn nicht, wie behauptet worden ist, sie fürchten den Menschen nicht, aber wenn sie den Rauch riechen und die ruhigen Bewegungen in ihrer Wohnung sehen, so bilden sie sich ein, dass es sich nicht um einen Angriff oder einen Feind handelt, gegen den sie sich verteidigen können, sondern um eine Naturkraft oder Katastrophe, in die sie sich fügen müssen. Statt einen fruchtlosen Kampf zu wagen, wollen sie in ihrer diesmal getäuschten Klugheit wenigstens die Zukunft retten: sie stürzen sich auf die Honigvorräte und schlucken möglichst viel davon herunter, um sie wo anders, gleichgültig wo, aber sofort, zur Gründung einer neuen Stadt zu verwerten, wenn die alte zerstört ist oder sie gezwungen sind, sie aufzugeben.
 Der Laie pflegt zuerst einigermassen
enttäuscht zu sein, wenn
man ihm Einblick in einen Beobachtungskasten[2]
gewährt. Man hatte
ihm versprochen, dass dieser Kasten
ein ungeheures Maass von Thatkraft,
eine Unzahl von weisen Gesetzen, eine erstaunliche
Fülle von Geist, dass er Mysterien, Erfahrungen,
Berechnungen, Wissen und Gewerbfleiss
der verschiedensten Art, weise Voraussichten, Gewissheiten
und Gewohnheiten voller Klugheit und
eine Menge von seltsamen Tugenden und Gefühlen
enthielte. Und nun erblickt er nur ein Gekribbel
von rötlichen Beeren, die wie geröstete Kaffeebohnen
aussehen, oder wie Rosinen, die massenhaft
an den Scheiben sitzen. Sie scheinen mehr tot als
lebendig und ihre Bewegungen sind langsam, unzusammenhängend
und unverständlich. Er erkennt
die herrlichen Lichttropfen nicht wieder, die noch eben
ohne Unterlass in den gold- und perlenschimmernden
Schoss von tausend geöffneten Blumenkelchen hinabtauchten
und wieder hervorkamen. Sie zittern anscheinend
in der Finsternis. Sie ersticken in einer
unbeweglichen Menge; man möchte sagen, sie sind
wie kranke Gefangene oder entthronte Königinnen,
die nur einen glänzenden Augenblick unter den
leuchtenden Blumen des Gartens leben, um alsbald
in das scheussliche Elend ihres armseligen, engen
Kerkers zurückzukehren.
Der Laie pflegt zuerst einigermassen
enttäuscht zu sein, wenn
man ihm Einblick in einen Beobachtungskasten[2]
gewährt. Man hatte
ihm versprochen, dass dieser Kasten
ein ungeheures Maass von Thatkraft,
eine Unzahl von weisen Gesetzen, eine erstaunliche
Fülle von Geist, dass er Mysterien, Erfahrungen,
Berechnungen, Wissen und Gewerbfleiss
der verschiedensten Art, weise Voraussichten, Gewissheiten
und Gewohnheiten voller Klugheit und
eine Menge von seltsamen Tugenden und Gefühlen
enthielte. Und nun erblickt er nur ein Gekribbel
von rötlichen Beeren, die wie geröstete Kaffeebohnen
aussehen, oder wie Rosinen, die massenhaft
an den Scheiben sitzen. Sie scheinen mehr tot als
lebendig und ihre Bewegungen sind langsam, unzusammenhängend
und unverständlich. Er erkennt
die herrlichen Lichttropfen nicht wieder, die noch eben
ohne Unterlass in den gold- und perlenschimmernden
Schoss von tausend geöffneten Blumenkelchen hinabtauchten
und wieder hervorkamen. Sie zittern anscheinend
in der Finsternis. Sie ersticken in einer
unbeweglichen Menge; man möchte sagen, sie sind
wie kranke Gefangene oder entthronte Königinnen,
die nur einen glänzenden Augenblick unter den
leuchtenden Blumen des Gartens leben, um alsbald
in das scheussliche Elend ihres armseligen, engen
Kerkers zurückzukehren.
Es ist mit ihnen, wie mit allen tiefen Realitäten. Man muss sie beobachten lernen. Wenn ein Bewohner einer andren Welt auf die Erde herabkäme und sähe, wie die Menschen durch die Strassen gehen, wie sie sich um einzelne Gebäude schaaren oder auf gewissen Plätzen zusammendrängen, wie sie ohne auffällige Gebärden in ihren Wohnungen sitzen und harren, so würde er auch zu dem Schlusse kommen, dass sie träge und bedauernswert sind. Mit der Zeit erst beginnt man die vielseitige Thätigkeit, die in dieser Trägheit liegt, zu erkennen.
In Wahrheit arbeitet jede dieser fast unbeweglichen kleinen Bienen unermüdlich, und jede thut etwas andres. Keine kennt die Ruhe, und gerade die z. B., welche scheinbar eingeschlafen sind und wie leblose Trauben an den Scheiben hängen, haben die geheimnisvollste und ermüdendste Arbeit zu verrichten, sie bereiten das Wachs. Aber wir werden auf diese Einzelheiten ihrer streng geteilten Thätigkeit bald näher eingehen. Inzwischen genügt es, die Aufmerksamkeit auf den Hauptcharakterzug der Bienen zu lenken, durch den sich das enge Beieinandersitzen in dieser mannigfachen Thätigkeit erklärt. Die Biene ist vor allem und mehr noch als die Ameise ein Gesellschaftstier, sie kann nur zu vielen leben. Wenn sie aus dem dichtbesetzten Stocke ausfliegt, so muss sie sich mit dem Kopfe einen Weg durch die lebenden Mauern bahnen, die sie umschliessen, und verlässt damit ihr eigentliches Element. Sie taucht einen Augenblick in den blumenreichen Raum, wie der Schwimmer in den perlenreichen Ocean, aber sie muss, wenn ihr das Leben lieb ist, von Zeit zu Zeit wieder in den Dunstkreis ihrer Gefährtinnen zurück, wie der Schwimmer wieder auftaucht, um Luft zu schöpfen. Bleibt sie allein, so geht sie auch bei den günstigsten Temperaturverhältnissen und dem grössten Blumenreichtum in wenigen Stunden zu Grunde, nicht infolge von Hunger oder Kälte, sondern von Einsamkeit. Die Menge ihrer Schwestern, der Bienenstock, ist für sie ein zwar unsichtbares, aber nicht weniger unentbehrliches Nahrungsmittel als der Honig. Dieses Bedürfnis muss man sich gegenwärtig halten, will man den Geist der Gesetze des Bienenstaates erfassen. Das Individuum gilt im Bienenstock nichts, es hat nur ein Dasein aus zweiter Hand, es ist gleichsam ein nebensächlicher Faktor, ein geflügeltes Organ der Gattung. Sein ganzes Leben ist eine vollständige Aufopferung für das unzählige, beharrende Wesen, zu dem es gehört. Sonderbarerweise lässt sich feststellen, dass dies nicht immer so war. Man findet auch heute noch unter den Honigwespen alle Stadien der schrittweisen Entwickelung unserer Hausbiene vor. Auf der untersten Stufe arbeitet sie allein im Elend; oft erblickt sie nicht einmal ihre Nachkommenschaft (wie bei den Prosopis und Colletes), bisweilen lebt sie im engen Familienkreise mit ihrer jährlichen Brut (wie bei den Hummeln), vereinigt sich dann vorübergehend zu Gesellschaften (Grabbienen, Hosenbienen, Ballenbienen) und erreicht schliesslich, von Stufe zu Stufe steigend, die nahezu vollkommene Gesellschaftsform unserer Bienenstöcke, wo das Individuum vollständig in der Gesamtheit aufgeht und die Gesamtheit wiederum der abstrakten, unsterblichen Gesellschaft der Zukunft geopfert wird.
 Hüten wir uns, aus diesen
Thatsachen voreilige Schlüsse auf den
Menschen zu ziehen. Der Mensch hat
das Vermögen, sich den Naturgesetzen
nicht zu fügen. Ob es Recht
oder Unrecht ist, von diesem Vermögen
Gebrauch zu machen: das ist der wichtigste, aber
auch der unaufgeklärteste Punkt unserer Moral.
Inzwischen ist es nicht belanglos, den Willen der
Natur in einer anders gearteten Welt zu belauschen,
und gerade bei den Honigwespen, die nächst dem
Menschen unzweifelhaft die intelligentesten Bewohner
dieses Erdballes sind, tritt dieser Wille
sehr deutlich zu Tage. Er trachtet sichtlich nach
Veredelung der Art, aber er zeigt auch, dass er
diese nur auf Kosten der individuellen Freiheit
und des individuellen Glückes erreichen will oder
kann. In dem Maasse, wie die Gesellschaft sich
organisiert und erhebt, wird dem Sonderleben eines
jeden ihrer Glieder ein immer engerer Kreis gezogen.
Wo ein Fortschritt eintritt, geschieht dies durch
ein immer vollkommeneres Opfer der persönlichen zu
Gunsten der allgemeinen Interessen. Zunächst muss
ein jedes Individuum auf eigenmächtige Laster verzichten.
So findet man auf der vorletzten Kulturstufe
der Bienen die Hummeln, die unseren Menschenfressern
zu vergleichen sind: die ausgewachsenen
Arbeiterinnen stellen nämlich unaufhörlich den Eiern
nach, um sie zu fressen, und die Mutter muss sie
mit aller Energie dagegen verteidigen. Ferner muss
sich jedes Individuum, nachdem es die gefährlichsten
Laster abgelegt hat, eine Anzahl von immer strenger
gefassten Tugenden zu eigen machen. Die Arbeiterinnen
bei den Hummeln lassen es sich z. B.
noch nicht einfallen, der Liebe zu entsagen, während
unsere Hausbiene in unbedingter Keuschheit lebt.
Nun, wir werden ja bald sehen, was sie alles in
Tausch giebt für das Wohlbefinden, die Sicherheit,
die architektonische, ökonomische und politische
Vollkommenheit des Bienenstockes, und wir kommen
auf den Entwicklungsgang der Honigwespen in dem
Kapitel über den „Fortschritt der Art“ noch einmal
zurück.
Hüten wir uns, aus diesen
Thatsachen voreilige Schlüsse auf den
Menschen zu ziehen. Der Mensch hat
das Vermögen, sich den Naturgesetzen
nicht zu fügen. Ob es Recht
oder Unrecht ist, von diesem Vermögen
Gebrauch zu machen: das ist der wichtigste, aber
auch der unaufgeklärteste Punkt unserer Moral.
Inzwischen ist es nicht belanglos, den Willen der
Natur in einer anders gearteten Welt zu belauschen,
und gerade bei den Honigwespen, die nächst dem
Menschen unzweifelhaft die intelligentesten Bewohner
dieses Erdballes sind, tritt dieser Wille
sehr deutlich zu Tage. Er trachtet sichtlich nach
Veredelung der Art, aber er zeigt auch, dass er
diese nur auf Kosten der individuellen Freiheit
und des individuellen Glückes erreichen will oder
kann. In dem Maasse, wie die Gesellschaft sich
organisiert und erhebt, wird dem Sonderleben eines
jeden ihrer Glieder ein immer engerer Kreis gezogen.
Wo ein Fortschritt eintritt, geschieht dies durch
ein immer vollkommeneres Opfer der persönlichen zu
Gunsten der allgemeinen Interessen. Zunächst muss
ein jedes Individuum auf eigenmächtige Laster verzichten.
So findet man auf der vorletzten Kulturstufe
der Bienen die Hummeln, die unseren Menschenfressern
zu vergleichen sind: die ausgewachsenen
Arbeiterinnen stellen nämlich unaufhörlich den Eiern
nach, um sie zu fressen, und die Mutter muss sie
mit aller Energie dagegen verteidigen. Ferner muss
sich jedes Individuum, nachdem es die gefährlichsten
Laster abgelegt hat, eine Anzahl von immer strenger
gefassten Tugenden zu eigen machen. Die Arbeiterinnen
bei den Hummeln lassen es sich z. B.
noch nicht einfallen, der Liebe zu entsagen, während
unsere Hausbiene in unbedingter Keuschheit lebt.
Nun, wir werden ja bald sehen, was sie alles in
Tausch giebt für das Wohlbefinden, die Sicherheit,
die architektonische, ökonomische und politische
Vollkommenheit des Bienenstockes, und wir kommen
auf den Entwicklungsgang der Honigwespen in dem
Kapitel über den „Fortschritt der Art“ noch einmal
zurück.

 Die Bienen des von uns erwählten
Bienenstockes haben
also die Starre des
Winterschlafes abgeschüttelt.
Die Königin beginnt
von Anfang Februar an wieder Eier zu legen. Die
Arbeitsbienen befliegen die Anemonen, Narzissen,
Veilchen, Salweiden und Haselnusssträucher. Der
Frühling hält seinen Einzug, die Speicher und Keller
strotzen wieder von Honig und Blütenstaub, und
tausende von Bienen erblicken täglich das Licht der
Welt. Die ungeschlachten Drohnen kriechen aus
ihren grossen Zellen, laufen auf den Waben herum,
und der Bevölkerungszuwachs der Stadt wird bald
so gross, dass hunderte von Arbeitsbienen, wenn
sie abends vom Felde heimkehren, kein Unterkommen
mehr finden und genötigt sind, die Nacht
auf der Schwelle zuzubringen, wo viele vor Kälte
sterben.
Die Bienen des von uns erwählten
Bienenstockes haben
also die Starre des
Winterschlafes abgeschüttelt.
Die Königin beginnt
von Anfang Februar an wieder Eier zu legen. Die
Arbeitsbienen befliegen die Anemonen, Narzissen,
Veilchen, Salweiden und Haselnusssträucher. Der
Frühling hält seinen Einzug, die Speicher und Keller
strotzen wieder von Honig und Blütenstaub, und
tausende von Bienen erblicken täglich das Licht der
Welt. Die ungeschlachten Drohnen kriechen aus
ihren grossen Zellen, laufen auf den Waben herum,
und der Bevölkerungszuwachs der Stadt wird bald
so gross, dass hunderte von Arbeitsbienen, wenn
sie abends vom Felde heimkehren, kein Unterkommen
mehr finden und genötigt sind, die Nacht
auf der Schwelle zuzubringen, wo viele vor Kälte
sterben.
Eine allgemeine Unruhe ergreift das Volk, und die alte Königin gerät in Aufregung. Sie ahnt, dass sich ein neues Schicksal vorbereitet. Sie hat ihre Pflicht als Mutter gewissenhaft gethan, und nun führt ihre Pflichterfüllung zu Verwirrung und Trübsal. Eine unabweisliche Notwendigkeit bedroht ihre Ruhe: bald wird sie die Stadt ihrer Herrschaft verlassen müssen. Und doch ist diese Stadt ihr Werk, ihr eigenstes Ich. Sie ist keine Königin im menschlichen Sinne. Sie giebt keine Befehle; sie ist, wie die letzte ihrer Unterthanen, einer verhüllten Gewalt von überlegener Weisheit unterworfen, die wir einstweilen, bis wir sie zu entschleiern versuchen, den „Geist des Bienenstockes“ nennen wollen. Sie ist die alleinige Mutter und das Werkzeug der Liebe. Sie hat die Stadt in Unsicherheit und Armut gegründet. Sie hat sie unaufhörlich mit ihrem eignen Fleisch und Blut bevölkert, und alles, was darinnen lebt, – Arbeitsbienen, Drohnen, Larven, Nymphen und die jungen Prinzessinnen, deren baldiges Ausschlüpfen ihren Aufbruch beschleunigen wird und deren eine ihr vom „Geiste des Bienenstockes“ schon zur Nachfolgerin bestimmt ist, – ist aus ihren Weichen hervorgegangen.
 Wo befindet sich dieser „Geist
des Bienenstockes“ und wo hat er
seinen Sitz? Er ist nicht wie der
individuelle Instinkt des Vogels, der
sein Nest mit Geschicklichkeit baut
und andere Himmelsstriche aufzusuchen
weiss, wenn der Tag des Wanderns wieder
angebrochen ist. Er ist ebensowenig eine mechanische
Gewohnheit der Gattung, die nur vom
blinden Lebenswillen beseelt ist und sich an allen
Ecken des Zufalls stösst, sobald ein unvorhergesehener
Umstand die Abfolge der gewohnten Erscheinungen
durchbricht. Im Gegenteil, er folgt Schritt für
Schritt den allmächtigen Umständen, wie ein kluger
und geschickter Sklave, der auch die gefährlichsten
Befehle seines Herrn sich zum Vorteil zu wenden
weiss.
Wo befindet sich dieser „Geist
des Bienenstockes“ und wo hat er
seinen Sitz? Er ist nicht wie der
individuelle Instinkt des Vogels, der
sein Nest mit Geschicklichkeit baut
und andere Himmelsstriche aufzusuchen
weiss, wenn der Tag des Wanderns wieder
angebrochen ist. Er ist ebensowenig eine mechanische
Gewohnheit der Gattung, die nur vom
blinden Lebenswillen beseelt ist und sich an allen
Ecken des Zufalls stösst, sobald ein unvorhergesehener
Umstand die Abfolge der gewohnten Erscheinungen
durchbricht. Im Gegenteil, er folgt Schritt für
Schritt den allmächtigen Umständen, wie ein kluger
und geschickter Sklave, der auch die gefährlichsten
Befehle seines Herrn sich zum Vorteil zu wenden
weiss.
Er verfügt ohne Rücksicht, aber gewissenhaft, als wäre ihm eine grosse Pflicht auferlegt, über Wohlstand und Glück, Leben und Freiheit dieses geflügelten Völkchens. Er bestimmt Tag für Tag die Zahl der Geburten und zwar genau nach der Blumenzahl, die auf den Fluren blüht. Er sagt der Königin, dass sie verbraucht ist oder dass sie ausschwärmen muss, er zwingt sie, ihren Nebenbuhlerinnen das Leben zu geben, erhebt diese zu Königinnen, schirmt sie vor dem politischen Hass ihrer Mutter und veranlasst oder verhindert, – je nach der Fülle des Blumensegens, dem früheren oder späteren Eintreten des Frühjahrs und den beim Hochzeitsflug zu befürchtenden Gefahren, – dass die erstgeborene unter den jungfräulichen Prinzessinnen ihre jüngeren Schwestern in der Wiege tötet. Oder auch bei vorgerückter Jahreszeit, wenn die Blumenstunden kürzer werden, gebietet er den Arbeitsbienen, die ganze königliche Brut zu vernichten, damit die Ära der Umwälzungen ein Ende hat und die fruchtbringende Arbeit wieder aufgenommen wird. Er ist ein Geist der Vorsicht und Sparsamkeit, aber nicht des Geizes. Er weiss anscheinend um die verhängnisvollen und etwas vernunftwidrigen Naturgesetze der Liebe, und duldet darum in den reichen Sommertagen, in denen die junge Königin ihren Liebhaber suchen geht, das Vorhandensein von drei- oder vierhundert thörichten, ungeschickten, bei aller Geschäftigkeit nur hinderlichen, anspruchvollen, schamlos müssigen, lärmenden, gefrässigen, groben, unsauberen, unersättlichen und ungeschlachten Drohnen. Aber sobald die Königin befruchtet ist, die Blumen ihre Kelche später öffnen und früher schliessen, ordnet er eines Tages gelassen an, dass sie alle miteinander ermordet werden. Er regelt die Arbeit jeder Biene nach ihrem Alter, er bestimmt die einen zur Pflege der Brut, die anderen zur königlichen Leibwache, welche die Königin zu unterhalten hat und sie nie aus den Augen verlieren darf, wieder andere zum Ventilieren: sie lüften mit ihren Flügeln den Stock, führen ihm Wärme oder Kälte zu und beschleunigen die Verdunstung des dem Honig zuviel zugesetzten Wassers; wieder andre verwertet er als Architekten, Maurer und Steinmetzen; sie hängen sich in Ketten auf, um Wachs zu bereiten, und bauen die Waben, während ein anderer Schwarm ausfliegt und einträgt: Nektar, der zu Honig verarbeitet wird, Blütenstaub zum Futterbrei für die Brut, und Stopfwachs (Propolis) zum Verkleben und Befestigen der Bauten. Er weist den Chemikern im Bienenstaate ihre Aufgabe an: den Honig haltbar zu machen, indem sie einen Tropfen Ameisensäure in die gefüllten Zellen thun, den Arbeiterinnen, welche diese Zellen verdeckeln, den Strassenkehrerinnen, die Strassen und Plätze in musterhafter Ordnung halten, den Totengräberinnen, welche die Leichen fortschaffen, und den Amazonen der Schildwache, die Tag und Nacht für Sicherheit des Eingangs sorgen, die Kommenden und Gehenden befragen, sich die jungen Bienen beim ersten Ausfluge merken, die Landstreicher, Bettler und Räuber fortjagen, Eindringlinge austreiben, gefürchtete Feinde in Masse angreifen und nötigenfalls das Flugloch verbarrikadieren.
Endlich bestimmt er die Stunde, wo dem Genius der Art das grosse Jahresopfer gebracht wird, ich meine das Schwärmen, wo das ganze Volk, auf dem Gipfel seiner Macht und seines Gedeihens angelangt, der nächsten Generation plötzlich alles überlässt, seine Schätze und Paläste, seine Wohnungen und die Frucht seiner Arbeit, um fern im Ungewissen und Öden eine neue Heimat zu suchen. Es ist dies ein Akt, der – bewusst oder unbewusst – über die menschliche Moral hinausgeht. Bisweilen zerstört er, immer verarmt er, und sicher zerreisst er das glückgesegnete Volk, damit es einem höheren Gesetze gehorche, als das Gedeihen der Stadt ist. Wo entsteht dieses Gesetz, das, wie wir sogleich sehen werden, nicht so fatalistisch und blind ist, wie man wohl glaubt? In welcher Versammlung, welchem Rat, welcher gemeinsamen Sphäre hat er seinen Sitz, dieser Geist, dem sich alle unterwerfen, und der selbst einer heroischen Pflicht, einer stets auf die Zukunft gerichteten Vernunft gehorcht?
Es ist bei unsren Bienen wie bei der Mehrzahl aller irdischen Dinge: wir beobachten einige ihrer Gewohnheiten, wir sagen, sie thun dies und jenes, sie arbeiten so und so, ihre Königinnen sorgen für Nachkommenschaft, ihre Arbeiterinnen bleiben Jungfrauen, und dann und dann schwärmen sie. Damit glauben wir sie zu kennen und fragen nicht weiter. Wir sehen sie von Blume zu Blume hasten, wir beobachten das behende Kommen und Gehen im Stock, und dieses Leben scheint uns höchst einfach und beschränkt, wie jedes Leben, das instinktiv nach Selbsterhaltung und Vermehrung trachtet. Aber sobald das Auge tiefer eindringt und sich Rechenschaft ablegen will, erkennt es die erstaunliche Kompliziertheit der einfachsten Erscheinungen, das Wunder des Verstandes und des Willens, der Bestimmungen und Ziele, der Ursachen und Wirkungen, die unbegreifliche Organisation der geringsten Lebensakte.
 In unsrem Bienenstock bereitet
sich also das grosse Opfer vor,
das den anspruchsvollen Volksgöttern
gebracht wird. Den Geboten dieses
„Geistes“ gehorsam, der uns ziemlich
unerklärlich erscheint, vorausgesetzt,
dass er allen Instinkten und Gefühlen unsrer Art
zuwiderläuft, – sind sechzig bis siebzigtausend von
den achtzig bis hunderttausend Bienen des Gesamtvolkes
im Begriff, die Mutterstadt zur gegebenen
Stunde zu verlassen. Es ist kein Augenblick
der Angst, in dem sie davonziehen, kein plötzlicher
toller Entschluss, das durch Hunger, Krieg
oder Seuchen verheerte Heimatland zu fliehen. Ihre
Selbstverbannung ist seit langem vorbedacht und
die günstigste Stunde wird geduldig abgewartet.
Ist der Stock arm und durch Unglück im Königshause,
schlechtes Wetter oder Plünderung geschwächt
worden, so wird nicht geschwärmt. Sie verlassen
ihre Stadt nur auf dem Gipfel ihres Wohlstands,
wenn der mächtige Wachsbau nach harter Frühjahrsarbeit
in seinen 120000 schnurgerade gebauten Zellen
prangt und von frischem Honig strotzt, oder von
jenem bunten Mehl, das zur Auffütterung der Brut
dient und Bienenbrot genannt wird.
In unsrem Bienenstock bereitet
sich also das grosse Opfer vor,
das den anspruchsvollen Volksgöttern
gebracht wird. Den Geboten dieses
„Geistes“ gehorsam, der uns ziemlich
unerklärlich erscheint, vorausgesetzt,
dass er allen Instinkten und Gefühlen unsrer Art
zuwiderläuft, – sind sechzig bis siebzigtausend von
den achtzig bis hunderttausend Bienen des Gesamtvolkes
im Begriff, die Mutterstadt zur gegebenen
Stunde zu verlassen. Es ist kein Augenblick
der Angst, in dem sie davonziehen, kein plötzlicher
toller Entschluss, das durch Hunger, Krieg
oder Seuchen verheerte Heimatland zu fliehen. Ihre
Selbstverbannung ist seit langem vorbedacht und
die günstigste Stunde wird geduldig abgewartet.
Ist der Stock arm und durch Unglück im Königshause,
schlechtes Wetter oder Plünderung geschwächt
worden, so wird nicht geschwärmt. Sie verlassen
ihre Stadt nur auf dem Gipfel ihres Wohlstands,
wenn der mächtige Wachsbau nach harter Frühjahrsarbeit
in seinen 120000 schnurgerade gebauten Zellen
prangt und von frischem Honig strotzt, oder von
jenem bunten Mehl, das zur Auffütterung der Brut
dient und Bienenbrot genannt wird.
Nie sieht der Stock schmucker aus, als am Tage vor der heroischen Entsagung. Es ist für ihn die Stunde ohne Gleichen, die lebensvolle, etwas fieberhafte und doch so heitere Stunde des Überflusses und der Ausgelassenheit. Suchen wir ihn uns vorzustellen, nicht wie ihn die Bienen sehen, denn wir ahnen nicht, welche magische und furchtbare Gestalt die Dinge in den sechs- bis siebentausend Facettenaugen annehmen, die sie an der Seite haben, oder in dem dreifachen Cyclopenauge auf ihrer Stirn, sondern so, wie wir ihn sehen würden, wenn wir ihre Grösse hätten. Oben von der Wölbung, die noch ungeheurer ist, als die des St. Peter in Rom, bis auf den Fussboden herab gehen zahlreiche senkrechte, parallele Riesenmauern, die im Finstern und im Leeren hängen und die man – im Verhältnis gesprochen – wegen ihrer kühnen Bauart, ihrer Genauigkeit und Riesenhaftigkeit mit keinem menschlichen Bauwerk vergleichen kann. Jede dieser Mauern, deren Baustoff noch jungfräulich frisch, silbern, unbefleckt und duftend ist, besteht aus tausenden von Zellen und enthält Vorräte, von denen das ganze Volk wochenlang leben könnte. Hier und dort leuchten rote, gelbe, schwarze und veilchenfarbene Flecken; es ist Pollen, der befruchtende Blumenstaub der gesamten Frühlingsflora, in durchsichtigen Zellen bewahrt, und ringsherum in schweren, üppigen Goldgewinden mit starren, unbeweglichen Falten der Aprilhonig, der reinste und duftreichste, in zwanzigtausend schon verdeckelten Behältern, die nur in den Tagen der höchsten Not erbrochen werden. Weiter unten reift der Maihonig noch in seinen weit geöffneten Behältern, an deren Rand eine wachsame Schaar für ununterbrochenen Luftwechsel sorgt. In der Mitte, fernab vom Lichte, dessen Diamantstrahlen durch die einzige Öffnung dringen, schlummert im wärmsten Teile des Bienenstockes die Zukunft oder beginnt zu erwachen. Es ist dies der Bezirk des Brutraums, in dem die Königin und ihre Mägde hausen, etwa zehntausend Zellen, in denen die Eier ruhen, fünfzehn- oder sechzehntausend, die von den Larven bewohnt sind, und vierzigtausend, in denen die wachsbleichen Nymphen von tausenden von Pflegerinnen gewartet werden. (Diese Zahlen entsprechen genau einem stark bevölkerten Stock zur Zeit der Volltracht.) Endlich im Allerheiligsten des Kinderhimmels drei bis zwölf geschlossene, verhältnismässig sehr grosse Weiselzellen, in denen die jungen Prinzessinnen, in eine Art von Leichentuch gehüllt, unbeweglich und bleich ihre Stunde erharren und im Finstern genährt werden.

 Dieser noch gestaltlosen Jugend
räumt also zu einer gegebenen,
vom „Geiste des Bienenstocks“ genau
bestimmten Stunde ein Teil des
Volkes das Feld, und auch er ist
nach unerschütterlichen, untrüglichen
Gesetzen hierzu erlesen. In der schlafenden Stadt
zurück bleiben die Drohnen, aus deren Reihen
der königliche Buhle hervorgehen wird, die noch
ganz jungen Bienen, die die Brut füttern, und einige
tausend Arbeitsbienen, die nach wie vor eintragen,
den aufgehäuften Schatz beschirmen und die moralischen
Traditionen des Bienenstockes aufrecht
erhalten. Denn jeder Bienenstock hat seine besondere
Moral. Man findet sehr tugendhafte und
sehr verdorbene, und der unvorsichtige Imker kann
ein Volk verderben, es die Achtung vor fremdem
Besitz verlieren lassen, zum Plündern verleiten,
ihm Eroberungsgelüste und Neigung zum Müssiggang
beibringen, wodurch es zum Schrecken aller
schwachen Völker der Umgegend wird. Er braucht
die Bienen nur merken zu lassen, dass die Feldarbeit
in den Blumen, von denen hunderte beflogen
werden müssen, um einen Tropfen Honig zu liefern,
weder das einzige, noch das bequemste Mittel zum
Reichwerden ist, sondern dass es viel leichter ist,
durch List in schlecht bewachte Städte oder durch
Gewalt in solche einzudringen, deren Bevölkerung
zu schwach ist, um sich zu wehren. Sie verlieren
bald den Sinn für die glänzende, aber unbarmherzige
Pflicht, die sie zu geflügelten Knechten
der Blumen im hochzeitlichen Reigen der Natur
macht, und es ist zuweilen garnicht leicht, ein so
zuchtlos gewordenes Volk wieder auf den Weg der
Pflicht zu bringen.
Dieser noch gestaltlosen Jugend
räumt also zu einer gegebenen,
vom „Geiste des Bienenstocks“ genau
bestimmten Stunde ein Teil des
Volkes das Feld, und auch er ist
nach unerschütterlichen, untrüglichen
Gesetzen hierzu erlesen. In der schlafenden Stadt
zurück bleiben die Drohnen, aus deren Reihen
der königliche Buhle hervorgehen wird, die noch
ganz jungen Bienen, die die Brut füttern, und einige
tausend Arbeitsbienen, die nach wie vor eintragen,
den aufgehäuften Schatz beschirmen und die moralischen
Traditionen des Bienenstockes aufrecht
erhalten. Denn jeder Bienenstock hat seine besondere
Moral. Man findet sehr tugendhafte und
sehr verdorbene, und der unvorsichtige Imker kann
ein Volk verderben, es die Achtung vor fremdem
Besitz verlieren lassen, zum Plündern verleiten,
ihm Eroberungsgelüste und Neigung zum Müssiggang
beibringen, wodurch es zum Schrecken aller
schwachen Völker der Umgegend wird. Er braucht
die Bienen nur merken zu lassen, dass die Feldarbeit
in den Blumen, von denen hunderte beflogen
werden müssen, um einen Tropfen Honig zu liefern,
weder das einzige, noch das bequemste Mittel zum
Reichwerden ist, sondern dass es viel leichter ist,
durch List in schlecht bewachte Städte oder durch
Gewalt in solche einzudringen, deren Bevölkerung
zu schwach ist, um sich zu wehren. Sie verlieren
bald den Sinn für die glänzende, aber unbarmherzige
Pflicht, die sie zu geflügelten Knechten
der Blumen im hochzeitlichen Reigen der Natur
macht, und es ist zuweilen garnicht leicht, ein so
zuchtlos gewordenes Volk wieder auf den Weg der
Pflicht zu bringen.
 Alles das beweist, dass das
Schwärmen nicht von der Königin,
sondern vom „Geiste des Bienenstocks“
ausgeht. Es ist mit der
Königin, wie mit den Führern der
Menschen: sie scheinen zu befehlen,
und gehorchen doch selbst nur Geboten, die gebieterischer
und unerklärlicher sind, als die, welche sie
ihren Untergebenen erteilen. Wann dieser „Geist“
den Augenblick für gekommen hält, muss er wohl
schon bei Morgengrauen, ja vielleicht schon am
Tage vorher oder zwei Tage vorher bekannt geben,
denn kaum hat die Sonne die ersten Thautropfen
aufgetrunken, so nimmt man rings um den Bienenstand
eine ungewöhnliche Unruhe wahr, über deren
Wesen sich der Bienenwirt selten täuscht. Manchmal
soll selbst Uneinigkeit, Zaudern und Zurückweichen
eintreten. Es kommt sogar vor, dass sich
der goldig schimmernde, durchsichtige Schwarm
mehrere Tage hintereinander bildet und ohne ersichtlichen
Grund wieder verschwindet. Entsteht
in diesem Augenblick am Himmel, den die Bienen
sehen, eine Wolke, die wir nicht wahrnehmen, oder
ein Heimweh in ihrem Geiste? Wird die Notwendigkeit
des Aufbruches in einer geflügelten
Ratsversammlung erörtert? Wir wissen davon ebensowenig,
wie wir wissen, auf welche Weise der
Geist des Bienenstocks seine Entschliessungen bekannt
giebt. Wenn es auch feststeht, dass die
Bienen sich Mitteilungen machen, so wissen wir
doch keineswegs, ob sie dies nach Art der Menschen
thun. Dieses honigduftende Summen, dieses trunkene
Schwirren an schönen Sommertagen, welches eine
der holdesten Freuden für den Bienenvater ist,
dieser Hochgesang der Arbeit, der im Krystall der
Luft rings um den Bienenstand bald steigt, bald
fällt und gleichsam das fröhliche Flüstern des
Blumenflors, das Preislied seines Glückes, der
Widerhall seiner süssen Düfte ist, – sie hören ihn
vielleicht nicht einmal. Trotzdem besitzen sie eine
ganze Skala von Tönen, die wir selbst unterscheiden
können und die von tiefer Seligkeit bis zu Drohung,
Zorn und Trübsal reicht, sie besitzen ein Lied auf
die Königin, ein Hoheslied des Überflusses und
Klagelieder, und endlich stossen die jungen Prinzessinnen
in den Kämpfen und Blutbädern, die dem
Hochzeitsausflug vorausgehen, ein langgezogenes,
seltsames Kriegsgeschrei aus. Sind das alles nur
Laute von ungefähr, die ihr inneres Schweigen nicht
berühren? Um die Geräusche, die wir rings um ihre
Wohnungen machen, scheinen sie sich allerdings nicht
zu kümmern, aber vielleicht sind sie der Meinung,
dass diese Geräusche nicht zu ihrer Welt gehören
und für sie keine Bedeutung haben. Wahrscheinlich
hören wir unsererseits auch nur einen geringen
Teil dessen, was sie sagen, und vielleicht verfügen
sie über eine Menge von harmonischen Tönen, die
nicht für unsre Organe gemacht sind. Jedenfalls
werden wir weiterhin sehen, dass sie sich verständigen
können und zwar mit einer oft wunderbaren
Geschwindigkeit, z. B. wenn der grosse
Honigdieb, der Totenkopf-Schmetterling, in den
Stock dringt und dabei von Zeit zu Zeit eine
eigentümliche, unwiderstehliche Beschwörungsformel
murmelt. Sofort läuft die Kunde von Mund
zu Mund und das ganze Volk von den Wachen
am Eingang bis zu den letzten Arbeitsbienen,
die auf den fernsten Waben arbeiten, gerät in
Schrecken.
Alles das beweist, dass das
Schwärmen nicht von der Königin,
sondern vom „Geiste des Bienenstocks“
ausgeht. Es ist mit der
Königin, wie mit den Führern der
Menschen: sie scheinen zu befehlen,
und gehorchen doch selbst nur Geboten, die gebieterischer
und unerklärlicher sind, als die, welche sie
ihren Untergebenen erteilen. Wann dieser „Geist“
den Augenblick für gekommen hält, muss er wohl
schon bei Morgengrauen, ja vielleicht schon am
Tage vorher oder zwei Tage vorher bekannt geben,
denn kaum hat die Sonne die ersten Thautropfen
aufgetrunken, so nimmt man rings um den Bienenstand
eine ungewöhnliche Unruhe wahr, über deren
Wesen sich der Bienenwirt selten täuscht. Manchmal
soll selbst Uneinigkeit, Zaudern und Zurückweichen
eintreten. Es kommt sogar vor, dass sich
der goldig schimmernde, durchsichtige Schwarm
mehrere Tage hintereinander bildet und ohne ersichtlichen
Grund wieder verschwindet. Entsteht
in diesem Augenblick am Himmel, den die Bienen
sehen, eine Wolke, die wir nicht wahrnehmen, oder
ein Heimweh in ihrem Geiste? Wird die Notwendigkeit
des Aufbruches in einer geflügelten
Ratsversammlung erörtert? Wir wissen davon ebensowenig,
wie wir wissen, auf welche Weise der
Geist des Bienenstocks seine Entschliessungen bekannt
giebt. Wenn es auch feststeht, dass die
Bienen sich Mitteilungen machen, so wissen wir
doch keineswegs, ob sie dies nach Art der Menschen
thun. Dieses honigduftende Summen, dieses trunkene
Schwirren an schönen Sommertagen, welches eine
der holdesten Freuden für den Bienenvater ist,
dieser Hochgesang der Arbeit, der im Krystall der
Luft rings um den Bienenstand bald steigt, bald
fällt und gleichsam das fröhliche Flüstern des
Blumenflors, das Preislied seines Glückes, der
Widerhall seiner süssen Düfte ist, – sie hören ihn
vielleicht nicht einmal. Trotzdem besitzen sie eine
ganze Skala von Tönen, die wir selbst unterscheiden
können und die von tiefer Seligkeit bis zu Drohung,
Zorn und Trübsal reicht, sie besitzen ein Lied auf
die Königin, ein Hoheslied des Überflusses und
Klagelieder, und endlich stossen die jungen Prinzessinnen
in den Kämpfen und Blutbädern, die dem
Hochzeitsausflug vorausgehen, ein langgezogenes,
seltsames Kriegsgeschrei aus. Sind das alles nur
Laute von ungefähr, die ihr inneres Schweigen nicht
berühren? Um die Geräusche, die wir rings um ihre
Wohnungen machen, scheinen sie sich allerdings nicht
zu kümmern, aber vielleicht sind sie der Meinung,
dass diese Geräusche nicht zu ihrer Welt gehören
und für sie keine Bedeutung haben. Wahrscheinlich
hören wir unsererseits auch nur einen geringen
Teil dessen, was sie sagen, und vielleicht verfügen
sie über eine Menge von harmonischen Tönen, die
nicht für unsre Organe gemacht sind. Jedenfalls
werden wir weiterhin sehen, dass sie sich verständigen
können und zwar mit einer oft wunderbaren
Geschwindigkeit, z. B. wenn der grosse
Honigdieb, der Totenkopf-Schmetterling, in den
Stock dringt und dabei von Zeit zu Zeit eine
eigentümliche, unwiderstehliche Beschwörungsformel
murmelt. Sofort läuft die Kunde von Mund
zu Mund und das ganze Volk von den Wachen
am Eingang bis zu den letzten Arbeitsbienen,
die auf den fernsten Waben arbeiten, gerät in
Schrecken.
 Man hat lange gemeint, die
klugen Honigwespen, die für gewöhnlich
so sparsam, nüchtern und weitblickend
sind, gehorchten in dem
Augenblick, wo sie die Schätze ihrer
Wohnung im Stiche lassen, um
sich selbst ins Ungewisse hinauszuwagen, einer
Art von Wahnsinn und Verhängnis, einem instinktiven
Trieb und Gattungsgesetz oder Naturgebot,
kurz, jener dunklen Gewalt, der alle in der Zeitlichkeit
lebenden Wesen unterworfen sind. Handelt
es sich um die Bienen oder um uns selbst, uns
scheint alles, was wir noch nicht verstehen, ein
Verhängnis. Aber man hat den Bienen heute drei
oder vier ihrer materiellen Geheimnisse abgewonnen,
und da hat es sich erwiesen, dass dieser Auszug
weder instinktiv, noch vom Schicksal verhängt ist.
Es ist keine blinde Auswanderung, sondern ein anscheinend
bewusstes Opfer, welches das lebende
Geschlecht dem zukünftigen bringt. Der Bienenzüchter
braucht nur die jungen, unausgeschlüpften
Königinnen in ihren Zellen zu töten und, wenn
viele Larven und Nymphen vorhanden sind, gleichzeitig
Honig- und Brutraum des Volkes zu erweitern
– und alsbald hört das ganze unfruchtbare
Treiben auf, die gewöhnliche Arbeit wird wieder
aufgenommen, Honig eingetragen, und die alte
Königin, die jetzt unentbehrlich geworden ist und
keine Nebenbuhlerinnen zu hoffen oder zu fürchten
hat, verzichtet in diesem Jahre auf ein Wiedersehen
des Sonnenlichtes. Friedlich nimmt sie ihre
Mutterpflicht im Finstern wieder auf und legt
methodisch, eine Spirale beschreibend, von Zelle
zu Zelle, ohne eine einzige auszulassen, ohne je
inne zu halten, jeden Tag zwei- bis dreitausend
Eier.
Man hat lange gemeint, die
klugen Honigwespen, die für gewöhnlich
so sparsam, nüchtern und weitblickend
sind, gehorchten in dem
Augenblick, wo sie die Schätze ihrer
Wohnung im Stiche lassen, um
sich selbst ins Ungewisse hinauszuwagen, einer
Art von Wahnsinn und Verhängnis, einem instinktiven
Trieb und Gattungsgesetz oder Naturgebot,
kurz, jener dunklen Gewalt, der alle in der Zeitlichkeit
lebenden Wesen unterworfen sind. Handelt
es sich um die Bienen oder um uns selbst, uns
scheint alles, was wir noch nicht verstehen, ein
Verhängnis. Aber man hat den Bienen heute drei
oder vier ihrer materiellen Geheimnisse abgewonnen,
und da hat es sich erwiesen, dass dieser Auszug
weder instinktiv, noch vom Schicksal verhängt ist.
Es ist keine blinde Auswanderung, sondern ein anscheinend
bewusstes Opfer, welches das lebende
Geschlecht dem zukünftigen bringt. Der Bienenzüchter
braucht nur die jungen, unausgeschlüpften
Königinnen in ihren Zellen zu töten und, wenn
viele Larven und Nymphen vorhanden sind, gleichzeitig
Honig- und Brutraum des Volkes zu erweitern
– und alsbald hört das ganze unfruchtbare
Treiben auf, die gewöhnliche Arbeit wird wieder
aufgenommen, Honig eingetragen, und die alte
Königin, die jetzt unentbehrlich geworden ist und
keine Nebenbuhlerinnen zu hoffen oder zu fürchten
hat, verzichtet in diesem Jahre auf ein Wiedersehen
des Sonnenlichtes. Friedlich nimmt sie ihre
Mutterpflicht im Finstern wieder auf und legt
methodisch, eine Spirale beschreibend, von Zelle
zu Zelle, ohne eine einzige auszulassen, ohne je
inne zu halten, jeden Tag zwei- bis dreitausend
Eier.
Was wäre in alledem fatalistisch als die Liebe des Volkes von heute zu dem von morgen? Diese Art von Verhängnis findet sich auch in der menschlichen Gattung, wenn auch nicht mit der gleichen Gewalt und Unbedingtheit, denn sie führt bei uns nie zu so grossen, einmütigen und vollständigen Opfern. Welchem weitblickenden Fatum, das jenes andre ersetzt, mögen wir gehorchen? Niemand weiss es, denn keiner kennt das Wesen, das uns so ansieht, wie wir die Bienen.
 Aber der Mensch soll den
Gang der Dinge in dem von uns beobachteten
Bienenstocke nicht unterbrechen,
und die feuchte Wärme eines
langsam dahinfliessenden Sommertages,
der seine Strahlen schon unter
das Blattwerk sendet, beschleunigt die Stunde des
Aufbruchs. Überall in den goldbraunen Gängen, die
zwischen den senkrechten Riesenmauern laufen,
rüsten die Arbeitsbienen sich zur Reise. Jede versieht
sich mit einem Honigvorrat für fünf bis sechs
Tage. Aus diesem Honig bereiten sie, durch einen
noch nicht recht aufgeklärten chemischen Prozess,
das zur Aufführung von neuen Bauten unmittelbar
erforderliche Wachs. Ferner versehen sie sich mit
einer gewissen Menge von Propolis, einer harzigen
Substanz, die dazu bestimmt ist, die Spalten und
Ritzen der neuen Wohnung zu verkitten, alles, was
locker ist, zu befestigen, alle Wände zu firnissen
und alles Licht abzublenden, denn sie arbeiten nur
in einer fast völligen Dunkelheit, in der sie sich
mit Hülfe ihrer Facettenaugen oder auch ihrer
Fühler zurechttasten, denn diese scheinen in der
That der Sitz eines unbekannten Sinnes zu sein,
welcher die Finsternis fühlt und misst.
Aber der Mensch soll den
Gang der Dinge in dem von uns beobachteten
Bienenstocke nicht unterbrechen,
und die feuchte Wärme eines
langsam dahinfliessenden Sommertages,
der seine Strahlen schon unter
das Blattwerk sendet, beschleunigt die Stunde des
Aufbruchs. Überall in den goldbraunen Gängen, die
zwischen den senkrechten Riesenmauern laufen,
rüsten die Arbeitsbienen sich zur Reise. Jede versieht
sich mit einem Honigvorrat für fünf bis sechs
Tage. Aus diesem Honig bereiten sie, durch einen
noch nicht recht aufgeklärten chemischen Prozess,
das zur Aufführung von neuen Bauten unmittelbar
erforderliche Wachs. Ferner versehen sie sich mit
einer gewissen Menge von Propolis, einer harzigen
Substanz, die dazu bestimmt ist, die Spalten und
Ritzen der neuen Wohnung zu verkitten, alles, was
locker ist, zu befestigen, alle Wände zu firnissen
und alles Licht abzublenden, denn sie arbeiten nur
in einer fast völligen Dunkelheit, in der sie sich
mit Hülfe ihrer Facettenaugen oder auch ihrer
Fühler zurechttasten, denn diese scheinen in der
That der Sitz eines unbekannten Sinnes zu sein,
welcher die Finsternis fühlt und misst.
 Sie vermögen also die Ereignisse
des gefahrvollsten Tages in
ihrem Dasein vorauszusehen. Heute
leben sie nur für den grossen Akt
und die vielleicht wunderbaren Abenteuer,
die er mit sich bringt; heute haben
sie keine Zeit, in Gärten und Wiesen hinauszuschwärmen,
und morgen oder übermorgen kann es vielleicht
regnen und stürmen, ihre kleinen Flügel können erstarren
und ihre Blumen sich nicht mehr öffnen.
Ohne diese Voraussicht wären sie dem Hungertode
preisgegeben. Nichts käme ihnen zu Hülfe,
und sie würden niemanden um Hülfe bitten. Von
Stock zu Stock kennen sie sich nicht und helfen
sich nie. Es kommt sogar vor, dass der Bienenzüchter
den Bienenstock, in den er die alte Königin
und den sie umgebenden Schwarm eingeschlagen
hat, dicht neben den eben verlassenen Stock stellt.
Welches Unglück sie nun auch trifft, man kann
sagen, dass sie seinen Frieden, sein emsiges Glück,
seine Reichtümer und seine Sicherheit unwiderruflich
vergessen haben, und dass sie alle, eine nach der
andern bis zur letzten, lieber bei ihrer unglücklichen
Königin verhungern, als in ihr Elternhaus zurückzukehren,
obschon der Duft seines Überflusses,
welches der Duft ihrer verflossenen Arbeit ist, bis
in ihre Trübsal herüberdringt.
Sie vermögen also die Ereignisse
des gefahrvollsten Tages in
ihrem Dasein vorauszusehen. Heute
leben sie nur für den grossen Akt
und die vielleicht wunderbaren Abenteuer,
die er mit sich bringt; heute haben
sie keine Zeit, in Gärten und Wiesen hinauszuschwärmen,
und morgen oder übermorgen kann es vielleicht
regnen und stürmen, ihre kleinen Flügel können erstarren
und ihre Blumen sich nicht mehr öffnen.
Ohne diese Voraussicht wären sie dem Hungertode
preisgegeben. Nichts käme ihnen zu Hülfe,
und sie würden niemanden um Hülfe bitten. Von
Stock zu Stock kennen sie sich nicht und helfen
sich nie. Es kommt sogar vor, dass der Bienenzüchter
den Bienenstock, in den er die alte Königin
und den sie umgebenden Schwarm eingeschlagen
hat, dicht neben den eben verlassenen Stock stellt.
Welches Unglück sie nun auch trifft, man kann
sagen, dass sie seinen Frieden, sein emsiges Glück,
seine Reichtümer und seine Sicherheit unwiderruflich
vergessen haben, und dass sie alle, eine nach der
andern bis zur letzten, lieber bei ihrer unglücklichen
Königin verhungern, als in ihr Elternhaus zurückzukehren,
obschon der Duft seines Überflusses,
welches der Duft ihrer verflossenen Arbeit ist, bis
in ihre Trübsal herüberdringt.
 Was, wird man sagen, würden
die Menschen nicht thun; es ist dies
ein Beweis dafür, dass hier trotz einer
staunenswerten Organisation keine
eigentliche Vernunft, kein Bewusstsein
vorhanden ist. Was wissen wir davon?
Sind wir, ganz abgesehen davon, dass es sehr
wohl möglich ist, dass andere Wesen eine andere
Vernunft haben als die unsre, eine Vernunft, die sich
in ganz anderer Weise äussert, ohne darum minderwertig
zu sein, – sind wir, die wir nie aus dem
engen Kreise des Menschlichen herauskommen, so
gute Richter über geistige Dinge? Wir brauchen
nur zwei oder drei Personen hinter einem Fenster
sprechen und gestikulieren zu sehen, ohne zu hören,
was sie sich sagen, und schon wird es uns sehr
schwer, den sie leitenden Gedanken zu erraten.
Glaubt man etwa, ein Bewohner des Mars oder der
Venus, der von einem Berggipfel herab die kleinen
schwarzen Punkte, die wir im Raume sind, durch
die Strassen und Plätze hin- und herwimmeln sähe,
könnte sich aus dem Anblick unserer Bewegungen,
unserer Gebäude und Kanäle oder Maschinen,
eine genaue Vorstellung von unserem Verstande,
unserer Moral, unserer Art zu lieben, zu denken
und zu hoffen, kurz unsrem inneren und wirklichen
Wesen machen? Er würde sich damit
begnügen, gewisse erstaunliche Thatsachen festzustellen,
ganz wie wir es im Bienenstock thun,
und daraus würde er wahrscheinlich ebenso unsichre
und irrige Folgerungen ziehen wie wir.
Auf alle Fälle dürfte es ihm sehr schwer fallen,
in den „kleinen schwarzen Punkten“ die grosse
moralische Tendenz, das wunderbar einmütige Gefühl
zu entdecken, das im Bienenstock zum Ausdruck
kommt. „Wohin gehen sie?“ würde er sich
fragen, wenn er uns Jahre und Jahrhunderte lang
beobachtet hätte. „Was thun sie? Welches ist
der Mittelpunkt und der Zweck ihres Lebens? Gehorchen
sie irgend einem Gotte? Ich sehe nichts,
was ihre Schritte lenkt. Heute scheinen sie allerhand
Kleinigkeiten aufzuhäufen und aufzubauen,
und morgen zerstören und zerstreuen sie sie. Sie
kommen und gehen, sie versammeln sich und gehen
auseinander, aber man weiss nicht, was sie eigentlich
wollen. Sie bieten allerhand unerklärliche Anblicke.
So sieht man z. B. etliche, die sich sozusagen
nicht rühren. Man erkennt sie an ihren
glänzenderen Gewändern. Oft auch sind sie von
grösserem Umfange, als die, welche ihnen dienen.
Ihre Wohnungen sind zehn oder zwanzig Mal so
gross, auch zweckmässiger eingerichtet und reicher
als die der andren. Sie halten darin Tag für Tag
Mahlzeiten ab, die stundenlang dauern und sich
bisweilen tief in die Nacht erstrecken. Alle, die
ihnen näher kommen, scheinen sie ausserordentlich
zu ehren; aus den Nachbarhäusern wird ihnen
Nahrung zugetragen, und vom Lande her strömen
sie in Massen herbei, um ihnen Geschenke zu
bringen. Man muss wohl glauben, dass sie unentbehrlich
sind und ihrer Gattung wesentliche Dienste
leisten, wiewohl unsre Forschungen uns noch keinen
Aufschluss darüber gegeben haben, welcher Art
diese Dienste sind. Dann wieder sieht man andre
in grossen Häusern, die mit kreisenden Rädern angefüllt
sind, in düsteren Schlupfwinkeln an den
Häfen, oder auf kleinen Erdgevierten, auf denen
sie vom Morgen bis zum Abend herumwühlen,
in unaufhörlicher, mühevoller Arbeit. Dies alles
führt zu der Vermutung, dass ihre Thätigkeit eine
Strafe ist. Man lässt sie in engen, schmutzigen und
baufälligen Hütten wohnen. Sie sind mit einem
farblosen Stoffe bekleidet. Und so gross scheint
ihr Eifer bei ihrer schädlichen oder doch zum
mindesten unnützen Thätigkeit, dass sie sich kaum
zum Schlafen und zum Essen Zeit gönnen. Auf
einen der vorhin genannten kommen ihrer Tausend.
Es ist zu bewundern, dass sich die Gattung unter
Umständen, die ihrer Entwicklung so ungünstig
sind, bis auf diesen Tag erhalten hat. Übrigens
muss man hinzusetzen, dass sie, wenn man von
dem zähen Eifer absieht, mit dem sie ihr mühevolles
Tagewerk betreiben, harmlos und willfährig
erscheinen und sich in allem jenen andren anbequemen,
die augenscheinlich die Hüter und vielleicht
die Retter der Gattung sind.“
Was, wird man sagen, würden
die Menschen nicht thun; es ist dies
ein Beweis dafür, dass hier trotz einer
staunenswerten Organisation keine
eigentliche Vernunft, kein Bewusstsein
vorhanden ist. Was wissen wir davon?
Sind wir, ganz abgesehen davon, dass es sehr
wohl möglich ist, dass andere Wesen eine andere
Vernunft haben als die unsre, eine Vernunft, die sich
in ganz anderer Weise äussert, ohne darum minderwertig
zu sein, – sind wir, die wir nie aus dem
engen Kreise des Menschlichen herauskommen, so
gute Richter über geistige Dinge? Wir brauchen
nur zwei oder drei Personen hinter einem Fenster
sprechen und gestikulieren zu sehen, ohne zu hören,
was sie sich sagen, und schon wird es uns sehr
schwer, den sie leitenden Gedanken zu erraten.
Glaubt man etwa, ein Bewohner des Mars oder der
Venus, der von einem Berggipfel herab die kleinen
schwarzen Punkte, die wir im Raume sind, durch
die Strassen und Plätze hin- und herwimmeln sähe,
könnte sich aus dem Anblick unserer Bewegungen,
unserer Gebäude und Kanäle oder Maschinen,
eine genaue Vorstellung von unserem Verstande,
unserer Moral, unserer Art zu lieben, zu denken
und zu hoffen, kurz unsrem inneren und wirklichen
Wesen machen? Er würde sich damit
begnügen, gewisse erstaunliche Thatsachen festzustellen,
ganz wie wir es im Bienenstock thun,
und daraus würde er wahrscheinlich ebenso unsichre
und irrige Folgerungen ziehen wie wir.
Auf alle Fälle dürfte es ihm sehr schwer fallen,
in den „kleinen schwarzen Punkten“ die grosse
moralische Tendenz, das wunderbar einmütige Gefühl
zu entdecken, das im Bienenstock zum Ausdruck
kommt. „Wohin gehen sie?“ würde er sich
fragen, wenn er uns Jahre und Jahrhunderte lang
beobachtet hätte. „Was thun sie? Welches ist
der Mittelpunkt und der Zweck ihres Lebens? Gehorchen
sie irgend einem Gotte? Ich sehe nichts,
was ihre Schritte lenkt. Heute scheinen sie allerhand
Kleinigkeiten aufzuhäufen und aufzubauen,
und morgen zerstören und zerstreuen sie sie. Sie
kommen und gehen, sie versammeln sich und gehen
auseinander, aber man weiss nicht, was sie eigentlich
wollen. Sie bieten allerhand unerklärliche Anblicke.
So sieht man z. B. etliche, die sich sozusagen
nicht rühren. Man erkennt sie an ihren
glänzenderen Gewändern. Oft auch sind sie von
grösserem Umfange, als die, welche ihnen dienen.
Ihre Wohnungen sind zehn oder zwanzig Mal so
gross, auch zweckmässiger eingerichtet und reicher
als die der andren. Sie halten darin Tag für Tag
Mahlzeiten ab, die stundenlang dauern und sich
bisweilen tief in die Nacht erstrecken. Alle, die
ihnen näher kommen, scheinen sie ausserordentlich
zu ehren; aus den Nachbarhäusern wird ihnen
Nahrung zugetragen, und vom Lande her strömen
sie in Massen herbei, um ihnen Geschenke zu
bringen. Man muss wohl glauben, dass sie unentbehrlich
sind und ihrer Gattung wesentliche Dienste
leisten, wiewohl unsre Forschungen uns noch keinen
Aufschluss darüber gegeben haben, welcher Art
diese Dienste sind. Dann wieder sieht man andre
in grossen Häusern, die mit kreisenden Rädern angefüllt
sind, in düsteren Schlupfwinkeln an den
Häfen, oder auf kleinen Erdgevierten, auf denen
sie vom Morgen bis zum Abend herumwühlen,
in unaufhörlicher, mühevoller Arbeit. Dies alles
führt zu der Vermutung, dass ihre Thätigkeit eine
Strafe ist. Man lässt sie in engen, schmutzigen und
baufälligen Hütten wohnen. Sie sind mit einem
farblosen Stoffe bekleidet. Und so gross scheint
ihr Eifer bei ihrer schädlichen oder doch zum
mindesten unnützen Thätigkeit, dass sie sich kaum
zum Schlafen und zum Essen Zeit gönnen. Auf
einen der vorhin genannten kommen ihrer Tausend.
Es ist zu bewundern, dass sich die Gattung unter
Umständen, die ihrer Entwicklung so ungünstig
sind, bis auf diesen Tag erhalten hat. Übrigens
muss man hinzusetzen, dass sie, wenn man von
dem zähen Eifer absieht, mit dem sie ihr mühevolles
Tagewerk betreiben, harmlos und willfährig
erscheinen und sich in allem jenen andren anbequemen,
die augenscheinlich die Hüter und vielleicht
die Retter der Gattung sind.“
 Ist es nicht sonderbar, dass
der Bienenstock, den wir aus der Höhe
einer andren Welt nur undeutlich erkennen,
uns beim ersten Blick eine tiefe
und gewisse Antwort giebt? Ist es nicht
wunderbar, dass seine Bauten, seine
Sitten und Gesetze, seine soziale und politische Organisation,
seine Tugenden und selbst seine Grausamkeiten,
uns unmittelbar den Gedanken oder Gott
offenbaren, dem die Bienen dienen, der weder der
unrechtmässigste, noch der vernunftwidrigste ist,
den man sich vorstellen kann, wiewohl vielleicht
der einzige, den wir noch nicht ernstlich angebetet
haben, nämlich die Zukunft? Wir suchen in unsrer
Menschheits-Geschichte bisweilen die moralische
Kraft und Grösse eines Volkes zu bewerten, und
wir finden keinen andren Maassstab, als die Dauerhaftigkeit
und Grösse des von ihm verfolgten Ideals
und die Selbstverleugnung, mit der es sich ihm
hingiebt. – Haben wir oft ein Ideal gefunden, das
dem Weltall näher steht, das fester, erhabener,
selbstloser und offenkundiger ist und mit einer
gänzlicheren und heldenhafteren Selbstverleugnung
Hand in Hand geht?
Ist es nicht sonderbar, dass
der Bienenstock, den wir aus der Höhe
einer andren Welt nur undeutlich erkennen,
uns beim ersten Blick eine tiefe
und gewisse Antwort giebt? Ist es nicht
wunderbar, dass seine Bauten, seine
Sitten und Gesetze, seine soziale und politische Organisation,
seine Tugenden und selbst seine Grausamkeiten,
uns unmittelbar den Gedanken oder Gott
offenbaren, dem die Bienen dienen, der weder der
unrechtmässigste, noch der vernunftwidrigste ist,
den man sich vorstellen kann, wiewohl vielleicht
der einzige, den wir noch nicht ernstlich angebetet
haben, nämlich die Zukunft? Wir suchen in unsrer
Menschheits-Geschichte bisweilen die moralische
Kraft und Grösse eines Volkes zu bewerten, und
wir finden keinen andren Maassstab, als die Dauerhaftigkeit
und Grösse des von ihm verfolgten Ideals
und die Selbstverleugnung, mit der es sich ihm
hingiebt. – Haben wir oft ein Ideal gefunden, das
dem Weltall näher steht, das fester, erhabener,
selbstloser und offenkundiger ist und mit einer
gänzlicheren und heldenhafteren Selbstverleugnung
Hand in Hand geht?
 O seltsame kleine Republik,
so logisch und so ernst, so zweckvoll
und so streng durchgeführt, so sparsam
und doch einem so grossen und ungewissen
Traume hingegeben! O kleines
Volk, so entschlossen und so tief, von
Licht und Wärme und allem Reinsten in der Welt
genährt, vom Kelch der Blumen, das ist vom sichtbarsten
Lächeln der Materie und ihrem rührendsten
Streben nach Glück und Schönheit! Wer wird uns
sagen, welche Probleme Ihr gelöst habt und uns
zu lösen aufgebt, welche Gewissheiten Ihr erworben
habt und uns zu erwerben noch übrig lasset! Und
wenn es wahr ist, dass Ihr Probleme gelöst, Gewissheiten
erlangt habt, indem Ihr nicht dem Verstande
folgtet, sondern einem blinden und dumpfen
Drange: welches noch unlösbarere Rätsel zwingt
Ihr uns dann noch zu lösen? O kleine Stadt voller
Glauben und Hoffen, und voller Mysterien, warum
wird Deinen hunderttausend Jungfrauen eine Aufgabe
zuteil, die kein menschlicher Sklave je auf
sich genommen hat? Schonten sie ihre Kräfte,
dächten sie ein wenig mehr an sich selbst, wären
sie etwas weniger eifrig bei der Arbeit, sie sähen
einen zweiten Lenz und einen neuen Sommer, und
doch scheinen sie in dem grossen Augenblick, wo
alle Blumen ihnen winken, von einer mörderischen
Arbeitslust ergriffen zu werden, und mit geknickten
Flügeln, mit eingeschrumpftem, wundenbedecktem
Leibe finden sie fast alle in weniger als fünf Wochen
den Tod.
O seltsame kleine Republik,
so logisch und so ernst, so zweckvoll
und so streng durchgeführt, so sparsam
und doch einem so grossen und ungewissen
Traume hingegeben! O kleines
Volk, so entschlossen und so tief, von
Licht und Wärme und allem Reinsten in der Welt
genährt, vom Kelch der Blumen, das ist vom sichtbarsten
Lächeln der Materie und ihrem rührendsten
Streben nach Glück und Schönheit! Wer wird uns
sagen, welche Probleme Ihr gelöst habt und uns
zu lösen aufgebt, welche Gewissheiten Ihr erworben
habt und uns zu erwerben noch übrig lasset! Und
wenn es wahr ist, dass Ihr Probleme gelöst, Gewissheiten
erlangt habt, indem Ihr nicht dem Verstande
folgtet, sondern einem blinden und dumpfen
Drange: welches noch unlösbarere Rätsel zwingt
Ihr uns dann noch zu lösen? O kleine Stadt voller
Glauben und Hoffen, und voller Mysterien, warum
wird Deinen hunderttausend Jungfrauen eine Aufgabe
zuteil, die kein menschlicher Sklave je auf
sich genommen hat? Schonten sie ihre Kräfte,
dächten sie ein wenig mehr an sich selbst, wären
sie etwas weniger eifrig bei der Arbeit, sie sähen
einen zweiten Lenz und einen neuen Sommer, und
doch scheinen sie in dem grossen Augenblick, wo
alle Blumen ihnen winken, von einer mörderischen
Arbeitslust ergriffen zu werden, und mit geknickten
Flügeln, mit eingeschrumpftem, wundenbedecktem
Leibe finden sie fast alle in weniger als fünf Wochen
den Tod.
„Tantus amor florum et generandi gloria mellis“, ruft Vergil aus, der uns im vierten Buche seiner „Georgica“, das den Bienen gewidmet ist, die holden Irrtümer der Alten überliefert hat, welche die Natur mit einem durch die glänzende Vision des Olymps geblendeten Auge betrachteten.

 Warum entsagen sie dem
Schlafe, den Wonnen des Honigs,
der Liebe und der göttlichen Musse,
die z. B. ihr geflügelter Bruder, der
Schmetterling, kennt? Könnten sie
nicht leben wie er? Der Hunger ist es
nicht, der sie zur Arbeit treibt. Zwei oder drei Blumen
genügen zu ihrer Ernährung, und sie befliegen
stündlich zwei- oder dreihundert, um einen Schatz
aufzuhäufen, dessen Süsse sie nie kosten werden.
Wozu schaffen sie sich soviel Qual und Mühe,
und woher kommt eine solche Entschiedenheit?
Es muss also das Geschlecht, für das sie sterben,
dieses Opfer wohl verdienen, es muss schöner
und glücklicher sein und etwas thun, was sie nicht
vermochten? Wir erkennen ihr Ziel, es ist klarer,
als das unsre, sie wollen in ihren Nachkommen
leben, solange die Welt steht: aber welches ist
doch der Zweck dieses grossen Ziels und die Aufgabe
dieses ewig wiederkehrenden Kreislaufes? –
Oder sind wir, die da zweifeln und zaudern, nicht
viel eher kindliche Träumer, die unnütze Fragen
stellen? Sie könnten von Stufe zu Stufe gestiegen
und allmächtig und glückselig geworden sein, sie
könnten die letzten Höhen erklommen haben, von
denen sich die Naturgesetze beherrschen lassen, sie
könnten unsterbliche Göttinnen geworden sein, und
wir würden sie immer noch befragen, was sie hofften,
wohin sie gingen, wo sie Halt zu machen gedächten
und sich am Ziel ihrer Wünsche glaubten. Wir
sind so geschaffen, dass uns nichts befriedigt, dass
uns nichts seinen eigenen Zweck zu haben und
einfach, ohne Hintergedanken, zu existieren scheint.
Haben wir uns bis auf diesen Tag auch nur einen
Gott vorstellen können, so dumm oder so vernunftgemäss
er auch sein mag, ohne dass wir ihn uns
unmittelbar geschäftig und wirkend dachten, ohne
dass wir ihn zum Schöpfer einer Menge von Wesen
und Dingen machten und tausend Zwecke noch
hinter ihm annahmen? Werden wir uns wohl je
damit begnügen, einige Stunden lang ruhig eine
besondere Form der wirkenden Materie darzustellen,
um alsbald ohne Staunen und ohne Bedauern jene
andre Form anzunehmen, welches die unbewusste,
unbekannte, schlafende, ewige ist?
Warum entsagen sie dem
Schlafe, den Wonnen des Honigs,
der Liebe und der göttlichen Musse,
die z. B. ihr geflügelter Bruder, der
Schmetterling, kennt? Könnten sie
nicht leben wie er? Der Hunger ist es
nicht, der sie zur Arbeit treibt. Zwei oder drei Blumen
genügen zu ihrer Ernährung, und sie befliegen
stündlich zwei- oder dreihundert, um einen Schatz
aufzuhäufen, dessen Süsse sie nie kosten werden.
Wozu schaffen sie sich soviel Qual und Mühe,
und woher kommt eine solche Entschiedenheit?
Es muss also das Geschlecht, für das sie sterben,
dieses Opfer wohl verdienen, es muss schöner
und glücklicher sein und etwas thun, was sie nicht
vermochten? Wir erkennen ihr Ziel, es ist klarer,
als das unsre, sie wollen in ihren Nachkommen
leben, solange die Welt steht: aber welches ist
doch der Zweck dieses grossen Ziels und die Aufgabe
dieses ewig wiederkehrenden Kreislaufes? –
Oder sind wir, die da zweifeln und zaudern, nicht
viel eher kindliche Träumer, die unnütze Fragen
stellen? Sie könnten von Stufe zu Stufe gestiegen
und allmächtig und glückselig geworden sein, sie
könnten die letzten Höhen erklommen haben, von
denen sich die Naturgesetze beherrschen lassen, sie
könnten unsterbliche Göttinnen geworden sein, und
wir würden sie immer noch befragen, was sie hofften,
wohin sie gingen, wo sie Halt zu machen gedächten
und sich am Ziel ihrer Wünsche glaubten. Wir
sind so geschaffen, dass uns nichts befriedigt, dass
uns nichts seinen eigenen Zweck zu haben und
einfach, ohne Hintergedanken, zu existieren scheint.
Haben wir uns bis auf diesen Tag auch nur einen
Gott vorstellen können, so dumm oder so vernunftgemäss
er auch sein mag, ohne dass wir ihn uns
unmittelbar geschäftig und wirkend dachten, ohne
dass wir ihn zum Schöpfer einer Menge von Wesen
und Dingen machten und tausend Zwecke noch
hinter ihm annahmen? Werden wir uns wohl je
damit begnügen, einige Stunden lang ruhig eine
besondere Form der wirkenden Materie darzustellen,
um alsbald ohne Staunen und ohne Bedauern jene
andre Form anzunehmen, welches die unbewusste,
unbekannte, schlafende, ewige ist?
 Indessen vergessen wir
nicht unsren Bienenstock, dessen
Schwarm die Geduld verliert, unsern
Bienenstock, der schon von schwärzlichen,
kribbelnden Fluten brodelt und
überschwillt, wie ein klingendes Gefäss
in der Sonnenglut. Es ist Mittag, und man möchte
sagen, dass die Bäume mitsamt in der brütenden
Hitze kein Blättchen bewegen, wie man seinen Atem
anhält, wenn man vor etwas sehr Holdem, aber
sehr Ernstem steht. Die Bienen schenken dem
Menschen Honig und duftendes Wachs, aber was
vielleicht mehr wert ist, als Honig und Wachs:
sie lenken seinen Sinn auf den heiteren Junitag, sie
öffnen ihm das Herz für den Zauber der schönen
Jahreszeit, und alles, woran sie Anteil haben, verknüpft
sich in der Vorstellung mit blauem Himmel,
Blumensegen und Sommerlust. Sie sind die eigentliche
Seele des Sommers, die Uhr der Stunden des
Überflusses, der schnelle Flügel der aufsteigenden
Düfte, der Geist und Sinn des strömenden Lichtes,
das Lied der sich dehnenden, ruhenden Luft, und
ihr Flug ist das sichtbare Wahrzeichen, die deutliche
musikalische Note der tausend kleinen Freuden,
die von der Wärme erzeugt sind und im Lichte
leben. Sie lehren uns die zarteste Stimme der
Natur verstehen, und wer sie einmal kennen und
lieben gelernt hat, für den ist ein Sommer ohne
Bienensummen so unglücklich und unvollkommen,
wie ohne Blumen und ohne Vögel.
Indessen vergessen wir
nicht unsren Bienenstock, dessen
Schwarm die Geduld verliert, unsern
Bienenstock, der schon von schwärzlichen,
kribbelnden Fluten brodelt und
überschwillt, wie ein klingendes Gefäss
in der Sonnenglut. Es ist Mittag, und man möchte
sagen, dass die Bäume mitsamt in der brütenden
Hitze kein Blättchen bewegen, wie man seinen Atem
anhält, wenn man vor etwas sehr Holdem, aber
sehr Ernstem steht. Die Bienen schenken dem
Menschen Honig und duftendes Wachs, aber was
vielleicht mehr wert ist, als Honig und Wachs:
sie lenken seinen Sinn auf den heiteren Junitag, sie
öffnen ihm das Herz für den Zauber der schönen
Jahreszeit, und alles, woran sie Anteil haben, verknüpft
sich in der Vorstellung mit blauem Himmel,
Blumensegen und Sommerlust. Sie sind die eigentliche
Seele des Sommers, die Uhr der Stunden des
Überflusses, der schnelle Flügel der aufsteigenden
Düfte, der Geist und Sinn des strömenden Lichtes,
das Lied der sich dehnenden, ruhenden Luft, und
ihr Flug ist das sichtbare Wahrzeichen, die deutliche
musikalische Note der tausend kleinen Freuden,
die von der Wärme erzeugt sind und im Lichte
leben. Sie lehren uns die zarteste Stimme der
Natur verstehen, und wer sie einmal kennen und
lieben gelernt hat, für den ist ein Sommer ohne
Bienensummen so unglücklich und unvollkommen,
wie ohne Blumen und ohne Vögel.
 Wer die betäubende und wirre
Episode des Schwärmens bei einem
starken Bienenvolke zum ersten Male
miterlebt, der ist ziemlich ausser
Fassung und kommt nur furchtsam
näher. Er erkennt die friedlichen und
ernsten Bienen der Trachtzeit nicht wieder. Noch
vor wenigen Minuten sah er sie aus allen vier Winden
herbeifliegen, wie kleine emsige Bürgerfrauen, die
sich durch nichts von ihren Haushaltungsgeschäften
ablenken lassen. Erschöpft, atemlos, hastig und aufgeregt,
aber leise, schlüpften sie fast unbemerkt in das
Flugloch und die jungen Wächterinnen am Eingang
nickten ihnen im Vorbeikommen mit den Fühlern
zu. Kaum wechselten sie die drei oder vier Worte,
die wahrscheinlich unerlässlich sind, und übergaben
ihre Honigbürde hastig einer der jungen Trägerinnen,
die stets im Innenhofe der Werkstätte postiert
sind, oder sie gingen selbst hinauf und entleerten
die zwei schweren Körbe von Blumenstaub, die an
ihren Hinterschenkeln hängen, in den geräumigen
Speichern, die rings um dem Brutraum liegen, um
alsbald wieder davonzufliegen, ohne sich darum zu
kümmern, was im Laboratorium, im Schlafraume
der Nymphen oder im königlichen Palaste vorgeht,
ohne sich auch nur eine Sekunde in das geschwätzige
Treiben des öffentlichen Platzes vor dem Thore zu
mischen, wo in den Stunden grosser Hitze eine
Anzahl von Bienen für Luftzufuhr sorgt, indem sie,
eine an der andern hängend, hin- und herschaukeln,
als ob ein Bart im Winde flattert.
Wer die betäubende und wirre
Episode des Schwärmens bei einem
starken Bienenvolke zum ersten Male
miterlebt, der ist ziemlich ausser
Fassung und kommt nur furchtsam
näher. Er erkennt die friedlichen und
ernsten Bienen der Trachtzeit nicht wieder. Noch
vor wenigen Minuten sah er sie aus allen vier Winden
herbeifliegen, wie kleine emsige Bürgerfrauen, die
sich durch nichts von ihren Haushaltungsgeschäften
ablenken lassen. Erschöpft, atemlos, hastig und aufgeregt,
aber leise, schlüpften sie fast unbemerkt in das
Flugloch und die jungen Wächterinnen am Eingang
nickten ihnen im Vorbeikommen mit den Fühlern
zu. Kaum wechselten sie die drei oder vier Worte,
die wahrscheinlich unerlässlich sind, und übergaben
ihre Honigbürde hastig einer der jungen Trägerinnen,
die stets im Innenhofe der Werkstätte postiert
sind, oder sie gingen selbst hinauf und entleerten
die zwei schweren Körbe von Blumenstaub, die an
ihren Hinterschenkeln hängen, in den geräumigen
Speichern, die rings um dem Brutraum liegen, um
alsbald wieder davonzufliegen, ohne sich darum zu
kümmern, was im Laboratorium, im Schlafraume
der Nymphen oder im königlichen Palaste vorgeht,
ohne sich auch nur eine Sekunde in das geschwätzige
Treiben des öffentlichen Platzes vor dem Thore zu
mischen, wo in den Stunden grosser Hitze eine
Anzahl von Bienen für Luftzufuhr sorgt, indem sie,
eine an der andern hängend, hin- und herschaukeln,
als ob ein Bart im Winde flattert.
 Heute bietet sich ein ganz
anderes Bild dar. Eine Zahl von Arbeitsbienen
fliegt allerdings nach wie
vor, als wäre nichts geschehen, friedlich
aus und ein, reinigt den Stock,
klettert zu den Brutzellen hinauf und
scheint von der allgemeinen Trunkenheit nicht fortgerissen
zu werden. Es sind die, welche die Königin
nicht begleiten werden, sondern im alten Heim zurückbleiben,
um es zu beschützen, die neun- oder zehntausend
Eier, die achtzehntausend Larven, die sechsunddreissigtausend
Nymphen und sieben oder acht
Prinzessinnen, die allein zurückbleiben, zu pflegen
und zu ernähren. Sie werden zu dieser schweren Aufgabe
auserkoren, ohne dass man wüsste, wie, noch
durch wen und nach welchem Gesetze. Doch sind
sie diesem Gesetze fest und unverbrüchlich treu,
und wiewohl ich mehrmals das Experiment gemacht
habe, eines dieser selbstverleugnenden Aschenbrödel,
die man an ihrem ernsten und bedächtigen
Wesen leicht aus dem schwärmenden Volke herauserkennt,
mit einem Farbstoffe zu bestäuben, so habe
ich doch nur selten eine von ihnen in der trunkenen
Menge des Schwarmes wiedergefunden.
Heute bietet sich ein ganz
anderes Bild dar. Eine Zahl von Arbeitsbienen
fliegt allerdings nach wie
vor, als wäre nichts geschehen, friedlich
aus und ein, reinigt den Stock,
klettert zu den Brutzellen hinauf und
scheint von der allgemeinen Trunkenheit nicht fortgerissen
zu werden. Es sind die, welche die Königin
nicht begleiten werden, sondern im alten Heim zurückbleiben,
um es zu beschützen, die neun- oder zehntausend
Eier, die achtzehntausend Larven, die sechsunddreissigtausend
Nymphen und sieben oder acht
Prinzessinnen, die allein zurückbleiben, zu pflegen
und zu ernähren. Sie werden zu dieser schweren Aufgabe
auserkoren, ohne dass man wüsste, wie, noch
durch wen und nach welchem Gesetze. Doch sind
sie diesem Gesetze fest und unverbrüchlich treu,
und wiewohl ich mehrmals das Experiment gemacht
habe, eines dieser selbstverleugnenden Aschenbrödel,
die man an ihrem ernsten und bedächtigen
Wesen leicht aus dem schwärmenden Volke herauserkennt,
mit einem Farbstoffe zu bestäuben, so habe
ich doch nur selten eine von ihnen in der trunkenen
Menge des Schwarmes wiedergefunden.
 Und doch scheint der Reiz
unwiderstehlich. Es ist der Wonnetaumel
des – vielleicht unbewussten
– gottverordneten Opfers, das Honigfest,
der Sieg der Rasse und der Zukunft,
es ist der einzige Tag der Freude,
des Vergessens und der Ausgelassenheit, es ist der
einzige Sonntag der Bienen. Und anscheinend auch
der einzige Tag, wo sie nur für ihren Hunger essen,
wo sie die ganze Süsse des von ihnen aufgespeicherten
Schatzes empfinden. Sie sind wie freigelassene
Gefangene, die sich plötzlich ins Land der
Freiheit und des Überflusses versetzt sehen. Sie
frohlocken, sie sind nicht mehr Herr ihrer selbst;
sie, die nie eine unangebrachte oder unnötige Bewegung
machen, sie kommen und gehen, fliegen
ein und aus und immer wieder, um ihre Mitschwestern
anzufeuern, um nachzusehen, ob die
Königin bereit ist, um ihre Ungeduld zu betäuben.
Sie fliegen höher, als es sonst der Fall ist, und das
Laub der grossen Bäume rings um den Bienenstand
bebt von ihrem Schwirren. Sie kennen keine
Furcht und Sorge mehr. Sie sind nicht mehr wild,
schnüfflerisch, argwöhnisch, reizbar, heftig und unbändig.
Der Mensch, der unbekannte Herr, den sie nie anerkennen,
und der ihrer nur dadurch Herr wird, dass
er sich allen ihren Arbeitsgewohnheiten anpasst,
alle ihre Gesetze achtet und Schritt für Schritt der
Spur folgt, die ihr stets auf die Zukunft gerichteter
Sinn, ihr durch nichts zu trübender, durch nichts
von seinem Ziele abzulenkender Verstand dem Leben
aufdrückt, – der Mensch kann ihnen nahen, kann
den brausenden, kreisenden Schleier zerreissen, in
den sie ihn goldig und sanft einhüllen, er kann sie
in die Hand nehmen, sie einzeln abpflücken, wie Weinbeeren
von der Traube; sie sind ebenso sanft, ebenso
harmlos, wie ein Schwarm Libellen oder Nachtfalter.
Sie sind an diesem Tage glücklich, obwohl
sie nichts mehr besitzen, sie blicken vertrauensvoll
in die Zukunft, und wenn man sie nicht von ihrer
Königin trennt, die diese Zukunft in sich trägt,
fügen sie sich in Alles und verletzen niemand.
Und doch scheint der Reiz
unwiderstehlich. Es ist der Wonnetaumel
des – vielleicht unbewussten
– gottverordneten Opfers, das Honigfest,
der Sieg der Rasse und der Zukunft,
es ist der einzige Tag der Freude,
des Vergessens und der Ausgelassenheit, es ist der
einzige Sonntag der Bienen. Und anscheinend auch
der einzige Tag, wo sie nur für ihren Hunger essen,
wo sie die ganze Süsse des von ihnen aufgespeicherten
Schatzes empfinden. Sie sind wie freigelassene
Gefangene, die sich plötzlich ins Land der
Freiheit und des Überflusses versetzt sehen. Sie
frohlocken, sie sind nicht mehr Herr ihrer selbst;
sie, die nie eine unangebrachte oder unnötige Bewegung
machen, sie kommen und gehen, fliegen
ein und aus und immer wieder, um ihre Mitschwestern
anzufeuern, um nachzusehen, ob die
Königin bereit ist, um ihre Ungeduld zu betäuben.
Sie fliegen höher, als es sonst der Fall ist, und das
Laub der grossen Bäume rings um den Bienenstand
bebt von ihrem Schwirren. Sie kennen keine
Furcht und Sorge mehr. Sie sind nicht mehr wild,
schnüfflerisch, argwöhnisch, reizbar, heftig und unbändig.
Der Mensch, der unbekannte Herr, den sie nie anerkennen,
und der ihrer nur dadurch Herr wird, dass
er sich allen ihren Arbeitsgewohnheiten anpasst,
alle ihre Gesetze achtet und Schritt für Schritt der
Spur folgt, die ihr stets auf die Zukunft gerichteter
Sinn, ihr durch nichts zu trübender, durch nichts
von seinem Ziele abzulenkender Verstand dem Leben
aufdrückt, – der Mensch kann ihnen nahen, kann
den brausenden, kreisenden Schleier zerreissen, in
den sie ihn goldig und sanft einhüllen, er kann sie
in die Hand nehmen, sie einzeln abpflücken, wie Weinbeeren
von der Traube; sie sind ebenso sanft, ebenso
harmlos, wie ein Schwarm Libellen oder Nachtfalter.
Sie sind an diesem Tage glücklich, obwohl
sie nichts mehr besitzen, sie blicken vertrauensvoll
in die Zukunft, und wenn man sie nicht von ihrer
Königin trennt, die diese Zukunft in sich trägt,
fügen sie sich in Alles und verletzen niemand.
 Aber das eigentliche Zeichen
ist noch nicht gegeben. Im Bienenstock
herrscht eine unbegreifliche Aufregung
und eine anscheinend durch
nichts zu erklärende Unordnung. Sonst
scheinen die Bienen, wenn sie heimgekehrt
sind, zu vergessen, dass sie Flügel haben,
und jede einzelne sitzt nahezu unbeweglich, wenn
auch nicht unthätig, auf den Waben, und zwar an dem
Flecke, der ihr durch die Art ihrer Arbeit zugewiesen
ist. Jetzt fliegen sie wie unsinnig in dichten Ketten
an den Seitenwänden hinauf und hinunter, wie ein
bebender Teig, der von einer unsichtbaren Hand geknetet
wird. Die Temperatur steigt im Innern jäh,
oft so weit, dass der Wachsbau weich wird und
sich zerdehnt. Die Königin, welche den Brutraum
sonst nie verlässt, läuft aufgeregt und kopflos
durch die Oberfläche der brausenden Masse, die
sich gleichsam um sich selbst dreht. Geschieht
dies zur Beschleunigung oder zur Verzögerung des
Aufbruches? Befiehlt sie oder bittet sie? Verbreitet
sie die wunderbare Aufregung oder unterliegt
sie ihr? Nach dem, was wir von der Psychologie
der Bienen im allgemeinen wissen, scheint
es ziemlich erwiesen, dass das Schwärmen allemal
gegen den Willen der alten Königin stattfindet.
Im Grunde ist die Königin in den Augen der asketischen
Arbeitsbienen, welche ihre Töchter sind,
das unentbehrliche und geheiligte, aber auch ein
wenig geistesschwache und oft kindliche Organ der
Liebe. Sie behandeln sie darum auch wie eine
Mutter, die unter Vormundschaft steht. Sie besitzen
eine grenzenlose Verehrung und heldenmütige Anhänglichkeit
gegen sie. Ihr bleibt der reinste, besonders
geläuterte und fast restlos verdauliche Honig
vorbehalten. Sie hat ein Gefolge von Trabanten
oder Liktoren, wie Plinius sagt, eine Leibwache, die
Tag und Nacht über sie wacht, ihr die mütterliche
Arbeit erleichtert, die Zellen zum Eierlegen bereit
macht, sie pflegt, liebkost, ernährt, reinigt, ja, selbst
ihre Exkremente auffrisst. Wenn ihr das Geringste
zustösst, verbreitet sich die Kunde durch das ganze
Volk; alles umdrängt sie und klagt. Wenn man
einem Stocke die Königin nimmt und die Bienen
auf einen Ersatz nicht hoffen können, sei es, dass
sie keine königliche Nachkommenschaft hinterlassen
hat, sei es, dass keine Larven von Arbeitsbienen
im Alter von weniger als drei Tagen vorhanden
sind (denn jede Arbeitsbienenlarve unter drei Tagen
kann durch besondere Ernährung in eine Königinnenlarve
verwandelt werden; das ist das grosse demokratische
Prinzip des Bienenstockes, welches die
Vorrechte der mütterlichen Abkunft kompensiert),
– wenn man, sage ich, unter diesen Verhältnissen
einem Stocke die Königin nimmt und ihr Fehlen
bemerkt wird – es vergehen oft zwei bis drei
Stunden, ehe alle Bienen es wissen, so gross ist
ihre Stadt, – so ruht alsbald fast jede Arbeit, die
Brut wird im Stich gelassen, ein Teil des Volkes
irrt im Stock umher und sucht nach seiner Mutter,
ein anderer fliegt aus und sucht sie da, die Ketten
der Arbeitsbienen, die am Wachsbau beschäftigt
waren, zerreissen und lösen sich auf, die Honigsucherinnen
befliegen ihre Blumen nicht mehr, die
Schildwachen am Eingang verlassen ihren Posten
und die fremden Räuber und Honigschmarotzer,
die stets auf unverhoffte Beute lauern, kommen und
gehen, ohne dass jemand daran denkt, den mühsam
erworbenen Schatz zu verteidigen. Allmählich verarmt
und verödet der Stock und seine trostlosen
Bewohnerinnen sterben bald vor Trübsal und Elend,
wiewohl der Sommer ihnen alle seine Blüten öffnet.
Aber das eigentliche Zeichen
ist noch nicht gegeben. Im Bienenstock
herrscht eine unbegreifliche Aufregung
und eine anscheinend durch
nichts zu erklärende Unordnung. Sonst
scheinen die Bienen, wenn sie heimgekehrt
sind, zu vergessen, dass sie Flügel haben,
und jede einzelne sitzt nahezu unbeweglich, wenn
auch nicht unthätig, auf den Waben, und zwar an dem
Flecke, der ihr durch die Art ihrer Arbeit zugewiesen
ist. Jetzt fliegen sie wie unsinnig in dichten Ketten
an den Seitenwänden hinauf und hinunter, wie ein
bebender Teig, der von einer unsichtbaren Hand geknetet
wird. Die Temperatur steigt im Innern jäh,
oft so weit, dass der Wachsbau weich wird und
sich zerdehnt. Die Königin, welche den Brutraum
sonst nie verlässt, läuft aufgeregt und kopflos
durch die Oberfläche der brausenden Masse, die
sich gleichsam um sich selbst dreht. Geschieht
dies zur Beschleunigung oder zur Verzögerung des
Aufbruches? Befiehlt sie oder bittet sie? Verbreitet
sie die wunderbare Aufregung oder unterliegt
sie ihr? Nach dem, was wir von der Psychologie
der Bienen im allgemeinen wissen, scheint
es ziemlich erwiesen, dass das Schwärmen allemal
gegen den Willen der alten Königin stattfindet.
Im Grunde ist die Königin in den Augen der asketischen
Arbeitsbienen, welche ihre Töchter sind,
das unentbehrliche und geheiligte, aber auch ein
wenig geistesschwache und oft kindliche Organ der
Liebe. Sie behandeln sie darum auch wie eine
Mutter, die unter Vormundschaft steht. Sie besitzen
eine grenzenlose Verehrung und heldenmütige Anhänglichkeit
gegen sie. Ihr bleibt der reinste, besonders
geläuterte und fast restlos verdauliche Honig
vorbehalten. Sie hat ein Gefolge von Trabanten
oder Liktoren, wie Plinius sagt, eine Leibwache, die
Tag und Nacht über sie wacht, ihr die mütterliche
Arbeit erleichtert, die Zellen zum Eierlegen bereit
macht, sie pflegt, liebkost, ernährt, reinigt, ja, selbst
ihre Exkremente auffrisst. Wenn ihr das Geringste
zustösst, verbreitet sich die Kunde durch das ganze
Volk; alles umdrängt sie und klagt. Wenn man
einem Stocke die Königin nimmt und die Bienen
auf einen Ersatz nicht hoffen können, sei es, dass
sie keine königliche Nachkommenschaft hinterlassen
hat, sei es, dass keine Larven von Arbeitsbienen
im Alter von weniger als drei Tagen vorhanden
sind (denn jede Arbeitsbienenlarve unter drei Tagen
kann durch besondere Ernährung in eine Königinnenlarve
verwandelt werden; das ist das grosse demokratische
Prinzip des Bienenstockes, welches die
Vorrechte der mütterlichen Abkunft kompensiert),
– wenn man, sage ich, unter diesen Verhältnissen
einem Stocke die Königin nimmt und ihr Fehlen
bemerkt wird – es vergehen oft zwei bis drei
Stunden, ehe alle Bienen es wissen, so gross ist
ihre Stadt, – so ruht alsbald fast jede Arbeit, die
Brut wird im Stich gelassen, ein Teil des Volkes
irrt im Stock umher und sucht nach seiner Mutter,
ein anderer fliegt aus und sucht sie da, die Ketten
der Arbeitsbienen, die am Wachsbau beschäftigt
waren, zerreissen und lösen sich auf, die Honigsucherinnen
befliegen ihre Blumen nicht mehr, die
Schildwachen am Eingang verlassen ihren Posten
und die fremden Räuber und Honigschmarotzer,
die stets auf unverhoffte Beute lauern, kommen und
gehen, ohne dass jemand daran denkt, den mühsam
erworbenen Schatz zu verteidigen. Allmählich verarmt
und verödet der Stock und seine trostlosen
Bewohnerinnen sterben bald vor Trübsal und Elend,
wiewohl der Sommer ihnen alle seine Blüten öffnet.
Giebt man ihnen ihre Königin aber wieder, ehe ihr Verlust ihnen zur vollendeten, unumstösslichen Thatsache geworden ist, ehe die Demoralisation zu sehr um sich gegriffen hat, – denn die Bienen sind wie die Menschen; Unglück und Verzweiflung brechen mit der Zeit ihren Charakter und trüben ihren Verstand, – giebt man ihnen die Königin nach einigen Stunden wieder, so bereiten sie ihr einen ausserordentlich rührenden Empfang. Alle umdrängen sie und rotten sich zusammen, klettern über einander weg und liebkosen sie im Vorbeilaufen mit ihren langen Fühlhörnern, die noch manche unaufgeklärten Organe enthalten, bieten ihr Honig dar und geleiten sie im Gedränge bis zu den königlichen Gemächern. Sofort ist die Ordnung wieder hergestellt und die Arbeit wird wieder aufgenommen, von den innersten Waben des Brutraumes bis zu den abgelegensten Vorbauten, in denen der Überschuss der Ernte gespeichert wird; die Honigsucherinnen fliegen in schwarzen Fäden hinaus und kehren oft schon drei Minuten darnach mit Nektar und Blütenstaub beladen heim; die Räuber und Schmarotzer werden vertrieben oder umgebracht, die Gänge gesäubert und der Stock ertönt wieder von dem sanften und eintönigen, eigentümlich freudigen Summen, welches gleichsam das Hohelied auf die Gegenwart der Königin ist.
 Es giebt tausend Beispiele
für diese unbedingte Treue und Hingebung
der Arbeitsbienen an ihre
Königin. Bei fast allen Missgeschicken
dieser kleinen Republik, wenn einzelne
Tafeln oder der ganze Bau durch
menschliche Rohheit oder Unwissenheit zerstört werden,
wenn das Volk durch Kälte, Hungersnöte oder
Krankheiten dahingerafft wird, bleibt die Königin fast
immer wohlbehalten und man findet sie lebend unter
den Leichen ihrer treuen Töchter. Denn alle beschützen
sie, erleichtern ihr die Flucht und schirmen
sie mit ihrem eigenen Leibe, sparen für sie die bekömmlichste
Nahrung und die letzten Honigtropfen.
Und so lange sie am Leben ist, mag das Missgeschick
noch so gross sein, die Verzweiflung bleibt
der Stadt der Jungfrauen fern. Man mag ihnen
zwanzigmal hintereinander die Waben zertrümmern,
die Brut und die Lebensmittel nehmen, man macht
sie doch nicht irre an der Zukunft. Mögen sie gezehntet,
halb verhungert sein und kaum noch so
viele Überlebende zählen, dass sie ihre Mutter vor
den Augen des Feindes verbergen können, sie werden
doch die Ordnung im Bau wiederherstellen, werden
so schnell wie möglich für Vorräte sorgen und sich
nach den neuen Ansprüchen ihrer unglücklichen
Lage in die Arbeit teilen. Und sie werden diese
Arbeit mit einer Geduld, einem Eifer, einer Umsicht
und Beharrlichkeit verrichten, die man in der Natur
nicht oft findet, obgleich die Mehrzahl ihrer Bewohner
mehr Mut und Zuversicht zu entwickeln
pflegt, als der Mensch.
Es giebt tausend Beispiele
für diese unbedingte Treue und Hingebung
der Arbeitsbienen an ihre
Königin. Bei fast allen Missgeschicken
dieser kleinen Republik, wenn einzelne
Tafeln oder der ganze Bau durch
menschliche Rohheit oder Unwissenheit zerstört werden,
wenn das Volk durch Kälte, Hungersnöte oder
Krankheiten dahingerafft wird, bleibt die Königin fast
immer wohlbehalten und man findet sie lebend unter
den Leichen ihrer treuen Töchter. Denn alle beschützen
sie, erleichtern ihr die Flucht und schirmen
sie mit ihrem eigenen Leibe, sparen für sie die bekömmlichste
Nahrung und die letzten Honigtropfen.
Und so lange sie am Leben ist, mag das Missgeschick
noch so gross sein, die Verzweiflung bleibt
der Stadt der Jungfrauen fern. Man mag ihnen
zwanzigmal hintereinander die Waben zertrümmern,
die Brut und die Lebensmittel nehmen, man macht
sie doch nicht irre an der Zukunft. Mögen sie gezehntet,
halb verhungert sein und kaum noch so
viele Überlebende zählen, dass sie ihre Mutter vor
den Augen des Feindes verbergen können, sie werden
doch die Ordnung im Bau wiederherstellen, werden
so schnell wie möglich für Vorräte sorgen und sich
nach den neuen Ansprüchen ihrer unglücklichen
Lage in die Arbeit teilen. Und sie werden diese
Arbeit mit einer Geduld, einem Eifer, einer Umsicht
und Beharrlichkeit verrichten, die man in der Natur
nicht oft findet, obgleich die Mehrzahl ihrer Bewohner
mehr Mut und Zuversicht zu entwickeln
pflegt, als der Mensch.
Um der Verzweiflung vorzubeugen und die Arbeitslust wach zu erhalten, bedarf es nicht einmal des Vorhandenseins einer Königin: genug, wenn diese bei ihrem Scheiden die entfernteste Hoffnung auf Nachkommenschaft zurücklässt. „Wir haben“, sagt der ehrwürdige Langstroth, einer der Väter der modernen Bienenzucht, „ein Volk gesehen, das nicht Bienen genug zählte, um eine Fläche von zehn Quadratzentimetern zu bedecken, und doch suchte es eine Königin zu erziehen. Zwei volle Wochen gab es die Hoffnung nicht auf; endlich, als die Bienen auf die Hälfte reduziert waren, kroch die Königin aus, aber ihre Flügel waren so schwach, dass sie nicht fliegen konnte. Aber trotz ihrer Ohnmacht behandelten ihre Bienen sie nicht weniger ehrerbietig. Eine Woche darauf war nur noch ein Dutzend Bienen übrig und einige Tage später war die Königin verschwunden, einige verzweifelte Überlebende auf den Waben zurücklassend.“
 Noch eine Thatsache, die der
Mensch in seiner unerhörten tyrannischen
Einmischung an diesen unglücklichen,
aber unerschütterlichen
Heldinnen erprobt hat, ein Experiment,
an dem sich die letzte Geberde der kindlichen
Liebe und Selbstverleugnung beobachten lässt.
Ich liess mir mehrmals aus Italien geschwängerte Königinnen
kommen, wie dies jeder Bienenfreund thut,
denn die italienische Rasse ist besser, kräftiger und
fruchtbarer, sie ist emsiger und von sanfterer Gemütsart,
als die einheimischen. Man verschickt sie in kleinen
durchlöcherten Kästen, giebt ihnen etwas Nahrung
und einige Arbeitsbienen mit, die nach Möglichkeit
aus den älteren Jahrgängen ausgesucht sind. (Das
Alter der Bienen erkennt man ziemlich leicht an
ihrem glatteren, mageren, fast kahlen Leib und vor
allem an ihren abgenutzten und durch die Arbeit
beschädigten Flügeln.) Diese Begleiterinnen haben
die Aufgabe, sie zu ernähren, zu pflegen und während
der Reise zu bewachen. In vielen Fällen kommt
eine Reihe davon tot an. In einem Falle waren
sogar alle verhungert, aber hier wie dort war die
Königin unversehrt und kräftig, und die letzte ihrer
Gefährtinnen war wahrscheinlich umgekommen,
indem sie ihrer Herrin, der Verkörperung eines
kostbareren und herrlicheren Lebens, als das eigene
war, den letzten Honigtropfen gegeben hatte, den
sie in der Tiefe ihrer Honigblase aufgespart hatte.
Noch eine Thatsache, die der
Mensch in seiner unerhörten tyrannischen
Einmischung an diesen unglücklichen,
aber unerschütterlichen
Heldinnen erprobt hat, ein Experiment,
an dem sich die letzte Geberde der kindlichen
Liebe und Selbstverleugnung beobachten lässt.
Ich liess mir mehrmals aus Italien geschwängerte Königinnen
kommen, wie dies jeder Bienenfreund thut,
denn die italienische Rasse ist besser, kräftiger und
fruchtbarer, sie ist emsiger und von sanfterer Gemütsart,
als die einheimischen. Man verschickt sie in kleinen
durchlöcherten Kästen, giebt ihnen etwas Nahrung
und einige Arbeitsbienen mit, die nach Möglichkeit
aus den älteren Jahrgängen ausgesucht sind. (Das
Alter der Bienen erkennt man ziemlich leicht an
ihrem glatteren, mageren, fast kahlen Leib und vor
allem an ihren abgenutzten und durch die Arbeit
beschädigten Flügeln.) Diese Begleiterinnen haben
die Aufgabe, sie zu ernähren, zu pflegen und während
der Reise zu bewachen. In vielen Fällen kommt
eine Reihe davon tot an. In einem Falle waren
sogar alle verhungert, aber hier wie dort war die
Königin unversehrt und kräftig, und die letzte ihrer
Gefährtinnen war wahrscheinlich umgekommen,
indem sie ihrer Herrin, der Verkörperung eines
kostbareren und herrlicheren Lebens, als das eigene
war, den letzten Honigtropfen gegeben hatte, den
sie in der Tiefe ihrer Honigblase aufgespart hatte.
 Die Erkenntnis dieser unverbrüchlichen
Hingebung hat dem Menschen
den Weg gewiesen, wie er den
wunderbaren politischen Sinn der
Bienen, ihre Arbeitslust, ihre Beharrlichkeit,
Hochherzigkeit und Liebe zur
Zukunft, die aus dieser Hingebung hervorgehen oder
darin einbegriffen sind, zu seinem Vorteil zu benutzen
hat. Durch sie ist es ihm seit einigen Jahren gelungen,
die wilden Bienen, ohne dass sie es ahnen,
bis zu einem gewissen Grade zu zähmen; denn sie
weichen keiner fremden Gewalt und noch in ihrer
unbewussten Knechtschaft dienen sie nur ihren
eignen Gesetzen. Der Mensch kann glauben, dass
er mit der Königin die Seele und das Geschick des
Schwarmes in Händen hält. Je nachdem er sie
verwendet, je nachdem er sozusagen mit ihr spielt,
kann er z. B. das Schwärmen hervorrufen oder
verhüten, künstliche Schwärme machen, Schwärme
vereinigen oder teilen und die Auswanderung der
Völker regeln. Die Königin ist im Grunde eine Art
von lebendigem Symbol, das, wie alle Symbole, ein
weniger sichtbares und allgemeineres Prinzip vertritt,
und der Imker muss sich dessen wohl bewusst
werden, wenn er sich nicht mancherlei Misserfolgen
aussetzen will. Übrigens täuschen sich
die Bienen keineswegs über ihre Königin und verlieren
nie aus den Augen, dass hinter ihrer sichtbaren
und kurzlebigen Gebieterin eine höhere, beharrende,
geistige Macht steht, das ist ihr herrschender
Gedanke. Ob dieser Gedanke bewusst
oder unbewusst ist, darauf kommt es nur dann an,
wenn wir die Bienen, die ihn haben, oder die Natur,
die ihn in sie gelegt hat, insbesondere bewundern
wollen. Wo er aber auch seinen Sitz hat, dieser
herrschende Gedanke, in den kleinen zarten Bienenleibern
oder in dem grossen unerkennbaren Weltkörper,
er ist unserer Beachtung wert, und wenn
wir uns nebenbei gesagt davor hüteten, unsre Bewunderung
gewohnheitsmässig von örtlichen Nebenumständen
abhängig zu machen, oder von der Herkunft
eines Dinges, so würden wir nicht so oft die
Gelegenheit versäumen, unsre Augen voll Bewunderung
zu öffnen; denn nichts ist heilsamer, als sie
so zu öffnen.
Die Erkenntnis dieser unverbrüchlichen
Hingebung hat dem Menschen
den Weg gewiesen, wie er den
wunderbaren politischen Sinn der
Bienen, ihre Arbeitslust, ihre Beharrlichkeit,
Hochherzigkeit und Liebe zur
Zukunft, die aus dieser Hingebung hervorgehen oder
darin einbegriffen sind, zu seinem Vorteil zu benutzen
hat. Durch sie ist es ihm seit einigen Jahren gelungen,
die wilden Bienen, ohne dass sie es ahnen,
bis zu einem gewissen Grade zu zähmen; denn sie
weichen keiner fremden Gewalt und noch in ihrer
unbewussten Knechtschaft dienen sie nur ihren
eignen Gesetzen. Der Mensch kann glauben, dass
er mit der Königin die Seele und das Geschick des
Schwarmes in Händen hält. Je nachdem er sie
verwendet, je nachdem er sozusagen mit ihr spielt,
kann er z. B. das Schwärmen hervorrufen oder
verhüten, künstliche Schwärme machen, Schwärme
vereinigen oder teilen und die Auswanderung der
Völker regeln. Die Königin ist im Grunde eine Art
von lebendigem Symbol, das, wie alle Symbole, ein
weniger sichtbares und allgemeineres Prinzip vertritt,
und der Imker muss sich dessen wohl bewusst
werden, wenn er sich nicht mancherlei Misserfolgen
aussetzen will. Übrigens täuschen sich
die Bienen keineswegs über ihre Königin und verlieren
nie aus den Augen, dass hinter ihrer sichtbaren
und kurzlebigen Gebieterin eine höhere, beharrende,
geistige Macht steht, das ist ihr herrschender
Gedanke. Ob dieser Gedanke bewusst
oder unbewusst ist, darauf kommt es nur dann an,
wenn wir die Bienen, die ihn haben, oder die Natur,
die ihn in sie gelegt hat, insbesondere bewundern
wollen. Wo er aber auch seinen Sitz hat, dieser
herrschende Gedanke, in den kleinen zarten Bienenleibern
oder in dem grossen unerkennbaren Weltkörper,
er ist unserer Beachtung wert, und wenn
wir uns nebenbei gesagt davor hüteten, unsre Bewunderung
gewohnheitsmässig von örtlichen Nebenumständen
abhängig zu machen, oder von der Herkunft
eines Dinges, so würden wir nicht so oft die
Gelegenheit versäumen, unsre Augen voll Bewunderung
zu öffnen; denn nichts ist heilsamer, als sie
so zu öffnen.
 Vielleicht wird man sagen,
dass dies sehr gewagte und allzumenschliche
Annahmen sind, dass die
Bienen wahrscheinlich keinen Gedanken
dieser Art haben und dass die Begriffe
Zukunft, Liebe zur Rasse und
viele andre, die wir ihnen andichten, im Grunde weiter
nichts sind, als die Formen, welche der Selbsterhaltungstrieb,
die Furcht vor Schmerz und Tod oder
der Lustreiz bei ihnen annehmen. Ich gebe zu, dass
dies alles nur eine Ausdrucksweise ist und darum
messe ich ihm auch keinen allzugrossen Wert bei.
Das Einzige, was in diesem Falle – wie in allen
andern Fällen – sicher feststeht, ist die Thatsache,
dass die Bienen unter den und den Verhältnissen
sich gegen ihre Königin so und so benehmen. Der
Rest ist ein Mysterium, über das man nur Vermutungen
haben kann, die mehr oder weniger annehmbar,
mehr oder weniger zutreffend sind. Aber
wenn wir von den Menschen so sprächen, wie es
vielleicht klug wäre, von den Bienen zu sprechen,
hätten wir dann wohl das Recht, mehr zu sagen?
Auch wir gehorchen nur den Notwendigkeiten des
Lebens, dem Lustreiz oder der Furcht vor Schmerz
und Tod, und was wir unsern Verstand nennen,
das hat den gleichen Ursprung und den gleichen
Zweck wie das, was wir bei den Tieren Instinkt
nennen. Wir vollziehen gewisse Akte, deren Folgen
wir zu kennen meinen, wir unterliegen anderen,
deren Gründe wir uns besser zu kennen schmeicheln,
als sie selbst; aber abgesehen davon, dass diese
Annahme durchaus nicht unanfechtbar dasteht, sind
solche Akte unerheblich und im Vergleich mit der
Unzahl der übrigen selten, und alle, die bestbekannten
und die unbekanntesten, die kleinsten und die gewaltigsten,
vollziehen sich in einer undurchdringlichen
Nacht, in der wir fast ebenso blind sind, wie
nach unserer Meinung die Bienen.
Vielleicht wird man sagen,
dass dies sehr gewagte und allzumenschliche
Annahmen sind, dass die
Bienen wahrscheinlich keinen Gedanken
dieser Art haben und dass die Begriffe
Zukunft, Liebe zur Rasse und
viele andre, die wir ihnen andichten, im Grunde weiter
nichts sind, als die Formen, welche der Selbsterhaltungstrieb,
die Furcht vor Schmerz und Tod oder
der Lustreiz bei ihnen annehmen. Ich gebe zu, dass
dies alles nur eine Ausdrucksweise ist und darum
messe ich ihm auch keinen allzugrossen Wert bei.
Das Einzige, was in diesem Falle – wie in allen
andern Fällen – sicher feststeht, ist die Thatsache,
dass die Bienen unter den und den Verhältnissen
sich gegen ihre Königin so und so benehmen. Der
Rest ist ein Mysterium, über das man nur Vermutungen
haben kann, die mehr oder weniger annehmbar,
mehr oder weniger zutreffend sind. Aber
wenn wir von den Menschen so sprächen, wie es
vielleicht klug wäre, von den Bienen zu sprechen,
hätten wir dann wohl das Recht, mehr zu sagen?
Auch wir gehorchen nur den Notwendigkeiten des
Lebens, dem Lustreiz oder der Furcht vor Schmerz
und Tod, und was wir unsern Verstand nennen,
das hat den gleichen Ursprung und den gleichen
Zweck wie das, was wir bei den Tieren Instinkt
nennen. Wir vollziehen gewisse Akte, deren Folgen
wir zu kennen meinen, wir unterliegen anderen,
deren Gründe wir uns besser zu kennen schmeicheln,
als sie selbst; aber abgesehen davon, dass diese
Annahme durchaus nicht unanfechtbar dasteht, sind
solche Akte unerheblich und im Vergleich mit der
Unzahl der übrigen selten, und alle, die bestbekannten
und die unbekanntesten, die kleinsten und die gewaltigsten,
vollziehen sich in einer undurchdringlichen
Nacht, in der wir fast ebenso blind sind, wie
nach unserer Meinung die Bienen.
„ Man muss gestehen“, sagt
Buffon, der gegen die Bienen eine
höchst spasshafte Abneigung hat,
„man muss gestehen, dass diese Tiere
einzeln genommen weniger Witz haben
als der Hund, der Affe und die meisten
anderen Wesen. Man muss gestehen, dass sie weniger
gelehrig und anhänglich sind und weniger Gemüt,
kurz, weniger menschenähnliche Eigenschaften besitzen,
und ferner, dass ihr anscheinender Verstand
nur von ihrer vereinigten Masse kommt. Doch setzt
diese Vereinigung selbst keinerlei Verstand voraus,
denn sie vereinigen sich keineswegs aus moralischen
Absichten, sie finden sich ohne ihre Einwilligung
zusammen. Ihr ‚Staat‘ ist also nur eine physische
Versammlung, von der Natur angeordnet und ohne
irgendwelche Bewusstheit und Überlegung entstanden.
Die Königin gebiert zehntausend Stück auf
einmal und am nämlichen Fleck, also müssen diese
zehntausend Stück, auch wenn sie noch tausendmal
stumpfsinniger sein mögen, als ich annehme, sich um
der blossen Lebenserhaltung willen irgendwie zusammenthun,
und da sie alle miteinander mit denselben
Kräften ausgerüstet sind, so müssen sie gerade
durch den Schaden, den sie sich anfangs etwa thun,
bald dahin kommen, sich möglichst wenig zu schaden,
d. h. sich zu helfen; sie erwecken infolgedessen
den Anschein eines Einvernehmens und eines gemeinsamen
Zieles; wer sie beobachtet, wird ihnen
also leicht Absichten und den Geist, der ihnen gerade
fehlt, unterschieben, er wird bemüht sein, für
jede Handlung eine Ursache zu entdecken, jede Bewegung
wird bald einen Beweggrund haben, und
daraus werden dann Vernunft-Ungeheuer oder Wundertiere
ohne Gleichen; denn diese zehntausend Stück,
die alle zugleich zur Welt gekommen sind, die zusammen
gewohnt haben und fast alle zugleich die
Metamorphose durchgemacht haben, können nicht
umhin, alle dasselbe zu thun und, wenn sie auch
noch so wenig Gemüt haben, die gleichen Gewohnheiten
anzunehmen, sich in die Arbeit zu teilen und
in dieser Gemeinschaft sich wohl zu fühlen, sich
um ihre Wohnung zu kümmern, nach dem Ausfluge
wieder zurückzukehren u. s. w. Daher kommt auch
die Architektur, die Geometrie, die Ordnung, die
Voraussicht und Heimatsliebe, mit einem Wort:
die Republik und das, wie man sieht, auf der Bewunderung
des Beobachters beruhende Ganze.“
Man muss gestehen“, sagt
Buffon, der gegen die Bienen eine
höchst spasshafte Abneigung hat,
„man muss gestehen, dass diese Tiere
einzeln genommen weniger Witz haben
als der Hund, der Affe und die meisten
anderen Wesen. Man muss gestehen, dass sie weniger
gelehrig und anhänglich sind und weniger Gemüt,
kurz, weniger menschenähnliche Eigenschaften besitzen,
und ferner, dass ihr anscheinender Verstand
nur von ihrer vereinigten Masse kommt. Doch setzt
diese Vereinigung selbst keinerlei Verstand voraus,
denn sie vereinigen sich keineswegs aus moralischen
Absichten, sie finden sich ohne ihre Einwilligung
zusammen. Ihr ‚Staat‘ ist also nur eine physische
Versammlung, von der Natur angeordnet und ohne
irgendwelche Bewusstheit und Überlegung entstanden.
Die Königin gebiert zehntausend Stück auf
einmal und am nämlichen Fleck, also müssen diese
zehntausend Stück, auch wenn sie noch tausendmal
stumpfsinniger sein mögen, als ich annehme, sich um
der blossen Lebenserhaltung willen irgendwie zusammenthun,
und da sie alle miteinander mit denselben
Kräften ausgerüstet sind, so müssen sie gerade
durch den Schaden, den sie sich anfangs etwa thun,
bald dahin kommen, sich möglichst wenig zu schaden,
d. h. sich zu helfen; sie erwecken infolgedessen
den Anschein eines Einvernehmens und eines gemeinsamen
Zieles; wer sie beobachtet, wird ihnen
also leicht Absichten und den Geist, der ihnen gerade
fehlt, unterschieben, er wird bemüht sein, für
jede Handlung eine Ursache zu entdecken, jede Bewegung
wird bald einen Beweggrund haben, und
daraus werden dann Vernunft-Ungeheuer oder Wundertiere
ohne Gleichen; denn diese zehntausend Stück,
die alle zugleich zur Welt gekommen sind, die zusammen
gewohnt haben und fast alle zugleich die
Metamorphose durchgemacht haben, können nicht
umhin, alle dasselbe zu thun und, wenn sie auch
noch so wenig Gemüt haben, die gleichen Gewohnheiten
anzunehmen, sich in die Arbeit zu teilen und
in dieser Gemeinschaft sich wohl zu fühlen, sich
um ihre Wohnung zu kümmern, nach dem Ausfluge
wieder zurückzukehren u. s. w. Daher kommt auch
die Architektur, die Geometrie, die Ordnung, die
Voraussicht und Heimatsliebe, mit einem Wort:
die Republik und das, wie man sieht, auf der Bewunderung
des Beobachters beruhende Ganze.“
Diese Art, unsere Bienen zu erklären, ist freilich eine ganz andere. Sie kann auf den ersten Blick als natürlicher erscheinen, aber sollte sie nicht gerade, weil sie so einfach klingt, garnichts erklären? Ich übergehe die sachlichen Irrtümer der eben zitierten Worte; aber wenn man sagt, sie passten sich, indem sie sich möglichst wenig schadeten, den Notwendigkeiten des gemeinsamen Lebens an, setzt man dann nicht eine gewisse Intelligenz voraus und zwar eine, die um so beträchtlicher erscheinen muss, je genauer man zusieht, auf welche Weise diese „zehntausend Stück“ sich zu schaden vermeiden und sich zu helfen wissen? Ist das nicht ebensogut unsere eigene Geschichte, die der alte ärgerliche Naturforscher da erzählt, und lässt sie sich nicht ganz genau auf alle unsere menschlichen Gesellschaften anwenden? Unsere Weisheit, unsere Tugenden, unsere Politik sind weiter nichts als die Früchte der herben Notwendigkeit, die unsere Einbildungskraft vergoldet hat; sie haben keinen anderen Zweck, als unsere Selbstsucht nutzbar zu machen und die ursprünglich schädliche Thätigkeit der Einzelwesen zum gemeinsamen Heile zu wenden. Und dann, um es noch einmal zu sagen: wenn man den Bienen jeden Gedanken, jedes Gefühl abspricht, das wir ihnen zugelegt haben: was liegt schliesslich an dem Gegenstande unserer Bewunderung? Wenn man es für unvernünftig hält, die Bienen zu bewundern, so können wir ja die Natur bewundern; es wird allemal ein Augenblick kommen, wo man uns unsere Bewunderung nicht mehr rauben kann, und wir werden dann nichts verloren haben, indem wir warteten und zurückwichen.
 Wie dem aber auch sei, und
um unsere Annahme nicht fallen zu
lassen, denn sie hat wenigstens den
Vorzug, gewisse mit der Wirklichkeit
in Beziehung stehende Thatsachen
auch mit unserem Geiste in Beziehung
zu setzen, so ist es unstreitig weit mehr das unendliche
Fortbestehen ihrer Rasse, was die Bienen in ihrer
Königin anbeten, als die Königin selbst. Die Bienen
sind keineswegs empfindsam, und wenn eine von
ihnen mit so schweren Verletzungen von der Arbeit
heimkommt, dass sie für dauernd arbeitsunfähig
erachtet werden muss, so wird sie ohne Erbarmen
verjagt. Und doch kann man nicht sagen, dass sie
jeder persönlichen Anhänglichkeit an ihre Mutter
bar sind. Sie erkennen sie unter allen anderen
heraus. Selbst wenn sie alt, elend und gelähmt ist,
werden die Wachen am Eingang keiner unbekannten
Königin Einlass gewähren, so jung, schön und
fruchtbar sie auch scheinen mag. Es ist dies freilich
einer der Fundamentalgrundsätze ihrer Polizei,
und nur in der grossen Trachtzeit wird er zu gunsten
einiger fremden Arbeitsbienen aufgegeben, vorausgesetzt,
dass diese mit Vorräten wohl beladen sind.
– Wird sie schliesslich völlig unfruchtbar, so wird
sie ersetzt, indem eine gewisse Zahl von jungen
Königinnen erzogen wird. Was aber geschieht mit
der alten Herrin? Man weiss es nicht genau, aber
es begegnet dem Bienenzüchter bisweilen, dass er
auf den Waben eines Bienenstockes eine prachtvolle
Königin in der Blüte ihres Alters findet, und
ganz im Grunde in einer dunklen Ecke die alte
„Herrin“, wie sie in der Normandie heisst, abgemagert
und gelähmt. Wie es scheint, haben sie
sie in diesem Falle bis zuletzt gegen den Hass ihrer
jugendstarken Rivalin geschützt, die ihren Tod will,
denn die Königinnen haben stets einen unbezwinglichen
Abscheu vor einander und stürzen auf einander
los, sobald zwei unter demselben Dache vereinigt
sind. Man ist also zu der Annahme geneigt,
dass sie der alten Königin eine Art von friedlichem
und bescheidenem Alterssitz in einem entfernten
Eckchen des Stockes sichern, wo sie ihre Tage in
Frieden beschliessen kann. Es ist dies eines der
tausend Wunder dieses Wachskönigreiches, und
wir können wieder einmal feststellen, dass die Politik
und die Lebensgewohnheiten der Bienen nichts
Fatalistisches und Engherziges an sich haben, und
dass sie vielen weit verborgeneren Gesetzen gehorchen,
als wir zu kennen wähnen.
Wie dem aber auch sei, und
um unsere Annahme nicht fallen zu
lassen, denn sie hat wenigstens den
Vorzug, gewisse mit der Wirklichkeit
in Beziehung stehende Thatsachen
auch mit unserem Geiste in Beziehung
zu setzen, so ist es unstreitig weit mehr das unendliche
Fortbestehen ihrer Rasse, was die Bienen in ihrer
Königin anbeten, als die Königin selbst. Die Bienen
sind keineswegs empfindsam, und wenn eine von
ihnen mit so schweren Verletzungen von der Arbeit
heimkommt, dass sie für dauernd arbeitsunfähig
erachtet werden muss, so wird sie ohne Erbarmen
verjagt. Und doch kann man nicht sagen, dass sie
jeder persönlichen Anhänglichkeit an ihre Mutter
bar sind. Sie erkennen sie unter allen anderen
heraus. Selbst wenn sie alt, elend und gelähmt ist,
werden die Wachen am Eingang keiner unbekannten
Königin Einlass gewähren, so jung, schön und
fruchtbar sie auch scheinen mag. Es ist dies freilich
einer der Fundamentalgrundsätze ihrer Polizei,
und nur in der grossen Trachtzeit wird er zu gunsten
einiger fremden Arbeitsbienen aufgegeben, vorausgesetzt,
dass diese mit Vorräten wohl beladen sind.
– Wird sie schliesslich völlig unfruchtbar, so wird
sie ersetzt, indem eine gewisse Zahl von jungen
Königinnen erzogen wird. Was aber geschieht mit
der alten Herrin? Man weiss es nicht genau, aber
es begegnet dem Bienenzüchter bisweilen, dass er
auf den Waben eines Bienenstockes eine prachtvolle
Königin in der Blüte ihres Alters findet, und
ganz im Grunde in einer dunklen Ecke die alte
„Herrin“, wie sie in der Normandie heisst, abgemagert
und gelähmt. Wie es scheint, haben sie
sie in diesem Falle bis zuletzt gegen den Hass ihrer
jugendstarken Rivalin geschützt, die ihren Tod will,
denn die Königinnen haben stets einen unbezwinglichen
Abscheu vor einander und stürzen auf einander
los, sobald zwei unter demselben Dache vereinigt
sind. Man ist also zu der Annahme geneigt,
dass sie der alten Königin eine Art von friedlichem
und bescheidenem Alterssitz in einem entfernten
Eckchen des Stockes sichern, wo sie ihre Tage in
Frieden beschliessen kann. Es ist dies eines der
tausend Wunder dieses Wachskönigreiches, und
wir können wieder einmal feststellen, dass die Politik
und die Lebensgewohnheiten der Bienen nichts
Fatalistisches und Engherziges an sich haben, und
dass sie vielen weit verborgeneren Gesetzen gehorchen,
als wir zu kennen wähnen.
 Aber wir kreuzen alle Augenblicke
die Naturgesetze, die den Bienen
unerschütterlich erscheinen müssen.
Wir versetzen sie alle Tage in die
Lage, in der wir uns selbst sehen
würden, wenn jemand plötzlich die
Gesetze der Schwerkraft, des Lichtes und des
Todes aufhöbe.
Aber wir kreuzen alle Augenblicke
die Naturgesetze, die den Bienen
unerschütterlich erscheinen müssen.
Wir versetzen sie alle Tage in die
Lage, in der wir uns selbst sehen
würden, wenn jemand plötzlich die
Gesetze der Schwerkraft, des Lichtes und des
Todes aufhöbe.
Was werden sie z. B. thun, wenn man dem Stocke durch List oder Gewalt eine zweite Königin beisetzt? Von Natur ist dieser Fall nie eingetreten, seit Bienen leben, dafür sorgen die Wachen am Eingang. Sie verlieren den Verstand indess nicht, sondern wissen die zwei Grundsätze, die sie wie Göttergebote zu achten scheinen, in einer wunderbaren Weise zu vereinigen. Der eine dieser Grundsätze ist der der ungeteilten Mutterschaft einer Königin, ein unverbrüchlicher Grundsatz, ausser wenn die herrschende Königin unfruchtbar ist (und auch in diesem Falle nur ganz ausnahmsweise). Der zweite ist noch sonderbarer, denn wenn er auch nicht übertreten werden darf, so lässt er sich sozusagen doch beugen. Es ist dies das Prinzip der Unverletzlichkeit jeder königlichen Person. Es wäre den Bienen ein leichtes, die Eingedrungene mit ihren tausend Giftstacheln zu durchbohren, sie würde auf der Stelle tot sein und sie hätten ihren Leichnam nur aus dem Bau zu schaffen. Aber obwohl ihr Stachel stets kampfbereit ist, obwohl sie ihn jeden Augenblick gebrauchen, um innere Zwistigkeiten auszufechten, die Drohnen oder die Schmarotzer des Bienenstockes zu töten, so brauchen sie ihn nie gegen eine Königin, ebenso wie die Königin den ihren nie gegen Menschen, Tiere oder Arbeitsbienen zückt: sie zieht ihre königliche Waffe, die nicht gerade ist, wie bei den Arbeitsbienen, sondern gekrümmt, wie ein Türkensäbel, nur im Kampfe mit ihresgleichen, d. h. gegen eine andere Königin.
Keine Biene wagt also, wie es scheint, einen unmittelbaren, blutigen Königsmord auf sich zu nehmen, und so suchen sie in allen Fällen, wo Ordnung und Gedeihen ihrer Republik den Tod der einen Königin erheischen, diesem Tode den Anschein eines natürlichen zu geben: sie teilen das Verbrechen in tausend Teile, und so wird es anonym.
Sie schliessen dann die Eingedrungene in einen dichten Knäuel ein und bilden eine Art von lebendem Kerker um sie, in dem sie sich nicht rühren kann, bis sie nach vierundzwanzig Stunden verhungert oder erstickt ist. Erscheint inzwischen aber die rechtmässige Königin und wagt den Kampf gegen die Nebenbuhlerin, so öffnen sich alsbald die lebendigen Kerkerwände, die Bienen ziehen sich zurück und schliessen um die beiden Gegnerinnen einen Kreis, ohne sich an dem Kampfe zu beteiligen. Aufmerksam, aber unparteiisch verfolgen sie diesen eigentümlichen Zweikampf, denn nur eine Mutter darf den Stachel gegen eine Mutter erheben, und nur die, welche zwei Millionen Leben in ihren Weichen birgt, scheint das Recht zu haben, mit einem Streiche zwei Millionen zu töten. Wenn aber der Kampf unentschieden bleibt, wenn die zwei gekrümmten Stachel an den schweren Chitinpanzern machtlos abgleiten, so wird die, welche Miene macht zu fliehen, die rechtmässige sowohl wie die fremde, ergriffen und wieder in den lebenden Kerker eingeschlossen, bis sie die Absicht kundgiebt, den Kampf von neuem aufzunehmen. Es muss übrigens noch hinzugefügt werden, dass bei den zahlreichen Versuchen dieser Art die regierende Königin fast immer Siegerin bleibt, sei es, dass sie im Gefühl zu Hause zu sein, mehr Wagemut und Kraft hat, als die andre, sei es, dass die Bienen nur im Augenblick des Kampfes unparteiisch, hingegen in der Art, wie sie die beiden Rivalinnen einschliessen, ziemlich parteiisch sind, denn ihre Mutter scheint unter ihrer Einkerkerung keineswegs zu leiden, aber die Fremde geht fast immer sichtlich gelähmt und zerquetscht daraus hervor.
 Ein einfaches Experiment
zeigt besser als alles andere, dass
die Bienen ihre Königin wiedererkennen
und eine wirkliche Anhänglichkeit
an sie haben. Nimmt man
einem Bienenstocke die Königin, so
sieht man bald alle die Kundgebungen der Unruhe
und Trübsal eintreten, die ich in einem früheren
Kapitel beschrieben habe. Lässt man nach einigen
Stunden dieselbe Königin wieder ein, so kommen alle
ihre Töchter ihr huldigend entgegen und bieten ihr
Honig dar. Die einen bilden Spalier vor ihr, die andern
„präsentieren“ in grossen unbeweglichen Halbkreisen
um sie herum, d. h. sie senken den Kopf, halten
den Hinterleib hoch und schwirren dabei in eigentümlich
zitternder Weise mit den Flügeln. Dieses
sonderbare Gebahren ist der Ausdruck ihrer Freude
über die glückliche Heimkehr und bedeutet in ihrem
Hofceremoniell anscheinend feierliche Verehrung
oder höchstes Wohlbehagen. Aber man glaube
nicht, man könnte sie täuschen, und statt der rechtmässigen
Königin eine fremde einführen. Wenn
diese kaum einige Schritte vorwärts gemacht hat,
so laufen die Arbeitsbienen von allen Seiten entrüstet
zusammen. Sie wird auf der Stelle umringt,
in das furchtbare Getümmel des Schwarms eingekerkert
und darin gefangen gehalten, bis sie stirbt,
denn in diesem besonderen Falle kommt es fast nie
vor, dass sie lebend entrinnt.
Ein einfaches Experiment
zeigt besser als alles andere, dass
die Bienen ihre Königin wiedererkennen
und eine wirkliche Anhänglichkeit
an sie haben. Nimmt man
einem Bienenstocke die Königin, so
sieht man bald alle die Kundgebungen der Unruhe
und Trübsal eintreten, die ich in einem früheren
Kapitel beschrieben habe. Lässt man nach einigen
Stunden dieselbe Königin wieder ein, so kommen alle
ihre Töchter ihr huldigend entgegen und bieten ihr
Honig dar. Die einen bilden Spalier vor ihr, die andern
„präsentieren“ in grossen unbeweglichen Halbkreisen
um sie herum, d. h. sie senken den Kopf, halten
den Hinterleib hoch und schwirren dabei in eigentümlich
zitternder Weise mit den Flügeln. Dieses
sonderbare Gebahren ist der Ausdruck ihrer Freude
über die glückliche Heimkehr und bedeutet in ihrem
Hofceremoniell anscheinend feierliche Verehrung
oder höchstes Wohlbehagen. Aber man glaube
nicht, man könnte sie täuschen, und statt der rechtmässigen
Königin eine fremde einführen. Wenn
diese kaum einige Schritte vorwärts gemacht hat,
so laufen die Arbeitsbienen von allen Seiten entrüstet
zusammen. Sie wird auf der Stelle umringt,
in das furchtbare Getümmel des Schwarms eingekerkert
und darin gefangen gehalten, bis sie stirbt,
denn in diesem besonderen Falle kommt es fast nie
vor, dass sie lebend entrinnt.
Es ist darum auch sehr schwierig für den Bienenzüchter, Königinnen zu ersetzen. Es ist eigentümlich zu sehen, zu welchen Kniffen und komplizierten Listen der Mensch greifen muss, um seinen Willen durchzusetzen und diese kleinen klugen, aber stets im besten Glauben lebenden Insekten irrezuführen, die mit rührendem Mute die unverhofftesten Ereignisse annehmen und augenscheinlich nichts anderes in ihnen sehen, als eine neue unvermeidliche Laune der Natur. Auf jeden Fall rechnet der Mensch bei all seiner List und bei der trostlosen Verwirrung, die er mit seinen gewagten Manövern oft anrichtet, allemal auf den wunderbaren praktischen Sinn der Bienen, auf den unerschöpflichen Schatz ihrer Gesetze und merkwürdigen Gewohnheiten, auf ihre Ordnungs- und Friedensliebe, ihren Gemeinsinn, ihre Treue gegen die Zukunft, ihre so geschickte Charakterfestigkeit und ihren so selbstlosen Ernst, vor allem aber auf ihre unermüdliche Pflichterfüllung. Doch die Einzelheiten dieses Verfahrens gehören in das Gebiet der eigentlichen Bienenzucht und würden uns hier zu weit führen.[3]
 Was aber die persönliche Anhänglichkeit
betrifft, mit der ich hier
zu Ende kommen möchte, so scheint
es gewiss, dass sie vorhanden ist,
ebenso gewiss aber, dass sie nicht
lange im Gedächtnis bleibt, und wenn
man eine Mutter, die mehrere Tage verschwunden
war, wieder in ihr Reich einsetzen will, so wird sie
von ihren erbitterten Kindern derart behandelt, dass
man sich beeilen muss, sie der tötlichen Einkerkerung
zu entziehen, welche das Loos der fremden Königinnen
ist. Denn sie haben inzwischen Zeit gehabt,
ein Dutzend Zellen für Arbeitsbienen in solche für
Königinnen umzubauen, und die Zukunft des Volkes
steht nicht mehr auf dem Spiele. Ihre Anhänglichkeit
nimmt also in dem Maasse zu oder ab, inwieweit
die Königin diese Zukunft vertritt. So sieht
man, wenn eine Königin die gefährliche Zeremonie
des Hochzeitsausfluges vollzieht, ihre Unterthanen
häufig so besorgt, sie möchte verloren gehen, dass
sie sie auf diesem tragischen Liebesfluge, von dem
ich späterhin reden werde, begleiten. Das thun
sie aber nie, wenn man ihnen ein Stück Zellenbau
gegeben hat, der junge Brutzellen enthält, weil sie
dann die Aussicht haben, andere Mütter aufzuziehen.
Die Anhänglichkeit kann sogar in Wut und Hass
umschlagen, wenn ihre Herrin nicht alle ihre Pflichten
gegen jene abstrakte Gottheit erfüllt, die man die
künftige Gesellschaft nennen könnte und die sie
höher zu verehren scheinen, als wir. So hat man
die Königin z. B. aus verschiedenen Gründen am
Schwärmen gehindert, indem man ein Gitter am
Flugloch anbrachte, durch das die dünnen und gelenken
Arbeitsbienen ahnungslos hindurchschlüpften,
während die arme Sklavin der Liebe mit ihrem
beträchtlich schwereren und umfangreicheren Körper
nicht hindurchkonnte. Beim ersten Ausflug merkten
die Bienen, dass sie ihnen nicht gefolgt war, kehrten
in die alte Wohnung zurück und stiessen, drängten
und misshandelten die unglückliche Gefangene, die
sie ohne Zweifel der Trägheit anklagten oder für
etwas geistesschwach hielten, auf eine sehr unzweideutige
Weise. Beim zweiten Ausflug schien ihr
böser Wille festzustehen, der Zorn wuchs und die
Ausschreitungen wurden ernster. Endlich beim
dritten Ausflug waren sie der Meinung, dass sie
ihrem Loose und der Zukunft der Rasse für immer
untreu geworden war, und verurteilten sie zum Tode
in dem königlichen Gefängnis.
Was aber die persönliche Anhänglichkeit
betrifft, mit der ich hier
zu Ende kommen möchte, so scheint
es gewiss, dass sie vorhanden ist,
ebenso gewiss aber, dass sie nicht
lange im Gedächtnis bleibt, und wenn
man eine Mutter, die mehrere Tage verschwunden
war, wieder in ihr Reich einsetzen will, so wird sie
von ihren erbitterten Kindern derart behandelt, dass
man sich beeilen muss, sie der tötlichen Einkerkerung
zu entziehen, welche das Loos der fremden Königinnen
ist. Denn sie haben inzwischen Zeit gehabt,
ein Dutzend Zellen für Arbeitsbienen in solche für
Königinnen umzubauen, und die Zukunft des Volkes
steht nicht mehr auf dem Spiele. Ihre Anhänglichkeit
nimmt also in dem Maasse zu oder ab, inwieweit
die Königin diese Zukunft vertritt. So sieht
man, wenn eine Königin die gefährliche Zeremonie
des Hochzeitsausfluges vollzieht, ihre Unterthanen
häufig so besorgt, sie möchte verloren gehen, dass
sie sie auf diesem tragischen Liebesfluge, von dem
ich späterhin reden werde, begleiten. Das thun
sie aber nie, wenn man ihnen ein Stück Zellenbau
gegeben hat, der junge Brutzellen enthält, weil sie
dann die Aussicht haben, andere Mütter aufzuziehen.
Die Anhänglichkeit kann sogar in Wut und Hass
umschlagen, wenn ihre Herrin nicht alle ihre Pflichten
gegen jene abstrakte Gottheit erfüllt, die man die
künftige Gesellschaft nennen könnte und die sie
höher zu verehren scheinen, als wir. So hat man
die Königin z. B. aus verschiedenen Gründen am
Schwärmen gehindert, indem man ein Gitter am
Flugloch anbrachte, durch das die dünnen und gelenken
Arbeitsbienen ahnungslos hindurchschlüpften,
während die arme Sklavin der Liebe mit ihrem
beträchtlich schwereren und umfangreicheren Körper
nicht hindurchkonnte. Beim ersten Ausflug merkten
die Bienen, dass sie ihnen nicht gefolgt war, kehrten
in die alte Wohnung zurück und stiessen, drängten
und misshandelten die unglückliche Gefangene, die
sie ohne Zweifel der Trägheit anklagten oder für
etwas geistesschwach hielten, auf eine sehr unzweideutige
Weise. Beim zweiten Ausflug schien ihr
böser Wille festzustehen, der Zorn wuchs und die
Ausschreitungen wurden ernster. Endlich beim
dritten Ausflug waren sie der Meinung, dass sie
ihrem Loose und der Zukunft der Rasse für immer
untreu geworden war, und verurteilten sie zum Tode
in dem königlichen Gefängnis.
 Man sieht, dieser Zukunft ist
alles mit einer Voraussicht, einer Einstimmigkeit,
einer Unbeugsamkeit und
Geschicklichkeit im Auslegen und Benutzen
der Umstände untergeordnet,
dass man vor Bewunderung starr ist,
wenn man bedenkt, wie unverhofft und übernatürlich
unser Eingreifen den Bienen erscheinen muss. Man
wird vielleicht sagen, dass sie sich in diesem Falle
das Unvermögen der Königin, ihnen zu folgen, sehr
schlecht deuten. Aber würden wir viel hellsichtiger
sein, wenn ein anders gearteter Verstand in Verbindung
mit einem so riesenhaften Körper, dass
seine Bewegungen fast ebenso unfasslich sind, wie
die einer Naturerscheinung, sich das Vergnügen
machte, uns Fallen gleicher Art zu stellen? Haben
wir nicht einige tausend Jahre gebraucht, um eine
einigermassen annehmbare Erklärung für den Blitzstrahl
zu finden? Jeder Intellekt ist mit Langsamkeit
geschlagen, wenn er aus seiner eng begrenzten
Wirkungssphäre heraustritt und sich Vorgängen gegenüber
sieht, zu denen er nicht den Anstoss gegeben
hat. Ausserdem ist nicht gesagt, dass die Bienen,
wenn man das Experiment mit dem Gitter fortsetzen
und verallgemeinern würde, nicht schliesslich
doch dahinterkämen und einen Ausweg fänden.
Sie haben schon manches andre Experiment begriffen
und das bestmögliche Teil dabei erwählt,
z. B. das Experiment mit den beweglichen Waben
oder das mit den Aufsätzen, wo man sie zwingt,
ihren überschüssigen Honig in die kleinen amerikanischen
Honigkästen zu tragen, oder endlich das
ausserordentliche Experiment mit den Kunstwaben,
wo die Zellen nur durch einen dünnen Wachsumriss
angedeutet sind und die Bienen sofort die
Nützlichkeit begreifen und sie sorgfältig ausbauen,
ohne Stoff und Arbeitskraft zu verlieren. Finden
sie nicht unter allen Verhältnissen, die sich ihnen
in Gestalt einer von einem böswilligen und hinterlistigen
Gotte gestellten Falle darstellen müssen,
stets die beste und einzig menschliche Lösung?
Um nur einen ganz naturgemässen, aber abnormen
Fall zu erwähnen: wenn eine Schnecke oder
eine Maus in den Stock gerät oder darin umkommt
– was werden sie wohl thun, um den Kadaver
loszuwerden, der alsbald ihre ganze Wohnung
verpesten würde? Wenn es ihnen nicht möglich
ist, den Eindringling hinauszujagen oder zu zerstückeln,
so schliessen sie ihn methodisch in ein
hermetisches Grabmal von Wachs und Propolis ein,
das unter den gewöhnlichen Bauten der Stadt
einen bizarren Eindruck macht. Letztes Jahr fand
ich in einem meiner Bienenstöcke ein Konglomerat
von drei solchen Grabhügeln, die wie die Zellen
des Wachsbaues nur durch eine gemeinsame Mittelwand
getrennt waren, um möglichst viel Wachs
zu sparen. Die klugen Totengräberinnen hatten
sie über den Leichen dreier Schnecken errichtet,
welche ein Kind in ihre Behausung hineingesteckt
hatte. Gewöhnlich begnügen sie sich bei Schnecken
damit, die Öffnung des Gehäuses mit Wachs zu
verkleben. Aber hier, wo die Schale mehr oder
weniger zerbrochen oder rissig war, hatten sie es
für klüger gehalten, das Ganze zu begraben, und
um den Eingang nicht zu verstopfen, hatten sie in
dieser den Weg versperrenden Masse eine Anzahl
von Gängen angebracht, die genau der Körpergrösse
der Drohnen angepasst waren, welche zweimal
so gross sind, wie die Bienen. Dies und der folgende
Fall erlauben wohl die Annahme, dass sie
eines Tages dahinterkommen könnten, warum die
Königin ihnen durch das Gitter nicht folgen kann.
Sie haben einen ganz ausgeprägten Sinn für Proportionen
und den nötigen Spielraum, dessen ein
Körper zu seiner Bewegung bedarf. In den Gegenden,
wo der Totenkopfschmetterling (Acherontia
atropos) häufig ist, errichten sie am Flugloche ihrer
Stöcke kleine Wachssäulen, zwischen denen der
nächtliche Räuber seinen dicken Leib nicht hindurchzwängen
kann.
Man sieht, dieser Zukunft ist
alles mit einer Voraussicht, einer Einstimmigkeit,
einer Unbeugsamkeit und
Geschicklichkeit im Auslegen und Benutzen
der Umstände untergeordnet,
dass man vor Bewunderung starr ist,
wenn man bedenkt, wie unverhofft und übernatürlich
unser Eingreifen den Bienen erscheinen muss. Man
wird vielleicht sagen, dass sie sich in diesem Falle
das Unvermögen der Königin, ihnen zu folgen, sehr
schlecht deuten. Aber würden wir viel hellsichtiger
sein, wenn ein anders gearteter Verstand in Verbindung
mit einem so riesenhaften Körper, dass
seine Bewegungen fast ebenso unfasslich sind, wie
die einer Naturerscheinung, sich das Vergnügen
machte, uns Fallen gleicher Art zu stellen? Haben
wir nicht einige tausend Jahre gebraucht, um eine
einigermassen annehmbare Erklärung für den Blitzstrahl
zu finden? Jeder Intellekt ist mit Langsamkeit
geschlagen, wenn er aus seiner eng begrenzten
Wirkungssphäre heraustritt und sich Vorgängen gegenüber
sieht, zu denen er nicht den Anstoss gegeben
hat. Ausserdem ist nicht gesagt, dass die Bienen,
wenn man das Experiment mit dem Gitter fortsetzen
und verallgemeinern würde, nicht schliesslich
doch dahinterkämen und einen Ausweg fänden.
Sie haben schon manches andre Experiment begriffen
und das bestmögliche Teil dabei erwählt,
z. B. das Experiment mit den beweglichen Waben
oder das mit den Aufsätzen, wo man sie zwingt,
ihren überschüssigen Honig in die kleinen amerikanischen
Honigkästen zu tragen, oder endlich das
ausserordentliche Experiment mit den Kunstwaben,
wo die Zellen nur durch einen dünnen Wachsumriss
angedeutet sind und die Bienen sofort die
Nützlichkeit begreifen und sie sorgfältig ausbauen,
ohne Stoff und Arbeitskraft zu verlieren. Finden
sie nicht unter allen Verhältnissen, die sich ihnen
in Gestalt einer von einem böswilligen und hinterlistigen
Gotte gestellten Falle darstellen müssen,
stets die beste und einzig menschliche Lösung?
Um nur einen ganz naturgemässen, aber abnormen
Fall zu erwähnen: wenn eine Schnecke oder
eine Maus in den Stock gerät oder darin umkommt
– was werden sie wohl thun, um den Kadaver
loszuwerden, der alsbald ihre ganze Wohnung
verpesten würde? Wenn es ihnen nicht möglich
ist, den Eindringling hinauszujagen oder zu zerstückeln,
so schliessen sie ihn methodisch in ein
hermetisches Grabmal von Wachs und Propolis ein,
das unter den gewöhnlichen Bauten der Stadt
einen bizarren Eindruck macht. Letztes Jahr fand
ich in einem meiner Bienenstöcke ein Konglomerat
von drei solchen Grabhügeln, die wie die Zellen
des Wachsbaues nur durch eine gemeinsame Mittelwand
getrennt waren, um möglichst viel Wachs
zu sparen. Die klugen Totengräberinnen hatten
sie über den Leichen dreier Schnecken errichtet,
welche ein Kind in ihre Behausung hineingesteckt
hatte. Gewöhnlich begnügen sie sich bei Schnecken
damit, die Öffnung des Gehäuses mit Wachs zu
verkleben. Aber hier, wo die Schale mehr oder
weniger zerbrochen oder rissig war, hatten sie es
für klüger gehalten, das Ganze zu begraben, und
um den Eingang nicht zu verstopfen, hatten sie in
dieser den Weg versperrenden Masse eine Anzahl
von Gängen angebracht, die genau der Körpergrösse
der Drohnen angepasst waren, welche zweimal
so gross sind, wie die Bienen. Dies und der folgende
Fall erlauben wohl die Annahme, dass sie
eines Tages dahinterkommen könnten, warum die
Königin ihnen durch das Gitter nicht folgen kann.
Sie haben einen ganz ausgeprägten Sinn für Proportionen
und den nötigen Spielraum, dessen ein
Körper zu seiner Bewegung bedarf. In den Gegenden,
wo der Totenkopfschmetterling (Acherontia
atropos) häufig ist, errichten sie am Flugloche ihrer
Stöcke kleine Wachssäulen, zwischen denen der
nächtliche Räuber seinen dicken Leib nicht hindurchzwängen
kann.
 Aber genug davon, ich hätte
erst garnicht damit angefangen, wenn
es gälte, alle Beispiele zu erschöpfen.
Um jedoch die Rolle und Lage der
Königin noch einmal zusammenzufassen,
so kann man sagen, dass sie das
sklavische Herz des Schwarmes ist, während die Arbeitsbienen
den Verstand darstellen. Sie ist die Alleinherrscherin,
aber auch die königliche Magd, die gefangene
Hüterin und die verantwortliche Vertreterin
der Liebe. Ihr Volk dient ihr und verehrt sie,
ohne darüber zu vergessen, dass es nicht ihrer
Person unterthan ist, sondern der von ihr erfüllten
Aufgabe und Bestimmung. Man wird schwerlich
ein menschliches Gemeinwesen finden, dessen Plan
und Anlage einen so beträchtlichen Teil der Wünsche
und Sehnsüchte unseres Planeten erfüllt, eine Gesellschaft,
deren Glieder eine grössere und vernünftigere
Unabhängigkeit geniessen, und wo andererseits
eine unerbittlichere und zweckmässigere Unterordnung
herrscht, wo die Opfer härter und unbedingter
sind. Man glaube nicht, dass ich diese
Opfer ebenso bewunderte, wie ihre Resultate. Es
wäre augenscheinlich zu wünschen, dass diese Resultate
mit weniger Leid und Selbstaufopferung zu
erreichen wären. Stimmt man dem Prinzip aber
einmal bei – und vielleicht will die Vernunft unseres
Erdballs dieses Prinzip – so ist seine Durchführung
jedenfalls bewundernswert. Mag für die
Menschen eine andere Wahrheit gelten oder nicht,
im Bienenstock wird das Leben jedenfalls nicht
als eine Reihe von mehr oder minder angenehmen
Stunden angesehen, die man sich nur so weit verbittern
und verdüstern darf, als zu seiner Erhaltung
unerlässlich ist, sondern als eine grosse gemeinsame
Pflicht, die auf eine von Weltbeginn an ewig zurückweichende
Zukunft gerichtet ist. Jedes Individuum
verzichtet hier auf mehr als auf sein halbes Glück
und seine halben Rechte. Die Königin entsagt dem
Tageslicht, den Blumenkelchen und der süssen Freiheit,
die Arbeitsbienen entsagen der Liebe, fünf
oder sechs Lebensjahren und dem Mutterglück.
Die Königin sieht ihr Hirn zu Gunsten der Zeugungsorgane
auf ein Nichts reduziert und die Arbeitsbienen
eben diese Organe auf Kosten ihres Intellekts
verkümmern. Es wäre unrecht zu behaupten, dass
der Wille an diesen Verzichtleistungen keinen Anteil
hat. Die Arbeitsbiene ist zwar nicht Herrin
ihres eigenen Geschickes, aber sie bestimmt das
Schicksal aller Nymphen ihrer Umgebung, die
ihre mittelbaren Töchter sind. Wir haben gesehen,
dass aus jeder Larve, wenn sie königlich
ernährt oder untergebracht wird, eine Königin entstehen
kann, und wenn man umgekehrt die Ernährung
einer königlichen Larve ändert und ihre
Zelle verkleinert, würde eine Arbeitsbiene daraus
hervorgehen. Diese geheimnisvollen Wahlen
finden jeden Tag in dem goldbraunen Schatten des
Bienenstockes statt. Sie geschehen nicht auf gut
Glück, sondern eine Klugheit, deren tiefehrlichen
Ernst nur der Mensch missbrauchen kann, eine
allzeit wachsame Weisheit, die sich von allem
Rechenschaft ablegt, was ausserhalb und innerhalb
des Stockes vor sich geht, lenkt sie in ihren Entschliessungen.
Tritt ein unverhoffter Blumenreichtum
ein, wird die Königin alt oder lässt ihre Fruchtbarkeit
nach, wird es dem Schwarm infolge starker
Vermehrung zu eng in seinen Wänden, so entstehen
alsbald Königinnenzellen. Dieselben Zellen können
aber wieder abgetragen werden, wenn die Ernte
nicht hält, was sie versprach, oder wenn der Bienenstock
grösser geworden ist. Sie werden oft nicht
zerstört, so lange die junge Königin ihren Hochzeitsausflug
noch nicht – oder noch nicht erfolgreich
– ausgeführt hat, aber sofort geschieht dies,
sobald sie heimgekehrt und das untrügliche Zeichen
ihrer Befruchtung wie eine Trophäe hinter sich herschleppt.
Wo befindet sich diese Weisheit, die
Gegenwart und Zukunft so gewissenhaft abwägt
und für die das noch nicht Sichtbare mehr in die
Waage fällt, als alles, was man sehen kann? Wo
hat sie ihren Sitz, diese unpersönliche Klugheit, die
da entsagt und wählt, erhöht und erniedrigt, die so
viele Bienen zu Königinnen machen könnte und aus
sovielen Müttern ein Volk von Jungfrauen erzieht?
Wir sagten weiter oben, dass sie im Geiste des
Bienenstockes zu suchen sei, aber wo ist dieser
Geist schliesslich zu finden, wenn nicht in der
Masse der Arbeitsbienen? Vielleicht war es, um
sich zu überzeugen, dass er hier seinen Sitz hat,
nicht nötig, die Sitten und Gebräuche dieses republikanischen
Königreiches so aufmerksam zu studieren.
Es genügte, wie Dujardin, Brandt, Girard,
Vogel und andere Entomologen gethan haben, den
etwas leeren Hirnschädel der Königin und den
prächtigen Drohnenkopf, an dem zwanzigtausend
Augen glänzen, neben den kleinen undankbaren
und kümmerlichen Kopf der jungfräulichen Arbeitsbiene
unter das Mikroskop zu legen. Wir würden
alsdann gesehen haben, dass sich in diesem kleinen
Köpfchen das grösste und vollkommenste Schädelmark
des ganzen Gemeinwesens windet, ja, selbst
das schönste, komplizierteste und nächst dem des
Menschen auch das vollkommenste in der ganzen
Natur, wenngleich es auf einer ganz anderen Stufe
steht und ganz anders beschaffen ist.[4] Hier wie
überall in der uns bekannten Welt ist da, wo das
Gehirn liegt, der Sitz der Autorität, der wirklichen
Kraft, der Weisheit und des Sieges. Auch
hier findet sich ein fast unsichtbares Atom jener
geheimnisvollen Substanz, welche die Materie unterjocht
und organisiert und den ungeheuren, trägen
Gewalten des Nichts und des Todes ein gesichertes,
dauerndes Plätzchen abzuringen weiss.
Aber genug davon, ich hätte
erst garnicht damit angefangen, wenn
es gälte, alle Beispiele zu erschöpfen.
Um jedoch die Rolle und Lage der
Königin noch einmal zusammenzufassen,
so kann man sagen, dass sie das
sklavische Herz des Schwarmes ist, während die Arbeitsbienen
den Verstand darstellen. Sie ist die Alleinherrscherin,
aber auch die königliche Magd, die gefangene
Hüterin und die verantwortliche Vertreterin
der Liebe. Ihr Volk dient ihr und verehrt sie,
ohne darüber zu vergessen, dass es nicht ihrer
Person unterthan ist, sondern der von ihr erfüllten
Aufgabe und Bestimmung. Man wird schwerlich
ein menschliches Gemeinwesen finden, dessen Plan
und Anlage einen so beträchtlichen Teil der Wünsche
und Sehnsüchte unseres Planeten erfüllt, eine Gesellschaft,
deren Glieder eine grössere und vernünftigere
Unabhängigkeit geniessen, und wo andererseits
eine unerbittlichere und zweckmässigere Unterordnung
herrscht, wo die Opfer härter und unbedingter
sind. Man glaube nicht, dass ich diese
Opfer ebenso bewunderte, wie ihre Resultate. Es
wäre augenscheinlich zu wünschen, dass diese Resultate
mit weniger Leid und Selbstaufopferung zu
erreichen wären. Stimmt man dem Prinzip aber
einmal bei – und vielleicht will die Vernunft unseres
Erdballs dieses Prinzip – so ist seine Durchführung
jedenfalls bewundernswert. Mag für die
Menschen eine andere Wahrheit gelten oder nicht,
im Bienenstock wird das Leben jedenfalls nicht
als eine Reihe von mehr oder minder angenehmen
Stunden angesehen, die man sich nur so weit verbittern
und verdüstern darf, als zu seiner Erhaltung
unerlässlich ist, sondern als eine grosse gemeinsame
Pflicht, die auf eine von Weltbeginn an ewig zurückweichende
Zukunft gerichtet ist. Jedes Individuum
verzichtet hier auf mehr als auf sein halbes Glück
und seine halben Rechte. Die Königin entsagt dem
Tageslicht, den Blumenkelchen und der süssen Freiheit,
die Arbeitsbienen entsagen der Liebe, fünf
oder sechs Lebensjahren und dem Mutterglück.
Die Königin sieht ihr Hirn zu Gunsten der Zeugungsorgane
auf ein Nichts reduziert und die Arbeitsbienen
eben diese Organe auf Kosten ihres Intellekts
verkümmern. Es wäre unrecht zu behaupten, dass
der Wille an diesen Verzichtleistungen keinen Anteil
hat. Die Arbeitsbiene ist zwar nicht Herrin
ihres eigenen Geschickes, aber sie bestimmt das
Schicksal aller Nymphen ihrer Umgebung, die
ihre mittelbaren Töchter sind. Wir haben gesehen,
dass aus jeder Larve, wenn sie königlich
ernährt oder untergebracht wird, eine Königin entstehen
kann, und wenn man umgekehrt die Ernährung
einer königlichen Larve ändert und ihre
Zelle verkleinert, würde eine Arbeitsbiene daraus
hervorgehen. Diese geheimnisvollen Wahlen
finden jeden Tag in dem goldbraunen Schatten des
Bienenstockes statt. Sie geschehen nicht auf gut
Glück, sondern eine Klugheit, deren tiefehrlichen
Ernst nur der Mensch missbrauchen kann, eine
allzeit wachsame Weisheit, die sich von allem
Rechenschaft ablegt, was ausserhalb und innerhalb
des Stockes vor sich geht, lenkt sie in ihren Entschliessungen.
Tritt ein unverhoffter Blumenreichtum
ein, wird die Königin alt oder lässt ihre Fruchtbarkeit
nach, wird es dem Schwarm infolge starker
Vermehrung zu eng in seinen Wänden, so entstehen
alsbald Königinnenzellen. Dieselben Zellen können
aber wieder abgetragen werden, wenn die Ernte
nicht hält, was sie versprach, oder wenn der Bienenstock
grösser geworden ist. Sie werden oft nicht
zerstört, so lange die junge Königin ihren Hochzeitsausflug
noch nicht – oder noch nicht erfolgreich
– ausgeführt hat, aber sofort geschieht dies,
sobald sie heimgekehrt und das untrügliche Zeichen
ihrer Befruchtung wie eine Trophäe hinter sich herschleppt.
Wo befindet sich diese Weisheit, die
Gegenwart und Zukunft so gewissenhaft abwägt
und für die das noch nicht Sichtbare mehr in die
Waage fällt, als alles, was man sehen kann? Wo
hat sie ihren Sitz, diese unpersönliche Klugheit, die
da entsagt und wählt, erhöht und erniedrigt, die so
viele Bienen zu Königinnen machen könnte und aus
sovielen Müttern ein Volk von Jungfrauen erzieht?
Wir sagten weiter oben, dass sie im Geiste des
Bienenstockes zu suchen sei, aber wo ist dieser
Geist schliesslich zu finden, wenn nicht in der
Masse der Arbeitsbienen? Vielleicht war es, um
sich zu überzeugen, dass er hier seinen Sitz hat,
nicht nötig, die Sitten und Gebräuche dieses republikanischen
Königreiches so aufmerksam zu studieren.
Es genügte, wie Dujardin, Brandt, Girard,
Vogel und andere Entomologen gethan haben, den
etwas leeren Hirnschädel der Königin und den
prächtigen Drohnenkopf, an dem zwanzigtausend
Augen glänzen, neben den kleinen undankbaren
und kümmerlichen Kopf der jungfräulichen Arbeitsbiene
unter das Mikroskop zu legen. Wir würden
alsdann gesehen haben, dass sich in diesem kleinen
Köpfchen das grösste und vollkommenste Schädelmark
des ganzen Gemeinwesens windet, ja, selbst
das schönste, komplizierteste und nächst dem des
Menschen auch das vollkommenste in der ganzen
Natur, wenngleich es auf einer ganz anderen Stufe
steht und ganz anders beschaffen ist.[4] Hier wie
überall in der uns bekannten Welt ist da, wo das
Gehirn liegt, der Sitz der Autorität, der wirklichen
Kraft, der Weisheit und des Sieges. Auch
hier findet sich ein fast unsichtbares Atom jener
geheimnisvollen Substanz, welche die Materie unterjocht
und organisiert und den ungeheuren, trägen
Gewalten des Nichts und des Todes ein gesichertes,
dauerndes Plätzchen abzuringen weiss.
 Doch kehren wir zu unsren
schwärmenden Bienen zurück, die
nicht auf das Ende dieses Exkurses
gewartet haben, um das Zeichen zum
Aufbruch zu geben. In dem Augenblick,
wo dieses Zeichen gegeben wird, scheinen
sich alle Thore der Stadt mit einem Male zu öffnen,
wie von einem plötzlichen, irren Stosse, und die
schwarze Menge strömt oder vielmehr stürzt heraus,
je nach der Anzahl der Öffnungen in einem doppelten,
dreifachen oder vierfachen, geraden, straffen,
zitternden und ununterbrochenen Strahle, der sich
alsbald in der Luft zu einem summenden Netze von
hunderttausend wild schwirrenden, durchsichtigen
Flügeln zerteilt. Einige Minuten schwebt dieses
Netz über dem Bienenstock wie ein durchsichtiges,
knisterndes Seidengewebe, das tausend und abertausend
elektrisch bewegte Hände unaufhörlich zerreissen
und wieder zusammenfügen; es schwankt
hin und her, stockt und wallt von neuem zwischen
den Blumen der Erde und dem Blau des Himmels
auf und nieder, wie ein Schleier der Freude, den
unsichtbare Hände beständig schwenken, zusammenraffen
und wieder entfalten, als feierten sie die Ankunft
oder das Scheiden eines hohen Gastes. Endlich
senkt sich einer der Zipfel, ein andrer hebt sich,
die vier sonnenglänzenden Enden des schimmernden
Mantels stossen zusammen, und wie ein Zaubertuch
im Märchen, das den Horizont durchsegelt, um
irgend welche Wünsche zu erfüllen, steigt der
Schwarm, bereits wieder geballt, nach dem nächsten
Linden-, Birnen- oder Weidenbaum auf, um die heilige
Trägerin der Zukunft wieder mit seinen Leibern zu
bedecken. Denn die Königin hat sich dort bereits
angesetzt, wie ein goldener Nagel, an den sich nun
die brausenden Wellen des Schwarmes eine nach
der andern anhängen, bis rings herum sich ein
flügelglänzender Perlenmantel schlingt.
Doch kehren wir zu unsren
schwärmenden Bienen zurück, die
nicht auf das Ende dieses Exkurses
gewartet haben, um das Zeichen zum
Aufbruch zu geben. In dem Augenblick,
wo dieses Zeichen gegeben wird, scheinen
sich alle Thore der Stadt mit einem Male zu öffnen,
wie von einem plötzlichen, irren Stosse, und die
schwarze Menge strömt oder vielmehr stürzt heraus,
je nach der Anzahl der Öffnungen in einem doppelten,
dreifachen oder vierfachen, geraden, straffen,
zitternden und ununterbrochenen Strahle, der sich
alsbald in der Luft zu einem summenden Netze von
hunderttausend wild schwirrenden, durchsichtigen
Flügeln zerteilt. Einige Minuten schwebt dieses
Netz über dem Bienenstock wie ein durchsichtiges,
knisterndes Seidengewebe, das tausend und abertausend
elektrisch bewegte Hände unaufhörlich zerreissen
und wieder zusammenfügen; es schwankt
hin und her, stockt und wallt von neuem zwischen
den Blumen der Erde und dem Blau des Himmels
auf und nieder, wie ein Schleier der Freude, den
unsichtbare Hände beständig schwenken, zusammenraffen
und wieder entfalten, als feierten sie die Ankunft
oder das Scheiden eines hohen Gastes. Endlich
senkt sich einer der Zipfel, ein andrer hebt sich,
die vier sonnenglänzenden Enden des schimmernden
Mantels stossen zusammen, und wie ein Zaubertuch
im Märchen, das den Horizont durchsegelt, um
irgend welche Wünsche zu erfüllen, steigt der
Schwarm, bereits wieder geballt, nach dem nächsten
Linden-, Birnen- oder Weidenbaum auf, um die heilige
Trägerin der Zukunft wieder mit seinen Leibern zu
bedecken. Denn die Königin hat sich dort bereits
angesetzt, wie ein goldener Nagel, an den sich nun
die brausenden Wellen des Schwarmes eine nach
der andern anhängen, bis rings herum sich ein
flügelglänzender Perlenmantel schlingt.
Dann wird es plötzlich still, und das laute Brausen dieser sonnenverfinsternden Wolke, die aus unendlichem Zorn und unzähligen Drohungen gewebt schien, der betäubende Goldhagel, der unaufhörlich über der ganzen Umgebung schwebte und tönte, verwandelt sich eine Minute darauf zu einer grossen, harmlosen und friedlichen Traube von tausend und abertausend kleinen, lebenden Beeren, die unbeweglich an einem Baumzweige hängt und geduldig auf die Rückkehr der Spürbienen wartet, die eine neue Wohnung auskundschaften.

 Es ist dies das erste Stadium
des Schwärmens, der s. g. erste oder
Hauptschwarm, der allemal die alte
Königin bei sich hat. Er legt sich
gewöhnlich an einem Baume oder
Busche in nächster Nähe des Bienenstocks
an, denn die Königin ist mit ihren Eiern beschwert
und hat das Licht seit ihrem Hochzeitsausflug
oder dem vorjährigen Schwärmen nicht mehr
erblickt, deshalb zaudert sie noch, sich dem weiten
Luftmeer anzuvertrauen, ja, sie scheint den Gebrauch
ihrer Flügel verlernt zu haben.
Es ist dies das erste Stadium
des Schwärmens, der s. g. erste oder
Hauptschwarm, der allemal die alte
Königin bei sich hat. Er legt sich
gewöhnlich an einem Baume oder
Busche in nächster Nähe des Bienenstocks
an, denn die Königin ist mit ihren Eiern beschwert
und hat das Licht seit ihrem Hochzeitsausflug
oder dem vorjährigen Schwärmen nicht mehr
erblickt, deshalb zaudert sie noch, sich dem weiten
Luftmeer anzuvertrauen, ja, sie scheint den Gebrauch
ihrer Flügel verlernt zu haben.
Der Bienenzüchter wartet, bis der Schwarm sich recht zusammengeballt hat. Dann geht er mit einem grossen Strohhut auf dem Kopfe (denn die harmloseste Biene macht unweigerlich Gebrauch von ihrem Stachel, sobald sie sich in die Haare verirrt, wo sie sich jedenfalls in einer Falle wähnt), aber ohne Bienenhaube, sofern er Erfahrung besitzt, und nachdem er die Arme bis an den Ellenbogen in kaltes Wasser getaucht hat, auf den Schwarm zu und schüttelt ihn von dem Aste, an dem er hängt, in einen umgestülpten Bienenkorb. Die Traube fällt schwer hinein wie eine reife Frucht. Oder, wenn der Ast zu stark ist, schöpft er den Klumpen mit einem Löffel auf und schüttet die vollen Löffel wie Getreide, wohin er will. Er braucht die Bienen, die um ihn herumsummen und ihm auf Gesicht und Händen herumkriechen, nicht zu fürchten. Vernimmt er doch ihr trunkenes Lied, den s. g. Schwarmgesang, das ihrem zornigen Summen ganz unähnlich ist. Er braucht nicht zu fürchten, dass der Schwarm sich teilt, wütend wird, sich zerstreut oder entschlüpft. Wie ich schon sagte, haben die geheimnisvollen Arbeiterinnen heute ihren Festtag und sind voll unwandelbaren Zutrauens. Sie haben sich von dem unter ihrer Obhut stehenden Schatze losgerissen und kennen ihre Feinde nun nicht mehr. Sie sind harmlos vor Glückseligkeit, und man weiss nicht, warum sie so glücklich sind: erfüllen sie doch nur das Gesetz. Aber alle Wesen kennen diese Stunden blinden Glücks, welche die Natur für solche Augenblicke aufspart, wo sie ihr Ziel erreichen will. Wundern wir uns nicht, dass sie die Betrogenen sind! Auch wir mit unserm vollkommeneren Gehirn, das sie seit vielen Jahrhunderten beobachtet, werden von ihr zum Besten gehalten und wissen noch nicht einmal, ob sie wohlwollend, gleichgültig oder niedrig grausam ist. –
Der Schwarm bleibt da, wohin die Königin gefallen ist, und wenn sie allein in den Bienenkorb gefallen ist, so ziehen alle Bienen, sobald sie dies merken, in langen, schwarzen Fäden nach dem mütterlichen Obdach, die meisten hastig eindringend, andre wieder an der Schwelle des unbekannten Thores stutzend und jenen Reigen feierlicher Freude bildend, mit dem sie glückliche Ereignisse zu begrüssen pflegen. Sie „präsentieren“, wie der Kunstausdruck lautet. Im Nu wird der unerwartete Unterkunftsort angenommen und bis in seine kleinsten Schlupfwinkel untersucht, seine Lage, Form und Farbe vermerkt und in die tausend kleinen, klugen und treuen Gedächtnisse eingegraben. Die Merkzeichen der Umgebung werden sorgsam eingeprägt, die neue Stadt mit ihrem Platze in Geist und Herzen aller Bewohnerinnen gegründet, und bald erschallt in ihren Mauern das Liebeslied der königlichen Gegenwart, während die Arbeit beginnt.
 Wenn der Mensch den
Schwarm nicht pflückt, so ist seine Geschichte
hier noch nicht zu Ende. Er
bleibt an seinem Aste hängen, bis die
zur Rekognoszierung und zum Quartiermachen
ausgesandten Spürbienen, die
sich von Anbeginn des Schwärmens an nach allen
Windrichtungen zerstreut haben, um eine neue Wohnung
zu suchen, sich wieder eingefunden haben. Eine
nach der andern kehrt zurück und berichtet, was
sie gefunden hat, denn da wir nicht im stande sind,
in das Denken der Bienen einzudringen, so müssen
wir uns das Schauspiel, dem wir beiwohnen, wohl
auf menschliche Weise erklären. Es ist also wahrscheinlich,
dass man ihren Meldungen aufmerksam
lauscht. Die eine rühmt gewiss einen hohlen Baumstamm,
die andere die Vorteile einer alten Mauerspalte,
einer Felsenhöhle oder einer verlassenen
Grube. Oft geschieht es, dass der Schwarm zaudert
und bis zum nächsten Morgen berät. Endlich wird
die Wahl getroffen und die Einstimmigkeit erzielt.
In einem bestimmten Augenblick beginnt der Schwarm
zu kribbeln, sich zu zerteilen und mit ungestümem,
andauernden Fluge, der jetzt kein Hindernis mehr
kennt, über Hecken, Getreide- und Leinfelder, Heuschober
und Teiche, Flüsse und Ortschaften hinweg,
in gerader Linie einem bestimmten und jedesmal
sehr entfernten Ziele entgegenzufliegen. Selten
kann der Mensch ihnen auf diesem zweiten Teil
ihres Fluges folgen. Sie kehren zur Natur zurück
und wir verlieren die Spur ihres Schicksals.
Wenn der Mensch den
Schwarm nicht pflückt, so ist seine Geschichte
hier noch nicht zu Ende. Er
bleibt an seinem Aste hängen, bis die
zur Rekognoszierung und zum Quartiermachen
ausgesandten Spürbienen, die
sich von Anbeginn des Schwärmens an nach allen
Windrichtungen zerstreut haben, um eine neue Wohnung
zu suchen, sich wieder eingefunden haben. Eine
nach der andern kehrt zurück und berichtet, was
sie gefunden hat, denn da wir nicht im stande sind,
in das Denken der Bienen einzudringen, so müssen
wir uns das Schauspiel, dem wir beiwohnen, wohl
auf menschliche Weise erklären. Es ist also wahrscheinlich,
dass man ihren Meldungen aufmerksam
lauscht. Die eine rühmt gewiss einen hohlen Baumstamm,
die andere die Vorteile einer alten Mauerspalte,
einer Felsenhöhle oder einer verlassenen
Grube. Oft geschieht es, dass der Schwarm zaudert
und bis zum nächsten Morgen berät. Endlich wird
die Wahl getroffen und die Einstimmigkeit erzielt.
In einem bestimmten Augenblick beginnt der Schwarm
zu kribbeln, sich zu zerteilen und mit ungestümem,
andauernden Fluge, der jetzt kein Hindernis mehr
kennt, über Hecken, Getreide- und Leinfelder, Heuschober
und Teiche, Flüsse und Ortschaften hinweg,
in gerader Linie einem bestimmten und jedesmal
sehr entfernten Ziele entgegenzufliegen. Selten
kann der Mensch ihnen auf diesem zweiten Teil
ihres Fluges folgen. Sie kehren zur Natur zurück
und wir verlieren die Spur ihres Schicksals.

 Sehen wir indes zu, was
der Schwarm in der von
dem Imker dargebotenen
Behausung macht. Und zunächst
gedenken wir des
Opfers, das die fünfzigtausend
Jungfrauen gebracht haben, die nach Ronsards
Wort
Sehen wir indes zu, was
der Schwarm in der von
dem Imker dargebotenen
Behausung macht. Und zunächst
gedenken wir des
Opfers, das die fünfzigtausend
Jungfrauen gebracht haben, die nach Ronsards
Wort
„Ein edles Herz in kleinem Leibe tragen.“
Bewundern wir noch einmal den Mut, dessen es bedarf, um in der Wüste, in die sie gefallen sind, das Leben fortzusetzen. Sie haben die vorratsreiche, prächtige Stadt verlassen, in der sie geboren sind, wo das Leben so gesichert, so wundervoll organisiert war, wo der Saft aller Blumen, die der Sonne entgegenblühen, dem Dräuen des Winters zu spotten erlaubte. Tausende und abertausende kleiner Töchter, die sie nie wieder sehen werden, haben sie in ihren Wiegen schlummernd zurückgelassen. Sie haben ausser dem riesigen Schatz von Wachs, Propolis und Blütenstaub, den sie aufgehäuft hatten, mehr als hundertundzwanzig Pfund Honig im Stich gelassen, d. h. mehr als das zwölffache Gewicht des ganzen Volkes und das sechsmalhunderttausendfache jeder Biene, was für den Menschen zweiundvierzigtausend Tonnen Lebensmittel vorstellen würde. Eine ganze Flotte von grossen Lastschiffen, mit kostbareren und vollkommeneren Lebensmitteln beladen, als die, welche wir kennen, denn der Honig ist für die Bienen eine Art von Lebenselixir und Nahrungssaft, der unmittelbar und fast restlos verdaulich ist.
Hier in der neuen Wohnung ist nichts vorhanden, kein Tropfen Honig, kein Wachsstreifen, kein Merkzeichen und kein Stützpunkt. Es ist die trostlose Nacktheit eines riesenhaften Bauwerks, das nur Dach und Mauern hat. Die glatten, kreisrunden Wände bergen nur Finsternisse, und die riesige Wölbung droben ründet sich über der grossen Leere. Aber die Biene kennt kein unnötiges Heimweh, jedenfalls hält sie sich damit nicht auf. Kaum ist der Bienenkorb wieder aufgerichtet und an seinen Platz gestellt, kaum die Betäubung und Verwirrung des geräuschvollen Falles etwas gewichen, so sieht man in der kribbelnden Masse eine sehr reinliche und ganz unerwartete Scheidung eintreten. Die grosse Mehrzahl der Bienen beginnt wie ein Heer, das einem bestimmten Befehl gehorcht, in dichten Reihen an den Seitenwänden des Gebäudes hochzuklettern. In der Kuppel angelangt, hängen die vordersten sich mit den Krallen ihrer Vorderfüsse darin auf, die folgenden an den ersten und so weiter, bis lange Ketten entstehen, die der nachdrängenden Menge zur Brücke dienen. Allmählich vermehren, verstärken und verschränken sich diese Ketten und es entstehen Guirlanden, die durch den fortwährenden Aufstieg der Massen schliesslich in einen dicken, dreieckigen Vorhang übergehen, oder besser in einen kompakten Kegel, dessen Spitze im höchsten Punkte der Kuppel hängt, während die Basis sich bis zur Hälfte oder Dreiviertel der Gesamthöhe des Bienenkorbes herabzieht. Hat die letzte Biene, die sich durch eine innere Stimme zu dieser Gruppe berufen fühlt, den im Dunkeln hängenden Vorhang erreicht, so hört das Klettern auf, jede Bewegung erstirbt allmählich und der seltsame Kegel wartet Stunden und Stunden lang in einem geradezu andachtsvollen Schweigen und in einer schier erschrecklichen Unbeweglichkeit auf das Mysterium der Wachsbildung.
Während dieser Zeit prüft der Rest der Bienen, d. h. alle die, welche im untern Teile des Bienenkorbes geblieben sind, das Gebäude und unternimmt die notwendigen Arbeiten, ohne sich irgendwie an der Bildung des wunderbaren Vorhanges zu beteiligen, in dessen Falten die Wundergabe herabzuträufeln beginnt, ohne sich auch nur versucht zu fühlen, dabei mitzuwirken. Sorgsam säubern sie den Fussboden und tragen welke Blätter, Hälmchen und Sandkörner Stück für Stück hinaus, denn der Reinlichkeitssinn der Bienen geht bis zur Manie, und wenn sie mitten im Winter zur Zeit der grossen Fröste allzulange verhindert sind, den „Reinigungsausflug“ zu unternehmen, wie der Imker es nennt, so gehen sie lieber massenhaft an grässlichen Unterleibsleiden zu Grunde, als dass sie den Stock besudelten. Nur die Drohnen sind unverbesserlich unsauber und beschmutzen schamlos die Waben, auf denen sie sitzen, und die Arbeitsbienen sind dann gezwungen, hinter ihnen rein zu machen. Ist das Säubern beendigt, so beginnen die Bienen derselben profanen Gruppe, die sich an dem in einer Art von Extase dahängenden Kegel nicht beteiligt, die Innenwände ihrer gemeinsamen Wohnung sorgfältig zu verkitten. Alle Spalten werden untersucht und mit Propolis zugestopft und die Wände von oben bis unten gefirnisst. Die Thorwache wird eingesetzt und bald fliegt eine Anzahl von Arbeitsbienen aus, um Nektar und Pollen einzutragen.
 Ehe wir die Falten des geheimnisvollen
Vorhangs lüften, unter
dem die Grundmauern der eigentlichen
Wohnung gelegt werden, versuchen
wir doch einmal uns klar zu machen,
welche Intelligenz unser Völkchen von
Auswanderern entwickeln muss, welches Augenmass
und welcher Fleiss nötig sind, um das neue Obdach
wohnlich zu machen, den Stadtplan im Leeren zu
entwerfen und in Gedanken den Platz für die einzelnen
Gebäude festzulegen, die so sparsam und so
schnell wie möglich erbaut werden müssen, denn
die Königin hat es eilig mit dem Eierlegen und setzt
die ersten bereits auf den Boden. Es ist in diesem
Labyrinth der verschiedensten, bisher nur in der
Vorstellung bestehenden Bauten, die durchaus nach
keinem Schema errichtet werden können, sowohl
den Gesetzen der Ventilation, wie denen der Haltbarkeit
und Stabilität Rechnung zu tragen; die
Widerstandskraft des Wachses, die Art der aufzuspeichernden
Lebensmittel, die Bequemlichkeit der
Zugänge, die Lebensgewohnheiten der Königin, die
gewissermassen vorherbestimmte, weil organisch
zweckmässigste Verteilung der Vorratshäuser und
Wohnräume, der Strassen und Durchgänge und viele
andre Fragen, deren Aufzählung hier zu weit führen
würde, sind zu bedenken.
Ehe wir die Falten des geheimnisvollen
Vorhangs lüften, unter
dem die Grundmauern der eigentlichen
Wohnung gelegt werden, versuchen
wir doch einmal uns klar zu machen,
welche Intelligenz unser Völkchen von
Auswanderern entwickeln muss, welches Augenmass
und welcher Fleiss nötig sind, um das neue Obdach
wohnlich zu machen, den Stadtplan im Leeren zu
entwerfen und in Gedanken den Platz für die einzelnen
Gebäude festzulegen, die so sparsam und so
schnell wie möglich erbaut werden müssen, denn
die Königin hat es eilig mit dem Eierlegen und setzt
die ersten bereits auf den Boden. Es ist in diesem
Labyrinth der verschiedensten, bisher nur in der
Vorstellung bestehenden Bauten, die durchaus nach
keinem Schema errichtet werden können, sowohl
den Gesetzen der Ventilation, wie denen der Haltbarkeit
und Stabilität Rechnung zu tragen; die
Widerstandskraft des Wachses, die Art der aufzuspeichernden
Lebensmittel, die Bequemlichkeit der
Zugänge, die Lebensgewohnheiten der Königin, die
gewissermassen vorherbestimmte, weil organisch
zweckmässigste Verteilung der Vorratshäuser und
Wohnräume, der Strassen und Durchgänge und viele
andre Fragen, deren Aufzählung hier zu weit führen
würde, sind zu bedenken.
Nun aber ist die Form der Wohnungen, die der Mensch den Bienen anbietet, die denkbar verschiedenste; sie wechselt vom hohlen Baumstamm oder der Thonröhre, die in Asien und Afrika noch im Gebrauch ist, und von der klassischen Strohglocke, die in einem Gebüsch von Monatsrosen und Sonnenblumen im Gemüsegarten oder unter den Fenstern unserer meisten Bauernhöfe steht, bis zu den wirklichen Werkstätten der modernen Mobilzucht, wo sich oft mehr als 150 Kilogramm Honig in drei oder vier Wabenstockwerken übereinander in einem herausnehmbaren Rahmen befinden, der das Ausschleudern der Waben mit einer Honigschleuder und das Wiedereinsetzen derselben gestattet, ganz als ob man in einer wohl geordneten Bibliothek ein Buch nach Benutzung wieder an seinen Platz stellt.
Laune oder Erwerbssinn des Menschen führt den Schwarm also eines Tages in die eine oder andre dieser recht ungleichen Wohnungen ein, und es ist nun Sache des kleinen Insekts, sich darin zurecht zu finden, Pläne zu modifizieren, die eigentlich unveränderlich sein sollten, und in diesem ungewohnten Raume die Lage des Wintersitzes zu bestimmen, der innerhalb der Zone der von dem halb erstarrten Volke noch erzeugten Wärme liegen muss; endlich muss der Brutraum seinen richtigen Platz haben, er darf, wenn kein Unglück geschehen soll, weder zu hoch noch zu tief, weder zu nahe am Flugloch noch zu weit davon entfernt sein. Der Schwarm kommt z. B. aus einem umgestürzten hohlen Baumstumpf, der nur einen langen, engen Gang bildete, und nun sieht er sich in einer Wohnung, die turmhoch ist und deren Dach sich im Finstern verliert. Oder, um uns in sein gewöhnliches Erstaunen zu versetzen: er war seit Jahrhunderten daran gewöhnt, unter dem Strohdach unserer ländlichen Bienenwohnungen zu hausen, und nun sperrt man ihn in eine Art Wandschrank oder grossen Kasten, der drei oder viermal grösser ist, als sein Elternhaus, in ein Durcheinander von Rahmen, die bald parallel, bald senkrecht zum Flugloch über einander hängen und alle Wandflächen des Baues mit einem Netz von Gerüsten bedecken.
 Und doch giebt es keinen
Fall, wo ein Schwarm die Arbeit verweigert
hätte, wo er sich durch die
Seltsamkeit der Umstände hätte verwirren
oder entmutigen lassen, vorausgesetzt,
dass die ihm dargebotene Wohnung
nicht schlecht riecht oder wirklich unbewohnbar
ist. Aber selbst in diesem Falle tritt keine Entmutigung
und Bestürzung oder Pflichtverweigerung ein: der
Schwarm verlässt dann einfach die ungastliche Stätte
und sucht sich anderswo etwas Besseres. Ebensowenig
lässt sich sagen, dass man die Bienen je
habe veranlassen können, eine sinnlose oder unzweckmässige
Arbeit zu verrichten. Man hat nie festgestellt,
dass die Bienen den Kopf verloren und nicht
gewusst hätten, welchen Entschluss sie fassen sollen,
dass sie planlose, missratene oder überflüssige
Bauten unternommen hätten. Man schüttle sie in
eine Hohlkugel, einen Trichter, eine Pyramide, einen
ovalen oder eckigen Korb, eine Röhre oder eine
Spirale, und man besuche sie einige Tage später,
vorausgesetzt, dass sie die Wohnung angenommen
haben, so wird man sehen, dass diese seltsame
Vielheit von kleinen, selbständig denkenden Köpfen
sich unmittelbar geeinigt und nach einer Methode,
deren Grundsätze unwandelbar, aber deren Folgen
lebendig sind, den günstigsten und oft den einzig
brauchbaren Punkt der sonderbaren Wohnung ohne
Zaudern gewählt hat.
Und doch giebt es keinen
Fall, wo ein Schwarm die Arbeit verweigert
hätte, wo er sich durch die
Seltsamkeit der Umstände hätte verwirren
oder entmutigen lassen, vorausgesetzt,
dass die ihm dargebotene Wohnung
nicht schlecht riecht oder wirklich unbewohnbar
ist. Aber selbst in diesem Falle tritt keine Entmutigung
und Bestürzung oder Pflichtverweigerung ein: der
Schwarm verlässt dann einfach die ungastliche Stätte
und sucht sich anderswo etwas Besseres. Ebensowenig
lässt sich sagen, dass man die Bienen je
habe veranlassen können, eine sinnlose oder unzweckmässige
Arbeit zu verrichten. Man hat nie festgestellt,
dass die Bienen den Kopf verloren und nicht
gewusst hätten, welchen Entschluss sie fassen sollen,
dass sie planlose, missratene oder überflüssige
Bauten unternommen hätten. Man schüttle sie in
eine Hohlkugel, einen Trichter, eine Pyramide, einen
ovalen oder eckigen Korb, eine Röhre oder eine
Spirale, und man besuche sie einige Tage später,
vorausgesetzt, dass sie die Wohnung angenommen
haben, so wird man sehen, dass diese seltsame
Vielheit von kleinen, selbständig denkenden Köpfen
sich unmittelbar geeinigt und nach einer Methode,
deren Grundsätze unwandelbar, aber deren Folgen
lebendig sind, den günstigsten und oft den einzig
brauchbaren Punkt der sonderbaren Wohnung ohne
Zaudern gewählt hat.
Wenn man sie in einen der obengenannten grossen Kastenstöcke bringt, so beachten sie die darin befindlichen Rahmen nur insoweit, als sie ihnen zum Ausgangs- und Stützpunkt beim Bau ihrer Waben dienen, und das ist schliesslich auch ganz verständlich, da die Wünsche und Absichten des Menschen ihnen ja gleichgültig sind. Wenn der Bienenzüchter aber den oberen Rand einiger Rahmen mit einem schmalen Wachsstreifen versehen hat, so begreifen sie sogleich den Vorteil, der in dieser angefangenen Arbeit liegt, bauen den Streifen sorgsam aus und führen den angedeuteten Plan mit eigenem Wachs zu Ende. Desgleichen – und der Fall tritt bei dem intensiven Betriebe von heute häufig ein – wenn alle Rahmen des Stockes, in den man den Schwarm eingeschlagen hat, von oben bis unten mit angefangenen Kunstwaben bedeckt sind, so fangen sie keinen Zeit und Wachs vergeudenden Neubau an, sondern sie nehmen die Gelegenheit wahr, führen das begonnene Werk weiter und bauen die eingepressten Zellenansätze bis zur Normaltiefe fertig, wobei sie übrigens an Stellen, wo die künstliche Wabe von der haarscharfen Senkrechten abweicht, ihre Korrektur vornehmen. Auf diese Weise besitzen sie in mehr als einer Woche eine ebenso prächtige und wohlgebaute Stadt, wie die eben verlassene, während sie, auf sich allein angewiesen, zwei oder drei Monate gebraucht hätten, um dasselbe Gewirr von Speicherräumen und weissen Wachshäusern aufzuführen.
 Dieses Anpassungsvermögen
scheint die Grenzen des „Instinkts“
doch merklich zu überschreiten. Überdies
ist nichts willkürlicher, als dieses
Unterscheiden zwischen Instinkt und
Intellekt. Sir John Lubbock, der über
Ameisen, Wespen und Bienen ganz persönliche und
sonderbare Beobachtungen gemacht hat, ist vielleicht
infolge einer unbewussten und etwas ungerechten
Vorliebe für die Ameisen, die er am genausten beobachtet
hat, – denn jeder Beobachter will, dass
das von ihm studierte Insekt intelligenter und bemerkenswerter
sei als die andern, und man thut
wohl daran, sich vor solchen kleinen Anwandlungen
von Eigenliebe zu hüten – Sir John Lubbock, sage
ich, ist sehr geneigt, der Biene jedes Unterscheidungsvermögen
und jede Überlegung abzusprechen,
sobald es sich nicht um ihre gewöhnlichen Arbeiten
handelt. Als Beweis giebt er ein Experiment, das
Jeder leicht wiederholen kann. Man thue in eine
Wasserflasche ein halbes Dutzend Fliegen und
ebenso viele Bienen, lege die Flasche wagerecht und
drehe ihren Boden dem Zimmerfenster zu. Die
Bienen werden sich stundenlang abquälen, einen
Ausgang durch den Glasboden zu finden, bis sie
schliesslich vor Erschöpfung und Hunger sterben,
während die Fliegen in weniger als zwei Minuten
zur entgegengesetzten Seite durch den Flaschenhals
entschlüpft sind. Sir John Lubbock schliesst
daraus, dass der Verstand der Biene äusserst beschränkt
ist und dass die Fliege viel mehr Geschick
besitzt, sich aus der Verlegenheit zu ziehen und
ihren Weg zu finden. Dieser Schluss scheint nicht
einwandsfrei. Man wende bald den Boden, bald
den Flaschenhals dem Lichte zu, zwanzigmal, wenn
man will, und die Bienen werden sich zwanzigmal
umdrehen, und dem Licht entgegenfliegen. Was
sie in dem Experiment des englischen Gelehrten
herabsetzt, ist ihre Liebe zum Licht und ihr Verstand
selbst. Sie bilden sich augenscheinlich ein,
dass die Befreiung aus jedem Gefängnis auf der
Lichtseite liegt, sie handeln also ganz folgerichtig,
nur zu folgerichtig. Sie wissen nichts von dem
übernatürlichen Mysterium, das für sie das Glas
ist, diese plötzlich undurchdringliche Luft, die es
in der freien Natur nicht giebt und die ihnen um
so unverständlicher sein muss, je intelligenter sie
sind. Die hirnlosen Fliegen, die sich um die Logik,
den Ruf des Lichtes und das Wunder des Krystalls
nicht kümmern, schwirren planlos in der Flasche
herum, bis sie schliesslich mit dem Glück der Einfältigen,
die sich oft da retten, wo die Weisheit
verdirbt, in den guten Flaschenhals geraten, der
sie befreit.
Dieses Anpassungsvermögen
scheint die Grenzen des „Instinkts“
doch merklich zu überschreiten. Überdies
ist nichts willkürlicher, als dieses
Unterscheiden zwischen Instinkt und
Intellekt. Sir John Lubbock, der über
Ameisen, Wespen und Bienen ganz persönliche und
sonderbare Beobachtungen gemacht hat, ist vielleicht
infolge einer unbewussten und etwas ungerechten
Vorliebe für die Ameisen, die er am genausten beobachtet
hat, – denn jeder Beobachter will, dass
das von ihm studierte Insekt intelligenter und bemerkenswerter
sei als die andern, und man thut
wohl daran, sich vor solchen kleinen Anwandlungen
von Eigenliebe zu hüten – Sir John Lubbock, sage
ich, ist sehr geneigt, der Biene jedes Unterscheidungsvermögen
und jede Überlegung abzusprechen,
sobald es sich nicht um ihre gewöhnlichen Arbeiten
handelt. Als Beweis giebt er ein Experiment, das
Jeder leicht wiederholen kann. Man thue in eine
Wasserflasche ein halbes Dutzend Fliegen und
ebenso viele Bienen, lege die Flasche wagerecht und
drehe ihren Boden dem Zimmerfenster zu. Die
Bienen werden sich stundenlang abquälen, einen
Ausgang durch den Glasboden zu finden, bis sie
schliesslich vor Erschöpfung und Hunger sterben,
während die Fliegen in weniger als zwei Minuten
zur entgegengesetzten Seite durch den Flaschenhals
entschlüpft sind. Sir John Lubbock schliesst
daraus, dass der Verstand der Biene äusserst beschränkt
ist und dass die Fliege viel mehr Geschick
besitzt, sich aus der Verlegenheit zu ziehen und
ihren Weg zu finden. Dieser Schluss scheint nicht
einwandsfrei. Man wende bald den Boden, bald
den Flaschenhals dem Lichte zu, zwanzigmal, wenn
man will, und die Bienen werden sich zwanzigmal
umdrehen, und dem Licht entgegenfliegen. Was
sie in dem Experiment des englischen Gelehrten
herabsetzt, ist ihre Liebe zum Licht und ihr Verstand
selbst. Sie bilden sich augenscheinlich ein,
dass die Befreiung aus jedem Gefängnis auf der
Lichtseite liegt, sie handeln also ganz folgerichtig,
nur zu folgerichtig. Sie wissen nichts von dem
übernatürlichen Mysterium, das für sie das Glas
ist, diese plötzlich undurchdringliche Luft, die es
in der freien Natur nicht giebt und die ihnen um
so unverständlicher sein muss, je intelligenter sie
sind. Die hirnlosen Fliegen, die sich um die Logik,
den Ruf des Lichtes und das Wunder des Krystalls
nicht kümmern, schwirren planlos in der Flasche
herum, bis sie schliesslich mit dem Glück der Einfältigen,
die sich oft da retten, wo die Weisheit
verdirbt, in den guten Flaschenhals geraten, der
sie befreit.
 Derselbe Naturforscher
giebt noch einen anderen Beweis von
ihrer mangelnden Intelligenz, indem
er sich auf den grossen amerikanischen
Bienenzüchter, den ehrwürdigen und
väterlichen Langstroth beruft. „Da die
Fliege“, sagt Langstroth, „nicht dazu geschaffen ist,
von Blumen, sondern von Dingen zu leben, in denen
sie leicht ertrinken könnte, so setzt sie sich vorsichtig
auf den Rand von Gefässen, die eine flüssige
Nahrung enthalten, und saugt klüglich daraus, während
die arme Biene sich kopfüber hineinstürzt und
bald darin umkommt. Das traurige Geschick ihrer
Mitschwestern hält die anderen nicht ab: sobald sie
sich derselben Lockspeise nähern, setzen sie sich
wie wahnsinnig auf Leichen und Sterbende, um
alsbald ihr trauriges Loos zu teilen. Niemand kann
ihren Wahnsinn ganz ermessen, wenn er nicht gesehen
hat, mit welcher nimmersatten Gier sie
schaarenweise in die Zuckersiedereien eindringen.
Ich habe tausende aus dem Zuckersaft herausziehen
sehen, in dem sie ertrunken waren, tausende auf
den siedenden Zucker sich setzen; der Boden war
mit Bienen bedeckt und die Fenster von ihnen verdunkelt;
die einen krochen, die andren flogen, wieder
andere waren so vollständig verkleistert, dass sie
weder kriechen noch fliegen konnten; nicht eine
von zehn war im stande, die verderbliche Beute
heimzutragen, und doch war die Luft voll von Myriaden
von Neuankömmlingen, die ebenso unsinnig
waren.“
Derselbe Naturforscher
giebt noch einen anderen Beweis von
ihrer mangelnden Intelligenz, indem
er sich auf den grossen amerikanischen
Bienenzüchter, den ehrwürdigen und
väterlichen Langstroth beruft. „Da die
Fliege“, sagt Langstroth, „nicht dazu geschaffen ist,
von Blumen, sondern von Dingen zu leben, in denen
sie leicht ertrinken könnte, so setzt sie sich vorsichtig
auf den Rand von Gefässen, die eine flüssige
Nahrung enthalten, und saugt klüglich daraus, während
die arme Biene sich kopfüber hineinstürzt und
bald darin umkommt. Das traurige Geschick ihrer
Mitschwestern hält die anderen nicht ab: sobald sie
sich derselben Lockspeise nähern, setzen sie sich
wie wahnsinnig auf Leichen und Sterbende, um
alsbald ihr trauriges Loos zu teilen. Niemand kann
ihren Wahnsinn ganz ermessen, wenn er nicht gesehen
hat, mit welcher nimmersatten Gier sie
schaarenweise in die Zuckersiedereien eindringen.
Ich habe tausende aus dem Zuckersaft herausziehen
sehen, in dem sie ertrunken waren, tausende auf
den siedenden Zucker sich setzen; der Boden war
mit Bienen bedeckt und die Fenster von ihnen verdunkelt;
die einen krochen, die andren flogen, wieder
andere waren so vollständig verkleistert, dass sie
weder kriechen noch fliegen konnten; nicht eine
von zehn war im stande, die verderbliche Beute
heimzutragen, und doch war die Luft voll von Myriaden
von Neuankömmlingen, die ebenso unsinnig
waren.“
Auch dies erscheint mir nicht entscheidender, als für einen übermenschlichen Beobachter, der die Grenzen unserer Intelligenz feststellen will, der Anblick der Alkoholverwüstungen unter den Menschen oder eines Schlachtfeldes. Die Biene ist uns gegenüber in einer seltsamen Lage, sie ist geschaffen, um in der gleichgiltigen und unbewussten Natur zu leben, und nicht an der Seite eines Ausnahmewesens, das die festesten Gesetze rings um sie erschüttert und grossartige, unbegreifliche Erscheinungen hervorruft. In der Natur, im eintönigen Waldleben wäre der von Langstroth beschriebene Wahnsinn nur dann möglich, wenn ein honigstrotzender Bau durch irgend einen Zufall auseinanderbräche. Aber dann gäbe es keine tötlichen Fenster, keinen kochenden Zucker, keinen dicken Syrup, und folglich auch keine Toten und keine anderen Gefahren als die, welche jedem Beute machenden Tiere drohen.
Würden wir unsere Kaltblütigkeit besser bewahren als sie, wenn eine unbekannte Gewalt unsere Vernunft auf Schritt und Tritt auf die Probe stellte? Es ist für uns also sehr schwer, die Bienen zu beurteilen, die wir selbst toll machen, und deren Intelligenz nicht darauf gerüstet ist, unsere Fallen zu meiden, ebensowenig wie die unsere darauf gerüstet ist, der Listen eines heutigen Tages unbekannten, aber nichts destoweniger doch möglichen, höheren Wesens zu spotten. Da wir es nicht kennen, schliessen wir daraus, dass wir den Gipfel dieses Erdenlebens erklommen haben, aber im ganzen genommen ist das nicht unbestreitbar. Ich verlange nicht, dass wir uns bei ungereimten oder niedrigen Handlungen, die wir thun, in den Schlingen dieses Wesens wähnen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies eines Tages Wahrheit sein wird. Andererseits kann man vernünftiger Weise nicht behaupten, die Bienen seien jedes Verstandes bar, weil es ihnen noch nicht gelungen ist, uns von dem Affen oder dem Bären zu unterscheiden, und sie uns behandeln, wie sie diese eingeborenen Bewohner des Urwaldes behandeln würden. Es ist gewiss, dass in und um uns Einflüsse und Mächte herrschen, die einander ebenso unähnlich sind und von uns doch nicht unterschieden werden.
Zuletzt, und um diese Apologie der Bienen abzuschliessen, mit der ich selbst ein wenig in die Anwandlungen von Eigenliebe verfalle, die ich dem Sir John Lubbock vorwarf, steht die Frage noch offen, ob man nicht intelligent sein muss, um so grosser Thorheiten fähig zu sein. Ist es doch stets so in dem ungewissen Bereich des Verstandes, welcher der unsicherste und schwankendste Zustand der Materie ist. In derselben Flamme wie der Verstand, ist auch die Leidenschaft, und man kann nicht einmal genau sagen, ob sie der Rauch oder der Docht der Flamme ist. Und hier ist die Leidenschaft der Bienen edel genug, um das Schwanken des Verstandes zu entschuldigen. Was sie zu dieser Tollheit treibt, ist nicht das tierische Verlangen, sich voll Honig zu saugen. Das hätten sie in den Zellen ihres Baues leichter. Man beobachte sie und verfolge sie in einem analogen Falle, und man wird sehen, dass sie, sobald ihre Honigblase voll ist, nach dem Bienenstock zurückkehren, ihre Beute abgeben und dreissig Mal in einer Stunde nach dem wunderbaren Erntefelde zurückkehren. Es ist also derselbe Trieb, der sie so viel Bewundernswertes thun lässt: der Eifer, dem Hause ihrer Schwestern und der Zukunft so viel Gutes zuzuführen, als sie vermögen. Wenn die Thorheiten der Menschen eine ebenso selbstlose Ursache haben, pflegen wir ihnen einen andern Namen zu geben.
 Die ganze Wahrheit muss
trotzdem gesagt werden. Angesichts
der Wunder ihres Gewerbfleisses,
ihres Gemeinsinnes und ihrer Opferfreudigkeit,
muss uns ein Umstand
immerhin in Erstaunen setzen und
unsere Bewunderung etwas beeinträchtigen, nämlich
ihre Gleichgiltigkeit gegen den Tod und das Unglück
ihrer Mitschwestern. Es geht durch den Charakter
der Bienen ein seltsamer Spalt. Im Bienenkorbe
lieben und helfen sich alle. Sie sind so einig,
wie die guten Gedanken derselben Seele. Verletzt
man eine, so opfern sich tausend, um ihre Mitbürgerin
zu rächen. Ausserhalb des Bienenstockes
kennen sie sich nicht mehr. Man verstümmele oder
vernichte – oder besser, man thue es nicht, es
wäre eine unnötige Grausamkeit, denn die Thatsache
steht fest, – aber gesetzt, man verstümmelte
oder vernichtete auf einem Stück Wabenhonig, ein
paar Schritte vom Bienenstand entfernt, zwanzig
oder dreissig Bienen aus demselben Stocke, und
die nicht getroffenen werden nicht einmal den Kopf
drehen, sondern achtlos gegen die in Todeszuckungen
Liegenden, deren letzte Bewegungen ihre Glieder
streifen, deren Schmerzensrufe ihnen ins Ohr gellen,
saugen sie nach wie vor mit ihrer phantastischen
Zunge, die wie eine chinesische Waffe aussieht,
den Saft, der ihnen kostbarer ist als das Leben.
Und wenn die Wabe leer ist, klettern sie, um nichts
zu verlieren, um auch den Honig, der an den Opfern
klebt, noch zu gewinnen, ruhig über Leichen und
Verwundete weg, ohne sich über das Vorhandensein
der Einen aufzuregen und ohne den Anderen
Hilfe zu bringen. Sie haben in diesem Falle also
weder einen Begriff von der Gefahr, die sie laufen,
denn der Tod, den sie um sich sehen, erschüttert
sie nicht im Mindesten, noch das geringste Gefühl
der Zusammengehörigkeit und des Mitleids. Was
die Gefahr betrifft, so ist das erklärlich: die Biene
kennt in der That keine Furcht, und nichts in der
Welt kann sie schrecken, ausser dem Rauche.
Ausserhalb ihres Bienenkorbes ist sie voller Langmütigkeit
und Friedfertigkeit. Sie weicht dem Störenfried
aus und ignoriert das Vorhandensein alles
dessen, was sie nicht unmittelbar angeht. Man
möchte sagen, dass sie sich in einer Welt fühlt,
die Allen gehört, wo Jeder Anspruch auf seinen
Platz hat, wo man friedlich und nachsichtig sein
muss. Aber unter dieser Nachsichtigkeit und Friedfertigkeit
verbirgt sich ein so selbstgewisses Herz,
dass sie garnicht daran denkt, sich zu behaupten.
Sie weicht aus, wenn jemand sie bedroht, aber sie
flieht nie. Andrerseits beschränkt sie sich im Bienenstock
keineswegs auf dieses passive Ignorieren
der Gefahr. Sie stürzt sich mit einer unerhörten
Wucht auf jedes lebende Wesen, Ameise, Löwe
oder Mensch, das ihre heilige Arche anzutasten
wagt. Nennen wir das je nach unserer geistigen
Veranlagung Zorn, Verbissenheit, Stumpfsinn oder
Heroismus.
Die ganze Wahrheit muss
trotzdem gesagt werden. Angesichts
der Wunder ihres Gewerbfleisses,
ihres Gemeinsinnes und ihrer Opferfreudigkeit,
muss uns ein Umstand
immerhin in Erstaunen setzen und
unsere Bewunderung etwas beeinträchtigen, nämlich
ihre Gleichgiltigkeit gegen den Tod und das Unglück
ihrer Mitschwestern. Es geht durch den Charakter
der Bienen ein seltsamer Spalt. Im Bienenkorbe
lieben und helfen sich alle. Sie sind so einig,
wie die guten Gedanken derselben Seele. Verletzt
man eine, so opfern sich tausend, um ihre Mitbürgerin
zu rächen. Ausserhalb des Bienenstockes
kennen sie sich nicht mehr. Man verstümmele oder
vernichte – oder besser, man thue es nicht, es
wäre eine unnötige Grausamkeit, denn die Thatsache
steht fest, – aber gesetzt, man verstümmelte
oder vernichtete auf einem Stück Wabenhonig, ein
paar Schritte vom Bienenstand entfernt, zwanzig
oder dreissig Bienen aus demselben Stocke, und
die nicht getroffenen werden nicht einmal den Kopf
drehen, sondern achtlos gegen die in Todeszuckungen
Liegenden, deren letzte Bewegungen ihre Glieder
streifen, deren Schmerzensrufe ihnen ins Ohr gellen,
saugen sie nach wie vor mit ihrer phantastischen
Zunge, die wie eine chinesische Waffe aussieht,
den Saft, der ihnen kostbarer ist als das Leben.
Und wenn die Wabe leer ist, klettern sie, um nichts
zu verlieren, um auch den Honig, der an den Opfern
klebt, noch zu gewinnen, ruhig über Leichen und
Verwundete weg, ohne sich über das Vorhandensein
der Einen aufzuregen und ohne den Anderen
Hilfe zu bringen. Sie haben in diesem Falle also
weder einen Begriff von der Gefahr, die sie laufen,
denn der Tod, den sie um sich sehen, erschüttert
sie nicht im Mindesten, noch das geringste Gefühl
der Zusammengehörigkeit und des Mitleids. Was
die Gefahr betrifft, so ist das erklärlich: die Biene
kennt in der That keine Furcht, und nichts in der
Welt kann sie schrecken, ausser dem Rauche.
Ausserhalb ihres Bienenkorbes ist sie voller Langmütigkeit
und Friedfertigkeit. Sie weicht dem Störenfried
aus und ignoriert das Vorhandensein alles
dessen, was sie nicht unmittelbar angeht. Man
möchte sagen, dass sie sich in einer Welt fühlt,
die Allen gehört, wo Jeder Anspruch auf seinen
Platz hat, wo man friedlich und nachsichtig sein
muss. Aber unter dieser Nachsichtigkeit und Friedfertigkeit
verbirgt sich ein so selbstgewisses Herz,
dass sie garnicht daran denkt, sich zu behaupten.
Sie weicht aus, wenn jemand sie bedroht, aber sie
flieht nie. Andrerseits beschränkt sie sich im Bienenstock
keineswegs auf dieses passive Ignorieren
der Gefahr. Sie stürzt sich mit einer unerhörten
Wucht auf jedes lebende Wesen, Ameise, Löwe
oder Mensch, das ihre heilige Arche anzutasten
wagt. Nennen wir das je nach unserer geistigen
Veranlagung Zorn, Verbissenheit, Stumpfsinn oder
Heroismus.
Aber über ihren Mangel an Solidaritätsgefühl ausserhalb des Bienenstockes weiss ich nichts zu sagen. Man muss wohl annehmen, dass es sich auch hier um jene unverhofften Grenzen handelt, die jeder Art von Verstand gezogen sind, und dass die kleine Flamme, die durch den schwierigen Verbrennungsprozess so vieler träger Stoffe nur mühsam dem Gehirn entstrahlt, jederzeit so ungewiss ist, dass sie einen Punkt nur auf Kosten vieler anderer erleuchtet. Man kann sich sagen, dass die Biene – oder die Natur in der Biene – die gemeinsame Arbeit, den Kultus der Zukunft und die Fernstenliebe in einer nie wieder erreichten Vollkommenheit durchgeführt hat. Sie lieben über sich hinaus und wir lieben vornehmlich, was um uns ist. Vielleicht genügt es, hier zu lieben, um dort keine Liebe mehr übrig zu haben. Nichts ist veränderlicher als die Richtung der Barmherzigkeit oder des Mitleids. Wir selbst wären ehedem über diese Fühllosigkeit der Bienen weit weniger erstaunt gewesen, und manchen alten Schriftstellern wäre es garnicht eingefallen, sie deswegen zu tadeln. Zudem können wir nicht ahnen, wie sehr ein Wesen, das uns so beobachten würde, wie wir sie beobachten, über uns in Erstaunen geraten würde.
 Schliesslich müssten wir, um
uns von ihrer Intelligenz eine genauere
Vorstellung zu machen, festzustellen
suchen, auf welche Weise
sie sich mit einander verständigen.
Denn dass sie sich verständigen, ist
sonnenklar; ein Gemeinwesen von so grosser Volkszahl,
dessen Arbeiten so mannigfach sind und doch
so wunderbar harmonieren, könnte bei der Unfähigkeit
seiner Mitglieder, in Verbindung miteinander
zu gelangen und aus ihrer geistigen Vereinsamung
herauszutreten, nicht bestehen. Sie müssen also
die Fähigkeit haben, ihre Gedanken und Gefühle
auszudrücken, sei es durch eine Lautsprache, sei
es, was wahrscheinlicher ist, mit Hilfe einer Tastsprache
oder einer magnetischen Übertragung, die
sich vielleicht an Eigenschaften der Materie und
an Sinne knüpft, die uns völlig unbekannt sind, und
der Sitz dieser Sinne könnte sich in ihren geheimnisvollen
Fühlern befinden, welche die Finsternis
abtasten und fühlen und nach den Berechnungen
von Cheshire bei den Arbeitsbienen aus zwölftausend
Fühlfäden und fünftausend Geruchshöhlen bestehen.
Dass sie sich nicht nur über ihre gewöhnlichen
Arbeiten verständigen, sondern dass auch
Aussergewöhnliches Platz und Namen in ihrer
Sprache hat, das geht daraus hervor, dass jede gute
oder böse, gewohnte oder übernatürliche Nachricht
sich durch den Bienenstock verbreitet, z. B. Verlust
und Wiederkehr der Königin, Eindringen eines
Feindes, einer fremden Königin, Nahen eines Räuberschwarms,
Entdeckung eines Schatzes u. s. w. Das
Benehmen und die Töne der Bienen sind bei jedem
dieser Ereignisse so verschieden, so charakteristisch,
dass der gewiegte Bienenwirth unschwer errät,
was in dem kribbelnden Dunkel des Bienenstockes
vorgeht.
Schliesslich müssten wir, um
uns von ihrer Intelligenz eine genauere
Vorstellung zu machen, festzustellen
suchen, auf welche Weise
sie sich mit einander verständigen.
Denn dass sie sich verständigen, ist
sonnenklar; ein Gemeinwesen von so grosser Volkszahl,
dessen Arbeiten so mannigfach sind und doch
so wunderbar harmonieren, könnte bei der Unfähigkeit
seiner Mitglieder, in Verbindung miteinander
zu gelangen und aus ihrer geistigen Vereinsamung
herauszutreten, nicht bestehen. Sie müssen also
die Fähigkeit haben, ihre Gedanken und Gefühle
auszudrücken, sei es durch eine Lautsprache, sei
es, was wahrscheinlicher ist, mit Hilfe einer Tastsprache
oder einer magnetischen Übertragung, die
sich vielleicht an Eigenschaften der Materie und
an Sinne knüpft, die uns völlig unbekannt sind, und
der Sitz dieser Sinne könnte sich in ihren geheimnisvollen
Fühlern befinden, welche die Finsternis
abtasten und fühlen und nach den Berechnungen
von Cheshire bei den Arbeitsbienen aus zwölftausend
Fühlfäden und fünftausend Geruchshöhlen bestehen.
Dass sie sich nicht nur über ihre gewöhnlichen
Arbeiten verständigen, sondern dass auch
Aussergewöhnliches Platz und Namen in ihrer
Sprache hat, das geht daraus hervor, dass jede gute
oder böse, gewohnte oder übernatürliche Nachricht
sich durch den Bienenstock verbreitet, z. B. Verlust
und Wiederkehr der Königin, Eindringen eines
Feindes, einer fremden Königin, Nahen eines Räuberschwarms,
Entdeckung eines Schatzes u. s. w. Das
Benehmen und die Töne der Bienen sind bei jedem
dieser Ereignisse so verschieden, so charakteristisch,
dass der gewiegte Bienenwirth unschwer errät,
was in dem kribbelnden Dunkel des Bienenstockes
vorgeht.
Will man einen deutlicheren Beweis, so beobachte man eine Biene, die auf einem Fensterbrett oder einer Tischecke ein paar Honigtropfen gefunden hat. Zuerst saugt sie sich so gierig voll, dass man sie in aller Musse, ohne sie in ihrer Arbeit zu stören, mit einem kleinen Farbfleck zeichnen kann. Aber diese Fressgier ist nur scheinbar. Der Honig kommt nicht in den eigentlichen, sozusagen persönlichen Magen der Biene, er bleibt im Honigmagen, der gewissermaassen der Magen der Gesamtheit ist. Sobald dieses Behältnis gefüllt ist, fliegt die Biene von dannen, aber nicht blind und unmittelbar, wie ein Schmetterling oder eine Fliege. Man wird sie im Gegenteil einige Augenblicke rückwärts fliegen sehen; sie schwirrt aufmerksam in der Fensteröffnung oder um den Tisch herum, den Kopf nach dem Zimmer gewandt. Sie prägt sich die Örtlichkeit ein und merkt sich genau die Stelle, wo der Schatz liegt. Dann erst fliegt sie nach dem Stock zurück, entleert ihre Beute in eine der Vorratszellen und ist in drei oder vier Minuten wieder da, um eine neue Ladung von dem wunderbaren Brett zu holen. Alle fünf Minuten kommt sie, solange noch Honig da ist, und wenn es bis zum Abend währt, ununterbrochen wieder und fliegt, ohne sich die geringste Ruhe zu gönnen, von dem Fenster nach dem Bienenstock und vom Bienenstock nach dem Fenster.
 Ich will die Wahrheit nicht
ausschmücken, wie Viele es gethan
haben, die über die Bienen schrieben.
Beobachtungen dieser Art sind nur
dann von Interesse, wenn sie absolut
ehrlich sind. Ich hätte vielleicht gesagt,
dass die Bienen unfähig sind, sich über ein
Ereignis ausserhalb des Bienenstockes zu verständigen,
wenn ich gelegentlich einer kleinen experimentellen
Enttäuschung ein Vergnügen daran gefunden
hätte, wieder einmal zu konstatieren, dass
der Mensch im Grunde genommen doch das einzige
wirklich intelligente Wesen auf diesem Erdball ist.
Und dann empfindet man, wenn man bis zu einem
gewissen Punkte des Lebens gekommen ist, mehr
Freude daran, etwas Wahres zu sagen, als etwas
Auffälliges. Hier wie in allen Dingen muss man
sich von dem Grundsatz leiten lassen: wenn die
nackte Wahrheit uns im Augenblick weniger gross,
edel oder anziehend erscheint, als der erträumte
Schmuck, mit dem man sie behängen könnte, so
liegt die Schuld an uns, weil wir die stets erstaunlichen
Beziehungen, die zwischen unserm Wesen
und den Weltgesetzen bestehen müssen, noch nicht
zu erkennen vermögen, und es ist in diesem
Falle also nicht die Wahrheit, die einer Vergrösserung
und Veredelung bedarf, sondern unser
Intellekt.
Ich will die Wahrheit nicht
ausschmücken, wie Viele es gethan
haben, die über die Bienen schrieben.
Beobachtungen dieser Art sind nur
dann von Interesse, wenn sie absolut
ehrlich sind. Ich hätte vielleicht gesagt,
dass die Bienen unfähig sind, sich über ein
Ereignis ausserhalb des Bienenstockes zu verständigen,
wenn ich gelegentlich einer kleinen experimentellen
Enttäuschung ein Vergnügen daran gefunden
hätte, wieder einmal zu konstatieren, dass
der Mensch im Grunde genommen doch das einzige
wirklich intelligente Wesen auf diesem Erdball ist.
Und dann empfindet man, wenn man bis zu einem
gewissen Punkte des Lebens gekommen ist, mehr
Freude daran, etwas Wahres zu sagen, als etwas
Auffälliges. Hier wie in allen Dingen muss man
sich von dem Grundsatz leiten lassen: wenn die
nackte Wahrheit uns im Augenblick weniger gross,
edel oder anziehend erscheint, als der erträumte
Schmuck, mit dem man sie behängen könnte, so
liegt die Schuld an uns, weil wir die stets erstaunlichen
Beziehungen, die zwischen unserm Wesen
und den Weltgesetzen bestehen müssen, noch nicht
zu erkennen vermögen, und es ist in diesem
Falle also nicht die Wahrheit, die einer Vergrösserung
und Veredelung bedarf, sondern unser
Intellekt.
Ich will also eingestehen, dass die gezeichneten Bienen oft allein wiederkehren. Man muss wohl glauben, dass es unter ihnen dieselben Charakter-Unterschiede giebt, wie bei den Menschen, und dass die einen schweigsam, die andern mitteilsam sind. Jemand, der meinen Versuchen beiwohnte, bemerkte, dass es bei vielen Eitelkeit oder Egoismus sein könnte, was sie bestimmt, die Quelle ihres Reichtums nicht zu verraten, um den Ruhm einer Leistung, die der Schwarm für wunderbar halten muss, nicht mit andern zu teilen. Aber das sind recht niedrige Laster, die nicht nach dem reinen und frischen Duft des Hauses ihrer tausend Schwestern schmecken. Wie dem indes auch sei, es geschieht auch oft genug, dass die vom Glück begünstigte Biene mit zwei oder drei Gefährtinnen wieder kommt. Es ist mir bekannt, dass Sir John Lubbock im Anhang zu seinem Werke „Ants, Bees and Wasps“ ausführliche und gewissenhafte Beobachtungstabellen aufstellt, aus denen hervorzugehen scheint, dass fast nie andere Bienen der Wegweiserin folgen. Ich weiss freilich nicht, welche Bienenart der gelehrte Naturforscher beobachtet hat, oder ob die Umstände besonders ungünstig waren. Meine eigenen Beobachtungstabellen, die ich sorgfältigst aufgestellt habe, indem ich unter Benutzung aller möglichen Vorsichtsmassregeln verhinderte, dass die Bienen direkt durch den Honigduft angezogen wurden, ergaben, dass im Durchschnitt viermal in zehn Fällen andere Bienen von der ersten mitgebracht wurden.
Einmal betupfte ich einer besonders kleinen italienischen Biene den Leib mit einem Farbfleck. Beim zweiten Male kam sie mit zwei Schwestern wieder. Ich fing diese weg, ohne dass sie sich stören liess. Das nächste Mal kam sie mit drei Gefährtinnen wieder, die ich ebenfalls wegfing, und so fort, bis ich am Ende des Nachmittags achtzehn Bienen gefangen hatte. Sie hatte also achtzehn Schwestern die Mitteilung zu machen gewusst.
Alles in allem genommen, wird man bei solchen Experimenten zu dem Schlusse kommen, dass die Mitteilung an andere, wo nicht regelmässig, so doch häufig stattfindet, und dieses Vermögen der Bienen ist den Bienenjägern Amerikas so gut bekannt, dass sie es sich regelmässig zu nutze machen, wenn sie ein Nest ausspüren. „Sie wählen“, sagt Josiah Emmery, „zum Beginn ihrer Thätigkeit ein Feld oder ein Gehölz, das weitab von allen Bienenständen zahmer Bienen liegt. Hier angekommen, lauern sie einigen Bienen auf, welche die Blüten befliegen, fangen sie weg und sperren sie in einen mit Honig versehenen Kasten. Sobald sich die Bienen darin vollgesogen haben, lassen sie sie wieder fliegen. Nun kommt ein Augenblick des Wartens, dessen Dauer von der Entfernung des Bienennestes abhängt, aber bei einiger Geduld findet der Jäger seine Bienen allemal mit einem Gefolge von mehreren Gefährtinnen wieder. Er fängt sie von neuem ein, regaliert sie und lässt sie jede nach einer andern Seite fliegen, wobei er genau aufpasst, welche Richtung sie nehmen. Der Punkt, nach dem sie zusammenzustreben scheinen, giebt ihm die mutmassliche Lage des Nestes an.“ (Citiert von Romanes in „L’Intelligence des Animaux“, Bd. I, S. 117)
 Man wird bei Wiederholung
des oben genannten Experimentes bemerken,
dass die mitgebrachten Freundinnen,
die der Losung des Glückes gehorchen,
nicht immer zusammen ankommen
und dass oft ein Zwischenraum
von mehreren Sekunden zwischen der Ankunft der
einzelnen liegt. Man muss sich also über ihr Mitteilungsvermögen
dieselbe Frage vorlegen, die Sir
John Lubbock für die Ameisen gelöst hat: Thun
die Gefährtinnen, die sich bei dem von der ersten
Biene entdeckten Schatze mit einfinden, nichts weiter,
als dass sie dieser folgen, oder sind sie vielleicht
von ihr geschickt und finden ihn selbst nach deren
Angaben und der von ihr gemachten Ortsbeschreibung?
Es wäre dies, wie man leicht einsieht, ein
gewaltiger Unterschied hinsichtlich der Höhe und
Vollkommenheit ihrer Intelligenz. Dem gelehrten
Engländer ist es mit Hilfe eines komplizierten
und sehr sinnreichen Apparates von Gängen und
Stegen, Wassergräben und fliegenden Brücken gelungen,
nachzuweisen, dass die Ameisen in diesem
Falle einfach der Fährte der Wegweiserin folgen.
Solche Experimente sind nun zwar sehr sinnreich
bei den Ameisen, die man zwingen kann, einen bestimmten
Weg zu wählen, aber der Biene, die Flügel
hat, stehen alle Wege offen und man müsste zu
andern Hilfsmitteln greifen. Das Folgende habe
ich angewandt, ohne jedoch zu entscheidenden Resultaten
gekommen zu sein. In grösserer Vervollkommnung
aber und unter günstigeren Umständen
dürfte es doch zu befriedigender Gewissheit führen.
Man wird bei Wiederholung
des oben genannten Experimentes bemerken,
dass die mitgebrachten Freundinnen,
die der Losung des Glückes gehorchen,
nicht immer zusammen ankommen
und dass oft ein Zwischenraum
von mehreren Sekunden zwischen der Ankunft der
einzelnen liegt. Man muss sich also über ihr Mitteilungsvermögen
dieselbe Frage vorlegen, die Sir
John Lubbock für die Ameisen gelöst hat: Thun
die Gefährtinnen, die sich bei dem von der ersten
Biene entdeckten Schatze mit einfinden, nichts weiter,
als dass sie dieser folgen, oder sind sie vielleicht
von ihr geschickt und finden ihn selbst nach deren
Angaben und der von ihr gemachten Ortsbeschreibung?
Es wäre dies, wie man leicht einsieht, ein
gewaltiger Unterschied hinsichtlich der Höhe und
Vollkommenheit ihrer Intelligenz. Dem gelehrten
Engländer ist es mit Hilfe eines komplizierten
und sehr sinnreichen Apparates von Gängen und
Stegen, Wassergräben und fliegenden Brücken gelungen,
nachzuweisen, dass die Ameisen in diesem
Falle einfach der Fährte der Wegweiserin folgen.
Solche Experimente sind nun zwar sehr sinnreich
bei den Ameisen, die man zwingen kann, einen bestimmten
Weg zu wählen, aber der Biene, die Flügel
hat, stehen alle Wege offen und man müsste zu
andern Hilfsmitteln greifen. Das Folgende habe
ich angewandt, ohne jedoch zu entscheidenden Resultaten
gekommen zu sein. In grösserer Vervollkommnung
aber und unter günstigeren Umständen
dürfte es doch zu befriedigender Gewissheit führen.
Mein Arbeitszimmer auf dem Lande liegt im ersten Stock über einem sehr hohen Erdgeschoss. Ausser in der Blütezeit der Kastanien und Linden pflegen die Bienen nie sehr hoch zu fliegen, sodass ich ein Stück entdeckelten Wabenhonig (d. h. gefüllte Honigwaben, von denen die Wachsdeckel entfernt waren) vor dem Experiment mehr als eine Woche lang auf dem Tische liegen hatte, ohne dass eine einzige Biene von dem Duft angelockt wurde und die Wabe beflog. Ich nahm nun eine italienische Biene aus einem unfern des Hauses aufgestellten Beobachtungsstock, trug sie in mein Arbeitszimmer hinauf und liess sie an dem Honig naschen, während ich sie mit einem Farbfleck betupfte.
Als sie sich vollgesogen hatte, flog sie nach ihrem Bienenstock zurück. Ich ging hinterher und sah, wie sie hastig über die andern Bienen hinweglief, ihren Kopf in einer leeren Zelle verschwinden liess, den Honig entleerte und sich zum Ausfliegen anschickte. Zwanzigmal hintereinander wiederholte ich denselben Versuch mit verschiedenen Bienen und fing dabei jedesmal die geköderte Biene fort, sodass die andern ihrer Spur nicht folgen konnten. Ich hatte zu diesem Zwecke vor dem Flugloch einen Glaskasten angebracht, der durch eine Klappthür in zwei Abteilungen geschieden war. Kam die gezeichnete Biene allein heraus, so fing ich sie einfach weg und wartete dann in meinem Zimmer auf die Ankunft der Freundinnen, denen sie die Nachricht gebracht hätte. Kam sie mit zwei oder drei andern Bienen heraus, so hielt ich sie in der ersten Abteilung des Glaskastens gefangen und trennte sie so von ihren Gefährtinnen, denen ich einen Fleck von anderer Farbe auftupfte und dann die Freiheit gab, wobei ich sie mit den Augen verfolgte. Es ist klar, dass, wenn eine lautliche oder magnetische Mitteilung stattgefunden hätte, die eine Ortsbeschreibung und Orientierungsmethode in sich schlösse, ich eine Anzahl von Bienen, die auf die Fährte gesetzt waren, in meinem Zimmer hätte vorfinden müssen. Ich muss gestehen, dass sich nur eine einfand. Folgte sie den im Bienenstock empfangenen Anweisungen, oder war es reiner Zufall? Die Beobachtung war nicht ausreichend genug, aber die Umstände verstatteten nicht, sie fortzusetzen. Ich liess die Bienen wieder frei, und alsbald war mein Arbeitszimmer voll von der summenden Menge, der sie in ihrer gewohnten Weise den Weg zum Schatze gewiesen hatten.[5]
 Aber auch ohne aus diesem
unvollkommenen Versuch Schlüsse
zu ziehen, sieht man sich zu der Annahme
gezwungen, dass die Bienen
in geistigen Beziehungen zu einander
stehen, die über ein blosses Ja und
Nein oder jene elementaren Mitteilungen, die durch
Geberde oder Vorbild entstehen, weit hinausgehen.
Man braucht nur die rührende Harmonie ihrer Arbeiten
im Bienenstock, die überraschende Arbeitsteilung
und die regelmässige Ablösung in der Arbeit
zu bedenken. Ich habe oft beobachtet, wie die
Beutemacherinnen, die ich am Morgen betupft hatte,
ausser bei ungewöhnlichem Blumenreichtum Nachmittags
damit beschäftigt waren, das Brutnest auszulüften
oder zu „bebrüten“; andere fand ich unter
der Schaar wieder, die jene geheimnisvollen, wie
tot dahängenden Ketten bildet, in deren Mitte die
Wachszieherinnen und Steinmetze arbeiten. Ebenso
habe ich beobachtet, wie die Arbeiterinnen einen
ganzen Tag lang Pollen eintrugen, am nächsten
Tage dagegen ausschliesslich Nektar und umgekehrt.
Aber auch ohne aus diesem
unvollkommenen Versuch Schlüsse
zu ziehen, sieht man sich zu der Annahme
gezwungen, dass die Bienen
in geistigen Beziehungen zu einander
stehen, die über ein blosses Ja und
Nein oder jene elementaren Mitteilungen, die durch
Geberde oder Vorbild entstehen, weit hinausgehen.
Man braucht nur die rührende Harmonie ihrer Arbeiten
im Bienenstock, die überraschende Arbeitsteilung
und die regelmässige Ablösung in der Arbeit
zu bedenken. Ich habe oft beobachtet, wie die
Beutemacherinnen, die ich am Morgen betupft hatte,
ausser bei ungewöhnlichem Blumenreichtum Nachmittags
damit beschäftigt waren, das Brutnest auszulüften
oder zu „bebrüten“; andere fand ich unter
der Schaar wieder, die jene geheimnisvollen, wie
tot dahängenden Ketten bildet, in deren Mitte die
Wachszieherinnen und Steinmetze arbeiten. Ebenso
habe ich beobachtet, wie die Arbeiterinnen einen
ganzen Tag lang Pollen eintrugen, am nächsten
Tage dagegen ausschliesslich Nektar und umgekehrt.
Schliesslich wäre noch eine Erscheinung zu berücksichtigen, die der berühmte französische Bienenzüchter Georges de Layens „die Verteilung der Bienen auf die honigspendenden Pflanzen“ nennt. Allmorgendlich, wenn die Sonne aufgeht und die mit dem Morgenrot ausgesandten Spürbienen zurückkehren, erhält der erwachende Bienenstock sichere Nachrichten von draussen. „Heute blühen die Linden an den Kanalufern.“ „Der Weissklee leuchtet durch das Gras am Wege.“ „Steinklee und Salbei sind im Aufblühen.“ „Lilien und Reseda strömen von Pollen über.“ Da heisst es, sich schnell zusammenthun, Massregeln ergreifen und die Arbeit einteilen. Fünftausend von den stärksten werden hinauf zu den Lindenwipfeln fliegen, dreitausend jüngere den Weissklee besuchen. Die einen fahndeten gestern auf den Nektar der Blumenkelche, heute sollen sie ihre Zunge und die Drüsen des Honigmagens schonen; sie werden den roten Reseda-Pollen, den gelben Pollen der grossen Lilien eintragen, denn nie wird man eine Biene Pollen von verschiedenen Blumensorten und verschiedener Farbe ernten oder vermischen sehen, und das methodische Sortieren der einzelnen Arten dieses schönen duftigen Mehls, je nach Farbe und Herkunft, bildet eine der Hauptbeschäftigungen im Stocke selbst. So werden die Befehle von einem verborgenen Geiste ausgegeben, und alsbald kommen die Arbeiterinnen in langen Zügen hervor, um jede unbeirrt ihrer Aufgabe entgegenzufliegen. „Anscheinend“, sagt de Layens, „sind die Bienen genau informiert über Standort, Honiggehalt und Entfernung aller honigtragenden Pflanzen in einem gewissen Umkreise um den Bienenstock. Merkt man sich genau die Richtung, welche die Beutemacherinnen einschlagen, und kann man die Ernte, die sie von den verschiedenen Pflanzen der Umgegend eintragen, methodisch beobachten, so stellt sich heraus, dass die Arbeitsbienen sich sowohl nach der Quantität der Pflanzen einer Art, wie nach ihrem Honigreichtum in die verschiedenen Blumen teilen. Mehr noch: sie schätzen täglich ab, welcher Zuckersaft der beste zum Einernten ist. Wenn z. B. nach Abblühen der Sahlweiden noch nichts auf den Feldern erblüht ist und die Bienen auf die ersten Waldblumen angewiesen sind, so kann man sie beim regen Besuche von Anemonen, Schlüsselblumen, Narzissen und Veilchen sehen. Ein paar Tage darauf, wenn die Raps- und Kohlfelder in genügender Menge erblüht sind, sieht man sie ihre Waldblumen fast vollständig verlassen, obschon sie noch in voller Blüte stehen, und sich ganz den Raps- und Kohlblüten widmen. So verteilen sie sich täglich auf die Pflanzen, die in möglichst kurzer Zeit den besten Zuckersaft liefern. Man kann also sagen, das Bienenvolk weiss sowohl in seinen Erntearbeiten, wie im Innern des Bienenstocks eine rationelle Verteilung der Arbeitsbienen vorzunehmen und zwar unter strikter Anwendung des Prinzips der Arbeitsteilung“.
 Aber, wird man sagen, was
liegt uns daran, ob die Bienen mehr
oder minder intelligent sind? Warum
mit soviel Sorgfalt eine kleine, fast
unsichtbare Spur der Materie verfolgen,
als handelte es sich um ein
Fluidum, von dem die Geschicke der Menschheit
abhingen? Ohne zu übertreiben: ich glaube, das
Interesse, das wir hieran nehmen, ist nicht genug
zu schätzen. Indem wir ausser uns eine wirkliche
Spur von Intelligenz finden, empfinden wir etwas
von dem seltsamen Schauder Robinsons, als er den
Eindruck eines menschlichen Fusses im Strandsande
seiner Insel fand. Es scheint uns, dass wir weniger
allein sind, als wir wähnten. Wenn wir uns über
die Intelligenz der Bienen klar zu werden versuchen,
so erforschen wir im Grunde genommen das Kostbarste
unseres eigenen Wesens in ihnen und suchen
ein Atom jenes seltenen Stoffes, der überall, wo er
hervortritt, die wunderbare Gabe hat, die blinden
Notwendigkeiten umzuformen und zu organisieren,
das Leben zu verschönen und zu mehren und der
hartnäckigen Macht des Todes, dem grossen gedankenlosen
Strome, der fast Alles, was besteht, in
ewiger Unbewusstheit dahinträgt, ein sinnfälliges
Halt zu gebieten.
Aber, wird man sagen, was
liegt uns daran, ob die Bienen mehr
oder minder intelligent sind? Warum
mit soviel Sorgfalt eine kleine, fast
unsichtbare Spur der Materie verfolgen,
als handelte es sich um ein
Fluidum, von dem die Geschicke der Menschheit
abhingen? Ohne zu übertreiben: ich glaube, das
Interesse, das wir hieran nehmen, ist nicht genug
zu schätzen. Indem wir ausser uns eine wirkliche
Spur von Intelligenz finden, empfinden wir etwas
von dem seltsamen Schauder Robinsons, als er den
Eindruck eines menschlichen Fusses im Strandsande
seiner Insel fand. Es scheint uns, dass wir weniger
allein sind, als wir wähnten. Wenn wir uns über
die Intelligenz der Bienen klar zu werden versuchen,
so erforschen wir im Grunde genommen das Kostbarste
unseres eigenen Wesens in ihnen und suchen
ein Atom jenes seltenen Stoffes, der überall, wo er
hervortritt, die wunderbare Gabe hat, die blinden
Notwendigkeiten umzuformen und zu organisieren,
das Leben zu verschönen und zu mehren und der
hartnäckigen Macht des Todes, dem grossen gedankenlosen
Strome, der fast Alles, was besteht, in
ewiger Unbewusstheit dahinträgt, ein sinnfälliges
Halt zu gebieten.
Wären wir im Alleinbesitz eines Teiles dieser Kraft in dem besonderen Blüte- und Glanzzustande, den wir Intelligenz nennen, so hätten wir einiges Recht darauf, uns für bevorzugt zu halten und uns einzubilden, dass die Natur ein Ziel in uns erreicht; aber da ist nun eine ganze Kategorie von Wesen: die Honigwespen, in denen sie fast dasselbe Ziel erreicht. Dies entscheidet nichts, wenn man will, aber die Thatsache nimmt doch einen Ehrenplatz ein in der Menge der kleinen Thatsachen, die zur Klärung unserer Lage auf Erden beitragen. Hier findet sich eine Parallel-Erscheinung für den unentzifferbarsten Teil unseres Wesens, eine Ablagerung von Schicksalen, die wir von einem höheren Standpunkt aus überschauen, als wir es für die Geschicke der Menschheit je vermöchten. Hier finden sich mit einem Worte die grossen, einfachen Linien, die wir in unserm eigenen, unverhältnismässig grösseren Wirkungskreis weder aufdecken, noch bis zu Ende verfolgen können. Hier findet sich Geist und Materie, Art und Individuum, Entwickelung und Beharren, Vergangenheit und Zukunft, Leben und Tod auf einen Raum zusammengeschaart, den wir mit der Hand umspannen und mit einem Blick überschauen können, und es drängt sich die Frage auf: hat die grössere Ausdehnung unseres Körpers in Raum und Zeit wirklich soviel Einfluss auf die geheimen Pläne der Natur, die wir im Bienenstock mit seiner kurzen, nach Tagen zählenden Geschichte zu erforschen suchen, wie in unserer grossen Menschheitsgeschichte, wo drei Geschlechter ein ganzes Jahrhundert ausfüllen.

 Nehmen wir die Geschichte
unseres Bienenstockes also wieder auf,
wo wir sie fallen gelassen hatten,
und versuchen wir eine der Falten
des geheimnisvollen Vorhanges zu
lüften, von dem jene seltsame Ausschwitzung
herabzuträufen beginnt, die fast so weiss
ist wie Schnee und leichter als Daunenfedern. Denn
das Wachs ist im Augenblick seiner Entstehung
anders als in dem allbekannten Zustand, in dem
wir es finden; es ist fleckenlos und leicht wie Luft; es
scheint wirklich die Seele des Honigs zu sein, der
seinerseits wieder der Geist der Blumen ist, und
wird durch eine regungslose Beschwörung hervorgezaubert,
um späterhin in unseren Händen, gewiss
im Angedenken an seinen Ursprung, in dem so viel
Himmelsbläue, soviel keuscher und segenspendender
Wohlgeruch liegt, zur duftenden Kerze unserer
Totenbahre zu werden.
Nehmen wir die Geschichte
unseres Bienenstockes also wieder auf,
wo wir sie fallen gelassen hatten,
und versuchen wir eine der Falten
des geheimnisvollen Vorhanges zu
lüften, von dem jene seltsame Ausschwitzung
herabzuträufen beginnt, die fast so weiss
ist wie Schnee und leichter als Daunenfedern. Denn
das Wachs ist im Augenblick seiner Entstehung
anders als in dem allbekannten Zustand, in dem
wir es finden; es ist fleckenlos und leicht wie Luft; es
scheint wirklich die Seele des Honigs zu sein, der
seinerseits wieder der Geist der Blumen ist, und
wird durch eine regungslose Beschwörung hervorgezaubert,
um späterhin in unseren Händen, gewiss
im Angedenken an seinen Ursprung, in dem so viel
Himmelsbläue, soviel keuscher und segenspendender
Wohlgeruch liegt, zur duftenden Kerze unserer
Totenbahre zu werden.
 Es ist sehr schwer, die verschiedenen
Phasen der Wachsbildung
und des Wachsbaues bei einem Volke,
das zu bauen beginnt, zu verfolgen.
Es vollzieht sich alles in der Enge
des Schwarmes, der sich immer dichter
zusammenschliesst, um die zu seiner Ausschwitzung
erforderliche Temperatur zu erzeugen; diese Ausschwitzung
selbst ist das Vorrecht der jüngsten
Bienen. Huber, der sie zuerst mit unsäglicher Geduld
studiert hat, nicht ohne bisweilen in ernste
Gefahr zu geraten, widmet diesem Vorgang mehr
als 250 spannende, aber notwendigerweise zusammenhangslose
Seiten. Ich, der ich kein technisches
Werk schreibe, beschränke mich darauf, unter gelegentlicher
Benutzung seiner trefflichen Beobachtungen
nur das zu berichten, was jeder beobachten
kann, wenn er einen Schwarm in einen mit Glaswänden
versehenen Beobachtungskasten einschlägt.
Es ist sehr schwer, die verschiedenen
Phasen der Wachsbildung
und des Wachsbaues bei einem Volke,
das zu bauen beginnt, zu verfolgen.
Es vollzieht sich alles in der Enge
des Schwarmes, der sich immer dichter
zusammenschliesst, um die zu seiner Ausschwitzung
erforderliche Temperatur zu erzeugen; diese Ausschwitzung
selbst ist das Vorrecht der jüngsten
Bienen. Huber, der sie zuerst mit unsäglicher Geduld
studiert hat, nicht ohne bisweilen in ernste
Gefahr zu geraten, widmet diesem Vorgang mehr
als 250 spannende, aber notwendigerweise zusammenhangslose
Seiten. Ich, der ich kein technisches
Werk schreibe, beschränke mich darauf, unter gelegentlicher
Benutzung seiner trefflichen Beobachtungen
nur das zu berichten, was jeder beobachten
kann, wenn er einen Schwarm in einen mit Glaswänden
versehenen Beobachtungskasten einschlägt.
Zunächst muss man gestehen, dass wir noch nicht wissen, durch welchen chemischen Vorgang der Honig in dem rätselreichen Körper unserer regungslos dahängenden Bienenketten sich in Wachs umformt. Man kann nur feststellen, dass nach einer Wartezeit von achtzehn bis zu vierundzwanzig Stunden und bei einer so hohen Temperatur, dass man glauben möchte, der Bienenstock glühte innerlich, weisse durchsichtige Schuppen aus den vier kleinen Taschen auf jeder Seite des Hinterleibes der Bienen hervortreten.
Sobald die Mehrzahl derer, welche den hängenden Kegel bilden, diese Elfenbeinblättchen am Hinterleib trägt, sieht man eine von ihnen, als ob sie einer plötzlichen Erleuchtung folgte, sich mit einem Male von der Menge ihrer Schwestern ablösen, über die ruhig dahängende Masse hinwegklettern und den höchsten Punkt der inneren Kuppel erklimmen. Hier angekommen, hängt sie sich fest auf, indem sie die Nachbarinnen, die ihr in ihren Bewegungen hinderlich sind, mit dem Kopfe beiseite schiebt. Dann packt sie mit Füssen und Mund eines der acht Plättchen ihres Hinterleibes, beschneidet und hobelt es, dehnt und durchkaut es mit ihrem Speichel, biegt und reckt es, zerdrückt und stellt es wieder her, wie ein geschickter Tischler, der eine kunstvolle Lade zimmert. Endlich scheint ihr das durchgekaute Wachs die richtige Form und Haltbarkeit zu haben, und sie klebt es in der Spitze der Kuppel an: es ist die Grundsteinlegung der neuen Stadt, oder vielmehr die des Schlusssteins, denn es handelt sich hier um eine umgekehrte Stadt, die vom Himmel herabwächst, statt von der Erde empor, wie eine Menschenstadt.
Dies geschehen, klebt sie an den im Leeren hängenden Schlussstein neue Wachsstückchen, die sie einzeln unter ihren Hornringen hervorzieht, giebt dem Ganzen die letzte Feile mit der Zunge und den Fühlern, und verschwindet darauf ebenso plötzlich, wie sie gekommen ist, in der Menge. Sofort tritt eine andre an ihre Stelle, setzt die Arbeit fort, wo jene sie liegen gelassen hat, fügt das ihrige hinzu, verbessert, was ihr mit dem Idealplan des Volkes nicht übereinzustimmen scheint, und verschwindet dann gleichfalls, während eine dritte, eine vierte und fünfte ihr unerwartet und plötzlich folgen, keine das Werk vollendend, aber alle ihr Scherflein zum allgemeinen Wohle beitragend.
 Bald hängt ein kleiner, noch
ungestalter Wachszipfel von der Decke
herab. Sobald er ihnen die nötige
Dicke zu haben scheint, sieht man
aus der hängenden Traube eine andere
Biene auftauchen, deren körperliche
Erscheinung von der der ihr vorangegangenen
Gründerinnen merklich absticht. Wenn man die
Sicherheit ihres Auftretens und die Erwartung der
sie umgebenden Schwestern sieht, so könnte man
meinen, dass es eine erleuchtete Baumeisterin ist,
die den Plan der ersten Zelle, welche die Lage
aller anderen mathematisch nach sich zieht, im
Leeren entwirft. Jedenfalls aber gehört sie zu der
Klasse der Steinmetze und Bauleute, die kein Wachs
hervorbringen, sondern das ihnen gelieferte Material
nur bearbeiten. Sie wählt also den Platz für die
erste Zelle aus, gräbt eine Vertiefung in den Wachsblock
und zieht das Wachs, das sie aus dem Boden
herausgräbt, nach den Rändern zu aus, die allmählich
rings um die Grube entstehen. Dann lässt sie,
ganz wie die Gründerinnen, ihr angefangenes Werk
plötzlich liegen, eine ungeduldige Arbeiterin tritt
an ihre Stelle und führt ihre Arbeit weiter, und
eine dritte vollendet sie, während andere rechts und
links davon nach derselben Methode der Arbeitsunterbrechung
und Fortsetzung den Rest der Wachsfläche
und die andere Seite der Wachswand bearbeiten.
Man möchte sagen, dass ein wesentliches
Gesetz des Bienenstaates den Arbeitsstolz verteilt
und dass jedes Werk gemeinsam und namenlos
sein muss, um desto brüderlicher zu sein.
Bald hängt ein kleiner, noch
ungestalter Wachszipfel von der Decke
herab. Sobald er ihnen die nötige
Dicke zu haben scheint, sieht man
aus der hängenden Traube eine andere
Biene auftauchen, deren körperliche
Erscheinung von der der ihr vorangegangenen
Gründerinnen merklich absticht. Wenn man die
Sicherheit ihres Auftretens und die Erwartung der
sie umgebenden Schwestern sieht, so könnte man
meinen, dass es eine erleuchtete Baumeisterin ist,
die den Plan der ersten Zelle, welche die Lage
aller anderen mathematisch nach sich zieht, im
Leeren entwirft. Jedenfalls aber gehört sie zu der
Klasse der Steinmetze und Bauleute, die kein Wachs
hervorbringen, sondern das ihnen gelieferte Material
nur bearbeiten. Sie wählt also den Platz für die
erste Zelle aus, gräbt eine Vertiefung in den Wachsblock
und zieht das Wachs, das sie aus dem Boden
herausgräbt, nach den Rändern zu aus, die allmählich
rings um die Grube entstehen. Dann lässt sie,
ganz wie die Gründerinnen, ihr angefangenes Werk
plötzlich liegen, eine ungeduldige Arbeiterin tritt
an ihre Stelle und führt ihre Arbeit weiter, und
eine dritte vollendet sie, während andere rechts und
links davon nach derselben Methode der Arbeitsunterbrechung
und Fortsetzung den Rest der Wachsfläche
und die andere Seite der Wachswand bearbeiten.
Man möchte sagen, dass ein wesentliches
Gesetz des Bienenstaates den Arbeitsstolz verteilt
und dass jedes Werk gemeinsam und namenlos
sein muss, um desto brüderlicher zu sein.
 Bald lässt sich die werdende
Wabe erkennen. Sie ist einstweilen
noch linsenförmig, denn die kleinen
prismatischen Wachsröhren, aus denen
sie besteht, sind ungleich lang und
nehmen in regelmässiger Verjüngung
von der Mitte nach den Enden zu ab. Sie hat jetzt
fast das Aussehen und die Stärke einer menschlichen
Zunge, die auf ihren beiden Breitseiten aus
sechseckigen, mit den Seiten aneinander stossenden
und mit den Böden sich berührenden Zellen besteht.
Bald lässt sich die werdende
Wabe erkennen. Sie ist einstweilen
noch linsenförmig, denn die kleinen
prismatischen Wachsröhren, aus denen
sie besteht, sind ungleich lang und
nehmen in regelmässiger Verjüngung
von der Mitte nach den Enden zu ab. Sie hat jetzt
fast das Aussehen und die Stärke einer menschlichen
Zunge, die auf ihren beiden Breitseiten aus
sechseckigen, mit den Seiten aneinander stossenden
und mit den Böden sich berührenden Zellen besteht.
Sobald die ersten Zellen fertig sind, heften die Gründerinnen einen zweiten, dann einen dritten und vierten Wachsblock an die Wölbung an, und zwar mit regelmässigen, wohl berechneten Zwischenräumen, sodass, wenn die Tafeln ihre volle Stärke erreichen, was allerdings erst viel später eintritt, die Bienen immer Platz genug behalten, um zwischen den Parallelwänden durchzugehen.
Sie müssen also einen bestimmten Plan vor Augen haben, in dem die endgiltige Stärke jeder Tafel (22 bis 23 mm) vorgesehen ist, desgleichen die Breite der trennenden Strassen, die etwa 11 mm betragen muss, d. h. die doppelte Höhe einer Biene, denn sie müssen zwischen den Tafeln Rücken an Rücken an einander vorüber.
Übrigens sind sie nicht unfehlbar, und ihre Sicherheit hat nichts mechanisches. Unter schwierigen Verhältnissen machen sie manchmal recht bedeutende Fehler. Bisweilen ist zuviel Zwischenraum zwischen den Tafeln, oft auch zu wenig. Sie suchen dem später abzuhelfen, so gut es geht, sei es, dass sie die zu eng herangerückte Tafel schräg weiter führen, oder in den zu grossen Zwischenraum eine Zwischenwabe einbauen. „Bisweilen geschieht es, dass sie sich täuschen“, sagt Réaumur in Hinblick hierauf, „und gerade das scheint zu beweisen, dass sie urteilen“.

 Wie bekannt, bauen die Bienen
viererlei Zellen. Erstens die Königinnenzellen
von ungewöhnlicher Bauart,
wie Eicheln aussehend, zweitens
die geräumigen Zellen zur Aufziehung
der Drohnen und zum Aufspeichern
von Vorräten in der Haupttrachtzeit, ferner die kleinen
Zellen, die zur Erziehung der Arbeitsbienen und
als gewöhnliche Speicher dienen und unter normalen
Verhältnissen acht Zehntel des Baues einnehmen,
und endlich, um zwischen den grossen
und kleinen Zellen eine ordnungsmässige Verbindung
herzustellen, eine Zahl von Übergangszellen. Abgesehen
von der unvermeidlichen Unregelmässigkeit
der letzteren, sind die Dimensionen des zweiten
und dritten Typus so gut berechnet, dass Réaumur,
als das Dezimalsystem festgesetzt wurde und man
in der Natur nach einem festen Maasse suchte, das
zum unumstösslichen Normalmaass erhoben werden
konnte, die Bienenzelle vorschlug.[6]
Wie bekannt, bauen die Bienen
viererlei Zellen. Erstens die Königinnenzellen
von ungewöhnlicher Bauart,
wie Eicheln aussehend, zweitens
die geräumigen Zellen zur Aufziehung
der Drohnen und zum Aufspeichern
von Vorräten in der Haupttrachtzeit, ferner die kleinen
Zellen, die zur Erziehung der Arbeitsbienen und
als gewöhnliche Speicher dienen und unter normalen
Verhältnissen acht Zehntel des Baues einnehmen,
und endlich, um zwischen den grossen
und kleinen Zellen eine ordnungsmässige Verbindung
herzustellen, eine Zahl von Übergangszellen. Abgesehen
von der unvermeidlichen Unregelmässigkeit
der letzteren, sind die Dimensionen des zweiten
und dritten Typus so gut berechnet, dass Réaumur,
als das Dezimalsystem festgesetzt wurde und man
in der Natur nach einem festen Maasse suchte, das
zum unumstösslichen Normalmaass erhoben werden
konnte, die Bienenzelle vorschlug.[6]
Jede dieser Zellen bildet eine sechseckige Röhre mit pyramidaler Basis, und jede Wabe besteht aus zwei Schichten dieser Röhren, die mit der Basis gegen einander liegen, und zwar derart, dass jeder der drei Rhomben, welche die pyramidale Basis einer Zelle der Vorderseite bilden, auch drei Zellen der Rückseite zur Basis dient.
In diese prismatischen Röhren wird der Honig eingetragen. Um zu vermeiden, dass er in der Zeit des Ausreifens herausfliesst, was unvermeidlich eintreten würde, wenn sie, wie es den Anschein hat, genau horizontal lägen, geben die Bienen ihnen ein leichtes Gefälle von vier bis fünf Winkelgraden.
„Ausser der Wachsersparnis“, sagt Réaumur im Hinblick auf das Gesamtgefüge dieses Wunderbaus, „ausser der Wachsersparnis, die durch die Anordnung der Zellen erreicht wird, und abgesehen davon, dass die Bienen mit Hilfe dieser Anordnung die ganzen Tafeln anfüllen, ohne eine Lücke zu lassen, führt dieselbe auch zu einer grösseren Haltbarkeit des Baues. Der Bodenwinkel jeder Zelle, die Spitze der pyramidenförmigen Vertiefung, findet ein Widerlager in der Spitze zweier Ecken des Sechsecks einer andern Zelle. Die beiden Dreiecke oder Fortsetzungen der hexagonalen Seitenwände, die einen der ausspringenden Winkel der von den drei Rhomben begrenzten Vertiefung ausfüllen, bilden mit einander einen Flächenwinkel an ihrer Berührungsseite; jeder dieser Winkel, der im Innern der Zelle konkav ist, stützt mit seiner konvexen Kante eine der Kanten des Sechsecks einer anderen Zelle, und diese Kante übt ihrerseits wieder einen Gegendruck, ohne den der Winkel nach aussen getrieben würde; derart sind alle Kanten verstärkt. Alles, was man von der Haltbarkeit jeder einzelnen Zelle verlangen könnte, wird somit durch die Form der Zellen sowohl, wie durch die wechselseitige Anordnung derselben erreicht.“
„Die Mathematiker“, sagt Dr. Reid, „wissen, dass es nur drei Arten von Figuren giebt, um eine Fläche in kleine Teile von regelmässiger Form und gleicher Grösse ohne Zwischenraum zu teilen. Es sind dies: das gleichseitige Dreieck, das Quadrat und das gleichseitige Sechseck, das in Hinsicht auf die Bauart der Zellen vor den beiden anderen Figuren durch grössere Bequemlichkeit und Widerstandskraft den Vorrang verdient. Desgleichen besteht der Zellenboden aus drei in der Mitte zusammenstossenden Flächen, und es ist bewiesen worden, dass diese Bauart eine beträchtliche Arbeits- und Materialersparnis mit sich bringt. Es war auch die Frage, welcher Neigungswinkel der Flächen zu einander der grössten Ersparnis entspricht, ein Problem der höheren Mathematik, das von einigen Gelehrten, u. a. Maclaurin S., gelöst worden ist, man findet die Lösung dieses Gelehrten in den Berichten der königlichen Gesellschaft zu London.[7] Nun aber entspricht der derart errechnete Winkel dem Bodenwinkel der Bienenzellen.“
 Gewiss, ich glaube es nicht,
dass die Bienen diese komplizierten
Berechnungen angestellt haben, aber
ich glaube ebensowenig, dass der blosse
Zufall oder die Gewalt der Dinge zu
so erstaunlichen Resultaten führen. Für
die Wespen, welche ebenfalls Tafeln mit sechseckigen
Zellen bauen, war das Problem dasselbe,
und sie haben es doch auf weit weniger sinnreiche
Art gelöst. Ihre Zellen sind nur einfach gelagert
und besitzen somit keinen gemeinsamen Boden, wie
die doppelseitige Bienenwabe. Daher besitzen sie
auch weniger Haltbarkeit und Regelmässigkeit und
verursachen einen Zeit-, Raum- und Materialverlust,
der etwa ein Viertel der unumgänglichen Arbeit
und ein Drittel des notwendigen Raumes darstellt.
Desgleichen bauen die Trigonen und Meliponen,
die wirkliche Hausbienen sind, doch auf einer niedrigeren
Kulturstufe stehen, ihre Zellen nur ein Stockwerk
hoch und verbinden die horizontalen, über
einander liegenden Stockwerke durch unförmige,
zeitraubende Wachssäulen. Ihre Vorratszellen oder
„Honigtöpfe“ sind grosse, regellos neben einander
sitzende Schläuche und werden von den Meliponen,
jeder Raum- und Materialersparnis zum Trotze,
zwischen die Tafeln des regulären Wachsbaues
eingeschoben. Und so machen denn ihre Nester,
im Vergleich zu der mathematisch gebauten Stadt
unserer Hausbienen, den Eindruck eines Marktfleckens
von primitiven Hütten neben einer jener
unerbittlich regelmässigen Städte, die das vielleicht
reizlose, aber der menschlichen Logik mehr entsprechende
Resultat eines immer härter gewordenen
Kampfes gegen Zeit, Raum und Materie sind.
Gewiss, ich glaube es nicht,
dass die Bienen diese komplizierten
Berechnungen angestellt haben, aber
ich glaube ebensowenig, dass der blosse
Zufall oder die Gewalt der Dinge zu
so erstaunlichen Resultaten führen. Für
die Wespen, welche ebenfalls Tafeln mit sechseckigen
Zellen bauen, war das Problem dasselbe,
und sie haben es doch auf weit weniger sinnreiche
Art gelöst. Ihre Zellen sind nur einfach gelagert
und besitzen somit keinen gemeinsamen Boden, wie
die doppelseitige Bienenwabe. Daher besitzen sie
auch weniger Haltbarkeit und Regelmässigkeit und
verursachen einen Zeit-, Raum- und Materialverlust,
der etwa ein Viertel der unumgänglichen Arbeit
und ein Drittel des notwendigen Raumes darstellt.
Desgleichen bauen die Trigonen und Meliponen,
die wirkliche Hausbienen sind, doch auf einer niedrigeren
Kulturstufe stehen, ihre Zellen nur ein Stockwerk
hoch und verbinden die horizontalen, über
einander liegenden Stockwerke durch unförmige,
zeitraubende Wachssäulen. Ihre Vorratszellen oder
„Honigtöpfe“ sind grosse, regellos neben einander
sitzende Schläuche und werden von den Meliponen,
jeder Raum- und Materialersparnis zum Trotze,
zwischen die Tafeln des regulären Wachsbaues
eingeschoben. Und so machen denn ihre Nester,
im Vergleich zu der mathematisch gebauten Stadt
unserer Hausbienen, den Eindruck eines Marktfleckens
von primitiven Hütten neben einer jener
unerbittlich regelmässigen Städte, die das vielleicht
reizlose, aber der menschlichen Logik mehr entsprechende
Resultat eines immer härter gewordenen
Kampfes gegen Zeit, Raum und Materie sind.
Nach einer landläufigen, übrigens von Buffon wieder aufgewärmten Theorie sollen die Bienen gar nicht die Absicht haben, sechseckige Cylinder mit pyramidaler Basis zu bauen; sie wollen nur runde Zellen in das Wachs eingraben, aber ihre Nachbarinnen und die auf der anderen Seite der Tafel arbeitenden graben zu gleicher Zeit mit der gleichen Absicht die gleichen Zellen, und folglich nehmen diese an den Berührungsstellen notwendigerweise eine sechseckige Form an. Dasselbe, sagt man, findet bei den Krystallen, den Schuppen gewisser Fische, den Seifenblasen u. s. w. statt. Es findet gleichfalls bei folgendem, von Buffon vorgeschlagenem Experiment statt. „Man fülle“, sagt er, „ein Gefäss mit Erbsen oder einer anderen, cylindrischen Hülsenfrucht, giesse soviel Wasser hinein, als zwischen den Körnern Platz ist, schliesse es und lasse es kochen. Alle diese cylindrischen Körner werden zu sechsseitigen Säulen werden. Der Grund ist leicht ersichtlich, er ist rein mechanischer Natur. Jedes Korn von cylindrischer Form hat beim Aufquellen die Tendenz, sich in einem gegebenen Raume so weit wie möglich auszudehnen; sie werden durch den wechselseitigen Druck also notwendiger Weise sämtlich sechseckig. Ebenso sucht jede Biene in einem gegebenen Raume soviel Platz wie möglich zu erlangen, und da der Körper der Bienen cylindrisch ist, so müssen ihre Zellen ebenfalls sechsseitig werden, eben infolge des wechselseitigen Widerstandes.“ –
 In der That sind dies wechselseitige
Widerstände von wunderbarer
Wirkung, ebenso wie die Laster
der einzelnen Menschen eine gemeinsame
Tugend hervorbringen, die genügt,
um der menschlichen Gattung,
die in ihrem Individuum oft hassenswert ist, jedes
Odium zu nehmen. Zunächst könnte man mit
Brougham, Kirby, Spence u. a. Gelehrten antworten,
dass das Experiment mit den Seifenblasen und
Erbsen nichts beweist, denn in beiden Fällen führt
der wechselseitige Druck nur zu ganz unregelmässigen
Formen und erklärt jedenfalls nicht die
Ursache des prismatischen Zellenbodens. Vor allem
aber könnte man entgegnen, dass es mehr als eine
Art giebt, aus den blinden Notwendigkeiten sein
Teil zu ziehen. Z. B. kommen die Papierwespen,
die Erdhummeln, die Meliponen und Trigonen Mexikos
und Brasiliens bei gleichen Umständen und
gleichem Zweck zu ganz anderen und offenbar
minderwertigen Ergebnissen. Endlich könnte man
sagen, dass die Bienenzellen, wenn sie den Gesetzen
der Krystalle, des Schnees, der Seifenblasen und
der gekochten Erbsen Buffons unterworfen sind,
durch ihre allgemeine Symmetrie, ihre Anordnung
in doppelseitigen Waben, ihre berechnete Neigung
u. s. w. gleichzeitig noch vielen anderen Gesetzen
gehorchen, welche die tote Materie nicht kennt.
In der That sind dies wechselseitige
Widerstände von wunderbarer
Wirkung, ebenso wie die Laster
der einzelnen Menschen eine gemeinsame
Tugend hervorbringen, die genügt,
um der menschlichen Gattung,
die in ihrem Individuum oft hassenswert ist, jedes
Odium zu nehmen. Zunächst könnte man mit
Brougham, Kirby, Spence u. a. Gelehrten antworten,
dass das Experiment mit den Seifenblasen und
Erbsen nichts beweist, denn in beiden Fällen führt
der wechselseitige Druck nur zu ganz unregelmässigen
Formen und erklärt jedenfalls nicht die
Ursache des prismatischen Zellenbodens. Vor allem
aber könnte man entgegnen, dass es mehr als eine
Art giebt, aus den blinden Notwendigkeiten sein
Teil zu ziehen. Z. B. kommen die Papierwespen,
die Erdhummeln, die Meliponen und Trigonen Mexikos
und Brasiliens bei gleichen Umständen und
gleichem Zweck zu ganz anderen und offenbar
minderwertigen Ergebnissen. Endlich könnte man
sagen, dass die Bienenzellen, wenn sie den Gesetzen
der Krystalle, des Schnees, der Seifenblasen und
der gekochten Erbsen Buffons unterworfen sind,
durch ihre allgemeine Symmetrie, ihre Anordnung
in doppelseitigen Waben, ihre berechnete Neigung
u. s. w. gleichzeitig noch vielen anderen Gesetzen
gehorchen, welche die tote Materie nicht kennt.
Man könnte schliesslich noch hinzufügen, dass der menschliche Geist sich auch in der Form befindet, in der er aus den gleichen Notwendigkeiten sein Teil zieht, und dass uns diese Form nur darum als die bestmögliche erscheint, weil wir keinen Beurteiler über uns haben. Aber es ist besser, die Thatsachen selbst reden zu lassen, denn um einer Einwendung zu begegnen, die aus einem Experiment gezogen ist, giebt es nur ein Mittel: ein Gegenexperiment.
Um mich also zu vergewissern, dass der sechsseitige Bau der Zellen wirklich in den Geist der Bienen eingeschrieben ist, habe ich eines Tages aus der Mitte einer Wabe, und zwar an einer Stelle, wo sich Brutzellen und Honigbau befanden, ein rundes Stück von der Grösse eines Fünffrankenstücks herausgeschnitten. Nachdem ich dieses Stück in der Mitte durchgeteilt hatte, wo die pyramidalen Zellenböden aneinander stossen, legte ich auf die Schnittfläche der einen Hälfte ein Zinnblättchen von demselben Umfange und stark genug, dass die Bienen es nicht verbiegen konnten. Dann setzte ich den Ausschnitt wieder ein. Die eine Wabenseite war also ganz normal, da der Schaden derart repariert war, die andre dagegen enthielt ein grosses Loch, dessen Boden aus einer Zinnscheibe bestand, und in dem etwa dreissig Zellen fehlten. Die Bienen waren zunächst ganz verblüfft, kamen massenhaft herbei, um den unglaublichen Abgrund zu prüfen und zu erforschen, und liefen mehrere Tage ratlos herum, ohne zu einem Entschluss kommen zu können. Da ich sie aber jeden Abend stark fütterte, kam schliesslich ein Augenblick, wo sie keine Zellen mehr frei hatten, um ihre Vorräte zu bergen. Wahrscheinlich erhielten die grossen Baumeister, die Steinmetze und Wachszieherinnen nun Befehl, den unnützen Abgrund nutzbar zu machen. Eine dicke Kette von Wachsbereiterinnen bildete sich um das Loch, um die nötige Wärme zu erzeugen, andere kletterten hinein und begannen die Metallscheibe mit kleinen Wachsleisten in regelmässigen Abständen ringsherum an den Ecken der angrenzenden Zellen zu befestigen. Dann gingen sie an die Errichtung von drei oder vier Zellen in dem oberen Halbkreise der Scheibe, und zwar im Anschluss an die kleinen Leisten. Jede dieser Übergangszellen war am äusseren Rande mehr oder weniger unregelmässig gebaut, um sich dem ursprünglichen Bau anzuschliessen, aber die untere Hälfte bildete auf der Zinnscheibe stets drei genau abgezirkelte Winkel, und es entstanden bereits drei kleine gerade Linien, welche die erste Hälfte der nächsten Zelle andeuteten.
Nach 48 Stunden war die ganze Zinnscheibe mit angefangenen Zellen bedeckt, obschon höchstens drei Bienen in der engen Öffnung bauen konnten. Die Zellen waren zwar unregelmässiger, als bei gewöhnlichem Bau, und die Königin hütete sich wohl, als sie dieselben untersucht hatte, sie zu „bestiften“, denn die Brut, die daraus entstanden wäre, würde sehr unregelmässig ausgefallen sein. Aber sie waren alle vollständig sechseckig, ohne eine krumme Linie, eine abgerundete Ecke, wiewohl alle gewöhnlichen Voraussetzungen verändert waren. Die Zellen waren nicht, wie bei Hubers Beobachtung, in einen Wachsblock eingegraben, noch, wie nach Darwins Beobachtung, in einem Wachszipfel angelegt, erst kreisförmig und dann durch den Gegendruck derer Nachbarzellen sechseckig. Es war keine Rede von wechselseitigen Widerständen, denn sie entstanden eine nach der andern und ihre kleinen Anfangslinien entstanden frei auf eine Art von tabula rasa. Es scheint also festzustehen, dass das Sechseck nicht das Resultat mechanischen Druckes ist, sondern vielmehr der Absicht und Erfahrung, der Intelligenz und dem Willen der Bienen entspringt. Nebenbei gesagt, beobachtete ich noch einen anderen merkwürdigen Zug ihres Scharfsinns: die auf die Metallscheibe gebauten Zellen hatten keinen Wachsboden. Die Baumeister des Volkes hatten also augenscheinlich festgestellt, dass das Zinn stark genug war, um Flüssigkeiten abzudämmen, und darum hatten sie es nicht für nötig erachtet, es mit Wachs zu überziehen. Doch als kurz darauf ein paar Honigtropfen in zwei dieser Zellen gebracht wurden, bemerkten sie wahrscheinlich, dass sich der Honig bei Berührung mit dem Metall mehr oder weniger veränderte. Sie liessen sich dies also gesagt sein und überzogen die ganze Zinnfläche mit Wachs.
 Wollten wir alle die Geheimnisse
dieser geometrischen Bauweise
ans Licht ziehen, so müssten wir
mehr als eine seltsame Frage erörtern,
z. B. die Form der ersten, an das
Dach des Bienenstockes angehefteten
Zellen, welche so gebaut sind, dass sie dieses Dach
an möglichst vielen Stellen berühren.
Wollten wir alle die Geheimnisse
dieser geometrischen Bauweise
ans Licht ziehen, so müssten wir
mehr als eine seltsame Frage erörtern,
z. B. die Form der ersten, an das
Dach des Bienenstockes angehefteten
Zellen, welche so gebaut sind, dass sie dieses Dach
an möglichst vielen Stellen berühren.
Man müsste auch sein Augenmerk nicht sowohl auf die Anlage der grossen Strassen lenken, die durch den Parallelismus der Waben bedingt wird, als vielmehr auf die Verteilung der Gassen und Durchgänge, die hin und wieder durch die Tafeln hindurch oder um sie herum ausgespart sind, um den Verkehr zu erleichtern und Luftwege zu schaffen, und die durch ihre geschickte Anlage sowohl grosse Umwege wie zu grosses Gedränge verhindern.
Endlich müsste man die Bauart der Übergangszellen und die wunderbare Einmütigkeit studieren, mit der die Bienen ihre Zellen in einem gegebenen Augenblick erweitern, sei es, dass die Ernte besonders ergiebig ausfällt und grössere Gefässe erheischt, sei es, dass sie die Volkszahl für stark genug halten oder die Aufziehung von Drohnen notwendig wird. Zugleich müsste man die kluge Sparsamkeit und harmonische Sicherheit bewundern, mit der sie in solchen Fällen von den kleinen Zellen zu grossen und von den grossen zu kleinen, von der vollendeten Symmetrie zu einer unvermeidlich unsymmetrischen Bauart übergehen, um alsbald, wenn die Gesetze ihrer lebendigen Mathematik es erlauben, zur idealen Regel zurückzukehren, ohne eine Zelle zu verlieren, ohne in der Flucht ihrer Bauten ein aufgegebenes, kindliches, unreifes und barbarisches Stadtviertel, einen unbrauchbaren Bezirk zu hinterlassen. Aber ich fürchte, ich habe mich schon in viele belanglose Einzelheiten verloren, wenigstens sind sie belanglos für einen Leser, der vielleicht nie mit eigenen Augen einen Bienenschwarm gesehen hat oder sich nur im Vorbeigehen dafür interessiert, wie wir im Vorbeigehen an einer Blume, einem Vogel, einem seltenen Steine Gefallen finden, ohne etwas anderes zu verlangen, als eine kleine, oberflächliche Gewissheit, und ohne uns genugsam zu sagen, dass das geringste Geheimnis eines Dinges, das wir in der aussermenschlichen Natur erblicken, an dem tiefen Rätsel unseres Ursprunges und Zweckes vielleicht einen unmittelbareren Anteil hat, als das Geheimnis unserer glühendsten und mit besonderer Vorliebe erforschten Leidenschaften.
 Um diese Studie nicht unnötig
zu beschweren, übergehe ich auch die
erstaunliche Thatsache, dass die Bienen
die Ränder ihrer Waben bisweilen
abtragen und zerstören, wenn
sie dieselben erweitern oder verlängern
wollen. Man wird mir freilich zugeben, dass
zerstören, um neu zu bauen, vernichten, was man
geschaffen hat, um es noch einmal und zwar regelmässiger
zu machen, eine eigentümliche Spaltung
des blinden Instinkts voraussetzt. Ich übergehe
ferner einige bemerkenswerte Experimente, bei denen
man sie zwingen kann, ihre Waben kreisförmig,
oval oder in ganz bizarren Formen anzulegen; ebenso
will ich nicht weiter erörtern, auf welche sinnreiche
Weise sie es fertig bringen, dass die erweiterten
Zellen der konvexen Seite mit denen der
konkaven Seite der Tafel übereinstimmen. Nur
möchte ich, ehe ich diesen Gegenstand verlasse,
einen Augenblick dabei verweilen, auf welche geheimnisvolle
Weise sie ihre Arbeit in Einklang
setzen und ihre Massregeln ergreifen, wenn sie zu
gleicher Zeit und ohne sich zu sehen, auf beiden
Seiten einer Tafel arbeiten. Man halte eine dieser
Tafeln gegen das Licht, und man wird aus dem
durchsichtigen Wachs ein ganzes Netz von Prismen
mit haarscharfen Spitzen und Kanten, ein ganzes
System von Konstruktionen mit scharfen Schattenlinien
hervortreten sehen, die so sicher geführt sind,
als wären sie in Stahl geätzt.
Um diese Studie nicht unnötig
zu beschweren, übergehe ich auch die
erstaunliche Thatsache, dass die Bienen
die Ränder ihrer Waben bisweilen
abtragen und zerstören, wenn
sie dieselben erweitern oder verlängern
wollen. Man wird mir freilich zugeben, dass
zerstören, um neu zu bauen, vernichten, was man
geschaffen hat, um es noch einmal und zwar regelmässiger
zu machen, eine eigentümliche Spaltung
des blinden Instinkts voraussetzt. Ich übergehe
ferner einige bemerkenswerte Experimente, bei denen
man sie zwingen kann, ihre Waben kreisförmig,
oval oder in ganz bizarren Formen anzulegen; ebenso
will ich nicht weiter erörtern, auf welche sinnreiche
Weise sie es fertig bringen, dass die erweiterten
Zellen der konvexen Seite mit denen der
konkaven Seite der Tafel übereinstimmen. Nur
möchte ich, ehe ich diesen Gegenstand verlasse,
einen Augenblick dabei verweilen, auf welche geheimnisvolle
Weise sie ihre Arbeit in Einklang
setzen und ihre Massregeln ergreifen, wenn sie zu
gleicher Zeit und ohne sich zu sehen, auf beiden
Seiten einer Tafel arbeiten. Man halte eine dieser
Tafeln gegen das Licht, und man wird aus dem
durchsichtigen Wachs ein ganzes Netz von Prismen
mit haarscharfen Spitzen und Kanten, ein ganzes
System von Konstruktionen mit scharfen Schattenlinien
hervortreten sehen, die so sicher geführt sind,
als wären sie in Stahl geätzt.
Ich weiss nicht, ob sich jemand, der nie einen Blick in das Innere eines Bienenstockes geworfen hat, die Anordnung und das Aussehen der Waben richtig vorstellen kann. Man denke sich also, um den bäurischen Bienenstock zu nehmen, in dem die Biene sich völlig selbst überlassen ist, einen Stroh- oder Weidenkorb. Dieser Korb ist von oben bis unten in fünf, sechs, acht, bisweilen auch zehn genau parallele Wachstafeln geteilt, die wie grosse durchgeschnittene Brote aussehen und sich von der Spitze des Bienenstockes bis auf den Boden herab ziehen, indem sie sich der ovalen Form seiner Wände genau anschmiegen. Zwischen je zwei dieser Tafeln ist ein Raum von einer Zellenhöhe ausgespart, in dem die Bienen sich aufhalten und gehen. In dem Augenblicke, wo oben in der Spitze des Bienenstockes mit dem Bau einer dieser Tafeln begonnen wird, ist die angefangene Wachswand, die später ausgezogen und verdünnt wird, noch sehr stark und trennt die fünfzig oder sechzig Bienen, die auf der Vorderseite arbeiten, vollständig von den ebensovielen Bienen, die die Rückwand ausmeisseln, sodass sie sich gegenseitig nicht sehen können, vorausgesetzt, dass ihre Augen nicht die Gabe haben, die dunkelsten Körper zu durchdringen. Nichtsdestoweniger gräbt keine Biene der Vorderseite ein Loch oder klebt ein Wachsstück an, das nicht einer Aus- oder Einbuchtung auf der anderen Seite entspräche und umgekehrt. Wie fangen sie das an? Wie kommt es, dass die eine nicht zu tief und die andere nicht zu flach gräbt? Wie kommt es, dass alle Winkel der Rhomben stets so wunderbar zusammentreffen? Wer sagt ihnen, hier anzufangen und dort aufzuhören? Wir müssen uns wieder einmal mit der Antwort begnügen, die keine Antwort ist: „Das ist ein Mysterium des Bienenstocks.“ Huber hat versucht, dieses Geheimnis zu erklären; er hat gesagt, sie riefen durch den Druck ihrer Füsse oder ihrer Zähne in gewissen Abständen leichte Ausbuchtungen auf der entgegengesetzten Seite hervor, oder sie überzeugten sich von der grösseren oder geringeren Stärke der Wachswand durch den Grad der Biegsamkeit, Elastizität oder einer anderen physischen Eigenschaft des Wachses, oder auch, ihre Fühler schienen zur Untersuchung der zartesten, fernsten Umrisse gemacht und dienten ihnen zum Kompass im Unsichtbaren, oder endlich, die Lage aller Zellen ergäbe sich mit mathematischer Genauigkeit aus Anlage und Grössenverhältnissen der obersten Zellen, ohne dass es anderweitiger Maassnahmen bedürfte. Aber diese Erklärungen sind, wie man sieht, unzulänglich. Die ersteren sind unbeweisbare Hypothesen, und die anderen geben dem Mysterium nur einen anderen Namen. Und wenn es auch gut ist, mit den Mysterien so oft wie möglich einen Namens- und Ortswechsel vorzunehmen, so darf man sich doch nicht dem Irrglauben hingeben, dass solch ein Ortswechsel hinreichte, um sie zu zerstören.
 Verlassen wir endlich die
eintönigen Tafeln und die geometrische
Einöde der Zellen. Hier sind fertige
Waben, die bewohnt werden können.
Wenn auch nur verschwindend Kleines
sich zu verschwindend Kleinem fügt,
ohne scheinbare Aussicht auf Fortschritt, und unser
Auge, das so wenig sieht, hinblickt, ohne etwas
zu sehen, so bleibt der Wachsbau doch keinen
Augenblick stehen, weder bei Tage noch bei Nacht,
vielmehr wächst er mit ausserordentlicher Geschwindigkeit.
Mehr als einmal ist die Königin
schon durch das Dunkel der wachsbleichen Werkstätten
gelaufen, und sobald die ersten Reihen der
künftigen Wohnung entstanden sind, ergreift sie von
ihnen Besitz, und mit ihr das Gefolge ihrer Leibwache,
ihrer Beraterinnen und Mägde, denn man
kann nicht sagen, ob sie geführt oder begleitet,
verehrt oder überwacht wird. An der Stelle angekommen,
die sie für geeignet hält oder die ihre
Ratgeberinnen ihr bezeichnen, krümmt sie den
Rücken, beugt sich zurück und führt das Ende ihres
langen, spindelförmigen Hinterleibes in eine der
Zellen ein, während all die kleinen aufmerksamen
Köpfe mit den grossen schwarzen Augen sie begeistert
umringen, ihr die Beine stützen, die Flügel
streicheln und mit ihren fiebernden Fühlern über
sie hintasten, wie um sie zu ermutigen, zu drängen
und zu beglückwünschen.
Verlassen wir endlich die
eintönigen Tafeln und die geometrische
Einöde der Zellen. Hier sind fertige
Waben, die bewohnt werden können.
Wenn auch nur verschwindend Kleines
sich zu verschwindend Kleinem fügt,
ohne scheinbare Aussicht auf Fortschritt, und unser
Auge, das so wenig sieht, hinblickt, ohne etwas
zu sehen, so bleibt der Wachsbau doch keinen
Augenblick stehen, weder bei Tage noch bei Nacht,
vielmehr wächst er mit ausserordentlicher Geschwindigkeit.
Mehr als einmal ist die Königin
schon durch das Dunkel der wachsbleichen Werkstätten
gelaufen, und sobald die ersten Reihen der
künftigen Wohnung entstanden sind, ergreift sie von
ihnen Besitz, und mit ihr das Gefolge ihrer Leibwache,
ihrer Beraterinnen und Mägde, denn man
kann nicht sagen, ob sie geführt oder begleitet,
verehrt oder überwacht wird. An der Stelle angekommen,
die sie für geeignet hält oder die ihre
Ratgeberinnen ihr bezeichnen, krümmt sie den
Rücken, beugt sich zurück und führt das Ende ihres
langen, spindelförmigen Hinterleibes in eine der
Zellen ein, während all die kleinen aufmerksamen
Köpfe mit den grossen schwarzen Augen sie begeistert
umringen, ihr die Beine stützen, die Flügel
streicheln und mit ihren fiebernden Fühlern über
sie hintasten, wie um sie zu ermutigen, zu drängen
und zu beglückwünschen.
Die Stelle, an der sie sitzt, erkennt man leicht; sie bildet in jener gestirnten Kokarde, oder besser in jener ovalen Brosche, die den mächtigen Broschen unserer Grossmütter ähnelt, den Mittelstein. Es ist nämlich bemerkenswert, da sich die Gelegenheit, es zu bemerken, hier bietet, dass die Arbeitsbienen ihrer Königin niemals den Rücken zudrehen. Sobald sie einer Gruppe naht, stellen sich alle mit den Augen und Fühlern gegen sie und gehen rückwärts vor ihr. Es ist dies ein Zeichen von Ehrfurcht oder vielleicht von Besorgnis, die, so grundlos sie hier auch scheinen mag, nichtsdestoweniger immer rege und ganz allgemein ist. Kommen wir indes auf unsere Königin zurück.
Oft geschieht es bei dem leichten Krampf, der das Eierlegen sichtbar begleitet, dass eine ihrer Töchter sie in ihre Arme schliesst und Stirn an Stirn, Mund an Mund, mit ihr zu flüstern scheint. Sie bleibt diesen etwas überschwenglichen Liebesbezeugungen gegenüber jedoch ziemlich gleichgiltig; sie regt sich nie auf, nimmt sich stets Zeit und geht ganz in ihrem Berufe auf, der für sie mehr eine Liebeswonne als eine Arbeit zu sein scheint. Endlich, nach Verlauf einiger Sekunden, richtet sie sich ruhig wieder auf, macht einen Schritt zur Seite, dreht sich etwas um und steckt den Kopf in die Nebenzelle, um sich, bevor sie den Hinterleib in diese einführt, zu überzeugen, ob alles in Ordnung ist und ob sie dieselbe Zelle nicht zweimal bestiftet, während zwei oder drei Bienen aus ihrem Gefolge schnell nacheinander in die von ihr verlassene Zelle stürzen, um nachzusehen, ob das Werk vollbracht ist, und das kleine bläuliche Ei, das sie auf den Boden gesetzt hat, mit ihrer Fürsorge zu umgeben oder richtig hinzustellen.
Von nun an rastet sie bis zu den ersten Herbstfrösten nicht mehr im Eierlegen; sie legt, während sie gefüttert wird, und schläft, wenn sie schläft, im Legen. Sie ist fortan die Verkörperung jener alles verschlingenden Macht, die jeden Winkel des Stockes ergreift: der Zukunft. Schritt für Schritt folgt sie den unglücklichen Arbeitsbienen, die sich im Bauen der Wiegen erschöpfen, welche ihre Fruchtbarkeit heischt. Man kann auf diese Weise einem Wettkampfe zweier mächtiger Instinkte folgen, dessen Ausgang auf verschiedene Wunder des Bienenstockes genug Licht wirft, nicht um sie zu erklären, wohl aber, um auf sie hinzuweisen.
Es kommt z. B. vor, dass die Arbeitsbienen in ihrer treuen Hausfrauenfürsorge, die sie Vorräte für schlechte Zeiten aufspeichern heisst, einen Vorsprung gewinnen, indem sie die Zellen, die sie der Habsucht der Gattung abgerungen haben, in aller Eile mit Honig füllen. Aber die Königin kommt herbei; die materiellen Güter müssen dem Gedanken der Art weichen, und die Arbeitsbienen schaffen den lästigen Schatz voller Verzweiflung hastig bei Seite.
Es kommt auch vor, dass ihr Vorsprung eine ganze Wabe beträgt: dann haben sie das Symbol der Tyrannei einer Zukunft, die keine von ihnen je erblicken wird, nicht mehr vor Augen und bauen, sich dies zu Nutze machend, so schnell wie möglich eine Reihe von grossen, sogenannten Drohnenzellen, die viel leichter und schneller zu errichten sind. In dieser undankbaren Zone angelangt, bestiftet die Königin hie und da nicht ohne Widerwillen eine Zelle, überschlägt die meisten anderen und fordert, am Ende angelangt, neue Arbeitsbienenzellen. Die Arbeitsbienen gehorchen, verengern die Zellen allmählich und die unersättliche Mutter setzt ihren Rundgang fort, bis sie von den Enden des Bienenstockes wieder zu den ersten Zellen gelangt ist, die in der Zwischenzeit von der eben auskriechenden ersten Generation besetzt waren, welche sich aus ihrem dunklen Geburtswinkel soeben über die Blumen der Umgegend ergiesst, die Sonnenstrahlen bevölkert und die schönsten Stunden des Jahres belebt, um sich ihrerseits wieder dem nachfolgenden Geschlechte zu opfern, das sie in ihren Wiegen schon ablöst.

 Und die Bienenkönigin, wem
gehorcht die? Der Nahrung, die ihr
gegeben wird, denn sie ernährt sich
nicht selbst, sie wird wie ein Kind
von eben den Arbeitsbienen gefüttert,
die ihre Fruchtbarkeit erschöpft. Und
diese Nahrung wiederum, die ihr die Arbeitsbienen
zuteilen, hängt von dem Blumenreichtum und den
Ergebnissen der Trachtzeit ab. Auch hier also,
wie überall auf Erden, ist ein Teil des Kreises in
Finsternis getaucht; auch hier, wie überall, kommt
der höchste Befehl von aussen, von einer unbekannten
Macht, und die Bienen gehorchen gleich
uns dem namenlosen Herrn des aus sich rollenden
Rades, das die es bewegenden Willenskräfte zermalmt.
Und die Bienenkönigin, wem
gehorcht die? Der Nahrung, die ihr
gegeben wird, denn sie ernährt sich
nicht selbst, sie wird wie ein Kind
von eben den Arbeitsbienen gefüttert,
die ihre Fruchtbarkeit erschöpft. Und
diese Nahrung wiederum, die ihr die Arbeitsbienen
zuteilen, hängt von dem Blumenreichtum und den
Ergebnissen der Trachtzeit ab. Auch hier also,
wie überall auf Erden, ist ein Teil des Kreises in
Finsternis getaucht; auch hier, wie überall, kommt
der höchste Befehl von aussen, von einer unbekannten
Macht, und die Bienen gehorchen gleich
uns dem namenlosen Herrn des aus sich rollenden
Rades, das die es bewegenden Willenskräfte zermalmt.
Als ich einem Freunde kürzlich in einem meiner Beobachtungskästen die Bewegung dieses Rades zeigte, die so sichtbar ist, wie die einer grossen Wanduhr, als er die Unruhe und das zahllose Hin und Her auf den Waben, das beständige, rätselhafte, tolle Beben und Zittern der Pflegerinnen auf dem Brutnest, die lebenden Gänge und Leitern, welche die Wachszieherinnen bilden, die alles befruchtenden Spiralen der Königin, das mannigfaltige, unaufhörliche Schaffen des Schwarmes, die erbarmungslose und vergebliche Arbeit, den verzehrenden Eifer im Gehen und Kommen, das Fehlen jedes Schlafes, ausser in den Wiegen, welche von Arbeit umringt sind, ja selbst das Fernbleiben des Todes von einem Orte, der weder Krankheit noch Gräber zulässt – als er dies alles sah, da wandte er nach dem ersten Staunen die Augen ab und ich las darin Trübsal und Schauder.
In der That steht im Bienenstock hinter dem fröhlichen Eindruck des ersten Anblicks, hinter den leuchtenden Erinnerungen der schönen Tage, die ihn erfüllen und zur Juwelenlade des Sommers machen, hinter dem trunkenen Hin und Her, das ihn mit den Blumen, den Wasserbächen und dem blauen Himmel, mit dem friedlichen Überfluss aller schönen und glücklichen Dinge verknüpft – hinter all diesen äusseren Wonnen verbirgt sich in der That ein Schauspiel, das zu dem Traurigsten gehört, was man sehen kann. Und wir Blinde, die wir nur blöde Augen öffnen, wenn wir diese unschuldig Verurteilten ansehen, wir wissen wohl, dass es nicht sie allein sind, die wir zu sehen uns bemühen, dass es nicht sie allein sind, die wir nicht verstehen, sondern nur eine traurige Gestalt jener grossen Kraft, die auch uns beseelt.
Ja, wenn man will, so ist dies traurig, wie alles in der Natur, wenn man näher zusieht. Und es wird so lange traurig sein, solange wir ihr Geheimnis nicht wissen, noch ob sie eines hat. Und wenn wir eines Tages erfahren, dass sie keines hat oder dass dies Geheimnis schauerlich ist, dann werden andere Pflichten zu Tage treten, die vielleicht noch namenlos sind. Inzwischen möge unser Herz sich sagen, wenn ihm danach gelüstet: „Das ist traurig“, aber unsere Vernunft möge sich begnügen, zu sagen: „Das ist so“. Unsere Pflicht ist zu dieser Stunde, danach zu suchen, ob hinter diesem Traurigen nichts anderes liegt, und darum soll man die Augen nicht davon abwenden, sondern es fest anschauen und mit so viel Mut und Teilnahme erforschen, als wäre es etwas Freudiges. Es gebührt sich, die Natur zu befragen, ehe wir sie verurteilen und uns beklagen. –
 Wir haben gesehen, dass die
Arbeitsbienen, sobald sie durch die
bedrohliche Fruchtbarkeit der Mutter
nicht mehr gedrängt werden, Vorratszellen
anlegen, die sich mit geringeren
Mitteln bauen lassen und mehr Fassungsvermögen
haben, als die Arbeitsbienenzellen.
Wir haben andererseits gesehen, dass die Königin
lieber die kleinen Zellen bestiftet und unaufhörlich
nach solchen verlangt. Nichtsdestoweniger schickt
sie sich, wenn keine da sind, in die Verhältnisse
und legt in Erwartung neu zu erbauender Arbeitsbienenzellen
ihre Eier auch in die grossen Zellen,
die sie auf ihrem Wege findet.
Wir haben gesehen, dass die
Arbeitsbienen, sobald sie durch die
bedrohliche Fruchtbarkeit der Mutter
nicht mehr gedrängt werden, Vorratszellen
anlegen, die sich mit geringeren
Mitteln bauen lassen und mehr Fassungsvermögen
haben, als die Arbeitsbienenzellen.
Wir haben andererseits gesehen, dass die Königin
lieber die kleinen Zellen bestiftet und unaufhörlich
nach solchen verlangt. Nichtsdestoweniger schickt
sie sich, wenn keine da sind, in die Verhältnisse
und legt in Erwartung neu zu erbauender Arbeitsbienenzellen
ihre Eier auch in die grossen Zellen,
die sie auf ihrem Wege findet.
Die Bienen, die aus ihnen hervorgehen, sind männliche Bienen oder Drohnen, wiewohl die Eier genau ebenso aussehen, wie die der Arbeitsbienen. Nun aber ist im Gegensatz zur Verwandlung einer Arbeitsbiene in eine Königin, nicht die Form und der grössere Umfang der Zelle für die Veränderung maassgebend, denn wenn man ein Ei, das in eine grosse Zelle gelegt ist, in eine kleine Zelle schafft (was schwer zu bewerkstelligen ist, weil das Ei sehr klein und verletzlich ist, so dass mir diese Umquartierung nur vier- oder fünfmal geglückt ist), so geht daraus ein mehr oder minder schmächtiges, aber unverkennbares Männchen hervor. – Die Königin muss beim Eierlegen also das Vermögen haben, das Geschlecht des Eies zu erkennen oder zu bestimmen und der Grösse der Zelle, über der sie niederhockt, anzupassen. Es kommt selten vor, dass sie sich täuscht. Wie geschieht das? Wie ist es möglich, dass sie bei den tausenden von Eiern, die ihre beiden Eierstöcke enthalten, die männlichen und weiblichen zu scheiden weiss, und wie gelangen diese nach ihrem Willen in den gemeinsamen Eileiter?
Wir stehen hier wiederum vor einem der Wunder des Bienenstockes, und zwar vor einem der unerklärlichsten. Es ist bekannt, dass die jungfräuliche Königin keineswegs unfruchtbar ist, dass sie hingegen nur Drohneneier legen kann. Erst nach der Befruchtung des Hochzeitsausfluges bringt sie Drohnen- und Arbeitsbieneneier zur Welt, und zwar bleibt sie von dem Hochzeitsausfluge an bis zu ihrem Tode mit den Samenfäden geschwängert, die sie ihrem unglücklichen Buhlen entreisst. Diese Samenfäden, deren Zahl Dr. Leuckart auf 25 Millionen schätzt, bleiben in einer besonderen Samentasche unter den Eierstöcken am Anfang des gemeinsamen Eileiters bewahrt und halten sich darin lebend. Man nimmt an, dass die enge Öffnung der kleinen Zellen und die Art, wie die Form dieser Mündung die Königin zwingt, sich zu bücken und niederzuhocken, auf die Samenfäden einen gewissen Druck ausübt, so dass dieselben herausquellen und das Ei im Vorbeigleiten befruchten. Dieser Druck findet nicht statt bei den grossen Drohnenzellen und die Samentasche öffnet sich dann nicht. Andere dagegen sind der Meinung, dass die Königin wirklich Herr der Schliessmuskeln ihrer Samentasche ist, und in der That sind diese Muskeln ausserordentlich zahlreich, ausgebildet und mannigfach. Ohne darum entscheiden zu wollen, welche von diesen zwei Hypothesen die bessere ist – denn je weiter man geht, desto mehr nimmt man wahr, je mehr man einsieht, dass man nur ein Schiffbrüchiger auf dem bisher fast unerforschten Meere der Natur ist, desto besser erkennt man, dass immer eine Thatsache bereit ist, aus dem Schosse einer plötzlich durchsichtiger werdenden Welle emporzutauchen und mit einem Schlage alles zu vernichten, was man zu wissen glaubte – so kann ich doch nicht leugnen, dass ich mehr zu der letzteren Annahme hinneige. Denn einmal beweisen die Experimente eines Bienenvaters aus Bordeaux, Namens Drory, dass die Königin, auch wenn alles Drohnenwerk aus dem Stocke entfernt ist, sobald der Augenblick zum Legen von Drohneneiern gekommen ist, nicht zögert, diese in Arbeitsbienenzellen zu legen, und umgekehrt Arbeitsbieneneier in Drohnenzellen, wenn man ihr keine anderen übrig gelassen hat. Ferner geht aus den schönen Beobachtungen von Fabre über die Mauerbienen (Osmiae), einsame Kunstbienen aus der Familie der Bauchsammler, zur Genüge hervor, dass die Mauerbiene das Geschlecht des Eies, das sie legen wird, nicht nur im Voraus kennt; auch die Geschlechtsbestimmung liegt in der Macht der Mutter, und diese richtet sich dabei nach dem ihr zu Gebote stehenden Platz, „der oft vom Zufall abhängig und nicht modificierbar ist“, indem sie hier ein männliches, dort ein weibliches Ei legt. Ich will auf die Einzelheiten der Experimente des grossen französischen Entomologen nicht näher eingehen; sie sind zu verwickelt und würden uns zu weit führen. Aber welche Hypothese auch zuletzt recht behält, sie würden beide die Vorliebe der Königin, nur Arbeitsbienenzellen zu „bestiften“, ganz ohne Hineinziehung der Zukunft erklären.
Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass die Sklavin dieser Zukunft, die wir zu beklagen geneigt sind, vielleicht eine grosse Liebende, ein Ausbund von Wollust ist und in der Vereinigung des männlichen und weiblichen Prinzipes, die sich in ihrem Wesen vollzieht, eine gewisse Wonne und gleichsam einen Nachgeschmack der Trunkenheit ihres einzigen Hochzeitsausfluges empfindet. Vielleicht ist die Natur, die nie sinnreicher, nie hinterlistiger, weitblickender und erfindungsreicher ist, als wenn sie die Fallen der Liebe stellt, auch hier darauf bedacht gewesen, das Interesse der Gattung auf eine persönliche Wonne zu stützen. Aber seien wir vorsichtig und lassen wir uns nicht von unserer eigenen Erklärung blenden. Der Natur derart einen Gedanken zuschreiben und wähnen, das sei genug, heisst einen Stein in einen unerforschlichen Abgrund werfen, wie man ihn im Grunde mancher Höhlen findet, und sich dabei einbilden, der Schall, den dieser Stein im Fallen verursacht, wird auf alle unsere Fragen antworten und uns mehr offenbaren, als die Unermesslichkeit des Abgrundes.
Wenn man nachspricht: die Natur will dies, sie organisiert dieses Wunder, geht auf diesen Endzweck aus, so kommt das auf dasselbe heraus, als wenn man sagt: eine kleine Erscheinung des Lebens weiss sich in der Zeit, in der wir sie beobachten können, auf der ungeheuren Oberfläche der Materie, die uns leblos erscheint und darum von uns, anscheinend sehr zu Unrecht, das Nichts oder der Tod genannt wird, zu behaupten.
Ein durchaus nicht notwendiges Zusammentreffen von Umständen liess diese Erscheinung unter tausend anderen, vielleicht nicht minder sinn- und belangreichen, sich durchsetzen, während diese nicht die Gunst der Verhältnisse besassen und auf ewig verschwunden sind, ohne dass wir sie hätten bestaunen können. Es wäre tollkühn, wollte man mehr sagen, und alles Übrige, unsere Gedanken und unser hartnäckiger Glaube an Zwecke, unser Hoffen und unsere Bewunderung ist im Grunde etwas Unbekanntes, das wir in etwas noch Unbekannteres werfen, um ein kleines Geräusch zu verursachen, das uns ein Bewusstsein von der höchsten Stufe des besonderen Daseins giebt, die wir auf dieser stummen und unerforschlichen Oberfläche erreichen können, wie das Lied der Nachtigall und der Flug dem Kondor die höchste Stufe des besonderen Daseins ihrer Art offenbaren. Nichts destoweniger bleibt es eine unserer unzweifelhaftesten Pflichten, dieses kleine Geräusch hervorzurufen, ohne uns dadurch entmutigen zu lassen, dass es wahrscheinlich vergeblich ist.

 Schliessen wir hier unsern
jungen Bienenstock, wo der
Kreislauf des Lebens von
Neuem beginnt, wo das Leben
sich ausbreitet und mehrt,
um sich alsbald wieder zu teilen, wenn es den
Gipfel seiner Macht und seines Glückes erreicht
hat, und öffnen wir noch einmal den Mutterstock,
um zu beobachten, was nach Abzug des Schwarmes
darin geschieht.
Schliessen wir hier unsern
jungen Bienenstock, wo der
Kreislauf des Lebens von
Neuem beginnt, wo das Leben
sich ausbreitet und mehrt,
um sich alsbald wieder zu teilen, wenn es den
Gipfel seiner Macht und seines Glückes erreicht
hat, und öffnen wir noch einmal den Mutterstock,
um zu beobachten, was nach Abzug des Schwarmes
darin geschieht.
Sobald die Aufregung des Aufbruches sich gelegt hat und zwei Drittel der Einwohner ohne Aussicht auf Wiederkehr ausgewandert sind, liegt der Stock verödet, wie ein Körper, der sein Blut verloren hat. Er ist matt, entkräftet, fast tot. Trotzdem sind einige tausend Bienen zurückgeblieben. Sie nehmen unerschüttert, wenn auch etwas gedrückt, die Arbeit wieder auf, suchen die Fehlenden so gut wie möglich zu ersetzen, entfernen die Spuren der vorangegangenen Orgie, verschliessen die zum Plündern freigegebenen Vorräte, befliegen die Blüten, wachen über die Speicher der Zukunft, kurz, sind sich ihrer Aufgabe bewusst und ihrer Pflicht, welche ein ganz bestimmtes Schicksal vorschreibt, treu ergeben.
Aber wenn die Gegenwart trübe erscheint, so ist alles, worauf das Auge fällt, von Hoffnungen erfüllt. Wir sind in einem jener Märchenschlösser der deutschen Sage, dessen Wände aus tausend und abertausend Phiolen bestehen, welche die Seelen der Ungeborenen enthalten. Wir sind an der Stätte des Lebens, das dem Leben vorausgeht. Überall ruhen in wohlverschlossenen Wiegen, in dem zahllosen Übereinander der wunderbaren sechseckigen Zellen, Myriaden von Nymphen, weisser als Milch, die Beine zusammengelegt und das Köpfchen über die Brust gebeugt, und warten auf die Stunde des Erwachens. Wenn man sie so sieht in ihrem einförmigen Grabe, das, aus seiner Umgebung herausgelöst, fast durchsichtig ist, so möchte man sagen, es sind eisgraue Zwerge in tiefem Sinnen oder Legionen von Jungfrauen, in die Falten ihres Leichentuches gehüllt und in sechskantige Prismen eingesargt, die ein unbezähmbarer Geometer bis zum Wahnsinn fort und fort gebaut hat.
Auf dem gesamten Umkreise dieser senkrechten Mauern, die eine werdende, sich wandelnde Welt umschliessen, die vier oder fünf Mal die Hülle wechselt und ihr Linnen im Finstern webt, tanzen ein paar hundert Arbeitsbienen flügelschlagend herum, um die nötige Wärme zu erzeugen und auch noch um eines dunkleren Zweckes willen, denn ihr Reigen weist aussergewöhnliche, methodische Bewegungen auf, die einen, wie ich glaube, bisher von keinem Beobachter erschlossenen Zweck haben.
Nach Verlauf weniger Tage reissen die Deckel dieser Myriaden von Urnen (man zählt deren in einem starken Bienenstock 60000 bis 80000), und zwei grosse ernste schwarze Augen kommen zum Vorschein, darüber ein paar Fühler, die das Dasein ringsum schon betasten, während die thätigen Kinnbacken die Öffnung erweitern. Sogleich kommen die Ammen herbei, helfen der jungen Biene aus ihrem Gefängnis heraus, stützen, bürsten und säubern sie und bieten ihr auf der Spitze ihrer Zunge den ersten Honig ihres neuen Lebens dar. Sie, die aus einer andern Welt kommt, ist noch betäubt, blass und schwankend; sie hat das hinfällige Aussehen eines kleinen Greises, der dem Grabe entronnen ist. Man möchte sagen, sie ist wie ein Wanderer, der mit dem flaumweichen Staube der unbekannten, zum Dasein führenden Strassen bedeckt ist. Im übrigen ist sie vom Kopf bis zu Füssen vollkommen entwickelt, weiss unmittelbar alles, was sie zu wissen hat, und begiebt sich, gleich jenen Kindern des Volkes, die sozusagen schon in der Wiege lernen, dass sie nie die Zeit haben werden, zu lachen und zu spielen, alsbald nach den noch verdeckelten Zellen, um ebenfalls mit den Flügeln zu schlagen, sich rhythmisch zu bewegen und ihre noch schlummernden Schwestern zu wärmen, ohne dass es ihr in den Sinn käme, das erstaunliche Rätsel ihrer Bestimmung und ihrer Gattung lösen zu wollen.
 Einstweilen bleiben ihr die
anstrengendsten Verrichtungen trotzdem
noch erspart. Sie verlässt den
Stock erst acht Tage nach ihrer Geburt,
um ihren ersten „Reinigungsausflug“
zu machen und ihre Luftsäcke
mit Luft zu füllen. Diese schwellen alsbald auf,
weiten ihren ganzen Körper und vermählen sie von
Stund’ an dem unendlichen Raume. Danach fliegt sie
heim, wartet noch eine Woche und befliegt dann in
Gemeinschaft mit ihren Altersgefährtinnen zum ersten
Mal die Blüten, nicht ohne eine ganz bestimmte Aufregung,
die dem Bienenzüchter wohl bekannt ist
(„das Vorspiel“). Man sieht in der That, wie sich
die jungen Bienen fürchten, wie sie, die Kinder des
Dunkels und der Enge, vor dem azurenen Abgrund und
der unendlichen Einsamkeit des Lichtes schaudern,
und ihre tastende Freude ist aus Schrecken gewebt.
Sie bleiben vor der Schwelle stehen, sie zögern,
fliegen zwanzig Mal aus und ein, wiegen sich in
den Lüften, den Kopf beharrlich nach ihrem Geburtshause
gewandt, beschreiben grosse Halbkreise
nach oben und fallen plötzlich unter der Last eines
Heimwehs herab; und ihre dreizehntausend Augen
prüfen oder spiegeln wieder und behalten mit einander
alle Bäume, den Springbrunnen, das Gitter,
das Spalier, die Dächer und Fenster der Umgebung,
bis die luftige Strasse, auf der sie heimwärts fliegen
werden, so unwandelbar in ihr Gedächtnis eingegraben
ist, als wäre sie mit dem Stahlgriffel in den
Raum geritzt.
Einstweilen bleiben ihr die
anstrengendsten Verrichtungen trotzdem
noch erspart. Sie verlässt den
Stock erst acht Tage nach ihrer Geburt,
um ihren ersten „Reinigungsausflug“
zu machen und ihre Luftsäcke
mit Luft zu füllen. Diese schwellen alsbald auf,
weiten ihren ganzen Körper und vermählen sie von
Stund’ an dem unendlichen Raume. Danach fliegt sie
heim, wartet noch eine Woche und befliegt dann in
Gemeinschaft mit ihren Altersgefährtinnen zum ersten
Mal die Blüten, nicht ohne eine ganz bestimmte Aufregung,
die dem Bienenzüchter wohl bekannt ist
(„das Vorspiel“). Man sieht in der That, wie sich
die jungen Bienen fürchten, wie sie, die Kinder des
Dunkels und der Enge, vor dem azurenen Abgrund und
der unendlichen Einsamkeit des Lichtes schaudern,
und ihre tastende Freude ist aus Schrecken gewebt.
Sie bleiben vor der Schwelle stehen, sie zögern,
fliegen zwanzig Mal aus und ein, wiegen sich in
den Lüften, den Kopf beharrlich nach ihrem Geburtshause
gewandt, beschreiben grosse Halbkreise
nach oben und fallen plötzlich unter der Last eines
Heimwehs herab; und ihre dreizehntausend Augen
prüfen oder spiegeln wieder und behalten mit einander
alle Bäume, den Springbrunnen, das Gitter,
das Spalier, die Dächer und Fenster der Umgebung,
bis die luftige Strasse, auf der sie heimwärts fliegen
werden, so unwandelbar in ihr Gedächtnis eingegraben
ist, als wäre sie mit dem Stahlgriffel in den
Raum geritzt.
Da wir hier zufällig ein neues Mysterium berühren, so wollen wir es nicht unbefragt am Wege liegen lassen. Es ist immer vorteilhaft, ein Mysterium zu befragen, und wenn es keine Antwort giebt, so trägt doch selbst sein Schweigen zur Erweiterung unserer bewussten Unwissenheit bei, welche das fruchtbarste Feld unserer Thätigkeit ist. Wie also finden die Bienen ihre Wohnung wieder, die sie oft durchaus nicht sehen können, da sie meist unter Bäumen versteckt ist, und deren Flugloch jedenfalls nur ein unendlicher Punkt im Raume ist? Wie ist es möglich, dass man sie in einem Kasten zwei oder drei Kilometer vom Bienenstock fortbringen kann und sie ihn doch nur äusserst selten nicht wieder finden?
Sehen sie ihn durch die Gegenstände hindurch? Finden sie sich mit Hilfe von Merkzeichen zurecht oder besitzen sie etwa jenen besonderen, noch wenig bekannten Sinn, den wir gewissen Tieren, z. B. den Schwalben und Tauben, zuschreiben und den man den Richtungssinn nennt? Die Experimente von J. Fabre, Lubbock und vor allem Romanes („Nature“, 29. Oktober 1886) scheinen zu beweisen, dass sie von diesem seltsamen Instinkt nicht geleitet werden. Andererseits habe ich mehr als einmal die Erfahrung gemacht, dass sie Form und Farbe des Bienenstockes keineswegs berücksichtigen. Sie scheinen sich mehr an den gewohnten Anblick des Bienenstandes, an die Lage des Flugloches und die Stellung des Flugbrettes zu halten.[8] Aber selbst das ist nebensächlich, und wenn man z. B., während sie ihre Tracht holen, die Vorderseite ihrer Wohnung von oben bis unten verändert, so kommen sie nichtsdestoweniger aus den Tiefen des Horizontes direkt darauf zugeflogen und zögern nur in dem Augenblicke etwas, wo sie die unverkennbare Schwelle betreten. Ihre Orientierungsmethode scheint, soweit wir dies nach unseren Erfahrungen beurteilen können, vielmehr auf einem System von Merkzeichen zu beruhen und ausserordentlich fein und zuverlässig zu sein. Es ist nicht der Bienenstock, den sie wiedererkennen, es ist der Platz, den er unter den umliegenden Gegenständen einnimmt. Und dieser Ortssinn ist so wunderbar genau, so mathematisch sicher und so tief in ihr Gedächtnis eingegraben, dass, wenn der Bienenstock nach vier oder fünf Monaten der Einwinterung in einem dunklen Keller wieder an seinen Platz gestellt und das Flugloch wenige Zentimeter zur Seite gerückt wird, alle Bienen, wenn sie mit der ersten Tracht heimkehren, genau an der Stelle anfliegen, wo es sich im vorigen Jahre befand; nur allmählig finden sie tastend den verschobenen Eingang. Man möchte glauben, der Raum habe den ganzen Winter hindurch die unzerstörbare Spur ihrer Flüge sorgfältig bewahrt, und der Pfad ihrer Emsigkeit sei in der Luft eingegraben.
So kommt es auch, dass viele Bienen sich verirren, sobald man den Bienenstock wo anders hinstellt, ausgenommen, wenn es sich um eine grosse Reise handelt oder die ganze Gegend, die sie bis auf drei oder vier Kilometer im Umkreise genau kennen, völlig verändert ist, oder endlich, wenn man ein Brett vor dem Flugloche anbringt und ihnen dadurch begreiflich macht, dass sich etwas verändert hat, dass sie sich neu orientieren und andere Merkpunkte aussuchen müssen.
 Indessen kehren wir zu dem
sich allmählig wieder bevölkernden
Bienenstocke zurück, in dem sich eine
Wiege nach der andern öffnet und
selbst der Stoff der Wände in Bewegung
zu geraten scheint. Aber
der Stock hat noch keine Königin. An den Rändern
des Brutnestes erheben sich sieben bis acht bizarre
Bauten, die an der rauhen Oberfläche der gewöhnlichen
Zellen wie die Kreise und Protuberanzen
aussehen, welche den photographischen Mondbildern
ein so seltsames Gepräge geben. Es sind sozusagen
runzelige Wachskapseln oder hängende, rundum
geschlossene Eicheln, die den Raum von drei
oder vier Arbeitsbienenzellen einnehmen. Sie sitzen
gewöhnlich auf einem Fleck, und eine zahlreiche,
eigentümlich unruhige und aufmerksame Wache
beschirmt diesen Teil des Stockes, über dem irgend
ein Zauber zu walten scheint. Es ist das Reich
der Mütter. In jede dieser Zellen ist vor Aufbruch
des Schwarmes ein Ei gelegt, das genau so aussieht
wie die, aus denen die Arbeitsbienen hervorgehen,
sei es von der Königin selbst, sei es, was wahrscheinlicher
ist, obwohl es bisher nicht festgestellt
wurde, von den Arbeitsbienen, indem diese es von
einer der benachbarten Zellen hinüberschafften.
Indessen kehren wir zu dem
sich allmählig wieder bevölkernden
Bienenstocke zurück, in dem sich eine
Wiege nach der andern öffnet und
selbst der Stoff der Wände in Bewegung
zu geraten scheint. Aber
der Stock hat noch keine Königin. An den Rändern
des Brutnestes erheben sich sieben bis acht bizarre
Bauten, die an der rauhen Oberfläche der gewöhnlichen
Zellen wie die Kreise und Protuberanzen
aussehen, welche den photographischen Mondbildern
ein so seltsames Gepräge geben. Es sind sozusagen
runzelige Wachskapseln oder hängende, rundum
geschlossene Eicheln, die den Raum von drei
oder vier Arbeitsbienenzellen einnehmen. Sie sitzen
gewöhnlich auf einem Fleck, und eine zahlreiche,
eigentümlich unruhige und aufmerksame Wache
beschirmt diesen Teil des Stockes, über dem irgend
ein Zauber zu walten scheint. Es ist das Reich
der Mütter. In jede dieser Zellen ist vor Aufbruch
des Schwarmes ein Ei gelegt, das genau so aussieht
wie die, aus denen die Arbeitsbienen hervorgehen,
sei es von der Königin selbst, sei es, was wahrscheinlicher
ist, obwohl es bisher nicht festgestellt
wurde, von den Arbeitsbienen, indem diese es von
einer der benachbarten Zellen hinüberschafften.
Nach drei Tagen entsteht aus dem Ei eine kleine Larve, die eine besondere, möglichst reichliche Nahrung erhält, und nun können wir die Natur in der Verfolgung einer ihrer beliebtesten Methoden belauschen, die, handelte es sich um Menschen, sogleich den anspruchsvollen Namen Verhängnis erhalten würde. Die kleine Larve macht infolge dieser Behandlungsart eine ganz besondere Entwickelung durch und ihr Geist und Körper verändert sich dergestalt, dass die Biene, die aus ihr hervorgeht, einer ganz anderen Insektengattung anzugehören scheint. Die Königin – denn sie ist es – lebt vier bis fünf Jahre, statt fünf oder sechs Wochen. Ihr Hinterleib ist zweimal länger, von hellerer, goldiger Farbe, ihr Stachel ist gekrümmt, ihre Augen zählen nur sechs- bis siebentausend Facetten, statt zwölf- oder dreizehntausend. Ihr Hirnschädel ist enger, aber ihre Eierstöcke sind mächtig entwickelt, und sie besitzt ein besonderes Organ, die sogenannte Samentasche, die sie gewissermassen zweigeschlechtig macht. Sie besitzt keinerlei Arbeitswerkzeuge, weder Organe zur Wachsbildung, noch Bürsten und Körbchen zum Einsammeln des Blütenstaubes. Sie hat keine der Gewohnheiten und Leidenschaften, die uns von der Biene unzertrennlich scheinen. Sie empfindet keinen Sonnendurst, kein Verlangen nach dem Luftraume, sie stirbt, ohne auch nur eine Blume beflogen zu haben. Sie verbringt ihr Dasein im Dunkeln und in der Enge des Bienenstockes, voll unermüdlichen Verlangens nach Wiegen für die Brut. Dafür lernt sie allein die Freuden der Liebe kennen. Sie weiss nicht, ob sie das Licht zweimal in ihrem Leben erblicken wird, denn das Schwärmen ist nicht unbedingt notwendig; vielleicht wird sie nur ein einziges Mal ihre Flügel gebrauchen, aber dieser einzige Ausflug gilt ihrem Geliebten. Es ist sonderbar zu sehen, dass so viele Dinge, Organe, Gedanken, Sehnsüchte und Gewohnheiten, kurz, ein ganzes Schicksal, sich dergestalt nicht in einem Samen befindet – dies wäre das gewöhnliche Wunder von Pflanze, Tier und Mensch –, sondern in einem fremden, trägen Stoffe: nämlich in einem Honigtropfen.[9]
 Ungefähr eine Woche ist seit
dem Scheiden der alten Königin verstrichen.
Die königlichen Nymphen,
die in ihren Kapseln schlummern,
sind nicht alle gleichalterig, denn die
Bienen haben ein Interesse daran,
dass die Königinnen nur nach einander auskommen,
je nachdem das Volk sich entscheidet, einen zweiten,
dritten oder vierten Schwarm dem ersten nachzusenden.
Seit einigen Stunden tragen sie die Wände
der reifsten Zelle allmählig ab, und bald streckt die
junge Königin, die von innen gleichzeitig an dem
geründeten Deckel nagt, den Kopf heraus, kommt
halb zum Vorschein und kriecht schliesslich mit
Hilfe der Wärterinnen, die herbeilaufen, sie bürsten,
reinigen und liebkosen, ganz aus, um ihre ersten
Gehversuche auf der Wabe zu machen. Sie ist
wie die auskriechenden Arbeitsbienen bleich und
schwankend, aber nach zehn Minuten steht sie schon
fest auf den Beinen und läuft voller Unruhe, in dem
Gefühl, dass sie nicht allein ist, dass sie ihr Reich
erobern muss, dass es irgendwo noch Prätendenten
giebt, über alle Wachsmauern hin und sucht nach
ihren Nebenbuhlerinnen. Hier greift nun die Weisheit,
der Instinkt, der Geist des Bienenstockes oder
die Masse der Arbeitsbienen mit einer geheimnisvollen
Entscheidung ein. Am überraschendsten ist
es, wenn man den Gang dieser Ereignisse in einem
Bienenstock mit Glaswänden mit den Augen verfolgen
kann. Denn man gewahrt nie das geringste
Zaudern, die geringste Uneinigkeit. Man findet nie
das geringste Zeichen von Zwist und Streit. Eine
vorherbestimmte Einmütigkeit herrscht überall; es
ist dies der Dunstkreis des Bienenstaates, und jede
Biene scheint im voraus zu wissen, was die andern
denken werden. Trotzdem ist der Augenblick für
sie sehr ernst; es ist, genau genommen, der Augenblick,
wo es sich um Leben und Bestand des Stockes
handelt. Sie haben zwischen drei oder vier weittragenden
Möglichkeiten zu wählen, die in ihren
Folgen völlig verschieden sind und durch ein Nichts
verhängnisvoll werden können. Sie haben die eingeborene
Leidenschaft oder Pflicht der Vermehrung
der Art mit der Erhaltung des Bienenstockes und
seiner Sprösslinge in Einklang zu bringen. Bisweilen
greifen sie fehl und senden nach einander vier oder
fünf Schwärme aus, wodurch der Mutterstock übermässig
geschwächt wird. Sie sind dann nicht mehr
im stande, sich schnell genug zu vermehren, werden
durch unser Klima überrascht, welches nicht das
Klima ihres Ursprungslandes ist, das sie trotz allem
noch immer in Erinnerung behalten, und gehen mit
Einbruch des Winters zu Grunde. Sie werden so
das Opfer des sogenannten Schwarmfiebers, das,
wie das gewöhnliche Fieber, eine Art von zu heftiger
Reaktion des Lebens ist, die über das Ziel
hinausschiesst, den Kreis schliesst und mit dem
Tode endigt.
Ungefähr eine Woche ist seit
dem Scheiden der alten Königin verstrichen.
Die königlichen Nymphen,
die in ihren Kapseln schlummern,
sind nicht alle gleichalterig, denn die
Bienen haben ein Interesse daran,
dass die Königinnen nur nach einander auskommen,
je nachdem das Volk sich entscheidet, einen zweiten,
dritten oder vierten Schwarm dem ersten nachzusenden.
Seit einigen Stunden tragen sie die Wände
der reifsten Zelle allmählig ab, und bald streckt die
junge Königin, die von innen gleichzeitig an dem
geründeten Deckel nagt, den Kopf heraus, kommt
halb zum Vorschein und kriecht schliesslich mit
Hilfe der Wärterinnen, die herbeilaufen, sie bürsten,
reinigen und liebkosen, ganz aus, um ihre ersten
Gehversuche auf der Wabe zu machen. Sie ist
wie die auskriechenden Arbeitsbienen bleich und
schwankend, aber nach zehn Minuten steht sie schon
fest auf den Beinen und läuft voller Unruhe, in dem
Gefühl, dass sie nicht allein ist, dass sie ihr Reich
erobern muss, dass es irgendwo noch Prätendenten
giebt, über alle Wachsmauern hin und sucht nach
ihren Nebenbuhlerinnen. Hier greift nun die Weisheit,
der Instinkt, der Geist des Bienenstockes oder
die Masse der Arbeitsbienen mit einer geheimnisvollen
Entscheidung ein. Am überraschendsten ist
es, wenn man den Gang dieser Ereignisse in einem
Bienenstock mit Glaswänden mit den Augen verfolgen
kann. Denn man gewahrt nie das geringste
Zaudern, die geringste Uneinigkeit. Man findet nie
das geringste Zeichen von Zwist und Streit. Eine
vorherbestimmte Einmütigkeit herrscht überall; es
ist dies der Dunstkreis des Bienenstaates, und jede
Biene scheint im voraus zu wissen, was die andern
denken werden. Trotzdem ist der Augenblick für
sie sehr ernst; es ist, genau genommen, der Augenblick,
wo es sich um Leben und Bestand des Stockes
handelt. Sie haben zwischen drei oder vier weittragenden
Möglichkeiten zu wählen, die in ihren
Folgen völlig verschieden sind und durch ein Nichts
verhängnisvoll werden können. Sie haben die eingeborene
Leidenschaft oder Pflicht der Vermehrung
der Art mit der Erhaltung des Bienenstockes und
seiner Sprösslinge in Einklang zu bringen. Bisweilen
greifen sie fehl und senden nach einander vier oder
fünf Schwärme aus, wodurch der Mutterstock übermässig
geschwächt wird. Sie sind dann nicht mehr
im stande, sich schnell genug zu vermehren, werden
durch unser Klima überrascht, welches nicht das
Klima ihres Ursprungslandes ist, das sie trotz allem
noch immer in Erinnerung behalten, und gehen mit
Einbruch des Winters zu Grunde. Sie werden so
das Opfer des sogenannten Schwarmfiebers, das,
wie das gewöhnliche Fieber, eine Art von zu heftiger
Reaktion des Lebens ist, die über das Ziel
hinausschiesst, den Kreis schliesst und mit dem
Tode endigt.
 Von diesen Entschlüssen, die
sie fassen können, scheint keiner vorherbedingt
zu sein, und der Mensch
kann, wenn er blosser Zuschauer bleibt,
nicht voraussehen, welchen sie wählen
werden. Aber dass diese Wahl allemal
überlegt ist, das geht daraus hervor, dass er
sie beeinflussen und selbst herbeiführen kann, indem
er gewisse Umstände modifiziert, z. B. wenn
er den Raum, den er ihnen zur Verfügung stellt,
verkleinert oder vergrössert, indem er gefüllte Honigwaben
mit leeren Waben, die Arbeitsbienenzellen
enthalten, vertauscht und umgekehrt.
Von diesen Entschlüssen, die
sie fassen können, scheint keiner vorherbedingt
zu sein, und der Mensch
kann, wenn er blosser Zuschauer bleibt,
nicht voraussehen, welchen sie wählen
werden. Aber dass diese Wahl allemal
überlegt ist, das geht daraus hervor, dass er
sie beeinflussen und selbst herbeiführen kann, indem
er gewisse Umstände modifiziert, z. B. wenn
er den Raum, den er ihnen zur Verfügung stellt,
verkleinert oder vergrössert, indem er gefüllte Honigwaben
mit leeren Waben, die Arbeitsbienenzellen
enthalten, vertauscht und umgekehrt.
Es handelt sich also für sie nicht darum, ob sie sofort einen zweiten oder dritten Schwarm aussenden werden; dies wäre, könnte man sagen, nur eine blinde Entschliessung, die durch die Launen und Reizungen einer guten Stunde veranlasst wird; es handelt sich vielmehr darum, vom Fleck weg und in voller Übereinstimmung Maassregeln zu ergreifen, die es ihnen ermöglichen, drei bis vier Tage nach Geburt der ersten Königin einen neuen Schwarm, und drei Tage nach Aufbruch der jungen Königin mit diesem Schwarme einen dritten Schwarm auszusenden. Man kann nicht leugnen, dass hierin ein ganzes System, eine ganze Kombination von zukünftigen Dingen liegt, die sich, wenn man die Kürze ihres Lebens in Erwägung zieht, über einen beträchtlichen Zeitraum erstreckt.
 Diese Maassregeln nun betreffen
die Pflege der jungen Königinnen,
die noch in ihren Wachssärgen
schlafen. Ich will annehmen, der „Geist
des Bienenstockes“ entschliesst sich,
keinen zweiten Schwarm auszusenden.
Auch dann stehen noch zwei Wege offen. Sollen
sie der Erstgeborenen unter den jungen Prinzessinnen,
deren Geburt wir beiwohnten, gestatten, ihre
feindlichen Schwestern zu vernichten, oder sollen
sie abwarten, bis sie die gefährliche Zeremonie des
Hochzeitsausfluges vollzogen hat, von der die Zukunft
des Volkes abhängen kann? Zuweilen lassen
sie den unmittelbaren Mord zu, oft auch widersetzen
sie sich ihm, aber man sieht ein, dass es
schwer zu sagen ist, ob dies in Voraussicht der
Gefahren des Hochzeitsausfluges geschieht oder
weil ein zweiter Schwarm ausgesandt werden soll,
denn es ist oft beobachtet worden, dass sie sich
zur Aussendung eines zweiten Schwarmes entschlossen,
dann aber plötzlich ihren Willen geändert
und die ganze, vor der Wut der Erstgeborenen
beschirmte Nachkommenschaft vernichtet haben, sei
es, dass die Witterung zu ungünstig wurde, sei es
aus einem anderen, für uns undurchdringlichen
Grunde. Aber nehmen wir einmal an, sie hätten
auf das Schwärmen verzichtet und die Gefahren
des Hochzeitsausfluges angenommen. Wenn also
unsere junge Königin, von Eifersucht getrieben, sich
dem Gebiet der königlichen Wiegen naht, so macht
die Wache ihr Platz; sie stürzt sich in ihrer Eifersucht
wutentbrannt auf die erste Zelle, die sie trifft,
und sucht mit Füssen und Zähnen die Wachshülle
zu zerreissen. Sie erbricht die Zelle, zerreisst das
Gespinnst, mit dem die Innenwände bekleidet sind,
entblösst die schlafende Prinzessin, und wenn ihre
Nebenbuhlerin bereits erkenntlich ist, dreht sie sich
um, führt ihren Stachel in die Zelle ein und bohrt
ihn wild in den Leib der Gefangenen, bis diese den
Wunden der vergifteten Waffe erliegt. Dann beruhigt
sie sich; der Tod, der dem Hass aller Wesen
eine geheimnisvolle Schranke setzt, scheint sie zu
befriedigen, und sie zieht ihren Stachel heraus, um
sich einer anderen Zelle zuzuwenden. Sie öffnet
diese gleichfalls, lässt sie jedoch unversehrt, sobald
sie nur eine Larve oder unentwickelte Nymphe
darin findet, und hält erst dann inne, wenn sie,
röchelnd und erschöpft, mit ihren Zähnen an den
Wachsmauern kraftlos abgleitet.
Diese Maassregeln nun betreffen
die Pflege der jungen Königinnen,
die noch in ihren Wachssärgen
schlafen. Ich will annehmen, der „Geist
des Bienenstockes“ entschliesst sich,
keinen zweiten Schwarm auszusenden.
Auch dann stehen noch zwei Wege offen. Sollen
sie der Erstgeborenen unter den jungen Prinzessinnen,
deren Geburt wir beiwohnten, gestatten, ihre
feindlichen Schwestern zu vernichten, oder sollen
sie abwarten, bis sie die gefährliche Zeremonie des
Hochzeitsausfluges vollzogen hat, von der die Zukunft
des Volkes abhängen kann? Zuweilen lassen
sie den unmittelbaren Mord zu, oft auch widersetzen
sie sich ihm, aber man sieht ein, dass es
schwer zu sagen ist, ob dies in Voraussicht der
Gefahren des Hochzeitsausfluges geschieht oder
weil ein zweiter Schwarm ausgesandt werden soll,
denn es ist oft beobachtet worden, dass sie sich
zur Aussendung eines zweiten Schwarmes entschlossen,
dann aber plötzlich ihren Willen geändert
und die ganze, vor der Wut der Erstgeborenen
beschirmte Nachkommenschaft vernichtet haben, sei
es, dass die Witterung zu ungünstig wurde, sei es
aus einem anderen, für uns undurchdringlichen
Grunde. Aber nehmen wir einmal an, sie hätten
auf das Schwärmen verzichtet und die Gefahren
des Hochzeitsausfluges angenommen. Wenn also
unsere junge Königin, von Eifersucht getrieben, sich
dem Gebiet der königlichen Wiegen naht, so macht
die Wache ihr Platz; sie stürzt sich in ihrer Eifersucht
wutentbrannt auf die erste Zelle, die sie trifft,
und sucht mit Füssen und Zähnen die Wachshülle
zu zerreissen. Sie erbricht die Zelle, zerreisst das
Gespinnst, mit dem die Innenwände bekleidet sind,
entblösst die schlafende Prinzessin, und wenn ihre
Nebenbuhlerin bereits erkenntlich ist, dreht sie sich
um, führt ihren Stachel in die Zelle ein und bohrt
ihn wild in den Leib der Gefangenen, bis diese den
Wunden der vergifteten Waffe erliegt. Dann beruhigt
sie sich; der Tod, der dem Hass aller Wesen
eine geheimnisvolle Schranke setzt, scheint sie zu
befriedigen, und sie zieht ihren Stachel heraus, um
sich einer anderen Zelle zuzuwenden. Sie öffnet
diese gleichfalls, lässt sie jedoch unversehrt, sobald
sie nur eine Larve oder unentwickelte Nymphe
darin findet, und hält erst dann inne, wenn sie,
röchelnd und erschöpft, mit ihren Zähnen an den
Wachsmauern kraftlos abgleitet.
Die Bienen, die um sie sind, sehen ihrem Thun zu, ohne daran teilzunehmen, und weichen zurück, um ihr freies Feld zu lassen, aber sobald sie eine Zelle erbrochen und zerstört hat, eilen sie herbei, zerren den Leichnam, die noch lebendige Larve oder die verletzte Nymphe hervor und schaffen sie aus dem Stocke, um sich alsdann voller Gier über die königliche Nahrung zu stürzen, die auf dem Zellenboden zurückgeblieben ist. Wenn schliesslich die Wut ihrer erschöpften Königin nachlässt, vollenden sie selbst den Mord der Unschuldigen, und das Königsgeschlecht verschwindet mitsamt seinen Häusern.
Es ist dies neben der Drohnenschlacht, die übrigens noch entschuldbarer ist, die furchtbarste Stunde des Bienenstockes, die einzige, wo die Arbeitsbienen dem Tod und der Zwietracht Einlass in ihr Haus gewähren, und auch hier, wie so oft in der Natur, sind es die Bevorzugten der Liebe, welche die aussergewöhnlichen Anzeichen des gewaltsamen Todes tragen.
Bisweilen – doch der Fall ist selten, denn die Bienen wissen ihm vorzubeugen – kommen zwei Königinnen zugleich aus. Dann entspinnt sich gleich nach Verlassen der Wiege der tödliche Zweikampf, der Huber Gelegenheit zu einer eigentümlichen Entdeckung gab.
Jedesmal, wenn die beiden Jungfrauen in ihren Chitinpanzern einander so gegenüberstehen, dass sie sich, wenn sie ihren Stachel zücken, gegenseitig durchbohren würden, scheint, wie in den Kämpfen der Ilias, ein Gott oder eine Göttin – vielleicht der Gott oder die Göttin der Rasse – sich ins Mittel zu legen, und die beiden Kriegerinnen lassen von einander ab, wie in plötzlichem Schrecken, und fliehen sich gegenseitig voller Entsetzen, um alsbald wieder auf einander loszufahren, sich abermals zu fliehen, wenn das zwiefache Verhängnis die Zukunft ihres Volkes von neuem bedroht, und so fort, bis es einer von beiden gelingt, ihre Nebenbuhlerin bei einer unvorsichtigen oder ungeschickten Bewegung zu überlisten und gefahrlos zu töten.
Denn das Gesetz der Gattung heischt nur ein Opfer.

 Hat die junge Königin dergestalt
die königlichen Wiegen zerstört
oder ihre Nebenbuhlerinnen ermordet,
so wird sie von dem Volke anerkannt,
und es bleibt ihr, um wirklich zu regieren
und so behandelt zu werden,
wie ihre Mutter, nur noch eins übrig, nämlich den
Hochzeitsausflug zu vollziehen; denn die Bienen
kümmern sich wenig um sie und erweisen ihr wenig
Ehre, so lange sie unfruchtbar ist. Aber oft ist
ihre Geschichte nicht so einfach, und die Arbeitsbienen
verzichten selten auf das Vergnügen, noch
ein zweites Mal zu schwärmen.
Hat die junge Königin dergestalt
die königlichen Wiegen zerstört
oder ihre Nebenbuhlerinnen ermordet,
so wird sie von dem Volke anerkannt,
und es bleibt ihr, um wirklich zu regieren
und so behandelt zu werden,
wie ihre Mutter, nur noch eins übrig, nämlich den
Hochzeitsausflug zu vollziehen; denn die Bienen
kümmern sich wenig um sie und erweisen ihr wenig
Ehre, so lange sie unfruchtbar ist. Aber oft ist
ihre Geschichte nicht so einfach, und die Arbeitsbienen
verzichten selten auf das Vergnügen, noch
ein zweites Mal zu schwärmen.
In diesem wie in dem obigen Falle nähert sie sich, von demselben Verlangen getrieben, den Königinnenzellen, aber statt hier unterwürfige Dienerinnen und Zuspruch zu finden, prallt sie gegen eine zahlreiche, feindselige Wache, die ihr den Weg versperrt. Von ihrem fixen Gedanken getrieben, sucht sie zornig den Durchgang zu erzwingen oder zu umgehen, allein überall trifft sie auf Schildwachen, welche die schlummernden Prinzessinnen behüten. Hartnäckig versucht sie zum zweiten Male durchzubrechen, sie wird immer unwirscher zurückgewiesen und selbst misshandelt, und schliesslich begreift sie dunkel, dass die kleinen unbeugsamen Arbeitsbienen ein Gesetz vertreten, vor dem das ihre zurückstehen muss.
Zuletzt zieht sie sich zurück und tobt ihren ungestillten Zorn von Wabe zu Wabe aus, wobei sie jenes, dem Bienenzüchter so wohlbekannte, Kriegsgeschrei oder vielmehr jenen drohenden Klagegesang ertönen lässt, der wie ein ferner silberner Trompetenton klingt und doch so deutlich vernehmbar ist in seiner zornigen Schwäche, dass man ihn namentlich des Abends, durch die doppelten Wände des bestverschlossenen Stockes hindurch, auf drei oder vier Meter Entfernung hört.
Dieser königliche Zornruf ist von magischer Wirkung auf die Arbeitsbienen. Er versetzt sie in eine Art von Schrecken oder ehrfürchtiger Starre, und wenn die Königin ihn auf den verteidigten Zellen ausstösst, so halten die Wachen, die sie umringen und fortzuzerren suchen, plötzlich inne, neigen den Kopf und warten regungslos, bis er verklungen ist. Man nimmt übrigens an, dass der Totenkopfschmetterling (Acherontia atropos) diesen Ruf nachahmt und durch die bezaubernde Wirkung desselben in die Stöcke einzudringen und sich voll Honig zu saugen vermag, ohne dass die Bienen an eine Abwehr denken.
Zwei oder drei Tage, bisweilen auch fünf, irrt dies zornige Ächzen durch den Bienenstock und ruft die beschützten Prätendenten zum Kampfe heraus. Inzwischen haben diese sich völlig entwickelt, drängen zum Lichte empor und beginnen an ihren Zellendeckeln zu nagen. Eine grosse Gefahr scheint den Staat zu bedrohen. Aber der Geist des Bienenstockes hat, als er seine Entschliessung traf, alle ihre Folgen vorausgesehen, und die wohl unterrichteten Schildwachen wissen Stunde für Stunde, was sie zu thun haben, um Überraschungen von Seiten eines entgegengesetzten Instinktes zuvorzukommen und die beiden feindlichen Gewalten zum Besten zu führen. Es ist ihnen also wohl bewusst, dass die jungen Königinnen, die es in ihrem Kerker nicht mehr duldet, wenn sie wirklich auskämen, in die Hand ihrer bereits unbesieglichen älteren Schwester fallen und eine nach der anderen den Tod erleiden würden. Sobald also eine der lebendig Eingemauerten die Thore ihres Turmes von innen zu öffnen sucht, bauen sie von aussen eine neue Lage von Wachs vor, und die ungeduldige Gefangene arbeitet hartnäckig an ihrer Befreiung, ohne zu ahnen, dass sie eine Zauberwand durchnagt, die immer wieder nachwächst. Sie vernimmt dabei die Herausforderung ihrer Nebenbuhlerin, und da sie ihre Bestimmung und ihre königliche Pflicht kennt, noch ehe sie einen Blick ins Leben hat thun können, ehe sie weiss, wie ein Bienenstock aussieht, so antwortet sie aus der Tiefe ihres Kerkers. Da aber ihr Ruf durch die Wände eines Grabes dringen muss, so klingt er ganz anders, erstickt, hohl, und wenn der Bienenzüchter gegen Abend, wenn aller Tageslärm sich legt und das Schweigen der Sterne heraufzieht, am Eingang seiner Wunderstädte horcht, so vernimmt und versteht er das Zwiegespräch der umherirrenden Jungfrau mit den noch eingekerkerten.
 Diese verlängerte Haft ist
den jungen Prinzessinnen übrigens
höchst heilsam. Wenn sie auskriechen,
sind sie reifer und kräftiger, und schon
zum Ausfliegen bereit. Andererseits
hat das Warten auch die freie Königin
gestärkt, so dass sie jetzt im stande ist, den
Gefahren des Schwärmens zu trotzen. Der zweite
oder Nachschwarm verlässt alsdann die Wohnung,
an der Spitze die erstgeborene Königin. Unmittelbar
nach ihrem Aufbruch lassen die im Stocke zurückgebliebenen
Arbeitsbienen eine der Gefangenen
frei, und diese zeigt alsbald dieselbe Mordlust,
stösst denselben Zornesruf aus und verlässt drei
Tage später an der Spitze des dritten Schwarmes
ebenfalls den Stock u. s. w., im Falle des „Schwarmfiebers“,
bis zur völligen Erschöpfung des Mutterstockes.
– Der alte holländische Naturforscher
Swammerdam erwähnt einen Bienenstock, der durch
seine Schwärme und die Schwärme dieser Schwärme
in einem Jahre dreissig Kolonien gründete.
Diese verlängerte Haft ist
den jungen Prinzessinnen übrigens
höchst heilsam. Wenn sie auskriechen,
sind sie reifer und kräftiger, und schon
zum Ausfliegen bereit. Andererseits
hat das Warten auch die freie Königin
gestärkt, so dass sie jetzt im stande ist, den
Gefahren des Schwärmens zu trotzen. Der zweite
oder Nachschwarm verlässt alsdann die Wohnung,
an der Spitze die erstgeborene Königin. Unmittelbar
nach ihrem Aufbruch lassen die im Stocke zurückgebliebenen
Arbeitsbienen eine der Gefangenen
frei, und diese zeigt alsbald dieselbe Mordlust,
stösst denselben Zornesruf aus und verlässt drei
Tage später an der Spitze des dritten Schwarmes
ebenfalls den Stock u. s. w., im Falle des „Schwarmfiebers“,
bis zur völligen Erschöpfung des Mutterstockes.
– Der alte holländische Naturforscher
Swammerdam erwähnt einen Bienenstock, der durch
seine Schwärme und die Schwärme dieser Schwärme
in einem Jahre dreissig Kolonien gründete.
Diese ausserordentliche Vervielfältigung lässt sich namentlich nach strengen Wintern beobachten, wie wenn die stets mit dem geheimen Willen der Natur vertrauten Bienen sich der ihrer Gattung drohenden Gefahren bewusst wären. Aber bei normaler Witterung und bei starken, richtig behandelten Völkern bricht das Schwarmfieber selten aus. Viele schwärmen nur einmal, manche überhaupt nicht.
Gewöhnlich verzichten die Bienen schon nach Absendung des zweiten Schwarmes auf eine weitere Volksteilung, sei es, dass sie eine übermässige Schwächung des Mutterstockes befürchten, sei es, dass die Ungunst des Wetters ihnen Besonnenheit auferlegt. Sie gestatten dann der dritten Königin, den Rest der Gefangenen zu morden, und das regelmässige Leben tritt wieder ein. Der Eifer, mit dem die Arbeit wieder aufgenommen wird, ist dabei um so grösser, als fast alle Arbeitsbienen noch sehr jung sind und ihr Stock verarmt und entvölkert ist, so dass grosse Lücken noch vor Einbruch des Winters ausgefüllt werden müssen.
 Die Vorgänge beim Ausfliegen
des zweiten und dritten Schwarmes
sind genau dieselben wie beim ersten,
nur sind diese Schwärme weniger
volkreich und vorsichtig, denn sie
senden keine Spürbienen aus, und die
junge, jungfräuliche Königin mit ihrem unbeschwerten
Körper fliegt in ihrem Eifer viel weiter und
reisst den Schwarm nach dem ersten Anlegen zu
einer grossen Entfernung vom Mutterstocke fort.
Es kommt hinzu, dass diese zweite und dritte Auswanderung
viel tollkühner und das Schicksal dieser
Schwärme recht ungewiss ist. Sie haben als Vertreterin
der Zukunft nur eine ungeschwängerte Königin
bei sich, und ihr ganzes Geschick hängt von
dem bevorstehenden Hochzeitsausfluge ab. Ein
vorüberfliegender Vogel, einige Regentropfen, ein
kalter Wind, ein Irrtum genügen, um das unabwendbare
Verhängnis heraufzubeschwören. Die
Bienen sind sich dessen so wohl bewusst, dass sie
trotz ihrer schon festen Anhänglichkeit an ihre erst
seit einem Tage bezogene Wohnung, und trotzdem
die Arbeit schon begonnen hat, oft alles im Stiche
lassen und ihre junge Herrin auf der Suche nach
ihrem Geliebten begleiten, um sie ja nicht aus den
Augen zu verlieren, sie mit tausend treuen Flügeln
zu bedecken und zu schirmen, oder mit ihr unterzugehen,
wenn die Liebe sie so weit von dem
Stocke fortreisst, dass der noch ungewohnte Rückweg
in ihrem Gedächtnis schwankt und sich verwirrt.
Die Vorgänge beim Ausfliegen
des zweiten und dritten Schwarmes
sind genau dieselben wie beim ersten,
nur sind diese Schwärme weniger
volkreich und vorsichtig, denn sie
senden keine Spürbienen aus, und die
junge, jungfräuliche Königin mit ihrem unbeschwerten
Körper fliegt in ihrem Eifer viel weiter und
reisst den Schwarm nach dem ersten Anlegen zu
einer grossen Entfernung vom Mutterstocke fort.
Es kommt hinzu, dass diese zweite und dritte Auswanderung
viel tollkühner und das Schicksal dieser
Schwärme recht ungewiss ist. Sie haben als Vertreterin
der Zukunft nur eine ungeschwängerte Königin
bei sich, und ihr ganzes Geschick hängt von
dem bevorstehenden Hochzeitsausfluge ab. Ein
vorüberfliegender Vogel, einige Regentropfen, ein
kalter Wind, ein Irrtum genügen, um das unabwendbare
Verhängnis heraufzubeschwören. Die
Bienen sind sich dessen so wohl bewusst, dass sie
trotz ihrer schon festen Anhänglichkeit an ihre erst
seit einem Tage bezogene Wohnung, und trotzdem
die Arbeit schon begonnen hat, oft alles im Stiche
lassen und ihre junge Herrin auf der Suche nach
ihrem Geliebten begleiten, um sie ja nicht aus den
Augen zu verlieren, sie mit tausend treuen Flügeln
zu bedecken und zu schirmen, oder mit ihr unterzugehen,
wenn die Liebe sie so weit von dem
Stocke fortreisst, dass der noch ungewohnte Rückweg
in ihrem Gedächtnis schwankt und sich verwirrt.
 Aber das Gesetz der Zukunft
ist so mächtig, dass keine Biene angesichts
dieser Unsicherheit und dieser
Gefahren zaudert. Die Begeisterung
des zweiten und dritten Schwarmes
kommt der des ersten gleich. Sobald
der Mutterstock seine Entscheidung gefällt hat, findet
jede der gefährlichen jungen Königinnen eine
Schaar von Arbeitsbienen, die ihr Glück mit ihr
versuchen wollen und sie auf ihrer Reise begleiten,
auf der viel zu verlieren und nichts zu gewinnen
ist, als die Hoffnung auf Befriedigung eines Triebes.
Wer giebt ihnen diese Energie, die wir nie haben,
mit der Vergangenheit zu brechen, wie mit einem
Feinde? Wer wählt aus der Menge die aus, welche
aufbrechen sollen, und die, welche bleiben? Es ist
nicht die und die Altersklasse, die geht oder bleibt:
hierher die Jüngsten, dorthin die Ältesten. Um
jede der auf Nimmerwiedersehen aufbrechenden Königinnen
scharen sich ganz alte und ebenso ganz
junge Bienen, die sich zum ersten Mal dem schwindeltiefen
Luftraum anvertrauen. Ebensowenig ist
es der Zufall, die Gelegenheit, das vorübergehende
Aufflackern oder Verblassen eines Gedankens, Instinktes
oder Gefühls, was das Stärkeverhältnis des
Schwarmes bestimmt. Ich habe mich oft bemüht,
das Zahlenverhältnis zwischen den bleibenden und
scheidenden Bienen festzustellen, und ich habe, wiewohl
die Schwierigkeiten des Experimentes nicht zu
mathematisch genauen Resultaten führten, doch feststellen
können, dass dieses Verhältnis, – die Stärke
des Brutnestes, d. h. der bevorstehenden Geburten,
eingerechnet, – konstant genug ist, um eine wirkliche
geheimnisvolle Berechnung durch den Geist
des Bienenstockes anzunehmen.
Aber das Gesetz der Zukunft
ist so mächtig, dass keine Biene angesichts
dieser Unsicherheit und dieser
Gefahren zaudert. Die Begeisterung
des zweiten und dritten Schwarmes
kommt der des ersten gleich. Sobald
der Mutterstock seine Entscheidung gefällt hat, findet
jede der gefährlichen jungen Königinnen eine
Schaar von Arbeitsbienen, die ihr Glück mit ihr
versuchen wollen und sie auf ihrer Reise begleiten,
auf der viel zu verlieren und nichts zu gewinnen
ist, als die Hoffnung auf Befriedigung eines Triebes.
Wer giebt ihnen diese Energie, die wir nie haben,
mit der Vergangenheit zu brechen, wie mit einem
Feinde? Wer wählt aus der Menge die aus, welche
aufbrechen sollen, und die, welche bleiben? Es ist
nicht die und die Altersklasse, die geht oder bleibt:
hierher die Jüngsten, dorthin die Ältesten. Um
jede der auf Nimmerwiedersehen aufbrechenden Königinnen
scharen sich ganz alte und ebenso ganz
junge Bienen, die sich zum ersten Mal dem schwindeltiefen
Luftraum anvertrauen. Ebensowenig ist
es der Zufall, die Gelegenheit, das vorübergehende
Aufflackern oder Verblassen eines Gedankens, Instinktes
oder Gefühls, was das Stärkeverhältnis des
Schwarmes bestimmt. Ich habe mich oft bemüht,
das Zahlenverhältnis zwischen den bleibenden und
scheidenden Bienen festzustellen, und ich habe, wiewohl
die Schwierigkeiten des Experimentes nicht zu
mathematisch genauen Resultaten führten, doch feststellen
können, dass dieses Verhältnis, – die Stärke
des Brutnestes, d. h. der bevorstehenden Geburten,
eingerechnet, – konstant genug ist, um eine wirkliche
geheimnisvolle Berechnung durch den Geist
des Bienenstockes anzunehmen.
 Wir wollen den Abenteuern
dieser Schwärme nicht folgen. Sie
sind zahlreich und oft verwickelt.
Bisweilen vermischen sich zwei
Schwärme, manchmal kommt es auch
vor, dass zwei oder drei der gefangenen
Königinnen in der Aufregung des Aufbruches ihren
Wachen entrinnen und der sich bildenden Traube
anschliessen. Bisweilen benutzt auch eine der jungen
Königinnen, wenn sie von Drohnen umringt wird,
die Gelegenheit des Schwärmens, um sich befruchten
zu lassen, und reisst dann ihr Volk zu einer ausserordentlichen
Höhe und Entfernung mit fort. In der
Praxis der Bienenzucht führt man diese zweiten
und dritten Schwärme dem Mutterstocke wieder
zu. Die Königinnen treffen im Baue wieder auf
einander, die Arbeitsbienen bilden einen Kreis um
ihren Kampfplatz, und wenn die Tüchtigere gesiegt
hat, so entfernen sie in ihrer Ordnungsliebe und
Emsigkeit alsbald die Leichen aus dem Stock, beugen
künftigen Gewaltthätigkeiten vor, vergessen das Vergangene,
klettern wieder in die Zellen hinauf und
fliegen von neuem auf friedlichen Pfaden zu den
ihrer harrenden Blumen.
Wir wollen den Abenteuern
dieser Schwärme nicht folgen. Sie
sind zahlreich und oft verwickelt.
Bisweilen vermischen sich zwei
Schwärme, manchmal kommt es auch
vor, dass zwei oder drei der gefangenen
Königinnen in der Aufregung des Aufbruches ihren
Wachen entrinnen und der sich bildenden Traube
anschliessen. Bisweilen benutzt auch eine der jungen
Königinnen, wenn sie von Drohnen umringt wird,
die Gelegenheit des Schwärmens, um sich befruchten
zu lassen, und reisst dann ihr Volk zu einer ausserordentlichen
Höhe und Entfernung mit fort. In der
Praxis der Bienenzucht führt man diese zweiten
und dritten Schwärme dem Mutterstocke wieder
zu. Die Königinnen treffen im Baue wieder auf
einander, die Arbeitsbienen bilden einen Kreis um
ihren Kampfplatz, und wenn die Tüchtigere gesiegt
hat, so entfernen sie in ihrer Ordnungsliebe und
Emsigkeit alsbald die Leichen aus dem Stock, beugen
künftigen Gewaltthätigkeiten vor, vergessen das Vergangene,
klettern wieder in die Zellen hinauf und
fliegen von neuem auf friedlichen Pfaden zu den
ihrer harrenden Blumen.

 Zur Vereinfachung unserer
Darstellung wollen wir die Geschichte
der jungen Königin da wieder aufnehmen,
wo die Bienen ihr erlauben,
ihre Schwestern in ihren Wiegen zu
ermorden. Wie ich schon sagte, dulden
sie diesen Mord oft nicht, auch wenn sie nicht
die Absicht zu hegen scheinen, einen zweiten
Schwarm auszusenden. Oft aber lassen sie ihn
auch zu, denn der politische Sinn der einzelnen
Bienenstöcke desselben Bienenstandes ist eben so
verschieden, wie der der Nationen desselben Erdteils.
Aber es steht fest, dass sie eine Thorheit
begehen, wenn sie ihn zulassen, denn wenn die
Königin bei ihrem Hochzeitsausfluge umkommt oder
sich verirrt, so ist niemand da, der sie ersetzen
könnte, und die Arbeitsbienenlarven sind zu alt geworden,
um in Königinnenlarven verwandelt werden
zu können. Doch die Thorheit ist nun einmal geschehen,
und die erstgeborene unter den jungen
Königinnen ist von ihrem Volke als alleinige Herrin
anerkannt worden. Sie ist aber noch Jungfrau.
Um ihrer Mutter, an deren Stelle sie getreten ist,
in allen Stücken zu gleichen, muss sie in den ersten
zwanzig Tagen nach ihrer Geburt den Gatten finden.
Geschieht dies aus irgend einem Grunde später, so
bleibt sie unwiderruflich Jungfrau. Nichtsdestoweniger
ist sie, wie ich schon gesagt habe, auch
als solche nicht unfruchtbar. Es handelt sich hier
um jenes grosse Mysterium, jene Vorsicht oder
Laune der Natur, die man Parthenogenesis nennt
und die sich bei einer Reihe von Insekten findet,
z. B. bei den Blattläusen, den Schmetterlingen der
Gattung Psyche, den Hautflüglern aus der Familie
der Gallwespen (Cynipidae) u. s. w. Die jungfräuliche
Königin vermag also Eier zu legen, als ob sie
befruchtet wäre, aber aus allen diesen Eiern, mögen
sie in grosse oder kleine Zellen gelegt werden, entstehen
nur Drohnen, und da diese nie arbeiten,
sondern stets auf Kosten der (weiblichen) Arbeitsbienen
leben, ja, nicht einmal ihre eigne Nahrung
suchen noch für ihren Unterhalt sorgen können, so
tritt wenige Wochen nach dem Tode der letzten
erschöpften Arbeitsbienen der völlige Ruin und Untergang
des Stockes ein. Die Jungfrau gebiert also
nur tausende von Drohnen und jede dieser Drohnen
oder männlichen Bienen besitzt Millionen von Samenfäden,
von denen doch kein einziger in ihren Organismus
eindringen kann. Das ist nicht erstaunlicher,
wenn man will, als tausend analoge Erscheinungen,
denn wenn man sich mit dergleichen
Problemen beschäftigt, insbesondere mit denen der
Zeugung, so scheint das Wunderbare und Unerwartete
gar kein Ende mehr zu nehmen, und alles
macht einen noch viel fabelhafteren Eindruck, als
in den seltsamsten Märchen und Zaubergeschichten;
man gerät auch bald in ein so beständiges Staunen,
dass man ziemlich schnell das Gefühl der Verwunderung
verliert. Aber die Thatsache ist darum nicht
minder verwunderlich. Wie soll man sich andererseits
die Absicht der Natur erklären, wenn sie die
verderblichen Drohnen auf Kosten der nötigen und
nützlichen Arbeitsbienen derart begünstigt? Fürchtet
sie, der weibliche Verstand würde danach trachten,
die Zahl dieser Schmarotzer über Gebühr zu beschränken?
Oder ist es eine übermässige Reaktion
gegen das Unglück einer unfruchtbaren Königin?
Ist es einer jener Fälle von zu gewaltsamer, blinder
Vorsicht, welche den Grund des Übels nicht erkennt,
über das Ziel hinausschiesst und, um einem
schlimmen Zufall vorzubeugen, eine Katastrophe
herbeiführt? In der Wirklichkeit – doch vergessen
wir nicht, dass diese Wirklichkeit nicht ganz die
natürliche, primitive Wirklichkeit ist, denn im Urwalde
könnten die einzelnen Kolonien weit mehr
zerstreut werden, als heutzutage, – in der Wirklichkeit
liegt, wenn eine Königin nicht geschwängert
wird, die Schuld meist nicht an den Drohnen, die
immer zahlreich sind und von sehr weit herbeikommen,
sondern an Regen oder Kälte, durch die
sie zu lange an den Stock gefesselt wurde, oder
wohl gar an ihren unvollkommenen Flügeln, die es
ihr unmöglich machen, den Drohnen auf ihrem
hohen Fluge zu folgen. Trotzdem kümmert sich
die Natur nicht im mindesten um diese tieferen
Ursachen und hat nur das eine leidenschaftliche
Streben, möglichst viel Drohnen hervorzubringen.
Sie durchkreuzt noch andere Gesetze, um dies Ziel
zu erreichen, und man kann in weisellosen Stöcken oft
zwei oder drei Arbeitsbienen von einem solchen Verlangen
nach Erhaltung der Art ergriffen sehen, dass sie
sich trotz ihrer verkümmerten Eierstöcke zum Eierlegen
zwingen. In der That schwellen diese Organe
unter dem Drucke eines verzweifelten Willens auf und
ergeben einige Eier, aber aus ihnen, wie aus denen der
ungeschwängerten Königin, entstehen nur Drohnen.
Zur Vereinfachung unserer
Darstellung wollen wir die Geschichte
der jungen Königin da wieder aufnehmen,
wo die Bienen ihr erlauben,
ihre Schwestern in ihren Wiegen zu
ermorden. Wie ich schon sagte, dulden
sie diesen Mord oft nicht, auch wenn sie nicht
die Absicht zu hegen scheinen, einen zweiten
Schwarm auszusenden. Oft aber lassen sie ihn
auch zu, denn der politische Sinn der einzelnen
Bienenstöcke desselben Bienenstandes ist eben so
verschieden, wie der der Nationen desselben Erdteils.
Aber es steht fest, dass sie eine Thorheit
begehen, wenn sie ihn zulassen, denn wenn die
Königin bei ihrem Hochzeitsausfluge umkommt oder
sich verirrt, so ist niemand da, der sie ersetzen
könnte, und die Arbeitsbienenlarven sind zu alt geworden,
um in Königinnenlarven verwandelt werden
zu können. Doch die Thorheit ist nun einmal geschehen,
und die erstgeborene unter den jungen
Königinnen ist von ihrem Volke als alleinige Herrin
anerkannt worden. Sie ist aber noch Jungfrau.
Um ihrer Mutter, an deren Stelle sie getreten ist,
in allen Stücken zu gleichen, muss sie in den ersten
zwanzig Tagen nach ihrer Geburt den Gatten finden.
Geschieht dies aus irgend einem Grunde später, so
bleibt sie unwiderruflich Jungfrau. Nichtsdestoweniger
ist sie, wie ich schon gesagt habe, auch
als solche nicht unfruchtbar. Es handelt sich hier
um jenes grosse Mysterium, jene Vorsicht oder
Laune der Natur, die man Parthenogenesis nennt
und die sich bei einer Reihe von Insekten findet,
z. B. bei den Blattläusen, den Schmetterlingen der
Gattung Psyche, den Hautflüglern aus der Familie
der Gallwespen (Cynipidae) u. s. w. Die jungfräuliche
Königin vermag also Eier zu legen, als ob sie
befruchtet wäre, aber aus allen diesen Eiern, mögen
sie in grosse oder kleine Zellen gelegt werden, entstehen
nur Drohnen, und da diese nie arbeiten,
sondern stets auf Kosten der (weiblichen) Arbeitsbienen
leben, ja, nicht einmal ihre eigne Nahrung
suchen noch für ihren Unterhalt sorgen können, so
tritt wenige Wochen nach dem Tode der letzten
erschöpften Arbeitsbienen der völlige Ruin und Untergang
des Stockes ein. Die Jungfrau gebiert also
nur tausende von Drohnen und jede dieser Drohnen
oder männlichen Bienen besitzt Millionen von Samenfäden,
von denen doch kein einziger in ihren Organismus
eindringen kann. Das ist nicht erstaunlicher,
wenn man will, als tausend analoge Erscheinungen,
denn wenn man sich mit dergleichen
Problemen beschäftigt, insbesondere mit denen der
Zeugung, so scheint das Wunderbare und Unerwartete
gar kein Ende mehr zu nehmen, und alles
macht einen noch viel fabelhafteren Eindruck, als
in den seltsamsten Märchen und Zaubergeschichten;
man gerät auch bald in ein so beständiges Staunen,
dass man ziemlich schnell das Gefühl der Verwunderung
verliert. Aber die Thatsache ist darum nicht
minder verwunderlich. Wie soll man sich andererseits
die Absicht der Natur erklären, wenn sie die
verderblichen Drohnen auf Kosten der nötigen und
nützlichen Arbeitsbienen derart begünstigt? Fürchtet
sie, der weibliche Verstand würde danach trachten,
die Zahl dieser Schmarotzer über Gebühr zu beschränken?
Oder ist es eine übermässige Reaktion
gegen das Unglück einer unfruchtbaren Königin?
Ist es einer jener Fälle von zu gewaltsamer, blinder
Vorsicht, welche den Grund des Übels nicht erkennt,
über das Ziel hinausschiesst und, um einem
schlimmen Zufall vorzubeugen, eine Katastrophe
herbeiführt? In der Wirklichkeit – doch vergessen
wir nicht, dass diese Wirklichkeit nicht ganz die
natürliche, primitive Wirklichkeit ist, denn im Urwalde
könnten die einzelnen Kolonien weit mehr
zerstreut werden, als heutzutage, – in der Wirklichkeit
liegt, wenn eine Königin nicht geschwängert
wird, die Schuld meist nicht an den Drohnen, die
immer zahlreich sind und von sehr weit herbeikommen,
sondern an Regen oder Kälte, durch die
sie zu lange an den Stock gefesselt wurde, oder
wohl gar an ihren unvollkommenen Flügeln, die es
ihr unmöglich machen, den Drohnen auf ihrem
hohen Fluge zu folgen. Trotzdem kümmert sich
die Natur nicht im mindesten um diese tieferen
Ursachen und hat nur das eine leidenschaftliche
Streben, möglichst viel Drohnen hervorzubringen.
Sie durchkreuzt noch andere Gesetze, um dies Ziel
zu erreichen, und man kann in weisellosen Stöcken oft
zwei oder drei Arbeitsbienen von einem solchen Verlangen
nach Erhaltung der Art ergriffen sehen, dass sie
sich trotz ihrer verkümmerten Eierstöcke zum Eierlegen
zwingen. In der That schwellen diese Organe
unter dem Drucke eines verzweifelten Willens auf und
ergeben einige Eier, aber aus ihnen, wie aus denen der
ungeschwängerten Königin, entstehen nur Drohnen.
 Man kann hier einen überlegenen,
aber vielleicht unüberlegten
Willen, der den bewussten Willen
einer Lebensform unrettbar kreuzt,
gewissermaassen auf frischer That
und mitten in seinem Eingreifen beobachten.
Derartige Eingriffe sind in der Insektenwelt
nicht selten. Es ist sehr eigenartig, sie hier
zu beobachten; diese Welt ist bevölkerter und vielfältiger
als die andern, gewisse Absichten der Natur
treten deutlicher hervor und man überrascht sie
hier bei Versuchen, die man für unabgeschlossen
halten könnte. Sie hat z. B. ein grosses allgemeines
Bestreben, das sie überall offenbart: die Verbesserung
der Art durch den Sieg des Stärksten.
Gewöhnlich bewegt sich der Kampf in ganz bestimmten
Bahnen. Die Hekatombe der Schwachen
ist ungeheuer, doch was verficht das, wenn dem
Sieger nur ein wirksamer und gewisser Lohn zu
teil wird? Aber es giebt Fälle, wo man sagen
möchte, sie habe noch keine Zeit gehabt, ihre Kombinationen
ins klare zu bringen, wo der Lohn nicht
erfolgt, oder das Schicksal des Siegers ebenso verhängnisvoll
ist, wie das der Besiegten. Um z. B.
bei unseren Bienen zu bleiben, so wüsste ich nichts,
was in dieser Hinsicht auffälliger wäre, als die Geschichte
der Triangulinen der Gattung Sitaris colletis.
Übrigens ist dabei zu bemerken, dass verschiedene
Einzelheiten dieser Geschichte der des Menschen
durchaus nicht so fern stehen, wie man versucht
sein könnte, zu glauben.
Man kann hier einen überlegenen,
aber vielleicht unüberlegten
Willen, der den bewussten Willen
einer Lebensform unrettbar kreuzt,
gewissermaassen auf frischer That
und mitten in seinem Eingreifen beobachten.
Derartige Eingriffe sind in der Insektenwelt
nicht selten. Es ist sehr eigenartig, sie hier
zu beobachten; diese Welt ist bevölkerter und vielfältiger
als die andern, gewisse Absichten der Natur
treten deutlicher hervor und man überrascht sie
hier bei Versuchen, die man für unabgeschlossen
halten könnte. Sie hat z. B. ein grosses allgemeines
Bestreben, das sie überall offenbart: die Verbesserung
der Art durch den Sieg des Stärksten.
Gewöhnlich bewegt sich der Kampf in ganz bestimmten
Bahnen. Die Hekatombe der Schwachen
ist ungeheuer, doch was verficht das, wenn dem
Sieger nur ein wirksamer und gewisser Lohn zu
teil wird? Aber es giebt Fälle, wo man sagen
möchte, sie habe noch keine Zeit gehabt, ihre Kombinationen
ins klare zu bringen, wo der Lohn nicht
erfolgt, oder das Schicksal des Siegers ebenso verhängnisvoll
ist, wie das der Besiegten. Um z. B.
bei unseren Bienen zu bleiben, so wüsste ich nichts,
was in dieser Hinsicht auffälliger wäre, als die Geschichte
der Triangulinen der Gattung Sitaris colletis.
Übrigens ist dabei zu bemerken, dass verschiedene
Einzelheiten dieser Geschichte der des Menschen
durchaus nicht so fern stehen, wie man versucht
sein könnte, zu glauben.
Diese Triangulinen sind die Schmarotzer oder richtiger gesagt, die Läuse einer einsam bauenden wilden Biene (Colletes), die ihr Nest in Erdhöhlen hat. Sie lauern der Biene am Eingange ihrer Wohnung auf, hängen sich zu dritt, zu viert oder fünft, oft noch mehr, an sie und setzen sich auf ihrem Rücken fest. Wenn in diesem Augenblick der Kampf der Starken gegen die Schwachen stattfände, so wäre kein Wort weiter zu verlieren und alles würde nach dem allgemeinen Gesetze verlaufen. Aber ihr Instinkt gebietet ihnen, man weiss nicht warum – und folglich gebietet auch die Natur, – dass sie sich ruhig verhalten, solange sie auf dem Rücken der Biene sitzen. Während diese die Blumen befliegt, Zellen baut und mit Vorräten füllt, halten sie sich still und harren ihrer Stunde. Aber sobald sie ein Ei gelegt hat, schlüpfen alle darauf, und die harmlose Biene verschliesst die Zelle, die sie fürsorglich mit Vorrat versehen hat, ohne zu ahnen, dass sie den Tod ihrer Brut mit einschliesst. Sobald die Zelle verkapselt ist, bricht unter den Sitarislarven der unvermeidliche und heilsame Auslesekampf um das einzige Ei aus. Die Stärkste und Geschickteste ergreift ihre Nebenbuhlerin trotz ihres Panzers, hebt sie über ihren Kopf empor und hält sie derart Stunden lang in ihren Klauen, bis dieselbe tot ist. Aber während dieses Kampfes hat eine andere Sitarislarve, die allein geblieben oder ihres Gegners schon Herr geworden ist, sich auf das Ei gestürzt und es angebissen. Die, welche zuletzt gesiegt hat, muss jetzt also mit diesem neuen Feinde fertig werden, was ihr auch nicht schwer fällt, denn die Trianguline, die einen eingeborenen Heisshunger zu stillen hat, klammert sich so hartnäckig an ihr Ei an, dass sie gar nicht an Verteidigung denkt. Endlich ist sie auch getötet und die andere befindet sich im Alleinbesitze des kostbaren und so wohlfeil errungenen Eies. Gierig steckt sie den Kopf in die von ihrer Vorgängerin geschaffene Öffnung und macht sich an die lange Mahlzeit, die sie in ein vollkommenes Insekt verwandeln soll. Aber die Natur, die diese Kampfprobe will, hat den Siegespreis mit einem so kleinlichen Geize festgesetzt, dass ein Ei gerade ausreicht, um eine einzige Trianguline zu ernähren, „so dass“, sagt Mayet, dem wir den Bericht dieses erstaunlichen Missgeschickes danken, „unsere Siegerin um die Nahrung zu kurz kommt, die ihr letzter Feind vor seinem Tode verzehrt hat, und somit die erste Häutung nicht stattfinden kann. Sie stirbt also gleichfalls und bleibt an der Haut des Eies hängen oder vermehrt in dem flüssigen Zuckersafte die Zahl der Ertrunkenen.“
 Dieser Fall liegt zwar selten
so klar, steht aber in der Naturgeschichte
nicht vereinzelt da. Doch
der Kampf zwischen dem bewussten
Willen der Trianguline, die leben will,
und dem dunkeln, allgemeinen Willen
der Natur, die ebenfalls will, dass sie lebt und zugleich
will, dass sie ihr Leben so verbessert und
kräftigt, wie es ihr aus freien Stücken nie einfallen
würde, ist hier einmal blossgelegt. Nur führt durch
eine seltsame Unachtsamkeit der Natur die erzwungene
Verbesserung gerade den Tod der Besten
herbei, und die Sitaris colletis wären längst ausgestorben,
wenn nicht einzelne von ihnen durch Zufall,
und ganz gegen die Absicht der Natur, allein
blieben und so dem trefflichen und weitblickenden
Gesetze, welches den Sieg des Stärksten fordert,
auf diese Weise entrännen.
Dieser Fall liegt zwar selten
so klar, steht aber in der Naturgeschichte
nicht vereinzelt da. Doch
der Kampf zwischen dem bewussten
Willen der Trianguline, die leben will,
und dem dunkeln, allgemeinen Willen
der Natur, die ebenfalls will, dass sie lebt und zugleich
will, dass sie ihr Leben so verbessert und
kräftigt, wie es ihr aus freien Stücken nie einfallen
würde, ist hier einmal blossgelegt. Nur führt durch
eine seltsame Unachtsamkeit der Natur die erzwungene
Verbesserung gerade den Tod der Besten
herbei, und die Sitaris colletis wären längst ausgestorben,
wenn nicht einzelne von ihnen durch Zufall,
und ganz gegen die Absicht der Natur, allein
blieben und so dem trefflichen und weitblickenden
Gesetze, welches den Sieg des Stärksten fordert,
auf diese Weise entrännen.
Es kommt also vor, dass die grosse Gewalt, die uns unbewusst erscheint, aber notwendigerweise vernünftig ist, denn das Leben, das sie hervorruft und erhält, giebt ihr jederzeit Recht, – es kommt also vor, sage ich, dass sie Fehlgriffe thut. Ihre höhere Vernunft, die wir anrufen, wenn wir mit der unseren am Ende sind, hat also Mängel. Und wenn dem so ist, wer wird sie wieder gut machen?
Aber kommen wir auf ihr gebieterisches Eingreifen in der Form der Parthenogenesis zurück. Und vergessen wir nicht, dass diese Probleme einer anderen Welt, die uns sehr fern zu liegen scheint, uns sehr nahe berühren. Wer wollte leugnen, dass ähnliche, noch geheimere, aber nicht minder gefährliche Eingriffe in die Sphäre des Menschen jederzeit stattfinden? Und wer hat in dem vorliegenden Falle recht, wenn man alles in allem nimmt, die Natur oder die Bienen? Was würde geschehen, wenn diese gelehriger oder intelligenter wären, wenn sie die Absicht der Natur nur zu gut verstünden und bis zur äussersten Konsequenz anwendeten, indem sie immerfort nur Drohnen hervorbrächten, wie sie gebietet? Würden sie nicht Gefahr laufen, ihre Gattung zu vernichten? Muss man glauben, dass es Absichten der Natur giebt, die zu begreifen gefährlich und denen allzueifrig zu folgen verhängnisvoll ist, und dass eine ihrer Absichten die ist, nicht alle ihre Absichten zu verstehen und zu befolgen? Und steht es nicht ebenso mit den Gefahren des Menschen? Auch wir fühlen unbewusste Kräfte in uns schlummern, die gerade das Gegenteil von dem wollen, was unser Verstand fordert. Ist es gut, dass unser Verstand, der sich gewöhnlich um sich selbst dreht und dann nicht mehr weiss, wohin, diesen Kräften Recht giebt und sein unerhofftes Gewicht dem ihren hinzufügt?
 Haben wir das Recht, aus
der Gefahr der Parthenogenesis zu
schliessen, dass die Natur Mittel und
Zweck nicht immer in Einklang zu
bringen vermag, dass das, was sie
zu erhalten wähnt, sich oft nur infolge
von Vorsichtsmaassregeln erhält, die sie just gegen
ihre Vorsichtsmaassregeln ergriffen hat, und oft gar
durch fremde Umstände, die sie keineswegs vorausgesehen
hat? Aber sieht sie überhaupt voraus,
sucht sie etwas zu erhalten? Die Natur, wird
man sagen, ist ein Wort, mit dem wir das Unerkennbare
belegen, und es ist wenig Grund vorhanden,
ihr ein Ziel oder Vernunft zuzutrauen. Allerdings
handelt es sich hier um die hermetisch
verschlossenen Gefässe, die den Hausrat unserer
Weltanschauung bilden. Um nicht ewig die Aufschrift
„Unbekannt“ darauf zu setzen, denn sie entmutigt
und zwingt zum Schweigen, gebrauchen
wir, je nach Form und Grösse, die Worte „Natur“,
„Leben“, „Tod“, „Unendlichkeit“, „Auslese“, „Genius
der Art“ u. v. a., wie die, welche vor uns
lebten, die Namen „Gott“, „Vorsehung“, „Bestimmung“,
„Lohn“ u. s. w. darauf anbrachten. Das
ist es, wenn man will, und weiter nichts. Aber
wenn der Inhalt auch verborgen bleibt, so haben
wir doch das eine gewonnen, dass die Aufschriften
weniger bedrohlich geworden sind, und dass wir
den Gefässen näher treten, sie berühren und in
heilsamer Wissbegierde das Ohr daran legen können.
Haben wir das Recht, aus
der Gefahr der Parthenogenesis zu
schliessen, dass die Natur Mittel und
Zweck nicht immer in Einklang zu
bringen vermag, dass das, was sie
zu erhalten wähnt, sich oft nur infolge
von Vorsichtsmaassregeln erhält, die sie just gegen
ihre Vorsichtsmaassregeln ergriffen hat, und oft gar
durch fremde Umstände, die sie keineswegs vorausgesehen
hat? Aber sieht sie überhaupt voraus,
sucht sie etwas zu erhalten? Die Natur, wird
man sagen, ist ein Wort, mit dem wir das Unerkennbare
belegen, und es ist wenig Grund vorhanden,
ihr ein Ziel oder Vernunft zuzutrauen. Allerdings
handelt es sich hier um die hermetisch
verschlossenen Gefässe, die den Hausrat unserer
Weltanschauung bilden. Um nicht ewig die Aufschrift
„Unbekannt“ darauf zu setzen, denn sie entmutigt
und zwingt zum Schweigen, gebrauchen
wir, je nach Form und Grösse, die Worte „Natur“,
„Leben“, „Tod“, „Unendlichkeit“, „Auslese“, „Genius
der Art“ u. v. a., wie die, welche vor uns
lebten, die Namen „Gott“, „Vorsehung“, „Bestimmung“,
„Lohn“ u. s. w. darauf anbrachten. Das
ist es, wenn man will, und weiter nichts. Aber
wenn der Inhalt auch verborgen bleibt, so haben
wir doch das eine gewonnen, dass die Aufschriften
weniger bedrohlich geworden sind, und dass wir
den Gefässen näher treten, sie berühren und in
heilsamer Wissbegierde das Ohr daran legen können.
Aber welchen Namen man ihnen auch giebt, so viel steht fest, dass zum mindesten eines dieser Gefässe, das grösste von ihnen, das auf seiner Ründung den Namen „Natur“ trägt, eine sehr reale Kraft birgt, vielleicht die realste von allen, und jedenfalls weiss sie auf unserem Erdballe eine ungeheure und wunderbare Quantität und Qualität von Leben mit so sinnreichen Mitteln zu erhalten, dass man ohne Übertreibung sagen kann, sie übertrifft alles, was Menschengeist zu ersinnen im stande wäre. Und diese Qualität und Quantität sollten sich plötzlich durch andere Mittel erhalten? Oder täuschen wir uns da, indem wir Vorsichtsmaassregeln zu erblicken wähnen, wo es sich vielleicht nur um einen vom Glück begünstigten Zufall handelt, der eine Million minder glücklicher Zufälle überlebt?
 Mag sein, aber diese glücklichen
Zufälle geben uns alsdann eine
nicht geringere Lehre der Bewunderung,
als die, welche wir von
Dingen, die über dem Zufall stehen,
empfangen. Wir brauchen gar nicht
bei den Wesen stehen zu bleiben, die einen Schimmer
von Intelligenz und Bewusstsein besitzen und
gegen die blinden Gesetze anringen können, wir
brauchen nicht einmal die ersten zweifelhaften Repräsentanten
der untersten Stufen des Tierreiches,
die Protozoën, ins Auge zu fassen. Die Experimente
des berühmten Mikroskopikers M. H. J. Carter
zeigen in der That, dass Wille, Absichten und
Unterscheidungsvermögen schon bei Embryos von
der Winzigkeit der Myxomyceten zu finden sind,
dass Bewegungen, die eine List voraussetzen, sich
schon bei Infusorien ohne jeden sichtbaren Organismus
zeigen, z. B. bei der Amoebe, die den jungen
Acineten an der Mündung der mütterlichen Eierstöcke
auflauert, weil sie weiss, dass sie dann noch
keine giftigen Fühlhörner haben. Dabei besitzt die
Amoebe weder Nervensystem noch irgendwelche
beobachtungsfähigen Organe. Gehen wir direkt zum
Pflanzenreich über; die Pflanzen scheinen keine
eigene Bewegung zu haben und allen äusseren
Einflüssen ausgesetzt zu sein. Halten wir uns auch
nicht bei den fleischfressenden Pflanzen auf, bei den
Drosera z. B., die ganz wie Tiere auf Reize reagieren,
sondern sehen und staunen wir, welches
Genie manche unserer einfachsten Pflanzen entwickeln,
um die kreuzweise Befruchtung, die sie
nötig haben, durch eine die Blüte befliegende Biene
sicher herbeizuführen. Betrachten wir das wunderbar
komplizierte Spiel des Rostellum und der Pollinarien
mit ihrem klebrigen Stielende und ihrer
mathematisch-automatischen Vorwärtsneigung bei
Orchis morio, der schlichten Orchidee unserer Himmelsstriche.[10]
Verfolgen wir das doppelte, unfehlbare
Schaukelspiel der Salbei-Antheren, die den
Körper des die Blume besuchenden Insektes an dem
und dem Punkte berühren, damit es die Narbe einer
Nachbarblume genau an derselben Stelle berührt
und befruchtet. Folgen wir ferner dem allmählichen
Aufklinken und der Berechnung, welche die Narbe
von Pedicularis silvatica zeigt; beobachten wir die
Organe dieser drei Blumen, wie sie beim Hineinkriechen
der Biene nach Art jener komplizierten
Mechaniken funktionieren, die man in den Schiessbuden
unserer Jahrmärkte hat, und die sofort in
Bewegung treten, wenn ein guter Schütze ins
Schwarze getroffen hat.
Mag sein, aber diese glücklichen
Zufälle geben uns alsdann eine
nicht geringere Lehre der Bewunderung,
als die, welche wir von
Dingen, die über dem Zufall stehen,
empfangen. Wir brauchen gar nicht
bei den Wesen stehen zu bleiben, die einen Schimmer
von Intelligenz und Bewusstsein besitzen und
gegen die blinden Gesetze anringen können, wir
brauchen nicht einmal die ersten zweifelhaften Repräsentanten
der untersten Stufen des Tierreiches,
die Protozoën, ins Auge zu fassen. Die Experimente
des berühmten Mikroskopikers M. H. J. Carter
zeigen in der That, dass Wille, Absichten und
Unterscheidungsvermögen schon bei Embryos von
der Winzigkeit der Myxomyceten zu finden sind,
dass Bewegungen, die eine List voraussetzen, sich
schon bei Infusorien ohne jeden sichtbaren Organismus
zeigen, z. B. bei der Amoebe, die den jungen
Acineten an der Mündung der mütterlichen Eierstöcke
auflauert, weil sie weiss, dass sie dann noch
keine giftigen Fühlhörner haben. Dabei besitzt die
Amoebe weder Nervensystem noch irgendwelche
beobachtungsfähigen Organe. Gehen wir direkt zum
Pflanzenreich über; die Pflanzen scheinen keine
eigene Bewegung zu haben und allen äusseren
Einflüssen ausgesetzt zu sein. Halten wir uns auch
nicht bei den fleischfressenden Pflanzen auf, bei den
Drosera z. B., die ganz wie Tiere auf Reize reagieren,
sondern sehen und staunen wir, welches
Genie manche unserer einfachsten Pflanzen entwickeln,
um die kreuzweise Befruchtung, die sie
nötig haben, durch eine die Blüte befliegende Biene
sicher herbeizuführen. Betrachten wir das wunderbar
komplizierte Spiel des Rostellum und der Pollinarien
mit ihrem klebrigen Stielende und ihrer
mathematisch-automatischen Vorwärtsneigung bei
Orchis morio, der schlichten Orchidee unserer Himmelsstriche.[10]
Verfolgen wir das doppelte, unfehlbare
Schaukelspiel der Salbei-Antheren, die den
Körper des die Blume besuchenden Insektes an dem
und dem Punkte berühren, damit es die Narbe einer
Nachbarblume genau an derselben Stelle berührt
und befruchtet. Folgen wir ferner dem allmählichen
Aufklinken und der Berechnung, welche die Narbe
von Pedicularis silvatica zeigt; beobachten wir die
Organe dieser drei Blumen, wie sie beim Hineinkriechen
der Biene nach Art jener komplizierten
Mechaniken funktionieren, die man in den Schiessbuden
unserer Jahrmärkte hat, und die sofort in
Bewegung treten, wenn ein guter Schütze ins
Schwarze getroffen hat.
Wir könnten noch tiefer heruntergehen und, wie Ruskin in seinen „Ethics of the Dust“, den Charakter, die Gewohnheiten und Listen der Krystalle, ihre Kämpfe und Maassnahmen, wenn ein Fremdkörper ihre Absichten stört (die älter sind, als alles, was unsere Phantasie begreift), die Art und Weise, wie sie einen Feind annehmen oder abstossen, den möglichen Sieg des Schwächsten über den Stärksten u. s. w. beobachten. Z. B. giebt das allmächtige Quarz dem unscheinbaren, heimtückischen Epidot in zuvorkommendster Weise nach und lässt sich von ihm übertrumpfen, während das Bergkrystall mit dem Eisen einen bald furchtbaren, bald prachtvollen Ringkampf führt. Mancher durchsichtige Krystall hat ein regelmässiges, tadelloses Wachstum, eine ungetrübte Reinheit, denn er stösst von vorn herein alles Unreine ab, während sein Bruder neben ihm ein krankhaftes Wachstum, eine augenscheinliche Immoralität zeigt, da er alles Unreine annimmt und sich kläglich im Leeren windet. Endlich wäre auf die seltsame Erscheinung der krystallinischen Vernarbung und Reïntegration zu verweisen, die Claude Bernard studiert hat, aber dies Mysterium ist zu seltsam. Halten wir uns an unsere Blumen, als an die letzten Glieder eines Lebens, das zu dem unseren noch Beziehungen hat. Es handelt sich hier nicht mehr um Tiere oder Insekten, bei denen wir einen vernünftigen, eigenen Willen annehmen können, infolgedessen sie sich erhalten. Ihnen schreiben wir, mit Recht oder Unrecht, keinen solchen Willen zu. Jedenfalls können wir bei ihnen nicht die geringste Spur jener Organe entdecken, in denen Wille, Vernunft und Initiative zu einer Handlung ihren Sitz oder Ursprung haben. Folglich stammt das, was in ihnen solche Wunder wirkt, unmittelbar aus der Quelle, die wir sonst „die Natur“ zu nennen pflegen. Es ist nicht mehr die Intelligenz des Einzelwesens, sondern die unbewusste, ungeteilte Kraft, welche anderen Gebilden Fallen stellt. Sollen wir daraus folgern, dass diese Fallen keine reinen Zufälle sind, die durch zufällige Wiederkehr zur Regel geworden sind? Dazu haben wir noch kein Recht. Man kann sagen, dass diese Blumen ohne solche wunderbaren Vorrichtungen sich nicht erhalten hätten. Andere, die der kreuzweisen Befruchtung nicht bedurften, wären an ihre Stelle getreten, und niemand hätte das Nichtvorhandensein der Ersteren bemerkt, auch wäre das Leben uns darum nicht minder unbegreiflich, vielfältig und erstaunlich erschienen.

 Und doch kann man sich
schwerlich der Auffassung verschliessen,
dass die Vorgänge, welche die
glücklichen Zufälle herbeiführen und
immer wieder herbeiführen, Akte der
Klugheit und Intelligenz sind. Aber
welches ist ihre Quelle, die Wesen selbst, oder die
Kraft, aus der diese ihr Leben schöpfen? Ich sage
nicht: „Was liegt daran?“ Im Gegenteil; es läge
uns sehr viel daran, dies zu wissen. Einstweilen
aber, bis wir erfahren, ob es die Blume ist, die danach
trachtet, das von der Natur in sie gelegte
Leben zu unterhalten und zu vervollkommnen, oder
die Natur, die alles versucht, um das Stück Dasein,
das die Blume darstellt, zu erhalten und zu veredeln,
oder endlich der Zufall, der zuletzt den Zufall
regelt, – lädt eine Menge von Erscheinungen
zu der Annahme ein, dass etwas Ähnliches wie
unsere höchsten Gedanken bisweilen aus einem
gemeinsamen Muttergrunde hervorgeht, den wir
bewundern müssen, ohne sagen zu können, wo er
sich befindet.
Und doch kann man sich
schwerlich der Auffassung verschliessen,
dass die Vorgänge, welche die
glücklichen Zufälle herbeiführen und
immer wieder herbeiführen, Akte der
Klugheit und Intelligenz sind. Aber
welches ist ihre Quelle, die Wesen selbst, oder die
Kraft, aus der diese ihr Leben schöpfen? Ich sage
nicht: „Was liegt daran?“ Im Gegenteil; es läge
uns sehr viel daran, dies zu wissen. Einstweilen
aber, bis wir erfahren, ob es die Blume ist, die danach
trachtet, das von der Natur in sie gelegte
Leben zu unterhalten und zu vervollkommnen, oder
die Natur, die alles versucht, um das Stück Dasein,
das die Blume darstellt, zu erhalten und zu veredeln,
oder endlich der Zufall, der zuletzt den Zufall
regelt, – lädt eine Menge von Erscheinungen
zu der Annahme ein, dass etwas Ähnliches wie
unsere höchsten Gedanken bisweilen aus einem
gemeinsamen Muttergrunde hervorgeht, den wir
bewundern müssen, ohne sagen zu können, wo er
sich befindet.
Bisweilen scheint uns ein Irrtum aus diesem gemeinsamen Grunde hervorzugehen. Aber obwohl wir sehr wenig wissen, so haben wir doch oft Gelegenheit einzusehen, dass der „Irrtum“ ein Akt der Klugheit war, der nur über den Horizont unserer ersten Einfalt hinausging. Selbst in unserem kleinen Gesichtskreise können wir erkennen, dass die Natur, wenn sie sich hier täuscht, es für nützlich hält, ihre angebliche Unachtsamkeit dort wieder gut zu machen. Sie hat die drei Blumen, von denen wir reden, in eine so schwierige Lage gebracht, dass sie sich nicht selbst befruchten können, aber sie hält es für vorteilhaft, warum, wissen wir nicht, dass diese drei Blumen sich durch ihre Nachbarinnen befruchten lassen, und das Genie, das sie zu unserer Rechten vergessen hat, bekundet sie zur Linken, indem sie die Intelligenz ihrer Stiefkinder mehrt. Die Umwege, die sie macht, scheinen uns unerklärlich, aber ihr Genius bleibt stets auf der gleichen Höhe. Sie scheint in einen Irrtum herabzusinken, vorausgesetzt, dass ein Irrtum hier möglich ist, und sie erhebt sich unmittelbar darauf in dem Organ, das diesen Irrtum wieder gut zu machen hat. Wohin wir uns wenden, sie überragt uns überall. Sie ist der Kreisstrom Okeanos, der die Erde umfliesst, die ungeheure Wasserfläche ohne Ebbe, auf der unsere verwegensten und unabhängigsten Gedanken immer nur eine untergeordnete Schaumblase bilden. Wir nennen sie heute „die Natur“, und morgen haben wir vielleicht einen anderen Namen gefunden, der sanfter oder schrecklicher klingt. Inzwischen herrscht sie zu gleicher Zeit und in gleichem Geiste über Leben und Tod und liefert den beiden unversöhnlichen Schwestern die prunkhaften oder vertrauten Waffen, die ihren Busen völlig verändern und schmücken.
 Ob sie Maassregeln ergreift,
um das, was sich auf ihrer Oberfläche
regt, zu erhalten, oder ob man den
seltsamsten der Kreise schliessen
muss, indem man sagt, dass das, was
sich auf dieser Oberfläche regt, selbst
Maassregeln gegen den Genius ergreift, der es beseelt:
das sind Fragen besonderer Art. Es ist für
uns nicht möglich zu wissen, ob eine Gattung trotz
der Fürsorge des höheren Willens, unabhängig von
ihm, oder schliesslich allein durch ihn sich erhalten
hat. Alles, was wir feststellen können, ist, dass
die und die Art sich erhält, und folglich hat die
Natur in diesem Punkte recht. Aber wer kann
uns sagen, wie viele andere, die wir nicht kennen,
ihrer Achtlosigkeit oder Ungeduld zum Opfer gefallen
sind? Alles, was wir noch feststellen können,
sind die überraschenden und bisweilen bedrohlichen
Formen, die, bald in absoluter Unbewusstheit, bald
in einer Art von Bewusstheit, das ausserordentliche
Fluidum annimmt, das Leben heisst, und das uns
und alles übrige beseelt und unsere Gedanken hervorbringt,
die es beurteilen, und unsere Stimme,
die davon zu reden versucht.
Ob sie Maassregeln ergreift,
um das, was sich auf ihrer Oberfläche
regt, zu erhalten, oder ob man den
seltsamsten der Kreise schliessen
muss, indem man sagt, dass das, was
sich auf dieser Oberfläche regt, selbst
Maassregeln gegen den Genius ergreift, der es beseelt:
das sind Fragen besonderer Art. Es ist für
uns nicht möglich zu wissen, ob eine Gattung trotz
der Fürsorge des höheren Willens, unabhängig von
ihm, oder schliesslich allein durch ihn sich erhalten
hat. Alles, was wir feststellen können, ist, dass
die und die Art sich erhält, und folglich hat die
Natur in diesem Punkte recht. Aber wer kann
uns sagen, wie viele andere, die wir nicht kennen,
ihrer Achtlosigkeit oder Ungeduld zum Opfer gefallen
sind? Alles, was wir noch feststellen können,
sind die überraschenden und bisweilen bedrohlichen
Formen, die, bald in absoluter Unbewusstheit, bald
in einer Art von Bewusstheit, das ausserordentliche
Fluidum annimmt, das Leben heisst, und das uns
und alles übrige beseelt und unsere Gedanken hervorbringt,
die es beurteilen, und unsere Stimme,
die davon zu reden versucht.

 Sehen wir indessen zu, auf
welche Weise sich die Befruchtung
der Bienenkönigin
vollzieht. Auch hier hat
die Natur ausserordentliche
Maassregeln ergriffen, um die Vereinigung der
beiden Geschlechter aus verschiedenen Stöcken zu
begünstigen, ein seltsames Gesetz, zu dem sie durch
nichts gezwungen wird, eine Laune vielleicht oder
Unachtsamkeit, deren Wiederausgleichung die wundervollsten
Kräfte ihrer Wirksamkeit verschlingt. Es
ist höchst wahrscheinlich, dass, wenn sie zur Erhaltung
des Lebens, zur Milderung des Leidens,
zur Herbeiführung eines sanfteren Todes, zur Fernhaltung
der schrecklichsten Zufälle halb so viel
Geist aufgewandt hätte, als sie für die kreuzweise
Befruchtung und einige andere willkürliche Einfälle
vergeudet, das Rätsel des Daseins uns minder unbegreiflich
und erbarmungswürdig erschienen wäre,
als so, wie es sich jetzt unserer Wissbegier darstellt.
Doch wir dürfen unser Bewusstsein und
den Anteil, den wir am Dasein nehmen, nicht aus
dem schöpfen, was vielleicht hätte sein können,
sondern aus dem, was ist.
Sehen wir indessen zu, auf
welche Weise sich die Befruchtung
der Bienenkönigin
vollzieht. Auch hier hat
die Natur ausserordentliche
Maassregeln ergriffen, um die Vereinigung der
beiden Geschlechter aus verschiedenen Stöcken zu
begünstigen, ein seltsames Gesetz, zu dem sie durch
nichts gezwungen wird, eine Laune vielleicht oder
Unachtsamkeit, deren Wiederausgleichung die wundervollsten
Kräfte ihrer Wirksamkeit verschlingt. Es
ist höchst wahrscheinlich, dass, wenn sie zur Erhaltung
des Lebens, zur Milderung des Leidens,
zur Herbeiführung eines sanfteren Todes, zur Fernhaltung
der schrecklichsten Zufälle halb so viel
Geist aufgewandt hätte, als sie für die kreuzweise
Befruchtung und einige andere willkürliche Einfälle
vergeudet, das Rätsel des Daseins uns minder unbegreiflich
und erbarmungswürdig erschienen wäre,
als so, wie es sich jetzt unserer Wissbegier darstellt.
Doch wir dürfen unser Bewusstsein und
den Anteil, den wir am Dasein nehmen, nicht aus
dem schöpfen, was vielleicht hätte sein können,
sondern aus dem, was ist.
Die jungfräuliche Königin lebt in der kribbelnden Enge des Bienenstockes mit einigen hundert sie umschwärmenden Drohnen oder männlichen Bienen, die voller Übermut in stetem Honigrausche leben und keinen anderen Daseinsgrund haben, als die Vollziehung eines Aktes der Liebe. Aber trotz der ewigen Berührung der beiden Geschlechter, die überall wo anders alle Widerstände überwinden, findet die Begattung niemals im Bienenstock statt, und es ist noch nie gelungen, eine eingesperrte Königin zu schwängern.[11] Die sie umringenden Drohnen kennen sie nicht, so lange sie in ihrer Mitte weilt. Sie fliegen aus und suchen sie im Luftraum, in den verborgensten Winkeln des Horizontes, ohne zu ahnen, dass sie sie eben verlassen haben, dass sie mit ihr auf derselben Wabe schliefen und sie bei ihrem ungestümen Aufbruche vielleicht angerannt haben. Man möchte sagen, ihre prachtvollen Augen, die ihren ganzen Kopf mit einem blinkenden Helme bedecken, erkennen sie und verlangen nur dann nach ihr, wenn sie im blauen Äther schwebt. Jeden Tag von Mittag bis um drei Uhr, wenn die Sonne am höchsten steht, fliegt ihre federgeschmückte Horde zur Eroberung der Gattin aus, die königlicher und unvergleichlicher ist, als die unerreichbarste Märchenprinzessin, denn zwanzig oder dreissig Stämme sind von allen Stöcken der Nachbarschaft herbeigeströmt und umschwärmen sie: ein Gefolge von mehr als zehntausend Freiern, von denen ein einziger zu einer einzigen minutenlangen Umarmung auserkoren wird, die ihn dem Glücke, aber auch dem Tode vermählt, während alle anderen das engverschlungene Paar als unnütze Begleitung umschwirren und bald darauf umkommen werden, ohne das schicksalsvolle Zauberbild wiedergesehen zu haben.
 Diese erstaunliche, unsinnige
Verschwendung der Natur ist keineswegs
übertrieben. In den volkreichsten
Stöcken zählt man gewöhnlich
vier- bis fünfhundert Drohnen. In
entarteten oder schwächeren Stöcken
findet man deren oft vier- oder fünftausend, denn
je mehr ein Bienenvolk dem Verfall entgegenneigt,
desto mehr Drohnen bringt es hervor. Man kann
sagen, dass ein Bienenstand von zehn Kolonien im
Durchschnitt ein Volk von zehntausend Drohnen
in die Luft schickt, von denen höchstens zehn bis
fünfzehn Gelegenheit haben werden, den einzigen
Akt, zu dem sie da sind, zu vollziehen.
Diese erstaunliche, unsinnige
Verschwendung der Natur ist keineswegs
übertrieben. In den volkreichsten
Stöcken zählt man gewöhnlich
vier- bis fünfhundert Drohnen. In
entarteten oder schwächeren Stöcken
findet man deren oft vier- oder fünftausend, denn
je mehr ein Bienenvolk dem Verfall entgegenneigt,
desto mehr Drohnen bringt es hervor. Man kann
sagen, dass ein Bienenstand von zehn Kolonien im
Durchschnitt ein Volk von zehntausend Drohnen
in die Luft schickt, von denen höchstens zehn bis
fünfzehn Gelegenheit haben werden, den einzigen
Akt, zu dem sie da sind, zu vollziehen.
Derweilen erschöpfen sie die Vorräte des Volkes, und die unermüdliche Arbeit von fünf bis sechs Arbeitsbienen reicht kaum hin, um einen dieser anspruchsvollen und gefrässigen Schmarotzer, die nur mit dem Munde fleissig sind, zu erhalten. Aber die Natur ist stets verschwenderisch, wo es sich um die Funktionen und Privilegien der Liebe handelt. Sie knausert nur bei den Organen und Werkzeugen der Arbeit. Sie ist parteiisch und hart gegen alles, was die Menschen Tugend nennen. Dagegen spart sie die Diamanten und Gunstbeweise nicht, die sie auf den Weg der gleichgiltigsten Liebenden ausstreut. Sie ruft überall: „Vereinigt und vermehrt Euch, es giebt kein anderes Gesetz und Ziel als die Liebe“, – um dann halblaut hinzuzufügen: „und erhaltet Euch nachher, wenn Ihr es vermögt, das geht mich nichts weiter an.“ Umsonst, etwas anderes zu thun, etwas anderes zu wollen, man findet überall dieselbe Moral, die der unseren so zuwiderläuft. Man beobachte nur an denselben kleinen Wesen ihren ungerechten Geiz und ihre sinnlose Verschwendung. Die pflichttreue Arbeitsbiene muss von der Wiege bis zum Grabe hinaus in die dichtesten Wälder, muss tausend versteckte Blüten befliegen, muss im Labyrinth der Honigbehälter, in den verborgenen Schächten der Staubgefässe Honig und Pollen entdecken. Trotzdem sind ihre Augen und Geruchsorgane im Vergleich zu denen der Drohnen verkümmert. Diese könnten fast blind und ohne Geruchssinn sein, ohne darunter zu leiden, kaum ohne sich dessen bewusst zu sein. Sie haben nichts zu thun, keine Beute zu verfolgen, ihre Nahrung wird ihnen fertig zugetragen, und ihr Dasein ist ein ununterbrochenes Honigfest. Aber sie sind die Vollstrecker der Liebe, und die ungeheuersten und unnützesten Geschenke werden mit vollen Händen in den Abgrund der Zukunft geworfen. Einer von tausend unter ihnen wird einmal in seinem Leben das Bild der königlichen Jungfrau im Azurblau erblicken. Einer von tausend wird im Luftraum einen Augenblick der Spur des Weibes folgen, das nicht flieht. Das genügt. Die parteiische Macht hat ihre unerhörten Schätze bis zum Übermaass und Wahnsinn aufgethan. Jedem dieser unwahrscheinlichen Liebhaber, von denen 999 einige Tage nach der Todeshochzeit des tausendsten geschlachtet werden, hat sie 13000 Augen auf jeder Kopfseite gegeben, während die Arbeitsbiene nur 6000 hat. Jeden ihrer Fühler hat sie, nach den Berechnungen von Cheshire, mit 37800 Geruchshöhlen versehen, gegen 5000, welche die Arbeitsbiene auf beiden Seiten hat. Wer den Charakter der Natur schildern wollte, so wie er sich aus derartigen Zügen ergiebt, der müsste eine ganz ungewöhnliche, unserem Ideal ganz unähnliche Gestalt entwerfen, obschon dieses Ideal doch auch von ihr stammen muss. Aber der Mensch weiss zu wenig, um ein solches Bild zu malen, er könnte nur einen grossen Schatten hinzeichnen und zwei oder drei ungewisse Lichter daraufsetzen.
 Ich glaube, es sind sehr Wenige,
die das Hochzeitsgeheimnis der
Bienenkönigin belauscht haben, denn
diese Hochzeit vollzieht sich in dem
unendlichen, blendenden Brautbett des
Sommerhimmels. Aber man kann den
Aufbruch der Braut und die todkündende Rückkehr
der Gattin unter Umständen beobachten.
Ich glaube, es sind sehr Wenige,
die das Hochzeitsgeheimnis der
Bienenkönigin belauscht haben, denn
diese Hochzeit vollzieht sich in dem
unendlichen, blendenden Brautbett des
Sommerhimmels. Aber man kann den
Aufbruch der Braut und die todkündende Rückkehr
der Gattin unter Umständen beobachten.
Trotz ihrer Ungeduld wartet sie im Schatten ihrer Thore Tag und Stunde ab, bis ein wundervoller Morgen sich aus der Tiefe der azurenen Himmelsurne in den hochzeitlichen Raum ergiesst. Sie liebt den Augenblick, wo noch ein Rest von Thau auf Blatt und Blüten schimmert, wo die letzte Frische der sinkenden Morgenröte noch gegen die Glut des Tages anringt, wie eine Jungfrau in den Armen eines Kriegsmannes, und die krystallenen Laute des Morgens in dem Schweigen des nahenden Mittags noch nicht ganz verhallt sind.
Dann erscheint sie auf der Schwelle, unbeachtet von den Arbeitsbienen, die ihren Geschäften obliegen, oder auch von ihren bethörten Töchtern umringt, je nachdem sie Schwestern im Stocke zurücklässt oder nicht mehr ersetzt werden kann. Sie fliegt zuerst rückwärts, lässt sich zwei bis dreimal auf das Flugbrett nieder, und erst, wenn sie Lage und Anblick ihres Königreiches, das sie noch nie von aussen gesehen hat, genau in ihren Geist aufgenommen hat, fliegt sie in gerader Linie scheitelwärts ins Blaue, und erreicht so Höhen und eine Lichtzone, zu denen die anderen Bienen sich nie in ihrem Leben aufschwingen. Die Drohnen drunten, die sich träge auf den Blumen wiegen, haben die Erscheinung gesehen und den magnetischen Duft eingesogen, der sich alsbald bis zu den nachbarlichen Bienenstöcken verbreitet. Sofort sammeln sich die Horden und tauchen, ihrer Fährte folgend, in das Meer der Heiterkeit, dessen krystallene Grenzen sich immer weiter verschieben. Freudetrunken über den Gebrauch ihrer Flügel und dem herrlichen Gesetze der Art getreu, das ihr den Liebsten zuführt und nur den stärksten allein in ihre ätherferne Einsamkeit hinaufdringen lässt, steigt sie immerfort, und die blaue Morgenluft strömt zum ersten Male in ihre Luftgefässe und braust wie ein himmlisches Blut in den tausend strahlenförmigen Luftröhren ihrer beiden Lungen, welche die Hälfte ihres Körpers einnehmen und sich vom weiten Raume nähren. Sie steigt immerfort, bis sie eine öde Zone erreicht, wo kein Vogel ihr Mysterium mehr stört. Sie steigt immerfort, und schon zerteilt und vermindert sich der ungleiche Schwarm unter ihr. Die Schwachen und Kranken, die Greise und Missratenen, die schlecht Ernährten der kraftlosen und heruntergekommenen Völker stehen von ihrer Verfolgung ab und verschwinden im Leeren. Nur eine kleine Schaar von Unermüdlichen schwebt noch im unendlichen Raume. Noch eine letzte Anspannung der Flügel, und der Auserwählte der unbegreiflichen Mächte hat sie eingeholt, umarmt und durchdrungen, und von doppeltem Schwunge beflügelt, kreist das eng verschlungene Paar einen Augenblick im tötlichen Delirium der Liebe.
 Die Mehrzahl der Wesen hat
das dunkle Gefühl, dass Tod und Liebe
nur durch eine durchsichtige Haut
von einander getrennt sind. Sie meinen,
die Natur wolle streng genommen,
dass man in dem Augenblick,
wo man neues Leben hervorruft, das seine lässt.
Wahrscheinlich ist es diese angeerbte Furcht, die
der Liebe solche Bedeutung verleiht. Hier wenigstens
offenbart sich diese Absicht der Natur in
ihrer primitiven Einfachheit, die ihren Schatten noch
auf den Kuss zweier Menschen wirft. Sobald die
Vereinigung stattgefunden hat, platzt der Leib der
Drohne auf, das Werkzeug der Zeugung löst sich
ab und zieht die ganzen Eingeweide nach; die
Flügel erschlaffen, und der entleerte Körper stürzt,
vom hochzeitlichen Blitze getroffen, kreiselnd in den
Abgrund. Dieselbe Absicht, die in der Parthenogenesis
die Zukunft des Bienenstockes durch die ungewöhnliche
Vermehrung der Drohnen aufs Spiel
stellte, opfert hier die Drohnen der Zukunft des
Bienenstockes. Sie setzt immer in Erstaunen, diese
Absicht; je mehr man in sie einzudringen sucht,
desto ungewisser wird sie, und Darwin, um einen
Forscher zu nennen, der sie von allen Menschen
am leidenschaftlichsten und methodischsten studiert
hat, Darwin verliert auf Schritt und Tritt
die Fassung und weicht vor dem Unerwarteten und
Unvereinbaren zurück. Man sehe nur zu – wenn
anders man dem erhebend demütigenden Schauspiel
des menschlichen Geistes im Ringen mit dem
Unendlichen zusehen will – man sehe nur zu, wie
er die seltsamen, unglaublich geheimnisvollen und
zusammenhangslosen Gesetze der Unfruchtbarkeit
und Fruchtbarkeit der Bastarde, oder die der Variabilität
der Art- und Gattungscharaktere zu entwirren
sucht. Kaum hat er ein Prinzip formuliert, so
drängen sich schon zahllose Ausnahmen auf, und
bald ist das bedrängte Prinzip froh, in einem Eckchen
ein Obdach zu finden und als Ausnahme einen
Rest von Dasein zu fristen.
Die Mehrzahl der Wesen hat
das dunkle Gefühl, dass Tod und Liebe
nur durch eine durchsichtige Haut
von einander getrennt sind. Sie meinen,
die Natur wolle streng genommen,
dass man in dem Augenblick,
wo man neues Leben hervorruft, das seine lässt.
Wahrscheinlich ist es diese angeerbte Furcht, die
der Liebe solche Bedeutung verleiht. Hier wenigstens
offenbart sich diese Absicht der Natur in
ihrer primitiven Einfachheit, die ihren Schatten noch
auf den Kuss zweier Menschen wirft. Sobald die
Vereinigung stattgefunden hat, platzt der Leib der
Drohne auf, das Werkzeug der Zeugung löst sich
ab und zieht die ganzen Eingeweide nach; die
Flügel erschlaffen, und der entleerte Körper stürzt,
vom hochzeitlichen Blitze getroffen, kreiselnd in den
Abgrund. Dieselbe Absicht, die in der Parthenogenesis
die Zukunft des Bienenstockes durch die ungewöhnliche
Vermehrung der Drohnen aufs Spiel
stellte, opfert hier die Drohnen der Zukunft des
Bienenstockes. Sie setzt immer in Erstaunen, diese
Absicht; je mehr man in sie einzudringen sucht,
desto ungewisser wird sie, und Darwin, um einen
Forscher zu nennen, der sie von allen Menschen
am leidenschaftlichsten und methodischsten studiert
hat, Darwin verliert auf Schritt und Tritt
die Fassung und weicht vor dem Unerwarteten und
Unvereinbaren zurück. Man sehe nur zu – wenn
anders man dem erhebend demütigenden Schauspiel
des menschlichen Geistes im Ringen mit dem
Unendlichen zusehen will – man sehe nur zu, wie
er die seltsamen, unglaublich geheimnisvollen und
zusammenhangslosen Gesetze der Unfruchtbarkeit
und Fruchtbarkeit der Bastarde, oder die der Variabilität
der Art- und Gattungscharaktere zu entwirren
sucht. Kaum hat er ein Prinzip formuliert, so
drängen sich schon zahllose Ausnahmen auf, und
bald ist das bedrängte Prinzip froh, in einem Eckchen
ein Obdach zu finden und als Ausnahme einen
Rest von Dasein zu fristen.
Bei der Bastardierung wie bei der Variabilität (namentlich bei den gleichzeitigen Variationen, die man Korrelation des Wachstums nennt), beim Instinkt, wie bei den Vorgängen des Kampfes ums Dasein, bei der Auslese, der geologischen Aufeinanderfolge und geographischen Verteilung der organischen Wesen, bei den Verwandtschaften unter einander, kurz überall, ist die Natur tastend und nachlässig, sparsam und verschwenderisch, weitblickend und unaufmerksam, unbeständig und unerschütterlich, lebendig und regungslos, ein- und tausendfältig, grossartig und niedrig in demselben Augenblick und derselben Erscheinung. Da sie das unendliche, jungfräuliche Land der Einfachheit vor sich hatte, bevölkert sie es mit kleinen Irrtümern, kleinen, sich widersprechenden Gesetzen und kleinen schwierigen Problemen, die sich ins Dasein verlaufen, wie blinde Heerden. Freilich ist das nur in unseren Augen so, die nur das von der Realität widerspiegeln, was sich uns und unseren Bedürfnissen angepasst hat, und nichts berechtigt uns zu dem Glauben, dass die Natur ihre Ursachen und Wirkungen, die sich verlaufen haben, aus den Augen verlöre.
Jedenfalls gestattet sie ihnen selten, so weit zu gehen, dass sie widersinnig und gefährlich werden. Sie verfügt über zwei Kräfte, die stets Recht haben, und wenn die Erscheinungen gewisse Grenzen überschreiten, winkt sie dem Leben oder dem Tode, und diese stellen die Ordnung wieder her und zeichnen den Weg, der fürderhin zu beschreiten ist, gleichgiltig vor.
 Sie entschlüpft uns überall,
sie missachtet die meisten unserer
Regeln und durchbricht alle unsere
Maassstäbe. Rechts von uns steht
sie weit unter unserem Denken, doch
zur Linken überragt sie es plötzlich
wie ein Gebirge. Sie scheint sich fortwährend zu
irren, sowohl in der Welt ihrer ersten Versuche,
wie in der der letzten, will sagen, in der Menschenwelt.
Sie heiligt hier den Instinkt der dunklen
Masse, die unbewusste Ungerechtigkeit der Zahl,
die Niederlage der Intelligenz und Tugend, die flache
Durchschnittsmoral, die den grossen Strom der
Gattung lenkt und offenbar viel niedriger steht, als
die Moral, wie sie ein Geist erhofft und versteht,
der sich dem kleinen, klareren Strome anschliesst,
welcher dem grossen entgegenläuft. Trotzdem fragt
derselbe Geist sich vielleicht nicht mit Unrecht,
ob es nicht seine Pflicht sei, alle Wahrheit, folglich
auch die moralischen Wahrheiten, in dieser
Masse und nicht in sich selbst zu suchen, wo sie
verhältnismässig so klar und bestimmt zu Tage
liegen.
Sie entschlüpft uns überall,
sie missachtet die meisten unserer
Regeln und durchbricht alle unsere
Maassstäbe. Rechts von uns steht
sie weit unter unserem Denken, doch
zur Linken überragt sie es plötzlich
wie ein Gebirge. Sie scheint sich fortwährend zu
irren, sowohl in der Welt ihrer ersten Versuche,
wie in der der letzten, will sagen, in der Menschenwelt.
Sie heiligt hier den Instinkt der dunklen
Masse, die unbewusste Ungerechtigkeit der Zahl,
die Niederlage der Intelligenz und Tugend, die flache
Durchschnittsmoral, die den grossen Strom der
Gattung lenkt und offenbar viel niedriger steht, als
die Moral, wie sie ein Geist erhofft und versteht,
der sich dem kleinen, klareren Strome anschliesst,
welcher dem grossen entgegenläuft. Trotzdem fragt
derselbe Geist sich vielleicht nicht mit Unrecht,
ob es nicht seine Pflicht sei, alle Wahrheit, folglich
auch die moralischen Wahrheiten, in dieser
Masse und nicht in sich selbst zu suchen, wo sie
verhältnismässig so klar und bestimmt zu Tage
liegen.
Es fällt ihm nicht ein, die Vernünftigkeit und Tugendhaftigkeit seines Ideals, das so viele Helden und Weise geheiligt haben, zu verneinen, aber bisweilen sagt er sich doch, dass dieses Ideal sich vielleicht abseits von der grossen Masse gebildet hat, deren gestaltlose Schönheit er zu verkörpern wähnt. Er hat bisher mit gutem Grunde fürchten können, dass er durch Anpassung seiner Moral an die der Natur gerade das, was ihm die Krone der Natur zu sein dünkte, vernichten würde, aber heute, wo er sie etwas besser kennt und aus einigen noch dunklen, aber von unerwarteter Grösse zeugenden Antworten erkannt hat, dass ihre Pläne und ihre Vernunft ungeheuerer sind, als alles, was er in seiner Selbstbeschränkung hätte denken können, fürchtet er sie minder und bedarf darum nicht mehr so unbedingt der Zuflucht zu seiner Sondertugend und Vernunft. Er sagt sich, dass etwas, das so gross ist, keinen erniedrigenden Einfluss haben kann. Er möchte wissen, ob nicht der Augenblick gekommen ist, wo er seine Gewissheiten, Prinzipien und Träume einer gründlicheren Prüfung unterwerfen soll.
Ich wiederhole es: er denkt nicht daran, sein menschliches Ideal aufzugeben. Gerade das, was dieses Ideal zuerst widerrät, lässt ihn schliesslich darauf zurückkommen. Die Natur kann kein schlechter Ratgeber sein für einen Geist, dem jede Wahrheit, die nicht wenigstens auf der Höhe seines eigenen Strebens steht, nicht hoch genug erscheint, um endgiltig und des grossen Planes würdig zu sein, den er aufzudecken trachtet. Nichts wechselt seinen Platz in seinem Leben, ohne mit ihm zu steigen, und er wird sich noch lange sagen, dass er steigt, wenn er sich dem alten Bilde des Guten nähert. Aber in seinem Denken wandelt sich alles mit grösserer Freiheit, und er kann in seiner leidenschaftlichen Betrachtung ungestraft bergab steigen, bis er die grausamsten und unsittlichsten Widersprüche des Lebens wie Tugenden schätzt, denn er fühlt im Voraus, dass eine Menge von Thälern nach einander zu der ersehnten Hochfläche führen. Diese Betrachtung und diese Leidenschaft hindern ihn nicht daran, im Suchen nach dieser Gewissheit, selbst wenn dies Suchen ihn zum Gegenteil von dem führt, was er liebt, sein Verhalten nach der menschlich schönsten Wahrheit zu regeln und sich an das am höchsten stehende Vorläufige zu halten. Alles, was die wohlthätige Tugend mehrt, geht unmittelbar in sein Leben auf; alles, was sie schmälern würde, bleibt ungelöst darin, wie eines jener unlöslichen Salze, die sich erst zur Stunde des entscheidenden Experiments bewegen. Er kann eine niedrige Wahrheit annehmen, aber um danach zu handeln, wird er – vielleicht Jahrhunderte lang – warten, bis er erkannt hat, welche Beziehungen zwischen dieser Wahrheit und denen bestehen, die unendlich genug sind, um alle anderen einzubegreifen und zu überschatten.
Mit einem Worte, er wird die moralische Weltordnung von der intellektuellen trennen und in die erstere nur das aufnehmen, was grösser und schöner ist als ehedem. Und wenn es tadelnswert ist, diese beiden Ordnungen zu trennen, wie man es oft genug im Leben thut, um schlechter zu handeln, als man denkt, und das Bessere zu erkennen, aber dem Schlechteren zu folgen, so ist es doch immerhin heilsam und vernünftig, das Schlechtere zu erkennen, aber dem Besseren zu folgen und über seine Gedanken hinaus zu handeln, denn die menschliche Erfahrung giebt uns täglich mehr Hoffnung, dass der höchste Gedanke, den wir erfassen können, noch lange unter der geheimnisvollen Wahrheit stehen wird, nach der wir trachten. Und wenn von alledem auch nichts wahr wäre, so wird er doch von einem vertrauteren Gedanken und Gefühl geleitet. Je mehr Kraft nach seiner Meinung den Gesetzen innewohnt, die zur Selbstsucht, Ungerechtigkeit und Grausamkeit einzuladen scheinen, desto mehr bestärkt er jene anderen, die Grossmut, Mitleid und Gerechtigkeit lehren, denn indem er den Anteil des Weltalls und der eigenen Person gleichzusetzen und methodischer abzugrenzen beginnt, findet er in der letzteren etwas ebenso tief Natürliches.
 Indessen kehren wir zu der
tragischen Hochzeit der Bienenkönigin
zurück. In dem uns beschäftigenden
Falle will die Natur also in Anbetracht
der kreuzweisen Befruchtung,
dass Königin und Drohne sich nur
im weiten Raume begatten. Aber ihre Pläne verstricken
sich wie ein Netz, und ihre liebsten Gesetze
müssen unaufhörlich durch die Maschen von
anderen hindurch, und diese im nächsten Augenblick
wieder durch die der ersteren. Da sie denselben
Himmel mit ungezählten Gefahren bevölkert
hat, mit kalten Winden, stürmischen Luftströmungen,
Vögeln, Insekten und Wassertropfen, die auch unbeugsamen
Gesetzen gehorchen, muss sie dafür
sorgen, dass diese Paarung sich so schnell wie
möglich vollzieht. Dies geschieht durch den blitzhaften
Tod der Drohne. Eine Minute genügt, und
der Rest der Befruchtung vollzieht sich in den
Weichen der Gattin.
Indessen kehren wir zu der
tragischen Hochzeit der Bienenkönigin
zurück. In dem uns beschäftigenden
Falle will die Natur also in Anbetracht
der kreuzweisen Befruchtung,
dass Königin und Drohne sich nur
im weiten Raume begatten. Aber ihre Pläne verstricken
sich wie ein Netz, und ihre liebsten Gesetze
müssen unaufhörlich durch die Maschen von
anderen hindurch, und diese im nächsten Augenblick
wieder durch die der ersteren. Da sie denselben
Himmel mit ungezählten Gefahren bevölkert
hat, mit kalten Winden, stürmischen Luftströmungen,
Vögeln, Insekten und Wassertropfen, die auch unbeugsamen
Gesetzen gehorchen, muss sie dafür
sorgen, dass diese Paarung sich so schnell wie
möglich vollzieht. Dies geschieht durch den blitzhaften
Tod der Drohne. Eine Minute genügt, und
der Rest der Befruchtung vollzieht sich in den
Weichen der Gattin.
Diese kehrt von den blauen Höhen schnell in den Stock zurück und schleppt die langgezogenen Gedärme ihres Buhlen wie eine Oriflamme nach. Einige Bienenkenner behaupten, dass sie bei dieser hoffnungsschwangeren Rückkehr eine grosse Freude offenbarte. U. a. entwirft Büchner eine ausführliche Schilderung davon. Ich habe diese hochzeitliche Heimkehr nun oft genug belauscht, aber ich muss gestehen, dass ich nie eine ungewöhnliche Aufregung beobachtet habe, ausser wenn es sich um eine junge Königin handelt, die an der Spitze eines Schwarmes aufgebrochen ist und die einzige Hoffnung einer neu gegründeten, noch öden Stadt bildet. In diesem Falle stürzen alle Arbeitsbienen ihr wie bethört entgegen, um sie zu empfangen. Doch für gewöhnlich scheinen sie sie zu vergessen, obwohl die Zukunft des Volkes oft keine kleinere Gefahr läuft. Sie haben eben alles bedacht, bis dahin, wo sie den Mord der jungen Prinzessinnen zuliessen, aber weiter geht ihr Instinkt nicht; es ist wie ein Loch in ihrer Voraussicht. Sie machen also einen ziemlich gleichgiltigen Eindruck. Sie heben den Kopf, erkennen vielleicht auch das mörderische Wahrzeichen der Befruchtung, aber immer noch misstrauisch, wie sie sind, verraten sie nichts von der Heiterkeit, die wir von ihnen erwarten. Als positive, wenig illusionsfähige Wesen erwarten sie, bevor sie sich freuen, wahrscheinlich noch andere Beweise. Wir thun unrecht, wenn wir alle Gefühle dieser kleinen Geschöpfe, die uns so unähnlich sind, vermenschlichen und logisch machen wollen. Bei den Bienen, wie bei allen anderen Tieren, die einen Abglanz unseres Verstandes in sich tragen, kommt man selten zu so bestimmten Ergebnissen, wie sie in den Büchern geschildert werden. Es bleiben zu viele Umstände, die uns nicht bekannt sind. Warum soll man sie vollkommener machen, als sie sind, und etwas sagen, was nicht wahr ist? Wenn manche wähnen, dass sie anziehender wären, wenn sie uns glichen, so haben sie noch keinen richtigen Begriff davon, was einem aufrichtigen Geiste belangreich erscheinen muss. Das Ziel des Beobachters ist nicht, in Erstaunen zu setzen, sondern zu verstehen, und es ist interessanter, die Lücken eines Verstandes und alle Anzeichen eines von dem unseren abweichenden Zerebralsystems aufzuzeigen, als Wunder davon zu erzählen.
Trotzdem ist die Gleichgiltigkeit nicht allgemein, und sobald die Königin atemlos auf dem Flugbrett landet, bilden sich einige Gruppen und geleiten sie in die Vorhalle, in welche die Sonne, der Held aller Feste des Bienenstockes, mit kleinen, furchtsamen Schritten hineindringt, um die Wachswände und Honigguirlanden mit goldbraunem Helldunkel zu zieren. Übrigens regt die junge Gattin sich nicht mehr und nicht weniger auf, als ihr Volk; es ist nicht viel Raum für unnötige Wallungen in dem engen Hirn der praktischen Barbarenkönigin. Sie hat nur ein Verlangen, nämlich: sich sobald wie möglich von dem lästigen Angedenken an ihren Gatten zu befreien, das sie am Gehen hindert. Sie hockt auf der Schwelle nieder und entledigt sich sorgfältig der unnützen Organe, die alsbald von den Arbeitsbienen aus dem Stocke geschafft werden, denn die Drohne hat ihr alles gegeben, was sie besass, und weit mehr, als nötig war. Sie behält nichts bei sich, als in ihrer Samentasche die Samenflüssigkeit, in der Millionen Keime schwimmen, die einer nach dem andern beim Vorbeigleiten der Eier im Dunkel ihres Leibes die geheimnisvolle Vereinigung des männlichen und weiblichen Elementes vollziehen werden, aus der die Arbeitsbienen entstehen. Es ist eine seltsame Umkehrung der Dinge, dass sie das männliche Prinzip liefert und die Drohne das weibliche. Zwei Tage nach der Begattung legt sie ihre ersten Eier, und alsbald umgiebt das Volk sie mit peinlicher Fürsorge. Sie ist fortan zweigeschlechtig und ihr eigentliches Dasein nimmt jetzt seinen Anfang. Sie verlässt nie mehr den Stock, sieht nie mehr das Licht, ausser bei Begleitung eines Schwarmes, und ihre Fruchtbarkeit erlahmt erst bei ihrem Tode.
 Eine seltsame Hochzeit! Die
märchenhafteste vielleicht, die sich
träumen lässt, voller Himmelsbläue
und Trauerspiel, ein Aufschwung des
Verlangens über das Leben hinaus,
blitzhaft und unvergänglich, kurz und
blendend, einsam und unendlich. Eine erhabene
Trunkenheit, ein Tod im Reinsten und Schönsten,
was es auf dieser Erde giebt. Im jungfräulichen,
unendlichen Raume, in der majestätischen Klarheit
des offenen Himmels schwebt der Augenblick der
Wonne; im keuschen Lichte läutert sich alles Unreine,
was der Liebe anhaftet, wird die unvergessliche
Umarmung vollzogen und für eine lange Zukunft
einem und demselben Leibe das doppelte Vermögen
beider Geschlechter unzertrennlich verliehen.
Eine seltsame Hochzeit! Die
märchenhafteste vielleicht, die sich
träumen lässt, voller Himmelsbläue
und Trauerspiel, ein Aufschwung des
Verlangens über das Leben hinaus,
blitzhaft und unvergänglich, kurz und
blendend, einsam und unendlich. Eine erhabene
Trunkenheit, ein Tod im Reinsten und Schönsten,
was es auf dieser Erde giebt. Im jungfräulichen,
unendlichen Raume, in der majestätischen Klarheit
des offenen Himmels schwebt der Augenblick der
Wonne; im keuschen Lichte läutert sich alles Unreine,
was der Liebe anhaftet, wird die unvergessliche
Umarmung vollzogen und für eine lange Zukunft
einem und demselben Leibe das doppelte Vermögen
beider Geschlechter unzertrennlich verliehen.
Die tiefere Wahrheit hat freilich nichts von dieser Poesie; sie besitzt eine andere, für die wir weniger empfänglich sind, obwohl wir sie vielleicht dereinst auch begreifen und lieben werden. Die Natur hat keine Anstalten getroffen, um diesen beiden „abgekürzten Atomen“, wie Pascal sagen würde, eine glänzende Hochzeit, einen Augenblick idealen Glücks zu bescheren. Sie hat, wir haben es schon gesagt, nichts im Sinne, als die Verbesserung der Art durch die Befruchtung über Kreuz, und um diese sicherzustellen, hat sie das Organ der Drohne so eingerichtet, dass es keinen anderen Gebrauch zulässt, als im weiten Raume. Die Drohne muss durch andauerndes Fliegen ihre beiden grossen Luftsäcke vollständig ausdehnen, damit diese beiden luftgefüllten Gefässe den Unterteil des Hinterleibes herausdrücken, wodurch die Befruchtung stattfindet. Das ist das ganze physiologische Geheimnis – „wie trivial“, werden die einen sagen, „fast peinlich“, die anderen – des wunderbaren Liebesfluges, der blendenden Verfolgung und der seltsamen Hochzeit.
 Und wir, fragt ein Poet, sollen
wir unsere Freude denn stets
über der Wahrheit suchen?
Und wir, fragt ein Poet, sollen
wir unsere Freude denn stets
über der Wahrheit suchen?
Ja, bei jeder Gelegenheit, in jedem Augenblick, in allen Dingen wollen wir unsere Freude stets zwar nicht über der Wahrheit suchen, was unmöglich ist, denn wir wissen nicht, wo sie zu suchen ist, wohl aber oberhalb der kleinen Wahrheiten, die wir erkennen. Wenn ein Gegenstand durch irgend welchen Zufall, eine Erinnerung, eine Illusion, eine Leidenschaft oder irgend einen Anlass sich unseren Augen schöner darstellt als den anderen, sei uns dieser Anlass zunächst lieb und teuer! Vielleicht ist es nur ein Irrtum, aber der Irrtum verhindert nicht, dass der Augenblick uns den Gegenstand am schönsten erscheinen lässt, wo wir nahe daran sind, seine Wahrheit zu erkennen. Die Schönheit, die wir ihm verleihen, lenkt unsere Aufmerksamkeit auf seine wirkliche Grösse und Schönheit, die durchaus nicht leicht zu entdecken sind und in den Beziehungen aller Dinge zu den allgemeinen, ewigen Gesetzen und Kräften liegen. Die Fähigkeit zu bewundern, die wir an einer Illusion erprobt haben, ist für die Wahrheit, die ihr später oder früher folgt, unverloren. Mit Worten und Gefühlen der Vergangenheit, mit der Glut, die alte, imaginäre Schönheiten entfesselt haben, nimmt die Menschheit heute Wahrheiten auf, die vielleicht nie geboren wären, noch günstigen Boden gefunden hätten, wenn diese längst geopferten Illusionen das Herz und den Verstand, auf welche diese Wahrheiten sich herablassen wollen, nicht erfüllt und bestärkt hätten. Glücklich die Augen, die keiner Illusion bedürfen, um die Grösse des Anblickes zu ermessen! Die anderen lernen eben durch die Illusion aufschauen, bewundern und sich freuen. Und so hoch sie auch aufschauen mögen, sie werden nie zu hoch blicken. Je näher man der Wahrheit kommt, desto mehr erhebt sie sich, und je mehr man sie bewundert, desto näher kommt man ihr. Und so hoch sie sich auch freuen mögen, sie werden sich nie im Leeren freuen, noch über der unbekannten ewigen Wahrheit, die über allen Dingen wie eine unbestimmte Schönheit schwebt.

 Heisst das, wir sollen uns
der Lüge befleissigen, einer willkürlichen,
unwirklichen Poesie nachtrachten
und uns in Ermangelung
eines Besseren an dieser erfreuen?
Sollen wir etwa in dem vorliegenden
Falle, der an sich nichts bedeutet, aber für tausend
ähnliche Fälle und unsere ganze Stellung zu gewissen
Thatsachenreihen typisch ist – sollen wir
in diesem Falle etwa die physiologische Erklärung
unterlassen und uns nur an die Empfindung halten,
die uns dieser Hochzeitsausflug hinterlässt, der,
was auch seine Ursache sein mag, immerhin einer
der schönsten lyrischen Vorgänge jener plötzlich
selbstlosen und unwiderstehlichen Gewalt bleibt,
der alle Lebewesen gehorchen und die man Liebe
nennt? Nichts wäre kindlicher, nichts wäre auch
unmöglicher, dank den trefflichen Gewohnheiten,
denen heute alle redlichen Geister huldigen.
Heisst das, wir sollen uns
der Lüge befleissigen, einer willkürlichen,
unwirklichen Poesie nachtrachten
und uns in Ermangelung
eines Besseren an dieser erfreuen?
Sollen wir etwa in dem vorliegenden
Falle, der an sich nichts bedeutet, aber für tausend
ähnliche Fälle und unsere ganze Stellung zu gewissen
Thatsachenreihen typisch ist – sollen wir
in diesem Falle etwa die physiologische Erklärung
unterlassen und uns nur an die Empfindung halten,
die uns dieser Hochzeitsausflug hinterlässt, der,
was auch seine Ursache sein mag, immerhin einer
der schönsten lyrischen Vorgänge jener plötzlich
selbstlosen und unwiderstehlichen Gewalt bleibt,
der alle Lebewesen gehorchen und die man Liebe
nennt? Nichts wäre kindlicher, nichts wäre auch
unmöglicher, dank den trefflichen Gewohnheiten,
denen heute alle redlichen Geister huldigen.
Die kleine Thatsache, dass die Befruchtung durch die Drohne nur dann stattfindet, wenn die Luftsäcke aufgeschwellt sind, wollen wir mit Freuden aufnehmen, da sie unbestreitbar ist. Aber wenn wir uns damit begnügten, wenn wir nicht darüber hinausblickten, wenn wir daraus folgerten, dass jeder zu hoch fliegende oder zu weitgehende Gedanke notwendigerweise Unrecht hat, und dass die Wahrheit sich allemal in materiellen Kleinigkeiten befindet, wenn wir nicht irgendwo, vielleicht in Ungewissheiten, die von grösserer Tragweite sind, als die, welche durch die kleine Erklärung nun aufgehellt sind, z. B. in dem seltsamen Mysterium der kreuzweisen Befruchtung, der Fortdauer der Art und des Lebens, im Weltplan u. s. w. eine Fortsetzung dieser Erklärung, eine Fortdauer des Schönen und Grossen im Unbekannten suchen: ich möchte fast behaupten, dass wir unser Dasein dann in grösserem Abstande von der Wahrheit verbringen würden, als die, welche sich blind auf die poetische und völlig imaginäre Auslegung dieser wunderbaren Hochzeit verlegen würden. Sie täuschen sich ohne Zweifel über Form und Farbe der Wahrheit, aber sie leben weit mehr als die, welche sich schmeicheln, sie ganz und gar in Händen zu halten, in ihrem Dunstkreise und unter ihrem Einfluss. Sie sind darauf vorbereitet, sie zu empfangen, denn es ist ein gastlicherer Raum in ihnen, und wenn sie sie nicht sehen, so erheben sie ihre Augen doch zu dem Orte der Schönheit und Grösse, allwo es heilsam ist, sie zu suchen.
Das Ziel der Natur, welches für uns die alle anderen beherrschende Wahrheit ist, kennen wir nicht. Aber um diese Wahrheit zu lieben, um die Glut, mit der wir nach ihr trachten, in unserem Herzen zu nähren, müssen wir sie für gross halten. Und wenn wir eines Tages erkennen sollten, dass wir auf falscher Fährte sind, dass sie klein und unzusammenhängend ist, so werden wir diese Entdeckung doch nur der Anregung verdanken, die uns ihre vermeintliche Grösse gegeben hat, und wenn diese Kleinheit feststeht, wird sie uns lehren, was zu thun ist. Einstweilen ist es nicht zu viel gethan, wenn wir im Trachten nach ihr alles Mächtigste und Verwegenste in Bewegung setzen, dessen unser Verstand und Herz fähig ist. Und wenn das letzte Wort in alledem etwas Niedriges sein sollte, so ist es doch nichts Kleines, die Kleinheit oder Hohlheit des letzten Zieles der Natur aufgedeckt zu haben.
 Es giebt für uns noch keine
Wahrheit, sagte mir eines Tages einer
unserer grossen zeitgenössischen Psychologen
bei einem Spaziergange auf
dem Lande. Es giebt noch keine
Wahrheit, aber es giebt überall drei
gute Wahrscheinlichkeiten. Jeder wählt sich eine
davon aus, oder besser, sie wählt ihn, und diese
Wahl, die er trifft, oder die ihn trifft, geschieht oft
ganz instinktiv. Er hält sich fortan an sie, und sie
bestimmt Form und Inhalt aller Dinge, die auf ihn
eindringen. Der Freund, dem wir begegnen, das
Weib, das uns lächelnd entgegengeht, die Liebe,
die unser Herz öffnet, der Tod oder Kummer, der
es schliesst, dieser Septemberhimmel, dieser schöne,
anmutige Garten, in dem man, wie in Corneilles
„Psyche“, grüne, goldumsäumte Lauben erblickt,
und die weidende Herde und der Schäfer, der daneben
schläft, und die letzten Dorfhäuser, und das
Meer zwischen den Bäumen: das alles bückt oder
erhebt sich, schmückt oder entkleidet sich seines
Reizes, je nach dem Zeichen, das ihm die Wahl,
die wir getroffen, macht. Lernen wir unter den
drei Wahrscheinlichkeiten wählen. Am Abend
meines Lebens, in dem ich so viel nach der kleinen
Wahrheit und der physikalischen Ursache geforscht
habe, beginne ich, zwar nicht das zu schätzen, was
uns von diesen ablenkt, wohl aber das, was ihnen
vorangeht, und namentlich das, was etwas über sie
hinausgeht. –
Es giebt für uns noch keine
Wahrheit, sagte mir eines Tages einer
unserer grossen zeitgenössischen Psychologen
bei einem Spaziergange auf
dem Lande. Es giebt noch keine
Wahrheit, aber es giebt überall drei
gute Wahrscheinlichkeiten. Jeder wählt sich eine
davon aus, oder besser, sie wählt ihn, und diese
Wahl, die er trifft, oder die ihn trifft, geschieht oft
ganz instinktiv. Er hält sich fortan an sie, und sie
bestimmt Form und Inhalt aller Dinge, die auf ihn
eindringen. Der Freund, dem wir begegnen, das
Weib, das uns lächelnd entgegengeht, die Liebe,
die unser Herz öffnet, der Tod oder Kummer, der
es schliesst, dieser Septemberhimmel, dieser schöne,
anmutige Garten, in dem man, wie in Corneilles
„Psyche“, grüne, goldumsäumte Lauben erblickt,
und die weidende Herde und der Schäfer, der daneben
schläft, und die letzten Dorfhäuser, und das
Meer zwischen den Bäumen: das alles bückt oder
erhebt sich, schmückt oder entkleidet sich seines
Reizes, je nach dem Zeichen, das ihm die Wahl,
die wir getroffen, macht. Lernen wir unter den
drei Wahrscheinlichkeiten wählen. Am Abend
meines Lebens, in dem ich so viel nach der kleinen
Wahrheit und der physikalischen Ursache geforscht
habe, beginne ich, zwar nicht das zu schätzen, was
uns von diesen ablenkt, wohl aber das, was ihnen
vorangeht, und namentlich das, was etwas über sie
hinausgeht. –
Wir waren auf einer jener Hochebenen im Lande Caux in der Normandie angelangt, das so sanft ist, wie ein englischer Park, aber ein natürlicher Park ohne Grenzen. Es ist einer jener seltenen Erdenwinkel, wo das Land vollständig gesund und mit tadellosem Grün bedeckt ist. Etwas mehr nordwärts wird das Klima zu rauh, etwas mehr nach Süden wirkt die Sonne erschlaffend und sengend. – Am Saum einer Ebene, die sich bis ans Meer herabzog, türmten Bauern einen Getreideschober auf.
Sehen Sie, sagte er, von hier aus gesehen sind sie schön. Sie errichten ein einfaches und doch so wichtiges Ding; es ist das glückbedeutende und fast unveränderliche Denkmal des sich bejahenden Menschenlebens: ein Getreideschober. Die Entfernung und die Abendluft verwandeln ihre Freudenrufe in eine Art von Lied ohne Worte; es ist wie eine Antwort auf das Hohelied der Bäume, die über unseren Köpfen rauschen. Der Himmel über ihnen ist wundervoll, als ob gütige Geister alles Licht mit feurigen Palmwedeln nach dem Schober zugekehrt hätten, um ihrer Arbeit noch länger zu leuchten. Und die Spur der Palmen ist am Himmel geblieben. Sehen Sie die schlichte Dorfkirche halb zur Seite unter den rundwipfeligen Linden; sie überragt und überwacht sie. Und das Gras des heimatlichen Kirchhofes, der ins heimische Meer schaut. Sie errichten ihr Denkmal des Lebens harmonisch zwischen den Denkmälern ihrer Toten, die dieselben Bewegungen machten und in ihnen weiterleben. Fassen Sie nun das Ganze zusammen. Es ist ohne besondere, allzu hervorspringende Einzelheiten, wie man es in England, Holland oder der Provence finden könnte. Es ist das breite, beschauliche Bild eines natürlichen, glücklichen Lebens, alltäglich genug, um symbolisch zu wirken. Sehen Sie, welches Ebenmaass in der nutzbringenden Bethätigung des Menschenlebens liegt! Blicken Sie den Mann an, der die Pferde lenkt, den ganzen Körper des anderen, der die Garbe auf der Gabel hinaufreicht, die Weiber, die sich über das Getreide beugen, und die spielenden Kinder ... Sie haben keinen Stein verschoben, keine Erdscholle bewegt, um die Landschaft zu verschönern, sie thun keinen Schritt, sie pflanzen keinen Baum, säen keine Blume, wo es nicht notwendig ist. Das ganze schöne Bild ist nichts als das ungewollte Ergebnis des menschlichen Bemühens, sich eine kurze Zeit in der Natur zu erhalten. Und doch können die unter uns, die ein Bild der Anmut und des Friedens, ein Bild voll tiefer Bedeutung ersinnen oder schaffen möchten, nichts Vollkommeneres entdecken und kommen einfach hierher, um dies zu malen oder zu beschreiben, wenn sie uns Schönheit oder Glück darstellen wollen. Das ist die erste Wahrscheinlichkeit, die einige die Wahrheit nennen. –
Gehen wir näher heran. Hören Sie den Gesang, der dem Rauschen der grossen Bäume so frohgemut antwortete? Er besteht aus groben Worten und Schimpfreden, und wenn ein Lachen erschallt, so hat ein Mann ein Weib mit Dreck geworfen, oder sie ziehen den Schwächsten, den Buckeligen auf, der seine Bürde nicht heben kann, werfen den Lahmen hin oder zausen den Blöden.
Ich beobachte sie seit manchem Jahr. Wir sind in der Normandie, der Boden ist fett und leicht zu bebauen. Hier um den Schober herrscht ein bischen mehr Wohlstand, so dass man nicht überall eine Szene dieser Art vermutet. Folglich sind die Mehrzahl der Männer Alkoholiker, viele Weiber sind es gleichfalls, und ein anderes Gift, das ich nicht erst zu nennen brauche, verdirbt den Volksschlag vollends. Das Resultat davon sind die Kinder, die Sie da sehen. Dieser Knirps ist skrophulös, dieser Krummbeinige hat einen Wasserkopf. Alle, Männer und Weiber, junge und alte, huldigen den gewöhnlichen Lastern des Bauern. Sie sind brutal, heuchlerisch, verlogen, habgierig, verleumderisch, misstrauisch, neidisch, auf kleinen unerlaubten Profit bedacht, stets mit der niedrigsten Erklärung bei der Hand, schmeichlerisch gegen den Stärksten u. s. w. Die Not weist sie auf einander an und zwingt sie, sich gegenseitig zu helfen, aber wo sie es unbeschadet thun können, trachten alle insgeheim danach, sich zu schaden.
Die Schadenfreude ist die einzige wahre Freude des Ortes. Ein grosses Unglück ist der lange gehätschelte Gegenstand heimtückischen Ergötzens. Sie belauschen, beargwöhnen, verachten und verabscheuen einander. So lange sie arm sind, hegen sie gegen die Härte und den Geiz ihrer Brotherren einen zähen und verschlossenen Hass, und wenn sie selber Knechte haben, benutzen sie die Erfahrungen ihrer Knechtszeit, um die Härte und den Geiz, unter denen sie selbst gelitten haben, noch zu übertreffen. Ich könnte Ihnen manche Einzelheiten über die Schurkereien und Knickereien, die Tyrannei, Ungerechtigkeit und Ränkesucht erzählen, die dieser in Frieden und Himmelsschein ruhenden Arbeit zu Grunde liegen. Wir dürfen nicht glauben, dass der Anblick dieses herrlichen Himmels und des Meeres, das jenseits ihrer Kirche einen anderen greifbareren Himmel bildet, der die Erde umfängt, wie ein grosser Spiegel voller Bewusstsein und Weisheit, – dass dieser Anblick sie erhöbe und erbaute. Sie haben ihn nie genossen. Ihr Denken wird nur von drei oder vier ganz bestimmten Furchtempfindungen geleitet: der Furcht vor Hunger, der Furcht vor der Kraft, der öffentlichen Meinung, dem Gesetze, und in der Todesstunde der Furcht vor der Hölle. Um zu zeigen, was sie wert sind, müsste man sie einzeln vornehmen. Erst den grossen Burschen rechts, der so gemütlich aussieht und so schön die Garbe wirft. Vergangenen Sommer zerbrachen ihm seine Freunde bei einem Streit im Wirtshause den rechten Arm. Ich habe den Bruch geheilt, es war eine schlimme, komplizierte Geschichte. Ich habe ihn lange gepflegt. Ich habe ihn unterstützt, bis er wieder arbeiten konnte. Er kam alle Tage zu mir. Er hat sich das zu Nutze gemacht und im Dorfe verbreitet, er hätte mich in den Armen meiner Schwägerin überrascht, und meine Mutter tränke. Er ist nicht schlecht und will mir nicht böse, im Gegenteil, sein Gesicht strahlt von dem aufrichtigsten Lächeln, wenn er mich sieht. Es war kein sozialer Hass, der ihn dazu trieb. Der Bauer hasst den Reichen nicht, dazu hat er zu viel Respekt vor dem Reichtum. Aber ich denke, mein wackerer Gabelschwinger begriff nicht, warum ich ihn pflegte, ohne Vorteil daraus zu ziehen. Er witterte Ränke und wollte nicht der Genarrte sein. Mehr als einer, reich oder arm, hatte es vor ihm ebenso getrieben, oder noch schlimmer. Er glaubte nicht, dass er löge, als er seine Erfindungen verbreitete, er stand unter dem Drucke der Moralität seiner Umgebung. Er gehorchte unwissentlich und gewissermaassen wider Willen dem allmächtigen Gebote der allgemeinen Niedertracht ... Aber warum dies Bild weiter ausmalen? Wer einige Jahre auf dem Lande gelebt hat, der kennt es ja. Das ist also die zweite Wahrscheinlichkeit, die von den Meisten „die Wahrheit“ genannt wird. Es ist die Wahrheit des notwendigen Lebens. Es ist unzweifelhaft, dass sie auf den zuverlässigsten Thatsachen beruht, den einzigen, die jeder Mensch beobachten und erfahren kann. –
Setzen wir uns hier auf diese Garben, fuhr er fort, und sehen wir weiter zu. Verwerfen wir keine der kleinen Thatsachen, welche die eben genannte Realität ausmachen. Lassen wir sie von selber im Raum kleiner werden. Sie füllen den Vordergrund aus, aber hinter ihnen, das muss man wohl zugeben, steht eine grosse, höchst merkwürdige Kraft, die das Ganze in starken Händen hält. Hält sie es aber nur, oder vielmehr, erhebt sie es nicht? Die Menschen, die wir da sehen, sind nicht mehr in allen Stücken die wilden Tiere La Bruyère’s, die so etwas wie eine artikulierte Stimme hatten und sich des Nachts in Höhlen verbargen, wo sie von Schwarzbrot, Wasser und Wurzeln lebten ...
Die Rasse, werden Sie mir sagen, ist weniger kräftig und gesund. Wohl möglich. Das Alkohol und die andere Plage sind Zufälle, deren die Menschheit auch Herr werden muss. Vielleicht sind es Prüfungen, die manchen unserer Organe, z. B. dem Nervensystem, zum Heile gereichen werden, denn wir sehen das Leben aus den Übeln, die es überwindet, regelmässig Vorteil ziehen. Überdies kann ein Nichts, das vielleicht morgen gefunden wird, sie unschädlich machen. Dies ist es also nicht, was unseren Blick beschränken darf. Diese Menschen haben Gedanken und Empfindungen, welche diejenigen La Bruyère’s noch nicht hatten. – Ich mag die einfache, nackte Bestie lieber, als das abstossende Halbtier, murmelte ich. – Da sprechen Sie ganz im Sinne der ersten Wahrscheinlichkeit, die wir ins Auge fassten, entgegnete er. Vermischen wir sie nicht mit der, die wir jetzt prüfen wollen. Diese Gedanken und Empfindungen sind klein und niedrig, wenn Sie wollen, aber das Kleine und Niedrige ist schon ein Fortschritt gegen das Nichts. Sie gebrauchen sie nur, um sich zu schädigen und in ihrer Mittelmässigkeit zu beharren, aber es geht in der Natur oft so zu. Die Gaben, die sie gewährt, werden zuerst nur zum Bösen gebraucht und machen das, was sie scheinbar verbessern wollte, nur noch schlimmer, aber zuletzt entspringt diesem Übel doch ein gewisses Gutes. Übrigens bin ich gar nicht darauf aus, den Fortschritt zu beweisen. Er ist je nach dem Standpunkte, von dem man ihn betrachtet, etwas sehr Grosses oder etwas sehr Kleines. Die Lage des Menschen etwas menschenwürdiger, etwas weniger qualvoll zu gestalten, das ist ein grosses Ziel, das ist vielleicht das sicherste Ideal, aber wenn man von den materiellen Folgen einmal absieht, so ist der Abstand zwischen dem Menschen, der an der Spitze des Fortschrittes schreitet, und dem, der blindlings hintendreinläuft, nicht beträchtlich. Unter diesen jungen Bauernflegeln, deren Hirn nur von verworrenen Gedanken erfüllt ist, haben mehrere die Möglichkeit, den Grad von Bewusstsein, in dem wir leben, in kurzer Zeit zu erlangen. Man wundert sich oft, wie klein der Unterschied zwischen der Unbewusstheit dieser Menschen, die man für vollständig hält, und dem Bewusstsein ist, das wir für das höchste ansehen.
Überdies: woraus besteht denn dies Bewusstsein, auf das wir so stolz sind? Aus weit mehr Schatten, als aus Licht, aus weit mehr erworbener Unwissenheit als aus Wissen, aus weit mehr Dingen, auf deren Erkenntnis wir mit vollem Bewusstsein verzichten müssen, als aus bekannten. Trotzdem liegt in ihm alle unsere Würde, unsere wirklichste Grösse, und vielleicht ist es die erstaunlichste Erscheinung auf der Welt. Es lässt uns die Stirn zu dem unbekannten Prinzip erheben und zu ihm sprechen: „Ich kenne Dich nicht, aber etwas in mir erfasst Dich schon. Du wirst mich vielleicht zerstören, aber wenn Du aus meinen Trümmern keinen besseren Organismus zusammensetzen kannst, als ich bin, so bist du meiner nicht wert, und das Schweigen, das dem Tode der Art folgt, zu der ich gehöre, wird Dich lehren, dass Du gerichtet bist. Und wenn Dir nicht einmal daran liegt, eine gerechte Verurteilung zu erfahren, was liegt dann an Deinem Geheimnis? Wir wollen es dann nicht mehr ergründen. Es muss stumpfsinnig und schauderhaft sein. Du hast durch Zufall ein Wesen hervorgebracht, zu dessen Erzeugung Du nicht das Vermögen hattest. Ein Glück für den Menschen, dass Du ihn durch einen entgegengesetzten Zufall wieder ausgemerzt hast, ehe er den Abgrund Deiner Geistlosigkeit ermessen hat, und noch mehr Glück für ihn, dass er die unendliche Abfolge Deiner scheusslichen Zufallsspiele nicht mehr erlebt. Er gehörte nicht in eine Welt, in der seiner Vernunft keine ewige Vernunft entsprach, in der sein Trachten nach dem Besten kein wirkliches Gut erreichen konnte.“
Noch einmal: der Fortschritt ist nicht unbedingt erforderlich, damit das Schauspiel uns begeistert. Das Rätsel genügt, und dieses Rätsel hat in jenen Bauern ebensoviel Grösse und mystischen Glanz, wie in uns. Man findet es überall, wenn man dem Leben bis auf seinen allmächtigen Urgrund nachgeht. Dieser Urgrund erhält von Jahrhundert zu Jahrhundert einen anderen Namen. Einige waren deutlich und bestimmt, und waren tröstlich. Man hat erkannt, dass dieser Trost und diese Bestimmtheit illusorisch waren. Aber mögen wir ihn Gott, Vorsehung, Natur, Zufall, Leben, Geist, Materie, Verhängnis nennen, das Mysterium bleibt sich gleich, und alles, was wir in Jahrtausende langer Erfahrung gelernt haben, ist, ihm einen immer weiteren, uns menschlich näher stehenden Namen zu geben, der dem, was wir erwarten, und dem, was sich nicht vorhersehen lässt, Rechnung trägt. Diesen Namen führt er heute bereits, und darum ist er niemals grösser erschienen. – Dies ist einer der zahlreichen Fälle der dritten Wahrscheinlichkeit und auch ein Stück Wahrheit.

 Bleibt nach dem Hochzeitsausfluge
der Königin der
Himmel noch klar und die
Luft warm, sind die Blumen
noch ergiebig an Nektar
und Pollen, so dulden die Arbeitsbienen in einer
Art von Nachsicht und Vergesslichkeit, oder vielleicht
aus übertriebener Vorsicht, noch eine Zeit
lang die lästige und verderbliche Anwesenheit der
Drohnen. Diese gebährden sich im Stocke, wie
die Freier der Penelope im Palast des Odysseus.
Sie tafeln und schmausen und führen das müssige
Leben von verschwenderischen und rücksichtslosen
Ehrenliebhabern. Selbstzufrieden und breitspurig,
wie sie sind, versperren sie die Gänge, verstopfen
die Thore, stören die Arbeit, rämpeln und werden
gerämpelt und stehen blöde und wichtig da, von
blinder, gedankenloser Verachtung aufgeblasen, aber
selbst mit Bewusstsein und Hintergedanken verachtet,
und ohne eine Ahnung von der Erbitterung,
die sich still häuft, und dem Schicksal, das ihrer
harrt. Um nach Herzenslust zu schlafen, wählen
sie sich die wärmste Ecke des Stockes zur Ruhestätte,
erheben sich lässig, um aus den offenen
Honigzellen, die am schönsten duften, nach Belieben
zu saugen, und beschmutzen die Waben, auf
denen sie sitzen, mit ihrem Unrat. Die langmütigen
Arbeitsbienen gedenken der Zukunft und machen
den Schaden stillschweigend wieder gut. Von
Mittag bis um drei Uhr, wenn die Landschaft in
bläulichem Sommerduft liegt und unter dem sieghaften
Auge der Juli- oder Augustsonne in seliger
Müdigkeit bebt, fliegen sie aus. Sie tragen einen
Helm aus riesigen schwarzen Perlen mit zwei hohen
lebendigen Federn, ein Wams von falbem Sammet
mit lichten Perlen, ein zottiges Fell und einen vierfachen,
starren, durchscheinenden Mantel. Dabei
machen sie einen furchtbaren Lärm, drängen die
Schildwachen beiseite, stören die Lüfterinnen und
rennen die Arbeitsbienen um, die mit ihrer Tracht
beladen heimkehren. Sie haben das geschäftige,
auffällige und rücksichtslose Auftreten von unentbehrlichen
Göttern, die geräuschvoll nach einem
grossen, dem gemeinen Volke unbekannten Ziele
aufbrechen. So vertrauen sie sich nacheinander
stolz und unwiderstehlich dem weiten Luftraum
an, um sich alsbald friedlich auf die nächsten Blumen
niederzulassen und ihr Mittagsschläfchen zu halten,
bis die abendliche Kühle sie wieder aufweckt. Dann
kehren sie in demselben gebieterischen Fluge in
den Stock zurück, laufen dort, stets von der gleichen,
unentwegten Absicht erfüllt, wieder an die Honigbehälter,
stecken den Kopf bis zum Halse hinein,
saugen sich wie Schläuche voll, um ihren erschöpften
Kräften aufzuhelfen, und schreiten dann wieder
schweren Schritts zum Lager, wo der gute Schlaf
ohne Sorgen und Träume sie bis zum nächsten
Mahle umfängt.
Bleibt nach dem Hochzeitsausfluge
der Königin der
Himmel noch klar und die
Luft warm, sind die Blumen
noch ergiebig an Nektar
und Pollen, so dulden die Arbeitsbienen in einer
Art von Nachsicht und Vergesslichkeit, oder vielleicht
aus übertriebener Vorsicht, noch eine Zeit
lang die lästige und verderbliche Anwesenheit der
Drohnen. Diese gebährden sich im Stocke, wie
die Freier der Penelope im Palast des Odysseus.
Sie tafeln und schmausen und führen das müssige
Leben von verschwenderischen und rücksichtslosen
Ehrenliebhabern. Selbstzufrieden und breitspurig,
wie sie sind, versperren sie die Gänge, verstopfen
die Thore, stören die Arbeit, rämpeln und werden
gerämpelt und stehen blöde und wichtig da, von
blinder, gedankenloser Verachtung aufgeblasen, aber
selbst mit Bewusstsein und Hintergedanken verachtet,
und ohne eine Ahnung von der Erbitterung,
die sich still häuft, und dem Schicksal, das ihrer
harrt. Um nach Herzenslust zu schlafen, wählen
sie sich die wärmste Ecke des Stockes zur Ruhestätte,
erheben sich lässig, um aus den offenen
Honigzellen, die am schönsten duften, nach Belieben
zu saugen, und beschmutzen die Waben, auf
denen sie sitzen, mit ihrem Unrat. Die langmütigen
Arbeitsbienen gedenken der Zukunft und machen
den Schaden stillschweigend wieder gut. Von
Mittag bis um drei Uhr, wenn die Landschaft in
bläulichem Sommerduft liegt und unter dem sieghaften
Auge der Juli- oder Augustsonne in seliger
Müdigkeit bebt, fliegen sie aus. Sie tragen einen
Helm aus riesigen schwarzen Perlen mit zwei hohen
lebendigen Federn, ein Wams von falbem Sammet
mit lichten Perlen, ein zottiges Fell und einen vierfachen,
starren, durchscheinenden Mantel. Dabei
machen sie einen furchtbaren Lärm, drängen die
Schildwachen beiseite, stören die Lüfterinnen und
rennen die Arbeitsbienen um, die mit ihrer Tracht
beladen heimkehren. Sie haben das geschäftige,
auffällige und rücksichtslose Auftreten von unentbehrlichen
Göttern, die geräuschvoll nach einem
grossen, dem gemeinen Volke unbekannten Ziele
aufbrechen. So vertrauen sie sich nacheinander
stolz und unwiderstehlich dem weiten Luftraum
an, um sich alsbald friedlich auf die nächsten Blumen
niederzulassen und ihr Mittagsschläfchen zu halten,
bis die abendliche Kühle sie wieder aufweckt. Dann
kehren sie in demselben gebieterischen Fluge in
den Stock zurück, laufen dort, stets von der gleichen,
unentwegten Absicht erfüllt, wieder an die Honigbehälter,
stecken den Kopf bis zum Halse hinein,
saugen sich wie Schläuche voll, um ihren erschöpften
Kräften aufzuhelfen, und schreiten dann wieder
schweren Schritts zum Lager, wo der gute Schlaf
ohne Sorgen und Träume sie bis zum nächsten
Mahle umfängt.
 Aber die Geduld der Bienen
reicht nicht so weit wie die der Menschen.
Eines Morgens läuft die längst
erwartete Losung durch den Stock,
und die friedlichen Arbeitsbienen werden
zu Richtern und Henkern. Man
weiss nicht, wer die Losung giebt, sie scheint aus
der kalten, verstandesmässigen Entrüstung der Arbeitsbienen
plötzlich hervorzubrechen und erfüllt,
sobald sie ausgesprochen ist, wie es der Geist des
einmütigen Gemeinwesens will, alsbald aller Herzen.
Ein Teil des Volkes steht vom Beutemachen ab,
um sich ganz dem Werke der Gerechtigkeit zu
widmen. Die schamlosen Müssiggänger, die klumpenweise
auf den honigspendenden Wänden sitzen,
werden in ihrer Sorglosigkeit überrascht und durch
ein Heer von zornigen Jungfrauen plötzlich aus dem
Schlaf gerissen. Sie wachen glückselig auf, und
doch unsicher, sie trauen ihren Augen nicht recht,
und ihr Erstaunen dringt allmählig durch ihre allgemeine
Gleichgiltigkeit hindurch, wie ein Mondstrahl
durch ein sumpfiges Wasser. Sie bilden
sich ein, sie seien das Opfer eines Irrtums, blicken
starr um sich, und da der leitende Gedanke ihres
Lebens in ihren dicken Hirnschädeln zuerst lebendig
wird, so wenden sie sich nach den Honigbehältern,
um sich zu stärken. Aber es ist jetzt nicht mehr
die Zeit des Maihonigs, des Blumenweins der Linden
und seines ambrosischen Seitenstückes, der Salbei,
der Esparsette und des Majoran. Statt des freien
Zugangs zu den schönen, vollen Behältern, die ihre
gefälligen Zuckerränder unter ihrem Munde öffneten,
finden sie ringsum ein grimmes Gestrüpp von gesträubten
Giftstacheln. Der Dunstkreis der Stadt
hat sich verändert, und statt des freundlichen Nektarduftes
weht der bittere Anhauch des Giftes, das
in tausend Tröpfchen auf den Spitzen der Stachel
funkelt und Hass und Rache verbreitet. Aber noch
ehe die verblüfften Schmarotzer sich dieser unerhörten
Verletzung ihres gesegneten Schicksals bewusst
werden, ehe sie den Umschwung der Glücksgesetze
des Bienenstaates begriffen haben, stürmen
schon drei bis vier Gerichtsfrauen auf sie los, versuchen
ihnen die Flügel zu kappen, den Hinterleib
vom Brustkasten abzutrennen, die fiebernden Fühler
zu amputieren, die Füsse auszurenken und einen
Spalt zwischen den Ringen ihres Panzers zu finden,
um ihr vergiftetes Schwert hineinzutauchen. Die
ungeschlachten, wehrlosen Tiere denken nicht an
Verteidigung, sondern suchen zu entfliehen oder
bieten ihr dickes Fell den auf sie niederregnenden
Schlägen dar. Auf dem Rücken liegend, wehren
sie mit ihren starken Fussenden die erbitterten
Feindinnen ab, die nicht von ihnen ablassen, oder
sie laufen im Kreise herum und reissen den ganzen
Haufen zu einem tollen Wirbel mit fort, der indessen
bald erlahmt. Nicht lange, so sind sie schon
so mitleidswürdig, dass das Mitleid, welches in unserem
Herzen nie weit von der Gerechtigkeit wohnt,
sofort die Oberhand erlangt und um Gnade bitten
würde. Aber umsonst, die harten Arbeiterinnen
kennen nur das tiefe, harte Naturgesetz. Die Flügel
werden den Ärmsten zerrissen, die Fusswurzeln
abgetrennt, die Fühlhörner abgebissen, und ihre
prachtvollen schwarzen Augen, in denen der Blumenflor
sich spiegelte und der unschuldige Prunk
des azurenen Sommerhimmels widerstrahlte, brechen
im Schmerz und der Trübsal der Todesangst. Die
einen erliegen ihren Wunden und werden von zwei
oder drei ihrer Henkerinnen sofort nach den abliegenden
Kirchhöfen geschleppt. Andere, die weniger
schwer verletzt sind, retten sich in einen
Winkel, wo sie eng zusammengedrängt sitzen und
von einer unerbittlichen Wache blockiert werden,
bis sie elendiglich sterben. Vielen gelingt es auch,
den Ausgang zu gewinnen und in den Luftraum
zu entweichen, wohin ihre Feindinnen sie verfolgen.
Aber am Abend, wenn Hunger und Kälte sie quälen,
kehren sie scharenweise nach dem Stocke zurück
und flehen um Obdach. Doch auch hier finden sie
eine erbarmungslose Wache. Am nächsten Morgen
beim ersten Ausfluge räumen die Bienen die Leichenhügel
der unnützen Riesen von der Schwelle fort,
und mit ihnen verschwindet die Erinnerung an das
Schmarotzergeschlecht aus dem Bienenstock bis
zum nächsten Frühling.
Aber die Geduld der Bienen
reicht nicht so weit wie die der Menschen.
Eines Morgens läuft die längst
erwartete Losung durch den Stock,
und die friedlichen Arbeitsbienen werden
zu Richtern und Henkern. Man
weiss nicht, wer die Losung giebt, sie scheint aus
der kalten, verstandesmässigen Entrüstung der Arbeitsbienen
plötzlich hervorzubrechen und erfüllt,
sobald sie ausgesprochen ist, wie es der Geist des
einmütigen Gemeinwesens will, alsbald aller Herzen.
Ein Teil des Volkes steht vom Beutemachen ab,
um sich ganz dem Werke der Gerechtigkeit zu
widmen. Die schamlosen Müssiggänger, die klumpenweise
auf den honigspendenden Wänden sitzen,
werden in ihrer Sorglosigkeit überrascht und durch
ein Heer von zornigen Jungfrauen plötzlich aus dem
Schlaf gerissen. Sie wachen glückselig auf, und
doch unsicher, sie trauen ihren Augen nicht recht,
und ihr Erstaunen dringt allmählig durch ihre allgemeine
Gleichgiltigkeit hindurch, wie ein Mondstrahl
durch ein sumpfiges Wasser. Sie bilden
sich ein, sie seien das Opfer eines Irrtums, blicken
starr um sich, und da der leitende Gedanke ihres
Lebens in ihren dicken Hirnschädeln zuerst lebendig
wird, so wenden sie sich nach den Honigbehältern,
um sich zu stärken. Aber es ist jetzt nicht mehr
die Zeit des Maihonigs, des Blumenweins der Linden
und seines ambrosischen Seitenstückes, der Salbei,
der Esparsette und des Majoran. Statt des freien
Zugangs zu den schönen, vollen Behältern, die ihre
gefälligen Zuckerränder unter ihrem Munde öffneten,
finden sie ringsum ein grimmes Gestrüpp von gesträubten
Giftstacheln. Der Dunstkreis der Stadt
hat sich verändert, und statt des freundlichen Nektarduftes
weht der bittere Anhauch des Giftes, das
in tausend Tröpfchen auf den Spitzen der Stachel
funkelt und Hass und Rache verbreitet. Aber noch
ehe die verblüfften Schmarotzer sich dieser unerhörten
Verletzung ihres gesegneten Schicksals bewusst
werden, ehe sie den Umschwung der Glücksgesetze
des Bienenstaates begriffen haben, stürmen
schon drei bis vier Gerichtsfrauen auf sie los, versuchen
ihnen die Flügel zu kappen, den Hinterleib
vom Brustkasten abzutrennen, die fiebernden Fühler
zu amputieren, die Füsse auszurenken und einen
Spalt zwischen den Ringen ihres Panzers zu finden,
um ihr vergiftetes Schwert hineinzutauchen. Die
ungeschlachten, wehrlosen Tiere denken nicht an
Verteidigung, sondern suchen zu entfliehen oder
bieten ihr dickes Fell den auf sie niederregnenden
Schlägen dar. Auf dem Rücken liegend, wehren
sie mit ihren starken Fussenden die erbitterten
Feindinnen ab, die nicht von ihnen ablassen, oder
sie laufen im Kreise herum und reissen den ganzen
Haufen zu einem tollen Wirbel mit fort, der indessen
bald erlahmt. Nicht lange, so sind sie schon
so mitleidswürdig, dass das Mitleid, welches in unserem
Herzen nie weit von der Gerechtigkeit wohnt,
sofort die Oberhand erlangt und um Gnade bitten
würde. Aber umsonst, die harten Arbeiterinnen
kennen nur das tiefe, harte Naturgesetz. Die Flügel
werden den Ärmsten zerrissen, die Fusswurzeln
abgetrennt, die Fühlhörner abgebissen, und ihre
prachtvollen schwarzen Augen, in denen der Blumenflor
sich spiegelte und der unschuldige Prunk
des azurenen Sommerhimmels widerstrahlte, brechen
im Schmerz und der Trübsal der Todesangst. Die
einen erliegen ihren Wunden und werden von zwei
oder drei ihrer Henkerinnen sofort nach den abliegenden
Kirchhöfen geschleppt. Andere, die weniger
schwer verletzt sind, retten sich in einen
Winkel, wo sie eng zusammengedrängt sitzen und
von einer unerbittlichen Wache blockiert werden,
bis sie elendiglich sterben. Vielen gelingt es auch,
den Ausgang zu gewinnen und in den Luftraum
zu entweichen, wohin ihre Feindinnen sie verfolgen.
Aber am Abend, wenn Hunger und Kälte sie quälen,
kehren sie scharenweise nach dem Stocke zurück
und flehen um Obdach. Doch auch hier finden sie
eine erbarmungslose Wache. Am nächsten Morgen
beim ersten Ausfluge räumen die Bienen die Leichenhügel
der unnützen Riesen von der Schwelle fort,
und mit ihnen verschwindet die Erinnerung an das
Schmarotzergeschlecht aus dem Bienenstock bis
zum nächsten Frühling.
Oft findet die Drohnenschlacht, in einer grossen Zahl von Kolonien desselben Bienenstandes gleichzeitig statt. Die reichsten und geordnetesten geben das Zeichen zum Morden. Einige Tage später folgen die weniger begünstigten kleineren Republiken. Nur die ärmsten und kläglichsten Völker, deren Königin sehr alt und fast unfruchtbar ist, lassen ihre Drohnen, in der Hoffnung, dass die junge Königin, die sie erwarten, noch geschwängert wird, bis zum Einbruch des Winters am Leben. Dann kommt das unausbleibliche Elend, und der ganze Schwarm, Mutter, Schmarotzer und Arbeitsbienen, ballt sich zu einem darbenden, dicht verschlungenen Knäuel zusammen und geht im Dunkel des Stockes still zu Grunde, bevor der erste Schnee gefallen ist.
Nach dem Strafgericht der Müssiggänger nehmen die starken und wohlhabenden Völker die Arbeit wieder auf, doch mit vermindertem Eifer, denn die Blumen werden immer seltener. Die grossen Feste und die grossen Trauerspiele sind vorüber. Trotzdem füllen die nahrungspendenden Wände sich zur Vervollständigung der unentbehrlichen Vorräte noch mit Herbsthonig, und die letzten Behälter werden mit dem weissen unverderblichen Wachssiegel verschlossen. Der Wachsbau hört auf, die Geburten nehmen ab, die Todesfälle zu, die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Regen und ungünstige Winde, Frühnebel und die Fallen der allzufrüh sinkenden Dämmerung bringen hunderten der emsigen Arbeiterinnen den Tod vor den Thoren, und das ganze kleine Volk, das so sonnensüchtig ist wie die Cicaden Attikas, sieht der drohenden Winterkälte entgegen.
Der Mensch hat sich seinen Anteil an der Ernte schon vorweggenommen. Jeder der guten Bienenstöcke hat ihm 80 bis 100 Pfund Honig geliefert, – und die reichsten geben bisweilen 200, – den Ertrag riesiger Lichtmeere und endloser Blumenfelder, die sie Tag für Tag und Blüte für Blüte beflogen haben. Jetzt wirft er noch einen letzten Blick auf die der Winterstarre entgegengehenden Völker. Den reichsten nimmt er ihre überflüssigen Schätze und verteilt sie an die stets durch unverdientes Missgeschick verarmten Bewohner dieser emsigen Welt. Er deckt ihre Wohnungen zu, schliesst die Eingänge halb, nimmt die unnützen Rahmen heraus und überlässt die Bienen ihrem langen Winterschlaf. Sie ziehen sich dann nach der Mitte des Bienenstockes zusammen und hängen sich an die Waben, aus denen während der Frosttage der Ertrag des Sommers geschöpft werden soll. In der Mitte sitzt die Königin, umgeben von ihrer Leibwache. Die erste Reihe der Arbeitsbienen hängt an den gedeckelten Zellen, über ihnen eine zweite Reihe, auf dieser eine dritte u. s. w. bis zur letzten, die den anderen zur Decke dient. Fühlen die Bienen dieser Deckschicht sich von der Kälte überwältigt, so verschwinden sie in der Masse und werden durch andere ersetzt. Die hängende Traube ist wie eine dunkle Kugel, die durch die Honigwände geteilt wird und sich unmerklich auf und ab, vorwärts und zurück bewegt, je nachdem die Zellen, an denen sie hängt, nachgeben. Denn das Leben der Bienen steht im Winter nicht ganz still, wie man allgemein glaubt, sondern es pulsiert nur langsamer.[12] Durch Zittern mit ihren Flügeln, den kleinen überlebenden Schwestern der Sommerglut, und indem sie je nach den Schwankungen der Aussentemperatur bald stärker, bald schwächer „brausen“, unterhalten sie in ihrem Winterlager eine gleichmässige Temperatur von der Wärme eines Frühlingstages. Dieser verborgene Frühling aber quillt aus dem Honig, der nichts anderes ist, als ein vormals verwandelter Wärmestrahl, der nun zu seiner ersten Form zurückkehrt und wie ein edles Blut durch ihren Wintersitz strömt. Die Bienen, die auf den offenen Zellen sitzen, reichen ihn ihren Nachbarinnen und diese geben ihn wieder weiter. Er geht derart von Hand zu Hand, von Mund zu Mund und erreicht schliesslich die letzten Glieder des Schwarmes, in dessen tausend kleinen Herzen nur ein Gedanke und ein Schicksal lebt. Er ersetzt ihnen Sonnenschein und Blumen, bis sein älterer Bruder, die Sonne, an einem schönen Frühlingstage wieder durch die halbgeöffnete Pforte blickt, um mit seinen lauen Blicken, unter denen die Veilchen und Anemonen erblühen, die Bienen vom Winterschlaf zu erwecken und ihnen zu bedeuten, dass der Himmel wieder sein blaues Kleid angethan hat und dass der ununterbrochene Kreislauf des rastlosen Lebens und des frühzeitigen, aber thätigen und glückseligen Sterbens wieder begonnen hat.

 Ehe ich dieses Buch schliesse,
wie wir den Bienenstock
über dem Schweigen der
Winterstarre geschlossen
haben, möchte ich noch einem
Einwand begegnen, der fast immer erhoben wird,
wenn man die Wunder des Bienenstaates, seinen
politischen Sinn und Gewerbfleiss, dem Beschauer
vor Augen führt. Ja, heisst es gewöhnlich, das
alles ist wunderbar, aber unveränderlich und starr.
Seit abertausenden von Jahren leben sie unter bemerkenswerten
Gesetzen, aber diese Gesetze sind
seit abertausenden von Jahren die gleichen geblieben.
Von Urbeginn an bauen sie ihre wunderbaren
Waben, denen man nichts nehmen und nichts
hinzusetzen kann, und in denen sich das Wissen
des Chemikers mit dem des Mathematikers, Architekten
und Ingenieurs in gleicher Vollendung paart;
aber diese Waben sind genau dieselben, wie in den
Sarkophagen, oder in den Darstellungen auf Steinen
und in den Papyrusrollen Ägyptens. Man nenne
uns eine Thatsache, die den geringsten Fortschritt
bedeutet, eine Einzelheit, in der sie eine Neuerung
getroffen, einen Punkt, wo sie von ihrer Jahrhunderte
alten Gewohnheit abgewichen wären, und wir
werden uns beugen, wir werden anerkennen, dass
in ihnen nicht nur ein wundervoller Instinkt lebt,
sondern auch ein Verstand, der ein Recht hat, sich
dem des Menschen zu nähern und mit ihm auf
irgend ein höheres Geschick zu hoffen, als das der
unbewussten, unterworfenen Materie.
Ehe ich dieses Buch schliesse,
wie wir den Bienenstock
über dem Schweigen der
Winterstarre geschlossen
haben, möchte ich noch einem
Einwand begegnen, der fast immer erhoben wird,
wenn man die Wunder des Bienenstaates, seinen
politischen Sinn und Gewerbfleiss, dem Beschauer
vor Augen führt. Ja, heisst es gewöhnlich, das
alles ist wunderbar, aber unveränderlich und starr.
Seit abertausenden von Jahren leben sie unter bemerkenswerten
Gesetzen, aber diese Gesetze sind
seit abertausenden von Jahren die gleichen geblieben.
Von Urbeginn an bauen sie ihre wunderbaren
Waben, denen man nichts nehmen und nichts
hinzusetzen kann, und in denen sich das Wissen
des Chemikers mit dem des Mathematikers, Architekten
und Ingenieurs in gleicher Vollendung paart;
aber diese Waben sind genau dieselben, wie in den
Sarkophagen, oder in den Darstellungen auf Steinen
und in den Papyrusrollen Ägyptens. Man nenne
uns eine Thatsache, die den geringsten Fortschritt
bedeutet, eine Einzelheit, in der sie eine Neuerung
getroffen, einen Punkt, wo sie von ihrer Jahrhunderte
alten Gewohnheit abgewichen wären, und wir
werden uns beugen, wir werden anerkennen, dass
in ihnen nicht nur ein wundervoller Instinkt lebt,
sondern auch ein Verstand, der ein Recht hat, sich
dem des Menschen zu nähern und mit ihm auf
irgend ein höheres Geschick zu hoffen, als das der
unbewussten, unterworfenen Materie.
Es sind nicht nur die Laien, die so reden. Auch Entomologen vom Range Kirbys und Spences haben dasselbe Argument gebraucht, um den Bienen jede Intelligenz abzusprechen, ausser der, die sich in dem engen Kerker eines wunderbaren, aber unveränderlichen Instinktes verworren kundgiebt. „Man zeige uns“, sagen sie, „einen einzigen Fall, wo sie unter dem Drucke der Verhältnisse darauf gekommen sind, an Stelle von Wachs oder Propolis z. B. Thon oder Mörtel zu verwerten, und wir werden zugeben, dass sie der Überlegung fähig sind.“
Dieses Argument, das Romanes „the question begging argument“ nennt – man könnte es auch das unersättliche Argument nennen – gehört zu den allergefährlichsten und würde uns, auf den Menschen angewandt, sehr weit führen. Wohl betrachtet, stammt es aus jenem gesunden Menschenverstande, der oft Schaden genug stiftet und dem Galilei antwortet: „Die Erde bewegt sich nicht, denn ich sehe die Sonne am Himmel wandeln, des Morgens emporsteigen und des Abends untergehen, und nichts kann das Zeugnis meiner Augen widerlegen“. Der gesunde Menschenverstand ist als Grundlage unseres Geistes vortrefflich und notwendig, aber nur, wenn ein erhabener Zweifel ihn stets überwacht und ihm seine unendliche Unwissenheit nach Bedarf vorhält; anderenfalls ist er nichts als eine Angewohnheit der unteren Stufen unseres Verstandes. Aber die Bienen haben die Einwendung von Kirby und Spence selbst beantwortet. Sie war kaum gemacht worden, als ein andrer Naturforscher, Andrew Knight, der die kranke Rinde gewisser Bäume mit einer Art Zement aus Wachs und Terpentin bestrichen hatte, die Beobachtung machte, dass seine Bienen kein Propolis mehr eintrugen und nur dieses unbekannte Material benutzten, das sich bald bewährte und angenommen wurde, da sie es vollständig fertig und in grossen Mengen in der Nähe ihrer Wohnung fanden.
Überdies läuft die Hälfte aller Bienenkunde und Bienenzucht darauf heraus, der Initiative der Bienen Vorschub zu leisten und ihrem praktischen Verstande Gelegenheit zu geben, sich zu üben und wirkliche Entdeckungen, wirkliche Erfindungen zu machen. Wenn z. B. wenig Pollen in der Natur vorhanden ist, so streut der Bienenwirt zur Auffütterung der Brut, zu der viel Pollen nötig ist, in der Nähe des Bienenstockes Mehl aus. Im Naturzustande, im Schoosse der Urwälder oder asiatischen Thäler, in denen sie vor der Tertiärzeit wahrscheinlich gelebt haben, ist ihnen ein derartiger Stoff jedenfalls nicht begegnet. Trotzdem braucht man nur einige darauf aufmerksam zu machen, indem man sie in das Mehl setzt, und sie werden es betasten, kosten und seine dem Blütenstaub verwandten Eigenschaften erkennen, sie werden in den Stock zurückkehren, ihre Schwestern von ihrer Entdeckung benachrichtigen, und alsbald wird ein ganzer Schwarm erscheinen, um dies unerwartete und unbegreifliche Nahrungsmittel einzuernten, das in ihrem anererbten Gedächtnis von den Blumenkelchen unzertrennlich ist.
 Es ist kaum hundert Jahre
her, dass man nach Hubers Vorgang
die Bienen ernstlich zu beobachten
und die ersten Fundamentalwahrheiten
zu entdecken begonnen hat, die
ein erfolgreiches Studium erlauben.
Etwas mehr als fünfzig Jahre sind es her, dass
sich durch die Erfindung der beweglichen Waben
und Kastenstöcke des Pfarrers Dzierzon eine rationelle
und praktische Bienenzucht anbahnt, dass der
Bienenstock nicht mehr ein unverletzliches Haus
ist, wo alles in Mysterien gehüllt bleibt, bis der
Tod es entschleiert, wenn es nicht mehr ist.
Schliesslich sind es weniger als fünfzig Jahre her,
seit durch Vervollkommnung des Mikroskops und des
Handwerkszeuges der Entomologen das Geheimnis
der Hauptorgane der Arbeitsbienen, der Königin
und der Drohnen blosgelegt ist. Ist es da erstaunlich,
dass unser Wissen nicht weiter reicht,
als unsere Erfahrung? Die Bienen leben seit Jahrtausenden,
und wir beobachten sie seit zehn oder
zwölf Lustren. Und wenn es auch bewiesen wäre,
dass sich im Bienenstocke nichts verändert hat,
seit wir ihn geöffnet haben, so haben wir doch
noch kein Recht, daraus zu folgern, dass sich
nie etwas darin geändert hat, ehe wir ihn befragten.
Wissen wir nicht, dass in der Entwickelung
einer Gattung ein Jahrhundert wie ein Regentropfen
ist, der sich im Strom verliert, und dass
im Leben der Materie die Jahrtausende ebenso
schnell vergehen, wie die Jahre im Leben eines
Volkes?
Es ist kaum hundert Jahre
her, dass man nach Hubers Vorgang
die Bienen ernstlich zu beobachten
und die ersten Fundamentalwahrheiten
zu entdecken begonnen hat, die
ein erfolgreiches Studium erlauben.
Etwas mehr als fünfzig Jahre sind es her, dass
sich durch die Erfindung der beweglichen Waben
und Kastenstöcke des Pfarrers Dzierzon eine rationelle
und praktische Bienenzucht anbahnt, dass der
Bienenstock nicht mehr ein unverletzliches Haus
ist, wo alles in Mysterien gehüllt bleibt, bis der
Tod es entschleiert, wenn es nicht mehr ist.
Schliesslich sind es weniger als fünfzig Jahre her,
seit durch Vervollkommnung des Mikroskops und des
Handwerkszeuges der Entomologen das Geheimnis
der Hauptorgane der Arbeitsbienen, der Königin
und der Drohnen blosgelegt ist. Ist es da erstaunlich,
dass unser Wissen nicht weiter reicht,
als unsere Erfahrung? Die Bienen leben seit Jahrtausenden,
und wir beobachten sie seit zehn oder
zwölf Lustren. Und wenn es auch bewiesen wäre,
dass sich im Bienenstocke nichts verändert hat,
seit wir ihn geöffnet haben, so haben wir doch
noch kein Recht, daraus zu folgern, dass sich
nie etwas darin geändert hat, ehe wir ihn befragten.
Wissen wir nicht, dass in der Entwickelung
einer Gattung ein Jahrhundert wie ein Regentropfen
ist, der sich im Strom verliert, und dass
im Leben der Materie die Jahrtausende ebenso
schnell vergehen, wie die Jahre im Leben eines
Volkes?
 Aber es ist unbewiesen, dass
sich in den Gewohnheiten der Bienen
nichts verändert haben soll. Prüft
man sie ohne vorgefasste Meinung
und ohne das kleine Feld unserer
heutigen Erfahrung zu verlassen, so
wird man im Gegenteil sehr merklicher Veränderungen
gewahr. Und wer nennt die, welche uns
entgehen? Ein Beobachter, der etwa einhundertfünfzigmal
unsere Grösse und siebenhunderttausendmal
unseren Umfang hätte (es sind dies die Zahlenverhältnisse
zwischen unserer Statur und Schwere
und denen der kleinen Honigbiene), ein Beobachter,
der unsere Sprache nicht verstünde und mit ganz
anderen Sinnen begabt wäre, als wir, würde vielleicht
entdecken, dass sich in den zwei letzten Dritteln des
verflossenen Jahrhunderts recht sonderbare materielle
Veränderungen vollzogen haben, aber von unserer
moralischen, sozialen, religiösen, politischen
und ökonomischen Entwickelung könnte er sich
keinen Begriff machen.
Aber es ist unbewiesen, dass
sich in den Gewohnheiten der Bienen
nichts verändert haben soll. Prüft
man sie ohne vorgefasste Meinung
und ohne das kleine Feld unserer
heutigen Erfahrung zu verlassen, so
wird man im Gegenteil sehr merklicher Veränderungen
gewahr. Und wer nennt die, welche uns
entgehen? Ein Beobachter, der etwa einhundertfünfzigmal
unsere Grösse und siebenhunderttausendmal
unseren Umfang hätte (es sind dies die Zahlenverhältnisse
zwischen unserer Statur und Schwere
und denen der kleinen Honigbiene), ein Beobachter,
der unsere Sprache nicht verstünde und mit ganz
anderen Sinnen begabt wäre, als wir, würde vielleicht
entdecken, dass sich in den zwei letzten Dritteln des
verflossenen Jahrhunderts recht sonderbare materielle
Veränderungen vollzogen haben, aber von unserer
moralischen, sozialen, religiösen, politischen
und ökonomischen Entwickelung könnte er sich
keinen Begriff machen.
Eine höchst wahrscheinliche wissenschaftliche Hypothese wird uns sogleich erlauben, unsere Hausbiene an den grossen Stamm der Apinen zu knüpfen, der alle wilden Bienen umfasst, und in dem vielleicht ihre Vorfahren zu suchen sind.[13] Wir werden dann physiologischen, sozialen, ökonomischen, architektonischen und industriellen Wandelungen beiwohnen, die selbst unsere menschliche Entwickelung in Schatten stellen. Zunächst jedoch wollen wir uns an unsere Hausbiene halten, deren man etwa sechszehn Arten zählt. Aber ob Apis dorsata, die grösste, oder Apis florea, die kleinste, die man kennt, es ist immer dasselbe Insekt, durch Klima und Umstände, denen es sich hat anpassen müssen, mehr oder minder verändert. Alle diese Arten sind sich nicht viel unähnlicher, als ein Engländer einem Russen oder ein Japaner einem Europäer. Indem wir unsere Vorbemerkungen dermassen beschränken, wollen wir hier nur das feststellen, was wir mit eigenen Augen und zu dieser Stunde sehen können, ohne unsere Zuflucht zu irgend einer Hypothese zu nehmen, mag sie noch so wahrscheinlich und unabweislich sein. Wir wollen auch nicht auf all die Thatsachen Bezug nehmen, die man hier heranziehen könnte. Einige der bezeichnendsten mögen in schneller Aufzählung folgen.
 Die wesentlichste und radikalste
Verbesserung, die einer ungeheuren
Arbeitsleistung in der Menschenwelt
entsprechen würde, ist zunächst
der Schutz des Gemeinwesens
nach aussen.
Die wesentlichste und radikalste
Verbesserung, die einer ungeheuren
Arbeitsleistung in der Menschenwelt
entsprechen würde, ist zunächst
der Schutz des Gemeinwesens
nach aussen.
Die Bienen wohnen nicht wie wir in Städten unter offenem Himmel, die den Launen von Wind und Wetter ausgesetzt sind, sondern ihre Siedelungen sind ganz und gar mit einer schützenden Hülle umgeben. Im Naturzustande und in einem idealen Klima ist das nicht der Fall. Wenn sie nur den Tiefen ihres Instinktes Gehör gäben, so würden sie ihre Waben offen bauen. In Indien sucht die Apis dorsata nicht allzubegierig hohle Bäume und Felshöhlen auf. Der Schwarm legt sich an einen Astwinkel an und die Wabe entsteht, die Königin legt, die Vorräte häufen sich ohne ein anderes Obdach, als die Leiber der Arbeitsbienen. Man hat bisweilen beobachtet, dass unsere nördlichen Bienen sich durch einen zu milden Sommer täuschen liessen und diesem Instinkt wieder Gehör gaben, und man hat Schwärme gefunden, die so im Freien im Buschwerk lebten.[14]
Aber selbst in Indien hat diese anscheinend eingeborene Gewohnheit oft unangenehme Folgen. Sie verdammt einen Teil der Arbeitsbienen zur Unbeweglichkeit. Die nötige Wärme für die am Wachsbau und an der Errichtung von Brutzellen thätigen Bienen zu erzeugen, ist ihre einzige That, und infolge dessen baut die Apis dorsata, die an den Ästen hängt, nur eine Wabe. Das bescheidenste Obdach erlaubt ihr vier oder fünf und noch mehr anzulegen, und um soviel hebt sich auch die Bevölkerungszahl und der Wohlstand des Volkes. Darum haben auch alle Bienenrassen der kalten und gemässigten Zone diese ursprüngliche Methode aufgegeben. Augenscheinlich hat die natürliche Auslese die kluge Initiative des Insektes geheiligt, indem sie nur die volkreichsten und geschütztesten Stämme den nordischen Winter überdauern lässt; und was zuerst nur ein Gedanke war, der dem Instinkte zuwiderlief, ist allmählich zur instinktiven Gewohnheit geworden. Aber darum steht es doch fest, dass es zuerst ein kühner und wahrscheinlich an Beobachtungen, Erfahrungen und Überlegungen reicher Gedanke war, dem weiten, angebeteten, natürlichen Lichte Valet zu sagen und sich in den Höhlen eines Baumes oder Felsens zu bergen. Man möchte fast sagen, diese Erfindung war für die Geschicke der Hausbiene ebenso bedeutungsvoll, wie die Entdeckung des Feuers für das Menschengeschlecht.
 Neben diesem grossen Fortschritte,
der, obwohl alt und erblich,
doch jedesmal neu errungen werden
muss, finden wir eine Fülle von unendlich
veränderlichen Einzelheiten,
die uns beweisen, dass Politik und
Gewerbfleiss des Bienenstaates nicht in eherne
Formen gegossen sind. Wir erwähnten schon den
klugen Ersatz von Pollen durch Mehl und den von
Wachs durch eine künstliche Zementmasse. Wir
haben gesehen, wie geschickt sie die oft verzweifelt
ungastlichen Wohnungen, in die man sie einschlägt,
ihren Bedürfnissen anzupassen wissen. Wir haben
gleichfalls gesehen, mit welcher unmittelbaren, überraschenden
Gewandtheit sie sich die Kunstwaben,
die ihnen der erfinderische Sinn des Menschen darbot,
zu Nutze gemacht haben. Hier ist die sinnreiche
Ausnutzung eines wunderbar brauchbaren,
aber unvollständigen Dinges geradezu staunenswert.
Sie haben den Menschen mit seinen halben Andeutungen
thatsächlich verstanden. Man stelle sich
vor, wir bauten unsere Städte seit Jahrhunderten
nicht mit Kalk, Steinen und Ziegeln, sondern mit
einer hämmerbaren Substanz, die wir mit Hilfe von
besonderen Organen mühsam aus unserem Körper
ausschieden, und eines Tages setzt uns ein allmächtiges
Wesen mitten in eine fabelhafte Stadt.
Wir erkennen, dass sie aus einem ganz ähnlichen
Stoffe besteht, wie wir ihn ausscheiden, aber im
übrigen ist es ein Traum, der just durch seine Logik,
eine verzerrte und gewissermaassen reduzierte
und konzentrierte Logik, mehr verwirrt, als die
Zusammenhangslosigkeit selbst. Unser gewöhnlicher
Bauplan findet sich darin wieder, alles ist
so, wie wir es erwarten können, aber nur in Potenz
und sozusagen durch eine eingeborene feindliche
Macht erdrückt, im Entstehen aufgehalten und nicht
zur vollen Entfaltung gediehen. Die Häuser, die
vier oder fünf Meter hoch sein sollen, bestehen nur
aus kleinen Anschwellungen von Handbreite. Tausend
Mauern sind durch einen Strich angedeutet,
der ihr Schicksal und zugleich das Baumaterial,
aus dem sie gebaut werden sollen, in sich schliesst.
Dazu findet sich manche grosse Unregelmässigkeit,
die zu verbessern bleibt, Abgründe müssen ausgefüllt
und mit dem Ganzen in Einklang gebracht,
weite lockere Flächen versteift werden. Denn das
Werk ist unverhofft brauchbar, aber unfertig und
in seinem jetzigen Zustande geradezu gefährlich.
Es scheint von einer überlegenen Vernunft ersonnen,
die unsere meisten Wünsche erraten hat, aber durch
ihre eigene Riesenhaftigkeit behindert wurde, sie
anders als ganz grob zu verwirklichen. Es handelt
sich also darum, das alles zu entwirren, sich die
geringsten Absichten des übernatürlichen Gebers
zu Nutze zu machen, in wenigen Tagen das zu
bauen, was sonst Jahre in Anspruch nehmen würde,
auf seine organischen Gewohnheiten zu verzichten
und seine Arbeitsmethoden von Grund aus umzuwerfen.
Ganz gewiss bedürfte es aller unserer
Anspannung, um die auftauchenden Probleme zu
lösen und nichts von den Vorteilen zu verlieren,
die eine grossmütige Vorsehung uns darböte. Aber
dies ist ungefähr dasselbe, was die Bienen in unseren
modernen Mobilstöcken thun.[15]
Neben diesem grossen Fortschritte,
der, obwohl alt und erblich,
doch jedesmal neu errungen werden
muss, finden wir eine Fülle von unendlich
veränderlichen Einzelheiten,
die uns beweisen, dass Politik und
Gewerbfleiss des Bienenstaates nicht in eherne
Formen gegossen sind. Wir erwähnten schon den
klugen Ersatz von Pollen durch Mehl und den von
Wachs durch eine künstliche Zementmasse. Wir
haben gesehen, wie geschickt sie die oft verzweifelt
ungastlichen Wohnungen, in die man sie einschlägt,
ihren Bedürfnissen anzupassen wissen. Wir haben
gleichfalls gesehen, mit welcher unmittelbaren, überraschenden
Gewandtheit sie sich die Kunstwaben,
die ihnen der erfinderische Sinn des Menschen darbot,
zu Nutze gemacht haben. Hier ist die sinnreiche
Ausnutzung eines wunderbar brauchbaren,
aber unvollständigen Dinges geradezu staunenswert.
Sie haben den Menschen mit seinen halben Andeutungen
thatsächlich verstanden. Man stelle sich
vor, wir bauten unsere Städte seit Jahrhunderten
nicht mit Kalk, Steinen und Ziegeln, sondern mit
einer hämmerbaren Substanz, die wir mit Hilfe von
besonderen Organen mühsam aus unserem Körper
ausschieden, und eines Tages setzt uns ein allmächtiges
Wesen mitten in eine fabelhafte Stadt.
Wir erkennen, dass sie aus einem ganz ähnlichen
Stoffe besteht, wie wir ihn ausscheiden, aber im
übrigen ist es ein Traum, der just durch seine Logik,
eine verzerrte und gewissermaassen reduzierte
und konzentrierte Logik, mehr verwirrt, als die
Zusammenhangslosigkeit selbst. Unser gewöhnlicher
Bauplan findet sich darin wieder, alles ist
so, wie wir es erwarten können, aber nur in Potenz
und sozusagen durch eine eingeborene feindliche
Macht erdrückt, im Entstehen aufgehalten und nicht
zur vollen Entfaltung gediehen. Die Häuser, die
vier oder fünf Meter hoch sein sollen, bestehen nur
aus kleinen Anschwellungen von Handbreite. Tausend
Mauern sind durch einen Strich angedeutet,
der ihr Schicksal und zugleich das Baumaterial,
aus dem sie gebaut werden sollen, in sich schliesst.
Dazu findet sich manche grosse Unregelmässigkeit,
die zu verbessern bleibt, Abgründe müssen ausgefüllt
und mit dem Ganzen in Einklang gebracht,
weite lockere Flächen versteift werden. Denn das
Werk ist unverhofft brauchbar, aber unfertig und
in seinem jetzigen Zustande geradezu gefährlich.
Es scheint von einer überlegenen Vernunft ersonnen,
die unsere meisten Wünsche erraten hat, aber durch
ihre eigene Riesenhaftigkeit behindert wurde, sie
anders als ganz grob zu verwirklichen. Es handelt
sich also darum, das alles zu entwirren, sich die
geringsten Absichten des übernatürlichen Gebers
zu Nutze zu machen, in wenigen Tagen das zu
bauen, was sonst Jahre in Anspruch nehmen würde,
auf seine organischen Gewohnheiten zu verzichten
und seine Arbeitsmethoden von Grund aus umzuwerfen.
Ganz gewiss bedürfte es aller unserer
Anspannung, um die auftauchenden Probleme zu
lösen und nichts von den Vorteilen zu verlieren,
die eine grossmütige Vorsehung uns darböte. Aber
dies ist ungefähr dasselbe, was die Bienen in unseren
modernen Mobilstöcken thun.[15]
 Selbst die Politik des Bienenstaates
ist wahrscheinlich nicht
stets dieselbe geblieben, sagte ich.
Es ist dies der dunkelste und am
schwersten nachzuweisende Punkt.
Ich will mich nicht bei der veränderlichen
Behandlungsweise der Königinnen aufhalten,
noch bei den jedem Volke eigenen Gesetzen des
Schwärmens, die sich von Geschlecht zu Geschlecht
zu vererben scheinen. Neben diesen Thatsachen,
die nicht ganz fest umschrieben sind, giebt es noch
andere, die weder schwankend noch unbestimmt
sind und deutlich beweisen, dass nicht alle Arten
der Hausbiene auf derselben Stufe politischer Gesittung
stehen, dass es solche giebt, deren politischer
Geist noch tastet und vielleicht nach einer andern
Lösung des Problems der Königin trachtet. Die
syrische Biene z. B. zieht gewöhnlich einhundert
und zwanzig Königinnen auf und mehr, wogegen
unsere Apis mellifica höchstens bis auf zehn oder
zwölf kommt. Cheshire berichtet von einem syrischen
Volke, das keineswegs abnorm war und bei
dem sich einundzwanzig tote Königinnen und neunzig
lebende und freie befanden. Dies ist der Ausgangs-
oder Endpunkt einer recht seltsamen sozialen
Entwickelung, und es verlohnte sich, ihr mehr auf
den Grund zu gehen. Übrigens steht die cyprische
Biene in Bezug auf die Aufziehung der Königinnen
der syrischen sehr nahe. Ist dies ein tastender
Rückfall vom monarchischen Prinzip zur Oligarchie,
zur vielfachen Mutterschaft nach der erprobten einzigen?
Jedenfalls war die syrische und cyprische
Biene, die der ägyptischen und italienischen nahe
verwandt ist, wohl die erste, die der Mensch unter
seine Botmässigkeit gebracht hat. Zum Schluss
noch eine Beobachtung, die noch deutlicher zeigt,
dass die Sitten und die weitblickende Organisation
des Bienenstaates nicht das Ergebnis eines ursprünglichen
Triebes sind, der sich mechanisch von
Jahrhundert zu Jahrhundert und von Klima zu
Klima forterbt, sondern dass der Geist, der diese
kleinen Gemeinwesen lenkt, den veränderten Umständen
Rechnung trägt, sich ihnen fügt und daraus
Vorteil zieht, wie er den früheren Gefahren vorzubeugen
wusste. Wird unsere schwarze Biene also
nach Australien oder Californien gebracht, so verändert
sie ihre Gewohnheiten vollständig. Vom
zweiten oder dritten Jahre an, d. h. sobald sie gemerkt
hat, dass ewiger Sommer herrscht und nie
Blumenmangel eintritt, lebt sie in den Tag hinein,
begnügt sich damit, soviel Pollen und Honig einzutragen,
als zum täglichen Gebrauche nötig ist,
und da ihre neue, verstandesmässige Beobachtung
über ihre erbliche Erfahrung Herr wird, so trägt
sie keinen Wintervorrat mehr ein. Man erhält sie
sogar nur dadurch in Thätigkeit, dass man ihr die
Früchte ihrer Arbeit fortnimmt.[16]
Selbst die Politik des Bienenstaates
ist wahrscheinlich nicht
stets dieselbe geblieben, sagte ich.
Es ist dies der dunkelste und am
schwersten nachzuweisende Punkt.
Ich will mich nicht bei der veränderlichen
Behandlungsweise der Königinnen aufhalten,
noch bei den jedem Volke eigenen Gesetzen des
Schwärmens, die sich von Geschlecht zu Geschlecht
zu vererben scheinen. Neben diesen Thatsachen,
die nicht ganz fest umschrieben sind, giebt es noch
andere, die weder schwankend noch unbestimmt
sind und deutlich beweisen, dass nicht alle Arten
der Hausbiene auf derselben Stufe politischer Gesittung
stehen, dass es solche giebt, deren politischer
Geist noch tastet und vielleicht nach einer andern
Lösung des Problems der Königin trachtet. Die
syrische Biene z. B. zieht gewöhnlich einhundert
und zwanzig Königinnen auf und mehr, wogegen
unsere Apis mellifica höchstens bis auf zehn oder
zwölf kommt. Cheshire berichtet von einem syrischen
Volke, das keineswegs abnorm war und bei
dem sich einundzwanzig tote Königinnen und neunzig
lebende und freie befanden. Dies ist der Ausgangs-
oder Endpunkt einer recht seltsamen sozialen
Entwickelung, und es verlohnte sich, ihr mehr auf
den Grund zu gehen. Übrigens steht die cyprische
Biene in Bezug auf die Aufziehung der Königinnen
der syrischen sehr nahe. Ist dies ein tastender
Rückfall vom monarchischen Prinzip zur Oligarchie,
zur vielfachen Mutterschaft nach der erprobten einzigen?
Jedenfalls war die syrische und cyprische
Biene, die der ägyptischen und italienischen nahe
verwandt ist, wohl die erste, die der Mensch unter
seine Botmässigkeit gebracht hat. Zum Schluss
noch eine Beobachtung, die noch deutlicher zeigt,
dass die Sitten und die weitblickende Organisation
des Bienenstaates nicht das Ergebnis eines ursprünglichen
Triebes sind, der sich mechanisch von
Jahrhundert zu Jahrhundert und von Klima zu
Klima forterbt, sondern dass der Geist, der diese
kleinen Gemeinwesen lenkt, den veränderten Umständen
Rechnung trägt, sich ihnen fügt und daraus
Vorteil zieht, wie er den früheren Gefahren vorzubeugen
wusste. Wird unsere schwarze Biene also
nach Australien oder Californien gebracht, so verändert
sie ihre Gewohnheiten vollständig. Vom
zweiten oder dritten Jahre an, d. h. sobald sie gemerkt
hat, dass ewiger Sommer herrscht und nie
Blumenmangel eintritt, lebt sie in den Tag hinein,
begnügt sich damit, soviel Pollen und Honig einzutragen,
als zum täglichen Gebrauche nötig ist,
und da ihre neue, verstandesmässige Beobachtung
über ihre erbliche Erfahrung Herr wird, so trägt
sie keinen Wintervorrat mehr ein. Man erhält sie
sogar nur dadurch in Thätigkeit, dass man ihr die
Früchte ihrer Arbeit fortnimmt.[16]
 Soviel können wir mit unseren
Augen sehen. Wie man zugeben
wird, sind dies ein paar ausschlaggebende
Thatsachen und ein
gutes Argument gegen die Ansicht
derer, die da meinen, dass aller Verstand
unbeweglich und in eherne Formen gegossen
ist, ausgenommen der menschliche.
Soviel können wir mit unseren
Augen sehen. Wie man zugeben
wird, sind dies ein paar ausschlaggebende
Thatsachen und ein
gutes Argument gegen die Ansicht
derer, die da meinen, dass aller Verstand
unbeweglich und in eherne Formen gegossen
ist, ausgenommen der menschliche.
Wenn wir die Hypothese der Entwickelung aber einen Augenblick zugeben, so wird das Schauspiel grösser, und sein unbestimmter, gewaltiger Schein reicht bis an unsere eigenen Geschicke. Es ist nicht augenscheinlich, aber wer sich ernstlich damit beschäftigt, für den ist es nicht mehr zweifelhaft, dass in der Natur ein Wille herrscht, der danach trachtet, einen Teil der Materie auf eine höhere, vielleicht auch bessere Stufe zu erheben und ihre Oberfläche allmählich mit jenem geheimnisvollen Fluidum zu überziehen, das wir zuerst das Leben, dann den Instinkt und kurz danach den Verstand nennen, ein Wille, der die Existenz alles dessen, was einem unbekannten Ziele zustrebt, zu sichern, zu organisieren und zu erleichtern trachtet. Es steht nicht fest, aber viele Beispiele, die wir um uns haben, laden zu der Annahme ein, dass die Materie, die sich von Urbeginn an dergestalt erhoben hat, gesetzt dass man sie wägen und zählen könnte, nicht aufgehört hat, zuzunehmen. Ich wiederhole es: die Annahme steht auf schwachen Füssen, aber es ist die einzige über die verborgene Kraft, welche uns lenkt, zu der wir ein Recht haben, und das ist viel in einer Welt, in der unsere erste Pflicht die Zuversicht zum Leben ist, selbst dann, wenn man keine ermutigende Gewissheit darin entdecken würde, und solange es keine gegenteilige Gewissheit giebt.
Ich weiss, was man gegen die Entwickelungslehre alles einwenden kann. Sie hat zahlreiche Beweise und starke Gründe für sich, aber sie sind nicht notwendig überzeugend. Man darf sich den Wahrheiten seines Zeitalters nie rückhaltlos anvertrauen. In hundert Jahren werden vielleicht viele Kapitel in unseren Büchern, die von ihr durchtränkt sind, deswegen veraltet sein, wie heute die Werke der Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts, die von einer zu vollkommenen Menschheit ausgehen, die es nicht giebt, oder so viele Werke des siebzehnten Jahrhunderts, die durch den Gedanken des kleinlichen und strengen Gottes der von so vielen Lügen und Eitelkeiten entstellten katholischen Tradition befleckt werden.
Trotzdem ist es gut, wenn man die Wahrheit über eine Sache nicht wissen kann, die Hypothese anzunehmen, die sich in dem Augenblick, wo der Zufall uns ins Leben gerufen hat, dem Verstande am unabweislichsten aufdrängt. Man kann wetten, dass sie falsch ist, aber solange man sie für wahr hält, ist sie nützlich, belebt sie die Gemüter und giebt unserer Wissbegier eine neue Richtung. Es mag auf den ersten Blick weiser erscheinen, diese feinsinnigen Hypothesen durch die einfache, tiefere Wahrheit zu ersetzen, dass wir nichts wissen. Aber diese Wahrheit wäre nur dann erspriesslich, wenn es bewiesen wäre, dass wir nie etwas wissen werden. Inzwischen würde sie uns in einer Unbeweglichkeit erhalten, die verderblicher ist, als die thörichtesten Illusionen. Wir sind so geschaffen, dass uns nichts höher und weiter trägt, als die Sprünge unserer Irrtümer. Im Grunde danken wir das Wenige, was wir wissen, den gewagtesten, oft geradezu absurden Hypothesen, die zumeist weit unkluger sind, als die heutige. Sie waren vielleicht sinnlos, aber sie haben die Glut der Erkenntnis in uns geschürt. Mag der, welcher am Herde der Herberge der Menschheit wacht, blind oder im höchsten Alter sein: was thut das dem Wanderer, der friert und sich an seine Seite setzt? Wenn das Feuer unter seiner Obhut nicht erloschen ist, so hat er gethan, was der Beste nicht besser machen könnte. Übertragen wir diese Glut, und zwar nicht wie sie ist, sondern gesteigert; und nichts kann sie so mehren, wie diese Entwickelungshypothese, die uns zwingt, alles, was auf und unter dieser Erde, in den Tiefen des Meeres und an der Veste des Himmels ist, fortan nach strengeren Methoden und mit anhaltenderer Leidenschaft zu befragen. Was giebt es zum Ersatz für sie, und was sollen wir an ihre Stelle setzen, wenn wir sie verwerfen? Etwa das grosse Geständnis der gelehrten Unwissenheit, die sich selbst erkennt, ein Geständnis, das gewöhnlich so thatlos und für die Wissbegier, die dem Menschen nötiger ist, als selbst die Weisheit, so entmutigend ist, oder die Hypothese von dem Beharren der Arten und der göttlichen Schöpfung, die noch unbewiesener ist, als die unsere, und die den lebensvollsten Teil des Problems für immer von sich abschiebt, indem sie das Unerklärliche zu befragen vermeidet?
 An diesem Aprilmorgen im
Garten, der unter dem frischen Himmelstau
zu neuem Leben erwachte,
sah ich an den Rosenbeeten und den
zitternden Primeln in ihrer Einfassung
von weissem Täschelkraut, das auch
Alysse oder Steinkraut genannt wird, die wilden
Bienen schwirren, die Urmütter der unserem Willen
und Begehren unterworfenen, und ich gedachte der
Lehren meines alten seeländischen Bienenfreundes.
Mehr als einmal ist er mit mir durch seine bunten
Blumenbeete gegangen, die so gehalten und angelegt
waren, wie zu Zeiten des Vater Cats, jenes
guten, prosaischen und unversieglichen holländischen
Dichters. Sie bildeten Rosetten, Sterne, Guirlanden,
Ohrringe und Armleuchter am Fusse einer Weissdornhecke
oder eines Obstbaumes, der als Kugel,
Pyramide oder Spindel zugeschnitten war, und die
Buchsbaumeinfassung lief wie ein wachsamer Schäferhund
um alle Ränder, um zu verhüten, dass die
Blumen auf den Weg wuchsen. Ich lernte die Namen
und Gewohnheiten der einsamen Kunstbienen
kennen, die wir nie beachten, da wir sie für gemeine
Fliegen, schädliche Wespen oder stumpfsinnige
Käfer halten. Und doch trägt eine jede von ihnen
unter ihrem doppelten Flügelpaar, das sie im Insektenlande
kennzeichnet, den Lebensplan, die Werkzeuge
und den Gedanken zu einem ganz besonderen
und oft wunderbaren Schicksal. Da sind zunächst
die nächsten Verwandten unserer Hausbiene, die
zottigen, untersetzten Hummeln, bisweilen winzig,
meist aber riesig und wie die Urmenschen in
ein unförmiges Fell gekleidet, um das sich kupferne
oder zinnoberrote Spangen schlingen. Sie
sind noch halbe Barbaren, vergewaltigen die Kelche,
zerreissen sie, wenn sie Widerstand leisten, und
dringen unter die atlasschimmernden Schleier der
Blumenkronen, wie ein Höhlenbär unter das seiden-
und perlenglänzende Zelt einer byzantinischen Prinzessin.
An diesem Aprilmorgen im
Garten, der unter dem frischen Himmelstau
zu neuem Leben erwachte,
sah ich an den Rosenbeeten und den
zitternden Primeln in ihrer Einfassung
von weissem Täschelkraut, das auch
Alysse oder Steinkraut genannt wird, die wilden
Bienen schwirren, die Urmütter der unserem Willen
und Begehren unterworfenen, und ich gedachte der
Lehren meines alten seeländischen Bienenfreundes.
Mehr als einmal ist er mit mir durch seine bunten
Blumenbeete gegangen, die so gehalten und angelegt
waren, wie zu Zeiten des Vater Cats, jenes
guten, prosaischen und unversieglichen holländischen
Dichters. Sie bildeten Rosetten, Sterne, Guirlanden,
Ohrringe und Armleuchter am Fusse einer Weissdornhecke
oder eines Obstbaumes, der als Kugel,
Pyramide oder Spindel zugeschnitten war, und die
Buchsbaumeinfassung lief wie ein wachsamer Schäferhund
um alle Ränder, um zu verhüten, dass die
Blumen auf den Weg wuchsen. Ich lernte die Namen
und Gewohnheiten der einsamen Kunstbienen
kennen, die wir nie beachten, da wir sie für gemeine
Fliegen, schädliche Wespen oder stumpfsinnige
Käfer halten. Und doch trägt eine jede von ihnen
unter ihrem doppelten Flügelpaar, das sie im Insektenlande
kennzeichnet, den Lebensplan, die Werkzeuge
und den Gedanken zu einem ganz besonderen
und oft wunderbaren Schicksal. Da sind zunächst
die nächsten Verwandten unserer Hausbiene, die
zottigen, untersetzten Hummeln, bisweilen winzig,
meist aber riesig und wie die Urmenschen in
ein unförmiges Fell gekleidet, um das sich kupferne
oder zinnoberrote Spangen schlingen. Sie
sind noch halbe Barbaren, vergewaltigen die Kelche,
zerreissen sie, wenn sie Widerstand leisten, und
dringen unter die atlasschimmernden Schleier der
Blumenkronen, wie ein Höhlenbär unter das seiden-
und perlenglänzende Zelt einer byzantinischen Prinzessin.
Neben ihnen, und grösser als die grösste unter ihnen, steht ein in Finsternis gehülltes Ungetüm, von düsterem Feuer glühend, grün und violett: die Holzbiene (Xylocopa violacea), der Riese in der Bienenwelt. Ihr folgen in der Grösse die ernsten Mörtelbienen (Chalicodoma), die in Schwarz gekleidet sind und sich aus Lehm und Kies Wohnungen erbauen, die hart wie Stein sind. Dann kommen mit einander die Bürsten- oder Hosenbienen (Dasypoda) und die wespenähnlichen Ballenbienen (Halictus), die Erd- oder Sandbienen (Andrena), die oft einem phantastischen Schmarotzer zum Opfer fallen, dem Stylops, der ihr Aussehen vollständig verändert, die zwerghaften, stets schwer mit Pollen beladenen Grabbienen und die vielgestaltigen Osmien (Mauerbienen), die hundert verschiedene Industriezweige haben. Eine von ihnen, die Osmia papaveris, begnügt sich nicht mit dem Brot und Wein, den ihr die Blumen liefern, sie schneidet sich auch grosse Purpurlappen aus den Mohnblumen heraus, um damit den Palast ihrer Töchter fürstlich auszutapezieren. Eine andere Biene, die kleinste von allen, ein Staubkorn, das auf vier elektrisch bewegten Flügeln schwebt, der Blattschneider (Megachile centuncularis), sägt haarscharfe Halbkreise, die man mit der Maschine ausgeschnitten meint, aus den Rosenblättern, faltet sie zusammen und formt daraus jene wundervoll regelmässig zusammengesetzten fingerhutförmigen Zellen, deren jede zur Aufnahme einer Larve dient. Aber ein Buch würde kaum genügen, um die mannigfachen Gewohnheiten und Talente der honigsuchenden Schaar aufzuzählen, die sich in jedem Sinne auf begierigen und unthätigen Blüten tummelt, wie zwischen geketteten Brautpaaren, die der Liebesbotschaft harren, welche zerstreute Gäste ihnen bringen.
 Man kennt etwa 4500 wilde
Bienenarten. Wir werden sie selbstredend
nicht alle durchgehen. Vielleicht
wird eines Tages ein gründlicheres
Studium in Verbindung mit
Beobachtungen und Experimenten,
die noch nicht gemacht sind, und die mehr als ein
Menschenleben in Anspruch nehmen würden, ein
entscheidendes Licht auf die Entwickelungsgeschichte
der Bienen werfen. Diese Geschichte ist meines
Wissens noch nicht methodisch geschrieben worden.
Und doch ist dies zu wünschen, denn es würde
damit mehr als ein Problem berührt, das ebenso
gross ist, wie die vieler Geschichten der Menschheit.
Was uns betrifft, so wollen wir keine Behauptungen
mehr aufstellen, denn wir betreten
hier das dunkle Gebiet der Vermutungen, sondern
wir wollen uns damit begnügen, einem Zweige der
Immen auf seinem Wege zu einem durchgeistigteren
Dasein, zu etwas mehr Wohlstand und Sicherheit
zu folgen und die springenden Punkte dieses
mehrtausendjährigen Aufstieges mit einfachen Strichen
anzudeuten. Der Zweig, den wir verfolgen
wollen, ist, wie wir schon wissen, der der Apinen[17],
deren Merkmale so genau bestimmt und
deutlich sind, dass ihre Abkunft von einem gemeinsamen
Ahnen nicht unwahrscheinlich ist.
Man kennt etwa 4500 wilde
Bienenarten. Wir werden sie selbstredend
nicht alle durchgehen. Vielleicht
wird eines Tages ein gründlicheres
Studium in Verbindung mit
Beobachtungen und Experimenten,
die noch nicht gemacht sind, und die mehr als ein
Menschenleben in Anspruch nehmen würden, ein
entscheidendes Licht auf die Entwickelungsgeschichte
der Bienen werfen. Diese Geschichte ist meines
Wissens noch nicht methodisch geschrieben worden.
Und doch ist dies zu wünschen, denn es würde
damit mehr als ein Problem berührt, das ebenso
gross ist, wie die vieler Geschichten der Menschheit.
Was uns betrifft, so wollen wir keine Behauptungen
mehr aufstellen, denn wir betreten
hier das dunkle Gebiet der Vermutungen, sondern
wir wollen uns damit begnügen, einem Zweige der
Immen auf seinem Wege zu einem durchgeistigteren
Dasein, zu etwas mehr Wohlstand und Sicherheit
zu folgen und die springenden Punkte dieses
mehrtausendjährigen Aufstieges mit einfachen Strichen
anzudeuten. Der Zweig, den wir verfolgen
wollen, ist, wie wir schon wissen, der der Apinen[17],
deren Merkmale so genau bestimmt und
deutlich sind, dass ihre Abkunft von einem gemeinsamen
Ahnen nicht unwahrscheinlich ist.
Darwins Schüler, insbesondere Hermann Müller, halten eine kleine wilde Biene, die in der ganzen Welt vorkommt, die Prosopis, für den gegenwärtigen Repräsentanten der Urbiene, von der alle uns bekannten Arten abstammen sollen.
Die arme Prosopis steht zu den Hausbienen in etwa dem Verhältnis, wie der Höhlenmensch zum glücklichen Grossstadtbewohner. Vielleicht hat jeder von uns, ohne darauf zu achten, und ohne zu ahnen, dass er hier die ehrwürdige Urmutter vor sich hat, der wir vielleicht die Mehrzahl unserer Blumen und Früchte verdanken – denn man glaubt thatsächlich, dass über hunderttausend Pflanzenarten nicht mehr sein würden, wenn die Bienen sie nicht beflögen und dadurch befruchteten – und wer weiss? vielleicht auch unsere Zivilisation, denn alles greift bei diesen Mysterien in einander über – vielleicht hat jeder von uns sie schon öfter in einem entlegenen Winkel seines Gartens um Gestrüpp herumfliegen sehen. Sie ist hübsch und lebhaft, und die, welche in Frankreich am häufigsten vorkommt, ist elegant mit weiss auf schwarzem Grund gesprenkelt. Aber unter dieser Eleganz verbirgt sich eine unglaubliche Armut. Sie führt ein Hungerleben. Sie ist fast nackt, während ihre Schwestern in warme, prächtige Pelze gekleidet sind. Sie hat keine Schenkelkörbchen zum Einsammeln von Pollen, wie die Apiden, oder an ihrer statt Schienenbürsten, wie die Andrenen, oder Bauchbürsten wie die Bauchsammler. Sie muss den Blumenstaub mit ihren kleinen Krallen hervorscharren und verschlucken, um ihn einzutragen. Sie hat kein anderes Werkzeug, als ihre Zunge, ihren Mund und ihre Füsse, aber die Zunge ist zu kurz, ihre Füsse sind schwächlich und ihre Kauwerkzeuge ohne Kraft. Sie kann weder Wachs erzeugen, noch Löcher in Holz bohren oder in die Erde graben. Sie legt ungeschickte Gänge im weichen Mark der trockenen Brombeeren an, baut ein paar grobe Zellen hinein, versieht sie mit etwas Nahrung für die Brut, die sie nie erblicken wird, und nach Erledigung dieser armseligen Aufgabe, deren Ziel sie nicht kennt, ebensowenig wie wir es kennen, stirbt sie, einsam auf dieser Welt, wie sie gelebt hat, in einem Winkel.
 Wir übergehen viele Zwischenstufen,
wo die Zunge allmählich
länger wird, um einer immer grösseren
Zahl von Blumenkelchen ihren
Nektar zu entreissen, wo sich Sammelwerkzeuge
für Pollen, Haare und
Franzen, Schenkel-, Fersen- und Bauchbürsten bilden
und entwickeln, wo die Füsse und Kinnbacken
kräftiger werden, während nützliche Ausscheidungen
des Körpers eintreten und über dem Wohnungsbau
ein Geist schwebt, der erstaunliche Verbesserungen
aller Art zu suchen und zu finden weiss. Dies darzustellen,
würde ein Buch für sich beanspruchen. Ich will
nur ein Kapitel daraus skizzieren oder noch weniger
als ein Kapitel, eine Seite, die uns das Zaudern und
Tasten des Lebenswillens in seinem Trachten nach
Glück und die langsame Entstehung, das Wachstum
und die Selbstgestaltung der sozialen Vernunft zeigt.
Wir übergehen viele Zwischenstufen,
wo die Zunge allmählich
länger wird, um einer immer grösseren
Zahl von Blumenkelchen ihren
Nektar zu entreissen, wo sich Sammelwerkzeuge
für Pollen, Haare und
Franzen, Schenkel-, Fersen- und Bauchbürsten bilden
und entwickeln, wo die Füsse und Kinnbacken
kräftiger werden, während nützliche Ausscheidungen
des Körpers eintreten und über dem Wohnungsbau
ein Geist schwebt, der erstaunliche Verbesserungen
aller Art zu suchen und zu finden weiss. Dies darzustellen,
würde ein Buch für sich beanspruchen. Ich will
nur ein Kapitel daraus skizzieren oder noch weniger
als ein Kapitel, eine Seite, die uns das Zaudern und
Tasten des Lebenswillens in seinem Trachten nach
Glück und die langsame Entstehung, das Wachstum
und die Selbstgestaltung der sozialen Vernunft zeigt.
Wir haben gesehen, wie die unglückliche Prosopis in dieser ungeheuren Welt voll schrecklicher Gefahren ihr kleines einsames Leben schweigend erträgt. Eine gewisse Anzahl ihrer Schwestern, die zu Rassen mit besseren Werkzeugen und grösserer Gewandtheit gehören, wie z. B. die reich gekleideten Seidenbienen (Colletes) oder die sonderbaren Blattschneider des Rosenstockes (Megachile centuncularis), leben in derselben tiefen Vereinsamung, und wenn zufällig ein anderes Wesen mit ihnen zusammenwohnt und ihr Obdach teilt, so ist es ein Feind oder gar ein Schmarotzer. Denn die Bienenwelt ist mit weit absonderlicheren Gespenstern bevölkert als die unsere, und manche Art hat einen geheimnisvollen, unthätigen Doppelgänger, der dem von ihm auserkorenen Opfer in allen Stücken gleicht, ausser dass er durch seine unvordenkliche Faulheit alle Arbeitswerkzeuge nacheinander verloren hat und nur noch auf Kosten des emsigen Typus seiner Rasse leben kann.[18]
Indessen regt sich schon bei den Bienenarten, die man etwas zu kategorisch als „einsame Bienen“ bezeichnet, der soziale Instinkt wie eine unter dem Druck der auf allem primitiven Leben lastenden Materie erstickte Flamme. Hier und da, an unvermuteter Stelle, züngelt er in furchtsamer und bisweilen bizarrer Weise, wie um zu zeigen, dass er da ist, allmählich aus dem auf ihm lastenden Holzstoss hervor, der eines Tages seinem Triumphe die Nahrung zuführen wird.
Wenn alles auf Erden Stoff ist, so kann man hier die unstofflichste Bewegung des Stoffes beobachten. Es handelt sich um den Übergang vom egoistischen, unsicheren, unvollkommenen Leben zum brüderlichen, etwas gesicherteren und glücklicheren Dasein. Es handelt sich darum, im Geiste zu vereinigen, was in der Körperwelt getrennt ist, die Selbstverleugnung des Individuums zu Gunsten der Art und die Ersetzung des Sichtbaren durch das Unsichtbare anzubahnen. Ist es da erstaunlich, dass den Bienen das, was wir von unserem privilegierten Platze aus noch nicht erreicht haben, von dem der Instinkt nach allen Seiten ins Bewusstsein strahlt – dass den Bienen das nicht mit einem Schlage gelingt? Es ist wunderbar, fast rührend zu sehen, wie die neue Idee zuerst in der Finsternis tastet, die alles auf Erden Entstehende umhüllt. Sie geht aus der Materie hervor und ist noch ganz Materie. Sie ist nichts als Hunger, Furcht und Kälte, in etwas noch Gestaltloseres umgesetzt. Sie schleicht unsicher um die grossen Gefahren, die langen Nächte, den Einbruch des Winters und einen zweideutigen Schlaf herum, der schon fast Tod ist.
 Holzbienen (Xylocopa) sind
starke Bienen, die ihr Nest in trockenes
Holz graben. Sie leben immer
einsam. Trotzdem kommt es gegen
Ende des Sommers vor, dass man
einige Exemplare einer besonderen
Art, der Xylocopa cyanescens, in einem Asphodelenkelche
frostig bei einander kauern sieht, um
den Winter gemeinsam zu verbringen. Diese zögernde
Brüderlichkeit ist eine Ausnahme bei den
Holzbienen; aber bei ihren nächsten Verwandten,
den Ceratinen, wird sie schon zur unveränderlichen
Gewohnheit. Hier kommt die Idee zum Vorschein.
Sofort hält sie wieder inne, und bis hierher ist sie
bei den Holzbienen über die erste dunkle Linie der
Liebe nicht hinausgekommen.
Holzbienen (Xylocopa) sind
starke Bienen, die ihr Nest in trockenes
Holz graben. Sie leben immer
einsam. Trotzdem kommt es gegen
Ende des Sommers vor, dass man
einige Exemplare einer besonderen
Art, der Xylocopa cyanescens, in einem Asphodelenkelche
frostig bei einander kauern sieht, um
den Winter gemeinsam zu verbringen. Diese zögernde
Brüderlichkeit ist eine Ausnahme bei den
Holzbienen; aber bei ihren nächsten Verwandten,
den Ceratinen, wird sie schon zur unveränderlichen
Gewohnheit. Hier kommt die Idee zum Vorschein.
Sofort hält sie wieder inne, und bis hierher ist sie
bei den Holzbienen über die erste dunkle Linie der
Liebe nicht hinausgekommen.
Bei anderen Apinen nimmt die sich noch suchende Idee andere Gestalt an. Die Mörtelbienen (Chalicodoma) oder Maurerbienen, die Bürstenbienen (Dasypoda) und Ballenbienen (Halictus) vereinigen sich in zahlreichen Kolonien zum Nesterbau. Aber dies ist ein illusorisches Gemeinwesen von lauter Einsiedlern. Keinerlei Einvernehmen, keine gemeinsame That. Eine jede ist in der Menge tief vereinsamt und baut sich ihre Wohnung für sich selbst, ohne sich um ihre Nachbaren zu kümmern. „Es ist“, sagt J. Perez, „ein einfaches Zusammenkommen von Einzelwesen, die derselbe Geschmack, dieselben Fähigkeiten am gleichen Platze versammeln, wo der Grundsatz ‚jeder für sich‘ auf das strengste durchgeführt wird. Es ist ein Schwarm von Arbeitern, der lediglich durch seinen Fleiss und seine Zahl an einen Bienenstock erinnert. Solche Vereinigungen sind also die einfache Folge einer grossen Zahl von Einzelwesen, die auf demselben Fleck wohnen.“
Aber bei den Grabbienen, den Vettern der Dasypoden, dringt plötzlich ein kleiner Lichtstrahl hervor und wirft einen Schein auf die Entstehung eines neuen Gefühls in dem zufälligen Beieinander. Sie vereinigen sich nach Art der vorigen, und jede gräbt ihre eigene unterirdische Höhle für sich, aber der Eingang, das von der Erdoberfläche nach ihren getrennten Behausungen führende Schlupfloch, ist gemeinsam. „So beträgt sich jede“, sagt Perez, „was die Arbeit in den Zellen betrifft, wie wenn sie allein wäre, aber alle benutzen den gemeinsamen Zugang und benutzen so die Arbeit einer einzigen, wodurch sie die Zeit und Mühe sparen, sich jede einen besonderen Gang anzulegen. Es wäre interessant festzustellen, ob diese vorläufige Arbeit selbst nicht gemeinsam ausgeführt wird, und ob sich nicht verschiedene Weibchen abwechselnd darin ablösen.“
Wie dem aber auch sei, die Idee der Brüderlichkeit ist einmal durch die Mauer gedrungen, die zwei Welten schied. Es ist nicht mehr der Winter, der Hunger oder die Todesfurcht, der sie dem Instinkt in entstellter und thörichter Form abzwingt, es ist das thätige Leben, das sie einflüstert. Aber auch diesmal kommt sie nicht weit in dieser Richtung. Trotzdem verzagt sie nicht, sie versucht andere Wege einzuschlagen. So dringt sie bei den Hummeln durch, nimmt in ihrer veränderten Atmosphäre Gestalt an, reift und bewirkt die ersten entscheidenden Wunder.
 Die Hummeln, diese grossen,
zottigen, geräuschvollen, furchteinflössenden
und doch so friedfertigen
Bienen, die wir alle kennen, sind zunächst
einsam. Von den ersten Tagen
des März an beginnt das fruchtbare,
überwinterte Weibchen sein Nest zu bauen, entweder
unterirdisch oder in einem Busche, je nach
der Art, zu der es gehört. Es ist allein auf der
Welt im erwachenden Lenze. Es räumt die gewählte
Stelle auf, gräbt ein Loch und tapeziert es
aus. Dann legt es ziemlich unförmige Wachszellen
an, versieht sie mit Honig und Pollen, legt Eier,
bebrütet sie, pflegt und ernährt die auskriechenden
Larven und sieht sich alsbald von einer Töchterschaar
umgeben, die bei allen inneren und äusseren
Arbeiten Hand anlegt und zum Teil gleichfalls Eier
legt. Der Wohlstand nimmt zu, der Zellenbau wird
besser, die Kolonie wächst. Die Gründerin bleibt
die Seele und Hauptmutter des Ganzen und steht
an der Spitze eines Königreiches, das schon ein
Ansatz zu dem unserer Hausbiene ist. Übrigens
ein recht grober Ansatz. Der Wohlstand ist beschränkt,
die Gesetze sind unklar und werden schlecht
befolgt, der Kannibalismus und Kindermord der Urzeit
tauchen immer wieder auf, die Architektur ist
formlos und weitläufig, aber was beide Stadtbildungen
am meisten unterscheidet, ist, dass die eine permanent
und die andere vorübergehend ist. In der
That verschwindet die Hummelstadt im Herbst
vollständig, ihre drei- bis vierhundert Bewohner
sterben, ohne eine Spur ihres Daseins zu hinterlassen,
all ihre Arbeit ist umsonst; es überwintert
nur ein einziges Weibchen, das im nächsten Frühjahr
in derselben Einsamkeit und Armut die fruchtlose
Arbeit der Mutter wieder aufnehmen wird.
Nichtsdestoweniger ist die Idee sich hier ihrer
Kraft bewusst geworden. Wir sehen sie bei den
Hummeln diese Grenze nicht überschreiten, aber
sogleich wird sie sich, ihrer Gewohnheit getreu,
in einer Art von unermüdlicher Seelenwanderung
inkarnieren, noch zitternd über ihren letzten Triumph,
aber allmächtig und fast vollkommen, und zwar in
einer anderen Sippe, der vorletzten der Rasse, der
unmittelbaren Vorgängerin unserer Hausbiene, die
ihre Krone bildet, nämlich in der Sippe der Meliponiten,
die in die tropischen Meliponen und Trigonen
zerfällt.
Die Hummeln, diese grossen,
zottigen, geräuschvollen, furchteinflössenden
und doch so friedfertigen
Bienen, die wir alle kennen, sind zunächst
einsam. Von den ersten Tagen
des März an beginnt das fruchtbare,
überwinterte Weibchen sein Nest zu bauen, entweder
unterirdisch oder in einem Busche, je nach
der Art, zu der es gehört. Es ist allein auf der
Welt im erwachenden Lenze. Es räumt die gewählte
Stelle auf, gräbt ein Loch und tapeziert es
aus. Dann legt es ziemlich unförmige Wachszellen
an, versieht sie mit Honig und Pollen, legt Eier,
bebrütet sie, pflegt und ernährt die auskriechenden
Larven und sieht sich alsbald von einer Töchterschaar
umgeben, die bei allen inneren und äusseren
Arbeiten Hand anlegt und zum Teil gleichfalls Eier
legt. Der Wohlstand nimmt zu, der Zellenbau wird
besser, die Kolonie wächst. Die Gründerin bleibt
die Seele und Hauptmutter des Ganzen und steht
an der Spitze eines Königreiches, das schon ein
Ansatz zu dem unserer Hausbiene ist. Übrigens
ein recht grober Ansatz. Der Wohlstand ist beschränkt,
die Gesetze sind unklar und werden schlecht
befolgt, der Kannibalismus und Kindermord der Urzeit
tauchen immer wieder auf, die Architektur ist
formlos und weitläufig, aber was beide Stadtbildungen
am meisten unterscheidet, ist, dass die eine permanent
und die andere vorübergehend ist. In der
That verschwindet die Hummelstadt im Herbst
vollständig, ihre drei- bis vierhundert Bewohner
sterben, ohne eine Spur ihres Daseins zu hinterlassen,
all ihre Arbeit ist umsonst; es überwintert
nur ein einziges Weibchen, das im nächsten Frühjahr
in derselben Einsamkeit und Armut die fruchtlose
Arbeit der Mutter wieder aufnehmen wird.
Nichtsdestoweniger ist die Idee sich hier ihrer
Kraft bewusst geworden. Wir sehen sie bei den
Hummeln diese Grenze nicht überschreiten, aber
sogleich wird sie sich, ihrer Gewohnheit getreu,
in einer Art von unermüdlicher Seelenwanderung
inkarnieren, noch zitternd über ihren letzten Triumph,
aber allmächtig und fast vollkommen, und zwar in
einer anderen Sippe, der vorletzten der Rasse, der
unmittelbaren Vorgängerin unserer Hausbiene, die
ihre Krone bildet, nämlich in der Sippe der Meliponiten,
die in die tropischen Meliponen und Trigonen
zerfällt.
 Hier ist bereits Alles so organisiert,
wie in unserem Bienenstocke:
eine einzige Mutter[19], unfruchtbare
Arbeiterinnen und Drohnen.
Einige Einzelheiten sind sogar besser
eingerichtet. Die Drohnen sind z. B.
nicht vollständig müssig, sie schwitzen Wachs aus.
Das Eingangsthor ist sorgfältiger geschlossen, in
kalten Nächten durch eine Thür, in warmen durch
eine Art von Vorhang, der die Luft durchlässt.
Hier ist bereits Alles so organisiert,
wie in unserem Bienenstocke:
eine einzige Mutter[19], unfruchtbare
Arbeiterinnen und Drohnen.
Einige Einzelheiten sind sogar besser
eingerichtet. Die Drohnen sind z. B.
nicht vollständig müssig, sie schwitzen Wachs aus.
Das Eingangsthor ist sorgfältiger geschlossen, in
kalten Nächten durch eine Thür, in warmen durch
eine Art von Vorhang, der die Luft durchlässt.
Aber das Gemeinwesen ist weniger stark, das gemeinsame Leben weniger gesichert, das Gedeihen beschränkter als bei unseren Bienen, und überall, wo man diese einführt, beginnen die Meliponiten vor ihnen zu weichen. Der Gedanke der Brüderlichkeit ist bei ihren beiden Stämmen gleichfalls prächtig entwickelt, nur in einem Punkte ist er bei dem einen nicht über das hinausgekommen, was im engen Familienbau der Hummeln schon erreicht war. Es ist dies die mechanische Organisation der gemeinsamen Arbeit, das genaue Haushalten mit den Kräften, mit einem Worte, die Architektur der Stadt, die hier offenbar noch sehr rückständig ist.[20] Hinzugefügt sei noch, dass bei unseren Apiten alle Zellen sowohl zur Aufziehung der Brut wie zur Aufspeicherung der Vorräte geeignet sind, und ebensolange vorhalten, wie die Stadt selbst, während sie bei den Meliponiten nur zu einem bestimmten Zwecke benutzt, und wenn sie den jungen Nymphen zur Wiege dienen, nach deren Auskriechen abgetragen werden.
Bei unserer Hausbiene hat dieser Gedanke also seine vollkommenste Form erreicht, und somit wäre das rasch entworfene und unvollständige Bild seines Entwickelungsganges hier beendet. Sind nun aber die einzelnen Stufen dieses Entwickelungsganges bei jeder Art konstant, und besteht die Verbindungslinie zwischen ihnen nur in unserer Vorstellung? Wir wollen auf diesem noch wenig erforschten Gebiete keine voreiligen Schlüsse wagen. Begnügen wir uns zunächst mit vorläufigen Annahmen, und neigen wir, wenn wir wollen, lieber den hoffnungsvollsten zu, denn wenn es unbedingt zu wählen gälte, so zeigt uns hier und dort ein schwacher Schein, dass die am meisten herbeigewünschten die gewissesten sein werden. Überdies müssen wir wieder einmal eingestehen, dass wir garnichts wissen. Wir fangen erst an, die Augen zu öffnen. Tausend Versuche, die gemacht werden könnten, haben noch nicht stattgefunden. Wäre es z. B. nicht möglich, dass die Prosopis, wenn sie in Gefangenschaft gehalten und gezwungen würden, mit ihresgleichen zu hausen, mit der Zeit die Eisenschwelle der vollkommenen Einsamkeit überschreiten und Freude daran finden würden, sich wie die Hosenbienen zu vereinigen und einen Schritt zur Brüderlichkeit zu thun, wie die Grabbienen? Und diese wiederum, würden sie unter abnormen, aufgezwungenen Verhältnissen den gemeinsamen Schlupfgang nicht mit einer gemeinsamen Wohnung vertauschen? Würden die Hummelmütter, wenn sie zusammen überwintert und in Gefangenschaft aufgezogen und gefüttert würden, sich nicht schliesslich zur Arbeitsteilung verstehen? Hat man den Meliponiten je Kunstwaben gegeben? Hat man ihnen künstliche Gefässe gegeben, um ihre sonderbaren „Honigtöpfe“ zu ersetzen? Würden sie dieselben annehmen und sich zu Nutze machen, und wie würden sie ihre Gewohnheiten dieser ungewohnten Bauart anpassen? Dergleichen Fragen sind an sehr kleine Wesen gerichtet und schliessen doch die Lösung unserer grössten Geheimnisse ein. Wir können nicht darauf antworten, denn unsere Erfahrung ist von gestern und ehegestern. Von Réaumur an gerechnet, ist es jetzt kaum anderthalb Jahrhunderte her, dass man die Gewohnheiten gewisser wilder Bienen studiert hat. Réaumur kannte nur einen Teil davon, wir haben einige andere beobachtet, aber hunderte, vielleicht tausende, sind bis heute nur von unwissenden oder hastigen Reisenden befragt worden. Die, welche wir seit den schönen Arbeiten des Verfassers der „Mémoires“ kennen, haben an ihren Gewohnheiten nichts geändert, und die Hummeln, die sich in den Gärten von Charenton voll Honig sogen und wie ein köstliches Murmeln des Sonnenlichtes goldbestäubt umhersummten, glichen in jedem Punkte denen, die sich im nächsten April einige Schritte weiter in den Wäldern von Vincennes tummeln werden. Aber von Réaumur bis auf unsere Tage ist es nur ein Augenzwinkern der Zeit, das wir beobachten, und mehrere Menschenleben hintereinander bilden nur eine Sekunde in der Geschichte eines Naturgedankens.
 Wenn der Gedanke der Gesellschaftsbildung,
dessen schrittweiser
Verwirklichung wir in diesem
Buche mit den Augen gefolgt sind,
seine vollkommenste Gestalt bei unseren
Hausbienen erreicht hat, so ist damit
nicht gesagt, dass im Bienenstock alles auf der
Höhe sei. Ein Meisterstück, die sechseckige Zelle,
erreicht freilich die absolute Vollkommenheit in jeder
Hinsicht, und alle Genies zusammen könnten nichts
mehr daran verbessern. Kein lebendes Wesen, selbst
der Mensch nicht, hat in seiner Sphäre das erreicht,
was die Biene in der ihren verwirklicht hat, und
wenn ein Geist aus einer anderen Welt auf die
Erde herabstiege und die vollkommenste Schöpfung
der Logik des Lebens zu sehen begehrte, so müsste
man ihm die schlichte Honigwabe zeigen.
Wenn der Gedanke der Gesellschaftsbildung,
dessen schrittweiser
Verwirklichung wir in diesem
Buche mit den Augen gefolgt sind,
seine vollkommenste Gestalt bei unseren
Hausbienen erreicht hat, so ist damit
nicht gesagt, dass im Bienenstock alles auf der
Höhe sei. Ein Meisterstück, die sechseckige Zelle,
erreicht freilich die absolute Vollkommenheit in jeder
Hinsicht, und alle Genies zusammen könnten nichts
mehr daran verbessern. Kein lebendes Wesen, selbst
der Mensch nicht, hat in seiner Sphäre das erreicht,
was die Biene in der ihren verwirklicht hat, und
wenn ein Geist aus einer anderen Welt auf die
Erde herabstiege und die vollkommenste Schöpfung
der Logik des Lebens zu sehen begehrte, so müsste
man ihm die schlichte Honigwabe zeigen.
Aber wie gesagt, es steht nicht alles auf gleicher Höhe. Wir sind schon einigen Fehlern und Irrtümern begegnet, die bisweilen auffällig, bisweilen geheimnisvoll sind, wie der Überfluss an müssigen und verderblichen Drohnen, die jungfräuliche Zeugung, die Gefahren des Hochzeitsausfluges, das Schwarmfieber, der Mangel an Mitleid, die geradezu ungeheuerliche Aufopferung des Individuums zu Gunsten der Art. Dazu käme noch eine seltsame Vorliebe zum Aufspeichern unmässiger Quantitäten von Pollen, die unbenutzt bleiben und daher ranzig und hart werden und die Waben verstopfen, ferner das lange unfruchtbare Interregnum, das vom ersten Schwärmen bis zur Befruchtung der zweiten Königin reicht, u. a. m.
Von diesen Fehlern ist der schwerste und der einzige, der unter unseren Himmelsstrichen fast immer verhängnisvoll wird, das wiederholte Schwärmen. Aber vergessen wir nicht, dass in dieser Hinsicht die natürliche Auslese der Hausbiene seit Jahrtausenden vom Menschen gekreuzt wird. Vom Ägypter der Pharaonenzeit bis zu unserm heutigen Bauern hat der Bienenzüchter den Wünschen und dem Vorteil der Gattung stets zuwider gehandelt. Die Bienenstöcke, die am besten gedeihen, sind die, welche zu Beginn des Sommers einen einzigen Schwarm aussenden. Sie befriedigen damit ihren mütterlichen Instinkt, sichern die Erhaltung des Stammes durch die notwendige Erneuerung der Königin, und ebenso die Zukunft des Schwarmes, der volkreich und früh abgesandt ist und darum Zeit hat, sich eine dauerhafte und mit Vorräten wohl versehene Wohnung anzulegen, ehe der Herbst kommt. Es ist klar, dass wenn die Bienen sich selbst überlassen wären, nur diese Stöcke und ihre Ableger aus den Prüfungen des Winters lebend hervorgegangen wären, während die von anderen Instinkten beseelten Völker ihnen fast regelmässig erliegen würden, und dass sich die Regel des beschränkten Schwärmens bei unsern nördlichen Rassen dadurch fast durchgehends herausgebildet hätte. Aber es sind gerade diese weitblickenden, reichen und wohl akklimatisierten Stöcke, die der Mensch stets vernichtet hat, um sich ihres Schatzes zu bemächtigen. Er liess und lässt auch heute noch in der hergebrachten Praxis nur die Stämme und Kolonien am Leben, die erschöpft sind, die zweiten und dritten (Nach-)Schwärme, die gerade soviel haben, um den Winter zu überdauern, oder denen er einige Honigabfälle giebt, um ihre kläglichen Vorräte zu vervollständigen. Das Resultat davon ist wahrscheinlich eine Schwächung der Rasse und eine erbliche Neigung zum Schwarmfieber, sodass heute fast alle unsere Bienen, insbesondere unsere schwarzen Bienen, zu viel schwärmen. Seit einigen Jahren wird diese gefährliche Angewohnheit durch die neuen Methoden der Mobilzucht bekämpft, und wenn man sieht, mit welcher Schnelligkeit die künstliche Auslese auf die meisten unserer Haustiere, Rinder, Schafe, Hunde, Pferde und Tauben wirkt, – um nicht noch mehr zu nennen, – so darf man der Hoffnung Raum geben, dass wir in kurzem eine Bienenrasse haben werden, die auf das natürliche Schwärmen fast ganz verzichtet und ihre ganze Thätigkeit der Honig- und Pollenernte zuwendet.
 Aber was die anderen Fehler
betrifft: würde ein Verstand, dem
Zweck und Ziel des Gesellschaftslebens
deutlicher wäre, sich nicht
davon befreien können? Es wäre
viel über diese Fehler zu sagen, die
bald aus den unbekannten Tiefen des Bienenstockes
hervordringen, bald nichts als eine Folge des Schwärmens
und seiner Irrtümer sind, an denen wir mitschuldig
sind. Aber nach dem, was man bisher
gesehen hat, kann jeder nach seinem Geschmack
den Bienen alle Intelligenz zu- oder absprechen.
Ich will sie nicht verteidigen. Mich deucht, sie
zeigen unter manchen Verhältnissen ein Einvernehmen,
aber wenn sie auch alles, was sie thun,
nur blindlings thäten, meine Wissbegier würde
darum nicht kleiner werden. Es ist so anziehend
zu sehen, wie ein Gehirn in sich die ausserordentlichen
Hilfsquellen entdeckt, um gegen Frost, Hunger,
Tod, Zeit, Raum, Einsamkeit und alle Feinde der
belebten Materie anzukämpfen, aber wenn es einem
Wesen gelingt, sein kleines verwickeltes und tiefes
Leben zu erhalten, ohne den Instinkt zu überschreiten,
ohne etwas zu thun, was nicht ganz gewöhnlich
ist: das dünkt mich erst recht anziehend
und ausserordentlich. Das Gewöhnliche und das
Wunderbare fliessen in einander über und halten
sich die Wage, sobald man sie auf ihren wirklichen
Platz in der Natur stellt. Nicht mehr sie, die Träger
angemasster Namen, sondern das Unerklärliche
und Unverstandene ist es, was unsere Blicke auf
sich lenken, unsere Thätigkeit belohnen und unseren
Gedanken, Worten und Gefühlen eine neue, gerechtere
Form verleihen soll. Es ist Weisheit darin,
sich mit nichts weiter zu befassen.
Aber was die anderen Fehler
betrifft: würde ein Verstand, dem
Zweck und Ziel des Gesellschaftslebens
deutlicher wäre, sich nicht
davon befreien können? Es wäre
viel über diese Fehler zu sagen, die
bald aus den unbekannten Tiefen des Bienenstockes
hervordringen, bald nichts als eine Folge des Schwärmens
und seiner Irrtümer sind, an denen wir mitschuldig
sind. Aber nach dem, was man bisher
gesehen hat, kann jeder nach seinem Geschmack
den Bienen alle Intelligenz zu- oder absprechen.
Ich will sie nicht verteidigen. Mich deucht, sie
zeigen unter manchen Verhältnissen ein Einvernehmen,
aber wenn sie auch alles, was sie thun,
nur blindlings thäten, meine Wissbegier würde
darum nicht kleiner werden. Es ist so anziehend
zu sehen, wie ein Gehirn in sich die ausserordentlichen
Hilfsquellen entdeckt, um gegen Frost, Hunger,
Tod, Zeit, Raum, Einsamkeit und alle Feinde der
belebten Materie anzukämpfen, aber wenn es einem
Wesen gelingt, sein kleines verwickeltes und tiefes
Leben zu erhalten, ohne den Instinkt zu überschreiten,
ohne etwas zu thun, was nicht ganz gewöhnlich
ist: das dünkt mich erst recht anziehend
und ausserordentlich. Das Gewöhnliche und das
Wunderbare fliessen in einander über und halten
sich die Wage, sobald man sie auf ihren wirklichen
Platz in der Natur stellt. Nicht mehr sie, die Träger
angemasster Namen, sondern das Unerklärliche
und Unverstandene ist es, was unsere Blicke auf
sich lenken, unsere Thätigkeit belohnen und unseren
Gedanken, Worten und Gefühlen eine neue, gerechtere
Form verleihen soll. Es ist Weisheit darin,
sich mit nichts weiter zu befassen.
 Wir sind überdies garnicht
im stande, die Fehler der Bienen im
Namen unserer Intelligenz zu richten.
Sehen wir nicht, wie lange Intelligenz
und Bewusstsein bei uns inmitten von
Fehlern und Irrtümern leben, ohne
sie zu bemerken, und länger noch, ohne ihnen abzuhelfen?
Wenn es ein Wesen giebt, das durch
seine Bestimmung besonders, ja fast organisch, berufen
scheint, sich aller Dinge bewusst zu werden,
das Gesellschaftsleben nach den Regeln der reinen
Vernunft zu gestalten und zu leben, so ist es der
Mensch. Und doch: was macht er daraus? Und
nun vergleiche man die Fehler des Bienenstaates
mit denen unserer menschlichen Gesellschaft. Wenn
wir Bienen wären, welche die Menschen beobachteten,
so würde unser Erstaunen gross sein, wenn
wir z. B. die unlogische und ungerechte Verteilung
der Arbeit bei einem Geschlechte beobachteten, das
im übrigen mit hervorragendem Verstande ausgerüstet
scheint. Wir sehen die Oberfläche der Erde,
die einzige Stätte alles gemeinsamen Lebens, von
zwei bis drei Zehnteln der Gesamtbevölkerung mühsam
und unzureichend bebaut; ein anderes Zehntel
zehrt in absolutem Müssiggange den besten Teil
der Produkte jener Arbeit auf, und die sieben übrigen
Zehntel sind zu ewigem Halbverhungern verdammt
und erschöpfen sich unaufhörlich in seltsamen
und unfruchtbaren Anstrengungen, von denen
sie doch nie etwas haben werden, und die nur den
Zweck zu haben scheinen, das Dasein der Müssiggänger
noch komplizierter und unerklärlicher zu
machen. Wir würden daraus folgern, dass Vernunft
und Moralbegriffe dieser Wesen einer Welt
angehören, die von der unseren gänzlich verschieden
ist, und dass sie Prinzipien gehorchen, die zu
begreifen wir nicht hoffen dürfen. Aber gehen
wir unsere Fehler nicht weiter durch, sind sie unserem
Geiste doch stets gegenwärtig, wenn ihre
Gegenwärtigkeit auch keine grosse Wirkung thut.
Höchstens, dass sich von Jahrhundert zu Jahrhundert
einer erhebt, einen Augenblick den Schlaf abschüttelt,
einen Schrei des Erstaunens thut, den
schmerzenden Arm unter seinem Kopfe wegzieht,
sich anders hinlegt und wieder einschläft, bis ein
neuer Schmerz, wiederum eine Folge der traurigen
Erschlaffung der Ruhe, ihn von neuem erweckt.
Wir sind überdies garnicht
im stande, die Fehler der Bienen im
Namen unserer Intelligenz zu richten.
Sehen wir nicht, wie lange Intelligenz
und Bewusstsein bei uns inmitten von
Fehlern und Irrtümern leben, ohne
sie zu bemerken, und länger noch, ohne ihnen abzuhelfen?
Wenn es ein Wesen giebt, das durch
seine Bestimmung besonders, ja fast organisch, berufen
scheint, sich aller Dinge bewusst zu werden,
das Gesellschaftsleben nach den Regeln der reinen
Vernunft zu gestalten und zu leben, so ist es der
Mensch. Und doch: was macht er daraus? Und
nun vergleiche man die Fehler des Bienenstaates
mit denen unserer menschlichen Gesellschaft. Wenn
wir Bienen wären, welche die Menschen beobachteten,
so würde unser Erstaunen gross sein, wenn
wir z. B. die unlogische und ungerechte Verteilung
der Arbeit bei einem Geschlechte beobachteten, das
im übrigen mit hervorragendem Verstande ausgerüstet
scheint. Wir sehen die Oberfläche der Erde,
die einzige Stätte alles gemeinsamen Lebens, von
zwei bis drei Zehnteln der Gesamtbevölkerung mühsam
und unzureichend bebaut; ein anderes Zehntel
zehrt in absolutem Müssiggange den besten Teil
der Produkte jener Arbeit auf, und die sieben übrigen
Zehntel sind zu ewigem Halbverhungern verdammt
und erschöpfen sich unaufhörlich in seltsamen
und unfruchtbaren Anstrengungen, von denen
sie doch nie etwas haben werden, und die nur den
Zweck zu haben scheinen, das Dasein der Müssiggänger
noch komplizierter und unerklärlicher zu
machen. Wir würden daraus folgern, dass Vernunft
und Moralbegriffe dieser Wesen einer Welt
angehören, die von der unseren gänzlich verschieden
ist, und dass sie Prinzipien gehorchen, die zu
begreifen wir nicht hoffen dürfen. Aber gehen
wir unsere Fehler nicht weiter durch, sind sie unserem
Geiste doch stets gegenwärtig, wenn ihre
Gegenwärtigkeit auch keine grosse Wirkung thut.
Höchstens, dass sich von Jahrhundert zu Jahrhundert
einer erhebt, einen Augenblick den Schlaf abschüttelt,
einen Schrei des Erstaunens thut, den
schmerzenden Arm unter seinem Kopfe wegzieht,
sich anders hinlegt und wieder einschläft, bis ein
neuer Schmerz, wiederum eine Folge der traurigen
Erschlaffung der Ruhe, ihn von neuem erweckt.
 Die Entwickelung der Apinen,
oder doch wenigstens der Apiten, sei
einmal zugegeben, da sie wahrscheinlicher
ist als die Starrheit. Welches
ist dann aber ihre beständige und allgemeine
Richtung? Sie scheint dieselbe
Kurve zu beschreiben, wie die unsrige. Sie
hat ersichtlich die Tendenz, Kraft zu sparen, die Unsicherheit,
das Elend zu mindern, den Wohlstand,
die günstigen Verhältnisse und die Autorität der
Art zu mehren. Diesem Ziele opfert sie ohne Zaudern
das Individuum, dessen überdies illusorische
und unglückliche Unabhängigkeit im Zustande der
Einsamkeit durch die Kraft und das Glück der Gesamtheit
wieder ausgeglichen wird. Man möchte
sagen, die Natur denkt wie Perikles bei Thukydides,
dass die Individuen im Schosse einer Stadt, die
als Ganzes gedeiht, glücklicher sind, selbst wenn
sie darunter zu leiden haben, als wenn das Individuum
gedeiht und der Staat zu Grunde geht. Sie
begünstigt die arbeitsame Sklaverei in der mächtigen
Stadt und überlässt den pflichtenlosen Wanderer
den namen- und gestaltlosen Feinden, die in allen
Winkeln von Raum und Zeit, in allen Bewegungen
des Weltalls lauern. Es ist hier nicht der Ort, diesen
Gedanken der Natur zu erörtern, noch sich zu fragen,
ob der Mensch gut thue, ihm zu folgen, aber das
steht fest, dass überall da, wo die unendliche Materie
uns den Ansatz zu einem Gedanken zu zeigen
scheint, dieser Ansatz denselben Weg der Entwickelung
nimmt, dessen Ziel man nicht kennt. Was
uns betrifft, so genügt es uns zu sehen, mit welcher
Fürsorge die Natur es sich angelegen sein lässt, in
der sich entwickelnden Rasse alles das zu erhalten
und festzulegen, was der feindlichen Trägheit der
Materie einmal abgerungen ist. Sie bucht jedes
erfolgreiche Bemühen und zieht gegen den Rückfall,
der nach dem Vorstoss unvermeidlich sein
würde, eine Schranke von besonderen, wohlwollenden
Gesetzen. Dieser Fortschritt, der sich bei den
intelligenteren Arten kaum ableugnen lässt, hat vielleicht
keinen anderen Zweck, als den der Bewegung,
und er weiss nicht, wohin er strebt. Auf alle Fälle
ist es in einer Welt, in der nichts, ausser einigen
Thatsachen dieser Art, auf einen bestimmten Willen
schliessen lässt, recht bezeichnend zu sehen, wie
sich gewisse Wesen von dem Tage an, wo wir die
Augen aufthaten, derart von Stufe zu Stufe ununterbrochen
erheben; und wenn die Bienen uns nichts
anderes offenbart hätten, als diese geheimnisvolle
Spirale zum Lichte in der allmächtigen Nacht, so
wäre dies doch genug, und wir hätten die Zeit nicht
zu bedauern, die wir dem Studium ihrer kleinen
Gebärden und bescheidenen Gewohnheiten gewidmet
haben, die unsern grossen Leidenschaften und
stolzen Geschicken so fern und doch so nahe stehen.
Die Entwickelung der Apinen,
oder doch wenigstens der Apiten, sei
einmal zugegeben, da sie wahrscheinlicher
ist als die Starrheit. Welches
ist dann aber ihre beständige und allgemeine
Richtung? Sie scheint dieselbe
Kurve zu beschreiben, wie die unsrige. Sie
hat ersichtlich die Tendenz, Kraft zu sparen, die Unsicherheit,
das Elend zu mindern, den Wohlstand,
die günstigen Verhältnisse und die Autorität der
Art zu mehren. Diesem Ziele opfert sie ohne Zaudern
das Individuum, dessen überdies illusorische
und unglückliche Unabhängigkeit im Zustande der
Einsamkeit durch die Kraft und das Glück der Gesamtheit
wieder ausgeglichen wird. Man möchte
sagen, die Natur denkt wie Perikles bei Thukydides,
dass die Individuen im Schosse einer Stadt, die
als Ganzes gedeiht, glücklicher sind, selbst wenn
sie darunter zu leiden haben, als wenn das Individuum
gedeiht und der Staat zu Grunde geht. Sie
begünstigt die arbeitsame Sklaverei in der mächtigen
Stadt und überlässt den pflichtenlosen Wanderer
den namen- und gestaltlosen Feinden, die in allen
Winkeln von Raum und Zeit, in allen Bewegungen
des Weltalls lauern. Es ist hier nicht der Ort, diesen
Gedanken der Natur zu erörtern, noch sich zu fragen,
ob der Mensch gut thue, ihm zu folgen, aber das
steht fest, dass überall da, wo die unendliche Materie
uns den Ansatz zu einem Gedanken zu zeigen
scheint, dieser Ansatz denselben Weg der Entwickelung
nimmt, dessen Ziel man nicht kennt. Was
uns betrifft, so genügt es uns zu sehen, mit welcher
Fürsorge die Natur es sich angelegen sein lässt, in
der sich entwickelnden Rasse alles das zu erhalten
und festzulegen, was der feindlichen Trägheit der
Materie einmal abgerungen ist. Sie bucht jedes
erfolgreiche Bemühen und zieht gegen den Rückfall,
der nach dem Vorstoss unvermeidlich sein
würde, eine Schranke von besonderen, wohlwollenden
Gesetzen. Dieser Fortschritt, der sich bei den
intelligenteren Arten kaum ableugnen lässt, hat vielleicht
keinen anderen Zweck, als den der Bewegung,
und er weiss nicht, wohin er strebt. Auf alle Fälle
ist es in einer Welt, in der nichts, ausser einigen
Thatsachen dieser Art, auf einen bestimmten Willen
schliessen lässt, recht bezeichnend zu sehen, wie
sich gewisse Wesen von dem Tage an, wo wir die
Augen aufthaten, derart von Stufe zu Stufe ununterbrochen
erheben; und wenn die Bienen uns nichts
anderes offenbart hätten, als diese geheimnisvolle
Spirale zum Lichte in der allmächtigen Nacht, so
wäre dies doch genug, und wir hätten die Zeit nicht
zu bedauern, die wir dem Studium ihrer kleinen
Gebärden und bescheidenen Gewohnheiten gewidmet
haben, die unsern grossen Leidenschaften und
stolzen Geschicken so fern und doch so nahe stehen.
 Vielleicht ist das alles eitel
und unsere Spirale zum Licht, wie
die der Bienen, ist nur dazu da,
um die Finsternis zu belustigen.
Vielleicht aber auch giebt ein ungeheurer
Zufall, der von aussen kommt,
von einer anderen Welt, oder von einer neuen
Erscheinung, diesem Streben einen endgiltigen Sinn
oder den endgiltigen Tod. Inzwischen wollen wir
unsern Weg weiter gehen, als ob nichts Ungewöhnliches
geschehen sollte. Wüssten wir, dass
morgen eine Offenbarung – etwa in Form einer
Verbindung mit einem älteren und lichtvolleren Planeten
– unsere Natur über den Haufen werfen und
die Leidenschaften, Gesetze und Grundwahrheiten
unseres Wesens aufheben kann, so wäre es das
Klügste, unser Heute ganz diesen Leidenschaften,
Gesetzen und Wahrheiten zu widmen, sie in unserem
Geiste in Verbindung zu setzen und unserem
Schicksal treu zu bleiben, welches darin besteht,
die dunklen Gewalten des Lebens in uns und um
uns zu unterjochen und um einige Stufen zu erheben.
Es ist möglich, dass in der neuen Offenbarung nichts
davon bestehen bleibt, aber unmöglich ist es, dass
die Seele derer, die diesen Beruf, welcher der menschliche
Beruf vor allem ist, bis zu Ende erfüllt haben,
nicht im Vordertreffen steht, um diese Offenbarung
zu empfangen, und selbst wenn sie von ihr nur
das lernten, dass die einzige wahre Pflicht das
Gegenteil von Wissbegier und der Verzicht auf das
Unerkennbare ist, so werden sie besser als die anderen
im stande sein, diesen Mangel an Wissbegier
und diese endgiltige Entsagung zu begreifen
und ihren Vorteil daraus zu ziehen.
Vielleicht ist das alles eitel
und unsere Spirale zum Licht, wie
die der Bienen, ist nur dazu da,
um die Finsternis zu belustigen.
Vielleicht aber auch giebt ein ungeheurer
Zufall, der von aussen kommt,
von einer anderen Welt, oder von einer neuen
Erscheinung, diesem Streben einen endgiltigen Sinn
oder den endgiltigen Tod. Inzwischen wollen wir
unsern Weg weiter gehen, als ob nichts Ungewöhnliches
geschehen sollte. Wüssten wir, dass
morgen eine Offenbarung – etwa in Form einer
Verbindung mit einem älteren und lichtvolleren Planeten
– unsere Natur über den Haufen werfen und
die Leidenschaften, Gesetze und Grundwahrheiten
unseres Wesens aufheben kann, so wäre es das
Klügste, unser Heute ganz diesen Leidenschaften,
Gesetzen und Wahrheiten zu widmen, sie in unserem
Geiste in Verbindung zu setzen und unserem
Schicksal treu zu bleiben, welches darin besteht,
die dunklen Gewalten des Lebens in uns und um
uns zu unterjochen und um einige Stufen zu erheben.
Es ist möglich, dass in der neuen Offenbarung nichts
davon bestehen bleibt, aber unmöglich ist es, dass
die Seele derer, die diesen Beruf, welcher der menschliche
Beruf vor allem ist, bis zu Ende erfüllt haben,
nicht im Vordertreffen steht, um diese Offenbarung
zu empfangen, und selbst wenn sie von ihr nur
das lernten, dass die einzige wahre Pflicht das
Gegenteil von Wissbegier und der Verzicht auf das
Unerkennbare ist, so werden sie besser als die anderen
im stande sein, diesen Mangel an Wissbegier
und diese endgiltige Entsagung zu begreifen
und ihren Vorteil daraus zu ziehen.
 Auch sollten unsere Phantasien
sich garnicht in dieser Richtung
bewegen. Die Möglichkeit einer
allgemeinen Vernichtung sollte unsere
Thätigkeit ebensowenig beeinflussen,
wie das wunderbare Eingreifen eines
Zufalls. Wir sind bisher, trotz der Verheissungen
unserer Einbildungskraft, stets auf uns selbst und
auf unsere eigenen Hilfsquellen angewiesen geblieben.
Alles Nützliche und Dauerhafte, was auf
Erden besteht, ist das Werk unseres bescheidenen
Strebens. Es steht uns frei, von einem fremden
Zufall das Beste oder das Schlimmste zu erwarten,
aber nur unter der Bedingung, dass diese Erwartung
sich nicht in unsere menschliche Aufgabe
hineinmischt. Auch darin geben uns die Bienen
eine vortreffliche Lehre, wie jede Lehre der Natur
vortrefflich ist. Sie haben wirklich solch einen
wunderbaren Eingriff erfahren. Sie sind mehr als
wir in den Händen eines Willens, der ihre Gattung
vernichten oder verändern und ihren Geschicken
einen anderen Lauf geben kann. Und doch bleiben
sie ihrer ursprünglichen, tiefen Aufgabe unbeirrt
treu. Und gerade die unter ihnen, die diese Pflicht
am treusten erfüllen, sind auch am besten im stande,
aus dem übernatürlichen Eingriff, der heute das
Loos ihrer Gattung erhebt, ihren Vorteil zu ziehen.
Nun aber ist die unfehlbare Pflicht eines Wesens
leichter zu entdecken, als man glaubt. Man kann
sie jederzeit in den Organen lesen, durch die es
sich vor andern auszeichnet und denen alle anderen
untergeordnet sind. Und ebenso wie es auf der
Zunge, dem Munde und Magen der Bienen geschrieben
steht, dass sie Honig hervorbringen müssen,
ebenso steht es in unseren Augen, unseren Ohren,
unserem Mark und allen Fibern unseres Kopfes,
im ganzen Nervensystem unseres Körpers geschrieben,
dass wir dazu geschaffen sind, alles Irdische,
was wir in uns aufnehmen, in eine besondere Kraft
von einer auf diesem Erdball einzigen Art umzusetzen.
Kein uns bekanntes Wesen ist so wie wir
befähigt, jenes seltsame Fluidum hervorzubringen,
das wir Denken, Verstand, Intelligenz, Vernunft,
Seele, Geist, Zerebralvermögen, Tugend, Güte,
Gerechtigkeit, Wissen nennen, denn es besitzt tausend
Namen, obwohl es immer dasselbe ist. Alles
in uns ist ihm geopfert worden. Unsere Muskeln,
unsere Gesundheit, die Beweglichkeit unserer Gliedmassen,
das Gleichgewicht unserer animalischen
Funktionen, die Ruhe unseres Lebens – alle tragen
mehr und mehr die Last seines Übergewichtes.
Es ist der kostbarste und schwierigste Zustand, zu
dem man die Materie erheben kann. Feuer, Licht,
Wärme, das Leben selbst, der Instinkt, der feiner
ist, als das Leben, und die Mehrzahl der unfasslichen
Kräfte, welche die Welt vor unserem Erscheinen
krönten, sie sind vor dem neuen Fluidum
verblasst. Wir wissen nicht, wohin es uns führen,
was es aus uns machen wird, noch wir aus ihm.
Von ihm werden wir es zu erfahren haben, sobald
es in unumschränkter Machtfülle regiert. Inzwischen
wollen wir nur darauf bedacht sein, wie wir ihm
alles geben und opfern können, was es verlangt,
alles, was seiner vollen Entwickelung frommt. Es
ist kein Zweifel, dass hier die erste und grösste
unserer augenblicklichen Pflichten liegt. Die anderen
werden wir von ihm erfahren, je mehr es
wächst. Es wird sie nähren und erweitern, je nachdem
es selbst genährt wird, wie das Wasser der
Höhen die Bäche der Ebenen speist und erweitert,
wenn es seine wunderbare Nahrung von den Gipfeln
empfangen hat. Zerbrechen wir uns den Kopf nicht,
wer von dieser Kraft, die sich derart auf unsere
Kosten anhäuft, einst Nutzen haben wird. Die
Bienen wissen auch nicht, ob sie den Honig essen
werden, den sie anspeichern. Und ebenso wissen
wir nicht, wem die Geisteskraft, die wir in die
Welt einführen, einst frommen wird. Wie sie von
Blume zu Blume fliegen, um mehr Honig zu ernten,
als sie und ihre Kinder bedürfen, so wollen auch
wir von Realität zu Realität schreiten und alles
sammeln, was dieser unbegreiflichen Flamme zur
Nahrung dienen kann, damit wir im Gefühl der Erfüllung
unserer organischen Pflicht auf alles, was
da kommen mag, vorbereitet sind. Nähren wir
sie mit unseren Gefühlen und Leidenschaften, mit
allem, was man sehen, fühlen, hören, fassen kann,
und mit ihrem eigenen Wesen, welches der Gedanke
ist, den sie aus allen Entdeckungen, Erfahrungen
und Beobachtungen zieht und aus allem einträgt,
was sie besucht. Dann wird ein Augenblick kommen,
wo sich für einen Geist, welcher der wahrhaft
menschlichen Pflicht mit bestem Willen gedient
hat, alles so natürlich zum Besten wendet, dass
selbst die Befürchtung, all sein Streben und Trachten
könnte umsonst sein, die Glut seines Forschens noch
heller, reiner, selbstloser, unabhängiger und edler
entfacht.
Auch sollten unsere Phantasien
sich garnicht in dieser Richtung
bewegen. Die Möglichkeit einer
allgemeinen Vernichtung sollte unsere
Thätigkeit ebensowenig beeinflussen,
wie das wunderbare Eingreifen eines
Zufalls. Wir sind bisher, trotz der Verheissungen
unserer Einbildungskraft, stets auf uns selbst und
auf unsere eigenen Hilfsquellen angewiesen geblieben.
Alles Nützliche und Dauerhafte, was auf
Erden besteht, ist das Werk unseres bescheidenen
Strebens. Es steht uns frei, von einem fremden
Zufall das Beste oder das Schlimmste zu erwarten,
aber nur unter der Bedingung, dass diese Erwartung
sich nicht in unsere menschliche Aufgabe
hineinmischt. Auch darin geben uns die Bienen
eine vortreffliche Lehre, wie jede Lehre der Natur
vortrefflich ist. Sie haben wirklich solch einen
wunderbaren Eingriff erfahren. Sie sind mehr als
wir in den Händen eines Willens, der ihre Gattung
vernichten oder verändern und ihren Geschicken
einen anderen Lauf geben kann. Und doch bleiben
sie ihrer ursprünglichen, tiefen Aufgabe unbeirrt
treu. Und gerade die unter ihnen, die diese Pflicht
am treusten erfüllen, sind auch am besten im stande,
aus dem übernatürlichen Eingriff, der heute das
Loos ihrer Gattung erhebt, ihren Vorteil zu ziehen.
Nun aber ist die unfehlbare Pflicht eines Wesens
leichter zu entdecken, als man glaubt. Man kann
sie jederzeit in den Organen lesen, durch die es
sich vor andern auszeichnet und denen alle anderen
untergeordnet sind. Und ebenso wie es auf der
Zunge, dem Munde und Magen der Bienen geschrieben
steht, dass sie Honig hervorbringen müssen,
ebenso steht es in unseren Augen, unseren Ohren,
unserem Mark und allen Fibern unseres Kopfes,
im ganzen Nervensystem unseres Körpers geschrieben,
dass wir dazu geschaffen sind, alles Irdische,
was wir in uns aufnehmen, in eine besondere Kraft
von einer auf diesem Erdball einzigen Art umzusetzen.
Kein uns bekanntes Wesen ist so wie wir
befähigt, jenes seltsame Fluidum hervorzubringen,
das wir Denken, Verstand, Intelligenz, Vernunft,
Seele, Geist, Zerebralvermögen, Tugend, Güte,
Gerechtigkeit, Wissen nennen, denn es besitzt tausend
Namen, obwohl es immer dasselbe ist. Alles
in uns ist ihm geopfert worden. Unsere Muskeln,
unsere Gesundheit, die Beweglichkeit unserer Gliedmassen,
das Gleichgewicht unserer animalischen
Funktionen, die Ruhe unseres Lebens – alle tragen
mehr und mehr die Last seines Übergewichtes.
Es ist der kostbarste und schwierigste Zustand, zu
dem man die Materie erheben kann. Feuer, Licht,
Wärme, das Leben selbst, der Instinkt, der feiner
ist, als das Leben, und die Mehrzahl der unfasslichen
Kräfte, welche die Welt vor unserem Erscheinen
krönten, sie sind vor dem neuen Fluidum
verblasst. Wir wissen nicht, wohin es uns führen,
was es aus uns machen wird, noch wir aus ihm.
Von ihm werden wir es zu erfahren haben, sobald
es in unumschränkter Machtfülle regiert. Inzwischen
wollen wir nur darauf bedacht sein, wie wir ihm
alles geben und opfern können, was es verlangt,
alles, was seiner vollen Entwickelung frommt. Es
ist kein Zweifel, dass hier die erste und grösste
unserer augenblicklichen Pflichten liegt. Die anderen
werden wir von ihm erfahren, je mehr es
wächst. Es wird sie nähren und erweitern, je nachdem
es selbst genährt wird, wie das Wasser der
Höhen die Bäche der Ebenen speist und erweitert,
wenn es seine wunderbare Nahrung von den Gipfeln
empfangen hat. Zerbrechen wir uns den Kopf nicht,
wer von dieser Kraft, die sich derart auf unsere
Kosten anhäuft, einst Nutzen haben wird. Die
Bienen wissen auch nicht, ob sie den Honig essen
werden, den sie anspeichern. Und ebenso wissen
wir nicht, wem die Geisteskraft, die wir in die
Welt einführen, einst frommen wird. Wie sie von
Blume zu Blume fliegen, um mehr Honig zu ernten,
als sie und ihre Kinder bedürfen, so wollen auch
wir von Realität zu Realität schreiten und alles
sammeln, was dieser unbegreiflichen Flamme zur
Nahrung dienen kann, damit wir im Gefühl der Erfüllung
unserer organischen Pflicht auf alles, was
da kommen mag, vorbereitet sind. Nähren wir
sie mit unseren Gefühlen und Leidenschaften, mit
allem, was man sehen, fühlen, hören, fassen kann,
und mit ihrem eigenen Wesen, welches der Gedanke
ist, den sie aus allen Entdeckungen, Erfahrungen
und Beobachtungen zieht und aus allem einträgt,
was sie besucht. Dann wird ein Augenblick kommen,
wo sich für einen Geist, welcher der wahrhaft
menschlichen Pflicht mit bestem Willen gedient
hat, alles so natürlich zum Besten wendet, dass
selbst die Befürchtung, all sein Streben und Trachten
könnte umsonst sein, die Glut seines Forschens noch
heller, reiner, selbstloser, unabhängiger und edler
entfacht.
ENDE

[1] (SEITE 6). Man könnte noch die Monographie von Kirby und Spence in ihrer „Introduction to Entomology“ erwähnen, aber sie ist fast ausschliesslich technisch.
[2] (SEITE 18). Ein Beobachtungskasten ist ein Bienenstock mit Glaswänden und schwarzen Vorhängen oder Läden. Die besten sind die, welche nur eine einzige Wabe enthalten, sodass man sie von beiden Seiten beobachten kann. Diese Kästen lassen sich ohne weiteres und ohne jede Gefahr in einem Wohn- oder Arbeitszimmer aufstellen, vorausgesetzt, dass sie einen Ausgang nach aussen haben. Die Bienen meines Beobachtungskastens, den ich in Paris in meinem Arbeitszimmer habe, tragen selbst in der Steinwüste der Grossstadt genug ein, um zu leben und fortzukommen.
[3] (SEITE 63). Man setzt eine fremde Königin gewöhnlich in einem kleinen Käfig aus Eisendrähten bei, den man zwischen zwei Waben aufhängt. Die Thüröffnung wird mit Wachs und Honig verschlossen, den die Bienen, wenn ihr Zorn verraucht ist, fortnagen. Die so befreite Gefangene wird von ihnen oft wohlwollend aufgenommen. Mr. S. Simmins, der Leiter der grossen Bienenwirtschaft von Rottingdean, hat kürzlich eine andere Methode gefunden, die ausserordentlich leicht zu befolgen und fast immer erfolgreich ist, weshalb sie auch bei den gewissenhaften Bienenwirten immer mehr Verbreitung findet. Die Schwierigkeit bei der Einführung von Königinnen liegt nämlich in dem Benehmen der Königin selbst. Sie ist aufgeregt, flieht, verbirgt sich, gebärdet sich wie ein Eindringling und erweckt dadurch den Verdacht der Arbeitsbienen, der sich nach näherer Prüfung alsbald bestätigt. Mr. Simmins isoliert darum die beizusetzende Königin vollständig und lässt sie eine halbe Stunde fasten. Dann lüftet er die Innendecke des weisellosen Stockes ein wenig und setzt die fremde Königin auf das oberste Ende einer Wabe. Die vorangegangene Einsamkeit hat sie so unglücklich gemacht, dass sie jetzt froh ist, sich wieder unter Bienen zu sehen, und in ihrem Hunger die ihr dargebotene Nahrung begierig annimmt. Die Arbeitsbienen lassen sich durch ihr sicheres Auftreten täuschen und stellen keine Untersuchung an. Sie bilden sich vielleicht ein, dass ihre alte Herrin wiedergekehrt ist, und nehmen sie mit Freuden auf. Aus diesem Experiment scheint hervorzugehen, dass sie, im Gegensatz zu Huber und allen Beobachtern, ihre Königin nicht wieder zu erkennen vermögen. Wie dem aber auch sei, die beiden Erklärungen sind gleich annehmbar, wenn die Wahrheit vielleicht auch in einer dritten liegen mag, die uns noch nicht bekannt ist, und jedenfalls zeigen sie wieder einmal, wie verwickelt und unklar die Psychologie der Bienen noch ist. Und es lässt sich, wie aus allen Lebensfragen, auch hieraus nur der eine Schluss ziehen, dass wir in Ermangelung eines Besseren die Wissbegier in unserm Busen walten lassen müssen.
[4] (SEITE 71). Das Gehirn der Biene beträgt nach den Berechnungen von Dujardin 1/174 des Gesamtgewichtes ihres Körpers, das der Ameise nur 1/296. Dafür sind die strangförmigen Körper, die sich im gleichen Verhältnis entwickeln, wie der Intellekt, bei den Bienen etwas geringer, als bei den Ameisen. Aus diesen Schätzungen scheint – wenn man das hypothetische derselben und die ganze Dunkelheit des Gegenstandes mit in Betracht zieht – sich zu ergeben, dass Ameise und Biene sich in Bezug auf Intellekt ungefähr gleich stehen müssen.
[5] (SEITE 99). Ich habe das Experiment bei der ersten Frühlingssonne dieses ungünstigen Jahres wiederholt, und zwar mit dem gleichen negativen Ergebnis. Ein mir befreundeter Bienenzüchter, der ein sehr geschickter und sehr zuverlässiger Beobachter ist und von mir dieses Problem vorgelegt erhielt, schreibt mir, er hätte bei demselben Experiment vier Fälle zu verzeichnen, wo unweigerlich eine Mitteilung stattgefunden haben müsste. Die Thatsache verdient festgestellt zu werden, doch die Frage bleibt ungelöst. Auch ich bin überzeugt, dass mein Freund sich durch das sehr begreifliche Verlangen, sein Experiment gelingen zu sehen, irreführen liess.
[6] (SEITE 109). Man hat übrigens gut gethan, dieses Normalmass nicht zu wählen. Der Zellendurchmesser ist von wunderbarer Regelmässigkeit, doch wie alles, was auf organischem Wege entstanden ist, nicht von mathematischer Unveränderlichkeit. Überdies haben die verschiedenen Bienenarten, wie Maurice Girard nachgewiesen hat, bei ihren Zellen eine ganz bestimmte Seitenachse, so dass das Mass von Stock zu Stock ein andres sein würde, je nach der darin wohnenden Bienenart.
[7] (SEITE 111). Réaumur hatte dem berühmten Mathematiker König folgendes Problem gestellt: „Unter allen sechskantigen Zellen mit pyramidalem, aus drei gleichen und ähnlichen Rhomben bestehendem Boden die zu bestimmen, die am wenigsten Baustoff erfordert.“ König antwortete, es wäre diejenige, deren Boden aus drei Rhomben bestände, deren grosse Winkel je 109° 26' und die kleinen je 70° 34' betrügen. Nun aber hat ein anderer Gelehrter, Maraldi, die Winkel der Rhomben in den Bienenzellen so genau wie möglich nachgemessen und gefunden, dass die grossen 109° 28', die kleinen 70° 32' betragen. Zwischen beiden Lösungen bestand also nur eine Differenz von zwei Minuten! Und es ist wahrscheinlich, dass der etwa vorliegende Irrtum von Maraldi begangen wurde, und nicht von den Bienen, denn es giebt kein Instrument, das die Zellenwinkel, die nicht so scharf hervortreten, mit untrüglicher Sicherheit nachzumessen erlaubte.
Ein anderer Mathematiker, Cramer, hat dasselbe Problem noch mehr im Sinne der Bienen gelöst; er fand 109° 28½' für die grossen und 70° 31½' für die kleinen Winkel. Maclaurin, der Königs Berechnung berichtigt hat, giebt 70° 32' und 109° 28' an, Léon Lalanne 70° 81' 44" und 109° 28' 16". Siehe über diesen Streitpunkt auch: Maclaurin, „Philos. Trans. of London“, 1743; Brougham, „Recherch. anal. et expér. sur les alv. des ab.“; L. Lalanne, „Note sur l’Arch. des abeilles“ u. s. w.
[8] (SEITE 136). Das Flugbrett ist oft nichts als eine Fortsetzung des Brettes, auf dem der Bienenstock ruht, und bildet eine Art Vorhof oder Ruheplatz vor dem Haupteingang, dem sogenannten Flugloch.
[9] (SEITE 140). Einige Bienenzüchter behaupten, dass Arbeitsbienen und Königinnen, sobald sie das Ei verlassen haben, dieselbe Nahrung erhalten, eine Art stickstoffreicher Milch, welche die Pflegerinnen aus einer Kopfdrüse ausscheiden. Doch werden die Arbeitsbienenlarven nach einigen Tagen entwöhnt und fortan mit gröberer Nahrung, Honig und Pollen, gespeist, während die junge Königin bis zu ihrer vollständigen Entwickelung reichlich mit jener kostbaren Milch ernährt wird, die man den „Königstrank“ genannt hat. Wie dem aber auch sei, der Erfolg und das Wunder bleiben die gleichen.
[10] (SEITE 162). Es ist unmöglich, die Einzelheiten dieser von Darwin beobachteten Fälle hier wiederzugeben. Der Vorgang ist in grossen Zügen folgender. Der Pollen von Orchis morio ist nicht staubförmig, sondern ballt sich zu kleinen Klumpen, welche die sogenannten Pollinarien bilden. Diese (es sind ihrer zwei) haben einen stielartigen Fortsatz, der an seinem unteren Ende in einer klebrigen Rundung endigt (dem Caudiculum) und von einem membranartigen Beutelchen (dem Rostellum) umschlossen wird, das bei der leisesten Berührung platzt. Steckt nun eine die Blüte befliegende Biene den Kopf in den Kelch, um den Nektar zu saugen, so streift sie dies Beutelchen, dasselbe zerreisst und die beiden klebrigen Rundungen treten zu Tage. Die Pollinarien bleiben infolge des Klebestoffes, der an den Rundungen sitzt, am Kopfe des Insekts haften und dieses trägt sie beim Verlassen der Blume wie ein paar zwiebelartige Hörner von dannen. Wenn diese zwei Pollenhörner nun steif und gerade blieben, so würden sie in dem Augenblick, wo die Biene die nächste Orchidee befliegt, das membranartige Säckchen derselben berühren und einfach zum Platzen bringen, aber nicht bis zu der Narbe (dem weiblichen Organ) der zweiten Blume dringen, die befruchtet werden muss und unter dem membranartigen Säckchen liegt. Die Orchis morio hat diese Schwierigkeit genial erkannt, und darum vertrocknet nach dreissig Sekunden, das heisst in der kurzen Spanne Zeit, die das Insekt braucht, um den Nektar vollends aufzusaugen und eine andere Blume zu befliegen, der Stengel des kleinen Kolbens und schrumpft zusammen, und zwar stets nach derselben Seite und im gleichen Sinne; die den Pollen enthaltende Zwiebel sinkt herab, und ihr Neigungswinkel ist so genau berechnet, dass sie sich in dem Augenblick, wo die Biene in die benachbarte Blume hineinschlüpft, genau in der Höhe der Narbe befindet, auf die sie ihren befruchtenden Staub entleeren muss. Siehe für alle Einzelheiten dieses intimen Dramas der unbewussten Blumenwelt die prachtvolle Studie von Darwin „Über die Befruchtung der Orchideen durch Insekten und die guten Wirkungen der Kreuzung“, 1862.
[11] (SEITE 169). Es ist dem Professor McLain kürzlich gelungen, einige Königinnen künstlich zu befruchten, aber nur mit Hilfe von komplizierten und schwierigen chirurgischen Operationen. Übrigens war die Fruchtbarkeit dieser Königinnen nur beschränkt und vorübergehend.
[12] (SEITE 204). Ein starkes Volk braucht während der Überwinterung, die in unseren Himmelsstrichen etwa sechs Monate dauert, d. h. vom Oktober bis Anfang April, gewöhnlich zwanzig bis dreissig Pfund Honig.
[13] (SEITE 211). In der wissenschaftlichen Einteilung nimmt die Hausbiene (Apis mellifica) folgenden Platz ein. Klasse: Insekten. Ordnung: Immen (Hymenoptera). Familie: Eigentliche Bienen (Apidae). Sippe: Apis. Art: Mellifica. Die Bezeichnung Mellifica stammt aus der Linné’schen Einteilung. Sie ist nicht sehr glücklich gewählt, denn alle Bienen, mit Ausnahme einiger Parasiten, sind Honigbienen. Scopoli sagt cerifera, Réaumur domestica, Geoffroy gregaria. – Apis ligustica, die italienische Biene, ist nur eine Abart von Apis mellifica.
[14] (SEITE 212). Der Fall tritt auch bei Nachschwärmen häufig genug ein, denn sie sind weniger erfahren und vorsichtig, als der Vorschwarm. An ihrer Spitze befindet sich eine junge, leichtsinnige Königin, und sie bestehen meist aus ganz jungen Bienen, in denen der ursprüngliche Instinkt um so lauter spricht, weil sie die Strenge und Wetterwendigkeit unseres nordischen Himmels noch nicht kennen. Übrigens lebt keiner dieser Schwärme über die ersten Herbststürme hinaus, und sie vermehren die unzähligen Opfer der langsamen und dunklen Versuche der Natur.
[15] (SEITE 215). Da wir uns hier zum letzten Male mit den Bauten der Bienen beschäftigen, wollen wir eine Eigentümlichkeit der Apis florea nicht unerwähnt lassen. Einzelne Drohnenzellen sind bei ihr cylindrisch, statt sechseckig. Es scheint also, dass sie noch nicht dauernd von der einen Form zur anderen übergegangen ist und endgiltig die bessere angenommen hat.
[16] (SEITE 217). Etwas ähnliches berichtet Büchner: Auf der Insel Barbados, wo viele Zuckersiedereien sind und die Bienen das ganze Jahr hindurch Zucker in Überfluss finden, befliegen sie keine Blüte mehr. Ein Beweis mehr, dass die Anpassung an die Umstände nicht langsam, etwa im Laufe von Jahrhunderten stattfindet oder unbewusst und fatalistisch ist, sondern dass sie unmittelbar eintritt und auf Überlegung beruht.
[17] (SEITE 223). Man verwechsele nicht Apinen, Apiden und Apiten. Diese drei Ausdrücke werden durcheinander gebraucht, wie sie sich in der Klassifikation von Emile Blanchard vorfinden. Der Stamm der Apinen umfasst alle Familien der Bienen, die Apiden bilden die erste Familie derselben und zerfallen ihrerseits in Apiten, Meliponiten und Bombinen (Hummeln). Die Apiten endlich umfassen die verschiedenen Arten unserer Hausbiene.
[18] (SEITE 225). Zum Beispiel die Hummeln, deren Schmarotzer die Psithyrus oder Schmarotzerhummeln sind, die Steliden, die auf Kosten der Anthidien leben. „Man ist“, sagt J. Perez („Les Abeilles“) sehr richtig, „wegen der häufig vorkommenden Ähnlichkeit der Schmarotzer mit ihren Opfern zu der Annahme gezwungen, dass beide Arten nur zwei Formen desselben Typus bilden und engstens mit einander verwandt sind. Für die der Entwickelungslehre huldigenden Naturforscher ist diese Verwandtschaft nicht nur ideell, sondern real. Die Schmarotzerart ist nach ihnen nur eine Abart der anderen und hat ihre Sammelwerkzeuge durch Anpassung an das Schmarotzerleben verloren.“
[19] (SEITE 230). Es steht freilich nicht fest, ob das Prinzip des Königtums oder der Mutterschaft einer Einzigen bei den Meliponiten sehr streng durchgeführt wird. Blanchard glaubt mit Recht, dass wahrscheinlich mehrere Weibchen in einem Stocke leben, da sie sich bei ihrer Stachellosigkeit nicht so leicht töten können, wie die Bienenköniginnen. Aber dies ist bisher nie festgestellt worden, weil die Weibchen und Arbeiterinnen sehr schwer zu unterscheiden sind und die Meliponiten in unseren Himmelsstrichen durchaus nicht gedeihen.
[20] (SEITE 231). Siehe auch die ausführlichere Darstellung auf Seite 112.
Eine vollständige Bibliographie der Bienenkunde würde die Grenzen, die wir uns gesteckt haben, überschreiten. Ich begnüge mich damit, auf die interessantesten Werke zu verweisen.
a) Die Alten. – Aristoteles, „Geschichte der Tiere“, passim; Varro, „De agricultura“, L. III, 16; Plinius, „Historia naturae“, L. XI; Virgil, „Georgica“, IV; Columella, „De re rustica“; Palladius, „De re rustica“, L. I, 37, etc.
b) Die Neueren. – Swammerdamm, „Biblia naturae“, 1737; Maraldi, „Observations sur les abeilles“ (Mém. Acad. des Sciences), 1712; Réaumur, „Mémoires pour servir à l’histoire des insectes“, 1740; Ch. Bonnet, „Oeuvres d’histoire naturelle“, 1779-1783; A. G. Schirach, „Physikalische Untersuchung der bisher unbekannten, aber nachher entdeckten Erzeugung der Bienenmutter“, 1767; J. Hunter, „On bees, philosophical transactions“, 1732; A. Janscha, „Hinterlassene vollständige Lehre von der Bienenzucht“, 1773; François Huber, „Nouvelles Observations sur les abeilles“, 1794, etc.
Dzierzon, „Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes“; Langstroth, „The honey bee“, ins Französische übersetzt von Ch. Dadant („L’abeille et la ruche“), eine Verbesserung und Vervollständigung des Originals; Georges de Layens und Bonnier, „Cours complet d’apiculture“; Frank Cheshire, „Bees and bee-keeping“ (Band II, Praxis); Dr. E. Bevan, „The honey bee“; T. W. Cowan, „British bee-keeper’s guide book“; A. J. Cook, „Bee-keeper’s guide book“; A. Root, „The ABC of Bee culture“; Henry Alley, „The Bee-keeper’s Handy book“; Abbé Collin, „Guide de propriétaire d’abeilles“; Ch. Dadant, „Petit cours d’apiculture pratique“; Ed. Bertrand, „Conduite du rucher“; Weber, „Manuel pratique d’apiculture“; Hamet, „Cours complet d’apiculture“; de Bauvoys, „Guide de l’apiculteur“; Pollmann, „Die Biene und ihre Zucht“; S. Simmins, „A modern bee farm“; F. W. Vogel, „Die Honigbiene und die Vermehrung der Bienenvölker“; Baron A. von Berlepsch, „Die Biene und ihre Zucht“; Jeker, Kramer und Theiler, „Der Schweizerische Bienenvater“ etc.
F. Cheshire, „Bees and Bee-keeping“ (Band I, Wissenschaft); T. W. Cowan, „The Honey Bee“; J. Perez, „Les abeilles“; Girard, „Manuel d’apiculture“ (die Bienen, ihre Organe und deren Funktion); Shuckard, „British bees“; Kirby and Spence, „Introduction to Entomology“; Girdwoyn, „Anatomie et physiologie de l’abeille“; F. Cheshire, „Diagrams on the anatomy of the Honey Bee“; Gundelach, „Die Naturgeschichte der Honigbiene“; Ludwig Büchner, „Geistesleben der Tiere“; O. Bütschli, „Zur Entwickelungsgeschichte der Biene“; J. D. Haviland, „The social instincts of bees, their origin and natural selection“.
(Organe und deren Funktionen, Arbeiten u. s. w.): Ed. Brandt, „Recherches anatomiques et morphologiques sur le système nerveux des insectes hyménoptères“ (Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 1876, Band LXXVIII, S. 613); F. Dujardin, „Mémoires sur le système nerveux des insectes“; Dumas und Milne-Edwards, „Sur la production de la cire des abeilles“; E. Blanchard, „Recherches anatomiques sur le système nerveux des insectes“; L. R. D. Brougham, „Observations, demonstrations and experiences upon the structure of the cells of bees“ (Natural Theology, 1856); P. Cameron, „On Parthenogenesis in the Hymenoptera“ (Trans. nat. soc. of Glasgow, 1888); Erichson, „De fabrica et usu antennarum in insectis“; B. T. Lowne, „On the simple and compound eyes of insects“ (Phil. trans., 1879); G. K. Waterhouse, „On the formation of the cells of Bees and Wasps“; Dr. C. T. E. von Siebold, „On a true Parthenogenesis in Moths and Bees“; F. Leydig, „Das Auge der Gliederthiere“; Pastor Schönfeld, „Bienenzeitung“, 1854-1883, „Illustrierte Bienenzeitung“, 1885-1890; Assmus, „Die Parasiten der Honigbiene“.
E. Blanchard, „Histoire naturelle des insectes“, „Métamorphoses, moeurs et instincts des insectes“; Darwin, „Origin of species“; Fabre, „Souvenirs entomologiques“ 3 (Séries); Romanes, „Mental evolution in animals“, „animal intelligence“; Lepeletier St. Fargeau, „Histoire naturelle des Hyménoptères“; V. Mayet, „Mémoire sur les moeurs et les métamorphoses d’une nouvelle espèce de la famille des Vésicants“ (Ann. Soc. entom. de France, 1875); H. Müller, „Ein Beitrag zur Lebensgeschichte der Dasypoda hirtipes“; E. Hoffer, „Biologische Beobachtungen an Hummeln und Schmarotzerhummeln“; Jesse, „Gleaning in natural history“; Sir J. Lubbock, „Ants, Bees and Wasps“, „The senses, instincts and intelligence of animals“; Walkenaer, „Les Haclites“; Westwood, „Introduction to the study of insects“; V. Rendu, „De l’intelligence des animaux“; Espinas, „Animal Communities“, u. s. w.
| AUF DER SCHWELLE DES BIENENSTOCKES | 4 |
| DAS SCHWÄRMEN | 23 |
| DIE STADTGRÜNDUNG | 77 |
| DIE JUNGEN KÖNIGINNEN | 132 |
| DER HOCHZEITSAUSFLUG | 168 |
| DIE DROHNENSCHLACHT | 198 |
| DER FORTSCHRITT DER ART | 206 |
| ANMERKUNGEN | 245 |
| BIBLIOGRAPHISCHES | 253 |
Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigert. Weitere Änderungen sind hier aufgeführt (vorher/nachher):
End of Project Gutenberg's Das Leben der Bienen, by Maurice Maeterlinck
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DAS LEBEN DER BIENEN ***
***** This file should be named 61584-h.htm or 61584-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/1/5/8/61584/
Produced by Jens Sadowski and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This book was
produced from images made available by the HathiTrust
Digital Library.
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.