
The Project Gutenberg EBook of Die fünf Waldstädte, by Paul Keller
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll
have to check the laws of the country where you are located before using
this ebook.
Title: Die fünf Waldstädte
Ein Buch für Menschen, die jung sind
Author: Paul Keller
Illustrator: G. Holstein
Reinhold Pfahler von Othegraven
Release Date: February 9, 2020 [EBook #61354]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE FÜNF WALDSTÄDTE ***
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
Die fünf Waldstädte

Ein Buch für Menschen, die jung sind
von
Paul Keller
Mit Bildern von G. Holstein und
Reinhold Pfaehler von Othegraven
32. bis 42. Auflage.

Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn Breslau

| Seite | |
| Die fünf Waldstädte Ameisenfeld – Eichenhofen – Der Geistergrund – Heinrichsburg – Die heilige Stadt | 5 |
| Der kleine General | 53 |
| Der Schatz in der Waldmühle | 63 |
| Der angebundene Kirchturm | 101 |
| Das Abenteuer auf der Themse | 111 |
| Die Ferienkolonisten | 123 |
| Gedeon | 133 |
| Hotel Laubhaus | 157 |
| Mein Roß und ich | 167 |
| Die Räuber aus dem Riesengebirge | 177 |
Alle Rechte,
insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.
Copyright 1915 by
Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau.
Von den fünf Waldstädten will ich erzählen, in denen ich als Kind oft glücklich gewesen bin.
Wir waren ihrer drei: meine beiden Freunde Ludwig, Heinrich und ich. Als Ludwig in jungen Jahren starb, waren Heinrich und ich die fast unumschränkten Herren der fünf Waldstädte.
Da war in der Gegend zwischen Frankreich und Rußland ein Wald, der war so groß, daß ein lahmer Mann an die dreiviertel Stunden brauchte, ehe er um ihn herum war. In diesem Walde lagen die fünf Waldstädte: Ameisenfeld, Eichenhofen, Geistergrund, Heinrichsburg und die heilige Stadt. Alle fünf Städte waren von seltener Pracht und Herrlichkeit, und es gab Wunder über Wunder in ihnen zu sehen, obwohl gar keine großen, steinernen Häuser in ihnen standen und unsere Städte nach Meinung dummer Knechte und alberner Mägde nur »ganz gewöhnlicher Busch« waren. Wir aber wußten sicher, daß es Städte waren, und Heinrichs Mutter wußte es auch. An allen[6] Frühlings- und Sommertagen, aber auch zur wilden Sturmzeit im Herbst reiste ich mit meinem Freunde durch das Gebiet der fünf Städte, und wenn einer etwas Neues entdeckte, dann war er glücklich, es unserer »lieben Fee« zu sagen. Das war Heinrichs schöne Mutter. Die ging oft mit uns durch die fünf Waldstädte, und was wir selbst nicht sahen und fanden, das sah sie und fand sie und zeigte es uns. Sie erzählte und sang Lieder vom heiligen, deutschen Wald und machte ihn uns lieb und vertraut.
Da war also zunächst die Stadt
Sie war 90 Quadratmeter groß und hatte nach der letzten Volkszählung 567319 Einwohner. Deshalb zählte sich Ameisenfeld mit Recht zu den Großstädten. Die Bewohner von Ameisenfeld waren berühmt durch ihren Fleiß und ihre Betriebsamkeit. Sie beschäftigten sich damit, sich zu ernähren und Eier zu legen. In ihren freien Stunden prügelten sie sich. Ob dieser Eigenschaften galten die Ameisenfelder im ganzen Lande nicht nur als sehr fleißig, sondern auch als sehr intelligent.[7] Man erzählte sogar, daß ein großer Prophet unter ihnen erstanden sei, der folgende tiefsinnigen Lehren aufgestellt hatte:
»Wenn dir ein Hölzlein zu schwer zu tragen ist, nimm dir jemand zu Hilfe!«

»Wenn dir eine Blattlaus süßen Saft gibt, der dir sehr wohlschmeckt, dann beiße sie nicht tot.«
»Wenn dir jemand irgendwie nicht paßt, so bespritze ihn mit einem ätzenden Saft, damit er schnell Reißaus nehme.«
Das waren die Grundsätze, nach denen die Ameisenfelder fortan lebten. –
Es geschah aber, daß eines Tages ein Igel durch[8] das Stadttor von Ameisenfeld, das durch die Blätter einer großen Schwarzwurz gebildet wurde, einzog und Quartier begehrte. Der Bürgermeister der Stadt ließ sich schnell von seinen sieben Stadträten die Fühler abputzen und ging dem großen Gaste entgegen. Als er ihn sah, knickte er vor lauter Ehrfurcht mit allen sechs Beinen vor ihm ein: und sagte:
»Hoher Herr, dir unsere Gefühle ob deines Einzugs in unsere Stadt auch nur annähernd zu schildern, geht leider über meine Kraft. Was uns vor allem bewegt, ist tiefe Beschämung. Denn siehe, Ameisenfeld ist nur eine Fabrikstadt. Unsere Straßen sind bestreut mit dem Schutt der Arbeit. Anlagen haben wir keine, außer einer Distelplantage und einem kleinen Gundermannwäldchen. In deren Schatten würdest du dich nicht wohlfühlen. Und es fehlt uns leider auch an einem geeigneten Palast für dich.«
Der Igel zog die Stirn in Falten und sagte:
»Ich bin ein Forschungsreisender. Ehe ich nicht Ameisenfeld in- und auswendig kenne, kann ich nicht weiterziehen. Vor allen Dingen will ich hier einen wissenschaftlichen Vortrag halten.«
Der Bürgermeister legte über dieses Anerbieten eine gezwungene Freude an den Tag und ließ den Vortrag für abends 6 Uhr ansagen. Da kein Eintrittsgeld erhoben wurde, erschien die ganze[9] Stadt. Der Igel hub nun an zu reden von den schweren Gefahren, die dem Ameisenvolke drohten. In Südamerika lebe ein Tier, das trotz seines schlichten Namens Myrmecophaga jubata doch eine scheußliche Bestie sei. Es habe einen spitzen Rüssel und eine ellenlange, mit Leim bedeckte Zunge. Den Rüssel und die Zunge stecke es nun in die Ameisenhäuser und fange und morde, was es nur erwischen könne. Wenn man dagegen ihn, den Igel, betrachte, müsse man einsehen, daß er weder eine spitze Schnauze noch eine klebrige Zunge habe.
Die Ameisenfelder hatten der Erzählung zitternd zugehört. Als der Igel geendet hatte, brachte der Bürgermeister ein Hoch auf ihn aus, wobei er sich auf den Rücken legte, damit er bei dem Hoch alle sechs Beine in die Höhe strecken konnte. Der Igel nickte befriedigt und sagte: wenn sich also die Ameisenfelder über seine Ankunft so freuten, so wolle er gern das Opfer bringen und etwas bei ihnen bleiben.
Darauf aber erhob sich ein kecker Ameisenjüngling, welcher sagte:
»Was geht uns das Tier aus Südamerika an, wo doch unsere Waldstadt gar nicht in Südamerika liegt?«
Der Igel zog seine Stirnrunzeln bis zur Nase herab und rief:
»Habt ihr je solchen Unverstand gehört? Kann sich nicht alle Tage ein Myrmecophaga jubata auf einem Schiff ohne Paß einschmuggeln und zu uns kommen? Sind nicht auf solche Weise alle ausländischen Tiere zu uns gekommen?«
Die Menge nickte Beifall, sah voll Mißbilligung auf den naseweisen Ameisling, und der Bürgermeister meinte: »Er muß streng bestraft werden!«
»Das muß er!« nickte der Igel, »und um mich euch gefällig zu erweisen, werde ich ihn hinrichten!«
Darauf fraß der Igel den Ameisenjüngling. Wie von ungefähr erwischte er auch noch dreißig Verwandte des Jünglings, die in dessen Nähe standen.
Darüber erschrak das Volk; der Bürgermeister aber zwinkerte ihm beruhigend zu: über so einen kleinen Fehlgriff eines großen Herrn dürfe man keinen Lärm machen.
So blieb der Igel in Ameisenfeld, bis sich das Volk allgemach um 90 Prozent vermindert hatte. Da endlich versammelte der Bürgermeister eines Nachts heimlich die wenigen Überlebenden, und sie beschlossen, gemeinsam über den mörderischen Igel herzufallen und ihn zu töten.
Mit dem Heldenmute, der den Ameisenfeldern eigen und der im ganzen Lande berühmt ist, zogen sie aus.
Sie fanden den Igel tot. Er hatte sich den Magen überfressen und war an Ameisensäurevergiftung gestorben.
Der Bürgermeister atmete auf, trat auf seine Leiche und hielt eine Rede:
»Bürger, da liegt unser Feind! Tot! Er hat unserer Macht nicht zu widerstehen vermocht. An der starken inneren Kraft der Ameisenfelder ist er zugrunde gegangen. Der Ruhm unserer Stadt ist und bleibt unsterblich!«
Das Volk trampelte mit allen sechs Beinen Beifall und winkte mit den Fühlern.
Darauf wurde ein großes Freudenfest gehalten. Alle Bürger zogen auf die grüne Alm, die in der Nähe von Ameisenfeld war. Dort wurde die große Fingerhutglocke geläutet. Dann wurden die Blattläuse gemolken. Alles Volk trank sich ein Räuschlein an, und schließlich sprach man mit einer gewissen Liebe und Achtung von dem Igel, dem allein dieses fröhliche Fest zu verdanken war.
Der große Baum, der Eichenhofen seinen Namen gab, war so schön und gewaltig, daß mein Freund Heinrich behauptete, das sei dieselbe Eiche,[12] die Bonifacius einst bei den alten Hessen umgehauen habe. Ich glaubte dies eine Zeitlang, dann aber kam mir der Gedanke, unsere Eiche werde vielleicht doch nur der Sohn von jener berühmten Donarseiche sein. »Nein,« sagte Heinrich, »Sohn ist viel zu jung; wenn sie es nicht selbst ist, dann ist sie ihr Vater!«
Dabei blieb es, und das war nun historisch.
Eine grimmige Feindschaft hegten wir gegen vier Waldarbeiter, die einst, um uns zu verspotten, sich die Hände reichten und einen gemütlichen Tanz um unsere Eiche ausführten, wo wir doch bestimmt festgestellt hatten, daß der Baum von sieben Männern nicht zu umspannen sei. Wir setzten uns über das höchst ärgerliche Vorkommnis nur dadurch hinweg, daß wir uns sagten, die Arbeiter seien betrunken gewesen und darum »gelte« ihr Tanz nicht.
Eichenhofen war rings von Brombeer- und Himbeerhecken eingefaßt; auch viele wilde Rosen blühten an seinen Grenzen. Da dachten wir oft an Dornröschens Schloß, und jeder brach gern und kühn durch die Dornenhecke, zumal zur Spätsommerzeit, wenn die Beeren reiften. –
Die »Traumstadt« nannten wir Eichenhofen auch manchmal. Da gab es einen Moosplatz, auf dem die Käferlein stolzierten und eitel ihre funkelnden Röcke zeigten, eine Rosenstraße, wo[13] unter lauter lieblichen Heckenröslein sich das Volk der haftenden Bienen und der sammetröckigen, vornehmen Hummeln tummelte, eine Hirschstraße, die tief ins Dunkel des Waldes ging und auf der wir einmal zu seinem und unserem Schrecken dem König des Waldes begegneten.

In Eichenhofen ersann ich mein erstes Märlein, dort klangen die ersten Verse in meiner Seele. Ich erfand eine Geschichte von dem Brünnlein, dessen Wasser im Mondschein zu goldgelbem Wein[14] wird, von dem die Gnomen ihr Schöpplein trinken, und wenn Heinrich und ich fortan aus dem Brünnlein tranken, sahen wir uns oft an und sagten: es schmeckt wirklich wie Wein. Ich konnte das um so eher sagen, als ich damals noch nie einen richtigen Tropfen Wein getrunken hatte.
Einmal, als ich ein Gedicht gemacht hatte, das ich Heinrichs Mutter, unserer »Fee«, vorlas, küßte sie mich auf die Stirn, flocht einen Eichenkranz, setzte ihn mir auf den Kopf und sagte: »Gott segne dich!« Da war es wirklich, als ob ein tiefer Segenstrom von dem grünen Kranz aus durch meine Seele ränne; ich stand ganz still da und ging dann bald nach Hause. Dort hängte ich das Kränzlein über mein Bett, rund um das kleine Kreuz herum, das dort war, und wenn ich fortan mein Abendgebet sprach und den Kranz sah, betete ich immer einen Satz mit: »Lieber Gott, laß mich ein Dichter werden.« Ich sprach aber die Worte nie aus, ich dachte sie nur; ich schämte mich, sie zu sprechen.
Heinrich war mein treuer Freund. Er neidete mir meinen Kranz nicht; aber er sehnte sich danach, auch einen zu erhalten. Er bekam ihn erst, als er sich ihn verdient hatte. Ehrlich verdient! Er hatte ein kleines Mädchen mit Gefahr seines eigenen Lebens aus dem Wasser gezogen. Damals hatte die Fee wohl ihren glücklichsten[15] Tag, als sie ihrem Jungen den Eichenkranz flocht. –
Sonst war es mit unserer Tapferkeit nicht übermäßig gut bestellt; ja, es gab Fälle, wo wir eine traurige Rolle spielten.
Einmal machten wir einen schauerlichen Fund. Wir entdeckten im Dorngestrüpp die Leiche eines Eichkätzchens. Erschüttert betrachteten wir das herrliche Tier, seufzten laut und lange und zergrübelten uns die Köpfe, was seinem jungen, lustigen Leben ein so jähes Ende bereitet haben könne.
»Vielleicht hat es der Marder gefressen,« sagte Heinrich tiefsinnig.
»Oder eine Eule hat es fortgeschleppt,« meinte ich bedächtig.
Darauf war eine Pause. Plötzlich machte ich ein spöttisches Gesicht und sagte: »Wie kann es dein Marder gefressen haben, wenn es doch noch hier liegt?« Worauf sich Heinrich höhnisch an die Stirn tippte und sprach: »Kann es wohl deine Eule weggetragen haben, wenn es noch hier liegt?«
So machten wir uns gegenseitig unsere Überlegenheit klar, und einer ärgerte sich über die Dummheit des anderen. Endlich glaubte ich es zu haben: »Es ist jedenfalls fehlgetreten, heruntergestürzt und hat den Hals gebrochen.«
»Nein,« sagte Heinrich, »der Hals ist noch ganz. Es hat gewiß einen giftigen Pilz gefressen.«
Da schrie ich: »Nein, siehst du, es ist totgeschossen!«
Das Eichkätzchen war wirklich erschossen; wir sahen nun deutlich die Schußwunde.
Heinrich erbleichte.
»Das ist ein Wilddieb gewesen,« sagte er.
Ich sah ihn an, nickte mit dem Kopfe und rannte ohne weiteres davon. Und er rannte hinterher. Wir rannten so lange, bis wir in der Nähe von Feldarbeitern waren, und blieben dann mutig stehen.
»Wir müssen den Mörder fangen,« sagte Heinrich ganz laut.
»Ja, wir müssen ihn fangen,« rief ich und ballte die Faust. Daran beschlossen wir, zum Förster zu gehen und ihm die verbrecherische Tat zu melden. Wir rieten, wo der Förster zu dieser Stunde sein könne, und fanden die größte Wahrscheinlichkeit schließlich darin, daß er in der Schenke sei. Und so war es auch. Er hörte unseren fast atemlosen Bericht an und machte ein bitterernstes Gesicht.
»Der Wilddieb muß augenblicklich gefangen werden,« meinte er zornig, spielte mit zwei anderen Männern noch eine halbe Stunde lang Karten und ging dann mit uns.
Ganz in der Nähe hatte Heinrich seine Vogelflinte[17] und ich meine Armbrust aufbewahrt. Diese Waffen holten wir, nahmen sie schußbereit unter den Arm und folgten dem Förster, der sagte, nun sei ihm vor dem Wilddieb weiter nicht bange.
Ich für meinen Teil gestehe, daß ich diese lobende Anerkennung meiner Männlichkeit und Tapferkeit nur mit gemischten Gefühlen aufnahm. Eine Armbrust einem mörderischen Wilddieb gegenüber ist immer so eine eigene Sache. Man muß aufs Auge oder vielleicht auch auf die Schläfe zielen, wenn man einen Erfolg haben will. Aber ich war nun einmal eine Person, auf die sich der Förster in seinem schweren Beruf verließ, und so wollte ich in der Stunde der Gefahr nicht kneifen.
Wir durchsuchten den ganzen Busch. Ein paarmal entdeckten wir Fußspuren, den Wilddieb aber fanden wir nicht. Von Minute zu Minute wuchs unser Mut, und in großer Tollkühnheit riefen wir laut, er solle nur zum Vorschein kommen, der elende, feige Kerl. Er kam nicht, und schließlich sagte der Förster: »Wahrscheinlich ist der Wilddieb mal auf einen Augenblick weggegangen. So'n Mann hat ja auch mal was anderes vor.«
Das bedauerten wir sehr, und wir verachteten den Wilddieb, der nicht auf seinem Posten geblieben war. Der Förster machte den Vorschlag, wir könnten ja unterdes das Eichhorn beerdigen.[18] Darauf gingen wir mit Freuden ein. Das tote Tierchen wurde in eine Erdgrube gelegt, und wir drei standen mit feierlichen Angesichtern an seinem Grabe. Der Förster befahl mir, mit meiner Armbrust den Trauersalut zu schießen. Darauf schoß ich meinen Rohrpfeil über das Grab hinweg, und der Förster machte mit seinem Munde »Plaff!« dazu. Das veranlaßte mich, ihn scharf anzusehen, ob er die ganze Sache auch ernst nehme.
Er nahm sie aber sehr ernst. Mit geradezu verbissenem Gesicht stand er da, und mit dumpfer Stimme sprach er:
»Heinrich, halte eine Leichenrede! Aber vergiß das ›Amen!‹ nicht.« Heinrich und ich waren beide ausgezeichnete Redner. So war es kein Wunder, daß Heinrich, ohne sich's erst lange zu überlegen, folgende schöne Rede hielt:
»Liebes Eichhörnchen, du bist leider tot. Von wegen eines Schuftes! Er hat jetzt gerade etwas anderes zu tun, sonst täten wir ihn erschießen. Liebes Eichhörnchen, du warst das schönste Tier auf der ganzen Welt. Du hast so niedliche Pfoten. Jedes Jahr zu Weihnachten werde ich dir drei große, vergoldete Nüsse in dein Grab stecken. Amen.«
Der Förster drückte die Augen zu, dann wies er auf mich.
»Jetzt halte du eine Leichenrede!«
Ich hustete, bis ich rot wurde, dann sagte ich:
»Liebes Eichhörnchen, du bist leider tot. Von wegen eines Schuftes!«
»Du leierst ja wieder dasselbe her!« fuhr mir der Förster dazwischen. Ich sagte verlegen, es komme schon noch, hustete noch einmal lange und inbrünstig und sagte dann: »Liebes Eichhörnchen, du warst das allernützlichste Tier. Hoch auf der Eiche hast du dein Haus gehabt, und es hatte immer die Tür dort, wo kein Wind ging. Und, und im Winter hast du geschlafen. Und, und du konntest so fix turnen. Und du hattest einen schönen Schwanz und vier schöne, weiße Nagezähne. Amen.«
Nun hustete der Förster, stützte sich auf seine Büchse und sprach:
»Jetzt werde ich eine Leichenrede halten!«
»Liebes Eichhörnchen, du warst also sozusagen das allerschönste und allernützlichste Tier. Wenn ein Vogelnest auf der Eiche war, dann bist du gleich fix angeturnt gekommen. Da hast du mit deinen niedlichen Pfoten die Eierchen genommen und hast sie ausgesoffen. Und dann, liebes Eichhörnchen, wenn kleine Vögelchen im Neste waren, dann hast du sie mit deinen schönen, weißen Nagezähnen zerbissen und gefressen. Wenn ein Baum im Frühjahr frische Sprossen trieb, hast du sie hübsch zierlich abgenagt, du liebes Eichhörnchen,[20] du! Und darum ist ein ›Wilddieb‹ gekommen und hat dich tot geschossen, du Rabenvieh, du Kanaille! Und der Wilddieb war ich selbst, und ich habe das alles gemacht, um mal zwei Schafsköpfen eine Lehre zu geben. Amen.«
Damit machte er Kehrt und stapfte davon.
Heinrich und ich standen mit offenen Mäulern da. Ich fand zuerst die Sprache wieder und sagte: »Das ist eine Gemeinheit.« Heinrich aber meinte: »Er hat was von zwei Schafsköpfen gesagt!«
»Damit sind wir gemeint,« sagte ich zornig. »Und er hat das Eichhörnchen selbst erschossen.«
Heinrichs Stirn zog sich in Falten.
»Wenn ich mal unser Gut erbe,« sagte er, »setze ich ihn ab.«
»Das tue aber bestimmt,« rief ich, »er hat es verdient!«
Von fernher scholl das fröhliche Lachen des Försters.
Der Geistergrund war der einzige Ort im Gebiet der fünf Waldstädte, von dem die Leute im Dorfe etwas Genaueres wußten. Während so ein Bauer achtlos durch Ameisenfeld stapfte und[21] dort nicht einmal den Bürgermeister kannte, während er an der tausendjährigen Donarseiche dumm und achtlos vorüberging, ja selbst nach den Herrlichkeiten von Heinrichsburg kaum hinüberschielte, ging sein träges Herz sofort rascher, wenn er in die Nähe von Geistergrund kam.
Was spielten auch dort für schauerliche Geschichten an dem dunklen Moor und dem Graben mit dem schwarzen Wasser, Geschichten, die Hunderte von Jahren alt waren und an den Winterabenden beim flackernden Kienspanfeuer erzählt wurden, bis alle Wangen rot und alle Herzen bange waren.
Da war die Geschichte von der Bäuerin, die ihren Mann umgebracht hatte, indem sie ihm ein Mahl von giftigen Pilzen bereitete. Noch am gleichen Tage kam die schwere Übeltat ans Tageslicht, und am anderen Morgen errichtete die Obrigkeit einen Galgen und hängte die Bäuerin auf. Aber ihr Leichnam verschwand, und auch der Leichnam des Mannes verschwand, und lange Zeit wußte niemand, wohin beide gekommen seien, bis eine Frau im Geistergrund einen großen giftigen Pilz sah, der den Hut vor ihr abnahm und sagte: »Erbarme dich meiner, erbarme dich meiner!« Als die Frau sich vor Schreck nicht rühren konnte, kam eine Schlange gekrochen und wickelte sich dem Pilz ums Bein. Und die Schlange sprach: »Ich fresse den Pilz;[22] ich fresse den häßlichen, geizigen Pilz!« Sie funkelte dabei mit den Augen.
Da ist die Frau schreiend davongelaufen und hat im Dorfe alles erzählt, und es hat sich lange Zeit niemand an den Geistergrund herangewagt.
Als aber einmal der Schuster Humpel erzählte, er habe nun die beiden auch gesehen, nur hätte diesmal der Pilz die Schlange gefressen, glaubte ihm niemand; denn die Leute waren sehr aufgeklärt, und Humpel war oft betrunken. – – –
Da war die andere Geschichte von dem Müller Eisert. Der war in der Zeit, da der alte Fritz Krieg führte, ins Lager der Russen übergegangen und war ein so schlechter Kerl geworden, daß er gegen seinen eigenen König kämpfte. Eisert besiegte auch den alten Fritz in der Schlacht bei Cunnersdorf und zog dann mit seinen Russen als ein prahlender Kriegsheld bis vor sein Heimatsdorf. Dort ließ er Kanonen auffahren und alles zusammenschießen und in Brand stecken. Dann ritt er auf einem pechschwarzen Roß durch das brennende Dorf und verhöhnte die Leute und zwang sie: »Gnädiger Herr!« und »Euer Wohlgeboren!« zu ihm zu sagen. Für diese Missetat wurde er bestraft. Als er wieder fortritt, begann auf dem Turme die Glocke zu läuten. Den Turm und die Kirche hatten die Russen, weil sie Christen sind, verschont.
O, wie drang der Ton der Heimatglocke dem argen Sünder so anklagend ins Ohr! Sie dröhnte ihm in die Seele wie Posaunenton des jüngsten Gerichts und versetzte sein Herz in eine ganz schreckliche Angst. Und plötzlich wandte sich das Roß, jagte zurück auf das Dorf zu, warf den bösen Mann am Eingang des Dorfes auf die Erde und galoppierte ganz allein in die finstere Nacht hinaus.
Der Müller schlich sich an den Turm, um zu sehen, wer da so schrecklich an der Glocke zöge. Da sah er, daß niemand in dem Turm war, daß die Glocke ganz von selber läutete. Darüber wurde er ganz unsinnig vor Angst. Schreiend und winselnd lief er um das Dorf herum, fand auf dem Wege einen Strick und erhängte sich in der Verzweiflung seines Herzens im Geistergrund, wie sich Judas erhängte, als er den Herrn Jesus verraten hatte.
Jetzt noch stand die Weide im Geistergrund, an der der Verräter sein elendes Leben selbst beendet hatte. – –
Das waren unfreundliche Geschichten. Und da war noch eine Geschichte, von der wir Kinder etwas gehört hatten, ohne sie recht zu verstehen. Und eben, weil ich sie nicht verstand, machte ich ein Gedicht darüber. Das Gedicht aber war so:
Das war das Gedicht, für das mir unsere gute Fee drüben in Eichenhofen den Kranz schenkte. –
Es gab Zeiten, wo Heinrich und ich uns sehr vor dem Geistergrund fürchteten. Um die Dämmerzeit wären wir nicht hingegangen, und auch wenn die Nebelmänner zwischen den Erlen hin- und herkrochen, wagten wir uns nicht in diese Gegend. Heinrich machte sogar einmal den Vorschlag, den Geistergrund abzusetzen. Was ihm nicht paßte, wollte er immer »absetzen«: den Förster, den Geistergrund, die Kreuzottern und die lateinische Grammatik. Es ist aber leider alles bestehen geblieben.
Unsere Fee hatte im allgemeinen nichts dagegen, wenn wir uns mal etwas fürchteten. Wenn wir sie fragten, ob es Räuber gebe, sagte sie »Ja!«,[25] und wenn wir wissen wollten, ob wohl die Räuber je in unsere Gegend kommen könnten, sagte sie auch »Ja«! Dann bekamen wir allemal knallrote Backen, und unsere Stimmen wurden weniger krähend, als sie sonst waren. –

Einmal, als wir mit dem Förster zufällig wieder auf freundschaftlichem Fuße lebten, hätten wir ihm gar zu gern eine zahme Dohle abgebettelt, die er in seinem Forsthause hielt. Er machte eine geheimnisvolle Miene und sagte:
»Die kann ich euch nicht geben. Die ist ein ganz seltsamer Vogel. Ich habe sie auf der Judasweide gefangen. Dort hatte sie ihr Nest. Und sie ist eine verwunschene Prinzessin.«
Wir Jungen versuchten, ein ungläubiges Gelächter[26] anzuschlagen, aber es klang ganz meckrig, und wir sahen mit Unbehagen auf den Vogel, der plötzlich auf uns zukam, so daß wir einige Schritte zurückwichen. Die Dohle funkelte uns mit ihren Äuglein an, schlug mit den beschnittenen Flügeln und schrie: »Beatrice! Beatrice!«
Da sagten wir schnell: »Guten Abend« und gingen davon. Der Förster kam uns nach.
»Ich sehe es ja ein, daß ihr die Dohle durchaus haben wollt,« sagte er; »aber es würde euch nichts nützen, wenn ich sie euch schenkte, denn sie würde euch trotz ihrer beschnittenen Flügel entwischen. Wollt ihr die Dohle haben und behalten, so müßt ihr in die Judasweide abends in der Dämmerung einen Nagel einschlagen. Einer muß den Nagel halten, der andere muß hämmern.«
Darauf sagten wir, wir hätten es uns überlegt: eigentlich wüßten wir gar nicht recht, was wir mit einer Dohle anfangen sollten. Er, der Förster, brauche eigentlich einen solchen Vogel viel notwendiger als wir.
Der Förster spuckte auf den Boden, uns gerade dicht vor die Zehen, und sagte: »Wenn ich nicht wüßte, was ihr für mutige und kluge Kerle seid, würde ich denken, ihr fürchtet euch. Aber damit habt ihr recht, daß ich den Vogel notwendig brauche.«
»Wozu brauchst du ihn denn?« fragte ich neugierig.
»Zum Geschichtenerzählen.«
»Zum Geschichtenerzählen? Ei, wieso?«
»Hm. Wenn ich abends müde aus dem Walde komme, ziehe ich mir die Stiefel aus, sperre die Hunde aus der Stube hinaus, setze mich in den Lehnstuhl und dann sag' ich zu der Dohle: Beatrice, leg' los!«
»Und – und dann legt sie los?«
»Legt sie los! Jawohl! Sie erzählt famos. Aber leider bloß lauter Räuber-, Gespenster- und Indianergeschichten. Andere weiß sie nicht. Alles zum Gruseln.«
Räuber-, Gespenster- und Indianergeschichten! Das hielten Heinrich und ich damals für das Schönste auf der ganzen Welt. Wir hatten uns heimlich solche Bücher geliehen und einige davon gelesen, bis es die Fee erfuhr und uns sagte: sie hätte uns nicht mehr lieb, wenn wir so etwas wieder täten, denn solche Geschichten seien schlecht und dumm und erlogen. Da hatten wir es aus Liebe zur Fee unterlassen. Aber wenn wir nun eine Dohle hätten, die so etwas erzählen könnte, das wäre doch etwas anderes, denn eine Dohle ist doch kein Buch. Und man käme dann auf ehrliche Weise zu interessanten Geschichten.
»Ja,« sagte der Förster, »meine Großmutter[28] hört auch mit zu.« Des Försters Großmutter war 92 Jahre alt.
»Borg' uns einen Hammer und einen Nagel!« rief Heinrich; »wir gehen jetzt gleich zur Judasweide! Nimm deine Büchse und deinen Hirschfänger und geh mit.«
»Wäre noch besser,« meinte der Förster; »allein müßt ihr gehen, und morgen abend ist die richtige Zeit; morgen ist Neumond.« –
Der nächste Abend war trübe und regnerisch. Den ganzen Tag hatten Heinrich und ich in schrecklicher Aufregung zugebracht. Kein Essen hatte uns geschmeckt, kein Spiel hatte uns gefallen und die Fee hatte uns ein paarmal ganz eigentümlich forschend angesehen. Schwache Augenblicke kamen, wo uns die ganze Sache leid wurde; aber dann dachten wir an die verzauberte Dohle, die Räubergeschichten erzählen konnte, und ein Fieberschauer von Glück, einen solch wundersamen Vogel besitzen, packte uns.
Am späten Nachmittag holten wir aus dem Handwerkskasten einen Hammer und einen starken Nagel heraus und verbargen beides unter dem welken, abgefallenen Laub eines Kastanienbaumes.
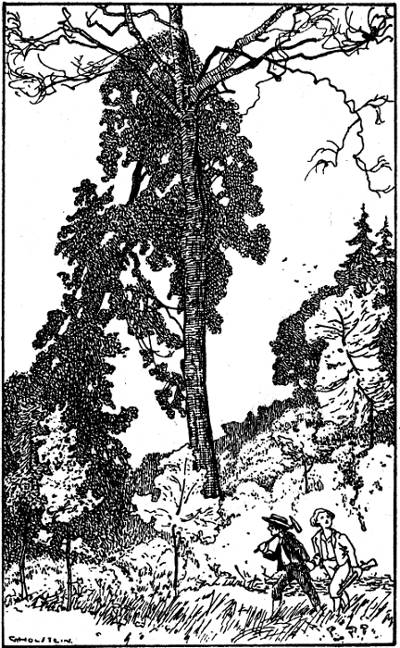
Als die ersten Lichter angezündet wurden, schauten wir uns starr in die Augen. Unter Heinrichs Wimpern blitzte eine Träne. Aber ich[31] – ich hätte für schöne Geschichten mein Leben hingegeben und faßte ihn an der Hand.
»Soll ich allein gehen?« fragte ich.
»Nein, ich lass' dich nicht allein gehen,« sagte er.
Er war immer ein treuer Freund. Er borgte mir sogar seine Flinte.
So schlichen wir uns aus dem Hof hinaus und gingen über die Felder. Der Wind jagte grauweiße Wolkenfetzen über den Himmel, und es regnete sacht. Wir kamen nach Ameisenfeld. Die ganze Stadt schlief. Wir gingen an der Wotanseiche vorbei. Sie stöhnte leise im Winde. Durch die Brombeerhecken brachen wir. Heinrich trug den Hammer; ich hatte den Nagel in der Hand wie einen spitzen Dolch. Manchmal war es mir, als ob er glühend heiß sei.
Wir sprachen beide kein Wort, denn das hatte uns der Förster eingeschärft. Aber das Schweigen machte unsere Herzen noch beklommener.
Nun tauchte der Geistergrund auf. Die niederen Erlen und Weiden zogen sich am schwarzen Graben entlang, eine hohe Ulme ragte über sie hinweg. Unter ihr sollten der Pilz und die Schlange gesehen worden sein. Und links von ihr, ein Stückchen vom Bachrande weg, war die Judasweide.
Ich schloß die Augen. Wie ein Wirbel war es in meinem Kopf. Rote Ringe sah ich tanzen, ein[32] brennendes Dorf sah ich, durch das auf schwarzem Roß der tolle Müller ritt. Dicker Schweiß rann mir unterm Hut hervor. Aber vorwärts ging es, immer vorwärts, zuletzt im Trab. Fest hielt ich den Nagel in der Hand. Heinrich strauchelte und fiel hin. Der Hammer entglitt ihm. Er hob ihn auf und packte mich fest am Arm. Unsere Herzen schlugen in rasender Schnelligkeit. Wir gingen immer noch vorwärts.
Da – erst sah ich's – dann sah's Heinrich – dann fielen wir auf die Knie –
Aus dem Erlengebüsch trat eine weiße Frau.
Die Frau aus dem Moor – die Frau, die ihr Kleid wäscht –
Wir schrieen laut um Hilfe.
Es war nicht die Frau aus dem Moor. Es war Heinrichs Mutter. Es war unsere Fee.
»Was wolltet ihr machen?« fragte sie freundlich. Da gestanden wir alles.
Sie zürnte uns nicht; sie strich uns beiden über die Köpfe.
»Nun, habt keine Angst; es passiert euch nichts, ich bin ja bei euch!«
Ja, nun wußten wir: es konnte uns nichts passieren, da sie bei uns war. Heinrich schlang den Arm um seine Mutter und küßte sie zweimal,[33] und dann nahm ich sie um den Hals und küßte sie dreimal.
Wir schritten ein paarmal an dem Graben auf und ab, ganz friedlich, als ob wir spazieren gingen, und nachdem wir etwa zehnmal ganz tief und erleichternd aufgeseufzt hatten, fühlten wir, daß unsere Herzen ruhiger wurden.
»Hat euch der Förster gerade um die jetzige Stunde bestellt?« fragte die Fee.
»Jawohl, später als 6 Uhr dürfe es nicht sein, hat er gesagt.«
»So wollen wir einmal hinübergehen in den Geistergrund,« meinte sie. Wir gingen ruhig und ohne Angst mit ihr über den schmalen Steg, der über den schwarzen Graben führte. Sie hielt uns an den Händen und sagte:
»Nun seht, wie still es hier ist, ebenso still wie überall im Walde.«
Dann gingen wir schweigend weiter. Über dem moorigen Grund wuchs dichtes, weiches Moos, und wir gingen ganz unhörbar. Einmal blieb die Fee stehen und sagte leise:
»Wenn euch etwas Seltsames oder Schreckliches auffällt, so erschreckt nicht oder schreit nicht; denn es ist ganz gewiß nichts wirklich Schreckliches.«
Da faßten wir großen Mut. Plötzlich aber blieben wir doch in jähem Schreck stehen.
Unter der hohen Ulme war der Pilz, ein schrecklich[34] großer, blutroter Pilz, und unter dem Pilze lag eine Frau. Heinrich begann zu weinen, ich begann zu schlucken, die Fee aber faßte fest unsere Hände und rief ganz laut und ruhig: »Du Pilz und du Pilzweib, kommt einmal beide her!«
Da schnellte plötzlich der verhexte Pilz hoch in die Höhe, das Weib richtete sich auf, und eine tiefe Stimme sagte:
»O jemine, die gnädige Frau!«
»Komm nur mal näher!« befahl die Fee.
Unsere Herzen schlugen; aber es war jetzt mehr Neugierde als Angst.
Der Pilz und die Frau wandelten ganz langsam auf uns zu. Und plötzlich brach Heinrich in ein lautes Gelächter aus, und ich lachte unter Tränen mit.
Vor uns stand der Herr Förster. Er hatte sich die Kleider seiner zweiundneunzigjährigen Großmutter angezogen, und der Pilz war der riesengroße und brennend rote Regenschirm der alten Frau, der die Verwunderung der ganzen Gemeinde bildete, wenn die Alte noch einmal zur Kirche gehumpelt kam.
»Gnädige Frau – gnädige Frau –« stammelte der Förster.
Er sah greulich aus. Der weite blumige Rock war ihm viel zu kurz, so daß seine groben Stiefel zum Vorschein kamen, das altmodische[35] Leibchen war ihm viel zu schmal, so daß man seine Weste sah, und die alte Schleifenhaube saß ihm ganz windschief auf seinem struppigen Kopf. Den roten Schirm hatte er nun zugeklappt und quetschte ihn wie ein brennendes dickes Gebund in höchster Verlegenheit unter den Arm.

Die Fee blickte halb streng und halb lächelnd auf den sonderbaren Geist und sagte:
»Schämen Sie sich denn nicht, Förster, solche Faxen zu machen? Denken Sie nicht daran, was den Kindern vor Schreck passieren kann?«
Die Pilzbäuerin raffte in tödlicher Scham an ihrem Kleid herum.
»Gnädige Frau, weil halt – weil halt die beiden solche Schlingel sind.«
»Es gibt viele Schlingel auf der Welt, große und kleine,« sagte die Fee.
Der Förster kraute sich die Schleifenhaube.
»Nun werd' ich wohl gar meine Stellung verlieren,« sagte der trostlose Hüter des Waldes. Die Fee lächelte milde.
»Etwas werden Sie schon verlieren: Sie werden den Jungen zur Strafe Ihre Dohle schenken!«
»Können sie kriegen, können sie kriegen!« schrie da das Zauberweib voll Entzücken und haschte nach der Hand der guten Fee, die sich abwenden mußte, weil es wohl mit ihrer Fassung vorbei war.
»Gnädige Frau,« sagte der Förster, »wenn es erlaubt ist, möcht' ich mich aus dieser sehr fatalen Begebenheit empfehlen.«
»Gehen Sie nur, gehen Sie nur!« sagte sie und blieb immer mit dem Gesicht abgewandt.
Da machte er eine Verneigung, wobei ihm der geblümte Rock bis über die Kniekehlen emporrutschte, und dann ging er davon. Als er an den Bach kam, wollte er, wie er's gewöhnt war, hinüberspringen; aber die Feiertagszier seiner Großmutter wickelte sich um seine Beine und er plumpste dicht am Rande in die Flut. Das war für uns Kinder der glänzendste Spaß. Gleich[37] darauf pudelte er sich ans Ufer und jagte in fliegendem Gewande und mit flatternden Haubenschleifen davon. –
Die Dohle haben wir bekommen; da sie aber tagaus, tagein nichts anderes zu erzählen wußte als: »Beatrice! Beatrice!«, wurde sie uns langweilig.
Die Stadt lag auf einer Insel, die ringsum von dem Wasser eines Stromes umgeben war. Wenn ein starker Regen fiel, wurde dieser Strom so tief, daß wir uns die Hosen aufstreifen mußten, um ihn durchwaten zu können. In trockenen Zeitläuften blies der Wind den Staub vom Flußgrunde bis in unsere Stadt. Wir warfen uns dann platt auf die Erde und redeten vom Samum.
Die Insel war mehrere Steinwürfe lang und fast eben so breit. Ihr Gebiet umfaßte die Hohkönigsburg, die Stadt selbst, das Felsengebirge, einen Kriegs- und einen Handelshafen, ein Jagdschloß, eine Meierei und eine Hundehütte. In der Stadt gab es ein Rathaus, eine katholische, evangelische, jüdische und heidnische Kirche, ein Museum, ein Hotel, sehr viele Geschäfts- und Wohnhäuser und einen Reichstag.
Die größten Gebäude waren die Hohkönigsburg, das Hotel und die Hundehütte. Die Burg war im 19. Jahrhundert vom Zimmermann Schadel erbaut, und der Bau hatte über 70 Mark verschlungen. Dafür war er aber auch prächtig und stattlich. Die Burg umfaßt nur den Thronsaal; für mindere Räume war kein Platz. Eine stolze Fahne wehte vom Dache, und an der Pforte zeigten zwei angeklebte Bilder grimmiger Löwen, von denen der eine ein Tiger war, daß hier im Schloß Macht und Größe wohne und jeder ein Kind des Todes sei, der sich den hier herrschenden Gewalten widersetze. Bei Regenwetter wurden sämtliche Hauptteile der Stadt mit Wachsleinwand überdeckt.
Das Hotel hatte früher dem Pächter einer Kirschenallee gehört, der darin sein Wächteramt ausgeübt hatte. Kinder unter vier Jahren konnten erhobenen Hauptes durch seine Pforten schreiten, und auch wir brauchten uns nicht sonderlich zu bücken, wenn wir eintraten. Es hieß »Hotel Bristol« und trug an seiner Front viele Schilder, als: »Zivile Preise«, »Warme und kalte Speisen zu jeder Jahreszeit«, »Eintritt verboten!« und was etwa sonst noch an ein gutes Hotel an Anschlägen gehört.
Der einzige ständig bewohnte Raum von Heinrichsburg war die Hundehütte. Hier hauste Pluto, der Wachhund. Er war von strengem[39] Charakter, aber gutem Appetit, deswegen geriet er in Verlegenheit, wenn ihm einer, den er eigentlich bekämpfen sollte, einen Knochen anbot. Auf diese Weise hat Pluto es leider nicht verhütet, daß uns eines Nachts das Hotel gestohlen wurde. Er stand am Morgen nach der Unglücksnacht mit albernem Gesicht auf der leeren Baustelle, wedelte verlegen mit dem Schwanze und bellte nach dem Ufer hin, wie einer bellt, der kein gutes Gewissen hat. Den Bestechungsknochen hatte er an einer leicht kenntlichen Stelle verscharrt.

Bei der letzten Volkszählung in Heinrichsburg wurde Plutos Flohbestand in Fell und Hütte auf zusammen 250 Stück lebend angegeben. Natürlich nur schätzungsweise, wie es bei wilden Stämmen[40] immer geschieht. All dieses Kleinvolk hielt Pluto in guter Zucht; Übergriffe ahndete er mit scharfer Kralle.
Pluto war sehr vielseitig von Beruf: des Nachts mußte er wachen, am Tage zog er als prächtig aufgeschirrtes Roß den Triumphwagen des Königs, Sonntags trat er in der Stierkampfarena mit grimmem Mute als Bulle auf, und oft spielte er im Felsengebirge den Drachen oder fing in der Stadt Mäuse, welche sehr lästig waren, weil sie uns bereits die Rathaustreppe und einen Nachtwächter aufgefressen hatten. Nur als Delphin hatte Pluto kein Talent; denn allemal, wenn wir auf seinem Rücken durch die Fluten des Stromes ziehen wollten, warf er uns ab, sprang ans Ufer und schüttelte sein Fell, was kein Delphin tun darf.
Das Felsengebirge war ein Steilgebirge von durchaus alpinem Charakter. Seine größte Erhebung, die Adlerkoppe, hatte eine relative Höhe von 2500 Zentimetern; sie war im Winter mit »ewigem Schnee« bedeckt und fiel steil zum Flusse ab, von dessen Seite her sie nur von den geübtesten Bergsteigern mit Nagelschuhen, Eispickel und nach vorangegangener Anseilung zu erreichen war. Ein prächtiger Aussichtsturm von 30 Zentimeter Höhe krönte ihren stolzen Gipfel, und wer sich auf die Erde legte und über diesen[41] Aussichtsturm hinweg in die Ferne sah, genoß die herrlichsten Landschaftsbilder. Dicht unter ihm das wildzerklüftete Gebirge, an dessen Fuß der Strom mit seinen weißen Segelbooten und seinem Spiritusdampfer brandete, dann die Stadt, die »wie eine Spielzeugschachtel« ausgebreitet lag, die trotzige Hohkönigsburg, die dunkel aufragende Hundehütte, der weite Wald und das grüne Wiesenland bis weit hinaus an den Horizont in das Gebiet von Geistergrund und Ameisenfeld.
Wie ich inzwischen auch herumgekommen bin in fremden Landen und Erdteilen: die Aussicht von der Adlerkoppe bei Heinrichsburg ist die einzige, die ich in dem Reisebuch meines Lebens mit drei Sternen bezeichnen mag.
Der Abstieg von der Adlerkoppe nach der Stadt bot nur mäßige Schwierigkeiten und war ohne Lebensgefahr zu bewerkstelligen. Er führte an einer grünen Alm vorüber, auf der eine Herde buntgescheckter Kühe weidete und ein Hirtenbub vor seinem Alpenhäuslein saß und lieblich auf einer Schalmei spielte. Nur eine drohende Kuppe ragte noch auf. Dort legte ein kühner Alpenjäger eben auf eine Gemse an. Wenn man sich die hohlen Hände als Fernglas vor die Augen hielt, konnte man die aufregende Szene so oft beobachten, wie man vorbeikam.
Etwa in halber Höhe des Gebirges war der »Gebirgsbahnhof« angelegt. Er hatte einen sehr schmuck eingerichteten Wartesaal, eine Wegeschranke und eine Telegraphenstange ohne Draht. Der Zug bestand aus einer Lokomotive und drei allerliebsten Aussichtswagen. Die Passagiere waren immer dieselben: ein Engländer, ein Professor mit einer Botanisiertrommel und eine Köchin mit einem Korb am Arm, die jedenfalls auf der Höhe nach Suppengemüse gesucht hatte. Wenn nun auch der Zug nicht übermäßig besetzt war, so war es doch herrlich anzusehen, wenn er in die Tiefe fuhr. Er machte die kühnsten Kurven, setzte über Viadukte, die über schauerliche Abgründe gespannt waren, raste durch pechdunkle Tunnel, durchbrauste die Ebene und fuhr endlich donnernd in den Bahnhof von Heinrichsburg ein, wo es sich bei dem Kommando: »Alles aussteigen!« ärgerlicherweise meist herausstellte, daß der Professor, der Engländer und die Köchin auf der raschen Fahrt von den Sitzen gepurzelt waren und auf dem Fußboden lagen. Ein Eisenbahnunfall wurde trotzdem, wie auf allen Gebirgsbahnen, nie bekannt.
O, und die Stadt Heinrichsburg selbst! Fürwahr, ein Fremdling hätte sich in ihrem Gewirr von Straßen und Plätzen rettungslos verlaufen. Auf dem Marktplatz stand das Rathaus; da[43] guckte der Bürgermeister den ganzen Tag zum Fenster heraus. In der katholischen Kirche war beständig Hochzeit, in der evangelischen immer Kindtaufen. Im Judentempel saßen tagaus, tagein drei Männer mit Zylinderhüten auf dem Kopf, und in der heidnischen Kirche schlachtete ein Priester, namens Mohammed, ständig ein Kind. Das Museum umfaßte vier Bilder und zwei Statuen, der Reichstag war immer geschlossen. Wir haben ihn, da wir nichts Rechtes mit ihm anzufangen wußten, später in eine »Aktien-Brauerei« umgewandelt.
Die Pracht der Auslagen, die sich die Geschäftshäuser leisteten, war erstaunlich. Allein der Fleischerladen mit seinen feuerroten Schinken und brennend braunen Würsten war ein kleines Weltwunder. Majestät sprach nebst hohem Gefolge täglich persönlich in diesem Geschäfte vor, dessen Warenbestand immer pünktlich erneuert wurde.
Heinrichsburg war eine werktätige Stadt: da saß der Schuster vor seinem Haus und zog den Pechdraht, da hieb in seiner dunklen Höhle der Schmied auf den Amboß, da saß der Weber am Webstuhl. Lastwagen fuhren die Straße entlang oder hielten vor dem Wirtshaus; der Postillon saß hoch auf dem Bock und blies sein lustiges Signal. Alle Handwerker waren vertreten, und[44] wo ein Gewerbe fehlte, da wurde zu Weihnachten oder zum Geburtstag Seiner Majestät König Heinrichs I. Abhilfe geschafft.
Nur eine Schule gab es in Heinrichsburg nicht. Majestät meinten, das sei nicht lustig und verderbe den Spaß. Dafür marschierten glänzende Soldaten auf den Straßen, und die Musikkapelle zog den ganzen Tag mit Tiradebumdieh durch die glückliche Stadt.
Merkwürdig war der Denkmälerbestand von Heinrichsburg. Von historischen Größen hatten Kaiser Wilhelm, Blücher, Zieten und der alte Fritz je ein Monument. Dann hatte Majestät selbst ein Denkmal, ebenso seine erlauchten Eltern: Rittergutsbesitzer Gerhardt und Frau. Diese Denkmäler bestanden aus Photographien, die in Steinpyramiden eingemauert waren. Bei Regenwetter wurden Zigarrenschachteln als Schutzdecke darüber gestülpt. Dann aber waren in Standbildern noch verewigt Robinson Crusoe und der »Pfadfinder«. Diese Denkmäler waren aus Holz, von Sr. Majestät selbst entworfen und modelliert. Sie wurden bei Regenwetter nicht zugedeckt; denn sie waren »abgehärtet«. Bei festlichen Gelegenheiten wurden sämtliche Denkmäler illuminiert.
Im Gerichtsgefängnis saßen Napoleon und der Räuberhauptmann Schinderhannes.

Herrlich war es draußen am Hafen. Oft lagen wir da am Ufer und sahen auf die weite, unübersehbare Wasserfläche und sprachen kein Wort. Wenn ein Schiff seine weißen Segel blähte und langsam von dannen fuhr, dann sahen wir ihm nach, dann schaute unsere junge Seele weit hinaus bis in die fernen Länder, nach denen das Schiff fuhr, zu fremdartigen Menschen, die in Zelten auf ewig grünen, ewig weiten Wiesen wohnten und andere Blumen und andere Sterne sahen als wir. Und all die tausend Gefahren, die das Schiff haben würde in Scylla und Charybdis, bei Seeräubern[46] und Meerungeheuern, erwogen wir und kämpften alle Not selbst durch und waren dabei, wenn das siegreiche Schiff eines Tages doch stolz und sicher in den Hafen fuhr.
Manchmal kam unsere gute »Fee«, die Schutzgöttin unseres Insellandes, zu uns herüber. Dann feuerten unsere Strandkanonen Salut, die Ehrenwache stand am Ufer, die ganze Militärkapelle war aufgestellt, und von allen öffentlichen und vielen privaten Häusern wehten Fahnen. Der König ging der »Schutzgöttin« entgegen und küßte ihr die Hand, und sie ging mit freundlichen Augen durch unsere Stadt, und wo es an etwas fehlte, das sah ihr gütiger Blick und ergänzte alsbald ihre geschickte, freigebige Hand.
Nur Pluto war an solchen Feiertagen eingesperrt. Wurde er losgelassen, so fuhr er in einer unsinnigen Freude durchs ganze Land, riß die Stadt um und brachte den Zug zum Entgleisen.
O, es war schön in Heinrichsburg! Die größten Ehren habe ich dort genossen: ich war Großwesir und Stierkämpfer, Hofdichter und Scharfrichter, Hotelportier und Mitregent. Ich habe die Straßen ausgebessert und das Gesetzbuch verfaßt, ich war Dachdecker und Theaterdirektor, Seeräuber und Staatsanwalt. Selbst die Frau Königin bin ich gewesen; da hatte ich lange gelbe Locken und ein weißes Kleid mit einem Goldgürtel und ein[47] Taschentuch, mit einer Krone gezeichnet. Am liebsten war ich Leuchtturm. Dann trug ich eine Laterne auf dem Kopf und ließ ihr Licht nach allen Seiten spielen, bis die Schiffe, die in Wetter und Not draußen waren, glücklich den Hafen erreicht hatten.
Unsere gute Fee! Wenn ich jetzt, da ich lange, lange schon ein Mann geworden bin, manchmal träumend die Augen schließe, sehe ich ein weites Gelände vor mir, dadurch ein schmaler Weg führt. Es ist der Weg, den ich durch mein Leben gegangen bin. Grüne Wälder, aber auch öde Schutthalden sind an seiner Seite, und es fehlt nicht an Denksteinen, und mancher der Denksteine ist ein Marterl. Wenn ich nun so sitze und träume, ziehen Hunderte und Tausende von Menschen an meiner Seele vorüber. Ihnen allen bin ich einmal begegnet, bin ein Stücklein mit ihnen gewandert. Aber die meisten schauen mich so fremd an, als hätte ich sie nie gesehen: alle die, die mir gleichgültig waren und alle die, die mir einmal wehe taten. Sie hat mein Herz vergessen. Die aber, die mir etwas Liebes, Gutes erwiesen, reichen mir alle die Hand, und ihre Stimme klingt mir wie die eines Freundes von gestern.
Und wenn sie kommt, die gute Fee meiner[48] Kinderzeit, schlägt mir auch heute noch das Herz in Liebe für sie; ich hasche nach ihrer weißen Hand und küsse die Hand und lege sie auf meine Stirn. Dann wehen ihre blonden Haare im Wind, und ihre Augen sind schön und lieb wie in alten Tagen. Und sie nimmt meine Seele mit sich und führt sie in
Da stand ein kleiner Tempel. In dem Tempel war eine Figur des Heilands, die war so weiß wie Schnee. Vor dem Heiland stand ein Knabe, und über der Gruppe waren in goldenen Lettern zwei Sprüche in die Wand geschrieben:
»Dieses Kind wird der Größte sein im Himmelreich!«
und:
»Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr in das Himmelreich nicht eingehen!«
Der Knabe aber, der vor dem Heiland stand, war Heinrichs Bruder Ludwig, der frühzeitig aus dem Leben geschieden war.
Als Ludwig starb, war ein solches Herzeleid auch über uns Kinder gekommen, daß ich mit Heinrich nach der Insel ging, um unsere schöne Stadt Heinrichsburg niederzureißen.
»Wenn Ludwig nicht mehr bei uns ist,« sagten[49] wir zueinander, »so macht uns die Stadt keine Freude mehr.«
Wir stiegen in bitteren Schmerzen auf die Adlerkoppe. Noch einmal schaute ich über den Aussichtsturm hinaus ins weite Land, dann löste ich ihn aus der Erde und nahm ihn unter den Arm. Heinrich packte den Bahnhof in seine Mütze, und eben wollten wir den Alpenjäger und die Gemse von der Felskuppe holen, als Heinrichs Mutter uns nachkam. Ihr Gesicht war weiß, und sie ging ganz langsam; aber sie lächelte doch, als sie uns über die Köpfe strich und sprach:
»Laßt nur eure Stadt stehen; Ludwig hat jetzt eine viel schönere Stadt als ihr!«
Da nahm Heinrich den Bahnhof wieder aus der Mütze, und ich trug den Turm wieder auf den Berg, richtete ihn dort auf und überzeugte mich, daß die Aussicht über ihn hinweg wieder ganz herrlich schön sei.
Dann gingen wir drei nach Hause. Wir sprachen nicht. Es war gegen Abend, und der erste Stern tauchte auf am Himmel. Da holte Heinrich tief Atem und fragte mit stockender Stimme:
»Was für eine Stadt hat Ludwig?«
Die Mutter zog ihn an sich und sagte:
»Der liebe Gott kann ihm eine Stadt aufbauen aus lauter Gold.«
»Und hat er auch einen Berg und einen Turm darauf?« fragte ich beklommen.
»Er steht auf einem Berg, der höher ist als alle Berge, und er kann von da über die ganze Welt sehen.«
»Bis Berlin zum Kaiser?« fragte Heinrich verwundert.
»Bis Berlin zum Kaiser,« sagte die Mutter, »und – bis zu uns dreien.«
»Sieht er uns jetzt gehen?«
»Ja, ich glaube, er sieht uns gehen.«
Da blies der Abendwind übers Feld, und ich fror.
»Dieser ist der Größte im Himmelreich!«
Der goldene Spruch stand über Ludwigs Marmorbild, das vor dem Heiland stand. Mit scheuer Ehrfurcht dachten wir an den Spielkameraden, der mit einem Kranz weißer Rosen um die Stirn in jenes ferne Land gewandert und nun dort ein Fürst und Herrscher war. Da habe ich oft auf der Adlerkoppe neben dem Aussichtsturm gelegen und hinaufgeschaut in das ewige blaue Land und im tiefsten Herzen gewünscht, daß ich auch einmal den Weg finden möge dorthin.

Oft pilgerten wir nach der heiligen Stadt. Ja,[51] selbst der Förster kam manchmal mit; er stand dann ganz still und hielt seinen grünen Hut in der Hand. Meist war unsere gute Fee mit uns dort. Ich habe sie nie weinen sehen um ihr totes Kind. Ein ruhiges Leuchten war immer in ihren Augen. Und sie ging mit uns aus der heiligen Stadt freundlich nach Heinrichsburg, nach Ameisenfeld und zu der Donarseiche, und[52] sprach mit friedlicher, fröhlicher Seele mit uns von allen wichtigen Dingen, die im Walde zu sehen waren.
Sie war selbst wie die Kinder, und darum hatte sie schon hier auf Erden ein Himmelreich im Herzen.
Meinem Freunde Heinrich und mir aber ist durch unser ganzes Leben der goldene Spruch aus der Heiligen Stadt nachgegangen:
»Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr in das Himmelreich nicht eingehen!«

Die Szene spielt am Weihnachtsabend in einem vornehm ausgestatteten Zimmer. Der kleine Hans liegt schwer krank im Bette. Die Mutter wacht bei ihm. Im Nebenzimmer steht der Christbaum. Eine rote Lampe verbreitet ein traumhaftes Licht. Auf dem Nachttischchen stehen zwölf Bleisoldaten.
Hans (richtet sich matt auf):
Mutter, ich möchte den Christbaum noch einmal sehen.
Die Mutter:
Wird dich nicht wieder das viele Licht stören, Hans?
Hans:
Ach, nein … ich möchte ihn sehen. Zünde doch die Lichter noch einmal an, Mutter … ja?
Die Mutter:
Gewiß, mein Kind, wie du willst …
Sie geht ins Nebenzimmer und zündet die Weihnachtskerzen an. Es wird lichter im Gemach. Hans schaut mit großen, fiebernden Augen der Mutter zu. Die Mutter kommt zurück.
Die Mutter:
Gefällt dir der Baum, mein Goldjunge?
Hans:
Er ist schön … er ist sehr schön! … Es ist wohl viel Marzipan dran? … Ich kann keines essen … es schmeckt mir bitter … Aber die Krone und der Engel! – – – – Ach, Mutter, mir tun die Augen weh … lösch die Lichter aus … bitte, bitte, lösch die Lichter wieder aus!
Die Mutter geht seufzend ins Nebenzimmer zurück und löscht die Weihnachtslichter aus.
Hans:
Ach, ist das schade! Die schönen, funkelnden Lichter! … Nun ist er ganz finster, der Baum …
Die Mutter (zurückkommend):
Ist es so gut?
Hans:
Ja, es ist gut so … Ich freu' mich so über die Soldatensachen, Mutter.
Die Mutter:
Mein lieber Junge!
Hans:
Bring mir doch den Säbel und den Helm! Und einen Spiegel … ja? Ich will mich gern sehen …
Die Mutter:
Ja, ich hole sie! (Pause.) So, mein guter Hans, hier sind die Sachen!
Hans:
Stütz' mir den Rücken, ja … ich will mich setzen, daß ich den Helm aufsetzen kann … So … ah, es geht schwer … und jetzt … jetzt den Säbel … halt' mich fest, Mutter, fest … ja so! … Und jetzt noch den Spiegel … Oh, oh, … wie seh ich denn aus? … Das bin ich doch nicht! Das ist ja ein ganz … altes … häßliches Gesicht!
Die Mutter (mit unterdrücktem Schluchzen):
Du wirst bald besser aussehen, lieber Hans!
Hans (mit tiefem, schmerzlichem Erstaunen):
Bin ich das wirklich?!
Die Mutter (tröstend):
Sieh doch den Helm … er steht dir so schön … mein kleiner, lieber Held …
Hans:
Oh … ich sehe aus … wie der Tod …
Die Mutter (läßt den Spiegel fallen):
Hans! … Sprich nicht so, Hans … das darfst du nicht … das ist böse von dir … entsetzlich böse …
Hans (sinkt erschöpft zurück; ganz leise und matt):
Ich will nicht böse sein … ich will gut sein … und ich will auch nicht gern … zum Tode … ich möchte bei dir bleiben, Mutter … bei dir ist's so schön …
(Die Mutter setzt sich langsam am Bette nieder. Lange Pause.)
Hans:
Ich glaube … daß ich heute sterben soll …
Die Mutter:
Du sollst ja nicht so sprechen … du wirst nicht sterben, Hans … ich laß dich ja nicht sterben … ganz bestimmt nicht … ich verspreche es dir … du weißt, ich halte immer, was ich verspreche … ich lasse dich nicht sterben, mein Junge, mein Junge!
Hans (langsam):
Aber der Vater ist ja auch gestorben und der Großvater auch.
Die Mutter:
Sie waren älter als du, aber so ein Knabe stirbt nicht, nein, der stirbt nicht!
Hans:
Setz' dich auf den Stuhl, Mutter … erzähl' mir vom Großvater … wie es war, ehe er starb, ja?
Die Mutter:
Nein, nein, heute nicht, ein anderes Mal will ich dir's erzählen …
Hans:
Heute, Mutter, heute! … Wo gehst du hin? …
Die Mutter:
Die Anna soll nach dem Arzt; ich warte schon so …
Hans:
Er hat Einbescherung zu Hause; laß ihn, er hat jetzt nicht Zeit für mich.
Die Mutter:
Ich will doch schicken, ich komme gleich wieder … Der Arzt kommt bestimmt …
(Sie geht hinaus.)
Hans (schaut ihr scheu nach, dann wendet er sich an die Bleisoldaten):
Paßt auf, ihr blauen Jungen, paßt auf … ich will euch was sagen … Ich bin euer General … Seht ihr meinen Degen und meinen Helm? … Ich kommandier' euch! … Jawohl! … Und wenn der Tod kommt … dann wollen wir mit ihm kämpfen … tapfer, ihr Jungen … er … er darf uns nicht unterkriegen … er nicht …[58] wir ihn … wir müssen ihn unterkriegen … Hört ihr? … Versteht ihr? … Wir ihn! … Mein Großvater, der ist auch mit 12 Mann … den Hügel hinauf … gegen viele Franzosen … bumm, schossen sie, bumm, bumm … sechse fielen … eine Kugel … eine ganz kleine, blaue Kugel … flog auch meinem Großvater in den Leib … er machte sich nichts draus … nein, gar nichts daraus aus der kleinen Kugel … er stürmte weiter … und erst, als er die Fahne hatte … da … da … tat er sterben … So, so müssen auch wir … tapfer, ihr Soldaten, tapfer … (er sinkt gänzlich erschöpft zurück).
Die Mutter (zurückkommend):
Da, Hans, bin ich wieder. Du liegst so still. Soll ich dir die Geschichte vom Großvater aus dem Kriege erzählen?
Hans (halb im Fiebertraum):
Nein, ich weiß sie; ich weiß sie gut … Stell' meine Soldaten zurecht … so mit den Flinten auf das Fenster zu! … Dort herein wird er kommen … ja, gewiß, dort zum Fenster herein kommt er! …
Die Mutter (angstvoll):
Wer denn? Wer soll denn kommen? Das Fenster ist fest zu.
Hans:
Er kommt! Er kommt durch! Er kriecht durchs Glas! Es ist der Feind … ja, der Tod … der ist der Feind …

Die Mutter:
O Gott, o Gott, wenn doch der Arzt … Fürchte dich doch nicht, Hans, es kommt niemand, es kann niemand herein, ich stelle mich vor das Fenster …
Hans (mit der Hand schlenkernd):
Nein, weg, Mutter, weg! Ich muß ihn gleich sehen, wenn er kommt … ich muß aufpassen,[60] ich bin ja der General … Die Soldaten … sieh mal die Soldaten, Mutter, sie wachsen … sie werden groß … groß wie die Riesen … sie haben richtige Flinten … o, er soll nur kommen … gib meinen Degen … weg, Mutter, weg vom Fenster … wenn die Soldaten auf ihn schießen … treffen sie dich! …
Die Mutter (reicht ihm in höchster Angst die Medizin):
Trinke, Hans, trinke!
Hans:
Ich will nicht! … Halt, doch … ein Schluck ist gut … Aah so! … Gib den Soldaten auch … aber geh nicht mehr zum Fenster … Wenn er kommt, legen wir gleich los … Achtung, ihr Soldaten …
(Die Mutter hält Hansens Kopf, unausgesetzt wirre, qualvolle Gebetsworte murmelnd, der Kranke hält den fiebernden Blick lauernd nach dem Fenster gerichtet.)
Hans (jäh aufschreiend):
Da ist er … da ist er … der schwarze König! … Der Tod! … Oh … oh, er schießt. Oh, er hat mich getroffen … in die Brust … mit einer Kugel … Ich mach mir nichts draus … Drauf, ihr Soldaten … drauf … schießen, stechen, hauen! … Mein Säbel … wart' … ich bring dich um … ich zerschlag dir den schwarzen[61] Kopf … ich … jetzt … jetzt hat er mich … jetzt hab ich ihn … laßt uns … helft nicht … ich nehm ihn allein … ich brech ihm den Hals … ich siege … o du … du schlechter Feind … du hast meinen Vater … meinen Großvater … wart … dein Hals, dein Blut … ich reiß dir das Herz heraus … ich hab's … ich hab' dein Herz … es hat Großvaters Blut getrunken – – – – Er … er … er ist tot … der Tod ist tot! … Der Tod ist tot …
(Er fällt mit geschlossenen Augen zurück.)
Die Mutter:
Gott im Himmel, erbarme dich! Hans! Hans! Hans! (Schreiend:) Doktor! Doktor! Hilfe! Mein Sohn stirbt! Hilfe! O Gott … Hilfe! Zu Hilfe …
Einige Stunden später. Gegen Morgen.
Der Arzt:
Wollen Sie nicht ruhen, gnädige Frau?
Die Mutter:
Wie könnte ich heute ruhen?
Der Arzt (beugt sich über Hans):
Er schläft gut … ich glaube bestimmt, nun[62] ist er gerettet! Sein Lebensmut, sein Lebenstrotz haben ihn die schlimme Stunde überstehen lassen.
Die Mutter (schlicht, aber mit großer, stiller Freude):
Er hat den Tod besiegt!
Die Frau sinkt langsam am Bette auf die Knie. Draußen beginnen die ersten Weihnachtsglocken zu läuten. Aus dem Nebenzimmer dringt Tannenduft. Die Bleisoldaten stehen am Lager ihres siegreichen, heldenhaften Generals und präsentieren ihre Gewehre.
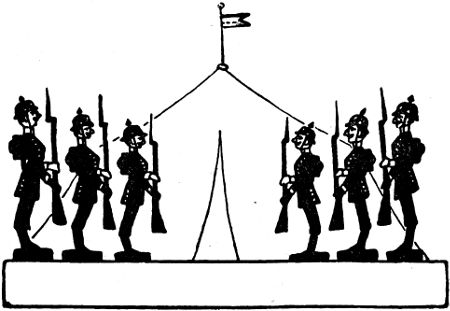
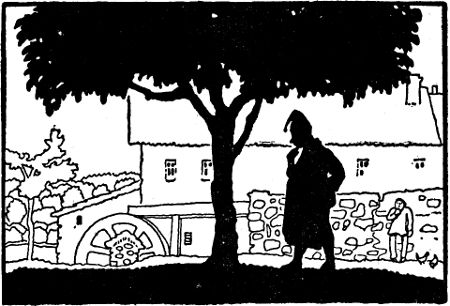
Andreas, der Waldmüller, ging im Großgarten um den starken Apfelbaum im Kreis herum, immer im Kreis herum. Dabei hielt er die Hände auf dem Rücken gefaltet, preßte die Lippen zu einem Spalt zusammen und bezeigte überhaupt eine ernste Haltung. Nach einiger Zeit kam der Mühlknecht Jakoble heraus, ging neugierig auf den Müller zu und fragte:
»Meister, warum geht Ihr denn immerfort so im Kreise herum?«
Ohne ein Wort zu sagen, holte der Müller aus[64] und hieb dem Jakoble eine gewaltige Ohrfeige herunter. Da stellte sich Jakoble erschrocken beiseite, rieb sich die Backe und sagte bei sich selbst: »Es scheint, er will mir's nicht verraten, warum er so im Kreise herumgeht.« Und er schlich in die Mühle zurück und war ob des Vorfalls sehr betrübt.
Der Müller ging noch oft seine Runde; aber endlich blieb er stehen, seufzte tief und sprach: »Tausend und einmal! Und ganz schweigsam! Diesmal, wenn ich mich nicht verzählt habe, wird es endlich glücken.«
Dann setzte er sich unter den Baum ins Gras. Rundum blühten die herrlichen Löwenzahnblumen, und der Gartengrund war schön wie ein Königsmantel mit lauter Orden und bunten Knöpfen. Die Mailuft trug Tau und Blütenstaub auf ihren weichen Flügeln, und die Wassermühle sang ihr surrendes, friedliches Lied.
Des Müllers Gedanken gingen weit zurück in seinem Leben, zu dem Tage, da seine Frau begraben wurde, zu dem anderen, da sein einziges Kind, die Trudel, geboren wurde, schließlich über Soldatenzeit und dumme Jungenstreiche weiter zurück bis zu dem Tage der eigenen Geburt. Da hatte sein Vater zu seiner Mutter gesagt: »Johanna, wir sind arme Leute. Die Bauern[65] sind geizig und unsere Mühle ist verschuldet; was fangen wir nun mit diesem Büblein an?« Die Müllerin hatte gesagt: »Zunächst wollen wir es Andreas taufen, das ist ein schöner und kräftiger Name, und dann wollen wir unsere reiche Base Dorette zu Gevatter bitten, die wird dem Jungen ein gutes Patengeschenk geben.«
Als nun der Tag der Taufe kam, erhielt das Büblein zwar den schönen und kräftigen Namen Andreas, das reiche Patengeschenk aber erhielt es nicht, wenigstens nicht in blanken Talern, wie es die Müllerleute erhofft hatten. Tante Dorette brachte nur ein winziges Holzkästlein, darin ein blanker Kupferdreier lag, und sprach:
»Dieses Kästlein müßt ihr in eurem Garten vergraben. Alsdann muß der Vater über dieselbe Stelle, wo der Kasten liegt, einen Apfelkern stecken. So wie der Baum wächst, so wird der Kasten und die Zahl der Dreier wachsen, und an dem Tage, wo das Bäumchen veredelt wird, werden sich alle Kupferdreier in Golddukaten umwandeln. Wenn dann der Kasten reif zum Heben ist, wird auf dem Apfelbaum ein Glöcklein läuten. Inzwischen müßt ihr fleißig und sparsam sein, dürft keinen Schnaps trinken und alle Wochen nur dreimal Fleisch essen. Auch muß das Büblein, sobald es größer geworden ist, immer an seinem[66] Geburtstag tausend und einmal um den Baum herumgehen, darf aber dabei kein Wort sprechen.«
Der Müller hatte ein wenig geseufzt über das sonderbare und umständliche Geschenk, dann aber hatte er das Kästchen vergraben und das Körnlein gesteckt. Als aber die Base Dorette fort war, hatte er sich arg hinter den Ohren gekratzt, denn seine Frau hatte den grauen Steinkrug, in dem der Schnaps war, mit einer Axt zerschlagen. Damit, meinte der Müller, sei eine schöne Quelle des Trostes und der Labsal in der Mühle versiegt. Die Frau hielt auch fortan auf großen Fleiß und Sparsamkeit, und es kam nie öfter als dreimal in der Woche ein Fleischgericht auf den Tisch.
So hob sich der Wohlstand der Müllerleute. Das Bäumchen wuchs von Jahr zu Jahr, und als es der Müller mit eigener Hand veredelte, zitterte er. Sein Bub stand neben ihm und behauptete, ein feines Klingen vernommen zu haben.
»Das ist,« belehrte ihn sein Vater, »wie das Kupfer in das Gold umgesprungen ist.«
Die Zeit verging. Tante Dorette, Vater und Mutter starben, der Bub wurde groß, wurde selbst Müller, wurde fünfzig Jahre alt. Ein Glöcklein aber läutete auf dem Baum niemals.
Als der Müller jetzt noch so da saß und von seinem lang ausbleibendem Reichtum träumte, trat Reinhard, der Müllerbursch, in den Garten. Er war ein so schöner Bursch, daß er sicher ein Prinz gewesen wäre, wenn er einen König zum Vater gehabt hätte. Heute stak Reinhard nicht in seiner staubigen Müllertracht, sondern war sonntäglich gekleidet und hatte einen runden Hut mit einer Feder auf dem Kopf. Der Müller schaute ihn verwundert an und fragte:
»Wie bist du denn so herausgeputzt; ist es bei dir heut Sonntag?«
»Herr Meister,« sagte der Jüngling, indem er einen kleinen Kratzfuß machte, »bei mir ist heute der allergrößte Festtag. Denn nicht bloß, daß Ihr den Geburtstag habt, es ist auch heute der Tag gekommen, wo ich mir ein Herz fasse, Euch zu bitten, daß Ihr mir Eure herzliebe Trudel zur Ehefrau gebt.«
Der Müller schaute den Burschen erst einige Augenblicke schweigend an; dann sagte er ohne weitere Umschweife: »Reinhard, du bist verrückt!«
Diese Worte klangen dem Freiersmann gar nicht wie liebliche Musik in den Ohren, und er machte ein betrübtes Gesicht. Der Müller stand auf, reckte sich und sagte:
»Die Trudel soll's besser haben als ich. Sie soll[68] nicht ihr Leben lang in diesem dunklen Waldwinkel sitzen. Der sollen bald schönere Tage kommen.«
»Ach, du lieber Gott,« seufzte der Bursche, »wie sollen ihr bessere Tage kommen, wenn Ihr mir sie nicht zur Frau gebt? Sie wird sich eben so sehr darum zu Tode grämen wie ich.«
Gegen solche Krankheit würde schon noch ein Kraut gewachsen sein, meinte der Müller, und da Reinhard grade so schön angezogen sei, habe er, der Meister, nichts dagegen, wenn der Bursch sein Ränzel nähme und über alle sieben Berge davonzöge. So – und damit basta.
Darauf ging der Müller aus dem Garten. Als er an das Türchen kam, trat ihm Jakoble in den Weg und fragte gutmütig und neugierig:
»Meister, was habt Ihr denn so böse mit dem Reinhard gesprochen?«
Der Müller langte ihm eine Ohrfeige herunter und ließ ihn stehen. Da rieb sich Jakoble die Backe und meinte bei sich: »Er will mir nicht verraten, was er mit dem Reinhard gesprochen hat. Also werde ich den Reinhard selbst fragen.«
Und er fragte ihn und erfuhr das ganze Elend und Herzeleid.
Als es gegen Abend war und die müde Sonne sich gegen die Waldberge senkte, wanderte der junge Müllerbursch in die Fremde. Die Trudel gab ihm ein Stück das Geleit und weinte, und der Jakoble ging mit und weinte aus Freundschaft auch.
Es war so traurig im Walde. Die Vögel saßen am Wege und sangen: »Lebe wohl! Lebe wohl!« und die Bäume schüttelten die Köpfe, und ein Reh sah mit großen Augen aus dem Gebüsch, als wollte es verwundert fragen: »Ja, wo geht Ihr denn hin?«
Langsam gingen die drei; jeder Schritt wurde ihnen schwer, der Sand knirschte, und die alte Mühle sang im Tal.
Als die drei an den Kreuzweg kamen, mußte geschieden sein. Das Mädchen hatte den beiden Burschen von dem Aberglauben des Vaters erzählt und was er sich für törichte Hoffnungen mache auf einen großen Schatz, der gewiß nicht da sei. Und es schloß mit vielen Tränen:
»Wenn ich nun sterbe, so mag mich der Vater in einen Sarg legen und unter dem Apfelbaum begraben, dann hat er dort in einem Kasten seinen Schatz liegen.«
Bei diesen traurigen und kläglichen Worten fing auch Reinhard heftig an zu weinen. Das Jakoble aber zählte plötzlich mit Eifer die Knöpfe an seinem[70] Anzuge ab und sprach immer dazu: »Mit ihr! Mit ihm! Mit ihr! Mit ihm!« Endlich rief er freudig aus:
»Reinhard, ich muß mit dir in die Fremde ziehen, denn erstens habe ich es an den Knöpfen abgezählt, und zweitens ist es auch wegen der vielen Ohrfeigen.«
Es wurde noch ein bißchen verhandelt und dann wurde beschlossen, daß Jakoble den Reinhard begleiten sollte auf der Reise in die weite Welt. Jakoble machte ein feierliches Gesicht bei diesem Beschluß, so feierlich, daß ihm die Ohren weit abstanden und die Kopfhaut hin- und herrutschte. Dann sprach er in väterlichem Tone:
»Trudelchen, weine nicht mehr. Denn wir bleiben dir treu, und in drei Jahren und drei Tagen kommen wir wieder.«
Darauf küßte Reinhard das Mädchen auf den Mund, und dann schieden sie voneinander, und dann ging die Sonne unter.
Reinhard und Jakoble wanderten miteinander in der Abenddämmerung dahin. Oftmals seufzte Reinhard tief und schmerzlich und sprach: »Ach, Jakoble, wenn du nicht da wärst, was sollte ich wohl anfangen?«
Da nickte Jakoble und erwiderte: »Ja, ja, was sollten wir wohl anfangen, wenn ich nicht da wäre!«
Es wurde finster, und die beiden wußten nicht, wohin sie kommen würden. Wenn man aber in der Welt nicht weiß, wohin man kommen wird, kommt man meist in eine Schenke.
So kamen auch die beiden in ein Straßengasthaus, wo es hoch herging. Bauern saßen drin und Fuhrleute, von denen manche so reich waren, daß sie zwei Pferde besaßen.
Was aber die Hauptsache war: in dem Gasthaus war ein Zauberkünstler anwesend. Er trug ein grün- und schwarzkariertes Gewand und auf dem Kopfe einen zinnoberroten Fez. Er stammte aus Hinterindien und hieß Kiutschitsufilutschi. Sein Vater war ein heidnischer Oberpriester und seine Mutter eine malaiische Göttertochter. Das alles hatte Kiutschitsufilutschi selbst gesagt. Als Reinhard und Jakoble eintraten, hörten sie den Zauberkünstler eben sagen:
»Jawoll, meine Herr'n, dat is nich so einfach wie Schnapstrinken. Diese Attraktion habe ick mal 'n Kaiser von Fedschir vorgemacht. Der wollte mir dabehalten und mir an seine Tochter verehelichen, und ick sollte mal da in der Jejend Kaiser werden, aber ick habe gesagt: Nee,[72] Majestät, habe ick gesagt, is nich zu machen! Ick will man lieber wieder rüber nach Europa.«
Nach diesen Worten zog Kiutschitsufilutschi einem Bauern aus der roten dicken Nase wohl an die hundert Dukaten. Die Dukaten warf er in die Luft, wo sie spurlos verschwanden. Jakoble vergaß vor lauter Erstaunen eine Viertelstunde lang den Mund zuzumachen und hatte überhaupt einen so merkwürdigen Gesichtsausdruck, daß ihn Reinhard nach einiger Zeit anstieß und sagte:
»Jakoble, tu mir den Gefallen und putz dir wenigstens die Nase!«
Ehe Jakoble diesen Wunsch erfüllen konnte, stürzte der Zauberkünstler auf ihn zu und steckte ihm eine Schlange in den Mund. Jakoble verschluckte sich und war krebsrot vor Angst und Aufregung.
Dann fing der Zauberkünstler an, Abendbrot zu speisen. Die Bauern spendeten ihm einen mächtigen Krug Bier, und Kiutschitsufilutschi aß dazu einen Frosch, einen Spazierstock, ein Bierglas und ein Hufeisen. Endlich zündete er sich eine Zigarre an und blies statt Rauchringel Schweinsblasen in die Luft.

Jakoble nahm Reißaus. Reinhard fand ihn draußen vor der Tür, wimmernd vor Angst. Er[74] beruhigte Jakoble und nahm ihn mit in die Schlafkammer. Dort fanden die beiden trotz ihrer müden Glieder lange nicht den erwünschten Schlummer. Den einen plagte die Sehnsucht im Herzen, den andern die Schlange im Magen. Und sie stöhnten und seufzten, denn wer schlafen will, dem müssen Herz und Magen in Sanftmut gewiegt sein.
Als es Mitternacht war und der Wind draußen lauter pfiff und in den Sparren des Holzwerks klapperte, öffnete sich die Tür, und Kiutschitsufilutschi trat ein. Jakoble tat einen Schrei und versuchte, an der Wand hochzuklettern, auch Reinhard richtete sich erschrocken auf. Aber der hinterindische Zauberer beschwichtigte die beiden und sagte:
»Haben Sie man keene Angst, meine Herr'n; ick will hier bloß 'n bißchen mit schlafen.«
Darauf ließ er sich seufzend neben den beiden nieder und nahm den Fez vom Kopfe. Der Mond schien durch die Dachluke und bestrahlte seine phantastischen Kleider. Ein schwerer Gram tat sich auf dem Gesicht des fremden Magiers kund, und endlich fuhr er drohend mit den Armen zur Höhe und sagte grollend:
»60 Pfennige, und das ist allens! Solche Duckmäuser!«
Es stellte sich heraus, daß der Hinterindier von den Bauern und Fuhrleuten für seine glänzenden Darbietungen nur vorbenannte Summe Geldes geerntet hatte. So war auch er ruhelos und ohne Schlummer, denn außer dem Herzen und dem Magen muß sich auch der Geldbeutel sicher und befriedigt fühlen, ehe der holde Schlaf auf die Wimpern eines irdischen Wanderers sinkt.
Jakoble, der etwas Mut gefaßt hatte, meinte schüchtern, der Zauberer könne sich doch die Goldstücke aus jeder Nase ziehen; worauf ihn Kiutschitsufilutschi halb mitleidig und halb zärtlich anblickte und zur Antwort gab:
»Können Sie mir vielleicht 'ne Mark pumpen?«
O ja, das könne er wohl, sagte Jakoble eifrig, fischte in seiner Hosentasche herum und übergab dem Zauberer eine Mark. Dieser war dankbar und machte gerührt Brüderschaft mit Jakoble, worauf alle drei sehr munter und aufgeräumt wurden.
Der Zauberer erklärte, er heiße »künstlerisch« Kiutschitsufilutschi und stamme »künstlerisch« von einem Oberpriester und einer Göttertochter ab. Sein »bürgerlicher« Name aber sei Heinrich Bimske, und seine »bürgerlichen Eltern« seien ehrsame Bäckersleute aus Rixdorf bei Berlin.[76] Ursprünglich habe er das schöne und reinliche Gewerbe eines Barbiers betrieben, aber dann sei die höhere Magie über ihn gekommen; er sei weit in der Welt herum, von Kottbus bis Salzwedel habe er alle bedeutenden Orte bereist. Aber nun sei er wandermüde, und wenn es ihm je gelänge, zwei bis drei Taler Reisegeld zu erübrigen, wolle er zu seinen Eltern zurückkehren und nebst einem neuen Lebenswandel ein eigenes Barbiergeschäft anfangen.
Wie es nun so ist: heimatloses Wandervolk lernt sich rasch kennen, wird rasch vertraut und verbündet sich leicht miteinander gegen die tückischen Mächte des Lebens, die ihm bedrohlicher sind als jenen, die in festen Häusern wohnen und am gedeckten Tische sitzen. So war es auch hier. Während der ganze Kretscham schlief und der Mond draußen auf der stillen Landstraße vergebens nach einem Wanderer, ja nach einem wachenden Vogel suchte, saßen die drei Gesellen in der Dachkammer beisammen und tauschten ihre Lebensschicksale aus. Reinhard erzählte von seiner Trudel, dem Müller, dem geheimnisvollen Schatz unter dem Apfelbaum und seiner Ausweisung und traurigen Fahrt in die weite Ferne. Die Gedanken flogen hin und her, und als der Hahn krähte, war ein kühner Plan gefaßt, und nun konnten die drei erst recht nicht schlafen: denn[77] will ein Mensch Schlummer finden, darf er keine Pläne fassen.
Dieses traurige Lied sang die Trudel in der Waldmühle nun täglich am Morgen und am Abend. Wenn es der Müller hörte, war ihm nicht wohl dabei, denn außer dem Gelde liebte er am meisten sein Kind. Aber er glaubte, mit der Zeit würde das Mädel seine »Mucken« schon verlieren, und alles würde gut und schön sein, wenn erst einmal ein Glöcklein auf dem Baum erschien und läutete.
Sonst auch hatte der Müller verschiedene Verdrießlichkeiten. Der neue Knecht, den er für das Jakoble eingestellt und dem er gleich in der ersten halben Stunde probeweise eine Ohrfeige gegeben hatte, hatte ihm zwei Ohrfeigen dafür zurückgegeben.[78] So etwas ist kränkend für einen Mann, der auf Ansehen hält, ist ebenso sehr gegen die Achtung wie gegen das Wohlbefinden eines Hausherrn.
Und dazu das blasse Mädel mit seinem traurigen Lied!
So kam es, daß der Müller einmal bis spät in die Nacht munter war und auch dann noch nicht in den dicken Federbetten lag, als die Uhr schon auf halb zehn Uhr zeigte. Wie er nun so sorgenvoll und still am Tische saß, spitzte er plötzlich die Ohren und machte Augen wie ein Luchs; er tat sogar etwas, was er noch nie in seinem Leben getan hatte – – er öffnete das Fenster.
Und nun hörte er es deutlich!
Unten im Garten, auf dem Apfelbaum, läutete ein Glöcklein. Silbern klar schallte sein Stimmlein durch die Nacht: Müller, die Zeit ist erfüllt, Müller, der Schatz ist reif!
Erbleichen konnte der Müller nicht; dafür war sein Gesicht zu rot; aber blaßrosa wurden seine Wangen, und der Schreck schüttelte seine Glieder, wie der Wind einen Eichbaum schüttelt.
Das Glöcklein läutete, läutete immerzu. Da ging der Müller zögernden Fußes hinaus in den Hof, suchte einen Spaten und rief sein Kind herbei.
»Trudelchen,« sagte er leise, »hörst du es[79] läuten? Die Zeit ist erfüllt. Der Schatz ist reif. Komm mit mir, wir wollen ihn heben.«
»Ach, was nützen mich alle Schätze der Welt,« sagte das Mädchen. Aber es ging mit dem Vater. Die Nacht war dunkel; große, schwarze Wolkenberge ragten in den Himmel, und der Wind flog von der Erde zu den dunklen Bergen hinauf; er zog um ihre Gipfel und zerwühlte ihre Abgründe. Dann löste es sich los von den Bergen wie große Adlervögel, die aufgescheucht waren und mit zuckenden Schwingen über den Himmel zogen.
Das Glöcklein war verstummt. Es hing an dem untersten Ast des Apfelbaumes, und eine weiße Schnur war an ihm befestigt. Der Müller und sein Kind gingen auf den Zehenspitzen zu dem Baume hin. In des Müllers Auge flackerte die Geldgier, in des Mädchens Augen war die alte Trauer, und in beiden wohnte die Furcht.
Ächzend setzte sich der Müller schließlich unter den Apfelbaum. Ein wenig verpusten, erst ein wenig verpusten.
So war nun der große Augenblick gekommen, auf den seine Eltern gehofft, nach dem er selbst von frühester Jugend an ausgeschaut hatte. Erfüllt war seine Sehnsucht, der ganze goldene Segen des Reichtums war nahe und gewiß.
»Trudel, du wirst dir einen Fürsten heiraten[80] oder gar einen Offizier,« sagte er traumhaft glücklich vor sich lächelnd. Das Mädchen schüttelte den Kopf.
»Der Reinhard ist kein Fürst und kein Offizier,« sagte es in seiner großen Treue.
»Wird alles anders, alles anders! Nur ein wenig verpusten!«
Da kam aus der Erde ein starkes Klopfen. Der Müller sprang auf; er glaubte, es komme ein Erdbeben. Zweimal holte er noch tief Atem, dann sagte er:
»Rasch machen, rasch, damit die glückliche Zeit nicht vergeht! Auch ist es hier sehr unheimlich. Hörtest du das Poltern in der Erde?«
Und er stieß den Spaten ins Gartenland und geriet augenblicklich auf einen Widerstand, der sich als ein starkes Brett herausstellte.
»Die Kiste, Trudel, die Kiste!«
Es war wirklich der Deckel einer Kiste, den der Müller in rascher, aufgeregter Arbeit bloßlegte. Dieser Deckel hatte über ein Meter im Geviert. Es war eine Riesenkiste, und der Müller sagte in schwerster Beklemmung:
»Trudelchen, wenn sie voll puren Goldes ist, müssen es an die tausend Taler sein!«

Auf einmal hob sich der Deckel der Kiste von selbst – der Müller und die Trudel wichen erschrocken[82] zurück – der Kistendeckel wurde beiseite geschleudert – und wie aus einem Grabe heraus erstand eine Gestalt und ragte mit dem halben Körper aus der Erde.
Es war Reinhard.
»Müller,« rief er mit feierlicher Stimme, »wisse und glaube: ich bin der Schatz, der dir und deiner Mühle und deiner Trudel bestimmt ist. Höhere Mächte haben mich hier eingegraben; jetzt bin ich Euch verliehen und Euer eigen.«
Das Trudelchen hatte erst ein bißchen erschrocken aufgequiekt, aber dann stand es eins, zwei, drei neben Reinhard in der Kiste und rief immerfort:
»Ja, ja, ja, so ist es, so ist es, so ist es!«
Und plötzlich kam etwas aus dem Zaungebüsch dahergerannt, und ob es auch geisterhaft aussah, wie es so daherhuschte, erwies es sich doch bei näherer Betrachtung als das Jakoble, und das rief:
»Ja, das ist der geheimnisvolle Schatz! Ich weiß es und kann es bezeugen.«
Um das Schmerzliche ganz kurz zu sagen: den Müller erfaßte eine Riesenwut. Er prügelte zuerst das Jakoble windelweich, dann stürzte er sich auf Reinhard, und er brüllte so laut, daß alle Leute in der Mühle zusammenliefen. Denen erklärte er nun in japsenden Sätzen, mit einer Stimme,[83] die vor Wut schrill wurde und sich überschlug: er sei genarrt, sei betrogen, sei von Spitzbuben geprellt; sein kostbarer Schatz, der unter dem Apfelbaum gelegen, sei ausgegraben, sei von diesen Dieben und Räubern gestohlen, und sie müßten nun alle, alle an den Galgen.
In der Nähe wohnte ein doppelter Sicherheitsmann, der zu gleicher Zeit Bahnwärter und Polizist war. Dieser Mann wurde herbeigeholt, Reinhard und Jakoble wurden überwältigt, es wurden ihnen Hände und Füße gebunden, wie es Räubern geziemt, und ihnen dann befohlen, mit dem Sicherheitsmann nach dem Amtsgefängnis zu marschieren. Zwecks Ausführung dieses Polizeibefehls mußten den Gefangenen die Füße wieder freigegeben werden.
Die Trudel weinte so laut, daß der ganze Hof und Garten aufwachte, die Vögel zu zwitschern, die Kühe zu brummen begannen und der Hahn zu krähen anfing.
Eberhard Schleifle, der Bahnwärter und Polizist, beförderte durch die dunkle Nacht seine beiden Gefangenen zum Gerichtsgefängnis, das zwei Stunden von der Waldmühle entfernt war. Er trug als Waffe einen Spieß, der so schwer war[84] wie weiland der Spieß Goliaths: sein Schaft war wie ein Weberbaum. Da nun Eberhard Schleifle den ganzen Tag schwere Bahnwärterdienste getan hatte, indem er fünf Eisenbahnzüge an sich hatte vorüberfahren sehen, so war er müde und gab dem Jakoble seinen Amtsspieß zu tragen. Zu diesem Zweck band er ihm die Hände los. Auch den Reinhard befreite Schleifle von den Handfesseln, weil sie ihn in dem Augenblick behinderten, als alle drei gemeinschaftlich eine Prise Tabak schnupfen wollten. Als die drei nun auf solche Weise ans Gefängnis kamen, war dieses geschlossen. Es ist auch nicht mehr als recht und billig, daß Gefängnisse des Nachts geschlossen sind. Der Polizist kehrte also mit seinen Gefangenen in ein Gasthaus ein, wo eben eine Hochzeit gehalten wurde, und gedachte da den Morgen abzuwarten. Er und Jakoble tanzten mit den Brautjungfern, Reinhard aber hielt sich traurig beiseite, denn er dachte an die Trudel. Am nächsten Morgen wurde er mit Jakoble eingekerkert. Die Zelle war so eng, daß Reinhard seufzte und sprach: »Hier hat man fast so wenig Luft wie in der Kiste, als sich der Müller grade oben auf das Luftloch gesetzt hatte; denn da wäre ich fast erstickt und mußte gewaltig anklopfen.«
Ach, du schwere Zeit! In der Waldmühle schlug die Uhr keine gute Stunde mehr. Der Müller ging in verbissener Wut umher; die Trudel weinte sich die Augen rot, wenn sie daran dachte, wie Reinhard und Jakoble von dem barbarischen Eberhard Schleifle so roh davongeführt worden waren.
Nun war es damals wie immer im Mai: es war kalt. Die Eisheiligen hatten sehr strenge Herrschaft aufgetan, und der Müller saß eines Abends am Ofen und fror. Es war um die Dämmerstunde, und alle Leute waren in den Ställen beschäftigt. Der Müller war allein.
Da tat sich die Tür auf, und ein fremder Mann trat ein, der war in einen schwarzen Mantel gehüllt und hatte den Hut tief ins Gesicht gezogen. Er grüßte nicht und stellte sich dem erstaunten und erschrockenen Müller ganz nahe gegenüber. Und er tat seinen Mund auf und sprach ohne jede weitere Einleitung:
»Müller! Müller! Gold ist Wind!«
Damit griff er dem Müller, der ganz verblüfft dasaß, an die Nase, zog ihm eine Menge Dukaten heraus und warf das blinkende Gold in die Luft, wo es spurlos verschwand. Dann sprach der Fremde weiter:
»Müller! Müller! Gold ist Wasser.«
Und er griff aus der Luft die Dukaten zurück, ließ sie am Herdfeuer auf seiner flachen Hand glänzen und steckte sie darauf in den Mund, worauf er einen Strahl Wasser auf den Fußboden spuckte, lachte und weitersprach:
»Wenn nun Gold Wind und Wasser ist, müssen alle Wind- und Wassermüller im Lande reich werden.«
Dem Müller standen die Haare zu Berge, und er vermochte es nicht, ein Wörtlein zu sagen. Der Fremde aber sagte:
»Auch in der Erde liegt Gold.« Er bückte sich darauf nach dem schwarzen Estrich der ungedielten Stube und hob da viele Getreidekörner auf, die zuvor dort nicht gelegen hatten. Er zeigte dem Müller die Körnlein, und sie wurden zu Goldmünzen.
»Wenn nun,« sprach der Fremde mit ernster Stimme, »Wasser und Wind und Erde Gold sind, warum hängst du so sehr am geprägten Golde? Wisse, es ist nicht gleich, ob du sagst: ›Wind ist Gold‹ oder ob du sagst: ›Gold ist Wind.‹ Es ist ganz etwas anderes, es ist das Entgegengesetzte. Verstehst du das?«
Der Müller schüttelte den Kopf; in diesem Augenblick hätte er überhaupt nichts verstanden.

Der Fremdling nahm nun den Hut ab und[88] strich sich durch die Haare. Da zischten und blitzten Flammen daraus; auch begann die Nase des unheimlichen Gastes in grellem Lichte zu leuchten. Zwei große Augen richteten sich auf den zitternden Müller, und der Fremde sprach:
»Den wahren Schatz hast du verschleudert; den Mann, der dir aus Wind und Wasser und Erde Gold gemacht hätte, hast du verjagt, und als ihn dir die höheren Mächte zurückbrachten, hast du ihn einem abscheulich verrohten Kerkermeister übergeben. Wenn du ihn nicht freimachst und ihn nicht deiner Trudel vermählst, so wird all dein Hab und Gut zerrinnen, so bist du über Jahr und Tag ein Bettler. Bedenke das wohl. Ich sage es, ich, der große Zauberer Kiutschitsufilutschi.«
Und der Zauberer griff mit der rechten Hand eine kleine Trommel, mit der linken einen Schläger aus der Luft, schlug einen kurzen, dumpfen Wirbel, öffnete seinen Mund und spie Rauch und Flammen aus, warf Trommel und Schläger durchs geschlossene Fenster hinaus, nahm eine große Wurst vom Tisch, die sich zusehends in eine Schlange verwandelte und ihm in den Halskragen kroch, verwandelte ein Stück Speck, das dalag, in eine Maus, die in seine Rocktasche schlüpfte, und verschwand knarrend durch die Tür.
Den Müller schwitzte und fror in dem gleichen[89] Augenblick. Lange saß er fassungslos da, dann schrie er um Hilfe. Das Trudelchen kam gesprungen und war außer sich vor freudigem Schreck, als ihr der Vater keuchend sagte:
»Trudelchen, zieh dir eine Jacke an; wir müssen augenblicklich den Reinhard aufsuchen, und du mußt ihn heiraten! Es ist etwas Schreckliches geschehen: du mußt jetzt den Reinhard heiraten, oder ich werde ein Bettler.«
O, wie flink hatte das Trudelchen die Jacke an und das Tuch über den Kopf gebunden! Die beiden machten sich nun auf und gingen zu Herrn Schleifle, der eben vor der Tür seines Bahnwärterhauses damit beschäftigt war, sich mittels eines Steines auf der Schiene Haselnüsse aufzuklopfen.
Er hielt in seiner Arbeit inne und sah die beiden erwartungsvoll an.
»Schleifle,« sprach der Müller, und man hörte ihm an, daß ihm das Reden schwer wurde, »Schleifle, du bist ein Mann der Gerichtsbarkeit. Du hast den Reinhard eingesperrt und mußt nun sehen, daß du ihn wieder herausbekommst, denn mein Trudelchen muß ihn heiraten.«
Herr Schleifle war sehr erstaunt, und indem er einige Haselnußschalen von der Schiene putzte, dachte er bei sich: Ei, ei, seht an, das Mädel hat[90] den Alten herumgekriegt; nun soll es ihn aber auch was kosten! Er schob also seine Amtsmütze aufs linke Ohr und sagte:
»Reinbringen ist leicht; rauskriegen ist schwer! Reinhard sitzt da drin im Namen des Gesetzes; ich kann ihn nicht begnadigen.«
Der Müller griff in die Hosentasche und ließ von ungefähr einen blanken Taler sehen, aber Schleifle, der schnell im stillen ausrechnete, drei Taler seien mehr als einer, meinte:
»Die Obrigkeit sieht nicht aufs Geld. Reinhard ist nun einmal ein Räuber und muß dafür brummen.«
In diesem Augenblick kam ein Zug angesaust.
Herr Schleifle, der dieses Ereignis nicht vermutet hatte, sprang beiseite und stand stramm, in der einen Hand den Stein, in der anderen die Haselnußtüte. Auch als der Zug fort war, blieb Herr Schleifle fest und meinte, die Geschichte mit Reinhard sei ein schwerer juristischer Fall und er könne da vorläufig nichts tun.
Mit diesem Bescheid mußten sich die beiden begnügen, und der Müller ging verdrossen mit dem weinenden Trudelchen heim. Was sollte nun werden? Der unheimliche Fremde, der so unerhörten Zauber ausüben konnte, hatte gedroht, der Müller würde zum Bettler werden, wenn der[91] Reinhard die Trudel nicht heiratete. Und Schleifle war als Beamter wie von Stahl und Eisen. Was sollte nun werden?!
Eine schwermütige Nacht brach an. Das Trudelchen war schluchzend nach seiner Schlafkammer gegangen; der Müller saß allein und hörte den Nachtwächter die zehnte Stunde tuten. Die Zukunft lag erschreckend und trostlos vor ihm. Wie der Fremdling Trommel und Schlägel durchs geschlossene Fenster geschleudert hatte, so würde all Müllers Geld und Gut auf die Gasse fliegen, er mochte es verschließen und bewachen, wie er wollte. Und wie sich Müllers schöne Wurst und sein saftiges Stück Speck in eine Schlange und eine Maus verwandelt hatten, so würde all seine Habe der Geier holen. Wer kam gegen Zauber an?
Wie nun der Ärmste noch in so schweren Gedanken dasaß, hörte er plötzlich vom Garten her wieder das silberhelle Klingen des Glöckleins. Mit drei Sätzen war der Müller im Hof, ergriff den Spaten und eilte nach dem Garten. O, wenn der Reinhard wieder unter dem Baume in der Erde steckte, welch ein Glück!
Der Müller stieß den Spaten in den Rasen, hob die Schollen ab, grub, grub um den ganzen Baum herum, und fand schließlich ein Kästlein, das zwar nicht ganz klein war, aber sich doch bequem in den Händen tragen ließ.
Wie betäubt stand der Müller mit dem Kasten da, stand wohl länger als fünf Minuten still, ehe er die Kraft fand, mit dem Schatz nach der Stube zu gehen.
Dort öffnete er den Kasten und stieß einen jubelnden Schrei aus.
Gold! Gold! Gold! Pures, eitles, blinkendes Gold! Flimmernde Stücke ohne Zahl! Der Müller schloß die Augen, nahm drei, nahm zehn Münzen, nahm beide Hände voll und lachte und schluchzte und verschluckte sich und bekam einen Krampfhusten vor lauter Freude.
Zehnmal wühlte er die Hände in den goldenen Segen. Das war ein Reichtum ohne Maß. Auch Diamanten, Rubinen und schimmernde Smaragdsteine waren unter den Münzen, und manch einer von den Edelsteinen war so groß wie ein Taubenei.
Der Müller brach in Tränen aus. Er war reich, reich wie kein Mensch der Welt, reicher als der Kaiser, reicher als der Sultan, reicher selbst als Herr von Pritzewitz, der drei Rittergüter besaß! Nun war alles gut und herrlich, nun konnte sich sein Trudelchen goldene Schuhe und silberne Schürzen kaufen, und jeder Jackenknopf sollte ein Demant sein. Und den Reinhard wollte er loskaufen, den Reinhard –
Hm! Halt! Halt! Hm! Vorsicht! Immer sachte!
Man brauchte nichts zu voreilig zu tun, man[93] konnte es sich überlegen. Wer war er jetzt, der Müller, wer war die Trudel, und wer war der arme Reinhard? Unerhört wäre es, wenn ein Müllerbursch eine Prinzessin heiratete, die die Erbin solcher Güter war, die einen Fürsten oder gar einen Offizier bekommen könnte. Müller übereil' dich nicht! Wenn das Mädel das hier sieht, diese Pracht, diesen märchenhaften Reichtum, dann wird sie schon von selbst vernünftig werden. Der Zauberer? Der Zauberer mit seiner Prophezeiung? Wo ist seine Prophezeiung? Wenn er der Teufel gewesen ist, muß er ein sehr dummer Teufel gewesen sein. Ist das der Rückgang von Müllers Wohlstand? Kann soviel Geld und Reichtum überhaupt je zu Ende gehen? Unsinn! Müller, sei fest, jetzt kann dir kein böser Geist mehr was anhaben. Halloh, nun mußte noch alles anders, ganz anders kommen, mußte so kommen, wie es der Müller wünschte. – –
Es klopfte ans Fenster. Der Müller erschrak und schloß den Kasten. Draußen an den Scheiben wurde das rote, umfangreiche Riechorgan Herrn Schleifles sichtbar. Der Müller ging in den Hof hinaus.
»Was willst du?«
Herr Schleifle machte eine hoheitsvolle Amtsmiene.
»Müller,« sagte er, »ich hab mir's überlegt und[94] die Gesetzbücher nachgeschlagen. Ich könnte den Reinhard doch vielleicht freikriegen. Aber es ist ein schwieriger Fall. Und Spesen wird's machen, viel Spesen.«
Der Müller sah Herrn Schleifle hochmütig an.
»Ich brauch' dich nicht mehr, Schleifle. Es ist anders gekommen. Meinetwegen kann nun der Reinhard solange im Gefängnis sitzen, wie ihm und den Herren Richtern beliebt. Nicht einen Pfennig gebe ich für ihn her.«
Damit schlug er dem verdutzten Gerichtsmann die Tür vor der Nase zu und ging nach der Stube zurück. Dort wartete er, bis er sich völlig unbeobachtet wußte, und öffnete dann wieder sein Schatzkästlein.
Da starrten seine Augen – – da stieß er einen Schrei aus, der durch die ganze Mühle gellte, und fiel schwer zu Boden. – – –
Das Trudelchen fand ihren Vater vor einem geöffneten Kästlein, in dem nichts war als ein paar Scherben, ein paar Kieselsteine, ein Bündelchen dürres Gras und ein Häufchen Asche.
Vierzehn Tage lang lag der Müller krank, dann stand er auf, tat Geld in seinen Beutel und wanderte nach dem Amtsgericht. Dort fragte er nach Reinhard. Er hörte, daß Reinhard und Jakoble[95] inzwischen nach der Stadt hineingeschafft und dort von dem Gericht freigegeben worden wären, da keine Schuld an ihnen gefunden worden sei.
Der Müller wanderte nach der Stadt und fragte nach Reinhard und Jakoble. Sie waren auf und davon; niemand wußte wohin.
Da ging der Müller aus der Stadt hinaus, setzte sich auf einen Wiesenrain und schluchzte zum Steinerbarmen. Nun wußte er, daß sein Glück dahin war, wußte, wie grausam sich die Prophezeiung des fremden Zauberers erfüllen würde. Eine ingrimmige Reue erfaßte den Müller. Wie hatte er sein Glück verscherzt! Nun mußte er ein Bettler werden, wenn er Reinhard nicht fand und nicht Schuld und Strafe von sich und seiner Mühle abwandte. Suchen mußte er den Reinhard, suchen, und wenn ihm die Füße bluteten.
Jahrelang wanderte der Müller durchs ganze Land. In allen Herbergen, auf allen Straßen fragte er nach Reinhard und Jakoble. Er fand sie nicht. Oft glaubte er, eine Spur zu haben, doch er verlor sie immer bald wieder. Oft auch beschloß er heimzukehren; aber er fürchtete sich. Vielleicht war inzwischen seine Mühle abgebrannt, seine Trudel gestorben; vielleicht war auch sein Besitztum[96] verpfändet und sein Kind davongetrieben worden in die weite Welt. Das hätte er nicht ertragen; viel lieber wollte er suchend durch die ganze Welt irren, um am Ende doch noch, wenn er seine Schuld gesühnt hatte, Reinhard zu finden und für sich und sein Kind das Glück zurückzugewinnen.
So wurde der Müller wirklich ein Bettler.
Nach Jahren, als seine Haare und sein Bart lang und grau geworden waren, kam er in eine Stadt und setzte sich müde auf eine Bank, die unter einer großen Linde war. Ihm gegenüber war ein schmuckes, ansehnliches Haus, davor hing ein blinkendes Becken, wie es die Barbiere als Aushängeschild haben. Über der Tür stand: Heinrich Bimske, Frisier- und Rasiersalon. Im Fenster, an der Tür und an den Wänden waren große Plakate, darauf stand in fetten Lettern zu lesen: »Bimskes Universalsalbe!« »Bimskes unfehlbares Haarwasser!« »Bimskes wohlriechende Mundpastillen!« »Bimskes weltbekanntes Zahnschmerzmittel!« Und so waren noch viele Schilder und eines in roten Buchstaben lautete: »Alles eigene Erfindung«! Auch wurden »Wahrsagen«, »Hühneraugentod« und eine wunderbare »Wünschelrute« angezeigt.
Nach einiger Zeit trat ein gelenkes Männlein aus dem Laden, kam auf den Müller zu und sagte:
»He, Herr Nachbar, Ihr seid wohl hier fremd? Wollt Ihr Euch vielleicht Kopf- und Barthaar scheren, Schröpfköpfe setzen oder wahrsagen lassen? Alles schmerzlos und konkurrenzlos billig! Erste Firma am Platz.«
Der Müller schüttelte den Kopf; aber dann fragte er schüchtern, was wohl das Wahrsagen koste.
»Von 25 Pfennig an aufwärts!« erwiderte das Männlein flink; »kommt ganz auf die Qualität an, mein Lieber. Aber da ich sehe, Ihr wollt nicht viel ausgeben, und da jetzt gerade stille Geschäftszeit ist, kommt nur mit! Fünfzehn Pfennig wird Euch für einen klaren Blick in die Zukunft nicht zu viel sein.«
Der Müller kramte in seinen Taschen, brachte fünfzehn Pfennige Kupfergeld zusammen und ging mit dem Barbier in eine Stube, wo es recht kunterbunt aussah von allerhand geheimnisvollen Dingen, als da sind: Totenköpfe, Eulen, Phiolen, und Siedekessel, seltsame Waffen, Urnen, alte Bücher. Vor allem aber fiel dem Müller ein Kästchen auf, das auf das Haar jenem Kästchen ähnlich war, das er einst unter dem Apfelbaum daheim ausgegraben und das ihm erst so viel[98] Glück und dann so viel Kummer und Herzeleid gebracht hatte.
»Was möchtet Ihr nun wissen?« fragte der Wahrsager.
Der Müller seufzte und erzählte seine ganze Geschichte, vor allem, wie er nun seit Jahren Land aus, Land ein den Reinhard suche, der ihm allein sein Glück und seine Ruhe wiedergeben könne.
Während dieser Erzählung rückte der Wahrsager unruhig hin und her, kratzte sich auf dem Kopf und wurde abwechselnd blaß und rot. Als der Müller geendet hatte, wandte sich der Barbier ab und sagte:
»Ja – hem – das tut mir leid – ja hem – das hätte ich nicht gedacht – nicht – nicht gewollt und ich – ich – nun wartet, da muß Euch ein stärkerer Geist helfen, als ich bin.«
Ein Viertelstündchen verging, dann trat Kiutschitsufilutschi ins Zimmer. Der Müller stieß einen Schrei aus; aber der Zauberer beruhigte ihn und sprach: »Ich komme als dein Freund! Deine Schuld ist gesühnt; ziehe nach Hause, du wirst wieder glücklich werden.«
Darauf legte er eine Schlange auf den Tisch; sie verwandelte sich in eine Wurst. Er ließ eine Maus aus dem Ärmel krabbeln; sie verwandelte sich in ein Stück Speck.
»Das nehmt,« sagte der Zauberer; »ich glaube, ich blieb es Euch schuldig. Und dann nehmt noch diese drei Taler, setzt Euch auf die Eisenbahn und fahrt heim!«
Und der Müller fuhr wirklich nach Hause. Als er seiner Mühle ansichtig wurde, überfiel ihn heftiges Zittern aus Angst und Sorge, wie er da alles antreffen werde.
Plötzlich sah er das Jakoble. Es ging eben mit einer Sense aufs Feld.
»Jakoble! Jakoble!« schrie der Müller; »sag, bist du's? Sag, wo ist der Reinhard?«
Das Jakoble erschrak, erkannte den Müller und wollte Reißaus nehmen. Erst auf die klagenden Zurufe des alten Mannes kam er näher.
»Jakoble, sag mir, wo ist Reinhard? Sag mir, was ist aus meiner Trudel und meiner Mühle geworden?«
Da duckte sich Jakoble und sagte:
»Meister, gebt Ihr mir keine Ohrfeige?«
»Nie mehr!« sagte der Müller. »Nie mehr, liebes Jakoble.«
»So will ich Euch sagen: die beiden sind längst verheiratet, und es geht ihnen gut.«
»Sie sind – sind verheiratet?«
»Ja! Ihr, Meister, seid den Weg nordwärts[100] gegangen und habt uns nicht gefunden; aber die Trudel ist südwärts gegangen, und da saßen wir beide, als wir aus dem Gefängnis heraus waren, ganz nahe bei der Mühle. Und da haben sie sich halt geheiratet. Und zwei Kinder haben sie, und Geld haben sie auch.«
»So, so,« nickte der Müller. »Es ist gut. Nun wollen wir heimgehen.«
Sie gingen. Unterwegs blitzte dem Müller durch den Kopf, da alles gut gehe, müsse er sehen, daß er nun das Heft wieder in die Hand bekomme. Man könne ja nicht wissen, ob das Glöcklein auf dem Baume am Ende doch nicht noch einmal läute.
Drei Tage später bekam Jakoble wieder die erste Ohrfeige.
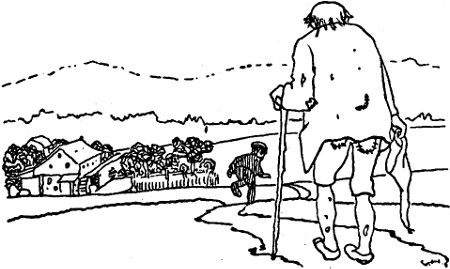
Der Kirchturm von Waldauendorf war schlechter Laune. Er hatte auch Ursache dazu. Was meint man, was einem alten, ehrwürdigen Kirchturm alles passieren kann? Angebunden hatten sie ihn wie einen Hund! Da waren solche schnippische Kerle aus der Stadt gekommen, hatten eine endlos lange eiserne Schnur hinter sich hergeschleppt, sie an Bäumen und Masten befestigt und schließlich auch den Kirchturm daran gebunden.
Also so etwas soll sich ein alter, ehrwürdiger Herr heutigen Tags gefallen lassen! Der Turm guckte mit seinen großen Augen, die als Wimper eine schöne Jalousie hatten, zornig auf die städtischen Knirpse, die einen mächtigen Haken in seine Seite schlugen und ein Porzellanhütchen daraufsetzten. Nun tut ja einem Kirchturm ein eingeschlagener Haken nicht mehr weh, als wenn andere Leute sich mit einer Stecknadel pieken. Auch das Porzellanhütchen hätte man sich gefallen lassen können wie einen schmucken Westenknopf.
Aber die Schnur! Daß er angebunden wurde, das ging gegen seine Ehre!
Der alte Herr, der als braver Kirchturm sonst sehr christlicher Gesinnung war, hatte plötzlich einen feindseligen Gedanken. Er lugte nach dem Waldrand hinüber und wünschte, die Schweden möchten kommen und die Frechlinge, die unten auf der Leiter hämmerten und bastelten, mit ihren Kanonen herunterschießen. Der Kirchturm kannte die Schweden. Erst neulich waren sie dagewesen; es konnte höchstens zwei- oder dreihundert Jahre her sein. Da hatten sie das Dorf beschossen, und auch dem Kirchturm steckten noch ein paar Kanonenkugeln in den Gliedern, wie einem Bauern, der zur Treibjagd war, die Schrotkörner. Damals hat der Turm die Schweden als die Feinde seiner Gemeinde gehaßt und ein halb zorniges, halb jubelndes Glockenlied gesungen, als sie endlich abziehen mußten. Aber jetzt wünschte er sie sich her. Die würden schon die bösen Buben, die ihn an die Leine legen wollten, vertreiben. Beim ersten Schuß würden sie ausrücken.
Natürlich, wie's so ist: braucht man einmal Schweden, sind sie nicht da. Die Männlein vollendeten ihr Werk und zogen mit einer anderen Schnur weiter durchs Dorf und in den Wald hinein.[105] Der Kirchturm war nach zwei Seiten hin angebunden.
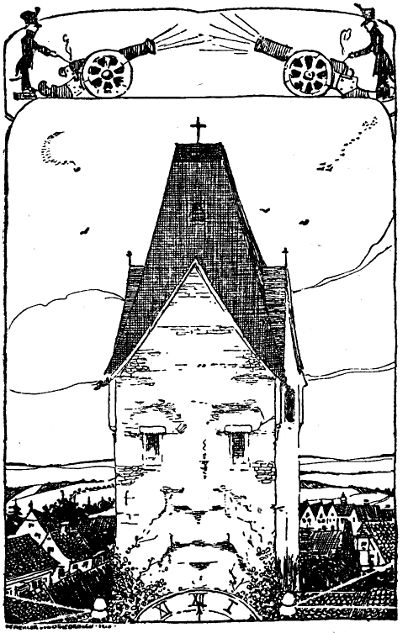
O Schmach! Was nutzte es ihm nun, daß er seit zehn Jahren einen sehr feinen hellgrauen Anzug besaß; was nutzte es, daß ihm der Herr Pfarrer neulich einen ganz neuen roten Hut versprochen; ja, was nutzte ihm sogar sein größter Stolz: daß er vor zwanzig Jahren eine richtig gehende Taschenuhr bekommen hatte? Die alte Sonnenuhr, die er einige hundert Jahre getragen, war schließlich etwas eingestaubt gewesen, und man hatte ihm eine Uhr mit richtigen Ziffern und Rädern gekauft. Da hatte er in seinem Stolz und seiner Freude den ganzen Tag darauf geschielt, wie spät es sei. Schöne Zeit war das!
Jetzt war alles dahin: sein Schmuck, seine Ehre, seine frohe Laune. Er war angebunden! – – –
Der Abend kam. Durch die Mauerluke des Turmes ging der Wind wie schluchzendes Atmen, und ein paar kalte Tropfen rannen über seine großen Augen.
Was hatte er seiner Gemeinde getan, daß sie ihm diese Schmach widerfahren ließ? Hatte er nicht freudig sein Lied gesungen zu ihren Festen? Hatte er nicht sein tröstendes Sprüchlein gesagt, wenn eine Seele am Scheiden war; hatte er nicht in wilden Sturmnächten, wie in den[106] Blütenstunden des Mai Wache gestanden an ihren Gräbern; hatte er nicht als erster jedem Heimkehrenden, der aus der Fremde kam, einen Willkommensgruß zugewinkt? Und sein golden Kreuzlein hatte er über Hof und Haus, Feld und Wald gestreckt, wie einen immerwährenden Segen. – – –
Ein paar Tage vergingen. Wieder war es Abend.
Die Schulmagd kam, die Glocke zu läuten. Der Turm tat seine Pflicht: er sang seinen Abendsegen. Aber in seiner Stimme war ein Klang von Trauer und Herzeleid. –
Unten knarrte das Kirchhoftürchen.
Die junge Frau Annemarie kam. Sie ging schnell und aufgeregt. Ihre Blicke irrten über den Kirchhof. Und sie fiel vor dem großen Kreuz auf die Knie, das unter der Linde stand.
»Erbarm dich, Herr, erbarm dich! Laß mein Kind nicht sterben! Laß mein Kind nicht sterben!«
Sie wiederholte schluchzend immer dieselben Worte.
Der Kirchturm wußte Bescheid. In ein paar Tagen mußten seine Glocken klingen über einem kleinen Grab, und in sein Läuten würde sich lautes Mutterweinen mischen und der Gesang: »In der Blüte deiner Jahre …«
Der Turm kannte das. Es war das alte Lied[107] seit vielen, vielen hundert Jahren. Mütter weinen an den Gräbern am schmerzlichsten.
»Erbarm dich, Herr, laß mein Kind nicht sterben!«
Wieder ging die Kirchhofstür. Der alte Herr Kantor kam. Er war wohl der Annemarie nachgegangen.
»Der Arzt muß kommen!« sagte er zu ihr.
Sie blickte ihn an wie irr.
»Der Arzt? Ehe ein Bote in die Stadt kommt und den Arzt holt, ehe der Arzt kommt und das Kind untersucht, ehe er wieder nach der Stadt zurück ist und von dort die Medizin schickt, ist das Kind tot – ist es tot!«
Da sprach der Kantor etwas, was der Turm durchaus nicht verstand; er sagte:
»Ich werde dem Arzt telephonieren!«
Und er zog die weinende Annemarie mit sich fort. – – –
Was wird er dem Arzt? Telephonieren? Was war das? Es ist wahr, das Gehirn des Kirchturms war schon ein bißchen morsch, und er mußte sich Mühe geben, Neues zu begreifen. Dafür war sein Herz gut und darum sein Gefühl unendlich fein geblieben.
O, was war das für ein wundersamer Abend! Der Kirchturm, der mit allen Sinnen spähend stillstand, hörte plötzlich die Stimme seines alten Kantors.[108] Er schielte nach unten, nach dem Kirchhof, nach der Dorfstraße: der Kantor war nicht zu sehen. Seine Stimme klang etwas verschleiert, aber sie war doch deutlich genug, daß der Turm alles verstand. Das heißt, er verstand die Worte, der Sinn aber erschien ihm gänzlich konfus.
Also, der Kantor, der doch im Waldauendorfe war, sprach mit dem Arzt, der in der Stadt war; der Kantor erklärte den Zustand von Annemaries Kinde, und der Doktor sagte: jawohl, das sei Diphtherie, er werde sofort kommen und das Kind impfen, da werde es wohl wieder gesund werden.
So verdutzt war der Kirchturm noch nie gewesen in seinem langen Leben, und als eine Stunde später eine Fuhre mit dem Doktor wirklich durchs Dorf fuhr, bekam er Atembeschwerden und Herzbeklemmung.
Ehe der Arzt zurückfuhr, begleitete ihn der Kantor ein Stück die Dorfstraße hinunter, und der Turm hörte, was die beiden sprachen, als sie vorbeigingen:
»Es ist doch gut, daß Sie jetzt die elektrische Leitung haben,« sagte der Arzt; »bei dem Kinde war keine Zeit zu verlieren.«
»Ja,« sagte der Kantor, »in meinen jungen Jahren hätte ich es nicht für möglich gehalten, daß man einmal einen Draht an meinen alten Kirchturm[109] befestigen und daß ich durch diesen Draht über Berg und Tal sprechen können würde. Eine neue Zeit!«
»Keine schlechte Zeit!« sagte der Arzt.
Die Männer trennten sich; der Kirchturm schnappte nach Luft. Also die Schnur, an die er gebunden war, war ein Draht, und durch diesen Draht konnte man bis in die Stadt sprechen!
Der Turm dachte nach, daß ihm die Balken seines Gehirns knackten – aber er kriegte nicht zusammen, wie das alles möglich sein könne.
Da faßte ihn tiefe Betrübnis. Er holte schwer Atem und sprach zu sich selbst:
»Wenn ich schon meine Gemeinde nicht mehr verstehe, wünschte ich, ich wäre tot. Vielleicht kommen die Schweden und erschießen mich, oder die Leute reißen mich weg und bauen einen neuen und klügeren Turm!«
So stand er traurig die ganze Nacht. Am nächsten Morgen aber hörte er aus dem Draht heraus die Stimme des Herrn Pfarrers. Der sprach mit einem Dachdeckermeister in der Stadt und bestellte tatsächlich den neuen roten Hut für den Turm.
»Wir müssen den alten Herrn schon etwas heraus putzen,« sagte der Pfarrer, »denn er ist ja im Nebenamt jetzt sogar Telephonbeamter geworden.«
Telephonbeamter! Da habt ihr's! Da ist man ein großes Tier und weiß es gar nicht, da ist man ein Beamter und hat keine blasse Ahnung von seinem Beruf! Aber das sollte jetzt anders werden! Telephonieren wollte der Turm, was das Zeug hielt.
Die gute Laune war plötzlich in goldenstem Maße wieder da. Der Turm sah nach seiner Taschenuhr. 9 Uhr! Wenn es der Dachdecker ebenso eilig hatte wie gestern der Doktor, konnte die Sache mit dem roten Hut also um 10 Uhr losgehen.
So schnell ging's nun nicht. Aber der Turm war immerfort in großem Glücksgefühl; er wußte, daß er nach wie vor seiner Gemeinde diente.
So mußte wohl auch auf den neuen Wegen der alte Gott regieren. Und hoch hob der Turm sein golden Kreuzlein über seine Gemeinde.
»Weißt Du, was die Oxford-Cambridge Boat Race ist? Nichts Genaues? Also eine Ruderwettfahrt in Achtern zwischen den Studenten der Universität Cambridge und Studenten von Oxford. Eine alte Sache. Schon seit 1829 im Schwange. Die Cambridger sind die Hellblauen und die Oxforder die Dunkelblauen. Natürlich wettet die Hälfte von London auf Hellblau, die andere Hälfte auf Dunkelblau. Die Damen tragen dunkel- oder hellblaue Toiletten, Hüte, Schleifen (natürlich die Farbe, die sie am besten kleidet);[112] Herren tragen hell- oder dunkelblaue Krawatten, Kinder hell- oder dunkelblaue Fähnchen, die Droschkenkutscher hell- oder dunkelblaue Bänder an den Peitschen. Ein Volksfest, ein Rummel! Ganz London auf der Themse oder wenigstens an der Themse.
Also, ich stand damals mit einem großen Sportblatt in Verbindung, war reiselustig und fuhr extra von Berlin nach London, um an der Oxford-Cambridge Boat Race teilzunehmen und meinem Blatt Bericht zu erstatten. Ich wußte, daß der Statt der Studenten bei Putney, zwei Stunden oberhalb Londons, stattfand und hatte nach mancherlei Mühe einen Platz auf dem Pressedampfer bekommen, von dem aus das Schauspiel am besten zu beobachten war.
In London treffe ich einige Bekannte und mache mit ihnen eine lange Nacht. Als ich um fünf früh ins Hotel kam, fühlte ich mich ruhebedürftig und schlafe und schlafe und schlafe richtig bis dreiviertel zehn Uhr.
Punkt 10 Uhr aber fuhr der Pressedampfer vom Londoner Kai aus hinaus nach Putney. Ich erschrak. Heraus aus dem Bett und die Unterhose verkehrt anziehen war eins. Donnerwetter! Donnerwetter! So ein Lumpenkerl – ich! Extra nach London gekommen, und nun – wo sind die Strümpfe? – Wenn bloß der Kragen nicht[113] so blödsinnig eng – Waschen? Verrücktheit! Ich wasche mich andermal wieder – Himmel, da ist ja mein linker Schuh am rechten – Portier! Portier! Waiter! Waiter! Einen Wagen! Ein cab! Sofort!
Ich flog die drei Treppen hinab und stieß mir sechs Beulen, auf jeder Treppe zwei, saß im Wagen, versprach dem Kutscher eine königliche Belohnung. Der Kerl hatte hellblaue Peitschenschnüre, und ich trug eine dunkelblaue Mütze. Er ein Cambridger, ich ein Oxforder! Trotzdem fuhr er großartig. Ich ein Oxforder, o nein, ein Ochse, ein großer Ochse! Zu verschlafen! Kutscher, wir müssen, müssen, müssen zurechtkommen!
Und wir kamen zurecht. Ich konnte gerade noch den Pressedampfer abdampfen sehen. Ich streckte die Arme nach ihm aus, ich brüllte wie ein Stier hinter dem Schiffe her, dann setzte ich mich auf einen Straßenstein und knirschte vor Wut mit den Zähnen. Es war mir, als müsse ich den bummeligen Kerl, der das verschuldet hatte, beim Kragen kriegen und in der Themse elend ersäufen – mich!
Extra von Berlin gekommen in dies blödsinnige Nest, wo die Dampfer so pünktlich abgehen, und jetzt, wo's da draußen losgeht, kauere ich hier wie ein trauriger Affe auf dem Straßenstein.
Müde erhob ich mich. Keine Möglichkeit, auf anderem Wege nach Putney zu kommen. Ein Boot? Unsinn, das kam gerade hinaus, wenn der Start längst vorüber war. So schlenderte ich in seltsamen Gefühlen und eigenartigen Selbstbetrachtungen den Kai entlang.
Da sah ich dicht an der Ufermauer einen stattlicher Dampfer liegen. Leer! Nur ein paar Bedienungsmannschaften lungerten träge herum, und der Kapitän spazierte auf Deck hin und her.
Ein Gedanke! Ein rettender Gedanke!
»Sir!« rufe ich dem Kapitän zu, »ich habe den Pressedampfer verpaßt, was mir äußerst unangenehm ist, und ich muß nach Putney, ich muß! Wollen Sie mich, mein Herr, auf Ihrem Schiff nach Putney fahren?«
»Aber sehr gern, mein Herr!« erwiderte er in freundlichstem Ton; »ich habe gerade Zeit, und es wird mir ein Vergnügen sein, Sie nach Putney zu fahren.«
Hurra!
»Und welches ist der Preis für den Extradampfer?«
»O, mein Herr, der Preis ist Nebensache. Steigen Sie nur ein!«
»Ja, my dearest, so ungefähr möchte ich wohl …«
»Steigen Sie nur ein, Sir, Sie werden sehr zufrieden[115] sein. Indes vergeht sonst unnütz die Zeit.«
Das sah ich ein, und ich bestieg das Schiff, auf die Gefahr hin, daß mir hinterher der Mann eine riesige Summe abverlangte. Ich mußte doch nach Putney! Ein Kommandowort nach dem Maschinenraum, ein Signal, das Schiff setzte sich in Bewegung. Und ich war sein einziger Passagier! An einem solchen Tage, wo sonst alle Schiffe überfüllt waren! Ein freudiger Stolz, ein Gefühl großer Vergnügtheit ergriff mich.
Der Kapitän trat an meine Seite und sagte:
»Mein Herr, Sie werden gewiß das wundervolle bunte Leben und Treiben auf der Themse und an ihren Ufern, wie es gerade der heutige Tag bringt, beobachten wollen. Wir haben hier an Bord einen brillanten Auslugposten. Sehen Sie, hier, wo die Bordwand unterbrochen und durch ein schmales Geländer ersetzt ist! Stellen Sie sich hierher! Hier sehen Sie alles.«
Ich war dem liebenswürdigen Manne aufs äußerste dankbar, drückte ihm gerührt die Hand und stellte mich an den bezeichneten Platz.
Eine prachtvolle Aussicht! Eben kommt eine blumengeschmückte Gondel vorbei. Dunkelblaue Fahnen, alle Insassen mit dunkelblauen Abzeichen. Oxforder!
Da – mit einem Male stutzen die Leute im[116] Boot, betrachten mein Schiff, betrachten mich und – brechen in ein schallendes Gelächter aus.
»O, Ihr lieben Oxforder! Ihr seht wohl meine dunkelblaue Mütze, seht, daß ich von Eurer Partei bin, ahnt, daß ich mir einen Extradampfer gechartert habe, um noch nach Putney zu kommen, und bringt mir diese jubelnde Ovation?! Seid bedankt, Freunde, seid bedankt!«
Und ich schwenke vergnügt meine dunkelblaue Mütze. Als die Leute das sehen, jubeln sie noch viel lauter. Entzückend, diese übersprudelnde Fröhlichkeit!
Da – ein Boot mit Hellblauen! Die gegnerische Partei. Aber auch sie – auch sie brechen ja in ein jubelndes, in ein schallendes Gelächter aus …
Nanu!
Was haben die Kerle zu lachen?
Aha, das ist Hohn! Sie sehen, daß ein Dunkelblauer sich verspätet hat und ein Extraschiff nehmen mußte. Glaubt nur ja nicht, ihr dummen Kerle, daß ich mich über euch ärgere! Im Gegenteil, ich schwenke herausfordernd meine dunkelblaue Mütze und wundere mich nur, daß diese hellblauen Kunden so blödsinnig vergnügt weiter lachen. Na ja, die Hellblauen, von denen kann man alles erwarten.
Potz Blitz, was ist das dort drüben am Strande?[117] Ein Menschenauflauf. Männer, Weiber, Kinder stürzen herbei, und alles zeigt auf mein Schiff und auf mich, der ich an seinem sichtbarsten Punkt stehe, und eine donnernde Lachsalve tönt vom Ufer herüber. Die Männer fuchteln mit den Armen, einzelne Frauen setzen sich platt auf die Erde und scheinen sich in Lachkrämpfen zu winden, Buben schlagen Purzelbäume vor Vergnügtheit, und immer neue Scharen strömen, nein, stürzen herbei und stimmen in das Gelächter ein.
Ich winke hinüber – stürmischer Jubel! – ich begucke und betaste bestürzt meinen Anzug – zwerchfellerschütternde Heiterkeit, – ich drehe mich verwirrt dreimal um meine Achse – ein brüllendes Gewiehere – ich reiße einen kleinen Spiegel aus meiner Tasche und betrachte mich – die Leute wollen bersten!
»Um Himmels willen, Kapitän, was ist denn los?«
Er sieht mich mit freundlichem, unendlich wohlwollendem Gesichte an.
»Ein bißchen verrückt,« sagt er phlegmatisch.
»Was, ein bißchen verrückt? Total verrückt ist diese Gesellschaft!«
Ein zweites, drittes, viertes – zehntes Boot fährt vorüber, und alle, alle, alle Insassen lachen, lachen, lachen ein wahnsinniges, tollhäuslerisches Gelächter.
Darüber werde ich völlig verwirrt. Ich drehe mich wie ein Kreisel, ich werfe die Arme wie Windmühlflügel, ich deute nach der Stirn, um die Leute auf ihren Geisteszustand aufmerksam zu machen.
Sie lachen, sie lachen Stürme!
»Kapitän, sagen Sie mir – erklären Sie mir um Himmels willen – das ist ja – das ist ja –«
»Boat race,« sagte er schmunzelnd.
»Aber Mann, wenn auch heute Oxford-Cambridge-Tag ist, braucht doch dieses Volk nicht über einen anständigen Ausländer in ein so verrücktes –«
Ein Schrei. Ein »Seelenverkäufer«, in dem zwei Leute gesessen haben, ist gekentert. Die Kerle klammern sich an ihr Boot, kämpfen mit den Wellen und lachen, lachen, – – – sie ersaufen beinahe und zeigen doch auf mich und lachen – lachen –
Also – irgend jemand mußte hier verrückt sein! Und da doch wahrlich nicht ganz London plötzlich toll geworden war, so war wahrscheinlich ich – –
Ein Angler, der am Ufer sitzt, zieht eben einen Fisch aus dem Strom, sieht mich, kriegt augenblicklich Schreikrämpfe und fliegt samt Angelrute und Fisch kopfüber ins Wasser. Mich überläuft es siedendheiß. Ich zittere vor Aufregung.
Da – ein Marineschiff kommt daher. Endlich ein ernstes Fahrzeug. Ein wildes, knallartiges Gelächter der Mannschaft samt den Offizieren …
Also doch!! Elender Porter! Elender Brandy! Eine einzige Nacht, und ich bin – – o, es ist nicht zum Ausdenken! Vielleicht befinde ich mich gar nicht auf einem Schiff; vielleicht bilde ich mir das alles bloß ein! – Aber hier stehe ich doch, hier halte ich doch das Geländer, hier ist doch die Themse!
»Es ist ein guter Tag heute!« sagt freundlich der Kapitän.
»Guter Tag?«
Ich fange an, einfach radzuschlagen und die Beine nach oben zu strecken.
Rundum dröhnt die Luft, knallt, prasselt, ächzt, stöhnt, heult es vor Gelächter. Am Strande, auf kleinen Booten, auf Segelschiffen, auf Dampfern, überall, überall diese entsetzlich lachenden Menschen. Ich drehe mich um die horizontale oder um die vertikale Achse wie eine Spule oder wie ein Flugrad. Mit einem Wort: ich rotiere.
Der Kapitän behält seinen menschenfreundlichen, wohlwollenden, zufriedenen Gesichtsausdruck. Unheimlich, grauenhaft ist meine Lage.
Da endlich sehe ich den Pressedampfer. Selbst in meinen Kinderjahren habe ich nicht an Zauberei geglaubt, jetzt aber bin ich felsenfest überzeugt,[120] daß ich mich auf einem verhexten Schiffe befinde.
»Halt! Kapitän, halt! Ein Boot! Ich will da hinüber! Da auf den vernünftigen Pressedampfer. Verlangen Sie meinetwegen, was Sie wollen, nur lassen Sie mich von diesem blödsinnigen Schiff herunter!«
Dort – dort sammeln sich die Hell- und Dunkelblauen zum Start. Die ganze internationale Pressegesellschaft sieht zu. Aber plötzlich verliert für sie die boat race alles Interesse, alle wenden sich meinem Schiff zu, und ein internationales Gelächter erdröhnt, untermischt mit Jubelrufen in aller Herren Sprachen.
Kalter Schweiß rinnt mir von der Stirn. Auch diese – auch diese Internationalen! Nur mühsam fuchtele ich noch mit den Armen.
»Was bin ich Ihnen schuldig?« keuche ich.
»Nichts!« sagt der Kapitän.
»Nichts? Für einen Extradampfer – nichts? Ach ja – ich – ich – bin ja –«
»Im Gegenteil,« fährt der Kapitän fort, »meine Gesellschaft ist Ihnen zu großem Dank verpflichtet, und ich bedaure nur, daß es nicht möglich ist, Sie beständig für uns zu engagieren. Sie wären eine Goldgrube für uns. Bitte, behalten Sie dies zum freundlichen Andenken!«
Er gibt mir ein kleines Paket. Mir ist schon alles eins; ich nehme das Paket.
»Also nichts?« lallte ich.
»Nichts!« sagte er. »Im Gegenteil: tausend Dank!«
Endlich sitze ich in einem Boot, das mich nach dem Pressedampfer bringen soll, von dem unaufhörlich das Gelächter weiterdröhnt.
Wie ich etwas Distanz gewonnen habe, wage ich es, einen Blick auf das verlassene Zauber- und Gelächterschiff zu werfen.
Da sehe ich – – – daß der ganze mächtige Schiffsrumpf mit schreienden Plakaten bedeckt ist.
Ein Reklameschiff ist es.
Und ich lese:
»Beechams Pillen! Beechams Pillen! Alle Krankheiten kommen aus der Leber! Und die Leber wird einzig geheilt durch Beechams Pillen! Wer an Cholera, Verstopfung, Gehirnschwund, Bartlosigkeit, Krätze, Triefaugen, Plattfüßen, Buckel, roter Nase, Hühneraugen oder Altweiberrunzeln leidet, nehme Beechams Pillen!!!«
Die Liste war noch viel länger, noch viel beleidigender.
Die Hauptsache aber:
Unter dem Auslugposten, auf dem ich gestanden und auf dem ich in der Erregung meine wilden[122] Bewegungen mit den Händen und Beinen gemacht hatte, war eine Riesenhand mit nach oben gestrecktem Zeigefinger gemalt und daneben stand:
»Sehet diesen Mann! Er hat an sämtlichen Krankheiten gelitten, die an unserem Schiff verzeichnet stehen. Er hat Beechams Pillen genommen und ist kuriert worden. Seht seine freundlichen und kräftigen Bewegungen!«
Das kleine Paket, das mir der wohlwollende Kapitän zum Andenken überreicht hatte, enthielt eine Schachtel Beechams Pillen.

»Durch die Güte freigebiger Menschen kann auch in diesem Jahre wieder eine Anzahl bedürftiger Kinder in die Ferienkolonie geschickt werden.«
Es gab einen Tumult in der Klasse, als der Lehrer das sagte. Doch er setzte bald einen Dämpfer auf die Freude.
»Pst! Wir haben 400 Kinder in der Schule, und davon dürfen wir nur sechs vorschlagen, von denen wieder der Schularzt nur zwei auswählt. Also, von den 400 Kindern unserer Schule können nur zwei in die Ferienkolonie mitgenommen werden.«
»Heißt 'n halbes Perzent,« brummte Moritz Cohn auf der hintersten Bank. Er beschloß, bei so schlechten Chancen auf dies Geschäft erst gar nicht zu reflektieren.
Anders Heinrich Menzel. Er saß ganz vorn, war der kleinste und schwächlichste von allen. Tagelang zerbrach er sich den Kopf, ob er zu den[124] zwei Auserwählten gehören würde, betete inständig zum lieben Gott um diese Gnade, verfiel zuletzt sogar in Aberglauben, indem er Vaters alten Würfelbecher zum Orakel machte. Einen Wurf mit den drei Würfeln! Wenn es über 16 wären, würde es mit der Ferienkolonie glücken. Schon hatte er den Becher in der Hand, da setzte er die Schicksalszahl von 16 auf 14 herab.
Er warf 18!
Und richtig wurde er am nächsten Tage unter die sechs Kandidaten eingereiht, aus denen der Schularzt als oberste und unwiderrufliche Instanz die zwei Glücklichen auswählen würde, die auf vier lange Wochen das unsägliche Glück haben sollten, in einem grünen Gebirgsdorf zu leben, fern von den engen Straßen und dumpfen Höfen der Großstadt.
Der kleine Trupp der sechs Buben machte sich auf den ziemlich weiten Weg zum Schularzt. Auch Moritz Cohn gehörte zu ihnen. Vornweg stelzte Karl Perschke mit seinem lahmen Bein. Wie ein Anführer zog er daher, überzeugt, daß ihn sein sichtliches Gebrechen zum Siege führen würde. Fritz Neumann prahlte mit den eiterigen Mandelentzündungen, die er hinter sich hatte.
»Das ist noch gar nichts,« warf Gottlieb Scharfenberger ein, »zweimal Diphtherie, einmal Scharlach und einen Leistenbruch, das soll mir erst[125] mal einer nachmachen. Die Zahnkrämpfe gar nicht mitgerechnet.«
Dagegen kam sich allerdings Heinrich Menzel mit seinen lumpigen Masern und seinem Ziegenpeter gerader ärmlich vor.

»Der Max Scholz, der sollte erst gar nicht mitmachen,« sagte einer verächtlich, »er ist bloß zweimal übers Treppengeländer gefallen.«
»Aber einmal vom zweiten Stock herunter, und da hat der Kopp gelitten,« verteidigte sich Scholz.
»Ach was, Kopp! Kopp ist nicht so schlimm!«
»Ich hab auch was für mich,« dachte Moritz Cohn. »Ich bin der einzige Jude in der Schule,[126] und ganz können sie unsere Religion auch nicht ausschließen. Wir müssen berücksichtigt werden!«
So zog der kleine Trupp dahin in Hoffen und Bangen, und keiner der vielen reichen Leute, die ihm begegneten, dachte daran, daß da sechs auszögen, um vier Wochen grüne Waldjugend zu suchen.
»Es gibt doch gute Leute,« meinte Scholz; »Leute, die für so was das Geld geben. Es kostet dreißig Mark pro Mann. Ein schweres Geld!«
»Oh,« sagte Moritz Cohn, »30 Mark for 'ne vierwöchige Sommerfrische is immer noch 'n reeller Preis!« …
Sie kamen zum Arzt, wurden untersucht und über vielerlei gefragt, und endlich fällte der Mann mit der goldenen Brille den entscheidenden Spruch:
»In die Ferienkolonie werden mitgenommen: Gottlieb Scharfenberger und der Kleine da, der Heinrich Menzel.«
Heinrich entfuhr ein kleiner Freudenschrei, und der Arzt lächelte. Dann sagte er freundlich:
»Es tut mir ja leid, daß ich euch nicht alle sechs schicken kann. Am liebsten schickte ich die ganze Schule. Na, vielleicht kommt ihr anderen in einem der nächsten Jahre dran. Jetzt könnt ihr gehen.«
Draußen vor der Haustür sagte Moritz Cohn,[127] der nicht mit »ausgehoben« worden war: »Der Mann is 'n Antisemit.«
Der Lahme aber fing in ohnmächtigem Zorn an zu heulen.
Der Mond schien in die Stube, in der Heinrich Menzel mit seinen Geschwistern schlief. So eng die Klause – und doch vor dem träumenden Kinderauge die Welt so weit. Ein Waldtal stand vor der jungen Seele, wie es phantastische Bilder zeigen: himmelhohe Berge, ein klarblauer See, eine Sägemühle am silbernen Bach, im Hintergrund eine drohende finstere Burg.
»Du«, fragte ihn sein jüngerer Bruder, »ob es da auch Wölfe und Löwen gibt?«
»Du bist dumm,« sagte Heinrich im Tone aufgeklärter Leute, »Wölfe und Löwen gibt es nicht, aber Hirsche in Menge und gewiß auch Räuber und Wilddiebe.«
»Da würd' ich mich fürchten!« sagte der Kleine.
»Oh, ich fürchte mich gar nicht!« rief Heinrich und setzte sich im Bette auf.
Er reckte seine dünnen, schwachen Ärmchen, wie er an die Räuber und Wilddiebe dachte, die es möglicherweise im Gebirge gab, und beschloß, seine kleine braune Büchse mitzunehmen, die er von dem reichen Hauswirtssohn bekommen hatte.[128] Die Büchse ging zwar nicht mehr los, weil die Feder schon zerbrochen war, als er sie bekam, aber gut würde es sich ausnehmen, wenn er sie auf dem Rücken trüge. Die Hasen, Füchse und Adler würden einen Schreck bekommen und schleunigst die Flucht ergreifen, und das würde ein Spaß sein. Augen würde er da machen – oh! Wer sich nicht vor der Flinte fürchtete, sollte vor den Augen ein Gruseln bekommen!
Und dann konnte er mit dem Munde so täuschend einen Flintenschuß nachmachen, daß der Erfolg gewiß nicht fehlen konnte. Und fischen wollte er! Hechte fangen und Karpfen! Eine Schnur für die Angel besaß er schon; einen Stecken schnitt er sich aus dem Walde, und nur der Angelhaken fehlte. Aber der würde sich wohl finden; im schlimmsten Falle bog man eine Stecknadel krumm. Da würden aber die Hechte was zu zappeln haben! Blumen pflücken, Pilze sammeln, nach dem Hexenhause im Walde suchen und womöglich einen Räuber fangen helfen! – Oh!
Wieder reckte er die dünnen Ärmchen, und in seiner Erregung sprang er aus dem Bett, öffnete weit das Fenster und schaute hinaus.
Die goldenen Sterne funkelten in die Kinderaugen; hinten am Horizont stand eine Wolke, die sah aus wie ein zerklüftetes Bergland. Die[129] Firnen waren weiß vom Sternenlicht, und rundum der Himmel war wie dunkelgrünes Wiesenland. Ob dort drüben das liebe, gesegnete Land der Waldfreiheit war?
Zwei Tage vor der Abreise in den Sommeraufenthalt sagte der Lehrer in der Schule:
»Da also leider der kleine Heinrich Menzel an schwerer Lungenentzündung erkrankt ist, wird Moritz Cohn an seiner Statt in die Ferienkolonie mitgenommen.«
Moritz Cohn bedankte sich und dachte im stillen:
»Man soll also nie eine Sache voreilig aufgeben; 's kann immer noch werden.«
Moritz war ein ganz guter Junge. Anfangs beschloß er, Heinrich Menzel aufzusuchen; aber dann dachte er:
»Was sollste sagen? Daß der's leid tut? Das wird er nich glauben. Er wird bloß einen Gift auf der haben. Wirst ihm eine Ansichtskarte schicken, wenn se dort nich zu teuer sind.«
Im Fiebertraum war der kleine Heinrich immer in den Bergen. Er ging auf die Jagd, fischte, kämpfte mit Rittern und Räubern. Manchmal lachte er zwischen dem Röcheln und Stöhnen seiner Schmerzen selig auf.
Und einmal, als er einige Minuten unbewacht war, sprang er aus dem Bett, öffnete das Fenster, streckte die Arme aus und wollte hinaussteigen und mitten durch die Luft ins grüne Land wandern. Die Mutter erfaßte ihn noch, und es war ein Wunder, daß kein Rückschlag der Krankheit eintrat.
In der vierten Ferienwoche, als Heinrich schon auf dem Wege der Genesung war, bekam er einen Brief von Moritz Cohn:
Eulenhausen, den …
Die Ansichtskarten sind hier schlecht und teuer. Den Briefbogen hat der Wirt umsonst hergegeben, und die 10 Pfennige auf die Marke kannst du mir einmal wiedergeben, wenn du wirst Geld haben.
Lieber Heinrich, Räuber und Hechte gibt es hier nicht. Es ist überhaupt nichts los, nichts wie lauter Buschwerk, Kühe, Stallmägde und Heuwiesen. Die anderen helfen auf dem Felde; ich bin zur Erholung hier. Ein paarmal war ich beim Kaufmann, welcher Krämer heißt. Es ist ein jammervolles Geschäft. 3 Mark 50 Pfennig Losung hat der Mann einmal auf den ganzen Tag gehabt. Ich wundere mich, wo er den Kredit hernimmt. Der Laden hat zwar eine gute Lage, aber Eulenhausen ist überhaupt kein Geschäftsort.[131] Für Zucker nimmt der Mann bloß 2 Prozent, und wieviel wiegt er ein!
Lieber Heinrich, da du so gern nach Eulenhausen willst, so habe ich an meinen Vater geschrieben. Wir werden's machen! Ich habe mit dem Wirt gesprochen. 30 Mark bekommt er pro Mann (da kommt er gut auf seine Rechnung). Für dich wollte er auch 30 haben. Da habe ich ihn ausgelacht: »Spaß,« habe ich gesagt, »30 Mark, wo die Ferien vorbei sind, und es ist bloß die lumpige Nachsaison.« 12 habe ich ihm geboten. Er hat gelacht und hat noch hin- und hergeschmust, und für 15 will er's machen. Der Lehrer hat mich auch ein bißchen unterstützt. Aber mit der Ferienkolonie ist das nun vorbei, die zahlt nicht. Da macht's mein Vater. 15 Mark kostet es, mit Reisespesen 18 Mark. Da hat sich der Vater mit sechs anderen zusammengetan, von denen gibt jeder einen Taler. Du kannst also, wenn du gesund sein wirst, vier Wochen hierher kommen; im September ist noch das schönste Wetter.
Es grüßt dich Dein Freund
Moritz Cohn.
Selig lächelnd lag Heinrich Menzel mit dem Brief im Bette. Nun sollte er doch noch in sein geliebtes Waldtal! Er sollte dann ganz allein[132] dort der Herr aller Berge sein … Räuber und Hechte gäb's nicht? Oh, Moritz hat sie bloß nicht gesehen, hat den ganzen Tag beim Krämer gesteckt und zugesehen, was der einnimmt.
Die große Freude trat als Wundertäterin an Heinrichs Bett und machte ihn gesund.
»Ja,« sagte aber einmal Heinrichs Schwester nachdenklich, »wenn es 18 Mark kostet und wenn Moritz' Vater sich noch mit sechs anderen zusammengetan hat, von denen jeder einen Taler gibt, da hat er ja selber gar nichts gegeben!«
»Laß nur,« sagte Heinrich, »die Hauptsache ist: er macht's. Die Hauptsache ist: ich kann in den Wald!«

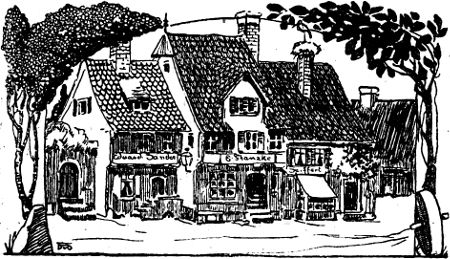
Mein Onkel Eduard hatte zehn Kinder. Sein linker Nachbar, der Krämer Franzke, hatte auch zehn Kinder, und sein zweiter Nachbar, der Müller Seiffert, hatte auch zehn Kinder.
Die befreundeten Familien standen natürlich gegenseitig zu Paten. Im Winter brachten Müller und Krämer meinem Onkel je zwei geputzte Taler als Patengeschenk ins Haus; im Sommer trug mein Onkel in Begleitung des Krämers zwei Taler zum Müller, im Herbst in Begleitung des Müllers zwei Taler zum Krämer. So machten sich die Nachbarn gegenseitig »nobel«, und des Bedankens und Verwunderns ob der[134] reichen Geschenke wollte immer gar kein Ende werden.
Gott ließ regnen und seine Sonne leuchten über all diese Gerechten. Die Kinder bekamen prompt der Reihe nach Masern, Scharlach und Diphtherie und wurden alle ebenso prompt wieder gesund. Alle Jahre wurde ein neuer Jungenanzug und ein neues Mädchenkleid für die beiden Ältesten und Größten gekauft, während sämtliche andere Garnituren um einen Jahrgang nach unten rückten. So ist es kein Wunder, daß, je kleiner die Kinder waren, desto unvorteilhafter sie gekleidet erschienen und deshalb eifersüchtig auf ihre Vorderleute Obacht gaben, ob sie ihnen die nächstjährige Gewandung auch nicht allzu sehr ruinierten.
Der ewig Neue, Strahlende, Moderne, Feine, Ungeflickte aber war Gedeon, der Älteste, der Kronprinz aus dem Hause meines Onkels. Eigentlich hieß er nicht Gedeon sondern August, aber er hatte sich den biblischen Heldennamen aus eigener Machtvollkommenheit beigelegt, und es hätte ihm den Titel niemand streitig zu machen gewagt. Selbst Vater und Mutter und der alte Kantor, ja sogar der Briefträger und der Gendarm nannten ihn Gedeon.
Gedeon war unbestritten der Beherrscher sämtlicher dreißig Kinder; der Älteste des Krämers[135] war ein schwächlicher Knabe, der für die Herrschaft nicht in Betracht kam, und der Älteste vom Müller war von Gedeon besiegt und unterworfen, hörig gemacht worden.
Gedeon hatte eine so große Vorliebe für das Alte Testament, daß er nicht nur sich selbst, sondern auch jedem seiner Untertanen einen biblischen Namen beilegte.
Bei den Knaben spielten die Namen der Brüder Josephs und der kleinen Propheten eine große Rolle. Schwieriger war die Benennung der Mädchen. Eva, Rahel, Ruth, Sarah, Judith, Mirjam, Lea, Rebekka, alles war schon vorhanden; als daher des Müllers Jüngste, die im Kinderwagen saß und in sanfter Unschuld an einer Milchflasche sog, in das »Volk« aufgenommen werden sollte, kraute sich Gedeon, der Namengeber, verlegen hinter den Ohren und wußte keinen alttestamentlichen Mädchennamen mehr. Schließlich sagte er langsam: »Nun, vorläufig kann sie heißen: die makkabäische Mutter.«
Darauf erteilte er dem Neuling mit seinem hölzernen Schwerte den »Ritterschlag«, worauf die makkabäische Mutter die Milchflasche weglegte und erbärmlich zu schreien anfing.
In Ferientagen kam ich öfters in des Onkels Haus zu Besuch. Mein Vater behauptete zwar in einem schiefen Gleichnis, ich sei das elfte oder gar das einundreißigste Rad am Wagen, aber die Verwandten nahmen mich immer freundlich auf, ohne sich sonst weiter darum zu kümmern, was ich etwa äße oder tränke oder wo ich schliefe. Es kam vor, daß ich schon zwei oder drei Tage da war, ehe mich der Onkel bemerkte. Er hatte mich im Gewühl übersehen.
Als ich das erste Mal auftauchte, musterte mich Gedeon kritisch und unterzog mich einer Prüfung. Ich mußte über einen ziemlich hochgehaltenen Stock springen, was ich fertig brachte, dann befahl er mir, ohne Leiter auf eine Linde zu kriechen, was gänzlich mißlang. Auch die Aufgabe, der Länge nach über einen beladenen Düngerwagen wegzuspucken, erwies sich als zu schwer für mich. Zuletzt sollte ich dem bösen Kettenhunde den Saufnapf mit Wasser füllen, was ich eifrig ablehnte.
»Er kann nichts, und er hat Angst! Er ist ein Muttersöhnchen!« sagte Gedeon verächtlich und wandte mir den Rücken. Darauf wandten mir auch alle anderen den Rücken. Ich war ein Dummkopf; ich war ein Feigling. Ich hatte mich gesellschaftlich unmöglich gemacht. Nur die makkabäische Mutter nahm sich meiner ein wenig an,[137] indem sie mich ihren Breilöffel ablecken lassen wollte.

Zwei Tage lang litt ich als Unzünftiger, dann beschloß ich, durch eine Tat von außergewöhnlicher Intelligenz meine Schneidigkeit darzutun. Einen schlimmeren Schimpfnamen als »Muttersöhnchen« gibt es für einen Jungen nicht. Am liebsten hätte ich abgestritten, je eine Mutter gehabt zu haben.
Nun hatte ich von Hause eine alte Schnupftabakdose[138] mitgebracht, die ließ ich beim Krämer füllen. Im Kinderstaate ging alsbald die Mär von Mund zu Mund: »Er schnupft!« Das hörte auch der Autokrat Gedeon, und was ich gewollt hatte, geschah – er suchte mich auf. Ich probierte gerade, auf einer starken Wagendeichsel auf einem Beine zu stehen, und fiel auf die Erde, als ich des Gewaltigen ansichtig wurde. Da lächelte er wieder verächtlich und hüpfte einmal höhnisch auf einem Beine die ganze Deichsel entlang, setzte sich aber doch zuletzt zu mir auf die Erde.
»Was kannst du eigentlich?« fragte er kalt.
»Ich hab' in Geographie ›gut‹ und im Aufsatz ›genügend plus‹,« sagte ich beklommen.«
Ob dieser Schulweisheit machte er nur eine maßlos verachtungsvolle Gebärde mit der Hand. Ich sah ein, daß ich mich da wieder greulich philisterhaft benommen hatte.
Darauf legte er mir eine Reihe von Fragen vor: ob ich boxen, angeln, kopfstehen, radschlagen, Sechsundsechzig spielen oder wenigstens mit den Ohren wackeln könne.
Nein, ich konnte von alledem nichts.
Gedeon runzelte finster die Stirn. Nie war ein Prüfungskandidat in ärgeren Nöten als ich.
Da platzte ich heraus:
»Ich kann schnupfen!«
Er sah mich etwas freundlicher an.
»Wenn man richtig schnupfen kann, darf man nicht niesen hinterher,« sagte er.
»Nein, nein, das darf man nicht,« beeilte ich mich beizupflichten.
»Zeig' mir die Dose!« befahl er dann. Ich reichte ihm die Dose hin und bat ihn, eine Prise zu nehmen. Das tat er, und darauf blickten wir uns an. Ich sah, daß Gedeon feuerrot im Gesicht wurde, daß seine Nase hundert Runzeln zog, die Muskeln zuckten, sich die Lippen fest aufeinander preßten, die Augen tränten, sich das Gesicht verzerrte, die ganze Gestalt bebte, und dann – nahm ich eine Prise und platzte augenblicklich los und nieste siebzehnmal.
Als ich wieder geradestehen und keuchend Luft schöpfen konnte, stand Gedeon gelassen an die Wagendeichsel gelehnt und sagte:
»Du kannst nicht schnupfen! Ich habe nicht ein einziges Mal geniest!«
In diesem Augenblick fing ihm heftig an die Nase zu bluten.
Noch an demselben Tage wurde ich in das Volk aufgenommen. Ich war stolzer darauf als auf das beste Schulzeugnis, wenn ich auch gewünscht hätte, Gedeon hätte mir einen prächtigen und wohlklingenden Namen beigelegt. So aber hieß ich »Habakuk«.
Gedeon war ein Held, sein Kopf war immer voll kühner Pläne und eigener Gedanken. Gott weiß, was in ihm steckte: ein Napoleon oder ein Räuberhauptmann, ein grausamer Iwan oder ein Befreier wie Washington. Jedenfalls eine unbeugsame Herrennatur, ein Führer. Er irrte nie, er bat nie um Entschuldigung, er war nie unschlüssig, nie besorgt, alles Gelingen war ihm selbstverständlich, er nahm immer das beste und gab stets den Ausschlag. Holofernes, einer der Müllerjungen, versuchte einmal, eine Revolution gegen Gedeon anzuzetteln, gewissermaßen eine Art Konstitution einzuführen, dem Volke eine Mitregierung zu sichern. Die Folge war, daß ihn Gedeon sechs Stunden lang in einen leeren Schweinestall sperrte, worauf Holofernes und seine Sache der Lächerlichkeit verfielen.
Gedeons Taten sind unzählbar.
Einmal zur Herbstzeit befahl mir Gedeon, mit ihm beim geizigen Heinisch-Weber Pflaumen vom Baum zu stehlen. Vor dem Garten des Webers war der Fluß; Jenseits des Wassers stand des Webers Pflaumenbaum, diesseits an der Landstraße eine Linde. Wir erklommen also die Linde und rutschten auf einem Aste weit, weit hinaus bis über den Fluß. Ich hatte eine Todesangst vor einem Unglück, aber eine noch viel größere vor Gedeon. So ließ ich nichts merken und rutschte[142] mit. Gedeon zog einen Ast des Pflaumenbaumes über das Wasser, pflückte die verbotene Frucht und gab mir davon. Ich aß standhaft, immer mit Grausen hinunter auf den Strom blickend, und sagte dann schüchtern:

»Gedeon, ich glaube, die Pflaumen zu Hause in unserem Garten schmecken doch besser.«
Da spuckte er einen Pflaumenkern in den Strom und sagte:
»Habakuk, du bist ein Schafskopf!«
In diesem Augenblick kam der Weber mit einem Knüppel aus dem Hause gelaufen; ihm folgte seine Gattin mit einem Besen. Ich riet zu schleuniger Flucht, aber Gedeon hielt mich mit eiserner Hand fest. Inzwischen rannten die empörten Pflaumenbesitzer über eine Brücke, kamen die Straße herauf, langten an der Linde an.
»Wart', ihr Kanaillen, – kommt nur herunter – kommt nur herunter! Hier bleiben wir stehen, und wenn's bis übermorgen dauert.«
Wir waren belagert. Kein Entrinnen möglich. Wir waren auf Gnade und Ungnade der bewaffneten Macht da unten verfallen.
»Heinisch,« rief Gedeon mit ernsthafter Miene hinunter, »Heinisch, ich sage Ihnen, es ist ein Kunststück, auf einer Linde Pflaumen zu pflücken!«
Heinisch geriet ob dieser neuen Frechheit in neue Wut und schwor, uns beide mausetot zu schlagen, wenn wir nur herunterkämen.
»Ich werde gleich kommen!« sagte Gedeon, kletterte bis auf den untersten Ast und fixierte von da die Webersleute:
»Also: wenn ich bis drei gezählt habe, springe ich runter und spring einem von Euch gerade auf den Schädel! Eins, zwei, dr–ei!«
Kreischend wichen die Weberleute beiseite, Gedeon langte mit eleganter Kniebeuge auf der Straße an und begab sich in mäßiger Eile von dannen.
Ich aber, ich armer Habakuk, saß nun verlassen und einsam in meiner belagerten Baum- und Stromfeste. Meine Gedanken und Gefühle will ich nicht schildern, sondern bloß angeben, daß ich schon nach drei Minuten fest überzeugt war, meine Position ließ sich nicht länger halten. So klomm ich langsam bis auf den untersten Ast und sagte schüchtern:
»Ach, Herr Heinisch, sind Sie nur nicht böse, ich komm jetzt auch runter. Wenn ich bis auf drei gezählt hab', dann komme ich. Eins, zwei, drei!« Und dann rutschte ich langsam den Stamm hinab.
Was soll ich sagen? Ich wurde gefangen genommen und barbarisch behandelt. Als ich wieder[144] zu Gedeon kam, empfing er mich in höchster Ungnade. Auch er bekam ja sicher auf die Anzeige des Webers hin am nächsten Tage seine Prügel in der Schule. Das war ein unabwendbares Naturereignis. Was aber mir passiert war, das hielt Gedeon für ehrenrührig.
Gedeon übte über uns alle die volle Herrschaft aus; er war nicht nur unser König, er war auch der oberste Priester.
Seine geistliche Lieblingsbeschäftigung aber war das Eheschließen. Er hatte ein Gesetz aufgestellt, nach dem jede zehnjährige männliche und jede achtjährige weibliche Person seines Reiches ein Recht auf Verheiratung hatte. Dabei verfuhr er oft gewalttätig. Er bestimmte die Paare; er hatte seine eigene Frau Judith entlassen, weil sie ihm einen Riß im Jackenärmel so schlecht zugestopft hatte, daß die Mutter den Schaden bemerkte, er hatte diese Judith zwangsweise an des Krämers Nabuchodonosor verheiratet und diesem dafür die nadelfertige Esther abgenommen. Das Volk murrte zwar über solche Gewaltakte, aber zu einer Empörung kam es nicht.
Nun war wieder einmal die Osterzeit genaht,[145] und ich hatte mich am Gründonnerstag als Feriengast im Hause des Onkels eingefunden. Aber noch ein zweiter Fremdling war da, ein liebliches neunjähriges Mägdelein aus Breslau, eine Verwandte der Müllerleute.
Dieses Mägdelein war etwas unendlich Feines. Es hieß Hildegard und war nie schmutzig. Es sprach hochdeutsch und hatte immer ein Taschentuch bei sich. Es hatte Spitzen am Wochentagskleide und sagte »bitte« und »danke!«, ohne daß es sich schämte. Es klopfte bei fremden Leuten sogar erst an die Tür an, ehe es eintrat, und tat noch mehr solch unerhörte Dinge. Und sein Vater war Postschaffner, das war noch mehr als Briefträger. Ja, es war vorauszusehen, daß Hildegard nach einem Jahr in die höhere Töchterschule gehen und alle fremden Sprachen lernen würde.
Am ersten Tage zogen sich alle Kinder von dem fremden Mädchen zurück. Eine große Scheu ergriff das Volk. Da stand die schöne Fremde einsam und richtete die großen blauen Augen in die Ferne, nach der sie Heimweh hatte.
Die makkabäische Mutter brach den Bann. In ihrer dreijährigen Zudringlichkeit redete sie die Feine an, und nun kamen alle anderen Mädchen und bildeten einen Hofstaat um die Prinzessin, und nach und nach suchten sich auch die Jungen[146] durch Vorführung ihrer Kunststücke und Aufzeigen ihrer Reichtümer bei der »Neuen« in Gunst zu setzen. Nur Salmanassar beging eine Taktlosigkeit, indem er der Feinen als Geschenk einen alten Taschenkamm anbot, den sie ablehnte.
Gedeon allein hielt sich abseits. Er war schwer verwundert in diesen Tagen, daß neben ihm etwas auftauchen könne, das derart imponiere. Doch bald schüttelte er die Beklemmung von sich. Er versammelte das ganze Volk im Garten und führte alle seine Kunststücke vor, auch die Riesenwelle und sogar den Totensprung. Und ich bemerkte, daß er oft auf die Fremde sah, ob es ihr auch gefiele, ob sie auch staune. Die aber saß da mit ihrem stillen Gesichtchen, und am Schluß sagte sie nur:
»Ich habe einmal im Zirkus gesehen, daß eine Frau sich eine große Stange ganz frei auf die Brust setzte und ein Mann an der Stange hochkletterte und oben turnte. Und die Stange wurde nicht gehalten und fiel nicht um.«
Gedeon erbleichte. Aber dann sagte er: »O, das könnte ich auch, wenn ich nur eine Frau hätte, die sich die Stange auf die Brust stellt.«
Das Mädchen erzählte weiter vom Zirkus: viele abenteuerliche aufregende Dinge. Dann sagte sie, sie sei schon einmal im Theater und einmal sogar im Zoologischen Garten gewesen, erzählte[147] von Tänzerinnen und Bären, vom Aschenbrödel und vom Kamel, von schönen Engelein und drolligen Affen, vom Königssohn und vom Nilpferd.
Das erstemal in seinem Leben fand Gedeon keine Worte, stand stumm unter seinem Volk, fühlte sich übertrumpft, gedemütigt von diesem kleinen Mädchen. Das erstemal sah das Volk mit einer gewissen Mißachtung auf ihn, auf seine Kenntnisse, auf seine Künste. Minutenlang stand er so still da, nur sein Kopf färbte sich rot. Und plötzlich ging er auf das Mädchen zu, schüttelte es an den Schultern und sagte: »Du – du bist eine dumme Gans!« Und ging davon.
Eine Stunde später rief er abermals das Volk zusammen und sagte: »Wer noch einmal – noch ein einziges Mal mit der spricht, den stoß ich aus, und der darf nie mehr mit uns sein!«
So tat er die Fremde in die Acht.
Das Mädchen war einsam, aber auch Gedeon war einsam. Mit finsterem Gesicht aß er den Osterbraten, mit finsterem Gesicht trug er seinen neuen Anzug, nachdem er dreimal an der Fremden vorübergegangen war und sie kein Wort über seine Leibeszier gesagt hatte. Friedlos wanderte[148] Gedeon hin und her und landete immer und immer wieder in der Nähe des Mädchens. Selbst in der Nacht fand er keine Ruhe. Ich sah ihn einmal aufrecht in seinem Bette sitzen und hörte ihn mit sich selber sprechen. »Einen richtigen Feuerfresser hat sie gesehen? Einen Elefanten, der Trompete bläst? Ach, Unsinn!« Und warf sich um in sein Bett, saß aber bald wieder mit wachen Augen träumend da. Und sprach leise und schmerzlich zu sich: »Sie ist schöner als alle!« Und wieder nach einer Weile hörte ich etwas – was ich nicht für möglich gehalten hätte – hörte ich, daß Gedeon ingrimmig schluchzte.
Am nächsten Morgen erschien die Rebekka vom Müller und meldete, die Fremde wolle nach Hause. Es sei ihr bange, es gefalle ihr hier gar nicht. Gedeon geriet in große Erregung:
»Sie wird nicht fort – sie darf nicht fort – das werde ich ihr austreiben!«
Es war ein Wunder geschehen. Gedeon und die Fremde waren ausgesöhnt. Sie wanderten mit strahlenden Gesichtern durch den Garten, und Gedeon erweckte durch hundert Kunststücke im Herzen des Mädchens Liebe und Bewunderung. Am Nachmittag wurde sie in das »Volk«[149] aufgenommen. Wir waren alle gespannt, wie die Neue heißen würde, da doch der Vorrat an Mädchennamen erschöpft war. So machte es einen tiefen Eindruck auf uns, als Gedeon dem schönen Kinde sein hölzernes Schwert auf die Schulter legte und mit glücklicher, ja, mit triumphierender Stimme sagte:
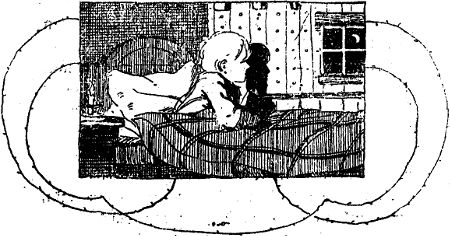
»Ich nehme dich auf in das Volk und nenne dich: die Königin von Saba.«
Holdselig lächelnd schaute das Mädchen zu dem Helden auf, und alles Volk neigte sich vor ihr.
Ein wenig später nahm mich Gedeon zur Seite und sagte:
»Ich werde die Königin von Saba heiraten!«
»Du hast doch schon die Esther!«
»Ach, die – schaff' ich ab. Ich muß die Königin von Saba zur Frau haben, ich muß! Und wer was dagegen sagt, der –« Er runzelte die Stirn. Ich aber fand es unerhört, erst eine Judith laufen zu lassen und dann auch noch einer Esther den Laufpaß zu geben.
»Was werden aber die andern dazu sagen?«
Er machte eine verächtliche Miene.
»Das ist egal! Die Esther wirst du heiraten oder der Zebulon.«
Ich muß sagen, es empörte sich etwas in mir. Diese abgelegte Esther zu übernehmen, dazu hatte ich gar keine Lust. Doch wagte ich natürlich nicht, heftig zu widersprechen, sondern sagte nur:
»Es wäre mir am liebsten, wenn ich vorläufig noch ledig bleiben könnte.«
Er besann sich ein wenig und sagte dann: »Ja, du kannst mich mit der Königin von Saba trauen, und der Zebulon nimmt die Esther.«
Die Gattenpflichten waren ja in diesem Volke sehr leicht. Sie bestanden darin, der Gesponsin beim Lumpenmann einen Ring zu kaufen, sie gegen ihre Feinde zu beschützen und beim Spiel ihr Partner zu sein. Immerhin tat mir Zebulon leid, denn Esther war drei Jahre älter als er und noch dazu seine Schwester. Das kann man nicht gerade eine vorteilhafte Partie nennen. Zebulon[152] weigerte sich auch, wurde aber von Gedeon durchgehauen und war dann zur Ehe bereit.

Mir fiel also das Amt zu, Gedeon und die Königin von Saba zu trauen. Es war eine saure Arbeit. Denn erstens waren mir die priesterlichen Gewänder, die sonst Gedeon trug, viel zu groß, und dann machte mir die Traurede viel Schmerzen. Es ist für einen Anfänger nicht leicht, gleich vor den Gewaltigen der Erde zu sprechen. Immerhin, ich nahm mich zusammen und stand würdevoll vor dem Altar, den Gedeon in einer großen Bodenkammer aufgebaut hatte. Der Hochzeitszug nahte. Die Braut trug einen wundervollen Schleier, den die Tante aufgesteckt hatte, Gedeon hielt effektvoll einen Zylinderhut in der Hand, den der Onkel geborgt hatte. Die andere Hochzeitsgesellschaft war weniger stilgerecht. Nabuchodonosor, der Trauzeuge war, hatte sich eine blaue Zuckerdüte auf den Kopf gesetzt, und die makkabäische Mutter, die als Brautjungfer fungierte, hatte sich den Gummilutscher mitgebracht. Einige Herren der Gesellschaft führten Säbel, Armbrust, Trommel oder Steckenpferd mit sich, und Ruben trieb mit seinem Bruder Lewy Allotria mit meiner Schnupftabakdose. Ganz aus der Art aber, war es, daß Salmanassar während der Trauung mit seinem Blaserohr nach dem Brautpaar Scheibe schoß.

Unter diesen Umständen ist es nicht leicht, eine ergreifende Predigt zu halten. Ich tat, was ich konnte.
»Geehrtes Brautpaar! Die Ehe stammt aus dem Paradiese. Da war Adam Bräutigam und Eva Braut.«
Hier blieb ich stecken. »Braut – Braut –« wiederholte ich einige Male mit einem fatalen Lächeln.
»Jawohl Braut!« sagte Salmanassar im Hintergrunde.
Ich machte ein hilfloses Gesicht und eine ohnmächtige Handbewegung. Gedeon, der Bräutigam, zog eine wütende Miene.
»Weiter – oder –«
Dieser Wüterich hätte sich sogar an der Geistlichkeit[154] vergriffen. Die Angst half mir. Allerhand fiel mir ein, was ich in Traureden gehört hatte.
»Geehrtes Brautpaar, das ist eine feierliche Stunde.«
»Der Salmanassar schießt mit'm Blaserohr,« kreischte mir Sarah dazwischen.
»Schmeißt ihn raus!« rief der Bräutigam, indem er sich umwandte. Salmanassar flog hinaus.
»Eine feierliche Stunde!« wiederholte ich. »Die Ehe ist schwer.«
»Mit der Königin von Saba ist sie nicht schwer!« grollte der Bräutigam.
»Nein, nein, mit der ist sie nicht schwer!« gab ich ohne weiteres zu und fuhr fort: »Ihr sollt alles miteinander tragen, Freude und Leid. Ihr sollt euch eure Schwächen verzeihen, denn jeder Mensch hat Schwächen. (Der Bräutigam schüttelte heftig den Kopf.) Wenn ihr krank seid, sollt ihr euch pflegen, und eure Kinder sollt ihr fromm erziehen. Amen.«
Der Bräutigam zuckte die Achseln. Ich merkte, er war nicht zufrieden. Die Braut aber sagte laut: »Das hat er schön gemacht«, und da hellte sich auch Gedeons Gesicht auf, und ich konnte erleichterten Herzens die Zeremonie zu Ende führen, was mir über Erwarten gut gelang.
Das Hochzeitsmahl war nicht schlecht. Die Tante kochte Schokolade für alle, und Gedeon[155] gab vier Zigarren zum Besten, die er um zehn Pfennig in der Stadt gekauft hatte. Zwei rauchte er selbst, eine bekam ich als Stolgebühren, und eine bekam Zebulon, der Zwangsmann der Esther, gewissermaßen als Trostpreis.
Gott weiß, was in ihm steckte, was Großes und Seltsames aus ihm geworden wäre, oder was Großes und Seltsames verdorben wäre in der Enge seiner äußeren Verhältnisse. Was ist ein Held unter Bauern, wenn es ihm bestimmt ist, auch ein armer Bauer zu werden, wenn rings auf eine edle Seele die Knechtschaft lauert?!
Und siehe, es wurde anders, als alle dachten.
Gedeon tat das Kühnste, was noch keiner aus dem Volke gewagt hatte, – er küßte seine Frau. Und alle die jungen Männlein und Weiblein sahen zu und lachten nicht einmal.
Auf der Wiese, die am Flusse lag, wurde das Hochzeitsfest begangen mit Spiel und Tanz. Gedeon hatte seiner Braut einen Schneeglöckchenstrauß geschenkt, den trug sie an der Brust. Ein großer, weißer Strohhut lag auf ihren blonden Haaren und seine blauen Schleifen flatterten im Winde.
Die Wiese war gelbgrün, die ersten Blättlein[156] standen an Baum und Strauch, der brausende Fluß sang sein rollendes Frühlingslied, hoch im Blauen war Lerchengesang.
Da streckte Gedeon seine starken Arme gen Himmel und fing laut und mächtig an zu schreien. Es war ein wilder, ein königlicher Schrei; Gedeon schrie vor Kraft und Glück.
Dann funkelten seine Augen, und er sagte zu seiner Braut:
»Paß auf, wenn ich zu den Soldaten geh, werde ich der alleroberste General. Oder ich geh auf die See!«
Nahm sie plötzlich und schwang sie im Kreise herum und schrie wieder laut dabei vor Kraft und Glück und Lebenslust.
Da löste sich dem Mädchen der Hut – der Wind nahm ihn – trieb ihn in den Fluß.
»Mein Hut! Mein Hut!«
»Ihr Hut, ihr schöner Hut!«
»Sei ruhig, ich hole ihn!« – – –
Dreißig Kinder standen am Ufer, als Gedeon in den Fluß sprang. Dreißig Kinder sahen freudig erregt zu, wie er dem Hut nachschwamm. Keines bangte um den Helden, dem alles gelang. Allen war es ein herrliches Schauspiel.
Seht, er hat den Hut, er hebt ihn triumphierend über das Wasser. Er schwimmt an den Rand, –[157] o, es hält schwer, – die Strömung ist stark – er ist in Kleidern – aber er ist der Gedeon. –
Halt, jetzt hat er den Erlenzweig! Seht, er schleudert den Hut ans Ufer. Da liegt er auf dem Erlenbusch.
Er hat gesiegt, er hat gewonnen, wie er immer gewinnt. O, Königin von Saba, was sind deine Zirkuskünstler gegen den! In lachendem Stolz steht das ganze Volk am Ufer.
Aber jetzt – jetzt bricht der Erlenzweig, an dem sich Gedeon emporziehen will, und er – er treibt nach der Mitte des Flusses zurück –
O, laßt ihn nur, laßt ihn nur, es ist ja der Gedeon! Paßt nur auf, paßt auf, was noch Großes kommt!
Da fängt ein Mädchen plötzlich an zu weinen und sagt:
»Das Wehr! Müllers Wehr ist so nahe!«
»Das Wehr! Das Wehr! Gedeon! Gedeon!«
Und plötzlich schreien und weinen dreißig Kinder.
Wir konnten es lange nicht fassen, daß Gedeon tot sein sollte. Einer von uns sagte:
»O, das läßt er sich nicht gefallen!«
Er ließ es sich aber doch gefallen, ließ sich tragen und in den weißen Sarg legen. Und hielt ganz still.
Es ging viel in diesem Sarg verloren. Verloren? O, jetzt glaube ich wohl: es wurde viel in diesem Sarg gerettet.
Verwundert, scheu, standen wir um den toten Gedeon. Er hatte ein Gesicht, wie immer, wenn er unzufrieden war. Er war unzufrieden mit sich selbst, unzufrieden, daß er sich vor uns allen und vor seiner Königin von Saba als kein besserer Schwimmer gezeigt hatte. Wir gingen die Tage behutsam, scheu, furchtsam wie Diener, wenn ein strenger Herr schläft.
Erst als der Sarg geschlossen wurde und Gedeon nicht dagegen tobte, sich nicht gegen den Deckel stemmte, sondern sich geduldig einnageln ließ, da fingen wir alle bitterlich an zu weinen.
Der Verlust wurde uns klar, wir erkannten, daß unser König gestorben war, daß wir ein verwaistes, führerloses Volk waren.

Die Szene spielt in einem Laubhaufen, der nahe einer Kirchhofmauer liegt. Durch die braunen und roten Blätter fällt von draußen Sonnenlicht wie durch tausend bunte Fenster. – In dem Laubhause wohnen: Der Käfer. – Die Fliege. – Die Schnecke. – Die Raupe. – Später kommt noch eine Spinne und zuletzt der Herbstwind dazu.
Käfer (träumerisch):
Nun wollen wir schlafen! Wie schön das rote Licht ist! Ich habe einmal in eine Schlafstube der Menschen gesehen, wo eine rote Ampel brannte. Das Licht war nicht schöner als dieses.
Fliege (mißmutig):
Dummer Junge, sei bloß still von den Menschen und den Lampen! Die Menschen fangen uns, und die Lampen verbrennen uns. (Zur Schnecke): Na, hab' ich da nicht sehr recht, Frau Nachbarin?
Schnecke (stolz):
Ich bin nicht Ihre Nachbarin! (Zur Raupe): Was meinen Sie, vergeben wir uns nicht etwas, wenn wir in demselben Lokal übernachten wie solches … Geschmeiß?
Raupe (seufzend):
Da haben Sie recht, gnädige Frau! Aber was[160] soll man machen? Es ist ja alles schon besetzt sonst! Das wenig saubere Bettzeug hier benutze ich ja bestimmt nicht. Ich puppe mich ein!
Schnecke:
Und ich zieh' mich in mein Privatzelt, das ich glücklicherweise immer bei mir habe, zurück und verschließe die Tür … das ist ja ganz klar!
Fliege (heimlich):
So 'ne hochmütige, dicke Schachtel!
Raupe:
Den Käfer find' ich aber sehr nett. Er sieht aus wie ein Prinz!
Schnecke (mit fauler Stimme):
Ich mache mir nichts aus Prinzen. Sie imponieren mir nicht! (Gähnt.) Ach, ich bin so abgespannt! Ich kann auf keinen Fall mehr umziehen, und wenn ich hier noch so geniert bin. Es ist ein rechter Jammer für eine Dame von Stande.
Raupe (mit Bezug auf die Fliege):
Sehen Sie doch, gnädige Frau, diese gewöhnliche Person sucht sich wirklich das allerschmutzigste Blatt zum Bette aus.
Schnecke:
Ah, sie widert mich an! Ich kann gar nicht sagen, wie ich in so ordinärer Umgebung leide. Und mich fröstelt auch etwas. Das Beste ist, ich ziehe mich zurück.

Raupe:
Wie lange gedenken gnädige Frau zu schlafen?
Schnecke (schmerzlich):
Ach, nur fünf bis sechs Monate. Dann rufen mich schon wieder meine Pflichten. Gute Nacht, liebes Fräulein!
Raupe (sehr höflich):
Gute Nacht, gnädige Frau!
(Die Schnecke zieht sich zurück in ihr Zelt.)
Käfer (traurig):
Es ist noch goldener Sonnenschein draußen! Aber es ist kalt! Und alle Rosen sind tot! Der Tau auf der Wiese ist weiß und hart, und mich friert. Ach, der Sommer ist weit!
(Die Raupe sieht immer begeistert nach dem Käfer. Draußen tönt von fern herein Singen. Im Laubhause ist's ganz still. Da kommt plötzlich an einem grauen Seile eine Spinne herabgeturnt.)
Fliege (aufkreischend):
Ein Teufel! Eine Hexe! Eine Spinne!
Käfer (bebend):
Eine Spinne! Das ist mein Tod! Ich bin verloren!
Raupe (aufgeregt):
Besetzt! Besetzt! Es ist schon alles besetzt hier!
Schnecke (zur Tür heraus):
Was ist denn los? Was ist denn das für ein Skandal?
Fliege (jammernd):
Lassen Sie mich ein! Lassen Sie mich in Ihr[163] Haus, liebste, gnädigste, herrlichste Frau Schnecke! Eine Spinne! Eine Spinne! O weh, o weh, o weh, o weh!
Spinne (mit lauter Stimme):
Ruhe, ihr feiges Gelichter! Ich freß Euch nicht! Ich bin viel zu satt. (Unheimlich.) Ich bin leider viel zu satt! Ich will hier bloß schlafen. Aber wer ausreißt, den ermurkse ich … jawohl, den ermurkse ich!
Schnecke (für sich):
Ein laß ich keinen! Ich bin ohnehin beengt genug. Seht ihr zu! (Sie verriegelt die Tür.)
Nun greift eine bedrückende Stille Platz. Man hört nur, wie die Spinne ihre feinen Fäden zieht und ihre Knoten knüpft, wie die Beinchen der Fliege zittern und der Käfer rascher atmet. Allgemach beruhigen sich die Tiere, da sie die Spinne nicht weiter beachtet. Draußen aber ist das Singen deutlicher geworden und klingt jetzt ganz nahe vom Kirchhof her.
Raupe (in staunender Frage):
Ein Kindlein ist gestorben?
Käfer (schmerzlich):
Ein süßes Menschenkindlein! Ich habe mit seinen weißen Fingern gespielt und bin einmal[164] über seinen goldenen Scheitel gewandert. Und das starb vor drei Tagen, und das ist nun tot!
Fliege (leichthin):
Es wird schlafen wie wir, und im Frühling wird es wieder aufwachen.
Käfer:
Es schläft wohl länger … es schläft viel länger!
Es entsteht eine lange Pause. Unterdes hat sich die Spinne ganz eingehüllt. Im Einschlafen summt sie:
Fliege (heimlich zu Raupe und Käfer):
Habt ihr's gehört? Habt ihr's gehört? Wenn sie aufwacht, frißt sie uns zum Frühstück!
Raupe:
Ich bin eher munter als sie und längst davon, wenn sie aufwacht. Ich werde Sie wecken, schöner Prinz!
Käfer (nickt freundlich)
Fliege (bettelnd):
Aber mich auch, mich auch, schönstes, bestes Fräulein Raupe! O bitte, bitte, werden Sie mich auch wecken, noch zur rechten Zeit wecken? Ich bin so langschläfrig!
Raupe:
Nur keine Sorge! Ich werde Sie auch wecken.
Fliege (erleichtert):
O, ich danke schön! O, dann ist alles gut, dann kann ich ruhig schlafen! … Ach, ist das schön in meinem verfaulten Bettlein! Ich wollte, mir träumte von einem großen Düngerhaufen und von lauter Milch und Zucker! (Halb im Einschlafen): Und vergessen Sie nur das Wecken nicht, Fräuleinchen! (Fliege schläft ein.)
Raupe (schüchtern zum Käfer):
Kennen Sie mich nicht, Herr Prinz?
Käfer:
Ich kenne dich nicht, aber du bist schön!
Raupe (freudig):
Sie finden mich schön! Die Menschen sagen, ich sei häßlich.
Käfer:
Das ist nicht wahr! Du hast ein goldenes Kleid und grünseidene Haare … Du bist schön!
Raupe (mit funkelnden Augen):
Und übers Jahr bin ich ein Falter und kann fliegen wie Sie, mein Prinz!
Käfer:
Du wirst ein Falter? Einer mit Sammetflügeln und Diamantsteinen? So ein lichter Himmelsvogel wirst du? O, dann treffen wir uns wieder bei den Lilien und Rosen!
Raupe (begeistert):
Und fliegen und trinken Honigwein und tanzen und leuchten ohne Ende!
Käfer:
Ohne Ende!
Raupe:
Und nun schlafen Sie wohl, mein Prinz!
Käfer:
Wohin willst du?
Raupe:
Einen häßlichen Arbeitskittel muß ich jetzt anziehen, indes ich mein Hochzeitskleid spinne. Häßlich dürfen Sie mich nicht sehen, Herr Prinz! Auf Wiedersehen bei den Lilien und Rosen … mein schöner Prinz! (Sie verkriecht sich tief in einen Winkel des Laubhauses.)
Käfer:
Nun bin ich allein! Nun will ich auch schlafen! Ich wollte, mir träumte von dem jungen Menschenkinde, und ich wollte, es lebte und lachte. Oder ich träumte von dem jungen Falter und den Rosen. (Er legt sich auf ein goldenes Bettlein und schläft.)
Lange Pause. Dem feinsten Ohre nur ist ganz leises Atmen vernehmbar. Da kommt als getreuer Hausmeister der Herbstwind. Vorsichtig schlürft er leise durch die stillen Gänge des Laubhauses und horcht an allen Kammertüren. Wie er sich überzeugt hat, daß alles schläft, schleicht er zurück und schiebt draußen an den Blättern, wie an Türen und Fensterläden, bis das letzte Fensterlein verschlossen, die letzte Tür verriegelt ist.
Ich ging nicht in die Schule – ich ritt! Ich konnte mir das leisten, denn ich hatte ein Roß, das nicht rechnen konnte. Wenigstens kam es nie hinter die verzwickten Schliche der indirekten Regeldetri. Bei »zehnstündiger Arbeitszeit« arbeiteten nach Meinung meines Rosses die bekannten »sechs Arbeiter« an dem bekannten »Graben« immer zehnmal so lange als bei einstündiger.
Dieses Roß hieß Reinhold Sander, war zwei Jahre älter und zwanzigmal so stark als ich und im übrigen der gutmütigste Schuljunge von der Welt. Jeden Morgen erschien mein Roß in meiner großväterlichen Wohnung, stopfte sich schnell einen Apfel oder was etwa sonst Genießbares auf dem Fensterbrett lag, in die Hosentaschen, setzte mich auf seine Schultern und trabte mit mir zur Schule, wo es mich auf meinem Platz sänftiglich absetzte.
Dafür machte ich meinem Rößlein in der Rechenstunde die tadellosesten »Bruchansätze«.
Eines schönen Maimorgens ritt ich nun gerade zur Schule, stolz wie Darius zur Schlacht, als uns ein Mann begegnete, den sowohl mein Roß als ich nach dem ersten prüfenden Blicke als einen »Stadtklecker« einschätzten. Als »Stadtklecker« galt damals in meinem Feld-, Strauch- und Wiesendorfe ohne weiteres jeder städtisch gekleidete Mensch, der sich in seiner Gemarkung blicken ließ.
»Nanu, nanu,« machte der Fremdling verwundert und musterte uns, »wo geht die Reise hin?«
»In die Schule!« sagte ich und fuchtelte siegesgewiß mit meinem breiten Lineal wie mit einem Kriegsschwert.
»Aber Junge, warum gehst du denn nicht zu Fuß? Kannst du denn nicht laufen?«
»Besser wie Sie!« sagte ich frech. Der Fremdling erzürnte sich und schnauzte mein Roß an:
»Wirf doch den Bengel ab! Wirst dich doch nicht mit ihm abrackern!«
Mein Roß schüttelte die Mähne und stieß Dampf aus den Nüstern. Dann sagte es:
»Er läßt mich die Regeldetri-Aufgaben abschreiben, und überhaupt geht Sie das 'n Quark an.«
Nun raste der fremde Wandersmann und wollte mit seinem dünnen Spazierstock meinem Roß eins[169] auf den sogenannten Bug geben. Das aber schlug nach hinten aus, schlug in eine Pfütze, bespritzte den Fremden von oben bis unten und setzte sich in Galopp mit mir.

Als wir ein Stück davon waren, sang ich mit[170] lieblicher, heller Stimme: »Stadtklecker! Stadtklecker!« und mein Roß wieherte und wieherte deutlich auf den Text »Stadtklecker! Stadtklecker!«
An diesem Tage aber hatten wir in der ersten Stunde biblische Geschichte. Da ich zu Hause vergessen hatte, die »Bibel« zu lernen, wollte ich auf den Vorzug, sie vortragen zu dürfen, lieber verzichten und bat daher gleich nach Anfang der Stunde den Lehrer, »mal austreten« zu dürfen. Er brummte etwas von »ewigem Gelaufe« und ließ mich ziehen. Darauf trat ich dreiviertel Stunden lang »aus«. Als ich vermutete, daß die biblische Gefahr vorüber sei, näherte ich mich wieder behutsam der Schulstubentür und hörte da folgenden Meinungsaustausch.
»Es heißt nicht Frau Putiphar, es heißt Frau Potiphar!«
»Herr Schulinspektor!« hörte ich unseren Lehrer bescheiden einwenden, »bei uns in der katholischen Bibel schreibt sich die Frau mit u.«
Mir aber wurde plötzlich an der Schulstubentüre so beklommen zumute, daß ich meinte, jetzt müsse ich wirklich mal austreten. Also verschwand ich noch auf fünf Minuten nach dem Hofe, dann aber trieb mich mein Pflichtgefühl und eine düstere Ahnung nach dem Klassenlokal.
Heiliger Himmel, der plötzlich anwesende Kreisschulinspektor[171] war tatsächlich unser »Stadtklecker«. Kaum erblickte er mich, so machte er auch schon den Finger krumm, winkte und sagte: »Komm mal her, du Schwede!«
»Wo warst du denn bist jetzt?« herrschte er mich an.
Ich sagte, ich sei nur schnell mal austreten gewesen.
»Schnell mal austreten – so! Du Range! Und über eine halbe Stunde bin ich schon hier. Wo warst du so lange, Schlingel – he?!«
Ich stotterte etwas von einer unheimlichen Bauchkrankheit, die ich hätte; er aber ergriff mich an den Ohren und begann in höchst lästiger und fataler Weise daran herumzuschrauben. Trotzdem hörte ich, wie mein Roß leise und zornig aufschnaubte, denn mein Roß liebte mich. Ich bekam noch eine ungewisse Anzahl von Ohrfeigen und konnte mich dann setzen.
Der Herr Schulinspektor hielt nun eine donnernde Strafrede über die Roheit von Dorfkindern Fremden gegenüber, was ich mit äußerer Zerknirschung und innerer Gleichgültigkeit anhörte.
Am Schlusse sagte er: »Der kleine Bengel dort ist zu faul, um in die Schule zu laufen; er reitet auf diesem langen starken Labander und läßt ihn dafür die Rechenaufgaben abschreiben.«
Ein vernichtender Blick traf unseren herzensguten Lehrer.
»Herr Schulinspektor, der Reinhold Sander ist einer meiner schwächsten Rechner, aber sonst ein guter Junge.«
Das alles galt nichts.
»Sander, komm mal raus an die Wandtafel. Nimm die Kreide und schreibe auf:
6 Arbeiter arbeiten über einem Graben von 175 m Länge, 1½ m Breite und ¾ m Tiefe 18 Tage bei täglich zehnstündiger Arbeitszeit. Wie lange arbeiten 25 Arbeiter an einem Graben von 300 m Länge, 1½ m Breite und ½ m Tiefe, wenn sie täglich nur 8 Stunden tätig sind?«
O, du armes Roß! Ich sah, wie seine Mähne sich sträubte, wie schwerer Atem durch seine Nüstern drang und seine Läufe zitterten.
Aber der Herr Kreisschulinspektor hatte seine Rechnung ohne den Telegraphen gemacht. Nämlich, wenn mein Roß an die Wandtafel gerufen wurde, galt folgende Telegraphie:
Ich setze meinen Schieferstift scharf wie zu einem Punkt auf die Schiefertafel (heißt: Reinhold, dieses »Glied« mußt du über den Bruchstrich setzen).
Ich mache einen quietschend langen Strich (heißt: das kommt unter den Bruchstrich).
Einmal Hüsteln heißt: jetzt mußt du »kürzen«.
Zweimal Hüsteln heißt: es läßt sich noch weiter »kürzen«.
Schneuzen bedeutet: die Sache ist falsch.
Kurzes Scharren bedeutet beifälliges »alles richtig!«
Das Wunder geschah: Reinhold Sander rechnete die schwere Aufgabe völlig richtig. Als der Herr Schulinspektor, der inzwischen weiter geprüft hatte, an der Tafel das richtige Resultat sah, war er verwundert und sagte zum Lehrer: »Aber, der Kerl kann ja rechnen!«
»Einer meiner schwächsten Rechner, aber sonst –«
»Schon gut, ich sehe, das Rechnen klappt!«
Und er machte für den Lehrer eine gute Note ins Protokoll. Die Stimmung des Schulgewaltigen schlug überhaupt sichtlich zum Besseren um und ehe er um ½11 ging, schraubte er mein Roß und mich nur noch einmal ganz leise und zärtlich an den Ohren und schied dann in Gnaden.
Als um 12 Uhr die Schule aus war, bestieg ich mein Roß und ritt als ein Sieger heimwärts. Die kleinen Blessuren, die ich erlitten hatte, taten meinem Triumph keinen Eintrag. Ich streichelte mein treues Roß, und als wir ein Stück das Dorf hinauf waren, sangen wir in der Freude unseres Herzens gemeinsam: »Stadtklecker! Stadtklecker!«
Auf einmal – wie wenn wir den Rübezahl gerufen[174] hätten und der fürchterliche Berggeist plötzlich vor uns stünde, tauchte der Schulinspektor aus einem Seitengäßchen auf. Wir hatten geglaubt, der Mann sei längst nach der Stadt zurück, und nun war er noch in der evangelischen Schule gewesen und noch im Dorf.
Den bösen Geist sehen und vom Pferde fallen war eins. Der Herr Schulinspektor tobte. Da aber viele Feldarbeiter vorbeigingen und schmunzelten, fühlte er, daß er keine günstige Rolle spiele, wenn er sich mit uns beiden in einen Straßenkampf einließe, und herrschte uns also an:
»Marsch nach der Schule zurück! Dort werdet ihr dem Herrn Lehrer sagen, was ihr getan habt. Er wird euch augenblicklich bestrafen. Ich gehe jetzt hier ins Wirtshaus, um meine Sachen zu holen. In einer Viertelstunde seid ihr vor dem Gasthaus. Wehe euch, wenn ihr meinen Befehl nicht ausführt!«
Wir gingen nach der Schule zurück. Ja, ich muß es eingestehen, ich ging zu Fuß. Heimlich schlichen wir nach der Schulstube. Die war ganz leer. Aber der Lehrer bemerkte uns bald.
»Was wollt ihr denn noch?«
Da stotterte ich, ich hätte mein Lineal vergessen. Das Lineal war das wichtigste aller meiner Schulutensilien, denn erstens brauchte ich es als Waffe und zweitens fürs Freihandzeichnen.
»Geht nur nach Hause!« sagte der Lehrer.
Da glaubte ich, wir sollten ihm gehorchen und ihm weiter keinen Kummer machen, und wir gingen. Meinem Roß war dabei nicht ganz wohl. Aber draußen belehrte ich es über meinen Feldzugsplan, und wir gingen also zum Gasthaus, vor dessen Tür wir ein jämmerliches Geheul anfingen. Ich weinte bitterlich, und mein Roß strich sich fortwährend mit seinen Vorderhufen den Bug.
Der Herr Schulinspektor kam erschreckt herausgestürzt.
»Na, heult nicht so! Ihr macht mir ja das ganze Dorf rebellisch. Der Lehrer hat euch wohl etwas zu stark gezüchtigt?«
Wir heulten noch lauter.
»Jungens, seid still! Daß er euch so stark bestrafe, wollte ich ja nicht. Na, hört doch schon auf mit eurem Geheule! Es sind doch Leute im Gasthaus. Was sollen die sich denn denken?«
Mein Roß schrie förmlich.
Dem Schulinspektor war die Sache furchtbar peinlich; denn er hatte sein Amt erst angetreten und wollte nicht in den Ruf eines Kinderquälers kommen.
Da schenkte er uns 10 Pfennige, sagte, wir seien ja sonst nette Kinder, auch fleißig in der Schule, hätten ihm Freude gemacht; da sollten[176] wir also in Zukunft ein höflicheres Straßenbenehmen an den Tag legen, jetzt sofort ruhig nach Hause gehen und uns für die 10 Pfennige was kaufen.
Die 10 Pfennige nahm das Roß in Verwaltung und kaufte am Nachmittag drei Zigarren dafür. Jeder rauchte eine, die dritte rauchten wir zusammen. Wir saßen dabei auf unserem Windmühlberg, sahen nach der Kreisstadt hinüber und sangen aus vollen Lungen: »Stadtklecker! – Stadtklecker!«

Drei ehrbare Handwerker aus dem Riesengebirge, ein Schuster, ein Schneider und ein Hutmacher, beschlossen eines Tages, Räuber zu werden; denn ach, ihre Geschäfte gingen schlecht! Machte der Schuster ein Paar Stiefel, so kam sein Kunde nach ein oder zwei Tagen angehinkt, schimpfte, daß ihm alle Zehen zerquetscht und die Fersen zerrieben seien, schlug dem Meister die Stiefel um den Kopf und verlangte sein Geld zurück. Nähte der Schneider mit Sorgfalt und viel Geschicklichkeit einen Anzug, so wies ihm sein Kunde bei der Ablieferung mit rauhen Worten nach, daß das eine Hosenbein weit wie ein Mehlsack, das andere eng wie ein Pfeifenrohr sei, und daß der Rock hinten zwei Buckel mache, wie das Fell eines Trampeltiers. Maß der Hutmacher einem ein recht fesch Hütlein an, so saß es ihm am Ende auf dem Wirbel wie eine Hanswurstkappe oder fiel ihm in die Stirn bis über die Spitze des Kinnbartes herab.
So sagten eines Tages die drei Meister zueinander: »Das Handwerk hat keinen goldenen Boden mehr. Man kann tun, was man will, das Publikum ist nicht zufrieden. Es gibt nichts als Zank und Streit. Wir wollen uns also nach einer friedfertigeren Beschäftigung umsehen.«
Darauf beschlossen sie, Räuber zu werden, und meinten, dabei ihr gutes Auskommen zu haben. Sie wuschen sich nun sechs Wochen lang nicht mehr, kämmten ihr Haar nicht mehr und zogen ihre ältesten Kleider an. Darauf nahmen sie von ihren Freunden Abschied, sagten, sie möchten sie nur in gutem Andenken behalten, zogen in den Wald und wurden Räuber.
Zwei Tage und zwei Nächte saßen sie unter dunklen Bäumen und lauerten, ob jemand des Weges daherkommen würde. Es kam aber niemand, und die Räuber froren und langweilten sich. Zum Glück hatten ihnen ihre Freunde Essen und Trinken mitgegeben, sonst hätten die armen Kerle Not leiden müssen.
Am zweiten Tage gegen Abend meldete der Schneider, der als Kundschafter ausgeschickt worden war: es ziehe ein starker Mann daher. Er sei groß wie ein Riese und habe einen Knüppel in der Hand. Man könne nicht wissen, was er im Schilde führe.

Da versteckten sich die drei Räuber hinter die[180] Brombeerhecken und atmeten auf, als der starke Kerl vorbei war. Der Hutmacher aber, welcher der Klügste von ihnen war, sprach:
»Auf diese Weise werden wir auch keine guten Geschäfte machen!« Und er hielt eine Rede, und alle drei beschlossen, den nächsten Wandersmann zu überfallen, sei es auch, wer es sei.
Wie nun der Morgen in hellgoldener Pracht über den Bergen aufging, kam der Schuster angerannt und sagte: ein einzelner Reiter komme den Talweg herauf. Es sei wohl ein reicher Ritter, denn er habe eine Feder auf dem Hut und trage ein seidenes Wams. Er sei schon ganz nahe. Das Schlimme sei nur, daß er ein Schwert an der Seite trage; man könne also nicht wissen, was er im Schilde führe.
»Schwert oder nicht Schwert,« brüllte der Hutmacher so mutig, zornig und laut, daß die Luft dröhnte; »wir müssen ihm am Kreuzweg auflauern und ihm seine Habe abnehmen. Der Schneider wirft dem Pferde eine Schlinge um den Hals, der Schuster zieht den Ritter vom Roß herunter, und ich packe ihn dann von hinten!«
In diesem Augenblick wieherte ein Pferd, und die drei Räuber rannten so schnell als möglich nach dem nahen Kreuzweg. Als nun der Ritter[181] ankam, sprangen sie ihm mit einem fürchterlichen Geschrei entgegen.
Und was nun kam, geschah alles blitzschnell. Der Ritter entriß dem Schuster die Schlinge und warf sie ihm selbst um den Hals, er zog den Schneider zu sich aufs Roß hinauf und packte den Hutmacher von hinten am Halswirbel. Darauf stieg er gelassen vom Roß herab, nahm auch den Schuster mit hinunter und legte alle drei Räuber sacht, aber bestimmt auf die Erde, mit den Nasen in den aufgeweichten Boden hinein. Dann befahl er ihnen, nur recht still zu liegen, da sie ja nicht wissen könnten, was er im Schilde führe, räumte ihnen die Taschen aus, was sie da noch an Wurst, Speck und Tabak hatten, zählte jedem mit der flachen Klinge seines biegsamen Degens zwanzig ansehnliche Streiche auf den Hosenboden, stieg dann wieder zu Roß und ritt langsam davon, indem er mit fröhlicher Stimme sang:
Als der Ritter um die nächste Waldecke verschwunden war, hob der Hutmacher die Nase aus dem Schlamm, nieste kräftig und sagte:
»Unser Anschlag ist fehlgegangen!«
Nun erhoben sich auch die beiden anderen,[182] gaben dem Hutmacher recht und waren allesamt äußerst betroffen.
»Wir werden uns nach einem friedfertigeren Gewerbe umsehen müssen,« klagte der Schuster. Sie wußten aber keines, denn es waren kümmerliche Zeitläufte.
So saßen sie am Kreuzwege und fingen schließlich alle drei an bitterlich zu weinen.
Plötzlich fuhren sie zusammen, denn es kam ein Mann gegangen.
»Der Ritter!« schrie der Schneider und wollte entfliehen. Doch der Fremdling war schon da. Er führte das Roß des Ritters am Zügel und trug seine Kleider und Waffen; aber es war der Ritter nicht.
Der Fremde machte erstaunte Augen, als er die drei sitzen sah, und fragte:
»Was sitzt ihr drei armen alten Frauen hier und weinet?«
»Wir sind keine alten Frauen,« schluchzte der Schuster, »wir sind Männer. Junge Männer!«
»I der Dauz,« rief der Fremdling erstaunt, »junge Männer seid ihr! Wer hätte das gedacht! Aber sagt mir, warum weinet ihr?«
»Weil es uns so schlecht geht,« heulte der Schneider.
»Schlecht geht? Wieso? Wie kann es einem jungen Mann schlecht gehen? Sehet mich an! Ich bin ein Räuber. Mir geht es gut. Werdet auch Räuber, und es wird auch euch gut gehen!«
»Wir sind ja Räuber!« sagte der Hutmacher kleinlaut.
Da lachte der Fremde so laut, daß sich das Roß aufbäumte und dem Schneider einen Tritt auf die Schulter gab.
»Ach, ihr seid Räuber? O, welch ein Spaß! Welch eine Überraschung! Warum aber habt ihr euch alsdann den reichen Rittersmann entgehen lassen, der vor einer Stunde hier vorbeizog? Seht mich an; ich bin ein einzelner Mann und habe dem Ritter alles abgenommen, was er besaß.«
Der Schneider log, sie hätten den Ritter leider nicht gesehen; sonst hätten sie ihn schon ordentlich ausgeraubt, denn sie seien tapfere Leute, und von alten Weibern sei keine Rede.
»Nun,« sagte der Fremde, »wenn ihr meine Kollegen seid, so sollt ihr wenigstens mit mir frühstücken.«
Er packte nun die Wurst und den Speck aus, den der Ritter vordem den dreien abgenommen hatte, und lud zum Mahle ein. Der Fremde aß aber fast alles selbst, und dem Schneider, dem Schuster und dem Hutmacher blieb nicht viel mehr[184] als von der Wurst die Haut und von dem Speck die Schwarte. Die lagen ihnen schwer im Magen.
Während des Frühstücks erzählte der Fremde, er heiße Wolfsklaue und habe in den italienischen Abruzzen, im ungarischen Bakonywald und im Böhmerwald seine Studien gemacht. Neulich habe er sein Meisterstück gemacht, und nun wolle er hier im Riesengebirge das Räubergewerbe auf eigene Faust betreiben. Wenn es den dreien recht sei, sollten sie in seine Dienste treten; er nehme nicht mehr als die Hälfte der Beute für sich; die andere Hälfte solle den dreien überlassen sein.
Da schlugen sie ein und wurden fröhlich.
»Kameraden,« sagte nun Wolfsklaue, »wenn wir rechte Räuber sein wollen, genügt es nicht, daß wir hier am Kreuzweg sitzen und heulen oder Wurst und Speck essen, sondern wir müssen auf Taten ausgehen.«
O, da stimmten die drei anderen bei. Jahrelang, sagten sie, sehnten sie sich schon danach, mal etwas Ordentliches zu tun zu bekommen. Taten! Das sei so etwas für sie!
»Gut,« sagte Wolfsklaue, »hört mich also an. Weit im Gebirge drin wohnt ein Müller, der ist so steinreich, daß er sich alle Tage mit Seife wäscht[185] und seine Kühe mit Apfelsinen füttert. Den wollen wir ausrauben.«
»Den wollen wir!« stimmten die drei freudig bei.
»Ja, aber die Sache ist nicht so leicht. Der Müller ist ein starker Kerl und hat vier Knechte; auch sind er und seine Leute wohlbewaffnet mit Dolchen, Pistolen und Totschlägern. Überdies hat er zwei Bluthunde.«
»Muß es nun grade der Müller sein?« fragte der Schneider.
»Jawohl. Denkt doch an sein vieles Geld. Die Sache bedarf nur der nötigen Schlauheit. Hört mich an! Ich stecke euch in Getreidesäcke und verkaufe euch dem Müller als Korn und Gerste. Er schafft euch in seine Mühle. In der Nacht schlüpft ihr aus den Säcken heraus, öffnet mir die Tür, und alles andere laßt ihr mich besorgen. Ich habe nicht umsonst in Böhmen mein Meisterstück gemacht.«
Auf diesen Plan gingen die drei ein, und am nächsten Morgen schon standen der Schuster, der Schneider und der Hutmacher als Säcke auf dem Getreidemarkt in Hirschberg.
Es war ein warmer Tag und viel Volk beisammen. Damit nun die Säcke nicht um die Gestalten schlotterten, waren sie mit Heu ausgestopft.
»Ich schwitz mich tot,« sagte der Hutmacher in seinem Sack.
»Mensch, halt dein Maul,« knirschte Wolfsklaue, »oder du verrätst uns. Schwitze im stillen!«
Nun kam ein Hund gegangen, schnubberte an dem Sacke, in dem der Schneider steckte, und fing ein wütendes Gebell an. Der Schneider erbebte; er erkannte den Hund an der Stimme; oft genug hatte er dem Köter früher einen Fußtritt gegeben. Jetzt mußte er es sich gefallen lassen, daß der Hund sich wie rasend in den Sack verbiß und ihn umriß. Alles Volk lachte.
Eine Stunde später kam der Ratspolizist. Er hatte im Auftrage der hohen Obrigkeit einzelne Säcke zu öffnen und zu prüfen, ob sie auch gutes, gesundes Korn enthielten.
»Wir sind verloren,« dachte der Schuster, als der Polizist gerade den Sack öffnete, in dem er steckte.
Zum Glück war der Polizist sehr kurzsichtig. Als er nun die Nase tief in den Sack steckte und des Schusters strohgelben Schädel sah, sagte er befriedigt:
»Ich habe lange kein Korn von so schöner goldener Farbe gesehen.«
Und er band den Sack wieder zu. Der reiche Müller, der in der Nähe stand, hatte das lobende Urteil gehört, und da die Säcke groß und prall[187] waren, kaufte er sie um einen guten Preis und ließ sie auf seinen Wagen laden.
»Das war Zeit,« seufzte der Schneider; »ich habe schon das Zittern in den Beinen!«
»Ich schwitz mich tot!« stöhnte der Hutmacher.
»Ich schwitze so,« sagte der Schuster, »daß der Schweiß sicher schon durch den Sack dringt. Es ist wenigstens gut, daß wir jetzt liegen!«
Nun kam der Müller, befühlte die Säcke und sagte: »Oho, sie sind ja feucht! Wenn ich nur kein dämpfiges Korn gekauft habe. Es scheint bei der Ernte nicht ordentlich ausgetrocknet zu sein. Peter, lade das andere Korn auf und laß uns heimfahren!«
Der Knecht lud nun noch etwa zehn Säcke auf und warf sie mit Wucht auf die drei Räuber, welche angstvoll ihr letztes Stündlein gekommen glaubten. Sie seufzten, stöhnten, ja schrieen zuweilen, und es war nur gut, daß der Wagen, der sich in Bewegung gesetzt hatte, so laut knarrte, daß von den Angstrufen nichts zu hören war.
Der Weg von Hirschberg bis zur Mühle betrug sechs Stunden. Es war eine so schreckliche Fahrt, daß der Schuster bei sich meinte, fast sei es weniger arg, ein Paar Stiefel zu machen, als ein solch heißes und drückendes Abenteuer zu erleben. Und die beiden anderen hatten ähnlich düstere Gedanken.
Endlich ging auch dieser Schmerzensweg zu Ende. Der Wagen hielt; die Säcke wurden abgeladen. Steif standen die drei Räuber, ohne sich zu rühren. So zerschlagen und zerschwitzt sie sich fühlten, freuten sie sich doch, daß bis jetzt alles glatt abgelaufen war, und hofften auf gute Beute und auf die Zufriedenheit ihres Herrn und Meisters Wolfsklaue.
Ach, es kam anders.
»Hm! Dieses Korn scheint wirklich ganz dämpfig zu sein,« sagte der Müller; »sieh mal, Peter, die Säcke sind naß, wie wenn sie aus dem Wasser gezogen wären. Da bin ich betrogen worden. Am besten ist es, wir schaffen das Zeug bald weg. Schütte es augenblicklich in die große Schrotmühle; wir machen Schweinefutter daraus!«
Wie der Schneider etwas von der Schrotmühle und vom Schweinefutter hörte, schrie er laut auf vor Angst, warf sich um und rollte durch den Hof. Von den anderen beiden Säcken begann der eine zu hüpfen, der andere um Hilfe zu schreien. Der Peter schrie, der Müller schrie, die anderen Knechte kamen gesprungen und schrieen, die Bluthunde heulten, und es ward ein großer Lärm.
Das Ende vom Liede war, daß die Säcke geöffnet und die drei Räuber herausgezogen wurden.[189] Triefend von Schweiß, mit angstverzerrten Gesichtern und schlotternden Beinen standen sie da, und als einer der Knechte rief:

»Die haben sich einschleichen wollen; das sind Räuber!« ging ein toller Lärm an. Der Schuster, der Schneider und der Hutmacher bekamen so viel Prügel, wie nie drei Räuber oder sonstige schlichte Bürger Prügel bekommen haben. Halb[190] totgeschlagen wurden sie endlich zum Tore hinausgeworfen. Dort blieben sie anfangs wie betäubt liegen; dann krochen sie, hinkten sie, schleppten sie sich in den Wald hinein.
Dort trafen sie Wolfsklaue.
Als er hörte, was vorgefallen war, sprach er ihnen erst sein Bedauern aus, dann hieb er sie noch einmal durch, indem er sagte:
»Ein richtiger Räuber darf nicht zucken und mucken, auch wenn er zu Schweinefutter gemahlen werden soll.«
Wochenlang kühlten sich die Räuber ihre brennenden Gebeine. Sie lagerten sich ins weiche Moos und legten sich gegenseitig Salben und kühlende Kräuter auf. Wolfsklaue erschien nur alle drei Tage bei ihnen, brachte ihnen einige Stücke harten Brotes, das sie sich im Wasser des Baches aufweichen mußten, und tat sich selbst bei Braten und Wein lecker. Manchmal erzählte er von seinen Taten; Schlösser hatte er ausgeraubt, reisende Kaufleute überfallen und andere einträgliche Geschäfte gemacht. So strotzten seine Finger von funkelnden Ringen; er hatte in jeder der sechs Taschen seiner rotseidenen Weste eine Uhr stecken und eine Kette daran und trug in jeder Hand zwei Spazierstöcke mit silbernen Knäufen.[191] Jedesmal kam er auf einem anderen Roß angeritten, die immer aus Arabien stammten; die gestickten Decken waren aus Persien, das Lederzeug aus England, die Beschläge aus Italien. Aus Deutschland war nichts, das wäre zu gewöhnlich gewesen.
Während nun die drei armen Kerle ihre Brotrinden aßen und sich von Zeit zu Zeit den abheilenden und darum juckenden Buckel krauten, hielt Wolfsklaue schwelgerische Mahlzeiten, funkelte mit seinen Ringen, zog seine Uhren auf und putzte seine goldenen Ketten mit einem Lederlappen.
Die drei armen Hascher sahen mit gierigen Augen zu. Und eines Tages, als Wolfsklaue wieder ganz aufdringlich geprahlt und die drei sehr schlecht behandelt hatte, sagte der Hutmacher, als sie wieder allein waren:
»Brüder, das halte aus, wer da wolle! Es ist schlimmer als ein Hundeleben! Was hat uns Wolfsklaue dagelassen? Nichts! Nicht einmal die Knochen von seinem Wildbret. Die hat er seiner dänischen Dogge gegeben. Es macht mir keinen Spaß mehr, ein so armer Teufel zu sein; ich will lieber so reich sein wie Wolfsklaue und werde das in drei Tagen erreichen.«
Der Schneider fragte den Hutmacher freundlich, ob er etwa Kopfschmerzen habe und am Gehirn[192] leide; aber der Hutmacher verneinte das und sagte, er sei kein bißchen verrückt, sondern er habe im Gegenteil einen großartigen Plan.
Erst nach Mitternacht, als der Mond schon untergegangen war, und das kleine Holzfeuer, um das die drei saßen, erlosch, gab der Hutmacher seinen Plan kund.
»Überfallen müssen wir ihn!«
»Wen?«
Der Hutmacher zog das linke Ohr des Schneiders und das rechte des Schusters dicht an seinen Mund und flüsterte:
»Ihn – Wolfsklaue!«
Da rissen die beiden ihre Ohren los und sprangen in die Höhe. Sie schüttelten sich vor Entsetzen.
Aber als die Sonne aufging, hatte des Hutmachers große Redekunst über alle Besorgnisse gesiegt, und es war ausgemacht, das nächste Mal Wolfsklaue zu überfallen, sobald er seine Waffen abgelegt hatte und seine Dogge in den Büschen verschwand, um nach Wildfährten zu spüren. –
Der dritte Tag erschien; aber Wolfsklaue erschien nicht. Da bekamen die drei Angst, er möge am Ende von ihrem Anschlag Wind bekommen haben.
»Man kann bei ihm nie wissen, was er im Schilde führt!« sagte der Schneider besorgt. Die beiden anderen schwiegen und sahen bedrückt vor sich hin. Es war ganz still im Walde. Kein Laut rührte sich. Nur die Magen knurrten von Zeit zu Zeit im Dreiklang, oder ein Schluchzer oder Seufzer kam aus einem bärtigen, verwilderten Räubermunde.
Am vierten Tage erschien Wolfsklaue. Er trug eine flimmernde Königskrone auf dem Kopf, ein ganzes Bündel von Spazierstöcken mit goldenen, silbernen und demantenen Knäufen unter dem linken Arm, unter dem rechten hatte er ein Szepter gequetscht, und in der Hand hielt er eine goldene Kugel. Von seinen Schultern fiel ein Purpurmantel, der mit Edelsteinen übersäet und so lang war, daß er den halben Waldweg entlang schleifte. Um den Hals trug er so viel goldene Ketten, daß sich unter der Last sein Nacken krümmte; seine Brust und sein Bauch waren wie ein Spiegel, weil dort gar so viele Orden blitzten, sein rechtes Hosenbein war aus himbeerrotem Sammet, sein linkes aus bernsteingelber Seide, an dem rechten Fuß hatte er einen Stiefel von Elenleder, an dem linken einen perlengestickten Pantoffel.
Der Schneider, der Schuster und der Hutmacher[194] sprangen ob des wunderbaren Anblicks in die Höhe und fielen dann platt auf die Nasen.
»Guten Tag, meine Herren,« sagte Wolfsklaue freundlich und lüftete die Krone; »ich freue mich, euch so wohl zu sehen. Ihr habt euch jedenfalls hier gut unterhalten. Ich habe inzwischen ein kleines Geschäft erledigt. Ich hatte eine Zusammenkunft mit dem Könige von Polen. Ihr seht, daß ich mir einige kleine Andenken mitgebracht habe. Es war wirklich sehr nett!«
Er winkte dem Hutmacher, ihm vom Pferde zu helfen, gürtete sich sein Schwert ab, das er dem Schneider übergab, nahm seine Pistole aus dem Gürtel und gab sie dem Schuster, raffte schließlich seinen Purpurmantel zusammen und legte sich auf die Erde.
»Aber anstrengend ist es, meine Herren, sehr anstrengend! Ihr glaubt gar nicht, wie müde ich bin! Siebzehn Kammerdiener und achtundfünfzig Soldaten habe ich erst entfernen müssen, ehe ich mit Se. Majestät unter vier Augen reden konnte. Gebt mir doch mal die Flasche aus der Satteltasche. Es ist alter Malvasier drin. Und füllt eure hohlen Hände dort am Brünnlein, und dann wollen wir mal auf meine Gesundheit trinken.«
Es geschah alles, wie Wolfsklaue es wünschte. Die drei armen Hascher füllten ihre Hände an der Quelle, und dann mußten sie mit der Hand[195] an Wolfsklaues goldenem Becher anstoßen und »Zur Gesundheit!« sagen.
»Ah, das schmeckt? Nicht wahr?« fragte Wolfsklaue, als sie getrunken hatten. »Ein bißchen schwer ist der Trank; aber wie Feuer geht er durch die Adern. Nun, lassen wir es uns wohl sein! Einen Sieg, wie den meinen, muß man feiern. Ich denke, wir trinken noch ein Schöpplein!«
Wieder mußten die drei armen Hascher ihre hohlen Hände an der Quelle füllen und mit Wolfsklaue anstoßen.
»Wohl bekomm es!« sagte Wolfsklaue; »es geht nichts über einen guten Trunk. Man wird so fröhlich dabei.«
Der Hutmacher hustete sehr laut und sagte, er habe sich verschluckt.
»Immer hübsch langsam trinken,« mahnte Wolfsklaue; »immer alles mit Maßen! Ich möchte wohl noch einen dritten Becher; aber ich sehe, ihr habt schon genug, und ich bin auch müde. Ich will ein wenig schlafen. Ihr drei möget Wache stehen und mich wecken, wenn der Morgen graut. So hat jeder sein Vergnügen. Gute Nacht!«
Er schlief ein. Die Krone rutschte ihm tief in die Stirn herab, er legte das himbeersamtne[196] Hosenbein über das bernsteingelbe, faltete die Hände auf seinem dicken, ordengeschmückten Bauche und schnarchte bald laut und tief.
Die drei anderen Räuber schauten sich an. Der Schneider wischte sich den Mund ab; der Schuster klagte, das kalte Wasser sei ihm in seine hohlen Zähne gekommen; der Hutmacher sah finster vor sich hin. Auch das Roß hatte sich gelegt, sich mit den Zähnen die schwere persische Seidendecke zurechtgezupft, so daß es nicht frieren konnte und schlief auch ein. Die große dänische Dogge verschwand im Walde, um zu wildern.
Die Nacht brach herein; der Mond verbarg sich hinter den Wolken. Da runzelte der Hutmacher die Stirn, blitzte die beiden anderen mit den Augen an und sagte leise:
»Jetzt, jetzt ist's Zeit!«
Bei diesen Worten krümmte sich der Schneider zusammen, sagte, es käme ihm in den Leib, und verschwand im Gebüsch. Der Schuster hielt den linken Fuß vorgesetzt, um zur Flucht bereit zu sein, der Hutmacher aber warf sich heulend auf Wolfsklaue, packte ihn am Halse und schrie:
»Gib alles her! Gib alles her!«
»Was – was ist – was ist los –«
Wolfsklaue rieb sich die Augen. Er sah den Hutmacher über sich knien und schrie plötzlich ganz jämmerlich:
»O weh! O weh! Ich bin überfallen! Ich habe keine Waffen! Ich bin verloren! Wehe mir! Wehe mir!«
Pardauz, lag auch der Schuster über ihm her und rief dem Hutmacher zu:
»Mach Platz! Mach Platz! Ich will ihn auch würgen!«
Und nun traute sich auch der Schneider aus dem Gebüsch, kam vorsichtig näher und hielt den Pantoffel in der Hand, den Wolfsklaue, weil er mit den Beinen um sich schlug, verloren hatte.
So wurde Wolfsklaue besiegt. Stück um Stück nahmen ihm die drei Räuber ab, zogen ihn aus bis aufs Hemd. Dann zwangen sie ihn, an der Quelle seine hohle Hand zu füllen, mit ihnen anzustoßen, die nun der Reihe nach den Becher leerten, sich hinzulegen und von jedem zehn Stockhiebe aufzählen zu lassen. Am Schluß gaben sie ihm aus Gnade den schäbigen, geflickten Mantel des Schneiders um; er mußte gegen alle vier Himmelsrichtungen hin eine Verneigung machen und zu der Räuber Gaudium laut schreien: »Ich bin ein großer Esel«, und dann wurde er in die finstere Nacht hinausgejagt.
»Nun wollen wir die Beute teilen,« sagte der Hutmacher. »Ich für meinen Teil begehre[198] nur die Hälfte all dieser Sachen; die andere Hälfte ist für euch beide.«
»Was?« höhnte der Schuster; »wenn drei teilen, wird wohl ein jeder ein Drittel bekommen.«
Der Hutmacher schüttelte den Kopf.
»Seit Wolfsklaue besiegt ist,« sagte er würdig, »bin ich euer Hauptmann.«
Die beiden anderen brachen in ein schallendes Gelächter aus.
»Lacht nicht!« begehrte der Hutmacher auf. »Wer hat den Gedanken gehabt, Wolfsklaue zu überfallen? Ich! Wer hat ihn tatsächlich überfallen? Ich!«
»Ich auch!« rief der Schuster, »und außerdem hatte er mir sein Schwert übergeben; ich hatte euch alle in meiner Gewalt.«
»Ja, wenn ich nicht die Pistole gehabt hätte,« meinte der Schneider; »eine Pistole ist flinker als ein Schwert.«
»Wenn du schießen könntest, du Tolpatsch!« höhnte der Schuster.
»Kannst du etwa fechten, du Dämlack?« zischte der Schneider.
Da fuhren sie sich in die Haare und prügelten sich. Der Hutmacher setzte sich indessen die Königskrone auf und zählte die Dukaten, die sie Wolfsklaue abgenommen hatten. Als das die beiden[199] Kampfhähne sahen, ließen sie ab von einander und fragten: »Was tust du da?«
»Ich zähle mir die Hälfte der Beute ab,« sagte der Hutmacher in Gemütsruhe, »Daran werdet ihr zwei Dummköpfe nichts ändern.«
Da sahen sich der Schuster und der Schneider mit einem bedeutungsvollen Blicke an, und plötzlich stürzten sie sich auf den Hutmacher und überwältigten ihn. Sie drohten, ihn zu töten, wenn er ihnen nicht gänzlich gehorsam sei. Darauf prügelten sie ihn durch, zwangen ihn, seine hohle Hand an der Quelle zu füllen und mit ihnen am goldenen Becher anzustoßen, und jagten ihn dann in die Nacht hinaus. – –
»Jetzt wollen wir zwei die Beute teilen,« meinte darauf der Schneider, »und es soll jeder seine Hälfte bekommen.«
»Jawohl,« sagte der Schuster; »aber da ich zuerst den Gedanken hatte, den Hutmacher zu überfallen, gebührt mir die größere Hälfte. Ich werde sie mir auswählen, und was übrig bleibt, sollst du erhalten.«
Damit bückte er sich zu den Schätzen nieder. Der Schneider aber griff blitzschnell nach der Pistole und dem Degen und rief:
»Laß alles liegen oder du bist ein Kind des Todes!«
Da erschrak der Schuster, und da der Schneider[200] alles Ernstes drohte, ihn zu erschießen, entfloh er schreiend in den Wald.
So kam es, daß der Schneider, der größte Feigling unter allen, zuletzt ganz allein in dem Besitz der geraubten Reichtümer des Polenkönigs war.
Der Hutmacher und der Schuster waren sich im Walde begegnet und saßen sich grollend gegenüber. Plötzlich sahen sie Wolfsklaue daherkommen. Er ritt auf einem starken Ziegenbock und hatte einen Stecken in der Hand. Zuerst schien es, als ob er entfliehen wolle, aber dann kam er näher, grüßte demütig und sagte:
»Ich hoffe, edle Herren, daß ihr mir nichts mehr anhaben werdet. Denn sehet, ich bin ein geschlagener Mann. All mein Hab und Gut habe ich verloren; ich sitze jetzt auf einem Ziegenbock und habe einen Stecken als Waffe; ich muß also, da ich in meinem Räubergewerbe pleite geworden bin, ganz klein wieder von vorn anfangen.«
Da erzählten ihm die beiden, der Schneider sei eine Bestie, er habe sie beraubt und betrogen, und sie seien nun ebenso arm wie er.
»Man hätte es dem Schneider nicht angesehen, daß er ein so großer Held ist,« meinte Wolfsklaue nachdenklich. »Da er nun alles Geld und alle[201] Waffen hat, ist es am besten, wir gehen hin und wählen ihn zu unserem Hauptmann.«
»Ich will lieber deinen Ziegenbock zu meinem Hauptmann wählen als den Schneider,« knirschte der Hutmacher.
»Nun, einen Hauptmann müssen wir haben,« lächelte Wolfsklaue, »und mein Ziegenbock wird die Wahl nicht annehmen. Er ist ein sehr gescheites Tier. Wählen wir also den Schuster!«
»Den Schuster?« schrie der Hutmacher. »Noch eher wählte ich den Schneider als den Schuster.«
Da saß ihm der Schuster auch schon an der Gurgel, und sie prügelten sich. Wolfsklaue aber setzte sich an den Wegrand, streichelte seinen Ziegenbock und sang mit fröhlicher Stimme:
Während er noch so fröhlich sang und die beiden anderen rauften, trat etwas Seltsames in Erscheinung. Das Araberroß kam daher; ganz langsam hob es die Beine wie in zierlichem Tanz und wandte den Kopf schelmisch bald hin, bald her. In den Zähnen aber trug es ein zappelndes Bündel von Purpur, himbeerfarbenem Samt und bernsteingelber Seide, auch fiel bei jedem Schritt ein kostbarer Orden klirrend auf den Waldboden.[202] Neben dem Roß trabte die dänische Dogge, die trug das Schwert im Maule.
Als Roß und Hund bei Wolfsklaue ankamen, legten sie ihre Bürde vor ihm nieder. Da wickelte sich aus dem zappelnden Bündel erst eine Königskrone heraus, aus der unten nur die Stumpfnase und der Ziegenbart des Schneiders hervorschauten; dann kam der ganze Schneider zum Vorschein, und eine meckernde Stimme rief um Gnade.
»Nun also!« rief Wolfsklaue und nahm das Schwert an sich, »so sind wir ja alle wieder beieinander.
Er blitzte mit den Augen.
Der Schneider, der Schuster und der Hutmacher warfen sich nun vor Wolfsklaue nieder und baten und wimmerten um Verzeihung.
Wolfsklaue sagte gar nichts. Er band den Schuster an den Halftergurt und den Schneider an den Schweif seines Rosses, legte den königlichen Schmuck wieder an, schwang sich auf das Roß und befahl dem Hutmacher, sich auf den Ziegenbock zu setzen, denn er verdiene eine Auszeichnung.
Dann ritt Wolfsklaue zwei Tage und zwei Nächte lang ohne zu rasten über das ganze Riesengebirge[203] weg und kam mit seinen Gefährten in das Land Böhmen.
Diese Reise war für die drei, die nicht auf dem Pferde saßen, äußerst beschwerlich. Der Schuster mußte so rasch traben, daß ihm oft der Atem ausging, der Hutmacher saß auf dem Ziegenbock wie auf einem schlingernden Schiff, das in schwerem Sturm hin- und herstößt, bald hoch, bald niedrig geht und seinem Passagier sehr übel am Magen mitspielt, und der arme Schneider am Pferdeschwanze verlebte erst recht keine gute Zeit. Das[204] Roß nahm in keinerlei Weise Rücksicht auf ihn. Das Schlimmste aber geschah, wenn sich dem Hengst eine Fliege in die Flanke setzte. Dann hob er den mächtigen Schweif und hieb ihn samt dem Schneider nach der Fliege, daß dem armen Kerl, der so durch die Luft sauste, Hören und Sehen verging.

Wolfsklaue aber pries die Annehmlichkeiten der Reise und die Schönheit des Gebirges und sang fröhliche Wald- und Wanderlieder.
Als sie nun nach Böhmen kamen, wurde endlich Rast gehalten. Die drei armen Hascher fielen wie tot auf das grüne Moos und schliefen drei Tage und drei Nächte lang. Dann weckte sie Wolfsklaue und sagte, plötzlich wieder sehr freundlich:
»Liebe Kameraden, es tut mir leid, euch in eurem kurzen Schlummer stören zu müssen; aber wir müssen nun endlich ausführen, was wir uns vorgenommen haben; wir müssen auf Taten ausgehen.«
»Herr,« meinte der Hutmacher, »ich bitte euch, gebt mir Urlaub. Ich will mein Räuberleben beenden. Ich kann ein wenig singen und Gitarre spielen; da will ich sehen, wie ich mich hierzulande durchschlagen kann.«
»Wäre noch schöner,« rief Wolfsklaue, »in Böhmen betteln und singen zu gehen, ist das[205] Dümmste von der Welt; denn die Hälfte aller Böhmaken sind selbst Bettler oder Musikanten.«
»Ich,« sagte der Schneider, »möchte mich als Bauernknecht vermieten.«
»Und ich,« sagte der Schuster, »will wieder Stiefel machen.«
»Mensch, willst du wieder ein Verbrecher werden?« fuhr ihn Wolfsklaue an. »Willst du, daß die Menschheit erlahmt und lauter Hinker durchs Leben schreiten? Nein, nein, es wäre jammerschade um drei so verwegene Gesellen wie ihr seid. Ihr, die ihr sogar Wolfsklaue besiegt habt!«
Da schlugen die drei die Augen nieder. Wolfsklaue aber machte ihnen mit gedämpfter Stimme Mitteilung von einem großen Plan, durch dessen Ausführung sie alle zu unerhörtem Reichtum gelangen würden, und der außerdem sehr lustig und unterhaltsam sei.
Weiter drin in Böhmen sei ein herrliches Schloß, das berge so große Reichtümer, daß sich der Kaiser aus Wien daselbst fast alles Geld borge, dessen er bedürfe. Und das wolle etwas heißen! Sich zum Herrn dieses Schlosses zu machen, sei nun Wolfsklaues Ziel. Er vermöge das aber nicht allein, sondern bedürfe dazu der Hilfe seiner drei guten, lieben Freunde.
Die drei »guten lieben Freunde« schlugen wieder schamhaft die Augen nieder; aber Wolfsklaue[206] klopfte sie vertraulich auf die Schultern und sagte in herzlichem Tone:
»Brüder, denkt nicht mehr an die alten Tage. Es waren Zeiten der Trübsal und der Prüfung. Sie sind nun vorüber, und eine bessere Zeit bricht für uns alle an. Kommt ein bißchen tiefer mit mir in den Wald hinein und seht, was ich mich herbeizuschaffen bemüht habe, indes ihr euch nach der langen beschwerlichen Reise ausruhtet.«
Da gingen sie mit ihm tiefer in den Wald und kamen in eine Räuberhöhle, von der man nichts anderes sagen kann, als daß sie höchst luxuriös war. Während der Fußboden mit echten und unechten Bärenfellen belegt war, hingen an den Wänden gerahmte und ungerahmte Bilder, die alle große Räuber- und Heldentaten darstellten und prachtvolle rote und grüne Farben hatten. Flinten, Schwerter und Spieße hingen an den Wänden, die ganz mit Edelsteinen besetzt waren, die kleineren stammten aus dem siebenjährigen, die größeren und wertvolleren aber aus dem dreißigjährigen Kriege. Der Raum wurde taghell beleuchtet von sieben Spitzbubenlaternen, die rubinrote Scheiben hatten, und in der Mitte der Höhle stand eine Tafel, da perlte in kristallenen Flaschen der köstlichste Branntwein, und auf goldenen und silbernen Tellern lagen Pökelfleisch und Sauerkraut.
Den drei Räubern liefen vor Rührung Tränen im Auge und das Wasser im Munde zusammen.
»Ach,« seufzte der Schuster, »ach, wenn wir bloß nicht wieder aus einer Wasserquelle trinken müssen!«
Diesmal aber kam's anders. Die Räuber aßen so reichlich und tranken so viel, daß sie nach der Mahlzeit auf den Bärenfellen einen Schlaf taten, der fünf Tage und fünf Nächte lang war, worauf sie sich lächelnd und gestärkt von ihrem Lager erhoben.
»Nun,« sagte Wolfsklaue, »wollen wir unsere große Tat vorbereiten. Das Schloß ist so wohl bewacht, daß es nur durch äußerste Klugheit und Tapferkeit gelingen wird, uns zu seinem Herrn zu machen. Mein Plan ist der, daß ich euch drei zunächst als meine geheimen Boten nach dem Schlosse absende.«
Alle drei Räuber machten abwehrende Handbewegungen und schüttelten heftig die Köpfe. Wolfsklaue lächelte.
»Ich schicke euch natürlich nicht so, wie ihr hier vor mir steht, sondern in einer geschickten Verkleidung, so daß euch sicher niemand erkennen wird, zumal ich euch eure Rollen gut einstudieren werde. Du, Hutmacher, hast eine schöne Stimme und spielst die Gitarre. Ich werde dir ein schönes Gewand besorgen, und du wirst als Minnesänger[208] nach dem Schlosse ziehen. Dir, Schuster, schaut Tapferkeit und ritterlicher Mut aus den Augen; ich werde dich in der Kunst des Kämpfens unterweisen und dich ausstatten wie einen Ritter aus dem Morgenlande. Du, Schneider, bist ein pfiffiger und gewandter Geist, du wirst als handelnder Jude in das Schloß eindringen.«
Da versanken die drei in tiefes Nachdenken, bis schließlich einer fragte:
»Und du – was wirst du tun?«
»Ich komme nach euch, wenn ihr den Weg für mich geebnet habt. Alsdann erscheine ich als Prinz von Czernagora. Der Minnesänger muß den Rittern und Edelfrauen sehr viel von den Tugenden und der Schönheit dieses Prinzen vorsingen; der Ritter muß sich nach großen Heldentaten als den geringsten unter den Mannen jenes Prinzen bezeichnen; der Jude muß erzählen, daß der Prinz reich genug ist, ihm alljährlich für viele Millionen Edelsteine abzukaufen, und wenn dann der Prinz einzieht, das heißt, wenn ich komme, werden alle Herzen schon so in Achtung und Liebe für mich entbrannt sein, daß es mir ein leichtes sein wird, mich eines Tages als den Herrn und Gebieter der Burg ausrufen zu lassen.«
»Und was wird dann aus uns?« fragte der Hutmacher.
»Euch drei erhebe ich dann in den Adelstand und statte euch aus mit großen Gütern.«
Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang mußte Wolfsklaue noch reden, ehe er den dreien ihre vielerlei Bedenken aus dem Kopf geschlagen hatte und sie sich bereit erklärten, die ihnen zugedachten Rollen zu übernehmen.
Dann begann der Unterricht.
Der Schuster lernte reiten und kämpfen; der Hutmacher saß den ganzen Tag im Walde, klimperte auf einer Gitarre und sang zärtliche oder lobpreisende Lieder dazu; der Schneider ging mit einem Hausiererkasten von einem Baum zum anderen und bot ihnen mit artigen Bücklingen und überzeugenden Handbewegungen seine Waren an. Wolfsklaue war der Lehrmeister, gab alles an, überwachte alles, lobte oder tadelte und sorgte für alles, was die drei brauchten.
Eines Tages sagte Wolfsklaue zu dem Schuster:
»Jetzt reite aus. Glaube mir, daß dir kein Ritter im Morgen- und Abendland gleicht. Du bist ganz einzig in deiner Art. Reite dahin und verkündige den Ruhm des kommenden Prinzen von Czernagora.«
Der Schuster trug eine blitzende Rüstung, hatte eine Lanze in der Hand, die neun Ellen lang war, und saß auf einem prachtvollen Roß. Sein strohgelber Schädel war von einer schwarzen Perücke wohltuend überdeckt, und selbst sein Auge hatte etwas Kühnes bekommen.
So ritt er dahin. Wolfsklaue in der bescheidenen Tracht eines Dieners zeigte ihm den Weg. Er gab ihm noch einmal viel gute Lehren, sagte ihm, er solle mit tapferen Rittern sich im Turnierkampf messen und, wenn er gesiegt habe, ja nicht vergessen, zu sagen, daß er nur der bescheidenste aller Mannen des czernagorischen Prinzen sei.
Der Schuster sagte zu allem »Ja!« Im Innern aber dachte er:
»Daß ich ein Esel wäre, wenn ich gesiegt habe, mich als einen geringen Mann zu bezeichnen. Dann werde ich mich schon in anderem Lichte zeigen, und wer weiß, ob sie nicht mich selbst zum Herrn der Burg ausrufen.«
So kamen sie auf eine waldige Berghalde und sahen in der Ferne die leuchtenden Zinnen der Burg. Sie lag im hellen Sonnenlicht; dreizehn Türme und viele Erker schmückten sie gar herrlich; eine starke Mauer umgürtete ihre vielen Gebäude und Höfe, und vier Wallgräben zogen sich um sie her, davon war der erste mit Wasser, der zweite mit Tinte, der dritte mit Schwefelsäure, der[212] vierte mit glühendem Blei gefüllt, so daß es für alle Feinde sehr mühsam war, die vier Gräben zu durchschwimmen.

Als der Schuster die Burg sah, wurde ihm übel. Aber Wolfsklaue gab ihm aus einem Fläschchen zu trinken, das einen ungeheuren Mut in die Adern des Schusters ergoß, und so zog er wohlgemut dahin, nachdem Wolfsklaue ihm glückliche Reise gewünscht hatte und umgekehrt war.
Von den dreizehn Türmen des Schlosses klangen die Hornsignale der Wächter, daß ein Fremder daherziehe. Der Schuster dachte: die blasen so niederträchtig laut, daß mir noch mein Roß scheu werden wird. Da sah er auch schon, wie sich auf den Söllern und Mauern der Burg hunderte von edlen Rittern, wunderschönen Edeldamen und allerhand Kriegsvolk ansammelte, um nach dem nahenden Fremdling auszuschauen. Der Schuster hob seine neun Ellen lange Lanze zum Gruß, und der Federbusch auf seinem Helm spielte im Winde. Er kam sich ganz herrlich vor, und alle Angst war verschwunden.
Da begegnete ihm auf einem Kreuzweg ein Reiter.
»Hallo,« dachte der Schuster, »das ist der rechte Mann, einen Waffengang mit ihm zu wagen und vor allem Volk auf der Burg meine Tapferkeit[213] und Geschicklichkeit zu erweisen.« Er nahm also seinen Helm ab, machte eine Verneigung und sagte: »Entschuldigt, edler Herr, beliebt es vielleicht, Euch im ritterlichen Kampfe mit mir zu messen?«
Ein Gelächter erscholl von der Burg, und der Reiter lachte auch. Da faßte den Schuster ein wilder Zorn, er trieb sein Roß an, stürmte gegen den Reiter, hob die Lanze und bohrte sie tief – in die Luft neben dem Reiter. Er selbst verlor ob des Anpralls das Gleichgewicht und purzelte in den Straßengraben.
Nun rasselte die Zugbrücke der Burg; Ritter und Damen eilten herbei, und die Ritter lachten so tief und schauerlich, daß es klang, wie wenn alte Wagen mit eisernen Rädern über spitze Steine fahren, oder wie wenn man mit klobigen Hämmern auf leere Fässer schlägt, und die Damen girrten und zwitscherten wie silberne Tauben in der Luft oder wie blaue Schwalben am Dachsims.
Das verdroß den Schuster; er arbeitete sich aus dem Graben heraus, verlor dabei seinen Helm und seine schwarze Perücke, stand mit seinem strohgelben Schädel da, machte ein dummes Gesicht und schrie:
»Ich bin der beste Ritter des Prinzen von Czernagora.«
O, wie rollten die Wagen, wie dröhnten die Fässer, wie girrten die Tauben, wie zwitscherten die Schwalben!
»Mit einem Knecht, mit einem waffenlosen, ganz gewöhnlichen Roßknecht hat er angebunden, und ist von ihm besiegt worden! Welch ein Spott, welch ein Spott!«
So lachte und höhnte es von allen Seiten.
Nun trat ein hoher Herr in königlichem Schmuck aus der Menge. Es war der Burgherr. Der sprach:
»Der Prinz von Czernagora ist mein Todfeind. Wenn dieser Mann zu seinen Rittern gehört und er sich von meinem Knechte hat werfen lassen, so nehmt ihn und bringt ihn ins Verließ. Wir werden Gericht über ihn halten.«
Schwapp – lag der Schuster auf den Knien. Er warf seine Lanze von sich, hob bittend beide Hände auf und flehte:
»Seid gnädig, Herr, und glaubt ja nicht, daß ich ein tapferer Ritter sei. Nein, ich bin nur ein Schuster, ein Schuster aus Hirschberg, und wenn Ihr das nicht glauben wollt, so will ich Euch augenblicklich ein Paar Stiefel fertigen.«
»Das verhüte Gott,« sagte der Burgherr mit Ernst. »Nehmt ihn und führt ihn ins Verließ!«
So geschah es. Und als der Tag vergangen war[215] und der Mond über die Waldberge wanderte, schien er auch durch eine winzige Mauerlucke in das bleiche Gesicht des Schusters, der in seinem feuchten Verließe saß und um den die Ratten und Mäuse tanzten, wie es nun einmal in den Burgverließen traurigerweise Mode ist.
Drei Tage darauf sagte Wolfsklaue zu dem Hutmacher:
»Nun singst du über alle Maßen schön und lieblich. Du kannst den Text, die Melodie und die Begleitung; also bist du über alle Nachtigallen des Waldes, die nur die Melodie können. Reite aus, edler Sänger, und verkünde auf der Burg die Schönheit und die Macht des Prinzen von Czernagora.«
Der Hutmacher stimmte seine Gitarre, setzte sich auf den zahmen Schimmel, den ihm Wolfsklaue besorgt hatte und zog gen die Burg. Als er ihrer ansichtig wurde, stimmte er die Gitarre aufs neue und sang ein schönes Weihnachtslied. Die Julisonne brannte ihm dabei auf den Rücken, und nach einiger Zeit dachte er sich: Die Leute werden meinen Gesang nicht hören, denn die Burg ist wohl noch gut eine Meile entfernt. Also ritt er auf seinem zahmen Schimmel noch etwa zwei[216] Stunden lang vorwärts, und da er dadurch der Burg sichtlich näher gekommen war, stimmte er seine Gitarre und sang ein neues Lied:
Trara! Trara! fingen die Wächter auf den dreizehn Türmen an zu blasen, so laut und dröhnend, daß die nächsten dreizehn Strophen des Minnesängerliedes nicht einmal von dem zahmen Schimmel gehört werden konnten. So brach der Hutmacher schon nach der zwölften ab und fragte sich, ob er sich als Sänger über solch schmetternden Empfang eigentlich freuen oder ärgern solle.
Zunächst ärgerte er sich. Aber bald leuchteten seine Augen auf. Das Burgtor öffnete sich, und an die dreißig schöne Jungfrauen traten heraus. Sie waren alle weißgekleidet, trugen goldene Gürtel um die Hüften, grüne Kränze im Haar und lichtblaue Schleier darüber. In den Händen hielten sie Rosen und bunte Blumen.
Der Hutmacher stieg von seinem Roß und machte dreißig Verneigungen. Darob lächelten die holden Mädchen; dann stellten sie sich im Halbkreise auf und begannen mit glockenhellen Stimmen zu singen:
O, war das noch ein Klang? War das noch eine Melodie? War das nicht wie ein Silberrieseln, das vom blauen Himmel heruntertaute? Die Mädchen standen in ihrer großen Schönheit wie Engel im reinen Licht, als sie das sangen.
Und der Hutmacher fiel mit dem Gesicht auf die Erde, bohrte seine Stirn tief in den Rasen und weinte bitterlich. Als die holden Mädchen erschreckt näher kamen, rief er:
»Ich schäme mich! Ich schäme mich! Schaut meine Stirn nicht an!«
»Ei warum denn nicht, du fremder Sänger?«
»Ich bin kein Sänger – ich habe euch betrügen[218] wollen – ich bin nur ein Hutmacher und ein Räuber!«
Erschreckt standen die Jungfrauen zur Seite. Da kam der Burgherr und fragte strenge:
»Wer hat dich gesandt?«
»Der Prinz von Czernagora!« gestand der wimmernde Mann.
»Führt ihn in das Verließ!« befahl der Burgherr. Das geschah, und es nutzte gar nichts, daß sich die Mädchen bemühten, für den armen Tropf Fürsprache einzulegen.
Der Schneider übte sich gerade in der Hausiererkunst, indem er einem alten Tannenbaum durchaus ein Paar Hosenträger aufschwatzen wollte, als Wolfsklaue an ihn herantrat und sprach:
»Nun ist's Zeit, lieber Freund, daß du dir andere Kundschaft aussuchst. Ziehe hin nach dem Schloß, mache dich angenehm durch dein Benehmen und deine Waren, und erzähle vom Reichtum des Prinzen von Czernagora.«
»Sie werden mer derkennen,« sagte der Schneider in seinem jüdischen Dialekt.
»Nein, se werden der nich erkennen,« beschwichtigte ihn Wolfsklaue. »Ich sage dir, Schneider, du bist ein Itzig, wie er sein soll.«
In der Tat sah der Schneider aus wie ein[219] jüdischer Händler. Wochenlang hatte er sein Gesicht den Sonnenstrahlen aussetzen müssen und sich nicht mehr waschen dürfen, so daß er eine schöne dunkle Hautfarbe hatte; Wolfsklaue hatte ihm eine Perücke mit langen schwarzen Locken verschafft, ihn auch sonst ganz richtig ausstaffiert, ihm sogar den leutselig verschmitzten Blick solcher Händler einstudiert.
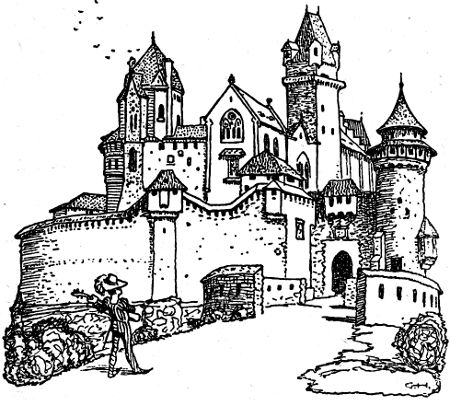
Nun übergab ihm Wolfsklaue zwei Kästen. In dem oberen waren allerhand billige, aber bunte[220] und schön anzuschauende Gebrauchsgegenstände für das Dienstvolk; in dem unteren lagen prachtvolle Goldgeschmeide und herrliche Edelsteine in allen Farben und Größen für Ritter und Edelfrauen.
Der Schneider nahm Abschied und machte sich auf den Weg. Als er allein im Walde war, öffnete er den unteren Kasten, betrachtete die Kostbarkeiten und dachte bei sich:
»Was nutzt es mir, wenn ich diese schönen Dinge auf der Burg verkaufe? Der Prinz von Czernagora wird kommen und mir den Erlös abnehmen. Höchstens werde ich einen kleinen Profit behalten. Besser ist es, ich wandere nach Prag, verkaufe dort meine Waren und freue mich dessen, was ich dafür erhalte.«
Also machte sich der Schneider nicht auf den Weg nach der Burg, sondern marschierte auf der Landstraße gen Prag. Als er aber einen halben Tag gewandert war, kam ihm plötzlich Wolfsklaue entgegen. Der Schneider erschrak des Todes. Wolfsklaue aber lächelte und sagte:
»Schneider, du verläufst dich! Hier geht es nach Prag. Die Burg liegt dir genau im Rücken. Sei also so freundlich und kehre um. Ich werde dich begleiten, bis du durch die Burgpforte hineingegangen bist, damit du dich nicht noch einmal verirrst.«
Der Schneider knirschte innerlich vor Wut über diese Begegnung; äußerlich aber mußte er tun, als freue er sich sehr, daß er vom unrechten Weg abgebracht worden war, und mußte sich Wolfsklauens Begleitung gefallen lassen, der mit ihm ging, bis die Burg in Sicht war, und sich dann unter einem Baum auf die Lauer setzte.
So wanderte der Schneider den Talweg entlang der Burg zu. Auf einer Wiese sah er ein Mädchen stehen. Es war eine Gänsehirtin. An die ging er heran, lüftete seine Kappe und sagte:
»Scheens Freilein, woll'n Se vielleicht kaufen ä Paar hochfaine Strumpfbänder?«
Das Mädchen lachte mit seinem kirschroten Mund, daß man alle ihre schönen weißen Zähne sah, und sagte:
»Ich habe noch nie Strümpfe gehabt; ich gehe immer barfuß. Und ich habe noch nie einen Pfennig Geld in der Hand gehabt.«
»Dumme Gans!« brummte der Schneider und klappte den Kasten zu.
Da kam des Wegs eine Edeldame geritten. Sie war prächtig aufgeputzt, trug einen Falken auf dem Finger, und hinter ihr ritt ein Forstmann. Als sie den Schneider sah, hielt sie ihr Roß an und rief:
»Heda, Hebräer, was hast du Schönes in deinem Kasten?«
Der Schneider stürzte herbei, machte eine Verneigung, sah der Dame ins Gesicht und stotterte:
»Ich könnte Euch geben, gnädigste Frau Ferstin, ä sehr ä gutes Mittel gegen rote Nase.«
»Pfui!« schrie die Dame und sprengte davon. Der Forstmann aber hieb dem Schneider mit der Reitpeitsche den Buckel ganz jämmerlich voll und sagte:
»Ich werde dich lehren, du schmutziger Kerl, unsere Frau Burggräfin zu beleidigen. Ich schlag dich auf der Stelle tot!«
Der Unmensch hätte es vielleicht auch getan, wenn nicht die Burggräfin zurückgekommen wäre.
»Laß ihn am Leben,« rief sie, »laß ihn vorläufig am Leben! Er soll mir erst sagen, ob er meine Nase wirklich für rot hält.«
»Gnädigste Burggräfin,« wimmerte der Schneider, »Eure allerdurchlauchtigste Nase ist so weiß und stattlich wie die Schneekoppe im Winter.«
Das besänftigte die Dame.
»Ich will ihm Gnade widerfahren lassen,« sagte sie milde, »weil er seinen Irrtum eingesehen und ihn so poetisch widerrufen hat. Zeige er, was er im Kasten hat.«
Da öffnete der Schneider den unteren Kasten, und wie die Sonne hineinschien, blitzte und gleißte es von Diamanten, Rubinen, Saphiren und[223] Opalen. Die Burggräfin sprang entzückt vom Pferde.
»Das ist das Schönste, was ich gesehen habe, das Allerherrlichste, das Allerwundervollste! Was soll dieser Stein kosten?«
Sie griff mit zitternder Hand nach einem Diamanten, der so groß war wie ein Gänseei.
»Gnädigste Burggräfin,« sagte der Jude; »den Stein habe ich abgekauft dem Kaiser von Persien selbst um die zehntausend Golddukaten. Er hatte gehabt gerade Ausverkauf, sonst hätt' ich ja beileibe den Stein nich gekriegt so spottbillig. Er is unter Brüdern wert ä Königreich. Aber da mer is mei Läben noch mehr wert als ä Königreich, und da mer hat geschenkt die Frau Burggräfin mei Läben, so schenk ich der Frau Burggräfin den Stein.«
Das Gesicht der Burggräfin wurde glühend rot wie die Sonnenscheibe. Aber dann machte sie eine hoheitsvolle Miene und sagte:
»Braver Mann, Ihr meint's gut. Aber als Burggräfin kann ich kein Geschenk von Euch annehmen; ich kann Euch den Stein nur abkaufen. Nehmt also diese fünf Gulden als Kaufpreis.«
»Auch recht,« sagte der Jude und steckte die fünf Gulden ein.
»Und nun,« sagte die Gräfin, »kommt mit auf[224] die Burg. Wir wollen sehen, was Ihr sonst noch Schönes im Kasten habt.«
Sie übergab dem Forstmann ihren Falken, sagte, die Jagd sei für heute aus, und ritt langsam den Burgweg hinan, während der Schneider zehn Schritte weit hinter ihr herging. Als sie aber in einen dunklen Torweg kamen, winkte die Gräfin den Händler heran und raunte ihm mit hastiger Stimme zu:
»Habt Ihr wirklich ein gutes Mittel gegen – gegen –«
Hier blieb sie stecken.
»Gegen was?« fragte der Schneider und tat unbefangen.
»Gegen – gegen Nasenröte!« brachte sie mühsam heraus.
»Hier, Frau Burggräfin,« sagte der Jude wohlwollend und drückte ihr ein Büchslein Salbe in die Hand. »Ich verrat nix!« – – –
Auf der Burg wurde der Schneider von den Damen mit aufgeregtem Gezwitscher, von den Herren mit freundlichem Gebrumm und Gegrunz aufgenommen. Alle wollten die prachtvollen Steine sehen, jedes wollte wenigstens eines der köstlichen Stücke, die der Jude um ein Spottgeld abgab, für sich kaufen. Selbst der Burgherr kam und erstand einen funkelnden Rubin, der so groß[225] wie ein Apfel war und einen prachtvollen Schmuck für einen Degengriff abgeben mußte.
In dieser Burg lebte aber wie in allen Burgen ein Alchimist. Dieser berühmte und gelehrte Mann hatte versprochen, aus Kupfer Gold zu machen und ein Lebenselixier zu brauen, das ewige Jugend verlieh. Er hatte zwar sein Versprechen noch niemals eingelöst, aber man konnte nicht wissen, ob er es nicht am ersten besten Tage tun werde. Er stand darum in hohem Ansehen.
Der Alchimist zog sich nun in seine Hexenküche zurück, kam nach einiger Zeit wieder und verkündete:
»Alles Geschmeide, das der Jude verkauft hat, und alle seine Steine sind unecht und ohne Wert.«
Da schrien die Männer, da schrien die Frauen vor Wut.
Der Schneider aber stand lächelnd da und sagte:
»Dieser Gelehrte ist ein Dummkopf. Meine Steine und mein Gold sind echt. Und wenn ihr mir nicht glaubt, so wartet, bis mein Herr, der Prinz von Czernagora, kommt, der wird es euch bezeugen.«
Kaum hatte der Jude den Namen des Prinzen von Czernagora ausgesprochen, so wurde er auch schon gepackt und flog ins Verließ. Die Goldgeschmeide und die Steine aber wurden in den[226] Brunnen geworfen, wo sie liegen bis auf den heutigen Tag.
Nur der Burggraf behielt seinen Rubin, und die Burggräfin behielt das Büchslein mit der Nasensalbe.
So saßen die drei armen Hascher gefangen beieinander und waren in großer Betrübnis.
»Wenn ich mir's recht überlege,« sagte der Schneider, »so haben wir eigentlich in unserem Räuberberufe Pech gehabt.«
»Ein Hundeleben ist es,« knirschte der Hutmacher, »und wenn dieser Wolfsklaue nicht ein großer Schelm und Betrüger ist, so will ich mich hängen lassen.«
»Gehängt werden wir so wie so!« meinte der Schuster schwermütig.
Da kratzten sich alle drei am Halse, als ob sie etwas jucke.
Gegen Mitternacht begann ein Glöcklein zu läuten. Bang und schaurig gingen seine Klänge durch die stillen Hallen und Gänge der Burg und drangen bis ins Verließ. Da wußten die drei armen Hascher, daß ihr letztes Stündlein gekommen sei.
»Brüder,« sagte der Hutmacher, »wir müssen Abschied nehmen vom Leben. Wir wollen uns[227] also in Liebe miteinander versöhnen und uns alles verzeihen, was wir einander angetan haben, damit auch Gott uns verzeihe.«
Sie fielen einander um den Hals, und ihre Tränen rannen heiß und schwer.
Da kamen auch schon die Schergen und schleppten sie hinauf in den Burghof. Dort stand unter einer großen Linde der Richtertisch. Ein Totenkopf lag darauf und ein Schwert. Der Burgherr saß auf dem hohen Richterstuhl, und um ihn herum im Halbkreis saßen sieben schwarz vermummte Männer. Der Nachtwind rauschte in dem Gezweig des großen Baumes, und die rotbrennenden Fackeln flackerten und warfen blutige Lichter über den Hof und das graue Gemäuer.
Der Burgherr erhob sich und sagte:
»Diese drei Schelme haben als Verräter und Betrüger in meine Burg eindringen wollen; sie sind gekommen als die Abgesandten meines Todfeindes, des Prinzen von Czernagora. Was dünkt euch, ihr ehrenwerten Richter, daß mit ihnen geschehen soll?«
»Sie sollen des Todes sterben!« sagten die Richter.
Da schlug der Burgherr mit dem Richtschwert dreimal auf den Tisch und bestätigte das Urteil:
»Sie sollen des Todes sterben!«
Darauf wurden die drei armen Hascher aus[228] der Burg hinausgeführt in die dunkle Nacht. Das Glöcklein läutete, und eine Trommel schlug die dumpfe, einförmige Todesmusik. Bis zum Galgenberge ging es, da ragten drei Richtgerüste gegen den Nachthimmel auf. Die drei Räuber wurden gehängt, und der ganze Troß von der Burg kehrte augenblicklich um.
Nun zappelten die drei armen Hascher. Der kalte Angstschweiß rann von ihren Stirnen, und ihre Züge verzerrten sich. Noch läutete das Glöcklein. Ein Schwarm schwarzer Raben flatterte zu Häupten der Gehängten, und drei Eulen saßen am Boden, die glühten sie an mit unheimlich funkelnden Augen.
Plötzlich brach ein Roß aus dem Gebüsch. Wolfsklaue saß darauf. Er stieß ein höhnisches, teuflisches Gelächter aus, blökte den dreien die Zunge heraus und jagte davon.
Dann kam ein Zug von Männern. Der Müller mit seinen Knechten war es, den die Räuber einmal hatten überfallen wollen. Die Männer lachten verächtlich und zogen vorbei.
Der Polenkönig kam geritten mit siebzehn Kammerdienern und achtundfünfzig Soldaten, und er trug die Krone und den Mantel und hatte die himbeersamtne und bernsteingelbe Hose an.
Zuletzt kam ein alter Mann. Er hinkte, hatte ein närrisch kleines Hütlein auf dem weißhaarigen[229] Kopf und zwei Buckel auf seinem Rücken. Er blickte die drei Gehängten an und sagte:
»Ehe ihr sterbt, will ich euch noch einmal danken dafür, daß ihr mich so schön ausstaffieret habt. Sehet die Stiefel, den Rock und den Hut, die ihr mir für gutes Geld gemacht habt!«

Da hoben die drei armen Hascher in ihrer[230] schweren Todesnot mit der letzten Kraft bittend die Hände zu ihm hin. Er aber sagte:
»Würdet ihr brave und geschickte Handwerker werden, wenn ich euch von da oben herunterhelfen würde?«
Sie nickten, und es war schrecklich anzusehen, wie eifrig sie nickten.
Da besann sich der alte Mann noch ein wenig, dann zog er sich ächzend die Stiefel aus, legte umständlich den Rock ab und nahm langsam den Hut vom Kopf. Die drei Gehängten sahen ihm mit stieren, angsterfüllten Augen zu.
Endlich kletterte der Alte an dem Galgen hoch, löste die drei Ärmsten und ließ sie schwer ins Gras hinunterfallen. Dort lagen sie lange, halb bewußtlos und schwer röchelnd. Der Alte flößte ihnen ein wenig Wein ein, und als sie sich erholt hatten, gebot er ihnen, mitzukommen. Mit schwankenden Schritten und leise weinend gingen sie hinter ihm her. Sie wanderten lange und kamen ums Morgengrauen an einen Scheideweg. Drei Straßen führten dort hinaus ins Land. Da machte der Alte halt und sprach in großem Ernst:
»Ein neuer Lebensweg liegt nun vor einem jeden von euch. Wenn ihr auf diesen drei Straßen wandert, so wird jeder zu einem tüchtigen Handwerksmeister kommen. Bei diesem mag er in die Lehre treten. Er mag sich ja nimmer einbilden,[231] je ein Meister gewesen zu sein, sondern demütig und treu ein Lehrling sein, der auch dann nicht murrt, wenn es einmal mehr Püffe und harte Worte gibt als gute Kost und faule Zeit. Drei Jahre beträgt die Lehrzeit. Haltet ihr sie aus, so ist euch geholfen; lauft ihr fort oder seid faul und frech, so werdet ihr, ehe die Sonne dreimal untergegangen ist, wieder am Galgen hängen. Geht in Frieden!«
Da wanderten die drei ein jeder seinen Weg, und der Alte stand da und sah ihnen nach, bis die Sonne aufging und sein ehrwürdiges Haupt verklärte.
Drei Jahre waren vergangen. Vor der Stadt Hirschberg lag ein kleiner Platz, darauf mündeten drei Wege. Von Osten her kam ein Mann, der trug sieben Paar Stiefel und Schuhe über der Achsel; von Süden her kam einer, der hatte auf einem Karren eine ganze Menge Kleider geladen; von Westen kam singend einer dahergeeilt, der führte in Beuteln und Schachteln sieben Hüte mit sich.
Und als sie alle drei auf den kleinen Platz kamen, blieben sie erst erschrocken stehen, fielen sich dann um den Hals und fingen an zu lachen und zu weinen vor lauter Freude.
»Hutmacher!« »Schneider!« »Schuster!« »Freund!« »Bruder!« »Kamerad!« so ging es in hellem Jubel durcheinander. –
»Nun, wie ist es euch inzwischen ergangen?« fragte endlich einer.
Da machten sie alle betroffene Gesichter und kratzten sich hinter den Ohren. Sie erzählten sich weiter nichts; es dachte sich jeder schon von selbst, wie es dem anderen ergangen war.
Aber gelernt hatten sie etwas, und die letzten Waren, die sie gefertigt hatten, durften sie nun als ihr Eigentum auf dem Markt von Hirschberg verkaufen, um einen Grund zu legen für ein neues Geschäft.
So zogen die drei fröhlich in Hirschberg ein und schlugen ihre Verkaufsplätze dicht nebeneinander auf. Sie waren voll der besten Hoffnung. Plötzlich aber erbleichten sie. Der Müller, den sie einmal hatten ausrauben wollen, kam auf sie zu und neben ihm ging der Ratspolizist.
»Es ist aus,« sagte der Schuster.
»Ja!« hauchte der Schneider.
Helden waren sie immer noch nicht geworden. Der Müller aber kam ganz freundlich näher, kaufte einen Anzug, ein paar Stiefel und einen Hut, bezahlte alles reichlich und pries laut die Ware. Der Ratspolizist nickte und sagte: ja, die drei seien berühmte Kaufleute aus Breslau, die[233] kenne er schon lange. Der gutmütige Mann war leider inzwischen noch kurzsichtiger geworden.
Wie nun den dreien das Geld in der Tasche klang und der Müller ruhig von dannen ging, wurden sie wieder vergnügt, und es stand ihnen bald ein neues Glück bevor. Der Bürgermeister ging über den Markt, schimpfte, daß die Handwerker nichts Rechtes mehr leisteten und man kaum einen vernünftigen Stiefel oder Rock bekommen könne, und stieß plötzlich auf die drei, die ihm bescheiden ihre Waren anboten.
O, was machte da die Stadtobrigkeit für erstaunte und glückliche Augen!
Ja, rief der Bürgermeister, das sei noch echte Handwerkskunst. So etwas gäbe es weder zu Augsburg, zu Venedig, zu Nürnberg oder zu Lübeck, so etwas gäbe es nur in Hirschberg!
Und er kaufte Anzug, Stiefel und Hut und bezahlte die Hälfte des Preises, während er die andere schuldig blieb.
Nun zog ein Rittersmann auf edlem Roß langsam über den Markt. Die drei Handwerker erkannten mit Schrecken, daß es jener starke Reiter war, den sie einmal überfallen, der ihnen aber den Speck abgenommen und ihnen die Haut gegerbt hatte. Der Ritter kam heran und summte leise vor sich hin:
Da glaubten sich die drei schon sicher erkannt; aber der Ritter machte seinen Einkauf, bezahlte gut und ritt davon, indem er laut sagte:
»Solch treffliches Handwerk soll man sich in der Welt suchen.«
Nun aber begann ein Sturm auf die Verkaufsstände der drei. Jeder wollte bei ihnen einen Anzug, ein paar Stiefel, einen Hut kaufen.
Da entstand ein Tumult auf der anderen Seite des Marktes. Der König von Polen zog in die Stadt ein. Er hatte siebzehn Kammerdiener und achtundfünfzig Soldaten bei sich. Aber er sah etwas schäbig aus. Die Krone und die Edelsteine hatte er aus Geldnot versetzen müssen, und die himbeersamtne und bernsteingelbe Hose war im Laufe der Jahre ein wenig fadenscheinig geworden. Trotzdem wurde er mit großer Ehrerbietung bewillkommnet. Er hörte aber kaum auf die Begrüßungsworte des Bürgermeisters und beachtete nicht die Bücklinge des Ratsdieners, welcher ihn für den Grafen Schaffgotsch hielt, sondern steuerte auf den Verkaufsstand der drei Freunde zu und wählte einen Federhut, einen Seidenmantel und ein Paar hirschlederne Stiefel.[235] Er bezahlte zwar nicht, aber er stellte einen langen Schuldschein aus.
Nun schien das Glück der drei Handwerker gemacht zu sein. Aber noch einmal faßte sie ein tödlicher Schrecken. Der Burgherr, der sie einmal hatte hängen lassen, kam mit einem Troß reisiger Knechte daher. Da duckten sich die drei armen Hascher tief über ihre Tische, und jeder von ihnen preßte beide Hände vor die Kehle.
Der Burgherr aber erkannte sie nicht. Er pries ihre Ware, kaufte den ganzen Rest und sagte zuletzt:
»Bares Geld habe ich nicht bei mir; aber ich gebe euch diesen Rubin, der so groß ist wie ein Apfel. Verkaufet den kostbaren Stein und teilt euch in den Erlös.«
Dann ritt er von dannen. Die drei Handwerker seufzten tief und erleichtert auf. Der Schneider aber sagte leise:
»Brüder, den Stein kenne ich. Er ist leider falsch. Aber es genügt uns, wenn uns das Leben und die Freiheit bleibt.«
Wie erstaunten sie aber, als bald darauf ein Frankfurter Jude zu ihnen kam, ihnen den Rubin für einen hohen Preis abkaufte und auf des Schneiders ehrliche Einwendung sagte: nur ein Dummkopf könne den Rubin für unecht halten; es sei der schönste Stein, den es je gegeben.
Glückselig saßen endlich die drei in der Herberge und teilten friedlich miteinander den Gewinn des Tages. Es war so viel, daß jeder von ihnen ein Handwerksgeschäft gründen konnte, das alle Sorge zeitlebens von ihnen nahm.
Wie sie noch so dasaßen, kam zur Tür der alte Mann herein, der ihnen einst vom Galgen geholfen und sie auf den neuen Weg geleitet hatte. Er trug noch das winzige Hütlein, die schlechten engen Stiefel und den buckligen Rock; aber er war freundlich und sagte:
»Ich freue mich über euch. Nun folgt mir und kommt mit.«
Da gingen sie verwundert hinter ihm her. Er führte sie zur Stadt hinaus gegen die Berge hin und ging plötzlich so schnell, daß sie ihm nicht zu folgen vermochten. Aber sie sahen, daß er sich auf einen Straßenstein setzte.
Als sie aber nun näher kamen, saß nicht der alte Mann auf dem Straßenstein, sondern der Burgherr. Der lächelte ihnen zu, schwang sich auf ein Roß, das am Wegrande weidete, und sprengte eine Strecke weit davon. Dann machte er halt, drehte sich um und winkte ihnen mit der Hand.
Wie nun die drei herbeieilten, saß nicht mehr der Burgherr auf dem Roß; sondern der Ritter, an dem sie zuerst ihre Räuberkunst probiert hatten.[238] Auch der Ritter sprengte schnell davon und verschwand hinter der nahen Wegbiegung.

Dort aber fanden ihn die drei nicht wieder, sondern der Müller trat ihnen entgegen, reichte ihnen die Hand und lachte.
Auch der Müller blieb nicht lange stehen, sondern verschwand in einem Wäldchen, aus dem gleich darauf auf einem prächtigen Araberrosse Wolfsklaue hervorritt.
»Kennt ihr mich nun?« fragte er, und seine Augen flammten schön und herrlich auf. Dann ritt er mit Windeseile gegen die Berge hin, verschwand im Wald und wurde wieder sichtbar, als er langsam und in feierlicher Größe den Kamm des Riesengebirges entlang ritt, der im roten Schimmer der untergehenden Sonne lag.
Da erkannten ihn die drei; da wußten sie, wer die Gestalten waren, die ihren seltsamen Lebenspfad gekreuzt, da wußten sie, daß es der Berggeist Rübezahl war, der gesunde Naturgeist, der alles Schlechte vernichtet und allem Guten aufhilft.
Und so war es und so ist es noch heute und wird es immer sein. Und darum muß auch zu allen Zeiten vom Rübezahl erzählt werden.
Paul-Keller-Bücher
»Es gibt in Deutschland und Österreich kaum einen zweiten Schriftsteller, der künstlerische Vornehmheit und die besondere Art volkstümlicher Herzlichkeit in Ernst und Humor so bedeutsam zu verbinden weiß, wie der Schlesier Paul Keller …« (Kölnische Zeitung.)
Ferien vom Ich
Roman.
40.-45. Auflage.
Preis M. 5.–, gebunden M. 6.–
Grünlein
Eine deutsche Kriegsgeschichte von einem Soldaten, einem Gnomen, einem Schuljungen, einem Hunde und einer Großmutter. Alten und jungen Leuten erzählt.
Bilderschmuck von Walter Bayer.
40.–45. Tausend. Gebunden M. 1.20
Waldwinter
Roman aus dem winterlichen Riesengebirge.
Mit Buchschmuck von G. Schütz.
56.–60. Auflage. Preis brosch. M. 5.–, geb. M. 6.–
Die Heimat
Roman aus den schlesischen Bergen.
Mit Buchschmuck von Philipp Schumacher.
35.–37. Auflage. Preis brosch. M. 5.–, geb. M. 6.–
Das letzte Märchen
25.–27. Auflage. Preis brosch. M. 5.–, geb. M. 6.–
Von Hause
Ein Paketchen Humor aus den Werken von Paul Keller.
Mit Bildern. 21.–26. Auflage. Gebunden M. 3.50
Der Sohn der Hagar
Roman. 44.–47. Aufl. Preis brosch. M. 5.–, geb. M. 6.–
Die alte Krone
Roman aus Wendenland.
26.–28. Auflage. Preis brosch. M. 5.–, geb. M. 6.–
Die Insel der Einsamen
Eine romantische Geschichte. 20.–24. Auflage.
Preis broschiert M. 5.–, gebunden M. 6.–
Die fünf Waldstädte
Ein Buch für Menschen, die jung sind.
Mit Bildern von G. Holstein u. R. Pfähler v. Othegraven.
22.–25. Auflage. Preis gebunden M. 3.50
Das Königliche Seminartheater und andere Erzählungen
Mit Bildern. 21.–26. Auflage. Preis gebunden M. 3.50
»Paul Keller … einer der feinsinnigsten Poeten, die unser Vaterland sein eigen nennt …«
(Literarisches Echo, Berlin.)
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
End of the Project Gutenberg EBook of Die fünf Waldstädte, by Paul Keller
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE FÜNF WALDSTÄDTE ***
***** This file should be named 61354-h.htm or 61354-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/1/3/5/61354/
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org Section 3. Information about the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.