Los von Rom
Eine Geschichte aus dem Leben.

The Project Gutenberg EBook of Los von Rom, by Anton Ohorn
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
Title: Los von Rom
Eine Geschichte aus dem Leben
Author: Anton Ohorn
Illustrator: Fritz Bergen
Release Date: February 1, 2020 [EBook #61287]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LOS VON ROM ***
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original wurde in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
Los von Rom
Eine Geschichte aus dem Leben.

Die 1. Auflage dieser Geschichte erschien unter dem Titel »Das neue Dogma«, ist aber vollständig vergriffen.
Eine Geschichte aus dem Leben
von
Anton Ohorn
Illustriert von Fritz Bergen
2. Auflage
(4. bis 9. Tausend)

Stuttgart
Verlag von Carl Weber & Cie.
Alle Rechte vorbehalten.
Druck des Süddeutschen Verlags-Instituts in Stuttgart.
Wer abenteuerliche Verwicklungen, romantische Liebesbeziehungen, oder jenen Naturalismus sucht, der die Wahrheit der Lebensverhältnisse nur in Sumpf und Schmutz finden zu können glaubt, für den ist diese Geschichte nicht geschrieben. Und doch macht sie gerade darauf Anspruch, wahr zu sein und Verhältnisse zu schildern, die dem Leben entnommen sind.
Nahezu 25 Jahre sind vergangen, seit der Glaubenssatz von der päpstlichen Unfehlbarkeit in Rom aufgestellt wurde. Es war ein Ereignis, welches die Gemüter der ganzen gebildeten Welt bewegte und die Herzen der katholischen Christen mit bangen Zweifeln und mit Schmerz erfüllte; die Verkündigung jener Lehre hat die volle selbstherrliche Macht Roms einerseits, die Schwäche und Haltlosigkeit kirchlich angesehener Kreise andrerseits bekundet.
Schwere Seelenkämpfe wurden damals von manchem ehrlich denkenden Katholiken, zumal von manchem katholischen Priester durchgestritten, und ein Bild solcher Kämpfe habe ich versucht, in diesem Werke vorzuführen. Ich habe gemeint, daß ich nicht ganz unberufen dazu sei; habe ich doch zum Teil an mir selbst erfahren, was ich berichte, und was man auch immer dem Werke zum Vorwurfe machen möge, eines wird nicht bestritten werden können, daß die Verhältnisse des katholischen Klerus, sein Leben und Empfinden, seine Anschauungen und deren Bethätigung auf Grund von Thatsächlichem geschildert sind. Die Gestalten der Erzählung sind wirkliche Typen und gezeichnet ohne jede Gehässigkeit.
Ich habe wiederholt beinahe mit einem Gefühl des Mitleids Werke gelesen, zumeist aus weiblicher Feder – denn es mag besonders in dem Cölibat und seinen Folgen für Schriftstellerinnen ein verlockender Reiz liegen – welche von katholischem Priester- und Mönchsleben handeln, und welche trotz aller Lobsprüche der mehr oder minder berufenen Kritik[6] von Unwahrheit in Situationen und Charakteristik strotzen. Ueber solche Verhältnisse vermag nur der zu schreiben, der einerseits ihre ganze erdrückende Schwere und andererseits ihre besondere und tiefere Bedeutung eingehend kennen gelernt hat, und darin liegt, wie ich anzunehmen wage, die Eigenart und die Berechtigung dieser Geschichte zugleich.
Ich darf wohl hoffen, daß ich darum auch von Einsichtsvollen weder mißverstanden, noch falsch beurteilt werde, wenn ich derselben mit einer kleinen Abweichung das Wort, welches Lessing von seinem »Nathan« gebraucht, voranstelle: »Wenn man mir sagt, daß ein Werk von so eigener Tendenz nicht auch einen gewissen Wert habe, so werde ich schweigen, aber mich nicht schämen. Ich bin mir eines Ziels bewußt, hinter dem man auch weiter mit Ehren bleiben kann«.
Der Verfasser.

Unter dem Titel »Los von Rom« geht das ursprünglich »Das neue Dogma« genannte Werk zum zweitenmale in die Welt, um zu erzählen, wie der Held »los von Rom« kam. Die Zustände in Oesterreich, wo dasselbe abspielt, haben sich in den letzten Jahren bedeutsam geändert; aus der nationalen Bewegung ist eine kirchliche hervorgewachsen, und sie hat das Schlagwort »Los von Rom!« geschaffen, und ähnliche Verhältnisse, wie die in der vorliegenden Geschichte geschilderten, haben Tausenden die Augen geöffnet. Darum dürfte das Buch neuerdings wieder besonders zeitgemäß erscheinen, und ich gebe mich, zumal eine ununterbrochene Nachfrage nach dem seit Jahresfrist vergriffenen Werke stattfand, der angenehmen Erwartung hin, daß es auch in seiner neuen Ausstattung und im Schmucke seiner Bilder eine freundliche Aufnahme finden werde.
Dr. Anton Ohorn.



Feierlicher Glockenklang zog weit hinein ins Land. Blauer Himmel lag über der Erde; auf den Feldern wiegten sich schwer die goldgelben Aehren, reif für den Sensenschnitt, und auf den Straßen und den grünen Wiesensteigen kamen von allen Seiten Leute im Sonntagsstaat heran nach der kleinen, freundlichen Stadt, die im Thale lag.
Sie hatte ein altertümlich-trauliches Gesicht. Der Rest einer alten, verwitterten Mauer drängte sich da und dort aus grünen Gartengehegen hervor, ein dicker, schwerfälliger Kirchturm sah hoch hinaus über die an einandergedrückten roten und grauen Dächer und über den bescheidenen Genossen, der das kleine Kloster der Bettelmönche am letzten Ende des Städtchens überragte.
Und die Glocke läutete noch immer mit langsamen, aber vollen und weichen Schlägen, als ob sie gute Botschaft zu sagen hätte.
Auf der hochgelegenen Straße, von der man in die sonnige Landschaft und auf die wandernden Menschen ringsum schauen konnte, saß bei einem Kapellchen auf einer Steinbank ein fahrender Gesell. Der erhob sich, als jetzt eine kleine[8] Schar von Landleuten herankam, lüftete zum Gruße seine Kappe, rückte sich das Ränzel zurecht auf dem Rücken und fragte:
»Mit Verlaub, da unten wird wohl heute ein besonderes Fest gefeiert?«
Der weißhaarige Bauer, welcher mit seinem Weibe dem Zug voranging, stützte sich einen Augenblick auf seinen Weißdornstecken, sah sich den Burschen an, und weil er ihm zu gefallen schien, sagte er im Weiterschreiten – denn er setzte voraus, daß der andere sich ihm anschließen wolle:
»Des seligen Sportelschreibers Frohwalt Sohn hat heute seine Primiz, sein erstes heiliges Meßopfer. Ein solch' Fest ist seit langen Jahren nicht mehr hier gewesen und darum kommt, wer nur immer kann, herbei, um demselben beizuwohnen. Bei uns heißt's, man soll, wenn's notthut, ein paar neue Schuhe auf dem Wege zerreißen, um den Segen eines neugeweihten Priesters zu erhalten, der eine besondere Kraft hat. Und diesmal ist's noch etwas anderes. Wir haben den alten, braven Sportelschreiber gekannt, und von Kindesbeinen an auch seinen Sohn, den Peter, und da wollen wir erst recht nicht fehlen am Ehrentag. Der Vater hätt' es noch erleben müssen, denn es ist ein großer Stolz für ein schlichtes Haus, wenn ein geistlicher Herr daraus hervorwächst und besonders einer wie der hochwürdige Herr Pater Peter, der gar so gescheit und fromm sein soll. Na, der Mutter und der Schwester ist auch die Freude zu gönnen, sind brave Leute, die sich recht und schlecht durchbringen und denen niemand etwas nachreden kann.«
Der Alte ging mit weitausgreifenden Schritten dahin, und sein Weib trippelte hastig nebenher, hinterdrein aber kamen Kinder und Enkel, Knecht und Magd. Die Glocke hatte jetzt ausgeklungen, und der Bauer sprach halb zurückgewendet:
»So, nun ist das erste Läuten vorüber, und in der Kirche wird's kaum noch Platz geben – das kommt davon,[9] daß bei euch jungem Volk kein Fertigwerden ist.« Dann redete er wieder leutselig mit dem wandernden Gesellen und frug nach seinem Handwerk und seiner Heimat, und so kamen sie ans Städtchen.
Durch einen altertümlichen Thorbogen führte der Weg hinein in die Gasse, und gleich zu ihrem Anfang stand zur Rechten ein kleines Haus, einstöckig, mit vier spiegelblanken Fenstern in der Front, dessen Thür umwunden war mit grünem Kranzwerke.
»Das ist des Sportelschreibers Haus!« sagte der Bauer, und der Geselle hätte sich's wohl denken können, denn Kinder und neugierige Frauen standen in der Nähe, den Ausdruck frommer, scheuer Spannung in den Gesichtern. Er sah einen plätschernden Brunnen unter einer Statue des heil. Johann von Nepomuk, dabei war eine Linde und eine Bank ringsum dieselbe; da sprach er:
»Hier bleibe ich und will warten, bis der Zug nach der Kirche geht. Gott befohlen!«
Und im Lindenschatten ließ er sich nieder neben einem Kindermädchen, das einen kleinen Knaben auf dem Arme schaukelte, stützte das Kinn auf den Griff seines Wanderstockes und wartete.
Im Erdgeschoß des kleinen Hauses aber war alles so blitzblank. Der Flur war gescheuert und mit weißem Sande bestreut, und in der großen Stube war kein Stäubchen zu sehen. Vor den Fenstern hingen weiße Vorhänge, und auf den Brettern standen blühende Blumen, die altertümlichen Möbel waren aufpoliert und an der Wand, der Thüre gegenüber, war ein einfacher Altar errichtet worden. Auf der blütenweißen Tischdecke befand sich ein Kruzifix, daneben zwei Leuchter mit brennenden Lichtern und in zwei kleinen Vasen duftende weiße und rote Rosen.
Vor dem Altar aber stand der junge Priester, Peter Frohwalt, eine jugendlich schöne Erscheinung, hochgewachsen[10] und schlank, mit einem frischen, von froher Erregung geröteten Antlitz, aus welchem zwei große, schöne, blaue Augen schauten. Das blonde Haar war kurzgeschoren und weiß schimmerte daraus die Tonsur hervor. Er trug das dunkle, wallende Priestergewand, und um den Hals den ringsum geschlossenen Kragen mit dem weißen Bändchen darum, das Collare. Zur Seite des Altars standen seine Mutter und seine Schwester. Erstere war eine Frau mit festen aber gutmütigen Zügen, in denen heute eine mühsam verhaltene Rührung lag, angethan mit einem dunkeln, verschossenen Seidenkleide, das wohl schon manchen Ehrentag des Hauses gesehen hatte; die Schwester war ein hübsches, hochgewachsenes Mädchen, dem Bruder ähnlich, und unter dem schlichten Hütchen, welches sie trug, drängten sich ein paar prächtige blonde Zöpfe hervor. Sie mochte vielleicht ein Jahr jünger sein als der neugeweihte Priester.
Dem Altar und den letzteren gegenüber standen um den alten Pfarrer des Ortes gereiht ältere und jüngere Geistliche, darunter die Mönche des in der Stadt befindlichen Kapuzinerklosters. Der Pfarrer, ein weißhaariger Herr mit milden, freundlichen Zügen trug den goldschimmernden Vespermantel, die andern zumeist weiße Chorhemden und darüber die Stola.
Der Pfarrer hatte seine Ansprache geendet, in welcher er den jungen Priester beglückwünscht und begrüßt hatte. Seine Worte waren ruhig und herzenswarm gewesen, und da er des verstorbenen Vaters des Primizianten gedachte, weinten Mutter und Tochter in Wehmut still für sich hin. Nun nahm der Jüngling vor dem Altare das Wort:
»Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: In domum Domine ibimus – ja, erfreut bin ich darüber, daß man mir sagt: Wir wollen hingehen in das Haus des Herrn!«
Mit diesem Ausspruch des Psalmisten hob er an, und seine anfangs bewegte Stimme wurde ruhiger und sicherer[11] und gewann einen weichen, wohlthuenden Klang. Vom Elternhaus ins Gotteshaus – welch ein schöner Weg! Von der Stätte, von welcher er Liebe empfangen, zu jener, von welcher aus er sie spenden wollte. – Das war der Grundgedanke, den er kurz und weihevoll ausführte, und dann schloß er:
»Mit reinem Herzen und mit reinen Händen will ich hintreten an den Altar des Herrn. Wer je mich gekränkt hat in meinem Leben, dem sei verziehen vom Grund der Seele, und wem ich wissentlich oder unwissentlich weh gethan, der möge mir verzeihen um dieser Stunde willen, in der Gott mich würdigt, der Wunder größtes zu vollbringen und Brot und Wein in seines ewigen Sohnes Fleisch und Blut zu verwandeln. Und wie ich meines toten Vaters gedenken werde bei meinem ersten heiligen Opfer, so will ich auch für euch beten, Mutter und Schwester. – Der Herr hat heute Großes gethan an uns allen, gepriesen sei sein Name – Amen!«
Hochaufgerichtet trat der junge Mann zu der beinahe fassungslosen alten Frau, die sich in seine umschließenden Arme schmiegte und nach der geweihten Hand des Sohnes faßte, um sie zu küssen, was dieser jedoch abwehrte, dann umarmte er die blühende, errötende Schwester – durch die kleinen Fenster aber flutete wärmer der Sonnenglanz herein und glänzte auf den priesterlichen Gewändern, auf den Rosen um das Kruzifix und auf dem blonden Scheitel des jungen Priesters.
Nun ordnete sich der Zug. Der alte Pfarrer und der Vorsteher des Kapuzinerklosters nahmen den Neugeweihten in die Mitte, die andern schlossen sich paarweise an, und den Priestern folgte Mutter und Schwester, sowie eine Anzahl Freunde der Familie. Im Flur des Hauses aber traten vor den Zug vier kleine, weißgekleidete Mädchen, die aus Körbchen, welche sie am Arme trugen, Blumen und Rosenblätter auf den Weg streuten.
Jetzt hoben die Glocken aufs neue an zu tönen – auch[12] jene von dem Klösterchen klangen darein – und langsam ging es im hellen Sonnenglanz durch die Gassen nach der Kirche.
Das Gotteshaus war umschlossen von dem Friedhofe, und ehe noch das Kirchenportal den Zug aufnahm, hatte der junge Priester dem Pfarrer einige Worte zugeflüstert und dieser den kleinen Mädchen eine Weisung erteilt. Sie bogen seitwärts ab nach dem Eingang zum Gottesacker, und zwischen den Kreuzen und Steinmälern ging der Zug zur Verwunderung der Neugierigen hin, bis er anhielt, wo hart am Wege auf einem schlichten Denkmal geschrieben stand:
Hier ruht in Gott der Sportelschreiber
Franz Frohwalt.
An den grauen Stein gelehnt stand hier ein Mann mit scharfgeprägten, verwitterten Zügen, der mit hellen Augen nach den Nahenden hinschaute und als sie ganz nahe waren, seinen alten Filzhut abnahm, so daß die grauen Haarsträhnen sich leicht im Winde bewegten. Sein Gewand war einfach wie das eines schlichten Handwerkers, und in der Hand hatte er einen kräftigen Naturstock.
»Das freut mich, daß Du zuerst Deinem toten Vater Deinen Gruß bringst und seinen Segen holst, Peter, und das hab' ich auch nicht anders erwartet,« sagte er mit klarer, wohltönender Stimme und reichte dem jungen Priester die Hand, welche dieser ergriff.
»Vetter Martin! Das ist lieb, daß Du da bist!«
»Bin gestern abend just wegen Dir heimgekehrt, aber das wollen wir jetzt nicht erörtern. Bete jetzt hier dein Vaterunser, und dann geh' in Gottes Namen in die Kirche und werde ein Priester nach seinem Herzen!«
Der seltsame Mann trat zurück unter die Leute, die sich hier angesammelt, Peter aber neigte sich über den grauen Stein, der seines Vaters sterbliche Reste deckte … und man hörte einige Augenblicke nur das klangvolle Tönen der Glocken[13] und verhaltenes Schluchzen ergriffener Frauen. Dann erhob sich der junge Priester, bedeckte sein Haupt, das er entblößt hatte, mit dem Barett und sprach wieder ruhig:
»In domum Domini ibimus!«
Dann lenkte der Zug in das von Menschen dichtgefüllte Gotteshaus ein, und mit dem Glockenklang mischte sich der lärmende Schall von Trompeten und Pauken, aus deren Gewirr sich endlich in klarer Majestät die Orgel herausarbeitete, deren Töne auch hinausdrangen in den stillen Friedhof, wo Vetter Martin noch lange an dem Grabe Franz Frohwalts stand. Die Kirche selbst betrat er nicht.
Drinnen hatte der Gottesdienst seinen Anfang genommen. Der Guardian der Kapuziner hielt die Festpredigt, während welcher der Primiziant zur Seite des Hauptaltars auf einem Faldistorium, einem rotgepolsterten Lehnstuhle, saß, umgeben von den andern Priestern, und dann folgte die feierliche Messe, in welcher der junge Priester, gleichfalls unter zahlreicher Assistenz, zum ersten Male von seiner Würde Gebrauch machte.
Als er die Hostie in den Händen hielt, und das Wort sprach, durch welches nach seinem Glauben das Wunder der Verwandlung sich vollzog: »Hoc est corpus meum – das ist mein Leib,« als er das Knie beugte vor der Gottheit und sich in tiefem, andachtsvollem Schweigen die Häupter aller Anwesenden neigten, rann ihm ein Schauer durch den Leib, und er ward erst ruhiger, als nach der Wandlung die Orgel mit weichen Tönen wieder einsetzte und zarte, süße Frauenstimmen vom Chor herab das »Benedictus« anstimmten.
Nach dem Hochamte drängte das Volk heran an das Gitter, welches den Hochaltar gegen den andern Raum absperrte, und die Vordersten knieten nieder. Es war die Stunde gekommen, da der Neugeweihte seinen ersten priesterlichen Segen erteilte. Die Ersten, welche ihn empfingen, waren seine Mutter und seine Schwester. Er legte[14] ihnen die weißen Hände auf die Häupter und machte mit stillem Gebete über sie das Zeichen des Kreuzes – desgleichen allen, die sich herandrängten.
Eine schwüle Luft erfüllte das Gotteshaus, der Schweiß rann dem jungen Priester über das Gesicht, und er trocknete sich immer wieder mit seinem Taschentuche ab, aber unermüdlich und mit freudigem Herzen übte er seine Pflicht, bis niemand mehr da war, welcher seines Segens begehrte. Es war leer geworden in der Kirche, nur seine Mutter und Schwester saßen noch in der vordersten Bank, die Seele erfüllt von Stolz und Glück, und warteten auf ihn. Er legte in der Sakristei die Meßgewänder ab, dann trat er in seinem schwarzen Talar hervor, beugte vor dem Hochaltar unter der ewigen Lampe das Knie, und nun gingen die drei Menschen, der junge Priester in der Mitte, hinaus.
Es war um die Mittagsstunde geworden, die Gasse lag still und einsam, und langsam schritten sie hin und schweigend. Aus den Fenstern lugte da und dort ein Gesicht und nickte ehrfürchtig-vertraulich heraus. Peter Frohwalt war es seltsam zumute; ihm war, als wäre er eben erst ein anderer geworden. Er mußte daran denken, wie er als Knabe in diesen Gassen gespielt hatte, wild und lustig, wie er in manchem dieser kleinen Giebelhäuser bis unter das Dach hinaufgeklettert war mit fröhlichen Genossen und manchen dummen Streich verübt hatte, von dem die Leute doch wissen mußten, die heute demütig vor ihm auf den Knieen gelegen, um seinen Segen gebeten und ihm die Hand geküßt hatten. Seine Mutter aber sah ihn immer wieder von der Seite her an mit glücklichen Augen, und bei aller Ehrfurcht vor dem geweihten Sohne hätte sie ihn am liebsten wie in Kindertagen bei der Hand genommen und hätte ihn so durch die stille, sonnige Gasse geführt.
So kamen sie zu dem kleinen Hause beim Thore. Die Guirlande um die Thüre war welk geworden, wie die Blumen[15] auf der Schwelle, aber die Fenster blinkten freundlich, und hinter der einen Scheibe sah das scharfgeschnittene Gesicht des »Vetter Martin« durch.
Als die drei in die Stube traten, kam er ihnen entgegen und reichte dem jungen Priester die Hand.
»Na, Gottes Segen zum heutigen Tage, Peter, und da habe ich Dir auch ein kleines Erinnerungszeichen gebracht!«
Er reichte dem Neugeweihten ein metallenes Kruzifix, nicht groß, aber augenscheinlich altertümlich und wertvoll.
»Ich hab's in Brüssel aufgetrieben – 's ist eine gute flandrische Bildnerarbeit aus dem 16. Jahrhundert, und ich denke, es paßt für Dich und macht Dir Freude.«
Peter Frohwalt besah zugleich mit der Mutter und Schwester das kleine Meisterwerk, stellte es dann auf den als Altar benützten Tisch zwischen die Rosen, und dankte dem Alten in herzlichen Worten. Der hatte sich in einem Lehnstuhl am Fenster niedergelassen und wehrte ab:
»Laß gut sein – ist nicht der Rede wert – weist ja, wie ich's mit Dir meine, auch wenn ich heute nicht bei Deiner Primiz war. Morgen, wenn Du zum erstenmal eine stille Messe lesen wirst, komme ich, aber heute, unter den vielen neugierigen Menschen ohne Andacht, die in die Kirche gehen wie in eine Komödie, hätte ich mich nur geärgert. Auch daß ich mir Deinen Segen nicht habe geben lassen, nimm mir nicht übel. Ich hab' Dich auf meinen Armen getragen und auf meinen Knieen reiten lassen und habe Dir manchen Klaps in aller Liebe und Freundschaft gegeben, wenn Deine Pfoten unnötigerweise mit allem Teufelsdreck besudelt waren, und ich kann mir nicht einreden, daß Deine Hände durch das bischen Salböl was Besonderes geworden sind … aber freuen thut's mich doch, daß ich just zu Deinem Ehrentag wieder im alten Neste eingetroffen bin.«
Die Mutter sah ein wenig verstimmt drein bei den Worten des wunderlichen Alten, der, das Kinn auf seinen[16] derben Stock gestützt, hinaus in die Sonne blinzelte, Peter Frohwalt aber hatte einen Sitz zu ihm herangezogen und fragte:
»Wo bist Du denn diesmal gewesen?«
»In Belgien und in Holland – sehr interessante Länder, mein Sohn, mit wunderlichen alten Städten, prächtigen Kunstsammlungen und einem fleißigen, verständigen Völkchen.«
»Und Du bist wieder zu Fuße dort gewesen?«
»Na ob – hier ist die ganze Reisegelegenheit!« – er deutete auf den kräftigen, knorrigen Stock – »das ist nun das achtzehnte Exemplar meiner Sammlung und heißt der Holländer – 's ist dabei ein ehrliches deutsches Eichengewächs. Ich habe manches Hübsche mitgebracht; wenn nur die alten Sächelchen nicht so teuer wären, oder meine Einkünfte weiter langten. Aber komm und sieh Dir's selber an. – Manches macht Ihnen vielleicht auch Spaß, Frau Gevatterin« – fügte er, zur Mutter gewendet, bei, die ihre Augen gar nicht von dem geistlichen Sohne abzuwenden vermochte und jetzt mit einer freundlichen Antwort einen Blick nach der Uhr warf.
»Ach so« – sagte der Alte, indem er sich erhob – »es wird wohl Essenszeit; wie wird denn das heute mit Euch?«
»Der hochwürdige Herr Pfarrer hat sich's nicht nehmen lassen, heute die Tafel auszurichten und uns einzuladen,« sagte die Frau mit unverkennbarem Stolze, und Peter Frohwalt fügte bei:
»Du kommst mit, Vetter Martin, der Pfarrer wird sich über den Gast freuen – –«
»Hm,« brummte der Alte, indem er den Kopf hin- und herwiegte und das linke Auge zukniff, »weißt Du, heute vielleicht nicht! Der Pfarrer ist gut und mit dem Kapuzinerguardian ist auch auszukommen, die nehmen mir's nicht übel, wenn mir einmal der Schnabel in die Quere steht, aber die andern, die heute da sind … na, es könnte einen Mißton[17] geben, wenn meine Glocke nicht immer mit den andern zusammenklingt, und den möcht' ich heute am wenigsten ins Pfarrhaus tragen. Darum Gott befohlen!«
»Ich gehe ein Stückchen mit Dir, Pathe Martin,« sagte jetzt Marie – »wir haben noch Zeit bis zur Tafel, und ich will noch einmal nach meiner armen Freundin Grethe Freidank sehen.«
»Ach, das ist das Weib des Uhrmachers; was ist's mit der?«
»Sie liegt seit vierzehn Tagen schwer am Nervenfieber und gestern abend ist's gar nicht gut gegangen.«
»Das thut mir leid … Die Leute können doch kaum drei Jahre verheiratet sein, das kommt noch so mitten ins junge Glück hinein, und Freidank ist ein braver Mensch. Sie haben wohl auch ein Kind?«
»Ja, ein herziges Mädel von zwei Jahren,« sagte Marie mit leuchtenden Augen.
»Na, da komm!«
Der Alte faßte seinen »Holländer« fester, gab dem Priester und der Mutter die Hand und ging. Er trat mit dem schönen, frischen Mädchen hinaus in den Sonnenschein.
»Wie ist mir's denn, ist das Weib Freidanks nicht eine Evangelische?« fragte er.
»Ja, er hat sie auf der Wanderschaft kennen gelernt und heimgeführt, wie er hier das Geschäft von seinem Vater übernahm. Es hat damals viel Gerede drüber gegeben – du warst gerade in Ungarn – und die fremde, junge Frau ist mit Mißtrauen angesehen worden. Aber sie war so freundlich und so fleißig, daß jeder ihr gut sein mußte, und an mich hat sie sich gar sehr angeschlossen, so daß wir rechte Freundinnen geworden sind.«
»Das freut mich, Marie!« sagte Martin mit besonderer Wärme – »und wenn du hinkommst, sag' auch von mir einen Gruß, und ich ließe gute Besserung wünschen. Ich komme[18] wohl auch selber vor, denn ich habe eine Arbeit für Freidank! Adieu!«
Er gab dem Mädchen die Hand und bog nach der Seitengasse, an deren Ende in einem kleinen Garten sein Haus stand.
Nach einem Viertelstündchen kehrte Marie heim mit ernstem Gesicht.
»Es geht sehr schlecht!« sprach sie – »das ist ein trüber Tropfen in meine heutige Freude.«
Peter Frohwalt sagte nichts. Er hatte seinen Cylinderhut ergriffen und die schwarzen Handschuhe und streifte dieselben an; die Mutter aber band ihre Haube sich fester, und dann gingen die drei nach dem Pfarrhause.
Das lag so freundlich und behäbig nahe bei der Kirche. Zwei alte Linden standen davor und beschatteten den Eingang, und zur Seite schloß sich ein kleiner, gutgepflegter Garten an. In demselben, im Schatten von Obstbäumen lustwandelten die geistlichen Herren, bis das festliche Mittagessen angerichtet sein würde. Mit dem weißhaarigen Pfarrer der Stadt ging ein Amtsbruder aus der Nachbarschaft, der erst vor einem halben Jahre in diese Stelle gekommen war und die Verhältnisse der Gegend noch nicht kannte. Er war ein behäbiger Herr mit wohlgenährtem, glänzenden Gesichte, in welchem nur der unruhige Ausdruck der Augen störte. Er frug jetzt im Gespräche:
»Sagen Sie mir doch, wer war denn eigentlich der wunderliche alte Kauz, der auf dem Gottesacker den Primizianten anredete, dieser »Vetter« Martin? Auf mich machte er einen Eindruck wie Ahasver, der ewige Jude.«
Der alte Pfarrer lächelte gutmütig.
»Etwas von Ahasver haftet ihm wirklich an; er ist ein ewiger Wanderer, der schon ein gut Stück Welt gesehen und viel erfahren hat. Er ist mit Pater Frohwalt gar nicht verwandt, aber mit dessen Vater so befreundet gewesen, daß er[19] als Vetter in der Familie gilt. Er ist ein prächtiges Original, welchem man gerne manches nachsieht, denn in tiefster Seele ist er gut. Sein Vater war ein Kaufmann hier im Orte und hat sein Schäfchen ins Trockene gebracht. Der Sohn sollte studieren und hat's auch mit der Theologie versucht. Aber er gab's bald auf, trieb dann Naturwissenschaften und Altertumskunde, und als damals sein Vater starb, kam er hierher, verkaufte das Geschäft des Alten, erwarb sich ein kleines Häuschen in der Berggasse und fing nun an zu wandern. Er lebt sehr bescheiden – man sagt, daß er nur Brot und Vegetabilien genieße – und verwendet sein bischen Rente auf seine Reisen. Er war schon in Rußland, Frankreich, in der Schweiz, in Ungarn, in Schweden und Gott weiß wo – und überall zu Fuß. Wenn er wieder einmal heimkommt, bringt er mancherlei mit, so daß er ein richtiges kleines Museum in seinem Häuschen hat … wie gesagt, ein Original, aber keines von den schlechtesten.«
Jetzt kam der Primiziant mit seinen beiden Verwandten und alle wurden herzlich begrüßt. Nicht lange darauf konnte man zu Tische gehen. Das Speisezimmer in der Pfarrei lag ebenerdig und nach dem Garten zu, und es herrschte eine behagliche Ruhe darin; auch das matte, durch die rebenumrankten Fenster aufgehaltene Licht wirkte stimmungsvoll. Der lange Tisch war mit blendendweißem Linnen gedeckt, und zwischen den Blumenvasen standen lang- und kurzhalsige Flaschen: Der alte Pfarrer schien zu Ehren des jungen Priesters alles aufzubieten, was sein Haus und seine Köchin leisten konnten.
Peter Frohwalt erhielt den Ehrenplatz an der Mitte der Tafel auf einem bekränzten Sitze; ihm zur Rechten saß seine Mutter und neben ihm der Pfarrer, zu seiner Linken seine Schwester, welche den Guardian als weiteren Nachbar hatte. Es wäre nicht ohne Interesse gewesen, diese Gesichter zu betrachten: Das jugendlich frische Antlitz des Primizianten[20] mit seinen leuchtenden blauen Augen, die halb verlegen, halb glückselig dreinschauenden beiden Frauen, das milde, sanft gerötete Gesicht des greisen Pfarrers, das von dem Kranze schneeiger Haare freundlich umrahmt war, die energischen und doch sympathischen Züge des Guardians, dem der lange, graumelierte Bart auf die braune Kutte weit herabsank, die feisten Wangen und lauernden Augen des fremden Pfarrers, einige gleichgültige Dutzendgesichter anderer Geistlicher und am untern Ende das hagere, blasse Antlitz des jungen Stadtkaplans, aus welchem ein Paar stechende, schwarze Augen stark hervortraten … das alles hatte sich in dieser Tafelrunde zusammengefunden.
Der alte Pfarrer hatte das Tischgebet gesprochen und die Stimmung wurde bald genug zwanglos und belebt; auch die Frauen legten die anfängliche Scheu ab, und Marie unterhielt sich heiter mit dem gesprächigen Kapuziner. Nur der Kaplan blieb ernst und gemessen.
Toaste waren ausgebracht worden, die Flaschen auf dem Tische leerten sich, und der Nachmittag lief gegen den Abend zu. Da klopfte es an der Thüre, und gleich darauf trat ein alter Mann ein und kam langsamen Schrittes auf den Pfarrer zu. Es war der Küster. Er war seit nahezu vierzig Jahren in seinem Amte und durfte sich deshalb auch manche Vertraulichkeit erlauben. Darum trat er ohne weitere Anmeldung hier ein.
Der Pfarrer sah darin auch nichts Besonderes; er lehnte sich behaglich in seinem Sitze zurück, wischte sich den Mund mit der Serviette und fragte:
»Na, was bringen Sie denn, Hummel?«
»Hochwürden, Herr Pfarrer, die Frau vom Uhrmacher Freidank ist vor zehn Minuten gestorben, und da wollt' ich fragen, ob ich das Totenglöckel läuten soll – – weil sie doch eine Evangelische – –.«
Das Lächeln auf den Lippen des greisen Priesters erlosch,[21] aufrichtiges Mitleid stand in seinen guten Augen, aber zugleich auch ein gewisser Ausdruck ängstlicher Hilflosigkeit.
»Das ist ja sehr traurig – das thut mir herzlich leid – – es war ein so rechtschaffenes, hübsches Paar! Der arme Freidank! – Ja, das Sterbeglöckchen – ja – ja – na, ich hätte ja eigentlich – hm – was meinen Sie, Pater Ignaz?« Mit der letzten Frage wandte er sich an den jungen Kaplan, der mit seinen scharfen Augen ihn fest anschaute und nun mit wenig klangvoller, ganz ruhiger Stimme sagte:
»Davon kann doch wohl nicht die Rede sein, Herr Pfarrer; das ist eine Ehre, die nur dem katholischen Christen zukommt, dessen Seele damit dem Gebet der Gläubigen empfohlen wird; dem Protestanten nützt das Gebet nicht, denn er kann des Himmels nicht teilhaft werden!«
Ein lautes Aufschluchzen unterbrach die peinliche Stille, welche diesen Worten gefolgt war, und alle Augen wendeten sich nach Marie, welche ihr Gesicht in den Händen barg; die Todesnachricht und nun noch dieses harte Wort schnitten ihr in die Seele, und zwischen Schluchzen und Weinen preßte sie heraus:
»Sie war sehr gut, und ich glaube, daß sie in den Himmel kommt!«
Ein strafender Blick aus den Augen des Kaplans, die sich mit jenen des fremden Pfarrers seltsam und verständnisvoll kreuzten, traf sie, der alte Stadtpfarrer aber sagte mit gepreßter Stimme: »Na ja, Hummel, dann muß es freilich unterbleiben – ein kleiner Unterschied zwischen Katholiken und Evangelischen wird schon gemacht werden müssen – na ja!«
Der alte Kirchendiener ging mit gesenktem Kopfe, ohne einen Gruß, mit langsamen, müden Schritten hinaus … im Speisezimmer selbst aber war es vorbei mit der Feststimmung. Peter Frohwalt erhob sich unter dem Vorwande,[22] daß er an diesem Tage noch eine Stunde stiller Sammlung für sich haben wolle und entfernte sich mit Mutter und Schwester, die Zurückbleibenden aber waren ernst und schweigsam geworden. Endlich sagte der Guardian:
»Daß man nicht beten soll für einen guten, braven Menschen, auch wenn er nicht unseres Glaubens ist, geht gegen meine Meinung von der Nächstenliebe und von der Güte Gottes; ich werde der Frau Freidank in der Messe gedenken.«
Ein heißer Strahl zuckte über die Wange des Kaplans, er preßte die schmalen, blutleeren Lippen aufeinander, als der alte Pfarrer hinzufügte:
»Das will ich ebenfalls thun – Gott gebe dem armen jungen Weibe die ewige Ruhe!«
Der fremde Pfarrer aber mit dem vollgeröteten Gesichte sprach ernst:
»Ich habe hier die Meinung des Pater Ignaz – es nützt solches Gedenken nicht der ketzerischen Seele und ist eine Entweihung des heiligen Meßopfers. Wie kann man jenen die Gnadenmittel der Kirche zuwenden wollen, welche in böswilliger Verstocktheit dem alleinseligmachenden Glauben fernbleiben?«
Der Kaplan nickte zustimmend und seine Augen blitzten unheimlich scharf, als er sagte:
»Es geht auch gegen kirchliche Lehre und Ueberlieferung.«
Der Stadtpfarrer sah mit seinem gutmütigen Gesichte ängstlich drein, aber der Guardian strich mit seinen weißen Fingern sich langsam durch seinen wallenden Bart, schaute den jungen Priester ruhig und groß an und erwiderte:
»Der Herr verkehrte mit dem Samariterweibe und mit den Pharisäern, und steht nirgends zu lesen, daß er verboten hat, für eines andern Seele zu beten. Fanatismus ist zu allen Zeiten zu nichts nütze gewesen, und die Nächstenliebe, welche Christus mit in das oberste Gesetz für die Menschen[23] stellt, gilt auch für Andersgläubige; darum hat der Herr die Geschichte erzählt vom barmherzigen Samariter.«
Nun mischten sich andere in das Gespräch und es war ziemlich laut in dem Speisesaale der alten Pfarrei, denn die Gemüter erhitzten sich an Wort und Wein, und es war zuletzt gut, daß die fremden Gäste aufbrechen mußten.
Während dem war Peter Frohwalt, nachdem er daheim seinen Priestertalar abgelegt, und einen langen schwarzen Tuchrock angezogen hatte, allein hinausgegangen in den schönen Sommerabend. Er hatte einen einsamen Feldweg eingeschlagen, der ihn auf einen Hügel führte, und von da sah er herab auf die friedliche kleine Stadt im Thale mit ihren weißen Häusern zwischen den grünen Gärten, und der tiefe Sonntagsfriede, welcher über dem ganzen Bilde lag, stimmte auch ihn ruhig und friedlich, so daß er, da ihm das verstorbene Weib des Uhrmachers in den Sinn kam, ein stilles Vaterunser betete. Er war in strengen kirchlichen Anschauungen erzogen, aber sein Herz war warm geblieben, und dem Zwange des Herzens war er in diesem Augenblick gefolgt.
Zur selben Zeit aber befand sich seine Schwester in der Wohnung des Uhrmachers Freidank. Sie lag in der Webergasse im Erdgeschosse eines kleinen Hauses. Sonst war in den beiden Zimmern, von welchen das vordere zugleich als Werkstatt diente, alles sauber und in schönster Ordnung, aber die liebe ordnende Hand hatte in der letzten Zeit gefehlt, und heute war sie kalt und starr geworden für immer.
Als Marie eintrat, war ihr Freidank, ein hübscher junger Mann mit dunklem Vollbart, entgegengekommen und hatte ihr die Hand gereicht. Die Thränen liefen ihm über die Wangen, als er mit gepreßter Stimme sagte:
»Sie wissen's wohl schon – – o, es ist hart, es ist bitter!«
Auch das Mädchen konnte die Thränen nicht zurückhalten.
»Ich möchte sie sehen!« sprach sie leise, und der Mann[24] führte sie schweigend in das geräumige Nebengemach. Die abendliche Sonne spielte zwischen grünem Laubwerk freundlich herein, und ein leiser Schimmer wob sich um das friedliche, schöne Antlitz des jungen toten Weibes, das, mit einer leichten Decke verhüllt, wie schlafend in seinem Bette ruhte. An dem Lager aber stand, hochaufgerichtet auf den Fußspitzen, ein kleines, zweijähriges Mädchen, blond wie die Tote, und haschte mit seinen Händchen nach der kalten, erstarrten Hand, und zupfte an der Decke, und sagte immer wieder halblaut: »Mutterchen, Mutterchen!«

Da schluchzte der Mann laut auf, Marie aber hob das Kind auf ihren Arm, zog es an sich und sprach:
»Mutterchen schläft!«
Dann sah sie tiefergriffen auf die Leiche der Freundin und hierauf nach dem beinahe fassungslosen Manne.
»Es ist wirklich, als ob sie schliefe – so ruhig, so schön! Gott tröste Sie, Herr Freidank … er wird wissen, warum er Ihnen diese Prüfung auferlegt. Bleiben Sie standhaft um Ihres kleinen Grethchens willen und glauben Sie nur – alle im Städtchen nehmen an Ihnen den herzlichsten Anteil.«
Der Uhrmacher wischte sich mit dem Taschentuche die Thränen ab und sagte:
»Sie sind ja so herzensgut, Fräulein Marie – vergelt's Ihnen Gott! Ja, getragen werden muß es freilich, wenn ich auch nicht recht weiß, wie. Ach, meine gute, liebe Grethe!«
Marie ging hin und her in den beiden Zimmern und ordnete da und dort ein wenig. Am Fenster blühte ein Rosenstock über und über. Sie brach eine der schönsten Blumen und legte sie still auf die Brust der Toten, dann sprach sie:
»Ich komme morgen früh wieder, um nach dem Kinde zu sehen.«
»Die Nachbarin Becker ist auch schon dagewesen; sie will Grethel einstweilen zu sich hinübernehmen!« antwortete der Mann; dann reichte er dem Mädchen, das sich zum Gehen[25] wandte, warm die Hand und sagte noch einmal: »Vergelt's Gott!« Marie aber vermochte nicht zu sprechen; sie eilte mit ausbrechenden Thränen hinaus.
Die Gasse herein aber kam soeben mit glücklich leuchtendem Gesicht ihr Bruder. Sie sah ihn kommen, aber sie wartete nicht auf ihn. Seine Seligkeit und ihr Jammer paßten doch nicht recht zusammen, und nach den Worten, welche heute auf der Pfarrei gefallen waren, hatte sie eine unbestimmte Furcht, mit ihm über die Tote zu sprechen.
Als sie heimkam, läutete eben die Vesperglocke, und die Mutter saß noch in ihrem verschossenen Seidenkleide am Fenster und betete.



Am andern Morgen bereits um sieben Uhr hatten der Pfarrer, sowie Peter Frohwalt gleichzeitig ihre Messe gelesen, der erstere am Hochaltare, der andere an einem der Seitenaltäre. Die Kirche war nur wenig besucht. In einer der hintersten Bänke, im Halbdunkel unter dem Chor, kniete der Uhrmacher Freidank und hatte sein Gesicht tief herabgebeugt; er betete für die arme Seele seines Weibes, und hatte nicht im mindesten das Bedenken des Kaplans P. Ignaz, daß sein Gebet ein verlorenes sein müsse. Nicht weit von ihm saß der Vetter Martin, und schaute beinahe unverwandt nach dem jungen Priester hin, der mit dem Ausdruck aufrichtiger Andacht seines Amtes waltete.
Auch diesmal fanden sich nach der Messe einige Frauen, die sich den Segen des Neugeweihten erbaten, und Martin trat, ohne daran teilzunehmen, hinaus ins Freie. Der Morgen war herrlich, und der alte Wanderer sog tief den Atem der Natur ein. Jetzt sah er Freidank und ging auf ihn zu, um ihm die Hand zu drücken:
»Tröste Sie Gott, mein Lieber – und sei'n Sie ein Mann! Noch liegt der blaue Himmel über Ihnen und die[27] blühende Erde um Sie hier, und auf dieser lebt Ihnen ein liebes Kind – 's ist Ihnen viel genommen, aber auch viel geblieben.«
Der traurige Mann nickte einige Male wehmütig mit dem Kopfe, und wandte sich mit einem Händedrucke schweigend ab nach dem Friedhofe. Martin ließ ihn allein – er focht es so vielleicht am besten mit sich selber aus. Jener aber ging zwischen den grünen Hügeln hin – er suchte den Totengräber, um ihn zu fragen, wo er seinem jungen Weibe das letzte Bett machen wolle. Endlich sah er ihn im fernsten Winkel des Gottesackers mit dem Spaten hantieren. Er ging langsam auf ihn zu, und wie er ihn grüßte, hörte der Mann mit seiner Arbeit auf, stützte sich leicht auf den Griff seines Werkzeuges und sah teilnehmend zu dem andern empor.
»Für wen ist denn die Grube?« fragte Freidank.
Der Totengräber war kein besonderer Gefühlsmensch, aber es stieg ihm doch seltsam heiß in die Kehle, als er erwiderte:
»Hier soll Ihre Frau liegen!«
Der Uhrmacher schlug die Hände zusammen und warf einen Blick hinauf nach dem lachenden Himmel, auf welchen ihn Vetter Martin eben erst verwiesen hatte.
»Hier, wo die Verbrecher und Selbstmörder eingescharrt werden? – O du lieber Gott!«
Der Totengräber zuckte mitleidig mit den Achseln: »'s ist einmal so Vorschrift!«
»Hat der Herr Pfarrer das so angeordnet?«
»Das gerade nicht, aber das ist bei solchen Fällen immer so, und der Herr Kaplan hat mir's heute in aller Frühe wieder eingeschärft. Reden Sie doch einmal mit dem Pfarrer, Herr Freidank – – ich thät's ja gerne anders machen, wirklich, denn mir will der Unterschied doch auch nicht einleuchten zwischen Evangelischen und Katholischen – unser Herrgott muß doch für alle derselbe sein!«
»Ich will einmal hingehen, Thomas – wartet so lange mit der Arbeit! Das wär' ja entsetzlich, wenn sie meine gute Grethe hier einscharrten!«
Der Uhrmacher ging wiederum langsam zwischen den Gräbern hin mit gesenktem Kopfe und wandte sich vor dem Friedhofsthore nach der Pfarrei zu. Die alten Linden rauschten ihm freundlich und traulich entgegen, und aus dem Garten wehte Rosenduft heraus auf die Gasse. Er ging durch den breiten Flur die altertümliche Holztreppe empor und pochte an der Thür des Pfarrers an. Auf das »Herein!« trat er in das freundliche, sonnenhelle Gemach, das außerordentlich einfach ausgestattet war. Zwei zahme Kanarienvögel hüpften, auf jedem der Fenster einer, zwischen den Blumentöpfen hin und her, und der weißhaarige Priester, der eben sein Frühstück eingenommen, spielte bald mit dem einen, bald mit dem anderen.
Jetzt wendete er sein mildes, gutes Gesicht dem Eintretenden zu, und mit dem Mitleid mischte sich in seinen Zügen eine unverkennbare Verlegenheit. Er reichte Freidank sogleich die Hand und sagte:
»Mein guter Herr Freidank, ich nehme herzlichen Anteil an Ihrem herben Verluste. Wenn ein solches Glück so plötzlich vernichtet wird, mag man fast geneigt sein, mit dem lieben Gott zu hadern, aber glauben Sie nur, der Vater im Himmel weiß auch, warum er das gethan hat und er wird Ihnen seinen Trost nicht entziehen!«
»Ja, ja, Herr Pfarrer – 's ist hart,« sprach Freidank, der den Sitz, welchen ihm der Priester anbot, ablehnte, so daß auch dieser stehen blieb – »sie war ein gutes, braves Weib, und nun soll sie nicht einmal ihre letzte Ehre haben – das ist das Bitterste.«
»Wieso? – Was meinen Sie?« fragte der Pfarrer einigermaßen verlegen.
»Da wird ihr Grab gemacht an der Friedhofsmauer, im[29] verlorensten, verrufensten Winkel, wo vor zwei Jahren der Trunkenbold, der sich im Brunnwalde aufgehängt hatte, verscharrt worden ist … muß das wirklich sein, Herr Pfarrer? Sie hat ja im Leben keinem Menschen ein Leid gethan; sie hat ihren Herrgott und ihren Nächsten rechtschaffen geliebt, sie ist ein braves Weib und die beste Mutter gewesen« – dem Manne stockte die Stimme vor Schluchzen – »und nur, weil sie eine Evangelische ist … muß das sein, Herr Pfarrer?«
Das milde Gesicht des Priesters war bleicher geworden und seine Stimme klang unsicher:
»Hm – na ja, mein guter Herr Freidank … ich habe ja Ihre liebe Frau sehr geschätzt und habe ihrer auch heute gedacht in meinem Meßopfer, und wenn's nach mir ginge, und ich dürfte, wie ich wollte … aber, na ja, da sind nun ganz bestimmte Vorschriften, von denen nicht abgewichen werden darf, und mit denen es das hochwürdige erzbischöfliche Konsistorium in Prag sehr genau nimmt – – und, wissen Sie, dann ist der Pater Ignaz, so ein junger Geistlicher hat die Augen überall … na ja, kurz, mein guter Herr Freidank, ich kann's nicht ändern.«
»Und da soll sie wirklich verscharrt werden wie ein Tier, meine liebe, arme Grethe, ohne Sang und Klang, denn die Glocken werden ja auch nicht geläutet, neben dem erhängten Säufer und Diebe? – das ist ja wie auf dem Schinderanger …«
»Na – na, so dürfen Sie nicht sagen! s'ist ja immer noch im Friedhof, auf dem Gottesacker, und sie schläft auch dort in des Herrn Hut …«
»Das hoff' ich« – sagte der schlichte Mann mit Nachdruck – »sonst müßt ich auch an unserm Herrgott verzweifeln; an der Nächstenliebe thu' ich's nun beinahe. Gott befohlen, Herr Pfarrer!«
Der Geistliche wollte noch etwas sagen, aber Freidank hatte seinen Hut ergriffen und war fortgegangen. Der greise[30] Priester holte tief Atem; er trat ans Fenster, aber ihm war der Sonnenschein verbittert, der über der Erde lag, und seine Vögel lockten ihn mit Zwitschern und Flattern umsonst zu dem unterbrochenen Spiele. Ihm war das Herz schwer geworden, und die Seele that ihm weh. So sah er traurig dem Manne nach, der eben unten aus der Hausthüre trat, und, den Hut tief in die Stirn gezogen, langsam in die Gasse hineinging. Dieser wandte sich nach dem Hause des verstorbenen Sportelschreibers, dort hatte er stets freundliche Teilnahme gefunden, dort hoffte er auch heute auf Trost, wenn er sein Herz entlasten würde. Daß auch dort ein Priester zu Hause sei mit den strengen Anschauungen der Kirche, daran dachte er in dieser Stunde nicht, denn er war nicht gewöhnt, Peter in der Heimat zu treffen. Erst als er in die Stube trat und den jungen Geistlichen am Tische sitzen sah, schrak er leicht zusammen, aber schon hörte er die freundliche Begrüßung der Frauen, und erblickte auch den Vetter Martin, der wie daheim behaglich in dem Lehnstuhl lag, seinen »Holländer« zwischen den Knieen.
Freidank ging das Herz über – es mußte heraus, was ihn drückte, und schon nach den ersten Worten der anderen stieß er hervor:
»Und denken Sie nur, meine arme Grethe; mein gutes Weib, soll an der Friedhofsmauer verscharrt werden …«
Marie fuhr von ihrem Sitze auf und schlug die Hände in einander, und Martin räusperte sich seltsam laut; der Uhrmacher aber konnte seinen Schmerz und seinen Unmut nicht verhalten und gab ihm heftige Worte.
Als er endlich innehielt, sagte Peter Frohwalt ruhig:
»Ich begreife Ihre Aufregung, Herr Freidank, aber ich kann sie nicht billigen. Was wollen Sie denn? Die Protestanten haben sich selber losgesagt von der alten Mutterkirche und auf deren Gnadenmittel verzichtet. Sie können nicht verlangen, daß die katholische Kirche sie ihren Kindern gleichachte[31] und ihnen im Leben und nach dem Tode dieselben Ehren angedeihen lasse. Auch mußten Sie und Ihre Frau bei Ihrer Verheiratung sich über solche Folgen klar sein, die leicht abzuwenden waren, wenn diese in unsere Kirche übergetreten wäre. Nein, Herr Freidank, ein Unrecht geschieht damit nicht!«
Vetter Martin hatte die Augenbrauen finster zusammengezogen; jetzt legte er die geballte Hand schwer vor sich auf den Tisch, stand auf und sagte:
»Und doch ist's ein Unrecht! Aber mit euch Buchstabengläubigen ist nicht zu streiten. Du bist noch jung, und das Leben schlägt Dir vielleicht noch die Funken jener Liebe aus der Seele, welche in jeder Religion das wahrhaft Religiöse ist. Kommen Sie, Freidank!«
Die beiden Frauen wagten kein Wort dazu zu sagen; stumm nickte Marie Martin und dem Uhrmacher zu, als diese nach kurzem Gruße die Stube verließen.
Peter Frohwalt stand auf und ging mit großen Schritten durch das Zimmer; er trug noch das Priestergewand, wie er aus der Messe gekommen war. Sein frisches Gesicht war etwas blaß geworden, als er sprach:
»Freigeisterei und kein Ende! Das sind alles schöne Worte, für mich jedoch bestehen die Satzungen der heiligen Kirche!«
»Aber sie sind hart!« wendete Marie schüchtern ein. Der Bruder blieb vor ihr stehen:
»Scheinbar – in Wirklichkeit nicht, denn selbst durch solche Maßregeln sucht die Kirche ihre verlorenen Kinder wiederzugewinnen.«
»Kann sie dadurch nicht auch treue Kinder verlieren?«
Das Wort war dem Mädchen beinahe unbewußt entschlüpft, und die Mutter schaute erschrocken, der junge Priester erstaunt darein; er erwiderte:
»Treue Kinder gewiß nicht, denn der Gutgesinnte unterstützt sie in ihren Bestrebungen und hilft ihre Satzungen[32] ehren. Ich hoffe, daß dem bei dem Begräbnis der Frau Freidank auch hier wird Ausdruck gegeben werden. Ein guter Katholik hält sich davon fern, weil es ihm nicht zukommt, ja sogar strafbar ist, an einem kirchlichen Akte einer ketzerischen Genossenschaft teilzunehmen.«
Ein tiefes Schweigen folgte diesen Worten; man hörte das Ticken der Uhr und das Summen einer Fliege am Fenster, dann klang die Stimme des Mädchens, so seltsam fremd und klar:
»Ich werde meine Freundin zu Grabe begleiten!«
»Marie!« rief warnend und drohend der Priester; aber diese fuhr mutvoller fort:
»Ich würde es mir als Sünde rechnen, wenn ich's nicht thäte, als Sünde an der armen Grethe, die doch nicht dafür kann, wenn sie als Evangelische geboren worden ist und von ihrem Glauben überzeugt war, und als Sünde an Freidank, der mehr Trost braucht als hundert andere. Und wenn ich eine Sünde damit thue, die wird mir Gott verzeihen, der barmherziger ist, wie mancher seiner Diener.«
Das aufgeregte Mädchen verließ das Gemach, und Mutter und Sohn sahen sich befremdend und fragend an.
In der Gasse aber ging Vetter Martin neben dem Uhrmacher hin; er sprach:
»Lassen Sie sich's nicht anfechten – 's ist zuletzt ganz gleich, wo der Mensch begraben liegt, wenn ihm nur die Liebe nachfolgt. 's ist mancher hinter'm Zaun verscharrt worden, der hundertmal besser war als ein anderer, dem sie die ausgemauerte Gruft mit Weihwasser überschwemmt und ein Marmordenkmal darauf gestellt haben. Zuletzt begraben wir das, was wir an unsern Toten geliebt haben, doch nicht in der Erde, sondern in unseren Herzen, und ob der Leib ihres guten Weibes sich in der Mitte oder am Ende des Friedhofs in seine Atome auflöst, das macht doch wahrlich in der Sache keinen Unterschied, so lange ihr Bild und ihr Gedächtnis bei[33] Ihnen und Ihrem Kinde fortlebt. Das ist die Ansicht eines alten Weltwanderers, der's gut mit Ihnen meint. Und nun wenden Sie sich an den Pastor der evangelischen Gemeinde in Burgdorf – so hieß ein kleiner Ort in der Nähe, wo eine Zahl von Protestanten vereint wohnte – daß er zum Begräbnis ihres Weibes komme, und Sie sollen sehen, daß ihr die letzten Ehren nicht ganz fehlen werden.«
Freidank fühlte sich durch die Worte Martins aufgerichtet und ruhiger, und so schied er von ihm mit herzlichem Händedruck.
Am Mittwoch nachmittag erfolgte die Beerdigung des jungen Weibes. Der Himmel hatte sich umwölkt, und die Luft war schwül; über den Bergen hingen Gewitterwolken. Trotzdem hatten sich bei dem Hause des Uhrmachers wie auf dem Kirchhofe ziemlich viele Leute eingefunden, welche wirkliche Teilnahme, aber auch Neugier angelockt hatte. Es war seltsam genug, daß keine Glocke klang, wie es sonst Brauch war bei dem letzten Wege eines Erdenpilgers, und die Leute, zumal die Frauen, äußerten darüber ihren Unmut. Kein Kreuz ging dem Zuge voran; der schlichte Sarg mit einer schwarzen Decke verhüllt, schwankte leicht auf den Schultern von vier Trägern, hinter ihm aber schritt Freidank einher, der sein Kind auf dem Arme trug; es sollte seiner Mutter das letzte Geleit geben. Die Kleine sah mit großen Augen und lächelndem Mündchen auf die Leute, dann auf die Bahre und lehnte den blonden Kopf an die Schulter des Vaters. Manches Weib aus dem Volke wischte sich bei dem Anblick die Thränen aus den Augen.
Zur rechten Seite Freidanks ging der Pastor aus Burgdorf, nicht in Amtstracht, sondern im einfachen, schwarzen Anzuge, ein noch junger Mann mit offenen, freundlichen Zügen, zur linken schritt der Vetter Martin einher, mit einem Kranze von blühenden Blumen in der Hand. Nun schlossen sich eine kleine Anzahl Menschen an, unter ihnen auch Marie.
Langsam, unheimlich still bewegte sich der Zug durch die Gassen, und an den Fenstern erschienen überall neugierige Gesichter. Auf dem Friedhofe bog er von dem Hauptwege ab und ging an der Mauer entlang bis dahin, wo der Totengräber die Erde ausgeschaufelt hatte; unfern der Grube wucherten Gestrüpp und Brennesseln. Freidank biß die Zähne aufeinander, sein Atem ging kürzer, und er drückte sein Kind fester an sich. Jetzt war man zur Stelle. Die Bahre wurde niedergestellt, die vier Träger übten ruhig ihr Amt und ließen den Sarg auf den Seilen niederrollen, so daß man nichts als den schlurfenden Ton vernahm in der sonnenheißen, regungslosen, schwülen Luft.
Jetzt trat der junge Pastor an das Kopfende des Grabes und begann zu sprechen, und schon nach den ersten Worten kamen die auf dem Friedhof zerstreuten Leute näher heran, und bald stand um den abgelegenen Winkel eine zahlreiche Schar. Die Stimme des Geistlichen klang hell und mild zugleich und nahm manchmal einen weichen, an das Herz greifenden Ton an. Das schlug so seltsam an Ohr und Seele der Versammelten:
»Versprengtes Kind des evangelischen Glaubens, dem Du treu gewesen bist bis an das Ende – der Herr hat Dich in seine Hand gezeichnet und Deinen Platz Dir bereitet dort, wo alle Guten sich zusammenfinden, die in seinem Namen gelebt und gewirkt haben und gestorben sind. Dein Leib aber ruht auch an diesem Plätzchen still und friedlich, und Gott läßt auch über Deinem Hügel die Sonne scheinen und schickt den Blumen, welche hier blühen werden, seinen Tau und Regen, sowie er dem gebeugten Gattenherzen seinen Trost verleihen wird. Und wenn am Tage des letzten Gerichts sein Ruf alle Schläfer weckt auf der weiten Erde und er die Seinen sammeln wird, so bist auch Du nicht vergessen und verloren, und wirst Deinen Mann und Dein Kind wiederfinden in den lichten Höhen, in welchen es keine Trennung mehr giebt, und in welchen eine[35] einzige, ewige Liebe waltet. Und dieser Liebe befehlen wir Deine Seele und befehlen wir uns alle, indem wir beten: Vater unser …«
Und langsam, ergreifend – wie man es in dieser Weise vielleicht an dieser Stelle nie gehört – sprach der Prediger das Gebet des Herrn und den Segen. Dann drückte er dem Uhrmacher mit einem milden Worte die Hand, die dieser fest umklammerte. Das Kind auf seinem Arme hatte in diesem Augenblick die näher getretene Marie gesehen und streckte die Händchen nach ihr aus mit lautem Rufen. Das Mädchen errötete, aber ohne Zaudern trat es heran und nahm die Kleine an sich, während es ein dankbarer Blick des Vaters traf. Es war eine ergreifende Gruppe: Der bleiche Mann, der jetzt den Spaten ergriff, um seinem Weibe eine Scholle Erde auf den Sarg zu legen und neben ihm das blühende Mädchen mit dem lächelnden Kinde. Es konnte auch festeren Gemütern die Thränen in die Augen treiben, zumal gerade jetzt aus dem heraufziehenden schweren Gewölk noch ein müder Sonnenstrahl hervorbrach und die drei Menschen beleuchtete.
Freidank trat zurück von dem gähnenden Grabe, und Marie, noch immer Grethel auf dem Arme, beugte sich nieder, hob mit der Hand ein wenig Erde auf und ließ sie auf den Sarg fallen, dann aber drückte sie der Kleinen eine dunkle Rose, welche sie mitgebracht hatte, in das Händchen und sagte:
»Wirf das hier hinein, gib's deinem Mütterchen!«
Heiß stieg es dem Mädchen in die Augen, das Kind aber ließ, noch immer lächelnd, die Rose niedergleiten und sagte voll naiver Ueberzeugung:
»Mutterchen schläft!«
»Ja, dein Mütterchen schläft!« sprach jetzt eine ernste Stimme laut, und an das Grab trat der Vetter Martin mit seinem Kranze in der Hand. »Möge sie schlafen in Frieden, Amen!« fügte er hinzu und ließ den Kranz hinabfallen, und[36] als ob der Himmel seine Zustimmung geben wollte, grollte jetzt dumpf und fern der erste Donner.
Bald war der Totengräber nur allein noch an dem Orte und schaufelte die Grube zu. Freidank aber ging, begleitet von dem Pastor, seinem Häuschen zu, und Marie mit dem Kinde, ging zur Seite des Vetters Martin hinterdrein. Die Leute aber, die sich von dem Friedhof aus zerstreuten, sprachen untereinander:
»Das war einmal erbaulich! – So schön ist's nicht, wenn ein Katholisches begraben wird; das Lateinische verstehen wir nicht, und das Vaterunser wird auch immer so schnell hergesagt … nein, der junge Pastor versteht's, ans Herz zu greifen.«
Am andern Morgen aber legte manche Frauenhand einen Blumenstrauß oder ein Kränzchen nieder auf dem Grabe in dem verlorenen Friedhofswinkel, und als bei Zeiten der trauernde Witwer kam, fand er den Hügel schon geschmückt. Er hatte wenig geschlafen in der Nacht, und vieles war ihm durch den Sinn gegangen, während stundenlang ein Gewitter über dem Städtchen hing, ab und zu ein Blitz seine Stube erhellte und der Donner langsam verhallend grollte. Jetzt am Morgen war alles frisch, blühend, ruhig und die Sonne schien wieder; auch in seinem Herzen war's wunderbar still geworden. Er ging von dem Grabe seines Weibes, auf welches er einen Strauß von Rosen niedergelegt hatte, auch diesmal wieder nach der Pfarrei.
Der Pfarrer hatte am Fenster gestanden und ihn kommen sehen, und ihn befiel ein leises Unbehagen; trotzdem er den Satzungen der Kirche gemäß gehandelt hatte, empfand er doch etwas wie ein Gefühl des Unrechts gegen den Mann, und er empfing ihn darum mit ganz besonderer Freundlichkeit.
Auch diesmal lehnte Freidank den ihm angebotenen Sitz dankend ab.
»Was ich zu sagen habe, Herr Pfarrer, thue ich besser stehend. Ich komme nur, um Ihnen meinen Austritt aus der katholischen Kirche anzuzeigen.«
Der greise Priester erschrak, daß er mit der Hand nach einer Stuhllehne faßte, und er brachte kein Wort hervor als: »Herr Freidank – –«
»'s ist mein heiliger Ernst, Hochwürden … es kommt mir nicht leicht an, denn ich bin ein guter Katholik gewesen – wenigstens glaubte ich ein solcher zu sein – und es wäre mir auch kein solcher Gedanke eingefallen …«
»Aber haben Sie denn diesen Entschluß reiflich erwogen?« fragte der Pfarrer, der jetzt erst die Fassung wiederfand. »Sie handeln zweifellos unter dem Eindrucke einer augenblicklichen Erregung, und da das Gesetz eine gewisse Bedenkzeit verlangt, so hoffe ich, daß der Himmel Sie erleuchten und stärken wird, und daß Sie der heiligen Kirche treu bleiben, in welche Sie hineingeboren sind.«
»Ich habe alles erwogen, und in dieser Gewitternacht ist mir der Weg klar geworden, welchen ich gehen muß, und von dem mich nichts abbringen kann. Wenn mein armes Weib, wie der Herr Kaplan behauptet, nicht in den Himmel kommen kann, so brauche ich auch nicht hinzugelangen; sie ist mir im Leben brav und treu gewesen, und wenn uns der Tod auch auseinandergerissen hat, so will ich doch, wenn ich einmal sterbe, wieder mit ihr zusammen sein. Und wenn schon die Evangelischen einen besonderen Himmel haben sollen, oder auch gar keinen, nun, so will ich das Schicksal meiner lieben Grethe teilen. Wo die allgemeine Menschenliebe fehlt, kann auch nicht der rechte Glaube sein – die Empfindung hab' ich, wenn ich auch nur ein schlichter Handwerker bin. Sie sind gut, Hochwürden, das weiß ich, aber daß Sie trotzdem nicht so dürfen, wie Ihr gutes Herz will, daß Sie mein armes Weib als eine Ketzerin verdammen müssen, obgleich Sie wissen, wie brav und tüchtig sie war, das ist's vor allem, was mir die Kirche verleidet, und weshalb ich noch einmal Ihnen meinen Austritt aus derselben erkläre.«
»Aber bedenken Sie doch Ihr Seelenheil, lieber Freidank![38] Berauben Sie sich nicht freiwillig der Gnadenmittel, wie sie in den heiligen Sakramenten Ihnen geboten werden.«
»Ich befehle mich der Gnade Gottes, wie mein Weib ihr befohlen worden ist, der auch Ihre Gnadenmittel nicht zuteil wurden. – Lassen Sie uns abbrechen, Herr Pfarrer, ich könnte sonst die Ruhe verlieren, die ich mir zu diesem Schritte am Grabe meiner guten Grethe geholt habe und könnte aufgeregt und bitter werden. Ihnen danke ich für alle Ihre Liebe, und ich hoffe, Sie verdammen mich auch nicht um dieses Schrittes willen.«
In den Augen des alten Pfarrers stieg ein feuchter Schimmer auf; er gab dem schlichten Handwerker die Hand und sagte:
»Gehen Sie mit Gott, Herr Freidank, und sein heiliger Geist erleuchte Sie! Vielleicht sagen Sie mir in vier Wochen doch noch anderen Bescheid.«
Der Uhrmacher schüttelte langsam das Haupt und ging, der Pfarrer aber griff nach einem Gebetbuche, das auf einem Eckbrett lag: Er wollte beten für die Seele, welche, wie er selbst nicht mehr zweifelte, seiner Kirche verloren ging.



Die Kunde, daß Freidank »evangelisch« geworden, war bereits am andern Tage im ganzen Städtchen verbreitet, und Peter Frohwalt hatte sie in der Sakristei der Kirche von dem Kaplan erfahren, der einige bissige Bemerkungen daran geknüpft hatte. Er selbst hatte alle Mühe, während des Meßopfers seine Gedanken von dieser Sache abzulenken, aber nach Beendigung desselben kehrte die mühsam verhaltene Erregung um so heftiger zurück. Er machte einen Gang über den Friedhof und zum Grabe seines Vaters, und sein Auge schweifte auch nach dem Winkel hinüber, wo Grethe Freidank beerdigt worden war. Dort stand der Uhrmacher und schien zu beten.
Auch das erbitterte den jungen Priester, und so kehrte er nach Hause zurück, wo Mutter und Schwester mit dem Frühstück auf ihn warteten. Er legte seinen Hut beiseite, und indem er die Handschuhe auszog, sprach er:
»Wißt Ihr's schon – Freidank will Protestant werden!«
»Das habe ich beinahe gedacht,« bemerkte Marie halblaut; der Bruder aber sagte heftig:
»So? – Das ist eine Erbärmlichkeit, so im Knabentrotz dem Herrn und seiner Kirche den Rücken zu kehren und sein eigen Seelenheil von sich zu stoßen. Die Kirche freilich verliert nichts daran, denn der Mann war schon ein räudiges Schaf, als er das protestantische Weib heimführte, aber es ist um das Aergernis, welches eine solche That giebt. Das ist nicht mehr Verblendung, sondern Verstocktheit und Herzenshärte, welche, anstatt in diesem Todesfalle die mahnende Hand des Herrn zu sehen und ihrem Winke zu folgen, denselben verrät und verleugnet. – Für unsere Familie kann keine Gemeinschaft mehr bestehen mit dem Hause Freidanks, und von Dir, Marie, erwarte ich besonders, daß Du Dich fern hältst. Es will mir auch sonst nicht schicklich scheinen, wenn ein junges Mädchen einem unbeweibten Manne ins Haus läuft, als hätte sie es auf ihn abgesehen.«
In das Gesicht Mariens stieg eine heiße Röte bis unter die glänzenden Haarflechten, und ihre Stimme bebte vor Erregung, als sie sprach:
»Ich glaub's nicht, daß es Leute giebt, die so denken, denn ich sowohl, wie Freidank haben bei diesem Jammer anderes im Sinn. Aber wüßt' ich auch, daß man so spricht, es könnt' mich nicht abhalten, ab und zu nach dem Kinde zu sehen, das seine Mutter mir auf die Seele gebunden hat, noch als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe. Und die Kleine hängt auch an mir. Wenn aber der Freidank evangelisch werden will, so kann ich's wenigstens begreifen, wenn ich's auch nicht billige. Es ist, wie ich Dir gesagt habe, daß auf solche Weise die Kirche auch treue Kinder verlieren kann.«
Peter Frohwalt hatte sich in seinem Sitz zurückgelehnt und sah mit großen, starren Augen seine sonst so zurückhaltende, schüchterne Schwester an.
»So? – Was heißt auf solche Weise? – Weil die Kirche auf ihren ehrwürdigen Satzungen besteht und sie nicht um der Gefühlsduselei jedes beliebigen Thoren willen bricht,[41] soll sie verantwortlich gemacht werden? Auf welcher Seite ist die Treue und die Treulosigkeit? – Das glaube ich, daß das Grab in der Friedhofsecke bei thränenseligen Weibern ein romantisches Mitgefühl erweckt, aber das ist vorübergehend, und ruhige Erwägung wird der Kirche zuletzt Recht geben. Das hoffe ich auch von Dir, und darum erwarte und wünsche ich, daß Euer Verkehr mit Freidank aufhört. Das seid Ihr mir schuldig.«
Die Röte war aus dem Antlitz des Mädchens gewichen, und sie saß mit gefalteten Händen schweigend da, indes die Mutter sagte:
»Gewiß, Peter hat Recht, und uns kann das niemand übel nehmen. Marie wird sich schon fügen –« bemerkte sie begütigend zu dem Sohne und goß ihm dabei den dampfenden Kaffee in die goldgeränderte Tasse. Dann wurde es ganz stille in der Stube, keiner der drei Menschen fand mehr ein Wort, Marie aber fühlte, wie ihr die Thränen über die Wangen rannen, ohne daß sie wagte, dieselben abzutrocknen.
Am Abend war sie ausgegangen, um etwas zu besorgen. Da begegnete ihr die Nachbarin Freidanks, welche dessen kleines Mädchen auf dem Arme trug. Das Kind schrie schon von weitem laut nach Marie, und diese konnte nicht anders, als dasselbe an sich nehmen. Fest preßte sie sein Köpfchen an ihre Brust, streichelte ihm die Wangen, und hörte nur mit halbem Ohr auf das, was das Weib redete.
»Er wird doch bald wieder heiraten müssen, schon wegen dem Würmchen da. Was soll denn aus dem Kinde werden ohne eine Mutter?« sprach die Frau und dabei sah sie Marie so eigentümlich von der Seite an, daß diese fühlte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Beinahe mit hastiger Geberde setzte sie die Kleine auf die Erde nieder und wollte mit raschem Gruße sich entfernen, als wie aus dem Boden auftauchend, aus dem Schatten eines nahen Baumes Freidank trat.
Sie konnte ihm nicht ausweichen, aber in ihrer Verlegenheit und Aengstlichkeit that sie scheu und fremd, so daß der Uhrmacher beinahe traurig sagte:
»Sie nehmen mir's wohl auch übel, daß ich evangelisch werden will?«
Da preßte sie das Wort heraus:
»Nein, Herr Freidank … im Gegenteil, ich fühl's, daß Sie nicht anders können, aber … dort kommt mein Bruder – Adieu!«
Sie huschte, hochrot vor Erregung, hastig fort; aber Peter Frohwalt hatte sie doch bereits bemerkt. Er kam von einem Spaziergang mit dem Kaplan zurück, und dieser sprach mit seiner trockenen, kalten Stimme:
»Ihre Schwester sollte doch kein Aergernis geben.«
»Es wird nicht wieder geschehen,« erwiderte der andere gepreßt und unmutig, und schweigend kamen sie näher zu der Stelle, wo das Weib mit dem Kinde stand, sowie der Uhrmacher, welcher dem davoneilenden Mädchen betrübt nachschaute. Jetzt grüßte er die beiden jungen Geistlichen, indem er seine Mütze abnahm, diese aber sahen zur Seite und beachteten seinen Gruß nicht.
Als Peter Frohwalt daheim ankam, sagte er zu seiner Mutter:
»Ich will meinem Freunde schreiben, ob ich von nächster Woche an einige Zeit bei ihm wohnen kann, bis ich vom Konsistorium meine Berufung an eine Stelle erhalte; ich kann nicht bei Euch bleiben, weil ich mich Mariens schämen muß.«
Das Mädchen war eben erst eingetreten und stand mit klopfendem Herzen beim Fenster. Das Wort war zu hart, und in ihr regte sich das verletzte weibliche Gefühl:
»Verzeih' Dir's Gott, Peter, was Du sprichst … das ist doch, als ob ich eine verworfene Dirne wäre! Ich habe Freidank nicht gesucht und bin gegangen, als er kam; der Umgang mit dem Kinde aber kann nichts Schlechtes sein, denn[43] Christus ließ ja auch die Kinder zu sich kommen, weil ihrer das Himmelreich ist.«
Raschen Schrittes ging sie hinaus, um in ihrem Stübchen dem gepreßten Herzen Luft zu schaffen, Peter Frohwalt aber sagte zu seiner Mutter:
»Gieb acht auf sie und hüte sie, Mutter! Ihr Wesen gefällt mir nicht. Sie ist störrig und halsstarrig, und ich fürchte um ihr Seelenheil.«
Die alte Frau suchte den Sohn zu beruhigen und gab ihm die besten Versicherungen ihrer Wachsamkeit, aber Friede und Behagen war aus dem kleinen Hause des Sportelschreibers gewichen, und als die drei Menschen am Abend beisammen saßen, lag es über ihnen wie ein gewitterschwüler Hauch, und nur wenige Worte gingen hin und her.
Am andern Morgen brachte der Postbote einen größeren Brief mit auffallendem Siegel, adressiert an Peter. Er war von dem erzbischöflichen Konsistorium und enthielt seine Ernennung zum Kaplan in Nedamitz. Dabei war bemerkt, daß wegen unheilbarer Erkrankung des bisherigen Inhabers dieser Stelle es wünschenswert erscheine, wenn er dieselbe so bald als möglich antrete.
Diese Mitteilung kam unter den augenblicklichen Verhältnissen nicht unangenehm, wenngleich der junge Priester, welcher seine theologischen Studien mit Auszeichnung absolviert hatte, heimlich gehofft hatte, daß man ihm in irgend einer Stadt eine Stellung geben, oder ihn gar als Adjunkt an die theologische Fakultät berufen werde. Aber er war nicht unmutig – wohin der Herr ihn rief, dort wollte er gerne wirken. Auch die Mutter hatte vielleicht anderes erwartet, aber sie äußerte sich nicht, sondern beeilte sich nur, alles, was an Wäsche und dergleichen in Ordnung gebracht werden mußte, schnellstens zu besorgen, so daß schon für den übernächsten Tag die Abreise Peters festgesetzt werden konnte.
Dieser machte seine Abschiedsbesuche, vor allem in der Pfarrei, bei einigen bekannten Familien und endlich auch bei dem Vetter Martin. Er empfand ein kleines Unbehagen, als er die stille Berggasse entlang schritt, an deren Ende in einem schlichten, wenig gepflegten Garten das Häuschen des wunderlichen alten Herrn stand. Es hatte nur ein Erdgeschoß, welches eine kleine Küche, ein ebenso kleines Schlafzimmer und außerdem noch drei Räume enthielt, welche mit allerhand Kuriositäten vollgepfropft waren. Als Knabe hatte Peter immer ein heimliches Grauen empfunden, wenn er die wegen der mit wildem Wein dichtumwachsenen Fenster beinahe stets halbdunklen Stuben durchschritt. Die Gerippe von Menschen und Tieren in den Ecken, alte, blutrostige Waffenstücke, Reste aus der Pfahlbautenzeit, verstäubte Schnitzereien, Steine und Muscheln, eine überaus reiche Stöckesammlung deren einzelne Exemplare nach den Ländern benannt waren, auf denen sie als Reisegefährten gedient hatten, und vieles andere mehr fand sich hier beisammen; der Vetter Martin aber saß in seiner »Bibliothek« an einem großen, unbemalten Eichentische, hatte einen alten, blumigen Schlafrock an, eine seidene Mütze mit großem Schirm auf dem etwas struppigen Haare und blies aus einer langen Pfeife behagliche Wolken. Er war eben bei der Sektion eines toten Hamsters, den er Gott weiß wo erwischt haben mochte, denn die Tierchen waren sehr selten in der Gegend, und ließ sich auch gar nicht stören.
»Ih, sieh mal, Peter – welche Ehre! Setz dich nieder, ich bin gleich fertig. Am Hunger ist das Vieh nicht zugrunde gegangen, im Gegenteil, eher an einer Indigestion. Und dabei futtert sich das Biest auch noch die Backentaschen voll, daß es eine Schande ist. Ja, 's giebt unter Mensch und Tier Exemplare, die niemals genug kriegen und anderen nichts gönnen, weder im Leben noch im Tode. Nicht einmal eine Scholle Erde auf dem … Ja so … na, was machst Du denn Gutes?«
Peter erzählte, warum er gekommen sei. Der Alte schob seine Mütze etwas aus der Stirne, sah ihn an und sprach:
»Nedamitz! Das Nest kenne ich nicht, obwohl ich ein gut Stück Heimat und Fremde gesehen habe, aber so viel ich weiß, liegt's bei ***, an der Sprachgrenze. Wirst noch tschechisch lernen müssen, fürcht' ich, aber ich hoffe auch, daß Du das Deutsche drüber nicht vergißt. Unsere deutschen Priester können überhaupt von den tschechischen Amtsgenossen lernen, daß sie unbeschadet ihrer Pflichten auch ihrem Volke in Liebe zur Muttersprache und zur Väterart ein Beispiel geben sollen. Na, der Anfang ist gut, um den Ehrgeiz im Zaum zu halten und zuletzt kannst Du gerade in Nedamitz recht viel Gutes stiften. Dazu giebt's auch im kleinsten Neste Gelegenheit, denn nicht, wo man schafft, sondern wie man schafft, darauf kommt's an … Aber da halte ich Dir eine Predigt, das ist ja die umgekehrte Welt!«
»Wer Deine Erfahrungen hinter sich hat, Vetter Martin, darf auch einmal Unsereinem eine Predigt halten!«
»Das freut mich, wenn Du das einsiehst! Das Leben bleibt die beste Hochschule, das hab' ich erfahren, und das schleift einem Manches ab, wovon sich die Schulweisheit nichts träumen läßt. Grau ist alle Theorie, sagt der große Dichter, und grün des Lebens goldner Baum. Und das Leben lehrt einem vor allem eines: Toleranz! Wer die Menschen gesehen hat in allen Ländern und überall Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte, der weiß, daß es verschiedene Wege geben kann, die alle zum Himmel führen, aber dem thut auch jede Engherzigkeit weh, besonders, wenn sie einer übt, den man lieb hat. Du verstehst mich, Peter!«
»Ich weiß – Du meinst die Sache mit Freidanks Weib.«
»Meine ich. Und der Mann will Protestant werden, weil er der größern Liebe nachgeht. Da soll einer den Stein auf ihn werfen, wenn er nicht selber ein Pharisäer ist. Erst greifen[46] sie ihm ans Herz und zerpressen es ihm mit kalter Härte und mit frostiger Satzung, wovon der Himmel nichts weiß, und dann soll der Mann sie dafür lieben und die Hand ihnen küssen. Ihr verdammt ihn – ich hätte mich gewundert, wenn's anders gekommen wäre. Nur wer Liebe säet, wird Liebe ernten.«
Peter saß wie auf glühenden Kohlen. Der alte Mann vor ihm, der, während er redete, ruhig an dem Hamster herumschnitt, war von seinen Kindestagen an ihm eine Respektsperson gewesen, die er gleich neben seinen Vater stellte, und im Grunde wußte er gegen seine Bemerkung auch nichts zu sagen, als daß die Kirche ihm sein Verhalten vorschreibe.
»Es giebt ein höheres Gesetz, als das Deiner Kirche, welches nur für einen Teil der Menschen gilt – ein Gesetz, das für alle vorhanden ist, die über die Erde hingehen, das ist das Gesetz der allgemeinen Bruderliebe. Sieh, ich habe in Schweden totkrank gelegen, und bin als wildfremder Mensch und als Katholik dazu in einem protestantischen Pfarrhaus gepflegt worden, Wochen lang, und kein Mensch hat mich nach meinem Glauben gefragt, und wenn ich gestorben wär', so hätten sie mich – das glaub' ich felsenfest – nicht im Winkel ihres Friedhofs eingescharrt. So, jetzt bin ich fertig mit dem da« – er schob den kleinen Kadaver, den er entbalgt hatte, beiseite – »und will nach meinen Rosen sehen.«
Er erhob sich, und Peter mit ihm. Diesem war die Kehle wie zugeschnürt; er hätte manches sagen mögen, aber es kam ihm dem alten, braven Manne gegenüber so leer und haltlos vor, daß er unmutig beinahe an sich selber irre ward. So ging er an seiner Seite durch das nächste Zimmer, in dessen Ecke nahe beim Fenster ein weißes Gerippe stand. Vetter Martin blieb einen Augenblick davor stehen und sagte humoristisch:
»Na, was meinst Du wohl, ob der einmal katholisch oder evangelisch war?«

Dann schritt er weiter. Auf einem Tischchen lag ein kleines, abgegriffenes Buch. Das nahm er in die Hand, blätterte flüchtig drin und indem er es Peter Frohwalt reichte, sprach er:
»Das kleine Werkchen will ich Dir schenken, ich habe in mancher Stunde Trost und Erhebung drin gefunden, vielleicht kann's auch Dir von Nutzen sein! Der's geschrieben hat, war ein guter, edler Mensch, und das bleibt das Beste, was man von jemandem sagen kann.«
Der junge Geistliche nahm das Bändchen und schlug den Titel auf: Es war Schefer's »Laienbrevier«. Er dankte für die Gabe und ging mit dem Alten hinaus in den Garten. Hier sprachen sie noch ein Weilchen über dies und das, dann ging Peter, nachdem Vetter Martin ihm noch zugerufen hatte:
»Und Nedamitz hoffe ich auch kennen zu lernen, und es soll mich freuen, wenn ich Dich dort recht zufrieden wiedersehe.«
Am andern Morgen früh fuhr der junge Priester mit dem Postwagen hinaus durch das alte Thor, in dessen Nähe sein Vaterhaus stand. Vor demselben harrten Mutter und Schwester und winkten ihm zu; der Postillon blies in herkömmlicher Weise das Lied, das er seit fünfundzwanzig Jahren stets bei diesem Anlasse hören ließ: »Muß i' denn zum Städtele 'naus,« und dann rollte der schwarzgelbe Wagen auf der staubigen Straße hin, hinein in den sonnigen Tag.
Auf der Höhe beim Kapellchen, wo am Tage der Primiz der fahrende Handwerksbursche gesessen hatte, stand der Vetter Martin, auf seinen »Holländer« gestützt, die Mütze mit dem breiten Schirm weit in die Stirn hereingezogen, und rief ihm noch einmal ein »Glückauf!« nach, dann fuhr der Wagen bergab und hinter dem Reisenden versank die kleine Stadt.
Er war allein in dem Wagen, hatte die Fenster geöffnet und ließ die angenehme, kühle Morgenluft hereinstreichen. An seinem Auge gingen die freundlichen Landschaftsbilder mit all den fleißigen Menschen vorüber, Lerchen sangen aus[48] der Höhe nieder, und ihm wurde die Seele weit. Er ging mit den besten Vorsätzen hinein ins Leben und in seinen Beruf.
Nach etwa zwei Stunden hielt der Wagen kurze Rast in Burgdorf. Das war die kleine evangelische Gemeinde mitten zwischen der katholischen Bevölkerung, die durch Gott weiß welchen Anlaß hieher verweht worden war. Eine schmucke Kirche mit weißen Mauern und einem zierlichen Türmchen, dessen vergoldetes Kreuz im Sonnenschein blinkte, stand auf einer kleinen Anhöhe, unfern davon das schlichte Pfarrhaus, von Holzfachwerk errichtet, mit spiegelnden Fenstern. An diesem fuhr der Wagen vorüber. Im Gärtchen vor dem Hause stand der junge Pastor, und an seinem Arme lehnte blühend und frisch sein Weib, schmuck und einfach, und sie sahen zwischen den Rosenbüschen hin nach dem vorüberrollenden Wagen. Zwei Kinder spielten jauchzend vor ihnen im Sande.
Peter Frohwalt wurde von seltsamen Empfindungen erfaßt, aber er wußte sich selbst nicht volle Rechenschaft darüber zu geben. Das Familienbild war von so friedlicher Anmut und atmete so sehr den Duft stiller, glücklicher Häuslichkeit, daß darüber der Unmut gegen den Ketzer zurücktrat und ein wehmütiger Neid beinahe die Oberhand gewann. Er wollte das Gefühl abschütteln, sobald das Dorf hinter ihm lag, aber unwillkürlich wandte er sich von einer kleinen Anhöhe aus nochmals zurück. Der ganze Ort war so sauber und freundlich, ja er sah geradezu wohlhabend darein, und tiefblauer Himmel lag über den grünen Gärten und den roten Dächern, gerade so wie über dem katholischen Lande … unser Herrgott machte keinen Unterschied!
Beinahe hätte ihn die Wahrnehmung verstimmt, doch er besann sich, daß geschrieben steht, daß Gott seine Sonne scheinen läßt über Gerechte und Ungerechte. Aber seine Gedanken wollte er doch ablenken, und so faßte er in die Tasche, in welche er noch zu guter Letzt das von Vetter Martin erhaltene Buch gesteckt hatte. Er schlug es auf und fand als Anhang zu dem[49] »Laienbrevier« noch eine Anzahl später wohl beigebundener Scheferscher Gedichte; er las:
Gern hätte er das Büchlein weggeworfen, aber die einfache Sprache, der edle Gedankenausdruck fesselte ihn.
Peter Frohwalt versank in Nachdenken und kümmerte sich nicht mehr um die Landschaftsbilder, die an ihm vorüberzogen. Was wollte er selbst denn sein? – Ein wahrer, redlicher Mensch, und der Weg zu diesem Ziele sollte eine Toleranz sein, die den Satzungen seiner Kirche nicht völlig entsprach! Es begann in seiner Seele sich ein Zwiespalt zu regen, und er war froh, als der Wagen in der Stadt ankam, von wo aus ihn das Dampfroß weiter tragen sollte.
Gegen Abend langte er in seinem Bestimmungsorte an. Von der letzten Bahnstation hatte er eine gute halbe Stunde zu gehen, aber das Marschieren that ihm wohl, nachdem er so lange in dem heißen Waggon gesessen hatte. Langsam schritt er durch die reifenden Felder, bis er das Dorf Nedamitz vor sich liegen hatte. Es war ziemlich groß, die Kirche lag am letzten Ende und ringsum dehnte sich ein welliges Hügelland[50] aus, auf welchem da und dort ein grüner Hopfengarten sich zeigte. Die Gegend war ziemlich einförmig.
Bei einem rotgestrichenen Holzkreuz standen zwei Kinder, Mädchen, mit Feldblumensträußchen in den Händen; sie knixten und sagten wie mit einer Stimme:
»Pochválen bud' Pán Ježiš Kristus!«1
1 Gelobt sei Jesus Christus!
Er antwortete, da ihm Gruß und Antwort von seinem Prager Aufenthalte her bekannt war:
»Až na věky.«2
2 In Ewigkeit!
Dann ging er rascher weiter; es war ihm unbehaglich, daß der erste Gruß, den ihm die neue Heimat entgegenbrachte, nicht in den Mutterlauten klang, und er hatte auch die unbestimmte Furcht, die Kinder möchten ihn tschechisch anreden und ihn in die Verlegenheit bringen, ihnen nicht antworten zu können.
Jetzt klang vom Dorfe her die Aveglocke. Das war noch ein anderer Gruß; jetzt grüßte ihn die Stimme seiner Kirche, und andachtsvoll entblößte er das Haupt und betete den »englischen Gruß«. Wie er durch die Gasse des Ortes schritt, begegnete er vielfach Landsleuten, die von den Feldern kamen oder vor den Thüren saßen. Mancher kümmerte sich gar nicht um ihn, andere, zumal Weiber, grüßten, fast durchaus in deutscher Sprache, und die Kinder kamen heran und küßten ihm die Hand. Er ging langsam und empfand jetzt beinahe ein Wohlbehagen bei dem Gedanken, hier daheim zu sein.
Nun war er bei der Pfarrei. Es war ein ansehnliches Gehöft, von einer Mauer umgeben, durch welche ein Thor hinein führte in den Hof. Dieser war nicht besonders sauber gehalten; Hühner und Gänse liefen umher, aus dem Stalle blökte ein Rind, und an der Kette lag vor seiner Hütte ein brauner, zottiger Hund. Bei dem Wassertroge schäkerte ein[51] älterer Knecht mit einer jungen Dirne, einer Magd, in einer ziemlich freien Weise.
Die Beiden fuhren auseinander, als der junge Priester herankam, der Knecht lief nach dem Stalle zu, das Mädchen aber blieb mit dem gefüllten Wassereimer stehen und grüßte mit einem verlegenen Knixe. Peter Frohwalt sagte:
»Treffe ich den Herrn Pfarrer zu Hause? – Ich bin der neue Kaplan!«
Bei diesem Worte setzte die Dirne den Eimer aus der Hand und huschte, ohne ein Wort zu erwidern, in das Haus, und er folgte ihr langsam.
Das Pfarrhaus war ein altes, einfaches, aber umfangreiches Gebäude mit vortretendem Obergeschoß und einer um dasselbe laufenden Holzgalerie; es machte im ganzen einen behaglichen Eindruck. Die Schwelle war schmutzig und Peter mußte darüber wegtreten. Da erinnerte er sich, was das Volk bei ihm zu Hause sagte bei solchen Anlässen: Man würde sich bald ärgern.
Kaum war er in den Flur gekommen, als ihm, wohl durch die Magd gerufen, ein Weib von etwa 50 Jahren entgegentrat, angethan wie eine Bäuerin, mit schwarzem Mieder, und nackten, drallen Armen; eine große blumige Schürze hatte sie umgebunden. Ihr Gesicht war einmal hübsch gewesen, jetzt sah es groß und gerötet aus. Sie wischte sich die Rechte an dem Schürzenzipfel ab und reichte sie dem jungen Priester, indem sie ihn in tschechischer Sprache begrüßte.
Peter Frohwalt hatte halb widerstrebend ihr seine Hand gegeben und sagte:
»Es thut mir leid, aber ich verstehe das Tschechische nicht!«
»Was?« rief das Weib nun deutsch – »Sie können nicht einmal Böhmisch? – Ja, wie wollen Sie denn hier durchkommen? Das begreife ich nicht, wie das Konsistorium einen Kaplan schicken kann, der kein Böhmisch versteht!«
Sie ließ den verblüfften jungen Mann einfach stehen oder vielmehr, sie überließ es ihm, ihr zu folgen, indem sie jetzt die Treppe emporstieg und ihm sehr ausdrucksvoll den breiten Rücken zuwendete. Und Peter ging hinter ihr drein. Auf dem oberen Flur riß sie nach raschem Anpochen eine Thür auf und rief hinein:
»Da schickt das Konsistorium uns einen, der nicht Böhmisch kann!«
Drinnen wurde ein Stuhl gerückt und gleich darauf erschien auf der Schwelle der Pfarrer. Er war in Hemdärmeln, mit einem kleinen Seidenkäppchen auf dem grauen Kopfe, eine hagere Gestalt, deren Gesicht im Halbdunkel nicht gut zu erkennen war.
»Seien Sie willkommen!« sagte er mit einem etwas heiser klingenden Organ und reichte dem neuen Hausgenossen die Hand. Er zog ihn nun in sein Zimmer, nachdem er noch in tschechischer Sprache das Weib gefragt, ob die Wohnung für den Herrn Kaplan in Ordnung gebracht sei und eine mürrisch-kurze Antwort erhalten hatte. Er fuhr eilig in einen alten, langen Hausrock, indem er sich entschuldigte, daß er bei der herrschenden Hitze es sich bequem gemacht habe. Nun konnte Peter Frohwalt den Mann, sowie den Raum einigermaßen mustern. Der erstere hatte trotz seiner Magerkeit ein rotes, einigermaßen gedunsenes Gesicht mit kräftig hervortretender Nase, ein paar seltsam feucht flimmernde Augen, und mochte ungefähr sechzig Jahre zählen.
Das Zimmer sah einfach genug aus. Zwei Tische, einer am Fenster, ein anderer vor einem verschossenen, ehemals wohl grünen Sopha, über dem ein großes Bild hing – der einzige Wandschmuck – ein braunes, wurmstichiges Büchergestell, das bedenkliche Lücken zeigte, vier oder fünf Holzstühle, eine Bank in der Nähe des Ofens, ein alter Kleiderschrank und eine Kommode, die mit ihrer hellen Farbe zu den übrigen Möbeln nicht paßte – das war die Ausstattung des Gemaches. Auf[53] dem Tische bei dem Sopha aber stand ein großer Zinnkrug und daneben ein Glas mit einem Reste Bier.
»Ich denke, Sie werden sich hier schon einrichten,« – sagte nun der Pfarrer, – »es ist gerade nicht viel zu thun, wenn man es erst richtig anfaßt. Ihrem Vorgänger hat's gut gefallen, und wir hatten recht schön mit ihm zusammen gelebt – da bekam er die Schwindsucht, der arme Teufel, und ging in seine Heimat; wiederkommen wird er nicht mehr. Er hat's verstanden, sich mit der Barbara, der Köchin, gut zu stellen, die ihm manchen besondern Bissen zugesteckt hat – na, ich habe nichts dawider gehabt. Machen Sie nur auch, daß Sie gut Freund mit ihr werden! Sie ist nun schon fünfundzwanzig – – hm, hm … lange Zeit bei mir, und darum nimmt sie sich auch manchmal etwas mehr heraus. Das sag' ich Ihnen, damit Sie wissen, woran Sie bei der oder jener Gelegenheit sind.«
»Wie es scheint, nimmt sie mir's schon übel, daß ich des Tschechischen nicht mächtig bin,« bemerkte Frohwalt, und der andere sagte mit einem breiten Lächeln:
»Ja, eine gute Tschechin ist sie, und darum hat auch Ihr Vorgänger, der Pater Sloczek, einen Stein bei ihr im Brette gehabt. Aber gerade notwendig ist es nicht, daß Sie das Böhmische verstehen. Das Dorf ist eigentlich ganz deutsch und nur die Filiale Květau ist gemischtsprachig. Aber da genügt's, wenn ich des Böhmischen mächtig bin. Doch jetzt will ich Sie auf Ihr Zimmer bringen und Ihr Gepäck von der Station holen lassen, und zum Abendbrot sehen wir uns dann hier wieder.« –
Es waren zwei mäßig große Räume, welche dem jungen Kaplan zur Wohnung angewiesen waren, so einfach eingerichtet, wie das Zimmer des Pfarrers, und mit weiß getünchten Wänden. Die Fenster des einen, welches als Schlafgemach diente, gingen nach dem Hofe hinaus und über diesen hinweg nach der Dorfgasse, diejenigen des andern schauten ins[54] freie Land, auf grüne Wiesen, wogende, goldschimmernde Felder, kleine Wälder, und im Hintergrunde fern verdämmernd blaute eine Bergkette. Hier hatte Peter Frohwalt hinausgeblickt und von seiner Zukunft geträumt. Der tiefe Gottesfrieden ringsum, der gleichsam durch das offene Fenster mit dem milden Abendhauche hereinzuwehen schien, that ihm wohl und wiederum wie am Morgen dachte er daran, daß er auf diesem kleinen, stillen Erdenflecken, wohin ihn Gott gestellt, Segen bringen wollte nach seinen besten Kräften.
Die Dienstmagd rief ihn zum Abendbrot. Er fand den Pfarrer bereits am Tische sitzend. Auf dem nicht mehr ganz sauberen Linnen stand Brot, Butter, Käse, einige Eier und aufgeschnittener Schinken, dazwischen wieder der große Zinnkrug, aus welchem der Pfarrer die Gläser füllte. Dieser sprach nicht viel während des Essens, erst nach demselben lehnte er sich behaglich in seinen Stuhl zurück und begann, während er seine Pfeife stopfte, den jungen Kaplan nach seinen Familienverhältnissen zu befragen.
Dann trat die Köchin ein und schien den Tisch abräumen zu wollen, aber sie setzte sich auf einem Stuhle neben dem Pfarrer nieder, stemmte den Arm vor sich hin und sagte:
»Der Waldbauer war da, aber den Pachtzins für die Wiese hat er noch immer nicht gebracht; eine Kuh wär' ihm gestorben, und er hätt' eine andere kaufen müssen, und da will er noch acht Wochen Frist haben – aber das geht nicht, er ist ein verlogener Lump, und ich hab' ihm auch gesagt, daß wir nicht länger warten können und daß wir ihn verklagen, wenn er nicht bei acht Tagen zahlt.«
Das Weib sprach so resolut und selbstbewußt, daß Peter Frohwalt den Pfarrer einigermaßen befremdet und erstaunt anblickte. Dieser schien auch verlegen; er räusperte sich, trank einmal mit kräftigen Zügen sein Glas leer und sagte dann:
»Er hat wirklich das Unglück gehabt mit der Kuh, Barbara – wir wollen doch nicht hart sein; er wird schon zahlen!«
»Ach was, Sie sind immer viel zu gut, und darum kommen wir zu nichts. Na, mir soll's recht sein – aber ich halte den Waldbauer für einen Lumpen. Na, wie wird's denn heute abend mit einem Spiel? Kann er's denn?«
Die letzte Frage war von einem Seitenblicke auf den Kaplan begleitet, den sie bisher so gut wie gar nicht beachtet hatte, und der Pfarrer geriet dabei, wie es schien, noch mehr in Verlegenheit. Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, rieb sich die Nase mit dem Zeigefinger und sprach endlich:
»Ja, sehen Sie, Herr Kaplan, wir leben hier sehr abgeschieden und eingezogen; Gesellschaft giebt es nicht – wenigstens gehe ich nicht gern ins Wirtshaus, und da haben wir denn gewöhnlich abends in der Pfarrei zusammengesessen, ich, der Kaplan und die Barbara und haben ein Kartenspiel gemacht. Es wär' hübsch, wenn das wieder so paßte und Sie mitthun wollten.«
»Ich bedaure sehr, ich kann nicht Karten spielen!« sagte Frohwalt ziemlich kühl, aber die Köchin rief: »Nicht einmal Karten spielen! Ja, das müssen Sie lernen – da wollen's wir gleich heute probieren!«
»Ich danke – ich habe auch gar keine Neigung und kein Interesse für Karten –« erwiderte der junge Priester.
»Aber, was wollen Sie denn machen, besonders an den langen Winterabenden?« fragte der Pfarrer beinahe kläglich.
»Ich habe besondere Freude am Studium des kanonischen Rechts, sowie an jenem der italienischen Sprache und finde in der Beschäftigung mit beiden einen ganz besonderen Genuß.«
Einen Augenblick saßen die beiden andern stumm, mit halb geöffnetem Munde da, als hätten sie ein Wunderding gehört, dann beschaute der Pfarrer seinen jungen Amtsgenossen beinahe respektvoll, schob das Seidenkäppchen weiter hinaus nach dem Wirbel und sagte:
»Aber Italienisch! – Was wollen Sie denn damit?«
»O, es macht mir Vergnügen, italienische Werke zu lesen, und die Sprache selbst ist an und für sich so schön!«
Der alte Priester sah ihn noch immer mit großen Augen an, während das Weib mit dem Kopfe schüttelte und spöttisch dreinschaute; da kam die Magd herein.
»Hochwürden, Herr Pfarrer,« sagte sie, »die Pilz-Rosalie in Květau liegt im Sterben und Sie möchten so gut sein und sie versehen, der Kirchendiener ist schon nach der Kirche gegangen.«
»Das paßt jetzt auch schlecht,« warf die Köchin hin, während der Pfarrer mit einem Seufzer nach dem großen Zinnkruge blickte – Frohwalt aber, der wohl merkte, daß der alte Herr nicht von besonderer Berufsfreudigkeit erfüllt war, und der gleichzeitig damit die ihm wenig erfreuliche Unterhaltung abbrechen wollte, erklärte:
»Ich will gehen, Herr Pfarrer, doch müssen Sie mir, da meine Sachen noch nicht hier sind, Ihre Klerik borgen.«
Das Gesicht des alten Mannes leuchtete vor Vergnügen; er zog eine kräftigere Rauchwolke aus seiner Pfeife, gab dem Kaplan dankbar die Hand, und wenige Minuten später war Peter Frohwalt in der Kirche, legte die geweihte Hostie in die Bursa, hing sich diese um den Hals und schritt nun, im Amtsgewande des Pfarrers, hinter dem Küster drein, dessen Glöcklein fast unablässig ertönte.
Die Dämmerung war eingebrochen, und das letzte Abendrot verglühte im Westen; aus Feld und Flur stieg ein Düften, und auf Wiesenwegen schritten die beiden hin. Wo ihnen Menschen begegneten, sanken sie auf die Knie vor dem Leib des Herrn und neigten die Häupter, und der junge Priester ging mit gehobener Seele.
Noch vor dem Dörfchen Květau, am Saume eines Gehölzes stand das Häuschen, in welchem die Kranke lag, welche die letzte Wegzehrung begehrte. Frohwalt sah in der dunklen Stube, in welcher jetzt eine geweihte Kerze einen müden[57] Schein verbreitete, ein steinaltes Weiblein, dessen verwittertes Gesicht aus dem Deckbett hervorschaute mit sterbensmüden Augen, in denen es noch einmal aufleuchtete, als der Priester kam.
»O mein Jesus – Sie sind wohl der neue Herr Kaplan?« fragte sie mit leiser Stimme, und als der Gefragte es bejahte, fügte sie bei:
»Ach jetzt bin ich schon glücklich, daß Sie kommen und mir den lieben Heiland bringen. Ich denk', mit mir geht's nimmer lang. Geh' hinaus, Susel, – sprach sie zu dem kleinen Mädchen, das noch in der Stube war – damit ich dem hochwürdigen Herrn meine Sünden sagen kann!«
Die Kleine ging zugleich mit dem Meßner, und mit einem seltsamen Empfinden nahm Peter Frohwalt das erste Sündenbekenntnis eines Menschen entgegen und noch dazu eines sterbenden. Das alte Weiblein hatte nicht viel zu beichten, aber dennoch hob sich seine Seele von einem heiligen Schauer, als er an Gottes Statt die lateinischen Worte der Vergebung sprach. Dann reichte er der Alten den Leib des Herrn, und nun blieb er noch eine Weile bei ihr sitzen.
»Ach, mir ist jetzt so sehr wohl,« sagte sie – »beinahe wie in meinem ganzen Leben nicht; es ist doch schön, wenn man mit seinem Herrgott gut steht und ruhig an den Augenblick denken kann, da er einen heimrufen wird. Vergelt's Gott, daß Sie gekommen sind. Sehen Sie, der Herr Pfarrer ist ein seelenguter Herr, er hat mir heimlich manchen Guldenzettel zugesteckt, von dem die Barbara nichts weiß – aber die Barbara … Gott verzeih' mir's, ich will nichts weiter sagen, nein, nein – der Herr Pfarrer ist eben auch ein armer sündiger Mensch, aber Sie haben noch nicht lange die heilige Weih' erhalten, die wirkt noch bei Ihnen, und darum freut's mich, daß Sie gekommen sind.«
Das Weib redete mit unverkennbarer Anstrengung, aber die Geschwätzigkeit des Alters verließ sie auch jetzt nicht. Frohwalt[58] jedoch wünschte nicht durch müßiges Reden den Eindruck des heiligen Abendmahls zu stören, darum erhob er sich und reichte der Alten die Hand. Sie faßte dieselbe in ihre beiden hagern, harten Hände und sagte:
»Bewahre Ihnen der liebe Gott die Freude an Ihrem Beruf, der so schön ist!«
Dann zog sie seine Rechte ehrerbietig an ihre welken Lippen und sank auf das Lager zurück. Der junge Priester verließ den schwülen, dumpfen Raum, und trat ins Freie. Die angenehme Kühle that ihm wohl, noch mehr aber das Bewußtsein, gleich in den ersten Stunden seiner Amtsthätigkeit einer Menschenseele Trost und Erquickung gebracht zu haben, und so schritt er jetzt neben dem Meßner, der ihn erwartet hatte, langsam wieder Nedamitz zu, wobei er nur mit halbem Ohr auf den geschwätzigen Gefährten hörte, der ihn über die Verhältnisse des Kirchspiels im allgemeinen und besondern zu unterrichten bemüht war.
Im Zimmer des Pfarrers sah er noch Licht. Er trat darum ein, um die Klerik zurückzustellen und fand den alten Herrn auf dem grünen Sopha, wie er mit Barbara »Mariage« spielte. Der Zinnkrug stand noch auf dem Tische. Er hielt sich nicht auf, ihn widerte dies Bild an nach dem, was er vor kurzem geschaut hatte, und er ging nach seinem Zimmer, wo er seinen Koffer vorfand, welchen der Knecht von der Station geholt hatte.

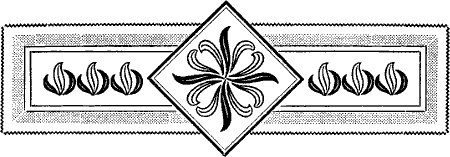

Der Aufenthalt im Nedamitzer Pfarrhause ward für Frohwalt eine Schule der Prüfung und der Selbstverleugnung. Immer mehr erkannte er, daß der Pfarrer ein schwacher Mann und ganz in den Händen der Köchin war, welche hier völlig wie eine Hausfrau schaltete. Der Kaplan, welcher von vornherein ihr Wohlwollen verscherzt hatte, kam dabei nicht besonders gut weg. Seine Zimmer wurden nur mangelhaft in Ordnung gebracht, sein Frühstück erhielt er meist kalt und in dürftigster Weise, und selbst mittags war es vorgekommen, daß für den Pfarrer etwas Besonderes gekocht war, während er sich mit den aufgewärmten Resten der vorigen Mahlzeit begnügen mußte.
Frohwalt nahm alles ruhig hin; er sah manchmal den hilflosen, entschuldigenden Blick des Pfarrers, und das genügte ihm. Dabei war er in seinem Amte unermüdlich und nahm, soweit es anging, dem alten Herrn die mühevollen Arbeiten gern ab; dafür hatte er wenigstens die Genugthuung, daß ihm die Leute überall mit Achtung begegneten, was ihm dem Pfarrer gegenüber nicht immer der Fall zu sein schien, und daß die Kinder der Gemeinde geradezu mit Liebe an ihm[60] hingen. Seine Erholung waren Spaziergänge in der Umgebung, seine Freude seine Privatstudien.
So war der Sommer hingegangen, und herbstlich wehte es über die Stoppeln und durch die Obstgärten. Die Zeit, da man überall Kirchweihfeste feierte, war gekommen, und Peter hatte bei einem derselben die Festpredigt zu halten. Es war in demselben Orte, aus welchem Barbara stammte und wo sie noch Verwandte hatte. Der Pfarrer des Kirchweihdorfes hatte seinen Wagen geschickt, um den Kaplan abzuholen, und die Köchin hatte es für ganz selbstverständlich angesehen, daß sie mit ihm fahren könne. Im größten Putze war sie darum herbeigekommen, um ohne weiteres ihren Platz einzunehmen, aber Peter erklärte, soviel er wisse, sei der Wagen für den Festprediger geschickt worden, und ihm wäre es lieb, ihn allein benützen zu können. Barbara glühte vor Zorn über die nach ihrer Meinung ihr angethane Schmach, sie lärmte im Hofe der Pfarrei, so daß Peter dem Kutscher befahl, schleunigst fortzufahren, und es wenigstens nicht mit anzusehen brauchte, wie der verlegene alte Pfarrer alles aufbot, um sie zu besänftigen und ihr zuletzt – da er selbst über Pferde nicht verfügte, – einen Wagen von einem Bauern verschaffte, in welchem sie auch zur Kirchweih fuhr.
Der alte Herr blieb gegen seine sonstige Gewohnheit zurück, da er mit seinem Amtsbruder in Obernitz, wo das Fest stattfand, nicht in besonders freundlichen Beziehungen stand; der Mann war ihm zu rigoros.
Für Peter war es ein wirklicher Feiertag gewesen; er hatte mit der ganzen Wärme seines Herzens gepredigt, dann hatte der Gottesdienst in würdiger Weise stattgefunden, unterstützt von einem trefflichen Kirchenchor, und der Mittag war im Kreise älterer und jüngerer Amtsbrüder, Dank dem feinen Takte des Gastgebers und dessen ungesuchter Liebenswürdigkeit, lebendig und anregend zugleich gewesen, so daß Frohwalt, der zur Rückkehr den Wagen abgelehnt hatte, mit einem unverkennbaren[61] Behagen dem zwei Stunden entfernten Nedamitz wieder zuwanderte. Auf dem Dorfplatze bei der Kirche, wo einige Verkaufs- und Schaubuden aufgestellt waren, hatte er auch Barbara gesehen, aber sie hatte ihm, sobald sie ihn erblickte, den Rücken zugewendet.
Als er in seinem Kirchdorfe anlangte, war es Abend geworden, und leichte Dämmerung hüllte schon das Pfarrgehöft ein, als er dasselbe betrat. Im Zimmer des Pfarrers brannte die Lampe, und da er demselben Grüße zu bestellen hatte, auch dieser vielleicht mit dem Abendbrote auf ihn wartete, so ging er, ohne sich umzukleiden, dahin. Als er die Thür öffnete, erschrak er. Auf dem Tisch stand der bekannte Zinnkrug neben der Lampe, auf dem Boden davor, mit dem Rücken gegen das Sopha gelehnt, lag der Pfarrer, und sein Gesicht schien bei dem zweifelhaften Lichtschimmer bläulichrot. Er röchelte laut und unheimlich, und dem Kaplan war's nicht zweifelhaft, daß hier ein Schlaganfall vorliege. Hier that schnelle Hilfe not.
Er eilte darum hinaus, den Knecht zu suchen, damit dieser ihm helfe, den schwerkranken Mann zu Bette zu bringen und einen Arzt herbeihole. Er flog die Treppen hinab nach dem Hofe. Der zottige, braune Hund blinzelte nach ihm und wedelte mit dem Schweife, im Stalle klirrte ein Rind an seiner Kette; er aber eilte nach der Kammer des Knechts, die in einem kleinen Wirtschaftsgebäude neben dem Stalle sich zu ebener Erde befand. Hastig riß er die Thür auf und rief, indem er in den halbdunklen Raum blickte, den Burschen beim Namen. Zwei erschrockene Menschen fuhren auseinander, und ein Weib, das ohne Mieder, nur im Unterrock und Hemd sich hier befand, suchte sich in einem dunkeln Winkel zu verbergen; es war zweifellos die junge Magd.
Peter Frohwalt war sich im Augenblick gar nicht klar über den Vorgang; er rief nur:
»Komm schnell, Jakob, den Herrn Pfarrer hat der Schlag getroffen – hilf ihn mir ins Bett tragen und hole den Arzt!«
Dann lief er davon, und der Knecht, welcher hastig eine Jacke überstreifte, rief der Dirne noch ein leichtfertiges Wort zu, dann folgte er dem Kaplan. Sie betraten das Zimmer des Pfarrers, der noch in derselben Stellung lag wie vordem, nur war das Haupt noch tiefer gesunken und das Röcheln ähnelte mehr einem Schnarchen. Der Knecht trat heran, betrachtete ihn, kratzte sich am Kopfe und sprach halb heiter, halb verlegen:
»Ich denke, er ist tot? – Hochwürden, Sie glauben, daß das ein Schlag ist? – Hm – hm – der Herr Pfarrer ist nicht krank, er ist nur – er hat nur …«
Der Bursche wies nach dem großen Kruge, und Peter Frohwalt ging zu seiner Bestürzung eine trübe Erkenntnis auf. Das also war's! – Betrunken! Und dazu hatte er den Knecht geholt! Er schämte sich, zumal er die Empfindung hatte, daß der Bursche mit seinem dummen Lächeln auf dem breiten Gesichte einen solchen Anblick schon kannte. So gebot er denn diesem zuzugreifen, gemeinsam kleideten sie den Pfarrer aus, der sich auch jetzt nicht ermunterte, sondern nur mit halb geschlossenen Augen unverständliche Dinge murmelte und nach Barbara verlangte, und dann brachten sie ihn zu Bette. Nun huschte der Knecht davon, denn ihm war es unbehaglich, wenn er daran dachte, daß ihn der Kaplan wegen der Magd zur Rede stellen könnte; auch wartete die Dirne vielleicht auf ihn. Frohwalt aber löschte das Licht und ging tieftraurig nach seinem Zimmer.
Am andern Morgen schien ihm der Pfarrer auszuweichen; es mochte doch eine Erinnerung in ihm aufdämmern, daß sein Kaplan ihn zu Bett gebracht, aber er rührte nicht an der Sache. Auch Frohwalt that dies nicht, aber ein anderes lag ihm auf der Seele, die Beziehung von Knecht und Magd. Er war sich erst in schlafloser Nachtstunde über den Vorgang in der Knechtkammer bekannt geworden und entsetzte sich über die Unsittlichkeit unter dem geistlichen Dache. Hier mußte Abhilfe[63] geschafft und einer von den beiden, oder alle beide aus dem Dienste entlassen werden.
Er brachte am Abend, als er mit dem Pfarrer allein zu Tische saß, die Rede darauf. Der alte Mann geriet sichtlich in Verlegenheit; er sprach nach vielem Räuspern:
»Mein lieber junger Amtsbruder, Sie fassen die Dinge etwas zu rigoros auf. Sehen Sie, das ist auf dem Lande nicht anders und läßt sich, wenn die Leute nicht selber die sittliche Kraft haben, nicht gut ändern. Hier hilft kein Zureden und kein Entlassen. Wenn ich andere Dienstboten nehme, geht es genau wieder so, weil's junge Leute sind, und alte kann ich nicht brauchen!«
»Aber mein Gott, das ist ja entsetzlich. Das kann ja nicht sein, daß gute Mahnung ganz umsonst sein sollte. Ich will selber einmal mit Jakob sprechen und ihm ans Gewissen klopfen; im Pfarrhause wenigstens muß es in sittlicher Beziehung sauber sein und von da aus muß ein gutes Vorbild und Beispiel gegeben werden.«
Der Pfarrer wurde noch verlegener und suchte sich mit »Ja, ja – hm, hm« zu helfen; er war froh, als Barbara eintrat und das Gespräch damit unterbrochen wurde.
Der Kaplan aber suchte schon in den nächsten Tagen eine Gelegenheit, mit dem Knechte, der ihm sichtlich auswich, allein zu sein. Er redete ihm scharf und doch warm ins Gewissen und verlangte mit Entschiedenheit, daß er keine solche Schande über das Haus bringe, weil er – Frohwalt – dann in jedem Falle auf seiner Entlassung bestehen müsse schon im Interesse der guten Zucht und der Verhinderung allgemeinen Aergernisses.
Der Bursche grinste ihn dummdreist an und sagte mit einem blöden Lächeln:
»Je ja – Hochwürden – ich will ja die Franziska heiraten – wir sind eben Brautleute – und ist alles in Ehren! Wenn Sie so sein wollen, dann wär' über Manches zu reden[64] – ich spreche nicht vom Pfarrhause, Gott behüte – aber im Dorfe! Der untere Wirt lebt mit seiner Magd – und da spricht niemand mehr drüber –.«
»Ich werde aber drüber sprechen! Das muß anders werden, im Hause und im Dorf, verlaß Dich drauf, Jakob! Und richte Dich danach samt der Franziska!«
Den jungen Priester hatte ein heiliger Zorn ergriffen, sein Gesicht glühte, als er fortging, der Knecht aber sah ihm kopfschüttelnd mit seinem dummen Lächeln nach.
Nun begann Frohwalt erst nach dem und jenem im Dorfe zu fragen und erfuhr denn so manches, was in einer kirchlich gut geleiteten Gemeinde nicht sein sollte. Das war ja ein kleines Sodom! Besonders die Geschichte mit dem untern Wirte, die sich bestätigte und in der niemand ein Aergernis sah. Der Mann war Witwer und die Magd ein stattliches Weibsbild.
An dieser Stelle mußte der Hebel zuerst angesetzt werden. Wiederum sprach Peter Frohwalt zuerst mit dem Pfarrer, der hin- und herredete und, wie es schien, doch nicht den Mut hatte, hier vorzugehen. Es wäre doch nichts zu machen. Man könnte ja mit Exekutivmitteln die Entfernung des Weibsbildes durchsetzen, aber einen Zweck würde das kaum haben, sie ginge zu einer Thür hinaus und käme bei der andern wieder herein. Am besten wär's da, ein Auge zuzudrücken, so lebe man wenigstens in Frieden mit den Leuten.
Damit aber mochte sich der Kaplan nicht beruhigen, und als er eines Nachmittags den unteren Wirt behäbig vor seiner Thüre stehen sah, und dieser ihn mit einem biedermännischen Schmunzeln beinahe vertraulich grüßte, trat er auf ihn zu und fragte, ob er vielleicht für eine Viertelstunde unter vier Augen mit ihm reden könne.
Der Mann war verwundert und bat ihn einzutreten. Er führte ihn nach dem Obergeschoß des Hauses, wo die Wohnzimmer waren. Auf der Treppe begegnete ihnen die Magd,[65] ein blühendes, dralles Weib, das ihnen freundlich zulachte und das der Wirt ohne jede Scheu auf den nackten Arm tätschelte.
In der Stube angelangt und unter vier Augen hörte der Mann beinahe verwundert, weshalb der junge Priester gekommen war. Er ließ ihn reden, und Frohwalt wußte nicht, ob die Röte, die jenem ins Gesicht stieg, Scham oder Unmut bedeute. Er sprach mit warmer Herzlichkeit, aber auch nicht ohne eine gewisse Strenge, und gerade die schlug bei dem heißblütigen Manne und angesichts der Jugend des Kaplans dem Fasse den Boden aus.
»So?« – polterte er. – »Was sagen Sie mir da von Unrecht und Sünde? Potz Element, da kehren Sie doch erst einmal in der Pfarrei aus. Herr Kaplan, Sie sind zu jung hier am Orte und darum kann ich Ihnen nicht allzu sehr übelnehmen, wenn Sie am verkehrten Ende anfangen. Der Herr Pfarrer ist jetzt auch etwas älter geworden, aber vor zwanzig und zehn Jahren noch ist's wunderlich hergegangen im Pfarrhof, und wir haben's ihm im Dorfe gar nicht übel genommen, er ist eben auch ein Mensch, und die Barbara war hübsch –.«
Frohwalt war bleich geworden bis in die Lippen und lehnte sich tiefatmend in seinen Sitz zurück, ihn traf jedes Wort wie ein Keulenschlag, und die Hände wie zur Abwehr vorgestreckt, stammelte er: »Das kann ja nicht sein – das ist …«
»Eine Lüge, wollen Sie sagen, Hochwürden?« fragte der andere, ohne jeden Hohn und völlig ruhig – »na, da wissen Sie auch nicht, was hier jeder weiß, daß ein Sohn von ihm in der Welt herumläuft, ein verkommener Bursche, der ihm viel Sorgen macht und den er gar nicht einmal verleugnet! Da giebt's nichts zu lügen und nichts zu verheimlichen, und darum ist's besser, man rührt an solchen Sachen nicht. Und ich hätt's auch nicht gethan, wenn Sie mir nicht so gekommen wären, aber wie man in den Wald schreit, so hallt's heraus …«
Der Kaplan vermochte nicht mehr zu sprechen; er ließ den Wortschwall des anderen über sich ergehen, ihm war die Kehle wie zugeschnürt. Zusammengebeugt, elend an Körper und Gemüt, verließ er das Haus, das er mit solcher sittlichen Entrüstung betreten hatte, und die schöne Magd sah ihm lächelnd von der Schwelle aus nach.
Seit jener Stunde fühlte er sich unglücklich in Nedamitz. Anfangs hatte er daran gedacht, selbst dem Pfarrer einen Vorhalt zu machen, aber das gab er auf, was hätte es auch nützen sollen! Er empfand mit dem alten, schwachen Manne Verachtung und Mitleid zugleich und suchte sich einigermaßen damit zu beruhigen, daß er sich an die Züge von Herzensgüte hielt, die versöhnlich neben seine Schwächen traten. Die Köchin jedoch haßte er, und mit ihr sprach er nur, was unbedingt nötig war; Barbara aber vergalt ihm diese feindliche Stimmung mit Gleichem und ließ ihn, wo es nur anging, empfinden, daß sie in diesem Hause das Heft in der Hand habe.
So kam der Winter. An den langen Abenden saß Frohwalt in seiner Stube und arbeitete. Er hatte eine größere kirchenrechtliche Abhandlung unter der Feder, die er zu veröffentlichen gedachte, und bei dieser Thätigkeit fand er Freude und Ruhe. Seine Pflichten erfüllte er dabei mit größter Pünktlichkeit und nahm nach wie vor das Beschwerlichste dem Pfarrer ab, der ihn mit unverkennbarer Zuneigung und zugleich mit einem fast scheuen Respekt behandelte.
Es war Weihnachten erschienen, das Fest der Freude. Der junge Kaplan hatte wenig von der letzteren gemerkt. Mutter und Schwester hatten ihn mit kleinen Geschenken bedacht, und die hatte er am heiligen Abend vor sich hingelegt, als er bei einsam brennender Lampe an dem vor den Ofen gerückten Tische saß. Kein Christbaum, kein Freund – zum ersten Male wurde ihm in diesen Stunden wehmutsvoll zu Sinne. Er sah hinaus auf die Dorfgasse, aus den kleinen Fenstern der[67] Häuschen fiel der Lichtschein und ihm war's, als höre er durch die Stille der Nacht das Jauchzen fröhlicher Kinderstimmen. O, die Entsagung war nicht immer leicht, das Sichselbst und sein Empfinden besiegen hart. Da fiel ihm das kleine Buch von Vetter Martin in die Hand, das Laienbrevier, und wie er es aufschlug, las er:
Das Wort gab ihm eine wunderbare Ruhe und Klarheit. Den Augenblick besiegen, immer gut sein! Darin lag ja alles, und der das sagte, der ihm in dieser Weihnacht solchen Trost verlieh, war – ein Protestant, aber der Gedanke vermochte ihn heute nicht zu erregen, um so mehr, als er manches Goldkorn schon in dem Büchlein gefunden hatte, das ihn bald abstieß, bald wieder seltsam anzog. Mit dem Gelöbnis, stets aufs neue danach zu streben, immer gut zu sein, ging er um Mitternacht, als die Glocken klangen, hinüber nach der Kirche zur Mette.
Der erste Weihnachtsfeiertag brach wenig freundlich an; er brachte kalten Wind und Schnee, und Frohwalt empfand sein ganzes Unbehagen, als er nach dem Filialdorfe Květau hinüberwanderte, um in der dort befindlichen Kapelle die heilige Messe zu lesen. Es war immer ein Stündchen Wegs, und selbst auf der Straße schlechter Pfad, aber, den Kragen[68] seines Ueberrockes heraufgeschlagen, die Klerik hochgeschürzt, so schritt er wacker aus.
Das kleine Gotteshaus war ganz gefüllt von Andächtigen, zu dem Klange der bescheidenen, dünnstimmigen Orgel tönte der fromme Gesang des Weihnachtsliedes:
Bei dem alten Lehrer trank er nach dem Gottesdienste eine Tasse Kaffee und hörte dessen Klage über die Feindseligkeiten zwischen den Deutschen und den Tschechen im Dorfe, welche durch die Tagesblätter, besonders die tschechischen, gegen einander gehetzt würden; er hätte manchmal mit der Jugend schon seine liebe Not. Dann ging er wieder gen Nedamitz zurück. Das Wetter war besser geworden und über dem winterlichen Landschaftsbilde lag ein wärmerer Sonnenstrahl, so daß sein Kirchdach recht freundlich aus der weißen Schneehülle herauslugte.
Dann saß er am Mittagstische mit dem Pfarrer beisammen. Der Gänsebraten duftete, und in den Gläsern perlte heute goldiger Czernosecker. Der alte Herr fühlte sich angesichts dessen besonders behaglich und heiter, aber auch hier sollte es sich bewähren, daß »der bösen Mächte Hand zwischen Lipp' und Kelchesrand schwebt.«
Die Köchin kam plötzlich recht eilfertig herein und hinter ihr ein Mann aus Květau. Sie rief:
»In Květau hat's nach der Kirche eine Rauferei gegeben, und der Jiři Pacak ist gestochen worden. Er wird wohl sterben, und da möcht' jemand kommen und ihm das Sakrament geben. Da haben die Deutschen wieder angefangen, die Mörderbande!«
»Ach nein« – suchte der Bote dazwischen zu reden – »der Jiři ist selber Schuld gewesen, er hat …«
Die beiden Geistlichen waren erregt aufgestanden und der Pfarrer sagte seufzend:
»Na, da will ich doch gleich – weil der Bursche nicht gut deutsch kann – –«
»Ach, das wär' noch schöner!« rief die Köchin – »Sie werden doch nicht bei dem Wetter – es hatte eben wieder zu schneien angefangen – selber gehen? Da geht allemal der Pater Peter. Schaun's, daß Sie fortkommen« – wandte sie sich an den Kaplan – »geben's dem Burschen die Oelung und reden's dabei dem verdammten Gesindel, den Deutschen, mal ins Gewissen! Nu ja – auf was warten's denn noch, da essen Sie mal ein Stückel Gans weniger!«
Im ersten Augenblick stand Frohwalt ganz verdutzt da, und der Bote aus Květau machte ein seltsam verwundertes Gesicht; der junge Priester erwartete, daß der Pfarrer etwas sagen würde auf solche Aeußerungen, die noch dazu im unhöflichsten Tone gesprochen wurden, und als dies nicht geschah, stieg ihm eine heiße Röte ins Gesicht und er sprach:
»Nun möcht' ich doch endlich wissen, ob ich vom hochwürdigsten Konsistorium oder von der Pfarrköchin in Nedamitz angestellt bin? – Sie haben wohl die Güte, dieselbe darüber zu unterrichten, Herr Pfarrer, denn ich bin der Quälerei dieses Weibes müde.«

»Was – Quälerei? – Ich bin noch mit jedem geistlichen Herrn drausgekommen, aber so stolz und hochnäsig hat noch keiner gethan; ich bin 25 Jahre – –«
»Barbara, Barbara,« rief der Pfarrer fast bittend dazwischen, Frohwalt aber sagte:
»Ich behalte mir vor, die Antwort auf meine Frage vom Konsistorium selbst zu erbitten! Jetzt wartet ein Sterbender – kommen Sie!«
Und während der Pfarrer und die Köchin noch sich stumm und befremdet anblickten, ging der junge Priester mit dem verdutzt dreinschauenden Boten hinaus. Er eilte, nachdem er[70] diesen zum Meßner geschickt hatte, seine Klerik anzuziehen, und bald darauf schritt er zum zweiten Male durch Schnee und Wind gegen Květau, diesmal mit beschleunigtem Fuße, sodaß er in einer halben Stunde dort anlangte. Er fand, noch im Wirtshause, wo der böse Streit stattgefunden, einen Sterbenden, um welchen sich der herbeigerufene Arzt vergebens bemühte, und dem er nur die letzte Oelung zu reichen vermochte.
Der Anblick des blutbefleckten, regungs- und bewußtlosen Menschen hatte ihn tief erschüttert, mehr noch aber die Erzählung des Wirtes, nach welcher er selbst die unschuldige Veranlassung der furchtbaren That geworden war. Er hatte am Ende der Messe drei deutsche Vaterunser gebetet – der Pfarrer hatte immer noch eins oder zwei in tschechischer Sprache eingefügt; – da hatte der Jiři im Wirtshause, wo sich die Bauern nach dem Gottesdienste zusammenfanden, sich darüber lustig gemacht, und so lange auf die Deutschen gestichelt, bis der Streit anhob, in welchem er selber zuerst das Messer gezogen hatte; ein Deutscher hatte es ihm entwunden, und als der trotzige Bursche mit diesem rang, glitt er aus und fiel in die noch immer offene Schneide.
Der Heimweg nach Nedamitz war für Frohwalt fürchterlich. Ihm lag es auf der Seele, daß er sich, noch dazu in Gegenwart des fremden Boten, im Pfarrhause von seinem Zorn hatte überwältigen lassen – er hätte ja auch schweigend fortgehen können, noch entsetzlicher aber war ihm dies letzte grauenhafte Erlebnis. Er ging, einem Automaten gleich, dahin, und seine Füße waren ihm schwer.
Als er im Pfarrhause ankam, schien der Pfarrer bereits auf ihn zu warten. Er war in Verlegenheit und in Sorge zugleich. Die Drohung des Kaplans mit dem Konsistorium war ihm nicht gleichgültig, da er wußte, daß er manches auf dem Kerbholz hatte. Darum suchte er Barbaras Ungehörigkeit zu entschuldigen, und bat ihn, die Sache nicht so ernst zu nehmen; er habe der Köchin ins Gewissen geredet, und Aehnliches werde[71] ganz gewiß nicht wieder vorkommen. Frohwalt hörte nur mit halbem Ohre hin; er sprach einige beruhigende Worte, denn der alte Herr, der in den Händen des Weibes war, that ihm leid, und dieser ging zuletzt gedrückt und verstimmt fort.
Zum Abendbrot kam der Kaplan nicht, sodaß die Sache selbst der Köchin unbehaglich ward; er betete lange, aber er fand keine rechte Ruhe. Immer sah er das bleiche, verzerrte Gesicht des erstochenen Burschen vor sich, und erst spät begab er sich zu Bette. Doch fand er lange keinen Schlaf. Er hörte das Heulen des Windes um das Haus, dazwischen ab und zu das Schlagen der Uhr vom Kirchturme, und wälzte sich fieberheiß von einer Seite nach der andern. Die Last seines Amtes lag zum erstenmale mit erdrückender Wucht auf ihm, und er hatte keine Menschenseele, in die er etwas davon hätte legen und der er hätte klagen können.
Gegen Morgen war er entschlummert, und mit dem grauenden Wintertage stand er wieder auf und ging nach der Kirche zur Messe. Dann war er aufs neue daheim in seiner Stube – einsam, bange und trüb. Was war das für ein Weihnachtsfest! Hatte denn der Himmel für ihn keinen Tropfen Freude?
Um die Mittagszeit stand er am Fenster, das nach der Dorfgasse hinsah und schaute hinaus. Heute lag es wie eine blaue Glocke über der Welt, und der Sonnenschein blitzte auf dem weißen Schnee. Kleine Mädchen rollten ihn zusammen zu Klumpen, um sie zu einem ungefügen Manne zusammenzusetzen, und neckende Knaben warfen sie dabei mit den weißen, weichen Bällen. Und sie jauchzten und lachten, daß es dem jungen Priester wunderlich in der Seele widerhallte. Das gab ihm einige Heiterkeit wieder, aber es sollte noch besser werden.
Da kam am Ende der Gasse, soweit er sie überschauen konnte, ein Mann her mit einer Pelzmütze auf dem eckigen Kopfe, um den die grauen Haare flatterten, einen wunderlichen[72] langen Mantel umgehangen, einen Ranzen auf dem Rücken und in der Faust den derben Knotenstock. Das war der Vetter Martin, wie er leibte und lebte.
In Frohwalts Gesicht stieg die Röte der Freude; er riß das Fenster auf, und rief einen lauten Gruß hinaus, so daß die liebe Jugend erstaunt empor sah, der alte Wanderer aber riß die Mardermütze vom Kopfe und schwenkte sie lustig. Bald darauf stampfte er herein in die Pfarrei.
»Na, komm ich recht? – Hab' mir Dein Nest einmal zur Winterszeit ansehen wollen, da paßt mir's am besten! Gesegnete Feiertage!«
»Ach, Vetter Martin, Dich schickt der Himmel! Keinen Menschen könnt' ich just so gut brauchen, als Dich!«
»Na, siehst Du wohl – mein Ahnungsvermögen! Ja, so ein alter Naturforscher hat eine höllisch feine Nase. Drückt Dich's irgendwo? Herunter damit, wir wollen schon fertig werden zusammen.«
Und da saß der Alte am Ofen und streckte seine Beine weit von sich, und hatte sich seine kurze Thonpfeife angebrannt, und Peter Frohwalt erzählte ihm nun alles, alles: Vom Leben in der Pfarrei, von der Köchin Barbara, von den faulen Zuständen in Haus und Gemeinde und von dem gestrigen Morde in Květau und es that ihm wohl, sich endlich einmal entlasten zu können.
Vetter Martin hatte ihm schweigend, manchmal mit leisem Kopfschütteln zugehört, und sagte nun:
»Ja, mein lieber Peter, ich hab's Dir's ja vorausgesagt, daß Dich das Leben erst noch abschleifen werde, und das thut allemal ein wenig weh. Dein alter Pfarrer, Deine liebe Barbara, der muntere Wirt, der verliebte Jakob und wer sonst noch sind die Wetzsteine für Dich und zeigen Dir zugleich, daß unser Herrgott sehr wunderliche Kostgänger hat, und daß man nicht alles mit Gesetzen und allgemeinen Regeln abthun kann. Der liebe Gott füttert und erhält sie alle in[73] gleicher Weise und thut jedem ein wenig Liebe an, und zuletzt bringt er alles in den richtigen Topf. Mach's ebenso! Deinen Pfarrer und seine Köchin will ich mir erst näher besehen und dann Dir meine Meinung sagen, auch den untern Wirt möcht' ich kennen lernen und sein »Aergernis«. Was aber die Květauer Geschichte betrifft, so weiß ich nicht, warum Du Dich gar so erregst; traurig ist sie, aber auf Deine Rechnung kann sie nicht kommen. Du hast Deine Vaterunser gebetet, wie deine gute Mutter es Dich gelehrt hat und in ihrer Sprache, weil Du eine andere nicht verstehst. – Das ist doch keine Schuld und keine Sünde, das ist doch gerade so, wie wenn sich die Bengels darüber totstechen wollten, weil Du Dich zufällig nicht in ein Schnupftuch mit den tschechischen Nationalfarben geschnäuzt hast. Thu', was Du in Deinem Gewissen für gut und recht hältst und fürs übrige laß unsern Herrgott sorgen! Basta – das ist die ganze Moral und die gilt für Christen, Juden, Türken und Kalmücken!«
Die Thüre öffnete sich und der Kopf des Pfarrers zeigte sich; er hatte laut sprechen hören, und war, von Neugier geplagt, gekommen, angeblich, um den Kaplan zu Tische abzuholen. Frohwalt stellte ihm seinen Gast vor, und der alte Herr lud mit liebenswürdigem Eifer denselben ein, am Mittagsmahle teilzunehmen. Vetter Martin ließ sich nicht drängen, und so gingen die Drei nach dem Speisezimmer und der Pfarrer erteilte der Köchin den Auftrag, noch für ein Gedeck zu sorgen.
Das Weib zeigte sich zur Verwunderung des Kaplans ganz besonders freundlich und höflich, und die Mahlzeit verlief, zumal der Gast mit seinen reichen Erfahrungen und seinem köstlichen Humor den Löwenanteil an der Unterhaltung nahm, in sehr angenehmer Weise. Auch der Pfarrer hatte sich dabei von einer so vorteilhaften Seite gezeigt, wie ihn Frohwalt noch gar nicht kannte. Er wurde lebhaft und sogar witzig, harmlos, heiter und liebenswürdig gesellig, und Vetter[74] Martin mußte versprechen, im Pfarrhofe über Nacht zu bleiben und wenigstens noch einen Tag hier zuzubringen. Der Pfarrer hatte früher sich mit Botanik beschäftigt, später fehlte ihm ein anregender Genosse und er hatte die Sache liegen lassen, aber er wollte seine wohlverwahrten Pflanzensammlungen auskramen und Martin sollte ihm einiges bestimmen helfen.
Als dieser nach Tische mit Peter allein zusammen war, sagte er:
»Sieh' mal, Dein Pfarrer ist ein Mensch, der viel besser verbraucht werden könnte, als es geschieht. Er ist einfach hier – wie man sagt – versauert, und weil er keinen besseren Umgang fand, in die Hand der Jungfrau Barbara gefallen. Er hat ein gutes, menschenfreundliches Herz, und daran mußt Du Dich halten, das söhnt mit Manchem aus; seine Schwächen mußt Du in Kauf nehmen, er ist zu alt, um sie noch abzulegen. Deiner lieben Barbara aber mußt Du die Zähne zeigen, ordentlich … dann wird sie zahm. Mich behandelt sie wie ein rohes Ei, und es war mir, als ob sie auch Dich ein- ums andere Mal achtungsvoll angesehen hätte … da siehst Du, wie's gut thut, wenn man zu Zeiten einmal aufmuckt! Thue recht und scheue niemand, nicht einmal eine Pfarrköchin! Also mein Lieber, die Leute nicht nach der allgemeinen Regel und nach dem Kirchenrecht behandelt, sondern nach der Art, wie sie verbraucht werden müssen! Wenn Du erst soweit gekommen bist, dann stehst Du auf freier Höhe, von der aus Du den rechten Segen bringen kannst!«
Am Abend saß der wunderliche Gast wieder mit den beiden Priestern zusammen, und es wurde ziemlich spät, ehe man zur Ruhe kam. Seltsamer Weise hatte der Pfarrer an diesem Abend viel weniger getrunken als sonst, nicht bloß, weil er sich vor dem Fremden scheute, sondern weil er dazu kaum die Zeit fand. Er hatte seine getrockneten Pflanzen gebracht, und ging wie in alten, schönen Tagen, wieder in der Botanik auf;[75] er wollte von neuem anfangen zu sammeln, und Martin versprach, ihn auch aus der Ferne zu unterstützen.
Frohwalt hatte an diesem Abend mehr als je den Eindruck, daß er von Vetter Martin noch Vieles lernen könne, namentlich im Umgang mit Menschen. Und er sollte noch mehr in dieser Hinsicht erleben. Der seltsame, sonst so unruhige Gast ließ sich sogar noch zwei Tage in der winterlichen, stillen Dorfpfarre festhalten und wohnte auch dem Begräbnis des in Květau erstochenen Burschen bei, das der Pfarrer abhielt, und bei welchem zahlreiche Gendarmerie anwesend war, weil man von der Erregung der Tschechen Unannehmlichkeiten und Störungen fürchtete. Aber die Sache ging ziemlich ruhig ab.
Als die beiden Männer nach Nedamitz zurückgekehrt waren, fanden sie im Pfarrhause den untern Wirt, welcher auf den Pfarrer wartete und bei diesem das kirchliche Aufgebot mit seiner Magd bestellte. Martin war dabei zugegen, und der Mann reichte ihm, nachdem er mit dem Pfarrer gesprochen, treuherzig die Hand und sagte:
»Na, ist's so recht, Herr Martin?«
»Ja, mein lieber Herr Polzner, – ich freue mich sehr drüber!« erwiderte dieser, und das Gesicht des Wirtes strahlte vergnüglich, als er fortging und so heiter wie selten in seinem Leben durch die Dorfgasse schritt.
Peter Frohwalt war angenehm überrascht und erfreut über diese Kunde, und Vetter Martin, der sie ihm zuerst hinterbracht hatte, lächelte dabei so seltsam, daß er diesen verwundert und fragend anschaute.
»Nun ja, mein lieber Peter, ich bin gestern im untern Wirtshause gewesen, habe ein Glas Bier getrunken und mich dabei mit dem Wirte, den ich allein traf, unterhalten. Er schien mir ein ganz vernünftiger und zugänglicher Mann zu sein, und da habe ich denn nach meiner Weise ihn gefaßt. Mit der Thür ins Haus fallen darf man dabei nicht, von Aergernis[76] in der Gemeinde reden und dergleichen ist hier ganz ungeschickt, man muß immer wieder sehen, aus welchem Holze der Mensch geschnitzt ist, und wo er eine weichere Stelle hat. So sagte ich ihm: ›Sie haben ja eine prächtige, stattliche Wirtin, hübsch, jung, flink – 's ist wohl Ihre zweite Frau?‹ – Er wurde ein bißchen verlegen, dann druckste er so langsam mit der Wahrheit heraus. ›I, sehen Sie mal – aber eine schönere, passendere Frau könnten Sie doch nicht finden, der Himmel schickt Ihnen ja förmlich das Glück ins Haus – sonst schnappt's ein anderer weg, greifen Sie zu! – Na, und wissen Sie, 's ist auch wegen dem Mädel selber, das nur einmal seinen guten Ruf hat, und wenn die Leute Ihnen nichts ins Gesicht sagen, hinterm Rücken reden sie doch, und das arme Frauenzimmer kommt dabei am schlimmsten weg. Ich thät' die Lästermäuler stopfen – Sie sind der reiche untere Wirt, Sie brauchen sich um niemanden zu kümmern – und Sie sollen sehen, was Sie erst gelten, wenn Sie den Trumpf ausspielen.‹ So ungefähr habe ich ihm zugeredet, und dabei haben wir wie zwei Brüder am Tische gesessen und miteinander getrunken und dies und das gesagt, bis er mit einem Male seine Hand auf meine legte und sprach: ›Sie sind ein vernünftiger Herr – Sie haben recht – und dann, man soll meine Johanne nicht mit der Pfarr-Barbara in einem Atem nennen – ich bestelle morgen mein Aufgebot!‹ Und heute ist er dagewesen. Siehst Du, mein lieber Peter, daß es auch ohne Kirchenrecht manchmal geht!« –
Als Vetter Martin am andern Morgen seinen Ranzen aufschnallte und seinen »Schweizer« ergriff, hatte der Pfarrer Thränen im Auge; ihm war's, als zöge ein lieber Verwandter fort, ein Mensch, der ihn verstanden hatte, wie seit langem keiner.
Peter Frohwalt begleitete den Wanderer noch ein gut Stück Wegs, und als er endlich auch mit kräftigem Handdruck[77] von ihm schied, kehrte er mit seltsam gehobener Stimmung in das Dorf zurück.
Es war, als ob ein guter Geist durch das Pfarrhaus gegangen wäre; der Pfarrer war heiterer und voll Interesse für manches, was ihn vordem gleichgültig gelassen; er begann wieder eifrig mit botanischen Studien, und als das Frühjahr die ersten Gräser und Blumen brachte, begann er wieder zu sammeln und zu ordnen, und dabei kam er viel seltener zu dem vorigen übermäßigen Trinken; Frohwalt selbst war nachsichtiger in seinem Wesen, verständiger in Behandlung der Menschen und ruhiger geworden, und selbst bei Barbara schien entweder der Besuch Martins, oder das entschiedene Auftreten des Kaplans zu Weihnachten gewirkt zu haben, denn sie behandelte den letzteren höflich, ja mitunter sogar freundlich.
Und gerade, als die Verhältnisse sich zu bessern anfingen, erhielt Peter Frohwalt den Ruf in einen andern Wirkungskreis. Er hatte die Abhandlung, an welcher er im Herbst bereits geschrieben, veröffentlicht, und hatte die Freude gehabt, daß namhafte Gelehrte, so besonders der Professor des Kirchenrechts an der Prager Hochschule, Dr. Holbert, sich ungemein anerkennend darüber ausgesprochen hatten. Das hatte wohl die Aufmerksamkeit seiner geistlichen Vorgesetzten auf ihn gelenkt; man erinnerte sich außerdem, daß er seine sämtlichen theologischen Prüfungen mit Auszeichnung bestanden hatte, und so bekam er eines Tags ein Schreiben, das seine Ernennung zum Adjunkten an dem Priesterseminar in Prag enthielt: die erste Staffel zur theologischen Professur, oder auch zum Kanonikat.
Sein Herz schlug ihm höher vor Freude, als er die Berufung las, und da er dem Pfarrer Mitteilung machte, sagte dieser, indem er ihm Glück wünschte:
»Dort passen Sie hin, und ich gönn's Ihnen von Herzen! Aber wenn Sie dort sind und einmal die violette Halsbinde[78]3 tragen, denken Sie nachsichtig an einen alten Landpfarrer!«
3 Abzeichen der Domherren.
Es klang eine schmerzliche Wehmut aus den Worten des greisen Priesters, und verständnisvoll drückte ihm Frohwalt die Hand.
Als der Frühling seinen Einzug hielt und die Bäume in den Gärten von Nedamitz blühten, verließ der Kaplan die Stätte seiner bisherigen Wirksamkeit. Der Knecht – es war nicht mehr Jakob, welcher vor kurzem wegen Unredlichkeit entlassen worden war – brachte sein Gepäck nach der Station, er selbst ging, wie er zu Fuße einst gekommen, ebenso wieder hinaus aus dem Dorfe. Der Pfarrer gab ihm das Geleit und Barbara, die ihm noch eine gebratene Ente in seine Umhängtasche gepackt hatte, wischte sich sogar das Auge aus mit dem Schürzenzipfel und küßte ihm die Hand. Es geschah vielleicht aus Klugheit, nachdem sie wußte, daß er jetzt am Sitze des allmächtigen Konsistoriums wohnen würde.
Die Leute in der Dorfgasse grüßten ihn freundlich, und er gab allen, die ihm begegneten, die Hand; besonders die Kinder aber drängten sich noch einmal heran, ihn mit dem Handkusse zu begrüßen. Beim untern Wirtshaus stand der Wirt mit seinem jungen Weibe unter der Thüre. Der Mann lüftete lustig sein grünes Sammtkäppchen und rief ihm herzlich-freundliche Worte zu, und Peter reichte auch den Beiden seine Rechte. Vor dem Dorfe sah er noch einmal zurück. Die erste Station seiner Berufsthätigkeit! Der Gottesfriede, der über dem freundlichen, blühenden Landschaftsbilde lag, ergriff ihn mächtig, und erst in dieser Minute wurde ihm der Abschied wirklich schwer.
»Gottes Segen über alle, die hier wohnen!« sprach er halblaut, und sah mit schimmernden Augen in das Angesicht des gleichfalls tiefbewegten Pfarrers.



Der Uhrmacher Freidank war thatsächlich zum protestantischen Bekenntnis übergetreten. Die Sache hatte sich in aller Stille vollzogen, und selbst in der kleinen Stadt, wo es nicht allzuviel Gesprächsstoff gab, wurde nicht lange darüber geredet. Das Ereignis schien sogar für Freidank günstige Folgen zu haben. Man hatte ein gewisses Interesse für ihn gewonnen, und die Zahl seiner Kunden mehrte sich, trotzdem der heißblütige junge Kaplan in seinen Kreisen gegen ihn eiferte. Ja selbst die gehässige Weise, in welcher dies geschah, blieb nicht ohne Folgen. Zwei Familien, in welchen die Gatten verschiedenen Glaubensbekenntnissen angehörten, traten, um solchen Vorkommnissen, wie sie beim Tode von Freidanks Frau sich abgespielt hatten, von vornherein die Spitze abzubrechen, ebenfalls zum Protestantismus über, und diese Uebertritte vollzogen sich in aller Stille in dem kleinen Kirchlein von Burgdorf.
Marie Frohwalt aber lebte Wochen lang mit sich selber in herbem Zwiespalt. Es zog sie hin zu dem verwaisten Kinde der Freundin, und doch fürchtete sie einerseits den Bruder, der von etwaigen Besuchen erfahren konnte, und dann hatte[80] sie doch eine mädchenhafte Scheu, die sie abhielt, das von diesem bereits angedeutete Gerede der Leute herauszufordern.
Zuletzt überwog die Liebe zu der kleinen Grethel, und Marie suchte die Nachbarin Becker auf, und spielte auf deren Stube mit dem Kinde. Dem Vater derselben wich sie sorgfältig aus, wenigstens konnte niemand sagen, daß er sie allein mit ihm im Gespräche gesehen hätte. Freidank selbst war ihr gegenüber zurückhaltend, beinahe ängstlich und einsilbig; er verstand wohl, was in der Seele des Mädchens vorging und wußte, daß er ihren Ruf zu schonen hatte.
Im Juli fiel der Namenstag seines verstorbenen Weibes, den er immer durch eine freundliche Gabe gefeiert hatte. Diesmal konnte er ihr nichts bringen, als eine Handvoll Rosen aus seinem Gärtchen von demselben Strauche, den sie selbst bald nach ihrer Hochzeit gepflanzt hatte. Am Morgen betrat er den Friedhof und ging, sein kleines Mädchen an der Hand, nach dem abgelegenen Grabe an der Mauer. Das weiche Gras machte seinen Schritt unhörbar, und so vernahm ihn auch die jugendliche Frauengestalt nicht, die ihm den Rücken zuwendete und über das schlichte Holzkreuz geneigt an dem wohlgepflegten Hügel stand. Erst als er grüßte, sah sie beinahe erschrocken empor. Es war Marie, die einen kleinen Kranz von Feldblumen – wie die Verstorbene sie besonders geliebt hatte – auf dem Grabe niedergelegt hatte. Freundlich lugten die blauen Kornblumen aus dem grünen Grase.
»Sie haben doch auch d'ran gedacht – das ist hübsch von Ihnen, Fräulein Marie,« sagte der Mann, während das Kind schon nach den Händen der »guten Tante« gehascht hatte und sich daran hing.
»Vor einem Jahre hat sie noch gelebt!« antwortete fast verlegen das blonde, hübsche Mädchen.
»Ja, aber zwei Tage später lag sie, und sollte nicht wieder aufstehen. O dies Einsamsein ist schrecklich, und das Kind muß auch darunter leiden. Die Frau Becker meint's ja[81] gut, aber sie hat selber keine Kinder gehabt und weiß nicht mit solchen umzugehen. Ich bin manchmal so trostlos, so elend – ach, Sie glauben's gar nicht, Fräulein Marie. Ja, wenn Sie einmal mit Grethel wieder geredet und gespielt haben, da lebt das Kind auf, und ich mit ihm … aber es kommt selten. Ich weiß ja, daß es nicht anders sein kann, die Welt hat eine zu böse Zunge, und ich kann mir's denken, daß Sie auch jetzt wieder auf Kohlen stehen, wenn uns jemand hier zusammen sähe, und doch ist's uns beiden hier ein geheiligter Boden. Nun, Gott dank's Ihnen, daß Sie heute an meine Grethe gedacht haben – ich will Sie aber nicht aufhalten – –«
Marie konnte sich aus ihrer Verlegenheit nicht herausfinden. Sie sprach endlich stockend:
»Ja, Sie wissen's ja, Herr Freidank, wie lieb mir Ihr Grethel ist, und wie ich mich immer freue, wenn ich das Kind sehe – nicht wahr, kleine Maus?« wandte sie sich an das Mädchen, das sich mit ganzer Zärtlichkeit an sie schmiegte und mit den kleinen Aermchen ihren Leib umschlang.
»Adieu, Grethel!«
Sie beugte sich, noch immer verlegen und ängstlich, nieder, küßte das Kind, und dann reichte sie dem Manne die Hand:
»Leben Sie wohl, Herr Freidank – Sie wissen ja, wie ich's meine!«
Er nickte stumm, und wie sie nun rasch zwischen den Kreuzen hinschritt, hinüber nach dem Grabe ihres Vaters, schaute er der schlanken Gestalt noch einmal nach, dann hob er seine Kleine empor und drückte sie fest an sein Herz.
Etwa drei Wochen später ging Marie gegen Abend durch die Berggasse. Da kam der Vetter Martin ihr entgegen. Er war erst vor kurzem wiedergekommen von einer seiner Reisen und mußte wegen eines Fußübels unfreiwillig Rast halten in der Heimat. Er ging langsamer als sonst, und stützte sich[82] schwer auf seinen derben Stock. Seine Miene, die sonst immer ungetrübt war, drückte heute eine gewisse Besorgnis aus und er rief dem Mädchen zu:
»Soeben sagt mir der Doktor Winkler, daß Grethel Freidank Diphtheritis habe, ein böser Fall!«
Marie fühlte, wie ihr das Blut aus den Wangen lief und wie ihr beinahe der Herzschlag stockte.
»Na, was ist Dir denn Mädel, Du wirst ja so weiß wie Dein Sacktuch« – sprach der Alte und humpelte hastig heran.
Marie that einen tiefen Atemzug, dann sagte sie mit gesenktem Blick und unsicherer Stimme:
»Glaubst Du, Vetter Martin, daß ich hingehen und das Kind pflegen kann die Nacht hindurch?«
»Na, warum denn nicht? – Ja so! Der Mann ist ein junger Witwer, und die Leute wären dumm genug, selbst bei Angst und Sorge noch die ungewaschenen Mäuler dazwischen zu hängen. Na, weißt Du, wir gehen mit einander. Ich denke, da hat's keine Gefahr, und ich wollt' auch niemandem raten, den Schnabel weiter aufzuthun, als er verantworten kann. Ich könnte zwar allein auch die Sache versorgen, aber eine Frauenhand ist bei so einem kleinen Wurm allemal besser, und dann hängt das Kind auch an Dir. Freidank wird den Kopf schon halb verloren haben, und die alte Becker'n ist ein Schaf – also hier hilft's nicht: Wir thun's um Gottes Lohn. Jetzt gehen wir erst einmal zu Deiner Mutter, damit sie Bescheid weiß und nicht erst unnötige Redensarten macht, und dann wollen wir mal zusehen, ob wir mit vereinten Kräften das kleine Mädel wieder gesund kriegen.«
So gingen sie beide erst nach dem alten Burgthor zu und, obgleich Frau Frohwalt eine bedenkliche Miene machte und einige bescheidene Einwände versuchte, Vetter Martin hatte heute seinen Tag, an dem er keinen Spaß verstand, und da[83] konnte er sehr unangenehm von der Leber weg reden. Es that auch Eile not.
Als sie zu Freidank kamen, schien dieser aufzuatmen. Ihm war's, als ob jetzt die Hilfe für sein kleines Mädchen kommen müßte, und aus tiefster Verzweiflung ging er zur Hoffnungsfreudigkeit über.
Es war eine böse Nacht. Das fieberheiße, geängstigte Kind, das bald in unruhigen Schlummer fiel, bald wie in Atemnot aufschreckte, hielt fast unablässig die Hand der lieben Pflegerin in seinen glühenden Händchen, und wenn es die furchtbare Angst überkam, dann schlang es derselben wohl auch die zuckenden Aermchen um den Hals und suchte mit heiserer Stimme ein Kosewort zu flüstern.
Vetter Martin war sich völlig im Klaren, daß er hier nicht mehr war, als der Ehrenwächter, aber er bewunderte still die Hingabe und das Geschick Mariens, und es war ihm außer Zweifel, daß das Kind sich von keinem Menschen – auch von seinem Vater nicht – diese Einspritzungen und Einpinselungen, diese Umschläge und Packungen hätte mit solcher Geduld machen lassen wie von dem Mädchen, auf dessen Auge kein Wehen des Schlummers kam, das unverwandt die kleine Kranke beobachtete und mit peinlichster Sorgfalt alle Vorschriften des Arztes beobachtete.
Gegen Morgen war der Schlummer der Kleinen ruhiger, und Vetter Martin nötigte Marie, jetzt wenigstens auch einige Stunden nach Hause zu gehen und zu schlafen; sie ging erst, nachdem er ihr heilig versichert hatte, daß er bei der geringsten Verschlimmerung sie augenblicklich wieder holen lassen wolle.
Der Arzt fand das Kind viel besser, wenngleich noch nicht außer Gefahr, und noch eine zweite Nacht saßen die Pfleger, der unruhige Vater, der grauhaarige Vetter Martin und das vom Nachtwachen bleiche Mädchen an dem kleinen Lager. Mit erneuter Heftigkeit schien die Krankheit in dieser zweiten Nacht loszubrechen – es war die Entscheidung, aber als der[84] Morgen in die Fenster leuchtete, begann die heiße Röte aus dem Antlitz des Kindes zu weichen, und seine Atemzüge wurden ruhiger. Unter solchen Anzeichen ließ Marie sich leichter bereden, heimzugehen, zumal sie selber nach der Aufregung der letzten Stunden das Gefühl einer tiefen Abspannung hatte. Noch einmal beugte sie mit ihrem bleichen Gesichte sich über die schlafende Kleine und lauschte auf ihren Atem, dann gab sie den beiden Männern die Hand, welche Freidank in tiefer Bewegung küßte.
Das Kind genas in der That und zwar rascher, als selbst der Arzt gehofft hatte, der diesen Erfolg unverhohlen der unendlichen Sorge der treuen Pflegerin zuschrieb. Schon nach etwa acht Tagen konnte die Kleine, zumal das Wetter wundersam schön war, ins Freie gebracht werden, und langsam ging sie an der Hand des Vaters durch die Gasse. Alle Nachbarn und Bekannten bekundeten eine freundliche Teilnahme und sahen dem Paare nach, das seine Schritte nach dem alten Thore hinlenkte, in dessen Nähe das Häuschen des Sportelschreibers stand.
Dort sah am Fenster zwischen den blühenden Blumen ein blonder Mädchenkopf heraus, um gleich darauf zu verschwinden. Marie sah Grethel zum ersten Male wieder und wollte hinauseilen, um das Kind zu begrüßen, da stand auch schon Freidank auf der Schwelle. Sie war einigermaßen verlegen, aber sie bat ihn, einzutreten in die Stube, in welcher die Mutter am Tische saß, mit einer Handarbeit beschäftigt. Sie selber nahm das Kind auf den Arm, welches sich mit größter Innigkeit an sie anschmiegte.
Der Uhrmacher, welcher den ihm gebotenen Stuhl angenommen hatte, schien einigermaßen in Verlegenheit zu sein, als ob ihm das rechte Wort fehle; endlich sprach er:
»Es drängt mich, noch einmal von ganzem Herzen Fräulein Marie zu danken für das, was sie meinem Kinde gethan hat; meine Grethel wär' heute bei ihrer Mutter, wenn Sie[85] nicht gewesen wären,« wandte er sich zu dem Mädchen, welches sich wieder an dem Fenster niedergelassen hatte.
»Der liebe Gott hat geholfen, und wir wollen ihm alle dafür danken, nicht wahr, Mäuschen?« sagte Marie zu dem Kinde, das auf ihrem Schoße saß und mit dem Kreuzchen spielte, das auf ihrer Brust hing.
»Ja, ja, freilich der liebe Gott,« erwiderte Freidank, »aber er thut's manchmal durch seinen Engel, und der sind Sie diesmal gewesen.«
»Ich hab's gethan, weil ich doch meiner guten Grethe versprochen hatte, über ihr Kind zu wachen, wenn sie's selber einmal nicht mehr könnte!«
»Haben Sie das wirklich versprochen?« rief lebhafter der Uhrmacher – »ja, wenn Sie nur auch …«
Er wußte offenbar nicht recht, wie er sich ausdrücken sollte, und suchte nach Worten.
»Sehen Sie, das Kind ist so verlassen, und ich auch. So kann's nicht weiter gehen, dabei gehen wir beide zu Grunde. Die alte Becker hat ja den guten Willen, aber sie muß doch zuerst auf ihre Wirtschaft und auf ihre Verwandtschaft sehen, und dann … sie versteht auch nicht mit dem Kinde umzugehen. Nein, so kann's nicht gehen, und wenn Grethel mir wieder krank würde, denken Sie nur, was das werden soll! Das arme kleine Ding braucht eine Mutter … und da dacht' ich … ob Sie nicht, da Sie auch meiner seligen Grethe versprochen haben … ob Sie nicht – – mein Weib werden wollten!«
Er hatte stockend, wie mit beklemmtem Atem gesprochen und endlich die letzten Worte hastig hervorgestoßen.
Das Mädchen war errötet und hatte das Kind auf die Erde gestellt, das sie aber nicht losließ, gleich als wüßte es, um was es sich handle; die alte Frau am Tische jedoch hatte erschrocken und wie abwehrend beide Hände nach dem Manne[86] ausgestreckt, der mit bleichen Wangen und erwartenden Augen auf seinem Stuhle saß; sie rief:
»Um Gotteswillen, Herr Freidank – wohin denken Sie – das kann ja nicht sein!«
Eine scheinbar unendlich lange Pause trat ein. Es war still, auch das Kind regte sich nicht, und man hörte nur die tiefen Atemzüge des Mädchens am Fenster; endlich sagte Freidank:ä
»Ach Gott, ich weiß ja, was Sie meinen – der hochwürdige Herr! Sollte er aber denn nicht auch glauben, daß er das Glück zweier Menschen – ich meine mich und meine Kleine – in der Hand hat, und daß es schön sein müßte, das Glück nicht zu zertreten? Ich bin doch kein schlechter Mann und was ich gethan habe, mußte ich eben thun. Ach, wenn ich nur besser zu reden verstände! Sehen Sie, Fräulein Marie, eine so heiße, glühende Liebe, die alles vergißt, was in der Vergangenheit liegt, kann ich Ihnen nicht entgegenbringen und meiner seligen Grethe wird immer ein Stück meines Herzens gehören. Aber ich habe gemeint, Sie werden das verstehen und begreifen, denn Sie haben sie ja auch lieb gehabt. Und unser aller Liebe kommt zuletzt in dem Kinde zusammen. Ihm gönne ich vor allem Ihre Liebe, und wenn Sie für mich nur ein wenig Zuneigung hätten, ich wär' schon zufrieden und glücklich, wenn Grethel Sie zur Mutter hätte. Ich will heute keine Antwort, ich bin ja mit der Thüre ins Haus gefallen. Ueberlegen Sie sich das drei Tage, acht Tage oder noch länger, und seien Sie nicht böse, daß ich geredet habe. Aber es mußte jetzt sein, wo ich gesehen habe, wie Ihnen mein Kind ans Herz gewachsen ist.«
»Ja, ja, sie ist mir ans Herz gewachsen!« sagte Marie, welche wieder die Kleine an sich gezogen hatte, die nun ihre Wangen streichelte und küßte, als ob sie die Worte ihres Vaters unterstützen wollte.
»Gut, Herr Freidank, lassen Sie mir Zeit … das kommt mir zu rasch – –«
»Aber Marie, wozu denn Bedenkzeit? Das kann ja nicht sein!« wiederholte beinahe angstvoll die alte Frau. »Erst müssen wir an Peter schreiben!«
»Ach seien Sie nicht hart, Frau Frohwalt,« bat der Mann, »und lassen Sie Ihrer Tochter wenigstens den freien Willen – ich habe ja noch keinem Menschen Böses gethan, warum wollen Sie mir Böses thun?«
»Das will ich ja nicht, Herr Freidank, ich will nur keinen Zwiespalt in meinem Hause, unter meinen Kindern!«
»Das wird der liebe Gott schon alles schlichten, wenn nur überall der gute Wille ist. Für heute lassen Sie uns friedlich und freundlich auseinander gehen, und Fräulein Marie, wenn Sie überlegen, denken Sie immer zuerst an Ihre verstorbene Freundin und deren Kind, und dann erst ein wenig an mich!« Marie hatte feuchte Augen, als sie dem schlichten Manne die Hand reichte, der nun seine Kleine zu sich aufhob und langsam dem Ausgang zuschritt. »Wenn's nicht sein kann, schreiben Sie mir's mit einer Zeile, und wenn ich eine solche in acht Tagen nicht erhalte, dann komme ich wieder!« sagte er noch, und Marie nickte stumm.
Als die beiden Frauen allein waren, erhob sich die Mutter; sie schlang die Hände in einander, trat an ihre Tochter hin, sah ihr tief in die Augen und sprach: »Marie – Du willst ihn doch heiraten!«
»Um des Kindes willen, Mutter – ja! Seit ich Grethel dem Tod abgerungen habe, ist sie recht eigentlich mein geworden, und ich kann mir nicht denken, daß sie eine andere Mutter einmal erhalten könnte. Das habe ich so kommen sehen, als ich in der letzten Nacht am Bette der Kleinen wachte und als mir Freidank im Gefühle der überwundenen Angst die Hand küßte.«
»Und Peter?« fragte die Frau.
»Schreibe Du ihm, Mutter, aber so, daß Du daran denkst, daß auch ich Dein Kind bin. Du wirst bessere Worte finden, als ich!«
Die beiden hielten sich stumm in den Armen, dann riß sich Marie los und ging hinaus. Nicht lange darnach schritt sie durch die stille, heiße Gasse. Das Herz war ihr zum Zerspringen voll; sie mußte sich jemandem mitteilen, und der, zu welchem sie das meiste Vertrauen hatte, war der Vetter Martin.
Sie fand ihn daheim unter seinen Schätzen, ordnend und sichtend, und da er sie sah, kam er herzlich ihr entgegen.
»Na, solcher Glanz in meiner Hütte! Ich dächte, Du wärst recht lange nicht bei mir gewesen, das heißt innerhalb der vier Pfähle, denn Gartenbesuch zählt nicht. Willst wohl einmal sehen, was ich an Kuriositäten von meiner letzten Reise mitgebracht habe?«
»Das ist's eigentlich nicht, Pathe Martin, sondern ich brauche Deinen Rat und Deine Hilfe!«
»Steht Dir zu Diensten, soweit der Vorrat irgend reicht! Setze Dich!«
Er schob ihr einen alten Polstersitz zu und nun saßen sie in dem kühlen, dämmerigen Gemache einander gegenüber und Marie erzählte von dem, was sich vor kurzem begeben hatte. Als sie zu Ende war, sagte der Alte:
»Na, ich bin schon manches gewesen in meinem Leben – Heiratsvermittler noch nicht; versuchen wir's auch damit! Meinen Rat und meine Hilfe! Mein Rat ist der: Nimm ihn, wenn Dich Dein Herz dazu drängt! Ich halte ihn für brav und tüchtig, und das bist Du auch, und wenn zwei solche Menschen sich finden, kann's nur zum Segen sein. Das denkt – glaube ich – Deine Mutter auch, aber sie traut sich's nicht zu sagen, weil er jetzt evangelisch ist. Und das ist's wohl, wo[89] Du meine Hilfe brauchst, denn um die ist Dir's doch mehr zu thun, als um meinen Rat.«
Das Mädchen nickte errötend mit dem Kopfe.
»Also, mit Deinem Herzen bist Du im Klaren, und Du hast nur Angst vor dem hochwürdigen Herrn Bruder. Daß dem die Sache gegen den Strich geht, ist mir auch klar; aber hier giebt's nur eins, was notwendig ist: Mut und Festigkeit. Auch Dein Herz hat sein gutes Recht, und das mußt Du verteidigen. Auf mich kannst Du rechnen: Ich will den Stier bei den Hörnern packen, schriftlich oder mündlich, denn ich vermute fast, daß die Nachricht Peter hierher treiben wird, und das wäre mir wenigstens lieber: Ich schreibe nicht gerne. Es wäre traurig, wenn die Verschiedenheit des Glaubensbekenntnisses Euch aus einander bringen sollte, und wenn ich hier dem religiösen Uebereifer die Spitze abbrechen kann, so weiß ich doch, warum mir unser Herrgott die linke Hinterpfote gerade jetzt lahm gemacht hat.«
Marie dankte mit überströmenden Augen: »Ach Pathe Martin, es ist mir ja besonders um das Kind. Heiraten muß Freidank, und wenn Grethel eine Mutter bekäme, die sie nicht lieb hätte, eine rechte Stiefmutter – das könnt' ich nicht ertragen.«
»Zu der Hacke wird sich schon der Stiel finden lassen, behalte nur ruhig Blut und denke: Ehen werden im Himmel geschlossen, und wenn's unser Herrgott so bestimmt hat, kommt ihr zusammen, auch wenn der Herr Pater Peter seinen Segen nicht dazu giebt.«
Ruhig, beinahe freudig und glücklich, verließ das Mädchen das kleine Haus in der Berggasse und kehrte nach Hause zurück, wo sie die Mutter mit dem Briefe an Peter beschäftigt fand.
Schon zwei Tage später gegen Abend traf dieser in dem Heimatstädtchen ein; er kam aus Prag, wo er seit einigen Wochen in seiner neuen Stellung weilte. Als er eigentlich[90] unerwartet in die Stube trat, schraken Mutter und Schwester auf und begrüßten ihn mit verlegener Herzlichkeit. Er selbst war von vornherein ernst, und sobald er es sich einigermaßen bequem gemacht hatte, ging er auch geraden Wegs auf sein Ziel los. Er sei bestürzt gewesen über die Mitteilung, welche ihm die Mutter gemacht hätte, und hoffe, nicht zu spät zu kommen, um eine Verlobung seiner Schwester mit einem Ketzer, einem Abtrünnigen, hintanzuhalten.
Die alte Frau war ängstlich und befangen; sie liebte ihre beiden Kinder; freilich hatte Peter bei ihr ein höheres Ansehen.
»Ach, ich habe ihr ja schon gesagt, und auch ihm, daß das ganz unmöglich sei, daß wir Dir schuldig seien …«
»Auch das, aber das ist ja nebensächlich, doch ich kann gar nicht daran denken, daß Marie ihr Seelenheil so leichtfertig opfern will. Du hast Dir wohl noch nicht überlegt, daß Dir Dein Beichtvater die Sündenvergebung verweigern müßte und daß Du der Gnadenmittel der Kirche Dich beraubtest – –«
»Ich habe an alles gedacht« – sprach halblaut und mit gesenktem Kopfe das Mädchen – »aber wenn die verstorbene Grethe evangelisch war und dabei doch so gut und brav, wie wenige Menschen, so möchte ich gleichfalls evangelisch werden.«
Der junge Priester sprang heftig auf. Er stieß den Stuhl zurück, auf welchem er gesessen hatte, und in seinem Gesichte flammte es:
»Hat Dich denn der Teufel verblendet, Marie, daß Du so reden magst? – Das ist Dein Ernst nicht! – Du hast die Wahl zwischen uns, Deiner Mutter und Deinem Bruder einerseits, und zwischen Freidank andererseits, zwischen dem Segen, den der Himmel ausdrücklich dem Kinde verheißt, das seine Eltern ehrt, und zwischen dem Fluche, den die Kirche auf das Haupt der Abtrünnigen schleudert. Ehe Du wählst,[91] denke aber auch an Deinen toten Vater, dem Du im Grabe noch eine Schande anthun würdest, wenn Du seinen Glauben verläßt!«
Die Mutter zitterte an allen Gliedern, und sah bald eins, bald das andere ihrer Kinder an, und aus den Wangen Mariens schien jeder Blutstropfen gewichen zu sein. Peter Frohwalt aber stand da, wie einst der Racheengel mit dem flammenden Schwert vor dem verlorenen Paradiese und hob seine Stimme mit wärmerem Klange:
»Noch ist das entscheidende Wort nicht gesprochen – o sprich's nicht, Marie! Opfere nicht der Hölle, was dem Himmel gehört, Deine unsterbliche Seele! Du hast sie nur einmal zu verlieren, und wenn der unselige Bund erst geschlossen wäre, so wärest Du unrettbar verloren in Deiner maßlosen Schuld vor dem Herrn! Und bedenke das Aergernis, das Du Hunderten von guten Christen geben würdest – –«

»Ach höre auf ihn, Marie, er meint's doch so sehr gut mit Dir, thu' mir die Freude und die Liebe, daß ich meine Kinder in Eintracht sehe und einmal mit dem Glauben sterben kann, daß wir uns alle, gemeinsam mit Deinem guten Vater, in einem Himmel wiedersehen werden.«
Die alte Frau hing sich schluchzend an den Hals des Mädchens, das bei diesem doppelten Ansturm beinahe die Fassung verlor – da kam diesem eine unerwartete Hilfe. In der Thüre stand mit einmal die alte Frau Becker und hatte die kleine Grethel an der Hand.
»Sie haben wohl mein Klopfen nicht gehört und da bin ich so eingetreten – nehmen Sie's nicht übel … ach, der geistliche Herr!«
Sie knixte einige Male und fuhr zungenfertig fort:
»Die Kleine hat ja nicht geruht, und wollte, weil wir gerade hier vorbeikamen, durchaus zu Ihrer lieben Marie und da habe ich ihr denn den Willen gethan. Na sehen Sie nur!«
Das Kind war ohne weiteres zu dem blonden Mädchen hingeeilt, und das hatte es beinahe stürmisch aufgehoben, es an sich gepreßt und küßte es jetzt wortlos, aber immer wieder. Endlich rang es sich wie ein Schluchzen aus Mariens Brust und sie rief:
»Wir bleiben beisammen, Grethel, wir bleiben beisammen!«
Frau Becker sah verdutzt von einem zum andern, und ihr schien ein Verständnis aufzudämmern.
»Wir haben hier wohl gestört?« fragte sie halb verlegen, halb mit forschender Neugier.
»Nein, nein, Frau Becker« – stieß Marie hastig hervor – »ich habe nur soeben meinem Bruder mitgeteilt, daß ich Freidank heiraten will!«
Jetzt stand das Mädchen wie von heißem Blute übergossen da, das Kind noch immer fest an der Brust haltend, das alte Weib aber schlug die Hände zusammen:
»Ach Du lieber Gott – na, das hab' ich mir gedacht! Ach, Sie passen auch für ihn, und besser konnt' er's gar nicht treffen, da muß der Himmel seine Freude daran haben!«
»Schweigen Sie! Lästern Sie nicht!« rief Peter dazwischen, und zu seiner Schwester gewendet sprach er mit bebender Stimme:
»Soll das die Antwort sein auf das, was ich Dir gesagt habe?«
»Verzeih mir, Peter, aber ich kann nicht anders!« stieß Marie hervor, und hielt noch immer das Kind fest umklammert, das mit großen, verwunderten Augen nach dem schwarzgekleideten Manne schaute. Jetzt merkte auch Frau Becker, daß sie überflüssig war, außerdem drückte ihr die Neuigkeit, die offenbar noch keiner im Städtchen wußte, das Herz ab – sie sagte darum:
»Komm, komm, Grethel, der Vater wird warten, und wir wollen auch nicht stören!«
Sie langte nach der Kleinen, welche nur widerwillig den Hals Mariens losließ, und ging nach vielen Knixen. Draußen setzte sie sich beinahe in Trapp und rannte an der Ecke der Berggasse ziemlich unsanft an Vetter Martin, dem sie zurief:
»Wissen Sie schon – Marie Frohwalt wird Freidank heiraten, und der geistliche Herr ist auch da!«
Dann sauste sie weiter, der Vetter Martin aber hielt sich einen Monolog, indem er sich einen Augenblick auf seinen Stock stützte:
»So ist's recht! Da ist ja die Geschichte schon im Gange und bei der Beckern auch gleich ins richtige Maul gekommen. Da steht das arme Mädel wohl schon im ersten Sturme, und um ihretwillen will ich dem alten Weibe den Stoß verzeihen, der mir bis auf das Zwerchfell gegangen ist. Da gilt's sogleich die Reserven vorrücken zu lassen, damit sie mir das Kind nicht kopfscheu machen. Vorwärts, Martin Hinkebein – auf nach Valencia!«
Und rascher humpelte er an seinem Stocke fort nach dem Thore zu und betrat die Stube bei Frohwalt just zur Zeit, wo die Wogen der Empörung seitens des jungen Priesters hoch anbrandeten gegen die verzweiflungsvoll sich wehrende Widerstandskraft des armen Mädchens.
»Gott zum Gruße und da wären wir ja glücklich!« sagte er beim Eintreten und reichte Peter die Hand. Verlegen nahm dieser sie an, aber er vermochte dabei nichts zu sprechen. So herrschte ein peinliches Schweigen in der freundlichen Stube, während die hellen Augen des alten Mannes von einem zum anderen schweiften.
»Hier ist wohl Vehmgericht – da komme ich, denke ich, gerade recht!«
Peter fand nun das Wort wieder:
»Ja, Vetter Martin, Du kommst recht, um eine Verirrte wieder auf den rechten Weg bringen zu helfen. Du bist bei uns seit langen Jahren wie an Vaters Stelle gewesen, nun[94] sprich auch diesmal ein Wort, wie es unser seliger Vater gesagt hätte. Marie will nämlich – –«
»Den Uhrmacher Freidank heiraten – weiß ich, mein lieber Peter, und es ist mir lieb, daß Du mich an Deinen seligen Vater erinnerst. Der war aber kein blinder Eiferer, und hielt dafür, daß jeder Mensch selig werden könne, wenn er nur rechtschaffen an den lieben Gott glaube und ihn und alle seine Mitmenschen lieb habe. Darum würde er auch jetzt sagen: ›Was Gott zusammengefügt, das soll der Mensch nicht scheiden!‹«
»Aber das ist ja Gotteslästerung! Das fügt doch Gott nicht zusammen – –«
»Wie kannst Du das behaupten? Wenn ohne ihn kein Haar von Deinem Haupte fällt, finden sich ohne ihn auch nicht zwei Herzen zusammen …«
»O Vetter, Du verwechselst Fügung mit Zulassung; Gott läßt auch Mord und Verbrechen zu – –«
»Richtig, aber darum handelt's sich hier nicht!«
»Doch – es ist ein Verbrechen, das Marie begehen will an ihrer Seele, die ich kraft meines Amtes mit zu hüten und zu schützen habe.«
»Sage, Peter, aber ganz aufrichtig: Hättest Du etwas gegen die Verbindung Deiner Schwester mit Freidank einzuwenden, wenn er nicht evangelisch wäre?«
Der Priester zögerte einen Augenblick, dann sagte er: »Nein!«
»Also der Mensch ist Deiner Ueberzeugung nach brav, ehrlich, tüchtig, und hat nur den Fehler, daß er nicht Deinem Bekenntnis angehört –«
»Und daß er ein Abtrünniger ist!«
»Na, und wer hat ihn denn dazu gemacht? Ihr mit Euern frostigen, lieblosen Satzungen habt ihn selber hinausgedrängt aus der Kirche, und nun wollt ihr ihm ein Verbrechen aus dem machen, was ihr im letzten Grunde – ihr[95] mögt es drehen und wenden, wie ihr wollt – selbst verschuldet habt. Und nun soll dem armen Menschen auch alles andere Lebensglück zertreten werden? Wenn er jetzt für sich ein braves Weib, für sein Kindchen eine gute Mutter sucht, wollt ihr wieder mit euren kalten Satzungen dazwischentreten? Deine Schwester will den Weg der Nächstenliebe gehen, Du aber den Weg des Hasses – wer handelt mehr im Geiste Gottes, dem nicht gedient wird durch blindes Eifern?«
Das Gesicht Peter Frohwalts verzog sich beinahe schmerzlich, da er sagte:
»Aber, Vetter Martin, das verstehst Du nicht! Du weißt nicht, was ich meiner heiligen Kirche, und was ich mir schuldig bin!«
»Das weiß ich wohl, aber ich fürchte, daß Du es nicht weißt. Du sollst ein Diener Gottes sein im Geiste und in der Wahrheit, das bist Du der Kirche und Dir schuldig – so diene dem Geiste, der ein Geist der Liebe ist, und diene der Wahrheit und kümmere Dich nicht um den Schein. Und wenn man Dir nachsagt, daß Deine leibliche Schwester einen Protestanten geheiratet hat, so habe den ehrlichen Mut und sprich:
›Er ist ein braver Mann, und glaubt an denselben Gott wie ich!‹«
»Aber Marie will selber evangelisch werden!« stöhnte der junge Priester.
»Das find' ich in der Ordnung. Ich bin kein Freund von gemischten Ehen, und was dabei herauskommt, hat sich bei Freidank bereits gezeigt. Nein, nur keine Halbheiten! Und da nicht zu verlangen ist, daß der Uhrmacher wieder katholisch wird, so wird sein Weib evangelisch werden – meinst Du, daß darum Deine Schwester eine schlechte Person wird, daß das, was jetzt gut an ihr ist und was alle Menschen an ihr lieb haben, dadurch mit einmal zur Scheusäligkeit verkehrt wird?«
»Und ich dulde es nicht, und werde es niemals dulden!« schrie jetzt Peter mit Heftigkeit auf – »und wenn sie dennoch wagt, mir und ihrer Mutter, die mit mir empfindet, zu trotzen, so werden wir vergessen, daß sie zu uns gehört und uns von ihr wenden für alle Zeit, und wie sie dem Fluche der Kirche verfällt, so soll sie …«
Die alte Frau kam bleich, mit aufgehobenen Händen an den Sohn heran, auch Marie stand fassungslos und klammerte sich mit der Rechten an die Lehne eines Stuhles, indes sie die Linke heftig gegen das pochende Herz preßte; Martin aber trat ganz nahe zu dem erregten Priester und sah ihm fest und ruhig in das gerötete Angesicht:
»Halt – nicht weiter – Verkünder der göttlichen Liebe! – Ich habe gemeint, daß Dir das Leben in Nedamitz schon eine Lehre gegeben haben würde, daß mit Eifern und mit blinder Gehässigkeit nichts gethan ist – ich sehe, Du hast wenig gelernt und mußt noch in eine härtere Schule kommen, und, will's Gott, zu guten Lehrern. Du bist nicht aus dem Holze, aus dem man sonst Glaubenseiferer schnitzt, und aus Dir redet nicht das Herz, sondern die Schulweisheit. Das will ich Dir zugute halten, und darum sage ich nichts weiter als: ›Wenn Marie hier hinausgeworfen wird aus dem Elternhause, so soll sie bei mir eine Heimat finden; eine solche Tochter ist mir zu jeder Stunde willkommen!‹«
Aufschluchzend warf sich das Mädchen an die Brust des Alten, der ihr liebkosend über die blonden Haare strich und in einem unendlich milden Tone, der bei ihm fremd und deshalb gerade ergreifend war, sagte:
»Folge Deinem Herzen, mein Kind! Das ist wie Gold gewesen zu allen Zeiten, und das kann nicht über Nacht zu wertlosem Messing werden. Wenn sie Dich quälen, komm zu mir, noch heute, ich will Dich halten, wie Dein seliger Vater Dich gehalten hätte – dafür bin ich Dein Pathe!«
Er küßte sie auf die Stirn, und in dem Zimmer war es tiefstille. Finster blickend lehnte Peter an dem Tische, und neben ihm stand die Mutter noch immer mit gefalteten Händen. Vetter Martin aber führte Marie langsam hinaus.
Am andern Morgen in aller Frühe verließ der junge Priester seine Vaterstadt, ohne seine Schwester noch einmal gesehen zu haben, die hinter dem Fenstervorhang in ihrem kleinen Stübchen versteckt dem Postwagen nachschaute, der ihren Bruder entführte. Sie weinte bitterlich.
Gegen Abend traf Peter Frohwalt auf dem Bahnhofe ein. Er war tief verstimmt und sein Kopf schmerzte ihn; er hatte das Gefühl des Unbehagens und der Unzufriedenheit und mußte sich immer wiederholen, daß er seiner Pflicht gemäß gehandelt habe. Langsam ging er durch die belebten Straßen der böhmischen Hauptstadt, sah den breiten, menschenvollen »Graben« entlang und schritt durch den Pulverturm hinein in die Zeltnergasse und nach dem Altstädter Ringe.
Nahe an der Moldau, unmittelbar bei dem Kloster der Kreuzherren mit dem roten Stern und angesichts des Turmes, der das Portal zu der alten, stattlichen Karlsbrücke bildet, steht die St. Klemenskirche und mit ihr in Verbindung ist ein weitausgedehnter, mehrere Höfe umfassender Bau, der den Jesuiten seine Entstehung verdankt. Ein Teil derselben enthielt die Hörsäle der theologischen und der philosophischen Fakultät der Prager Hochschule, die damals noch ausschließlich deutsch war, der nach der Moldau zugekehrte Teil umfaßt das erzbischöfliche Priesterseminar.
Hier war Peter Frohwalt als Adjunkt der theologischen Fakultät und als Aufseher über die Alumnen daheim. Er läutete an der Pforte; der Pförtner öffnete und grüßte ergeben, und der Priester ging langsam, beinahe müden Schrittes durch die gelbgetünchten Korridore, in denen eine feuchte, kühle Luft herrschte, hin. Einzelne »Seminaristen« mit der schwarzen Klerik und der violetten Binde um den[98] Leib begegneten ihm und grüßten – im ganzen aber war es fast unheimlich still in dem weitläufigen Gebäude.
Er betrat sein Zimmer, das einfach, aber freundlich möbliert war und ließ sich verstimmt und ermüdet auf einem Sopha nieder. Es war noch Zeit bis zu dem gemeinsamen Abendessen, und er nahm ein Buch zur Hand, um den Druck, der ihm auf Kopf und Herzen zugleich lastete, wenigstens auf einige Zeit zu vergessen.
Da pochte es. Auf sein »Ave!« trat ein Alumnus herein, ein hübscher, etwas bleicher Jüngling, mit kurzgeschorenen, dunklen Haaren. Es war ein junger Landsmann Peters, dem dieser schon manche Freundlichkeit erwiesen und der sich gewöhnt hatte, sobald es not that, bei ihm Rat und Trost zu suchen.
»Was bringen Sie mir denn, Vogel?« fragte der Adjunkt – »Sie sehen ja so aufgeregt aus!«
Der Alumnus war noch ein wenig näher getreten und sagte nun mit unsicherer Stimme:
»Verzeihen Sie, Hochwürden, wenn ich Sie belästige, aber es drängt mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich hier im Seminar nicht bleiben kann. Sie wissen, daß ich mich gerne dem geistlichen Stand gewidmet habe und bereit war, manches Schwere auf mich zu nehmen, aber hier wird es unerträglich!«
Peter Frohwalt war aufgestanden und legte dem Jüngling die Hände auf die Schultern, indes er ihm freundlich in das gerötete Gesicht schaute.
»Was giebt's denn? – Setzen Sie sich und erzählen Sie!«
Vogel folgte der Aufforderung und sprach, indem er sich bemühte ruhig zu werden:
»Die Tschechen machen uns Deutschen hier das Leben zu sauer und kränken uns durch Rücksichtslosigkeiten und Ungezogenheiten, wo es nur angeht. Ich sitze bei den Mahlzeiten an einem Tisch mit lauter solchen, und obwohl sie wissen,[99] daß ich kein Wort Tschechisch verstehe, reden sie absichtlich nur in dieser Sprache, und sehen mich dabei immer so höhnisch und herausfordernd an, daß ich wie verkauft und verraten bin. Will ich sprechen, so sagen sie: nerozumime4 und lachen mir ins Gesicht. Wenn in ihrer Zeitung, der »Politik«, irgend ein boshafter Ausfall gegen die Deutschen geschrieben steht, finde ich ihn gewiß in der Studierstube auf meinem Platz liegen, und wo man mir einen Schabernack, selbst der gemeinsten Art, anthun kann, geschieht es. Dabei habe ich keinem etwas in den Weg gelegt, und den anderen Deutschen geht es nicht besser. Einer und der andere hat sich wohl auch schon beschwert, aber denen ist gesagt worden, sie sollten nur ganz ruhig sein, sie wären wohl selber auch nicht ohne Schuld! Das macht Verbitterung unter den deutschen Alumnen. Wenn man erst hier in Prag vier Jahre lang alle Quälereien tschechischen Uebermuts ertragen und dann die ärmlichsten Kaplanstellen in kleinen Gebirgsdörfern übernehmen soll, während die besseren und angenehmeren Stellen selbst in deutschen Orten den Tschechen gegeben werden, dann verliert man die Freude an seinem Berufe. Wo bleibt denn da die christliche Liebe? Den Tschechen geht Huß über Jesus Christus und mancher hat das Bild des Ketzers in seinem Gebetbuche. Mir widerstrebt es, Namen zu nennen, denn ich will nicht denunzieren, aber ich möchte nicht, daß Sie mich verurteilen, wenn ich meinen Austritt anmelde.«
4 Wir verstehen nicht.
Der Adjunkt hatte den Jüngling ausreden lassen; er wußte, daß derselbe nichts übertrieb; er war ja selbst Alumnus in diesem Hause gewesen und hatte manche ähnliche Erfahrung gemacht. Nun sprach er:
»Mein lieber Vogel! Ich denke, das mit dem Austritt überlegen Sie sich doch noch. Ich werde dafür sorgen, daß Sie an einen anderen Tisch kommen und werde ein Auge[100] haben auf die nationalen Heißsporne. Fassen Sie die Sache auf als eine Uebung in der Geduld, welche Ihnen der Himmel schickt, der Sie damit zur Selbstüberwindung erziehen will, welche der schönste und größte Sieg ist.«
»Ach Gott, Hochwürden – Geduld habe ich schon, und habe sie lange bewiesen, aber die Unduldsamkeit der andern ist zu groß, und die brüderliche Liebe, mit welcher einer den andern ertragen soll, fehlt bei ihnen ganz. Und Unduldsamkeit und Lieblosigkeit ist doch das Schlimmste, und, wenn ich mir denke, daß daraus Priester werden sollen, dann thut mir's in der Seele weh.«
Peter wurde es bei diesen Worten seltsam zu Sinne. Wohl sprach der Alumnus von Unduldsamkeit und Lieblosigkeit zunächst im nationalen Sinne, aber ihm klang doch wie ein Vorwurf für ihn selbst durch und er fühlte sich mit einmal befangen. Er suchte nach beruhigenden tröstenden Worten für den Jüngling und war froh, als derselbe, wenigstens einigermaßen besänftigt und mit dem Versprechen, noch weiter aushalten zu wollen, ging.
Nun setzte er sich aufs neue auf das Sopha und lehnte sich sinnend in die Ecke. Die tiefe Verstimmung, mit welcher er aus der Heimat zurückgekommen, schien sich noch zu steigern. Er sah überall Haß bei den Dienern der Kirche, Kampf, Fehde und Lieblosigkeit, und der Vetter Martin erschien ihm den berufenen Vertretern Gottes auf Erden gegenüber als ein wahrhaft frommer Mann, der mit aller Welt den Frieden suchte und überall die Liebe hintrug und die Versöhnung.
Verstimmt ging er zum Abendbrot. Er hatte die Aufsicht in dem Speisesaal und schritt langsam zwischen den Tischen hin. Bei jenem, an welchem Vogel saß, blieb er stehen, und redete mit den tschechischen Alumnen hier in freundlicher Weise. Ehe er weiter ging aber fragte er mit gewinnender Sanftmut und Milde, ob es nicht anginge, daß während des Essens deutsch gesprochen werde, damit auch Vogel am Gespräch[101] teilnehmen könne. Die Seminaristen senkten die Köpfe, einige sahen ihn beinahe spöttisch an, und da er weiterschritt, hörte er, wie man tschechisch hinter ihm drein redete: Der Fanatismus war größer als die Liebe!
Am nächsten Mittag hatte er Vogel einen anderen Platz verschafft. – Die Sommerferien, während welcher sich die meisten der Alumnen in ihre Heimat begaben, so daß es in den Räumen des Seminars noch stiller, wie gewöhnlich war, hatte Peter in Prag zugebracht. Er hatte die ihm gegönnte Muße zu wissenschaftlichen Arbeiten benützt und bereitete sich zur Erlangung des theologischen Doktorgrades vor. Nach acht stillen Wochen kehrten die Seminaristen zurück, und das frisch pulsierende Leben brachte wenigstens vorübergehend einen neuen Reiz. Auch Vogel war gekommen und hatte Grüße von Peters Mutter und Schwester, welche dieser mit einem einfachen Danke! entgegennahm.
Das neue Semester an der Hochschule begann, und der junge Adjunkt hatte die Freude, für einen beurlaubten Professor eintreten und Vorträge aus dem Kirchenrecht halten zu können; dadurch stieg er bei den Alumnen im Ansehen, und selbst die Tschechen begegneten ihm jetzt höflicher und bescheidener als zuvor.
Es war an einem Samstag Nachmittag. Die Seminaristen befanden sich zum Teil in einem der Höfe und verkehrten hier gruppenweise. Auf einer Bank in der Ecke unter einem der wenigen Sträuche saßen drei junge Leute neben einander. Der eine war Vogel, der andere hatte das Ordenskleid der Kapuziner, die braune, härene Kutte mit dem weißen Strick um die Lenden gegürtet, und der Dritte, ganz in Schwarz gekleidet, trug eigentlich gar kein geistliches Abzeichen, obgleich auch er Student der katholischen Theologie war. Er war aus dem auf der Kleinseite gelegenen Wendischen Seminar, in welchem zumeist aus der sächsischen Lausitz stammende Angehörige der Bautzener Diözese Aufnahme[102] fanden. Er hieß Stahl und war ein hübscher Mensch mit frischen Wangen und feurigen dunklen Augen, dem das gelockte Haar gar keinen geistlichen Anstrich gab. Der junge Kapuziner, Frater Severin, war eine Art Heimatgenosse Vogels; er stammte aus einem Dorfe in der Nähe der kleinen Stadt, in der auch Peter daheim war, und hatte den Alumnus schon manchmal besucht; Stahl hatte sich an diesen angeschlossen, weil er im theologischen Hörsaal zufällig neben ihn zu sitzen kam, und weil er ein Deutscher war.
Severin spielte mit den Fingern an den Knoten seines Gürtels und sagte mit einem tiefen Atemholen:
»Heute in drei Wochen habe ich meine Profeß, dann bin ich für immer an die braune Kutte gebunden!«
»Es paßt Ihnen wohl nicht ganz recht?« fragte Stahl.
»Wie man's nimmt. Einerseits ist's gut, wenn man sich dem Orden für alle Zeit verpflichtet und endgültig weiß, wie man in seinem Leben dran ist; andererseits aber faßt einen doch ein bängliches Gefühl. So lange man noch denken kann, daß man es jeden Tag in der Hand hat, das Ordenskleid abzulegen, lebt man so in den Tag hinein, aber wenn das entscheidende Gelübde abgelegt ist, und es kein Zurück mehr giebt, fürchte ich, daß das Wort: ›Das Ordensleben ist der schwerste Kriegsdienst,‹ erst zur vollen Wahrheit wird.«
»Du hast aber doch freiwillig Deinen Stand gewählt, Severin,« bemerkte Vogel.
»So ganz und gar nicht. Meine Eltern sind arme Leute, und ich habe mich auf dem Gymnasium jammervoll durchschlagen müssen, sodaß ich froh war, als ich sechs Klassen hinter mir hatte und nun den ersten besten Ausweg ergreifen konnte, ein Kapuziner oder Franziskaner zu werden. Das Klösterchen in Deiner Vaterstadt hat etwas so Trauliches und Idyllisches, daß ich als Junge mir gar nichts anderes gewünscht hatte, als einmal drin zu wohnen, und mit einem langen Barte ehrwürdig in dem schönen Garten desselben spazieren gehen[103] zu können. Na, und meine Mutter war ja glücklich darüber, daß ich die braune Kutte nahm, und sie wäre sehr unglücklich, wenn ich sie ablegte; ich darf schon der alten Frau nicht die Freude verderben.«
»'s ist bald wie bei mir,« brummte Stahl und wippte lebhaft mit seinem Fuße auf dem Boden, ein Beweis, wie ihn das Gespräch erregte. »Halb zog sie ihn, halb sank er hin, da war's um ihn geschehen – die »sie« ist nämlich meine Stiefmutter. Mein Vater ist sehr fromm erzogen worden, einige Verwandte von mir sind Priester, teilweise in sehr angesehenen Stellungen, und da fand es denn meine liebe Stiefmutter im Interesse ihrer eigenen drei Kinder sehr zweckentsprechend, daß ich Theologe werde, und da mein Vater ihr gegenüber ein schwacher Mann ist, und meine geistlichen Vettern auch noch in die Kohlen bliesen, so bin ich – der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe – hier ins Wendische Seminar gekommen. Lieber wär' ich Maler geworden, und ich glaube, ein wenig Talent hätt' ich dazu. Aber ich durfte keine richtige Anleitung bekommen, damit mich die Kunst nicht auf Irrwege bringe, und so verschmiere ich denn jetzt, ganz meinem Genius folgend, ab und zu ein Stück Leinwand. Vogel, ich denke Sie sind der Glücklichste von uns Dreien?«
»Niemand ist glücklich vor seinem Ende!« sagte halb heiter, halb elegisch der Alumnus, und Stahl bemerkte:
»Das hat wohl der selige Krösus gesagt, oder Solon, na ob der nach seinem Ende glücklich war, darüber sind wohl die Kirchenväter auch nicht einig … aber was gaffen denn die da uns an, als wenn sie dafür bezahlt hätten?«
Die letzte Wendung galt einigen Alumnen, die in die Nähe gekommen waren, und mit unverkennbar spöttischen Gesichtern nach den drei Freunden blickten. Jetzt sagte der eine ganz vernehmlich in deutscher Sprache:
»Das ist die deutsche Dreifaltigkeit!«
»Ach bewahre, die deutsche Einfältigkeit!« sprach der[104] andere und beide lachten. Aber nur einen Augenblick, denn blitzschnell war der heißblütige Stahl vorgesprungen und hatte dem zweiten eine schallende Ohrfeige versetzt. Dieser schrie zornig auf und warf sich gegen den Angreifer, Vogel und Severin traten abwehrend dazwischen, aber schon lockte der Lärm die andern Seminaristen herbei, die im Hofe waren, und ehe noch alle recht wußten, was geschehen war, wurde es schon recht laut. Da stand mit einmal Peter Frohwalt, welcher die Aufsicht hatte, zwischen den Streitenden und deren geballten Fäusten.
»Was giebt's denn?« fragte er.
»Ich habe dem Herrn da eine Maulschelle versetzt, weil er uns Deutsche ohne jede Veranlassung beleidigt hat.«
Die Tschechen schrieen dazwischen, und der Adjunkt hatte zum ersten Male Gelegenheit, seine volle Autorität zu zeigen.
»Es ist auf beiden Seiten gefehlt worden,« sagte er ernst, »und ich werde veranlassen, daß auch beiderseits eine Sühne geleistet werde. Sie, Kubik«, sagte er zu dem Tschechen, »gehen sofort hinauf, das Weitere wird sich finden, und betreffs Ihrer Person, Herr Stahl, werde ich mit dem Herrn Rektor des Wendischen Seminars Rücksprache nehmen!«
Die tschechischen Alumnen murrten noch da und dort halblaut, aber als das klare Auge des jungen Priesters, der sich hoch aufgerichtet hatte, sie scharf ansah, duckten sie scheu und schweigend nieder; Hans Stahl aber machte dem Adjunkten eine stumme und durchaus respektvolle Verbeugung und entfernte sich.
Zwei Tage später erhielt er von seinem Rektor eine strenge Vermahnung wegen grober Verletzung der theologischen Sitte und des geistlichen Anstands.



Es war ein Sonntag zu Anfang des Oktober. Der Himmel machte kein besonders freundliches Gesicht, und der Wind peitschte einen Regenschauer nach dem andern durch die Gassen der böhmischen Hauptstadt. Die vielen Kirchen waren wenig besucht und ihre Hallen sahen bei dem grauen, unfreundlichen Wetter trübe drein.
Am Pořič, wo die Straße hinabführt nach der schönen Franz-Josefs-Brücke, steht das kleine Kloster zum heiligen Josef. Hier sind Kapuziner daheim, und die freundliche Kirche wird von Andächtigen besonders gern besucht, denn das Volk hat zu den bärtigen Bettelmönchen mit ihrem schlichten Wesen von altersher eine gewisse Zuneigung. Auch heute sind die heiligen Hallen trotz des schlechten Wetters ziemlich gefüllt, denn die Kunde, daß ein junger Bruder seine Profeß ablegen werde, war immerhin bekannt geworden, und so lockte neben der Frömmigkeit auch die Neugier.
Mit gelbem, müdem Lichte flackerten die Kerzen vor dem Hochaltare, rötlich schimmerte der Schein der ewigen Lampe, und die Orgel klang schwertönig und stimmungsvoll. Vor den Stufen des Altars aber lag Frater Severin in seiner braunen Kutte mit dem Angesicht zur Erde gebeugt, während[106] der Brüder ernster Gesang über ihn hin erklang. Dann sang er selbst mit seltsam zitternder Stimme:
»Suscipe me Domine secundum eloquium tuum et vivam et non confundas me ab expectatione mea.«5
5 Nimm mich auf, o Herr, nach Deiner Verheißung und ich werde leben.
Im ernsten Chor erklang die Antwort und noch zweimal mit stets erhöhter Stimme sang der junge Professe. Dann erhob er sich und ging langsam die Stufen des Altars hinan, vor welchem in einem Polstersessel der Provinzial des Ordens saß. Nun verlas Severin – und seine Stimme war ungleich sicherer geworden als vorher, die lateinische Formel, mit welcher er sich dem Orden und seinen ernsten Satzungen auf Lebenszeit verband. Darauf ergriff er eine ihm dargereichte Feder und langsam schrieb er auf der Altarsplatte selbst seinen Namen unter das bedeutsame Schriftstück. Er zwang sich, ruhig zu scheinen, und nur an der Blässe des Gesichts vermochten die ihm Nahestehenden die innere Erregung zu ermessen, welche ihn ergriffen hatte.
Nun kniete er vor dem Provinzial nieder, der mit ernsten, milden Augen ihm wie in die tiefste Seele hinabsah; er legte seine gefalteten Hände in die Hände des greisen Priesters und sprach: »Promitto obedientiam!«6 Dann umarmte ihn der Greis und gab ihm den Bruderkuß. Auch die andern Brüder näherten sich, und jeden begrüßte Severin in gleicher Weise mit den Worten:
6 Ich gelobe Gehorsam.
»Do tibi osculum verae et sincerae confraternitatis!«7
7 Ich gebe Dir den Kuß wahrer und aufrichtiger Brüderlichkeit.
Dann klang die Orgel und helle, schöne Menschenstimmen sangen von dem Chore herab. Ein freundlicher Sonnenstrahl[107] kam wie ein tröstlicher Himmelsbote herein durch das Fenster, und Severin durchschauerte es wundersam, als ihn das himmlische Licht traf; es war ihm wie eine schöne Verheißung, daß eine höhere Macht ihm das tragen helfen wollte, was er auf sich genommen.
Niemals hatte er dem Gottesdienste in größerer Ergriffenheit beigewohnt. Nach demselben traf er im Sprechzimmer seine Eltern. Den beiden schlichten Leuten liefen die Thränen über die gebräunten Wangen, und sie drückten, ohne Worte finden zu können, den Sohn an ihre Brust. Die Mutter war besonders gerührt, und nahe daran, dem Jüngling die Hand zu küssen, welche noch nicht einmal die Weihe empfangen hatte.
Am Abend war er wieder allein in seiner kleinen Zelle, die so eng und einfach war mit dem harten Lager in der Ecke, und die im Winter nicht geheizt wurde. Das war seine Welt! Er sah an sich hinab, auf das braune, härene Gewand und den weißen geknoteten Strick, und zum ersten Male kam ihm dieser vor wie eine Fessel, mit der man ihn gebunden hatte. Die Brust wurde ihm eng, er suchte tiefer zu atmen und vermochte es kaum, so daß er mit einem Rucke das Fenster aufriß und das heiße Gesicht in den kühlenden Abendhauch hinaushielt. Aus dem trüben Regenmorgen war ein freundlicher Tag geworden. Er sah blauen Himmel und hörte von der Straße her das verhallende Geräusch der rollenden Räder, und ein leises Summen, wie es das Leben der großen Stadt verursacht. Das war die Welt, mit der er abgeschlossen hatte für immer, für die er nicht mehr vorhanden war, und die nicht für ihn dasein durfte. Was blieb ihm? – – Sein Brevier, um zu beten, seine wenigen Bücher – es waren meist kirchenhistorische Werke, die er mit Vorliebe studierte – und die Musik.
Daheim in seiner Dorfkirche hatte ihm der Lehrer Unterricht im Orgelspiel gegeben, und er hatte so schnell begriffen,[108] daß er seinen Meister bald erreicht hatte. In Prag hatte er sich noch vervollkommnet, und in seinen Mußestunden war ihm die Orgel der liebste Freund geworden. An ihr saß er manche Stunde, indes irgend ein freundlicher Bruder, wohl auch ein Knabe, der es aus Vergnügen that, die Bälge bearbeitete. Dann klang es durch die kleine freundliche Kirche oft so weihevoll und schön, daß auch einer und der andere der Mönche herbeikam und, in einen Winkel gelehnt, lauschte. Und wegen seines Orgelspiels hatten ihn auch alle ganz besonders lieb.
An dem heutigen Tage aber trieb es ihn noch mehr als sonst, seinem Empfinden Ausdruck zu geben in Tönen, und so ging er nach dem Chore, nachdem er noch einen Laienbruder gebeten hatte, ihm den nötigen Wind zu machen. Da saß er vor dem lieben Instrument und vergaß seine Profeß und alle Welt. Die Orgelstimmen sangen so weich und so mild, aus frommen Melodieen und volkstümlich getragenen Weisen wob sich ein wundersamer Kranz von Tonbildern, und das dämmernde Abendlicht, das über dem Gotteshause lag und in welchem wie ein rotglühender Punkt das ewige Lämpchen schwankte, erhöhte den Zauber der Stimmung.
Das empfanden ganz besonders zwei Menschen, die in den hintersten Kirchenstühlen sich niedergelassen hatten. Die Kirche war wie stets des Sonntags geöffnet und der Orgelton hatte selbst manchen Spaziergänger noch gelockt, daß er durch die Pforte herein kam und das Kirchlein betrat. So waren auch diese beiden gekommen: Ein stattlicher Herr im eleganten Promenadenanzug mit geistvollem Gesichte, das ein graumelierter Vollbart umrahmte, und ein blühendes Mädchen im lichten Gewande mit dunklerem Ueberwurfe. Sie hielt den feinen, zierlichen Kopf mit den dichten braunen Flechten, die unter dem Hute reich hervorquollen, gesenkt und lauschte mit Ohr und Seele, bis endlich die Töne verklangen.
Nun erhoben sich die beiden und schritten dem Ausgange[109] zu. In der Nähe desselben lehnte ein älterer Mönch mit wallendem Barte. Er grüßte den Herrn und dieser wandte sich zu ihm und fragte:
»Was haben Sie denn hier für einen trefflichen Orgelspieler, Herr Guardian?«
»Das ist unser Frater Severin, der heute Profeß gemacht hat, Herr Professor. Wir sind ein wenig stolz auf ihn.«
»Das dürfen Sie auch; hier ist Technik und Seele zugleich!« Der Sprecher reichte dem Priester die Hand, und schritt hinter dem Mädchen weiter, das bereits die Pforte erreichte und eben die Fingerspitzen trotz der Handschuhe in den Weihwasserkessel tauchte. Der Herr folgte diesem Beispiel und hörte wohl noch, wie hinter ihm drein ein junger Mann, der mit einem Genossen gleichfalls in die Kirche gelockt war, zu diesem sagte:
»Das ist Dr. Holbert, der Professor des kanonischen Rechts, mit seiner Tochter!«
»Ein reizendes Mädchen!« erwiderte der andere – was freilich der Professor nicht mehr vernahm.
Dieser schritt mit seiner Begleiterin nach der Brücke zu, um nach der Kleinseite zu gelangen. Auf dem Wege sprach das Mädchen:
»Weißt Du, Papa, um was ich Dich zu meinem demnächstigen Namenstage bitten möchte? Ich habe ja einen Wunsch noch frei.«
Der Professor lächelte freundlich, indem er seinem Kinde den Arm bot und fragte:
»Das wäre?«
»Laß mich das Orgelspiel erlernen. Es wird mir, da ich auf dem Klavier leidliche Fertigkeit besitze, keine allzugroßen Schwierigkeiten machen, und ich liebe das königliche Instrument so ungemein: Es hat Kraft und Fülle bei Weichheit und Milde und erhebt das Herz wie kein anderes. Die Macht der[110] Töne voll entfesseln, in gewaltigen Fugen sie einherbrausen lassen zu können, hätte für mich einen wundersamen Reiz.«
»Aber Therese, ich kann Dir doch keine Orgel in Deinem Zimmer aufstellen lassen,« sagte, noch immer lächelnd, der stattliche Mann. Das Mädchen aber, das sich fester an seinen Arm schmiegte, erwiderte:
»Das sagst Du doch nur im Scherz. Ich weiß, daß zur vollen Wirkung der Orgel die Räume eines Gotteshauses gehören in Rücksicht auf die Klangwirkung, wie bezüglich der ganzen Stimmung, aber Du kennst ja den Pater Guardian von St. Josef gut genug, um mir die Erlaubnis auswirken zu können, die dortige Orgel benutzen zu dürfen …«
»Aha, der junge Virtuose hat Dir's angethan. Und Du meinst, daß derselbe Dein Lehrmeister werden könnte?«
»Weshalb nicht, Papa?« fragte sie, aber es huschte in diesem Augenblick doch ein leises Erröten über das liebliche Gesicht.
»Na, es fragt sich doch, ob der Pater Guardian dazu seine Erlaubnis geben würde.«
»Dann kann's ja auch ein anderer sein, aber nicht einer, dem die bloße Technik über alles geht; ich möchte mehr lernen als das Pedal treten und die Register beherrschen – –«
»Ich kenne Dich, Kind – und wir wollen sehen, was sich thun läßt!«
Sie waren über die schöne Franz Josef-Brücke gegangen und die Höhe hinangestiegen. Dann schritten sie über das grüne Belvedere hin und sahen die alte königliche Stadt zu ihren Füßen liegen mit ihren hundert Türmen und mit dem breiten Silbergürtel der Moldau. Der Abend war für die Jahreszeit besonders mild und schön, und von den zahlreichen Spaziergängern wurde der Professor häufig gegrüßt.
Jetzt kam Peter Frohwalt ihnen entgegen. Er war eine prächtige Erscheinung, der vielfach die Augen auf sich zog, hoch gewachsen, mit klarem, geistvollem Gesicht, dessen[111] Frische noch durch den weißen Saum des Collares um den Hals gehoben schien. Als er den Hut zog, blieb Dr. Holbert einen Augenblick stehen. Er kannte den jungen Geistlichen, der ihm bei seiner Ankunft in Prag einen Besuch gemacht hatte, um ihm für die anerkennende Beurteilung seiner Schrift zu danken. Sie wechselten heute einige freundliche Worte, der Professor stellte Frohwalt seine Tochter vor, und dann schieden sie mit herzlichem Händedruck, nachdem Holbert den anderen eingeladen hatte, ihn bald einmal wieder zu besuchen.
»Ein tüchtiger Kopf!« hatte dann der Gelehrte zu Therese gesagt. »Hoffentlich behält er in der Enge seiner Verhältnisse klaren Einblick in das, was uns bei unsern Priestern notthut. Er wird jedenfalls noch im Laufe des Winters den theologischen Doktorgrad erwerben und hat Zeug dazu, eine Zierde seiner Fakultät zu werden.«
Als es anfing zu dunkeln, schritten Vater und Tochter durch die belebten Straßen heimwärts. Schon am nächsten Tage nahm der Professor Gelegenheit, mit dem Guardian von St. Josef Rücksprache zu halten wegen des Wunsches seiner Tochter. Der war gern bereit, dem berühmten Gelehrten, welcher außerdem in kirchlichen Kreisen besonders hohen Ansehens sich erfreute, gefällig zu sein; selbstverständlich sollte Therese die Orgel benützen dürfen nach Belieben – nur betreffs des Lehrmeisters –
Der alte Herr strich sich mit beiden Händen abwechselnd durch seinen wallenden Bart.
»Ich weiß, Hochwürden, was Sie meinen,« sprach Dr. Holbert; »es thut nicht gut, Feuer und Zunder zusammen zu bringen, aber Sie müssen Ihren Frater Severin kennen. Für meine Tochter sage ich gut: Therese ist lediglich erfüllt von musikalischem Interesse und wird jedes Wort vermeiden, das nicht damit zusammenhängt, aber in Versuchung führen möchte ich den jungen Bruder nicht – –«
»Hm, hm – ich halte Severin für eine ernste und tüchtige Natur, die nicht leicht einen Schritt vom Wege weicht. Außerdem geht auch ihm die Liebe zum Orgelspiel über alles, und ich glaube, er würde glücklich sein, einen Schüler oder eine Schülerin zu haben. Wir wollen's versuchen – vorausgesetzt, daß er einverstanden ist; denn hier hört die Forderung des Gehorsams auf – und dabei die Vorsicht nicht außer acht lassen. Ich will, scheinbar aus Interesse am Unterricht, ab und zu dabei erscheinen, und wenn ich Unrat wittere, machen wir der Sache unverzüglich ein Ende.« Severin wurde gerufen. Anfangs war er einigermaßen verlegen, da er vernahm, um was es sich handle, aber nicht, weil es eine junge Dame war, die in Frage kam, sondern weil er seiner Begabung als Musiklehrer nicht genügend vertraute. Doch empfand er Freude bei dem Gedanken, jemanden im Orgelspiel unterrichten zu sollen, und er ging darauf ein.
Und nun kam Therese wöchentlich eine Stunde in die kleine Kirche. Als der Guardian zum ersten Male die beiden jungen Leute einander vorstellte, war Severin linkisch und schüchtern; er fühlte sich in der braunen Kutte etwas unbeholfen und hätte – er wußte selbst nicht recht warum, den Unterricht lieber in der Laientracht erteilt. Das junge Mädchen dagegen mit seinen feinen, sicheren Formen fand ohne weiteres den rechten Ton: Freundlichkeit ohne Vertraulichkeit, Anmut ohne Koketterie, klare Verständigkeit ohne Vorkehren der Ueberlegenheit in den Umgangsformen, das war es, was der Guardian für sich selbst an ihr rühmte, und was ihn um Severins willen mit großer Beruhigung erfüllte.
Für diesen aber waren es schöne Stunden, wie er sie in seinem Leben bis dahin nicht gekannt hatte, wenn er, mit voller Seele bei seinem Spiel, sah, welch' eine gelehrige Schülerin er gefunden hatte, und wenn diese schlanken weißen Finger so kraftvoll in die Tasten griffen, während er selbst, je nach der Stimmung, die Register zog, schien ihm das Instrument,[113] dem er lange genug vertraut geworden war, immer neue Vorzüge und Schönheiten zu entwickeln.
Der Guardian war ab und zu anwesend gewesen während dieser Stunden, und überzeugte sich mehr und mehr, daß ausschließlich die Freude an der Musik die beiden jungen Herzen erfüllte, und so gab er sich selbst gern dem Genusse hin, welcher in der Beobachtung lag, wie der junge Lehrer zu geben, die Schülerin aufzunehmen verstand.
So lief der Herbst in den Winter hinein, und eines Tages erhielt Peter ein Schreiben aus der Heimat, in welchem Freidank ihm in bescheidener und höflicher Weise anzeigte, daß er noch vor der Adventszeit sich mit Marie vermählen und daß die Hochzeit in der kleinen Kirche zu **dorf in aller Stille stattfinden werde. Für den Adjunkten war es klar, daß seine Schwester bereits Protestantin geworden war, obgleich man ihm dies nicht mitgeteilt hatte, und der Gedanke daran ergriff ihn so mächtig, daß er sich der Thränen nicht erwehren konnte; es war ihm, als wäre Marie gestorben, und nach seiner Meinung war das, was sie gethan hatte, schlimmer als der Tod. Darein mischte sich zu dem Schmerze der Zorn; er zerriß den Brief Freidanks in kleine Stücke, die er in das flackernde Ofenfeuer warf und mit diesem symbolischen Thun riß er nach seiner Absicht alle Fäden entzwei, welche ihn an seine Schwester knüpften; der ihm aufgezwungene Schwager war überhaupt nicht für ihn vorhanden.
Er suchte seine Gedanken abzulenken und ging nach dem Krankenzimmer des Seminars, in welchem seit einiger Zeit Vogel nicht unbedenklich an Brustfellentzündung darniederlag. Peter Frohwalt hatte eine Zuneigung für den Jüngling, die nicht bloß auf dem landsmännischen Verhältnis beruhte, sondern in dem ganzen ehrlichen, frischen und berufsfreudigen Wesen des Alumnus begründet war, und er hatte sich deshalb während der Erkrankung seiner mit besonderer Liebe und[114] Sorgfalt angenommen, und war täglich wiederholt gekommen, um nach ihm zu sehen.
Diesmal traf er mit dem Arzte zusammen. Dr. Otto war ein kleiner, lebhafter alter Herr, immer freundlich und liebenswürdig, dessen Besuch allein schon günstig auf seine Patienten wirkte; er hatte etwas Herzliches und Ermutigendes, und so leuchteten auch die Augen Vogels frischer, und auf seinem jungen Gesichte lag Zuversicht der Genesung.
Der Arzt versicherte auch Frohwalt, den er mit warmem Händedruck begrüßte, daß es nun mit der Gesundung rasch vorwärts gehen werde, und da er sich entfernt hatte, setzte sich der Adjunkt neben dem Bette des Kranken nieder. Es war zur Zeit kein weiterer Patient im Raume, und Vogel konnte ganz dem Zuge seines Herzens folgen. Er ergriff in aufwallender Freude und Dankbarkeit die Hand des Adjunkten und küßte sie innig.
»Sie haben mir so viel Liebes und Gutes gethan, Hochwürden, wie einem Bruder – das vergesse ich Ihnen in meinem ganzen Leben nicht.«
Peter Frohwalt suchte den Erregten zu beruhigen, aber seiner eigenen gedrückten Seele that die Liebe und die Dankbarkeit des Jünglings wohl. Er verließ denselben heiterer, als er gekommen war. Aber da er langsam durch den Korridor hinschritt, klang ihm fortwährend ein Wort in den Ohren, eine mahnende Stimme, von der er nicht wußte, woher sie kam:
»Wer Liebe säet, wird Liebe ernten!«
Sollte er nicht doch auch in der Heimat Liebe säen, in den Herzen seiner Schwester und Freidanks? – Wenn ihm der Fremde so dankte, wie würden dies erst die Seinen thun! Und wieder kam das alte Unbehagen über ihn, als er sein Gemach betrat, und er griff nach seinen Büchern, um über seinem Studium zu vergessen, was seine Seele quälte.
Er wurde indessen gestört durch einen Besuch, welchen er wohl kaum erwartet hatte. An der Thüre hatte es gepocht wie mit einem zaghaften, unsicheren Finger, und auf sein »Ave!« trat der alte Pfarrer von Nedamitz ein. Frohwalt freute sich, ihn zu sehen, und war doch erschrocken. Der Mann sah nicht gut aus. Sein Haar schien in der kurzen Zeit, seit ihn der Adjunkt nicht gesehen hatte, spärlicher und bleicher geworden zu sein, die hagere Gestalt war zusammengebeugt, und die Augen lagen glanzlos und tief in dem fahlen Gesichte.
Peter hatte ihm sogleich einen Sitz angeboten. »Was führt Sie einmal aus Ihrer ländlichen Idylle in die große Stadt?« frug er.
»Es ist aus mit der Idylle, Herr Adjunkt« – sagte der alte Priester mit einem wehmütigen Lächeln – »ich bin abgesägt worden.«
Frohwalt sah den zusammengesunkenen Mann mit dem ungesunden Gesichte und den schwimmenden Augen teilnahmsvoll an, und dieser fuhr fort:
»Barbara ist gestorben, ziemlich schnell und ohne lange Krankheit; der Herr geb' ihr die ewige Ruhe; sie hat ihre Schwächen gehabt, aber sie war ein tüchtiges Weibsbild. Und nach ihrem Tode habe ich wohl wieder ein wenig mehr ab und zu getrunken, als gut war. Ihr Nachfolger war ein lebenslustiger Herr, der auch etwas leisten und vertragen konnte, und wir haben so manchmal bis in die Nacht hinein gesessen. Recht war's ja nicht, und ich hätte auch den Verstand für uns alle beide haben müssen. Wenn Sie in Nedamitz geblieben wären, wär's auch nicht so weit gekommen. Ich glaube, der Gemeindevorstand hat zuletzt den Vikar auf mich gehetzt, und da ich beim hochwürdigen Konsistorium nicht gerade gut angeschrieben war, haben sie mich pensioniert. Die Pension – zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben – ist erbärmlich klein, und wenn ich auch nicht viel brauche, so ist's doch nicht zum Auskommen. Darum komm' ich zu Ihnen,[116] um Sie zu bitten, mir, falls Sie Gelegenheit haben, einige Meßgelder zuzuwenden.«
Der alte Mann seufzte und wischte sich mit seinem blau- und rotgewürfelten Taschentuche die feuchten Augen.
»Das thut mir leid, Herr Pfarrer, daß wir uns so wiedersehen,« sagte nun der Adjunkt, den, wenn er auch in all dem Gehörten eine gerechte Fügung erkannte, doch das Mitleid ergriffen hatte. »Ich werde mich gerne bemühen, Ihnen etwas zuzuwenden. Vielleicht gelingt es auch, Sie einem der Herren Canonici als Vikar zu empfehlen – freilich müssen Sie Ihre Lieblingsneigung, Ihre Schwäche will ich lieber sagen, bekämpfen.«
»Mit leerem Beutel wird sich das leicht machen lassen,« sprach beinahe bitter, mit einem Lächeln um die schlaffen, herabgezogenen Mundwinkel der Pfarrer – »und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie etwas thun wollten.«
»Wissen Sie was?« sagte Frohwalt in einer augenblicklichen milden Regung, denn wiederum klang ihm das Wort vom »Liebe säen« in der Seele – »ich habe heute vormittag Zeit, wir gehen gleich jetzt mit einander zum Herrn Kanonikus Kupetz, den ich persönlich ziemlich gut kenne, und der ein freundlicher und wohlwollender Herr ist.«
»Na, wenn Sie meinen – ich bin zwar den Domherren immer lieber aus dem Wege gegangen, aber wenn ich mich vorstellen soll, ist mir's doch lieber, ich habe Sie zur Seite und Sie reden für mich.« –
Bald darauf schritten die beiden Geistlichen über die Karlsbrücke. Es war ein herrlicher Wintertag, mild und klar, und die gelblichen Wellen des Flusses rollten, frei von der Eisfessel, unter ihnen hin und brachen sich an den mächtigen Strebepfeilern. Im Sonnenglanze lag der prächtige Hradschin da mit seinem weithin gedehnten, hundertfenstrigen Königsschlosse, mit dem stattlichen Bau des adeligen Damenstifts, das ehedem der Palast des berühmten Hauses Rosenberg[117] war, und mit dem rötlichen Gemäuer des massiven Palais Lobkowitz, welches die schwerfälligen beiden Türme des alten St. Georgklosters überragten, über welche der mit einer unpassenden Haube versehene Turm des herrlichen St. Veitdomes noch hinwegsah. Es war ein prächtiges Bild, das scharf sich abgrenzte von dem klaren Winterhimmel, und das selbst dem Pfarrer, der lange nicht in Prag gewesen, eine Aeußerung des Wohlgefallens entlockte.
Sie schritten über den Kleinseitner Ring, an dem schönen Denkmal des Feldmarschalls Radetzky vorüber und gingen langsam die steile Spornergasse hinauf. Bei einem grauen, schmalbrüstigen Hause in der Nähe der Liguorianer blieb der Pfarrer einen Augenblick stehen und sagte: »Hier wohne ich, in dem dritten Stockwerk nach hinten hinaus – wenn Sie mich ja einmal besuchen wollten. Ich hab's nicht geräumig und auch nicht gerade freundlich – die Aussicht geht auf die Dächer – aber ein alter abgesägter Priester darf nicht viele Ansprüche machen.«
Sie gingen weiter und kamen an dem erzbischöflichen Palais vorüber nach jener stattlichen Häuserreihe, welche sich an dem freundlichen, mit grünen Anlagen versehenen Platze hinzieht, und die der Volkshumor die »Gimpel- (Dompfaff-) Allee« zu nennen pflegt. Hier wohnen die Mitglieder des fürsterzbischöflichen Domkapitels, jeder in einem besonderen Hause.
Wieder blieb der alte Pfarrer stehen, sah zu den spiegelnden Fensterscheiben der vornehmen Häuserfront, deren Eingangsthüren meist mit der Mitra geschmückt waren, und sprach seufzend:
»Sehen Sie, der Herr Domprobst bezieht jährlich dreißigtausend, ein Kanonikus etwa zwölftausend Gulden – was machen die Herren mit dem vielen Gelde?«
»Sie müssen bedenken, daß ihre Stellung im Interesse des Ansehens der Kirche höhere Einkünfte verlangt.«
»Na, die Apostel haben's aber doch auch nicht gehabt!« sagte der Pfarrer mit halb humoristischer Bitterkeit, die seinem schlaffen Gesichte einen beinahe weinerlichen Zug verlieh.
An einem der Häuser zog Frohwalt an dem Klopfer. Ein Glockenton erklang, und gleich darauf erschien ein junges, schmuckes Dienstmädchen mit weißer Schürze, das, nachdem es erklärt hatte, daß der Herr Kanonikus zu Hause sei, die beiden durch einige Zimmer bis nach einem kleinen Salon führte, wo sie einstweilen warten sollten. Hier zeugte alles von Eleganz und Bequemlichkeit; die ganze Wohnung war vornehm: Polstermöbel mit reichen Ueberzügen, hohe Spiegel, Erzeugnisse der Malerei und Bildhauerei, ausländische Pflanzen und Vögel …
Der schlichte, alte Landpfarrer sah sich um, wie in einer fremden Welt, und wagte nicht, sich in einen der sammtnen Fauteuils zu setzen. Das war anders als im Nedamitzer Pfarrhause. Er seufzte halblaut und sagte nun flüsternd zu seinem Begleiter:
»Der hier hat keine Not und keine Sorgen!«

»Wer weiß?« erwiderte Frohwalt, aber als ob er Lügen gestraft werden sollte, so klang jetzt nebenan helles Lachen von Frauenstimmen und das Klingen von Weingläsern. Darauf folgte das Rücken eines Stuhles, und gleich darauf kam durch die Flügelthüren der Kanonikus herein. Er war ein kleiner, wohlbeleibter Herr mit einem geröteten Gesicht, das mit seinem Doppelkinn, seinen hängenden Wangen und den kleinen, gutmütigen Augen recht wohlwollend aussah. Er trug einen schwarzen Gehrock und um den Hals das violette Collare; an der Weste waren einige Knöpfe geöffnet – er schien sich eben vom Frühstück erhoben zu haben.
Der Domherr war nicht unfreundlich; er forderte die beiden auf, sich niederzulassen und hörte mit einem gewohnheitsmäßigen Lächeln um den breiten Mund dem Adjunkten[119] zu, der in warmen Worten ihm den Pfarrer empfahl und anfrug, ob nicht vielleicht eine Vikarstelle erledigt sei.
Der Kanonikus ließ seine Augen auf dem Gesichte des Pfarrers ruhen; er schien sich zu erinnern, warum dieser seines Amtes enthoben war; der letztere wagte übrigens selbst gar nicht zu sprechen, und so entstand eine kleine Pause. Der Herr des Hauses zog eine wertvolle Tabakdose hervor, spielte ein wenig mit derselben, nahm darauf mit zwei Fingern behäbig eine Prise heraus und bot das blinkende Gefäß leutselig den beiden andern, welche dankend ablehnten. Nun erst sagte er:
»Es trifft sich gut, und ich will einmal annehmen, daß Sie der Himmel mir schickt, Herr Pfarrer. Mein Vikar, der an meiner Stelle das kirchliche Gebet im Dom verrichtet, wenn ich verhindert bin, ist gestern vom Schlage gerührt worden und wird wohl nicht mehr werden. Ich will Ihnen seine Stelle übertragen und Ihnen dieselbe Entschädigung geben. Ich weiß, daß Sie es brauchen können. Aber« – fügte er lächelnd und mit erhobenem Zeigefinger bei – »über die kleine Schwäche, – na, Sie wissen schon – müssen Sie wegkommen!«
In das fahle, schlaffe Gesicht des Pfarrers war eine Röte gestiegen, vielleicht der Freude, vielleicht der Scham, und er stammelte einige Dankesworte. Der Kanonikus teilte ihm kurz noch das Weitere mit, und dann verabschiedete er die beiden Besucher mit dem Bemerken, daß er den Geburtstag seiner Schwester feiere.
Frohwalt schritt mit seinem Begleiter langsam über die weichen Teppiche; auf dem Flur begegneten sie einer hochgewachsenen Dame in dunklem Seidenkleide, die ihren Gruß steif herablassend erwiderte, und wenige Augenblicke später standen Sie unter den grünen Bäumen vor dem Hause.
Jetzt wurde der Pfarrer in der Freude seines Herzens gesprächig und redete von vergangenen Tagen, von seiner[120] Dankbarkeit und fragte auch nach dem »Vetter Martin«, den er gern einmal wiedersehen möchte, und dessen Adresse er sich ausbat. Die konnte der Adjunkt ihm nicht geben, denn der Alte war bereits auf einer seiner Wanderungen, wie er von Vogel erfahren hatte, und diesmal noch nicht einmal in das alte heimatliche Winterquartier zurückgekommen.
Sie gingen langsam wieder die Spornergasse hinab, und vor dem grünen Hause, in welchem der Pfarrer wohnte, sagte derselbe:
»Wollen Sie nicht einen Augenblick mit heraufkommen, damit Sie wenigstens sehen, wo ich stecke.«
Frohwalt ging mit. Durch einen dunklen Flur kamen sie auf einen schmutzigen Hof, und im Hintergebäude stiegen sie eine enge Treppe hinauf, dumpfiger Geruch erfüllte die Räume, Kindergeschrei erscholl aus einigen Wohnungen, und im obersten Stockwerk war die Behausung des Pfarrers. Er öffnete die Thür und ließ seinen Besuch eintreten.
»'s ist nicht ganz wie beim Herrn Kanonikus!« sagte er mit einem Anflug wehmütigen Humors, und der Gegensatz, den er hervorheben wollte, war allerdings groß genug. Das Wohnzimmer, an das noch ein kleiner Alkoven stieß, war klein, und trotz der beiden Fenster nicht hell, denn diese gingen nach dem Hofe. Die Möbel waren beinahe ärmlich, und das wurmstichige Kanapee mit dem geblümten Kattunüberzuge ächzte, als sich Frohwalt darauf setzte.
»Ich habe meine Möbel verkauft,« sagte der Pfarrer; »der Transport hätte mich zuviel gekostet, und die da thun's ja auch für mich. Nur Einiges vom Hausgerät, das mir besonders lieb war, habe ich mitgenommen.«
Der Blick des Adjunkten fiel eben jetzt auf den wohlbekannten Zinnkrug, der von einem alten Schrank herabgrüßte, und er hätte gewünscht, daß derselbe mitsamt den Möbeln in Nedamitz geblieben wäre. Er hielt sich nicht lange auf in dem[121] Raume; die Luft war muffig und lag ihm auf der Brust: Es war eine Mischung von Tabaksqualm und Kohlendunst.
Er war froh, als er langsamen Schrittes unter dem klaren Winterhimmel über die Brücke nach der Altstadt zurückkehrte. Bei dem Brückenturm begegnete er Professor Holbert, an dessen linker Seite Hans Stahl mit dem Ausdruck des Stolzes in dem frischen Gesichte einherschritt. Der erstere kam auf ihn zu und sagte ihm mit einem Händedruck:
»Sie sind mir noch immer einen Besuch schuldig, Hochwürden. Wie wäre es denn nächsten Sonntag nachmittag zu einer Tasse Kaffee? – Meine Tochter würde sich gleichfalls freuen.«
»Ich komme, wenn Sie gestatten, Herr Professor!«
»Schön – also, auf Wiedersehen!«
Und der Professor schritt mit Hans Stahl weiter nach dem Franzensquai, während der Adjunkt sich nach dem Seminar wandte.



Professor Holbert wohnte in der Zeltnergasse, nicht weit vom Pořič. Einfache Vornehmheit zeichnete die Räume aus, welche er innehatte, und das entsprach völlig seinem eigenen Wesen. Abhold jedem Prunk und Schein, gerade und ehrlich in Wort und Wirken, verschmähte er das Gehaltlose und Unechte auch in seiner Wohnung, und die geschnitzten Möbel, die wenigen aber trefflichen Bilder, die künstlerisch vollendeten Büsten, und die ganze Anordnung im allgemeinen zeugten von gediegenem Geschmack und von wohnlicher Behaglichkeit zugleich, so daß jeder Besucher sich bei ihm wohl fühlte, zumal er mit ungezwungener Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit empfangen wurde. Seine Gattin hatte der Professor seit einigen Jahren verloren, und Therese mußte ihm die Hausfrau ersetzen. Dazu besaß sie alle Fähigkeit: Klarheit des Geistes und Umsicht, gefälligen Schliff der Umgangsformen und Sinn für alles, was Anmut und Behagen in die Häuslichkeit zu bringen vermochte; der Professor nannte sie den Sonnenschein seines Hauses. Und dabei war sie noch jung, etwa neunzehn Jahre alt.
Es war der Sonntag, für welchen Dr. Holbert den[123] Adjunkten eingeladen hatte. Der Nachmittag war unfreundlich, Schneeschauer verfinsterten die Gasse, und manchmal schlug der Wind sausend gegen die Fenster, daß sie leise klirrten. Im wohlgewärmten Salon aber war es hier ungemein traulich und behaglich. Frohwalt war gekommen, herzlich begrüßt, wie es Brauch in diesem Hause war, und lernte zunächst noch einen Gast kennen, einen jungen Arzt, Dr. Moritz Haller, einen hübschen und, wie es schien, weltgewandten Mann mit etwas blasierten Manieren, der behaglich, wie wenn er hier zu Hause wäre, in einem Fauteuil beim Kamin saß, in einem bildergeschmückten Reisewerke blätterte und zu den Bildern seine Bemerkungen machte, worin er sich auch durch die Ankunft Frohwalts nicht stören ließ.
Diesen nahm der Professor in Beschlag, und während er sich mit ihm über eine kirchenrechtliche Frage unterhielt, welche den Adjunkten interessierte, plauderte der Doktor mit der Tochter des Hauses, wobei sich manchmal seine Stimme zu halbem Flüstern dämpfte.
Gewinnend schien der letztere dem jungen Geistlichen nicht, zumal er im Laufe des Nachmittags sich fortwährend bemühte, eine Art geistiger und gesellschaftlicher Ueberlegenheit herauszukehren, die er in letzterer Beziehung zweifellos, in ersterer nicht unbestritten besaß. Der Professor wußte indes geistvoll und gewandt allen etwaigen Unannehmlichkeiten die Spitze abzubrechen, so daß die allgemeine Stimmung keine Trübung erfuhr.
Es hatten sich noch zwei Gäste eingefunden: Frater Severin als Lehrer Theresens im Orgelspiel und Hans Stahl, der mit seinem weißen Stehkragen und der koketten schwarzen Schleife, sowie mit dem ganzen frischen und lebendigen Wesen nicht den Eindruck eines katholischen Theologen machte. Sein Vater und der Professor waren Jugendbekannte, und so hatte der Jüngling Eingang im Hause des Letzteren gefunden. Er bewegte sich gesellschaftlich sicher und gewandt, mit einigermaßen[124] burschikosem Anstrich, der aber nichts Rohes und Verletzendes hatte, wogegen der junge Kapuziner, dem solche Gesellschaft fremd war, sich einigermaßen befangen fühlte.
Aber auch einem solchen Gaste wußte der Professor gerecht zu werden, indem er die Musik ins Feld führte. Er veranlaßte Therese, sich an den Flügel zu setzen, und unter den gewandten Fingern perlte in köstlicher Reinheit eine Mozartsche Sonate hervor, und die Augen des jungen Mannes begannen zu leuchten. Er hatte sich, alles andere vergessend, zurückgelehnt in seinem Sitze, und hielt die Blicke unverwandt auf die weißen, schlanken Mädchenhände gerichtet, welche auf den glänzenden Tasten meisterten, und da das Stück endete, that er einen tiefen Atemzug. Dr. Haller und Hans Stahl sprachen, der erstere in etwas überschwänglicher Weise – ihr Lob aus; auch Frohwalt äußerte sich in gleichem Sinne, der junge Kapuziner aber sagte mit einem tiefen Erröten nur:
»Ich danke Ihnen, Fräulein.«
Nun begann Therese zu singen. Sie hatte einen volltönigen, milden Alt, der ungemein wohlthuend klang, und das schlichte Lied im Volkston gewann dabei einen herzgewinnenden Ausdruck. Es war die Ballade von den zwei Königskindern, die nicht zusammenkommen konnten
Dr. Haller spielte die Begleitung, gewandt und feinsinnig, Hans Stahl aber lehnte an der Fensterbrüstung und sah mit flimmernden Augen nach den beiden hin. Severin jedoch sank wieder tiefer in seinen Sitz und hielt den Kopf gesenkt, als ob er träume. Seine Seele war voll von seltsamen Empfindungen, wie er sie niemals gehabt hatte; er hätte jauchzen und zugleich weinen mögen.
Dann sang auch Hans Stahl, der einen frischen Tenor hatte, wenig geschult, aber klangvoll; es war das Mendelssohnssche:
Vor den Fenstern sang der Wintersturm, um so anmutender wirkte der Frühlingsgruß:
Dann setzten sich das Mädchen mit Dr. Haller und Stahl zusammen an den kleinen Tisch bei dem Kamin, in der Nähe des Fensters aber saßen die drei andern. Hier wurden wissenschaftliche Fragen behandelt, und dem jungen Kapuziner war es ein Genuß, die anderen beiden sprechen zu hören; nur als eine kirchengeschichtliche Frage gestreift wurde, wagte auch er einige Worte dazwischen zu werfen, die den Beweis lieferten, daß er auf diesem Gebiete wohl daheim war.
Da es zeitig dunkelte an dem Nachmittage, waren die Gaskronen angezündet worden, die ein freundliches Licht durch den behaglichen Salon ausgossen und den traulichen Eindruck desselben noch erhöhten. Leuchtender hob sich das helle Gewand des Mädchens von den dunklen Anzügen der Herren, sowie von dem tiefblauen Sammtbezug ihres Sitzes ab, und das Bild am Kamin war zum Malen hübsch.
Die drei jungen Leute blätterten in einer Mappe, die in photographischen Nachbildungen Meisterwerke der Malerei enthielt. Auch hier liebte es Dr. Haller, einen lehrhaften Ton anzuschlagen, wie einer, der gewohnt ist, mit unantastbarer Sicherheit über Kunstleistungen abzuurteilen. Hans Stahl hatte ab und zu eine Bemerkung dazwischen gethan, mehr zu dem Mädchen, als zu dem Arzte, aber es klang immer wie eine feindselige Gereiztheit in dem Tone. Die überlegene Art des andern schien ihn offenbar zu verdrießen.
»Ja, mein lieber Herr Stahl, das verstehen Sie doch[126] wohl nicht zu beurteilen,« sagte jetzt der Doktor, sehr vernehmlich und nicht ohne Geringschätzung, so daß die Drei am Fenster unwillkürlich hinhorchten.
»Meinen Sie, Herr Doktor, daß man dazu Medizin studiert haben müsse?« entgegnete Stahl ziemlich scharf.
»Das nicht, wohl aber Kunstgeschichte und Aesthetik!« war die kühle, überlegene Antwort.
»Das ist meine Meinung auch, aber ich fürchte, Sie sind darin nicht weit genug gekommen.«
»Herr, solche Anzüglichkeiten verbitte ich mir!«
Therese war unruhig geworden und suchte lächelnd zu vermitteln, wobei sie ihre Hand auf den Arm des Doktors legte, der auch sogleich, das Unhöfliche des ganzen Vorganges erkennend, sich zu ihr wandte mit einem Worte der Entschuldigung. Aber auch das trug so den Stempel des Verletzenden für Stahl, daß dieser nach seiner heißblütigen Art aufstand mit dem Worte:
»Ein Unwissender auf diesem Felde bleiben Sie aber doch!«
Jetzt hatte auch der Professor sich erhoben und rief milde und freundlich herüber:
»Das klingt ja bitterböse. Darf man wissen, um was es sich handelt?«
Dr. Haller hatte sich zu beherrschen gesucht; er sprach:
»Wir haben hier eben das Bild »Jakob und Rahel« von Giorgione Barbarelli, von dem nach der Behauptung des jungen Theologen« – die Stimme des Redenden hatte hier einen spöttischen Klang – »das Original sich in der Dresdener Galerie befinden soll – –«
»Ich habe es oft genug dort gesehen,« warf Stahl dazwischen.
»– und dessen Maler nach der Meinung Herrn Stahls der älteren venetianischen Schule angehören soll.«
»Nicht bloß nach meiner Meinung – –«
»– während derselbe ganz zweifellos zu dem Florentiner Kreise gehört.«
»Ich bin zwar nicht allzufest in den Einzelheiten der Kunstgeschichte« – sprach nun der Professor, noch immer lächelnd – »aber diesmal hat Herr Stahl doch Recht. Giorgione da Castelfranco hat zu Anfang des 16. Jahrhunderts in Venedig gelebt und ist dort gestorben.«
Haller wurde weiß bis in die Lippen, und seine Augen zuckten einmal gehässig über den jungen Theologen, der hochaufgerichtet, schweigend, aber mit dem Ausdruck eines Siegers im Antlitz dastand. Professor Holbert erkannte das Peinliche für den Doktor, und fügte bei:
»Ein solcher Gedächtnisfehler ist verzeihlich, mein lieber Doktor, und ein einzelner kann nicht auf allen Gebieten ausgezeichnet sein. Herr Stahl hat diesmal sein Recht mit jugendlichem Eifer verfochten, gönnen Sie ihm den kleinen Triumph, denn der alte Giorgione steht doch nicht dafür, daß sich seinethalben zwei liebe Gäste erhitzen. Zuletzt freuen wir uns doch der Werke eines Meisters alle gleich, und ob er Florentiner oder Venetianer, das ist dabei nebensächlich. Die wahre Kunst stammt aus göttlichen Höhen und ist überall daheim, soweit die Erde Gottes ist. Auf sie lassen Sie uns anstoßen!«
Er hatte sein Weinglas herbeigeholt, und die Gläser klangen.
»Und nun – daß die Kunst auch ihre versöhnliche Kraft übe, mag Therese uns noch ein Lied singen!«
Das Mädchen ließ sich nicht weiter nötigen; sie setzte sich an das Instrument, und indem sie sich selbst begleitete, sang sie das ergreifend schöne, schlichte Mendelssohnsche Lied:
Ein beinahe weihevoller Hauch ging durch die Herzen, und als die Sängerin geendigt hatte, und eine augenblickliche Stille mehr als lauter Beifall redete, erhob sich der junge Kapuziner und sagte halblaut:
»Das wird mir in der Seele bleiben! Nun muß ich gehen!«
»Ich begleite Sie, Frater Severin,« rief Stahl, der gleichfalls aufstand. Er fand mit seiner gewandten Manier einige verbindliche Worte für Therese, die ihm, wie dem jungen Mönche die Hand zum Abschiede reichte; die Rechte des letzteren zitterte leise in der warmen, weichen Hand des Mädchens. Der Professor selbst begleitete seine jungen Gäste hinaus und entließ sie mit freundlichem Worte, dann kehrte er zu den andern zurück, welche jetzt an dem Mitteltische saßen.
»Ein junger Hitzkopf!« sagte er lächelnd mit Bezug auf Stahl – »aber es ist gute Rasse. Nur meine ich, er hätte besser zum Künstler, vielleicht auch zum Soldaten gepaßt, als zum Theologen.«
Der Adjunkt bestätigte dies insofern, indem er den Vorgang im Seminar erzählte, bei welchem der junge Theologe sein nationales Bewußtsein so entschieden zum Ausdruck gebracht hatte.
Ueber das Gesicht Holberts zog ein leiser Schatten; er sagte:
»Das ist bezeichnend für unsere ganzen Verhältnisse. Die nationale Erregung ist auf beiden Seiten im Steigen und dürfte noch wunderliche Blüten treiben. Die Tschechen haben sich allmählich in einen Größenwahn hineingelebt, der sie Anstand, Gerechtigkeit und ernstes Streben ganz vergessen läßt. Daß der Ton ihrer Blätter sein Echo selbst unter der jungen Priesterschaft findet, ist höchst bedauerlich, und es kommt vielleicht bald die Zeit, da in der Prager Diözese ein Mangel an deutschen Priestern eintritt. Und wenn erst[129] auf deutschem Boden tschechische Geistliche amtieren, die Huß mehr verehren als die Apostel, und die ihre Stellung anstatt zu friedfertigem Wirken zu nationalen Gehässigkeiten ausnützen werden, wird man seitens der Staatsgewalt wie seitens des Konsistoriums vielleicht zu spät beklagen, daß man nicht bei Zeiten diesem Treiben ein Ende gemacht hat. Das ist ein unerquickliches Thema, lassen Sie uns auf einen anderen Boden zurückkehren. Wie weit sind Sie mit Ihren Rigorosen, Herr Adjunkt?«
»Ich hoffe noch vor Ostern den Doktorgrad zu erlangen,« sagte Frohwalt.
»Das freut mich – an Ihnen gewinnt die Hochschule und vor allem die theologische Fakultät eine Zierde.«
Der Adjunkt suchte das Lob bescheiden abzuwehren, aber der Professor fuhr fort:
»Ich will Ihnen keine Schmeichelei sagen, aber ich wünsche im Interesse der Sache, daß es so werden möge. Denn die Zustände an Ihrer Fakultät sind nicht erfreulich. Ich habe keine Ursache, mich darüber auszuschweigen, und habe auch vor maßgebenden Persönlichkeiten darüber gesprochen. Sie haben ja selbst erfahren, in welcher Weise die Hörer der Theologie gedrillt werden, und wie es dabei auf leeren Gedächtniskram in der Hauptsache hinausläuft: Gemüt und Geist bekommt dabei herzlich wenig ab. Das sind doch wahrlich nicht frische, freie Studenten, welche hier vor dem Katheder sitzen, sondern ganz armselige Schuljungen in der Kutte, welche auf die Worte des Lehrers schwören. Und wenn nur die Lehrer immer noch darnach wären! Ich schätze einige Herren Ihrer Fakultät sehr hoch, sie haben als Männer der Wissenschaft ihre Verdienste, aber wirklich bedeutende Gelehrte sind doch hier eine Seltenheit. Denn während die Professoren anderer Fakultäten und Hochschulen durch Herausgabe von Werken der Wissenschaft zu nützen bemüht sind, zeigt die[130] Liste unserer theologischen Fakultät im wesentlichen – nur Namen!«
Auf Frohwalts Gesicht stand eine hellere Röte. Er sagte mit einigermaßen verschleierter Stimme – die Anwesenheit Hallers schien ihm dabei Unbehagen zu machen:
»Sie haben ja völlig recht, aber es ist nicht abzusehen, wie das sich ändern soll.«
»So lange man nicht ein anderes System bei Berufungen einführt, weiß ich es auch nicht. Wer als Seminarist das Rädchen des Gedächtnisses am besten schnurren ließ, sich hübsch fügen und schmiegen konnte und sonstige nicht gerade zu wissenschaftlicher Bedeutung notwendige Eigenschaften besaß, so daß er es vielleicht zum Präfekten unter den Alumnen gebracht hat, der wird, wenn er sonst gut paßt, Adjunkt, und nun klettert er sachte an der Leiter der akademischen Würden in die Höhe und – wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch Verstand, das ist ja ein altes, bekanntes Sprichwort. Ein Deutscher hat übrigens seltener das Glück, zu solcher Laufbahn zu kommen, und das spricht bereits für Sie – abgesehen davon, daß ich Sie aus Ihren litterarischen Arbeiten aufrichtig hochschätze. Aber – nehmen Sie mir meine freimütige Aussprache nicht übel … mir thut das Herz weh, wenn ich an diese Verhältnisse denke … Therese, singe uns noch ein Lied, damit wir auf andere Gedanken kommen!«
Das Mädchen hatte schweigend dagesessen, und Dr. Haller hatte nach seiner Gewohnheit in einem Buche geblättert; um seine Lippen lag ein leiser Zug des Spottes. Therese erhob sich und ging an das Instrument, und wieder klangen die Töne der weichen Altstimme mild und freundlich durch den traulichen Raum.
Indessen waren auf der Gasse draußen Severin und Stahl langsam gegen den Pořič hingegangen. Der Wind hatte sich gelegt, aber die Flocken spielten dicht durch einander,[131] so daß die Gasflammen beinahe verschleiert erschienen und nur einen matten Schimmer ausgossen. Der Verkehr war geringer geworden, und es herrschte in der sonst belebten Straße ziemliche Ruhe. Hans Stahl aber sagte:
»Ein unausstehlicher Bengel, dieser Haller, mit seinem Alles-Besser-Wissen-Wollen. Es ist geradezu empörend, wie jeder Laffe gerade uns Theologen meint über die Achseln ansehen zu dürfen, und dabei sind wir die erste und angesehenste Fakultät. Und wissen Sie, Severin, was mich am meisten wurmt? – Daß dieser aufgeblasene Aeskulap, an dem seine hübsche Larve zweifellos das Beste ist, das schöne Mädchen, die Therese, heiraten will. Sie können sich darauf verlassen, ich habe beobachtet, wie er mit ihr verkehrte!«
Der junge Kapuziner war froh, daß es dunkel war, und daß sein Begleiter die Röte nicht gewahren konnte, welche ihm in das Gesicht stieg; die kühlen Schneeflocken, die an seine Wange flogen, thaten ihm wohl. Er erwiderte:
»Daß er sie nehmen möchte, glaube ich wohl, aber ob auch ihrerseits das Entgegenkommen erwidert wird – –«
Hans Stahl pfiff halblaut durch seine Zähne.
»Lieber Frater Severin, Sie sind kein Menschenkenner oder wenigstens kein Mädchenkenner. Der Mensch ist etwas, hat etwas, weiß etwas aus sich zu machen und sieht auch wirklich nach etwas aus. Das besticht Mädchen, selbst von viel geringeren Eigenschaften, als Therese Holbert, aber, hol's der Henker, wenn ich nicht Theologe wäre, ich stellte dem Burschen ein Bein, ehe es so weit käme, daß sie ihr Jawort giebt.«
Der junge Kapuziner fühlte neuerdings etwas wie ein Erschrecken und wußte wenig zu solchen Aeußerungen zu sagen. Er war eigentlich froh, als er an der Pforte von St. Joseph stand und hier die Glocke zog. Hans Stahl drückte ihm warm die Hand und stapfte dann mit heraufgeschlagenem Rockkragen auf dem beschneiten Wege durch die[132] Zeltnergasse zurück, dem Altmarkte und der Karlsbrücke zu. Bei der Wohnung Professor Holberts sah er einen Augenblick hinauf zu den erleuchteten Fenstern und an seinen Ohren klang das Lied:
Severin aber hatte seine Zelle betreten; er hatte noch eine Viertelstunde Zeit bis zum Abendessen, und so setzte er sich im Dunkeln auf sein Bett. Das Zimmer war kalt, und obwohl er den Schnee von seiner Kutte abgeschüttelt hatte, empfand er doch ein feuchtes Frösteln. Durch das Fenster fiel nur ein ganz matter Schimmer, und der schien von einem einzigen Stern zu kommen, der von hier aus zwischen grauem Gewölke sichtbar war. Severin wußte selber nicht, warum er bei dem glänzenden Punkte, der wie ein freundliches Auge herblinzelte, an Therese denken mußte, und dasselbe alte Volkslied, das Hans Stahl wieder zu hören vermeinte, klang auch ihm in der Seele:
Als die Glocke zur Abendmahlzeit rief, schrak er zusammen, als wäre er auf unrechtem Wege ertappt worden, und langsam ging er nach dem Refektorium. Hier war eine angenehme Wärme und trauliches Licht, ein Behagen, das ihn stets an Winterabenden angeheimelt hatte, aber er war schweigsamer als sonst, seine Erinnerung haftete an dem wohnlichen, vornehmen Salon und an den Menschen, mit denen er dort verkehrt hatte. Nach dem Abendbrot spielte er, wie es Brauch war, mit den Brüdern noch ein Kartenspiel, aber er war zerstreut und mußte sich darob manchen scherzhaften Vorwurf gefallen lassen. Früher als sonst ging er, unter dem Vorwande, daß er sich abgespannt fühle von der ungewohnten Gesellschaft, nach seiner kalten Zelle zurück. Er brannte seine Lampe an und wollte, sich in seine Bettdecke[133] hüllend, lesen, aber er schweifte in seinen Gedanken immer wieder von der Kirchengeschichte ab.
Zum ersten Male in seinem Leben hatte der schlichte Mönch, der aus ärmlichen Verhältnissen hervorgewachsen war und nichts von dem Glanz und der gefälligen Außenseite der Welt wußte, den Schritt in diese gesetzt, und er bezahlte das mit einer nie gekannten Unruhe. Er schloß die Augen und sah dann sofort wieder den vornehmen Raum vor sich und das Mädchen im hellen Gewande am Instrument, und seine Seele schien sich in der Erinnerung noch immer festzusaugen an den Tönen der vollen, weichen Altstimme.
Severin faltete die Hände heiß in einander und hielt zwischen ihnen die derben Knoten seines Gürtelstricks so fest, daß es ihn beinahe schmerzte; aber er wünschte sich körperlichen Schmerz. Immer zitterte in seiner Brust das Lied von den zwei Königskindern mit seiner einfachen, bestrickenden Melodie, und er suchte in seinem Gedächtnis umsonst nach jener anderen, Mendelssohnschen Weise, die mit ihrer frommen Innigkeit ihn so tief ergriffen hatte.
Er war aufgestanden, ging in dem kleinen Raum hin und wieder und blieb endlich am Fenster stehen. Das Schneetreiben hatte aufgehört, der Himmel war klar geworden, und heller noch als vordem schien der bläuliche Stern herabzuwinken, wie ein himmlisch-tröstendes Licht. Und in diesem Augenblicke fand der junge Mensch das Wort, welches er gesucht hatte:
Am liebsten wäre er jetzt nach der Orgel gegangen, aber das war nicht möglich, und so sank er auf dem harten, rohen Betschemel vor dem schlichten, geschnitzten Kreuzbilde auf die Kniee, senkte den Kopf tief in die Hände und betete lange.
Dann verlöschte er die Lampe und legte sich, angethan mit seinem Ordensgewande, nieder. Er schlief auch ein, aber in seinen Traum hinein klangen süße Mädchenlieder. – –
Die Orgelstunden waren im Laufe des Winters, wenn die Temperatur in der ungeheizten Kirche gar zu niedrig erschien, wiederholt ausgefallen, und mit einer gewissen Aufregung, wie er sie nie zuvor bei diesem Anlasse empfunden hatte, sah Severin dem Mittwoch entgegen, ob das Wetter wohl ein Kommen seiner Schülerin ermöglichen würde. Der Morgen brach herrlich an, und der Tag hielt, was jener verheißen hatte. Die Stunden selbst fanden unmittelbar nach Mittag statt, und Therese erschien auch diesmal.
Sie trug ein mit braunem Pelzwerk verbrämtes Jäckchen über dem dunklen Wollkleide, ein entsprechendes Pelzmützchen, unter dem ihr frisches Gesicht mit den hellen, freundlichen Augen munter hervorlachte, und grüßte liebenswürdig wie immer ihren jungen Lehrmeister. Dieser aber war heute befangener als sonst, und weniger bei dem Spiele selbst als bei seiner Schülerin, so sehr er sich auch zwang, seine Aufmerksamkeit auf ersteres zu konzentrieren.
Sie spielte eine Variation über ein Thema von Sebastian Bach, und dem jungen Mönche war es, als höre er dieselbe zum ersten Male, und als sehe er auch dabei zum ersten Male diese feinen, schlanken Finger, welche kraftvoll und gewandt die Tasten beherrschten, und die zierlichen kleinen Füße, welche das Pedal traten. Nur wie im Traume kam es ihm vor, daß er ab und zu einige Worte der Erläuterung spreche, ein oder das andere Register ziehe oder selbst in die Tastatur greife. Bei dem letzteren war es ihm geschehen, daß er die kühle, weiße Hand berührte, und es durchzuckte ihn plötzlich wie mit einem heißeren Empfinden.
Er stand hinter dem Mädchen, aber er heftete seine Augen nicht mehr auf die Noten, sondern hielt sie auf das[135] Haupt mit den weichen, braunen Flechten gewendet, von welchen ein feiner, berückender Duft auszugehen schien. Aus dem Pelzjäckchen hob sich anmutig der blütenweiße Hals ab mit einem ganz feinen schwarzen Schnürchen, das seine Helle noch mehr hervortreten ließ, die zarten Ohrmuscheln waren leicht rötlich angehaucht, und die kleinen Perlen darin blinkten. Auf der Orgelbank lag neben dem Mädchen ihr Mardermuff, und Severin fühlte, wie es seine Hand nach diesem hinzog, immer mehr, bis sie auf dem kühlen Pelzwerk lag und leise kosend darüber glitt. Er empfand ein unsägliches Wonnegefühl dabei, und als er gar die Oeffnung des Muffes fand, wo die Hand Theresens geruht haben mußte, war er heftiger erregt. Er sah nur wie durch einen völligen Schleier die hüpfenden Punkte der Noten, die weißen Finger auf den weißen Tasten, den zierlichen Kopf und beugte sich immer mehr vor.
O, wenn er nur eine Sekunde lang dies glänzende Haar berühren – nein, wenn er nur mit seinen Lippen das Pelzwerk ihres Gewandes streifen dürfte! Therese ahnte nichts von der heftigen Gemütsbewegung Severins. Ganz versunken in ihrem künstlerischen Thun fühlte sie auch nicht den heißen Atem, der ihr Haupt umspielte, kraftvoller faßten ihre Hände in die Tasten, ein Meer von Tönen wogte und brauste durch die hallende, leere Kirche und durch das Herz des jungen Mönchs … und nun hatte er sich niedergebeugt, und nur einen Pulsschlag lang berührte sein Mund das Gewand des Mädchens.

Es war, als stocke ihm der Herzschlag … mit einem machtvollen Akkorde klang die Variation aus, und Therese wandte sich um. Sie sah in ein gerötetes Gesicht, in flimmernde Augen und hatte doch keine Ahnung, was in dem jungen Bruder in diesem Augenblicke vorgehe; sie vermeinte, das Musikstück habe ihn so gewaltig ergriffen. Aber sie stand auf, sah nach ihrer Uhr, und da sie fand, daß die Zeit abgelaufen,[136] zog sie langsam ihre Handschuhe an und machte sich zum Fortgehen fertig.
»Nun, Sie sagen mir ja heute gar nichts über mein Spiel?« fragte sie halb scherzend, und er zwang sich zu dem Worte:
»Es war herrlich … ich kann Sie nichts mehr lehren!«
»O, sagen Sie nicht so! Das nächste Mal spielen Sie mir die Variationen vor, damit ich höre, wie viel mir noch fehlt!«
»Ja, ja – das nächste Mal!« stammelte er, indem er sie bis an die Thür des Chors begleitete.
Keines von beiden aber hatte bemerkt, daß der Guardian während der letzten Viertelstunde unbemerkt auf dem Chore gewesen war und sich erst entfernt hatte, als sich Therese erhob.
Severin wankte in seine Zelle; er hatte das Bewußtsein einer ungeheuren Schuld, die ihn fast zu erdrücken drohte. Er griff nach seinem Brevier, und, über sein Betpult gebeugt, murmelte er die Bußpsalmen des königlichen Sängers David, vor allem das ergreifende: Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam! (Erbarme Dich meiner, o Herr, nach Deiner großen Barmherzigkeit!)
Er wurde ruhiger im Gebete, aber er wußte, daß die Erkenntnis der Schuld noch nicht ausreiche, und daß er sich demütigen müsse auch im Bekenntnis derselben. Darum schritt er langsam, aber festen Fußes nach der Zelle des Guardians. Der alte Priester sah ihn verwundert an, und unter seinem milden Blicke fühlte Severin, wie er errötete; er bat, ob er ihm beichten dürfe.
Der Guardian bejahte und ließ sich, nachdem er die Zelle von innen verschlossen, auf einem alten Lehnstuhle am Fenster nieder; der junge Mönch aber hatte einen Fußschemel herbeigeholt; auf diesem kniete er zur Seite des anderen demütig nieder, und mit halblauter Stimme berichtete er den[137] Vorgang auf dem Chore. Als er zu Ende war, that er einen tiefen Atemzug, dann fügte er die übliche Formel von seiner Bereitwilligkeit, zu büßen, sowie die Bitte um Absolution bei.
Der alte Priester schien ergriffen zu sein, denn er sprach mit ungemein milder, bewegter Stimme:
»Wohl Dir, mein Bruder, daß Du selbst den Weg gefunden hast zu Deinem Heil, und daß Du ihn schnell gefunden hast, nachdem Du wohl gestrauchelt, aber nicht gefallen bist. Ich habe auf Dich gewartet in dieser Stunde, denn ich bin Zeuge gewesen von Deiner Schwachheit, und daß Du kommst, erfüllt mein Herz mit Freude und seliger Hoffnung. Halte fest an diesem Gesetz Deines Gewissens, laß die Sonne niemals untergehen über einer Schuld, und Du wirst den Frieden finden, den der Herr verheißen hat. Wer so bereut wie Du, schnell und tief, der hat sich die Verzeihung erworben, und so absolviere auch ich Dich im Namen des Vaters, Sohnes und heiligen Geistes. Zur Ehre Gottes aber bete heute fünf Vaterunser mehr als gewöhnlich. Und nun noch eins: Der Orgelunterricht soll nicht fortgesetzt werden, aber kein Mensch braucht zu ahnen, weshalb. Ich kann Ihnen mitteilen, lieber Bruder, daß der hochwürdige Herr Provinzial bei dem Mangel an Priestern in unserem Orden nachgesucht hat, daß Ihre Ausweihung zum Priester bereits zum Weihnachtsfeste erfolgen möge, und man hat der Bitte stattgegeben. Die würdige Vorbereitung zu diesem heiligen Akte macht das Aufhören jeder ablenkenden Nebenbeschäftigung von selbst nötig. Und nun gehen Sie mit Gott!«
Severin küßte tiefbewegt und wortlos die Hand des Guardians und verließ mit gesenktem Haupte, aber mit leuchtenden Augen dessen Zelle.



Peter Frohwalt hatte sein letztes theologisches Rigorosum mit Auszeichnung abgelegt und stand vor seiner Promotion zum Doktor der Gottesgelehrtheit früher, als er selbst vermutet hatte. Der Tag, an welchem die letztere stattfand, war für ihn ein schöner Festtag. Er hatte seine Mutter dazu eingeladen – seine Schwester dagegen nicht – und die alte Frau war auch am Vorabend bereits in Prag eingetroffen und von ihrem Sohne auf dem Bahnhofe abgeholt worden. Er brachte sie in einem einfachen, guten Gasthause in der Nähe des Klementinums unter. Gerne hätte er auch Vetter Martin hier gesehen, aber der Alte kam nicht, obwohl er wieder daheim war. Er schickte nur mit der Mutter ein Brieflein, in welchem er nach seiner ehrlichen Manier gerade heraus erklärte: die Lieblosigkeit, mit welcher bei einem solchen Anlasse Marie übergangen worden sei, würde ihm die Freude an der Feier verderben.
Das war ein bitterer Tropfen für Peter Frohwalt, der ihm nun thatsächlich Unbehagen schaffte; aber die Sache war nicht zu ändern, und zuletzt wäre es doch mehr als seltsam[139] gewesen, wenn der Doktorand der Theologie eine Abtrünnige eingeladen hätte.
Am Morgen des Promotionstages fuhr er in einem Fiaker bei dem Gasthause vor, in welchem seine Mutter wohnte, und holte die alte Frau ab, welche aus Stolz und Ergriffenheit an diesem Vormittage nicht herauskam. Peter Frohwalt trug über der Klerik heute einen mit Seide ausgeschlagenen Talar, den er über den linken Arm gelegt hatte, und seine Erscheinung war auffallend schön und vornehm, so daß, als er mit der schlichten Frau die Stufen im Carolinum hinaufstieg, alle, die ihn sahen, ihm nachschauten. Er führte seine Mutter in dem kleinen Saal zu einem Sitze in der vordersten Reihe der hier befindlichen Stühle und ging in ein Nebengemach um dort zu harren, bis er gerufen wurde.
Der Saal hatte sich beinahe völlig gefüllt, als er wieder eintrat. Auf erhöhtem Platze saßen die Würdenträger der alten Carl-Ferdinands-Universität um den Rektor gereiht, angethan mit den goldenen Ketten, außerdem zahlreiche Doktoren der Theologie, die ihr Recht auf einen Sitz in diesem Kollegium heute ausübten, und tiefer stand der Oberpedell, sowie der Pedell der theologischen Fakultät in ihren altertümlichen Gewändern; der erstere hielt das Universitätsszepter, bei dem nachher der Eid geleistet werden mußte, in der Rechten.
Die Feierlichkeit verlief in der gewohnten Weise. Peter Frohwalt neigte das Haupt, empfing die goldene Kette und den Doktorring, und, so geschmückt, sprach er in lateinischen wohlgesetzten Worten die übliche Danksagung. Seine Mutter verstand nicht, was er sagte, aber der volle, wohlklingende Ton der Stimme, die ganze Erscheinung ihres Sohnes, auf dessen Brust das Ehrenkleinod hell aufblinkte von dem dunklen Grunde der Klerik, hatten etwas überwältigendes, so daß sie in ihr Taschentuch hineinschluchzte in Wonne, Seligkeit und Wehmut zugleich, denn sie mußte in diesem Augenblicke[140] wieder ihres verstorbenen Mannes und – ihrer Tochter denken.
Als der Rektor und die anderen Herren vortraten, um sie zu beglückwünschen, vermochte sie nur durch ein Neigen des Hauptes und durch den Druck der Hand zu danken, und sie war unendlich froh, als sie wieder mit ihrem Sohne allein in dem geschlossenen Wagen saß und durch die belebte Straße hinfuhr.
»Es wäre doch schön gewesen, wenn Marie das hätte mit ansehen dürfen.«
Das war ihr erstes Wort, und der junge Doktor fühlte, wie sich abermals ein Hauch des Unbehagens über seine Seele legte, als empfände er das Bewußtsein einer Schuld. Er antwortete darauf nicht, sondern machte seine Mutter auf einen Vorgang auf der Straße aufmerksam. Den ganzen übrigen Tag war er mit ihr beisammen, zeigte ihr die reichen Sehenswürdigkeiten Prags, und erst am Abend verließ er sie in ihrem Gasthause. Er aber schritt langsam nach dem Seminar.
In der Stille seines Zimmers ließ er die Ehren des heutigen Tages noch einmal an sich vorübergehen, und die Brust hob sich ihm von einem freudigen Stolze. Aber mitten in dieser Stimmung trat ihm mit einem Male wieder das Bild der Schwester vor die Seele und schien ihn mit freundlichen Augen traurig anzublicken. Es führte ihn, ohne daß er es wollte, zurück in die Tage seiner Jugend, da er mit ihr zusammen geweint und gelacht in dem kleinen Hause bei dem alten Thore, und er empfand, daß er sie im Grunde doch lieb hatte trotz dessen, was zwischen ihm und sie getreten: Sie war ja seines Vaters, sein Blut. Es fiel ihm ein, daß das kleine Buch vom Vetter Martin, das »Laienbrevier«, einige Verse enthielt von der Liebe zu den Seinen, und er holte es herbei und blätterte, bis er fand, was er suchte. Und beim Lampenschimmer in der tiefen Stille des Seminars las er halblaut:
Er las die Verse zweimal, dreimal, als ob er sie recht fest seinem Gedächtnis einprägen wolle, und dabei überkam ihn eine freundliche Ruhe. Mit dem Gedanken an seine Lieben schlief er ein, und so ging ihm der schöne Tag schön zu Ende.
Am anderen Morgen reiste seine Mutter heimwärts; er hatte sie nach dem Bahnhofe begleitet und stand mit ihr bereits auf dem Perron. Sie drückten sich noch einmal die Hände, und jetzt erst sagte schüchtern die alte Frau:
»Darf ich Marie nicht grüßen von Dir? – Es braucht's ja niemand zu erfahren. Du und ich, wir haben eine große Freude gehabt, gönne ihr auch ein Teilchen!« Frohwalt sah einen Augenblick zur Seite, that einen kurzen Atemzug und sprach dann, wieder der Mutter zugewendet:
»Ja, grüße sie von mir!« – –
Der Zug brauste pfeifend, stöhnend hinaus aus dem Bahnhofe, der Adjunkt aber ging mit leichtem Herzen und mit einer gewissen Freudigkeit heim.
Noch an demselben Vormittage fuhr er in Begleitung des Syndikus der Universität nach dem Hradschin, um sich, wie es Brauch war, als neugeschaffener Doktor dem Kanzler der Hochschule, dem Erzbischof, vorzustellen.
Sie wurden, ohne im Vorzimmer lange warten zu müssen, bei dem Kirchenfürsten vorgelassen. Der Kardinal[142] Fürst Schwarzenberg war eine in jeder Weise aristokratische Erscheinung, hochgewachsen und schlank, mit einem länglichen, feinen, frischgeröteten Gesicht und klaren Augen, und seine Persönlichkeit erschien noch vorteilhafter gehoben durch die hochrote Soutane, welche in eine wallende Schleppe auslief; auf dem kurzen, silbergrauen Haare lag ein kleines, gleichfalls hochrotes Seidenkäppchen. Frohwalt war nach tiefer Verneigung zu ihm herangetreten, und küßte die feine Rechte, der Kardinal aber sprach in leutseligster, herablassender Weise mit ihm über seine Studien, zumal sein Lieblingsstudium, und befragte ihn zuletzt auch nach seiner Heimat und seinen Angehörigen.
»Ob seine Schwester verheiratet sei?«
Der junge Doktor errötete und fühlte eine Sekunde lang den Atem beengt; er hatte die Empfindung, daß der Kirchenfürst, der ihm mit seinem klaren Blicke tief in die Augen schaute, im nächsten Momente auch nach seinem Schwager fragen müsse. Es geschah nicht, im Gegenteil, die Audienz war zu Ende, aber Frohwalt war, indem er wieder nach seinem Seminar zurückfuhr, ernst und still. Er dachte daran, wie er sich im Grunde doch seiner Schwester schämen müsse, und beinahe reute ihn der Gruß, welchen er der Mutter für sie aufgetragen hatte. – –
Einige Tage später hatte sich im erzbischöflichen Palais an der Tafel des Kirchenfürsten eine besonders erlesene Gesellschaft zusammengefunden: Zwei Domherren, darunter Kanonikus Kupetz, einige Professoren der theologischen Fakultät und Professor Dr. Holbert, der sich besonderer Beliebtheit bei dem Kardinal erfreute. Kaum minder angesehen war der gleichfalls anwesende Professor der Moraltheologie Dr. Sales Meyer. Er trug das Ordensgewand der Cisterziensermönche, die weiße Tunik mit dem schwarzen Skapulier und der schwarzen Binde. Sein etwas volles, gerötetes Gesicht sprach von Geist und Klarheit, Frische und Energie, und[143] die Augen sahen klar und scharf durch die spiegelnden Brillengläser.
Das Gespräch hatte ein ernstes und bedeutsames Thema erfaßt. Für den 8. Dezember des laufenden Jahres, des Jahres des Heils 1869, war eine allgemeine Kirchenversammlung nach Rom berufen worden, und die Herzen der katholischen Christenheit waren bewegt, die der Kirchenfürsten und der gelehrten Theologen erregt. Man war noch im Unklaren, um was es sich handle, und der Kardinal selbst gab diesem Empfinden Ausdruck:
»Seit dreihundert Jahren hat ein solch' Ereignis nicht stattgefunden, und es ist begreiflich, daß es unsere Gemüter erfaßt, umsomehr, als eine besondere Veranlassung nicht erkennbar ist. Wir haben keine Spaltung in der Kirche und keine neue Irrlehre zu bekämpfen, auch keine großen theologischen Streitfragen, die der Entscheidung auf solchem Wege harrten.«
»Wäre es nicht möglich, Eminenz,« – nahm Kanonikus Kupetz das Wort – »daß angesichts der zersetzenden, auf Umsturz von Altar und Thron gerichteten Bestrebungen der Sozialdemokratie oder der Freimaurer der heilige Vater Gelegenheit nehmen wollte, durch eine großartige Kundgebung der gesamten Kirche dem Vordringen derselben einen Damm zu setzen?«
Der Kardinal schüttelte wie ungläubig das Haupt, und Professor Meyer sprach mit seiner klaren, ein wenig trocken lehrhaften Stimme:
»Ich erachte das für wenig wahrscheinlich, obwohl ich die Bedeutung eines solchen Vorganges auch in diesem Sinne nicht unterschätzen würde. Befremdlich erscheinen muß es jedoch, daß man mit dem eigentlichen Zweck geheimnisvoll hinter dem Berge hält – wozu in Dingen, welche alle Gläubigen interessieren müssen, sich in den Schleier des Geheimnisvollen hüllen?«
»Wozu, wenn es sich um keine Streitfrage handelt, die Geister zuvor entfesseln und durch theologische Zänkereien schon vorher die Gemüter verbittern?« fragte der Kardinal dagegen.
Jetzt nahm Professor Holbert das Wort:
»Verzeihung, Eminenz – aber ich bin vielleicht in der Lage, eine nicht unwichtige Andeutung der kommenden Dinge geben zu können. Mir ist heute früh erst eine italienische Zeitung zugegangen, ein Blatt, das in streng kirchlichem Sinne und unter dem Einfluß des Jesuitenordens redigiert wird, und da steht es ziemlich unverblümt zu lesen, daß es bei dem bevorstehenden Konzil sich um nichts Geringeres handle, als dem heiligen Vater die Unfehlbarkeit zuzusprechen.«
Das Wort fuhr wie ein zündender Strahl durch den ganzen Kreis. Eine Falte legte sich zwischen die feinen Augenbrauen des Kirchenfürsten:
»In welchem Sinne glauben Sie, daß man eine solche verkünden wolle?«
»Ich fürchte, Eminenz, in völlig persönlichem Sinne, insofern es sich um eine der Zustimmung der Kirche nicht bedürfende Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Sittensachen handelt.«
»Aber, Herr Professor« – sagte der Kirchenfürst im Tone des Vorwurfs – »ist es nicht unbillig, dem heiligen Vater solch' selbstsüchtige Pläne zu unterschieben?«
»Er ist so ergeben, so milde, wie sollte er dazu kommen?« fragte der andere Kanonikus, der Professor Holbert aber blieb völlig ruhig, und erwiderte:
»Ich darf wohl annehmen, daß meine kirchliche Gesinnung, die mir Herzenssache ist, in diesem Kreise genugsam bekannt ist, ebenso wie der Freimut, mit welchem ich meine Anschauungen und Ueberzeugungen auszusprechen gewohnt bin; mit Rücksicht auf beides bitte ich Eure Eminenz um[145] Verzeihung, wenn ich in einem derartigen Glaubenssatze nur den letzten Schluß eines seit Jahren verfolgten Vorgehens erblicken kann. Wenn ich denke, welche Fülle von Ablaßerteilungen, Heilig- und Seligsprechungen der Papst auf Anlaß seiner Berater aus dem Orden der Gesellschaft Jesu in den letzten Jahren vollzogen hat, ja wie man geflissentlich sogar die Kunde von angeblich durch ihn ausgeübten Wundern verbreitet hat, so will mich bedünken, als ob man damit nur die Voraussetzungen geschaffen zu dem Schlusse, der nun gezogen werden soll. Auch die Art, wie vor Jahren der Glaubenssatz von der unbefleckten Empfängnis Mariä entstand, hat nicht bloß mir zu denken gegeben, aber der Vorgang wird mir heute verständlicher. Etwa 100 Bischöfe, darunter circa 80 italienische, die zusammen nicht so viele Seelen vertreten, als Seine Eminenz, unser Herr Kardinal-Fürsterzbischof, haben bei einem Zusammensein in Rom durch einfachen Zuruf zu dem vom Papste vorgelegten Glaubenssatz dessen Aufstellung als Glaubenssatz bewirkt. Wo hat man sich dabei viel um die Kirche gekümmert?«
»Die Sache war ja immerhin anders,« nahm Professor Meyer das Wort. »Damals wurde etwas, was der fromme Sinn des katholischen Volkes schon lange glaubte, weil es seinem Herzensbedürfnis entsprach, zum Glaubenssatz erhoben – aber ein Glaubenssatz von der persönlichen Unfehlbarkeit des heiligen Vaters wäre eine Neuerung, welche die Gemüter verwirren müßte und schweres Unheil bringen könnte.«
»Aber, meine Herren, das ist ja Schwarzseherei! Die Sache liegt doch einfach: Entweder die Unfehlbarkeit ist eine bereits alte Lehre, oder wenn dies nicht nachgewiesen werden kann, kann sie nicht aufgestellt werden,« sprach der Kardinal.
»Ja, ein Glaubenssatz kann doch nur dann für die Kirche Gültigkeit haben, wenn die Mitglieder eines Konzils denselben einhellig oder nahezu einhellig annehmen. Das ist[146] aber in diesem Falle kaum zu erwarten,« bemerkte einer der theologischen Professoren.
»Das sollte man meinen, Herr Kollege,« erwiderte Dr. Holbert, »ich fürchte aber, daß man in Rom auch vor einer Majorisierung nicht zurückschreckt, wenn es sich um einen fest vorbereiteten Plan handelt.«
»Aber da würden wir doch auch noch auf dem Platze sein,« meinte der Kardinal mit einem feinen Lächeln, und Dr. Holbert senkte schweigend den Kopf.
Den sonst so ruhigen Professor Meyer schien die Angelegenheit besonders zu erregen:
»Ich kann noch nicht an solche Absicht glauben; es würde den geschichtlichen Ueberlieferungen, den geschichtlichen Thatsachen ins Gesicht schlagen und sich niemals aus Ueberlieferung und Schrift begründen lassen. Man kann aus vielen Gründen dem katholischen Volke nicht zumuten, daß es glaube, der Papst könne auf dem ganzen Gebiete des Glaubens und der Sitten der höchste Lehrer, Richter und Gesetzgeber sein, und tausend fromme und gelehrte Kirchenfürsten und Kirchenlehrer ständen auf dem Boden des Irrtums, wenn der heilige Vater, der weder gelehrt zu sein braucht, noch auch – dafür spricht ja leider die Geschichte – immer tugendhaft, für gut befindet, eine besondere Meinung zu haben.«
»Und wohin sollte das im Staatsleben führen« – sprach wieder Holbert – »wenn der jeweilige Papst mit seiner unfehlbaren Meinung in die Rechte der Staaten und der Völker eingreifen würde? Die Völker sind nicht mehr wie im Mittelalter, sie sind mündig geworden und lassen sich von Rom nicht mehr Gesetze geben, die unter Umständen der bloßen Willkür ihre Entstehung verdanken. Heute haben wir einen milden, guten Herrn auf dem Stuhle des heiligen Petrus, wer aber kann für seine Nachfolger bürgen?«
»Ich glaube, meine Herren, wir regen uns unnützer Weise auf« – sagte der Kardinal mit der Absicht, das Gespräch,[147] das eine unbehagliche Wendung zu nehmen drohte, zu wechseln, und seine Gäste waren taktvoll genug, ihn zu verstehen. – Die Wogen der erregten Gemüter glätteten sich, man kehrte zu harmloseren Tagesfragen zurück, und Seine Eminenz verstand auch hier, den feinsinnigen, liebenswürdigen, vornehmen Wirt zu machen. Unter andern kam die Rede auch auf Dr. Peter Frohwalt, der dem Kardinal nach seiner äußeren Erscheinung wie nach seinem ganzen Wesen einen sehr guten Eindruck gemacht hatte; er hörte mit Vergnügen, daß auch Professor Holbert sich lobend über den jungen Adjunkten äußerte, und sprach aus, daß er denselben im Auge behalten wollte.
Der Frühling brachte für Prag wie alljährlich das Fest des Landesheiligen Johannes von Nepomuk, der bekanntlich als Märtyrer des Beichtgeheimnisses in den Fluten der Moldau gestorben sein soll. Da, wo auf der steinernen Brücke heute sein Standbild steht, ließ ihn, wie erzählt wird, König Wenzel, der Luxemburger, in die Wellen schleudern, aber ein Kranz von sieben hellen Sternen umleuchtete noch das Haupt des Toten, dessen Leib nachher im Dome von St. Veit beigesetzt wurde, dessen Gedächtnis am 16. Mai jeden Jahres festlich begangen wird. Seine angeblich unversehrte Zunge wird in kostbarer Monstranz der Verehrung des Volkes ausgestellt.
Auch in diesem Frühling waren Tausende nach der böhmischen Hauptstadt gekommen, das Fest mitzufeiern, und über die Brücke nach der Höhe des Hradschin bewegte sich eine bunte Menge, meist Landvolk, und im Dome drängten sich Hunderte um das Grabmal des Heiligen, den massiven, schwerfälligen Sarkophag, zu welchem 27 Zentner feinen Silbers verwendet worden sind, und um welchen eine Anzahl Lampen ihr trauliches Licht ausgießen. Unter ihnen stand diesmal auch der wunderliche Heilige, Vetter Martin, der zwar Prag schon kannte, aber es bei Gelegenheit dieses Festes auch einmal sehen wollte.
Ihm behagte dies Leben und Treiben nicht, noch weniger die unvermeidlichen tschechisch-nationalen Kundgebungen, welche regelmäßig mit diesem Feste verbunden werden; diese angeputzten Banderien, diese buntscheckigen Sokolisten waren ihm nichts weniger als eine Herzensfreude, und so stapfte er am Morgen des Festes bereits wieder hinüber nach der Altstadt, um im Klementinum bei Peter Frohwalt vorzusprechen.
Der war erfreut, als der Alte bei ihm eintrat.
»Das riecht ordentlich nach Theologie bei Euch, etwas muffig, als ob schon lange kein frischer Luftzug hereingekommen wäre, so daß es sich Unsereinem auf die Brust legt – nimm mir's nicht übel, Peter! Ja so, Du hast ja jetzt eine akademische Würde, und dazu will ich Dir auch meinen Glückwunsch sagen. Ich wäre gern zur Promotion gekommen, aber mir that's leid um Deine Schwester, das arme Wurm, das nicht einmal thun darf, als ob es sich darüber freute – und sie hat sich doch gefreut mitsamt Deinem Schwager. Na, was machst Du denn auf einmal für einen schiefen Nasenwinkel … ja so, Dir ist etwas in die Schleimhäute gefahren, Du kannst Freidank nicht riechen! Aber ich sage Dir, er ist ein prächtiger Mensch und trägt Deine Schwester auf den Händen. Er weiß, daß er doppelt an Liebe geben muß, weil er auch den Bruder zu ersetzen hat. Herrgott, da schwatze ich, und weiß doch, daß ich Dir kein Vergnügen damit mache – na, wovon das Herz voll ist … und so weiter. Höre, das Prag ist ein unausstehliches Nest am Johannistage; man lebt wie in einer Heringstonne, und selbst wenn man mal ausspucken will, trifft man einen Verehrer des heiligen Nepomuk. Und wenn das Geschmeiß nur wirklich noch wegen des Heiligen herkäme! Aber das alles kommt zu seinem Pläsir. Nur die vielen Leierkästen! Aber jetzt rede Du – – während ich mich einmal in die Sophaecke setzen und, wenn Du nichts dagegen hast, ein Pfeifchen in Ruhe schmauchen will!«
Er hatte den Worten eigentlich die That schon vorausgeschickt, schmunzelte behaglich und sagte:
»Sieh, das ist der erste schöne Augenblick im goldenen Prag! Also, wie lebst Du?«
Frohwalt begann nun von seiner Tagesarbeit und von seinen Studien zu reden, von der Hoffnung auf einen Lehrstuhl an der Hochschule, und der Alte merkte, wie solche Aussichten auf die Zukunft ihn freudig bewegten. Als der Adjunkt geendet, sprach er, behaglich dampfend:
»Du bist ja tüchtig und fleißig, und ich gönne Dir von Herzen, daß Du einmal zum violetten Collare kommst, aber ein wenig Glück gehört zu dem allem auch. Dein alter Nedamitzer Pfarrer hat auch einen guten Kern gehabt und hat's wohl auch an Fleiß nicht fehlen lassen, aber ihm hat das Glück gefehlt, in die richtigen Verhältnisse gekommen zu sein. Was hörst Du von ihm?«
Frohwalt erzählte, was er wußte, und der Vetter vergaß, an seinem Pfeifchen zu saugen.
»Hm, hm, – also abgethan – in's alte Eisen – das wird er nicht lange aushalten! Höre, Peter, das ist ein elend' Leben, wie's ihm zuteil geworden ist. An der richtigen Stelle, in guten Händen, wäre er ein brauchbarer Kerl geworden, aber die Theologie allein thut's nicht. Also in der Spornergasse sitzt er mit seinem alten Zinnkrug – da will ich doch einmal zusehen, was er macht. Kommst Du mit?«
Frohwalt wurde einigermaßen verlegen.
»Ich bin heute mittag beim Kanonikus Kupetz eingeladen, der seinen Namenstag feiert, darum muß ich Dich sehr um Entschuldigung bitten, wenn ich mich nachmittags Dir nicht widmen kann. Du nimmst mir's nicht übel – bitte – morgen stehe ich dafür den ganzen Tag zu Deiner Verfügung.«
»Selbstverständlich, mein Sohn, kommt erst der Herr Kanonikus – nein, übelnehmen ist nicht! Da paßt mir's[150] doppelt, wenn ich Deinen alten Parochus wiederfinde und ihn vielleicht in die freie Natur locken kann; denn in den Gassen ist mir's heute unheimlich. Ich begleite Dich über die Brücke nach der Kleinseite!« – So geschah es, und bald schritten sie selbander durch den alten Brückenturm und bewegten sich langsam im Gewühle der Menschen, welche heute mehr als je die Brücke belebten, vorwärts. Vor dem Standbilde des heiligen Johannes gab es eine kleine Stauung; der Adjunkt zog andächtig seinen Hut, Vetter Martin aber nickte dem Heiligen vertraulich wie einem alten Bekannten zu.
Vor der Wohnung des Pfarrers trennten sie sich, nachdem Frohwalt dem Alten einen Gruß aufgetragen hatte, und dieser stapfte nun langsam über den unfreundlichen Hof und die Treppe im Hintergebäude empor. Er erschrak, als er bei dem Pfarrer eintrat, über die Aermlichkeit dieser Verhältnisse, noch mehr aber, als er den Bewohner dieses Raumes auf seinem alten Sopha, bedeckt mit einem zerschlissenen Schlafrock, liegen sah. Der Mann sah elend und heruntergekommen aus mit seinem fahlen Gesicht und den breiten Säcken unter den schwimmenden Augen.
»Ach, der Vetter Martin!« rief er jetzt, sich halb emporrichtend, und eine schnelle Röte, ob der Freude oder Verlegenheit wäre schwer zu sagen gewesen, flog über das graue Gesicht.
»Na ja, da sind wir, Herr Pfarrer,« knurrte der Alte, halb fröhlich, halb gerührt, und indem er mit der Rechten die Hand des andern drückte, hielt er ihn mit der Linken davon ab, aufzustehen.
»Liegen bleiben, liegen bleiben – Sie sind krank!«
»Ja, ich bin leidend!« seufzte der andere – »schwere Beine, schweren Kopf, elenden Magen, ich wollt', ich läge auf dem Nedamitzer Kirchhofe, denn in meinem Dorfe muß es tot hübscher sein, als hier lebendig. Nehmen Sie Platz – das ist mir eine rechte Freude in meinem Elend!«
Martin saß schon neben ihm am Tische und sagte:
»Der alte Diogenes hat in einer Tonne gewohnt, und da war's wohl noch unbequemer als bei Ihnen!«
»Ja, der alte Diogenes!« seufzte der Pfarrer – »der hat's immer noch hübscher gehabt als ein alter Priester mit seiner Hungerpension. Ich setzte Ihnen gern irgend etwas vor, aber ich habe nichts zu Hause …«
Das klang so traurig und ergreifend, und Martin hatte die Empfindung, als ob der alte Herr sich schon lange nicht satt gegessen haben müßte; er sagte:
»Na, da hatte ich mich darauf gefreut, einmal mit Ihnen Mittag essen zu können; selbstverständlich sollten Sie mein Gast sein, denn in Nedamitz war ich der Ihre – aber Sie können wohl nicht ausgehen?«
»Ich bin zu elend heute, darum habe ich mir von meiner Nachbarsfrau nur eine Wassersuppe kochen lassen – –«
»Hm, eine Wassersuppe und heute, zum heiligen Feiertage – –«
»Und zu meinem Namenstage obendrein!« seufzte der alte Priester und seinem Besucher that das gute Herz weh. Er dachte daran, wie der Kanonikus Kupetz seinen Namenstag feiern werde, und der arme Teufel hier hätte sich an den Brosamen seines reichen Tisches satt essen können; er fragte:
»Haben Sie denn jemanden, den Sie fortschicken können, und der Ihnen etwas besorgt?«
»O ja, die Nachbarsfrau!«
»So – na, dann erlauben Sie mir, daß ich mir mein Mittagessen zu Ihnen holen lasse, mir paßt das Feiertagstreiben heute nicht!«
Dann ging er eilends hinaus, und der Pfarrer sah ihm mit verwunderten Blicken nach. Er erhob sich indes doch, und suchte nach einem Rock und einem alten, schmutzigen Collare, und als Vetter Martin nach kurzem zurückkam, fand er ihn in der Sophaecke sitzend.
»Das ist nichts mit Wassersuppe für Ihren schwachen Magen – glauben Sie mir, Herr Pfarrer – eine gebratene Taube ist für einen Kranken viel besser! Ich habe mir erlaubt, eine für Sie kommen zu lassen, und will Ihnen zu Liebe auch einmal meine vegetarischen Grundsätze beiseite thun. Wir wollen denken, wir säßen in der Nedamitzer Pfarrei und wollen auch den heiligen Nepomuk feiern!«
Dem Priester rannen zwei schwere Thränen über die Wangen; er streckte wortlos dem Alten die Hand hin, dieser aber begann von der Botanik und von seinen Reisen zu reden, bis die Nachbarsfrau mit einem großen Korbe anrückte. Sie deckte den Tisch mit einem sauberen Linnen, und dann begann sie auszupacken: Geflügel und Braten, Mehlspeisen und Kompott, als ob ein halb Dutzend Menschen essen sollten, und dazwischen stellte sie eine Flasche dunkelglutigen Vöslauers und zwei Gläser. Sie wünschte wohl zu speisen und ging. Der Pfarrer aber saß da, wie in einem Märchen, und atmete den Duft der Speisen ein, und vermochte noch immer nicht zu reden.
Vetter Martin war der liebenswürdigste Wirt; er legte dem andern vor und schenkte ihm ein, und sie stießen an auf den Namenstag. Die Wassersuppe schien doch nicht besonders Grund gelegt zu haben, und der alte Weltwanderer verstand auch, diese Sorte »schlechter« Mägen zu behandeln. Der Pfarrer thaute auf; er vergaß Elend, Sorge und Unwohlsein und erzählte von vergangenen schönen Tagen, Vetter Martin aber feierte ein Johannisfest, wie er es sich nicht hatte träumen lassen.
So war es um die dritte Nachmittagsstunde geworden, und der Alte forderte den Priester zu einem kleinen Spaziergange auf; dieser aber erklärte, daß er beim besten Willen nicht gehen könne, seine Beine wären zu schwach, und außerdem habe ihn der gute Wein etwas angegriffen und schläfrig gemacht. Da wollte sein Besucher nicht weiter in ihn dringen,[153] und nachdem er ihm versprochen hatte, am nächsten Tage wieder zu kommen, verließ er ihn. Von dem Mahle aber war noch so viel vorhanden, daß es wohl noch für zwei Tage für den Pfarrer ausreichen mochte.
Es war ein herrlicher Maitag; schimmernde weiße Wölkchen zogen über den dunkelblauen Grund des Himmels hin, und die grauen Häuser der steil ansteigenden Spornergasse erschienen freundlich und festlich. Trotzdem hatte Vetter Martin keine Neigung, den Berg emporzuklimmen. Er bog unterhalb des Kleinseitener Ringes in eine Nebengasse gegen das Augustinerkloster zu St. Thomas hin ab, ging vorüber an dem umfangreichen Wallensteinschen Palais, der Prager Residenz des gewaltigen Friedländers, und gelangte endlich an der Moldau entlang zu dem neuerbauten Kettensteg, unterhalb der Franz-Josefsbrücke. Dieser Uebergang über den Fluß war ihm neu, und das lockte ihn zum Ueberschreiten.
So kam er nach oder Altstadt zurück, aber in diesem abgelegenen Teile derselben war kein festliches Gewoge, hier herrschte Stille und beinahe kleinstädtisches Behagen. Dabei fühlte sich Vetter Martin wohler, und er schlenderte langsam weiter, bis er mit einem Male hineingeriet in die engen Gäßchen des alten jüdischen Ghetto. Da fiel ihm ein, daß just in dieser Zeit, da der Flieder blühte, der alte Judenfriedhof Beth Chajim besonders stimmungsvoll und sehenswert sein müsse, und daß er dort heute zweifellos in voller Einsamkeit das wunderlichste Fleckchen der böhmischen Hauptstadt genießen könne Er kannte sich gut genug hier aus und fand auch bald sein Ziel.
Am selben Nachmittage war es, daß auch Hans Stahl von der Kleinseite, wo das Wendische Seminar sich befindet, über die Franz-Josefsbrücke hinübergegangen war, um dem Treiben zu entgehen. Der junge Theologe, der sonst sehr frisch und lebensfroh erschien, war seit einiger Zeit trübsinnig geworden. Er brachte seine Gedanken nicht mehr fort von dem[154] lieblichen Mädchenbilde in der Zeltnergasse, und die Ballade von den zwei Königskindern, die nicht zusammenkommen konnten, verfolgte ihn seit jenem Sonntag-Nachmittag unaufhörlich. Wie die Motte war er um das Licht geflattert und hatte sich die Flügel versengt, aber er konnte trotzdem das Licht nicht meiden. Fast jeder Ausgang führte ihn in die Nähe des Hauses des Professors Holbert, in die Zeltnergasse, und wenn er bei solchen Streifereien Therese auch nur ab und zu flüchtig begegnete, grüßen und ihren Gegengruß entgegennehmen konnte, so war er höchst beglückt.
Auch heute schien er einen guten Stern zu haben. Schon hatte er die Zeltnergasse passiert und stand auf dem Altstädter Ring vor der berühmten astronomischen Uhr, wo eben die Apostel an den offenen Fenstern vorbeischritten, während das Totengerippe die Stundenglocke zog, als ob er das alles noch nie gesehen hätte. Im Grunde aber war es weniger die Uhr, als das zahlreiche Publikum, das mit gespanntem Interesse dem Vorgang sich zuwendete, was ihn interessierte. Dabei hatte er gar nicht bemerkt, daß Professor Holbert mit seiner Tochter vorübergingen, gleichfalls flüchtig nach dem alten Prager Wahrzeichen aufschauten und sich dann nach der alten St. Niklaskirche wendeten.
Gerade als sie dort um die Ecke verschwanden, hatte er sie noch bemerkt, und wie der vom Bogen geschnellte Pfeil eilte er ihnen nach. Sie anzusprechen auf der Gasse hätte er wohl nicht gewagt, aber »errötend ihren Spuren folgen« zu dürfen, schien ihm bereits ein Glück, und sobald er beide wieder vor sich gewahrte, schritt er langsam hinter ihnen drein, die Blicke immer auf die schlanke, elastische Mädchengestalt gerichtet, die im hellen Frühlingskleide ungemein anmutig aussah.
Vater und Tochter gingen Arm in Arm, im freundlichen Gespräch und lenkten zur Verwunderung Stahls hinein in die Karpfengasse, und von da nach dem Ghetto. Ihm war es[155] gleichgültig, was sie dort wohl suchen mochten, in den engen, düstern, schmutzigen Gäßchen, wo der Trödel daheim ist, und wo gegenüberwohnende Nachbarn sich zu den Fenstern heraus beinahe die Hände reichen können. Eine schwere, unbehagliche Luft brütet fast immer, besonders aber während des Sommers, in diesen Regionen, zwischen diesen engbrüstigen Häusern, die von bösen, gehässigen Zeiten zu erzählen wissen, in denen die Christen nicht immer die würdigere Rolle gespielt haben.
Die beiden mit ihrem lebenden Schatten hinterdrein kamen aufatmend heraus bei dem jüdischen Rathause, dessen Uhr statt der Ziffern hebräische Buchstaben weist, und deren Zeiger von rechts nach links wandern, warfen einen Blick nach der altersgrauen Altneuschulsynagoge hinüber, die schon im Jahre 590 n. Chr. erbaut worden sein soll, und an deren dunkle, wohl nie übertünchte Wände mehr als einmal das Blut gemordeter Juden spritzte. Professor Holbert beabsichtigte heute, da er für eine historische Arbeit dessen bedurfte, im Archive des Rathauses nach einem alten Dokumente zu forschen und veranlaßte seine Tochter, ihn auf dem naheliegenden Beth Chajim zu erwarten, und so gingen sie nach freundlichem Händedruck auseinander.
Das Herz Stahls schlug rascher, als er dies bemerkte, und sobald der Professor sich abgewendet, folgte er mit beschleunigtem Schritte dem Mädchen, das er auch am Eingange des alten Friedhofes ereilte und begrüßte. Sie dankte einigermaßen überrascht, aber ohne jede Verlegenheit und nahm auch die ihr angebotene Begleitung des jungen Theologen, der auch heute kein geistliches Abzeichen trug, an. Den aufdringlichen Fremdenführer, welcher seine Dienste anbot, wies Stahl zurück mit dem Bemerken, daß er genugsam hier bekannt sei, um sich selbst als Führer empfehlen zu können, und langsam trat das junge Paar in einen der seltsamsten Friedhöfe ein, die es wohl überhaupt geben mag.
Beth Chajim, Haus der Lebenden! Es ist eine schöne, symbolisch tiefe Bezeichnung – aber der Besucher fühlt, daß er in einer Stadt der Toten ist, und noch dazu in einer uralten, mit recht unregelmäßigen Gassen und Gäßchen, mit tausenden stiller Wohnungen, die bedeckt sind von ebenso vielen alten, grauen, verwitterten Steinen mit hebräischen Inschriften und alttestamentlichen Symbolen. Sie hocken neben und über einander, sehen sich über die Schultern weg, wie um sich an einander zu stützen, oder auch, als ob sie wunderliche alte Geschichten sich zuraunten. Hier liegen Geschlechter über einander geschichtet, und der Fuß berührt keinen Flecken, unter dem nicht Tote ruhen. Vom Denkmal der Sarah Katz berichten die geschwätzigen Führer, daß es aus dem Jahre 606 der christlichen Zeitrechnung stamme, und bei dem Grabe des Rabbi Löw bleiben sie stehen und rühmen die Gelehrsamkeit und Weisheit des Mannes, dessen verwitterter Leichenstein mit Eisenklammern zusammengehalten wird und bedeckt ist von größeren und kleineren Steinen und Scherben, wie fromme Pietät sie hier niedergelegt hat. Unter den Symbolen findet sich häufig ein Krug, das Sinnbild des Stammes Levi, während zwei wie zum Segen emporgehaltene Hände auf Aarons erlauchtes Geschlecht deuten. Es ist etwas eigenes um die Kinder dieses Stammes; sie kommen nach dem Totenacker nur, wenn sie gestorben sind; ein Betreten bei Lebzeiten macht sie unrein. An besonderer Stelle, dem Ephel, der eine ansehnliche Erhöhung bildet, liegen Tausende von Kinderleichen, und Jahrhunderte haben diesen Hügel getürmt.
Was aber den seltsamen Reiz dieses Friedhofs besonders erhöht, das sind die uralten Hollunderbüsche, die dicht an einander gedrängt, ihre Kronen in einander verwachsen und die verwitterten Leichenmale überdecken und umhüllen; durch ihr Gewirr führen schmale Steige über das Gras hin, Gäßchen, enger als jene im Ghetto, und ungleich anmutiger.
Und es war im Mai. Der Flieder blühte; seine blauen Dolden hingen dicht gedrängt zwischen dem grünen Blattwerk, weit herab auf die grauen Steine, und ein wundersamer, süßer Duft wob durch den Beth Chajim, berauschend und berückend. Durch Blüten und Duft gingen zwischen den Gräberreihen die beiden jungen Menschen hin, und es mochte ein liebliches Bild sein, als sie nach kurzer Wanderung sich auf einer Steinbank niederließen, im Schatten des blauen Flieders: Hans Stahl im dunklen Anzug, das Mädchen heller gekleidet; beide Gesichter voll Jugendfrische und Lebensdrang – ein seltsamer Kontrast zu dem Orte, wo sie waren!
Das ungefähr dachte auch der Vetter Martin, der ganz unfern von ihnen, ungesehen hinter einem Strauche stand, und sich an dem hübschen Stimmungsbilde so freute, daß er die Augen nicht davon wenden konnte. Warum hätte er auch gehen sollen? Er hätte vielleicht das Pärchen aufgescheucht, und Geheimnisse schienen hier nicht verhandelt zu werden, außer solche des Herzens, und die haben zu allen Zeiten denselben Ausdruck gefunden. Das wußte der Alte, er hatte auch einmal von Liebe gestammelt – es war lange her – aber ein anderer war ihm zuvorgekommen, ehe er die Liebste heimführen konnte, und seitdem war er ein einsamer Wanderer geblieben.
Daran dachte er jetzt nicht; er gönnte auch dem hübschen jungen Paar das trauliche Selbander, und wäre eigentlich erstaunt gewesen, wenn der junge Mann nicht gesagt hätte:
»Ist das nicht herrlich hier? – So losgelöst von der ganzen Welt zu Zweien zu sitzen unter blühendem Fliedergesträuch und auf Minuten alles vergessen zu können außer dem, was man zur Seite hat – das ist ein Augenblick, wie ich ihn längst geträumt!«
Der Alte sah zwischen dem Blattgewirr eine feine Röte in das Antlitz des Mädchens steigen und deutete sie in seiner[158] Weise, aber er war wunderlich enttäuscht, als er dasselbe sagen hörte:
»Ja, es ist eigenartig schön hier; ich bin vor Jahren einmal hier gewesen, damals blühte aber der Flieder nicht, und das giebt dem fremdseltsamen Bilde einen besonderen Reiz.«
»Den schönsten Reiz aber erhält es durch Ihre Anwesenheit; Sie verschönen mit Ihrer Anmut ja alles, was um Sie her ist … o Fräulein Therese, lassen Sie mich die wenigen Augenblicke nützen, die ein freundliches Geschick mir gegönnt hat, Ihnen zu sagen, daß ich Sie unaussprechlich lieb habe …«

Das Mädchen war wie erschrocken beiseite gerückt und sagte halb verlegen, halb im Tone der Entrüstung:
»Aber Herr Stahl, wie können Sie als Theologe …«
»O, Sie brauchen nur ein Wort zu sprechen, und ich bin es nicht mehr. Ich tauge ja doch nicht für den Beruf, den man mir eigentlich aufgezwungen hat, und wenn ich wüßte, daß Sie mich ein wenig lieb haben könnten, Fräulein Therese …«
»Sie versetzen mich in eine peinliche Lage, und ich bedauere eigentlich, daß Sie diese Situation, in welche ich Ihnen vertrauensvoll gefolgt bin, in solcher Weise ausnützen –«
Das klang so ernst, so abwehrend und bestimmt, daß der alte Lauscher hinter dem Hollundergebüsch ein sehr verdutztes Gesicht gesehen hätte, wenn er jetzt in einen Spiegel hätte schauen können; aber nun verdroß ihn auch die Rolle, die er hier spielte. Ein wenig Glück und Liebessonnenschein in zwei jungen Herzen hätte ihn gefreut, der Mißklang verstimmte ihn, und so schlich er sachte weiter, ohne zu hören, was Therese sonst noch dem feurigen Theologen sagte. Ihm war – er wußte selbst nicht warum – das Behagen, das er an dem Orte empfunden, vergällt, und er fühlte etwas wie[159] Erbitterung, wobei ihm nicht ganz klar war, ob sich dieselbe mehr gegen den jungen Mann richtete, der eigentlich als Theologe gar nicht von solchen Dingen zu reden hatte, oder gegen das Mädchen, das den armen Teufel, der es vielleicht ganz gut meinte, so kurz abfahren ließ.
Er ging langsam an den grauen Steinen hin, bis ein anderes Bild ihn von seinen Gedanken einigermaßen ablenkte. Zwischen den Hollunderbüschen war eine grüne Lichtung, und hier kauerten einige schmutzige, bleiche Kinder, die mit großen, dunklen Augen nach dem fremden Manne hinstarrten, ohne sich weiter in ihrem Spiele stören zu lassen. Der Sonnenschein fiel auf die Gruppe, über die die blauen Fliederdolden herhingen, die Kleinen redeten mit fremdem Accent, und der Alte glaubte sich weit weg versetzt nach fernem Südland. Langsam ging er weiter, und unfern von sich sah er nun den jungen Theologen hineilen mit geröteten Wangen und brennenden Augen, dem Ausgange zu.
Gegen Abend war Vetter Martin wieder nach der Altstadt zurückgegangen und suchte den Gasthof auf, wo er Herberge genommen hatte. Es war »zum alten Ungelt« hinter der Teynkirche, deren interessante, architektonisch hervortretenden Türme ein besonders malerisches Gepräge dem Altstädtischen Ring verleihen. Als er eintrat in die Gaststube, fand er sie heute zum Johannistage besonders gefüllt, und er suchte nach einem Platze. Nahe bei einem Fenster war ein kleiner Tisch, und dort saß nur ein einziger Gast, in welchem Martin den jungen Theologen vom Beth Chajim wieder erkannte. Das Interesse, welches er an demselben nahm, ließ ihn rasch einen freien Sitz neben ihm in Beschlag nehmen. Hans Stahl dankte nur flüchtig dem Gruße des Fremden, der dann behaglich sein Pfeifchen hervorzog, es stopfte und anbrannte und nun vergnüglich seine Wölkchen in die bereits brav durchräucherte Luft paffte.
»Prächtiges Festtagswetter heute, wie?« fragte er.
»Jawohl!« stieß der andere hervor, und that einen tiefen Zug aus seinem Glase.
»Besonders angenehm auf dem alten Judenfriedhof zu genießen,« fuhr Vetter Martin gleichmütig fort, Hans Stahl aber schielte ihn von der Seite mit einem seltsam fragenden Blicke an und wurde dabei rot; er knurrte ein verlegenes: »Möglich!«
»Sie sind doch dort gewesen, wenn ich nicht ganz irre!«
»Jawohl, aber das kann Sie doch nichts kümmern!«
»Gott bewahre, junger Herr, aber darum brauchen Sie weder hitzig noch unhöflich zu werden; ich kann doch nicht dafür, daß Sie bei der jungen Dame kein Glück gehabt haben.«
»Teufel, Herr – das verbitte ich mir!« brauste der Theologe auf – »schämen Sie sich übrigens, wenn Sie gelauscht haben.«
»Habe ich – sehr unfreiwillig, aber mit großer Teilnahme für Sie, so daß Sie gar nicht in so undankbarer Weise mich anzufahren brauchen.«
»Ich brauche Ihre Teilnahme nicht!«
»Das glaube ich, daß das Ihre Meinung ist, und betreffs Ihrer Liebesgeschichte mögen Sie recht haben; so etwas muß jeder mit sich selber ausmachen, und Sie machen mir den Eindruck, als ob Sie die Willenskraft dazu hätten. Aber etwas anderes hat mich interessiert – warum haben Sie auch nicht einen Platz für Ihre Eröffnungen sich ausgesucht, der weniger dem Publikum zugänglich ist? Sehen Sie, ich bin auch einmal Theologe gewesen, aber ich habe bei Zeiten eingesehen, daß ich dazu nicht tauge, habe umgesattelt und fühle mich wohl dabei, und darum habe ich für jeden Teilnahme, Rat, und wenn's geht, Hilfe, von dem ich höre, daß er ins falsche Fahrwasser gekommen ist. Daß Sie zu allem andern besser passen, als zum Gottesgelehrten, leuchtet mir ein.«
Hans Stahl sah den Alten beinahe verdutzt an, und seltsam umgewandelt frug er:
»Mit wem habe ich die Ehre?«
»Sehen Sie, da schlagen Sie schon einen andern Ton an, und mir ist, als sollten wir noch gute Freunde werden. Im übrigen heiße ich schlechtweg Martin – der Dr. der Theologie Peter Frohwalt pflegt mich auch Vetter Martin zu nennen – und bin meines Zeichens Privatgelehrter und Weltbummler aus Vergnügen, und nun sagen Sie mir einmal ehrlich, wie Sie mit Ihrem heißen Herzen und Ihren schönheitsbegeisterten Augen unter die Kirchenväter geraten sind. Apropos, Sie haben ja nicht einmal ein geistliches Abzeichen?«
Hans Stahl hatte merkwürdiges Vertrauen fast mit einmal gewonnen zu dem wunderlichen alten Herrn mit dem verwitterten, gutmütigen Gesichte, und er brauchte gerade an diesem Tage jemanden, dem er dies Vertrauen schenken konnte. So that er denn allmählich sein junges Herz weit auf und erzählte von den Verhältnissen, welche ihn auf die theologische Laufbahn gebracht hatten, sowie zuletzt auch von der heißen Neigung, welche ihn zur Tochter Professor Holberts erfaßt hatte. Die Mitteilsamkeit schien ihm wohl zu thun, und auch der Alte hörte ihm, ruhig sein Pfeifchen rauchend, zu, nickte einigemale verständnisinnig mit dem grauen Haupte und sagte, als er schwieg:
»Da sind Sie wohl ein Sohn von dem Leinenfabrikanten Bruno Stahl in ** in der Lausitz, der früher in Görlitz lebte, und Ihre Mutter war eine geborene Wildung aus Lauban?«
Der junge Theologe starrte einige Sekunden mit weit offenen Augen und geöffneten Lippen den Alten an, ehe er dessen Fragen bejahte.
»I, sehen Sie doch, was man für wunderliche Geschichten erlebt! Das ist ja, als ob mich der liebe Herrgott gerade Ihretwegen jetzt nach Prag und ins »Alte Ungelt« geschickt hätte und nach dem alten Judenfriedhofe. Und Ihre Geschichte ist mir interessanter als die des Rabbi Löw und der[162] alten Sarah Katz zusammengenommen. Wissen Sie, Ihren Vater kenne ich, und Ihre gute Mutter habe ich gekannt mitsamt deren Familie. Wir sind einmal im Riesengebirge mit einander gereist, haben herrliche Tage verlebt, und Ihr Vater und ich, wir haben uns verwachsen wie zwei gute alte Freunde, und ich bin später auch in Görlitz gewesen. Damals hatten Sie die ersten Höschen an, und darum nehmen Sie mir's nicht übel, wenn ich Sie heute nicht wiedererkannt habe. Mit Ihrem Vater habe ich auch Briefe gewechselt, bis er nach ** übersiedelte, aber ich bin ein schlechter Briefschreiber, und so ist die Sache ins Stocken geraten. Aber nun will ich einmal das Versäumte nachholen, und Sie sollen sehen, daß ich Sie aus dem theologischen Fangeisen heraushole.«
»Auch das würde ich Ihnen ewig danken, lieber Herr –«
»Na, sagen Sie ruhig: Vetter Martin! Das bin ich gewöhnt, und ich habe meine Neffen beinahe in allen Kulturstaaten sitzen, da kommt's auf einen mehr bei meiner Erbschaft nicht an. Aber ohne Scherz: Sie sind mir um Ihres Vaters willen wie ein lieber Verwandter, und ich helfe Ihnen. Top! Und wenn wir Sie erst heraushaben aus dem Seminar, dann besuchen Sie die Kunstakademie, vorausgesetzt, daß Sie Talent haben – ich will mir morgen einmal die Dilettantenleistungen Ihres Pinsels ansehen – und wenn Sie was Rechtes sind, dann gehen Sie wieder zu Therese Holbert – –«
»Nein, Vetter Martin,« seufzte Stahl mit kläglicher Miene – »sie hat mich in einer Weise abfahren lassen, daß ich fürchten muß, es sitzt wirklich schon ein anderer im Herzen –«
»Dann lassen Sie ihn sitzen, mein Junge! Theresen giebt's noch mehr!«
»Aber nur eine Therese Holbert.«
»Darüber reden wir erst in den nächsten Kapiteln. Fürs[163] erste – haben Sie denn heute Urlaub, so lange auszubleiben?«
»Nein, ich habe mich eben in meinem Unmut hier festgesetzt, bereit, es auch auf eine Ausschließung aus dem Seminar ankommen zu lassen, nur um frei zu werden.«
»Nur ruhig' Blut, junger Freund! So geht das nicht; Sie müssen mit Ehren abgehen. Ich begleite Sie jetzt nach Hause, erzähle Ihrem Rektor, daß Sie einen guten Bekannten Ihres Vaters getroffen, und bitte für Ihre Versäumnis nachträglich um seine Entschuldigung. Und dann findet sich das Weitere!« – –
So kam Vetter Martin an diesem Tage noch einmal nach der Kleinseite herüber, und nachdem er im Wendischen Seminar glücklich seine Absicht erreicht hatte, schritt er langsam und trotz des Menschengewühls auf der Brücke doch mit einer stillen Befriedigung in der Seele wieder nach dem »Alten Ungelt« zurück.
Am nächsten Morgen holte ihn Frohwalt beizeiten ab, und nachdem sie zuerst im Kinskyschen Garten auf dem Smichow, der im ersten Frühlingsschmucke ungemein freundlich war, einige Zeit zugebracht hatten, gingen sie wieder nach der Kleinseite, um den alten Pfarrer zu besuchen. Zuvor aber gedachte Martin, sich über die künstlerische Befähigung Hans Stahls zu unterrichten, und während er Frohwalt nach der Spornergasse vorausschickte, ging er nach dem Wendischen Seminar.
Der junge Theologe erwartete ihn mit einer gewissen Aufregung; er hatte seine Zeichnungen und Malereien zusammen gesucht und legte sie nun dem Alten vor, der, behaglich in seinem Stuhl lehnend, sie aufmerksam betrachtete. Er besaß auch dafür einen geschulten Kennerblick, und Hans Stahl atmete auf, als er sagte:
»Es steckt etwas drin, und in guter Schule kann aus Ihnen etwas werden. Zum Domherrn sind Sie verdorben,[164] Hans, aber es ist zur Seligkeit nicht gerade notwendig, daß Sie die violette Halsbinde kriegen. Also es bleibt dabei: Ich lege mich bei Ihrem Vater ins Mittel, wenn's notthut, persönlich, und es wäre das erste Mal, daß ich mein Pulver umsonst verschossen hätte, wenn er nicht zur richtigen Erkenntnis der Sachlage gebracht werden könnte. Bis dahin treiben Sie noch ein Weilchen Ihre Dogmatik und Moral, denn seine Pflichten muß man unter allen Umständen thun. Jetzt Gott befohlen – ich habe noch einen Patienten zu besuchen.«
Er ging, und bald darauf trat er bei dem alten Pfarrer ein. Der fühlte sich heute seltsam wohler, und Vetter Martin ließ sich's nicht nehmen, ihn sowohl als Frohwalt für diesen Tag als seine Gäste zu betrachten. Sie aßen zusammen Mittag in einer freundlichen Restauration der Kleinseite und nachmittags mietete der Alte, weil dem Pfarrer das Gehen doch ein wenig sauer wurde, einen Wagen, und sie fuhren hinaus nach dem Baumgarten, dem Lieblingsvergnügungsorte der Prager. Die herrlichen Bäume waren freilich noch wenig belaubt, aber der Rasen und das Strauchwerk grünte, und der Lenz hatte seine duftenden Blüten ausgestreut über den schönen Flecken Erde, über dem ein herrlicher blauer Himmel sich ausspannte. Der große Restaurationsgarten war sehr besucht, die milde, warme Luft ermöglichte den Aufenthalt im Freien, eine Militärkapelle spielte fröhliche Weisen, und als der greise Kaiser Ferdinand der Gütige, zusammengebeugt, aber fortwährend grüßend und nickend in seinem mit zwei Braunen bespannten Wagen vorüberfuhr, als bei den Klängen der schönen Haydnschen Volkshymne sich alles von den Sitzen erhob, da wurde dem alten Pfarrer die Seele weit und froh, und er warf auf einige Stunden alles von sich, was ihn drückte und quälte.
Vetter Martin sah seine feuchtflimmernden Augen aufleuchten mit einem fremden Glanze des Glücks und fühlte[165] sich selber ergriffen. Er lud den alten Herrn für den Herbst in seine Heimat ein, denn für's erste gedachte er noch einige Zeit auf Geratewohl ins Bayernland und durch das Fichtelgebirge, den Rhön- und Thüringerwald zu streifen – und jener sagte freudig zu.
Es war ein Nachmittag, mit welchem alle drei, als sie abends heimkehrten, zufrieden waren, und als Vetter Martin mit der nächsten Morgenfrühe aufbrach, und mit dem Ränzel auf dem Rücken und dem derben Stocke in der Hand durch die kühlen, stillen Gassen schritt, hatte er das Bewußtsein, hier zwei Menschen glücklich gemacht zu haben, den Theologen Hans Stahl und den ehemaligen Pfarrer von Nedamitz.



Ueber der Altstadt Prags hingen dunkle Wetterwolken. Langsam und schwer waren sie über die Moldau herübergekommen, und schienen sich jetzt dicht niederzusenken über das Kloster der Kreuzherren und das alte Klementinum. Eine drückende Schwüle brütete in den Gassen, die Leute hasteten heimwärts, und auch der Schutzmann, welcher bei dem Denkmal Karls IV. stand, sah sich nach einem Obdach um, sobald das Wetter losbrechen würde. Dabei war es etwa um die zehnte Stunde vormittags.
Durch das Thor des Klementinums ging langsam mit gesenktem Kopfe ein noch junger Mann, einfach aber gut gekleidet; es war der Uhrmacher Freidank. Er bog hinter dem Thore nach links ab, wo der Eingang zum Priesterseminar war, aber ehe er die Glocke zog, schien er noch einmal mit sich zu kämpfen. Er atmete einigemale tief, hob die Hand, ließ sie sinken und hob sie aufs neue, und als jetzt die Glocke ertönte, schrak er zusammen.
Er trat nun in den Korridor, dessen Kühle wohlthuend berührte bei der Gewitterhitze in den Gassen und fragte einigermaßen zaghaft den Pförtner, ob er den Herrn[167] Dr. Frohwalt treffen könne. Dieser bejahte und wies ihm den Weg, und Freidank ging langsam, noch immer mit beengter Brust, weiter, die Treppen hinan, bis vor die bezeichnete Thür. Er pochte, und auf das »Ave!« von innen trat er ein. In demselben Augenblicke flammte der erste Blitz des losbrechenden Gewitters nieder und beleuchtete sein ohnehin bleiches Gesicht mit bläulichem Glanze, so daß Peter Frohwalt zwiefach erschrak wie vor einer Geistererscheinung und beinahe entsetzt von seinem Sitz aufsprang. Im Geroll des Donners verklang der Gruß des Eintretenden, dem es selbst unheimlich erschien, daß er hier bei Blitz und Donner ankam, und den das erschreckte und dabei doch finstere Gesicht seines geistlichen Schwagers noch mehr verschüchterte.
Frohwalt bot ihm nicht die Hand, auch nicht einen Sitz; er fragte, nachdem das Rollen verklungen, kühl und beinahe strenge:
»Was wollen Sie von mir?«
Der andere aber drehte langsam den Hut in seinen Händen, und hob nun sein treuherziges Auge auf; er sprach:
»Ich wäre nicht gekommen, Herr Doktor, wenn nicht Ihre Mutter und Marie mir Mut dazu gemacht hätten, und wenn mir's nicht besonders um die letztere zu thun wäre. Ich hatte einen Bruder, einen braven Menschen, Herr Doktor. Er hatte das Tischlerhandwerk gelernt, und da er eine wackere Braut hatte, hätte er gerne sich selbständig gemacht und geheiratet. Er hatte das Zeug dazu, sich vorwärts zu bringen, wenn er nur einmal über den Anfang hinaus war. Ich hätte ihm gerne geholfen, aber mein kleines Kapital steckt in meinem Geschäfte, und auf mein Häuschen kann ich nicht borgen, es ist noch verschuldet von meinem seligen Vater her. Er fand aber einen vermögenden Mann, der ihm achthundert Gulden vorstrecken wollte, wenn er jemanden hätte, der für ihn Bürgschaft leiste, und die habe ich denn in Gottes Namen übernommen. Mein Bruder heiratete nun, nachdem er Meister[168] geworden, und es ging recht hübsch vorwärts. Vor einigen Wochen aber hat er sich hingelegt und ist gestorben. Jetzt verlangt der Gläubiger sein Geld. Er ist zwar ein frommer Mann und geht jeden Tag in die Kirche, aber der Jammer meiner Schwägerin und ihres Kindes haben ihn eben so wenig gerührt, wie meine Bitte; er hält sich jetzt an mich und besteht auf Zahlung, sonst will er mir mein Häuschen verkaufen lassen. Fünfhundert Gulden, mein bischen Erspartes, will ich ihm geben, aber er will alles, weil der Herr Kaplan ihn gegen mich hetzt – Sie wissen ja, warum – und die dreihundert Gulden kann ich nicht aufbringen. Und da – wollte ich – bitten – ob nicht Sie vielleicht – mir, das heißt Ihrer Schwester – den fehlenden Betrag vorschießen könnten!«
Der schlichte Mann that einen tiefen Atemzug, und schaute dem jungen Priester noch immer voll in das Gesicht. Dieser aber blickte finster und ernst drein, als er erwiderte:
»Ich verstehe nicht, warum Sie zu mir kommen? – Was habe ich mit Ihnen zu thun? Zwischen uns ist keine Gemeinschaft, das sollten Sie wissen.«
»Ich komme auch nicht für mich, und ich würde es selbst ertragen, wenn mir mein Häuschen verkauft würde, aber Marie –.«
»Sie hat freiwillig sich an Sie gebunden, sie muß Ihr Los teilen!«
In Freidanks Herzen regte sich Unmut und Bitterkeit. Aber, ob ihm auch die Röte in die Wangen stieg ob der lieblosen Aeußerung, er bezwang sich doch und sagte ruhig:
»Dazu ist sie auch bereit, aber ich meinte nur, wenn ihr Böses erspart werden könnte – gerade jetzt … sie ist in gesegneten Umständen – und jede Erregung, jede Sorge …«
Frohwalt fühlte ein Unbehagen, eine Regung der Liebe rang in seiner Seele mit dem Zorn und dem Glaubenseifer, und der letztere blieb Sieger; er sprach:
»Ich habe Marie gebeten und beschworen, nicht Ihnen zu folgen und ihren Glauben zu verleugnen; ich habe ihr erklärt, daß, wenn sie es thue, keine Gemeinschaft mehr sei zwischen ihr und mir, und daß des Himmels Gerichte sie ereilen würden. Nun kommt, was ich vorausgesehen. Empfinden Sie nicht in all dem, was über Sie hereinbricht, die strafende Hand des Herrn? Und ich sollte ihm in den Arm fallen wollen, wenn er diejenigen züchtigen will, die ihn verlassen und verraten haben?«
Der Uhrmacher hatte sich hoch aufgerichtet; das sonst so ruhige Auge flammte, und die Wangen waren ihm heiß, als er mit bebenden Lippen sprach:
»Verzeih' Ihnen Gott, was Sie hier reden! Das ist Herzenshärte und Hochmut, hinter der sich Ihre Lieblosigkeit verschanzt. Ich hab' einmal einen fremden Hund mit Lebensgefahr aus dem Wasser geholt – bin ich da etwa auch dem Herrn in den Arm gefallen? – und Sie wollen Ihre einzige Schwester und deren Kind in Not und Elend treiben. Ich beneide Sie nicht um die Rolle, die Sie in diesem Augenblick spielen. Leben Sie wohl, Marie und ich, wir werden tragen, was uns der Himmel schickt, stark durch unsere Liebe, aber Ihnen wird ein Stachel bleiben von dieser Stunde, den Sie durch tausend Vaterunser nicht wegbringen!«
Mit raschen Schritten, ehe Frohwalt noch erwidern konnte, war Freidank hinausgegangen; er eilte durch die dunklen, dumpfigen Korridore, bis die Pforte sich wieder hinter ihm geschlossen hatte. Der Regen rauschte nieder, aber eine erquickende Kühle wehte den Mann an, der sie mit tiefen, gierigen Zügen einsog, und dann, unbekümmert um die dicht fallenden Tropfen durch die Gassen der böhmischen Hauptstadt gegen den Bahnhof hin schritt.
Der Doktor der Theologie Peter Frohwalt aber stand eine Weile verdutzt in der Mitte seines Zimmers; Aerger und noch ein anderes Gefühl, über das er selbst im Unklaren[170] war, erfüllte ihm die Seele und in tiefer Verstimmung trat er an das Fenster. Grau und wie nebelverhüllt war alles draußen, nur der Regen rann wie ein Schleier, und ab und zu zuckte ein Leuchten über die Stirn des Himmels. Die Worte des einfachen Mannes klangen im Herzen des jungen Priesters unaufhörlich nach, und vergebens suchte sich dieser einzureden, daß er selber recht gesprochen und gethan habe, immer wieder drängte sich etwas wie Reue zwischen seine erkünstelten Erwägungen.
Nun ließ der Regen nach und ein heller Flecken des Himmels lugte aus den zerrissenen grauen Wolken, Frohwalt aber mußte bei dem blauen Schimmer an die Augen seiner Schwester denken, die feucht und vorwurfsvoll sich nach ihm hinrichteten. Er ging mit großen Schritten in seinem Zimmer auf und ab, unruhig, bald dies, bald jenes erfassend, bis er von seinem Büchergestell wieder das kleine Buch nahm, das ihn immer anzog und abstieß zugleich, das Laienbrevier; er blätterte darin und seine Augen flogen über die Seiten, bis sie an einem Worte hängen blieben:
Er warf das Buch beinahe ärgerlich zur Seite.
»Soll ich mir von Protestanten und Abtrünnigen gute Lehren geben lassen?« murmelte er vor sich hin, aber in ihm klang doch das Wort immer wieder nach: »Es muß der Mensch das Gute thun,« und so beschloß er, gleichsam um mit seinem Gewissen sich abzufinden, nachmittags den alten Pfarrer aufzusuchen, um ihm einige verfügbare Meßgelder zu überbringen und auch mit freundlichem Worte ihm etwas Gutes zu thun.
Mit diesem guten Vorsatz ging er denn auch um die[171] dritte Nachmittagsstunde hinüber nach der Kleinseite. Bei dem Brückenturm der letzteren begegnete ihm Hans Stahl, und Frohwalt hielt einen Augenblick erstaunt auf seinem Wege an, als ihn der junge Mann grüßte. Derselbe trug einen leichten Sommeranzug, einen Strohhut mit hellem Band, und um den Hals hatte er eine bunte, flatternde Seidenschleife gebunden. In seinem Blicke lag beinahe etwas Triumphierendes, ganz gewiß aber etwas sonderbar Freudiges. Daß er nicht mehr Theologe war, war zweifellos, und dem Adjunkten fiel ein, was Professor Holbert seinerzeit über Stahl geäußert hatte.
Der Tag war nach dem Gewitter wieder heiter geworden, aber die Schwüle, die neuerdings in den Gassen lag, ließ eine Wiederkehr desselben befürchten. Frohwalt wischte sich mit dem Taschentuche den Schweiß von der Stirn und ging langsam quer über den Kleinseitner Ring nach der Spornergasse. Als er an die Thüre des Pfarrers kam, vernahm er die Stimme desselben mit einer gewissen Erregung, und er überlegte, ob er anpochen sollte.
In dem Augenblick hörte er den alten Herrn beinahe heiser vor Zorn rufen: »Hinaus mit Dir, Du Lump!« und ein höhnisches Gelächter aus einer rauhen Kehle war die Antwort, sowie einige in tschechischer Sprache hervorgestoßene Worte. Der Adjunkt hatte die Empfindung, als ob er dem Pfarrer zu Hilfe kommen müsse; er klopfte einmal kräftig an die Thüre, und trat, ohne den Bescheid darauf abzuwarten, ein.
Der alte Priester stand am Tische, die Faust geballt auf die Platte gestemmt, auf welcher auch hier der Zinnkrug nicht fehlte. Er hatte die Weste aufgeknöpft, so daß das wenig reinliche Hemd hervorsah, der Hals war entblößt, weil er, wohl der Wärme wegen, das Collare abgelegt hatte, sein Gesicht aber war gerötet, und die feuchten, schwimmenden Augen blitzten beinahe unheimlich. Nicht fern von ihm stand ein junger Mensch von zwanzig und etlichen Jahren, heruntergekommen[172] in seinem Anzuge, und von gemeinen, unangenehmen Gesichtszügen. Er schielte nach dem Eintretenden und dabei ging ein höhnisches, böses Zucken um seine Mundwinkel, der alte Pfarrer aber schien zu erschrecken, als er Frohwalt erkannte. Er dankte verlegen seinem Gruße und bat ihn, sich niederzusetzen, dann wandte er sich noch einmal zu dem andern, – und sprach mit erzwungener Ruhe: »Wir sind fertig mit einander – dort ist die Thüre!«

Der Angesprochene aber blieb stehen, und der böse Zug um den Mund und in den Augen schien sich zu verschärfen. Er sagte jetzt in deutscher Sprache:
»Nein, wir sind nicht fertig. Es ist wohl nicht so einfach, wenn man einen Bastard in die Welt gesetzt hat, zu sagen: Du gehst mich nichts an, wir sind fertig. Ich erwarte bis morgen mittag unter meiner Adresse das Geld, oder ich gehe an das Konsistorium!«
»Geh zum Teufel oder wohin Du willst!« schrie jetzt der alte Herr und erfaßte mit plötzlich erwachender Kraft den Burschen, schob ihn gegen die Thüre, riß dieselbe auf und gab ihm einen Stoß, daß er hinausflog. Während man ihn draußen ziemlich laut in tschechischer Sprache schimpfen hörte, sank der alte Mann in die Ecke seines wurmstichigen Sophas und fing laut und heftig an zu schluchzen. Frohwalt war tief erschüttert; er zog seinen Stuhl dicht zu ihm heran, legte ihm die Hand auf den Arm und sagte:
»Beruhigen Sie sich, Herr Pfarrer! – – Was bedeutet das um Gottes willen?«
Der andere bemühte sich zu beherrschen; er nahm, wie um der Erregung beizukommen, einen langen Schluck aus seinem Kruge, wischte mit dem Handrücken sich die Thränen aus dem Gesichte und rief:
»Brauchen Sie noch eine Erklärung, nachdem Sie gehört haben, was der Lump sprach?«
Während er, zu seinem Gast gewendet, redete, roch sein[173] Atem unangenehm wie nach Spirituosen, so daß sich Frohwalt halb abwendete; jener aber, halb schreiend, halb weinend fuhr fort:
»Der Bursche ist mein Sohn, mein und Barbaras Kind – was brauche ich's Ihnen zu verhehlen! Die Frucht der Sünde, und womit ich gefehlt habe, damit werde ich bestraft. Ich habe ihn ein Handwerk lernen lassen, aber er hat nirgends gut gethan, und ein Meister nach dem andern hat ihn fortgejagt. Er wird im Zuchthause sterben. Was habe ich nicht alles für ihn gethan und geopfert, Geld und Ehre – und alles umsonst!«
Er schlug die Hände vor das Gesicht und sank tiefer zusammen in seiner Ecke. Frohwalt aber fühlte sich von Widerwillen und Mitleid zugleich erfaßt. Er hatte den Eindruck, als hätte der alte Mann auch etwas zu viel getrunken, und darum sprach er, vielleicht etwas herber im Tone, als er selbst es beabsichtigt:
»Wie konnten Sie aber sich so weit vergessen mit jenem Weibe!«
Der Pfarrer sah mit dem Ausdrücke fragender Hilflosigkeit ihn an, dann lachte er bitter auf:
»So mögen Sie wohl reden, Sie sind nicht in meiner Lage gewesen. Soll ich Ihnen die Geschichte eines verfehlten Lebens erzählen? Sie ist erstaunlich einfach. Ich bin armer Leute Kind, habe unter Entbehrungen das Gymnasium besuchst und ging dann ins Seminar, weil ich sonst nicht wußte, wohin und weil meine Eltern mich hineindrängten. Damals fing mein Unglück an. Von der Stunde an, da ich ins Klementinum kam, hab' ich gefühlt, daß ich nicht zum Priester tauge, aber ich habe redlich mit mir gekämpft und gerungen und gemeint, es müsse zuletzt doch gehen und ich müßte mit der Weltlust fertig werden können. Als ich ausgeweiht war, kam ich in eine kleine Stadt. Da herrschte ein lebenslustiger Geist, und mein Pfarrer war selbst ein froher Lebemann.[174] Der nahm mich mit an den Stammtisch, wo ich mich gewöhnte, mit ihm und andern in die Nacht hinein zu trinken – meine Zeche wurde gewöhnlich bezahlt – er führte mich in Familien ein, wo es fröhlich und ausgelassen herging, und wo wir an Pfänderspielen mit Küssen und anderem uns beteiligten … und wenn ich dann in meine einsame Stube kam, wollte es mir garnicht gefallen, und der Geist der Unzufriedenheit wurde mächtiger als je zuvor. Ich hatte das Bedürfnis nach Liebe, nach Familienleben und Familienglück, und wenn ich in dem Entsagenmüssen mich recht trostlos und elend fühlte, ging ich ins Wirtshaus und trank mich in ein Vergessen und in eine falsche Lust hinein. Wenn ich einen einzigen Menschen gehabt hätte, der sich meiner angenommen, der mich über meine Schwäche weggetragen hätte! Dann kam ich nach Nedamitz, erst als Kaplan, zu einem kranken, unwirschen Pfarrer, mit dem überhaupt nicht auszukommen war, und der sich selber unglücklich fühlte in seinem Berufe, und dann war ich Administrator in einem Dorfe in der Egerer Gegend. Das war meine beste Zeit, da habe ich Botanik getrieben mit dem alten Lehrer und habe mich vom Wirtshause möglichst fern gehalten und hatte die allerbesten Vorsätze, bis seine Nichte, die Barbara, zu ihm kam auf einige Wochen. Da bin ich zuerst unruhig geworden, wenn ich sie sah, dann hatte ich wieder das Gefühl, daß ich unglücklich sei in meiner Vereinsamung und in meiner Ehelosigkeit, und ich mußte wieder trinken, um mich zu betäuben. Aber ich wollte den Teufel austreiben mit Beelzebub. Je mehr ich trank, desto begehrlicher wurden die Sinne – und damals kam ich als Pfarrer nach Nedamitz. Zu allem Unglück starb mein Freund, der alte Lehrer, seine Nichte stand allein in der Welt, und so nahm ich sie, unter dem Vorwand, sie sei eine Verwandte von mir, trotzdem sie das kanonische Alter nicht hatte, zu mir als Wirtschafterin. Nun war Feuer und Zunder beisammen, nun kam's, wie's kommen mußte und das Unglück[175] war fertig. Oft überfiel mich die Reue, aber ich hatte nicht die Kraft, das Wesen, das eigentlich mein Weib geworden, aus dem Hause zu jagen, und so suchte ich über die Seelenpein immer wieder mit dem Trinken wegzukommen. So ist eins mit dem andern geworden … und heute muß ich schwer büßen.«
Peter Frohwalt saß da mit gerunzelten Brauen; er war gekommen, dem Pfarrer etwas Gutes zu sagen und zu thun, aber er vermochte es nicht. Er sah den Zinnkrug auf dem Tische, er roch den Atem des Mannes, der sich eben erst durch die Begegnung mit seinem Sohne einigermaßen ernüchtert zu haben schien, und der Zorn über den Schwächling, den unwürdigen Priester, gewann in ihm die Oberhand. Er sprach:
»Sie können nicht verhehlen, daß Sie Ihren Schwächen zu sehr nachgegeben haben; ohne Selbstzucht geht es nicht, und zu solcher ist es auch jetzt nicht zu spät. Der erste Fehler war, daß Sie sich eingedrängt haben in den Dienst des Herrn, ohne den Beruf dazu zu haben – –«
»In der Jugend hat man nicht die Stärke, um gegen schwere Verhältnisse und äußeren Zwang sich aufzulehnen,« bemerkte der Pfarrer schüchtern.
»Dann gaben Ihnen die vier Jahre Ihres Aufenthalts im Seminar Anlaß zur Selbstprüfung, und wenn Sie Ihre Schwäche nicht bezwingen konnten, zum Austritt.«
»Aber Sie hörten ja, wie ich als Alumnus den besten Willen hatte und mit mir fertig zu werden suchte.«
»Doch Sie erlagen den kleinsten Versuchungen. Mußten Sie denn mit Ihrem ersten Pfarrer durch Dick und Dünn gehen? Konnten Sie, wenn Sie sich zu schwach fühlten, nicht Ihre Versetzung nachsuchen?«
»Sollte ich den sonst gutmütigen Mann anklagen?«
»Im Dienste des Herrn giebt es solche Rücksichten nicht;[176] er verlangt eine volle Hingabe, einen strengen Dienst. Ich begreife, daß es Sie bedrückt, wenn Sie auf Ihr Leben und Wirken zurückschauen, aber nehmen Sie mir's nicht übel, wenn ich es aufrichtig und in brüderlicher Teilnahme beklage, daß Sie die Mahnungen des Herrn auch jetzt noch nicht verstehen. Warum werfen Sie nicht diesen abscheulichen Zinnkrug, in welchem für Sie der böse Versucher sitzt, fort, warum fröhnen Sie noch immer der Schwäche des Trunkes? Sie haben ein verlorenes Leben hinter sich, aber Gebet und Enthaltsamkeit könnten Ihnen immer noch einen gewissen Seelenfrieden erwecken; soll denn auch der Abend Ihrer Tage ein verlorener sein?«
Der junge Priester hatte die Absicht, warm und herzlich zu sprechen, aber er sprach hart Und streng. Der alte Pfarrer saß da, die weitgeöffneten Augen ihm zugewendet, aus seinem Antlitz war die Röte gewichen, und mit bläulichen Lippen stammelte er:
»Sie haben recht – Sie haben recht – ein verlorenes Leben!«
Frohwalt erschrak vor seinem Anblick und vor diesem Worte, und er sagte wesentlich milder:
»Noch ist es nicht ganz zu spät! Raffen Sie sich auf, Sie haben ja mehr Gnadenmittel als viele andere. Sie sind selbst berufen, zu binden und zu lösen, an Gottes Statt den Sündern ihre Schuld zu vergeben und können täglich zum Tisch des Herrn treten und den lebendigen, persönlichen Gott in Ihren priesterlichen Händen halten; sollte ein solches Bewußtsein Ihnen nicht die Schlacken abthun helfen, die an Ihnen haften? Zum Gutwerden ist es für keinen zu spät. Weisen Sie dem Burschen, der Sie aussaugt, die Thüre; wenn Sie ihm Erziehung und Lehre haben angedeihen lassen, wie ein Vater seinem Sohne, so haben Sie alles gethan, was er verlangen darf; was er Ihnen an Schimpf und Schande anthut, das nehmen Sie hin als eine Buße. Und dann werfen[177] Sie dies dickbäuchige zinnerne Ungeheuer fort, das ich schon in Nedamitz hassen gelernt habe!«
Der alte Mann saß jetzt ganz zusammengesunken auf seinem Sitze, nickte gleich einer Holzpuppe mit dem Kopfe und wiederholte auch jetzt nur tonlos:
»Ein verlorenes Leben – ein verlorenes Leben!«
Frohwalt schied endlich von ihm in tiefer Verstimmung, und da er über die Brücke zurückging, hingen die Wetterwolken bereits schwer wieder herein über die Kleinseite, und der Wind wirbelte den Staub hinter ihm drein. Er wäre aber noch erregter gewesen, wenn er den Mann hätte sehen können, den er soeben verlassen hatte.
Der alte Priester hatte sich erhoben; mit schlotternden Knieen wankte er durch die Stube, rang die Hände und sagte nur immer wieder: »Ein verlorenes Leben!« Mit einmal blieb er vor dem Tische stehen, erfaßte den Krug, welcher dort stand, mit beiden Händen, umklammerte ihn fest und schleuderte ihn mit wütender Geberde zu Boden; dann trat er mit den Füßen darauf herum, daß das Zinn sich verbog zu einer schier unförmlichen Masse, die von dem Reste des Bieres benetzt war. Nun eilte er gegen das Fenster, sah hinaus nach dem Stückchen bleigrauen Himmels, welches er erblicken konnte, und preßte den Kopf gegen die Scheibe, bis ein grell aufzuckender Blitz ihn zurückschreckte. Und während das Wetter niederging, und der Donner immer aufs neue gewaltig rollte, rannte er unstät in dem kleinen, schwülen Raume hin und her.
Das trieb er bis an den Abend, dann suchte er Papier und Schreibzeug, setzte sich an den Tisch und begann zu schreiben. Es waren zwei Briefe, die er noch einmal durchlas, ehe er sie in Umschläge packte und versiegelte. Dann setzte er mit heftig zitternder Hand die Adressen darauf, eine an seinen Sohn, die andere an den Doktor der Theologie Peter Frohwalt.
Als auch das geschehen war, lief ein Beben wie ein Schauer durch seinen ganzen Leib, er hatte das Gefühl heftigen Frostes, und seine Zähne schlugen gegen einander. Er begann wieder auf und ab zu rennen, bis die Dämmerung sich durch den kleinen Raum auszubreiten anfing. Vor seinem Spiegel blieb er einen Augenblick stehen; es war ein bescheidenes, trübes Glas, wie er es benutzte beim Rasieren und stand auf zwei halbmorschen Holzfüßen über einem Kästchen, in welchem er Streichriemen und Rasiermesser hatte. Aus dem Spiegel sah ihm ein fahles, verzerrtes Gesicht entgegen, wie das eines Wahnsinnigen, Verzweifelnden.
»Ein verlorenes Leben!«
Er lachte gellend einmal auf, erschrak vor dem Laute und wankte von dem Bilde fort, das sich ihm geboten. Bei einem Stuhle am Fenster kniete er nieder, schlug die eiskalten Hände gegen das heiße Gesicht und wollte beten, aber er konnte nicht, der Engel des Herrn hatte ihn verlassen …
Als am andern Morgen ihm die Wirtin den Kaffee bringen wollte zur gewohnten Zeit, und bei ihm eintrat, schrie sie laut auf und ließ das Geschirr klirrend zur Erde fallen. In einer Blutlache neben dem zerbrochenen Bierkruge lag der alte Mann mit dem blassen, fahlen Gesichte, entsetzlich anzuschauen, und ein beschmutztes Rasiermesser neben ihm; auf dem Tische aber fand man die beiden Briefe – er hatte sich die Kehle durchgeschnitten.
Als Frohwalt mit dem an ihn gerichteten Schreiben zugleich die furchtbare Kunde erhielt, wich alles Blut aus seinem Antlitz, ein Schwindel erfaßte ihn und er fürchtete ohnmächtig zu werden. Mit zitternden Fingern riß er dann den Umschlag des Briefes ab und las mit beengter Brust:
Hochwürdiger Herr Doktor!
Sie haben Recht – es ist ein verlorenes Leben, und was verloren ist, ist vorbei, da hilft keine Flickarbeit mehr. Ich bin körperlich so elend, daß ich keine Widerstandskraft[179] mehr habe gegen meine Schwächen und kein anderes Mittel mehr weiß, um nicht zu sündigen, als zu sterben. Den Zinnkrug habe ich vorher vernichtet. Verwerfen Sie mich nicht ganz und beten Sie ein Vaterunser für mich. Ich befehle mich der Gnade Gottes, auch wenn mein Leben ein verlorenes war – er ist ja der Allgütige.
P. Schaffran.
Der Brief entsank den Händen des Adjunkten; er selbst aber lehnte wie gebrochen in seinem Sitze. Sein innerstes Wesen war gut, und weil er nicht ein zorniger Eiferer von Herzen war, sondern nur seinem Berufe eine gewisse Strenge schuldig zu sein glaubte, so brach ihn dies Ereignis zusammen. Er dachte mit Entsetzen daran, daß es sein Wort vom »verlorenen Leben« war, das den Unseligen zu der fürchterlichen That getrieben hatte, und ihn faßte ein Grauen vor sich selbst. Wer hatte ihn denn zum harten Richter bestellt über den alten, schwachen Mann, dem Liebe und Güte not that, nicht aber strenges, kaltes Eifern? – Auf seiner Seele lag es wie ein Mord, den er begangen hatte, und er suchte vergebens Ruhe im Gebete, Zerstreuung in der Arbeit. Er fand weder Sammlung noch Frieden.
Am Nachmittage ging er bleich und verstört nach der Neustadt hinüber; er mußte seine Seele erleichtern vor einem gewissenhaften und strengen Beichtiger, er mußte aus einem Munde, der ihm wert war, erfahren, ob er sich schuldig fühlen müsse, und wie er in diesem Falle zu büßen habe. Auf dem weiten, freundlichen Karlsplatze befindet sich das Kollegium der Väter der Gesellschaft Jesu bei der Kirche des hl. Ignazius von Loyola. Dort zog er die Glocke und fragte nach einem der Priester. Er traf ihn daheim und bat, ihm sein Herz ausschütten zu dürfen.
Der Jesuit, ein mittelgroßer, hagerer Mann, mit schlichtem grauen Haar, und grauen Augen, die scharf und klar dem Adjunkten in die Seele hinabzuschauen schienen,[180] empfing ihn in seinem einfachen Gemache mit ruhiger Freundlichkeit, und Frohwalt beichtete von dem alten Pfarrer, und was er seit gestern mit demselben erlebt. Als er geendet, sagte der Jünger Loyolas mit ruhiger Stimme:
»Sie haben sich keine Anklage zu machen, mein Bruder. Sie haben Gutes gewollt, und das sieht der Herr allein an; jener Unselige aber war aus der Gnade gefallen, und das Gericht des Herrn ist über ihn gekommen; der Allerhöchste hat Sie nur zu seinem Werkzeuge gewählt.«
So sprach er noch eine Weile, wies auf Stellen aus den Kirchenvätern hin, und that dies alles so kühl und bestimmt, so überlegen und überzeugend, daß Frohwalt fühlte, wie er ruhiger ward.
Aber die Wirkung war nicht nachhaltig. Es war eine seltsame Fügung, daß er, daheim angekommen, ein lateinisches Buch aufschlug und gerade dort eine Stelle fand, wo der Jesuitenpater Laymann sagt: »Ein Doktor, welcher befragt wird, kann einen Rat geben, nicht allein, der seiner Meinung nach wahrscheinlich, sondern der auch seiner Meinung entgegen ist, wenn er von andern für wahrscheinlich gehalten wird und wenn diese Meinung, welche der seinigen entgegen ist, demjenigen, welcher ihn um Rat frägt, günstiger und angenehmer wäre. Ja, ich sage mehr, daß es nicht unrecht sein würde, ihm einen solchen Rat zu erteilen, wenn er auch selbst versichert wäre, daß er allerdings falsch ist.«
Was war nach solchen Grundsätzen von den Trostworten des Jesuitenpaters zu halten? – Hier mußte das eigene Gewissen zuletzt der beste Ratgeber sein, und das sprach Frohwalt nicht frei von einer gewissen Lieblosigkeit und Härte, und das Bild des alten Pfarrers trat immer wieder wie ein stummer Ankläger vor seine Seele.
Er hatte eine fürchterliche, qualvolle Nacht, in welcher der Schlaf ihn floh, in welcher er an Vetter Martin dachte, der es verstanden hatte, auch dem alten, verkommenen Priester[181] freundliche Seiten abzugewinnen, und dem er nicht wagen würde, mitzuteilen, wie er zu dem Pfarrer gesprochen hatte. Und gerade der letztere Umstand ließ ihn fühlen, daß er ein Unrecht begangen hatte, das er nicht einmal mehr gut machen konnte. Aber eine Lehre wollte er wenigstens aus dem fürchterlichen Vorgange ziehen. Er wollte in ähnlichen Fällen mehr dem Menschen, als dem katholischen Priester gehorchen.
Als er nach wenigem Schlafe unerquickt am andern Morgen erwachte, war sein erster Gang nach der böhmischen Sparkasse, wo er ein kleines Sümmchen – Erträgnisse seiner litterarischen Thätigkeit – niedergelegt hatte. Er ließ sich dreihundert Gulden auszahlen. Die packte er daheim in einen Umschlag, schrieb dazu einige Zeilen, und schickte sie an seine Mutter. Sie sollte das Geld Freidank übergeben unter welchem Vorwande immer, nur ihn sollte sie nicht nennen.
Als er den Brief bei der Post aufgegeben hatte, und heimging, überkam ihn seit Stunden wieder einmal ein Gefühl innerer Ruhe; er hatte die Empfindung, wenigstens nach einer Seite hin eine Lieblosigkeit wieder gut gemacht zu haben, und ihm ging das schöne Gedicht Ferdinand Freiligraths durch den Sinn:



In der kleinen schlichten Klosterzelle zu St. Josef, welche Severin bewohnte, saß dieser im Gespräche mit dem Alumnus Vogel beisammen, als es kurz und hastig an die Thür klopfte und Hans Stahl hereintrat. Er trug denselben Anzug, in welchem er bereits die Aufmerksamkeit Frohwalts auf sich gelenkt hatte, und welchen auch die beiden Anwesenden mit Verwunderung und Staunen bemerkten.
»Et vox in faucibus haesit – und sie konnten das Maul nicht aufthun!« rief lachend der Extheologe anstatt eines Grußes – »na, wie paßt mir denn die neue Kluft, he?«
Der Kapuziner fand zuerst das Wort.
»Ja, sind Sie's denn wirklich, Stahl?«
»Leibhaftig, Hochwürden – und ich habe die Anwartschaft auf das Sakrament der Priesterweihe, da es zur Seligkeit nicht unumgänglich notwendig ist, aufgegeben.«
Er hatte sich in einem Stuhle niedergelassen und zog sein Zigarrenetui hervor:
»Ist's gestattet, in dieser profanen Weise hier die fromme Luft zu verderben?«
Severin reichte ihm ein Streichholz, und nun kam erst Vogel dazu, zu fragen:
»Ja, sagen Sie um's Himmelswillen, wie ist das gekommen?«
»Ja, wie ist das gekommen?« – Hans Stahl erzählte kurz und bündig, aber mit einer gewissen Begeisterung von seinem Nothelfer. Dieser Vetter Martin! Er hatte wirklich seine Absicht durchgesetzt, und zwar in Person. Er hatte, anstatt nach Thüringen zu wandern, seinen Stab mehr gegen Osten gewendet, war in die Lausitz gegangen, und eines schönen Tags bei seinem Bekannten vom Riesengebirge eingetreten. Und nun entfaltete er seine ganze prächtige und unwiderstehliche Beredsamkeit und wußte selbst die fromme Frau des Hauses so geschickt bei ihren schwachen Seiten zu fassen, daß auch sie nicht länger widerstrebte, Hans aus dem Seminar gehen zu lassen, damit er sich der Kunst widme; nur hatte sie den Wunsch, daß er der Kirche auch als Maler diene und sich besonders religiöse Stoffe wähle. So war dieser frei geworden und besuchte bereits seit zwei Tagen die Kunstakademie.
Das erzählte er mit ergötzlichem Humor und schloß:
»Trotzdem hoffe ich, daß wir Freunde bleiben, denn es ist immer hübsch, wenn man mit den Vertretern der Kirche auf gutem Fuße steht.«
»Weiß es denn schon Professor Holbert?« fragte Severin.
»Nein, aber ich gehe noch heute zu ihm, um mich als angehenden Künstler vorzustellen – aber Ihr sitzt ja hier in gelehrten Studien, ich habe wohl gestört?«
»Ja, Severin sucht mir eben aus der Kirchengeschichte den Nachweis zu liefern, daß es gar nicht möglich sei, einen Glaubenssatz von der Unfehlbarkeit des Papstes aufzustellen,« sagte Vogel.
»Die Geschichte mit dem neuen Konzil macht Euch wohl die Köpfe warm?« sprach Stahl – »da bin ich doppelt froh, daß ich aus der Gottesgelahrtheit heraus bin, und ruhig als[184] gläubiger Laie abwarten kann, bis es heißen wird: Roma locuta est!« (Rom hat gesprochen.)
»Das ist's eben, was es in diesem Falle nicht heißen darf. Nicht, daß Rom gesprochen hat – darauf kommt es nicht an – die Kirche muß ihre Stimme abgeben, und Kirchenfürsten und Gelehrte sind jetzt schon klar, daß ein solcher Glaubenssatz eine Unmöglichkeit ist,« bemerkte Severin.
»Man würde aber doch von Rom aus nicht die Absicht haben, denselben aufzustellen, wenn nicht ausreichende Gründe dazu vorhanden wären« – erwiderte der Alumnus.
»Jesuiteneinflüsse,« brummte der Extheologe.
»Da kann Stahl recht haben,« sprach der Kapuziner, »ich kann mir nicht helfen, ich liebe, wohl auch auf Grund meiner kirchengeschichtlichen Studien, die Gesellschaft Jesu nicht, denn sie hat nicht immer das Beste der Kirche erreicht, aber ich meine doch, daß sie nicht über die Köpfe der Kirchenfürsten hinweg etwas durchsetzen kann, und in den Kreisen der letzteren scheint keine Neigung für die Neuerung vorhanden zu sein.«
»Professor Meyer soll wenigstens im Kollegium sich ganz entschieden gegen die Unfehlbarkeit ausgesprochen haben, und er weiß jedenfalls, daß er damit auch im Sinne unseres Kardinals Schwarzenberg spricht, aber trotz alledem: Die Frage ist: Was bleibt dann übrig, wenn der Glaubenssatz doch beschlossen wird?« sprach wieder Vogel, und Hans Stahl brummte abermals: »Unterducken!«
»Nein, das glaube ich nicht« – sagte Severin mit einer gewissen Erregung – »dann führt's zur Kirchenspaltung, denn was bis heute nach allen Ergebnissen der Wissenschaft und Moral unmöglich ist, kann morgen nicht als wirklich angenommen werden von Männern, die als charakterfest gelten, und unfehlbar ist der Papst niemals gewesen, das beweist die Kirchengeschichte häufig genug, ja gerade die Geschichte des Jesuitenordens giebt dafür ein schlagendes Beispiel. Im[185] Jahre 1759 hat Papst Clemens XIII. in einer Bulle die Jesuiten als die frömmsten und uneigennützigsten Menschen hingestellt, und zehn Jahre später hat sein Nachfolger Clemens XIV. gleichfalls in einer Bulle den Orden aufgehoben, weil er den Frieden der Welt störe. Und beide Päpste müßten unfehlbar gewesen sein, denn ein solcher Glaubenssatz muß rückwirkend sein. Und was soll man antworten, wenn die Gegner der Kirche hohnlachend hinweisen auf einen Fall wie jenen mit dem Papste Vigilius? Die Geschichte der Päpste ist in jener älteren Zeit ohnehin nicht sehr sauber, so daß es wahrlich nicht notthut, durch solche Neuerungen die Aufmerksamkeit besonders darauf hinzulenken.«
»Was war's denn mit dem Papste Vigilius?« fragte Stahl; »man muß, wenn man wohlfeil dazukommen kann, sein Wissen auch in solchen Fragen zu bereichern suchen.«
»Er war der Nachfolger des heiligen Silverius – –«
»Halt einmal, hier weiß ich – glaube ich – auch etwas!« rief Stahl; – »war der heilige Silverius nicht der leibliche Sohn seines Vorgängers auf dem Stuhle Petri, des heiligen Hormisdas?«
»Jawohl. Silverius wurde auf unerwiesene Anklagen des Priesters Vigilius hin abgesetzt und in eine öde Gegend verbannt, wo er nahezu vor Hunger starb; sein Verleumder aber wurde sein Nachfolger. Er ließ sich unglücklicher Weise später in theologische Streitigkeiten ein, wobei er die Unfehlbarkeit sehr wohl hätte brauchen können, aber er hatte sie zweifellos nicht. Denn als er gezwungen wurde, sich nochmals vor einem Konzil zu verantworten, das in Konstantinopel stattfand, erklärte er selbst, er habe geirrt und sei ein Werkzeug des Teufels gewesen.«
»Na, Kinder, das genügt mir, und nun habe ich wegen der Unfehlbarkeit keine weiteren Bedenken; Eure theologische Gelehrsamkeit aber wird mir ungelehrtem Menschenkinde unheimlich, ich gehe!«
Hans Stahl erhob sich, legte seine Zigarre beiseite, und nach einigen Scherzworten und einer Einladung, ihn in seinem »Atelier« zu besuchen, ging er davon.
Die Frage wegen des Konzils und der Unfehlbarkeit des Papstes war eine brennende geworden, und die Gemüter maßgebender Kreise waren davon noch viel mehr erregt, als die der Alumnen. Der Kardinal Schwarzenberg hatte wiederholt mit seinen Theologen Rücksprache gepflogen, und es war ihm zu fester Ueberzeugung geworden, daß man den Versuch, den neuen Glaubenssatz aufzustellen, mit allen Mitteln bekämpfen müsse, und dazu war er auch ernstlich entschlossen. Fürs Erste hielt er Umschau nach gelehrten Helfern, die ihn nach der ewigen Stadt begleiten sollten, und die vielseitigen rühmenden Empfehlungen, welche er über Peter Frohwalt gehört, richteten seine Aufmerksamkeit auch auf diesen, und so kam es, daß der junge Doktor der Theologie und Adjunkt an der theologischen Fakultät eines Morgens durch einen fürsterzbischöflichen Diener zu seiner Eminenz befohlen wurde.
Einigermaßen aufgeregt folgte er der Aufforderung und fuhr nach dem Hradschin. Der Kirchenfürst empfing ihn diesmal noch leutseliger als das erste Mal und bot ihm einen Sitz an. Sein Auge lag einige Sekunden mit forschender Ruhe auf dem Antlitz des jungen Priesters, und die geistvolle Frische, die aus demselben redete, der klare Blick des blauen Auges, das sich vor dem seinen keine Sekunde senkte, gefiel ihm; ziemlich unvermittelt fragte er:
»Haben Sie sich bereits ein Urteil gebildet in der schwebenden Frage der päpstlichen Unfehlbarkeit?«
»Eminenz, ich habe mich damit beschäftigt vom Standpunkte meiner Wissenschaft, aber ich wage nicht, ein Urteil auszusprechen, bevor nicht überlegene Männer sich geäußert haben.«
»Die Hauptsache bleibt die Redlichkeit der Forschung und der gute Wille, der Kirche zu dienen.«
»Daß ich diese beiden besitze, glaube ich ohne Ueberhebung versichern zu dürfen.«
»Das habe ich bei Ihnen vorausgesetzt, und ich habe Sie deshalb rufen lassen. Man hat mir Ihre Tüchtigkeit und Ihren kirchlichen Sinn zugleich gerühmt, und ich wünsche darum, daß Sie mich nach Rom zum Konzil begleiten; eine geeignete Beschäftigung werde ich für Sie finden. Sind Sie des Italienischen mächtig?«
Eine heiße Blutwelle schoß Frohwalt nach dem Kopfe, die Mitteilung kam ihm zu unerwartet und öffnete ihm mit einmal einen weiten, herrlichen Ausblick.
Er wußte kaum Worte zu finden; endlich stammelte er:
»Ich bin erdrückt von der Gnade und Ehre, Eminenz, und was nur immer meine schwachen Kräfte vermögen …, das Italienische hoffe ich bei einiger Uebung beherrschen zu können, ich habe mich schon lange damit beschäftigt …«
Ein freundliches Lächeln spielte um die Lippen des Kardinals, dem die Ueberraschung des jungen Priesters offenbar Freude machte; er sprach:
»Das ist ja schön, und ich hoffe, daß wir zum Segen unserer heiligen Kirche nach der ewigen Stadt gehen werden. Das Weitere werden Sie noch erfahren, auch empfehle ich Ihnen, sich mit Herrn Professor Meyer ins Einvernehmen zu setzen, welcher mich gleichfalls begleiten wird.«
Peter Frohwalt war entlassen, aber vor dem Thore des Palastes stand er noch eine Weile wie ein Träumer und starrte um sich. Klarer Himmel lag über ihm, in den Bäumen der Domherrnallee rauschte es leise, und in der Brust fühlte er wie das Klingen einer Glocke, die mit jeder Schwingung sagte: »Nach Rom! Nach Rom!«
Eben als er langsam nach der Kleinseite hinabsteigen wollte, kam aus der Gegend von Strahow her Professor[188] Meyer. Der Adjunkt ging auf ihn zu, grüßte und teilte ihm, noch immer in Erregung, mit, was soeben geschehen war. Das glänzende, glatte Antlitz des anderen war umspielt von einem freundlichen Lächeln; ihm war die Kunde offenbar nicht neu, und nun gingen sie selbander langsam hinab durch die steile Spornergasse. Frohwalt lag daran, aus dem Munde des angesehenen Theologen eine Meinung zu hören über seine Auffassung der Unfehlbarkeit, und mit seiner gewöhnlichen Ruhe und in schlichter, klarer Weise sprach dieser aus, was er seinerzeit schon dem Kardinal gegenüber geäußert hatte: Ein solcher Glaubenssatz würde zur Beunruhigung der Gemüter beitragen und sei vom Standpunkte der Moral wie der Kirchengeschichte schwer anfechtbar.
Beim Klementinum schieden sie von einander, und Frohwalt, noch immer erregt von der Unfehlbarkeitsfrage, wie von der ehrenvollen Aufforderung, schritt durch den Korridor des Seminars. Da sah er den Alumnus Vogel, und in der Freude seines vollen Herzens, das nach Mitteilung drängte an einen, von dem er wußte, daß er ihn lieb habe, rief er ihn heran und sagte:
»Vogel, ich werde mit dem Herrn Kardinal nach Rom reisen zum Konzil!«
Der Seminarist sah mit einem geradezu bewundernden Blicke zu seinem Landsmann auf, und wünschte ihm Glück zu solcher Auszeichnung. Dann aber setzte er beinahe schüchtern hinzu:
»Meinen Sie, Herr Doktor, daß man den Glaubenssatz aufstellen wird?«
»Daran ist kaum zu denken; es widerspricht nach den berufensten Meinungen der Lehre der Kirche, der Kirchengeschichte und dem kanonischen Recht. Die Bischöfe, zumal die deutschen, werden niemals zustimmen.«
Mit dieser bestimmten Versicherung verließ Frohwalt den Alumnus und trat in sein Zimmer, wo er mit großen[189] Schritten auf- und abging, um einigermaßen ruhiger zu werden. Dabei überkam ihn beinahe ein Unbehagen über den zuversichtlichen Ton, in welchem er zu Vogel gesprochen hatte, und er beschloß, nachmittags zu Professor Holbert zu gehen, und auch die Meinung dieses ausgezeichneten und wahrhaft kirchlich gesinnten Mannes zu hören.
Diesen Vorsatz führte er auch aus, und sobald es das Gesetz des Anstands gestattete, machte er sich auf nach der Zeltnergasse. Therese empfing ihn, so heiter lächelnd, ja fast strahlend, daß ihm erst diesmal die Schönheit des Mädchens auffiel, und sie führte ihn in das Arbeitszimmer ihres Vaters.
Der Professor saß an seinem Schreibtische in dem weiten, freundlichen Raume, welcher seine Bestimmung bis in die Einzelheiten hinein nicht verleugnete. Er empfing den Adjunkten herzlich und unterbrach dessen Entschuldigung wegen der Störung in liebenswürdigster Weise. Er setzte sich neben ihn auf das Sopha und Frohwalt berichtete, was ihn herführte, und bat um seine Anschauung in der schwebenden Frage.
Dr. Holbert wurde ernst.
»Mein lieber Herr Doktor! Ich gönne Ihnen von Herzen, daß Sie die ewige Stadt sehen, aber, aufrichtig gestanden, hätte ich eine andere Veranlassung dazu gewünscht. Ich fürchte, Sie werden wenig Freuden dort erleben, um so mehr aber Enttäuschungen. Dieses Konzil wird der Kirche keinen Segen bringen, und was man dabei in Szene setzen will, ist mehr als bedenklich. Sie wollen meine ehrliche Meinung, und, wenn ich Sie recht verstehe, vor allem jene des Kirchenrechts-Lehrers. Nun, da sage ich kurz und bündig: Ein Glaubenssatz von der Unfehlbarkeit wäre geradezu ein Frevel. Was ist dann überhaupt noch Kirchenrecht, wenn der Papst unfehlbar ist? Es verliert alle und jede Festigkeit, denn das Oberhaupt der Kirche kann nach Belieben jeden[190] durch die Ueberlieferung geheiligten Satz desselben vernichten, jeden die Kirchenzucht betreffenden neu einführen. Er kann beliebig jede Diözeseneinteilung aufheben, alle Benefizien beseitigen, Ehehindernisse nach Gutdünken schaffen und verwerfen, jedes Recht des einzelnen Bischofs aufheben, nach Belieben eingreifen in die heiligsten Verhältnisse der Ehe, der Kindererziehung, in die Ausübung der Sakramente, so daß man ohne weiteres behaupten darf, daß es unter einem solchen Glaubenssatze in der Kirche überhaupt kein eigentliches Recht mehr gebe, sondern eine Herrschaft der reinen Politik. Wohin das führen sollte, ist ersichtlich. Dem Papste gegenüber gäbe es kein Recht eines Bischofs oder Erzbischofs mehr, derselbe urteilte in allem ganz wie es ihm beliebte, und wehe dem Kirchenfürsten, der nun nicht ganz mehr so tanzen wollte, wie von Rom aus gepfiffen würde. Lüge, Verleumdung und Angeberei gerade gegen die besten, ehrenwertesten Bischöfe käme an die Tagesordnung, die schmutzigste, ultramontane Presse, sobald sie nur dem Papste zu schmeicheln verstünde, wäre oben auf … ach, und in dogmatischer Hinsicht selbst – welch ein trostloser Gedanke für das gläubige Gemüt, daß es unter diesem neuen Glaubenssatze überhaupt feste Glaubenslehren nicht mehr gäbe. Bis jetzt wußte der gläubige Katholik – und das konnte ihm eine schöne Beruhigung gewähren – daß nur das gelehrt werden dürfe, was aus der Bibel und den Kirchenvätern als immerwährender Glaube in der Kirche vorhanden war, und nun sollte auf das Gebot des Papstes hin alles Beliebige zum Glaubenssatze gemacht werden können?«
»Aber so weit würde das doch nicht gehen – von allem Beliebigen könnte doch wohl nicht die Rede sein,« wendete Frohwalt etwas zaghaft ein.
»Und weshalb nicht? Warum sollte der Papst nicht die konstitutionelle Staatsverfassung, die Parität und anderes von seinem Stuhle aus als ketzerisch erklären? Betrachten[191] Sie doch den Syllabus und die Encyklika, und bedenken Sie, daß, wenn der Papst für unfehlbar erklärt wird, auch alle seine Erlasse, von Anfang seiner Regierung an unfehlbar und darum unabänderlich sein müssen. Ich weiß nicht, welchen Standpunkt Sie einnehmen, ich bin duldsam auch gegen Andersgläubige und sehe gerade darin das Wesen des wahren Christentums; ich würde mich, falls die Unfehlbarkeit zum Glaubenssatze würde, trotz meiner kirchlichen Gesinnungen als unter dem Banne betrachten müssen, denn Nummer siebzehn des Syllabus erklärt es für einen Irrtum, daß man hoffen dürfe, daß auch Andersgläubige die ewige Seligkeit erlangen können. Ich habe einen lieben Freund, seine Frau ist protestantisch – ein prächtiges Weib – und ich sollte annehmen müssen, daß der Mann alle Hoffnung darauf, daß seine Frau die ewige Seligkeit erlange, aufgeben müsse? – Das ist nach meiner innersten Ueberzeugung Gotteslästerung! Sie kennen ja auch den Syllabus, und ich glaube, es genügt dieser Hinweis.«
Frohwalt wurde es einigermaßen unbehaglich. Er schätzte Dr. Holbert ganz außerordentlich, und empfand beinahe etwas wie Beschämung, als er diesen von Duldung reden hörte. Er hatte nicht den Mut, einzugestehen, daß er gerade den erwähnten Passus des Syllabus ganz besonders hoch gehalten und geradezu bethätigt hatte. Er zwang sich beinahe zu der Frage:
»Und welchen Zweck sollte man mit dem neuen Glaubenssatze eigentlich anstreben?«
»Aber, mein lieber Herr Doktor, das ist ja sonnenklar; man will die unbeschränkte kirchliche Macht damit feststellen.«
»Sollte man nicht einfach bemüht sein, das in den Augen der Welt einigermaßen erschütterte Ansehen der Kirche wieder herzustellen?«
Dr. Holbert zuckte die Achseln.
»Ich zweifle nicht, daß man dies als Beweggrund betonen[192] wird, um die Sache unverfänglicher erscheinen zu lassen. Sehen wir aber genauer zu, wo das Ansehen der Kirche am meisten gesunken ist, so zeigt es sich, daß es da geschah, wo man es am stärksten betonte, in den strengkatholischen Staaten, in welchen eine unbeschränkte Regierungsgewalt mit dem Jesuitismus Hand in Hand gegangen ist. Und wohin das jesuitische Erziehungssystem geführt hat, ist den sachlich Urteilenden nicht unklar. Eine Fülle von Aeußerlichkeiten in Wissenschaft und religiösem Wandel ist dabei zu Tage gekommen. Prüfen Sie doch die Jesuitenzöglinge auf ihre Gründlichkeit und vor allem auf ihre wissenschaftliche Unbefangenheit, und Sie werden Wunder erleben. Ich weiß es aus Erfahrung. Die ganze Erziehung arbeitet lediglich nach der Schablone, und wie die Wissenschaft nur rein äußerlich angeeignet wird, so ist es auch mit dem Glauben. Auf beiden Gebieten ist darum eine bedauerliche, aber geflissentlich großgezogene Unselbständigkeit vorhanden. Das können Sie bei jeder Mission sehen. Die Leute sind wie weiches Wachs in den Händen der Jesuitenprediger, drängen sich zu den Beichtstühlen, zerfließen in Thränen, und im nächsten Augenblick begehen sie die alte Sünde wieder, um am andern Tage wieder scheinbar reuevoll vor dem Missionar auf die Kniee zu fallen. Glauben Sie mir, die Sittenlosigkeit, die ohne Zweifel zumal in den romanischen Ländern vorhanden ist, ist die Folge der durch dieses System großgezogenen rein äußerlichen Werkheiligkeit, bei welcher der Mensch noch überdies in ununterbrochener Angst lebt, daß er nur nicht eines der Gebote übertrete. Und darin sehen deshalb Tausende ihre ganze religiöse, kirchliche Lebensaufgabe, während ihr Gottesdienst ein Lippengebet, ihre Buße die mindest einmalige jährliche Beichte ist, und das genügt, wenn sie im übrigen nur das Ansehen der Kirche, richtiger das des Pfarrers, Bischofs und so weiter gebührend anerkennen und sich vor ihm demütig beugen.«
»Sie malen mit düsteren Farben, Herr Professor.«
»Ich male nach der Natur, mein lieber Herr Doktor, und ich wollte, ich könnte etwas Freundlicheres auf der Palette haben. Ihnen scheint es düster, weil Sie – und Sie dürfen mir die Aeußerung nicht übel nehmen – infolge Ihrer ganzen theologischen Erziehung nicht unbefangen sind, ich aber lasse mich nicht beeinflussen von irgend welchem Standesvorurteil, und dabei finde ich bei größtem Wohlwollen für die Kirche und ihre Priester, bei treuester Anhänglichkeit an dieselbe, die Gebrechen leichter heraus.«
»Sie sind also kein Freund des Jesuitenordens?«
»Ich kann mich für ihn und seine Grundsätze nicht erwärmen. Sie beurteilen ihn nach den Vertretern, welche Sie hier persönlich kennen gelernt haben und nach dem Umgang mit ihnen, und ich gebe Ihnen gern zu, daß man mit einem P. Klinkowström und andern sehr gut verkehren kann. Die Predigten des Erwähnten sind zudem geistvolle Feuilletons, die aber, wenn Sie ganz ehrlich sein wollen, zwar angenehm unterhalten, auch eine geistige Anregung bieten – erbauen, in tiefster Seele erfassen, hinausheben über das Zeitliche können sie nicht – vielleicht sollen sie es auch nicht, denn man hat Rücksicht zu nehmen auf das Publikum, und dies vergißt der Jesuitismus nie. Doch um auf unsern eigentlichen Gesprächsstoff und den Zusammenhang mit diesem zurückzukommen: Meinen Sie, daß Papst Pius IX. jemals von selbst auf den Gedanken gekommen wäre, die Unfehlbarkeit zum Glaubenssatz erheben zu lassen, wenn nicht die Jesuiten ihn darauf gebracht hätten? – Sie sind es, die den schwachen Greis völlig in der Hand haben, und es ist zuletzt nicht die Macht des päpstlichen Stuhles, sondern ihre eigene, wofür sie arbeiten. Und das ist für mich gleichfalls ein Grund, mich gegen den neuen Glaubenssatz auszusprechen. Ich werde das um so entschiedener thun, als ich mir darauf hin die Jesuitenmoral etwas genauer angesehen habe und mich nicht überzeugen[194] kann, daß dieselbe der Welt oder der Kirche zum Segen sei. Sehen Sie hier – diese Auszüge!«
Der Professor nahm eine Anzahl einzelner Blätter von seinem Schreibtische.
»Wollen Sie das Wesentliche ihrer Grundsätze? Das ist die Lehre vom Probabilismus und: der Zweck heiligt die Mittel. Ihnen wird man stets vorgehalten haben, daß das Letztere eine Erfindung der Feinde des Ordens sei, daß trotz aller Aufforderungen und Preisaussetzungen noch niemand diesen Ausspruch habe einem Jesuiten nachweisen können, aber auch das ist echt jesuitisch. Gefallen ist dieses Wort in so offener Weise vielleicht niemals, aber die Thatsache, daß ihre Moral darauf hinausläuft, ist nicht wegzuleugnen. Oder ist es etwas anderes, wenn selbst die ärgsten Laster je nach den Umständen nicht bloß entschuldigt, sondern sogar gebilligt werden von ihren Schriftstellern? Ich habe hier die Schriften eines Vasquez, Perez de Lara, Suarez, Gomez, Veracruz, Dias, Dealkozer und vieler anderer, und Sie können mir glauben, daß ich sie vorurteilsfrei und gewissenhaft studiert habe, und was ich fand, hat mich traurig und zornig zugleich gemacht. Sehen Sie, ich greife auf Geratewohl in meine Zettel. Hier der Pater Kaspar Hurtado sagt de sub. pecc. diff. 9: ›Einer, der eine Pfründe besitzt, kann ohne eine Todsünde den Tod desjenigen wünschen, welcher eine Leibrente auf diese Pfründe hat; auch kann ein Sohn den Tod seines Vaters wünschen und sich erfreuen, wenn derselbe erfolgt, jedoch nur um des zu erhaltenden Genusses willen, nicht wegen eines persönlichen Hasses.‹ Was sagen Sie dazu? – Und hier, bei Sanchez und Filutius: ›Man darf auch eine Unwahrheit beschwören, wenn man einen geistlichen Vorbehalt macht, das heißt, das Entgegengesetzte bei sich denkt.‹ – Ist das nicht: Der Zweck heiligt das Mittel? – Hier Eskobar im Kapitel über den Diebstahl: ›Frauen, welche am Spiele Freude haben, dürfen ihren Männern das Geld dazu[195] entwenden.‹ – Hier, Sanchez in seiner Moraltheologie, 2. Buch, Kap. 89, billigt den Zweikampf, und bei derselben Materie sagt Navarrus, man dürfe einen Feind, der uns durch einen Prozeß unseres Gutes berauben will, sogar heimlicherweise töten. Auch Eskobar behauptet, seinen Feind zu töten, sei kein Verrat, selbst wenn es hinterrücks geschehe, ja selbst dann nicht, wenn man sich mit ihm ausgesöhnt und versprochen habe, seinem Leben nicht nachzustellen – vorausgesetzt, daß keine sehr enge Freundschaft bestehe. – Hier, Eskobar: ›Versprechen verpflichten zu nichts, wenn man, während man sie macht, sich vornimmt, sie nicht zu halten.‹ Hier der Pater Valentia im dritten Bande, Seite 2039: ›Wenn man ein zeitliches Gut für ein geistliches giebt, nämlich Geld für ein Benefizium oder eine Pfründe, so ist das eine augenscheinliche Simonie. Wenn man es aber giebt als ein Mittel, um den Willen desjenigen, der sie zu vergeben hat, zu bewegen, daß er dieselbe uns giebt, so ist dies keine Simonie, obwohl derjenige, der sie vergiebt, das Geld als sein vornehmstes Augenmerk betrachtet und erwartet.‹ Dasselbe findet sich bei dem Jesuiten Tanner im 3. Bande, Seite 1519. Heißt das nicht: Der Zweck heiligt das Mittel? – Ich will Ihnen nicht mehr Proben vorlegen, auch nicht von der Probabilitätslehre, nach der man unter mehreren Meinungen derjenigen zu folgen berechtigt ist, welche einem am besten gefällt, auch wenn eine andere wahrscheinlicher ist. Hier habe ich die Belege bei dem Jesuiten Emanuel Sa, im aphorismo de dubiis p. 183, bei P. Filutius aus Rom in Mor. Quaest tr. 21, cap. 4, no. 128, bei Sanchez und vielen anderen. – Aber verzeihen Sie: ich halte Ihnen hier eine Vorlesung über Jesuiten und Jesuitenmoral – das kommt davon, wenn man in einer Materie arbeitet, auch wenn sie wenig erquicklich ist – aber es soll mir lieb sein, wenn Sie aus alledem erkennen, wie sehr es nötig ist, angesichts des Konzils und der neuen Lehre auf der Hut zu sein vor einer[196] Ueberrumpelung, denn nicht im Vatikan, sondern bei dem Jesuitengeneral laufen die letzten Fäden der gegenwärtigen Bewegung zusammen.«
Frohwalt hatte mit steigender Erregung den im ruhigsten Tone gehaltenen Auseinandersetzungen gelauscht, und fand auch nun, nachdem Professor Holbert schwieg, nicht gleich das geeignete Wort. Endlich sagte er:
»Ich bin Ihnen dankbar für Ihre Mitteilungen, wenn ich auch gestehen muß, daß sie eine Umwälzung in mehr als einer Hinsicht in mir zu bewirken geeignet sind. Das alles kommt mir zu plötzlich, zu überwältigend, das muß ich mit mir verarbeiten, und Sie verzeihen, wenn ich betreffs der Jesuiten nicht sogleich volle Zustimmung und das richtige Wort finden kann. Betreffs der Unfehlbarkeit aber bin ich durch Ihre Darlegung befestigt worden in der Meinung, welche ich bisher besessen, und ich weiß nun, daß ich ruhig nach Rom gehen werde, um so mehr, als ich auch nach den Aeußerungen des Herrn Professor Meyer die Zuversicht habe, daß Seine Eminenz und zweifellos auch andere Kirchenfürsten niemals einem solchen Glaubenssatz zustimmen werden.«
Holbert zuckte leicht mit den Achseln:
»Hoffen Sie nicht zu viel, mein lieber Freund! Wir wollen den Himmel bitten, daß er Unheil abwende von unserer heiligen Kirche und wollen selbst fest bleiben bei ihrer alten, guten Lehre, geschehe auch, was wolle!«
»Ja, Herr Professor, das wollen wir!« sagte Frohwalt warm und herzlich, und die beiden Männer legten einen Augenblick schweigend Hand in Hand.
»Und nun kommen Sie zu einer Tasse Kaffee, Therese wird sich freuen …«
»Entschuldigen Sie mich heute, Herr Professor, mir ist die Seele zu voll, ich muß einige Stunden für mich allein sein!«
»Ich verstehe Sie und darf Sie nicht zurückhalten!«
Noch einmal reichten sie sich die Hände, dann ging der[197] Adjunkt. Als er in das Vorzimmer kam, stürzte aus dem Salon Hans Stahl in höchster Erregung an ihm vorüber, ohne Gruß und Wort. Langsam folgte er ihm die Treppen hinab; auf der Straße aber konnte er keine Spur mehr entdecken von dem Extheologen. Er kümmerte sich um denselben auch nicht weiter, sondern schritt durch die Hibernergasse hinaus gegen die Bastei, und dort ging er mit gesenktem Haupte, nach innerer Ruhe ringend.
Durch seine Seele fegte es wie ein Gewittersturm, und zwei Dinge vor allem waren es, die ihn mächtig bewegten, zwei Worte, die wie zündende Blitze ihn durchzuckt hatten. Das eine war das, was Holbert von der Duldung gesprochen hatte, das andere dessen Ansichten über den Jesuitenorden. Hätte ein anderer solche Aeußerungen gethan, so würde Frohwalt von heiligem Zorn erfüllt worden sein, aus diesem verehrten Munde aber hatten sie ein gewaltiges Gewicht. Der Professor galt bei allen nicht bloß als ein durchaus charakterfester Ehrenmann, sondern auch als das Muster eines wahrhaft religiös gesinnten Mannes; seine Worte waren darum auch seine Ueberzeugung und ein Mann von seiner Bedeutung sprach eine solche nicht aus, ohne sie zuvor in seiner Seele fest und sicher begründet zu haben. Es mußte doch etwas an der Forderung der Duldung sein, wie sie dieser herrliche Mann in derselben Weise wie der Vetter Martin betonte; sie mußte menschenwürdig und edel und mit dem innersten Kerne des Christentums im Einklang sein. Das gab ihm zu denken.
Noch mehr aber das andere. Er war durch seine Studie und seine Erziehung im Seminar gewöhnt worden, die Jesuiten als die edelsten und mutigsten Vorkämpfer der katholischen Kirche zu betrachten; er hatte darum in eigenen Gewissensnöten gerade bei ihren Beichtstühlen Rat und Trost gesucht, aber er mußte sich in dieser Stunde gestehen, daß er, als er zum letzten Male nach dem Tode des alten Pfarrers[198] bei St. Ignaz auf dem Karlsplatze gewesen, unbefriedigt und wenig erhoben von dannen ging, ja daß er daheim gerade durch einen jesuitischen Ausspruch betreff des Probabilismus schwankend und unsicher geworden war. Was er heute von der Moral der Jesuiten auf Grund unanfechtbarer Belege – und an deren Echtheit war bei dem Charakter Holberts nicht zu zweifeln – erfahren hatte, ließ ihn sein ganzes eigenes theologisches Wissen höchst unsicher und einseitig erscheinen. Warum wurden von den Moraltheologen derartige Lehren verheimlicht, beziehungsweise nicht verurteilt? Lag in dem Orden wirklich eine solche Macht, daß man nicht den ehrlichen Mut fand, seitens der kirchlichen Gelehrten gegen ihn vorzugehen, oder hatte derselbe wirklich die höchste Gewalt in der Kirche, so daß er daran denken konnte, auch das Papsttum zu seinem Werkzeug zu machen?
Wie dem auch war, Frohwalt fühlte, daß sich in seinem Geistesleben eine Wandlung zu vollziehen anfing, aber er wußte auch, daß dieser Vorgang noch Stunden schwerer Kämpfe im Gefolge haben werde. Wenig beruhigt kam er gegen Abend heim, und bis tief in die Nacht brannte an seinem Tisch die Lampe.
Auch Hans Stahl fand an diesem Abend keine Ruhe. Er war am Nachmittage mit pochendem Herzen zu Professor Holbert gegangen, und in der stillen Hoffnung, nachdem er der Theologie untreu geworden, auf Therese einen günstigen Eindruck zu machen. Er nahm es als ein gutes Vorzeichen, als das Mädchen ihn empfing, und, da ihr Vater zur Zeit mit Frohwalt in seiner Studierstube war, ihn nach dem freundlichen Salon führte. Eine kleine Befangenheit, welche sie bei seinem Anblick in Erinnerung an den Vorgang im Beth Chajim erfaßt hatte, überwand sie mit der Sicherheit der Weltdame rasch genug, und so kam sie ihm wie immer entgegen, und als ob jene Stunde nie zwischen ihnen gewesen wäre.
Gerade das ermutigte Hans Stahl. Sie hatte ihm ihre Verwunderung ausgesprochen über seine äußere Erscheinung und nun erzählte er ihr mit einer gewissen freudigen Erregung von der Wandlung, welche in seinen Verhältnissen eingetreten war. Dann fuhr er, beim Anblick des schönen Mädchens wärmer werdend, fort: »Ich habe den Drang, mit ganzer Kraft mich der Kunst zu widmen, und wage zu behaupten, daß ich nicht der schlechteste ihrer Jünger sein werde, wenn ich die schönste Hoffnung hegen darf, meinen jungen Lorbeer einst zu Ihren Füßen niederlegen zu dürfen.«
Theresens Antlitz überflog eine Röte; der Jüngling aber schien dieselbe zu mißdeuten, und so faßte er nach ihrer Hand, und hielt sie fest, obwohl das Mädchen sie ihm zu entziehen strebte, und dabei stammelte er mit stockendem Atem:
»Sie wissen, wie unendlich lieb ich Sie habe, daß Sie die Sonne meines Lebens, das Licht meines Schaffens sind, daß ein Wort von Ihnen mich selig und elend macht. Heute darf ich mit mehr Recht von meiner Liebe reden als damals – o Therese, lassen Sie einen Schimmer des Glückes auf mich fallen, in Ihnen lebt mir ja alles, was mir das Dasein begehrenswert macht – –«
Das Mädchen war aufgesprungen und hielt wie abwehrend die Hände gegen Stahl ausgestreckt; jetzt unterbrach sie den heißen Fluß seiner Rede:
»O mein Gott, Herr Stahl, ich darf Sie ja nicht anhören, sprechen Sie nicht weiter! Ich will Ihnen sagen, daß Sie mir lieb und wert sind, daß …, aber weshalb davon sprechen, ich muß Ihnen Mut und Hoffen rauben, wenn Sie es wirklich auf mich gesetzt hatten – ich bin so gut wie verlobt mit Dr. Haller, und unsere Beziehung wird in den nächsten Tagen veröffentlicht!«
Hans Stahl fühlte, wie alles Blut aus seinem Antlitz wich, wie er, von einem Schwindel erfaßt, zurücktaumelte auf[200] seinem Sitze, dann schlug er beide Hände vor die Augen, aber ein Wort fand die gequälte junge Seele nicht. Therese wurde von tiefem Mitgefühl erfaßt; sie legte ihre Hand leicht auf seinen Arm, die Wahrheit und Tiefe seines Empfindens erschütterte sie:
»Fassen Sie sich, Hans … wir wollen recht gute Freunde bleiben!«
»Ein Bettelbrot!« preßte er hervor, dann stieß er beinahe heftig die Hand des Mädchens von seinem Arme hinweg, sprang auf und eilte hastig, ohne Gruß, davon.
Er war lange in den Straßen hin- und hergelaufen, ehe er heimging in die freundliche Stube, welche er in der Eisengasse bewohnte. Er hatte eine Leinwand auf der Staffelei beim Fenster; die stieß er hinab und trat mit dem Fuße hinein, ihm war die Kunst und beinahe sein Leben verleidet. Mit seinem Schmerz über den Verlust der Geliebten mischte sich aber der Zorn gegen den glücklichen Nebenbuhler, und dieser begann zuletzt bei ihm zu überwiegen. Er haßte diesen Dr. Haller, so lang er ihn kannte, er hatte die Empfindung, als könne derselbe Therese niemals wirklich glücklich machen, und immer mehr lebte er sich in den Gedanken hinein, daß er sie auch nicht besitzen dürfe.
Seinem etwas phantastischen Wesen erschien es in dieser Stunde als das Richtigste, seinen Nebenbuhler herauszufordern und zwar gleich zu einem Pistolenduell über das Taschentuch. Ihm war es ganz gleichgültig in seiner jetzigen Stimmung, wenn er dabei zu Grunde ging, wenn nur auch der Verhaßte nicht die Braut heimführte. So kam es, daß er nach manchem Erwägen noch in der Nacht sich hinsetzte und thatsächlich eine Herausforderung an Dr. Haller schrieb, die er auch noch zur selben Stunde hinabtrug nach dem nächsten Briefkasten. Er schlief erst gegen Morgen ein und hatte die wunderlichsten und zugleich beängstigende Träume, so daß er wie in Schweiß gebadet erwachte.
Doch bereute er am Morgen nicht, was er gethan hatte und sah mit Spannung der Antwort Dr. Hallers entgegen. Sie traf bereits gegen Abend bei ihm ein: ein Dienstmann hatte sie überbracht und lautete:
»Mein Herr Stahl! Ihre Stilübung ist mir zugegangen und ich glaube nicht, daß Sie bei ruhiger Erwägung mir zumuten werden, dieselbe ernst zu nehmen. Ich habe sie darum auch nicht dem Staatsanwalt, sondern dem Papierkorb übergeben und erachte damit die Sache für erledigt.
Ergebenst
Dr. Haller.«
Stahl war außer sich über den kalten Hohn des verhaßten Menschen, den er mit Wollust hätte erschlagen, erschießen, erwürgen mögen. Er war auch nicht geneigt, diese geringschätzige Behandlung ruhig hinzunehmen; er sah vielmehr darin einen Ausfluß von Feigheit und gedachte, seinen Gegner, wenn Worte nichts vermochten, durch die That zu überzeugen, daß seine »Stilübung« ernst zu nehmen sei. Den ganzen Tag rannte er ruhelos durch die Gassen und erwog einen Plan um den andern, ohne zu einem Entschlusse kommen zu können. Anfangs hatte er daran gedacht, Dr. Haller in seiner Wohnung aufzusuchen und ihn thätlich anzugreifen, doch verwarf er das aus mehr als einem Grunde; am allerliebsten wäre er ihm im Hause Holberts, in Gegenwart Theresens an die Kehle gesprungen, aber das war ja thöricht.
So hatte er sich den Tag über ziellos herumgetrieben und war immer in die Nähe der Zeltnergasse gekommen, wohin ihn sein Herz zog und der Haß zugleich, denn er vermutete, daß Haller mindestens gegen Abend zu seiner Braut gehen werde.
Darin hatte er sich auch nicht getäuscht. Er sah den Verhaßten in der neunten Abendstunde vom Altstädter Ringe herankommen, ein überlegenes Lächeln um die Lippen, mit[202] einem kleinen Stöckchen spielend, und in Stahls Seele bäumte sich der Haß auf. Die Straße war belebt, einen Angriff, welcher hier erfolgte, mußte jener als schwere Beleidigung empfinden …
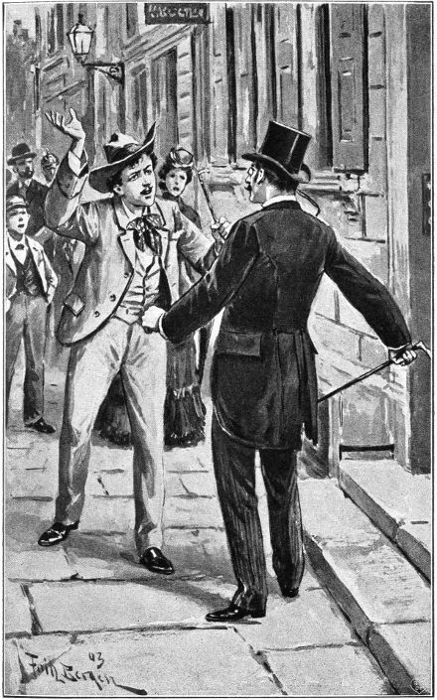
Der junge Mann verlor bei diesem Gedanken alle Selbstbeherrschung; in dem Augenblicke, da Haller in das Haus Holberts eintreten wollte, sprang er gegen diesen vor, und mit dem Rufe: »Elender Feigling!« versetzte er ihm einen Schlag ins Gesicht, daß der Getroffene zurücktaumelte, aber im nächsten Moment auch schon seinen Angreifer erfaßt hatte und ihm zurief:
»Unreife Jungen müssen das Stäbchen spüren!« Dann schlug er mit seinem Stocke auf ihn ein, während Stahl mit den Fäusten um sich hieb.
Das spielte nur einige Sekunden. Die Leute waren stehen geblieben, ihre Entrüstung wendete sich gegen den Angreifer, und ehe noch der nächste Schutzmann herbeikam, war Hans Stahl bereits von einigen kräftigen Händen erfaßt und festgehalten worden, während Haller ihm noch einen derben Hieb mit seinem Stöckchen versetzte. Der Geschlagene war sprachlos vor Wut, der Doktor aber rief dem Sicherheits-Wachmann zu:
»Nehmen Sie diesen Burschen fest, der mich gröblich angefallen hat. Mein Name ist Dr. Haller – das Weitere werde ich selbst veranlassen.«
Er wandte sich nach der Thür des Hauses, in welchem Professor Holbert wohnte, Hans Stahl aber ließ sich willenlos, elend bis in die tiefste Seele hinein, von dem Schutzmann hinwegführen. Er hatte mit der Empfindung, jetzt erst Therese für immer verloren zu haben, auch noch die andere, daß er sich in Prag unmöglich gemacht und die eben erst neu eingeschlagene Laufbahn sich selbst verdorben habe.



Zu Beginn des Herbstes fand die Hochzeit Theresens mit Dr. Haller statt und zwar auf besondern Wunsch der Braut in der freundlichen Kirche bei den Kapuzinern zu St. Josef, und P. Severin war es, welcher die Trauung vollzog. Als Professor Holbert dem Guardian diese Bitte Theresens vortrug, war der würdige alte Herr einigermaßen in Verlegenheit gekommen, aber da sein junger Ordensbruder ihm seine einstige Herzensbedrängnis in der Beichte anvertraut hatte, mochte er darüber nicht sprechen, sondern erklärte, daß er die Entschließung darüber P. Severin selbst überlassen müsse.
Zu seiner Verwunderung nahm dieser den Wunsch scheinbar völlig ruhig auf, und erklärte sich bereit, denselben zu erfüllen; er fügte seinem milden, freundlichen Ordensvorgesetzten gegenüber bei, er betrachte auch das als eine Buße, welche ihm der Himmel auferlegen wolle.
So fuhren am festgesetzten Tage eine Anzahl Kutschen vor dem Thore des Klösterchens vor und zwischen der gaffenden Menge hindurch führte Dr. Haller, dessen äußere Erscheinung heute besonders vorteilhaft aussah, die liebliche Braut, die in ihrem weißen Gewande, mit dem Myrtenkränzlein im Haare einer anmutigen, frischen Blüte vergleichbar war.
Hinter ihnen schritt Professor Holbert mit der Mutter[204] des Bräutigams am Arme und die andern Gäste, eine kleine, aber vornehme und auserlesene Schar.
Das Kirchlein hatte sich zur Feier besonders geschmückt, und weihevoller Orgelklang kam dem Brautpaare entgegen, das auf rotsammtenen Kissen auf der untersten Stufe des Altars niederkniete. Jetzt erschien aus der Sakristei der junge Priester. Er allein sollte die heilige Handlung vornehmen, ohne jede Assistenz, so hatte es Therese gewünscht, und Professor Holbert war mit der Einfachheit in jeder Hinsicht völlig einverstanden. Die Angehörigen des Bräutigams hätten freilich mehr Aufsehen gewünscht.
Severin war so blaß, wie wohl nie im Leben; sein wallender dunkler Bart ließ die Blässe noch mehr hervortreten, und seine Augen hatten einen müden Schimmer. Niemand ahnte, was in der Seele des jungen Priesters vorging, welchen furchtbaren Kampf er kämpfte und welche Selbstüberwindung er übte.
Gerade in diesen Augenblicken, da Therese, umwoben von dem ganzen jungfräulichen Liebreiz, in dem weißen, duftigen Gewande vor ihm kniete, das liebliche Haupt demutsvoll und fromm nach ihm emporgehoben, ging durch seine Seele ein unsagbares Gefühl heißen Schmerzes. O, die Entsagung verlangt von ihren Märtyrern fürchterlich harte Opfer! Das Herz des jungen Priesters zuckte und er konnte es nicht hindern, daß ihm davon auch die Hände bebten, als er sie wie zum Segen auf die mit der Stola umwundenen Hände des jungen Paares legte und dann über ihre Häupter hielt, und da er das Wort sprach, welches diesen Bund unauflöslich verknüpfen sollte, da meinte er, sein Herzschlag müsse stocken, und die Worte kamen heiser, hervorgepreßt von seinen Lippen.
Nun war es vorbei. Er wandte sich nach dem Altare zurück, hielt sich daran fest mit zitternden Fingern, und dann erst schritt er langsam, müde, wie ein gebrochener Mann, nach der Sakristei, um das Meßgewand anzulegen. Er mußte[205] sich doch einige Augenblicke niedersetzen – er fühlte, daß er sich zu viel zugetraut hatte. – Dann erst ging er wieder zum Altare zurück, um die Messe für die Neuvermählten zu zelebrieren. Mit solcher Inbrunst hatte er vielleicht niemals noch das lateinische Meßgebet gesprochen, mit heißerer Andacht nie den Leib des Herrn in den Händen gehalten; er fühlte sich wie ein Sünder, und dennoch wie ein Sieger.
»Ite, missa est!« sprach er zum Volke gewendet; sein Blick streifte noch einmal die Lichtgestalt der jungen Braut, dann war das Schlimmste überwunden, aber er wußte kaum, wie er nach seiner Zelle gekommen war.
Hier warf er sich auf sein hartes Lager, schlug beide Hände vor das Gesicht und schluchzte in sein Kissen hinein; ihm war zum Sterben weh. »Der Menschheit ganzer Jammer« erfaßte ihn, niemals würde ihm ein Glück scheinen, das ihm, dem Entsagenden, als das höchste und herrlichste dünkte, das Glück, ein geliebtes Wesen am Herzen halten, in ihm aufgehen zu dürfen in Leid und Lust.
Plötzlich riß er sich empor, wild und zornig, mit den Händen faßte er nach den Knoten seines Gürtelstricks, er hätte sich am liebsten gegeißelt, um in qualvoller Selbstpeinigung zu vergessen, und da dies nicht wohl anging, sank er auf den Betschemel nieder, schlug das Haupt gegen dessen Kante, und so lag er vor dem schlichten Kreuzbilde lange auf den Knieen. Dann erhob er sich und ging zu dem Guardian. Er bat denselben, ihn fortzugeben in ein kleines, armes Klösterchen, wo es am meisten Entbehrung, Demütigung und Mühe gebe, ihn verlange nach Einsamkeit und Thätigkeit. Der alte, würdige Priester verstand ihn. Er sprach:
»Gott segne Sie, lieber Bruder, Sie sind auf dem rechten Wege, und der Herr wird Ihnen in dem Kampfe, welchen Sie so tapfer kämpfen, nicht den Sieg vorenthalten. Ich werde bei dem P. Provinzial Ihre Versetzung beantragen.«
Er drückte ihm herzlich die Hand; Severin ging, und[206] schon acht Tage später befand er sich auf dem Wege nach der kleinen, freundlichen Landstadt, in welcher Peter Frohwalt daheim war. Als er den ihm wohlbekannten Ort unter sich liegen sah, als das rote Dach des Kapuzinerklösterchens mit dem kleinen Turme ihm zu winken schien, ging ihm die Seele auf; die Brust wurde ihm weit; er breitete die Arme aus, und mit rascheren Schritten ging er zu Thal.
Im Garten bei dem Kloster war Obsternte. Schwer von Aepfeln und Birnen beugten sich die Zweige, die wenigen Mönche aber, die hier lebten, waren, breitrandige Basthüte auf den Häuptern, beschäftigt, den Gottessegen zu bergen. Der eine stand auf der Leiter, ein zweiter hatte eine Schürze über sein Ordenskleid gebunden, und las auf, was herabfiel, und selbst der treffliche Guardian hielt einen fast gefüllten Korb am Arme. Als Severin bei ihnen eintrat mit seinem »Gelobt sei Jesus Christus!« und sie den Ordensbruder erkannten, ließen sie alles stehen und liegen. Der von der Leiter kam herab, und der Guardian umarmte und küßte ihn. Da ward es Severin unendlich wohl zu Mute, und alles, was sonst noch auf Erden war, versank hinter ihm wie ein Traum.
Ja, hier war es ungleich schöner, als in Prag. Kein Lärm und Geräusch störte die liebliche Idylle, und wenn er des Morgens das Fenster seiner Zelle öffnete und hinaussah ins freie, weite Land, das im Herbstsonnenglanz sich hindehnte, bis wo fern die blauende Hügelkette den Blick begrenzte, dann war er so ruhig und wunschlos, so glücklich in seiner Entsagung und Armut.
So vergingen ihm einige Wochen. Da geschah es, daß er eines Morgens, während er bei der Messe sich an dem Altar umwendete, in einem der vordersten Kirchenbänke eine Frauengestalt gewahrte, bei deren Anblick ihm alles Blut aus den Wangen wich. Es war kein Zweifel, daß es Therese war. Auch sie sah halb erstaunt, halb erfreut nach ihm hin, als er[207] beim Segnen sich noch einmal umwendete, und in ihren Augen stand etwas wie ein stiller Gruß. Und da er nach dem Gottesdienste wie ein Träumer aus der Kirche heraustrat, um über den Hof hinweg nach dem Klösterchen selbst zu gehen, da trat sie ihm mit freundlichem Gruß entgegen und reichte ihm die Hand.
Er folgte dem Drange des Augenblicks, als er das feine, behandschuhte Händchen zwischen seine beiden Hände nahm, durch welche ein leises Zittern der Erregung lief, und mit nicht ganz sicherer Stimme fragte er, während seine Augen seltsam schimmerten:
»Wie kommen Sie hierher, Frau Doktor?«
»Ei, das wissen Sie nicht? Mein Mann hat sich seit drei Tagen als praktischer Arzt hier niedergelassen, und ich fühle mich in dieser ländlichen Umgebung ungemein wohl. Doppelt freut es mich, Sie hier zu wissen, und ich hoffe, daß Sie ab und zu uns besuchen werden. Wir wohnen neben der Mutter des Herrn Dr. Frohwalt.«
Severin stammelte etwas wie ein Dankeswort für die freundliche Einladung, dann ging er, während die junge Frau ihm einigermaßen befremdet nachblickte. In seiner Zelle angekommen, trat er ans Fenster. Wie ein Schleier lag es über dem Landschaftsbilde, das ihn bisher entzückt hatte, und wie ein Druck beschwerte es ihm die Brust. Er that einen tiefen Atemzug, dann sprach er mit Festigkeit halblaut:
»Herr, Du suchst mich heim! Sei es! Du willst, ich soll kämpfen, und ich will mich nicht Deiner Prüfung entziehen. Nur, guter Gott, lege mir nicht mehr auf, als ich tragen kann.«
Von diesem Tage an war Severin noch eifriger als bisher in aller Arbeit. Er war ein trefflicher Prediger, unermüdlich im Beichtstuhl und schaffte dabei in Haus und Garten trotz einem Laienbruder, so daß die andern Brüder in stiller Verwunderung ihn beobachteten und in ihm ein Musterbild[208] eines Mönches sahen. Dabei war er stets heiter und gefällig, nahm jedem an Mühe ab, so viel er vermochte, und als einer der Brüder erkrankt war, pflegte er ihn mit peinlicher Sorgfalt Tag und Nacht.
So rang Severin mit sich selbst. –
Der Herbst schritt weiter vor, und man sprach überall von dem Zusammentritt des Konzils. In jenen Tagen kam Peter Frohwalt noch einmal heim, um, ehe er nach Rom ging, seine Mutter zu besuchen. Als er am Abend unvermutet bei ihr eintraf, fand er hier Therese Haller und seine Schwester, die ein winziges Kindlein, einen munter schauenden Knaben, in einem Steckkissen auf dem Arme trug.
Die Frauen waren, jede nach ihrer Weise, erregt, als sie ihn sahen; er nicht minder. Daß Therese in seiner Heimat war, wußte er allerdings, daß sie ab und zu seine Mutter besuchte, war ihm gleichfalls bekannt, und in diesem Augenblicke war ihm letzteres doppelt erfreulich, weil es ihn über das Peinliche der Begegnung mit seiner Schwester hinwegbrachte. So begrüßte er zuerst die Mutter mit Gruß und Kuß, und sie schloß froh und stolz die Arme um den stattlichen Sohn; dann reichte er Therese die Hand, welche sagte:
»Sehen Sie, wie wunderlich die Menschen sich zusammenfinden, Ihre liebe Mutter, Herr Doktor, läßt mich erst hier mich wohl fühlen, und ich komme in allen meinen Nöten als unerfahrene junge Frau zu ihr und bin glücklich, daß sie mich ein wenig als Töchterchen ansehen will. Und auch mit Marie habe ich mich auf freundschaftlichen Fuß gestellt. Und sehen Sie nur, was für einen kleinen, prächtigen Neffen Sie haben!«
Marie war schüchtern beiseite getreten, als sei sie eine Fremde, die kein Recht habe, hier zu sein; bei diesen Worten aber überflog ihre Wangen eine liebliche Röte, und verschämt blickte sie auf den schlafenden Säugling auf ihrem Arme nieder. Noch heißer aber ward das Rot, das sich bis unter die blonden Stirnhaare verlief, als ihr Bruder zu ihr[209] herantrat, ihr die Hand hinreichte, sich über das Kind beugte und mild und freundlich sagte:
»Grüß Gott, Marie, und er segne Dir Deinen Kleinen!« Das übermannte das junge Weib, so daß ihr die Thränen hell über die Wangen rannen und daß sie die Hand des Bruders an die Lippen ziehen wollte; dieser wehrte jedoch ab.
Therese erkannte mit feinem Taktgefühl, daß sie nicht bleiben dürfe, und so ging sie mit herzlichem Gruße, nicht ohne Frohwalt um seinen Besuch gebeten zu haben. Als sich die Thür hinter ihr geschlossen hatte, stammelte Marie:
»Ach, wie bist Du gut, Peter! Lohn' Dir's Gott tausendmal.«
Der junge Doktor geriet einigermaßen in Verlegenheit, er wußte nicht, ob er solchen Dank annehmen dürfe, aber er sprach milde, wie vorhin:
»Ich will an nichts anderes denken, als daß Du meine Schwester bist – von Deinem Manne aber wollen wir nicht sprechen!«
Ein Schatten lief über das hübsche Antlitz Mariens, und schüchtern sagte sie:
»Und doch hätte er Dir so gerne gedankt!«
»Wofür?«
»Ach, Du willst Dich nicht dazu bekennen, aber wir wissen es doch, auch wenn es die Mutter in Abrede stellt; jene dreihundert Gulden …«
Das Gesicht Frohwalts wurde finsterer:
»Ich weiß nicht, wovon die Rede ist! … Mutter, wie steht's mit Eurer Obsternte? Ist mein alter Apfelbaum wieder brav gewesen?«
Die alte Frau wurde redselig. Sie freute sich unendlich, daß ihr Sohn milder gegen seine Schwester war und bot nun alles auf, was sie nur irgend ihm vorsetzen konnte. So saßen die drei mit dem schlummernden Kinde beisammen, bis[210] es anfing zu dämmern und Marie gehen mußte. Peter reichte ihr wiederum die Hand und sie huschte hinaus.
Nun fragte er die Mutter nach Diesem und Jenem. Was der Vetter Martin mache?
Der sei seit kurzem daheim und einigermaßen verdrießlich, weil sein Bein ihm immer wieder beim weiteren Wandern Störungen mache. Gegenwärtig ordne und katalogisiere er seine Sammlungen, aber vor Einbruch des Winters denke er doch noch einmal auszumarschieren.
Auch nach Dr. Haller erkundigte sich Frohwalt und die alte Frau machte ein einigermaßen bedenkliches Gesicht.
»Er ist das herzige Frauchen nicht wert. Ich bin zweimal bei ihr gewesen und habe gesehen, daß er sie mindestens nicht ganz höflich behandelt; das eine Mal machte er mir den Eindruck, als sei er betrunken. Sie läßt sich nichts merken, aber ich habe sie hier bei mir schon mit verweinten Augen gesehen.«
»Das ist schlimm und sollte mir leid thun um Therese. Wie schätzt man ihn als Arzt?«
»Gar nicht; er hat zwei böse Fehlkuren gemacht, und seitdem hat er wohl wenig zu thun; sie müssen in der Hauptsache vom Eigenen leben.« – –
Der Abend verging, und Frohwalt fühlte, als er am Abend sich in dem freundlichen Giebelstübchen in seinem Bette streckte, ein wohliges Behagen. Daheim bei der Mutter war es doch am schönsten, und daß er der Schwester Liebe gezeigt hatte, trug auch dazu bei, ihn in angenehme Stimmung zu versetzen. Am andern Morgen blieb er, obwohl er munter war, noch liegen. Die Stille im Haus und im Städtchen that ihm wohl und heimelte ihn an, und wenn er ab und zu den leisen Schritt der alten Frau hörte, welche wohl lauschen mochte, ob er bereits wach sei, um ihm den Morgenkaffee ganz frisch zu bereiten, so drückte er die Augen zu und lag ganz still und träumte sich zurück in vergangene Tage.
Als er zum letzten Male hier gewesen war, war er beinahe im Zorn und heißen Unmut geschieden; diesmal wollte er das gutmachen, denn seine Schwester konnte trotz alledem, was geschehen war, nicht schlecht sein, wenn Therese sie ihrer Freundschaft wert hielt. So lachte ihm das Städtchen noch einmal so freundlich entgegen, als er seine Besuche machte. Acht Tage Urlaub hatte er sich erbeten, ehe er nach der ewigen Stadt gehen wollte auf längere Zeit, und er hatte das Bedürfnis, wie wenn er vor einem großen Lebensabschnitt stünde, noch einmal die Stätte und die Menschen zu sehen, mit denen er daheim bekannt und erwachsen war.
Er machte zuvörderst seinen Besuch auf der Pfarre; der alte, liebe Pfarrer empfing ihn herzlich und gütig; er freute sich, ihn so in Ehren und Ansehen zu wissen, und vermied dabei, über seine Familienbeziehungen zu sprechen, weil er ihn von früher her kannte. Als die Rede auf das Konzil kam, sagte er:
»Glauben Sie, daß man die Unfehlbarkeit zum Glaubenssatze erheben wird?«
»Ich hoffe zu Gott, daß es nicht geschieht,« erwiderte Frohwalt – »und hege diese Zuversicht um so mehr, als die eben jetzt in Fulda versammelten deutschen Kirchenfürsten an die Katholiken Deutschlands in diesen Tagen eine Ansprache erlassen haben, die kurz betonte: Man solle ruhig sein und Gott vertrauen; es werde keine neue Lehre aufgestellt werden.«
Der alte Priester schüttelte das weiße Haupt:
»Ich bin ein einfacher Landpfarrer und rühme mich keiner theologischen Gelehrsamkeit, aber ich meine, es hätte richtiger gesagt werden müssen: die Unfehlbarkeit ist keine neue Lehre oder: sie wird nicht aufgestellt werden. – Na, ich füge mich allem: Wenn der Herr Kardinal-Fürst-Erzbischof sie als Glaubenslehre annimmt, thue ich es auch, selbst wenn ich es für keinen Segen halten könnte. Ich bin ein alter Mann und möchte keine äußere und innere Unruhe haben.«
Frohwalt ging einigermaßen verstimmt von dannen und suchte, da es der Anstand einmal verlangte, den Kaplan auf. Der war verbittert nach allen Beziehungen. Er schwur auf die Unfehlbarkeit des Papstes und beklagte es, daß man daran überhaupt noch zweifeln könne; für ihn brauche es kaum noch einen ausgesprochenen Lehrsatz: der Papst als Statthalter und Stellvertreter Christi auf Erden müsse unfehlbar sein. Frohwalt hielt es nicht der Mühe wert, mit dem Eiferer, der nicht ernst zu nehmen war, über die Sache sich zu unterhalten, und jener sprang auf anderes über. Er beklagte die allzu große Duldung des Pfarrers, der es zuzuschreiben wäre, daß der Protestantismus in der Stadt an Boden gewinne; seit Freidanks Uebertritt bestehe bereits eine kleine ketzerische Gemeinde hier, und er beklage besonders tief, daß die Schwester eines katholischen Priesters dazu gehöre.
»Hier hat meine Macht eine Grenze, Hochwürden,« sagte ihm Frohwalt, »und ich bin nicht im Stande, meine Schwester bedingungslos zu verdammen, wenn ich auch niemals ihren Schritt billigen werde. Ob die Duldung des alten Herrn das Anwachsen des Protestantismus allein zu verantworten hat, möchte ich dahingestellt sein lassen, denn sie ist auch nicht die Veranlassung zum Abfall Freidanks gewesen.«
Der Kaplan sah den Sprecher mit verwunderten und beinahe zornigen Augen an; seine Aeußerungen waren von solchem finstern Glaubenseifer und so bitterer Gehässigkeit gegen die Andersgläubigen erfüllt, daß Frohwalt davor einen gelinden Schauer empfand. Nein, das war kein Jünger des Herrn! Man durfte die evangelische Sekte bekämpfen, ihre Anhänger bannen, aber man durfte sie nicht wie einen Abschaum der Menschheit behandeln. So war Marie nicht, wie dieser Pater Ignaz die Evangelischen schilderte!
Er war froh, als er die Pfarrei im Rücken hatte, dort herrschte ein unbehaglicher, finsterer Geist, und wehe dem[213] Städtchen, wenn der Kaplan hier jemals Pfarrer werden sollte. Es drängte ihn, zum Vetter Martin zu gehen, mit dessen Anschauungen er zwar auch nicht durchaus einverstanden war, der aber mit einem warmen, guten Herzen durch die Welt ging, niemandem wehe that und Freude verbreitete, wo er nur konnte. Er dachte an jenen Nachmittag in Prag, an dem der alte Nedamitzer Pfarrer vielleicht zum letzten Mal einen Hauch des Glückes empfunden hatte, das ihm verschafft war durch Vetter Martin, während er selbst mit seiner zornigen Härte, mit seiner kalten Moral vielleicht den alten Priester in Verzweiflung und Tod gebracht hatte. Er fühlte, daß er um deswillen schon manches gut zu machen hatte.
Vetter Martin war nicht allein; Frohwalt fand zu seinem Staunen bei ihm keinen anderen als Hans Stahl, der in »der Bibliothek« bei dem Alten saß mit einem recht zerknirschten Gesichte, in welches nun beim Anblick des neuen Besuchers ein unverkennbarer Zug von Verlegenheit trat. Der alte Herr war aufgestanden und begrüßte den Adjunkten freundlich:
»I, sieh mal, das ist hübsch, daß Du vor Deiner Romfahrt erst noch einmal nach Hause kommst und sogar bei mir vorsprichst, obwohl Du Dir denken kannst, daß ich auf die Unfehlbarkeit nicht gut zu sprechen bin.«
Hans Stahl wollte sich entfernen, Martin aber hielt ihn zurück:
»Bleiben Sie nur da – Sie kennen sich ja Beide – und ich vermute, daß der Doktor Frohwalt auch weiß, was Ihnen in Prag passiert ist.«
»Ich entsinne mich, von der unliebsamen Geschichte gehört zu haben, daß man Sie wegen öffentlicher Ruhestörung und Herausforderung zum Zweikampf zu Gefängnishaft verurteilt hatte,« sprach Frohwalt ziemlich kühl; Hans Stahl[214] aber saß da wie ein armer Sünder. Dem Vetter Martin that der frische Junge leid, und er sagte:
»Na, die Geschichte ist vorbei, und er ist Dank der Verwendung des Professors Holbert ziemlich glimpflich weggekommen, aber nun sitzt das Unglückswurm hier und bläst mir seine Trübsal vor. Da hat das Herz und der junge Hitzkopf Ihnen eben einen dummen Streich gespielt, lieber Hans, und was Sie sich eingebrockt haben, müssen Sie ausessen. Ich hatte nämlich – wandte sich der alte Herr zu Frohwalt – bei seinem Vater durchgesetzt, daß er die Theologie mit der Malerei vertauschen dürfe, und wir hatten beide die schönsten Hoffnungen, daß er einmal ein kleiner Raffael werde, da passiert die Geschichte. Und nun will der Vater nichts mehr von der Künstlerlaufbahn wissen, sie mache zu Ausschreitungen geneigt und was dergleichen mehr ist; er soll ins Geschäft eintreten und Kaufmann werden. Viel Talent scheinen Sie mir dazu nicht zu haben, aber es ist nichts dagegen zu machen, und mein Rat, den Sie haben wollen und weshalb Sie eigens hierher gereist sind, ist der: Sie folgen fürs erste Ihrem Vater, bemühen sich, möglichst tüchtig in seinem Kontor zu sein, und malen nur des Sonntags zu Ihrem Vergnügen. Na, Kopf hoch, die Sache ist doch nicht so schlimm, und wenn's wirklich bei allem guten Willen gar nicht geht, so können Sie auf mich zählen.«
Hans Stahl nickte noch immer recht trübselig mit dem Kopfe, dankte schön für den guten Rat und den erhaltenen Trost und ging.
»Er ist ein Windhund!« sagte Frohwalt hinter ihm.
»Aber nicht die schlechteste Rasse,« erwiderte der Alte; »den geb' ich nicht auf, und wär' alles vielleicht besser geworden, wenn er nicht mit der Theologie erst kopfscheu geworden wäre …«
Der »Windhund« aber schlich draußen recht langsam durch die Gassen des Städtchens; er befand sich im Zustande[215] moralischen Katzenjammers. Er sah sich bereits im Kontor seines Vaters auf dem Drehstuhl, trockene Geschäftsbriefe abschreibend und unerquickliche Zahlen schreibend, und in seiner Seele tauchten mitunter die abenteuerlichsten Gedanken auf. So ging er langsam fürbaß, ohne aufzublicken, bis ihn mit einmal eine Stimme aus seinem Sinnen weckte:
»Guten Tag, Herr Stahl, was führt Sie hierher?«
Der Angeredete schrak beinahe zusammen, blickte auf, und sah vor sich einen jungen Kapuziner stehen:
»Pater Severin! Sind Sie nicht mehr in Prag?«
Die Hände lagen fest in einander, und Hans Stahl schüttelte wie mit einem Ruck alles ab, was ihn quälte und bedrängte; er war wieder der Alte, der das Leben mit Humor und Drang nach frischem Genusse erfaßt.
»Das ist ja wunderhübsch daß ich Ihnen auf dieser Scholle begegne, in diesem kleinen, lieblichen Neste. Ich suche nämlich Menschen, und Sie sind wirklich der zweite, welchen ich hier finde. Dafür werden Sie mich auch heute nicht mehr los. Haben Sie Ihren Nachmittag frei?«
»Ich muß allerdings in einer unaufschiebbaren Sache nach Oberdorf zu meinen Eltern, aber wenn Sie mich dahin begleiten wollen, soll's mich freuen; es ist ein Weg von etwa fünfviertel Stunden.«
»Wenn ich Ihnen nicht lästig bin – –«
»Gott bewahre –«
»Abgemacht! Ich gehe jetzt, um für meinen Leib eine Atzung zu suchen, und bin nach Tische bei Ihnen – mich gelüstet's, wieder einmal einige Minuten in einer Mönchszelle zu sitzen.«
So gingen sie für's Erste auseinander, aber nachmittags stellte sich Hans Stahl pünktlich in dem Klösterchen ein. Er fand Severin im Garten zwischen blühenden Georginen und Astern hinschweifend, aber dieser führte ihn sogleich nach seinem kleinen, aber freundlichen Gelaß. Stahl setzte sich auf den[216] Stuhl beim Fenster und ließ seinen Blick die kühlen, weißgetünchten Wände entlang schweifen; dann sprach er:
»Wissen Sie, Ihre Zelle ist noch weitaus gemütlicher, als eine solche im Prager k. k. Landesgericht.«
»Das können Sie unmöglich beurteilen,« sagte lächelnd der Kapuziner, aber sein Besucher erwiderte:
»Na, ich dächte doch! Oder sollten Sie nichts davon ahnen, daß Sie einen entlassenen Sträfling beherbergen, der eben erst wieder die Fittiche dehnt … na, erschrecken Sie nicht so, Mann Gottes; erschlagen hab' ich keinen, aber nahe dran war ich. Also sie wissen wirklich nichts? Na, Gott sei Dank, daß es noch solche Menschen giebt, das verleiht mir ordentlich ein Selbstbewußtsein. Dafür will ich Ihnen auch eine Generalbeichte ablegen und hoffe, daß Sie mich absolvieren.«
Und nun erzählte er ehrlich die Geschichte seiner Liebe und seines Hasses, und beachtete es gar nicht, wie einmal, da er von der ersteren redete, ein fahler Schein über das Antlitz des jungen Mönches lief, und wie seine Brust sich einmal rascher hob zu einem unbezwinglichen Seufzer.
»So, nun wissen Sie alles, Sie Glücklicher, der keine solchen Anfechtungen hat und nicht daran zu denken braucht, wie man einen Nebenbuhler beseitigt!«
Severin nickte einigemale unbewußt mit dem Haupte und das Lächeln, das über sein Gesicht ging, erinnerte an müdes Abendlicht der scheidenden Sonne.
»Ja, ja … aber sagen Sie, haben Sie denn wirklich Therese Holbert so lieb gehabt?«
»Gehabt? Freund, ich habe sie noch lieb und werde sie in alle Ewigkeit so lieb haben, ob Sie mir's glauben oder nicht!«
Der junge Kapuziner mochte das wohl glauben, denn die Worte klangen ihm in der eigenen Seele nach, und es wurde ihm in diesem Augenblicke wieder so schmerzlich zu[217] Sinne, wie nur jemals in seinem jungen Leben. Aber er sah an seinem härenen braunen Gewande hinab, dann in das Gesicht des prächtigen, blühenden Burschen vor ihm, der gleichfalls entsagen mußte, und sprach:
»Wissen Sie denn, daß Dr. Haller hier als praktischer Arzt lebt?«
»Hier?«
Stahl sprang heftig von seinem Sitze.
»Hier? – Und Therese ist auch hier?«
»Gewiß, ich habe sie beide ehelich verbunden!«
»Sie? – Das hätte ich Ihnen nicht zugetraut, das ist ja ein Akt einer höllischen Boshaftigkeit, den Sie auch einem andern hätten überlassen können.«
Severin lächelte wiederum müde – wie gern er das einem andern überlassen hätte!
»Natürlich haben Sie die Verbindung so dauerhaft als möglich gemacht. Herr Gott, hätten Sie denn nicht einen geistlichen Vorbehalt einfügen können, so daß Therese eines schönen Tages, wenn Sie unglücklich wird – und ich sage Ihnen, sie wird's – wieder frei werden könnte! – Aber thun Sie mir den Gefallen, führen Sie mich an dem Hause vorüber, in welchem sie wohnt; ich will ja sie selbst nicht schauen, nur ihre Fenster. Und jetzt lassen Sie uns gehen, mir wird's mit einmal zu enge hier in Ihren vier Wänden!«
Sie brachen auf und gingen langsam, schweigend, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, durch die stillen Gassen. In der Nähe des alten Thores, in anmutiger Lage, stand ein freundliches Haus; hinter den spiegelnden Fenstern und vor den weißen Gardinen standen blühende Blumen. Hier zeigte Severin empor und Stahl verstand ihn. Seine Augen flammten heller auf, sie bohrten sich unverwandt gegen die spiegelnden Scheiben, als wollten sie hindurch schauen, ob sie nicht dahinter einem lieben, geliebten Antlitz begegneten, aber alles war vergebens. Severins Atem ging rascher, aber[218] seine Augen hafteten am Boden, und er hob sie erst wieder frei, als er mit seinem Begleiter das alte Thor passiert hatte und auf der Straße hin schritt, die langsam die Höhe hinan lenkte.
Es war ein schöner Herbsttag; das Laub an den Obstbäumen, sowie jenes in dem aus der Niederung hergrüßenden Walde färbte sich und die Luft war durchsichtig klar, so daß nach allen Seiten hin freundliche Landschaftsbilder sich aufthaten. In Hans Stahl erwachte der Künstler, so daß er einigermaßen das andere vergaß, und langsam ausschreitend in seiner gewohnten, harmlos heiteren Weise plauderte.
So langten sie endlich in dem hoch und hübsch gelegenen Oberdorf an. Severin lud den Gefährten ein, ihn zu seinen Eltern zu begleiten; dieser aber wollte bei Erörterung einer Familienangelegenheit – und daß es sich um eine solche handle, wußte er aus den Mitteilungen des jungen Mönchs – nicht stören. Er gedachte nach dem Gasthause zu gehen, dessen freundlicher und hochgelegener Garten einladend von fern ihm winkte, und dort auf Severin zu warten, um mit ihm den Rückweg anzutreten, und so that er auch trotz allen Zuredens des andern.
Er betrat den Garten und war erstaunt, einen derartigen auf dem Dorfe zu finden. Hier waren nicht bloß alte Bäume, Kastanien und Linden, von denen erstere freilich schon einigermaßen entlaubt waren, sondern auch schöne Blumenbeete im Schmuck des Herbstes, ein kleiner Springbrunnen, der seinen silbernen Strahl klingend in ein von Goldfischen belebtes Bassin fallen ließ, und einige hübsche Lauben. Er setzte sich in der Nähe eines Gebüsches nieder, das den Blick auf den Eingang einerseits, den Auslug in das Land andererseits freigab, ihn selbst aber den Blicken anderer Gäste beinahe völlig entzog und bestellte sich einen guten Trunk.
Es war still, so daß man das Fallen eines welken Blattes[219] vernehmen konnte, aber schon nach wenigen Sekunden ward die Ruhe unterbrochen durch ein nicht zu verkennendes Geräusch – das Aufschlagen von Kartenblättern auf einem Tische, und Stahl lugte durch das Buschwerk und bemerkte auch jetzt unfern von sich an einem Tische drei Herren, die sich am Spiel ergötzten, und – wie einige geleerte Weinflaschen zeigten – auch einen guten Tropfen nicht verschmähten. Von zweien sah er die Gesichter, die gerötet schienen vor Erregung oder von Wein, der Dritte aber kehrte ihm den Rücken zu, und doch schrak Stahl bei seinem Anblick zusammen: Das konnte kein anderer als Haller sein.
Als der Wirt kam, ihm das Verlangte zu überbringen, frug er diesen nach den Herren, und der erwiderte halblaut und in redseliger Manier:
»Der mit dem runden Hut und der roten Nase ist der Baron Nedam, der eine halbe Stunde von hier ein Gut hat, der andere, der die Karten hält, ist ein Ziegeleibesitzer, ein reicher Herr, und der Dritte ist der Dr. Haller aus der Stadt, ein junger Lebemann, der eine sehr hübsche Frau haben soll, aber mir scheint, sich wenig um sie kümmert. Die drei können etwas leisten im Trunk, und das Spiel geht auch manchmal höher als es soll – aber darüber will ich nicht reden – –«
Einer von den Dreien schlug an seine leere Flasche, und der Wirt sprang auf:
»Schon wieder leer – entschuldigen Sie!«
Stahl saß da mit brennenden, lauernden Augen wie ein Raubtier, und hätte sich am liebsten vorgestürzt gegen den Verhaßten; der Tropfen in seinem Glase schmeckte ihm bitter, aber er hätte jetzt nicht fortgehen mögen um alles in der Welt.
Er hörte Haller sprechen – frivol und zotenhaft, und die andern lachten, während der Horcher die Zähne gegeneinander preßte, er sah ihn trinken, richtiger, ein Glas um das andere hinunterstürzen, und dabei zog er immer aufs neue die Börse – er spielte offenbar mit Verlust.
»Ja – Glück in der Liebe, Herr Doktor!« lachte der Ziegeleibesitzer. – »Ich dächte, wir hörten für heute auf, Ihr Frauchen wird schelten, wenn Sie so spät zu Tische kommen, Sie sind ja noch in den Flitterwochen!«
»Ach, das hat sich ausgeflittert – und unter dem Pantoffel stehe ich nicht,« lallte Haller – »überdies müßt Ihr mir Revanche geben, nachdem Ihr mich ausgezogen habt.«
»Das nächste Mal, lieber Haller,« sprach der Baron.
»Nein, heute, heute – das wäre mir eine feine Art,« schrie der Doktor.
Jetzt trat der Wirt mit einem kleinen Mädchen zu dem Tisch heran und sagte:
»Mit Verlaub, Herr Doktor, die Kleine sucht Sie, der Müller im Malschthal hat sich mit der Sense arg am Bein verletzt, ob Sie nicht kommen wollten, es blutet sehr.«
»Bindet die Geschichte zu! Der Müller kann schon ein wenig Blut lassen, ich hab' jetzt keine Zeit, komme später – vorwärts, ihr Herrn!«
»Na, Doktor, ich dächte doch, Sie sähen nach dem Manne; wenn die Leute erst schicken, muß es schlimm sein!«
»Ach, davon verstehen Sie den Teufel! Wer giebt Karten?«
»Ich spiele heute nicht mehr!« sagte der andere.
»Das ist Bauernmanier!« schrie Haller, der Baron aber erwiderte kalt:
»Werden Sie erst nüchtern, ehe Sie mit anständigen Leuten weiter verkehren!«
Er erhob sich, auch der Doktor sprang auf, schlug auf den Tisch, daß die Weinflaschen klirrten und klangen und brüllte:
»Von Euerm Anstand ist wenig zu lernen, Ihr Landdragoner, Ihr Bauernfänger – –«
Der Ziegeleibesitzer lachte; der Baron aber, welcher gleichfalls sehr betrunken war, verlor den Rest seiner Ruhe:
»Sie sind ein betrunkener Lump; Sie gehören zu Ihren[221] Patienten und zu Ihrem Weibe, aber die Einen bringen Sie um, und das Andere sind Sie nicht wert!«
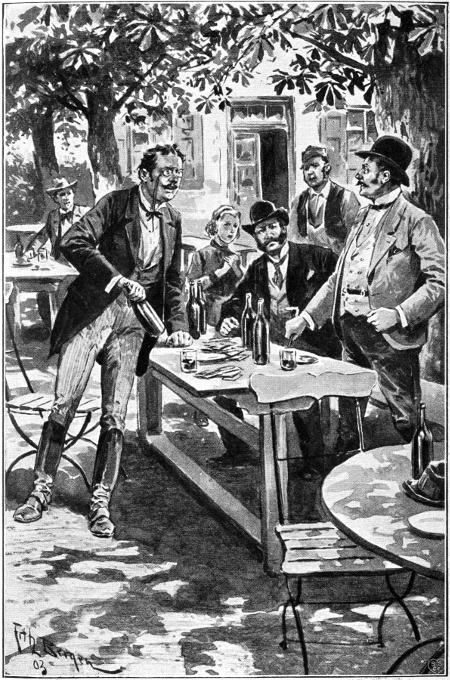
Haller ergriff seine Flasche und schleuderte sie nach dem Kopfe des Barons, welcher geschickt auswich und dann dem Wirte sagte:
»Huber, laßt Euren Hausknecht kommen und den Menschen hinauswerfen – sonst setze ich keinen Fuß mehr zu Euch!«
»Ach, Herr Doktor, wollen Sie nicht nach dem Malschthalmüller sehen – bitte, lieber Herr Doktor,« sagte der Wirt flehend und in höchster Verlegenheit; der Doktor aber, welcher sich jetzt gegen den Baron stürzen wollte, brach bei dem Stuhle lallend zusammen.
Verächtlich drehte sich sein Gegner um, zu dem Wirte sagte er: »Laßt das Schw… liegen, bis der Rausch vorüber ist« – und zu dem Ziegelbrenner: »Kommen Sie, Lederer!« Die beiden bezahlten ihre Zeche und entfernten sich, den Trunkenen aber hob der Wirt auf eine Bank und lehnte ihn in eine Ecke – er schien dessen Zustand bereits zu kennen; dort lallte dieser noch einige unverständliche Worte, dann sank ihm das Haupt auf die Brust.
Hans Stahl schüttelte es vor Ekel und Wut; er konnte es kaum erwarten, bis Severin kam. Mit dem früh hereinbrechenden Herbstabend erschien er, und er erschrak beinahe über das Aussehen Stahls. Der faßte mit seiner feuchten kalten Hand nach der Rechten des Mönchs und führte ihn schweigend vor den Trunkenen. Der lag da, den Kopf zurückgebeugt auf die Lehne der Holzbank, das Gesicht fahl, die Haare wirr in die Stirn hängend, mit stumpfem, blödem Ausdruck.
»Das ist der Mann von Therese Holbert! Kommen Sie, Severin, damit ich die Bestie nicht im Schlafe erwürge; ich kämpfe schon lange genug mit mir!«
Er zog den Kapuziner mit sich fort; schweigend gingen[222] sie durch den Abend, der seinen Schleier über das Thal auszubreiten begann, und als sie das Städtlein unter sich liegen sahen, schimmerten schon einzelne Lichter herauf. Da sie bei Hallers Wohnung wieder vorüberkamen, blickte Stahl empor, seine Linke preßte er heftig gegen das Herz, und Severin hörte ihn murmeln: »Armes junges Weib!«
Er ging mit dem Kapuziner bis an das Klösterchen; hier beim Abschied ergriff er dessen Hand und hielt sie fest:
»Severin – das unselige junge Weib hat hier keinen Freund, sehen Sie zu, was Sie ihr an Trost geben können! Sie kennen sie ja auch und wissen, daß sie Besseres wert war, als an diesen Menschen geschmiedet zu werden. Machen Sie's wieder gut, daß Sie die Beiden zusammengegeben haben. Und nun versprechen Sie mir, daß Sie mir schreiben wollen, wenn das Vieh ihr auch nur ein Haar krümmt – ich komme und wenn ich auf dem Sirius wär', und wenn ich ihn zum zweiten Male angreife, kommt er nicht lebendig davon!«
Den jungen Mönch überlief ein Schauer.
»Versprechen Sie mir's!«
»Ich werde ihr beizustehen suchen, wenn's notthut – und sollt' es mein Herzblut kosten!« sprach Severin, und seine Stimme zitterte, sowie seine Hand.
Stahl ließ diese plötzlich los; er sah dem jungen Mönche in das bleiche Gesicht, in die verschleierten Augen – und wie er ihn so anschaute beim blassen Mondlicht, das sich auf seine Züge legte und ihm den zuckenden Mund zeigte, da erschrak er beinahe.
»Severin, auch Sie lieben Therese …«
»Verzeih' mir's Gott!« stammelte der Mönch.
»Severin!« schrie Stahl auf – und dann hielten sich die Beiden einen Augenblick fest umschlungen – sie wußten, daß sie verbündet waren durch ihre Entsagung.



Rom!
Es liegt ein seltsamer Zauber um die sieben Hügel, der das Herz ergreift, und die Seele erhebt. Stadt der Cäsaren, die den Vollglanz einer alten, bis in die fernsten Zeiten nachwirkenden Kultur schaute, um deren gewaltige Trümmerreste und Gräbermale der Hauch einer großen Geschichte wittert – Stadt, in der die Kunst des Mittelalters ihre wunderbaren Tempel und Paläste baute, in der die größten Genien unvergänglich schufen, so daß das schönheitsdürstende Gemüt andachtsvoll zu ihren Schöpfungen wallt, und junge Künstlergeschlechter sich Begeisterung trinken an dem ewig frischen Brunnen – Stadt, in welcher der glaubensstarke Katholik den Mittelpunkt religiösen Lebens sieht, wo der Statthalter Gottes auf Erden thront in seiner Majestät und Würde, und von welcher Segen Und Fluch ausgegangen ist Jahrhunderte hindurch über Völker und Könige – ewige Stadt, dir giebt es keine vergleichbar!
Wer auf dich niederschaut von der Höhe des Monte Pincio, dem prägt sich dein Bild unverwischbar in die Seele, und er braucht nicht aus der Fontana Trevi getrunken zu haben, um die ewige Sehnsucht nach dir im Herzen zu tragen. Wer aus dem Grün der Laubengänge des alten »collis hortorum« auf die Terrasse hinaustritt an einem schönen[224] Abend, wenn es belebt wird in den Schattengängen, und wenn leise verhallend die Musik der Militärkapelle von der Passeggiata herklingt, der hat die Stadt in ihrem ganzen Reize und bei voller Stimmung unter sich. Ueber die Piazza del Popolo hinweg schweift der Blick hinüber auf das andere Ufer des Flusses, dessen Gewässer hier nicht sichtbar wird, nach dem herrlichen Juwel der Papststadt, der gewaltigen Kuppel von St. Peter, die machtvoll hinausragt über die von Grün umwobenen Paläste und Bauwerke des Vatikans, während mehr zur Linken das massive Bauwerk der alten Moles Hadriani, der Engelsburg, sich erhebt, deren ehernes Engelsbild vom letzten Sonnenschein übergossen wird. Und das trunkene Auge schweift weiter bis an die blauende Hügelkette, welche den Horizont begrenzt und deren Cypressen- und Pinienwäldchen sich deutlich von letzterem abheben.
Und wenn Du hineinschaust in die Stadt am linken Ufer des Flusses, da will der Anblick Dich fast verwirren und betäuben. Es ist eine erdrückende Fülle von Häusern, dazwischen ragende Paläste und zahllose Türme und Kuppeln, wie heiliger Sinn und weltliche Kunst sie neben einander gebaut haben. Und Gegenwart und Vergangenheit so nahe an einander gerückt! Ueber Kirchen und Gassen, über die Bauwerke und Gärten des königlichen Quirinals schweift das Auge suchend weiter gegen Süden, wo auf dem alten Capitol hinter dem Kloster Aracoeli sich die Trümmerreste der Cäsarenzeit erheben und vor dem Palazzo Caffarelli die Säule Marc Aurels auf der Piazza Colonna sichtbar wird.
Die Sonne war gesunken und vom Pincio herab nach der Piazza del Popolo schritt langsam ein behäbiger Herr in der Mitte der fünfziger Jahre. Er trug einen langen, dunklen Rock, auf dem Haupte einen breitrandigen Hut, wie ein Abbate, und an den kräftigen Beinen violettseidene Strümpfe. Die Füße staken in Schuhen, deren Silberschnallen hell blinkten. Es war ein kirchlicher Würdenträger, das sah[225] man an der ganzen Erscheinung. Das glattrasierte Gesicht, das infolge des kurzgeschorenen Haares noch voller erschien, hatte ein gutmütiges Gepräge, und die kleinen dunklen Augen, welche unter den dicken Lidern lagen, schauten recht verständig in die Welt.
Der Mann kannte das Bild der ewigen Stadt vom Monte Pincio aus genugsam, war er ja ein Kind Roms, und doch ging er immer wieder hinauf in die herrlichen Gärten der Villa Medici und konnte nicht scheiden, ohne von der Terrasse noch einmal herabgeschaut zu haben auf seine geliebte Stadt. Der Abend war ungewöhnlich warm und der geistliche Herr nahm den breitrandigen Hut ab und wischte sich mit einem seidenen Taschentuche im Weiterschreiten die Stirne. Er schritt langsam vorüber an dem Obelisk, den Kaiser Augustus einst aus Heliopolis gebracht und Papst Sixtus V. hier aufgestellt hatte und bog dann in die schnurgerade lange Via di Ripetta ein. Bei San Agostino wandte er sich nach rechts in das Gewirr kleiner Gassen und Gäßchen, die jetzt minder belebt waren und schlug augenscheinlich die Richtung nach der Via del Governo ein.
Die Leute, welchen er begegnete, grüßten ihn vielfach sehr ehrfürchtig, und ein ehrsamer Handwerker, der neben einem Fremden vor seiner Hausthür stand, sagte zu diesem, als der Priester mit den violetten Strümpfen vorüber gegangen:
»Das ist der Monsignore Parelli, der das prächtige Haus in der Via del Governo hat; ein braver und reicher Herr, der auch bei mir arbeiten läßt. Er ist auch immer mit mir zufrieden gewesen, und ich hoffe, Signore, daß Sie es auch sein werden. Ja, er ist Bischof.«
»Bischof?« fragte der andere – – »wohl in partibus?«
»Was ist das?« fragte der Handwerker.
»Nun, ich meine, er hat keine eigentliche Diözese zu verwalten, sondern führt den Titel von einem Gebiete, das zur[226] Zeit noch in den Händen von Ungläubigen ist, deshalb in partibus infidelium.«
»Da mögen Sie recht haben – ich habe seine Unterschrift gesehen, da stand Bischof i. p. von Mikrun. Mikrun ist meines Wissens nicht in Italien.«
»Das liegt vielleicht in Asien oder Afrika. – Nun, Gott befohlen, Meister!«
»Felice notte Signore!«
Der Fremde ging und sah den Bischof noch eine kleine Weile unfern vor sich hinwandern, dann entschwand er ihm um eine Ecke. Der Bischof war in eine schmale Via eingebogen und ging immer langsamen Schrittes weiter. Die Dämmerung war langsam in die Gassen gesunken, da bemerkte er in einem Winkel, der von einem Hausvorsprung gebildet wurde, eine zusammengekauerte Gestalt und hörte ein Schluchzen.
Er trat näher und sah einen etwa dreizehn- bis vierzehnjährigen Jungen. Die nackten braunen Beine hatte er an den Leib gezogen, seine Kleidung bestand aus verschlissenen Kniehosen und einer schäbigen Sammtjacke, auf dem Kopfe trug er weit zurück geschoben einen zerknitterten alten Filzhut, unter welchem dunkle Locken hervorquollen; die gebräunten Hände aber lagen über dem Gesicht.
»Was fehlt dir, mein Junge?« fragte der Prälat, indem er teilnahmsvoll näher trat, und der Bursche ließ die Hände sinken und blickte auf. Er hatte ein prächtiges Gesicht mit dunklen, großen Augen, die er nun ehrlich und befangen auf den vornehmen Priester heftete. Dann sprang er auf und sagte:
»Ich habe heute noch nichts gegessen – ach, Monsignore, haben Sie keine Arbeit für mich?«
Den Bischof ergriff Mitleid mit dem Burschen, dessen Worte so ungeschminkt klangen, und der nun, ohne Unterwürfigkeit zu zeigen, oder wie es sonst vielleicht geschehen[227] wäre, ohne nach seiner Hand zu fassen, um sie zu küssen, vor ihm stand; er sagte darum:
»Komm mit mir, ich will Dir zu essen und zu arbeiten geben!«
Da leuchteten die dunklen Augen des Burschen auf, er stammelte einige abgerissene Dankesworte und ging nun neben dem Prälaten her, der ihn nach seinen Familienverhältnissen befragte. Der Knabe antwortete bescheiden, aber mit ruhiger Sicherheit. Er hieß Sisto Brenta und war der Sohn armer Leute in der Campagna. Sein Vater war schon lange tot, die Mutter vor zwei Tagen begraben worden. Verwandte, die ihn aufnähmen, hatte er nicht, und so war er in die große Stadt gegangen. Er bettelte nicht um Brot, sondern um irgend eine Arbeit, aber den ganzen Tag hatte er sich in den Gassen herumgetrieben, war von Haus zu Haus gegangen, aber er fand nicht, was er suchte. Nun war er hungernd und verzweifelnd in einem Winkel zusammengesunken, wo er auch hatte übernachten wollen. Den heiligen Sixtus, seinen Patron, hatte er noch angerufen, dann aber war der Jammer über ihn gekommen, und so hatte ihn Parelli gefunden.
Das erzählte Sisto, und der Prälat hatte mit unverkennbarem Wohlwollen die schlichten Mitteilungen angehört, und war während derselben mit seinem jungen Begleiter auf eine breite, belebte Straße gekommen. Vor einem großen Gebäude stand er still und sagte:
»Hier sind wir zu Hause, komm!«
Der Knabe starrte ihn verwundert mit seinen großen Augen an, dann folgte er ihm nach wie ein Hund. Ueber teppichbelegte Treppen, zwischen Marmorsäulen stiegen sie empor nach der Beletage, wo ein galonnierter Diener respektvoll den Bischof grüßte und mit Befremden den Betteljungen ansah, der hinter ihm dreinschritt. Durch einige prachtvoll eingerichtete Gemächer mit Bildsäulen und Gemälden waren[228] sie gegangen, in welchen der barfüßige Bursche aus der Campagna mit großen, staunenden Augen flüchtige Umschau hielt, als ihnen aus einem Seitengemache eine Dame in dunklem Seidengewande entgegentrat und befremdet nach dem Begleiter des Prälaten schaute. Sie mochte ungefähr vierzig Jahre alt sein, und war stolz und schön.
»Signora Lucia, der Bursche hat Hunger und sucht Arbeit! Haben Sie die Güte, sich seiner anzunehmen und ihm für heute zunächst ein Obdach zu schaffen, morgen wollen wir sehen, was wir weiter mit ihm anfangen,« sprach Parelli.
Um den schönen Mund der Dame zuckte es einigermaßen spöttisch, da sie erwiderte:
»Da hat wohl Ihr gutes Herz wieder zu laut geredet. Nun, ich will den Burschen Giovanni übergeben, daß er vor allem ihn sich reinigen läßt – –«
»Nein, nein – vor allem muß er zu essen bekommen, er hungert heute den ganzen Tag!«
»Das hat er Ihnen wohl gesagt?«
Aus den Augen des Knaben blitzte es beinahe zornig.
»Ich lüge nicht!« sagte er beinahe heftig, und dann duckte er wie erschrocken vor dem Worte zusammen und sprach bittend zu dem Prälaten gewendet: »Verzeihung, Monsignore!«
Dieser hatte die Glocke gezogen, und als der Diener fast unmittelbar darnach eintrat, übergab er ihm den Knaben und band ihm auf die Seele, in bester Weise für Nahrung und Obdach zu sorgen. Da küßte ihm der braune Junge die Hand, sah ihn noch einmal an mit einem unbeschreiblich tiefen Blick des Dankes, und dann folgte er dem Diener.
»Ich hoffe, daß der Bursche mit seinem frechen Wesen sich nicht etwa hier einnistet,« sagte nun die Dame, und Parelli, der einigermaßen verlegen schien, sprach freundlich, indem er begütigend seinen Arm leicht um ihre Taille legte:
»Aber, teure Lucia, wenn der Junge Unterstützung[229] braucht und ihrer wert ist … Ich denke, daß ihn der Himmel mir in den Weg geführt hat. Lassen wir ihn erst einmal einige Tage hier, und sehen wir zu, wie er sich anstellt – Du hast doch sonst ein so gutes Herz!«
Sie lächelte seltsam und schwieg; dann schritten sie gemeinsam nach dem Speisezimmer, wo bereits der Tisch gedeckt war und wo sie zusammen Platz nahmen an demselben. Die Dame war ja – und die Diener wußten es nicht anders – eine ziemlich nahe Verwandte des Prälaten und hatte das Recht, an seinem Tische zu sitzen und in seinem Hause zu repräsentieren.
Am andern Morgen dachte Parelli sogleich seines Schützlings und erkundigte sich nach demselben. Sisto hatte im Fluge sich bereits die Gunst der Dienerschaft gewonnen durch freiwillige und geschickte Hilfeleistungen und durch sein ganzes munteres Wesen. Giovanni, der Kammerdiener, hatte ihm einen besseren Anzug verschafft, und als er so, mit sauberem Hemd unter der blauen Tuchjacke, mit bunten Strümpfen und Schuhen vor den Prälaten hintrat, war dieser erstaunt über den bildhübschen Burschen, der ihm ehrfurchtsvoll und dankbar die Hand küßte, und er fragte ihn:
»Willst Du bei mir bleiben, Sisto?«
In den prächtigen Augen des jungen Campagnolen leuchtete es auf in glücklichem Glanze:
»Oh, gnädigster Herr – Euch gehört mein Leben!« stammelte er. »Braucht mich, zu was Ihr wollt; was ich nicht kann, werde ich lernen, ich will ja nur arbeiten, und möcht' es am liebsten für Euch!«
»Nun gut, so magst du zuerst dem Gärtner helfen, und wenn es Besorgungen giebt, sollst Du mein Läufer sein!«
Der Knabe nickte wortlos und aus seinen Augen stahlen sich einige Thränen, welche auf die Hand des Prälaten niederfielen, als er sie abermals küßte.
So war der Hirtenjunge aus der Campagna in das glänzende Haus des Bischofs gekommen, und hatte hier nur einen Menschen, der ihm nicht wohlwollte – Signora Lucia. Sie wußte sich selbst nicht Rechenschaft zu geben, weshalb ihr der Bursche nicht gefiel vom ersten Augenblick an, da sie ihn gesehen hatte, und das Empfinden schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Sisto wich der Dame möglichst aus, zeigte sich aber auch ihr gegenüber dienstfertig, wenngleich ohne Unterwürfigkeit. Der Prälat hätte ihn halten dürfen wie seinen Sklaven, wenn aber Signora Lucia ihm eine Weisung in scharf befehlendem Tone gab, schoß ihm eine heiße Blutwelle durch das braune Gesicht, ein Blitz des Trotzes zuckte durch die Augen, er biß wohl auch die weißen Zähne zusammen, aber er gehorchte.
Parelli gewann den Burschen täglich lieber, der hundert kleine Künste verstand, mit prächtiger Stimme die Volkslieder der Campagna sang, den Dudelsack mit wahrer Virtuosität spielte, und dem neben der Lebenslust auch die Treue und Liebe zu seinem Herrn aus den Blicken leuchtete. Bald durfte Sisto auch ungerufen bei ihm erscheinen, und er fand eine gewisse Freude daran, den ungebildeten Jungen in Diesem und Jenem zu unterrichten, zumal die Sorge für seine Diözese ihm viel freie Zeit ließ. All das aber machte den Jungen bei Signora Lucia nur noch verhaßter; man hätte an eine Art Eifersucht beider Dame glauben können, und das erschien besonders begreiflich, da sie trotz ihres großen Einflusses auf den Prälaten diesen doch nicht dazu zu bewegen vermochte, daß er den Jungen aus dem Hause gab. Sisto war ihm anfangs lieb geworden, wie eine Art von Spielzeug für müßige Stunden, später aber fand er in dem aufgeweckten treuen Burschen mehr.
Auch Giovanni, der Kammerdiener, hätte Grund zur Eifersucht haben können, wenn er nicht einerseits Sisto wirklich lieb gehabt, und andererseits sich nicht gefreut hätte über[231] die mannigfache Entlastung, die er in seinem ohnehin nicht schweren Dienst durch den Burschen erfuhr, und Giovanni war sehr bequem. So überließ er das Reinigen des Arbeitszimmers seines Herrn gern dem jungen Gehilfen, und saß in der für sich gewonnenen Zeit entweder in einem Schaukelstuhl oder in der Küche bei der munteren Marietta, dem Küchenmädchen.
Nach Art der Landbevölkerung um Rom war Sisto fromm und bekreuzte sich nicht nur vor jedem Heiligenbild, sondern hatte auch eine demütige Verehrung für die unmittelbaren Diener der Kirche, die Priester, und wenn er in dem Papste selbst die Verkörperung der Heiligkeit erblickte, so ging ein Abglanz von derselben nach seiner Meinung auch auf jeden über, der die heiligen Weihen empfangen hatte. Darum war ihm auch der Bischof von Mikrun eine hoch über der gewöhnlichen Menschheit stehende Persönlichkeit, zumal sein kindlicher und pietätvoller Sinn keine Schwächen an ihm fand oder mindestens nicht an solche glauben mochte.
Eine ähnliche unterwürfige Verehrung brachte er auch den zahlreichen geistlichen Besuchern entgegen, welche in das vornehme und gastfreie Haus des Prälaten kamen, und mancher von jenen fand wiederum sein Wohlgefallen an dem hübschen, demütig-frommen Jungen. Nur bei einem machte Sisto eine Ausnahme, und dieser war der Jesuitenpater Felice. Er war lang und hager mit einem blassen, scharfgeschnittenen Gesicht und einem Paar stahlgrauer, scharfblickender Augen. Wenn er mit seinem langsamen, fast lautlosen Schritt kam, verbarg sich der Knabe, wenn es irgendwie anging, denn der dunkelgekleidete Mann mit dem breitrandigen Hute war ihm beinahe unheimlich, trotzdem er ihm nie etwas gethan, im Gegenteil immer freundlich mit ihm war.
Felice erschien sich der besonderen Gunst von Signora Lucia zu erfreuen, die sich gern mit ihm unterhielt, deren[232] Beichtiger er auch war, so daß er infolgedessen wohl öfter als andere im Hause Parellis verkehrte.
Das Unbehagen, welches Sisto beim Anblick des Jesuiten empfand, hatte sich besonders gesteigert, seit er eines Morgens Gelegenheit gehabt hatte, einen Teil eines Gesprächs anzuhören, das er zwar nicht recht verstand, das ihm aber doch den Eindruck machte, als ob Felice einen unheimlichen Zwang auf den Bischof ausübe. Er hatte im Garten hinter einem Boskett gearbeitet, und die beiden Priester, welche zwischen den grünen Gehegen dahingeschritten waren, blieben in unmittelbarer Nähe derselben stehen, unbekümmert um den Knaben, welchen sie vielleicht auch gar nicht bemerkt hatten.
»Ich halte einen solchen Glaubenssatz für bedenklich und zweifle auch, ob er angenommen wird!« sagte der Prälat.
»Aber von einem Bedenken kann doch keine Rede sein!« – klang halblaut, aber bestimmt und scharf die Stimme des anderen – »das Ansehen der Kirche verlangt gerade in unseren Tagen eine derartige Stellung des heiligen Vaters; und weshalb sollte man an der Annahme zweifeln?«
»Weil es bekannt ist, daß die deutschen Bischöfe dagegen sind.«
»Und was thut das? Bei der Abstimmung bleiben sie in der Minorität. Der Kirchenstaat allein zählt hundertdreiundvierzig Bischöfe.«
»Aber sie haben keine christlichen Seelen hinter sich.«
»Darauf kommt's nicht an. Die bischöfliche Gewalt und die bischöflichen Rechte sind für alle gleich, und Eure Bischöflichen Gnaden dürfen nicht vergessen, daß die Vorarbeiten hier in Rom gemacht werden, ebenso die Geschäftsordnung.«
»Das will eben mir nicht ganz gefallen. Die Art und Weise, wie die Arbeiten der vorbereitenden Kommission geheim gehalten werden, und daß die Mitglieder bei Strafe der Ausschließung aus der Kirche niemandem etwas davon mitteilen dürfen, ist der Kirche Christi nicht ganz würdig.[233] Christus selbst und die Apostel kannten keine solche Geheimthuerei.«
»Es ziemt sich nicht, gegen die weise Einsicht des heiligen Vaters zu remonstrieren. Wer ein guter Katholik, ein treuer Anhänger des Stuhles des heiligen Petrus ist, weiß, wie er sich zu verhalten hat, und Eure Bischöflichen Gnaden sind Seiner Heiligkeit zu besonderem Danke verpflichtet, man hofft, daß Sie das nicht vergessen werden!«
Die Stimme des Paters hatte bei aller Geschmeidigkeit einen beinahe strengen Ton angenommen, und Sisto, welcher durch das Laubwerk des Bosketts schaute, sah aus seinen Augen einen fast feindseligen Strahl gegen seinen Herrn und Gönner blitzen, so daß sich ihm unwillkürlich die Hand ballte. Die beiden Männer gingen weiter, und der Knabe, welcher ihnen nachblickte, schauderte zusammen, wie er die hohe, hagere Gestalt des Jesuiten sich über den Bischof beugen sah, wie wenn eine dämonische Gewalt übermächtig in dessen Leben und Wollen eingriffe.
Seitdem war es Sisto beinahe unheimlich, wenn Felice im Hause erschien.
Das war wieder eines Vormittags der Fall. Parelli war nicht daheim, als er kam, aber er fühlte sich hier völlig zu Hause, und die Diener, welche wußten, welches Ansehen er bei der Signora hatte, meldeten dieser sein Kommen. Er hatte indes das Bibliothekzimmer betreten und schritt mit seinen leichten, unhörbaren Schritten in demselben auf und nieder, und blieb nur stehen, um da und dort eines der Bilder zu betrachten, welche an den Wandpfeilern und in der Nähe der Fenster hingen und den Kunstsinn und feinen Geschmack des Besitzers bekundeten. Den Jesuiten fesselte besonders ein wunderhübsches, echtes Gemälde von Claude Lorrain mit tanzenden Mädchen, prächtigen, duftenden Gestalten im Waldesgrün, und eine ganz ausgezeichnete Kopie von Morettos »Herodias«.
Vor der letzteren stand er noch, als die Signora, noch immer in dunkler Seide, hereinrauschte. Sie begrüßte den Gast mit einer gewissen Vertraulichkeit, und dieser sagte:
»Wissen Sie, daß diese Herodias Ihnen ähnlich sieht?«
»Monsignore hat das auch behauptet, ich verwahre mich dagegen.«
»Gewiß – Sie würden nicht den Kopf eines Heiligen abzuschlagen begehren, aber dafür richten Sie Unheil an in anderen Köpfen.«
Die Signora lächelte bei der nicht gerade feinen Schmeichelei, und bot dann dem Besucher einen Sitz mit dem Bemerken, daß der Prälat bald aus der Kirche S. Jesu zurückkehren müsse, wo er den Gottesdienst zelebriere.
»Es ist mir lieb, daß ich Sie allein treffe, meine Freundin,« sagte Felice, »und daß ich Ihnen sagen kann, daß Sie allen Einfluß aufzubieten haben, daß der Bischof sich nicht gegen den Glaubenssatz stellt und so sich unangenehmen Folgen aussetzt. Er ist etwas freisinnig angekränkelt und wir haben schon lange ein Auge auf ihn, aber wir sind duldsam, so lange er nicht ein selbständiges, der heiligen Vereinigung unseres Ordens und dem päpstlichen Stuhle widerstrebendes Verhalten zeigt. Wir lassen einem jeden seine Privatanschauung und mischen uns auch nicht in seine privaten Beziehungen« – er hob bei diesen Worten bedeutsam die Augenbrauen – »so lange er ein unbedingt gehorsamer Sohn der Kirche ist. Auf seine Zustimmung zu dem neuen Glaubenssatz wird mit solcher Sicherheit gerechnet, wie auf die Stimmen der anderen italienischen Bischöfe, die nicht erst zu prüfen und zu erwägen, sondern einfach abzustimmen haben. Wenn ich das Ihnen sage, so wissen Sie, warum es geschieht, Signora.«
Frau Lucia senkte mit einem leichten Erröten auf dem immer noch schönen Gesichte das Haupt und sagte:
»Sie und Ihr hochwürdiger Orden dürfen immer auf[235] mich zählen, und so lange ich in diesem Hause Einfluß habe – –«
In diesem Augenblicke klirrte es im Nebenzimmer, dem Arbeitsgemache des Prälaten, als ob etwas herabgefallen und zerschmettert worden wäre. Beide sprangen auf und eilten, in der Meinung, Parelli sei zurückgekommen, dahin. Als sie die Thür öffneten, sahen sie einen seltsamen Anblick. Unweit vom Eingang bei der Bibliothek lag auf dem Boden eine immerhin wertvolle Vase, die auf einer Säule gestanden hatte, zertrümmert auf dem Fußboden und dabei stand Sisto, dem alles Blut aus den Wangen gewichen schien, mit gefalteten Händen und weitgeöffneten, auf die Scherben gerichteten Augen.
»O Signora,« stammelte er, als er Lucias ansichtig wurde, diese aber stürzte wild und zornig auf ihn zu.
»Du hast gelauscht, verdammter Spitzbube!« kreischte sie, und dann erfaßte sie den Knaben mit der Linken bei seinen dunklen Locken und während sie ihn hin- und herzerrte, schlug sie ihn in das Gesicht. Es war nur ein einziger Schlag, und ihm folgte ein Aufschrei, so grauenhaft und entsetzlich, daß das Weib und der Jesuit gleichzeitig davor zurückfuhren: das war Schmerz, trostloser Jammer und leidenschaftliche Wut zugleich. Vor ihnen aber stand Sisto und sah mit unheimlich großen und unheimlich funkelnden Augen nach Lucia; indes sich seine Hände schmerzhaft ballten, zog ihm eine Art Krampf die Oberlippe empor, so daß die blanken, weißen, fest aufeinandergebissenen Zähne zwischen den roten Lippen hindurchschimmerten, und der Körper beugte sich vor wie zum Sprunge. Die ganze Erscheinung hatte etwas von einem jungen, zu höchster Wut gereizten Raubtier, das sich eben mordgierig auf seinen Gegner werfen will.
Pater Felice war wieder vorgesprungen, aber sein Dazwischentreten hätte wohl wenig gefruchtet, wenn nicht eben jetzt Parelli erschienen und laut und bestürzt gefragt hätte:
»Was bedeutet das?«
Beim Klange seiner Stimme durchlief den Körper des Knaben ein Zittern, die geballten Fäuste lösten sich, die Spannung in seinem ganzen Wesen hörte plötzlich auf, und mit heiß hervorquellenden Thränen stürzte er zu den Füßen des Prälaten nieder:
»O, Monsignore, – ich habe die Vase zerschlagen beim Abstäuben – schlagt mich – stoßt mich mit Füßen – von Euch will ich alles dulden, aber sie soll mich nicht schlagen, ein Weib nicht – das ertrage ich nicht!«
Und wieder schüttelte es den jungen Körper wie im Fieberfrost, so daß Parelli mitleidig auf ihn niederschaute und freundlich sprach:
»Steh auf, Sisto – Du sollst gar nicht geschlagen werden!«
»Aber sie hat mich geschlagen, ins Gesicht geschlagen!« schrie er wieder auf und nun war ihm die Röte ins Antlitz wiedergekehrt und die Augen blitzten.
»Er verdient Strafe nicht nur wegen des Schadens, nein, weil er ein Horcher ist, und das ist unverschämt,« sagte kalt die Signora, der Knabe aber rief leidenschaftlich:
»Beim heilgen Sixtus, ich habe nicht gehorcht!«
»Und er ist wie ein zorniges Tier, vor dem man sich fürchten muß, und darum muß er aus dem Hause,« sprach das Weib leidenschaftlicher, und Parelli geriet bei diesem Tone sichtlich in Verlegenheit. Da nahm Felice das Wort:
»Ihr seid zu heftig gewesen, Signora, und vergeßt, daß der Knabe ein Wildling ist, der erzogen werden muß. Wenn er hier fortgejagt wird, wißt Ihr nicht, in welche Hand er fällt, und wie sein Seelenheil gefährdet werden kann. Hier ist er in gesicherter und guter Hand, und Ihr könnt an ihm ein gottgefälliges Werk thun!«
Sisto horchte hoch auf; er sah mit großen, verwunderten[237] Augen nach dem Sprecher und dann nach seinem Herrn. Dieser aber sagte:
»Steh auf, Sisto, und bitte die Signora um Verzeihung für Deine Wildheit, die Du Dir abgewöhnen mußt und dann bleiben wir wieder die Alten.«
Der Knabe atmete einigemale hastig, dann sprang er, blutrot im Gesichte, auf, trat mit gesenkten Augen an Lucia heran und sprach halblaut, mit gepreßter Stimme:
»Vergebt mir, Signora, wenn ich Euch erschreckt habe, bitte!«
Sie sah ihn halb zornig, halb triumphierend von oben her an, und sprach dann:
»Wenn zwei so hochwürdige Herren Dich unterstützen, will ich's vergessen, ich hoffe aber, daß ich nicht wieder Veranlassung habe, über Dich zu klagen!«
Das klang kühl und hochmütig, und Sisto fühlte auch, wie ihn fröstelte bei den Worten. Nun atmete er tief auf, ging zu dem Prälaten, drückte einen langen, heißen Kuß auf dessen Rechte und legte dieselbe dann an seine Brust, während er mit Augen voll unsäglicher Liebe und Hingabe zu ihm aufschaute, so daß dieser gerührt und ergriffen, ihm wie segnend die Hand auf die dunklen Locken legte und dann milde und freundlich sagte:
»So – jetzt bringe hier die Scherben fort!«



In der Nähe der Piazza Colonna steht ein kleines, freundliches Haus mit seinem Gärtchen, in welchem dicht und wirr Taxus und Lorbeer wuchert und dunkle Pinien hinwegschauen über die nicht hohe Mauer. Es gehörte der Witwe eines wenig bekannten Bildhauers, und die unteren Räume, die zum Teil als Atelier eingerichtet waren, bewohnte zur Zeit ein deutscher Maler, Heinrich Quandt, mit seinem jungen Frauchen.
Es war noch früh am Morgen; hell blinkte der Sonnenschein durch die Fenster, und das Paar saß am Frühstückstische. Es war eine prächtige deutsche Erscheinung, die in ihrem ganzen Wesen mit dem blondlockigen Haarwuchs und den lebhaften, leuchtenden Augen den Künstler nicht verleugnete, und die Frau paßte zu ihm wie eine liebliche Ergänzung. Sie hatte braune, sammtweiche Augen, dunkles Haar um die weiße Stirn und sah so kernfrisch und heiter drein, daß es ein prächtiges Bild bot, die beiden in dem ziemlich einfach eingerichteten Raume sitzen zu sehen.
Sie waren aus den sogenannten Flitterwochen lange heraus und nun das vierte Jahr verheiratet, und er hatte seinen Schatz schon immer einmal nach Rom führen wollen, aber immer mußte es verschoben werden. In diesem Herbste machte er ernst und gedachte das Angenehme mit dem Nützlichen[239] zu verbinden: Sein Frauchen sollte die ewige Stadt sehen, und er gedachte einige Studien zu machen.
Er hatte sie auf seinen Schoß gezogen und hielt sie mit dem linken Arm umschlungen, und sie lehnte sich leicht an ihn, indes er plauderte:
»Ist Dir's denn nicht wie ein Traum, Fritzel – er pflegte Friederike so abzukürzen – daß wir hier in Rom beisammen sitzen und während der Herbst daheim alles entblättert und in graue Nebelschleier hüllt, hinaussehen nach einem tiefblauen Himmel und eine Fülle grünender Gärten in der Nähe haben? Das ist ja heute ein köstlicher Tag und herrliches Wetter und geeignetere Stimmung, Dich mit Deinem blühenden Leben zwischen den Ruinen des alten Rom herumzugeleiten, kann es nicht geben. Ist Dir's recht, wenn wir heute gleich dem Forum und was drum und dran hängt, unsern Besuch machen?«
»Ich lasse mich von Dir führen, und wo Du bei mir bist, ist's hübsch; aber Du darfst Deinem dummen Weibchen nicht übelnehmen, wenn es ab und zu einmal eine ungeschickte Frage thut und auf die gütige Nachsicht seines Führers sündigt!«
»Gott bewahre, Schätzchen; frage nur nicht mehr, als ich beantworten kann. Also mache Dich fertig, das Heute gehört den alten Göttern und den Cäsaren, und morgen fangen wir an, das Atelier einzurichten.«
Er küßte sie auf die braunen, lieben Augen und schob sie sanft von sich, und schon kurze Zeit später schritt das Pärchen, Arm in Arm, quer über den Corso, durch dessen glänzende Häuserreihen die junge Frau erstaunt die Augen gleiten ließ, und durch die Via de Muratte, bis sie vor der herrlichen Fontana di Trevi stehen blieben.
Erstaunt, mit glänzenden Augen schaute Friederike zu dem gewaltigen marmornen Meergott auf, der auf seinem von Seepferden gezogenen Muschelwagen thront, während unter seinem von Tritonen geführten Gespann die Wasserfluten[240] spielend hervorbrechen zwischen Klippen und Blöcken, und sich in das weite Becken ergießen, aus dessen ruhigem Spiegel das Bild des blauen Himmels schaut.
»Das ist der Quell, aus dem man nicht trinken darf, wenn nicht seine Wassernymphe uns mit allgewaltiger Sehnsucht hieher zurücklocken soll, Fritzel.«
Die junge Frau lehnte sich inniger auf den Arm des Gatten.
»Du hast wohl daraus getrunken, Heinrich?«
»Gott bewahre, und wenn auch, mich lockt keine Wassernymphe, seitdem ich Dich kenne.«
Dann schritten sie weiter, zwei glückliche Menschen, schön, schlank, träumerisch – echte Deutsche, daran blieb den braunen Römern und Römerinnen, an denen sie vorüberkamen, kein Zweifel. Heinrich Quandt kannte sich hier gut aus. Er lenkte nach dem Platz des Kapitols. An der Rückseite des Senatorenpalastes führte er seine Gattin nach dem alten Tabularium, und von seinem offenen Thorbogen aus ließ er sie einen Blick thun über die in Trümmer gesunkene Herrlichkeit des alten Rom. Da lag das Forum Romanum mit all den Resten einer großen vergangenen Zeit, und schweigend, an einander gelehnt, schauten sie beide darüber hin. Derselbe Sonnenschein, der einst hier den Volksversammlungen geleuchtet, der die Festzüge auf der »heiligen Straße« zum Kapitol heranziehen sah, bei dessen Glanz von der menschenumwogten Bühne her kühne Redner zum Volke sprachen, welche auf den Bauten Julius Cäsars und den Tempeln und Triumphthoren der Kaiser flimmerte, er schien ihnen jetzt noch eben so mild und warm, und die beiden träumerischen Kinder des Nordens sahen mit ihrer lebhaften Phantasie die Ruinen sich beleben von den Bildern der Geschichte, die ihnen hier erst anfingen verständlich zu werden.
Endlich gingen sie weiter – für diesmal sollte es nur ein flüchtiges Wandern sein – vorüber an dem in mehr als[241] einer Beziehung bedeutenden Triumphbogen des Septimus Severus, über dessen Travertin-Unterbau sich schöne Marmorsäulen erheben, zwischen welchen drei Durchgänge hinführen; sie betrachteten darnach die schönen weißen, kannelierten Marmorsäulen des Vespasiantempels, sowie die Reste des auf Granitsäulen sich erhebenden Saturntempels, die Basilika Julia, den Dioskurentempel, und der Künstler konnte es sich nicht versagen, wenigstens einen Blick in die S. Lukas-Akademie zu thun, und seinem Weibe einige besonders schöne Reliefs von Canova und Thorwaldsen zu zeigen, sowie im Salone di Raffaeli sie auf einen seiner Lieblinge: Lukas malt die Madonna und Raffael sieht ihm zu – aufmerksam zu machen.
Sie war so dankbar, so verständnisvoll und glücklich bei seinen Erläuterungen, daß er gar nicht hätte aufhören wollen, sie von einem Schönen zum andern zu geleiten, aber er wußte sich zu beherrschen – es durfte nicht zu viel werden, damit keine Uebersättigung eintrete, und so mahnte er daran, endlich auch an den Leib und seine Bedürfnisse zu denken, und sie wandten sich wieder dem neuern Rom zu, um irgend ein Speisehaus aufzusuchen. Quandt war eine Erinnerung an ein solches mit Garten geblieben, das nicht weit von Aracoeli lag, aber er wußte es doch nicht wieder zu finden und hielt eben Umschau, wen er wohl fragen könnte, als sein Blick auf einmal auf einer Erscheinung haften blieb, so plötzlich, so gebannt, daß er auch den Arm seiner Frau fester an sich zog und mit dem Finger ihr Auge nach jener Richtung lenkte.
Ein gebräunter, armselig aber bunt gekleideter Junge von etwa zwölf Jahren mit nackten Beinen kauerte auf einer Schwelle und sah mit leuchtenden Blicken zu einem andern auf, der zu ihm redete und dabei ein kleines Aeffchen, das ihm auf die Schulter geklettert war, und dessen Fesselkettchen der erstere in der braunen Hand hielt, liebkoste. Der andere aber war etwa vierzehnjährig und trug einen braunen,[242] hübschen Tuchanzug, wie vermögender Leute Kinder, ein spitzes Filzhütchen auf den dunklen Locken und hatte ein prächtiges Gesicht, als ob er aus dem Rahmen eines Bildes von Murillo herausgeschnitten wäre, und dieser andere war Sisto Brenta.
Das Ganze aber bot ein Genrebildchen von köstlichem Reiz für das Malerauge, und Heinrich Quandt, der jetzt sogar den Arm Friederikens freiließ, trat, einem schnellen Antriebe folgend, an die Gruppe heran.
»Du willst ihm wohl sein Aeffchen abkaufen?« fragte er Sisto. Dieser sah einen Augenblick groß und ernst den Fremden an, dann zog er höflich sein Hütchen und sprach:
»Nein, Signor – den würde Beppo auch nicht hergeben, denn er muß mit ihm sein Brot verdienen. Aber wir sind aus einem Dorfe und ich freue mich, daß ich ihn getroffen habe. Es geht ihm schlecht, dem armen Beppo und seinem Piccolo – nicht wahr?«
Und Sisto streichelte das Aeffchen, welches ihn zu kennen schien und sich die Liebkosung gern gefallen ließ.
»Hört, Ihr Beide könntet mir eine Freude machen, und ich würde mich gern dankbar dafür bezeigen. Ich bin Maler und möchte Euch malen, so wie Ihr hier seid; wollt Ihr morgen zu mir kommen?«

»Darf Piccolo mit?« fragte schüchtern Beppo, und Heinrich Quandt erwiderte:
»Freilich, um Deinen Piccolo ist mir's gerade so zu thun, wie um Dich selber; also, willst Du kommen?«
»Ja Herr, gerne, wenn ich weiß, wohin.«
Der Maler nannte ihm seine Adresse und wandte sich dann an Sisto, an dessen prächtigem Kopfe ihm ganz besonders gelegen war. Er wußte nicht recht, wie er diesem beikommen sollte, denn sein feiner Anzug führte ihn einigermaßen irre.
»Und wie ist's mit Dir – mit Euch,« verbesserte er sich, »kleiner Signor?«
»O ich bin kein Signor, ich bin so arm wie Beppo, und wenn ich eine bessere Jacke habe, so verdanke ich sie dem guten Monsignore Parelli, der mich als Diener in sein Haus genommen hat. Wenn er erlaubt, daß ich zu Euch komme, Signor, so thue ich's gerne.«
»Wie, der Bischof Parelli ist Dein Herr? Derselbe, welcher in der Via di Governo wohnt? Den kenne ich, und er mich auch. Hier, nimm diese Karte mit und erzähle ihm meinen Wunsch, dann läßt er Dich gewiß kommen. Sag' ihm auch, daß ich nicht versäumen würde, ihm meinen Besuch zu machen. Also morgen, ihr Burschen - auf Wiedersehen!«
Heinrich Quandt drückte Beppo auf Abschlag ein Geldstück in die Hand, erkundigte sich dann nach dem Speisehause, welches er suchte, und ging mit Friederike weiter.
Am andern Vormittage stellte sich Beppo mit seinem Aeffchen pünktlich ein, während Sisto auf sich warten ließ. Endlich kam er, aber nicht allein, sondern der Prälat begleitete ihn. Quandt war erstaunt und erfreut über den Besuch und nahm Gelegenheit, auch seine Frau vorzustellen. Parelli mit seinen liebenswürdigen, gewandten Manieren wußte rasch die anfängliche Befangenheit Friederikens zu verscheuchen, erzählte, wie er vor Jahren bereits den jungen deutschen Maler kennen und schätzen gelernt habe und auch ein gutes Bild von ihm besitze. Er freue sich, die alte Bekanntschaft erneuern, beziehentlich erweitern zu dürfen und erklärte es als selbstverständlich, daß er das neue Gemälde, die beiden Knaben, zu erwerben wünsche. Damit Quandt seine Modelle gesichert habe, wollte er Beppo überdies, so lange der Maler seiner bedurfte, Aufnahme bei sich gewähren, eine Mitteilung, die auch den beiden jungen Landsleuten große Freude bereitete.
So war alles in schöner Ordnung. Der Maler begann[244] sein Bild mit Lust und Behagen, doch gönnte er sich dabei auch jene Muße, die er für sein Frauchen brauchte, damit sich dasselbe nicht langweile, und Beppo zumal war mit dem langsamen Fortschritt der Malerei sehr einverstanden, weil er während desselben so gute Tage hatte, wie niemals zuvor. Im Hause des Prälaten ging es ihm vortrefflich, und auch Piccolo konnte sich nicht beklagen, da er mit seinem lustigen Wesen bald der Liebling der Diener geworden war. Sie trieben im Hofe des Palais manche Kurzweil mit ihm, bis eines Tages Frau Lucia darauf aufmerksam wurde, und jetzt überhaupt erst erfuhr, daß noch ein zweiter kleiner Campagnole das Asylrecht des Hauses erhalten hatte.
Sie machte auch diesmal dem Prälaten Vorwürfe, aber der entgegnete lächelnd:
»Nur auf einige Tage, Lucia – und er stört Dich ja nicht, der arme Teufel!«
Sie murmelte einige unwirsche Worte und damit war die Sache abgethan.
Es war an einem Nachmittage und der Prälat war ausgegangen. Giovanni der Kammerdiener hatte diese Gelegenheit benutzt, um einen Besuch zu machen, und das andere Dienstpersonal hatte sich in dem schattigen Hofe um Beppo und seinen Affen eingefunden, und dieser gab nun eine höchlich belustigende Extravorstellung, bei welcher auch Sisto, angeregt durch seinen Kameraden, mitwirkte, indem er den Dudelsack blies, welchen ein Stalljunge verschafft hatte. Signora Lucia, deren Zimmer nach einer andern Seite hin lagen, konnte kaum sich gestört fühlen, und so überließen sich alle Beteiligten rückhaltlos dem Vergnügen.
Da erschien eine neue Persönlichkeit. Man wußte nicht recht, wo sie hergekommen war, aber sie war eben mit einem Male da, mitten in der lustigen Gesellschaft, die ihn beinahe verdutzt anschaute. Er war ein vierschrötiger Bauer, seinem[245] Anzuge nach aus dem Neapolitanischen, und er lachte über die Späße des Aeffchens so lustig und laut, als ob er ein volles Recht hätte, hier zu sein.
Da stellte ihn der Koch, welcher dem Range nach in diesem Kreise am meisten dazu berufen schien, zur Rede, und fragte, was er denn wolle?
»Ja so« – lachte der Angeredete breit und grinsend, so daß eine Reihe blanker Zähne aus dem mit großen Bartstoppeln bedeckten Munde hervorglänzten – »ich will hier einen Besuch machen!«
Jetzt sah erst Beppo, der mit seinem Piccolo beschäftigt gewesen war, auf, und gleichzeitig flog ein Strahl des Erkennens durch sein Auge.
»Vetter Gaetano!« rief er laut, und eilte auf den Mann zu.
»Ih, sieh einmal, das ist der kleine Beppo aus Castel S. Pietro! Ei, Beppo, kleine Kröte, wie kommst Du hierher?«
»O, ich suche mein Brot zu verdienen in Rom mit dem Piccolo da!«
»Ja, ja – und ich will auch mein Brot verdienen. Was macht denn Dein Vater, der Vetter Grisante?«
»Ach, der ist tot!«
»Tot! – das ist eine schlechte Sache! Hm, ich hätt' ihn gern noch einmal besucht, da ich just in der Nähe bin – aber wenn er tot ist – – heda, ihr Leute! Ich halte es mit den Lebenden – könnt Ihr mir sagen, ob ich hier in dem Hause Frau Lucia Vergani finde?«
Die Domestiken sahen den vierschrötigen Bauer erstaunt und beinahe entrüstet an, dann warfen sie sich gegenseitig fragende Blicke zu, und endlich sagte einer:
»Ich glaube, so heißt die Signora.«
»Eh – es kann gar kein Irrtum sein! Das Haus gehört doch dem Monsignore Parelli?«
Er drehte sich um und schickte sich an, nach der Freitreppe zu gehen, aber einer der Bedienten trat ihm in den Weg:
»Hoho, Freund – so schnell geht das nicht! Erst müssen wir Euch melden!«
»Melden? Hahaha, mich? Na meinethalben, meldet mich: Gaetano Vergani aus der Chiana di Sorrento! Sie wird sich freuen, mich wiederzusehen, das dürft Ihr glauben, Sie wird sich freuen! Hahaha!«
Der alte Bursche war offenbar nicht ganz nüchtern, und die Diener hatten Bedenken, ihn zu der Dame zu führen.
Der Koch aber sprach:
»Laßt ihn Sisto anmelden! Die Signora kann ihn ja nach Belieben empfangen oder abweisen!«
Und so geschah's, und während Beppo unten im Hofe erzählte, daß Gaetano ein weitläufiger Vetter sei, den er mit seinem Vater vor zwei Jahren im Neapolitanischen besucht hatte, wo er ein kleines Gütchen besaß, stieg der Bauer mit seinem jungen Begleiter die breite Treppe hinauf, über deren Marmor ein bunter Teppich lief, und er sah sich überall mit neugierigen großen Augen um.
»Hm, ich meine, sie wohnt hier recht hübsch, hübscher als wir bei Sorrent.«
»Dafür ist sie auch die Verwandte des hochwürdigsten Herrn Bischofs!« sagte Sisto.
Der Bauer pfiff durch die Zähne, blieb einen Augenblick stehen, legte den Zeigefinger an die Nase, und sagte:
»Aha, Verwandte! Auf die Art wäre ich wohl auch mit dem hochwürdigsten Herrn Bischof verwandt; das ist mir neu, aber sehr schmeichelhaft!«
Der Knabe wurde verblüfft durch diese Aeußerung:
»Wieso denn?« stotterte er beinahe verlegen.
»Na, weil ich der Bruder von Eurer Signora bin.«
Sisto traute seinen Ohren kaum; er hielt sich an der[247] Ballustrade fest, und sah mit offenem Munde den vierschrötigen Menschen an.
»Ah, nun kriegst Du Achtung vor mir, kleine Kröte – jetzt mach' aber auch, daß ich die Dame zu sehen bekomme, ich vergehe sonst vor Sehnsucht!«
Er lachte roh auf und stieg dann weiter, und Sisto ging langsam hinterdrein.
Im Vorzimmer der Signora hieß er den Bauern warten; er selbst pochte an die Thüre und trat erst nach erhaltener Erlaubnis ein. Lucia hatte, wie immer außerordentlich elegant gekleidet, auf einem Ruhebette gelegen und in einem Bande mit Bildern geblättert; sie sah nun gelangweilt und augenscheinlich verdrießlich nach dem Knaben.
»Verzeiht, Signora,« – sagte dieser – »es ist ein Mann da, ein Bauer aus der Chiana di Sorrento, welcher Euch zu sprechen wünscht; er heißt Gaetano Vergani.«
Das schöne Weib fuhr aus seiner bequemen Lage auf und starrte erblassend nach Sisto; aber sie wußte sich zu beherrschen und sprach mit kaum merklicher Erregung der Stimme:
»Ich kenne den Mann nicht; hat er gesagt, was er wünscht?«
»Nein, Signora; aber er erklärt, er sei Euer Bruder!«
Lucia stand wie ein vom Bogen geschnellter Pfeil neben dem Knaben und faßte ihn hart an beiden Schultern an:
»Und Du glaubst doch solche Thorheit nicht? – Das muß ein Verrückter, ein Wahnsinniger sein! Warum hat man den Menschen ins Haus gelassen, war denn niemand zur Stelle, der ihn hinauswarf?«
Die Stimme des Weibes war kreischend und drang bis in das Vorgemach an das Ohr des Bauern. Diesem behagte das Warten überhaupt nicht, und die Worte, die er vernahm, regten ihn auf, so daß er jetzt ohne weiteres die Thür öffnete und eintrat.
Aus den Wangen Lucias war alles Blut gewichen; sie taumelte und mußte sich an der nächsten Sessellehne festhalten; der Mensch aber lachte roh:
»Das Wiedersehen greift Dich wohl zu sehr an? Nun, nun, ich wollte Dich nicht erschrecken, will auch gar nicht lange bleiben.«
Sisto huschte bei diesen Worten hinaus; er fühlte, daß er überflüssig sei, und nun erst, nachdem die Signora sah, daß der Junge verschwunden sei und nachdem sie sich durch den Augenschein überzeugt hatte, daß er auch nicht im Vorzimmer horche, wandte sie sich, noch immer nach Fassung ringend, zu dem Manne:
»Unseliger, was führt Dich her? – Habe ich Dir nicht jedes Vierteljahr geschickt, was ich Dir versprochen?«
»Ja, ja, schöne Lucia – und beim Teufel, Du bist schön – aber wie es so geht, ich habe Unglück gehabt und sie wollen mir das Häuschen verkaufen. Schreiben kann ich nicht, und so muß ich selber kommen, um Dir's zu sagen. Du mußt helfen, Du hast's ja – Du wohnst hier wie eine Fürstin –«
»Ich habe gar nichts,« stöhnte das Weib, das jetzt beinahe fassungslos auf einen Stuhl gesunken war und die Hände krampfhaft in einander verschlang.
»Aber er hat,« sagte der Bauer mit frechem Ton, »und was ihm gehört, gehört auch Dir. Wenn Du mir nicht helfen kannst, wende ich mich an ihn selber!«
»Um der Madonna willen, Gaetano! … Sprich, wie viel brauchst Du?«
»Dreihundert Scudi.«8
8 1200 Mark.
»Und Du meinst, daß ich sie habe?«
»Aber Du kannst sie schaffen.«
»Bis wann?«
»Sogleich. Meinst Du, daß ich mich so lange in Rom aufhalten kann, bis es Dir passen wird?«
»Ich schicke Dir das Geld zu – aber geh' jetzt!«
»Daß ich ein Narr wäre. Da könnte ich lange warten und müßte zuletzt meinen Weg noch einmal machen.«
»Aber woher nehmen?« stöhnte das Weib in Verzweiflung. »Und der Prälat kann jeden Augenblick kommen – er darf Dich nicht antreffen, er darf auch nicht erfahren, daß Du hier warst …«
»Um so besser, so beeile Dich!«
Er ließ sich breit und roh in einen der Polstersessel fallen, und seine gierigen Augen schweiften die Wände entlang, indes das Weib noch immer mit gerungenen Händen vor ihm stand.
»Gaetano, ich bitte Dich, gehe!«
»Nein!«
Da atmete Lucia tief auf.
»So warte hier.«
Sie eilte hinaus, ihr Gewand rauschte auf dem Teppich, und ging in die Zimmer des Prälaten. Sie wußte, daß er in einem Fache des Sekretärs in seinem Arbeitszimmer Geld habe, auch daß er damit ziemlich sorglos umging und nicht sehr zu zählen pflegte, da er ein bedeutendes Privatvermögen besaß. Aber ihr schlug das Herz, so daß es ihr beinahe die Kehle zusammenzog und ihre Hände waren eiskalt und feucht, und obwohl die weichen Teppiche ihre Schritte unhörbar machten, schlich sie doch auf den Zehen – sie wußte, daß sie einen Diebstahl begehen wollte.
Als sie vor dem Sekretär stand, überkam sie eine Ohnmachtsanwandlung, aber mit übermenschlicher Kraft zwang sie sich, stark zu sein; sie sah um sich, als ob sie sich vergewissern wollte, ob sie niemand sähe, dann öffnete sie das Fach und sah eine Anzahl Rollen darin liegen. Sie wog sie in der Hand – dem Gewichte nach mußte es Gold sein, dann faßte sie eine derselben fester, ließ sie rasch in ihre Tasche gleiten, schob das Fach zu und eilte, wie von Furien gejagt, davon. Todbleich kam sie bei Gaetano an.
»Da – nimm!«
Der Bauer griff zu, sah das Geschenk flüchtig an, und las auf demselben: 400 neapolitanische Dukaten9. Ein breites Grinsen ging über sein rohes Gesicht.
9 1 neap. Dukaten – 3,40 Mark.
»Das genügt. Ich danke. Aber nun kannst Du mir auch noch einen Kuß geben, Lucia … Du bist noch schöner geworden, als Du damals warst … Die Tölpel mögen mich für Deinen Bruder halten … unter vier Augen …«
Er näherte sich lüstern mit funkelnden Augen dem schönen Weibe, aber das stieß ihn zurück und sagte heiser:
»Rühre mich nicht an!«
»Schade, daß Du so stolz geworden … einmal war ich Dir gut genug – und was soll ich denn Deinem Kinde sagen? …«
»Schweig, um der Heiligen willen und geh!«
»Ja, ja!« sprach er, da er ihr angstverzerrtes Gesicht schaute, »und vergiß nicht zum nächsten Vierteljahr!«
Er stolperte hinaus, Lucia aber sank in einen Sitz und schlug die zitternden Hände vor das Gesicht.
Der Bauer ging langsam, mit der Rechten mit der Geldrolle in seiner Tasche spielend, durch das Vorzimmer und auf dem Flur traf er Sisto.
»Ah, mein Junge, meine Schwester ist gut« – sagte er, eine Hand voll Goldstücke hervorziehend, von denen er dem Knaben eins reichte. Der aber weigerte sich, es anzunehmen, und in demselben Augenblicke rief ihn auch die Stimme der Signora.
Er eilte in ihr Gemach und fand sie noch immer sehr erregt, so sehr sie sich auch bemühte, ruhig zu erscheinen. Sie empfing ihn ziemlich streng:
»Der Mann, welcher eben gegangen, ist mein Bruder nicht, Sisto – verstehst Du mich? – Er ist ein ferner Verwandter von Monsignore, von welchem dieser nicht belästigt[251] zu werden wünscht, und Du wirst Dich hüten, ihm etwas zu sagen, daß er hier gewesen sei. Das mögen auch die anderen wissen, denen er etwa den Unsinn, daß ich seine Schwester sei, vorgeschwätzt hat. Dafür sorge, und wehe dem, der gegen diese Anweisung handelt. Geh!«
Der Knabe ging, aber er fühlte mit seinem naiven Sinne heraus, daß hier im Hause nicht alles in Ordnung sein müsse, und das war ihm unbehaglich.
Einige Tage später war er im Arbeitszimmer des Prälaten und hatte diesem eine Meldung zu machen. Parelli schien verstimmt und suchte in den Schubläden und Fächern seines Sekretärs, murmelte auch unverständliche Worte vor sich hin, bis er sich zu dem Knaben wandte und ihn scharf anblickend, fragte:
»Sisto, hast Du von meinem Schreibtisch etwas fortgenommen?«
Der Junge sah mit seinen großen, treuen Augen zu seinem Herrn auf und sagte einfach:
»Nein, gnädiger Herr!«
»Mir fehlen – mir fehlt – hm … mir fehlt etwas!«
»Was ist's, Monsignore? Vielleicht ist's verlegt worden?«
»Nein, nein – aber, es ist gut, Du kannst gehen!«
Mit schnellen Schritten ging der Prälat im Gemache auf und nieder:
»Ich kann das Geld nicht ausgegeben haben, es lag gewiß hier … Sisto hat es nicht, unmöglich! Wenn er mit solchen Augen lügen könnte, müßten selbst Engel zu stehlen imstande sein. Giovanni ist mir ganz treu und sicher; er nimmt keine Stecknadel; wer könnte sonst noch? – Lucia? Pah, wozu? Ich erfülle alle ihre Bedürfnisse … sollte ich mich doch irren und die kleine Summe zu Tognola u. Co. gegeben haben? – Ich muß vorsichtiger mit meinem Gelde sein, und darf niemanden in Versuchung führen.«
Nach diesem Selbstgespräch schloß er den Sekretär, zog den Schlüssel ab und ging bald darauf aus. Er beschloß, Quandt aufzusuchen und zu sehen, wie weit er mit seinem Bilde gekommen war.
Dieser beeilte sich, wie erwähnt, nicht allzu sehr. Seinen beiden Modellen that dies nicht leid; sie kamen nur zu gern in das Atelier des deutschen Malers, wo es manchen Leckerbissen, und, was mindestens Sisto noch lieber war, manches freundliche Wort gab. Frau Friederike war in den prächtigen Jungen geradezu vernarrt. Sein treuherziges, offenes Wesen, sein frisches, schönes Gesicht mit den dunklen Locken und den blitzenden Augen hatten es der jungen, kinderlosen Frau angethan, und Sisto selbst fühlte sich bald in der freundlichen Behausung des deutschen Malers heimisch, mehr noch als im Palais des Prälaten, wo er sich doch bei aller Güte seines Herrn fremd vorkam.
Auch die Kunst fesselte ihn an Heinrich Quandt. Der Junge hatte eine schönheitsfrohe Seele, jenes feine, angeborene Kunstverständnis, wie man es in Italien auch bei ganz schlichten Leuten trifft, und wenn der Maler an seiner Staffelei ruhte, trat er manchmal leise hinter denselben und schaute über dessen Schulter nach dem Bilde, aus welchem ihm sein Ebenbild entgegenblickte.
»Gefällt Dir's, Sisto,« frug ihn einmal Quandt.
»Sehr, Herr – ich wollte, ich könnte das auch machen!«
»Hast Du denn niemals eine Beschäftigung getrieben?«
»Nein, Herr; die Ziegen habe ich gehütet und dabei den Dudelsack gespielt.«
»Aber Lesen und Schreiben hast Du gelernt?«
»Ja, Herr, bei dem Pfarrer von Subiaco.«
»Möchtest Du denn nicht ein Gewerbe erlernen?«
»Eins wohl, Herr, die Bildschnitzerei. Ich habe das auch schon versucht …«
»Weiß Monsignore davon?«
»Nein, Herr!«
»Dann will ich mit ihm reden.«
Der Knabe errötete und stammelte:
»Ach, das würde mich sehr glücklich machen, Signore.«
An demselben Tage, an welchem dies Gespräch stattfand, war der Prälat nach dem Atelier gekommen. Er freute sich an dem Bilde, das er schon als sein Eigentum betrachtete und rühmte namentlich den Kopf Sistos, der sich mit lebensvoller Schönheit von der Leinwand abhob. Da benützte der Maler die Gelegenheit, Parelli den Wunsch des Knaben vorzutragen, und dieser zeigte sich sogleich geneigt, demselben entgegenzukommen.
»Ich habe auch schon gedacht, daß der Junge etwas anderes werden soll, als ein Bedienter, und wir wollen sehen, ob er Talent hat; es soll mich freuen. Aber wissen Sie, warum ich eigentlich heute komme? Ich wollte Sie und Ihr Frauchen einladen, morgen mit mir in die Campagna zu fahren, nach Tivoli; Frau Friederike muß ja hier in Ihrem Atelier verkümmern. Was meinen Sie?«
»Sie sind zu freundlich, Monsignore … aber wenn Sie gestatten, rufe ich meine Frau, damit Sie selbst ihre Freude sehen können. O, sie ist wie ein Kind, und so leicht glücklich zu machen!«
Schon nach wenigen Augenblicken eilte Friederike herein, die lieblichen Wangen rot übergossen. Ihre Blicke sagten, daß sie schon wußte, um was es sich handle, und der Prälat war entzückt, als er solche unmittelbare, reine Freude sah. So ward alles für den anderen Morgen verabredet, und zur bestimmten Stunde hielt der bequeme und vornehme Wagen des Bischofs vor der Thüre des kleinen Hauses. Friederike setzte sich zu seiner Rechten, Quandt, ihr gegenübersitzend, hatte die besondere Freude, immerwährend ihr glückliches,[254] rosiges Gesicht, ihre schönen, schimmernden braunen Augen zu sehen und war so doppelt froh.
Der Morgen war außerordentlich schön, etwas kühl, aber von wunderbarer Klarheit, und wie eine Glocke von Azur wölbte sich der Himmel über der ewigen Stadt, deren Gassen noch schweigend lagen. Durch die Porta San Lorenzo ging es hinaus und die alte Via Tiburtina entlang. Durch einen felsigen Engpaß zwängt sich die Straße hinab nach dem Teverone, und dann rollte der Wagen auf dem Lavaboden fort, hinein in die Campagna. Weithin dehnt sich ihr müdes Flachland, nur da und dort von einer Hügelwelle gefurcht. Vergebens sucht das Auge nach freundlichen Baumgruppen und grünen Gärten – und doch liegt ein eigentümlicher Reiz über der Landschaft.
Eine Poesie der Schwermut redet aus dieser öden Ebene, die um so ergreifender wird bei dem Gedanken, daß unfern die Blutwelle einer modernen Kultur lebensvoll in den Adern einer Weltstadt pulsiert, eine unausgesprochene Klage, wie das Leid des Weltgeistes, webt in dieser weichen, träumerischen Luft, und die da und dort auftauchenden und vom Horizont sich klar abhebenden Bauwerke reden alle eine für den Historiker und den Kunstfreund allein verständliche Sprache. Von seiner Höhe herab schaut San Angelo – das alte Corniculum – und fernher winkt das Kloster und Kastell von Monticelli, bis endlich in der Nähe von Castel Arcione das Bild der Landschaft freundlicher wird und der Wagen zwischen graugrünen Oliven und dunklen Steineichen über den antiken Brückenbogen der Ponte Lucano hinwegrollt, jenseits deren sich das Grabmal der Gens Plautia, ähnlich dem berühmten der Cäcilia Metella, erhebt.
Nun gebot der Prälat den Fahrweg einzuschlagen zur alten Villa Hadrians, des kunstsinnigen Römerkaisers, die mit ihren umfänglichen Trümmerresten aus rotem Backstein ungemein malerisch sich abhebt von dem wild und dichtverwachsenen[255] Gebüsch, über das mit ihrem ernsten Grün Cypressen und Pinien emporragen, während Lorbeer und Feige mit freundlich heller Färbung sich dazwischen zwängen.
Heinrich Quandt kannte das prächtige Landschaftsbild, und dennoch war er aufs neue entzückt, und machte auf seine Einzelheiten auch seine Begleiter aufmerksam. In der alten Kaiservilla übernahm der Prälat die Führung als ein kundiger und zugleich feinsinniger Cicerone. Er verstand es, vor dem Geiste der beiden andern aus den Ruinen das glänzende Haus des Imperators wieder aufleben zu lassen mit seinem Theater und seinem Nymphäum, von dem der cypressenbeschattete Weg nach der Poikile und den anstoßenden Räumen des Sprechsaals und des Notatoriums führt. Zuhöchst aber lag der eigentliche Kaiserpalast mit seinen säulengetragenen Prunksälen und Bäderresten. Und wie um dem ernst und trübe stimmenden Bilde einer versunkenen Herrlichkeit das Gepräge friedlichen Behagens zu verleihen, grünt auch hier um die Trümmerreste der Oelbaum, und der Weinstock umschlingt sie mit seinen grünen, beweglichen Ranken und Reben.
Die drei Reisenden fuhren nun nach der Ponte Lucano zurück und von da auf der neuen Straße langsam empor nach der freundlichen Stadt, die mit ihren weißen Mauern aus dem Grün hervorlugt, traulich und anmutig, indes um ihren Fuß die Wasserfälle des Anio brausen und rauschen. Das alte Tibur – das heutige Tivoli – ist reich an Schönheit, und die Patrizier der Kaiserzeit, die hier ihre Villen bauten, haben es ebenso gewußt, wie die modernen Künstler, welche hierher wallfahren.
Ueber die Piazza fuhr der Wagen, bis dahin, wo in der Nähe der Aniobrücke der Vicolo della Sibilla zu dem Gasthofe »La Sibilla« emporleitet. Hier hielten die Reisenden Rast, da wo hoch über dem linken Flußufer der schöne Tempel sich erhebt mit seiner runden Säulenhalle, der wie ein Asyl[256] des Friedens über dem Brausen und Schäumen der Wasser steht. Freundliche Kranzgewinde zieren den Fries, und an den Umlaufdecken sind Kassettonen mit Rosetten. Aber das Auge wendet sich doch auch hier der gewaltigen, elementar schaffenden Natur zu. Zur Linken stürzen die Wasser des Anio von einer Höhe von etwa 100 Metern mit wildem Tosen hinab über die Uferwand in die schaumverschleierte Schlucht – ein herrlicher und erhebender Anblick!
Der Prälat wußte zu erzählen, wie im Jahre 1826 der Anio zornig über seine Ufer getreten sei und einen Teil von Tivoli in wildem Ansturm in den Abgrund gerissen habe. Beim Sibillentempel waren auf dem Felsvorsprunge noch Trümmer aus jener Katastrophe zu sehen. Damals wurde dem Flusse Gewalt angethan, und er mußte sich demütigen vor menschlicher Kraft und Kunst und seinen Weg nehmen durch zwei Gänge, die durch den Berg Catillo getrieben waren. Hierher ward der Anio im Jahre 1834 geleitet, und in Gegenwart des Papstes Gregor XVI. brausten die gestauten Wasser zum ersten Male über die Felswand hinab.
In der Nähe des Tempels, in einer herrlichen Umgebung, hatten sich die Reisenden einen Platz gesucht, um ein Mahl einzunehmen. Unfern von ihnen an einem Tische aber saß einsam ein junger Mann, dessen Collare den Priester verriet. Er war hochgewachsen und schlank, mit frischem, gerötetem Gesicht und klaren blauen Augen. Als ihn der Maler bemerkte, sprach er:
»Das ist ein Deutscher – und es will mir eigentlich nicht gefallen, daß ein Landsmann hier bei dieser Schönheitsfülle, die zur Aussprache lockt, vereinsamt sitzt. Gestatten Sie Monsignore, daß ich ihn anspreche, und, wenn er genießbar erscheint, ihn zu uns bringe?«
»Ganz gewiß, lieber Quandt!« erwiderte der Prälat, und der andere stand auch gleich darauf vor dem Tische. Einige Worte, gegenseitig gewechselt, genügten dem erfahrenen[257] Maler, um seinen Mann zu beurteilen, und so führte er ihn gleich darauf am Arme heran und stellte ihn vor:
»Herr Dr. theol. Frohwalt aus Prag.«
Parelli entfaltete dem jungen Priester gegenüber seine ganze Liebenswürdigkeit.
»Sie sind gewiß anläßlich des Konzils nach Rom gekommen.«
»Jawohl, ich gehöre zu dem geistlichen Gefolge Seiner Eminenz des Prager Fürsterzbischofes.«
»Der Kardinal Schwarzenberg. Ach, ein ausgezeichneter Herr, ein feiner, vornehmer Herr … nun, ich freue mich, Sie kennen zu lernen, und Sie verbinden uns, wenn Sie sich uns anschließen.«
»Ich bin für die gütige Aufforderung um so dankbarer, als ich eigentlich von meinen Reisegefährten treulos verlassen erscheine. Ich hatte heute morgen mit zwei jungen Franzosen, welche ich zufällig traf, einen Wagen gemietet für den ganzen Tag. Während der Fahrt zeigte sich, daß wir nach unsern ganzen religiösen und sittlichen Anschauungen nicht zusammen paßten, und als ich ausstieg, um die Villa Adriana zu besuchen, fuhren sie weiter, und wir wollten uns hier in ›La Sibilla‹ zusammenfinden. Sie sind nicht da und, wenn sich der Wirt, bei welchem ich mich erkundigte, nicht getäuscht hat, sind sie weiter gefahren nach Subiaco und haben mich hier zurückgelassen.«
»Ein Gewinn für uns,« sprach Parelli verbindlich, »und ich freue mich, Ihnen zur Rückfahrt nach Rom noch einen Platz in meinem Wagen anbieten zu können.«
»Den ich mit größtem Dank annehme, Monsignore.«
Nun wurde das Gespräch allgemeiner und heiter, und man fand immer mehr gegenseitiges Gefallen an einander. Da ließ sich nahe bei ihnen an einem Tische ein vierschrötiger Mensch nieder, seiner Kleidung und seinen Manieren nach ein Bauer. Breit und behäbig stemmte er sich auf seine Ellenbogen[258] und sah ziemlich unverschämt nach dem Prälaten und seinen Begleitern, die sich nicht weiter um ihn kümmerten.
Als ein Kellner zu ihm herantrat, bestellte er die teuersten Gerichte und den besten Wein, und erregte dadurch zweifellos das Mißtrauen des Anfragenden. Er sah zu demselben mit einem schiefen Blick aus zusammengekniffenen Augen empor und sagte laut, daß man es weit hören konnte:
»Glaubt Ihr, weil ich den Bauernkittel trage, daß ich kein Geld im Sacke habe? Es gelüstet mich auch einmal, wie Herrenleute zu leben – und ich kann's. Ja, mein Schwager ist auch ein Monsignore, so gut wie der da drüben … mein Schwager nämlich, bei dem mein – na … meine Schwester lebt. Hier ist ein neapolitanischer Dukaten und da noch einer und noch einer – das wird wohl reichen – he?«
Er warf die Goldstücke auf den Tisch, daß sie klangen und sah mit rohem Lachen bald den Kellner, bald die ihm nahesitzenden Gäste an. Parelli aber war bleich geworden. Er erschrak, er wußte selbst nicht weshalb, bei den Worten des rohen Burschen – er dachte an Signora Lucia, und dann auch an das Gold, das ihm abhanden gekommen war: Es war dieselbe Münzsorte, mit welcher dort der Bauer um sich warf. Ihm war, als müsse er nach einem Zusammenhange suchen, aber er scheute das Aufsehen und mochte nicht an Dingen rühren, die ihm bedenklich werden konnten. Aber mit seinem Behagen war es vorüber, und mit ängstlicher Hast drängte er zum Aufbruch, zum Besuch der Wasserfälle.
Man folgte ihm, und da sie bei dem Bauer vorüberschritten, hob dieser eben sein Glas mit funkelndem Weine, hielt es ihnen entgegen und rief:
»Auf Euer Wohl und auf meine Gesundheit!«
Parelli errötete vor Unwillen, aber er ging ruhig weiter und hinter ihm und seinen Begleitern verklang das rohe Lachen des ungeschliffenen Burschen.
Sie stiegen nun abwärts zu den Kalkfelsen und gingen stromaufwärts zur Grotta della Sirene, wo ihnen ein Strahl des Falles entgegenrauschte, in dessen aufstäubenden Wasseratomen sich die schrägfallende Sonne brach und damit einen Regenbogenglanz über das Bild goß. Und wie sie weiter wanderten, wechselten die Bilder, aber überall war Anmut und Schönheit ihre Begleiterin, bis man von der Terrasse des Belvedere fast alle die Herrlichkeiten der sprühenden, blinkenden Cascatelle vor sich hatte. Hier rauschte und brandete der große Wasserfall in seiner Majestät niederwärts, und alle die kleineren Fälle dienten ihm mit ihren malerischen Einzelheiten zur köstlichen Folie.
Von da aus gingen sie, um nicht umkehren zu müssen, geradeaus weiter. Bei dem Kirchlein S. Maria di Quintiliolo mußten sie anhalten. Eine Prozession mit wehenden Fahnen kam herbeigezogen. Ein Kreuz wurde vorangetragen von einem jungen Mönche; ihm folgten eine Anzahl Ordensleute und dann Männer, Weiber und Kinder, singend und betend. Es war ein malerischer Anblick, aber erhebend oder andachtsvoll wirkte er nicht. Der Prälat zog vor dem Kruzifix seinen breitrandigen Hut, Frohwalt und Quandt thaten desgleichen, indes die junge Frau erstaunt, mit großen, verwunderten Augen, welche deutlich bekundeten, daß ihr der Anblick neu war, den lebhaften, singenden Zug an sich vorübergehen ließ. Als der letzte, ein zerlumpter Campagnole mit langem, grauem Bart, offenbar ein Bettler, kam, warf ihm der Prälat eine Münze in den abgezogenen, schäbigen Filzhut und fragte:
»Warum veranstaltet man diese Prozession nach S. Maria di Quintiliolo?«
»Wir bitten, daß die Madonna die Väter des Konzils erleuchten möge, damit sie die Unfehlbarkeit des heiligen Vaters annehmen.«
Damit humpelte der Alte weiter; die Reisegefährten aber[260] wandten sich schweigend ab und schritten zwischen den alten, knorrigen Olivenbäumen abwärts gegen die Ponte dell' Aquoria, wo ihr Wagen wartete.
Jeder von den drei Männern aber hatte seine eigenen Gedanken, und die Rückfahrt nach der ewigen Stadt war im Grunde minder heiter, als die Fahrt am Morgen, nur Frau Friederike besaß ihre unbefangene Fröhlichkeit und suchte mit ihrem Plaudern eine freundlichere Stimmung herbeizuführen. Frohwalt saß ihr gegenüber. Er schaute auf den roten plaudernden Mund und in die hellen braunen Augen, die so sonnig lachten, und als ihm beim Abschiede die junge Frau die Hand reichte und die Hoffnung aussprach, ihn bald einmal als ihren Gast zu sehen, sagte er so lebhaft und rasch zu, daß er darüber unwillkürlich errötete.
Auch Monsignore Parelli hatte ihn freundlich und herzlich zu einem Besuche eingeladen. Und so ging er in träumerisch-angenehmer Stimmung über die Ponte di Ripetta hinüber an das andere Tiberufer, wo in ewiger Majestät der Dom des heiligen Petrus ragt und wo er seine Wohnung hatte.

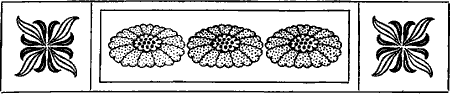

Das Konzil war feierlich in einem Seitenschiffe von St. Peter eröffnet worden, und das Aussehen von Rom nahm von da ab eine noch mehr kirchliche Färbung an. Die Zahl der geistlichen Würdenträger, welche sich an dem Sitze des Papsttums eingefunden hatten, war eine ungewöhnlich große – siebenhundertfünfzig Bischöfe fast aus allen Teilen der Welt waren zusammengekommen zu jenem außerordentlichen kirchlichen Ereignis, und zumal um den Vatikan und seine Umgebung sah man Tag aus, Tag ein die mehr oder minder vornehmen Wagen hinrollen, in welchen die Väter der Kirche zum Konzil oder von demselben fuhren. Seit langer Zeit war der Glanz und die Herrlichkeit des päpstlichen Stuhles nicht so zu Tage getreten.
Wenn aber seitens der Macher des neuen Glaubenssatzes und seitens der unbedingten Anhänger der Unfehlbarkeit geglaubt worden war, daß der Schimmer der päpstlichen Heiligkeit, der Atem Roms allein schon genügen werde, die versammelten Väter leicht zur Annahme der Neuerung zu bewegen, so hatte man sich einem Irrtum hingegeben. Schon in einer der ersten Sitzungen war Kardinal Schwarzenberg aufgetreten und hatte dem Konzil einige Wünsche vorgelegt, welche die Jesuiten und ihre Freunde nicht erwartet hatten, die ihnen nicht bloß unbequem waren, sondern ihnen sogar einige Bedenken erweckten.
Der erste dieser Wünsche war, daß man, schon aus Klugheitsrücksichten nicht unnötiger Weise die Zahl der Glaubenssätze vermehren möge. Man sollte nicht vergessen, daß, zumal in Deutschland, wo Katholiken und Protestanten neben und durcheinander wohnten, jeder neue Glaubenssatz mehr zur Verwirrung als zur Beruhigung der Gemüter beitrage.
Das klang wie ein deutlicher Widerspruch und er ging von einem Kirchenfürsten aus, welchen man um seiner Abkunft, wie um seiner Stellung willen immerhin zu berücksichtigen hatte. Die Hoffnung, welche sich die Jesuitenpartei gemacht hatte, daß man den in Frage stehenden Glaubenssatz durch einstimmigen Zuruf annehmen werde, wie vordem jenen von der unbefleckten Empfängnis Mariä, erwies sich trügerisch, und man sah sich umsomehr zu einem andern Vorgehen genötigt, als auch noch mancher andere streitbare und tüchtige Herr in Rom eingezogen war, der nicht ohne weiteres die Waffen streckte.
Es war an einem Spätnachmittage, als sich in der Wohnung des Kardinals Schwarzenberg die deutschen und österreichischen Bischöfe zu einer Besprechung eingefunden hatten. In dem geräumigen, vornehmen Saale saßen sie an einem langen Tische, Männer, unter welchen mancher sich durch hervorragendes Wissen und durch Geist auszeichnete. Es herrschte einerseits eine gedrückte, andererseits eine gereizte Stimmung. Der Prager Kardinal hatte das Wort und sagte mit seiner klaren, ruhigen Stimme:
»Meine hochwürdigsten Amtsbrüder! Sie wissen, weshalb ich Sie hierher gebeten habe. Es ist Ihnen nicht unbekannt, daß in dem Kreise der italienischen, spanischen und orientalischen Bischöfe ein Schriftstück die Runde macht, in welchem Seine Heiligkeit gebeten wird, ein Dekret wegen der Unfehlbarkeit einbringen zu lassen. Was dies bezwecken soll, ist klar. Aus der Mitte der Kirche heraus soll der Glaubenssatz[263] scheinbar begehrt werden, wie etwas, was immer in derselben vorhanden war. Die Zahl der Unterschriften wird zweifellos eine überwältigend große, so daß man dem heiligen Vater ohne weiteres die Ueberzeugung beibringen kann, daß dieser Glaubenssatz der sehnliche Wunsch der ganzen Christenheit ist, und doch ist in unserm Kreise vielleicht keiner, der nicht nach bestem Wissen und Gewissen sich gegen denselben sträubte. Sollen wir diesen Vorgang sich ruhig vollziehen lassen? Was ist Ihre Meinung?«
Der Erzbischof von München-Freising nahm das Wort:
»Ich beklage es tief, daß in solchem Falle die Mehrheit den Ausschlag geben soll. Der ganze Kirchenstaat hat nicht so viele Seelen, als meine Diözese, und doch ist er durch hundertdreiundvierzig Bischöfe vertreten. Rechnen wir dazu etwa hundert Bischöfe in partibus und circa zweihundert Titularbischöfe, die in Italien so dicht sitzen, wie bei uns die Pfarrer, so ist ersichtlich, daß wir dagegen nicht aufkommen, falls nicht andere Grundsätze bei der Abstimmung maßgebend werden. Deutschland hat nur vierzehn Stimmen – ein geradezu schreiendes Mißverhältnis – und darum ist es notwendig, mit doppelter Kraft einzutreten für unsere Ueberzeugung, und unter Darlegung der Verhältnisse, daß die Zahl der christkatholischen Seelen, welche hinter uns steht, Ausschlag gebend sein müsse, gleichfalls ein Bittgesuch an den Papst zu richten, es möge die Unfehlbarkeit nicht eingebracht werden.«
Einzelne Stimmen drückten ihren Beifall aus, Bischof Hefele von Rottenburg aber wiegte bedenklich das Haupt. Er gehörte zu den gelehrtesten Kirchenfürsten, die aus Deutschland nach Rom gegangen waren und erfreute sich eines gewissen Einflusses bei seinen Amtsbrüdern Er sprach nun:
»Meine hochwürdigsten Brüder! Mir ist es klar, daß jenes Vorgehen nichts anderes als eine Falle ist, welche man uns legt. Man sucht uns geradezu herauszulocken, der[264] Frage der Unfehlbarkeit, und sei es auch als Gegner, nahezutreten, denn für die Freunde derselben handelt es sich darum, sie in irgend einer Weise aufs Tapet zu bringen, um eine Abstimmung herbeizuführen, welche aus den eben angegebenen Gründen zu einer Annahme durch Stimmenmehrheit führen muß. Ich verspreche mir von einem Vorgehen, wie es eben vorgeschlagen wurde, keinen rechten Erfolg, und kann allerdings auch nicht verhehlen, daß ich keinen bessern Rat weiß, zumal die ganzen Verhältnisse hier niederdrückend und verstimmend wirken müssen. Vielleicht wäre durch eine persönliche Einwirkung bei Seiner Heiligkeit mehr zu erreichen.«
»Nichts!« brauste der heftigere Stroßmayr auf – »wir werden überhaupt in der unwürdigsten Weise behandelt, und davon muß doch der heilige Vater Kenntnis haben. Was ist das für eine Geschäftsordnung, welche uns hier aufgezwungen wird? – Der Papst ernennt nicht nur die Präsidenten und Sekretäre der Versammlung, sondern auch die Kommissionen für die Vorlagen und für die Prüfung der eingebrachten Anträge. Wer von uns einen Antrag stellt, muß zuletzt gewärtig sein, daß, wenn er Seiner Heiligkeit nicht genehm ist, er einfach in den Papierkorb geworfen wird. Oder ist es nicht ein müßiges Spiel, wenn bei einer Vorlage Abänderungen vorgeschlagen werden, daß die Sache an die Kommission zurückgeht, welche nun beliebig damit verfahren, eventuell die Vorlage unverändert wieder einbringen kann, welche nach der Geschäftsordnung nun die Versammlung annehmen muß, da eine weitere Besprechung, beziehungsweise Aenderung ausgeschlossen ist. Was ist das ferner für eine Maßregel, daß die stenographischen Aufzeichnungen der Konzilsverhandlungen von einer päpstlichen Kommission beliebig geändert werden, daß man einfach wegstreicht, was den Herren nicht paßt, oder einem das Wort im Munde umdreht? Wir sind ja hier unfreier wie die Kinder. Kein[265] Antragsteller darf in der Kommission erscheinen, wie es doch beim Concilium Tridentinum gestattet war; hier ist es geradezu verboten, die Tridentinische Geschäftsordnung nachzuschlagen und zu vergleichen. Ja, versuchen Sie es, meine Brüder, diese Geschäftsordnung aus einer Bibliothek zu entlehnen, Sie werden erfahren, daß dies verboten sei. Solche Dinge sind der Kirche und des Papsttums unwürdig.«
Der kühne Sprecher hörte ein Murmeln, das ebenso Entrüstung als Zustimmung ausdrücken konnte, und die Hand zur Faust geballt, wie im Kampfestrotz, saß er da und schaute um sich. Die Stille, welche eingetreten war, unterbrach die Stimme des Rottenburger Bischofs:
»Daß wir hier im höchsten Grade unfrei sind, dafür möchte auch ich einen Beleg bringen. Ich habe die Absicht, durch einen ganz besonderen Fall aus der Kirchengeschichte zu zeigen, daß es unmöglich ist, die Unfehlbarkeit zum Glaubenssatz zu erheben. Ich meine Papst Honorius. Sie wissen ja, meine lieben Amtsbrüder, daß er die Meinung hatte, daß in Christo nicht zwei Willen, ein göttlicher und ein menschlicher, sondern nur ein göttlicher vorhanden gewesen sei. Wegen dieser Ketzerei haben einige nachfolgende Päpste ihn noch nach dem Tode in den Bann gethan und verflucht. Nun, entweder hatten diese Päpste recht, und dann kann Honorius nicht unfehlbar gewesen sein, oder er war unfehlbar, und dann müssen die anderen gefehlt haben. Beide Parteien können unmöglich unfehlbar gewesen sein. Das habe ich in einer Schrift zu Nutz und Frommen der Konzilsväter drucken lassen wollen, und das ist mir in Rom einfach unmöglich gemacht durch die Bestimmung daß ohne päpstliche Genehmigung hier nichts erscheinen dürfe. Ich habe nun nach Neapel schreiben müssen, um dort den Druck besorgen zu lassen. Ist das Freiheit und Selbständigkeit, sind das würdige Zustände?«
»Wir schweifen ab, meine hochwürdigsten Brüder« –[266] nahm Kardinal Schwarzenberg das Wort – »und ich möchte, daß wir, anstatt uns in Klagen zu ergehen, uns klar würden, was geschehen soll.«
Einer der Kirchenfürsten beantragte, auf Grund der Darlegungen des Münchener Erzbischofs ein Bittgesuch an den heiligen Vater zu richten, daß man von Aufstellung der Unfehlbarkeit absehen möge, und dieser Antrag wurde denn auch angenommen. Nur betreff der Begründung war man nicht ganz einig. Ein kleiner Teil der Anwesenden wünschte, daß man geradezu hervorhebe, es sei eine falsche, weder nach Kirchenrecht, noch nach Kirchengeschichte zu rechtfertigende Lehre – und solche Ehrlichkeit wäre das allein richtige, vielleicht auch das wirksamste gewesen; die Mehrzahl aber suchte mit einer gewissen Aengstlichkeit den Unwillen des Papstes zu vermeiden; sie wollten, daß man lediglich Klugheitsgründe betone, zumal die unangenehmen Verwicklungen, die aus einem solchen Glaubenssatz für die Beziehung von Kirche und Staat sich ergeben könnten, und daß man, um der Ehrerbietung gegen den heiligen Stuhl in jeder Weise Ausdruck zu geben, dem Papste die weitgehendsten Zugeständnisse machen möge.
Diese Meinung drang auch zuletzt durch, und die Jesuitenpartei hatte erreicht, was sie wünschte.
In der Umgebung des Kardinals Schwarzenberg waren diese Verhandlungen und ihre Ergebnisse nicht unbekannt, und sie wirkten auf Peter Frohwalt niederdrückend und verstimmend. Er war mit ehrlichem Sinne und redlicher Ueberzeugung nach Rom gekommen, in der festen Hoffnung, hier nicht bloß die Herrlichkeit der Kirche in ihrer ganzen Größe und Reinheit zu schauen, sondern auch eine unbestechliche Einmütigkeit und Festigkeit unter den Vätern des Konzils zu finden gegenüber einer Sache, die nach seiner und der Meinung der Besten geradezu verwerflich war. Nun sah er hier rücksichtsloses Vergewaltigen auf der einen, eine schwächliche Verzagtheit[267] auf der anderen Seite. Daß die deutschen und österreichischen Bischöfe einer ehrlichen und mutigen Erklärung aus dem Wege gingen und sich hinter rein äußerliche Gründe verschanzten, erfüllte ihn, dessen sittliches Bewußtsein allzeit kräftig gewesen, mit größter Bitterkeit. Ihm kam die ganze Sache vor, wie wenn jemand einer Verführung zum Bösen nicht aus sittlichen Gründen Widerstand leistet, sondern weil es unangenehme Folgen oder üble Nachreden nach sich ziehen könnte. Ihm war es klar, daß der Widerstand gegen den geplanten Glaubenssatz durch ein solches Vorgehen sich seiner edelsten und darum wirksamsten Kraft beraubt habe.
In solcher Stimmung war es ihm Bedürfnis, ein Asyl aufsuchen zu können, wo man diese brennende Frage so gut wie gar nicht erörterte, wo reine, freie Heiterkeit mit mildem Strahle eine anmutige Häuslichkeit erhellte, und wo ihm selbst, wenigstens vorübergehend, das bedrückte Herz wieder leichter wurde.
Das war bei dem Maler Heinrich Quandt. Das Bild von den beiden Campagnolen-Jungen war vollendet und voll prächtiger, lebensvoller Frische, so daß der Prälat es aus freien Stücken mit einem ungewöhnlich hohen Preise bezahlt hatte, und der Künstler beabsichtigte nun, angeregt durch den Anblick in Tivoli, eine Bittprozession zu S. Maria zu malen, welche ihm Gelegenheit gab, die mannigfachen Typen des italienischen Volkes und zugleich seinen stimmungsvollen landschaftlichen Hintergrund anzubringen.
An einem trüben, unbehaglichen Tage war Frohwalt gegen Abend wieder bei dem Maler gewesen. Dieser und seine Frau hatten sich gewöhnt, ihn wie einen lieben Freund zu betrachten, und so luden sie ihn denn ein, das Abendbrot bei ihnen einzunehmen. Er folgte gern, und so saßen die drei Menschen in dem freundlichen Zimmer beisammen, welches an das Atelier grenzte. Der Raum war einfach, aber er zeigte überall in der Ausstattung, sowie in der Anordnung Geschmack.[268] Die Witwe des Bildhauers, welcher das Häuschen gehörte, und die sich mit drei kleinen Stuben behalf, hatte manche Erinnerung an ihren verstorbenen Mann gerade hier aufgestellt, und Heinrich Quandt hatte gleichfalls mit verschiedenem zur Ausschmückung beigetragen, so daß das Zimmer wie ein trauliches Nestchen erschien. Am meisten aber ward es verschönt durch den Geist, welcher hier waltete.
Frohwalt mußte wiederholt an die anmutige Häuslichkeit Professor Holberts denken, aber hier gefiel es ihm beinahe noch besser. Es ging von der jungen, lebensfrohen Frau ein bebender, sonniger Schimmer aus, der den Raum, und alles, was in ihm war, freundlich verklärte, und vor dem die bösen Geister des Unmuts und der Verstimmung weichen mußten.
Es war köstlich, wie die drei Menschen an dem rundlichen Tische beisammen saßen, und beim Schein der antiken Bronzelampe, die Häupter nahe an einander geneigt, sich in das Anschauen der Entwürfe vertieften, welche der Maler in einer Mappe herbeigebracht hatte und die er nun in köstlicher Weise erläuterte. Es waren Erinnerungen aus seinem Leben, welche an diese Skizzen sich knüpften, und die er freimütig, ungesucht, und oft von prächtigem Humor durchwoben, darbot. Dazu gab das junge Weib, das sich mitunter wärmer und inniger an den Gatten schmiegte, ab und zu eine schalkhafte Bemerkung, aus der aber beinahe immer ihr liebeerfülltes Herz redete, und Frohwalt hatte bei dem Anblick dieses sonnigen, stimmungsvollen Familienlebens gar seltsame Empfindungen. Es mußte doch etwas Herrliches darum sein, wenn zwei Menschen, so mit einander verbunden, durch's Leben gingen – eins in ihrem Lieben, Hoffen und Glauben!
Heinrich Quandt hatte wieder ein neues Blatt aufgeschlagen, und aus dem Auge Friederikens leuchtete ein wärmerer Strahl erst über die reizende farbige Skizze hin,[269] und dann nach dem Angesicht ihres Mannes. Das Bildchen aber stellte ein schlichtes, mit Holzfachwerk erbautes Haus mit breitem Giebel dar, der halbverdeckt erschien durch eine mächtige, breitästige Linde. Im Hintergrunde schaute über grüne Gartengehege ein Kirchturm heraus. Im geöffneten Giebelfenster waren die Oberkörper zweier Menschen sichtbar, der eines alten Herrn mit grauem Haar und unendlich milden, gütigen Zügen, und jener einer Frau, die wenig jünger sein mochte. Vor dem Hause aber fütterte ein junges, hochgewachsenes Mädchen mit kindlichen, frischen Zügen die lustig um sie sich drängenden Hühner und die vom Schlage herbeigeflatterten Tauben, während ein anderes Mädchen auf der schlichten Holzbank unter dem Lindenbaum saß und lächelnd nach der Schwester hinüberschaute.
»Das sind Sie –!« sagte Frohwalt, einen vergleichenden Blick nach der jungen Frau werfend, und sie nickte mit leisem Erröten.
»Das freut mich, daß Sie es finden – Fritzel hat stets behauptet, ihr Gesicht wäre das einzige an dem Bilde, was nicht gut wäre, und zur Strafe dafür lasse ich dasselbe in der Mappe liegen, anstatt es unter Glas und Rahmen in ihrem Zimmer aufzuhängen. Ja, das ist das Heim von meinem Schatz; hier sehen Vater und Mutter in Sonnabend-Feststimmung zum Fenster heraus und Schwester Trudchen füttert ihre Lieblinge. Schade, daß man nicht das Läuten der Abendglocken vernehmen kann, aber da hört unsere Kunst auf.«
»Ja, es ist ein allerliebstes Bildchen,« versicherte Frohwalt – »eine anmutige friedensvolle Stimmung weht aus demselben, so daß man wünschen möchte, hier gleichfalls daheim zu sein.«
»Und doch wäre es Ihnen vielleicht nicht so ganz behaglich, Verehrtester, nehmen Sie mir's nicht übel – – denn es ist ein protestantisches Pfarrhaus!«
Der Adjunkt fühlte, wie er einen Moment lang die[270] Farbe wechselte: die Hand, mit welcher er die Skizze gefaßt hatte, sank auf den Tisch, indem Quandt, der wohl über das Unbehagen der Situation rascher hinwegführen wollte, dasselbe vielleicht auch nicht einmal bemerkte, sagte:
»Ja, ich habe mir mein Fritzel aus dem Erzgebirge und wirklich und wahrhaftig aus einer protestantischen Landpfarre geholt, obwohl ich selber ein ganz guter Katholik zu sein glaube. Aber die böse Liebe, Herr Doktor – ja, die richtet manches Schlimme an!«
Frohwalt versuchte, einigermaßen verlegen, zu lächeln, der Maler aber fuhr weiter fort:
»Wir haben uns aber, wie Sie vielleicht selbst herausfinden, trotzdem wir nun schon über vier Jahre zusammengespannt sind, recht gut in einander gefunden, und ich denke, Sie lassen es mein Weibchen nicht entgelten, daß sie nicht unseres Glaubens ist … sie ist im übrigen wirklich lieb und gut und brav.«
Er nahm sein bräunäugiges Schätzchen beim Kopfe und gab der errötenden einen Kuß, dann fuhr er gesprächig fort:
»Ja, ich habe sie kennen gelernt, als sie in Dresden bei Verwandten sich aufhielt, und sie that anfangs recht scheu, als ob sie mich gar nicht sehen und nicht ausstehen könnte; aber bei einem gemeinschaftlichen Ausflug in die sächsische Schweiz, im Uttenwalder Grunde, bin ich vom Gegenteil überzeugt worden in unwiderleglicher Weise, und nun habe ich den Sturm auf das Pfarrhaus im Gebirge unternommen. Dem Papa war's ja nicht ganz recht, daß ich katholisch und ein Maler noch obendrein war, aber sehen Sie, lieber Doktor, er ist ein zu prächtiger Mensch! Die Güte, Herzlichkeit und Menschenfreundlichkeit selber! ›Sei's denn, wenn Ihr Euch lieb habt,‹ sprach er, ›und der Herrgott gebe seinen Segen dazu. Nur eins bitte ich und wünsche, daß mein Kind nicht seinem evangelischen Bekenntnis untreu wird und daß es nicht um deswillen Bedrängnisse zu erleiden habe‹;[271] das hab' ich versprochen, und redlich gehalten – nicht wahr Fritzel? – und wir sind wie brave, gute Kameraden neben einander hergegangen, und haben, wenn auch in andern Kirchen, so doch zu demselben himmlischen Vater, eins für das andere gebetet. Ach, das liebe Pfarrhaus! Das ist uns beiden so ans Herz gewachsen, daß wir uns schon nach dem nächsten Sommer sehnen, wo wir einige Wochen wieder dort zubringen wollen.«
Friederike sah mit leuchtendem Gesichte den Gatten an und hielt seine Hand in der ihren, Peter Frohwalt aber war es wunderlich zu Mute, und als der Maler jetzt schwieg, wußte er kaum, was er sagen sollte. Er suchte hinter einigen allgemeinen Redensarten, mit welchen er sich über das Angenehme eines solchen Landaufenthaltes bei lieben Angehörigen aussprach, über die Verlegenheit, in welche er geraten war, hinwegzukommen, und hielt sich auch nicht mehr lange in dem gastlichen Hause Quandts auf.
Er fühlte sich verstimmt auf dem Heimwege und konnte auch in seinem Gemache nicht das innere Gleichgewicht finden. Wie sollte er sich fürder zu dem Maler und seiner Frau stellen? – Sollte er seinen Verkehr bei ihnen ganz aufgeben? – Nach seinen bisherigen Grundsätzen hätte er es thun müssen. Er dachte an Freidank und sein erstes Weib, die protestantische Grethe, die man in seiner Heimat im Friedhofswinkel begraben hatte, und die doch so brav und gut gewesen sein sollte, und ihr Bild schwamm mit jenem Friederikens ihm in eins zusammen. Er mochte es aber nicht denken, daß man auch diese einmal zwischen Selbstmörder und Vagabunden betten könnte, und es war ihm, als wäre an Grethe Freidank seinerzeit ein schweres Unrecht verübt worden. Er versetzte sich im Geiste in das Empfinden seines jetzigen Schwagers, und er fühlte, wie er auch gegen diesen milder gestimmt wurde.
Auch an Professor Holbert mußte er denken und an das,[272] was derselbe von der protestantischen Gattin eines seiner Freunde gesagt hatte: daß er trotz des Syllabus nicht glauben könne, daß ihr die Seligkeit versagt sein solle. Auch er hätte betreff Friederikens das nicht glauben mögen, und er zweifelte, ebenso wie Holbert, an der Richtigkeit jener päpstlichen Verfügung. Wenn er aber das Weib Quandts nicht verurteilen und verwerfen konnte, trotzdem er es erst kurze Zeit kannte, warum wollte er härter gegen die eigene Schwester sein, deren gutes, liebes, treues Wesen ihm seit seinen Jugendtagen so vertraut war?
Zuletzt war's ihm eine feste und beschlossene Sache, daß er in derselben herzlichen und freundlichen Weise wie bisher mit Quandts weiter verkehren wolle, und was ihn darin besonders bestärkte, war der Umstand, daß auch der Prälat Parelli, obwohl auch dieser zweifellos von dem evangelischen Bekenntnis Friederikens wußte, in liebenswürdigster Weise den Umgang mit dem Hause des deutschen Malers pflegte.
Wenige Tage nach dem Besuche bei Quandt war Frohwalt übrigens bei Parelli geladen – im engsten Kreise, wie es in der Einladung lautete, und er stand nicht an, derselben Folge zu leisten.
Er kannte diese prunkvollen Gemächer bereits, in denen Reichtum und Geschmack sich vereinigt hatten, aber wenn auch das Auge hier sich freute und die Phantasie sich angeregt fühlte, es fehlte doch jenes stimmungsvolle Behagen, wie im schlichten, deutschen Malerheim.
Auch die Tafel war reich besetzt und in jeder Weise trefflich, und Frohwalt hatte Gelegenheit, einige ihm ganz fremde ausgezeichnete Weinsorten kennen zu lernen, so daß für einen Feinschmecker an diesem Tische kaum etwas zu wünschen übrig gewesen wäre.
Seltsamer Weise aber mußte der deutsche Priester trotz des vielfach hervortretenden Gegensatzes an den Nedamitzer[273] Pfarrer und sein ländliches Haus denken. Der Zinnkrug von dort war hier verwandelt in spiegelnde geschliffene Weinkaraffen, und an die Stelle Barbaras trat hier ein Weib in Seide, Flitterstaat und Juwelenschmuck.
»Signora Lucia Vergani, meine Cousine, die liebenswürdige Anstandsdame meines Hauses!« hatte der Prälat die in jeder Weise vornehm auftretende Frau vorgestellt, die mit dem verbindlichen Lächeln der Hausfrau den jungen Priester begrüßte und ihm den Platz zu ihrer Rechten anbot, während links von ihr der Jesuitenpater Felice saß. So waren sie nun zu Viert am Tisch, und die Unterhaltung war eine lebhafte und geistvolle – – aber Frohwalt konnte über ein unbehagliches Empfinden nicht hinwegkommen. Die kalten, klaren Augen des Jesuiten störten ihn eben so sehr, wie das ganze Wesen des geputzten Weibes, das ihm wie eine reichgeschmückte Lüge vorkam … Barbara in Seide!
Er that vielleicht dem Prälaten unrecht. Parelli benahm sich ja in jeder Weise untadelhaft, dabei ungemein liebenswürdig, daheim auf dem Gebiete der Kunst, und wenn er auch den Speisen und dem Weine sehr ausgiebig zusprach, so machte er doch nicht den Eindruck des Unmäßigen. Sein Körper schien just so viel zu gebrauchen, als er genoß. Trotz alledem schien Frohwalt unsichtbarer Weise der alte Nedamitzer Pfarrer mit am Tische zu sitzen und ihn traurig anzublicken, als ob er sagen wollte: »Sieh, Du hast mich verurteilt, und ich habe doch auch nichts anderes gethan!«
So kam es, daß es ihm gar nicht recht schmecken wollte, und daß er manchmal nur mit halbem Ohr auf das horchte, was das üppige, schöne Weib an seiner Seite zu ihm sprach. Und als es ihm gar erst schien, als ob er einen begehrlichen Blick aufgefangen hätte, der über ihn hinglitt, da überkam ihn ein Widerwille, und er wurde noch wortkarger.
Felice zeigte sich ihm gegenüber von sicherem weltmännischem Wesen, aber von einer so kalten, klugen Ueberlegenheit,[274] daß ihm bangte vor dem Manne, und wenn er sah, wie er mit seinem hagern Leibe sich über den kleinen Prälaten herbeugte, überkam ihn ein Empfinden, ähnlich jenem, welches Sisto hatte, als er damals die Beiden im Garten an sich vorübergehen sah. Ihm fiel alles ein, was Professor Holbert von Jesuiten und Jesuitenmoral zu ihm gesprochen, und trotz der beinahe zu großen Freundlichkeit Felices war er ihm gegenüber zurückhaltend, so daß derselbe äußerte:
»Sie verleugnen Ihren mehr nordländischen Charakter nicht, Herr Doktor – kühl und zurückhaltend! Das beobachten wir an fast allen deutschen Herren und Seine Eminenz, Ihr Herr Kardinal-Fürsterzbischof ist bei all seinen trefflichen Eigenschaften Ihnen darin ähnlich.«
Nach Tische zog die Signora Frohwalt wieder ins Gespräch und wünschte ihm, gleich wie mit dem Stolze der Hausfrau, die ganze Herrlichkeit dieses Hauses zu zeigen. Wenn er nicht unhöflich sein wollte, mußte er ihr folgen, während die beiden anderen sich für eine Weile in das Arbeitszimmer des Prälaten zurückzogen.
Lucia hatte manches von Parelli gelernt und ein gewisses äußerliches Kunstverständnis sich angeeignet. Dabei war ihr Benehmen ungezwungen.
Sie nahm ohne weiteres den Arm ihres Begleiters und stützte sich auf denselben, so daß es Frohwalt seltsam durchrieselte. So war er noch an keines Weibes Seite gegangen. Der Arm war voll und weich und warm, und es umwehte ihn wie ein sinnlicher Zauber. Dazu redete aus den dunklen Augen der Signora ein begehrliches, heißes Feuer, so daß er fühlte, wie auch ihm die Röte in die Wangen stieg. Das Weib schien seine Befangenheit zu bemerken, und das bereitete ihr offenbar Behagen und Befriedigung, so daß sie ihn mit Wort und Blick immer mehr umstrickte.
Sie sprach von den einzelnen Kunstgegenständen, wie sie zerstreut in den prunkvollen Gemächern standen und wußte[275] geschickt verhüllte Beziehungen herauszufinden und anzudeuten: Der blonde Deutsche schien es der schönen, heißblütigen Südländerin angethan zu haben. In den Räumen herrschte eine weiche, duftatmende Atmosphäre, die von den üppigen Polstermöbeln, den nackten Marmorbildern in den Nischen, und von den Gemälden in den breiten Goldrahmen auszugehen schien, denn Frohwalt merkte bald, daß die letzteren nur zum kleinsten Teile religiöse Stoffe behandelten. Auf den meisten glänzten blitzende Frauenaugen, blinkten weiße entblößte Schultern und Busen, war das lachende, verführerische Leben dargestellt. Er redete sich ein, sie befänden sich hier ausschließlich ihres Kunstwertes wegen, und Lucia schien ihn in dieser Meinung zu bestärken.
Dabei blieb sie gerade vor den bestrickendsten am längsten stehen, sah ihm, während sie sprach, immer heißer und tiefer in die Augen und drängte sich wohl auch enger an ihn, so daß er durch das leichte Seidengewand das Pochen ihres Herzens fühlte.
Er kam sich vor wie Tannhäuser im Venusberge, er fühlte, wie eine seltsame, nie gekannte und doch beinahe wohlige Schwäche ihn lähmte, und wie er beinahe willenlos sich von seiner Begleiterin fortziehen ließ.
In einem kleinen, lauschigen Gemach mit dunklen Möbeln, das nur matt erhellt war, ließ sie auf einem kleinen Sopha sich nieder und zog ihn an ihre Seite.
»Hier ruhen wir einen Augenblick – denn hier ist das schönste Bild, welches Monsignore besitzt.«
Es war ein in großem Stil gehaltenes Werk in dunklem Rahmen, welches gegenüber dem Sitze an der Wand hing: Potiphars Weib.
Die schöne, heißbegehrende Egypterin lag mit halb erhobenem Leibe auf purpurdunklem Pfühle. Das nilgrüne, duftig-durchsichtige Gewand war von dem Oberkörper herabgesunken, wie aus einem matten, gelblichen Schleier, der[276] wenig genug verhüllte, schimmerte die königliche Büste, der Kopf war von wundersamer, berückender Schönheit mit seinen glutendunklen Augen, mit dem blauschwarzen, leicht gewellten Haar, das sich um die weiße Stirn ringelte und die vollen, schönen, nackten Arme streckte sie begehrend aus nach dem nicht sichtbaren Joseph.
Frohwalt hatte nie ein solches Bild gesehen. Sein Atem ging schneller und kürzer, seine Augen hafteten fest auf dem entzückenden Weibe, und wie Faust vor dem Zauberspiegel der Hexenküche, so kam auch ihm wie ein zuckender Blitz der Gedanke: »Ist's möglich, ist das Weib so schön?«
Da fühlte er mit einem Male den heißen Hauch der Italienerin näher an seinem Gesichte, er sah die lodernden, dunklen Augen fast dicht vor den seinen, rote Lippen schienen ihm entgegenzuzittern, und bebend vor Erregung, eigentümlich tiefförmig und weich, rang sich das Wort von ihnen:
»Sagen Sie – war Joseph nicht ein Thor?«
Das Wort gab ihm seine fast verlorene Besinnung zurück; er wollte aufschreien: Potiphar! aber er bezwang sich, sprang von seinem Sitze auf, atmete einmal tief und sagte dann mit merkwürdiger Festigkeit:
»O nein, Signora, er war ein Held! … Aber wollen wir nicht Monsignore aufsuchen?«
Das Blut war dem schönen, üppigen Weibe zurückgetreten aus den Wangen, mit fahlem Gesicht, in dem die dunklen Augen noch leuchtender sprühten, sah sie dem stattlichen jungen Manne nach, der jetzt langsam, unbekümmert um sie, dem Ausgang des Gemaches zuschritt, und die kleinen Hände vor Unmut, Zorn und Scham geballt, ging sie ihm nach. –

Bald darauf verabschiedete sich Frohwalt von dem Prälaten und dem Jesuiten. Der erstere entließ ihn mit herzlicher Freundlichkeit und lud ihn zuvorkommend ein, seinen Besuch bald zu wiederholen, der andere aber sah ihn mit[277] seinem kalten, klaren Blick so forschend an, als wollte er in seiner Seele lesen, und da der junge Priester gegangen, sprach er zu Parelli:
»Seltsame Menschen, diese Deutschen! Ehrlich, aber wenig klug, starrköpfig, aber ohne große Ziele, schwärmerisch für Ideale begeistert, aber feige in der Wahl ihrer Mittel.«
»Aber ein Volk mit einer starken Zukunft, gründlich in seinem Wissen, kühn in seinem Wollen, kraftvoll in seinem Können,« erwiderte der Prälat.
Peter Frohwalt aber war in mächtiger, schwer bekämpfter Erregung fortgegangen. Was für ein Odem wehte durch dieses glänzende Haus eines hohen kirchlichen Würdenträgers? Wie die verkörperte Sünde ging das schöne, buhlerische Weib darin hin und her, wie die Herrin des Hauses, und wohl auch wie die des Hausherrn. Wenn das am grünen Holze war, was Wunder, wenn es sich auch an dem dürren fand? – Wenn das im Palaste des Prälaten sein konnte, warum nicht auch in der armen Landpfarre zu Nedamitz? Und jene Barbara war vielleicht noch um ein gutes Teil besser als diese Signora Lucia Vergani.
Er nahm sich vor, niemals mehr die Schwelle dieses Hauses zu überschreiten. Welch ein reiner Geist lebte dagegen in dem schlichten, anmutigen Heim des deutschen Malers, dessen Weib doch eine »Ketzerin« war, eine nach seinen bisherigen strengen Begriffen Verworfene und vom Himmel Ausgeschlossene. Nein, von solcher Satzung konnte der Allgütige nichts wissen, die ewige Liebe konnte sie nicht billigen, und wenn ein Papst einen solchen Grundsatz verkündet hatte, so war es schon um deswillen unmöglich, daß er unfehlbar sein könne.
Peter Frohwalt fühlte, daß an diesem Tage eine Erschütterung durch seine Seele, durch sein ganzes bisheriges Glauben und Empfinden gegangen war, und daß der Widerwille, den er gegen den Protestantismus empfunden, in[278] seinem Herzen schmolz wie der Schnee vor dem hellen warmen Frühlingsstrahl. Und wie nach dem Besuche bei Quandt mußte er auch heute wieder mit wärmerer Zuneigung seiner Schwester, und mit versöhnlicher Milde seines Schwagers gedenken.
Und als ob der Himmel selbst ein solches Erinnern unterstützen wollte, fand Frohwalt, als er heimkam, einen Brief vor von Vetter Martin. Ein Gruß aus der Heimat! Wie mit einem Schlage war die ganze Erregung, mit der er das Haus des Prälaten verlassen hatte, in ihm verwischt, hinter ihm versank alles andere, und von freundlichem Licht umwoben stand das kleine Landstädtchen im westlichen Böhmen vor ihm, und alles, was er dort lieb hatte. In solcher Stimmung öffnete er das Schreiben und las:
»Mein lieber Peter!
Ich habe allezeit etwas auf Ehrlichkeit und Geradheit gehalten, darum kann ich Dir auch nicht verhehlen, daß Du diese Epistel in erster Reihe dem Umstande verdankst, daß ich Langeweile habe. Draußen schneit es, wovon Ihr in Rom keine Ahnung habt, aber das könnte mich nicht abhalten, mich irgendwo in einer zur Zeit lieblicheren Gegend unseres Planeten herumzutreiben, wenn mir nicht wieder einmal meine linke Hinterpfote den Dienst versagte. So habe ich mir denn das Vergnügen gemacht, mein ganzes Museum einmal zu ordnen und zu katalogisieren und finde nun zu meiner eigenen Verwunderung, daß es nicht weniger als achthundertzweiundvierzig Nummern umfaßt, darunter manches Hübsche. Ich hoffe, daß mir's der Himmel vergönnt, die tausend voll zu machen. Seit drei Tagen bin ich mit der Arbeit fertig, habe die erste Freude an der Sache ohne weiteren Schaden an meiner Gesundheit verwunden, bin aber auch lahm gelegt in des Wortes vollster Bedeutung. Darum ergreife ich die Feder, wie mein Alter – Gott hab' ihn selig – immer seine Briefe an mich anfing, um ein wenig mit Dir zu plaudern.[279] Es thut Dir vielleicht auch gut, wenn Du einmal, anstatt mit den Vätern des allgemeinen Konzils, mit dem alten Vetter Martin eine Viertelstunde umgehst, der zwar weder selbst unfehlbar ist, noch einen andern, und wenn's der Papst wäre, dafür halten kann, der aber darum hoffentlich noch nicht als Ketzer von Dir angesehen wird, sintemal Ihr den neuen Glaubenssatz noch nicht fertig gekriegt habt. Es wäre überhaupt – in Klammern gesprochen – besser, wenn das Ei, welches die Jesuiten gelegt haben, vom Konzil nicht ausgebrütet würde. Das ist aber so meine Privatmeinung, die Dir und dem Kardinal Schwarzenberg sehr gleichgültig sein wird, weshalb Du sie auch diesem gar nicht zu sagen brauchst.
Aber reden wir lieber von angenehmeren Sachen! Deine Mutter ist wohlauf und freut sich über jeden Brief aus Rom. Ich glaube, sie hält Dich jetzt in der Siebenhügelstadt für den wichtigsten Mann nach dem Papste und meint, daß das ganze Konzil ohne Dich Essig wäre. Ich gönne ihr diese Freude, um so mehr, als sie mir dafür die andere macht, daß sie Deine Episteln immer mich zuerst lesen läßt, woraus Du ersehen kannst, daß ich in Deinen römischen Verhältnissen mich auskenne, wie in meinem Rucksack und daß ich Dich ohne Cicerone finden werde, wenn ich nach Rom komme. Und das habe ich mir vorgenommen. Ich muß mir so ein Konzil in der Nähe ansehen, denn ich glaube, ich erlebe kein zweites. Das wäre zwar kein Unglück, weder für mich, noch für die Welt, aber da ich meine Einkünfte ebenso gut in der ewigen Stadt, wie hier in dem entlegenen böhmischen Winkel verzehren kann, so …
Aber weiter im Texte. Deine Schwester blüht wie eine Rose in Glück und Gesundheit, und ich habe – unter uns gesagt – den Eindruck, als ob ihr weder die Ehe, noch der Protestantismus geschadet hätte. Und erst ihr kleiner Junge, Dein Neffe, mein Pathchen Martin Peter. Potz Respekt vor dem Bengel. Schade, daß der nicht beim Konzil sein kann;[280] ein Organ hat er wie ein Kirchenvater und dazu mehr Unschuld, als alle zusammengenommen. Da sagst Du nun: »Was dem alten Manne für dumme Witze passieren?« Na ja, aber ich meine nur, weil er ein kleiner Protestant und für den ewigen Höllenpfuhl vorherbestimmt ist, daß das arme Kerlchen weniger Sünden auf dem Gewissen hat, als irgend ein Konzilsvater, dem doch die ewige Seligkeit verbürgt ist, wenn er ein gehorsamer Sohn der Kirche ist, und nicht weiter muckt, wenn es heißt: Roma locuta est – Rom hat gesprochen!
Aber hier komme ich ins Schwatzen und auf ein Thema, das Dich möglicherweise veranlaßt, mit meiner Epistel Deinen Ofen zu heizen, wenn Du einen hast, was in Rom nicht immer der Fall sein soll. Wenn Du keinen hast, betrachte ich das als ein gutes Omen, das mich veranlaßt, wenigstens flüchtig auch Deines Schwagers Freidank zu gedenken, der zu den fleißigsten und bravsten Menschen gehört, die ich jemals kennen gelernt habe … und, Peter, das will viel sagen. Der alte Pfarrer hat nach wie vor seine Uhren bei ihm reparieren lassen. Das ist aber nun vorbei, denn dem alten, braven Herrn ist selber die Lebensuhr stehen geblieben.
Ganz plötzlich. Eines Morgens, vor etwa vierzehn Tagen lag er früh tot im Bette und lächelte. Es war ein großes Begräbnis, und da hat sich erst die Liebe gezeigt, die die Leute zu ihm hatten und da hat sich auch erst herausgestellt, was er unter der Hand Gutes gethan. Ich sage Dir, Peter, aus allen Winkeln kroch die Armut und die Lahmen und Presthaften hervor und humpelten hinter dem Sarge drein und schluchzten, wie wenn sie zu seiner Familie gehörten. Und ich glaube, der Mann war nicht gut angeschrieben beim hochwürdigen Konsistorium, er war – wie man sagte – aus der alten Schule Kaiser Josefs II., aber ich hatte den Eindruck, daß die Schule nicht schlecht war und bin seitdem noch stolzer, daß ich ihr auch angehöre.
Der neue Pfarrer gehört nicht dazu. Der Pater Ignaz ist, soviel wir hören, dazu bestimmt, und ich fürchte sehr, daß es jetzt mit dem lieben Frieden zwischen Katholischen und Evangelischen hier vollends vorbei ist. Mir kann's persönlich gleich sein, wer hier die frommen Schäflein zu weiden hat, aber ich wollte doch, sie hätten den Pater Ignaz lieber irgendwo in Hinterindien oder in einer sonstigen gesegneten Gegend zum Erzbischof, als gerade hier zum Pfarrer gemacht.
Noch eins, was Dich vielleicht interessiert. Du hast ja die Tochter von Professor Holbert gekannt, die hier an Dr. Haller verheiratet ist. Das ist eine Märtyrerin, die Ihr gleich beim jetzigen Konzil bei lebendigem Leibe heilig sprechen könnt! Wie diese zwei Menschen zusammenkommen konnten, das ist mir ein Rätsel der Seelenlehre, das ich mit meiner Alten-Junggesellen-Weisheit nicht klar kriegen kann. Der Mann verdiente bei den Botokuden als Leibarzt irgend einer schwarzen Menschenfresser-Majestät zu existieren und wäre vielleicht für eine solche zu einem Abendbrot noch leidlich genießbar. Hier hat er abgewirtschaftet. Ihm fehlt zum Arzte sehr viel, und zum anständigen Menschen nahezu alles, und ich kann manchmal, wenn ich ihn in einer besonders »geistvollen« (ich meine weingeistvollen) Phase erblicke, der Versuchung kaum widerstehen, zu erproben, ob mein Knotenstock oder sein Schädel mehr Festigkeit haben – 's ist mir aber immer wieder um meinen Stock leid. Das arme junge Weib! Er soll sie sogar mißhandeln, angeblich, weil sie nicht soviel Mitgift brachte, als er vermutete, und Deine Mutter weiß von verweinten Augen zu erzählen, aber sie klagt niemandem und ist immer so sehr freundlich! Herr Gott, wenn mein Hans Stahl davon Witterung erhält!
Ein hübscher Mann dagegen ist der Kapuzinerpater Severin. Er und der Guardian machen einem das Klösterchen lieb, und ich gehe nur zu ihnen in die Kirche, habe auch[282] mit dem Guardian schon botanisiert. Da muß ich wieder an Deinen guten Nedamitzer Alten denken. Ich hätte ihm gerne noch ein paar frohe Tage unter meinem Zeltdache bereitet … es hat nicht sein sollen. Möge er ruhen in Frieden! Ich glaube doch trotz allem, daß ich ihn im Himmel wiederfinde, vorausgesetzt, daß der Herrgott mich alten Sünder selbst einläßt. Na, wissentlich hab' ich niemandem Böses gethan – vielleicht ist das mein Passierschein.
Nun, mein lieber Konzilsvater, soll's aber gut sein. Bleibt nur fest und thut nichts, was gegen die Ueberzeugung ist … das hofft die Christenheit, und sie glaubt ein Recht dazu zu haben! Nun muß ich meine Hinterpfote schmieren, damit ich bald ausmarschieren kann.
Auf Wiedersehen in Rom, und herzlichen Gruß vom
Vetter Martin.«
Der Brief that wohl, wie ein frischer Trunk aus klarem, gutem Born; manches, was Frohwalt vordem darin vielleicht unbehaglich gewesen, erschien ihm jetzt so wahr und gesund, daß er bei seinem Abendmahle heiter und ruhig war und nach der Aufregung des Nachmittags einen friedlichen Schlaf fand, der ihn im Traum in seine Heimat trug.



Wochen waren vergangen. Der Unfehlbarkeitsbrei brodelte noch immer unfertig im Topfe des Konzils, und der Papst, welchem seine Umgebung vorgespiegelt haben mochte, daß die Sache glatt und schnell abgewickelt sein würde, wurde ungeduldig. So suchte die Jesuitenpartei nach einem Mittel, die Angelegenheit zu beschleunigen und glaubte ein solches gefunden zu haben in der Aenderung der als zu freisinnig sich erweisenden bisherigen Geschäftsordnung. Man rechnete dabei vor allem auf die für den Glaubenssatz unbedingt zur Verfügung stehenden Stimmen und glaubte auf das hin etwas wagen zu dürfen, was einem Gewaltakte täuschend ähnlich sah.
So wurde durch die neue Geschäftsordnung verfügt, daß sowohl die Versammlung, als auch der Präsident das Recht haben sollte, jede Debatte abzuschneiden und eine Abstimmung herbeizuführen. Wenn man erwägt, daß die Präsidenten und das gesamte Direktorium vom Papste ernannt wurden, und daß überdies die Mehrheit der Versammlung bedingungslos alles anzunehmen bereit war, so erhellt daraus, welchen Wert alle ferneren Beratungen noch haben konnten. Dazu kam die weitere Bestimmung der neuen Geschäftsordnung, daß alle Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt werden konnten. Der Zufall einer einzigen[284] Stimme sollte Ausschlag gebend sein für einen so ungeheuer wichtigen Beschluß, welcher tief in das Leben der Kirche eingriff.
Ein solches Vorgehen rief unter einem Teil der Konzilsväter eine heftige Bewegung hervor, und wiederum waren es die deutschen und österreichischen Bischöfe, denen sich auch französische und ungarische anschlossen, welche keinen Augenblick die gefährliche Bedeutung der neuen Geschäftsordnung verkannten.
Auch im Hause des Kardinals Schwarzenberg zitterte diese Erregung nach. Professor Meyer, der sonst außerordentlich ruhig blieb, erörterte mit Schärfe und klarer Gewissenhaftigkeit die Sachlage, und Dr. Frohwalt, welchem die ganzen unwürdigen Vorgänge genügend bekannt waren, fühlte sich immer mehr erschüttert in seinen Anschauungen, die er von der ewigen Stadt und ihrem kirchlichen Leben gehabt hatte. Mehr als einmal dachte er des Gesprächs mit Professor Holbert, und mit eigenen Augen sah er nun, welche gefährliche Macht der Jesuitismus in den Händen hatte, eine Macht, der gegenüber der offene, ehrliche Mut der besser denkenden Kirchenväter immer mehr ins Wanken kam.
Auch diesmal kamen sie über halbe Maßregeln nicht hinaus. Wohl machten etwa hundert Kirchenfürsten eine Eingabe an den Papst, in welcher sie gegen die neue Geschäftsordnung sich wendeten mit der Erklärung, daß infolge derselben dem Konzil vorgeworfen werden könnte, daß es der Allgemeinheit, der Wahrheit und der Freiheit entbehre.
Nur vorgeworfen werden könnte! Hier fehlte das eigentlich richtige, das mutig durchgreifende, entschieden protestierende Wort, und so war es nicht verwunderlich, wenn solche Eingaben erfolglos blieben, und wenn die jesuitischen Ratgeber des Papstes sich ins Fäustchen lachten.
Frohwalt war mit dem Jesuitenpater Felice zusammengetroffen,[285] und dieser hatte mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit sich an den jungen deutschen Theologen angeschlossen. Im Gespräch aber hatte er mit einem beinahe spöttischen Lächeln um den schmalen Mund sich über die Bemühungen der deutschen Bischöfe geäußert, dem heiligen Stuhle Widerstand zu leisten und hatte mit humoristischer, aber unverkennbar höhnischer Wendung darauf hingewiesen, wie die Konzilsväter Rom nicht eher verlassen würden, bevor nicht das neue Dogma fertig sei. Der römische Sommer werde ihre Bedenken schon schmelzen helfen.
Frohwalt war der kalt lächelnde Mann mit den scharfen Augen niemals mehr widerwärtig gewesen, und er fühlte sich von seiner Freundlichkeit abgestoßen. Die Frage, weshalb er das Haus des Prälaten Parelli nicht mehr besuche, und ob er vielleicht die schönen Augen der Signora fürchte, empörte den jungen Priester, und er war nahe daran, mit heftiger Deutlichkeit dem Jesuiten den wahren Grund dafür anzugeben. Aber er bezwang sich und schützte irgend einen gleichgültigen Grund vor.
An Parellis Haus und die Verhältnisse in demselben sollte er aber bald in noch weniger angenehmer Weise erinnert werden.
Es war an einem Sonntag. Sisto, welcher ein kleines Stübchen im Erdgeschoß des Hauses des Prälaten inne hatte, neben der Wohnung Giovannis, hatte den ganzen Nachmittag an seinem Fenster gesessen und an einer Buchsbaumfigur geschnitzt, welche er schon seit einiger Zeit in der Arbeit hatte. Der Junge besaß ein ganz außerordentliches Geschick, und der Meister, bei welchem er sich in der Lehre befand, hatte sich wiederholt dem Prälaten gegenüber ungemein lobend ausgesprochen. Sisto hatte beschlossen, seinem Wohlthäter heimlich eine kleine Freude und Ueberraschung zu bereiten, und niemand sollte davon wissen. Es war eine ganz köstliche Phantasiefigur, an welcher er schnitzte, eine Art Satyr,[286] welcher auf der Schulter ein reblaubumwundenes Fäßchen trug, das als Lämpchenhalter verwendet werden konnte.
An diesem Sonntage wollte der Knabe mit seiner Arbeit zu Ende kommen, und als es dämmerte, war er in der That so weit, daß er mit Befriedigung auf das vollendete Werk schauen konnte. Er freute sich daran, noch mehr aber darüber, das kunstvolle Lämpchen heimlich in das Schlafgemach des Prälaten zu stellen und ihn so besonders zu überraschen.
Sisto war in seinem Plane ganz aufgeregt und konnte kaum erwarten, bis er nach der Abendmahlzeit sich würde in das betreffende Zimmer schleichen können. Er hatte sich schon vordem ein kleines Glasgefäß verschafft, welches in das geschnitzte Fäßchen paßte, es mit Oel gefüllt und mit einem Docht versehen, auch probiert, wie das Lämpchen brannte und sich beim Schimmer des kleinen Lichtchens erst recht an seiner hübschen Arbeit gefreut.
Als er nun meinte, daß der Prälat mit der Signora – Gäste waren heute ausnahmsweise nicht anwesend – noch bei Tische sitzen werde, schlich er leise und mit pochendem Herzen, als ob er irgend etwas Schlimmes vorhätte, die kleine Dienertreppe hinauf nach dem Obergeschoß. Er kannte, da ihn der Prälat ganz ungehindert überall verkehren ließ, die Lage der Zimmer, sowie ihre Verbindung unter einander ganz genau. Er wußte auch, daß das Schlafzimmer zwei Zugänge hatte, deren einer durch die Salons und das Arbeitszimmer führte, während der andere fast unmittelbar vom Flur aus zu erreichen war.
Er hatte das Lämpchen angezündet, hielt die Hand vor das kleine Licht, damit es ihm nicht erlösche und trat nun, durch ein Dienerzimmer und ein Vorzimmer geräuschlos hinschreitend, an die Thür des Schlafgemachs. Er spähte durch das Schlüsselloch und fand, daß alles finster war; sein Plan wurde offenbar begünstigt, und so faßte er, während seine Linke die Lampe trug, mit der Rechten den Drücker, der[287] leicht und unmerklich nachgab, und einen Augenblick später stand er im Rahmen des Eingangs. Aber dieser Augenblick ließ ihn beinahe zu Stein erstarren.
Das unselige Lämpchen beleuchtete ein Bild, vor dem der Knabe sich entsetzte. In dem Gemache stand an der einen Wand ein geschnitztes breites Bett mit einem seidenen Baldachin darüber und vor demselben ein Divan, der mit einem schönen Pantherfelle bedeckt war. Auf diesem aber saßen in heißer Umschließung Parelli und Lucia, letztere in weißem Négligé mit nackten, vollen Armen. Aus dem dunklen Rahmen des Zimmers trat gerade diese Gruppe, beleuchtet durch das flimmernde Licht, in müden aber deutlichen Umrissen hervor, und auch die beiden Menschen saßen im ersten Momente bei der unerwarteten Ueberraschung wie erstarrt.

Dann folgte ein zweifacher lauter Aufschrei. Den einen stieß die Signora aus, welche hastig aufsprang und ihre Arme von dem Nacken des Mannes löste, den andern Sisto, der gleichzeitig seine Lampe fallen ließ und wie von bösen Geistern gejagt, hinausstürzte. Dunkelheit lag wieder auf dem üppig ausgestatteten Raume, Dunkelheit breitete sich aus auch in dem kleinen Hofstübchen des armen Jungen, der wie von Entsetzen geschüttelt, mit klappernden Zähnen, sich angekleidet auf seinem Lager hin- und herwarf und den Schlaf nicht finden konnte.
Ihm war zu Mute, als ob ihm ein verehrtes Heiligtum entweiht, als ob ihm eine Gottheit in den Staub getreten worden wäre. Der arme Knabe hatte mit seinem frommen, anhänglich treuen Wesen in dem Prälaten die Verkörperung der Gottähnlichkeit gesehen, er hatte mit einer unendlichen Verehrung, beinahe mit Anbetung zu ihm aufgeschaut, wie zu einem Heiligen … und nun war er so furchtbar enttäuscht. Er hätte aufschreien und weinen mögen in seinen entsetzlichen Schmerzen, die ihm das junge, in seinem Vertrauen so enttäuschte Herz bereitete, denn er fühlte, daß er[288] trotz allem noch den Prälaten liebte; das Weib aber haßte er von dieser Stunde an tödlich.
Der Knabe hatte eine qualvolle Nacht. Stunde ging langsam um Stunde, aber so sehr die bange, heiße Schlaflosigkeit ihn quälte, so sehnte er doch nicht den Morgen herbei, denn er wußte nicht, was der neue Tag ihm bringen würde, und wie er vor die Augen seines Wohlthäters treten sollte.
Aber die Zeit kümmert sich nicht um Leid und Lust, nicht um Sehnsucht und Zagen eines Menschenherzens; mit gleichmäßigem Fuße schreitet sie ihren ewigen Weg durch Glück und Unglück. Und die Sonne Roms ging an jenem Morgen mit wundersamer Herrlichkeit auf am blauen Himmel der Tiberstadt und lachte über den Palästen und blinkte hinein in das Stübchen des armen Jungen, der mit verhärmten Wangen und verweinten Augen, ein Bild des Jammers, in einem Winkel kauerte, wie ein Hund, der gewärtig ist, mit der Peitsche hinausgetrieben zu werden aus dem Orte, wo er friedlichen und freundlichen Unterschlupf gefunden hatte.
Aber Sisto dachte nicht an sich; er dachte an den Herrn, den er liebte und dessen Seelenheil ihm in seiner naiven Frömmigkeit am Herzen lag. O wenn er ihn freimachen könnte aus den Fesseln des buhlerischen Weibes, wenn er wieder gläubig, vertrauend und verehrend zu ihm aufschauen dürfte wie zu einem echten, rechten Hirten der Christenheit! Er hatte im Gebete gerungen und vor allem seinen Schutzheiligen angefleht, der einst ein frommer Papst gewesen und ein Stellvertreter Christi auf Erden, und nun war durch seine Seele wie ein heller Blitzstrahl ein leuchtender Gedanke geflogen. Vielleicht stand sein Heiliger ihm bei, wenn er ihn ausführte.
Er hatte den Prälaten zurückkehren sehen aus der Kirche, und bei dem Gedanken, daß er trotz der Sünde des gestrigen Abends die Messe zelebriert und den Leib des Herrn in Brot- und Weingestalt genossen haben könnte, schauderte[289] er zusammen: Das war nicht möglich – es wäre ein Gottesraub gewesen. Er suchte sich den Gedanken auszureden, während er langsam die kleine Treppe hinaufstieg, die er am vorigen Abend mit freudig klopfendem Herzen gekommen war.
Er wußte, daß Parelli allein frühstückte und zwar in einem kleinen Gemache, das unmittelbar an sein Arbeitszimmer stieß. Auf der Treppe begegnete Sisto seinem Freunde, dem Kammerdiener, der ihm beinahe bestürzt in das blasse, überwachte Gesicht schaute, in welchem die dunklen Augen heute größer und glänzender zu sein schienen. Er frug den Knaben, ob er krank sei; dieser aber verneinte es lebhaft und that die Gegenfrage, ob er Monsignore jetzt allein antreffe.
Giovanni bestätigte dies und schon nach wenigen Augenblicken trat Sisto, nachdem er zuvor durch Klopfen Einlaß begehrt, bei dem Prälaten ein. Als dieser den Knaben sah, fuhr er beinahe erschrocken auf; sein Gesicht rötete sich, und Sisto begann einen Augenblick sich vor einem Ausbruch des Zornes zu fürchten. Aber ehe noch Parelli ein Wort finden konnte, hatte sich der braune Junge schon vor ihm auf die Knie niedergerworfen und hob die gefalteten Hände zu ihm empor:
»O gnädigster Herr, seien Sie nicht böse! Ich habe Ihnen eine Freude machen und Sie mit dem kleinen Schnitzwerk überraschen wollen … ich konnte ja nicht wissen … ich wäre niemals gekommen, und es wäre auch besser für mich gewesen. O gnädigster Herr –« und hier brach Sisto in lautes Schluchzen aus, das den jungen Körper so sehr erschütterte, daß der Knabe nur mit Anstrengung die Worte hervorstoßen konnte »– ach verzeihen Sie mir, aber ich kann nicht anders, weil ich Sie zu lieb habe, entlassen Sie die Signora, die Sie unglücklich macht im Leben und im Sterben, die Ihnen die Seele vergiftet und die ewige Seligkeit raubt! O mein Gott, was rede ich da vor Ihnen, dem hohen[290] geistlichen Herrn! Aber beim heiligen Sistus, ich kann nicht anders, ich muß Sie anflehen, weil es mir sonst das Herz sprengen müßte. O, Signora Lucia ist nicht verwandt mit Ihnen, schicken Sie sie fort, und ich will auf den Knieen vor Ihnen liegen, wie vor den lieben Heiligen, o schicken Sie sie fort!«
Der Prälat war tief erschüttert von dem ungeheuchelten Seelenschmerze des Knaben; er war aufgestanden und stand da mit bleichem Gesichte, gelehnt an den Rand des Tisches. Er sagte mild, mit bewegter Stimme:
»Steh auf, Sisto! Ich will vergessen, daß Du durch Dein Eindringen in mein Gemach zu solcher Stunde ungebührlich gehandelt hast, und daß Deine Liebe zu mir Dich auch jetzt ungebührlich reden läßt.« Auch dem Knaben wich die Röte, welche, während er sprach, seine Wangen übergossen hatte, wieder aus dem Antlitz, und ohne sich zu erheben, stammelte er:
»Und das Weib? – Und die Signora?«
»Das verstehst Du nicht, Knabe, und darüber kann ich mit Dir nicht sprechen,« sagte Parelli ernst, beinahe strenge.
Sisto stand auf. Er sprach kein Wort mehr, die braunen Hände vor das Gesicht geschlagen, stürzte er hinaus, eilte die Treppe hinab nach seinem Stübchen, und hier warf er seine Kleider, die der Prälat ihm gekauft, von sich, suchte den verschlissenen Anzug, in welchem er ins Haus gekommen war, kleidete sich hastig darein, machte dann noch ein kleines Bündelchen zusammen von dem, was er mit Recht sein nennen konnte, und machte sich so wie zu einer Flucht fertig. In ihm stand es fest, daß er nicht hierbleiben konnte, er hätte das Weib erwürgen, vergiften, erdolchen müssen!
Er gab acht, daß ihn niemand bemerken konnte, und dann huschte er schnell durch das Thor hinaus auf die Straße. Noch einen scheuen Blick warf er nach dem hohen, prächtigen Hause, dann lief er von dannen. Er wußte nicht,[291] wohin er sich wenden sollte. Zu dem Meister, der ihn in der Holzbildhauerei unterrichtete, zu gehen, schämte er sich in seinem Anzuge; er hätte nicht gewußt, was er ihm mitteilen sollte über den Grund der Veränderung, die mit ihm geschehen war, und fürchtete Mißdeutungen. Auch zu Quandt wagte er sich aus dem gleichen Grunde nicht, und so stand er in dem weiten, glänzenden Rom wie damals, als er bettelarm in einem Winkel kauerte, weinend und hungernd.
Da fiel ihm der junge deutsche Priester ein, welchen er einigemale im Hause Parellis, sowie bei Quandt gesehen hatte.
Das frische Antlitz, das klare Auge, die wohlwollende Güte Dr. Frohwalts hatten auf den Knaben schon lange einen besonders guten Eindruck gemacht, so daß er stets mit gewissem Vertrauen zu ihm emporblickte. Und da er jetzt, in dieser unglückseligen Stunde jemanden brauchte, dem er, wie einem Beichtvater, alles erzählen konnte, was seine junge Seele schmerzlich zusammenzog, so beschloß er, Frohwalt aufzusuchen.
Er war bei dem Gedanken ruhiger geworden und schritt langsam über die Ponte San Angelo nach dem andern Tiberufer, wo ihm in massiver Majestät die Engelsburg entgegenragte. Sisto kannte die Wohnung des deutschen Priesters, denn er hatte denselben schon einmal im Auftrage des Prälaten aufgesucht, und zu seiner Freude fand er ihn daheim.
Frohwalt sah verwundert, ja beinahe betroffen auf den Knaben in seinem schäbigen Anzuge, und auch Sisto stand einige Augenblicke verlegen und mit schimmernden Augen vor ihm. –
»Was ist's? Und warum kommst Du so zu mir?« fragte endlich der Priester in freundlichem Tone, und der Knabe faßte nach seiner Hand und küßte sie inbrünstig.
»Ach, verzeihen Sie mir, hochwürdiger Herr! Aber ich[292] muß zu Ihnen kommen, Sie sind der Einzige, zu welchem ich Vertrauen habe.«
Frohwalt suchte den aufgeregten Jungen zu beruhigen. Er zog ihn neben sich auf den Divan, legte ihm freundlich die Hand auf die Schulter, und so, sich leicht an den Priester anschmiegend, die Augen gesenkt, berichtete Sisto alles, was seit gestern abend gewesen war. Er schloß:
»Und da konnte ich nicht anders, hochwürdiger Herr! Ich mußte das Haus verlassen und wenn ich auch betteln muß. Ich will keine Hilfe von Ihnen, Sie sollen mir nur sagen, ob ich recht gethan habe oder nicht, denn Gott weiß, ich wollte nicht undankbar sein!«
Frohwalt war tief erschüttert von den schlichten, wahrheitsvollen und doch so leidenschaftlich erregten Worten des Knaben. Er sah wie in einen Abgrund, in welchen kein Licht fallen konnte. Das Haus eines Kirchenfürsten, aus welchem die guten Geister wichen und worin die geputzte Sünde zurückblieb!
O, das war schlimmer als im Pfarrhause in Nedamitz! Aber was sollte er dem Knaben sagen? Was sollte überhaupt mit diesem geschehen?
Dieser sah ihn mit seinen großen dunklen Augen so treuherzig und vertrauend an, daß er, einem jähen Antrieb folgend, seine Hand ergriff und sagte:
»Du hast recht gethan, Sisto!«
Da küßte ihm der Knabe aufs neue die Hände, Frohwalt aber fuhr fort:
»Indes so ohne weiteres solltest Du doch nicht fortlaufen. Der Prälat wird sich um Dich ängstigen und er muß wissen, wo Du bist. Ich werde mit ihm sprechen – –«
»Sie wollen ihm sagen, daß ich Ihnen erzählt …«
»Sei ruhig – ich werde das Richtige zu finden suchen. Aber mit Dir will ich zuvor zu Herrn Quandt gehen, ob er[293] sich Deiner annehmen kann, denn ich selber kann Dich leider nicht bei mir haben.«
»Und auch Herrn Quandt wollen Sie sagen –?«
»Nein, Sisto – ich werde den Prälaten nicht bloßstellen.«
Die Augen dies Jungen leuchteten dankbar und freudig auf bei der Aussicht, zu dem deutschen Maler zu kommen, in dessen Häuslichkeit er sich allezeit besonders wohl gefühlt hatte. Aber in seinem jetzigen Anzuge sollte er nicht dahingehen, und Frohwalt ließ einen Wagen kommen, in welchem er mit seinem Schützling erst bei einem Kleiderhändler vorfuhr, wo er ihm ein einfaches aber kleidsames Gewand kaufte, das er sofort anlegen mußte.
»Das schenk' ich Dir, Sisto, und Du brauchst mir nicht dafür zu danken; bleibe nur immer so brav und ehrlich wie bisher – das ist der beste Dank!« sprach der Priester, und dann fuhr er mit dem freudig bewegten Knaben weiter, bis sie vor dem Häuschen hielten, welches Quandt bewohnte.
Sie trafen den Maler und Friederike, die eben ausgehen wollten, an der Treppe.
»Das ist gut, daß Sie uns gerade noch erwischen; wir wollten den schönen Vormittag zu einem Spaziergang benutzen, vielleicht schließen sie sich uns an? – Aber, Sie sehen ja so feierlich ernst drein mitsamt meinem jungen Modell, das schon wieder in einem neuen Futteral steckt … wir haben doch heute nicht heimlich Geburtstag, Fritzel?«
So rief lachend der Maler, seine Frau aber hatte schon den Jungen an der Hand und führte ihn die Treppe wieder hinauf.
»Schenken Sie uns nur eine Viertelstunde, verehrter Freund« – sagte Frohwalt – »es handelt sich um Sisto!«
»Sie thun ja so ernst, als ob der Junge entweder ein Staatsverbrechen begangen habe oder zum Konzilsvater vorgeschlagen worden sei – Verzeihung! Das war ein dummer[294] Scherz, aber unsereinem läuft manchmal die Zunge fort. Da sehen Sie nur meine Frau mit dem Bengel – das ist doch zum Eifersüchtigwerden!«
Sie waren wieder oben angekommen, und saßen in dem freundlichem behaglichen Zimmerchen neben dem Atelier, und Friederike hatte Sisto bereits einige süße Näschereien vorgesetzt.
»Und jetzt schießen Sie los!« sprach der Maler.
»Nun denn, kurz und bündig! Sisto kann nicht im Hause des Prälaten bleiben – die Schuld liegt an der Signora –«
»Wo ist das Weib?« murmelte Quandt.
»Nähere Einzelheiten möchte ich nicht anführen, sie regen nur den Jungen auf; lassen Sie sich mit der Versicherung genügen, daß seines Bleibens bei Monsignore Parelli nicht sein kann. Nun hängt er in der Luft – ich kann ihn leider Gottes nicht bei mir behalten, das erlauben mir die Verhältnisse nicht, und da wollte ich, zumal Sisto zu Ihnen und Frau Friederike so großes Vertrauen hat, anfragen, ob Sie nicht wenigstens für die Zeit Ihres Aufenthalts in Rom sich seiner annehmen und ihm Unterkunft gewähren wollten. Wir halten wohl Umschau, was weiter mit ihm werden soll.«
»Na, da brauchts wohl keinen Familienrat – he, Fritzel?«
»Wir haben keine Kinder, Heinrich – und da ist's doch, als ob uns der Himmel selber …«
»Na, er kommt freilich schon etwas sehr ausgewachsen an, der Junge … aber um so besser, da braucht man sich nicht mit den Zahnkrankheiten zu ängstigen! Also, wir wollen uns den Fall überlegen. Sisto, willst Du bei uns bleiben?«
Der Knabe errötete bis unter die dunklen Stirnlocken, und die Augen leuchteten. Er stammelte unverständliche Worte, aber Friederike zog ihn an sich und küßte ihn.
»Na, da haben Sie das Siegel auf dem Pakt – was[295] wollen Sie denn noch mehr? – Ich glaube, jetzt werde ich kürzer gehalten, und darum bin ich für eine Probezeit!« sagte der Maler lächelnd; dann zog er sein Weib und den Jungen zugleich an sich und küßte beide. – –
Frohwalt ging in wundersam gehobener Stimmung aus dem kleinen Hause. Die sonnige Heiterkeit, die selbstlose Menschenliebe, welche hier waltete, that ihm außerordentlich wohl. Aber je näher er der Wohnung Parellis kam, desto mehr schwand dieses Behagen aus seiner Seele, und mit pochendem Herzen, fast als hätte er eine Schuld auf sich geladen, trat er durch das Portal und frug den Portier, ob der Prälat daheim sei. Als dies bejaht wurde, ging er langsam die breite, glänzende Marmortreppe empor. Auf derselben begegnete ihm der Jesuit Felice. Mit vordringlicher Freundlichkeit hielt er den anderen auf. Frohwalt aber wurde bei dem Gedanken, daß der Pater, welcher hier so häufig verkehrte, doch auch Kenntnis von den Verhältnissen des Hauses haben mußte, dieselben stillschweigend hingehen ließ und so heimlich billigte, von einem Widerwillen gegen den Mann erfaßt, den er kaum verhehlen konnte. »Der Zweck heiligt die Mittel!« Das mußte er unwillkürlich in diesem Augenblicke denken, und er mußte sich zusammennehmen, um nicht unhöflich zu erscheinen.
»Wissen Sie schon, daß der Betteljunge, den Seine bischöflichen Gnaden so wohlwollend aufgenommen, ohne ein Wort des Dankes davongelaufen ist? Monsignore ist außerordentlich aufgeregt darüber und in Sorge um den gottlosen Burschen.«
»Ich hoffe, ihn beruhigen zu können,« sagte Frohwalt kühl; »ich weiß, wo der Knabe ist und kann versichern, daß er sich in guten Händen befindet.«
»Aber ein Undankbarer bleibt er doch!«
»Vielleicht haben Sie doch nicht ganz recht, Hochwürden,« sagte Frohwalt mit leichtem Achselzucken, »und ich bin überzeugt,[296] daß Seine bischöflichen Gnaden von meiner Mitteilung befriedigt sein werden.«
Er verneigte sich vor dem Jesuiten, und ging weiter, um durch den im Vorzimmer Parellis weilenden Kammerdiener sich anmelden zu lassen. Der Prälat empfing ihn in seinem Arbeitszimmer, freundlich und entgegenkommend wie immer, und fragte, was ihm die Freude mache, den langvermißten Gast wieder einmal bei sich zu sehen.
Als Frohwalt von Sisto berichtete, wie er zu ihm gekommen sei in seinem elenden Bettleranzuge, aufgeregt und erschüttert bis in die tiefste Seele, lehnte sich Parelli erbleichend in seinen Sitz zurück. Er schloß die Augen und fragte beinahe flüsternd:
»Hat er Ihnen gesagt, weshalb er von mir fortgegangen ist?«
»Er hat es mir anvertraut wie unter dem Siegel der Beichte, und es ist geborgen in meinem und seinem Herzen. Der Junge ist brav und tüchtig und hat ein großes Herz, Monsignore … Sie haben einen guten Engel aus Ihrem Hause vertrieben!«
Parelli wurde noch bleicher; er atmete tief, und einige Sekunden lang herrschte eine peinliche Stille in dem prunkvollen Raume. Dann sprach er:
»Und was soll mit ihm werden?«
»Herr Quandt und dessen Frau haben sich seiner zunächst angenommen bis auf Weiteres.«
»Ich werde einen Betrag für seine weitere Ausbildung Herrn Quandt zur Verfügung stellen.«
»Ich vermute, daß derselbe diesen ablehnen wird. Er ist, soviel ich weiß, nicht unvermögend und kinderlos. Ich komme auch nicht darum, sondern lediglich, um Eure bischöfliche Gnaden über das Schicksal des Knaben zu beruhigen.«
»Ich danke Ihnen!« sagte Parelli tonlos – »und kann ich gar nichts thun?«
»Monsignore, Sisto wird jeden Tag für Sie beten … wenn sein Gebet nicht vergebens wäre, so wäre dies das Herrlichste, was er erringen könnte,« sprach Frohwalt mit bewegter Stimme.
Der Prälat verstummte; er neigte langsam das Haupt, tief, bis auf die Brust herab, und so verließ ihn der junge Priester nach kurzem, höflichem Gruße. Und da er die Marmortreppe wieder hinabschritt, dachte er abermals an das schlichte Pfarrhaus in Nedamitz und an den alten Pfarrer mit seinem guten, schwachen Herzen, und es that ihm abermals leid, daß er ihn in jener letzten Stunde ihres Beisammenseins so hart angefaßt hatte.
Rom zeigte ihm Manches in anderem Lichte, als er es in der Heimat gesehen hatte.



Auf der Straße, die von Marino gegen das schön gelegene Frascati führt, schritt ein Wanderer, ein bejahrter Mann in einfachem Gewande, eine leichte Mütze auf dem Kopfe und einen kräftigen Stock in der Hand. Er sah mit hellen Augen in die Welt und ging gemächlich seines Weges, wobei ihn der Ranzen auf seinem Rücken gar nicht zu beeinträchtigen schien.
Es war der Vetter Martin.
Daheim hatte es ihn, seit es mit seinem Fuße besser ging, nicht mehr gelitten, und als noch der Winter über den deutschen Fluren lag und nur ab und zu ein milderer Märzhauch den kommenden Frühling ahnen ließ, war er aufgebrochen nach dem Süden. Dort mußte es ganz besonders schön und angenehm sein, und Italien war schon lange das Ziel seiner Sehnsucht gewesen. In seinen jungen Tagen hatte er Seumes »Spaziergang nach Syrakus« gelesen, und die Eindrücke jenes Buches wurden ihm bei seinem Wandern wieder lebendig, denn in ihm steckte manches, was mit dem alten »Spaziergänger« verwandt war.
Er hatte sich Zeit gelassen und gerastet, wo es ihm just gefiel, nur als er näher an die ewige Stadt kam, hatte ihn eine gewisse Unruhe erfaßt und seinen Fuß beschleunigt. So war er an diesem gesegneten Märztage im Albanergebirge[299] eingetroffen. Er hatte vom Monte Cavo, dem alten Mons Albanus, hinausgeblickt in die weite Ebene, durch welche der Tiber seine spiegelnden Fluten gleiten läßt, und hatte über den Sabiner- und Etruskerbergen den leuchtenden Gürtel des Mittelländischen Meeres blinken sehen, während unter ihm aus dem Grün der Oliven- und Steineichen, der Pinien und Reben, das freundliche Albano, das malerisch über dem kristallklaren Spiegel des Albanersees liegende Marino, das anmutige Castel Gandolfo, der Sommersitz des Papstes, emporschauten, und ferner her wie ein weißer leuchtender Häuserstreifen die Siebenhügelstadt selbst grüßte.
Das Herz war dem alten Manne weit geworden bei diesem Anblick, und alle Welt hätte er ans Herz drücken mögen. Die Vergangenheit wurde auch ihm hier lebendig, wie tausend anderen, welche diese Straßen wanderten, wo über den Trümmerresten alter Tempel und der Landhäuser berühmter Männer eine neuere Zeit ihre Kirchen und Klöster gebaut hat.
Was war doch diese Campagna für ein seltsames Gebiet! Dies Gefilde, mit Trümmern und Gräbern bedeckt, die über dem braunen, goldtönigen Boden sich erheben, der überwuchert wird von Ginster und Thymian, von Heidekraut und Binsen, zwischen denen einsame alte Bäume – Cypressen und Pinien – traurig und seltsam stimmungsvoll emporragen. Und als Staffage diese braunen Hirten in flockigen Schafspelzen, wie sie unter ihren Schafen und Ziegen stehen, den langen Stock unter die Achsel gestemmt und träumend hineinschauend in die melancholische Landschaft, während der zottige weiße Hund die Tiere zusammenhält – und die weidenden Heerden silbergrauer Rinder, welche die weitgeschweiften Hörner wiegen und mit traurigem Glockenton durch die stille Campagna läuten! Und um das ganze Bild der Rahmen der blauen Berge, um die ein verhaltener, fein sich abtönender Duft schwebt!
Vetter Martin fand es begreiflich, warum es die deutschen Maler hierher zog, und er hätte gewünscht, selbst etwas von der Kunst zu verstehen, um wenigstens den einen oder den andern Eindruck festhalten zu können. Er dachte an Hans Stahl, und wünschte, den lebendigen Burschen bei sich zu haben, der jetzt wohl daheim im Kontor des Vaters seufzend auf dem Drehstuhl saß. Es war schade um den Jungen.
Der Alte war nach den Ruinen von Tuskulum gelangt, wo einst die vornehmsten Römer ihre Landsitze gebaut hatten, unter ihnen auch Cicero. An den Ueberresten des Theaters vorbei schritt er auf dem vulkanischen Boden hinauf nach der alten Burg, von wo aus ein herrlicher Blick ins alte Latium geboten sein mußte. Und in der That, wo der Bergrücken ziemlich schroff abfällt, that sich ein wundersam schönes Landschaftsbild auf. Hier aber saß auf einem Steinblock ein blonder Mann mit breitrandigem Hute unter einem aufgespannten Schirm und skizzierte in seinem Buche, während eine junge hübsche Frau, im hellen Gewande, mit leichtem Sonnenschirm hinter ihm stand, und mit den leuchtenden braunen Augen über seine Schulter weg bald auf das Bild, welches unter seiner Künstlerhand sich gestaltete, bald auf jenes, das da sonnenvoll sich weit ins Land dehnte, schaute.
»Guten Tag!« grüßte der alte Weltfahrer in deutscher Sprache, als ob das gar nicht anders sein könnte, und die beiden anderen blickten nach ihm her und erwiderten wie aus einem Munde:
»Guten Tag!«
Und damit war die Bekanntschaft gemacht zwischen dem Maler Heinrich Quandt und seiner munteren jungen Frau einerseits und zwischen Jakob Martin, »Naturforscher und Naturbummler«, andererseits, und beide Teile schienen ungemein viel Gefallen an einander zu finden. Der Maler hatte trotz des Widerspruchs des Alten seine Gerätschaften eingepackt und erklärte, fertig zu sein; er ließ es sich nun nicht nehmen,[301] dem anderen das Landschaftsbild, dessen entzückender Reiz Vetter Martin die Seele schwellte, klar zu machen.
»Dort rechts liegt Camaldoli, Tivoli, dann Monticelli, dahinter die lieben blauen Sabinerberge und in der Ferne der Soracte; links sind die Cimini-Berge und die Albanerhöhen, von denen Sie wohl herkommen.«
»Ja, auf dem Rocca di Papa und dem Monte Cavo habe ich gestanden. O, ich habe manches anmutige Erdenfleckchen gesehen, aber einen so seltsamen Zauber haben wenige auf mich ausgeübt. Lassen Sie mich's schweigend aufnehmen, dann trag' ich's in der Seele mit fort!«
Der alte Mann hielt sich die Hand über die Augen, und schaute stumm und unverwandt hinein ins alte Latinergebiet, und die beiden andern störten ihn nicht in seiner Naturandacht; Friederike stützte sich nur fester auf den Arm des Gatten und schmiegte sich inniger an ihn. Nun drehte sich Martin um.
»Jetzt aber will ich nach Frascati und auch für mein sterblich Teil sorgen; ich hoffe, es giebt etwas Anständiges zu essen und zu trinken.«
»Wenn Sie uns mitnehmen, schließen wir uns Ihnen zu gleichem Zwecke an, und überdies würden Sie uns eine Freude machen, wenn Sie in unserem Wagen mit nach Rom führen.«
»Das nehme ich an, denn Sie gefallen mir, Herr Quandt mitsamt Ihrem Frauchen und mit guten Menschen kann man nicht lange genug beisammen sein. Das nehme ich als gutes Vorzeichen für meinen Einzug in Rom. Also: frisch auf nach Frascati!«
Der Maler schien den Weg genau zu kennen; er schlug den schönsten ein, der über Cappucini und vorüber an der prächtigen Villa Ruffinella, die auf der Stätte, wo einst Cicero sein Tuskulum hatte, Lucian Bonaparte sich erworben hatte, und die gegenwärtig wohl dem König von Italien gehört. Dies Frascati ist eine Villenstadt, in welcher überall[302] aus herrlichen Gärten die schönsten und stilvollsten Bauten hervorlugen, von deren Loggien und Terrassen sich entzückende Fernsichten bieten über die Campagna und in die blauen Sabinerberge.
Auf dem Wege plauderte der Alte in seiner gewohnten, gemütlichen Weise:
»Daß der erste Römer, welchem ich begegne, ein Deutscher sein würde, hätt' ich mir doch nicht träumen lassen. Also aus Dresden sind Sie? – Um so besser, da sind wir ja eigentlich gute Freunde als Sachsen und Oesterreicher, noch vom Jahre 66 her. Es war eine garstige Zeit, Herr, und die Preußen mitsamt ihrem Bismarck haben mir schwer im Magen gelegen. Aber der Teil ist gut bei mir, und darum hab' ich's verdaut und sage: 's ist vielleicht auch gut gewesen, und Bismarck – alle Hochachtung!«
»Ich fürchte fast, daß uns im katholischen Oesterreich das Jahr 70 noch Schlechteres bringt, als 66. Und das wird hier zusammengebraut, in Rom – ich meine den neuen Glaubenssatz. Ich weiß nicht, wie Sie zu der Sache stehen –«
»Ich bin Katholik, aber ich beklage mit Ihnen diese Jesuitenmachenschaften, und meine Frau ist eigentlich gleichgültig bei der Sache – sie ist Protestantin,« sagte Quandt ernst.
»So? – Na, dann verstehen wir uns um so besser. Ich habe noch eine kleine Hoffnung; die österreichischen und deutschen Bischöfe, sagt man, wollen von dem neuen Glaubenssatz nichts wissen, und leisten Widerstand. Das möcht' ich mir einige Tage hier in der Nähe ansehen, das heißt, soweit das möglich ist. Eine kleine Fühlung mit dem Konzil hab' ich durch meinen Paten – er nennt mich zwar immer Vetter – der auch hier ist im Gefolge des Prager Erzbischofs, Dr. Peter Frohwalt – –«
»Frohwalt?« schrie der Maler – »das ist ja ein guter[303] Freund von uns, der vielfach in unserem Hause verkehrt – nicht wahr, Fritzel?«
»Na, da bleibt doch die Weltgeschichte stehen« – rief der Alte – »was? Mein Peter Frohwalt verkehrt bei Ihnen, und er weiß, daß Ihre Frau evangelisch ist?«
»Jawohl!«
»Das ist mir eine große Zeitung, und Sie wissen gar nicht, wie mich das freut! Aber auf diese Weise sind wir ja einander noch viel näher gekommen. Und das Wunder hat die kleine Frau da zu Wege gebracht? Hören Sie, unsere Bekanntschaft ist noch sehr jung, aber nach dieser Mitteilung müssen Sie gleich nach den Erzengeln kommen, Frau Quandt – dafür kenne ich meinen Peter.«
»Ja, und ich schätze meine Fritzel auch wie meinen Erzengel!« sagte lachend der Maler und legte leicht den Arm um die Taille des jungen Weibes.
So kamen sie nach Frascati. Im freundlichen Garten einer Schenke hielten sie Einkehr, fröhliche Leute, die auf dem kurzen Wege völlig Freunde geworden waren, und bald saßen sie an einem Tische bei einem einfachen Mahle und stießen mit dem trefflichen Weine von Frascati an.
Neben ihnen, am nächsten Tische, saßen zwei Männer beim Würfelspiel. Sie waren sehr lebhaft nach Art der Südländer, und die dunklen Augen in den braunen Gesichtern funkelten. Der Eine war ein stämmiger Bursche in ländlicher Tracht, und wie der Maler das weinrote, gedunsene Gesicht sah, kam es ihm bekannt vor, doch wußte er nicht gleich, wo er demselben begegnet war.
Jetzt stieß der Mann einen lauten Fluch aus, fuhr in die Tasche und warf klingend ein Goldstück auf den Tisch.
»Das ist der letzte! Ein neapolitanischer Dukaten – und wenn er weg ist, geh' ich zu meinem Schwager und hole mir mehr! Wirf!«
Jetzt wußte Quandt, mit wem er es zu thun hatte;[304] das war der rohe Bursche, dem er in Tivoli begegnet war, als er in Gesellschaft Parellis und Frohwalts dort gewesen war, und der Mensch gewann für ihn einiges Interesse; auch Vetter Martin hielt den Blick nach ihm hingewendet. Die Würfel klapperten und fielen – einmal, zweimal.
»Maledetto! Schuft!« schrie der Bauer, und sprang mit lodernden Augen auf. »Du spielst falsch – her mit meinem Gelde!«
Der andere hatte das kleine Goldstück erfaßt, und sie rangen darum, nur zwei Sekunden. Da blitzte in der Hand des Neapolitaners eine blanke Klinge. Die beiden Deutschen sprangen gleichzeitig auf, aus der Schenke, um deren offene Fenster die Weinranken spielten, kreischten Weiberstimmen … und einen Augenblick später taumelte der unselige Gewinner zurück, hielt sich mit der einen Hand an der Tischplatte und preßte die andere gegen die Brust, und über diese rann ein heißer roter Strahl Der Angreifer aber schien jetzt erst in noch größere Wut zu geraten und wollte sich von neuem auf sein Opfer stürzen. Da packte ihn eine kraftvolle Faust von rückwärts, und eine starke Hand hielt ihm die erhobene Rechte mit dem blutbefleckten Messer fest, während sich die Person des Malers vor den Angegriffenen warf.
»Ich halte die Bestie schon,« rief Martin – »holen Sie Stricke, daß wir ihn binden!«
Der trunkene Bauer wehrte sich aus allen Kräften, aber Vetter Martin hatte durch die Abhärtung auf seinen Reisen eine Muskelstärke, die man ihm nicht zutraute; er hielt den andern wie in eisernen Klammern und rief noch einmal nach Stricken. Nun kamen der Wirt und seine Weibsleute herbeigelaufen; die letzteren nahmen sich des Verwundeten an, der ziemlich gut weggekommen zu sein schien, denn er schimpfte laut gegen den Angreifer, nannte ihn Dieb, Räuber, Mörder, Falschmünzer … und was ihm eben noch an wenig schmeichelhaften Bezeichnungen beifiel. Die Männer aber[305] banden dem Neapolitaner die geballten Fäuste zusammen, trotzdem er mit den Füßen um sich stieß, und seine Gegner anspie, und dann fesselten sie ihn an einen Baum, wo er mit lautem Gebrüll Neugierige lockte, die sich vor der Schenke sammelten.
Es war eine widerwärtige Szene. Das empfand besonders Friederike, die sich zu entfernen wünschte. Der Wirt suchte die Deutschen zurückzuhalten, bis der Bürgermeister gekommen wäre, der das Protokoll aufzunehmen hatte, und um Weiterungen zu vermeiden, blieben sie; aber sie gingen in die Schenke hinein, ohne freilich auch hier dem wüsten Schreien sich entziehen zu können. Endlich kam der Beamte, mit ihm ein päpstlicher Gendarm. Der Mann war höflich und zuvorkommend, aber ziemlich weitläufig in seinen Aufnahmen, und Vetter Martin wie Quandt fürchteten, daß die Geschichte ihnen noch weitere Scherereien machen werde.
Endlich konnten sie sich entfernen und ihren Wagen aufsuchen, und einigermaßen verstimmt bestiegen sie denselben und fuhren gegen Rom. Hart hinter Frascati begegneten sie dem Gendarmen, der den gefesselten Bauer vor sich hertrieb. Derselbe warf ihnen grollende Blicke zu und entfesselte eine Flut von Schimpfwörtern, bis sein Begleiter ihn mit dem Flintenkolben zwischen die Rippen stieß. Der Wagen aber rollte rasch davon.
Die im Abendlicht rötlich schimmernde Campagna mit ihrem unverwüstlichen Zauber regte die Reisenden wieder freundlicher an, und ehe sie noch in die ewige Stadt einfuhren, war es beschlossene Sache, daß Vetter Martin mit Quandts zusammenwohnen müsse – die Bildhauerwitwe würde schon für ein Unterkommen Rat schaffen – und daß man am nächsten Tage, beziehungsweise am Abende dem Doktor der Theologie Peter Frohwalt eine ganz besondere Ueberraschung bereiten wolle.
Derselbe erhielt denn auch für diesen Abend eine[306] dringende Einladung, die er unter keinen Umständen ablehnen dürfe, und so kam er ziemlich neugierig schon am Nachmittage an. Als er in die wohlbekannte trauliche Stube eintrat, blieb er wie erstarrt stehen, der Vetter Martin aber stand mit lachendem Gesichte vom Tische auf und rief:
»Na, was sagst Du dazu, Peter? – Herrgott! Da steht er wie weiland Lots Weib nach der Versalzung – komm zu Dir, Doktor der Theologie und Adjunkt, ich bin's leibhaftig!«
Und nun umarmte er den jungen Priester, der tiefbewegt die Begrüßung erwiderte, und dann saßen sie um den Tisch beisammen, die beiden Deutschböhmen, die Malersleute und der braune Sisto, der hier wie zu Hause war, und der Alte lachte:
»Ja, sieh – ich habe doch ein wunderliches Glück, Peter. Da läuft mir schon vor den Thoren Roms die Liebenswürdigkeit selber entgegen, und wenn Du Dir über die Situation recht klar sein wirst, wirst Du sehen, daß ich auch hier schon wieder der Vetter Martin bin, und mich ganz als solcher fühle, 's ist mir, als hätten wir uns alle schon lange gekannt, und als wäre ich speziell nach Rom gekommen, um gerade diesen Kreis aufzusuchen. Herrgott im Himmel, Du hast doch überall gute Menschen – man muß nur das Glück haben, sie zu finden!«
Der Alte war ganz in seinem prächtigsten Fahrwasser, aber er hatte nicht viel Geduld zum Sitzen, und so machte er selber nach einiger Zeit den Vorschlag, noch einen Spaziergang zu unternehmen. Das Wetter war überaus schön, und Quandt schlug eine Promenade nach dem Monte Picio vor, was Vetter Martin mit besonderer Freude annahm.
Die vier Menschen – Sisto war daheim geblieben – schritten langsam den glänzenden Corso entlang, auf welchem es von Menschen wimmelte, und über welchen zahlreiche vornehme Wagen hinrollten. Ueberall Pracht, Glanz und Lebenslust! Es war, als ströme ganz Rom heute zur Porta[307] del Popolo hinaus nach jenen wunderbar schönen Gartenanlagen, die in ihrer Art beinahe einzig sind.
Ueber begrünte Flächen schweift der Blick und haftet hier an herrlichen, mächtigen Steineichen, dort an malerischen Gruppen von Pinien und Cypressen, zwischen denen weiße Marmorbilder hervorlugen, während Fontänen ihre Silberstrahlen spielen lassen und künstlerisch geschaffene Sitze zum Ruhen einladen. Auf der breiten Fahrstraße rollen unablässig die goldglitzernden Equipagen; geputzte Damen winken heraus und erwidern die ihnen dargebrachten Grüße, und um eine riesige Palme gereiht steht das Musikkorps der päpstlichen Zuaven und läßt glutvolle, feurige Weisen ertönen.
Vetter Martin hatte manches gesehen in der Welt und das »nil mirari« – über nichts sich zu wundern – war ihm zum Grundsatz geworden, aber hier ward er demselben doch beinahe untreu. Er wußte auch kaum, wohin er seine Aufmerksamkeit am meisten wenden sollte, ob hinab nach der Stadt, die im Abendsonnenglanze wie ein Märchenbild sich ausbreitete, ob auf die bunte, wogende Menge, unter welcher zahlreiche Kirchenfürsten sich befanden, die eigentlich das meiste Interesse beanspruchen durften.
Frohwalt kannte sie fast alle, und er machte Vetter Martin auf die bedeutendsten derselben aufmerksam. Da ging der geistvolle Pariser Erzbischof Dupanloup mit dem durch seinen weißen Talar auffallenden Patriarchen von Jerusalem, dort die prächtige, feurig blickende Gestalt des schönen spanischen Bischofs von Urgel mit dem Erzbischof von Mecheln, dann der Generalvikar der Prämonstratenser-Chorherren mit Manning, dem Erzbischof von Westminster, die schlanke, vornehme Erscheinung des Kardinals von Schwarzenberg mit dem österreichischen Gesandten Graf Trautmannsdorf, und viele andere, unter welchen besonders die aus dem fernen Oriente gekommenen Konzilsväter auffielen. Die Römer selbst hatten sich an diese Gäste gewöhnt, Bischöfe[308] und Cardinäle waren ihnen nichts Absonderliches, aber die zahlreichen Fremden aus aller Herren Länder, die auf dem Pincio promenierten, blieben immer aufs neue stehen, um ihnen nachzublicken.
Vetter Martin war ernster geworden. Er hatte, während das Quandtsche Ehepaar voran schritt, seinen Arm in jenen Frohwalts gelegt und sagte:
»Die Herrlichkeit der streitenden Kirche! Sie sehen zumeist recht Ehrfurcht gebietend aus, diese geistlichen Herren, und man sollte meinen, sie müßten viel Geist und echten Christenglauben vorstellen … was hältst Du vom Konzil? Was hält man in der Umgebung des Prager Erzbischofs davon?« fragte er plötzlich ziemlich unvermittelt.
Frohwalts Miene wurde leicht beschattet; er dämpfte die Stimme einigermaßen, als er erwiderte:
»Vetter Martin, ich kann nicht anders, als zu sagen: Ich bin enttäuscht – wir alle sind enttäuscht. Selbst wir, in unmittelbarer Nähe der Verhandlungen und in unmittelbarem Umgang mit einem der hervorragendsten Konzilsmitglieder, erfahren wenig genug von dem, was in dem Konzilssaal vorgeht, und schon dies Geheimnisvolle ist unbehaglich und macht einen beinahe beängstigenden Eindruck. Von jeder Sitzung ist in der »Civilta Cattolica« zu lesen: Die Väter kamen um neun Uhr zusammen; darauf zelebrierte der Bischof X die heilige Messe, der Kardinal Y verlas die vorgeschriebenen Gebete, und darauf sprachen so und so viele Väter über die Vorlage. Um 1 Uhr wurde die Sitzung geschlossen! So steht es mit peinlicher Genauigkeit in dem päpstlichen Leibblatte zu lesen, und mehr erfährt die Christenheit nicht. Was aber sonst noch über Verfügungen der Geschäftsordnung bekannt wird, ist wenig Vertrauen erweckend. Man war bereits so weit, daß man die Väter mundtot machen wollte durch eine Bestimmung, wonach dieselben ihre Bedenken gegen die Vorlagen schriftlich zur Einsicht für die[309] Konzilsmitglieder im Sekretariat niederlegen sollten, in der Aula selbst aber sollte nicht mehr darüber gesprochen, sondern nur abgestimmt werden. Die Unermüdlichkeit des kroatischen Bischofs Stroßmayr, sowie dessen rücksichtslose Energie hat den Plan der Konzilsleitung vereitelt und es wird nun wie vordem mündlich weiter verhandelt. Ach, Vetter Martin – ich wollte, ich wäre nicht hierher gekommen und müßte dies alles in der Nähe ansehen … mir thut manchmal das Herz weh. Gott weiß es, wie ehrlich ich es mit unserer heiligen Kirche meine – hier aber verliert man Glauben und Vertrauen, und mich erfassen mitunter böse Beängstigungen, als wollte man mich gewaltsam hinausdrängen aus dem Heiligtum meines alten Glaubens. Ich bin so froh, daß ich Dich hier habe, und daß ich mich wenigstens darüber aussprechen kann, wie mir's ums Herze ist.«
»Na, na … die Sache wird wohl nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht wird. Die deutschen und sonstigen Bischöfe, welche die Gegnerschaft bilden, werden doch den Mut nicht verlieren und sich nicht etwas aufzwingen lassen, was gegen ihre Ueberzeugung und gegen die althergebrachte Lehre der Kirche ist!«
»Und wenn sie doch sich beugen?« fragte Frohwalt und sah mit besorgtem Blicke dem alten Manne ins Gesicht.
»Dann muß jeder ehrliche Katholik für sich allein den Weg seiner Ueberzeugung gehen, Peter! … Aber das kann und wird nicht sein, daß Leute wie Stroßmayr, Dupanloup, Schwarzenberg ihre Ueberzeugung, für die sie bisher so mannhaft einstehen, wie ein altes Hemd behandeln und wegwerfen, das müßte ja zu einer Umwälzung in der Kirche führen, wie sie noch nicht dagewesen wäre!«
»Du kennst nicht die Gewalt, welche in dem Papsttum liegt, Vetter Martin, und nicht den persönlichen Zauber, welchen die Erscheinung des Stellvertreters Christi auf Erden ausübt. Vor ihm beugen sich – –«
In diesem Augenblicke drehte sich Quandt, der vor ihnen ging, um und wies mit ausgestreckter Rechten nach einem glänzenden, von Gold strotzenden Reiter, der auf dem Fahrwege dahergesprengt kam. Unter die lustwandelnde Menge kam eine wunderliche Bewegung. Alles drängte näher an die Straße heran, die Wagen, die auf derselben fuhren, lenkten an den Rand herüber, so daß die Mitte frei ward, und blieben stehen, und von Mund zu Mund lief das Wort: Il Papa!
»Seine Heiligkeit kommt!« rief auch der Maler, und zog seine Frau nahe heran an die Straße und die beiden andern folgten.
Und nun erschien, nur wenige hundert Schritte hinter dem Vorreiter, der Wagen des Papstes, blitzend von Gold, und langsam rollte er daher. Die Musik war von der großen Palme herübergetreten an die Seite der Straße und spielte Gounods päpstliche Jubiläumshymne, und durch die angestaute Menge scholl der Ruf:
»Evviva il Papa!«
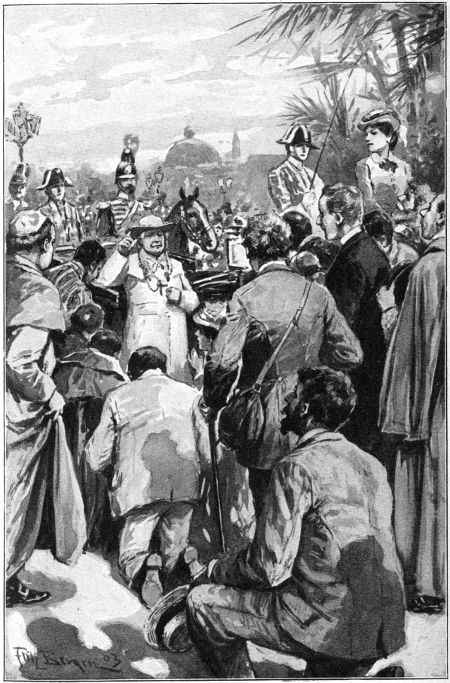
Beinahe unmittelbar vor unsern Freunden hielt der Galawagen, sowie die beiden andern, welche ihm folgten. Der Diener öffnete den Schlag und Pius der Neunte stieg aus. Eine schöne, edle Erscheinung, mit einem freundlichen Greisenantlitz voll Hoheit und Milde, dem man es nicht angesehen hätte, daß hinter dieser Stirne der Gedanke an die Unfehlbarkeit sich breit mache. Er trug auf dem Haupte den großen roten Kardinalshut mit goldenen Schnüren, und ein weißes, faltiges Gewand. Ihm zur Seite schritt der Kardinal Antonelli und andere hervorragende kirchliche Würdenträger, und ihr Zug bewegte sich langsam vorwärts. Von allen Seiten aber drängte es sich dichter heran, und besonders die Damen suchten das Kleid des Oberhirten der Christenheit zu berühren oder dessen besonderen Segen zu erlangen. So wogte es unmittelbar hinter ihm her von Hunderten, ja von Tausenden, die sich an seine Schritte hefteten, während sich[311] immer aufs neue wieder seine Hand erhob und den Segen spendete. Da und dort lag wohl auch einer auf den Knieen wie vor den Heiligen, und dazu brauste immer aufs neue das »Viva il Papa!«
Quandt hatte Friederike wie ein Kind auf den Arm genommen und emporgehoben, und so sah diese noch eine Weile im verglimmenden Abendsonnenschein den roten Kardinalshut, Vetter Martin aber wendete sich zu Frohwalt und sprach, wie im Anschluß an das, was dieser vordem gesagt hatte:
»Ja, Du magst recht haben, Peter … Sie werden sich beugen!«
Die Volkswoge strömte wieder zurück. Der Spaziergang des Papstes, welcher keine Erholung war, war beendet; dichter drängte sich noch einmal die Menge um den glänzenden Wagen, ehe dieser von dannen rollte. Martin aber sah in diesem Augenblicke nicht mehr den Papst, sondern jenseits des Fahrwegs in dem dichtgedrängten Menschenwalle ein Gesicht, das ihn jetzt ungleich mehr zu interessieren schien, und in das »Viva il Papa!« hinein schrie er ziemlich laut: »Hans Stahl!«
Verwundert sah ihn Frohwalt an; der Alte deutete mit dem Finger, eine Sekunde lang war es auch dem jungen Priester, als sehe er das lustige Gesicht des ehemaligen wendischen Seminaristen, aber dann war es auch schon in der Flut verschwunden.
»Das ist ja gar nicht möglich!« sagte Peter, als sie einigermaßen wieder in Bewegung kamen.
»Da wette ich mein ganzes Museum gegen ein Gericht muffiger Makkaroni, wenn das nicht mein geliebter Windhund war. Das weiß der Himmel, wie der hierher kommt. Aus alter theologischer Neigung sucht der das Konzil nicht auf, und daß ihn seines Vaters Leinengeschäft hierher entsendet hat, will mir nicht einleuchten. Hier stehe ich vor einem Rätsel!«
»Na, Vetter Martin, das nenne ich Glück,« sagte jetzt Quandt – »den ersten Tag hier und schon den Papst gesehen!«
»Das hab' ich gar nicht anders gedacht,« erwiderte der Alte – »das Merkwürdigste immer zuerst: Pius der Neunte und Hans Stahl!«
Langsam schritten sie weiter durch die aufs neue bewegte Menge, und als die Schatten des Abends kamen, wanderten sie durch den glänzenden Corso wieder heimwärts. –
Meister Quandt und Friederike ließen es sich nicht nehmen, dem alten Herrn die Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt in eingehender Weise zu zeigen, und wenn es Frohwalt irgend möglich war, so beteiligte er sich gern an diesen Spaziergängen und Vetter Martin fühlte sich in Rom trotz der Konzilsverhandlungen sehr behaglich. Aus der Heimat hatte er mancherlei erzählt, was sich in der Hauptsache mit seinem Briefe deckte, nur betreff der Familie Haller schienen seitdem die Schatten noch düsterer geworden zu sein: Therese litt mit der Geduld und der stummen Ergebung einer Märtyrerin.
Gerade die Erinnerung an sie ließ Vetter Martin immer wieder lebhafter auch an Hans Stahl denken, und so oft er jetzt die ewige Stadt durchschweifte, teilte er seine Aufmerksamkeit zwischen deren Sehenswürdigkeiten und den Menschen, die ihm begegneten. Aber sein Suchen schien vergebens; entweder hatten ihn seine Augen auf dem Monte Pincio doch getäuscht, oder der junge Lausitzer war wieder verschwunden.
Rom feierte in jenen Tagen das Fest der Lämmerweihe. Die Nonnen des Klosters in der Via Torre de' specchi am Capitol haben seit langer Zeit alljährlich die beiden Lämmer in Verwahrung und Pflege, welche bestimmt sind, am Osterfeste vom Papste und einigen besonders geladenen Kardinälen verspeist zu werden, und aus deren Fellen Pallien (Krägen) für die höchsten Kirchenfürsten gewebt werden.
Diese Lämmer werden an einem Frühlingstag in der Kirche der heiligen Agnes vor der Porta Pia nach altem Brauche von einem Kardinal für ihre Bestimmung eingeweiht, und die lebensfrohen Römer verbinden damit ein Volksfest. Der ganze Vorgang erhielt in diesem Jahre eine besondere Bedeutung und seinen außergewöhnlichen Glanz durch die Anwesenheit zahlreicher Prälaten, und der Himmel that zur Verschönerung des Festes sein Möglichstes: Er lachte rein und tiefblau über der alten Basilika St. Agnese und über den tausend Menschen, welche sich in derselben und um dieselbe herum drängten.
Unsere vier Freunde fehlten nicht, und da sie bei Zeiten sich dazu gehalten hatten, hatten sie noch Plätze in der Kirche gefunden und schauten nun, wie viele andere, auf Bänken und Stühlen stehend, dem kirchlichen Schauspiele zu. Auf dem Hauptaltare, unter einer von vier dunklen, mit Blumen bekränzten Säulen getragenen Kuppel stand, schimmernd von Kerzenglanz, das Bild der heiligen Agnes, zur Hälfte ein schönes antikes Statuenbruchstück aus Alabaster, dem Kopf und Hals von Goldbronze angesetzt wurden, und vor demselben liegen auf reichgeschmückten Kissen die beiden Osterlämmer, mit blendend weißem Vließ, geputzt mit roten Seidenbändern, die Füße zusammengebunden, und sehen mit den gutmütig-blöden Augen den vornehmen Priester in der roten Kardinalssoutane an, der, umgeben von zahlreichen Assistenten, nun mit Salböl und Weihwasser den feierlichen Akt an ihnen vollzieht.
Nach der Festlichkeit aber stürmte das Volk mit seiner ganzen südlichen Lebendigkeit und Lustigkeit in die zahlreichen, ringsum liegenden Weinschenken, und beim Becherklang schallte fröhliches Lachen und Singen, während die Nonnen mit ihren Lämmlein wieder nach der Stadt zurückfuhren.
Unsere Freunde waren auseinander geraten. Der Maler, der sein Frauchen fest am Arme gehalten hatte, hatte sich endlich[314] nach vergeblichem Suchen mit ihr nach einem der Weingärten gerettet, Martin aber und Frohwalt hatten eine andere aufgesucht, denn den Alten plagte der Durst. Es war alles schon besetzt, als sie in den freundlichen Garten traten, und schon wollten sie ihren Stab weiter setzen, als der Alte mit einmal seinen Begleiter bei der Hand faßte und mit der Rechten nach einem entlegenen Tischchen deutete.
Und dort saß Hans Stahl, wie er leibte und lebte. Vetter Martin brach sich beinahe stürmisch Bahn, als könnte ihm sein junger Freund zum zweiten Male entwischen, und schon von weitem rief er ihn beim Namen.
Der Extheologe schrak auf, und da er den Rufenden erkannte, huschte eine heiße Röte ihm über das Gesicht, und er sprang empor:
»Vetter Martin!«
»Ja wohl – adsum! Da sind wir, der Doktor Frohwalt auch – – ich bin schon seit einigen Tagen hinter Ihnen her wie ein Polizeispion … wie zum Henker kommen Sie denn in die Stadt des Konzils?«
Das alles sagte der Alte während des Begrüßens und Händedrückens, und er plauderte weiter:
»Aber erst ein paar Sitze und dann etwas Ordentliches zu trinken – das Weitere wird sich finden, lieber Neffe! Sie da – Signora, Signorina, Signoretta, Madonna … hol's der Kuckuck – da läuft sie hin – Hans, Sie haben mehr Verständnis mit den Weibsleuten umzugehen, sehen Sie mal zu, ob Sie mit Ihrer Liebenswürdigkeit von der schwarzbezopften Hebe etwas erwischen, worauf zwei Menschen sitzen können, und einen vernünftigen Tropfen – sonst verdurste ich Ihnen unter den Augen, eh' Sie noch Ihre zweifellos interessante Romfahrt erzählen können!«
Und Hans Stahl schien wirklich hier Verbindungen zu haben, er schaffte, was gebraucht wurde, und bald saß man eng aber nicht ungemütlich am Tische neben lustig schwatzenden[315] Römern und glutäugigen Römerinnen, und der Jüngling berichtete, wie es schien, freilich nicht mit besonderem Behagen.
»Ach lieber Vetter Martin, verehrter Herr Doktor – ich, und im Comptoir sitzen! Das war eine grauenhafte Zeit, an die ich mein Lebtag denken will. Und ich habe – Gott weiß es – dabei den allerbesten Willen gehabt, aber ich bin vor lauter Zahlen und trockener Geschäftskorrespondenz beinahe dumm geworden und war mehr als einmal daran, davonzulaufen. Da hab' ich erst so recht gespürt, daß wir zusammen gehören, ich und die Kunst, aber wie ich auch meinen Vater anflehte, mich wieder malen zu lassen, er wollte nichts mehr wissen. Ich hab' dann geschwiegen, aber ich wär' verblutet daran. Da schickt mich mein Vater nach Dresden, um einen Ausstand von etwas über zweitausend Mark einzukassieren. O wie gerne ich nach Elbflorenz ging! Ich machte mein Geschäft ab und dann war mein erster Weg in die Galerie. Und wie ich hier stand unter all den Herrlichkeiten und wie die Seele bald weit wurde, bald wieder sich zusammenzog, da traf ich einen Freund aus der Prager Malerschule. Der ging nach Rom, wohin er an einen Meister empfohlen war, und da war's um mich geschehen. Ich weiß, daß ich Unrecht that, aber ich ging mit, das Geld meines Vaters in der Tasche …«
»Nanu!« brummte der Alte und Frohwalt rief: »Aber Herr Stahl!«
»Verurteilen Sie mich nicht! Ich habe meinem Vater alles geschrieben; ich habe ihm erklärt, ich könnte nicht wieder nach Hause kommen, er solle mir das Geld lassen, ich verlange keinen Pfennig jemals mehr von ihm, und wenn ich drüber verhungern müßte, aber ins Geschäft käme ich lebendig nicht wieder zurück.«
»Na, und was schrieb der Alte?« fragte Martin einigermaßen erregt.
Hans Stahl seufzte:
»Ich sollte thun, was ich nicht lassen könnte – aber zwischen uns wär' es aus. Verfolgen würde er mich nicht wegen Unterschlagung, das wäre er sich und seinem Namen schuldig, aber in sein Haus sollt' ich auch nicht mehr kommen. O Vetter Martin – das war hart, und ich kann's auch nicht recht verwinden …«
»Haben Sie denn auch bedacht, was Sie gethan haben?« fragte Frohwalt ernst und strafend.
»Sachte, sachte, mein lieber Peter!« beschwichtigte Martin – »hier hilft kein Vorwurf und keine Schelte. Schön und recht war's nicht, Hans, was Sie gemacht haben, aber der Topf ist einmal zerbrochen, und Sie müssen zusehen, wie er wieder zu flicken ist. Von Ihren zweitausend Mark können Sie auch nicht ewig leben, Freund Leichtfuß … und haben Sie denn überlegt, was dann geschehen soll, wenn die Moneten bis auf den letzten Obolus verpulvert sind?«
Stahl machte ein trübseliges Gesicht und ließ den Kopf hängen.
»'s ist wohl schon bald auf der Neige, he? – Ja, sagen Sie mir um's Himmels willen, was treiben Sie denn eigentlich hier, und wie denken Sie sich denn die spätere Sachlage? Sie glauben doch nicht, daß Sie sich hier in vier Wochen zu einem Raphael auswachsen werden, he?« –
»Ich arbeite im Atelier meines Freundes und habe schon einige leichtere Sachen kopiert, auch zwei davon – freilich billig genug – verkauft!«
Vetter Martin zog die Augenbrauen in die Höhe, was ebenso Verwunderung als Unmut ausdrücken konnte.
»I potztausend, Hans Stahl … jetzt wird mir's unheimlich; entweder sind Sie ein Genie oder ein trostloser Sudler, aber in jedem Falle gefällt mir Ihre Beschäftigung nicht recht. Haben Sie denn eine regelrechte Unterweisung in der Kunst bei einem vernünftigen Meister?«
»Eigentlich nicht,« stotterte Hans.
»So – dann können Sie ja über kurz oder lang, wenn's mit dem Kopieren nicht geht, die Wände tünchen, das heißt sich ja wohl auch Malerei … na, danken Sie unserm Herrgott, daß ich Sie entdeckt habe, Sie Unglückswurm. Wenn ich Sie nicht für einen grundguten Kerl hielte, und Ihnen nach meinem unmaßgeblichen Urteil ein bischen Talent zutraute, ließe ich Sie in der Patsche sitzen, und um Ihren Vater haben Sie's ja eigentlich auch nicht verdient, daß ich, ohne Ihnen eine rechtschaffene Maulschelle appliziert zu haben, wieder Vorspann leisten will … aber ich will's als eine Fügung des Himmels ansehen, daß ich Sie just hier gefunden und noch dazu an dem Feste, wo man auch mit den Lämmern und Schafen besonders liebenswürdig umgeht. Also fürs Erste soll mir ein guter Freund und Fachmann sagen, was von Ihrem Talente und Ihren bisherigen Pinselübungen zu halten ist, und wenn die Sache so ist, wie ich hoffe, dann will ich Ihren Vater in Angriff nehmen, nicht etwa daß er Ihnen zur Belohnung Ihres Wohlverhaltens einen Jahresgehalt von zweitausend Thalern aussetzt, sondern daß er die Dummheit vergißt, die Sie gemacht haben, und daß er sich daran gewöhnt, einen Künstler in der Familie zu haben. Punktum, und darauf trinken wir.«
Hans Stahl drückte in überströmender Dankbarkeit dem Alten die Hand, und auch Peter Frohwalt fand, daß der Vetter auch diese Geschichte beim rechten Ende anzufassen wisse. Er stieß fröhlich mit den beiden anderen an.
Noch an demselben Tage aber führte Vetter Martin seinen jungen Freund in der Familie Heinrich Quandts ein.



Gaetano Vergani, der neapolitanische Bauer, der in Frascati festgenommen worden war, drehte und wendete sich wie ein Aal, um der Justiz ein Schnippchen zu schlagen. Zwar der Gebrauch des Messers und die Verwundung seines Genossen, der übrigens nicht gefährlich verletzt war, war nicht wegzuleugnen, und Quandt sowohl, wie der Vetter Martin hatten in die Geschichte, die ihnen unangenehmen Verkehr mit der römischen Behörde brachte, ihre Ausschlag gehenden Zeugnisse abgelegt, aber betreffs des im Weitern festgestellten Thatbestandes, daß der Gefangene schon seit längerer Zeit mit neapolitanischen Dukaten um sich werfe, über deren Erwerb er zunächst jede Auskunft verweigerte, schien dieser die Sache ziemlich leicht zu nehmen.
Er verlangte, als man ihn auch in dieser Hinsicht mit Strafe bedrohte, daß man ihm eine Unterredung mit dem Prälaten Parelli verschaffe, der wohl im Stande sein würde, ihn von jeder diesbezüglichen Anklage zu entlasten, denn aus dessen Hause stamme das Geld und gestohlen habe er es nicht.
Da er mit Hartnäckigkeit auf dieser Forderung bestand, und unverschämt genug war, zu behaupten, der Bischof von Mikrun würde seine etwaige Bestrafung in dieser Sache an dem betreffenden Richter zu ahnden wissen, und da andererseits[319] Parelli eine hochangesehene Persönlichkeit war, so wurde diesem von dem Ansinnen des Burschen Mitteilung gemacht, beziehentlich angefragt, ob man ihm denselben zuführen dürfe.
Der Prälat fühlte bei diesem Ansinnen – er wußte selbst nicht recht weshalb – ein gewisses Unbehagen, aber der Name des Menschen, auch die Erwähnung der neapolitanischen Dukaten veranlaßten ihn, sich bereit zu erklären, ihn zu sehen. So wurde eines Morgens Gaetano Vergani gefesselt in das Haus Parellis gebracht, begleitet von einem päpstlichen Gendarmen.
Als er das Zimmer durchschritt, welches nach dem Arbeitsgemache des Prälaten führte, begegnete ihm Signora Lucia, welche von diesen Vorgängen nichts wußte, da Parelli in seiner Zuneigung zu ihr jede Unannehmlichkeit ihr ersparen wollte. Beim Anblicke des Burschen, der mit gebundenen Händen eintrat, wich ihr alles Blut aus den Wangen, und sie heftete die geisterhaften großen Augen nach ihm hin. Gaetano sah sie mit einem frechen Blicke und mit einem höhnischen Lächeln an und sagte halblaut:
»Ich empfehle mich Ihrem Wohlwollen und Ihrer Fürsprache, Signora.«
Der Gendarm versetzte ihm einen Stoß, und während das Weib in dem dunklen Seidengewande wie gebrochen durch die eine Thür verschwand, führte der Mann des Gesetzes seinen Begleiter durch die andere vor den Prälaten.
Auch Parelli war bleich, als er den Menschen mit seinem rohen Gesicht sah, an den er sich in diesem Augenblicke von Tivoli her deutlich erinnerte; seine frechen Reden von damals kamen ihm ins Gedächtnis, obgleich derselbe anscheinend tief demütig vor ihm stand; er gebot dem Gendarmen, ihn mit dem andern allein zu lassen, da es sich vielleicht um eine Beichte handle.
Sobald sich der Bursche mit dem Prälaten allein sah, veränderte sich seine ganze Haltung. Er richtete sich auf, warf[320] den Kopf beinahe trotzig in den Nacken und schaute Parelli mit frechem Hohne an, so daß es diesem immer unheimlicher wurde. Endlich, nach einer kurzen, peinlichen Pause zwang er sich zu der Frage:
»Du hast mit mir zu sprechen verlangt; was willst Du?«
Der Bauer räusperte sich sehr vernehmlich und sagte:
»Eh, Monsignore – da haben sie mich wegen einer kleinen Dummheit festgenommen, weil ich einen, der falsche Würfel hatte, mit meinem Messer zu sehr gekitzelt habe, und dann machen sie mir den Vorwurf, ich hätte Geld gestohlen, neapolitanische Dukaten, und das ist nicht wahr. Das Geld habe ich erhalten von Signora Lucia – es waren wohlgezählte vierhundert Stück – ich habe aber gemeint, ich wollte sie nicht nennen, es könnte ihr oder auch Euch selbst unangenehm sein – he?«
Der Prälat saß zurückgelehnt in seinem Polstersitze und that einen tiefen Atemzug.
»Von Signora Lucia hast Du das Geld erhalten? Warum? Zu welchem Zwecke?«
»Eh, Monsignore … das ist eine heikle Geschichte, und wenn ich sie Euch mitteile, hoffe ich, daß Ihr vor Gericht dafür die vierhundert Neapolitaner auf Euch nehmt, mir auch sonst ein günstiges Urteil verschafft und noch einmal vierhundert Dukaten drauflegen werdet …«
»Unverschämter!« brauste Parelli auf; der Mann mit den gebundenen Händen aber trat ihm einen Schritt näher und grinste höhnisch:
»Sprecht nicht so laut, gnädiger Herr – der Gendarm draußen könnte an der Thüre horchen und der braucht nichts zu hören von dem, was wir hier verhandeln!«
Der Prälat sank, starr über diese Frechheit des Burschen, der seine rauhe Stimme zum Flüstern dämpfte, in seinen Sitz zurück, der andere aber fuhr fort:
»Ich hätt's mit dem Weibe allein abmachen können,[321] wie das erste Mal, aber Ihr habt ja an der Sache auch ein Interesse, und müßt wünschen, daß ich sie nicht an die große Glocke bringe …«
»Welche Sache?« stammelte Parelli erbleichend.
»Eh, Monsignore … Ihr sagt doch aller Welt, daß Signora Lucia eine sehr nahe Verwandte von Euch sei – ich könnte überall etwas anderes beweisen …«
»Und was denn?« fragte der Prälat mit bebenden Lippen.
Der Bauer fühlte, daß er den bleichen Mann vor sich in seiner Gewalt habe; er weidete sich einige Sekunden an der Angst desselben, dann trat er ganz nahe an den Polstersessel heran, beugte sich über Parelli und sagte, indem er ihm fest und wie mit dem bannenden Blick einer bösen Schlange ins Gesicht sah:
»Daß sie mein Weib ist! – Wie gefällt Euch das, Monsignore? He?«
Der Prälat war aufgesprungen und einige Schritte zurückgetreten; er rief halblaut:
»Du lügst, Bursche … das ist ein Erpressungsversuch.«
»Das Zweite mag sein – das Erste nicht! In Foligno habt Ihr sie kennen gelernt. Da waren wir schon zehn Jahre verheiratet und hatten einander überdrüssig, weil wir kaum zu leben hatten. Darum gingen wir auseinander, ich als Knecht in die Chiana di Sorrento, sie nach Foligno als Blumenhändlerin. Und sie war hübsch, ich kann's Euch nicht verdenken, daß sie Euch gefiel. Ihr brauchtet jemanden für Euer einsames Haus, und nahmt sie zu Euch, und habt sie in Sammt und Seide gesteckt, und sie erzählte Euch, sie sei eine Waise und stehe allein da in der Welt. Aber ich habe sie zu finden gewußt und sie hat mein Schweigen erkauft mit einem kleinen jährlichen Sümmchen. Dafür hab' ich mir ein bescheidenes Weingut erworben bei Sorrento und hause dort mit einem alten Weibe, das nichts von meiner Vergangenheit[322] und von Lucia weiß. Und dorthin kam sie, als sie im Begriffe war, Euch einen Sohn zu schenken und lebte wieder unter meinem Dache, und auch Euer Kind ist bei mir. Ihr vermeint, jener Gaetano Vergani sei der Bruder Lucias, nein, Monsignore, er ist der rechtmäßige Gatte, und Ihr habt zu allem andern noch einen Ehebruch auf dem Gewissen … wie gefällt Euch das? He?«
Parelli hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen und stöhnte; er rang nach Atem, nach Fassung. Was er hier hörte, traf ihn wie Keulenschläge, und das Bewußtsein einer furchtbaren Schuld lastete erdrückend auf seiner Seele. Er sank wieder auf seinen Sitz zurück, wie ein gebrochener, elender Mann, der rohe Bursche aber fragte frech:
»Eh, Monsignore – wie steht es mit den Dukaten? Und meint Ihr nicht, daß ich wegen der Messerstecherei frei kommen könnte? Etwas wenigstens, hoffe ich, werdet Ihr mir herunterhandeln … Denn wenn Ihr's nicht thut, dann muß ich der Welt doch erzählen, in welcher Verwandtschaft wir beide stehen, und das, denke ich, ist Euch nicht lieb!«
Der Prälat ließ die Hände sinken; sein Antlitz war noch blaß, aber es stand ein fester Entschluß auf demselben geschrieben. Er sprach leise, aber bestimmt:
»Ich habe schweres Unrecht auf der Seele – aber Du und Dein Weib, Ihr seid Schurken! Mir ekelt's vor Euch! Glaube nicht, Elender, daß Du mich mit Deinen Drohungen schrecken kannst; ich bin bereit, wenn es sein muß, für meine Schuld zu büßen, und am Stuhle des heiligen Petrus giebt es Verzeihung auch für den schwersten Sünder. Darum hoffe nicht, mir gegenüber ein Erpressungssystem ins Leben zu rufen, Du könntest Dich furchtbar täuschen. Die vierhundert Dukaten nehme ich auf mich, die Strafe für den Messerstich, welchen Du Deinem Genossen beigebracht, wirst Du unweigerlich tragen, und wenn Du sie überstanden hast, dann zahle ich Dir und Deinem Weibe je 500 Scudi ein für[323] alle Mal. Unterfangt Ihr Euch, mich jemals wieder zu belästigen, so werde ich selbst Euer Ankläger – komme, was da wolle. So, jetzt sind wir fertig!«
Der Bauer stand ziemlich verblüfft da, Parelli aber rief den Gendarmen und gebot ihm, den Gefangenen wieder fortzuführen; er würde selbst dem Gerichte die weiteren Mitteilungen zugehen lassen.
Als der Bursche hinaus war, brach der Prälat aufs neue zusammen unter seiner Schuld, und mit gerungenen Händen fiel er vor dem Kreuzbilde nieder, das auf einem reichgeschnitzten Betpulte stand. Hier lag er noch, als sich die Thüre leise öffnete und Lucia hereintrat. Sie war todbleich, ihr Gang war schleppend, und da sie Parelli im Gebete sah, hielt sie fast erschrocken den Schritt an. Da wendete er sich um. In sein Antlitz schoß eine dunkle Röte; er sprang empor, seine Hände ballten sich, die Adern auf der breiten Stirne schwollen ihm an, und das Weib in dem schleppenden, dunklen Seidengewande stürzte vor ihm nieder und beugte die Stirne bis zur Erde, als ob sie ihm die Füße küssen wollte.
Der Prälat rang nach Selbstbeherrschung und er bezwang gewaltsam seine Stimme, so daß sie halblaut, aber tief grollend klang:
»Hinweg von mir, Elende!«
»Verzeihung – o Verzeihung!« stöhnte das Weib, noch immer mit dem Antlitz auf dem Teppich liegend.

»Ja wohl, Verzeihung – der Himmel mag uns verzeihen, Dir und mir … aber aus muß es sein zwischen uns für alle Zeit. Geh in die Einsamkeit und büße, wenn Du kannst, geh mit Deinem Manne, wenn er Dich noch mag, mich aber befreie von Deiner Gegenwart, denn von Dir geht ein Hauch der Sünde aus. Du wirst morgen noch mein Haus verlassen! Behalte alles, was Du je von mir empfangen, aber laß Dich nie wieder sehen vor mir – Du hast mich belogen, betrogen, bestohlen! Hier nimm diese kleine Summe[324] noch« – er war zum Schreibtische geeilt, schloß ihn mit fieberhafter Hast auf und reichte ihr eine Rolle mit Goldstücken – »es ist das Letzte! Für unsern Sohn werde ich weiter sorgen.«
Das Weib wand sich auf den Knieen, aber es streckte die Hand nicht aus nach dem Gelde.
»Stoß mich nicht fort zu dem Elenden, der sich meinen Gatten nennt!« wimmerte sie.
Parelli warf die Rolle mit Goldstücken vor sie hin, daß sie sich öffnete und die Münzen herausrollten, dann wandte er sich schweigend und verachtungsvoll ab und verließ das Gemach.
Einige Augenblicke sah ihm Lucia nach, regungslos wie ein Steinbild, dann blitzte es in den dunklen Augen auf wie im Zorn, mit hastigen Händen raffte sie die zerstreuten Goldstücke zusammen, erhob sich und eilte hinaus. In den beiden prächtigen Gemächern, welche sie bewohnte, raffte sie zusammen, was sie an Schmuck und Wertgegenständen besaß und legte es in einen Handkoffer, dann ließ sie durch einen Diener einen Reisekorb herbeischaffen, welchen sie mit Wäsche und Kleidern bis an den Rand füllte.
Am andern Morgen ließ sie einen Wagen kommen, der sie nach dem Bahnhofe bringen sollte. Als sie, ohne Parelli noch einmal gesehen zu haben, langsam und gleich einer Fürstin, wie sie es in früheren Tagen gewöhnt war, die Treppen hinabstieg, ließ sie ihre Blicke noch einmal über all die Herrlichkeit schweifen, welche sie verließ, aber sie hatte ihr Auge und ihre Miene völlig in der Gewalt. Der Diener, welcher ihren Handkoffer trug, hatte, trotzdem er wiederholt einen beobachtenden Blick nach ihr gewendet, keine Ahnung von dem, was in der Brust des geputzten Weibes vorging.
Da kam eben der Jesuitenpater Felice. Er sah sie erstaunt an und fragte:
»Sie verreisen, Signora?«
»Ja wohl, Hochwürden.«
»Auf lange Zeit?«
»Auf Nimmerwiederkehr!« flüsterte sie zischend, und in diesem einen Worte brach ihre mühsam verhaltene Erregung durch.
»Aber was bedeutet das, Signora?« frug der Jesuit beinahe bestürzt.
»Fragen Sie Monsignore!« stieß sie noch hervor, dann rauschte sie an ihm vorüber und gleich darauf hörte er das Rollen des Wagens. Mit dem immer gleichen, kalten Gesicht stieg der Pater die Treppe empor und ließ durch Giovanni sich bei dem Prälaten melden.
Dieser sah ihm ziemlich finster entgegen und bot ihm einen Sitz, dann fragte er mit kühler Höflichkeit nach seinem Begehren.
Felice kam in Angelegenheiten des Konzils. Der Jesuitenorden hatte für die widerspenstigen Bischöfe, welche sich der neuen Geschäftsordnung, namentlich der Forderung, daß mit einfacher Mehrheit entschieden werden solle, nicht gutwillig fügen mochten, eine Falle zurecht gelegt und bearbeitete seine Anhänger in dem Sinne, wie diese Falle Verwendung finden sollte. Parelli glaubte man bei seiner Gutmütigkeit sicher zu haben, ihn konnte man wohl auch etwas tiefer in die Karten sehen lassen.
Aber Felice hatte keinen glücklichen Tag getroffen, das Gewissen des Prälaten hatte einmal angefangen, sich zu regen, er fühlte den starken Trieb, recht zu thun und damit seine Schuld wegen Lucia einigermaßen zu erleichtern, und so hörte er mit Unmut dem Jesuiten zu, der ihm auseinandersetzte, wie man zu den Dekreten betreff der Unfehlbarkeit eine Art Einleitung den Konzilsvätern vorlegen wolle, in welcher es auf eine besonders scharfe Verurteilung des Protestantismus abgesehen sei. Man erwarte nach der ganzen Fassung einen Widerspruch der nichtitalienischen Bischöfe, ja man wünsche sogar einen solchen und würde es auch nicht ungern[326] sehen, wenn selbst eine Anzahl für den Glaubenssatz gewonnener Kirchenfürsten sich in diesem Falle jenen anschlössen. Dadurch würde einerseits der Vorwurf hinfällig, daß die italienischen Bischöfe einfach alles annehmen, was ihnen vorgelegt würde und fürs zweite hätte man die widerstrebenden Bischöfe dazu gebracht, etwas mit einfacher Mehrheit zu entscheiden, und der von ihnen angefochtene Grundsatz der Geschäftsordnung hätte damit durch sie selbst Genehmigung erhalten.
»Mag die Beleidigung des Protestantismus auch hintertrieben werden, wenn sie nur die verhaßte neue Geschäftsordnung auf diese Weise annehmen!« schloß Felice, und um die schmalen Lippen ging ein leichtes Zucken, wie ein Lächeln.
Die Brauen Parellis hatten sich zusammengezogen. Jetzt sah er den Jesuiten durchdringend an und sprach mit unverkennbarem, bitterem Hohne:
»Der Zweck heiligt die Mittel! … Ich will ehrlich zu Ihnen sprechen, Hochwürden, denn ich bin in einer Stimmung, in der ich nicht anders kann, und wenn ich für meine Meinung und Ueberzeugung der schwersten Strafe verfiele. Ja, ich werde gegen einen solchen Angriff gegen den Protestantismus stimmen, aber nicht um das Spiel, das mit dieser Abstimmung getrieben werden soll, zu unterstützen, sondern aus innerster Ueberzeugung, denn ich kenne Protestanten, die himmelhoch stehen über Katholiken und katholischen Priestern, und von denen wir allzusammen lernen können, was in jeder Religion das wahrhaft Religiöse ist … im übrigen aber lassen Sie mich meine Wege von heute ab gehen auch in der Frage der Unfehlbarkeit. Die Mittel, welche angewendet werden, um sie durchzusetzen, die heimlichen Wege, welche man geht, um eine ehrliche, gesinnungstüchtige Gegnerschaft zu bekämpfen, sind unwürdig und ich schäme mich, wenn ich mit dafür haftbar gemacht werden solle. Ich werde, wenn es zur Abstimmung kommt, nicht nach der Vorschrift[327] des Jesuitenordens, sondern nach meiner Ueberzeugung stimmen – komme was da wolle!«
Felice sah den Prälaten groß und mit starren Augen an, als stehe er vor einem Rätsel, das selbst ihm, dem vielgewandten und kalten Manne unverständlich war; endlich sagte er:
»Bischöfliche Gnaden, ich höre mit Bedauern solche Worte, die aus einer augenblicklichen Erregung kommen, welche ich nicht ernst nehmen möchte. Ich merke daraus nur das Eine, daß Ihr guter Engel von Ihnen gegangen ist.«
Parelli sah ihn mit gehobenem Haupte und fest an:
»Meinen Sie damit das Weib, welches ich aus meinem Hause gejagt habe? – Haben Sie wirklich den Mut, als ihr Beichtvater, der doch von allem gewußt haben muß, diese Elende so zu nennen? Ihnen brauche ich meine Sünde und Schande nicht erst zu erzählen, Sie haben darum gewußt, Sie müssen darum gewußt haben, und doch haben Sie uns beide hinleben lassen in Schuld und Verbrechen ohne ein mahnendes und strafendes Wort? – Durch das Weib haben Sie den Einfluß auf mich sich gesichert … wie nennen Sie ein solches Verhalten? – O, mich widert das alles an – ach, wenn Sie wüßten, wie sehr es mich anwidert. In unserer heiligen Kirche ist vieles schlecht geworden und gerade durch die Schuld derjenigen, die über ihre Reinheit und sittliche Würde am meisten zu wachen berufen waren. – Ich kann nicht anders büßen für meinen Anteil, als indem ich redlich streben will, das Verderbte an mir und anderen zu bessern, und daß ich allezeit den geraden Weg gehe, auf welchem die beiden Sterne der Gottesliebe und der wahren Nächstenliebe leuchten. Dazu aber kann ich Ihrer Leitung entbehren, und da Sie mir immer nur aufs neue die Erinnerung an meine Sünde und an die Zeit meiner Schmach in mir wachrufen müßten, so ist es wohl besser, wenn wir uns so wenig als möglich begegnen; es kann ja auch Ihnen nur angenehm sein!«
Das blasse Gesicht des Jesuiten war noch um einen Schein fahler geworden, aber er beherrschte sich auch jetzt.
»Ich habe gehört und nicht gehört, Monsignore. Sie sind in Aufregung und ich bin nicht so lieblos, Sie darum für alles, was Sie eben gesagt haben, verantwortlich zu machen. Sie sollen über meine Zudringlichkeit nicht zu klagen haben, aber vergessen Sie auch nicht die Pflichten, die der heilige Stuhl berechtigt ist, von Ihnen erfüllt zu sehen. Es ist nicht gut, gegen den Stachel zu lecken, Herr Bischof von Mikrun!«
Er verneigte sich mit spöttischer Höflichkeit tief vor dem Prälaten und ging; Parelli aber atmete jetzt tief auf, dann trat er an das Fenster, öffnete es, als ob er eine andere, reinere Luft einlassen müsse, und nun ging er mit großen Schritten in dem Gemache auf und ab. Er hatte ein Gefühl des Wohlbehagens, wie er es seit langer Zeit nicht empfunden, das Gefühl der Befreiung von einem moralischen Drucke, der in gar mancher Stunde schwer auf ihm gelegen, am schwersten aber wohl damals, als der braune Junge aus der Campagna vor ihm auf den Knieen gelegen und mit gefalteten Händen ihn angefleht hatte, das Weib zu entlassen, das Felice die Frechheit besaß, seinen guten Engel zu nennen.
So hatte der junge deutsche Priester damals Sisto genannt, und er hatte mehr Recht. Die beiden Gestalten, der dunkellockige Knabe und Peter Frohwalt traten vor seine Seele, die nach der Berührung mit dem Reinen und Guten sich sehnte, und einem raschen Antriebe folgend, beschloß er, vor beiden sich zu rechtfertigen.
Er ließ seinen Wagen vorfahren und begab sich, da an diesem Tage keine Konzilssitzung stattfand, nach der Wohnung des jungen Priesters, welchen er auch daheim antraf, und der ihn erstaunt, aber mit gebührender Höflichkeit begrüßte.
»Wissen Sie, warum ich komme?« fragte der Prälat. »Ich habe das Bedürfnis, mein Gewissen zu entlasten, und bitte, Ihnen beichten zu dürfen.«
Frohwalt geriet beinahe in Verlegenheit.
»Verzeihung, bischöfliche Gnaden, aber ich besitze für Rom keine Berechtigung zur Ausspendung des Beichtsakramentes.«
»Ach so … das ist wieder die gewohnte Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit der deutschen Theologen. Sie haben freilich durch die Priesterweihe auch das Recht, zu binden und zu lösen erhalten, und jeder bedrängte Mensch, den sein Vertrauen zu Ihnen zieht, sollte kraft dessen auch von Ihnen von seinen Sünden freigesprochen werden können, aber ich weiß, daß sich formale Bestimmungen auch hier dazwischen drängen. Nun gut … haben Sie auch in Rom nicht das Recht, mich von Sünden zu lösen, so darf ich doch mein Bekenntnis vor Ihnen ablegen. Sie haben einst mit ruhigem und doch so eindringlichem Worte an meinem Gewissen gerüttelt, daß es mich drängt, jetzt, da ich die Kraft der inneren Erneuerung gefunden habe, zuerst zu Ihnen zu kommen.«
Und nun erzählte er ruhig und klar die Vorgänge des gestrigen Tages und was damit zusammenhing; er schloß:
»Endlich bitte ich Sie um Eines: Ich habe den Drang, daß auch der Knabe, der einstens um mein Seelenheil vor mir auf den Knieen gelegen, erfahre, daß sein Gebet durch die Gnade des Himmels erhört sei, und habe die Sehnsucht; ihn wieder in meiner Nähe zu wissen. Thun Sie mir die Liebe, Sisto aufzusuchen, und bringen Sie ihn mir wieder … ich habe erst in diesen Tagen empfunden, was mir der Knabe war.«
Frohwalt war von dem Gehörten tief ergriffen.
»Und habe ich auch keine formale Berechtigung, Ihnen Sünden zu vergeben, der Himmel und Ihr eigenes Herz werden Sie von Ihrer Schuld lossprechen – ich aber, das glauben Sie, bin unendlich glücklich, daß es so gekommen ist. Ich suche heute noch Sisto auf, und wenn es irgend möglich ist, führe ich Ihnen den Knaben zu. Quandts kehren ja doch[330] bald nach der Heimat zurück und ich glaube nicht, daß sie die Absicht haben, Sisto mit sich zu nehmen.«
»Ich danke Ihnen im voraus für alle Liebe, die Sie mir thun, und ich will bemüht sein, mich ihrer wert zu machen.«
Parelli hatte sich wieder entfernt und Frohwalt war es zu Mute, als beschere ihm der Himmel die erste glückliche Stunde in Rom. Er wollte auch nicht zaudern mit der ihm gewordenen Mission, aber eben, da er sich auf den Weg zu machen gedachte, trat der Vetter Martin bei ihm ein.
»Lieber Peter – das ist hübsch, daß ich Dich erwische – denn ich komme, um Dir meinen Abschiedsbesuch zu machen. Du weißt, daß ich der Mann der plötzlichen Entschlüsse bin. In Rom ist mir der Boden etwas heiß geworden unter den Füßen und Eure Konzilsverhandlungen sind das Langweiligste, was für die katholische Christenheit erdacht werden konnte – ich fürchte freilich, daß sie mit einem unangenehmen Knalleffekt abschließen. Also kurz und gut: Ich breche morgen früh auf gegen Neapel. Vedi Napoli poi more! Auf meiner Rückreise komme ich noch einmal nach der ewigen Stadt, und ich vermute, daß ich Dich noch finden werde. Meine Geschäfte hier sind in der Hauptsache erledigt. Mein Lausitzer Windhund, von dem sein Alter durchaus nichts mehr wissen will, ist bei Quandt untergebracht, und arbeitet in dessen Atelier auf Tod und Leben. Quandt hat ihm ein schönes Talent zugesprochen und wird ihn, wenn er mit seiner Frau Rom verläßt, an einen andern Maler empfehlen. Ich denke, wir schleppen den armen Teufel durch. Auch Quandts sind die prächtigsten Menschen auf Gottes Erdboden … Nun Gott befohlen, mein lieber Peter – ich habe noch Einiges rasch zu besorgen – und halte mir die Ohren steif wegen der Unfehlbarkeit!«
Noch ein kräftiger Kuß, dann ging der Alte und bald nach ihm verließ Frohwalt das Haus.
Der Himmel war trübe geworden und es begann zu[331] regnen, als er durch die Straßen schritt. Diesem Umstande vielleicht hatte er es zu danken, daß er Quandts daheim antraf.
Der Maler und Friederike empfingen ihn mit gewohnter Herzlichkeit und der Erstere rief:
»Hat unser alter Wandervogel schon Abschied genommen? Das kam ja mit einer merkwürdigen Plötzlichkeit über ihn, und ist für uns beinahe vorbedeutungsvoll geworden, denn sehen Sie, wir stehen gleichfalls auf dem Sprunge. Meine Schwiegereltern schreiben uns einen Brief, der Frühling rühre sich heuer schon im Sachsenlande, und die Schwalben kämen aus dem Süden, ob wir denn nicht das gute Beispiel nachahmen wollten. Das ist meinem Schatz so ins Herz gefahren, daß sie mit einmal alle Lust an Rom verloren hat, und ich bin ein so überaus folgsamer Gatte – was will ich thun? – Nächste Woche packen wir ein!«
»Das bedaure ich herzlich um meinetwillen,« sagte Frohwalt, »denn Sie wissen nicht, wie viel ich mit Ihnen verliere. Ich habe meine schönsten Stunden in Rom bei Ihnen verlebt, das vergesse ich Ihnen nicht …«
»Der Himmel hat uns hoffentlich nicht das letzte Mal zusammengeführt,« sprach Friederike herzlich und Quandt fiel ein:
»Und wir wollen uns nicht heute schon das Herz schwer machen! Wir sehen uns noch hier, und Dresden liegt doch auch nicht auf dem Monde oder irgend einem unerreichbaren Planeten. Aber jetzt wollen wir uns gemütlich zusammensetzen …«
Als sie saßen, berichtete Frohwalt, weshalb er eigentlich kam. Parelli, der nun ganz allein stehe, denn die Signora habe sein Haus verlassen, sehne sich nach Sisto und wünsche, ihn wieder bei sich zu haben. Daß die Zukunft des Knaben damit für alle Zeit gesichert wäre, sei selbstverständlich, und[332] angesichts ihrer bevorstehenden Abreise sei es ihnen vielleicht lieb, denselben wieder in guten Händen zu wissen …
»Aber haben Sie denn gemeint, daß wir ihn hier lassen wollten?« fragte Friederike beinahe bestürzt, und überrascht sah sie den Priester an.
»Ja, mein Fritzel hat sich eingebildet, der Himmel hätte ihr den Bengel extra zur Belohnung ihrer guten Sitten und ihres braven Herzens beschert, und ich fürchte sehr, daß wir dem Prälaten den Besitz Sistos streitig machen. Aber es handelt sich in erster Reihe um diesen selber, und wenn er auch nicht mündig ist, so hat er doch das Recht der freien Entschließung.«
Quandt stand auf, und rief in dem Atelier nach dem Knaben, und in wenigen Augenblicken erschien er.
»Er hat Herrn Stahl Gesellschaft geleistet, der an seinem Gesichte seinen ersten Porträtversuch macht … komm her, Sisto!«
Der Junge trat nahe zu dem Maler, der ihn zwischen seine Kniee zog, und, indem er ihm mit einer gewissen Bewegung in das frische Gesicht schaute, sprach:
»Denke Dir, mein lieber Sisto, Monsignore Parelli will Dich wieder in sein Haus haben –«
»Die Signora ist fort für immer,« – fügte Frohwalt ein, und die Augen des Knaben leuchteten auf.
»O, sie ist fort – da ist alles gut!« sagte er.
»Und Du willst also zu ihm zurückkehren?« fragte Quandt.
Da flog ein Schatten über die Züge des Jungen, und er senkte schweigend den Kopf.
Da sprach Frau Friederike:
»Macht ihm nicht bange! Er soll nicht denken, daß er zu dem Prälaten zurückkehren muß, weil wir etwa ihn nicht mehr haben wollten. Ach, warum ich mich nun nicht besser italienisch ausdrücken kann! – Jetzt, Heinrich, sag' Du's ihm[333] klar und vernünftig, daß er unser Kind sein und bleiben soll, wenn's ihm bei uns gefällt und daß wir ihn mit in die Heimat nehmen und adoptieren, und …«
Die junge Frau war lebhaft geworden und saß mit geröteten Wangen da, indes Sisto ihr die glänzenden Augen voll zuwendete. Quandt sah sie lächelnd an:
»Na, ja, ja, Kind – laß mich nur machen! – Also, mein Junge, wir müssen jetzt bald in unsere Heimat – das ist weit weg, und die Leute reden dort eine andere Sprache und alles sieht ein wenig anders aus, und im Winter schneit's und friert's, und es wachsen keine Citronen und Orangen …«
»Aber Heinrich …«
»So sei doch ruhig, Fritzel, der Junge muß doch erst die Schattenseiten kennen! – Aber, mein lieber Sisto, es giebt auch gute Menschen dort, wie der geistliche Herr da, meine Frau und ich, und wenn Du nicht wieder zu Monsignore willst, und uns lieber hast, so sollst Du bei uns bleiben, und ich will Dein Vater sein – –«
»Und ich Deine Mutter, Sisto – willst Du?«
Da rang es sich wie ein Jauchzen und Schluchzen zugleich aus der Brust des Knaben, und er warf sich mit ausgebreiteten Armen an das Herz der jungen Frau.
»Na seht Ihr, wie ich mit meinem bischen Italienisch die Sache klar bekommen habe. Sisto, Junge – komm her, ich will auch meine Hälfte haben von Dir!« rief der Maler, und nachdem er seinem Liebesbedürfnis Genüge gethan, suchte er seine Rührung unter Scherzworten zu verbergen. Er führte den Knaben wieder seiner Frau zu und sagte:
»Hier übergebe ich ihn Dir in aller Form Rechtens, und hoffe, daß Du ihn zu meiner Freude erziehen wirst; und nun laß einmal sehen, wie Dir die Mutterrolle zu Gesicht steht! – Was? Sehr gut! Nicht, Herr Doktor? – Sie sind Zeuge der Adoption und können dem guten Prälaten mitteilen,[334] daß wir als echtes und rechtes Ehepaar einen Jungen viel besser brauchen können, als ein Cölibatär, und katholisch soll er auch bleiben: die Söhne folgen der Religion des Vaters.«
Frohwalt stand in tiefer Ergriffenheit; er kam sich im Grunde recht überflüssig vor bei dieser Familienszene, und doch konnte er nicht gehen. Es ging ihm in wenig Augenblicken vieles durch den Sinn. Wie hätte er sich noch vor nicht langer Zeit entsetzt und für das Seelenheil des Knaben gebangt bei dem Gedanken, daß ein protestantisches Weib ihn wie ihr eigenes Kind halten und erziehen würde … und heute war ihm das so selbstverständlich, und er wußte und fühlte es gut, daß Sisto nirgends besser aufgehoben sein könne. Aus den beiden Menschen, die hier um den fremden Knaben sich bemühten, sprach eine solche Fülle echter Liebe, daß er selbst mächtig davon erfaßt wurde, zumal diese Liebe so ungesucht und unmittelbar aus dem Herzen kam.
»O, Ihr lieben, guten Menschen!« sprach er vor Rührung übermannt, und mehr vermochte er nicht hervorzubringen, aber mit überströmenden Augen reichte er dem Maler und seiner Frau die Hand.
Heinrich Quandt verzog sein gutmütiges Gesicht in die seltsamsten und wunderlichsten Falten, so daß man nicht im Klaren war, ob er im nächsten Augenblicke auflachen oder aufschluchzen werde; er riß fast gewaltsam seine Hand aus der des Priesters und eilte nach dem Atelier, um Hans Stahl herbeizuholen. Als er mit dem jungen Lausitzer eintrat, der ziemlich verblüfft dreinschaute, rief er: »Hans, lassen Sie in diesem feierlichen Augenblicke Pinsel und Palette, und bilden Sie sich etwas darauf ein, daß Sie der Erste sind, welchem Heinrich Quandt und Frau hierdurch die ergebene Mitteilung machen, daß ihnen Gott am heutigen Tage einen gesunden, kräftigen Jungen geschenkt hat. Da steht er: Sisto Quandt-Brenta! Klingt famos. Und nun, Fritzel, sieh einmal[335] zu, ob Du von unserer Gastfreundin etwas anständig Trinkbares auftreiben kannst.«
Hans Stahl war der Mensch, der sich in die Sachlage fand, und als der Falerner auf dem Tische stand, brachte er den ersten Toast aus auf den »Neugeborenen«, in welchem der gute alte Studentenhumor wieder zum Durchbruch kam.
Und mit seinen Worten fanden auch die anderen sich wieder in eine ruhige Stimmung, aber Quandt sagte:
»Hans, Sie sind ein prächtiges Individuum, und verdienten gleich als Zwilling mitadoptiert zu werden. Hei, da kommt mir ein prächtiger Gedanke! Lieber Doktor Frohwalt, wie wär's, wenn wir hier den Prälaten als Adoptivvater gewinnen könnten! Das wäre ja gleich ein Ersatz für Sisto. Ich habe zwar unsern Hans meinem Freunde und Berufsgenossen Paolo Grotti hier auf die Seele gebunden, und bei ihm kann er etwas lernen in Colorit und Pinselführung – 's ist auch ein prächtiger Mensch im übrigen – aber wenn Monsignore Parelli noch seine Huld unserm Landsmanne zuwendete … hören Sie, Frohwalt, ich glaube, Sie finden ihn in der Laune, reden Sie mal ein Wort mit ihm! Er soll sich ansehen, was Hans Stahl leistet, und wenn ihn nicht schon Sistos Kopf, der jetzt von der Leinwand heruntersieht, besticht, so könnt Ihr mich einen Sudler nennen!«
Frohwalt versprach, in diesem Sinne zu handeln, und Hans Stahl fühlte sich angesichts einer sorglosen Zukunft in heiterster Stimmung.
Als der junge Priester fortging – Sisto hatte ihm die Hand geküßt und den Prälaten um Verzeihung bitten lassen, daß er nicht zu ihm komme – war es draußen wieder Sonnenschein geworden, und Sonnenschein lag auch in seiner Seele. Vor ihm wurde angesichts der in dem kleinen Hause waltenden Liebe ein Wort lebendig aus dem »Laienbrevier«, das ihn zwar nicht nach Rom begleitet hatte, mit dem er[336] aber – oft gegen seine Absicht – immer vertrauter geworden war wie mit einem lieben Freunde.
So war es und so muß es sein! Alles Gute, das wir thun, kommt uns zu gut, und erfüllt unser Herz mit Freudigkeit. Und diese Freudigkeit empfand Frohwalt noch, als er am Nachmittage nach dem Hause des Prälaten ging. Erst als er die breiten Treppen hinanstieg, überkam ihn ein leises Schmerzgefühl bei dem Gedanken, daß er dem einsamen Manne in seinem großen, prächtigen Hause den Knaben, an dem seine Seele hing, nicht mitbringe.
Als er Parelli von der Szene im Hause Quandts erzählte, senkte dieser die Stirn und sagte leise:
»Ich hab's gewußt! – Auch das ist eine Sühne.«
Nun berichtete der junge Priester aber von dem andern Schützling des deutschen Malers, und das Auge des Prälaten begann freundlich zu leuchten.
»Ich danke Ihnen für diese Mitteilung, und seien Sie überzeugt, daß ich auch darin einen Fingerzeig des Himmels sehe. Ich komme morgen zu Herrn Quandt!«
Er verabschiedete sich herzlich von Frohwalt.
Er hielt Wort. Am nächsten Vormittage erschien er bei dem deutschen Maler. Beim Eintritt in das Atelier sah er mit einem Blick Sisto, wie er leibte und lebte, und sein Gesicht, das noch ein zweites Mal von der Leinwand wie aus einem Spiegel herschaute. Als ihn der Knabe erblickte, sprang er auf und eilte auf ihn zu. Stürmisch griff er nach den Händen Parellis, küßte sie und stammelte dazu beinahe leidenschaftlich:
»O Verzeihung, Verzeihung, Monsignore – ich kann nicht anders!«
Der Prälat legte leise seine Rechte auf das dunkellockige Haupt und sprach begütigend:
»Beruhige Dich, mein Sisto! Ich bin Dir nicht böse – Gott segne Dich!«
Dann begrüßte er Quandt:
»Ich wünsche Ihnen und Ihrem Frauchen Glück zu dem braven, prächtigen Sohne, und wenn Sie mich als einen Seitenverwandten desselben gelten lassen wollten, würde ich mich freuen. Das ist Herr Stahl?«
Hans hatte sich erhoben, und Parelli trat an seine Staffelei. Das Bild Sistos zeigte lebensvolle Frische, und an dem Talente des jungen Malers konnte kein Zweifel sein. Der Prälat schien sich ganz in die Züge des Knaben zu vertiefen, und über sein Gesicht huschte dabei ein Schatten der Wehmut. Es war ganz still in dem Raume, und Stahl hielt den Atem an, bis jener sich umwandte und freundlich sagte:

»Dies Bild müssen Sie mir überlassen! Sie selbst aber bitte ich, während der Zeit Ihres Aufenthalts in Rom mein Gast zu sein – ich hoffe, Sie gehen nicht eher, bis aus dem Jünger ein Meister geworden ist.«
Stahl, welcher des Italienischen beinahe garnicht mächtig war, fand keine Worte, aber seine Hand zitterte vor Erregung, als er sie in die dargebotene Rechte des Prälaten legte.
»Das walte Gott!« sagte leise der Maler, indem er seinen Arm um Sistos Hals schlang und den Jungen an sich zog.



Die Uhren der ewigen Stadt verkündeten die achte Morgenstunde. Rom begann langsam sich den Schlaf aus den Augen zu reiben, und ob es auch, zumal in den größern und glänzenden Straßen, in den Häusern der vornehmen Viertel noch recht still war, der Pulsschlag der Großstadt wurde doch überall vernehmlich. Auf den Plätzen sammelt sich müßiges Campagnolenvolk, um zu warten, ob man es zu irgend einer Arbeit dingen werde. Es sind prächtige Gestalten unter diesen lungernden Bauern, die in ihren verschlissenen, zerfetzten aber bunten Anzügen da und dort lehnen, gelangweilt in die Welt hinein schauen, oder in kleinen Gruppen auf dem Erdboden liegen, und mit leidenschaftlicher Erregung das geliebte Morra spielen. Kleine Wagen mit den täglichen Lebensbedürfnissen und den Erzeugnissen des Gartenbaus rollen langsam daher, und ihre Besitzer lassen ihre gewohnten eintönigen Rufe erschallen, welche zum Kaufen einladen sollen, während ihre Lasttiere dazwischen schreien, als wollten sie ihr Vergnügen über den neuen Morgen ausdrücken, vielleicht auch ihre Klage über die neue Plackerei. Die niedlichen Blumenverkäuferinnen richten ihre Verkaufsstände her, zumal in den Fremdenquartieren, und auf der Treppe, die nach dem spanischen Platze herabführt, haben sich zahlreiche Modelle eingefunden und warten auf die Künstler, die sich hier ein Stelldichein geben.
Auf der Piazza di Spagna selbst wird es lebendiger. Auch die vornehmen Hôtels und die prächtigen Paläste öffnen die schlaftrunkenen Augen, goldglitzernde Wagen fahren da und dort vor und warten, mit den reichgallonierten Dienern auf dem Bocke, und die bummelnden Campagnolen, das fahrende Volk und alle, die es bemerken, wissen, daß heute Konzilssitzung ist, und daß diese prächtigen Karossen einige besonders vornehme und reiche Väter nach der Peterskirche fahren werden.
Das Schauspiel ist nicht mehr neu und deshalb die Neugier keine besonders brennende. Endlich erscheint da und dort in einem Portale eine Gestalt in rot- oder violettseidenem Talar – je nachdem es sich um einen Cardinal oder Bischof handelt – und neben ihr oder hinterdrein kommt ein geistlicher Begleiter … und bald darauf rasselt der Wagen, dessen Radspeichen im Morgensonnenschein aufblitzen, die vornehme Via dei Condotti entlang nach der Engelsbrücke zu.
Hier ist es belebter. Von fünf Straßen rollen sie aus dem Innern der Tiberstadt heran, die Wagen mit den Vätern des Konzils. Da kommen von der Richtung des Palazzo Borghese her die Mietswagen der minder begüterten Herren, die in ihren violetten Talaren im Fond lehnen, die breitrandigen Hüte auf den Häuptern und blinkende Kreuze auf der Brust, und langsamer trotten dazwischen die gewöhnlichen Droschken, die vetture pubbliche, in welchen zwei, wohl auch drei der geistlichen Oberhirten Platz genommen haben, und die Leute schließen aus der Verschiedenheit der Gefährte auf Bedeutung und Vermögen der Herren.
In den Droschken sitzen zumeist die aus dem fernen Osten gekommenen Bischöfe, die mit voller Gleichgültigkeit und unentwegter Würde auf den Gesichtern, die bald von tiefschwarzen, bald von schneeweißen, wallenden Bärten umrahmt sind, auf die Leute herabsehen, ab und zu ihre Dose[340] hervorziehen, sie dem Nachbar reichen, und dann mit nachlässigem Behagen das duftende Labsal zur Nase führen.
Langsam fahren die Wagen, nur zwei, höchstens drei neben einander, über die Engelsbrücke hinüber nach dem vatikanischen Rom, und auf dem St. Petersplatze finden sich alle zusammen. Die Sonne Roms beleuchtet hier ein großartig schönes Bild. Vor der gewaltigsten aller Kirchen, deren einzig schöne Kuppel, das mächtigste herrlichste Denkmal des großen Michelangelo, in den tiefblauen Aether hinaufragt, breiten sich die Säulenhallen Berninis aus, und in den drei bedeckten Gängen, welche von den prächtigen Travertinsäulen gebildet werden, lustwandeln noch einzelne Konzilsväter. Rechts und links von dem Obelisken, den Sixtus V. aufstellen ließ, und der schon manche wunderlichen Dinge an sich vorübergehen sah, steigen glitzernde Wasserstrahlen und fallen tönend und klingend in die schönen achteckigen Schalen zurück.
Und daß neben dem Großen das Kleine, neben dem Heiligen das Weltliche nicht fehle, haben auf dem Petersplatze erfinderische Köpfe Trinkhallen errichtet, aus welchen ein köstlicher Kaffeeduft hervordringt, während Tabakhändler in kleinen Buden ihre trefflichen Waren anpreisen. Sie kennen die frommen Herren aus dem Oriente und haben ihnen ihre Bedürfnisse abgelauscht. Und diese Söhne einer fremden Sonne nehmen es nicht genau mit den Forderungen der üblichen Sitte und sind sinnlichen Lockungen, soweit sie nicht unerlaubt sind, nicht unzugänglich. Da stehen Bischöfe aus Syrien, Armenien, Bulgarien in dem kleinen Laden und schlürfen ihre Tasse Mokka formlos und ungezwungen, und um den Tabakshändler finden sich Maroniten, Chaldäer und andere ein, prüfen die Waren, und versorgen sich damit, um während der Konzilsverhandlungen eine Herzstärkung und dann daheim eine Tröstung zu haben für die entbehrten Genüsse der orientalischen Heimat.
Die abendländischen Kirchenfürsten sind ihrer Würde sich[341] mehr bewußt. Sie wandeln noch einige Zeit mit ernster Würde in den Säulenhallen hin und her, und wie beim Turmbau zu Babel vermag man auch hier alle Sprachen zu vernehmen. Im elegantesten Französisch unterhalten sich einige Herren mit geistvollen, bartlosen Gesichtern, von anderer Seite mischt sich mit dem wohlklingenden Neugriechisch das steife, breite Englisch, und neben dem vokalreichen Spanisch erklingen die konsonantenreichen slavischen Idiome. Und wenn sich all das Fremde unter einander verständlich machen will, dann wird auch die alte Sprache wieder lebendig, die einst an den Tiberufern erklang … und doch wiederum nicht dieselbe Sprache, denn wenn ein alter Römer vom Capitol herüber oder von der Moles Hadriani herankäme, er würde entsetzt sein über das, was sich mitunter hier als Latein ausgiebt.
Die Zeit für den Beginn der Sitzung ist gekommen.
Ueber die schöne Traventin-Freitreppe flutet langsam der seidenglänzende Strom hinauf und hinein in jene herrliche Vorhalle, deren großartige Perspektive und prachtvolle Deckenornamentik würdig auf das Gotteshaus selbst vorbereiten; aber von den Konzilsvätern kümmert sich keiner mehr um diesen Anblick; ihre Gemüter sind zumal heute mächtig erregt in der Vorahnung, daß es eine bewegte Sitzung geben werde. Um den streitbaren Bischof Stroßmayr geschart kommen die österreichischen und deutschen Bischöfe, und manches blitzende Auge eines italienischen Kirchenfürsten betrachtet den kühnen kroatischen Prälaten mit unverhohlener Gehässigkeit. Wenn er nicht wäre, könnte man viel rascher zum Ziele kommen.
In dem gewaltigsten Dome der Christenheit fehlt es niemals an Andächtigen, sowie an Neugierigen. Auch heute sind sie zahlreich hier und lassen den geistlichen Hofstaat des Papstes an sich vorübergehen.
Da wo unter der Riesenkuppel, die in wundersamer, ergreifender Großartigkeit, ein herrliches Pantheon, in der Luft[342] zu schweben scheint, sich der Hauptaltar mit dem unförmigen Tabernakel Berninis erhebt, hat sich die Menge am zahlreichsten eingefunden. Hier ist das Heiligste im Heiligen, das Grab des ersten »Statthalters Christi auf Erden,« vor welchem der Lichtglanz von 89 vergoldeten Lampen die »Konfession« von Carlo Maderno Tag und Nacht beleuchtet. Hier ist überall der matte Glanz des Marmors untermischt mit dem helleren Blinken des Metalls und mit dem kunstvollen Schmuck alter Mosaike.
Und wie die Kirchenfürsten hier langsam, ehrwürdig und würdevoll herankommen, da geht ein Fragen und ein Raunen durch den Kreis der Neugierigen und der Frommen, und die Namen der Kardinäle und Bischöfe laufen von Mund zu Mund. Diese selbst aber wenden sich nach rechts, wo in einem Querschiff der Versammlungsraum für das Konzil in einer weder besonders bequemen, noch hervorragend schönen Weise hergerichtet worden ist. Eine zu dem besonderen Zweck errichtete große hölzerne Pforte schließt den Konzilssaal ab gegen die Kirche. Die Holzwand ist mit einem Marmormuster angestrichen worden, auf welchem die Himmelskönigin gemalt ist, zu deren beiden Seiten die Apostelfürsten niederschauen auf die Vertreter der kirchlichen Rangordnung, wie sie jetzt an den wachehaltenden Schweizern, die ihre Hellebarden präsentieren, vorüberschreiten.
Enger drängen sich vor dem Eingang die Neugierigen heran, um zu sehen, wie da drin sich die kreisrund sich erhebenden, grüngepolsterten Sitze allmählich füllen, bis auch die letzten der Kirchenväter eingetreten sind. Dann wird die Pforte geschlossen, und die ernsten, stattlichen Gestalten der Schweizer drängen die Horcher noch um einige Schritte zurück, damit die Christenheit auch nicht das geringste vernähme von dem, was hier innen zu ihrem Heile verhandelt wird.
Tief und volltönig erklang nun der Gesang eines[343] lateinischen Hymnus, dann folgten Gebete und dazwischen der Ton des Glöckleins, der den Außenstehenden verkündete, daß der Meßgottesdienst in der geschlossenen Halle fortschreite, und sobald das Zeichen erscholl, daß sich eben jetzt in den Händen des zelebrierenden Bischofs das Wunder der Verwandlung vollzog, sanken die Gläubigen auch diesseits der hölzernen Thüre auf die Kniee nieder und flehten den Beistand des heiligen Geistes an für die Beratungen der frommen Väter.
Und an diesem Tage hätte derselbe besonders Veranlassung gehabt, in der Mitte des Konzils zu sein.
Die Falle, von welcher Felice vor Parelli gesprochen hatte, sollte aufgestellt werden. Von der Rednertribüne herab eiferte ein Kardinal über die Verderblichkeit des Protestantismus. Das Gewand des Kirchenfürsten schillerte in hellem Purpur, aber sein Gesicht nicht minder. Was er vortrug, war ein wohlgesetztes Machwerk, das von einer Kommission ausgearbeitet war und den Stempel jenes Geistes trug, in welchem der Jesuit Felice sich geäußert hatte.
Mit fanatisch leuchtenden Augen saßen die einen, mit würdevoller Gleichgültigkeit nickten die Häupter der andern Zustimmung, nur auf den Sitzen des deutschen, österreichischen, französischen und amerikanischen Episkopats rückten einige unruhig hin und her; man sah auf Dupanloup, den geistvollen französischen Erzbischof, der mit großen, klaren Augen nach dem Vortragenden schaute, und bei dem nur ein leiser Zug der Bitterkeit um den feinen Mund den Unmut verriet, den er empfand. In das frischgerötete, edle Gesicht des Cardinals Schwarzenberg war eine noch lebhaftere Färbung gestiegen. Ernst, beinahe finster, sah der Erzbischof von München-Freising drein und wechselte einen verständnisvollen Blick mit seinem landsmännischen Amts- und Gesinnungsgenossen, dem Bischof von Augsburg, die meisten Blicke aber richteten sich auf Bischof Stroßmayr, dessen scharfgeprägte[344] Züge von verhaltenem Kampfesmute zeugten und dessen Hände sich unruhig bewegten, als vermöge er sich kaum zu beherrschen.
Sobald der vortragende Cardinal geendet, sah man ihn sich erheben, und gleich darauf klang seine Stimme laut und vernehmlich, so daß sie hinausscholl bis in die Kirche selbst, und die Eingeweihten wußten, daß er das Wort ergriffen habe. Er war der gewaltigste Redner des Konzils, geistvoll und gelehrt, schlagfertig und ehrlich, gewandt und klug, und beherrschte die lateinische Sprache mit einer Sicherheit und Eleganz, als ob sie ihm angeboren wäre. Man sah, wie die Augen der päpstlichen Partei sich finster zusammenzogen, und wie die Gegnerschaft sich fester in die Sitze drückte, als überkäme sie ein Gefühl der Sicherheit angesichts der Thatkraft des Mannes, der jetzt das Wort ergriff. Neidlos hatten Schwarzenberg und die geistvollen Führer der französischen Kirche, Dupanloup und Maret, ihm die Palme der Führerschaft der Widerstandspartei überlassen, und der slavische Bischof war's, der als der Gefürchtetste und der Geehrteste zugleich angesehen werden muß.
»Mit Vergunst, ihr hochwürdigsten Väter!« begann er. »Harte Worte haben an unser Ohr geschlagen und fast will es mir scheinen, als ob sie an diesem Orte besser nicht gesprochen worden wären. Ich beklage es tief und aufrichtig, daß von der Kirche desjenigen Apostels, welcher dem Herrn am nächsten stand und der ein lebendiger Zeuge seiner allumfassenden Liebe war, Worte in die Welt ausgehen sollen, welche von dieser Liebe nichts wissen, und wenn ich bedenke, daß das Direktorium dieser hochwürdigsten Versammlung mit Vorbedacht diese Angelegenheit hier zur Erwägung und zum Beschlusse vortragen konnte, vermag ich – so hart es auch klingt – den Vorwurf der Lieblosigkeit nicht zu unterdrücken. Diese Lieblosigkeit muß aber um so größer erscheinen angesichts der bedauernswerten Unkenntnis der Geschichte – oder[345] soll ich sagen angesichts der absichtlichen Verkennung der geschichtlichen Thatsachen? Man muß der Wahrheit Zeugnis geben, auch wenn sie uns nicht behaglich ist, und wenn man dazu den Mut nicht finden kann, darf man sie wenigstens nicht absichtlich entstellen. Welche Thatsachen aber können zum Beweise vorgebracht werden für die Behauptung, daß der Protestantismus alle Uebel der Zeit verschuldet und den drohenden Glaubensbankerott auf dem Gewissen habe? Hier sitzen eine gute Anzahl ehrwürdiger Väter, in deren Diözesen Protestanten friedlich, ehrlich und brav neben Katholiken leben … sollen sie, sollen wir, die berufenen Hüter des Friedens, durch solche Beschlüsse, wie die angestrebten, die Brandfackel in die Gaue werfen, in denen wir das Wort der Liebe zu verkünden gesetzt sind? Und meine ehrwürdigen Väter, soll ich Ihnen Protestanten nennen, die gegen Umsturz und Unglauben sich erhoben, gegen Revolution und Sittenverderbnis gekämpft haben? Soll ich Ihnen Namen anführen, denen gegenüber selbst der Eifer des Ordens Jesu erbleicht, vor deren edler Thätigkeit im Dienste der Menschheit wir selbst in schweigender Achtung uns neigen müssen? …«
Schon einige Male hatten Zwischenrufe aus den Reihen zumal der italienischen Bischöfe den kühnen Redner unterbrochen, vereinzeltes Murren war vernehmbar geworden, jetzt aber brandete es auf wie in einem erregten Meere. Eine Anzahl Väter sprang von den Sitzen auf, andere suchten zu beschwichtigen, Rufe ertönten, welche dem Redner den Schluß seiner Rede aufdringen wollten, Stroßmayr aber schien an solche Szenen gewöhnt zu sein; er schaute einige Augenblicke schweigend in die Versammlung, seine Augen blitzten klar und fest, und nachdem einigermaßen die Ruhe wieder hergestellt worden war, nahm er das Wort von neuem.
»Ich weiß nicht, meine ehrwürdigen Brüder, ob durch eine solche Weise der Behandlung der aufgeworfenen Fragen die Würde des Konzils gewahrt und das Ansehen des Einzelnen[346] gefördert werden kann, ich weiß nur, daß auch ein solcher Eingriff in das Recht, hier seine Meinung ehrlich aussprechen zu dürfen, mich nicht abhalten wird, dies zu thun. Oder soll dieser Vorgang kennzeichnend sein für die Handhabung der neuen Geschäftsordnung, mit welcher man uns unangenehm überraschen möchte? Und das ist ein Punkt, über welchen ich an dieser Stelle gleichfalls mich nicht auszuschweigen vermag, um so mehr, als ich weiß, daß ich im Sinne und nach der Meinung einer großen Zahl meiner hochwürdigen Amtsbrüder spreche. Der Schwerpunkt dieser neuen Geschäftsordnung liegt darin, daß eine einfache Mehrheit entscheiden soll über die wichtigsten Fragen der Kirche. In jeder andern parlamentarischen Körperschaft wird die Annahme selbst unwesentlicher Gesetze davon abhängig gemacht, daß eine relativ größere Mehrheit dafür stimmt, und wo es sich um das Seelenheil von Millionen von Katholiken handelt, soll der Zufall einer einzigen Stimme den Ausschlag geben dürfen? Man kann doch nicht in einem solchen Falle das Walten des heiligen Geistes annehmen, der bei 700 Bischöfen und Prälaten gerade 351 erleuchtet und 349 die Erleuchtung versagt! Eine solche Annahme wäre doch frivol, ja gotteslästerlich. Freilich ist es bei den Mitteln, die man anwendet und bei der Zusammensetzung dieser hochwürdigsten Versammlung außer Zweifel, daß man für die Vorlagen eine Mehrheit von mehr als einer Stimme erreichen werde. Auch hier handelt es sich um den Grundsatz, nach welchem vorgegangen wird, und die Einführung dieses Grundsatzes würde einen beklagenswerten Mißbrauch der Gewalt bedeuten, welche die in Rom herrschende Partei und das nicht aus freier Wahl des Konzils hervorgegangene Direktorium ausübt, und gegen einen solchen lege ich im Namen Vieler Widerspruch ein …«
Aufs neue erhob sich ein Sturm der Empörung, laute Zurufe für und wider erschollen, aber machtvoll durch das Getöse klang die Stimme des kühnen Sprechers:
»Der heutige Antrag soll die Probe machen auf die neue Geschäftsordnung, man möchte uns heute schon verlocken, mit einfacher Stimmenmehrheit die Kundgebung gegen die Protestanten zu verwerfen, aber wir sind auf der Hut. Mit solchen Mitteln wird man uns nicht zwingen, man wird damit noch weniger die Gewissen der katholischen Welt vergewaltigen können …«
Weiter kam er nicht. Der Lärm wurde betäubend. Das war keine Versammlung von ehrwürdigen Kirchenvätern, das war ein wüstes Chaos von zornig erregten Parteimännern. Nur wenige saßen; überall war man von den Sitzen aufgesprungen, viele hatten ihre Plätze verlassen, man schrie einander zu, man überschrie aber auch vor allen den kroatischen Bischof, und als dieser trotz alledem auf das Wort nicht verzichten wollte, da nahm die leidenschaftliche südliche Erregung selbst bedrohliche Formen an. Es erklangen Worte, die nicht bloß die Heiligkeit des Ortes verletzten, sondern auch die Würde des Sprechers, und mit blitzenden Augen, ja mit geballten Händen drang man gegen ihn vor, als wolle man ihn thatsächlich insultieren.
Der wüste Lärm klang vernehmbar hinaus auch vor die Pforte des Konzilssaals. Neugierige und Fromme sahen sich erstaunt an, über manches Gesicht flog ein mühsam verhaltenes Lächeln des Spottes, auf manchem dagegen stand etwas von der Erregung geschrieben, die jenseits der Pforte die Gemüter bewegte. Zahlreiche Kutscher und Diener der Prälaten harrten hier auf ihre Herren. Auch sie hatten ihre Meinung über das, was da drinnen vorgehen mochte.
»Sie schlagen und raufen sich!« rief halblaut ein derber galonnierter Rosselenker, und die Behauptung schien nach dem, was man vernehmen konnte, die Wahrheit für sich zu haben.
»Laßt uns hineindringen – – wir wollen unsern Herren helfen – wir wollen sie retten …«
Das raunte und rief durcheinander wie der Widerhall[348] aus der Konzilshalle, und die Schweizer vor derselben kreuzten die Hellebarden und stemmten sich dem Andrang entgegen. Da verklang der Lärm hinter der Pforte, und auch vor derselben begannen die Gemüter sich zu beruhigen.
Früher als sonst aber schloß diesmal die Sitzung. Mit roten Gesichtern, vielfach mit vor Erregung leuchtenden Blicken kamen die Väter aus dem Dome des heiligen Petrus. Von der Anwesenheit des heiligen Geistes in der eben abgehaltenen Sitzung war auch jetzt nicht viel zu bemerken. Gruppenweise, mitunter dicht geschart, schritten sie über den Petersplatz hin in eifrigen, erregten Gesprächen. Um Stroßmayr, den Helden des Tages, drängten sich die andern hervorragenden Persönlichkeiten, der französische Bischof Mathieu, der Erzbischof Moreno von Valladolid und andere spanische Bischöfe, sowie eine größere Zahl deutscher Kirchenfürsten. Finstern Blickes schritt der Erzbischof Manning von Westminster neben dem Erzbischof Deschamps von Mecheln daher, umgeben von den eifrigsten Vertretern der Unfehlbarkeit, in Gruppen haben sich die Orientalen zusammengefunden, die fast alle auf Seite der römischen Kurie stehen, und die Vorgänge der vergangenen Stunde bilden überall den Gesprächsstoff.
»Man wird nicht wagen, diese Einleitung zu den päpstlichen Dekreten ein zweites Mal vor das Konzil zu bringen,« äußerte ein deutscher Bischof.
»Wenigstens nicht mehr in dieser Form, und wenn sie gereinigt und verbessert zur Abstimmung gebracht werden sollte, liegt wohl kein Grund vor, sie zu verwerfen, und wir werden der Welt doch den Beweis der moralischen Einstimmigkeit einer Kirchenversammlung geben,« fügte ein anderer in der Begleitschaft Stroßmayrs hinzu, dieser aber wandte sich nach dem Sprecher und sagte:
»Seien wir nicht vertrauensselig, lieber Amtsbruder, ich habe, um mich kriegerisch auszudrücken, mich daran gewöhnt,[349] in Rom im Harnisch zu schlafen, und es wäre gut, wenn das andere auch thäten.«
Der kroatische Bischof schritt auf seinen Wagen zu, aber ehe er ihn erreichte, trat ihm Parelli in den Weg. Mit der ganzen Liebenswürdigkeit, die ihm zu Gebote stand, reichte er ihm die Hand:
»Ich freue mich der Ehrlichkeit und des Mutes, die Sie zeigen, hochwürdigster Bruder, und es drängt mich, Sie zu versichern, daß ich aus voller Seele Ihre Ueberzeugung teile und bereit bin, für dieselbe einzustehen.«
Verwundert sah ihn der andere an.
»Sie? Ein italienischer Prälat! Sie wagen, mir angesichts der Kurie Ihre Zustimmung auszusprechen? Wissen Sie, was Sie heraufbeschwören?«
Parelli lächelte:
»Das ist nebensächlich. Ich habe gesprochen und meine Seele bewahrt. Gott sei mit Ihnen!«
»Und mit Ihrem Geiste!«
Einen Augenblick lagen die Hände der beiden Männer in einander, und ihre Blicke begegneten sich. Dann verschob sich das Bild wieder; andere Gruppen drängten heran, auch Parelli fühlte, wie man ihn vorwurfsvoll ansah, aber er schritt, freundlich nach allen Seiten grüßend, langsam über den weiten Platz, und der Sonnenschein, der denselben erfüllte, schien ihm in die Seele zu leuchten.
Immer schwüler wurden die Tage. Die Fremden begannen Rom zu verlassen – auch Quandt war mit den Seinen in die Heimat zurückgekehrt – und den Konzilsvätern wurde es zwiefach ungemütlich in der ewigen Stadt. Erschlaffung sank ihnen bleischwer in die Glieder, denn gar viele von ihnen waren den italienischen Sommer nicht gewöhnt, Erschlaffung sank ihnen aber auch lastend und lähmend in die Seelen, denn gar Manches war wieder seit jener bewegten Sitzung[350] geschehen, das auch die Besten und Stärksten mit trüber Ahnung erfüllte.
Es war ein trauriger und aussichtsloser Kampf, welchen Ehrlichkeit und gründliches Wissen gegen römische Schlauheit und Willkür zu führen hatte, und die Kurie ging in demselben mit äußerster Rücksichtslosigkeit vor. Die durch Stroßmayrs Energie vereitelte »Einleitung« wurde »verbessert« wieder vor das Konzil gebracht, verbessert in dem Sinne, daß man die Schläge gegen den Protestantismus wegließ, dafür aber den Zusatz anhängte, daß man dem Papst gehorchen müsse, auch wenn er etwas verwerfe, was nicht gerade kirchenfeindlich oder ketzerisch sei.
Diese »Verbesserung« war viel schlimmer als die vorherige Fassung, und in ihr lag bereits der ganze Glaubenssatz von der Unfehlbarkeit. Es wurde hin- und hergeredet, und zuletzt ward die bedenkliche »Einleitung« samt dem Zusatz angenommen. Einen besseren Erfolg konnte sich die päpstliche Partei nicht wünschen, und nachdem einmal dieser errungen war, konnte auch die Debatte über den neuen Glaubenssatz selbst anheben. Welch' warme, ergreifende, aus dem Herzen quellende Beredsamkeit ward nun noch einmal aufgeboten, um die Annahme des Glaubenssatzes zu verhindern! Die edelsten, besten, gelehrtesten Männer, welche die katholische Kirche besaß, traten dagegen auf, manch einer mit blutendem Herzen, denn sie ahnten ja den Ausgang und fürchteten den Schaden, welcher damit ihrem Glauben und seinen Anhängern bereitet werden mußte. Aber auch der Trost, seine Meinung äußern zu dürfen, sollte den Konzilsvätern nicht unbeschränkt bleiben.
Es war am 3. Juni, als der Cardinal Schwarzenberg in besonders heftiger Erregung um die Mittagsstunde heimkehrte. Auf der edlen, hohen Stirn lagen Falten des Unmuts, und die sonst so klaren Augen zuckten unruhig. Er kam mit Professor Meyer, dessen sonst so gleichmäßig ruhiges[351] Gesicht ebenfalls von Erregung zeugte, und da er Frohwalt in einem Zimmer antraf, in welchem derselbe eben mit einer schriftlichen Arbeit beschäftigt war, blieb er vor diesem stehen und sagte:
»Mein lieber Doktor, das ganze Kirchenrecht kommt ins Wanken; ich fürchte, Ihre Studien und Kenntnisse haben nur noch geschichtlichen und nicht praktischen Wert. Hier in Rom wird nachgerade ein Kirchenrecht geübt, das kein Recht ist!«
Er brach ab und preßte die Lippen gegen einander, als habe er schon zu viel gesagt, dann ging er mit flüchtigem Gruße mit Professor Meyer weiter. Nach einem halben Stündchen kam der letztere aus dem Gemache des Kirchenfürsten. Er ließ sich neben Frohwalt auf einem Sitze nieder, und seufzte:
»Man wird zuletzt irre an allem! Es ist empörend, wie man hier mit den angesehensten Kirchenfürsten umspringt. Denken Sie, lieber Kollege, es waren noch fünfzig Redner eingeschrieben betreff des Dogmas, und das Präsidium erklärte heute mit einem Male: Die Debatten sind geschlossen. Eine ärgere Gewaltmaßregel läßt sich kaum mehr denken. Was haben wir deutschen Priester für eine erhabene Vorstellung gehabt von einer Kirchenversammlung, und welche entsetzliche Enttäuschung wird uns hier bereitet!«
Das glatte, freundliche Gesicht senkte sich tiefer auf die Brust, und die Finger griffen nervös herum an der schwarzen Binde, welche Tunika und Skapulier gürtete. So erregt hatte Frohwalt niemals den trefflichen Mann gesehen, aber auch durch seine Seele zog das Gefühl maßloser Bitterkeit. Er sprach halblaut:
»O, ich wollte auch, ich wäre nie nach Rom gekommen.«
»Dann kommt Rom zu uns – das ist ein und dasselbe.«
»Und werden sich die widerstrebenden Kirchenfürsten bei diesem Gewaltakte beruhigen?«
»Sie haben sich bisher noch bei jedem beruhigen lassen. Man wird zweifellos beraten, was nun geschehen soll und einen halben Beschluß fassen, der einfach unbeachtet bleibt, wie jede Aeußerung der Entrüstung, die bisher zu Tage getreten ist. Ich glaube, daß sich noch heute eine Anzahl der Prälaten hier einfinden.«
Das war auch wirklich der Fall. Im Laufe des Nachmittags fuhr Dupanloup vor, dann der Münchener Erzbischof, zahlreiche deutsche Bischöfe, und bei sengender Sonnenglut saßen sie beisammen in eifriger Beratung.
Der Unmut fand hier manches scharfe Wort. Allen war es klar, daß hier überhaupt von einem rechtmäßigen und allgemeinen Konzil nicht mehr die Rede sei, und einzelne Kühnere machten den Vorschlag, Rom ohne weiteres zu verlassen, und so die eigene Ehre und die Ehre der einzelnen Diözesen zu retten. Dann müsse man aber Urlaub vom heiligen Vater erbitten, gaben andere zu bedenken, und daß ein solcher jetzt bewilligt werden sollte, das war nicht anzunehmen. Man wollte wohl gerade durch die täglich anwachsende Sonnenglut, die den Aufenthalt in Rom beinahe unerträglich machte, die Väter müde und nachgiebig werden lassen. Auch die Bedenklichkeit und Zaghaftigkeit fehlte nicht in diesem Kreise, welche immer wieder zu Vorsicht und Leisetreterei mahnte.
Unmutig hatte Cardinal Schwarzenberg die verschiedenen Meinungen angehört:
»Geschehen muß etwas, meine hochwürdigsten Amtsbrüder, wenn wir uns nicht vor unsern Diözesanen schämen sollen. Eines ist unzweifelhaft: Wir stehen unmittelbar vor der Abstimmung, und wie sie fallen wird, ist nicht zweifelhaft. Sollen wir aber einen Glaubenssatz annehmen, der nur von einer zweifelhaften Mehrheit als solcher anerkannt wird?«
»Uebereilen wir nichts,« sprach einer der französischen Bischöfe. »Lassen wir ruhig die Abstimmung sich vollziehen,[353] wir haben dann wenigstens ein klares Bild über die Sachlage gewonnen, und wenn die Annahme nicht nahezu einstimmig erfolgt, so erheben wir Widerspruch!«
»Aber endlich ganz entschieden! Ich wollte, wir legten Widerspruch ein, ehe die Abstimmung oder gar die Verkündigung erfolgt, denn, heißt es einmal: Rom hat gesprochen, dann giebt es überhaupt keinen Widerspruch mehr!« ließ sich Stroßmayr vernehmen.
»Gut, warten wir ab – aber gehen wir dann auch entschieden vor, um das Aeußerste zu vermeiden!«
Das war zuletzt die überwiegende Meinung, und mit diesem Beschlusse gingen die Herren mit den roten und violetten Talaren auseinander.
Peter Frohwalt stand am Fenster, als die glänzenden, prächtigen Equipagen unten von dannen rollten mit den behaglich in den Polstern lehnenden Prälaten, und in seinem Herzen lag eine unendliche Bitterkeit. Alles äußerlich, alles Schein – innen Haltlosigkeit und Kraftlosigkeit, das war das allgemeine Bild, das erschien ihm als der Zustand der ganzen Kirche, und ihm, dem ehrlichen, treuen, überzeugungsfesten Katholiken fiel es wie Schuppen von den Augen, und er sah wie in einem Traume, was im Laufe der Jahrhunderte aus der Kirche Christi geworden war. Hier in Rom war Petrus, der einst ein armer Fischer war, für seinen Glauben gestorben, ein bedürfnisloser Mann, der seine Ruhestatt im Gefängnis hatte, und hier strebte sein in Prachtpalästen wohnender Nachfolger nach dem Nimbus der Göttlichkeit, und lebte, umgeben von Glanz und Herrlichkeit. In jenen alten Tagen aber hatte neben der Einfachheit die Wahrheit in der Kirche gewohnt, jetzt herrschte hier Weltklugheit und Schein.
Es war seltsam, daß Frohwalt in dieser Stunde Martin Luthers denken mußte, des schlichten Augustiners, der einst nach Rom gegangen war mit voller, freudiger Seele, um den Statthalter Christi und die wahre Herrlichkeit der Kirche[354] zu schauen, und der mit blutendem Herzen heimwärts ging ob der fürchterlichen Enttäuschung, die ihm bereitet worden war und die ihn eine Erneuerung der Kirche im Sinne der alten Einfachheit und Kraft herbeisehnen ließ, ohne daß er noch daran dachte, daß er selbst zum Werkzeuge dieser Erneuerung berufen sein sollte.
Peter Frohwalt war gelehrt worden, den Augustiner von Wittenberg zu hassen, und er hatte das redlich und mit der ganzen Glut des fanatischen Katholiken gethan, und wie er heute an ihn dachte, war dieser Haß wie mit einem Male aus seiner Seele herausgewischt und die Gestalt des Reformators wollte ihm beinahe groß und achtunggebietend erscheinen. Und solch Empfinden mußte sich ihm in Rom aufdrängen!
Er wurde unruhig, erregt, er hatte das Bewußtsein, daß solch ein Denken Sünde sei, und doch auch wieder ein anderes, das ihn freisprach. O, wie vermißte er in dieser Stunde einen Menschen wie Quandt oder wie den Vetter Martin! Daß auch der Alte nicht wiederkam!
Und Tag um Tag verging, der eine unbehaglicher als der andere, und für den 13. Juli war die erste Abstimmung über den neuen Glaubenssatz festgesetzt worden. Zwei Tage zuvor traf Martin in Rom ein. Sein erster Gang war zu Quandts gewesen, und dieser war vergeblich, sein zweiter war zu Frohwalt. Der junge Priester hatte ihn umarmt mit der Herzlichkeit eines Sohnes, und schon aus diesem Empfange schloß der Alte auf Manches.
»Es hat länger gedauert mit meiner Wiederkunft, als ich dachte,« sagte er, nachdem er sich niedergelassen und nach seiner Gewohnheit sein kurzes Pfeifchen in Brand gesetzt hatte – »aber wie das eben Unsereinem geht! Also Neapel habe ich gesehen, und schön war's, Peter! Das muß man wirklich geschaut haben vor seinem Sterben. Auch im alten Pompeji bin ich gewesen, und man hat recht wunderliche Empfindungen, besonders wenn man mit leidlich lebhafter[355] Phantasie diese Reste sich vervollständigt und im Geiste der Vorzeit ausbaut. Aber in Neapel ist der Geist des alten Seume über mich gekommen und ließ mir keine Ruhe; ich mußte weiter nach dem Süden und mußte auch meinen Spaziergang nach Syrakus haben. Und aus der Stadt, in der einst zu Dionys dem Tyrannen Möros, den Dolch im Gewande, schlich, komme ich geradenwegs zurück. Es ist derweilen etwas heiß geworden, und, wie mir scheint, spürt Ihr hier in Rom die Schwüle ganz besonders. Wie? – Du machst mir gar kein recht glückliches Gesicht, Peter, und es ist mir so zu Mute, als ob ich Dir gerade zurecht gekommen wäre, um Dir die Seele zu erleichtern. Das ist mein Schicksal, daß ich ein Beichtvater geworden bin, ohne die Weihen dazu erhalten zu haben, und es ist, als ob die verlassene Theologie sich an mir dadurch rächen wollte. Aber da ist sie im Irrtum, wenn sie meint, mir dabei einen Tort anzuthun. Mir ist nichts lieber, als wenn ich Herzen erleichtern kann. Also, mein lieber Doktor Peter – schieße los!«
»Ja, mein guter Vetter Martin – gerade Dich habe ich hergesehnt, und seit Du mir in Nedamitz aufgetaucht warst, an jenem traurigen Weihnachtsfeste, habe ich Dich niemals wieder so freudig begrüßt. Hier liegen die Dinge zum Verzweifeln. Dies Konzil …«
»Ach Du lieber Gott – da werde ich wohl nicht helfen können,« seufzte der Alte komisch – »für die Jesuiten ist es ein Lustspiel, für die Protestanten und andere ähnliche ein Schauspiel, und für gute, ehrliche Katholiken ein Trauerspiel. Du gehörst zu den letzteren, und da Du die Sache sozusagen aus der Proszeniumsloge ansehen kannst, begreife ich's, daß Du besonders davon ergriffen wirst. Ich kann mir aber nicht helfen. Ich meine, es ist gut so für Dich, und wenn ich die richtige Empfindung habe, so hat dies Konzil Dir schon manche Schlacken abgeschliffen, die an Deiner gesunden Menschennatur sich gebildet hatten und ihr garnicht zum[356] Vorteil gereichten. Aber da rede wieder ich – anstatt daß Du jetzt das Wort hast – das Alter macht geschwätzig!«
Und nun that Frohwalt sein Herz weit auf. Alle die Fülle von Enttäuschungen, welche Rom ihm gebracht in betreff der kirchlichen Einrichtungen im allgemeinen und geistlicher Persönlichkeiten im besonderen, betreff der Personenverherrlichung und des glänzenden Scheinwesens schilderte er ohne Bitterkeit, aber so klar und scharf, daß Vetter Martin voll Staunen den jungen Mann ansah, der mit solcher Sachlichkeit und mit solcher getreuen Ehrlichkeit die Verhältnisse erfaßte.
»Und wenn, wie nicht mehr zu zweifeln ist, durch eine einfache Stimmenmehrheit dieser neue, unerhörte Glaubenssatz angenommen wird, so kann nur eine Kirchenspaltung die Folge sein, und ich bete, daß aus ihr der Nutzen für alle Guten erwachse, daß eine abermalige Erneuerung der Kirche im Sinne der alten Einfachheit und Wahrheit erfolgen möge. Mein Weg ist mir dabei vorgezeichnet und ich glaube, ich werde ihn leicht gehen können, wenn Männer wie der Cardinal Schwarzenberg und Professor Meyer mir voranschreiten,« schloß Frohwalt.
»Wenn!« sagte Martin und wiegte ernst das graue Haupt.
»Du glaubst doch nicht, daß sie gegen ihre katholische Ueberzeugung …«
»Ich glaube in dieser Beziehung nur den Thatsachen. Warten wir sie ab! Und zuletzt kommt es bei jedem immer nur auf seine persönliche Festigkeit an, und daß die ihm nicht verloren geht, wenn er andere, die er für fest gehalten hat, ins Wanken kommen sieht. In der Hauptsache ist mir's lieb, daß Dir die Augen in Rom aufgegangen sind, und daß Du unter anderem auch darüber Klarheit hast, daß in dem protestantischen Weibe Heinrich Quandts ein Reichtum von echter Religiosität und Liebe lebt, und daß sie trotz aller unfehlbaren päpstlichen Dekrete eine größere Garantie besitzt für die ewige[357] Seligkeit, als selbst mancher Papst seligen, beziehungsweise unseligen Angedenkens haben durfte. – Uebrigens, was weißt Du Neues von Quandt? Und was hörst Du von Hans Stahl?«
Damit war das Gespräch auf ein ruhigeres Gebiet gekommen.
Am 13. Juli war der Petersplatz mehr belebt als sonst; so sehr das Interesse der Römer am Konzil im allgemeinen erloschen war, die Abstimmung in der Frage des neuen Glaubenssatzes war immerhin der wesentliche Punkt in der Geschichte dieser Kirchenversammlung, zumal bei der zwiespältigen Stimmung der Teilnehmer an derselben. Um die Mittagszeit, da die Sitzungen zu Ende zu gehen pflegten, ward es am lebendigsten in der Kirche sowohl, wie außerhalb derselben, und es war bereits bekannt, daß, abgesehen davon, daß verschiedene Kirchenfürsten Rom schon verlassen hatten, andere sich von der heutigen Sitzung fern gehalten hatten.
Auch Vetter Martin und Frohwalt gingen in den herrlichen Säulenhallen hin und her und harrten auf den für sie nicht zweifelhaften Ausgang; Martin war darüber ziemlich gleichgültig, der junge Priester dagegen erregt. Nun kamen die ersten der Konzilsväter aus dem Portale des Domes, näher drängten Neugierige heran, man wagte sogar, sich an diesen und jenen mit einer Frage zu wenden. Immer lebhafter drängte es nun durcheinander von seidenen Talaren und großen runden Hüten, die vielfach mit einer buntfarbigen Feder geschmückt waren. Zwischen ihnen huschten Angehörige des niederen Klerus, Mönche und Weltpriester hin, und auch die Gestalt des Jesuitenpaters Felice tauchte auf.
Er bemerkte Frohwalt, und mit einem seltsamen, beinahe schadenfrohen Aufleuchten der sonst so kühlen Augen trat er an ihn heran:
»Wissen Sie schien das Ergebnis der Abstimmung, Hochwürden? – Nein? – Nun, von etwa 600 Vätern haben[358] 70 gefehlt, 88 haben mit non placet (Nein) gestimmt, 62 mit placet juxta modum (Ja, unter Vorbehalt), die andern 380 haben den Glaubenssatz angenommen. Ein schönes Ergebnis … Dank dem heiligen Geiste!«

Er stieß die Worte beinahe triumphierend hervor, dann eilte er weiter. Frohwalt wollte sprechen und sich gegen Martin äußern, da sah er ganz nahe Parelli vorübergehen – richtiger vorüberschwanken, gestützt auf den Arm eines jüngeren Geistlichen. Von einer raschen Erregung erfaßt, trat Frohwalt auf ihn zu und fragte teilnehmend:
»Bischöfliche Gnaden sind unwohl?«
Der Prälat sah auf; über sein Gesicht huschte ein müdes Lächeln, und er reichte dem jungen Deutschen die Hand:
»Es hat mich zu sehr angegriffen, Herr Doktor – aber ich habe meine Pflicht gethan und mit Nein gestimmt. Beten Sie für mich!«
Er schwankte, bleich und müde, weiter und Frohwalt sah ihm tief ergriffen nach, bis er ihm aus dem Gesichte entschwand. Martin war ihm nachgekommen und stand nun neben ihm.
»Ein Trauerspiel für uns, wie ich Dir gesagt habe, Peter: Siebzig Feige, die sich überhaupt nicht mehr getrauen, eine Meinung zu haben, zweiundsechzig Unentschiedene, die so gut wie gar nicht zählen, und achtundachtzig, die ehrlich genug sind, sich bis heute noch zu wehren. Dort neben mir hat eben einer mitgeteilt, daß am 18. Juli die feierliche Schlußabstimmung erfolgt … wieviele meinst Du werden von den achtundachtzig noch fest bleiben?«
Die beiden Männer gingen langsam weiter und Martin begleitete Frohwalt nach seiner Wohnung zu dem Kardinal Schwarzenberg. Hier war alles in Aufregung. Seine Eminenz war bereits zurückgekehrt aus der Sitzung, blaß und ernst, und hatte Weisung gegeben, sofort alles zur Abreise aus Rom bereit zu machen. Eine allgemeine Bewegung ging[359] durch Gefolge und Dienerschaft, und diese Bewegung im Hause wurde noch vermehrt durch das Kommen und Gehen von zahlreichen Kirchenfürsten, die mit dem Cardinal, der wenigstens äußerlich als Führer der Gegenpartei galt, beraten wollten, was nun noch geschehen sollte. Trotz dieser Regsamkeit aber lag es lastend, gewitterschwül auf dem Hause, und alle Gemüter waren erfüllt von Unruhe und Bangigkeit. Man hatte bis zum untersten Bedienten das Gefühl, daß etwas Unnatürliches, Gewaltsames, Verhängnisvolles geschehen sei, vor dem man aus unheimlichem, innerem Antriebe sich zur Flucht rüste.
Und an demselben sowie am nächsten Tage machten sich außer dem Cardinal noch mehr als 50 Kirchenfürsten fertig zur Abreise; es waren meist Deutsche, welche die Schlußabstimmung und die Veröffentlichung des Glaubenssatzes nicht abwarten wollten, zumal öffentlich bekannt gegeben war, daß diejenigen, welche am 18. Juli etwa noch auf ihrem Widerspruch verharren würden, vor dem heiligen Vater selbst zur Unterwerfung aufgefordert werden sollten. Und das nannte man freie Ueberzeugung und freie Meinungsäußerung!
Manch einer von den geistlichen Würdenträgern war trotzdem geneigt, in dem Widerspruch zu verharren, aber die meisten hatten angesichts der erwähnten Drohung den Mut verloren – sie fühlten sich nicht stark genug, vor dem Stellvertreter Gottes ihr non placet (Nein) zu wiederholen, und bei solcher Uneinigkeit in der Gegnerschaft war es besser, dieser letzten Versuchung auszuweichen.
In der Wohnung des Cardinals Schwarzenberg saßen eine Anzahl Kirchenfürsten noch am Abend in ernster Beratung: sie hatten ihre theologischen Beiräte hinzugezogen, und auch Peter Frohwalt nahm nebst Professor Meyer an derselben Teil. Endlich war der Wortlaut eines Schreibens an den heiligen Vater festgesetzt, in welchem die Unterzeichneten erklärten, daß sie bei ihrem »Nein« beharren müßten, da sich[360] seit dem Tage, da sie zum ersten Male als Gegner der neuen Lehre aufgetreten seien, nichts ereignet habe, was eine Aenderung ihrer Ansicht hätte herbeiführen können, im Gegenteil seien sie in dieser immer aufs neue bestärkt worden.
Mit fester Hand setzte Cardinal Schwarzenberg seinen Namen unter das Schriftstück, ihm folgte der Vertreter des bayerischen Episkopats, der Erzbischof von München-Freising.
In tiefer Nacht suchte Frohwalt sein Lager mit einem Gefühle der Beruhigung, denn er setzte sein volles Vertrauen in die Aufrichtigkeit und Festigkeit dieser Erklärung und gelobte sich selbst, bei der erkannten Wahrheit unter allen Umständen auszuharren. Und noch ein anderer Gedanke erfüllte ihn, die Freude wieder in die Heimat zurückzukommen, seine Mutter wieder zu sehen, und seiner Schwester … vielleicht auch seinem Schwager die Hand zu drücken, denn die Sehnsucht stimmte ihn weich und versöhnlich.
Der nächste Morgen war trübe und der junge Priester ging daran, seine letzten Besuche zu machen. Zunächst wollte er den Vetter Martin zu finden trachten, der diesmal wieder bei der Bildhauerwitwe wohnte, wo ehedem Quandts gehaust hatten. Er traf ihn auch zu Hause, und der Alte lächelte seltsam, als Frohwalt von der plötzlichen Abreise des Cardinals erzählte.
»Hm … ich fürchte, Pio Nono hat einen langen Arm und wird die Herren auch außerhalb Rom zu finden wissen. Das ist der Anfang vom Ende – wohl mir, daß ich kein Bischof geworden bin. Deshalb kann ich auch mit ruhigem Gewissen noch in Rom bleiben und auf eigene Faust im Widerstande verharren. Man wird zwar gegenwärtig hier im eigenen Fett geschmort, ein Vorgang, der bei meiner Leibesbeschaffenheit übrigens einige Schwierigkeiten hat, aber mein Eintrittsgeld für die Komödie habe ich einmal bezahlt, und darum will ich mir den Schlußakt auch noch ansehen. So etwas ist doch in der ganzen Weltgeschichte noch nicht dagewesen.[361] Dir wünsche ich glückliche Reise, und grüße mir die alte Heimat und alles, was drum und dran hängt.«
Der Alte begleitete ihn noch zu Parelli, von dem sich Frohwalt ebenfalls zu verabschieden gedachte, während Martin seinen »Lausitzer Windhund« aufsuchen wollte. Hans Stahl war ungemein fleißig und arbeitete mit einer Energie, welche ihm kaum jemand zugetraut hätte, für ihn war Rom in mehr als einer Hinsicht eine treffliche Schule, und Vetter Martin hatte schon bei einem früheren Besuche ihm seine Freude geäußert über die sichtbaren Fortschritte in seinem Schaffen. Heute war der junge Mann nicht daheim, und auch Parelli war nicht zu sprechen. Frohwalt erfuhr, daß er nach der gestrigen Konzilssitzung schwer erkrankt sei, und nach Aussage des Arztes sehr bedenklich am Nervenfieber darniederliege.
Traurig und still gingen die beiden Landsleute neben einander her, wieder der Wohnung des jungen Priesters zu. Endlich sagte Martin:
»Ich glaube, Dein Prälat ist ein durch und durch braver Mann – er hat den größten Mut bewiesen – schade um ihn!«
»Du fürchtest, daß er sterben wird?«
»Ich weiß nicht, ob der Tod für ihn das Schlimmste wäre. Er wäre in seiner Pflicht und in seiner ehrlichen Ueberzeugung gestorben, und dafür würde ihm nach meiner schlechten Meinung im Himmel manches gutgeschrieben werden. Wenn er mit dem Leben davonkommt, muß er sich beugen oder man wird ihn aus der Kirche ausstoßen.«
Mit großem, bestürztem Blick sah Frohwalt den Alten an:
»Du meinst, daß man …«
»Das ist so gewiß, mein lieber Peter, daß ich mich nur wundere, wenn Du anderer Ansicht sein solltest. Man wird auch Deinen Cardinal-Erzbischof ausstoßen, wenn er sich nicht duckt, ebenso gut wie den Doktor der Theologie Peter Frohwalt.«
Der junge Priester war ganz bleich geworden, aber er faßte jetzt warm die Hand des Alten:
»Weißt Du, was Martin Luther auf dem Reichstage in Worms gesagt hat? – Hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders!«
»Amen!« fügte Vetter Martin hinzu, und schweigend gingen sie weiter. – –
Am nächsten Morgen fuhr Frohwalt fort aus der ewigen Stadt. Sonnenglut lag über der weiten Campagna, und mit träumerischem Blicke schaute der junge Priester darüber hin … es kam ihm feucht in die Augen, und er wußte selbst nicht warum.
Auf einer kleinen Station, wo der Zug kurz anhielt, sah er zwei Menschen aussteigen, die sich lachend umschlangen und feldein gingen. Sie wandten sich noch einmal um nach dem Zuge, und er erkannte die Gesichter: Es war der Bauer Geatano Vergani – augenscheinlich betrunken – und sein Weib, Signora Lucia, aber ohne Sammet und Seide: das würdige Paar schien sich wiedergefunden zu haben. Frohwalt widerte das Bild an, und er blickte nach der anderen Seite. –
Am 18. Juli aber entfaltete das Papsttum den ganzen reichen Glanz, der ihm zu Gebote stand. Die Herrlichkeit des Statthalters Christi auf Erden hatte auch niemals Veranlassung gehabt, so prunkhaft in die Erscheinung zu treten als diesmal, die der göttliche Schimmer der Unfehlbarkeit zum ersten Male öffentlich die dreifache Papstkrone umleuchten sollte.
Im Petersdome flammten die Kerzen, und zogen duftende Weihrauchsäulen durch die Hallen. Im höchsten Ornate hatten sich die Bischöfe eingefunden und sich um Pius IX. geschart, der, auf seinem Thronsessel sitzend, der letzten Generalkongregation beiwohnte und die letzte Abstimmung kontrollierte.
Von den nahezu fünfhundert Bischöfen, welche zugegen[363] waren, wagte auch nicht ein einziger, gegen das neue Dogma zu stimmen. Und nun konnte der Hofstaat des Papstes in seiner ganzen Pracht ausziehen, und in feierlichster Weise unter den glanzvollsten Ceremonien wurde es der Stadt und dem Weltkreis verkündet, daß der heilige Geist den Sinn der Kirchenväter erleuchtet, und daß sie mit Einhelligkeit dem Stellvertreter Christi auf Erden die Unfehlbarkeit zuerkannt hatten.
Jauchzend drängte sich das Volk auf dem Petersplatze; der für Glanz und äußeren Schein empfängliche Sinn der Römer war bestrickt von all der Herrlichkeit, und brausend erscholl aus tausend und abertausend Kehlen das »Viva il papa!« Dazwischen dröhnten in mächtigen Salven die Kanonen der Engelsburg und die Sonne flimmerte auf der Fülle von Gold und bunter Seide, auf den prachtvollen Gewändern kirchlicher Würdenträger, auf den strahlenden Uniformen der päpstlichen Nobelgarde und auf den vor Lust leuchtenden Gesichtern der Menge.
Vetter Martin fehlte nicht. Mit einem seltsamen Lächeln sah er das großartige Schauspiel an, als mit einmal das Gesicht Hans Stahls in der Menge auftauchte. Der Alte arbeitete sich vorwärts und erreichte auch glücklich seinen jungen Freund.
»Na, Hans, was sagen Sie als Mensch, Maler und Katholik zu dem Bilde?«
»Ich? O Vetter Martin!«
Er wollte weiter sprechen, aber mit einem Male erstickten Thränen seine Stimme.
»Oho, Junge, was ist Ihnen denn? Na, seit wann sind Sie denn so nervös? – Zum Flennen ist doch die Geschichte nicht!«
»O nein – aber – er ist heute früh gestorben!« stotterte Stahl.
»Wer?«
»Parelli.«
Der Alte faßte die Hand des andern.
»Gerade heute. Das ist beinahe wunderbar. Er ist vielleicht der einzige, der als Sieger mit seiner Ueberzeugung zu Grabe gegangen ist. Gnad' ihm Gott! Kommen Sie, Hans – Sie haben recht – das kann einem das Interesse an dieser Komödie nehmen!«
Die zwei Deutschen drängten sich lautlos durch die lärmende Menge und wandten sich nach der Engelsbrücke zu. Noch donnerten die Kanonen von der Moles Hadriani, als ihnen ein deutscher Maler, welcher Hans kannte, entgegenkam, aufgeregt und mit funkelnden Augen.
»Wissen Sie das Neueste, Stahl? – Frankreich hat an Deutschland den Krieg erklärt! – Es geht los! Hurrah!«
Da fiel es wie ein Alpdruck von dem Herzen des jungen Lausitzers und so laut er konnte, schrie auch er: »Hurrah!«
Das klang wie ein Aufjauchzen aus einer vollen Seele, und er warf sich an die Brust des Alten:
»Morgen reise ich heim, Vetter Martin!«
»Und ich fahre mit! Die Eisenbahn soll auch einmal etwas an mir verdienen!« sagte der Alte. »Gott mit den deutschen Waffen!«



Die milde Sonne eines schönen Augusttages leuchtete über der kleinen Landstadt in Böhmen, in welcher Peter Frohwalts Wiege gestanden hatte. Es war vormittags und in den Gassen war es still bis auf das Rufen spielender Kinder und das verhallende Geräusch, welches da und dort aus einer Werkstatt kam. Hier merkte man es nicht, daß vor kurzem ein bedeutsames Kapitel der Weltgeschichte draußen am Rheine seinen Anfang genommen hatte, und auch das, was in Rom geschehen war, schien zunächst nicht die Gemüter zu beunruhigen.
Von der Berggasse her kam behäbig und langsam der Vetter Martin; er sah prächtig aus mit seinem gebräunten Gesicht, aus dem die klugen, hellen Augen freundlich in die Welt lachten, und auch seine »Hinterflosse« schien ihm keine Unannehmlichkeiten weiter zu bereiten, denn sein Gang war sicher, seine Haltung gerade. Man sah es ihm an, daß er sich freute, wieder in dem lieben, kleinen Neste zu sein, das auf ihn wie auf eine besondere Charakterfigur ein Recht hatte, stolz zu sein, und alles schien ihn zu interessieren, ob hier ein Haus neu angetüncht, dort ein Zaun repariert oder ein Gartenhaus errichtet war, und wo er Menschen sah, rief er kräftig seinen »Guten Morgen« über die Gasse und in die Fenster hinein und sorgte so dafür, daß man noch an diesem Vormittage im ganzen Städtchen erfahre, daß der »Vetter Martin« wieder eingetroffen sei.
Er war erst am Abend zuvor gekommen. Getreu seinem Grundsatze, nichts halb zu thun, war er mit Hans Stahl bis in dessen Heimat gefahren und hatte ihn selbst seinen Eltern zugeführt. Diese, zumal der Vater, hatten sehr erstaunte und eigentlich zürnende Augen gemacht, aber gerade darum war der Alte mitgekommen, um ihnen zu sagen, daß sie eigentlich unserm Herrgott dafür danken müßten, daß er ihnen einen so prächtigen Jungen gegeben habe. Das mit den zweitausend Mark sei freilich eine Dummheit gewesen, aber man müsse es als Lehrgeld betrachten in der Schule des Lebens, im übrigen aber habe sich Hans als Mensch wie als Künstler so tüchtig ausgewachsen, daß er – der Vetter Martin – jede weitere Bürgschaft für ihn übernähme. Außerdem aber stelle er sich jetzt in den Dienst des Vaterlandes, und dazu brauche er den Segen von Vater und Mutter … und kurz und gut, der Alte hatte die Freude, daß sie alle einander in den Armen lagen, und daß er selber noch einige Tage bleiben mußte, nachdem Hans bereits zum Heere abgegangen war.
Auch das mochte wohl mit dazu beitragen, seinem guten alten Gesichte heute jene sonnige Heiterkeit zu geben, die wie ein Widerschein des Lichtes war, das vom Himmel herab die Erde vergoldete. Jetzt machte er seine Besuche, und der erste derselben galt Frohwalts Mutter.
Das kleine Haus am Thore sah so sauber und blitzblank aus, als ob es ein Fest feiere, und Martin war auch nicht wenig verwundert, als er beim Eintritt in die Stube seinen jungen Freund Peter hier mit Mutter und Schwester beisammen fand. Auch dieser war gestern abend eingetroffen, um einige Tage in der Heimat zuzubringen, und seine Ankunft schien besonders die alte Frau, welche seit einiger Zeit kränkelte, neu zu beleben, denn sie saß mit geröteten Wangen und hellen Augen da und schaute glückselig den jungen Priester an, dessen schöne Züge die Sonne des Südens gebräunt hatte.
Auch Marie schien glücklich zu sein über den Bruder. Sie[367] war als Frau noch hübscher geworden, und man merkte ihr an, daß sie es nicht bereute, ihrem Herzen gefolgt zu sein; auch das lachende Kind in ihrem Schoße, das ohne Furcht nach dem unbekannten »Onkel« hinschaute, war eine Bürgschaft dafür.
»Na, so ist's recht!« rief Martin – »da sind wir ja alle glücklich wieder beisammen. Was? – Bei Muttern ist es doch noch schöner als in Rom, und mir kommt unser kleines Nest jetzt noch einmal so behaglich vor. Die Hitze war schon nicht mehr angenehm. Und Marie hat's natürlich schon gestern abend gewußt, daß unser Konzilsvater eingetroffen ist und hat ihren kleinen Peter heute herausgeputzt – – nein, wie so ein Kerlchen heranwächst – und so verständig sieht er drein, als ob er gleich etwas ungeheuer Vernünftiges von sich geben wollte. Also und Ihnen, Frau Gevatter, war der Besuch die beste Medizin, das merkt man Ihnen an. Na, eine Tasse Kaffee trinke ich noch mit zur Feier des Tages, wenn Ihr sie gerade übrig habt!«
Und dann saß er in dem alten, gepolsterten Stuhle, in welchem der selige Papa Frohwalt immer ausgeruht hatte, und streckte sich, nachdem er allen die Hände gereicht, mit Behagen aus.
»Da fehlen bloß noch Quandts und Hans Stahl … dann sind wir alle wieder beisammen!« sagte er.
»Quandts sitzen in Ehrenberg bei seinen Schwiegereltern und er hat mir schon seinen Gruß von dort zugehen lassen mit der Mitteilung, daß Sisto bei einem trefflichen Dresdener Meister Bildhauer untergebracht ist und sich in Elbflorenz wohl befindet!« bemerkte Frohwalt. »Er war so entschieden besser aufgehoben, als bei Monsignore Parelli.«
»Jawohl« – sagte der Alte und ein Schatten huschte über sein Gesicht – »besonders da der Monsignore gestorben ist.«
»Wie? – Also doch?« fragte der junge Priester.
»Ja, gerade am 18. Juli, dem Tage der Generalkongregation und des Schlußakts der großen Komödie in Rom.«
»Das ist eine wunderbare Fügung des Himmels!«
»Wunderbar und schön zugleich!« sprach Martin ernst, und einen Augenblick blieben alle stille. Dann begann der Alte von Hans Stahl zu erzählen, der jetzt bereits gegen den Erbfeind Deutschlands zu Felde lag, und durch eine begreifliche Ideenverbindung kam er auf Therese Haller.
Da verdüsterten sich die Gesichter der beiden Frauen, und sie sahen sich seltsam und einige Sekunden schweigend an, dann sprach Marie halblaut und gedrückt:
»Man kann nicht viel davon reden, aber es ist ein großes Leid, das sie trägt. Sie klagt nicht, gegen niemanden, ich glaube auch gegen ihren Vater nicht, aber die blassen Wangen und die müden Augen erzählen traurige Geschichten. Patienten hat Dr. Haller in der Stadt selbst nicht, und da reitet er jeden Morgen über Land und kommt oft erst in tiefer Nacht wieder. Ob er Kranke besucht, ist sehr ungewiß, aber bekannt ist, daß er viel trinkt und spielt, und er ist schon manchmal am Morgen gefunden worden … ach, man sagt's nicht gern. Und was sich im Hause mitunter abspielen mag, das erfährt niemand. Ihn selbst hat man schon heftig reden hören bis auf die Gasse, aber sie scheint zu schweigen.«
Der Alte wiegte den grauen Kopf und Frohwalt senkte die Stirne. Der erstere dachte an jenen Maitag auf dem alten Beth Chajim und an den prächtigen Jungen, der zur Entsagung gezwungen ward, und der andere war mit seinen Gedanken bei Professor Holbert und bei der Erinnerung daran, wie dieser sein einziges Kind liebte. Das Gespräch wollte gar nicht mehr recht in Fluß kommen. Da pochte es, und auf das Herein! erschien eine Frau von schlichtbürgerlichem Wesen, deren Gesicht eine besondere Erregung zeigte. Sie war eine Freundin der Hausfrau und wurde von dieser herzlich begrüßt. Als sie Peter bemerkte, schien sie einigermaßen[369] verlegen zu werden, und es war beinahe, als ob sie sich wieder entfernen wolle. Aber Martin, der hier wie daheim war, und sie gleichfalls gut kannte, rief:
»Hier ist noch Platz, Frau Franke – und Kaffee können Sie doch nicht mehr kriegen, da habe ich den letzten weggetrunken! Setzen Sie sich einmal her – wir haben lange nicht neben einander gesessen und dann schütten Sie Ihr Herz aus, denn daß Sie darum gekommen sind, sehe ich Ihnen an!«
»Ach freilich, Du lieber Gott« – sagte die Frau – »und so was ist mir auch noch gar nicht passiert! Aber ich weiß nicht, ob ich – –«
Sie hielt mit einem bezeichnenden Blicke auf Peter inne.
»Ach, vor dem geistlichen Herrn brauchen Sie keine Furcht zu haben; der weiß schon lange, daß Sie einen protestantischen Mann geheiratet haben und trotzdem eine kreuzbrave Frau und gute Katholikin sind.«
Der Frau liefen die Thränen über die Wangen und sie setzte sich nieder.
»Ach, ich muß mir's auch von der Seele herunterreden, und 's ist vielleicht gut, wenn der hochwürdige Herr das weiß und sagen kann, ob so etwas recht ist.«
Die Aufgeregte mußte erst ein wenig von den andern beruhigt werden, ehe sie fortzufahren vermochte.
»Mein Sohn wird doch in diesen Tagen heiraten. Er ist evangelisch wie der Vater und nimmt auch eine Evangelische aus Burgdorf. Daß ich als Mutter der Trauung beiwohnen will, auch wenn sie nicht in einer katholischen Kirche stattfindet, ist doch, denke ich, keine Sünde, und unser Herrgott wird's einem katholischen Mutterherzen nicht übel nehmen. Aber ich wollte doch vorher beichten und eine Beruhigung haben und so bin ich heute früh vor der Messe bei unserm Herrn Pfarrer gewesen. Der aber war sehr streng und ernst und hat mir's verboten, der Trauung beizuwohnen, und weil ich ihm gesagt habe, das könnt' ich ihm nicht versprechen,[370] 's wär' mein einziger Sohn, und wär' so brav, und ich könnt' ihm das nicht anthun und an seinem Ehrentage fehlen, da hat er mir die Sündenvergebung verweigert. Ich habe gemeint, ich muß in die Erde sinken, wie ich aus dem Beichtstuhl heraustrat und mir's war, als ob alle Leute mich ansähen, als ständ' es an meiner Stirn geschrieben, daß ich eine so große Sünderin sei, der man nicht einmal die Absolution erteilen konnte. Ich hätte doch nicht in der Kirche bleiben können, denn ich hätte ja nicht kommunizieren dürfen, und dann hätten's erst recht alle Leute gewußt, wie es mit mir steht … und da habe ich auch noch gelogen und habe ein paar Bekannten gesagt, mir wäre recht übel und ich müßte fortgehen. Freilich war's auch wieder nicht gelogen, denn übel war mir's auch. Mein Mann ist außer sich über die Sache – ach Du lieber Gott, und ich weiß nun nicht, was ich machen soll.«
Das Weib schwieg und sah beinahe ängstlich nach Peter Frohwalt hin, als ob es gerade von ihm eine Meinung erwarte. Auch Vetter Martin, dem man es ansah, daß ihn innerlich der Unmut erfaßt hatte, schaute schweigend seinen jungen Freund an. Dieser rang offenbar mit sich selbst; eine wärmere Röte huschte über sein Gesicht und nach einem Augenblicke des Schweigens sprach er ruhig und milde:
»Meine liebe Frau Franke – gehen Sie in Gottes Namen zur Trauung Ihres Sohnes, denn die Stimme des Mutterherzens ist hier auch Gottes Stimme!«
»Für das Wort danke ich Ihnen tausendmal, Hochwürden,« sagte das Weib schluchzend und lachend zugleich, in demselben Augenblicke aber fühlte Peter seine Hände von rechts und links erfaßt und warm gedrückt. Auf der einen Seite besorgte das der Vetter Martin und nickte dazu mit dem Kopfe, wie zu etwas ganz Selbstverständlichem, und von der anderen Seite war es Marie, die in überwallendem Gefühl die Hand des Bruders an ihre Lippen zog.
Dem aber ward es mit einem Male wie zu enge in der Stube; er stand auf und ging hin und her. Auch seine Schwester hatte sich erhoben und sagte:
»Ich muß nun nach Hause gehen, meine Wirtschaft wartet auf mich!«
»Ich gehe mit Dir!« sprach Frohwalt und griff nach seinem Hute.
Vetter Martin hatte gleichfalls die Absicht gehabt, sich zu entfernen; als er das Wort hörte, sah er ganz eigentümlich drein, setzte sich fester in seinem Stuhle zurück und wandte sich mit einer Frage an Frau Franke, welche wohl den Zweck haben sollte, auch diese von der Begleitung der beiden Geschwister abzuhalten. So gingen diese mit einander fort und traten auf die Gasse in den hellen Sonnenschein.
Sie waren lange nicht so nebeneinander hergeschritten und aus manchem Fenster sah man ihnen verwundert beinahe nach. Ueber ihnen selbst lag eine gewisse Befangenheit, aber durch die Seele der jungen Frau ging trotz alledem ein Glücksgefühl.
Endlich begann der Priester zu sprechen, beinahe alltägliche Dinge, und so kamen sie bis an das Haus des Uhrmachers.
Hier blieb Marie stehen, als ob sie glaubte, ihr Bruder werde sich nun von ihr verabschieden. Anstatt dessen aber sagte dieser:
»Ich möchte doch auch einmal sehen, wie Du Dich eingerichtet hast, und was Dein Mann macht.«
Eine heiße Röte flog über Mariens Wangen, und mit leuchtenden, liebeerfüllten Augen sah sie zu ihm auf; sie sprach nur das eine Wort: »Komm!« aber darin lag ihre ganze aufjauchzende Seele.
Sie traten ein in das freundliche, ungemein saubere Zimmer, und Freidank kam ihnen entgegen. Als er den Schwager sah, erschrak er beinahe, aber Marie, die ihm den[372] Kleinen, der die Händchen verlangend nach ihm ausstreckte, entgegenhielt, sagte:
»Peter wollte sehen, was Du machst!«
In dem Gesichte des Uhrmachers stand eine tiefe Bewegung geschrieben; er wagte nicht, selbst die Hand auszustrecken, aber als ihm der Priester seine Rechte reichte, ergriff er sie und hielt sie einige Augenblicke schweigend fest, Frohwalt aber bemühte sich, so unbefangen als möglich zu erscheinen; er berührte nichts von der Vergangenheit, sprach seine Freude aus über den anmutigen, friedlichen Eindruck der ganzen kleinen Häuslichkeit, ja er nahm auch das Kind auf den Arm, das sich gar nicht vor ihm zu fürchten schien, und nach kurzem Aufenthalte entfernte er sich wieder. In dem kleinen Hause aber ließ er einen Hauch der Freude zurück, dessen er sich bewußt war und der ihn selbst beglückte.
Er hatte bei diesem Besuche an Quandt und Frau Friederike denken müssen.
Wie er nun, auf der Gasse hinschreitend, gegen die Kirche herankam, begegnete ihm der Vetter Martin; er kam auf ihn zu, und drückte ihm die Hand mit den Worten:
»Du hast heute mehr als einen Menschen glücklich gemacht; Gott vergelt' Dir's!«
Dann ging der Alte ohne Aufenthalt weiter, Frohwalt aber wendete sich nach dem Pfarrhause, um dem Pfarrer Ignaz seinen Besuch zu machen, wie es schon die Höflichkeit erforderte. Er traf denselben daheim und er empfing ihn mit gemessener Freundlichkeit.
»Sie bringen uns also den neuen Glaubenssatz aus Rom mit!« sagte er nach den ersten allgemeinen Begrüßungen.
»Ich bringe es nicht, Herr Pfarrer, denn ich habe mich so wenig wie mancher Kirchenfürst überzeugen können, daß es zum Segen für die Kirche sein wird,« erwiderte Peter ernst.
»Aber es ist in der Generalkongregation vom 18. Juli einstimmig angenommen worden, und ich halte es für einen Segen, daß der Statthalter Christi auf Erden mit einer Gewalt ausgerüstet worden ist, die mit seiner Würde notwendig verbunden sein muß.«
»Darüber könnte man eben verschiedener Meinung sein, aber es wäre mir lieb, mich nicht darüber äußern zu müssen, nachdem ich in Rom nur zuviel solcher Verhandlungen habe anhören und mitmachen müssen. – Lassen Sie mich lieber fragen, wie es Ihnen geht, und wie die kirchlichen Verhältnisse hier im Orte sind.«
Der Pfarrer machte ein beinahe finsteres Gesicht.
»Mir persönlich geht es körperlich gut – als Seelsorger aber habe ich manchen Aerger, besonders durch das Ueberhandnehmen dieses ketzerischen Protestantismus. Ich beklage noch immer tief, daß Ihre Schwester so böses Beispiel gegeben hat. Seit ich hier als Pfarrer amtiere, sind ein Dutzend Familien vom Glauben abgefallen.«
»Und haben Sie niemals über die eigentliche Veranlassung dieser Erscheinung sich klar zu werden versucht?«
»Der Zug der Zeit! Aufklärung und Gottlosigkeit an allen Enden, Mangel an Sittlichkeit und wahrer Frömmigkeit …«
»Und Unduldsamkeit!« fiel Frohwalt ernst ein. »Ist Ihnen nicht klar geworden – verzeihen Sie mir meine Offenheit – daß Sie selbst in dieser Hinsicht zu weit gehen?«
»Wieso?«
»Nun, ich habe heute erst erfahren, daß Sie Frau Franke die Sündenvergebung verweigerten, weil sie der Trauung ihres Sohnes in der evangelischen Kirche beiwohnen will.«
»Ich habe gethan, was meine priesterliche Pflicht ist!«
»Und wissen Sie, was Sie damit erzielen? – Daß die Frau, welche, wie ich weiß, sehr fromm und religiös ist, sich dem evangelischen Bekenntnis zuwenden wird, dem ihr Mann[374] und ihr Sohn angehören. Und das konnte in diesem Falle vermieden werden!«
»Das muß ich bestreiten!« sagte der Pfarrer heftig.
»Nun, was meinen Sie wohl? – Sollten Sie nicht wissen, daß auch unser Kaiser, daß andere katholische regierende Fürsten ähnlichen evangelischen Gottesdiensten beiwohnten, und daß es wohl noch keinem ihrer Beichtiger eingefallen sein dürfte, ihnen darum die Sündenvergebung zu verweigern?«
»Das sind andere Verhältnisse – staatliche Gründe – politische Beziehungen – –«
»Nach welchem Grundsatze machen Sie denn einen Unterschied? Wir haben nicht Katholiken erster und zweiter Klasse; vor Gott und in der Kirche sind alle gleich, und wenn man erst anfängt, solche Unterschiede aufzustellen, ist es um die Würde der Kirche, um die innere Wahrheit ihrer Einrichtungen geschehen. Außerdem glaube ich etwas von Kirchenrecht zu verstehen und weiß, daß besonders in Gegenden mit konfessionell gemischter Bevölkerung eine duldsamere Behandlung geradezu empfohlen wird. Was an den Protestantismus hier verloren gegangen ist, haben die Vertreter der katholischen Kirche auf dem Gewissen.«
»Sie haben vordem, glaube ich, andere Anschauungen gehabt.«
»Das spricht nicht für deren Richtigkeit; ich habe in Rom gar wunderliche Erfahrungen gemacht – –«
»Das scheint mir auch,« sagte der Pfarrer mit leisem Hohn, »und es soll mich nicht wundern, Sie demnächst mit Ihren vom Glauben abgefallenen Verwandten Arm in Arm zu sehen.«
»Wenigstens hätten Sie mich heute im Hause meines Schwagers finden können,« erwiderte Frohwalt ruhig; »seit ich Protestanten kennen gelernt habe, in denen das wahre Christentum sich abspiegelt, scheue ich mich auch nicht, zu[375] glauben, daß auch ihnen der Himmel offen ist, und mit ihnen umzugehen.«
Pater Ignaz schlug entsetzt die Hände zusammen.
»Aber das ist ja Ketzerei!«
»Die ich in Rom gelernt habe.« – –
Die beiden Männer trennten sich, ohne sich die Hand zu reichen, und Frohwalt trat in den Sonnenschein hinaus mit dem Vorsatze, die Pfarrei nicht mehr zu betreten, solange der Fanatismus hier seine Heimstatt hatte.
Die Sonne desselben Augustmorgens hatte auch in die Fenster der Wohnung des Dr. Haller hineingeleuchtet. Dieselbe gab überall Zeugnis von bestem Geschmack, einfacher Vornehmheit und einer verständnisvoll waltenden Frauenhand. Die Zeit der Sprechstunde, welche auf der Thüre von neun bis zehn Uhr festgesetzt war, war gekommen, in dem Wartezimmer flimmerte der Sonnenglanz auf den polierten Stühlen und der türkischen Decke, die auf dem Tische lag, aber der Raum war leer. Patienten, welche gekommen wären, würden aber auch den jungen Arzt nicht in seinem Sprechzimmer gefunden haben, sondern noch im Schlafzimmer. Er war, wie gewöhnlich, spät in der Nacht heimgekommen und holte nun am Morgen erst das Versäumte nach, was er um so leichter thun konnte, als er schon seit längster Zeit keine Patienten mehr im Städtchen selbst fand. Seine ersten unglücklichen Kuren hatten von ihm abgeschreckt, und mit dem Mißtrauen in seine ärztliche Kunst mischte sich außerdem bei den gewöhnlichen Bürgersleuten eine Abneigung gegen das kühle, vornehm-dünkelhafte Wesen des Doktors.
So suchte er wenigstens den Schein zu wahren, als habe er eine ausgedehnte Landpraxis, und man sah ihn jeden Vormittag auf seinem Fuchs hinausreiten zum Städtchen, und wenn die Bürgersleute in der Nacht durch Hufschlag aus dem ersten oder auch schon aus dem zweiten Schlaf geweckt wurden, wußten sie, daß Dr. Haller jetzt heimkehrte. An zahlreiche[376] Patienten auf dem Lande glaubte aber trotzdem niemand, und man erzählte an den Biertischen der Spießbürger, sowie in den Weiberstuben seltsame Geschichten, wie er seine Zeit verbringe.
In der Oeffentlichkeit sprach man nicht davon, denn er gehörte zu den Vornehmsten im Städtchen, und die beste Gesellschaft verkehrte mit ihm, zumal er für einen trefflichen Unterhalter von feinen Manieren galt; besonders aber sahen die jüngeren, vermögenderen Elemente in ihm beinahe das Muster eines Lebemannes.
Am besten wußte freilich sein junges Weib, wie es mit seiner Praxis und mit seiner ganzen Lebensweise stand, und sie hatte oft genug in der heimlichen Einsamkeit ihres Zimmers bittere Thränen darüber geweint. Nach außen aber suchte sie ihren Jammer – trotzdem die blassen Wangen eine beredte Sprache redeten – zu verbergen, und es war rührend, wie sie darin dem Vogel Strauß gleich, von dem man sagt, daß er bei größter Not und Angst den Kopf unter den Flügeln verberge im Glauben, daß man ihn selbst mit seiner Sorge nicht sehe. Wohl hatte sie schon in seiner Bräutigamszeit manches bemerkt, was ihr nicht gefallen wollte, ein gewisses herrisches Wesen, einen Hang zu sinnlichen Genüssen, aber sie hatte gehofft, daß die Liebe ihm die Ecken seines Charakters abschleifen und das Unebene ausgleichen würde. Sie hatte ja so unendlich viel Vertrauen gehabt zu der Gewalt ihres Herzens und auch zu dem Herzen ihres Verlobten, und hatte diesen auch gegen den scharfsichtigen Vater verteidigt, der mitunter sehr zutreffende Bemerkungen gemacht hatte, der aber nicht seinem Kinde bei der Wahl eines Lebensgefährten in den Weg treten wollte, zumal er hoffte, daß die einfachen Verhältnisse der kleinen Landstadt und das liebe, sonnige Wesen seiner Tochter einen günstigen Einfluß üben würden.
Das alles waren getäuschte Erwartungen. Haller hatte[377] einen leidlich guten Anlauf genommen, aber die ersten Mißerfolge und das damit zusammenhängende Gefühl der Beschämung, die er zu verbergen bemüht war, dann der Müßiggang, zu welchem er sich verurteilt sah und die Gesellschaft, in welche er bei seinen ländlichen Ausflügen geriet … das alles zusammengenommen war ihm verderblich, und auch die Liebe seines Weibes konnte ihn nicht halten auf der schiefen Ebene, auf der es ihn hinunterzog.
Therese wußte, daß er keine Patienten auf dem Lande besuchte; er hatte dort keine, so wenig wie in der Stadt; sie wußte, daß er spielte und trank, und sie hatte ihn oft wacher erwartet in tiefer Nacht, und mit Entsetzen bemerkt, daß er betrunken heimkam. Wenn er sie dann sah mit ihrem bleichen, verwachten Gesicht, überfiel es ihn anfangs wie Scham, aber da sie ihm keine Vorwürfe machte, sondern ihn nur stumm mit den großen, fragenden Augen anschaute, deren Blick er nicht zu ertragen vermochte, wurde er allmählich in solchen Fällen gereizt und zornig und sprach harte Worte, so daß sie es vorzog, nicht mehr auf ihn zu harren. Aber sie lag schlaflos im Bette, und hörte ihn heimkommen und regte sich nicht, auch wenn es ihr das Herz zusammenzog; und wenn sie ihn tief atmen hörte, dann schluchzte sie hinein in ihr Kissen.
Ihr Vater hatte sie besucht, ihm fiel ihr Aussehen auf, sowie das Wesen ihres Gatten, aber sie wich seinen Fragen aus und wußte ihn trotz ihres blutenden Herzens zu beruhigen. Und doch konnte es nicht so weiter gehen! Haller war nicht unvermögend, aber da er nichts verdiente und vom Baren zu leben begann, fingen auch die Vermögensverhältnisse an, beängstigend zu werden; ihr eigenes mütterliches Erbgut war ihr sicher geschrieben, aber die Interessen davon reichten gerade für den Haushalt, und wenn Haller wie sie fürchtete, anfing Schulden zu machen, so wurde auch diese Hilfsquelle in Mitleidenschaft gezogen, und es drohte das Schlimmste.
Auch diese Nacht war er erst gegen Morgen heimgekommen, und das bleiche, junge Weib, das am Fenster saß und nach dem kleinen Garten hinausblickte, der so freundlich im Schmucke der letzten Sommerblüten unter ihr lag, wußte auch, wie er gekommen war. Sie fand darüber keine Thränen mehr, aber sie wollte sich ein Herz fassen und mit ihrem Gatten reden mit dem Aufgebot all ihrer Liebe. So saß sie regungslos und lauschte auf jedes Geräusch im anstoßenden Schlafzimmer, das ihr verkündete, daß er erwacht sei. Mehrmals war sie auf den Zehen an die Thür geschlichen und immer wieder zurückgekehrt zu ihrem Sitze. Jetzt hörte sie ein sehr vernehmliches Räuspern, und wieder sprang sie auf.
Haller war in der That erwacht. Er sah mit glanzlosen Augen umher und griff mit den Händen nach der schmerzenden Stirn. Dann warf er gähnend einen Blick hinüber nach der Uhr und sank wieder zurück. In diesem Momente trat Therese ein. Sie war allerliebst in dem hellen Morgenanzuge mit dem freundlichen Gesichte, über welchem jetzt ein feiner, rosiger Hauch, halb der Verlegenheit, halb der Verschämtheit lag, und wie Haller sie bemerkte, leuchtete sein Blick eine Sekunde lang auf.
»Ach, das ist hübsch, Schätzchen, daß Du mir einmal einen Morgengruß bringst. Komm her, gieb mir einen Kuß … Du bist ja ganz wunderhübsch.«
Er zog die Nähertretende zu sich heran, und sie ließ sich willig küssen, dann aber wehrte sie sich sanft gegen seine Umschlingung:
»Laß mich, Paul … mir ist's nicht zum Kosen und Küssen … Du weißt, daß mir das Herz schwer ist!«
»Und mir der Kopf!« lachte er wüst – »da passen wir zusammen.«
»Ich muß mit Dir sprechen – und es ist schlimm genug, daß ich keine andere Stunde dafür finden kann …« sprach das junge Weib mit beklemmtem Atem.
»Ah – eine Gardinenpredigt – –«
»Spotte nicht, Paul! Mir blutet das Herz!«
Er begann unruhig und ärgerlich zu werden.
»Ich weiß Alles, was Du sagen willst – –«
»Vielleicht doch nicht!« entgegnete sie sanft. »Du weißt, wie ich Dich lieb gehabt – –«
»Gehabt!« unterbrach er sie beinahe höhnisch.
»Und wie ich noch immer an Dir hänge, trotzdem Du mir so oft bitter weh thust. Aber keinen Vorwurf will ich Dir machen, nur eine Bitte laß mich an Dich richten! Sieh, hier gehen wir zu Grunde, Du und ich, Du an der Berufslosigkeit und ich an dem Jammer, den ich um Dich empfinde. Was nützt Beschönigen und Versteckenspielen? Wir haben hier durch einen unglücklichen Anfang den Boden unter den Füßen verloren, und der ist nicht wieder zu gewinnen. Aber wir müssen doch nicht hier leben. Was bindet uns denn an diese Scholle? Laß uns fortziehen nach einem Orte, wo uns niemand kennt – ich gehe mit Dir und wenn es nach dem ärmsten, ödesten Erdenfleckchen wäre, nur raffe Dich auf, beginne ein thätiges Leben und werde wieder so, daß Du selbst und andere Dich achten können! Es ist ja wie ein Hohn, das leere Wartezimmer, und wie ein bitterer Spott klingt es, wenn Du von Deiner Landpraxis sprichst, und dabei verlieren wir neben der Freude am Dasein, neben dem Frieden des Hauses, neben dem Glück unserer Liebe auch allgemach die Mittel zu unserem Leben. Ermanne Dich, Paul! Lieber Paul, ich bitte Dich!«
Das junge Weib stand mit erglühenden Wangen, mit gefalteten Händen vor ihm voll rührender Schönheit, aber sie rührte nur seine Sinne. In seinen Augen leuchtete es begehrlich und er streckte wieder die Hände nach ihr:
»Ach laß jetzt die Dummheiten, und komm und küsse mich!«
Therese aber wich einige Schritte zurück und flehte mit innigem, angstvollem Tone:
»Paul – gieb mir Antwort! Höre mich, Paul – – es muß ein Ende nehmen – – o Gott!«
Und nun brachen ihr die Thränen aus den Augen, und aufschluchzend schlug sie die Hände vor das Gesicht. Da erfaßte ihn der Unmut:
»Was soll mir denn das Geschwätz? – Bin ich etwa ein Lump, der sich verstecken muß? – Brauche ich denn für diese Kleinstädter überhaupt Tränkchen und Salben zu verschreiben? – Warum soll ich denn nicht meinen Neigungen leben und dem Vergnügen? – Und denkst Du denn, wenn ich irgendwo anders mich niederlasse, daß mir die Philister von hier aus nicht nachschreien werden, ich sei ein Kurpfuscher und dergleichen Dummheiten mehr? – Ich habe die Lust verloren an dieser ganzen traurigen Wissenschaft, die auch nicht eine einzige wirkliche Krankheit des inneren Menschen heilen kann. Wer das Glück hat, bei seinen Versuchen von der Natur unterstützt zu werden, dem läuft die Menge zu, und wem das Glück fehlt, der verliert seine Patienten. Hol der Teufel dies ganze Glücksspiel – da ist mir das andere mit den zweiunddreißig Blättern noch lieber … und kurz und gut, mir gefällt es hier und ich bleibe hier, und Du sei nicht dumm und weine Dir Deine hübschen Augen nicht häßlich – Du bist hier die schönste Frau im Städtchen, wer weiß, ob das anderwärts wieder der Fall wäre.«
Die Worte klangen sinnlos, frivol, und dem jungen Weibe zog sich schmerzhaft die Brust zusammen. Sie sah den Gatten mit einem unendlich traurigen Blicke an und sprach:
»Paul, Du weißt ja nicht, was Du redest. Wie magst Du Deinen Beruf, einen der segensvollsten, wenn er mit Lust und Liebe geübt wird, so mit Füßen treten? Fühlest Du denn nicht, wie solche Worte Dich und mich entwürdigen? Es kann ja Dein Ernst nicht sein, was Dir aus dem Munde[381] geht! Du kannst doch nicht daran denken, in Deinen Jahren bloß dem Müßiggang zu leben? Du willst doch nicht die Verachtung aller Guten auf Dich lenken? – Paul, ich beschwöre Dich … laß uns fortziehen von hier, wo wir den rechten Boden unter den Füßen verloren haben …«
Jetzt brauste er auf:
»Was gehen mich denn Deine Stockphilister an, die ihre Schnäbel an jedem wetzen, der nicht so lebt, wie sie selber? – Gerade ihnen zum Trotze bleibe ich und lebe ich, wie ich will, denn was aus Dir redet, das ist der dumme Klatsch, den Du hörst bei Deinen Frohwalts und Freidanks … warum gehst Du auch nicht mit Besseren um?«
»Niemand hat mir ein Wort darüber gesagt, nur mein eigenes Herz drängt mich – –«
»Ach Herz! – Herz ist das Pumpwerk im tierischen Körper – was Ihr Weiber Herz nennt!«
Er lachte roh, so daß sie erbleichend ihn ansah, und plötzlich ein seltsames Gefühl hatte. Ihr war, als sei in diesem Augenblicke ein Riß durch ihre Seele gegangen, als wäre sie aus einem Traume erwacht, in welchem sie diesen Mann geliebt hatte. Sie richtete sich hoch auf und sprach:
»Verzeih mir's Gott – aber ich fange selbst an, Dich zu verachten!«
Das Wort hatte eine seltsame Wirkung auf ihn. So lange sein Weib flehend, bittend, in ihrer demütigen, rührenden Schönheit vor ihm stand, war es ihm eine Lust, sie – die seine Liebkosungen abwehrte – zu quälen, weil er ein Uebergewicht und eine Herrschaft über sie zu haben glaubte, die ihm durch ihre Liebe gesichert schien – dies Wort aber ließ ihn erkennen, daß er seine Macht überschätzt habe, und das versetzte ihn in Erregung und Zorn. Er raffte sich auf und seine Augen und seine Hände suchten nach irgend einem Gegenstande, welchen er nach Therese schleudern könnte, während sein blasses, übernächtiges Gesicht sich dunkelrot färbte.
In diesem Augenblicke pochte es an der Thür. Die junge Frau ging hinaus und das im Nebenzimmer befindliche Dienstmädchen überbrachte ihr eine Karte mit dem Namen Ferdinand von Sorb und meldete, daß ein Herr den Herrn Doktor zu sprechen wünsche, aber nicht als Patient, wie er hinzugefügt habe.
Therese hatte den Namen wohl gehört, aber sein Träger war ihr unbekannt, und sie begab sich nach dem Salon, wohin das Mädchen denselben geführt hatte. Hier traf sie einen noch jungen Mann mit etwas verlebten Zügen, der zwar einigermaßen verlegen schien, als sie eintrat, aber doch mit weltmännischer Gewandtheit seine Entschuldigung vorbrachte. Er fragte an, ob er nicht Herrn Dr. Haller selbst sprechen könne, da seine Angelegenheit keinen Aufschub dulde.
Therese wußte nicht, warum sie vor dem Manne ein unverkennbares Unbehagen empfand, und mit einem Gefühl der Beschämung, das sie hatte bei dem Gedanken, daß Herr von Sorb das Unwahre ihrer Worte erkennen müsse, sagte sie mit erzwungener Ruhe:
»Mein Mann fühlte sich unwohl und hat das Bett noch nicht verlassen, ich werde ihn jedoch von Ihrer Anwesenheit und Ihrem Wunsche verständigen und bitte indes, sich zu gedulden!«
Sie entfernte sich und atmete jenseits der Thüre einmal tief auf, dann ging sie zagend nach dem Schlafzimmer zurück und rief die Worte hinein:
»Ein Herr von Sorb wünscht Dich dringend zu sprechen«!«
Sie hatte ihren Gatten nicht angesehen und war zurückgetreten, ohne seine Erwiderung abzuwarten, aber es war ihr doch, als höre sie ein Fluchwort und zugleich ein Geräusch, als ob er sich rasch erhebe. In der That war Haller bei dem Namen erschrocken und erbleicht. Er fuhr von seinem Lager, kleidete sich rasch und oberflächlich an, fuhr in seinen Schlafrock und begab sich nach dem Salon.
Der Wartende stand bei seinem Kommen auf und sah ihn mit einem seltsamen Lächeln an; sie reichten sich nicht die Hände, obwohl sie im übrigen bekannt genug schienen.
»Da Sie nicht zu mir kommen, muß ich mich bei Ihnen einfinden,« sagte Herr von Sorb; »ich darf Sie wohl daran erinnern, daß heute der 14. ist, und daß ich am 10. bereits eine Zahlung von Ihnen zu erwarten hatte. Ich würde Sie auch heute noch nicht wegen dieser Ehrenschuld belästigen, aber ich habe gleichfalls meine Verpflichtungen und bin als Edelmann gewohnt, denselben pünktlich nachzukommen.«
Es klang etwas Hochmütiges, Verletzendes aus den Worten, das Haller sehr wohl empfand, das ihn erbitterte und worauf er doch nicht so erwidern konnte, wie er es gern gethan hätte. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn, wie um die wirren Haare hinauszustreichen, in Wirklichkeit aber um sich den kalten Schweiß abzuwischen welcher ihm ausbrach.
»Verzeihen Sie, Herr von Sorb, wenn ich den Termin versäumt habe, ohne mich auch nur zu entschuldigen; es war gewiß ein unabsichtliches Versehen, aber gerade weil ich nicht daran gedacht, habe ich auch vergessen, die kleine Summe flüssig zu machen. Geben Sie mir noch zwei Tage Frist, ich habe das Geld nicht augenblicklich zur Hand …«
»Das ist unangenehm, sehr unangenehm, denn ich muß morgen selbst eine Zahlung leisten, wobei ich zuversichtlich auf Ihre Pünktlichkeit gerechnet hatte. Sie können doch nicht wünschen, daß ich Ihretwillen mich bloßstelle … ich bin Edelmann …«
Gerade das wiederholte Betonen dieses Moments war so verletzend für Haller; als ob der Mann vor ihm mehr Ehre besessen hätte, als er selber. Er war nichts mehr als ein gewerbsmäßiger Spieler, dessen Adelsdiplom vielleicht noch dazu recht fadenscheinig war, aber es galt um jeden Preis, die Demütigung hinunterzuschlucken.
»Nun gut – Verehrtester – ich schaffe Ihnen bis[384] morgen Mittag das Geld … solange müssen Sie durchaus noch Geduld haben – ich kann's doch nicht im Augenblick aus den Fingern saugen, und seiner Frau erzählt man auch nicht gern derartige Verlegenheiten.«
»Sei's denn … aber dann rechne ich auch bestimmt auf Zahlung, Herr Doktor. Also morgen auf Wiedersehen!«
Herr von Sorb entfernte sich mit ziemlich hochmütigem Gruße, Haller aber ballte hinter ihm die Fäuste und sah finster drein. Er hatte sich tief zurückgelegt in den Fauteuil, von dessen dunkler Sammtlehne sein bleiches Gesicht sich scharf abhob und stierte vor sich hin.
Es waren 1200 Gulden, die er an den andern verspielt hatte, und er wußte nicht, woher er sie bezahlen sollte. Er hatte sie in der That nicht vorrätig, aber er wußte auch nicht, woher er sie flüssig machen sollte. Seine eigenen Mittel waren erschöpft, denn seine Lebensweise und fast immerwährendes Unglück im Spiel hatten in kurzer Zeit große Lücken gemacht, seines Weibes Heiratsgut war festgelegt, und er fand gerade nach der heutigen Szene nicht den Mut, sich ihr zu offenbaren. Davon hielt ihn wohl auch sein finsterer Trotz ab, der einen Grundzug seines harten, dünkelvoll unbeugsamen Wesens bildete.
Und doch mußte das Geld geschafft werden. Er zermarterte seinen schmerzenden Kopf und ließ an seinem Geiste alle seine sogenannten Freunde vorübergehen, ohne daß er bei einem derselben einen Hoffnungsstrahl erkannte. Zuletzt kam er, wie fast alle Spieler, wieder zu dem zweifelhaften Hilfsmittel zurück, das Glück zu versuchen mit dem letzten Reste seines baren Geldes. Es waren noch ungefähr fünfhundert Gulden, die er zum Teil erst am Abend vorher gewonnen hatte … auf sie setzte er sein Hoffen. Mit beinahe nervöser Hast erfaßte er den Gedanken, heute nach einer benachbarten größeren Stadt zu reiten, wo Pferdemarkt abgehalten wurde; dort fanden sich Offiziere, vermögende Landedelleute,[385] Rittergutsbesitzer, reiche Roßhändler ein, und er wußte, daß dort hoch gespielt wurde. Dahin gedachte er sich zu begeben.
Er machte sich rasch fertig. Ein Frühstück nahm er nicht ein, auch von Therese verabschiedete er sich nicht. Schon nach einer halben Stunde ritt er fort auf seine »Landpraxis«, wie er die Leute glauben machen wollte. Auch sein Weib sah ihn hinter den herabgelassenen Gardinen, wie er mit dem blassen finsteren Gesichte vorübertrabte, ohne einen Blick nach den Fenstern heraufzuwerfen, etwas vornübergebeugt, als ob er über Unangenehmes sinne. Sie war es gewohnt, ihn um diese Zeit reiten zu sehen, auch war er manchmal schon gegangen, ohne ihr ein kurzes Abschiedswort zu sagen, heute aber überkam sie, nachdem der Hufschlag verhallt war, ein unsägliches Gefühl des Verlassenseins, der Bangigkeit und Schwermut, ein Gefühl eines maßlosen Jammers; sie ging in ihr kleines, freundliches Zimmer, und aufschluchzend sank sie in einen Sessel.
Haller aber ritt anfangs langsam die Straße entlang, die gegen Burgdorf aufstieg. Auf der Hochebene jedoch gab er dem Pferde den Sporn und jagte rasch dahin, seinem Ziele zu. Um die Mittagszeit kam er in der Stadt an und suchte sogleich das Hôtel auf, in welchem er seine Gesellschaft zu finden hoffte. Er hatte sich auch nicht getäuscht: Bekannte Lebemänner aus der ganzen Umgegend hatten sich in einem besonderen Zimmer zusammengefunden, und er ward von den meisten in beinahe vertraulicher Weise begrüßt.
Man war eben dabei gewesen, sich zu Tische zu setzen, als er kam, und da ihn der Hunger plagte, hatte er rasch seinen Platz eingenommen. Die trefflichen Speisen, der ausgezeichnete Wein, die ganze laute, lärmende Gesellschaft übten bald ihren Einfluß, und als erst die Champagnerkorke knallten, da ward er von ausgelassener, beinahe übertriebener Lustigkeit und stürzte Glas um Glas des prickelnden Schaumweins[386] hinab. Dabei konnte er augenscheinlich die Zeit nicht erwarten, bis man daran ging, den Tisch für das Hazardspiel herzurichten. Der Wirt kannte seine Gäste, und obwohl solches Thun gesetzlich verpönt war, leistete er demselben doch Vorschub, denn er kam dabei nicht zu kurz.
Das kleine Speisezimmer lag in dem ersten Stockwerk nach dem Garten hinaus, welcher der Familie des Wirtes ausschließlich gehörte und um diese Zeit von niemandem besucht war, und wenn man auch da und dort von dem Spielklub munkelte, der besonders zu Marktzeiten sich hier zusammenfand, so hatte doch die Behörde niemals Notiz genommen von solchen Gerüchten, und die Beteiligten konnten ganz sicher sein.
So saßen sie auch heute wieder beisammen schon am hellen Nachmittage, und das Spiel war im besten Gange. Haller beteiligte sich an demselben mit wechselndem Erfolge, ohne durchgreifenden Gewinn oder Verlust. So ging es, bis der Abend hereindämmerte. Die Lichter wurden angezündet, und da dem Weine ausgiebig zugesprochen worden war, sah man manches besonders erhitzte und glühende Antlitz und leidenschaftlich funkelnde Augen. Haller hatte nach seiner Gewohnheit stark und schwere Weine getrunken, aber seine Gesichtsfarbe war fahl; Schweiß stand ihm auf der Stirne.
Es war, als ob mit den flammenden, flackernden Lichtern sein Unstern aufgegangen wäre, und was sein Unbehagen ganz besonders steigerte, war, daß gerade jetzt auch Herr von Sorb ankam und sich mit außerordentlicher Kaltblütigkeit am Spiele beteiligte. Dem Doktor schien es dabei, als ob jener manchmal wie mit spöttischem Lächeln ihn streife, als ob er seine Gedanken erriete, und so wurde er immer erregter und zugleich immer unsicherer, so daß auch die Aufmerksamkeit der andern sich gerade ihm immer mehr zuwendete.
Jetzt setzte er sein letztes Geld auf eine Karte. Seine Augen flimmerten, seine Hände, die auf der Tischplatte lagen,[387] bebten wahrnehmbar – einige Augenblicke später hatte er verloren.
»Wer kauft mein Pferd?« fragte er mit heiserer Stimme, und einige der Umstehenden lachten, weil sie meinten, er rede im Scherz, einer aber rief:
»Was soll die Mähre kosten?«
»Sechshundert Gulden!« stieß Haller hervor.
»Ach, Thorheit, um vierhundert nehme ich sie.«
»Gegen sofortige Zahlung.«
»Topp! – Hier ist das Geld.«
Der Handel war flott gemacht worden, ohne daß die andern sich viel darum kümmerten, und gleich darauf warf Haller wieder einen Hundertguldensschein hin. Aber das Glück wollte sich nicht zwingen lassen, auch nicht um den Preis des treuen Tieres. Kalter Schweiß trat auf die Stirn des Mannes, zumal er den forschenden Blick Ferdinands von Sorb fühlte. Er vermochte den Bann dieser Augen nicht zu ertragen und rief ihm zu:
»Sehen Sie mich nicht immerfort an, Sie bringen mir Unglück!«
Der so rauh Angesprochene lächelte kühl und spöttisch und wandte Haller schweigend und wie verächtlich den Rücken. Dieser fühlte sich dadurch noch mehr verletzt und gedemütigt, aber er zwang sich zur Selbstbeherrschung, und spielte weiter. Nach einer halben Stunde war das Geld, das er für sein Pferd erhalten hatte, verschwunden.
Mit stieren Blicken starrte er um sich, trank dann mit wilder Hast sein Glas leer, und griff plötzlich nach seiner Uhr, die er samt der Kette aus der Tasche riß und auf den Tisch schleuderte. Es war eine schöne und wertvolle Ankeruhr mit doppeltem goldenen Deckel. »Wer kauft sie oder leiht mir darauf zweihundert Gulden?«
Die ganze Szene machte einen unendlich widerwärtigen Eindruck, und das empfanden selbst einige der Anwesenden,[388] trotzdem die Geister des Weines bei allen mehr oder minder ihre Wirkung übten.

»Aber wir haben doch hier keine Trödelbude oder Leihanstalt!« bemerkte endlich kalt und scharf einer der Offiziere, und nach diesem Worte wurde es unheimlich still in dem Gemache. Die Lichter schienen trüber und düsterer zu brennen, die Luft zum Ersticken schwül und schwer zu werden. Alle Augen wandten sich nach Haller und dieser fand kein Wort der Erwiderung. Er hatte das Gefühl, daß er kein Recht habe, weiter hier zu sein; aus allen Blicken schien Verachtung zu reden, und so erhob er sich, todbleich, schlotternd, mit zusammengebissenen Zähnen und feuchter Stirn. Er raffte seine Uhr an sich und schwankte schweigend hinaus. In der Nähe der Thüre hörte er wie im Traum die Stimme des Herrn von Sorb:
»Vergessen Sie nicht – morgen Mittag!«
Einige Augenblicke später stand er im Freien. Er wußte nicht, wie er die Treppe herabgekommen war, und um ihn schien alles zu schwanken, so daß er mehrmals mit den Händen hastig in die Luft griff, als suche er nach einer Stütze. Die Kühle des Abends berührte ihn angenehm, und barhäuptig, wie er war, schritt er durch die stillen nächtlichen Gassen, hinaus auf die freie Straße, und ging weiter, immer weiter. Wie lange er so gegangen war, darüber gab er sich keine Rechenschaft.
Der Himmel hatte sich mit trüben Wolken behangen, und ein feiner Regen begann niederzugehen, als er durch ein kleines Dorf kam. Das lag still und schlafend; nur ein Hund, der den späten Wanderer spürte, bellte heiser. Haller fühlte sich müde und elend, körperlich und seelisch. Aber sein Kopf war so wüst, daß er gar nichts zu denken vermochte, nur das eine Gefühl hatte er, daß er mit der Verachtung der Menschen belastet sei.
So kam er an die Schenke. Ein mattes Licht fiel durch[389] die Fenster auf die Straße, und er gedachte einzutreten, denn die Schwäche begann ihn zu überwältigen. Die niedrige Stube war voll Tabaksqualm. In der Nähe des Ofens saßen drei Bauern, jüngere Burschen, und spielten Karten; auf der Ofenbank lag der Wirt. Er erhob sich langsam bei Hallers Eintritt, und auch die Drei sahen sich nach dem barhäuptigen Herrn um, der wie eine Gespenstererscheinung auftauchte. »Bringt mir Salzbrot und ein Glas Branntwein!« sagte dieser mit heiserer Stimme, indem er sich an einem Tische niederließ, und jetzt betrachteten ihn die Burschen beinahe frech und zudringlich.
Er aß und trank mit Gier und hörte zwischendurch mit halbem Ohre die spöttischen Bemerkungen der rohen Gesellen.
»Ein Schnapsbruder im Frack!« sagte der eine.
»Das arme L…r kann vielleicht kein Bier bezahlen!« lachte der andere.
Haller griff mechanisch in die Tasche seiner Beinkleider; wo sonst sein Portemonnaie war; er fand es nicht. Offenbar hatte er es am Morgen gar nicht zu sich gesteckt und das Geld, welches er verspielt hatte, war alles gewesen, was er bei sich trug. Ein Zittern durchlief seinen Körper bei dem Gedanken, hier nicht bezahlen zu können, und krampfhaft suchte er in allen übrigen Taschen. In der Brusttasche fühlte er etwas Hartes, Kaltes – – er erschrak: Es war der Lauf des kleinen Pistols, welches er auf seinen nächtlichen Ritten als Schutzwaffe bei sich zu führen pflegte.
Er aß langsamer, und die Bissen quollen ihm im Munde besonders unter den spöttischen Blicken seiner Beobachter, die ganz zu spielen aufgehört hatten und ihre Zeche bezahlten.
Jetzt sagte der Wirt:
»Nun wird zugemacht! Wegen einem Salzbrot und Schnaps kann ich nicht die ganze Nacht durch sitzen bleiben.«
Das fuhr Haller durch die Seele. In sein Gesicht stieg eine flutende Röte der Scham, und er sagte stockend:
»Ich habe mein Geld verloren – ich muß meine Uhr als Pfand –«
Er legte den goldenen Chronometer zagend auf den Tisch. Mißtrauisch sah der Wirt bald diesen, bald ihn selbst an, dann wog er das Wertstück in der Hand und sagte verächtlich: »Talmi? – He? – Na, ich will's behalten!«
Der Unselige erhob sich. Er widersprach nicht, sondern wankte, den letzten Bissen noch im Munde, hinaus, und hörte den Wirt hinter sich sagen:
»Ein versoffener Lump!«
Das rohe Gelächter der Burschen in der Dorfgasse hallte ihm nach, dann ward es still. Am Himmel waren wieder einzelne Sterne sichtbar geworden, aber sie waren ihm keine trostvollen Lichter, und langsam, verzweiflungsvoll ging er die Straße weiter. Selbst die rüden Gesellen verlachten und verachteten ihn … er kam sich vor wie ein Geächteter, von aller Welt Ausgestoßener, und wenn er an sein Weib dachte, klang ihm ihr Wort im Ohr: »Ich fange selbst an, Dich zu verachten.« Wie konnte er sich vor ihr wieder sehen lassen nach dieser furchtbaren Nacht? Wo war sein Pferd? Wo war sein letztes Geld? Und was that er, wenn morgen Ferdinand von Sorb auf Bezahlung seiner »Ehrenschuld« bestand? Und dieser würde darauf bestehen, zumal er ihn erst heute roh beleidigt hatte.
Die Straße senkte sich nieder in einen Hohlweg. Zu beiden Seiten war finsterer Fichtenwald und ließ den milden Sternenschimmer nicht hindurch, der Weg selbst war dunkel und unheimlich, und in den Baumkronen raunte und rauschte es seltsam. Da überkam ihn die Verzweiflung, und am Straßengraben setzte er sich nieder und begann mit dem Kolben der kleinen Waffe in seiner Tasche mechanisch zu[391] spielen. Nach einer Weile scholl schriller Eulenruf durch die Nacht und wenige Augenblicke später ein kurzer, scharfer Knall – – dann war die Nacht wieder ruhig wie zuvor, und nur die Bäume raunten und rauschten weiter. – –
Und am andern Morgen lachte die Sonne wieder hell und heiter über der kleinen Landstadt. Therese hatte kein Auge geschlossen. Stunde um Stunde hatte sie gelauscht, ob sie nicht Hufschlag höre, aber die Zeit verrann, die Nacht war vorüber, und ihr Gatte kehrte nicht heim. So sehr sie an solche Sachen gewöhnt war, so überkam sie doch heute eine seltsame Angst. Sie dachte an den Auftritt von gestern, und es war ihr, als habe sie ihm ein hartes Wort zu viel gesagt, das sie bereuen müßte. Unruhevoll schritt sie durch die Zimmer, bald dieses, bald jenes Fenster öffnend, um hinauszuhorchen, aber vergebens, das Leben der kleinen Stadt hatte lange schon begonnen, die Glocken hatten zur Frühmesse gerufen, ihr Dienstmädchen hatte den Kaffeetisch bereitet, aber das junge, bleiche, müde und von Schlaflosigkeit schier erschöpfte Weib fand nicht die Ruhe, ihr Frühstück einzunehmen.
So gingen noch mehr als zwei Stunden hin. Ihre Angst steigerte sich, ihr Herz klopfte erregt … sie ertrug es nicht mehr, sich niemandem mitteilen zu können. Aber zu wem sollte sie sich wenden? Wem hätte sie die gequälte Seele aufthun und Trost von ihm erbitten können? Ihren Jammer hatte sie ja vor aller Augen gehütet, und selbst dem Priester in der Beichte hatte sie nichts gesagt von ihrem häuslichen Elend. Aber heute mußte sie sprechen, sie mußte wissen, ob sie selbst gestern ein zu hartes Wort gesprochen habe. Da dachte sie an den Kapuziner Severin. Er war ihr stets wie ein Freund entgegengekommen mit so zarter, schöner Teilnahme, und er war als Priester musterhaft. Ihm wollte sie beichten, von ihm Rat und Trost begehren in ihren furchtbaren Nöten, in der entsetzlichen Ungewißheit dieser Stunden.
Rasch kleidete sie sich an, und auf einem Umwege, der sie[392] nicht durch die Gassen führte, begab sie sich nach dem kleinen Kloster.
Pater Severin ging nahezu um dieselbe Zeit im Klostergarten hin und wider, sein Brevier in der Hand. Er sah ernst, aber nicht leidend aus, und mit ruhigen Augen schaute er empor nach dem Himmel, und hinein in das Laubgewirr der Obstbäume, aus dessen Grün da und dort der reiche Segen der Früchte blinkte. Da vernahm er einen Schritt, und da er sich umsah, bemerkte er den »Vetter Martin«, der langsam herankam. Der junge Kapuziner eilte ihm entgegen. Auch er freute sich an dem Wesen des wackern alten Herrn und begrüßte ihn freudig, nachdem er ihn lange genug nicht gesehen hatte. Dieser aber rief:
»Briefe von Hans Stahl! Eben eingetroffen! Hier schreibt er mir:
»Lieber Vetter Martin! Nur wenig, wie es im Feld und auf dem Tornister möglich ist. Habe gestern mitgekämpft in der Schlacht bei Wörth und werde diese Stunden, die ersten im Feuer, nicht vergessen. Ich fühle erst jetzt, daß ich ein anderer Kerl geworden bin – Gott helfe mir, wenn ich's jemals vergäße! Ich bin heil und gesund und kampfesfreudig wie nur einer. Wir haben gestern Preußen, Bayern, Württemberger Schulter an Schulter gefochten; es giebt kein Nord- und Süddeutschland mehr, das soll der Franzmann spüren. Gott mit Ihnen und mit uns! Tausend Grüße! Ihr Hans Stahl!«
»Was? – Ist das nicht ein infam prächtiger Bengel? Wenn ich ihn hier hätte, für die Zeilen müßt' ich ihn einmal küssen, obgleich ich für gewöhnlich keine sentimentalen Anwandlungen habe. – Aber hier ist eine Beilage mit Ihrer Adresse; viel wird auch nicht drin stehen!«
Pater Severin öffnete den Umschlag und fand in der That nur die wenigen Zeilen:
»Das Neueste von mir erfahren Sie durch Vetter Martin.[393] Wie geht es Therese? Schreiben Sie mir von ihr und wachen Sie über sie! Mit herzlichem Gruße der Ihrige.« – Dann folgte eine Adresse.
Der Kapuziner reichte seinem Begleiter schweigend das Blättchen; dieser las und sagte:
»Der arme Junge! Das kann er nicht verwinden, aber da können wir alle beide nicht helfen. Was wollen Sie ihm schreiben?«
Severin zuckte die Achseln und erwiderte wehmütig:
»Ich weiß nur, was das Volk spricht, und das möchte ich ihm nicht mitteilen; es ist nicht verbürgt, und wenn es wäre, so könnte er nicht helfen, so wenig wie ich. ›Wachen Sie über sie!‹ Ich weiß nicht, wie er sich das denkt. Ich habe ja nicht einmal ein Recht zu einem Worte des Trostes für sie, so lange sie es nicht begehrt.«
»'s ist richtig, und für ihn ist's besser, wenn er nichts Schlechtes hört. Er braucht seinen Mut und seine gesunde Frische jetzt doppelt, und wenn er denken kann, es geht ihr gut oder mindestens erträglich, so vergißt er sie zuletzt am leichtesten, und das muß doch einmal sein.«
Ein leiser Seufzer hob die Brust des Mönches … er wußte, daß man Therese nicht so leicht vergaß!
Das Gespräch aber wendete sich mehr dem großen Ereignis der Zeit, dem Kriege, zu, und die beiden wanderten langsam unter den Bäumen auf und nieder, bis die Glocke läutete.
»Ich muß zur Messe – verzeihen Sie!« sagte nun Severin, und der Alte entfernte sich mit einem Worte der Entschuldigung, während der Kapuziner langsam nach dem Kirchlein ging. Da kam ihm ein Laienbruder entgegen mit der Mitteilung, daß eine Dame ihm zu beichten wünsche. Das war nichts Außergewöhnliches und er begab sich ruhig nach dem Beichtstuhl, in welchem er erwartet wurde: Dort kniete eine junge Frau im dunklen Gewande, und als er näher kam,[394] fühlte er, wie sein Herz heftiger anfing zu schlagen und wie ein Zittern ihn erfaßte; er hatte Therese Haller erkannt.
Sie aber preßte die weiße Stirne gegen das Holzgitter, das sie von seinem Sitze trennte, und begann leise, zaghaft zu sprechen, indes er das Haupt neigte und seine Hände krampfhaft in einander schlang. Das war nicht eine Beichte, wie sie sonst üblich war mit Beobachtung der vorgeschriebenen Einleitungsworte … es war auch nicht ein Sündenbekenntnis, sondern ein banges Stammeln einer gequälten Seele, eine Geschichte von dem Märtyrertum eines stillen, verschwiegenen Frauenherzens, das in seiner Angst und in seinem Jammer sich in den Schutz der Kirche flüchtet, und nicht Sündenvergebung, sondern Trost und Rat erfleht.
Jetzt erst erkannte Severin mit sehenden Augen die ganze Größe des Elends, dem das junge Weib preisgegeben war, und sein Herz zog sich schmerzlich zusammen. Daß sie auch ihm gerade all das erzählen mußte, der sein Herzblut gegeben hätte, um sie glücklich zu machen, und der nun gar nichts thun konnte, ja kaum recht wußte, was er ihr sagen sollte. Ihm war gewiß noch elender zu Mute, als der Armen, die zu seinen Füßen kniete, und nun, nachdem sie ihm erzählt von ihrem gestrigen Versuch, den Gatten sich zurückzugewinnen und von dem letzten Worte, das sie gesprochen und das sie in ihrem feinfühligen Wesen heute beinahe als zu hart bereute, schweigend harrte, was er ihr verkünden werde.
Der Mönch atmete tiefer, er sandte ein heißes Stoßgebet zum Himmel und dann begann er zu sprechen, warm, herzlich, ruhig. Ihm war selbst, als ob aus ihm ein anderer, Höherer rede; ihm schien, als ob er noch niemals in seinem Leben so die rechten Worte gefunden habe, mit denen er sein Beichtkind hinwies auf Gottes Vaterhuld, die niemandem mehr auferlege, als er tragen könne, und wie seine Allmacht auch Mittel finden werde, ihrem Leid ein Ende zu bereiten. Für ihr Verhalten gegen ihren Gatten am gestrigen Tage[395] sprach er sie frei von aller Schuld und Verantwortung; sie habe nur gethan, was ihre Pflicht und ihr Recht war.
Es läutete bereits zum andern Male zum Meßgottesdienst, aber er unterbrach sich nicht, und als er endlich schloß, und das Zeichen des Kreuzes über Therese machte, da war ihm die Brust so frei und gehoben, er fühlte, daß er des Priesters schönste, weihevollste Pflicht getreulich erfüllt habe, und ihn überraschte und verwirrte es nicht, als sein Beichtkind sich über seine Hand neigte und sie mit heißen Lippen küßte.
Getröstet und erhoben war die junge Frau aus dem kleinen Kirchlein heimwärts gegangen, und sie fühlte sich ungleich ruhiger als vorher, trotzdem ihr Gatte noch immer nicht zurückgekehrt war.
Es kam die Mittagszeit und um dieselbe Herr von Sorb. Therese empfing ihn mit kühler Höflichkeit, und er sprach sich verwundert aus, als er hörte, daß er Dr. Haller nicht antreffe; er schien beinahe mißtrauisch gegenüber der Mitteilung zu sein und äußerte:
»Er verließ doch gestern bei Zeiten R…« – er nannte den Namen der Stadt, wo am Abend vorher gespielt worden war – »freilich zu Fuße, denn sein Pferd hatte er verkauft. Ich werde mir gestatten, morgen wieder vorzusprechen, gnädige Frau …«
Damit ging er und sinnend trat Therese an das Fenster. Ihr Gatte hatte sein Pferd verkauft – sie fühlte, was damit gesagt war; er hatte sich auch wohl geschämt, ohne Pferd am hellen Tage heimzukommen und werde die Nacht abwarten. In ihre Seele kam wieder ein Hauch von bitterer Bangigkeit … und aufs neue gingen die Stunden, bis endlich der Nachmittag die furchtbare Kunde brachte.
Ein Fuhrmann hatte am Morgen den Toten gefunden am Straßenrand, gelehnt an eine alte Fichte, wie einen Schlafenden. In der Stirn war eine kleine, runde, schwarz[396] gerandete Oeffnung, die Schußwaffe lag neben ihm. Der Fuhrmann war, von Entsetzen erfüllt, ins nächste Dorf gefahren und hatte dort Mitteilung gemacht, dann war der Gemeindevorstand mit einem zufällig anwesenden Arzte hinausgeeilt, und der letztere hatte festgestellt, daß der Erschossene der Dr. Haller aus … sei, und daß hier zweifellos ein Selbstmord vorliege. Das übliche Protokoll wurde aufgenommen, und dann die Leiche auf einen Wagen geladen, mit einer alten Decke zugedeckt und nach dem Städtchen gefahren, wo seine Frau lebte. Und hier war sie nachmittags angekommen.
Sie fuhr vorüber an dem Kapuzinerklösterchen, eben als Severin aus der Pforte trat. Der Fuhrmann grüßte ihn, und da ihn die furchtbare Nachricht drückte, erzählte er sie dem jungen Mönche. Dieser erbleichte und verlor einige Augenblicke die Fassung, dann aber dachte er des armen jungen Weibes.
»Weiß seine Frau bereits davon?« fragte er.
»Es ist ein Herr vom Gericht vorausgefahren, um sie vorzubereiten,« sagte der Mann.
»Fahren Sie ganz langsam, ich will vorausgehen!«
Damit eilte Severin so schnell er konnte von dannen, die schwere, braune Kutte aufraffend, damit sie ihn nicht hindere beim Ausschreiten. Bebenden Herzens lief er die Treppe hinan in dem freundlichen Hause, ein weinendes Dienstmädchen kam ihm entgegen, und gleich darauf stand er vor Therese.
Sie war marmorbleich, aber Thränen schien sie nicht gefunden zu haben. Die großen dunklen Augen lagen tief in dem weißen Gesichte und hatten einen seltsamen Glanz. Als sie ihren jungen Beichtiger erkannte, eilte sie ihm entgegen … sie wollte sprechen, aber sie vermochte es nicht, und wortlos, wie ein Kind an das Herz des Vaters, sank sie an seine Brust und nun erst konnte sie weinen.
Was der junge Kapuziner in diesem Augenblicke empfand,[397] war unbeschreiblich; eine Flut der mannigfaltigsten Empfindungen durchtobte ihn: Schmerz, Mitleid, Jammer, Lust und Glück waren da zugleich. Da hielt er sie an seinem Herzen und in seinem Arme; er fühlte das Beben ihres Leibes, das Wehen ihres Atems … und doch, kein Hauch der Sinnlichkeit überkam ihn, nur etwas wie das Bewußtsein eines stillen, unsäglichen, kurzen Glücks. In Sekunden durchlebte er unendlich viel. Aber hier galt es Kraft und Fassung.
»Gott sei mit Ihnen! Mehr kann ich in dieser Stunde Ihnen nicht sagen, seine Wege aber sind unerforschlich und weise. Er weiß, warum er es zuließ, daß dieses Eheband, das er durch meine Hand knüpfte, so plötzlich und gerade so zerrissen wurde. Ihm möge er gnädig sein, und Ihnen wird er seinen Frieden wieder schenken, der Ihnen so lange schon gefehlt hat. Seien Sie getrost – noch haben Sie Ihren guten Vater und Ihre Freunde!«
Er sprach ohne jedes salbungsvolle Pathos, schlicht und herzlich, und das junge Weib hob die überströmenden Augen nach ihm auf und reichte ihm die Hand.
»O, ich danke Ihnen! Mein Vater wird bestürzt sein, und es thut mir so leid um ihn … bitte, telegraphieren sie ihm in meinem Namen, wie Sie es für gut halten!«
»Gern, aber nun nehmen Sie mit Fassung auch das Härteste auf sich: Nehmen Sie den Verschiedenen noch einmal auf, denn er kommt eben an.«
Auf der Straße knirschte der Wagen: Erwachsene und Kinder, die von der Begebenheit gehört, liefen hinterher und sammelten sich vor der Thüre. Dann trugen einige Männer den in die alte Decke gehüllten Leib herauf, und Severin trat ihnen entgegen.
»Hierher!« gebot er mit halblauter Stimme, und sie schafften ihn nach dem Sprechzimmer und betteten ihn auf dem Sopha, und schaudernd sah ihm der Mönch in das bleiche Angesicht: Er war wohl der Erste, der, an seiner Seite[398] stehend, für ihn ein stilles Gebet sprach. Dann ging er zu Therese, die ihn gefaßt empfing und den Toten zu sehen wünschte. Er führte sie hinüber nach dem Gemache, aber noch einmal mußte sich hier das bleiche, zitternde Weib auf seinen Arm stützen.
»Sie dürfen nicht hier bleiben, so lange er da ist. Ich bringe Sie zu Frau Frohwalt hinüber, und für alles Weitere lassen Sie mich Sorge tragen,« sprach er, und sie folgte ihm schweigend und ohne Widerstreben.
Die furchtbare Kunde war ungemein schnell durch das Städtchen gelaufen, und es fehlte nicht an zahlreichen Beweisen der herzlichsten Teilnahme für Therese. Schon am andern Tage kam Professor Holbert und führte sein Kind wieder hinüber in ihre Wohnung. Er hatte die Ruhe und Festigkeit des echten Mannes, und seine Anwesenheit wirkte wunderbar beruhigend auf Therese. Der Tote aber lag aufgebahrt im Sprechzimmer.
Auch der Pfarrer war gekommen, um der Witwe seine Teilnahme auszudrücken und ihr die Versicherung zu geben, daß man den Selbstmord Hallers seitens der Kirche als eine That des Wahnsinns auffasse und ihm darum ein feierliches Begräbnis nicht versagen werde. Therese dankte kühl und müde für diese Versicherung: Es war ihr ja tröstlich, zu wissen, daß der Mann, an dem ihr Herz gehangen, nicht einfach, wie es sonst bei Selbstmördern Brauch und wie es vor kurzem erst bei einem armen Teufel im Städtchen geschehen war, ohne Sang und Klang eingescharrt werden sollte.
Als man am Begräbnistage den Sarg schloß, und sie zum letzten Male ihrem Gatten ins Antlitz schaute, empfand sie seltsamer Weise keinen Schmerz; ihr war, als sei auch in ihrer Seele etwas gestorben, was sie vordem für Liebe gehalten hatte. Sie folgte langsam ihrem Vater, der sie nach einem andern Gemache führte und schweigend an der Hand hielt, als von der Gasse her der eintönige Gesang des Kirchenchors[399] und die Trauermusik erklang. Dann begannen die Glocken zu läuten.
Professor Holbert und seine Tochter folgten dem Sarge nicht, und es war in mehr als einer Beziehung besser. Sie brauchten dann auch nichts zu hören von dem gärenden Unmut der Leute, die in den Gassen standen, und als der in silberverbrämtem Trauerornate herschreitende Pfarrer vorüberkam, deutlich genug sich äußerten über das »zweierlei Maß« in der Kirche.
Am andern Morgen klebten am Gotteshause wie an der Pfarrei große Zettel, die es noch schärfer geißelten, daß der vornehme Selbstmörder mit allen Ehren beerdigt worden sei und geradezu drohten, man werde ihn wieder ausscharren und nach dem Winkel werfen, wohin die Armen kämen, wenn sie unserm Herrgott vorgriffen. Pater Ignaz war darüber im höchsten Grade ärgerlich, zumal auch Frohwalt, als er in der Sakristei mit ihm am nächsten Morgen zusammentraf, ihm kühl und ruhig bemerkte:
»Frau Franke will wirklich evangelisch werden, da sie das zweifache Maß in der Kirche nicht begreift.«
An demselben Abend schrieb Pater Severin an Hans Stahl einen ausführlichen Brief, und am nächsten Morgen reiste Professor Holbert mit seiner Tochter nach Prag. Er hatte sein Kind wieder ganz für sich gewonnen.



Die Alumnen des fürsterzbischöflichen Seminars in Prag waren aus den Ferien wieder zurückgekehrt, und mit ihnen kam der Geist des Unfriedens und der Gehässigkeit wieder in das große, finstere Jesuitengebäude neben der St. Klemenskirche. Die nationalen Gegensätze hatten sich indessen noch mehr zugespitzt unter dem Einflusse der deutschen Siege. Wie eine seltsame Heldensage war die Geschichte des Tages von Sedan und der Zusammenbruch der Kaiserherrlichkeit Napoleons III. durch die Lande gegangen, und die Deutschen in Oesterreich vergaßen den seit 1866 in ihren Herzen noch immer nagenden Groll über dem stolzen Bewußtsein, daß es die Waffen der Stammesbrüder waren, welche den alten welschen Uebermut so tief demütigten und zuletzt auch Oesterreich eine Rache schafften für das Jahr 1859 und seine Verluste. Die Tschechen aber verbitterte das deutsche Kriegsglück nur noch mehr. Ihre Teilnahme wandte sich in auffälliger, gehässig herausfordernder Weise den Franzosen zu, sie suchten die Siege der Deutschen, die einmal nicht ungeschehen zu machen waren, zu verkleinern, und wo sie die Gewalt und das numerische Uebergewicht hatten, äußerte sich dies mitunter in geradezu roher Weise.
Die Bewegung welche in der ganzen Stadt, ja wohl im ganzen Böhmerlande bemerkbar war, zitterte auch im[401] Seminar zu Prag nach. In den gemeinsamen Schlafsälen der Alumnen, in den Gängen und Höfen fiel manches scharfe Wort, das von nationaler Erbitterung redete, und für die gegenseitige Anfeindung schienen alle Mittel recht.
Der Seminarist Vogel, der um seines ruhigen, ernsten Wesens willen sich ein gewisses Ansehen erworben hatte, der aber auch sein deutsches Bewußtsein niemals preisgab, sondern dasselbe gerade damals im Kreise von Stammesgenossen entschieden betonte, galt als Hauptvertreter des Deutschtums und erfreute sich deshalb des besonderen Hasses der nationalen Gegner. Er kümmerte sich darum wenig, ging ruhig und ehrlich seinen Weg weiter und vermied es in jeder Art, irgendwie die andere Partei herauszufordern. Freilich konnte auch er das Dichterwort nicht Lügen strafen:
und an einem Nachmittage sollte er die Wahrheit desselben ganz besonders empfinden. Er war mit einigen Freunden nach Gewohnheit in dem Hofe auf- und abgeschritten, und die aus Frankreich immer neu eintreffenden Siegeskunden bildeten den naheliegenden Gesprächsstoff. Es mochte sein, daß sie dabei etwas lebhafter wurden, ohne jede herausfordernde Absicht, aber tschechische Alumnen, die sie schon lange beobachteten, schienen doch eine solche zu wittern und fühlten sich zweifellos durch den nationalen Gesprächsstoff verletzt. Sie mischten sich darum – diesmal sogar in deutscher Sprache – in die Unterhaltung und suchten hämisch die deutschen Siege zu verkleinern. Vogel fühlte keine Neigung, sich in einen müßigen Streit einzulassen und bemühte sich immer wieder, der Erregung die Spitze abzubrechen und das Gespräch auf einen anderen Stoff hinüberzulenken. Dabei aber war er ganz und gar nicht glücklich. Er war mit einem etwas gewagten Sprunge auf die neue Glaubenslehre von der Unfehlbarkeit gekommen, sowie darauf, daß die Gläubigen[402] bereits zu Anfang September von den Kanzeln herab nicht bloß die Verkündigung desselben, sondern auch die Forderung der Unterwerfung unter dasselbe vorgetragen erhielten.
»Da hättet Ihr's wohl auch lieber gesehen, wenn die deutschen Bischöfe einen Sieg über den heiligen Vater davongetragen hätten, anstatt daß sie zu Kreuze gekrochen sind?« fragte höhnisch ein langer, hagerer Mensch in mangelhaftem Deutsch.
»Das sind wohl nicht die ganz richtigen Ausdrücke,« bemerkte Vogel ruhig – »und was wir lieber gesehen hätten oder nicht, darauf kommt es nicht an, aber was bisher geschehen ist, kann nicht der letzte Abschnitt sein in der Geschichte dieses Glaubenssatzes.«
»Nein, der letzte wird sein, daß man Euch hinausjagt aus dem Seminar, denn Ihr habt jetzt eure Köpfe so voll von deutschem Großmannsdünkel, daß Ihr glaubt, Ihr braucht auch dem Papste nicht mehr zu gehorchen.«
»Man hat uns ebenso wie Euch gelehrt, daß man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen!«
»Hört die deutsche Spitzfindigkeit! Als ob der Papst ein beliebiger Mensch wäre!« rief einer, und ein anderer sagte:
»Wissen Sie denn, Vogel, daß Sie eigentlich mit Ihren Ansichten gar nicht mehr in das Kleid passen, das Sie tragen?« und ein dritter fügte bei:
»Und daß Sie sich von der Kirche füttern lassen, obgleich Sie ihr den Gehorsam weigern? Sie sagen's ja offen, daß Sie die neue Glaubenslehre nicht annehmen, so seien Sie doch auch so ehrlich und verlassen Sie das Seminar!«
In Vogels Gesicht stieg eine Röte des Unwillens und des Zorns:
»Noch haben andere bessere Männer, die derselben Ansicht sind wie ich, sich nicht bewogen gefühlt, darum das geistliche Gewand abzulegen – –«
»Ah, Frohwalt!« schrie es.
»Nein, nicht nur Herr Dr. Frohwalt, auch Professor Meyer und …«
Man ließ ihn nicht weiter reden:
»Meyer hat zur Unterwerfung aufgefordert und hat sich gefügt – Frohwalt wird sich auch fügen … Der ist ein deutscher Dickkopf … Dann wird er exkommuniziert … Nicht schade um ihn …«
So klang es erregt durcheinander, und die erbitterten jungen Leute standen in einem dichten Knäuel zusammen, welchen Vogel mit einem Male durchbrach mit dem Rufe:
»Platz da! Von meiner Ehrlichkeit sollt Ihr die Probe haben, und das Recht, einen Deutschen einen Heuchler zu schimpfen, gebe ich Euch noch lange nicht!«
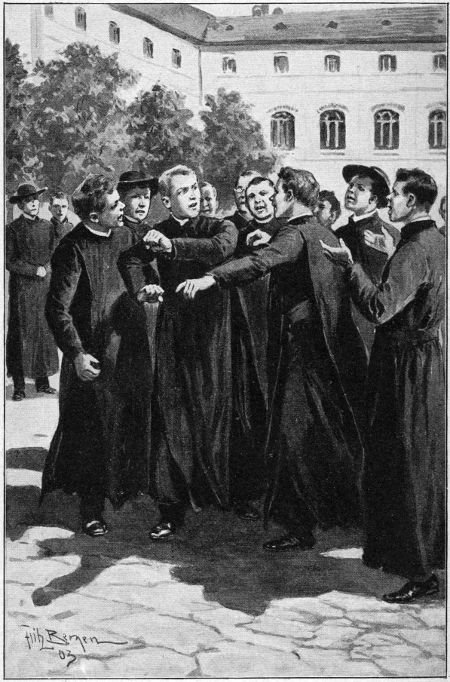
Er eilte mit großen Schritten dem Hause zu. Hinter ihm schwirrte und summte es her von Fragen und Rufen in beiden Sprachen, er kümmerte sich nicht weiter darum, sondern ging jetzt die Treppen hinan, um Frohwalt aufzusuchen.
Auch diesem schufen die Zeitverhältnisse Unruhe und Pein. Was der Vetter Martin in Rom bereits vorausgesagt hatte, daß die widerstrebenden Bischöfe sich zuletzt doch dem neuen Glaubenssatze, den sie nach bestem Wissen und Gewissen bekämpft hatten, fügen würden, war eingetroffen. Es war geradezu traurig, anzusehen, wie manch einer sich drehte und wendete, um sich wegen seiner Nachgiebigkeit vor sich und seinen Diözesanen zu entschuldigen. Nichts, auch nicht das Geringste, war geschehen, was vom Standpunkte der Wissenschaft und der Moral eine andere Auffassung der Unfehlbarkeit als vordem oder gar eine Berechtigung derselben dargeboten hätte, und doch brachte der sonst so tüchtige Rottenburger Bischof Hefele das Opfer seiner Ueberzeugung, weil es ihm zu thun war »um die Einheit der Kirche«; der Bischof von Trier verschanzte sich jetzt hinter den heiligen Geist, der in der Frage des Glaubenssatzes zuletzt die Entscheidung und damit den Sieg über menschliche Meinung und menschlichen[404] Irrtum herbeigeführt habe, der Erzbischof von München-Freising forderte von den gelehrten und frömmsten Männern, deren Rat und Ansehen ihm bis dahin alles gegolten, unbedingte Unterwerfung und drohte mit der Ausschließung aus der Kirche, der Bischof von Mainz drehte und wendete sich in geschraubten Redensarten, welche zwar die ganze innere Hilflosigkeit und Schwäche bekundeten, aber doch darauf hinausliefen, daß man sich fügen müsse, nachdem die Kirche gesprochen, und der Erzbischof von Prag, »der Führer der Opposition« hatte von allen Kanzeln herab den neuen Glaubenssatz verkünden lassen als ein von der ganzen Kirche geheiligtes Gesetz.
Durch die Seele Frohwalts ging ein bitterer, banger Zwiespalt. Sollte er einfach dem Beispiele folgen, das von den Kirchenfürsten gegeben war, und die Verantwortung dafür, daß er gegen sein Gewissen, seine Erkenntnis und seine heiligste Ueberzeugung handle, auf sie abladen? Das war wohl das Wohlfeilste und Naheliegendste, und tausend und abertausend Priester würden es thun, wie es Professor Meyer und andere bereits gethan hatten. Oder sollte er den Mut haben, die verderbliche und bedenkliche Neuerung auch jetzt noch zu verwerfen, und damit auch alle weiteren Folgen auf sich nehmen?
Bis jetzt hatte man ihm noch nicht zugemutet, sich klar und bündig darüber zu äußern; man nahm wohl seitens seiner Vorgesetzten als selbstverständlich an, daß er keinen weiteren Widerstand gegen den Glaubenssatz ausübe, und vermied es geradezu, mit ihm darüber zu sprechen, weil man ein solches Gespräch unter den obwaltenden Verhältnissen als peinlich erkennen mußte. Er konnte also mit einem entsprechenden geistigen Vorbehalt seine priesterlichen Pflichten weiter üben, so lange man nicht von selbst ihn zwang, Farbe zu bekennen und ihn nicht von denselben entband. Freilich war auch das nicht ganz ehrlich. Sein Rechtsbewußtsein verlangte, daß er,[405] zumal als Lehrer der jungen Priesterschaft, auch unumwunden keine Täuschung darüber obwalten lasse, wie er zu der neuen Lehre stehe, und wie er sie aus allen Gründen, die bisher dagegen gesprochen, auch jetzt noch verwerfe. So hatten es andere mutige Männer, wie der Stiftsprobst Döllinger und der Professor Friedrich in München, die Professoren Reinkens, Reusch u. a. gehalten, denen er seine Achtung nicht zu versagen vermochte.
Aber wenn man ihn exkommunizierte, aus der Kirche und aus seinem Amte ausstieß, – was dann? Was sollte er in der Welt beginnen? Welchen Beruf ergreifen? – Und wie würde das seine Mutter treffen! Das war ihm der bängste, schmerzlichste Gedanke. Sollte er die Ruhe und das Glück der alten Frau, das gerade in ihm und seiner Stellung begründet war, so mit einem Schlage vernichten, und noch dazu jetzt, da bei ihrer anhaltenden Kränklichkeit ihr Leben durch eine solche Thatsache gefährdet werden konnte? Langsamen Schrittes, gesenkten Hauptes ging er auf und nieder in seinem freundlichen Gemache – da pochte es, und gleich darauf trat der Alumnus Vogel ein.
»Verzeihen Sie, Herr Doktor, wenn ich in einer ernsten Angelegenheit Ihren Rat erbitte, aber ich weiß nicht, an wen ich mich mit mehr Vertrauen wenden möchte,« begann der junge Mann, sobald er den ihm angebotenen Sitz eingenommen hatte.
»Sie wissen, daß ich Ihnen gern in jeder Weise behilflich bin,« erwiderte Frohwalt schlicht und herzlich, aber nicht ohne eine leise Befangenheit, denn ihn überkam eine Ahnung dessen, was sein junger Landsmann wollte.
»Ich darf Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen, und will mich kurz fassen. Es betrifft den Glaubenssatz von der Unfehlbarkeit. Wir sind gelehrt worden, daß er den alten Satzungen der Kirche zuwider, gegen Ueberlieferung, Kirchengeschichte und Kirchenrecht sei, und das hat gegolten bis vor[406] wenigen Wochen. Seitdem ist er aber als Lehre der Kirche offen hingestellt und die Katholiken sind zur Anerkennung aufgefordert worden. Es widerstrebt jedoch meinem innersten Wesen, etwas, was bis vor kurzem als unrecht angesehen wurde, heute, ohne daß ich über die Gründe Klarheit gewinnen kann, auf einmal wie durch einen Gewaltakt als Recht hingestellt zu sehen, und so wollte ich Sie bitten, mir zu sagen, ob ich ein Unrecht begehe, wenn ich die Anerkennung verweigere?«
Frohwalt senkte seinen Blick vor dem klaren Auge des jungen Mannes, der mit dieser Frage an seine eigene Seele klopfte, und er fand nicht im Augenblicke die Antwort; eine kleine Pause trat ein, ehe er erwiderte:
»Mein junger Freund, Sie wenden sich in einer Angelegenheit an mich, die nicht nur Ihr Gemüt bewegt, sondern deren Beantwortung ich mir selbst bereits vorgelegt habe. Was jetzt in der Kirche geschieht, ist wohl geeignet, die Herzen zu verwirren, und ich weiß nicht, ob es nicht richtig wäre, erst noch eine gewisse Klärung abzuwarten, denn es will mir dünken, als ob das letzte Wort in dieser Sache noch immer nicht gesprochen sei.«
»Sie meinen, Herr Doktor, daß ein Teil der Kirchenfürsten ihre frühere Anschauung wieder aufnehmen und vertreten könnte?«
Frohwalt geriet in Verlegenheit.
»Das meine ich nicht, lieber Vogel. Die Bischöfe haben sich einhellig unterworfen, daran ist nicht zu zweifeln, aber der Widerstand, welcher von ganz hervorragenden Theologen und hochangesehenen christlichen Laien erhoben wird, ist etwas, worüber man doch nicht zur Tagesordnung ohne weiteres übergehen kann. Es ist kaum glaublich, daß man so kurzer Hand mit der Ausschließung gegen sie vorgehen wird.«
»Man wird ihnen vielleicht eine gewisse Bedenkzeit geben und dann wird man auch vor dem letzten Schritte nicht zurückschrecken.[407] Doch darum handelt es sich für mich nicht. Ich möchte wissen, wie ich mich zu verhalten habe. Ich bin ja nur ein bescheidenes Glied der Kirche, und meine Meinung und mein Thun wiegt in der Allgemeinheit nichts, aber ich möchte nicht vor mir selber erröten müssen, ich möchte mich selbst achten können, und darum bitte ich Sie inständig: Sagen Sie mir aufrichtig, ob Sie mit Ihrem christlichen Sinn, mit Ihrem Rechtsgefühl im Stande sind, sich der Forderung Roms zu unterwerfen?«
Frohwalt that einen tiefen Atemzug. Hier galt es die erste Probe seines Mutes, und er war sich klar darüber, dieselbe würde Folgen haben müssen. Hier half auch kein Versteckenspielen und Ausweichen, der Alumnus vor ihm, der ihm sein Herz seit langer Zeit erschlossen, hatte das Recht auf eine gerade, ehrliche Antwort, und so antwortete er bestimmt und fest:
»Nein!«
»Dann erlauben Sie mir nur noch eine Frage. Sie sind Priester, haben die heiligen Weihen, und da Sie auf dem Boden der letzteren stehen, auf Grund deren Sie Ihre unvertilgbare Würde erhalten haben, so dürfen Sie abwarten, was man Ihnen thun werde, und darin liegt wohl mehr Mut, als mancher vielleicht glauben mag. Ich soll diese Weihe erst erhalten mit der Verpflichtung auf die neue Glaubenslehre und es hängt von mir ab, ob ich als ein Heuchler das Priesteramt übernehme oder vorher ehrlich erkläre, daß meine katholische Ueberzeugung mich die neue Lehre nicht anerkennen läßt. Würden Sie – o verzeihen Sie mir die seltsame Frage – wenn Sie Alumnus und an meiner Stelle wären, dies Gewand noch weiter tragen?«
Frohwalt fühlte, wie eine heiße Röte ihm in die Wangen stieg; er empfand den unausgesprochenen Vorwurf, der in den Worten des Jünglings lag, die ihm geradezu den Weg zu zeigen schienen, den auch er gehen mußte, wenn er ehrlich[408] sein wollte, aber Vogel sah ihn an, bang an seinem Munde hängend, und so sprach er mit gedämpfter Stimme:
»Ich würde es nicht mehr tragen!«
»Ich danke Ihnen, Herr Doktor! Ihr Wort soll mir gelten, und ich gehe von hier zum Herrn Seminardirektor, um ihm meinen Austritt anzuzeigen. Es thut mir leid um meine guten Eltern, die gern einen Priester aus mir gemacht hätten, aber sie sind einsichtsvoll genug, um mir keinen Zwang anzuthun. Ich danke Ihnen!«
»Gehen Sie mit Gott, Vogel – Sie sind ein tüchtiger, ehrlicher Mensch, und der Himmel wird Sie nicht verlassen. Bewahren Sie mir ein freundliches Gedenken!«
»Für immer!« sagte der junge Mann herzlich, und drückte warm die ihm gebotene Hand, und wenige Augenblicke später war Frohwalt allein, erregter und unruhiger als zuvor. Gab es denn für ihn noch etwas anderes, als der Jüngling gethan? War es für ihn nicht Pflicht, gleichviel ob man ihn darum fragte oder nicht, zu erklären, daß sein Gewissen ihm nicht gestatte, sich der willkürlich geschaffenen Neuerung zu unterwerfen? War er denn nicht bereits ausgeschlossen, auch wenn es nicht geradezu ausgesprochen war? Hatte er denn noch ein Recht, die Messe zu lesen, die Sünden zu vergeben und die andern Sakramente zu spenden?
Der Seminarist war zu ihm gekommen, um vertrauensvoll sich seinen Rat zu erbitten, und er war für sich selbst so ratlos, so bange und unschlüssig. An wen sollte er sich wenden in seiner Bedrängnis? Von den angesehenen Priestern und den Lehrern der Hochschule gab es, nachdem auch Meyer sich willig gefügt hatte, keinen, der ihm nicht den Rat gegeben haben würde, sich der Forderung der Kirche zu unterwerfen … dann hatte man ja Ruhe und konnte auf Ehre und Anerkennung rechnen und sich im schlimmsten Falle, wenn das Gewissen sich rührte, beruhigen mit dem Worte der Schrift, daß Gehorsam besser sei als Opfer. Nur eine Persönlichkeit[409] tauchte noch vor seiner Seele auf, die stark und vorurteilslos genug schien, auf jede Gefahr hin den Weg der eigenen Ueberzeugung zu wandeln und auch einem andern Gleichgesinnten als Stütze dienen zu können, und diese war Professor Holbert.
Zu ihm beschloß Frohwalt am nächsten Morgen zu gehen, und dieser Gedanke gab ihm einigermaßen Ruhe und Fassung wieder. In dieser Stimmung fiel ihm seit langem einmal das »Laienbrevier« in die Hände, und er blätterte darin, ohne Bestimmtes zu suchen, und ließ seine Augen da und dort über einzelne Abschnitte schweifen, bis sie an der Stelle haften blieben:
Es war ihm, als höre er den Vetter Martin reden, so schlicht und bündig, treuherzig und gerade. Ja, der Alte, der ihm das Büchlein von Leopold Schefer einst gegeben, war wohl ein Geistesverwandter des alten Dichters und hatte damals gewußt, was er that. Er wollte mit diesem Werkchen immer unsichtbar bei Peter Frohwalt sein, ihn seinen Geist fühlen lassen, und ihm ein Mahn- und Warnwort in ernster, bewegter Stunde durch den Mund seines Lieblingspoeten zurufen. Ja, wenn er den Vetter Martin um Rat fragte, so würde der ihn vielleicht an jene Stunde in Rom erinnern, da Frohwalt mit einem gewissen Selbstbewußtsein das Wort Martin Luthers vom Wormser Reichstage gesprochen hatte. Jetzt gelte es, auch dafür einzustehen, wenn er sich nicht vor dem braven Alten schämen wollte.
Mit dem Gedanken an diesen begab er sich zur Ruhe und schlief tief und gut bis an den Morgen.
Als er am Vormittage nach der Zeltnergasse kam zu Professor Holbert, empfing ihn Therese im Trauergewande, aber freundlich und herzlich. Sie bedauerte, daß er ihren[410] Vater nicht anträfe, welcher vor einer Stunde bereits zu Seiner Eminenz dem Cardinal-Erzbischof beschieden worden sei, und bat Frohwalt, zu warten, da er bald zurückkehren müsse. Dieser blieb, und so saß er wieder einmal in dem freundlichen Salon, wo er damals mit Stahl, Severin und Haller zusammengewesen, und er mußte die Gedanken, welche ihn erfaßten, gewaltsam zurückdrängen. Mit keiner Silbe wurde des Unseligen gedacht, um so mehr aber sprach Therese von Frohwalts Mutter und Schwester, die ihr beide so lieb und wert geworden waren, sowie von seinem Schwager, dem Uhrmacher Freidank, dessen biederes, schlichtes und bescheidenes Wesen ihr in freundlicher Erinnerung war, und sie berichtete von ihm manchen kleinen Zug aus seiner Häuslichkeit und von seinem wahrhaft religiösen Wesen, daß es Frohwalt beinahe mit leiser Beschämung empfand, daß diese Fremde mehr und Besseres von seinen eigenen Verwandten wußte, als er selbst.
Indessen befand sich Holbert bei dem Cardinal Schwarzenberg. Dieser hatte den angesehenen Gelehrten mit jener vornehmen Freundlichkeit empfangen, die ihn im gesellschaftlichen Umgange auszeichnete, und das ganze Beisammensein hatte nicht den Charakter einer Audienz, sondern den eines ungezwungenen Gedankenaustausches, bei welchem der Professor bald genug die herrschende Stellung gewann.
Die beiden Männer befanden sich im Arbeitszimmer des Kirchenfürsten und saßen sich hier gegenüber. Das sonst so klare Auge des Cardinals war heute einigermaßen unruhig, und die Finger der feinen Hand spielten nervös auf der Lehne seines Sessels. Es war ihm ein gewisses Unbehagen anzumerken angesichts des bevorstehenden Gesprächs. Er hatte nach der Begrüßung sofort begonnen:
»Sie vermuten wohl, Herr Professor, weshalb ich Sie zu mir bitten ließ.«
Holbert verneigte sich stumm.
»Ich habe zu meinem aufrichtigen Bedauern vernommen, daß Sie, auch nachdem der Glaubenssatz von der Unfehlbarkeit von der Kirche allgemein angenommen worden ist, den Kampf gegen denselben fortsetzen.«
»Eminenz, ich thue nur, wozu mich meine katholische Ueberzeugung und meine Pflicht als Lehrer des Kirchenrechts nötigen.«
»Ich meine, die höchste Pflicht ist jene gegen die Kirche; sie hat entschieden, wir Katholiken haben zu gehorchen.«
»Verzeihung, Eminenz, aber es gab noch vor kurzem eine Zeit, da deutsche Kirchenfürsten ihre höchste Pflicht darin fanden, eine unbillige und gefährliche Neuerung zu bekämpfen, und seitdem hat sich nichts in der Begründung der neuen Lehre, wohl aber manches in den Anschauungen der geistlichen Oberhäupter geändert.«
Die Wangen des Cardinals röteten sich, und eine Sekunde lang senkte er den Blick vor dem durchdringend klaren Auge, welches ernst auf ihm ruhte; seine Stimme klang leiser, verschleiert, als er sagte:
»Was ich gethan habe, dafür bin ich nur Gott und Seiner Heiligkeit Rechenschaft schuldig, und da will ich's verantworten.«
»Ich meine doch auch Ihren Diözesanen, Eminenz, die in Verwirrung sind durch den Zwiespalt der früheren und der heutigen Anschauung.«
»Sie verkennen die Verhältnisse, Herr Professor. Meine und der meisten meiner Amtsbrüder Widerstand galt nicht dem neuen Glaubenssatze; als wir uns darüber äußerten und aus Klugheitsgründen die Unfehlbarkeitslehre bekämpften, traten wir nicht gegen die Kirche auf, sondern gegen eine zunächst nur als Meinung hingestellte Sache. Heute ist das anders. Der heilige Geist hat in der Schlußkongregation entschieden, die Unfehlbarkeit ist Glaubenssatz geworden, und[412] ich und andere Kirchenfürsten haben gegen die fertige Lehre kein Recht mehr anzukämpfen.«
Ein beinahe schmerzliches Lächeln umzog den Mund Holberts:
»Wollen Eure Eminenz mir huldvollst gestatten, daß ich unumwunden und ehrlich mich äußern darf?«
Der Cardinal nickte und lehnte sich schweigend tiefer in seinen Sessel; der Professor aber sprach:
»Ich will nicht daran erinnern, daß nach der Abstimmung vom 13. Juli, in welcher die Mehrheit der in Rom versammelten Kirchenfürsten den neuen Glaubenssatz bereits als solchen angenommen hatte und der Meinungsaustausch darüber zu Ende war, eine große Zahl von deutschen und österreichischen Konzilsvätern, wie die hochwürdigsten Erzbischöfe und Bischöfe Ketteler, Krementz, Hefele, Rauscher, Fürstenberg, Förster, Deinlein und auch Eure Eminenz selbst die offizielle Erklärung dem römischen Stuhl gaben, daß sie nach wie vor Gegner der Unfehlbarkeit bleiben müßten, weil sie keinen Grund zu finden vermöchten, der ihnen eine andere Ueberzeugung beibringen könnte – ich gestatte mir, nur daran zu gemahnen, daß auch nach dem 18. Juli noch ein Teil der deutschen Kirchenfürsten und Theologen den Glaubenssatz verwarfen, dessen Zustandekommen auch vom kirchenrechtlichen Standpunkte schwer anfechtbar erscheint; ich gestatte mir, daran zu erinnern, wie einer der gelehrtesten und geistvollsten Kirchenväter, der hochwürdigste Bischof von Rottenburg, wiederholt in Briefen nach dem 18. Juli den neuen Glaubenssatz verurteilt hat, wie, abgesehen von anderen auch Eure Eminenz bei allen wahrhaft gesinnungstüchtigen Katholiken den Glauben zunächst noch fortleben ließen, daß in Ihrer Diözese keine verderbliche und verwerfliche Neuerung, der Sie in innerster Seele selbst nicht zuzustimmen vermögen, verkündet werden würde. Da kam die Reihe der Enttäuschungen, und sie waren bei einzelnen Kirchenfürsten ganz besonders[413] hart. Der Erzbischof von München-Freising, welcher sich über Einzelheiten der neuen Konstitution bei seiner Rückkehr aus Rom erst von dem gelehrten Stiftspropst Döllinger unterweisen lassen mußte, hat denselben Döllinger seither aus der Kirche ausgeschlossen, und der Erzbischof von Köln vermochte den gelehrten und glaubensfesten Theologen von Bonn zu sagen: ›Wenn der Papst und ich übereinkommen, können Sie gar nichts einwenden, Sie sind dann nicht verantwortlich.‹ Das Herz blutet mir und tausend anderen, Eminenz, wenn wir die fadenscheinigen und unhaltbaren Beweggründe hören, mit denen eine Anzahl Kirchenfürsten ihre Ueberzeugung nicht bloß aufgeben, sondern die Gemüter der ihrer Obhut anvertrauten Christen zu vergewaltigen bemüht sind. Und daß Eure Eminenz nun gleichfalls der erkannten und so lange tapfer verteidigten Wahrheit untreu werden, das ist für mich das Allerbitterste. Verzeihung, wenn mir das Herz mit dem Munde durchgeht! Was aus mir redet, ist die Verehrung vor dem Kirchenfürsten, der mir allezeit besonders hoch und wert gegolten, ist die Treue und die Liebe, mit welcher ich an meinem alten katholischen Bekenntnis hänge, ist der Schmerz, der mich erfüllt, wenn ich das Beste und Edelste ins Wanken kommen sehe. Es ist soweit gekommen, daß unsere obersten Hirten nicht mehr den Mut haben, ihren eigentlichen Glauben zu bekennen, und das wird mit Notwendigkeit dazu führen, daß Religion und Kirchenherrschaft zuletzt als Eines angesehen werden. Und wenn das am grünen Holze geschieht, was soll am dürren werden? Woher soll die Priesterschaft den Mut gewinnen, fest zu bleiben in der Meinung, die man vordem ihnen als die einzig richtige hingestellt hat und die nun mit einem Male falsch sein soll? Unrecht kann nicht im Handumdrehen zum Rechte werden durch ein einfaches Machtwort. Das hieße, eine Art Faustrecht in der Kirche aufstellen, welches freilich die Schwachen erdrücken, der Sache der Kirche aber nichts nützen würde. Es ist ganz sicher, daß tausende von[414] Priestern jetzt einfach sich ducken, teils weil sie denken, daß es zwecklos ist, wenn der Einzelne, der Untergebene, Widerstand leistet, teils, weil sie nicht wissen, was aus ihnen werden soll, wenn sie eventuell vom Amte entsetzt oder aus der Kirche ausgeschlossen werden: Es ist für sie eine Brotfrage. O wenn nur eine Anzahl Bischöfe den Mut besäße, auch jetzt noch in dem berechtigten Widerstande zu verharren, es wäre nicht möglich, daß Millionen Christen einfach von Rom aus vergewaltigt würden. Und darum ist meine schlichte, ehrliche Meinung, daß auch Eure Eminenz nicht bloß das Recht hätten, gegen den neuen Glaubenssatz anzukämpfen – sondern noch etwas mehr!«
Cardinal Schwarzenberg hatte mehrmals tiefer geatmet bei den kühnen Worten, und hatte ab und zu die blitzenden Augen, das von warmer Empfindung gerötete Antlitz des Professors gestreift; jetzt, da dieser schwieg und ihn erwartungsvoll ansah, sprach er:
»Ich habe Sie ruhig sprechen lassen, und gebe Ihnen gern zu, daß Sie mir manche bittere Wahrheit gesagt haben. Ich kann mich auch nicht darauf einlassen, mit Ihnen darüber zu verhandeln, ich kann nur sagen, daß ich an die bedenklichen Folgen, welche der Glaubenssatz Ihrer Meinung nach haben soll, nicht glauben kann. Es wird in der Kirche nicht anders werden als bisher, nur das Ansehen des Stellvertreters Christi auf Erden hat gewonnen, und das kann uns nicht schaden.«
»Verzeihung, Eminenz, wenn ich auch darüber mich noch zu hören bitte. Ich habe die Erklärung der einzelnen Kapitel der neuen Konstitution bei mir. Gestatten mir Eure Eminenz gnädigst, betreff des dritten Kapitels den Passus zu zitieren.« – Holbert suchte rasch in dem Hefte, das er aus der Brusttasche zog und las:
»Wer daher sagt, der römische Papst habe lediglich das[415] Amt der Aufsicht oder Führung, nicht aber die volle und höchste Jurisdiktionsgewalt über die ganze Kirche, nicht nur in Sachen des Glaubens und der Sitten, sondern auch in Sachen, welche die Disziplin und die Regierung der über die ganze Erde verbreiteten Kirche betreffen; oder derselbe besitze nur den bedeutenderen Anteil, nicht die ganze Fülle dieser höchsten Gewalt; oder diese seine Gewalt sei keine ordentliche und unmittelbare, sei es nicht über alle und jegliche Kirchen, oder über alle und jegliche Hirten und Gläubigen: der sei im Banne!«
»Nun, Eminenz – das ist doch klar und deutlich gesprochen und heißt, der Papst hat die volle und höchste Gewalt in Glauben, Sitten, Disziplin und Kirchenverwaltung. Und diese Gewalt wird bezeichnet als eine ordinaria et immediata, eine regelmäßige und unmittelbare, und demnach ist der Papst überhaupt der alleinige Bischof der gesamten Kirche. Ich bitte Euer Eminenz, die Tragweite dieses Gedankens zu erwägen. Was ist dadurch der einzelne Bischof oder Erzbischof mehr oder anderes als eine Puppe, die am Draht bewegt wird, wenn der Papst in jeder Diözese, zu jeder Stunde, nach freiem Belieben Pfarreien und Präbenden geben und nehmen, die Diözesangrenzen nach Willkür verschieben, die Diözesanvorschriften nach Gutdünken verändern, den Bischof selbst nach Belieben des Amtes entsetzen, das Kirchenvermögen zu seinen persönlichen Zwecken verwenden und vieles andere thun kann, was die schlimmsten Folgen nach sich ziehen könnte? Wir sind so weit gekommen, daß wir nicht mehr in der Lage sein sollen, unsere Bischöfe als vom heiligen Geiste eingesetzt ansehen zu können, da sie nur noch Geschäftsträger und Vikare des Papstes sind, der ihm mißliebige Personen beseitigen und sie ohne weiteres durch gefügige und unter Umständen selbst verworfene Persönlichkeiten ersetzen kann …«
»Sie malen zu schwarz; so weit wird es nicht kommen,[416] Herr Professor,« rief der Kirchenfürst erregt, Holbert aber entgegnete:
»Vielleicht nicht so bald, aber die Kirchengeschichte weiß von sehr verschiedenartigen Stellvertretern Christi zu erzählen, und Gott gnade der Kirche, wenn unter der Herrschaft des neuen Glaubenssatzes ein Papst die dreifache Krone trüge, dem es beikäme, in unwürdiger Weise seine Gewalt zu mißbrauchen.«
»Wir leben nicht mehr im Mittelalter, Herr Professor … und darum kann ich mich noch nicht überzeugen, daß der Schaden, welcher durch gehorsame Annahme der neuen Glaubenslehre möglicherweise erwüchse, größer wäre, als jener, der bestimmt einträte, wenn wir in dem Widerstande verharrten.«
»Und welcher Schaden ist das, wenn ich mir die unterthänige Frage gestatten darf, Eminenz?«
»Daß wir zu einer Kirchenspaltung kommen müßten.«
»Und meinen Eminenz, daß eine solche überhaupt zu vermeiden ist? – Ich glaube, sie hat sich bereits vollzogen und wird bald noch schärfer zu Tage treten. Eine Anzahl geistig hervorragender und durch Festigkeit und Gläubigkeit ausgezeichneter Katholiken sind sich völlig klar darüber, daß die Kirche, welche diese constitutio dogmatica de Ecclesia Christi annimmt, nicht mehr die katholische Kirche ist, welche vor dem 18. Juli und seit 1800 Jahren bestand, und diese neue katholische Kirche ist verkörpert in dem römischen Bischof.«
»Wie« – fuhr der Kirchenfürst beinahe entsetzt auf – »demnach halten Sie uns, mich und die Bischöfe, welche den Glaubenssatz annehmen, für Abtrünnige?«
»Ich kann nicht anders, Eminenz, denn wer zu der römisch-päpstlichen Kirche sich zählt, die seit dem 18. Juli über dem Satze der Unfehlbarkeit errichtet ist, gehört nicht mehr zu der alten katholischen, apostolischen Kirche.«
Der Cardinal war aufgestanden und stand mit erbleichten Wangen vor dem kühnen Manne, der ihn fest ansah; dann sprach er mit leise bebender Stimme:
»Ich will dies Wort nicht gehört haben … ich müßte die Ausschließung über Sie verhängen – und das sollte mir leid thun.«
Holberts Wimper zuckte nicht, als er dem Kirchenfürsten ruhig entgegnete:
»Ich möchte mit dem Marquis Posa, dem Philipp II. mit seinem Ketzergericht drohte, fragen: ›Wirklich? Sollt' es das?‹ – Ich muß es Eurer Eminenz überlassen, zu thun, was Sie für Ihre Pflicht ansehen, ich aber werde unter allen Umständen den Weg meiner Ueberzeugung gehen. Was mich einzig leitet, ist die Wahrheit und das Recht, sowie das Bewußtsein, daß nicht ich es bin, der seinen Glauben gewechselt hat.«
Den Kirchenfürsten schien eine Rührung zu übermannen:
»Wenn Sie wenigstens diese Anschauungen verschließen wollten in Ihrer Seele … ich könnte …«
»Eminenz, das ist Ihr Ernst nicht, daß Sie meinen, ich könnte ein Heuchler sein! Ich werde mein Amt niederlegen an dieser Hochschule, aber ich werde mich nicht mundtot machen lassen, wo es die beste, heiligste Sache gilt. Ich bitte, mich zu entlassen, Eminenz … ich vermöchte sonst vielleicht nicht mehr meine Ruhe zu bewahren …«
Der Cardinal winkte schweigend mit der Hand, und hochaufgerichtet verließ der Professor nach ehrerbietigem Gruße das Gemach.
Als er nach seiner Wohnung zurückkehrte – er hatte sich vom Hradschin herab eines Wagens bedient – leuchtete sein Gesicht wie von innerer Freudigkeit, und so trat er Frohwalt entgegen.
»Wollen Sie mir noch Ihre Hand geben? Ich bin so gut wie aus der Kirche ausgeschlossen,« sagte er ruhig.
Der junge Priester lächelte schmerzlich, aber er streckte seine Rechte aus und drückte jene des anderen fest und herzlich.
»Ich glaube, ich habe Sie verstanden, lieber Freund!« sprach Holbert mild, »und wenn ich recht ahne, führt Sie dasselbe zu mir, was mich veranlaßt hat, vor den Cardinal zu treten. Kommen Sie! Liebes Kind, Du läßt uns wohl allein!«
Therese war bereits im Begriffe gewesen, sich zu entfernen; sie empfahl sich nun mit Herzlichkeit, und gleich darauf saßen die beiden Männer vertraulich Seite an Seite. Und nun öffnete Frohwalt dem Professor sein ganzes Herz, den Einblick in den bittern Kampf, welchen er kämpfte zwischen der Ueberzeugung und der Forderung des Gehorsams gegen die Kirche; er verhehlte ihm nicht die Zweifel, die ihm noch manchmal kamen, ob es nicht doch ein Unrecht sei, in dem Widerstande zu verharren, wenn alle Kirchenfürsten sich beugten, und verschwieg auch nicht die Besorgnis, was mit ihm werden solle, wenn er vom Amte enthoben würde.
Holbert hatte ihn ruhig aussprechen lassen. Als er schwieg, sah er ihm mit milder Freundlichkeit ins Gesicht und sprach:
»Ich habe diese Stunde kommen sehen, mein lieber Freund, weil ich seit langem Sie als eine im innersten Kerne tüchtige und wahre Natur kenne und schätze, und ich bin überzeugt, daß Sie auch ohne mich den einzig wahren Weg in diesem Wirrsal finden und ihn gehen würden. Was gegen den neuen Glaubenssatz gesprochen hat und heute noch ebenso dagegen spricht, wissen Sie so gut wie ich. Daß sich aber unsere Kirchenfürsten und Theologen jetzt schweigend unterwerfen, ist kein Beispiel, das zur Nachahmung verpflichtet. Im Gegenteil, wenn Tausende feige werden, gewinnt der Mut des Einzelnen erst an Wert und Gewicht. Der neue Glaubenssatz stellt die ausschließliche, rücksichtslose Herrschaft des Papstes über Fürsten und Völker als eine Lehre der Kirche hin. Das kann kein wahrer Katholik, das kann überhaupt[419] kein vernünftig und klar Denkender annehmen; wer aber diese Lehre vom 18. Juli als Glaubenssatz äußerlich annimmt und glaubt, oder gar, wer sie bloß äußerlich annimmt und nicht glaubt, der verliert allen Anspruch auf die Achtung der andern, sowie auf seine Selbstachtung, denn er belügt sich und andere und ist ein Heuchler. So und nicht anders liegt die Sache, und zum Heuchler haben Sie so wenig das Zeug wie ich. Darum thun Sie mit Gott, was Ihrem Wesen entspricht, und geben Sie der Wahrheit die Ehre; was daraus folgt, das überlassen Sie dem Himmel, er wird Sie nicht verlassen, und bei Ihren Kenntnissen und Ihrem Charakter brauchen Sie nicht um die Zukunft bange zu sein.«
Wiederum drückte Frohwalt warm und innig die Hand des andern:
»Ich danke Ihnen herzlich, Herr Professor, für Ihre Anerkennung meines Wesens und Charakters, sowie für Ihre freundschaftlichen Worte überhaupt, und Sie dürfen überzeugt sein, daß ich nichts thun werde, dessen ich mich vor Ihnen und vor mir selbst schämen müßte. Doch gestatten Sie mir noch eine Frage: Wie denken Sie sich das Verhältnis derer, die um ihres Mutes willen hinausgedrängt werden aus der Kirche?«
»Eigentlich ist diese Ausdrucksweise nicht die richtige, denn wir, Sie, ich und alle, die gleich uns denken, stehen auf dem alten, einzig wahren Boden der Kirche, aus welcher alle jene sich selbst ausscheiden, die diese Neuerung als Glaubenssatz annehmen. Und was mit uns geschehen soll? Nun, wir Katholiken, welche der alten, staatsrechtlich anerkannten katholischen Kirche treu bleiben und an ihr festhalten wollen, wir werden den Staat angehen um seinen Schutz und ihn um Durchführung unserer im Staatsgesetze von selbst anerkannten kirchlichen Rechte bitten. Es handelt sich doch nur darum, daß wir alten, echten Katholiken in unserem Rechte als katholische Priester und Laien nach der anerkannten Lehre[420] und Verfassung der Katholiken leben zu können, geschützt werden; wir bitten um Schutz für die treuen Priester und Pfarrer, die etwa durch Vergewaltigung vertrieben worden sind, um Schutz für die Vornahme aller kirchlichen Akte durch dieselben, welche nach den Gesetzen staatliche Bedeutung haben, wie Taufe, Eheschließung und Begräbnis, um Schutz für öffentliche Religionsübung und für Religionsunterricht in der bisher anerkannten Lehre und Aehnliches.«
»Und meinen Sie, daß der Staat darauf eingehen werde?«
»Das glaube ich allerdings, und wenn man auch in Oesterreich, dem Hort des Katholizismus, anfänglich vielleicht Schwierigkeiten macht, so wird in Deutschland der Boden für das gute Alte zuerst bereitet werden und Oesterreich wird sich demselben nicht verschließen können.«
»Das würde allerdings zu einer Spaltung führen von Alt- und Neukatholizismus.«
»Das wird es, und die Spaltung ist bereits da, aber die Altkatholiken haben sich dabei keine Schuld zuzumessen.«
Frohwalt erhob sich, ihn erfaßte mit einmal eine ganz besondere Erregung.
»Wie es sich auch gestalte, ich bleibe bei der erkannten Wahrheit, und werde nicht länger auch nur den Schein fortleben lassen, als beugte ich mich, oder als fehlte mir der Mut des wahren Bekenntnisses. Ihrer Freundschaft halte ich mich versichert.«
»Für alle Zeit!« entgegnete Holbert warm, und mit einem innigen Händedrucke schieden die beiden Männer.
Raschen Schrittes ging Frohwalt durch die Straßen nach dem Seminar; er wollte auch keine Stunde länger zögern und unmittelbar zu seinem Vorgesetzten, dem Direktor, sich begeben, um ihm mitzuteilen, daß es gegen sein Gewissen sei, die neue Lehre anzuerkennen und daß er bereit sei, alle Folgen dafür zu tragen.
Der Himmel aber schien ihm seinen Schritt noch erleichtern zu wollen. Um seine Mutter war ihm dabei besonders leid gewesen, die für das, was in ihm vorging, kein volles Verständnis würde gewinnen können, und die, nur nach dem Aeußern urteilend, entsetzt sein würde über eine Ausschließung des Sohnes aus der nach ihrer schlichten Meinung alleinseligmachenden römischen Kirchengemeinschaft. Das sollte der alten Frau erspart bleiben.
Unter dem Thore des Klementinums traf Frohwalt den Telegraphenboten, der ihm eine Depesche überreichte. Er erbrach sie hastig und las:
»Mutter sehr schwach. Komme so bald als möglich.
Marie.«
Da war keine Zeit, um anderes zu erörtern. Wohl ging er zu dem Seminardirektor, aber nur, um sich einen sofortigen Urlaub zu erbitten, und noch in der Nacht traf er in der Heimat ein.
Das kleine Städtchen lag in tiefem Schlummer, als er mit dem Wagen, den er auf der letzten Station gemietet, durch das alte Thor einfuhr. Mit der Hast der geängstigten Liebe betrat er das freundliche, traute Heimatshaus, zu dessen Fenster ein müder Lichtglanz herausschimmerte. Er wußte, daß hinter jenen Scheiben die alte Frau lag, die sich wohl zum letzten Male nach dem Sohne sehnte, und sein Herz schlug ihm mit einmal bange zum Zerspringen.
Er trat ein in das Stübchen und der Lichtschimmer zeigte ihm die Gesichter des Uhrmachers Freidank und seines Weibes, die rechts und links von dem Lager saßen, auf welchem Frau Frohwalt gebettet lag.
Die Kranke hatte in all ihrer Schwäche, in ihrer halben Bewußtlosigkeit doch das Rollen des Wagens gehört und versucht, sich zu erheben. Aber die Schwäche übermannte sie, so daß sie mit geschlossenen Augen zurücksank, doch mit einem[422] Lächeln um die Lippen. Mit wenigen Schritten war der Sohn bei dem Bette der Mutter, und als ob die alte Frau seine Nähe empfände, öffnete sie wieder die Augen, weit und hell, und mit aufflackernder Kraft streckte sie dem Geliebten die Arme entgegen.
Frohwalt aber war niedergesunken an dem Lager und küßte die welken, erkaltenden Hände, die seinen Lippen sich entzogen und sich jetzt liebkosend auf sein Haupt legten; der Mund der Kranken aber flüsterte:
»Gott sei Dank, daß ich Dich noch einmal sehe, nun sterb' ich gerne. Du wirst für mich beten … ich geh' zum Vater. Und habe Marie lieb und Freidank – – er hat mich gepflegt und gehalten, wie ein Sohn … hörst Du, Peter?«
Dieser erhob sich und streckte seinem Schwager die Arme entgegen, und stumm hielten sich die beiden Männer umschlungen, während Marie mit gefalteten Händen daneben stand, und die Augen der Kranken seltsam hell glänzten.
»Dank – Dank!« flüsterte sie wieder – »und nun … schlafen … schlafen …«
Frohwalt zog rasch auch die Schwester an sein Herz und küßte sie, dann aber setzte er sich an das Lager der alten Frau und hielt ihre Rechte in seinen Händen. Und so schlief sie, ruhig lächelnd, immer leiser atmend, bis mit dem Morgen kein Hauch mehr die Brust hob.
Als der erste Sonnenstrahl in das Fenster fiel, standen die Drei um die bleiche Tote her, und Frohwalt betete in ergreifender Andacht ein Vaterunser, und machte über die erkaltende Stirn das Zeichen des Kreuzes. Die geweihte Kerze, welche angezündet worden war, wurde verlöscht, und der junge Priester sagte:
»Freidank, meine Mutter hat Sie ihren Sohn genannt … lassen Sie uns Brüder sein! Ich weiß, daß ich an Ihnen gut zu machen habe!«
Der Uhrmacher hatte trotz der Trauer Augen, die von[423] innerem Glück leuchteten; er zog sein leise weinendes Weib an sich und sprach:
»Nein, wir sind nicht schlechte Menschen, und unser Glaube ist auch ein guter Glaube. Darum hoffen wir auch, einmal mit der lieben Toten hier wieder vereint zu werden.«
»Das hoffe ich auch,« sagte Frohwalt … »und nun laßt uns eine Stunde ruhen, ehe wir an die weiteren Pflichten für unsere Mutter denken.«
Drei Tage später wurde die alte Frau begraben unter allgemeiner Beteiligung des ganzen Städtchens. Hinter dem Sarge ging zwischen dem Gatten und dem Bruder Marie, unmittelbar hinter dem Pfarrer, P. Ignaz; der sah finster und mürrisch drein, und als auf dem Gottesacker auch die beiden evangelischen Leidtragenden ihre Schaufel Erde hinunterrollen ließen auf den schlichten Sarg, war es ihm, als müsse er sie hinwegstoßen von der geweihten Scholle, aber das ernste Auge Frohwalts, das auf ihm ruhte, schien ihn einzuschüchtern: Seit der Beerdigung Hallers hatte er nicht mehr völlig jene Energie des Fanatismus wie vorher.
Als am andern Morgen die Seelenmessen für die Verstorbene in der Kirche gelesen wurden, hatten sich auf Veranlassung Frohwalts Freidank und seine Frau wiederum eingefunden, aber sie saßen ganz hinten im Halbdunkel unter dem Chor und beteten dort still für das Seelenheil der Heimgegangenen, während Frohwalt selbst mit dem trauerfarbigen Meßgewande angethan am Hauptaltare den Totengottesdienst abhielt. Die Messe, welche er für seine Mutter darbrachte, sollte die letzte sein, welche er in seinem Leben las, und andachtsvoller hatte er wohl auch selten eine celebriert.

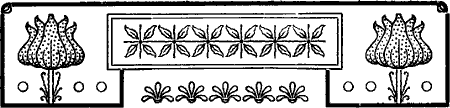

Der Frühling des Jahres 1871 war gekommen. Das gewaltige Kriegsspiel in Frankreich hatte sein Ende erreicht, mit Blut und Eisen war die Einigung Deutschlands vollzogen und die alte deutsche Kaiserherrlichkeit wieder erneut worden. Ueber tausend Heldengräbern im welschen Land grünte und blühte es, und wie ein echter Friedensherold zog der junge Lenz durch die Welt. Auch in dem kleinen Landstädtchen in Böhmen hatte er seinen Einzug gehalten und hatte die Bäume in Vetter Martins Garten mit seiner ganzen blühenden Herrlichkeit überschüttet. Darunter ging an einem besonders schönen Morgen der alte Herr langsam auf und nieder: Der Wandertrieb begann sich zu regen, und in seiner Seele erwog er verschiedene Pläne. Er wäre schon lange wieder in der weiten Welt gewesen, wenn er nicht um Peter Frohwalts willen daheim geblieben wäre, denn der junge Priester befand sich seit etwa einem halben Jahre in seiner Vaterstadt, ohne zunächst noch recht zu wissen, was mit ihm werden solle.
Er hatte seinem Gewissen gemäß sogleich nach dem Tode der Mutter seine Stellung zu dem neuen Glaubenssatze ehrlich vor seinen Vorgesetzten ausgesprochen, die sich vergebens bemühten, ihn zur Annahme der päpstlichen Unfehlbarkeit zu bewegen. Aber man liebte und achtete ihn, vielleicht gerade wegen seines ehrlichen Mutes, und wollte nicht mit den strengsten Mitteln gegen ihn vorgehen; darum ward er von[425] seinem Amte und allen priesterlichen Thätigkeiten vorübergehend enthoben und ihm eine halbjährige Frist gestellt, nach deren Ablauf er erklären solle, ob er geneigt sei, sich zu unterwerfen.
Er wollte und konnte diese Zeit nicht in Prag zubringen, und darum begab er sich nach der Heimat, obwohl er wußte, daß der kleinliche Klatsch sich hier an seine Fersen heften und daß vor allem Pater Ignaz alles thun werde, um ihn in hämischer Weise zu verunglimpfen. Aber das konnte ihn nicht anfechten. Er hatte die beste Stütze in seinem guten Bewußtsein und eine andere, ganz vortreffliche in dem Vetter Martin, der sein ganzes Verhalten in dieser Sache völlig billigte und in gewisser Hinsicht sein Schicksal teilte, indem er sich auch als einen nicht mehr vollgültigen Katholiken ansah.
Frohwalt wohnte im elterlichen Hause, welches von Freidank, der sein kleines Besitztum veräußert hatte, bezogen worden war, und da er auf jeden Anteil an dem väterlichen Erbe zu gunsten der Schwester und ihres Kindes verzichtet hatte, ließen es sich der Uhrmacher und seine Frau nicht nehmen, ihn auf das Beste zu pflegen. So hatte er jetzt im täglichen Verkehr erst recht Gelegenheit, das ganze prächtige Wesen, die schlichte Herzlichkeit und die wahre Frömmigkeit seines Schwagers zu beobachten. Er sah unmittelbar vor sich das Bild einer anmutigen, auf den schönsten sittlichen Grundlagen ruhenden Häuslichkeit, mit welcher ganz sichtbarlich auch der Segen des Himmels verbunden war, und manchmal wollte es ihn beinahe wie Rührung erfassen, wenn er Zeuge war, wie Freidank und seine Schwester ihre Kinder beten lehrten für Tote und Lebende, auch für ihn. Er dachte beinahe nicht mehr daran, daß es »Evangelische« waren, mit denen er verkehrte, und aus deren kleinem Kreise ein schöner Hauch echten und duldsamen Christentums ihn anwehte: Nein, eine kirchliche Lehre, die solche Bekenner hat, ist keine ketzerische, gotteslästerliche und verwerfliche – das war ihm völlig klar.
Um nicht müßig zu sein, beschäftigte er sich mit historischen und kirchenrechtlichen Studien, schrieb Aufsätze für verschiedene angesehene Blätter, die ihn mit ihrem Honorar in den Stand setzten, nicht ausschließlich auf Kosten seiner Verwandten leben zu müssen, und beschäftigte sich auch mit einem größeren wissenschaftlichen Werke, wobei ihn Professor Holbert in eingehender Weise unterstützte.
Außer mit Vetter Martin verkehrte er sonst beinahe mit niemandem im Städtchen; bei diesem aber sprach er täglich ein Stündchen wenigstens vor, oder machte wohl auch ab und zu mit ihm einen längeren Spaziergang, und eben, weil der Alte wußte, was er ihm just in dieser Zeit war, hatte er sein Wandergelüst unterdrückt, aber Sonnenschein und Frühlingsluft, blauer Himmel und blühende Welt hatten es ihm einmal angethan und zogen ihn auch jetzt mächtiger als je ins Weite.
Er schob seine Mütze bald hinaus aus der Stirn, bald zog er sie herein, er schnupperte förmlich nach der Lenzesluft und that immer wieder ein paar tiefere Atemzüge … da kam der Postbote an den Gartenzaun und reichte einen Brief herüber. Martin kannte die Handschrift, er war von Heinrich Quandt; darum öffnete er das Schreiben mit Behagen und las:
»Alter lieber Freund und Wandervogel!
Da sitze ich seit drei Tagen mit Fritzel auf meinem oder richtiger meiner Schwiegereltern Landsitz und freue mich an den Blüten, die der Frühling auch im Erzgebirge hervorgelockt hat, und denke mir, wie hübsch es wäre, Sie einmal hier zu haben auf ein paar Tage. Wir haben seit Rom nicht viel von einander gehört, was aber nur beweist, daß wir alle beide saumselige Briefschreiber sind, im Herzen aber haben wir uns wohl gegenseitig bewahrt – ich wenigstens kann für meinen Teil gutstehen. Wandern müssen Sie doch einmal, wie ich Sie kenne, also holen Sie frisch den Knotenstock und brechen Sie auf ins Erzgebirge – so schön und blütenfrisch bekommen[427] sie's nicht gleich wieder zu sehen. Und noch eins will ich Ihnen verraten. Hier in Ehrenberg sitzt noch einer, der vor Sehnsucht nach seinem Vetter Martin bald vergeht – das ist unser Held Stahl. Der arme Teufel hat – wie Ihnen ja bekannt ist – stark Blut lassen müssen fürs liebe Vaterland. Der linke Arm liegt noch in der Binde und wird wohl nicht mehr ganz dienstfähig werden, aber die Wunde, die ihm der Granatsplitter in die Brust gerissen, ist ziemlich verheilt. Er selbst ist frisch und lebenslustig, und Fritzel, die den lieben Genesenden eigentlich hierhergelockt hat, geht mit ihm um, daß ich auf den Ritter des eisernen Kreuzes – und das ist er, wie Sie vielleicht nicht wissen – mitunter beinahe eifersüchtig werde. Was macht Herr Dr. Frohwalt? – – Es waren doch hübsche Tage damals in Rom, und wir sähen ihn fürs Leben gern auch einmal wieder. Wenn Sie Gelegenheit haben, grüßen Sie ihn herzlich von uns. Aber daß ich das Interessanteste nicht vergesse. Denken Sie, der gute Prälat Parelli hat in seinem Testamente seine Schützlinge nicht vergessen, und vor kurzem ist auf dem gehörigen Instanzenwege die Nachricht eingetroffen, daß er sowohl Sisto als Hans Stahl je 5000 Scudi (d. i. 20000 Mark) zu ihrer künstlerischen Ausbildung übermacht habe. Er hat doch ein prächtiges Herz gehabt, dieser Monsignore. Hans Stahls weitere Künstlerlaufbahn war zwar durch die Versöhnung mit seinem Vater gesichert, aber der Zuschuß ist nicht zu verachten, und für Sisto soll er nutzbringend bis zu seiner Großjährigkeit angelegt werden. Der Junge macht übrigens wunderbare Fortschritte und seinen »Eltern« große Freude. Am liebsten hätte ihn Fritzel mit hier – aber das geht denn doch nicht, er darf nicht so ohne weiteres von seinem Meister weggenommen werden, bei dem er trefflich aufgehoben ist. Der Junge spricht schon ein ganz niedliches Deutsch und wächst sich, wie ich mit Vaterstolz sagen kann, zu einem wahren Adonis aus, der den Dresdner Mädchen einmal gefährlich werden kann.
Doch genug! Vieles andere mündlich – denn daß Sie nun doch kommen, zumal ich Stahl gern mit Ihnen überraschen möchte, nehme ich fest und entschieden an. Also auf Wiedersehen in Ehrenberg! Mit vielen Grüßen auch von Fritzel
Ihr alter treuer Freund Heinrich Quandt.«
Vetter Martin faltete das Schreiben zusammen, und war nahe daran, einen Luftsprung zu machen vor Vergnügen, aber er besann sich, daß er sich in seinem Garten so gut wie auf offener Straße befand, und so begnügte er sich, ein paar Mal kräftig mit den Fingern zu schnalzen und im Weitergehen vor sich hinzubrummen:
»Was doch für wunderliche Dinge auf diesem Planeten passieren! Mein Lausitzer Windhund ist Ritter geworden und erbt ein kleines Vermögen – das ist doch, um sich in die Nase zu beißen! Aber es steckt was in dem Bengel, das habe ich herausgewittert, schon als ich ihn zum ersten Male unter den toten Juden sein Süßholz raspeln hörte … Freilich! Wo werde ich denn jetzt hier sitzen bleiben können, das ist ja der reine Fingerzeig des Himmels, und – holla, das ist das Allerhübscheste! – Peter Frohwalt muß mit, das ist meine Ueberraschung! – Ach, Hochwürden, das trifft sich gut, Nachrichten von Hans Stahl!«
Martin hatte am Gartenzaune den Kapuzinerpater Severin vorübergehen sehen und eilte ihm entgegen. Der junge Mönch war auf den Anruf einen Augenblick stehen geblieben, und über sein bleiches Gesicht flog eine Röte, als er durch das Gitterthor eintrat, und dem alten Herrn die Hand reichte.
Severin war seit dem Tode Hallers einigermaßen verändert; sein Aussehen war leidend, und die Blässe seiner Wangen trat im Gegensatze zu dem dunklen Vollbart noch mehr hervor, aber was ihn eigentlich quälte, wußte niemand. Seit er Therese in jener furchtbaren Stunde einen Augenblick an seinem Herzen und in seinem Arme gefühlt hatte, hatte[429] es ihn wie mit verzehrender Unruhe erfaßt, und schwerer als zuvor rang er mit sich selbst. Sie war ja wieder frei und er ahnte es, Hans Stahl werde sie nun gewinnen, er aber werde zum zweiten Male entsagen, und diesmal fiel es ihm schwerer als zuvor.
Der Alte teilte ihm mit, was er von dem jungen Lausitzer erfahren hatte, und daß er ihn aufsuchen wolle, und um die Lippen des Kapuziners flog ein beinahe schmerzliches Lächeln, da er sagte:
»Ich gönne ihm alles von Herzen! Er hat viel Glück: Ruhm, Reichtum und … was er sonst wünscht, wird ihm zuteil – –«
»Ach, Sie meinen Therese Haller?«
»Ich habe ihm seinerzeit geschrieben von dem Vorkommnis, durch welches Frau Haller Witwe wurde, und seine Antwort aus dem Feldlager war wie ein Aufjubeln des Herzens, voll Siegeszuversicht.«
»Na, wenn's der Himmel fügt, so sollte mich auch das für ihn freuen!« sprach Martin, und wehmütig nickte der junge Mönch dazu.
Dann gingen die zwei unter den blühenden Bäumen hin und redeten noch Manches von dem gemeinsamen Freunde. Eben als Severin sich entfernen wollte, kam aber Peter Frohwalt. Auch er war blaß, aber seine Augen schauten hell und friedlich drein; er trug nicht mehr das Abzeichen des Priesters, das Collare, um den Hals.
»So ist's recht,« – rief ihm Martin entgegen – »Drei gehören zu einem Kollegium! Auch für Dich habe ich interessante Nachrichten.«
»Und Sie gehen, da ich komme,« sagte Frohwalt freundlich zu dem Kapuziner – »ich kann es Ihnen nicht übel nehmen!«
Das Gesicht Severins rötete sich plötzlich:
»Womit habe ich es verdient, Herr Doktor, daß Sie[430] mir so wehe thun? – Ich weiß, was Sie sagen wollen mit Ihren Worten, aber glauben Sie mir, daß ich mich nicht scheue, mit Ihnen zu verkehren, sondern im Gegenteil, es stets und unter allen Umständen für eine Ehre ansehe, in Ihrer Gesellschaft sein zu dürfen.«
»Auch wenn vielleicht nächsten Sonntag schon der Herr Pfarrer triumphierend von der Kanzel herab meine Ausschließung aus der Kirche verkündet?«
»Oho,« – rief Martin – »so weit ist's doch noch nicht?«
»Doch,« entgegnete Frohwalt mit ruhigem Lächeln; »die Bedenkzeit, die man mir für meine mögliche Unterwerfung gelassen hat, ist vorüber, und ich habe eben jetzt meine bündige Erklärung nach Prag abgehen lassen, daß ich meine ehrliche Ueberzeugung unter keinen Umständen opfern werde, folge daraus was immer!«
»Das ist brav, und darauf darfst Du stolz sein, Peter!« sagte der Alte, indem er kraftvoll dem jungen Manne die Hand drückte, zur selben Zeit aber hatte auch Severin diesem seine Rechte schweigend entgegengestreckt, und verwundert sah ihn Frohwalt an.
»Ja, ja, Herr Doktor, 's ist mir voller Ernst,« sagte der Kapuziner wehmütig – »ich verstehe Sie völlig, aber verachten Sie mich nicht, wenn ich Ihrem Wege nicht folgen kann. Sie sind ein Adler, ich bin ein Sperling. Für Ihren reichen Geist steht die ganze Welt offen, ich würde zu Grunde gehen, wenn ich nicht den schützenden Hafen meines Klösterchens hätte. Was sollte ich anfangen, wenn ich heute die braune Kutte auszöge … und meine Eltern würden verzweifeln. Darum schweige ich und bücke mich, und überlasse es denen, die mein Gewissen belasten, auch einen Teil der Verantwortung dafür vor Gott zu tragen. Mein Gelübde heischt Gehorsam. Mir geht es wie Tausenden, denen der Mut fehlt, weil sie weder das Vermögen, noch die geistigen Mittel haben, sich gegen die Gewalt auflehnen zu können. Seien Sie mir[431] darum nicht böse. Und grüßen Sie Hans Stahl, Herr Martin … er soll recht glücklich werden.«
Zusammengebeugt, wie ein gebrochener, müder Mensch, wankte Severin fort, und die beiden anderen sahen ihm bewegt nach.
»Wie sagt der Bruder Martin im »Götz«?« sprach endlich der Alte; – »das Gefühl seines Standes frißt ihm das Herz.«
»Schade um ihn!« fügte Frohwalt mit aufrichtigem Bedauern bei.
Jetzt kam Martin auf seinen Brief zu sprechen; er ließ seinen Besuch ihn lesen und dann bemerkte er:
»Und weißt Du was, Peter? – Wir schnüren unsere Ränzchen und marschieren morgen ab, geradewegs nach dem Erzgebirge und nach dem kleinen Neste, wo unsere römischen Freunde hausen. Hier wird der Boden ohnedies etwas zu warm für Dich werden, denn daß Dein Freund, der Pfarrer, kräftig einheizt, darauf kannst Du Dich verlassen. Und mir juckt's schon den ganzen Morgen so wunderlich in den Beinen, daß ich zum Städtele hinaus muß. Also, wie steht's?«
»Ja, lieber Vetter Martin – zum Reisen gehört Geld!«
»Das haben wir, Peter! Wie Fürsten reisen wir freilich nicht, eher wie fahrende Schüler, aber das ist bei weitem vergnüglicher, und dafür reichen meine Mittel für uns zwei sehr anständig aus. Was mein ist, ist Dein – das ist doch selbstverständlich, und wenn Du etwa eine andere Meinung haben solltest, so sprich sie aus, aber sei gewärtig, daß ich Dich aus meinem Besitztum hinauswerfe und jede diplomatische Beziehung zu Dir abbreche.«
»Na gut denn, Du lieber, närrischer Vetter, – und wenn Du mit einem aus der Kirche Ausgeschlossenen Dich zu wandern getraust ohne Schaden für Dein leibliches und seelisches Heil – –«
»Sei ganz ruhig, Peter! Wenn sie erst Dich herausthun[432] aus der Kirche, dann können sie's bei mir gleich mit besorgen, das will ich dem Pfarrer schriftlich geben!«
»Dann ist's recht – und morgen wandern wir!«
»Topp!« sagte Martin, und unbekümmert um die Nähe der Gasse schleuderte er seine Mütze hoch in die Luft und fing sie wieder auf, wie ein lustiger Knabe, für den die Ferien gekommen sind, und dem eine goldene Zeit der Freiheit winkt.
Am andern Morgen, als es noch recht ruhig war im Städtchen, aber der Sonnenschein schon über den Dächern lachte, zogen zwei Wanderer zum Thore hinaus. Ueber ihnen blauer, weitgespannter Himmel, unter ihnen noch leicht wogender Nebel, und wo sie gingen zur Rechten und zur Linken ein Glänzen und Blühen. Die ersten Lerchen stiegen empor in die klare Luft, aufjauchzend aus den kleinen Kehlen, und die Brust wurde den Beiden weit und froh, so daß sie erst eine gute Weile schweigend ausschritten, bis der Vetter Martin endlich sein Morgenpfeifchen anzündete, und nun begann er redselig zu werden.
So kamen sie nach Burgdorf, der kleinen evangelischen Gemeinde, und das Dorf machte im Morgensonnenschein einen besonders freundlichen und sauberen Eindruck.
Als sie an dem schlichten Pfarrhause vorüberkamen, in dessen Gärtchen alles in frischer Blüte stand, sahen sie den jungen Pfarrer mit seiner Frau unter den Bäumen auf- und abschreiten, und Frohwalt erinnerte sich, dies Bild beinahe ebenso schon früher einmal gesehen zu haben. Heute sah er es mit ganz anderen Augen an: Jeder Hauch von Feindseligkeit war aus seinem Herzen geschwunden, und er empfand eine Art reiner Freude über diese trauliche Häuslichkeit und das freundliche Familienleben in diesem Pfarrhause, das einen bedeutsamen Gegensatz bildete zu dem, was er in Nedamitz und im Hause Parellis in Rom geschaut und erlebt hatte.
Die beiden Wanderer ließen sich Zeit und genossen die[433] Schönheit der Gotteswelt in vollen Zügen; Frohwalt aber schien es, als ob er nie so sonnige, herrliche Tage durchlebt hätte, und wenn er gemeint hatte, Vetter Martin völlig zu kennen, so wurde er jetzt eines Besseren belehrt, denn auf der Wanderung gab sich der Alte erst ganz, wie er war, mit seinem reichsten Humor, mit seinen wärmsten Empfindungen, mit seinem für alles Schöne und Gute empfänglichen Herzen.
An einem Nachmittage trafen sie in Ehrenberg ein. Es war ein ziemlich großes, freundliches Dorf, das im Grün der Gärten in einer Thalsenkung des Erzgebirges lag. Die Gegend schien fruchtbar und wohlhabend, und war von landschaftlicher Anmut, wie der Gegensatz von grünem, flußdurchzogenem Thal und in der Ferne blauenden Bergen sie bot. Der Kirchturm war für unsere Freunde der Wegweiser; in der Nähe des Gotteshauses mußte sich die Pfarrei befinden.
Und sie täuschten sich nicht. Ein Knabe hatte sie zurecht gewiesen, und so traten sie in den Pfarrhof ein. Hier aber war es Frohwalt, als sehe er jenes freundliche Bild in Wirklichkeit vor sich, das er in Quandts Skizzenmappe in Rom erblickt hatte. Da war das alte, breitbehäbige Haus von Holzfachwerk mit dem der Straße zugewendeten stattlichen Giebel und davor die prächtige Linde mit ihrem jungen, noch nicht voll entfalteten Grün. Auf der Holzbank darunter aber saßen der Maler mit seiner Frau und mit Hans Stahl, und sahen zu, wie ein prächtiges, blühendes Mädchen die lustig um sie flatternden Tauben fütterte.
Aber die Ankömmlinge hatten nicht Zeit, das Bild zu genießen mit seiner traulichen Anmut, denn Heinrich Quandt hatte sie schon gesehen.

»Der Vetter Martin! Doktor Frohwalt!« klang es, dann eilten die drei von der Linde her, und das junge Mädchen ließ die goldenen Weizenkörner achtlos aus der Schürze rollen unter das durch die Bewegung der Menschen gleichfalls erregtere Taubenvolk. Dann fanden sich die Hände im warmen,[434] herzlichen Drucke, und Begrüßungsworte gingen hin und her. Martin aber hielt seinen »Lausitzer Windhund« wie einen Sohn in den Armen, und sah ihm dann ins Gesicht:
»Potz Respekt, Herr Ritter des eisernen Kreuzes!« sagte er bewegt, und dann fuhr er liebkosend über den verwundeten Arm, der noch in der Binde lag.
Heinrich Quandt aber rief dem Mädchen zu: »Trudchen, komm her!« und zum Giebelfenster hinauf: »Papa, Mama, unsere römischen Freunde sind gekommen!«
Aus dem Fenster beugte sich einen Augenblick ein von weißschimmernden Haaren umwobenes freundliches Gesicht und eine sonore Stimme rief:
»Herzlich willkommen! Wir sind gleich bei Euch!«
Und eben als die andern in den breiten Flur des Hauses traten, kamen der Pfarrer und seine Frau die Treppe herab, ein hübsches, altes Paar, dem Herzlichkeit und Gutmütigkeit aus den Augen leuchtete. Sie begrüßten die beiden Ankömmlinge wie gute alte Bekannte, und schon nach kurzem saßen sie alle beisammen um den Tisch bei einem Imbiß, der von der geistlichen Hausfrau schnell bereitet worden war, und bei Gesprächen, die alte Erinnerungen rasch neu belebten, aber auch bekundeten, wie man im Pfarrhause zu Ehrenberg über alles, was mit Rom zusammenhing, auf das Beste unterrichtet war und für alles die herzlichste Teilnahme zeigte.
Als Martin und Frohwalt am Abend das Gasthaus aufsuchen wollten, geriet der Pfarrer geradezu in liebenswürdigen Zorn:
»Davon kann doch nicht die Rede sein! Wir haben übergenug Platz in unserem alten, gemütlichen Hause und Gott Lob auch genug zu essen und zu trinken, und wir denken doch nicht, daß Sie hierhergekommen sind, um uns zu kränken? Was müßten denn meine Kirchkinder sagen, wenn ihr Pfarrer seine Freunde im Gasthofe unterbringen ließe!«
Da fiel sein Blick auf Frohwalt, und er wurde ernster, als er beifügte:
»Herr Doktor, Ihnen darf ich keinen, auch keinen freundschaftlichen Zwang anthun …«
»Ich verstehe Sie, Herr Pfarrer,« sagte der Angeredete lächelnd, – »aber ich bin in der Lage, ganz meinem Herzen folgen zu dürfen, und wenn Sie mich hier behalten, bleibe ich!«
Herzlich drückte der alte evangelische Geistliche ihm die Hand, und die Sache war abgemacht.
Frohwalt war erstaunt über den feinen Takt, welcher in diesem Hause herrschte, und wie man alles vermied, was nach der Meinung der Pfarrerfamilie ihm peinlich oder unangenehm sein könnte. Auch von dem Konzil war nicht die Rede, ebensowenig wie von seiner Stellung zu der Unfehlbarkeit, bis er am zweitnächsten Tage selbst darauf, wie auch auf seine Ausschließung aus der römischen Kirche zu sprechen kam.
Der Pfarrer schien überrascht, aber, so nahe auch nun der Gedanke oder die Versuchung dazu gewesen wäre, er hielt sich völlig fern von einem Anpreisen seines eigenen Glaubens und sprach mit Frohwalt über die Sache in einer nicht bloß völlig objektiven, sondern auch sehr klaren und kenntnisvollen Weise, so daß dieser vor dem Wissen wie vor dem Charakter des alten Herrn immer neue Achtung bekam.
Es war Sonntag. Die Glocke rief zur Kirche, und Vetter Martin, der mit Stahl und Frohwalt im Garten hin- und widerging, sagte:
»Ich dächte, wir hörten den Pfarrer predigen. Gottes Wort kann uns nichts schaden, und ich denke, der alte Herr wird nichts Unrechtes reden. Du, Peter, bist überhaupt an nichts mehr gebunden, und Hans und ich wollen es schon mit unserem katholischen Gewissen ausmachen, wenn wir einmal ein evangelisches Gotteshaus besuchen. 's ist bei mir überdies nicht das erste Mal.«
So gingen sie mit einander. Niemals noch hatte Frohwalt[436] eine protestantische Kirche betreten, und darum wohl ergriff ihn eine seltsame Befangenheit. Aber bald schwand dieselbe vor der würdigen Einfachheit, welche hier herrschte. Der einzige, schlichte Altar, nur mit einem schönen Kreuzbilde geziert, zu dessen Seiten zwischen frischen Blütenzweigen die Kerzen brannten, die weißgetünchten Wände, hell beschienen von der durch die hohen Fenster einfallenden Sonne, die Emporen mit dem alten, gefälligen Schnitzwerke, die hölzerne Kanzel, auf welche von der Kirche aus die Treppe emporführte, und das kleine Orgelchor mit den blinkenden Pfeifenreihen … das alles stimmte so ruhig und drängte, da der Blick nicht abgelenkt wurde durch überflüssigen Schmuck, zahlreiche Bildwerke und Statuen, zu innerer Sammlung.
Die Orgel setzte ein, und der gemeinsame Gesang der zahlreich Versammelten erklang weihevoll wie ein Beten. Die Worte des alten Liedes von Paul Gerhardt: »Befiehl Du Deine Wege« muteten Frohwalt seltsam an; es war, als ob der alte evangelische Dichter sie just für ihn verfaßt hätte, und es drängte ihn, bei der dritten Strophe selbst mit einzustimmen, so daß das Auge Vetter Martins ihn ganz verwundert streifte.
Mit Aufmerksamkeit folgte er der Liturgie, mit noch größerer aber der Predigt des alten Pfarrers. Die Worte klangen so herzlich und ungesucht, sie paßten sich dem Verständnis und Empfindungsleben der schlichten Zuhörer völlig an, und sie wurden mit einer so natürlichen Wärme gesprochen, daß Frohwalt sich am Ende derselben tief ergriffen fühlte. Ja, das war eine evangelische Predigt … und er hätte ihr tausende von katholischen Zuhörern gewünscht. Da war nichts gesagt worden, was er nicht auch empfand, und was er von seinem Standpunkte aus nicht auch hätte sagen dürfen.
An die Predigt schloß sich der Beichtgottesdienst, und wie in einem frommen Banne hörte er das allgemeine Sündenbekenntnis und die Absolutionsworte des greisen, würdigen[437] Mannes, er hörte mit andächtigem Staunen die nun folgende Liturgie des Abendmahls, die alles Wesentliche enthielt wie die katholische Messe, ja genau mit denselben Worten, nur daß sie schlicht und schön in der Muttersprache erklangen, allen verständlich und allen erbaulich. Dann schritten sie langsam heran an den Altar, Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen und empfingen Brot und Wein, ehrfürchtig sich verneigend, und mit dem schönen, dreifachen Segen des Priesters schloß der Gottesdienst.
Das kleine Kirchlein war schon leer geworden, als Frohwalt erst mit seinen zwei Begleitern es verließ. Vor dem Thore stand er still und faßte die Hand Martins, der ihn schweigend beobachtet hatte und sagte:
»Das ist ein wahrer Gottesdienst! Gemahnt es nicht an die ältesten Zeiten der Kirche, da man nichts wußte von Prunk und Glanz der Aeußerlichkeiten, und da die Christen still und schön ihr schlichtes Liebesmahl gemeinsam genossen? Solche weihevolle Andacht habe ich niemals empfunden, als in dieser evangelischen Dorfkirche!«
Er konnte es sich nicht versagen, das auch dem alten Pfarrer gegenüber auszusprechen, der ruhig und freundlich erwiderte:
»Sie sind nicht der erste Katholik, welcher diese Empfindung hat; bei manchem ist sie freilich bedingt durch den Reiz des Neuen, bei Ihnen, glaube ich, ist sie tiefer, weil Sie mit Ernst nach dem Wahren suchen. Der liebe Gott erleuchte Sie auf Ihrem Wege!«
Er ging auf ein anderes Gespräch über, und gerade das berührte Frohwalt ungemein wohlthuend.
Am nächsten Morgen brach der Vetter Martin auf; bei solchem Frühlingswetter hatte er nirgends lange Ruhe, und es drängte ihn hinaus in die Welt. Er wollte diesmal Elsaß und Lothringen besuchen, die wiedergewonnenen Kinder der Mutter Germania. Quandt mit seiner Frau, Hans Stahl[438] mit Trudchen und Frohwalt gaben ihm ein Stück weit das Geleite. Mit letzterem ging der Alte einige Schritte den anderen voraus, und als es beinahe ans Abschiednehmen kam, sagte er:
»Ich weiß Dich hier in guten Händen, Peter; drum kann ich ausmarschieren, und wenn ich wiederkomme, hat sich in Dir, wie ich bestimmt hoffe, manches völlig ausgeklärt, was jetzt noch schwankend ist. Ich meine aber, Du bist auf dem besten Wege, erst recht ein brauchbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu werden. Konfessionslos kannst Du nicht bleiben, der Altkatholizismus ist noch unfertig … werde evangelisch, wie Deine Schwester ist! Werde ein Priester wie unser alter Gastfreund, ein Leiter, Führer und Vorbild Deiner Gemeinde. Das ist mein ehrlicher Rat, und es soll mich freuen, Peter, Dich einmal auf Deiner evangelischen Pfarre und in Deinem Hausstande besuchen zu können. Und dann nimmst Du mich auch in Deine Kirchengemeinde auf. Punktum! Und jetzt gehen wir auseinander!«
Der Alte wandte sich nach den übrigen um und schwenkte lustig seinen Stock. Sie kamen rascher herbei, und es folgte der herzlichste, rasche Abschied. Viel dabei herumzureden, war nicht Martins Art. Nach kurzer Weile wanderte er weiter, mit großen Schritten, noch zweimal sich umblickend nach den wehenden Tüchern und winkenden Händen, dann gingen die Zurückbleibenden langsam wieder dem freundlichen Dorfe zu, dessen Kirchturm ihnen friedlich entgegenwinkte.
Quandt und Fritzel gingen mit Hans Stahl voran, Frohwalt folgte mit Trudchen nach. Unbefangen hatte er bisher mit dem heitern, schönen Mädchen verkehrt, in dieser Stunde aber überkam ihn zum ersten Male eine gewisse Befangenheit: Ein Wort des Alten klang ihm in der Seele nach, wenn er in die hellen, frischen, braunen Augen schaute, und auf den plaudernden roten Mund. Sie merkte seine schweigsame Art und sagte:
»Der Abschied vom Vetter Martin hat Sie ja ganz still gemacht!«
»Ja, er ist mir sehr lieb, der alte Mann, und ich sehe ihn immer mit heimlicher Wehmut scheiden.«
»Er erinnert mich in manchem an meinen Vater!«
»Sie haben recht. Beide haben dieselbe milde Art, die gleiche Duldsamkeit und die nie versiegende, von sonnigem Humor verklärte Herzenswärme.«
Das Mädchen sah ihn mit aufleuchtenden Augen an. »Es freut mich, daß Sie schon nach so kurzer Zeit meinen Vater so beurteilen –«
Und nun ging ihr das kindliche Herz auf, und sie begann von ihren Eltern zu erzählen, und dem stillen Zuhörer ward es dabei wärmer in der Seele. Diese Kindesliebe hatte etwas unendlich Anmutiges und Wohlthuendes, und das Mädchen gewann in seinen Augen ganz besonderen Wert und Reiz.
Von diesem Tage an schloß sich Frohwalt mehr als bisher an den alten Pfarrer an und verkehrte manche Stunde mit ihm in ernsteren Gesprächen. Er selbst lenkte die Rede dabei auf religiöse Fragen, und ihn überraschte die ruhige Klarheit, die edle Milde, mit welcher der Pfarrer solche behandelte. So gewann er einen Einblick in das evangelische Bekenntnis und fühlte sich seltsam davon angezogen. Es lag in demselben ein schöner, gesunder, wahrhaft religiöser Kern, ein tiefbegründetes, sittliches Bewußtsein, ein Ablehnen des äußeren Scheins, eine Verklärung des deutschen Wesens, so daß es ihm jetzt erst verständlich ward, wie die Reformation auf deutschem Boden erwachsen, und wie ein einfacher Sohn des deutschen Volkes sie ins Leben rufen konnte.
Und die Worte, welche er von dem Pfarrer hörte, erhielten ihre schönste Bestätigung in den Verhältnissen in dem Pfarrhause selbst. Hier herrschte ein wundersamer Geist des Friedens und der Menschenliebe, von hier aus ging Trost und Rat in die bedrängten Herzen der Gemeindeglieder, und[440] dabei wetteiferten die weiblichen Glieder der Familie mit dem Oberhaupte. Die Pfarrerin war in jeder Weise des Gatten wert. Sie besaß eine vortreffliche Bildung des Verstandes und des Herzens, und war mit ihrem freundlichen, teilnahmsvollen Wesen wie der gute Geist des Hauses.
Was waren das für herrliche Stunden, welche Frohwalt in diesem Kreise verlebte, zumal des Abends, wenn die Familie enger an einander rückte und jeder gab und empfing, und sich an beidem still erfreute. Da setzte sich wohl die Pfarrerin ans Klavier, und die beiden Töchter sangen, Trudchen mit schöner, sympathischer Sopranstimme und Friederike mit klangvollem Alt, während der Hausherr mit dem Seidenkäppchen auf dem ehrwürdigen Haupte behaglich in seinem Lehnstuhl saß und seine lange Pfeife schmauchte. Dann erzählte Hans Stahl von den ruhmvollen Tagen, die er mit durchgestritten, oder Quandts und Frohwalt ergingen sich in römischen Erinnerungen, bis der Pfarrer zuletzt einen kurzen Abendsegen sprach, der das Haus und alle seine Bewohner dem Schutze Gottes empfahl, dann begab man sich zur Ruhe, und tiefer Friede lag über dem Pfarrhause und dem ganzen freundlichen Dorfe.
Frohwalt lebte hier wie in einem Zauberbann, und manchmal war es ihm, als träume er und müsse das Erwachen fürchten. Besonders fühlte er das, wenn er sich mit Trudchen unterhielt. Er hatte sich bisher, getreu den Vorschriften seines Berufs, wenig um das weibliche Geschlecht gekümmert und kannte von demselben aus näherem Umgang nur Mutter und Schwester. Dann hatte er besondere Wertschätzung für Friederike gewonnen, und da Trudchen der Schwester in jeder Weise ähnlich war, so übertrug er dies Empfinden gleich von vornherein auf sie. Und sie kam ihm mit ungesuchter Herzlichkeit und Natürlichkeit entgegen, als ob er ihr gar kein Fremder wäre, und gab sich in Wort und Wesen mit so heiterer Anmut, daß der Umgang mit ihr für Frohwalt beinahe ein Bedürfnis[441] wurde, und er an jedem Morgen sich zumeist darauf freute, ihr frisches, liebes Gesicht wiederzusehen.
Ueber die Bedeutung solchen Empfindens war er sich selbst nicht klar; um so klarer aber schienen andere sich darüber zu sein, und Quandts, sowie Hans Stahl ließen die beiden, so oft es unverfänglich geschehen konnte, ungestört mit einander verkehren, aber um des Malers Lippen flog ein gutmütig schönes Lächeln in solchen Augenblicken, und den Arm seines Weibchens wärmer an sich ziehend, flüsterte er wohl:
»O rühret, rühret nicht daran!«
So mochten etwa drei Wochen vergangen sein. Der junge Lausitzer, der seinen Arm beinahe mehr aus Gewohnheit als aus Notwendigkeit in der Binde trug, gedachte in seine Heimat abzureisen, und auch Frohwalt schien es an der Zeit, die Gastfreundschaft des lieben Pfarrhauses nicht länger in Anspruch zu nehmen. Er hatte mehrmals schon davon gesprochen, zu gehen, aber immer wieder gern sich halten lassen.
Da war er eines Vormittags – Friederike und Gertrud hatten daheim zu schaffen, und Quandt malte – mit Stahl allein durch das Dorf gegangen. Als sie an dem stattlichen Gasthofe vorüberkamen, hatte der letztere einen Blick in den Garten desselben geworfen und plötzlich schrie er auf:
»Professor Holbert!«
Dann eilte er durch die Hinterthüre ein. Frohwalt, der ihm beinahe mechanisch folgte, sah jetzt in der That auch den Professor an einem der einfachen Holztische sitzen und neben ihm Therese. In wenigen Augenblicken waren die vier Menschen bei einander und reichten sich herzlich die Hände, und Fragen gingen lebhaft hin und her.
Holbert hatte mit seiner Tochter, um den unerquicklichen Prager Verhältnissen sich auf einige Zeit wenigstens zu entziehen, eine kleine Reise gemacht, die beide meist zu Fuß zurücklegten. So waren sie nach Ehrenberg gekommen und gedachten[442] hier Mittagsrast zu halten. Ihre Freude, Frohwalt und Stahl hier zu finden, war aufrichtig und groß, und besonders angenehm überrascht waren sie über den letzteren, dessen Gesicht in diesem Augenblicke wie von innerer Verklärung aufleuchtete, und den sie herzlich beglückwünschten zu seinen Heldenthaten und seinen ehrenvollen Erfolgen in Krieg und Frieden. Als Therese ihm dabei die Hand reichte, hielt er sie eine Sekunde lang fest, und sah ihr dabei so seltsam in die Augen, daß sie errötend die Blicke senkte.
Um der Freunde willen gedachten Holberts den Nachmittag über hier zu bleiben und gemeinsam mit ihnen einen nahen Berg zu ersteigen, der eine schöne Fernsicht bot. Die Pfarrersfamilie war feinfühlig genug, sich daran nicht zu beteiligen, und so wanderten die vier langsam die bewaldete Höhe hinan, unter leise rauschenden Föhren hin. Frohwalt und der Professor schritten voran, Hans Stahl und Therese folgten.
»Ist Ihnen der im Mai von München aus von Döllinger erlassene Aufruf an die deutschen Katholiken zu Gesicht gekommen?« fragte Holbert seinen Begleiter.
»Nein. Um was handelt es sich darin?«
»Nun, Döllinger betont in Uebereinstimmung mit einer Anzahl gesinnungstüchtiger, gläubiger Männer, daß auf dem Boden der Treue gegen den alten katholischen Glauben eine Erneuerung kirchlicher Zustände durch einträchtige Arbeit von Klerus und Laien herbeigeführt und als letztes Ziel christlicher Entwicklung die Vereinigung der jetzt getrennten christlichen Glaubensgenossenschaften angestrebt werden soll. Wahrlich ein edles und würdiges Programm, bei welchem, wie ich annehmen zu dürfen glaube, wohl auch auf Ihre Mitwirkung zu rechnen ist.«
»Zürnen Sir mir nicht, Herr Professor, wenn ich sagen möchte: ›Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.‹ – Ich habe hier reichlich Gelegenheit gehabt, über[443] religiöse und kirchliche Verhältnisse nachzudenken, und darum finde ich zwar die Bestrebungen des Altkatholizismus schön und würdig, aber seine letzten Ziele scheinen mir weder völlig klar, noch vor allem erreichbar.«
»Es kommt nur auf den guten Willen der Beteiligten und auf die allgemeine Unterstützung an.«
»Und gerade an der letzteren wird es, fürchte ich, fehlen, weil man in die Ausführbarkeit des Programms kein volles Vertrauen gewinnt. Eine Umwandlung der kirchlichen Zustände! Sie ist oft versucht worden von Kirchenversammlungen aus, aber umsonst!«
»Weil man stets mit der römischen Kurie als einem besonderen Faktor rechnete, der sich angestrebten Aenderungen verschloß oder gar widersetzte. Für uns Altkatholiken aber ist auch die altkirchliche Verfassung maßgebend, nach welcher alle Bischöfe gleich und gleichberechtigt sind mit dem römischen, der nur der Erste unter Gleichen ist.«
»Sie streben also den Ausbau des bischöflichen Systems an? Aber woher nimmt der Altkatholizismus seine Bischöfe? Wer soll sie weihen? Denn die bloße Ernennung könnte doch nicht genügen, in ihnen die Nachfolger der Apostel zu sehen?«
»Gewiß nicht. Aber wir haben ja bereits eine altkatholische Kirche, die seit dem siebten Jahrhundert in den Niederlanden besteht, und seit Anfang des vorigen Jahrhunderts erneuert wurde, die römisch-katholische Kirche der bischöflichen Klerisei. Sie steht unter dem Erzbischof von Utrecht und den Bischöfen von Deventer und Haarlem, und bestreitet, wie wir, die päpstliche Unfehlbarkeit. Durch ihre Bischöfe wird durch Handauflegung die bischöfliche Weihe rechtmäßig auch auf unsern Oberhirten übertragen werden.«
»Auch das sind Aeußerlichkeiten, denen ich keinen zu hohen Wert beilegen möchte. Der Altkatholizismus hat die Absicht, die alte katholische Kirche wieder herzustellen, und darin liegt nach meinem Ermessen eine Halbheit, die nicht[444] zum Ziele führen kann. Das Hinarbeiten auf ein bloß kirchliches Christentum kann nicht das Letzte und Höchste sein, sondern die religiös-sittliche Ausgestaltung desselben müßte angestrebt werden, zu welcher die auf den Grundlagen des Humanismus sich erhebende Reformation den Anlauf genommen hat. Wir brauchen, möchte ich beinahe sagen, eine Art staatliches Christentum, ein weltlich sittliches Christentum, wodurch das Wesen des Protestantismus sich kennzeichnet im Gegensatz zu dem Katholizismus, der das Wesen des Christentums nur in der kirchlichen Form dargestellt wissen will. Alle Bestrebungen der Zeit im Geiste des wahren Christentums aufzufassen, dasselbe in ihnen fruchtbringend werden zu lassen, das wäre eine Aufgabe für den Altkatholizismus, aber gerade der Erfüllung desselben setzt das Festhalten an kirchlichen Aeußerlichkeiten Schranken.«
»Ich höre das protestantische Pfarrhaus aus Ihnen sprechen, lieber Freund!« sagte lächelnd der Professor.
»Es mag etwas Wahres an dem Worte sein, aber andererseits muß ich betonen, daß ich niemals einen Mann mit milderem Sinne und mit geringerer Absicht, Glaubensgenossen zu gewinnen, kennen gelernt habe, als den alten Pfarrer von Ehrenberg.«
»Aber scheint Ihnen nicht wenigstens das letzte Ziel des Altkatholizismus groß und der Bemühungen der Besten wert? Die wirkliche Wiederherstellung der katholischen Kirche, in der nur ein Hirt und eine Heerde ist, die Wiedervereinigung von allen, die sich Christen nennen, ist das Erhabenste, was sich denken läßt.«
»Gewiß, Herr Professor – aber leider unerreichbar. Ein Zurückgehen auf die allerälteste christliche Zeit, ein Wiedererwecken der altkirchlichen Lehre würde stets auf Widersprüche stoßen und statt der Einigung noch schärferen Zwiespalt erwecken. Wohl weiß ich, daß Döllinger in bester Absicht einen Unterschied machen will zwischen Glaubenssatz und[445] Meinung – aber wer soll feststellen, was als Glaubenssatz zu gelten hat? Als Glaubenssatz für alle Christen? Als Glaubenssatz, der auch einhellig angenommen würde? Aus jedem Glaubenssatz würde ein neuer Zwiespalt erwachsen, wie es bisher stets der Fall gewesen ist.«
Sie waren, indem sie dies Gespräch fortsetzten, auf der freien Höhe angekommen. Unter ihnen lag im Sonnenglanze das schöne blühende Land mit freundlichen kleinen Städtchen und Dörfern, mit dem blinkenden Silberbande eines Flüßchens, umrahmt gegen Süden von einem Kranze höherer Berge und dem Kamme des Gebirges. Einige Augenblicke standen sie schweigend, dann sagte Holbert:
»Ich sehe aus allem, wie es um Sie steht, lieber Freund, und wohin Ihre Ueberzeugung Sie führt. Ich achte Sie darum nicht minder, und ich denke, daß wir die Alten bleiben. Im innersten Wesen stimmen wir doch überein. Sie wie ich streben die sittliche Wiedererneuerung der menschlichen Gesellschaft an. Das ist ein großes und edles Ziel, und der Wege dazu giebt es mannigfache. Uns allen aber leuchtet dazu dieselbe Sonne und es blaut uns derselbe Himmel, und derselbe ewige Vater giebt allen seinen Kindern, die ehrlich der erkannten Wahrheit nachstreben, seinen Segen. Möge er auch uns nicht fehlen!«
Mit wärmstem Drucke fanden sich die Hände der beiden Männer, die schweigend sich dabei in die Augen sahen. Sie wußten, was sie einander geworden waren und bleiben wollten.
Langsamer war indes das zweite Paar hinterher gekommen. Ueber Stahl, sowie über Therese lag anfangs eine gewisse Befangenheit, und die junge Frau suchte darüber hinwegzukommen, indem sie ihren Begleiter nach seinen künstlerischen Erfolgen, seinen Arbeiten und Bestrebungen fragte. Er erzählte ihr davon, begeistert, mit leuchtenden Blicken, dann blieb er mit einem Male stehen, so daß auch sie den[446] Schritt anhalten mußte. Ringsum war schweigender Wald, durch welchen die Sonnenstrahlen zuckten, die beiden Männer vor ihnen waren verschwunden hinter den Föhrenstämmen, ein Vogel huschte scheu durch das Gezweige … da sagte er mit einmal mit bebender Stimme:
»Denken Sie noch an den Beth Chajim, und was mein junges, thörichtes Herz unter den blühenden Fliedersträuchen damals bewegte?«
Es schien, als wolle sie abwehren, aber die Geberde mißlang, und die Röte, welche ihr in die Wangen trat, strafte sie Lügen. Kühn gemacht dadurch, fuhr er fort:
»Ich bin seitdem ein anderer geworden. Ich bin durch eine ernste Schule gegangen, ich habe geblutet für eine heilige Sache, und ich fühle es, daß ich eine Zukunft habe … wenn mir der Sonnenschein, an den ich geglaubt und gehofft habe, seit ich Sie kenne, nicht untergeht. Damals in Prag mußte ich schweigen – heute darf ich reden. Therese, ich brauche es Ihnen nicht zu sagen, daß ich Sie heute noch ebenso lieb habe, ja noch mehr, denn Sie haben gelitten, und daß mein ganzes Wesen und Denken nur aufgeht in Ihnen. Sie sind frei, wie ich es bin, und wenn sie glücklich machen wollen, so sollen Sie auch glücklich sein, das gelobe ich Ihnen bei allem, was uns heilig ist!«
Therese war in heftiger Erregung, ihre Brust atmete lebhaft, sie rang nach Worten, und ohne sie finden zu können, ging sie einige Schritte vorwärts. Stahl aber war stehen geblieben; er sah ihr beinahe enttäuscht, traurig, nach und nur ihr Name entrang sich seinen Lippen, aber mit einem so unendlich traurigen und doch so liebeerfüllten Klange, daß sie stehen blieb und ihn ansah.
»Dringen Sie heute … noch jetzt nicht in mich … Hans – es kommt mir zu überraschend … ich weiß ja nicht, ob ich noch auf ein Glück rechnen darf …«
Er hatte nur das eine Wort gehört, das ihm Alles[447] verriet, und aufjauchzend rief er noch einmal ihren Namen, und streckte ihr die ausgebreiteten Arme entgegen.
Sie trat wieder näher an ihn heran, und reichte ihm die beiden Hände:
»Noch nicht, Hans … lassen Sie mir noch Zeit …«
Da ergriff er die Hände und küßte sie abwechselnd, bald die Rechte, bald die Linke, trotz des Handschuhes, so daß ein leises Lächeln um ihre Lippen spielte.
»Ungestümer!«
Dabei drückte sie auch seine Hände warm und herzlich, und sagte:
»Kommen Sie, Hans, wir wollen vernünftig sein!«
»Wie lange noch, Du Liebe, Herrliche?«
Sie legte ihm die Hand auf den Mund und ihren Arm in den seinen. Und wie sie leicht sich an ihn schmiegte, da ging ein seliger Schauer durch sein Herz, so daß er keine Worte finden konnte, und schweigend schritten sie selbander den Berg hinan. Ehe sie aber hinaustraten auf die Lichtung auf dem Gipfel, flüsterte er mit unendlicher Innigkeit:
»O sage nur ein einzigmal Du!«
Und mit holdem Erröten flüsterte sie das kleine, süße, inhaltvolle Wort, und fester zog er ihren Arm an sich –
So kamen sie heran zu den beiden Männern …
Als Frohwalt an diesem Abende in das Pfarrhaus zurückkehrte, geschah es mit dem festen Vorsatz, dem Pfarrer anzuzeigen, daß er zum evangelischen Bekenntnis übertreten wolle. Das Gespräch mit Holbert hatte ihm die Ueberzeugung beigebracht, daß der Altkatholizismus ihn niemals ganz befriedigen könne.
Mit ruhiger Freude hatte der Pfarrer diesen Entschluß gehört und seinem Gastfreunde schweigend die Hand gereicht. Dann aber hatte er nach seines Herzens Drang mit ihm gesprochen, und als Frohwalt aus seinem Gemache trat, war seine Seele wundersam erhoben.
Da sah er Trudchen im Flur stehen.
Er eilte auf sie zu mit einer freudigen Erregung und sprach:
»Fräulein Gertrud, soeben habe ich Ihrem Vater mitgeteilt, daß ich Ihrem Glauben beitreten und ein evangelischer Priester werden will in seinem Geiste!«
Das Gesicht des hübschen Mädchens wurde von hoher Röte übergossen, und sie reichte ihm die Hand.
»O wie mich das freut! Wie mich das freut!«
Mehr vermochte sie nicht zu sagen; aber wie sie so dastand im milden Lichte des Abends, das durch das Flurfenster herein fiel, erschien sie ihm lieblicher als jemals, und er fragte mit unsicherer Stimme:
»Und warum freut Sie das so, Gertrud?«
Sie vermochte nicht zu antworten. Mit einem leisen, seligen Aufschluchzen lehnte sie sich an seine Brust und schlang die Arme um seinen Nacken.

Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht. Die Abbildungen wurden an die zugehörige Textstelle verschoben.
End of the Project Gutenberg EBook of Los von Rom, by Anton Ohorn
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LOS VON ROM ***
***** This file should be named 61287-h.htm or 61287-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/1/2/8/61287/
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.