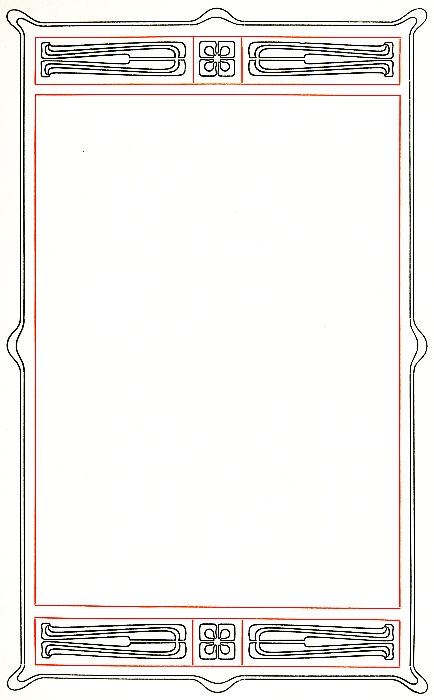
The Project Gutenberg EBook of Die Steinbergs, by Josephine Siebe
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
Title: Die Steinbergs
Eine Erzählung aus der Zeit der Befreiungskriege
Author: Josephine Siebe
Illustrator: Wilhelm Roegge
Release Date: April 27, 2019 [EBook #59374]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE STEINBERGS ***
Produced by Norbert H. Langkau, Matthias Grammel and the
Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
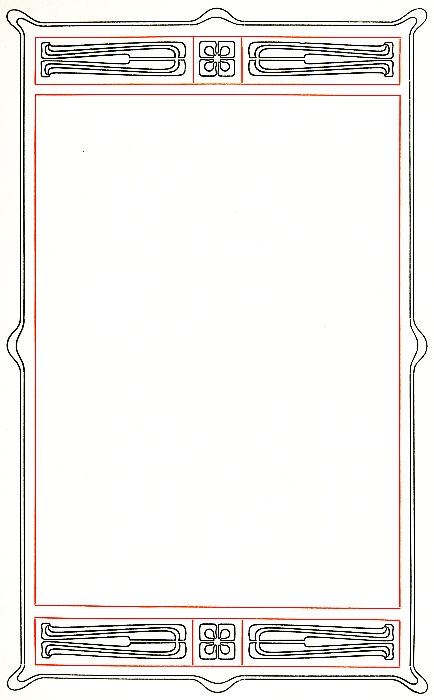

Die Steinbergs
Eine Erzählung aus der Zeit der Befreiungskriege
von
Josephine Siebe
Mit sechs farbigen Vollbildern von Wilhelm Roegge

Stuttgart
Verlag von Levy & Müller
Nachdruck verboten.
Alle Rechte, insbesondere das Uebersetzungsrecht, vorbehalten.
Druck: Chr. Verlagshaus, Stuttgart.
| Seite | |
| Erstes Kapitel. Gute Hausgenossen | 1 |
| Zweites Kapitel. Das Schreiberlein des Herrn Advokaten Schnabel |
18 |
| Drittes Kapitel. Abschiedsstunden | 37 |
| Viertes Kapitel. Auf Hohensteinberg | 55 |
| Fünftes Kapitel. Als Fremdling in des Vaters Heimat | 66 |
| Sechstes Kapitel. Der Tugendbund wird gegründet | 81 |
| Siebentes Kapitel. Der Tugendbund nimmt ein jähes Ende |
101 |
| Achtes Kapitel. Einem traurigen Morgen folgen schwere Tage |
115 |
| Neuntes Kapitel. Auf weiten Wegen ins alte Nest zurück |
126 |
| Zehntes Kapitel. Nach langer Not zum heiligen Krieg | 141 |
| Elftes Kapitel. Fürs Vaterland was es auch | 161 |
| Zwölftes Kapitel. Ausklang | 175 |


»Richtig ist das nicht mit dem Bengel,« schalt der dicke Bäckermeister Käsmodel und schlurrte aufgeregt in dem kleinen Laden auf und ab, der ein Schiebefenster nach dem Hausflur hin hatte, durch das die Backware verkauft wurde. »Allweil, wenn ich'n brauche, hat er zu lernen, immer zu lernen. Das Gymnasium, scheint's mir, hat ihm den Kopf verdreht.«
»Aber Christian,« beschwichtigte die Frau Bäckermeisterin, die gerade dabei war, Backware in die Körbe zu zählen, »hast es ja selbst gewollt, daß Gottlieb auf die hohe Schule kommt!«
»Na, ja,« murrte der Bäckermeister, »hast allweil recht. Wenn man von drei Jungen nur einen übrig behält, will man an den auch was wenden. Aber mein Herr Vater selig hätte mir schön heimgeleuchtet, wenn ich beim Austragen und Helfen [S. 2] nicht gleich wie der Blitz zur Hand gewesen wäre. Aber unserer, daß Gott erbarm!«
»Mann, Mann, er tut doch nichts Schlimmes,« mahnte die Frau freundlich, »und zum Austragen ist ja Raoul immer bereit.«
»Na freilich,« spottete der Bäcker, »'s ist gut, einen Boten bezahlen bei den schlechten Zeiten, nur weil der Musjeh Sohn nicht mag. Und warum mag er nicht? Weil er sich schämt, Laufjunge für seinen Vater zu sein, seit er auf der Lateinschule mit den feinen Herrchens verkehrt. Solche Alfanzereien hätte mir mein Vater selig kräftig mit dem Stock – –«
»So ist's nicht, Vater, das müssen Sie nicht denken!« — Aus einem dunklen Winkel des Lädchens, hinter Mehlsäcken schaute in diesem Augenblick zur grenzenlosen Überraschung seiner Eltern ein keckes, rundes Bubengesicht hervor.
»Daß dich das Mäuschen beißt!« schrie der dicke Bäckermeister wütend, ergriff im Eifer einen langen Holzlöffel, der ihm gerade zur Hand lag, und wollte damit seinem Sohne etwas unsanft um die Ohren fahren.
»Christian,« bat die Frau etwas ängstlich und hielt ihren Mann am weißen Kittel fest, »hör' doch den Jungen erst an!«
Der war furchtlos aus seinem Versteck hervorgekrochen; er sah weiß und bemehlt aus, wie ein rechter Bäckerbub, selbst die Wimpern, die die trotzigen, ehrlichen Blauaugen überschatteten, schimmerten weiß.
»Ich will's dem Herrn Vater bekennen, warum ich nicht Austräger sein mag,« rief der kräftige, stämmige Bursche unerschrocken, »es ist wegen dem Raoul, nicht wegen der feinen Mitschüler, wie's der Herr Vater denkt. Der Raoul ist über jeden [S. 3] Groschen glücklich, den er seiner Mutter bringen kann; schenken läßt er sich nichts, aber verdienen ist was anders, und darum —«
»Siehst du, Christian,« sagte die Bäckermeisterin, und ein Freudenschein lag auf ihrem Gesicht, »unser Junge meint's gut.«
»Na freilich, der reine Engel ist's, nur schade, daß man's so selten merkt, ist aus seines Vaters Tasche heraus großmütig, faulenzt aus lauter Freundschaft,« brummelte Meister Käsmodel, der es nicht zeigen wollte, wie weich es ihm eigentlich ums Herz war.
Gottlieb aber kannte seinen Vater und wußte schon, daß der Zorn verraucht war, und so rief er vergnügt: »Ich denke, den Herrn Vater machen die paar Groschen nicht zum armen Mann, und er gönnt Raoul schon den kleinen Verdienst.«
»Na ja, na ja, meinetwegen. Ein Jammer ist's ja, so eine feine, vornehme Frau, der's wahrhaftig anders an der Wiege gesungen wurde, und muß sich so kümmerlich durchs Leben bringen. Na ja, ja, meinetwegen, lauf, Gottlieb, und hol' deinen Freund. Nee nee, 's soll keiner vom Meister Käsmodel sagen, daß er nicht gern hilft, wenn er kann!«
Gottlieb war schon, ehe der Vater noch recht seine Rede beendet hatte, durch die Tür aus den Hausflur geschlüpft, und mit einer Schnelligkeit, die wohl niemand seiner kurzen, gedrungenen Gestalt zugetraut hätte, stürmte er die Treppen in dem alten, himmelhohen Haus empor. Oben gab es zuletzt nur eine Leitertreppe, auch sie kletterte er mit Windeseile hinan. Vor einer niedrigen Türe blieb er aber dann einige Sekunden pustend stehen und klopfte nun leise und vorsichtig. Doppelstimmig klang es von drinnen »herein«, und als Gottlieb rasch eintrat, scholl es ihm entgegen. »Gottlieb ist's, ich dachte es mir schon!«
Ein schlanker, etwa dreizehnjähriger Knabe, der den Bäckerssohn um einen Kopf überragte und in seiner ärmlichen, abgetragenen Kleidung fast wie ein verwunschener Prinz aussah, kam eilig herbei, und in seinen dunklen Augen blitzte es wie Hoffnung auf: »Soll ich kommen?«
Gottlieb nickte und sagte, verlegen sich durch seinen Strubbelkopf fahrend: »Es ist schon nötig, bist nicht böse drüber, nein?«
Und ohne eine Antwort abzuwarten, ging Gottlieb Käsmodel rasch durch das Zimmer und verbeugte sich, so gut er es zuwege brachte, und so tief, daß sein dichter, blonder Haarschopf beinahe den Boden fegte, vor einer Dame, die an einem der beiden kleinen Fenster saß und das verdämmernde Licht des kurzen Wintertages noch emsig zu ihrer Näharbeit ausnützte.
Trotzdem auch sie schlicht, ja ärmlich gekleidet war, würde jeder in dieser schlanken Frau die vornehme Dame erkannt haben. Sie, der Knabe und ein paar von blitzenden Goldrahmen umfaßte Ölbilder nahmen sich ganz fremd in der Stube mit den schiefen Wänden, den kleinen Fenstern und dem ärmlichen Hausrat aus.
»Darf Raoul kommen?« fragte Gottlieb, der ganz unwillkürlich hier immer etwas seine laute Stimme dämpfte.
Über das sehr blasse Gesicht der Frau, auf dem Kummer und Sorge noch nicht die einstige strahlende Schönheit verwischt hatten, glitt ein wehes Lächeln. »Gewiß gern, lieber Gottlieb,« sagte sie unendlich sanft, »und grüße die Eltern!«
Gottlieb Käsmodel verneigte sich noch einmal so tief, daß er nun beinahe nicht wieder in die Höhe gekommen wäre, Raoul von Steinberg küßte seiner Mutter ehrfurchtsvoll die Hand, und dann eilten die Knaben hinaus, leise und gemessen durch das Zimmer, die Treppen aber polterten sie gar geschwind hinab.
»Wenn du fertig bist, kommst du in meine Kammer,« bat Gottlieb, »ich warte mit den Aufgaben.«
Raoul nickte nur und schlüpfte eilfertig durch den Hausflur in das Lädchen. Dort hatte die Bäckermeisterin zwei große Körbe mit Backwaren gefüllt, und Raoul bekam die Weisung, dahin und dorthin dies und das zu tragen. »Ein Bäckerjunge muß aber zeigen, daß die Ware gut ist, und was essen,« sagte die Frau gutmütig und steckte dem schlanken Knaben ein paar recht große Wecken zu. Einer hätte wohl genügt, um einen gesunden Bubenappetit zu stillen, aber die Meisterin wußte, daß der andere hinauf wanderte in das Dachzimmer und dort eine Mahlzeit der Frau von Steinberg bildete. Raoul teilte immer mit der Mutter, mochten die Bissen noch so klein und der Hunger noch so groß sein.
Während Raoul von Steinberg an diesem etwas trüben Januartag des Jahres 1811 durch die engen Straßen der alten Stadt Leipzig lief und die bestellte Ware Meister Käsmodels Kunden zutrug, vollendete seine Mutter eine vielfach gefältelte Frauenhaube. So mühsam die Arbeit war, sie ließ ihr doch Zeit genug, mit ihren Gedanken in die Vergangenheit zu eilen. Die Gegenwart war so trübe, und die Zukunft lag so schwer und hoffnungslos vor der Frau, daß ihr die glückliche Vergangenheit wie ein blumenreiches Gärtlein war, in dem sie nach des Tages Last und Mühe still einherging.
Frau Madeleine von Steinberg war eine Französin von Geburt. Sie entstammte einer sehr vornehmen Emigrantenfamilie, die sich vor den Schrecken der Revolution erst in eine kleine rheinische Stadt, dann nach Dresden geflüchtet hatte. In dieser schönen, heiteren Stadt verlebte Madeleine ihre Mädchenjahre. [S. 6] Ihr Vater hatte wenigstens einen Teil seines Vermögens gerettet, und zwar so viel, daß die Familie ohne Sorgen leben konnte. Ein Vetter der Gräfin hatte ein hohes Amt am sächsischen Hofe inne. In seinem Hause und durch seine Vermittlung wurde Madeleine in die Gesellschaft eingeführt, und auf einem Balle lernte sie auch ihren nachherigen Gatten, Georg Wilhelm von Steinberg, kennen. Dieser, Ostpreuße von Geburt, hielt sich nur kurze Zeit in Dresden auf; als er ging, bat er Madeleines Vater um die Hand seiner Tochter. Doch der wies ihn ab, er sagte, er wolle keinen Preußen zum Schwiegersohn. Die Mutter, der das feste, ehrenhafte Wesen dieses preußischen Junkers gut gefiel, tröstete: »Abwarten! Die Zeit mildert wohl des Vaters Sinn!« Aber ehe dies geschah, starb der Graf, gerade als sich sein Sohn nach Frankreich begeben hatte, um dort zu versuchen, die reichen Güter der Familie zurückzugewinnen, denn der wilde Brand der Revolution war im Erlöschen. Die Gräfin, eine zarte, schwächliche Frau, war müde von allem Leid, sie wollte ihre junge Tochter in gutem Schutz wissen, und so durfte diese dem abgewiesenen Freier schreiben, daß einer Heirat nichts mehr im Wege stand. Nach wenigen Wochen schon wurde Madeleine Georg Wilhelm von Steinbergs Gattin, und wieder nach wenigen Wochen stand sie am Sarge der Mutter.
Das junge Ehepaar siedelte nach Berlin über; Herr von Steinberg war preußischer Offizier und stand in der Hauptstadt. Madeleine hatte nicht geahnt, daß gleich ihrem Vater auch die Familie ihres Mannes die Heirat ungern gesehen hatte. In diese alte preußische Familie passe keine Französin hinein, hatte die Mutter ihres Mannes geschrieben. Diese, eine stolze, durch ein schweres Leben herb und verschlossen gewordene Frau, hatte den [S. 7] herzlichen, um Liebe bittenden Brief der Schwiegertochter nur kühl erwidert. Vielleicht wäre es Frau Madeleine gelungen, nach und nach die Liebe und das Vertrauen der neuen Verwandten zu erringen, sie war aber scheu, und ein hartes Wort schreckte sie gleich zurück. Ihr Gatte zürnte den Verwandten, er bat auch nicht weiter, ja die Vorwürfe der Mutter verletzten ihn so, daß er zuletzt gar nicht mehr schrieb, und zu einer Fahrt in die Heimat kam es auch nicht. Doch auch Madeleines eigener Bruder zürnte ihr: er wieder haßte den Preußen, und sein Haß ging so weit, daß er der Schwester das Erbteil entzog.
Mit Sorge und Leid begann die junge Ehe, und doch war sie unendlich glücklich; die Jahre, die Madeleine an der Seite ihres Mannes verlebt hatte, waren für sie der reiche, köstliche Blumengarten, in den ihre Seele immer wieder zurückkehrte. Dann kam der Krieg von 1806/1807. Bei Saalfeld wurde Rittmeister von Steinberg schwer verwundet. Einem Freund von ihm gelang es, den Verwundeten zu retten und ihn nach Leipzig zu schaffen. Dort fand Frau Madeleine den Gatten, dort pflegte sie ihn die letzten schweren Monate seines Lebens, dort starb er, und nach seinem Tode blieb die Witwe mit ihrem einzigen Kinde, einem Knaben, in der Stadt.
Die Krankheit, der Krieg und eigenes schweres Leiden raubten der Witwe das geringe Vermögen, und zwei Jahre nach dem Tode ihres Mannes befand sie sich in den ärmlichsten Verhältnissen. Sie wandte sich mit der Bitte um Hilfe an ihren Bruder, der inzwischen in Napoleons Dienst getreten war und alle seine Güter zurückerhalten hatte. Ein hartes Nein war die Antwort. »Ich will dir nur helfen, wenn du hier in dein Vaterland zurückkehrst und deinen Sohn als Franzosen erziehst,« [S. 8] schrieb er, doch Frau Madeleine hatte dem Gatten gelobt, den Sohn in der Heimat zu erziehen, und sie hielt ihr Wort.
Die Verwandten ihres Mannes um Hilfe zu bitten, wagte sie nach dieser harten Abweisung des einzigen Bruders gar nicht mehr, dazu war sie zu scheu und zaghaft, so nahm sie tapfer allein den Kampf mit dem Leben auf. Sie blieb in Leipzig, bezog mit ihrem Sohne eine Mansardenstube im Hause des Bäckermeisters Käsmodel und versuchte sich mit feinen Putzarbeiten zu ernähren. Es wäre ihr wohl auch ganz gut gegangen, denn sie war geschickt und erwarb sich bald einige Kunden, doch die Zeiten waren schlecht, und dazu kamen wochenlange Krankheiten, die sie oft arbeitsunfähig machten. Das wenige Geld, das sie besaß, mußte nach und nach verbraucht werden, und mit heißer Angst dachte sie manchmal an die Zukunft. Was sollte aus ihrem Sohn werden? Sie erzog den Knaben, dem Wort getreu, das sie ihrem sterbenden Manne gegeben hatte, im Sinne seines Vaters. Sie selbst besaß nur noch eine blasse Erinnerung an ihr schönes Heimatland, an das Schloß ihres Vaters an den Ufern der Loire und das Palais in Paris. Die neue Herrschaft in Frankreich, Napoleons Eroberungszüge erfüllten ihre sanfte Seele mit Schrecken. Ihr Mann war im Kampf gegen den unersättlichen Eroberer gefallen, sie sah, welch namenloses Leid dieser gewissenlose Emporkömmling über die Länder brachte, und ihr Herz blutete vor Mitgefühl mit den gepeinigten, zertretenen Völkern. Napoleon war für sie nicht der Kaiser von Frankreich, dieses schönen, anmutigen Landes, das ihr wie ein Märchenland in der Erinnerung lebte, er war ihr ein böser Dämon, der Not, namenloses Leiden über die Menschen brachte. In dieser Anschauung wuchs Raoul auf; ein tiefer Haß gegen [S. 9] den Völkervernichter, ein heißes Mitleid mit denen, die unter seiner Tyrannei litten, wurde groß in dem Herzen des Knaben. —
Die Dämmerung hatte nach und nach das Mansardenzimmer Frau von Steinbergs in Dunkel gehüllt, nur am Fenster hing noch ein matter Lichtschein, zu schwach aber, um bei ihm weiter arbeiten zu können. Erschöpft ließ die Frau die Arbeit sinken; Brust und Rücken taten ihr weh, und fröstelnd zog sie das dünne Tuch um ihre Schultern. Es war kalt im Zimmer, in dem Öfchen war das Feuer ausgegangen, und draußen wehte ein scharfer, harter Nordwind. Doch Brennholz kostete Geld, Nahrung, Kleidung, alles kostete Geld, und der Verdienst war gering. Ein paar Goldstücke lagen freilich noch in dem Kasten, in dem Frau Madeleine den Trauring ihres Mannes, sein Bild, eine Haarlocke von ihm und ähnliche Erinnerungen aufbewahrte, aber dieser Notgroschen sollte, mußte für Raoul bleiben. »Wenn ich nicht mehr lebe,« dachte die Frau müde.
Draußen polterte wieder jemand die Stiegen herauf, es klopfte, und einen Augenblick später trat breit und behaglich, ein bammelndes Laternchen in der Hand, die Bäckermeisterin Käsmodel in das Zimmer. »Nichts für ungut, wenn ich störe,« sagte sie freundlich, »ich wollte nur sagen, daß es in unserer Backstube kuchenwarm ist, und daß es eigentlich jammerschade ist, daß Feuer und Licht nicht genug ausgenutzt werden. Na, und dann, Frau von Steinberg wissen, wie himmelgern ich so 'n kleinen Tratsch mache. 'n bißchen was von Dresden hören, darüber geht nur nichts. Wär's gar so unbescheiden, wenn ich bitten tät, auf ein Stündchen herunterzukommen?«
Madeleine von Steinberg sah die Bäckermeisterin dankbar an, die im Lichtschein ihres Laternchens an der Türe stand und [S. 10] die blasse Frau anschaute, just als möchte sie sagen: Komm, du armes, krankes Menschenkind, laß dich lieb haben von mir und dir was Gutes tun!
Diese Szene wiederholte sich allabendlich: immer wenn es dunkel und kalt in der Kammer wurde, holte die Meisterin ihre Hausgenossin in die warme Stube hinab, in der es so kräftig nach Mehl und nach frischem Brot roch. Dann saßen die Frauen bis zum Nachtmahl zusammen, wohl noch darüber hinaus, denn oft baten die Bäckersleute, es sei doch gerade so gemütlich, da könnte Frau von Steinberg doch ein Häppchen mitessen, es sei ihnen dies eine besondere Ehre. Anfangs hatte sich die Frau gegen diese stille, versteckte Wohltätigkeit gewehrt, hatte nichts, auch gar nichts annehmen wollen, aber jetzt war sie so müde und niedergeschlagen; die Einsamkeit lastete so schwer auf ihr, daß sie aufatmete, wenn die Meisterin Käsmodel mit ihrem Laternchen erschien.
Auch heute raffte Madeleine von Steinberg hastig ihre Näherei zusammen und folgte der freundlichen Hausgenossin die steilen Treppen hinab in das durch das Ofenfeuer und eine Unschlittkerze traulich erhellte Stübchen. Die Meisterin strickte und bewunderte dazwischen höchlichst die Fältchen, Tollen und Schleifen, die unter Frau von Steinbergs geschickten Händen entstanden. »'s ist wirklich zum Anbeißen adrett, was Sie da nähen, aber freilich, die Lust vergeht einem schon an solchen Dingen, eine gar so böse Zeit ist's.« Die Bäckermeisterin seufzte tief. »Wohin man hört, gibt's Kummer. Draußen auf den Landstraßen soll man seines Lebens nicht mehr sicher sein.«
Am Schiebefensterchen nach dem Hausflur hin bimmelte die Klingel, und ein von der Luft gerötetes Mädchengesicht erschien [S. 11] daran. Ein Brot wurde verlangt, die Meisterin reichte es hinaus und erkundigte sich dabei gleich, ob die Madame Preußer wieder wohlauf sei.
»Die Madame ist wieder beisammen,« erzählte die Magd, »aber der Herr, der Herr! Gestern hab' ich ihn sagen hören, an nichts hätt' er mehr Freude, seit die Franzosenbagasch« —
»Halt Sie das Maul,« fuhr die sonst so sanftmütige Meisterin Käsmodel die Magd heftig an, »so was hört mer nicht, und wenn mer's hört, sagt mersch nicht! Verstanden?«
Die Magd riß ihre großen wasserblauen Augen weit auf vor Schreck, und ganz kleinlaut versicherte sie: »Ich sag nischte mehr, nie nich.«
»Das ist auch am besten,« brummte die Bäckermeisterin und wandte sich einer neuen Kundin zu, einem schmächtigen, verhutzelten Weiblein, das ganz scheu in eine Ecke gedrückt im dunklen Flur stand und kaum an das Schiebefensterchen zu treten wagte. »Na, was gibt's, Schmidten, soll's ein Brot sein?«
Die Frau wartete erst, bis die stattliche Magd gegangen war, dann trat sie vor und flüsterte mit heiserer, ängstlicher Stimme: »Wenn Se mer's borgen täten, Frau Meistern, nich en Groschen hab' ich im Haus!«
Die Bäckerin seufzte, und ihr Blick überflog die auf den Ständern aufgereihten Brote. Wie manches ging davon weg ohne Bezahlung. Ihr Mann schalt oft, sie sei zu weichherzig, bringe sie alle noch an den Bettelstab, aber was sollte sie tun? Die Frau dort am Schiebefensterchen hatte fünf Kinder daheim. Wo ihr Mann geblieben war, wußte niemand; er war in die Fremde gezogen, um einen Verdienst zu finden, als die harten Zeiten anfingen, und dort war er verschollen, vielleicht gestorben.
»Da, Schmidten, Gott segne es ihr und den Kindern,« sagte die Meisterin und legte rasch eins der Brote in die verlangend ausgestreckte Hand der Frau. Dann schloß sie, da keine Kunden mehr draußen standen, geschwind das Schiebefensterchen und kehrte zu ihrem Gast zurück.
Die beiden Frauen waren nach Stand und Bildung sehr verschieden voneinander, denn als Madeleine von Steinberg noch in Dresden die glänzenden Feste der Hofgesellschaft mitgemacht hatte, war Frau Käsmodel eine flinke, fröhliche Magd im Pfarrhause an der Kirche von St. Thomä gewesen, aber trotzdem verstanden sie sich gut mitsammen. Frau von Steinberg kannte Not und Entbehrung aus Erfahrung. Die Bäckermeisterin hatte zwar noch nie um ihr tägliches Brot gebangt, aber sie sah, wie ringsum die Armut wuchs, wie die Zeiten schlechter und schlechter wurden. Sie hatte auch tiefes Mutterleid erfahren: zwei Kinder waren ihr gestorben, und so wußten sich die beiden Frauen mancherlei zu sagen. Der Meisterin Käsmodel konnte die zarte, langsam dahinsiechende Bewohnerin aus der Mansarde auch von ihrer Sorge um ihres einzigen Kindes Zukunft sprechen.
Während die Mütter mal wieder über ihre Kinder sprachen, — die Bäckersleute besaßen noch zwei dralle runde Mädels von drei und vier Jahren, — saßen die beiden Buben zusammen auf einem Bänkchen im Backofenwinkel und lernten, daß ihnen die Köpfe rauchten. Seit einem Jahre besuchte Gottlieb das Gymnasium. Meister Käsmodel wollte seinem Buben eine gute Bildung geben lassen, er pflegte zu sagen: »Du mußt ebenso gescheit werden wie drei!« Zu dieser großen Gescheitheit verspürte Gottlieb nun freilich keine allzu große Lust, und er wäre vielleicht etwas schwer über die Anfänge der lateinischen Sprache [S. 13] hinweggekommen, wenn Raoul nicht gewesen wäre. Frau von Steinberg, die selbst eine sehr gute Bildung genossen hatte, unterrichtete ihren Sohn selbst; es war ihr unmöglich, ihn auf eine höhere Schule zu schicken. Als der Sohn heranwuchs, sah sie freilich, daß es zu wenig war, was sie den glänzend begabten Knaben lehren konnte, allein Raoul war so lerneifrig, daß er selbst voll Eifer aus den wenigen Büchern, die er besaß, lernte, was er vermochte. »Ich wollte, du könntest statt meiner dies alberne Latein lernen!« murrte Gottlieb einmal, als er seufzend und stöhnend die ersten Gymnasiumstage hinter sich hatte.
»Ich will mit dir lernen,« sagte Raoul dienstwillig, »vielleicht wird es dir dann leichter!«
Gottlieb hatte das Anerbieten gern angenommen, und seitdem arbeiteten die Knaben zusammen und merkten bald, daß sie beide Vorteil davon hatten. Was der Bäckerssohn in der Schule gelernt hatte, teilte er dem Freunde mit. Dabei wurde ihm selbst manchmal erst klar, was er nicht verstanden hatte; er paßte auch besser auf, um sich seiner Dummheit nicht schämen zu müssen, und wußte er einmal gar nicht weiter, dann fand sicher Raoul aus den Büchern den richtigen Weg, und so umschifften beide gemeinsam manche Klippe der lateinischen Grammatik und der andern Lehrbücher. Raoul sagte oft sehr vergnügt zu seiner Mutter: »Es ist beinahe so gut, als ob ich selbst auf das Gymnasium ginge.«
An diesem Abend hatten sich die Buben beide in die Geheimnisse der römischen Geschichte vertieft. Gottlieb ein wenig unlustig, er sah nämlich nicht ein, warum ein zukünftiger ehrsamer Bäckermeister die römischen Könige, Volkstribunen und Kaiser mit Namen kennen mußte, und daß er einmal Vater [S. 14] Käsmodels Beruf ergreifen würde, stand bei ihm fest. »Du,« brummte er und stieß den Kameraden an, »die kaufen doch mal keine Brote und Wecken bei mir, warum soll ich sie nun alle kennen?«
Raoul sah mit seinen ernsten Augen nachdenklich auf den Freund und sagte träumerisch: »Ich wollte, ich wär' ein Römer!«
»Nee,« rief Gottlieb verdutzt, »das hab' ich mir noch nie gewünscht, aber weißte, Soldat möchte ich werden und dem Napoljong feste de Jacke verhauen; dazu brauch' ich doch aber nicht alle diese eklichen Namen zu wissen.«
Das stimmte nun freilich, und der sonst so lerneifrige Raoul ließ auch für ein Weilchen das Buch sinken, denn jetzt waren die Knaben wieder mal bei dem allerbeliebtesten Gespräch angelangt: Napoleon und seine Kriege. Im Hause Meister Käsmodels war man alleweg gut deutsch gesinnt. Das Kriechen und Katzbuckeln vor Frankreich, das Verherrlichen des gewissenlosen Eroberers, das auch in Leipzig leider in manchen guten Bürgersfamilien geübt wurde, war dem ehrlichen, aufrichtigen Bäckermeister in der Seele zuwider. Er war zwar ein schlichter, ungelehrter Mann, aber er hatte einen hellen, klaren Verstand, und voll Schmerz sah er, wie tief der deutsche Stolz, das deutsche Vaterlandsgefühl am Boden lag; nach den Reden mancher Bürger hätte man meinen müssen, Sachsen gehöre von Gottes und Rechts wegen zu Frankreich. In widerlich schmeichelnden Lobeshymnen sang man Bonapartes Lob, und man hatte ganz vergessen, daß es Deutsche waren, Stammesgenossen, die von Napoleon geknechtet wurden. Der Kaiserhaß, der Abscheu vor dem französischen Übermut hinderte dabei die Bäckersleute nicht, ihrer Hausgenossin, der Französin, in Treue hilfreich beizustehen. [S. 15] »Denn,« pflegte der Meister Käsmodel zu sagen, »der einzelne Mensch, der meine Hilfe braucht, ist alleweil mein Nächster, und wenn man über ein Volk auch gerade vor Wut bersten möchte, kommt uns einer davon in die Quere, so ist es eben Christenpflicht zu helfen, wenn man kann. Na, und so'n armes Weiberseelchen hat in der lieben Gotteswelt noch keinem ein Unrecht getan. Pfui Teufel, wäre das ruppig, der nicht beizustehen!«
In diesem Geist wuchsen die Kinder auf, und sie vertrugen sich so gut zusammen, daß nie ein Streit die Freundschaft trübte. Gottlieb bewunderte Raoul restlos. Der war ein Idealist, ein Feuerkopf, der von hohen Taten träumte, und manchmal staunte der praktische, ein bißchen schwerfällige Bäckerssohn über des Freundes kühne, hochfliegende Zukunftspläne.
»Warum ist man nur noch so jung!« schrie Raoul plötzlich in hellflammender Tatensehnsucht auf.
»Allweil nu möcht ich wissen, warum der Musjeh zu jung ist?« fragte Meister Käsmodel, der gerade wieder eintrat. »Jugend ist alleweil der einzige Fehler, von dem man jeden Tag 'n Linschen ablegt.«
»Ich möchte groß sein, Soldat sein und in den Kampf gegen Napoleon ziehen können!« rief Raoul.
»Jetzt ist Frieden,« brummte der Meister, »Frieden, ihr Bengels, aber merkt's: alleweil ist's mit dem Frieden jetzt so wie mit meiner Backofenglut. Wenn ich nicht backe, decke ich Asche drauf, viel Asche, und nachher, wenn ich wieder Feuer brauche, stöbere ich die Asche weg, ein paar Scheite drauf, und heissa, das Feuer brennt!«
»Das Feuer brennt!« schrieen die Knaben unwillkürlich mit, die Frauen aber schraken zusammen, und die Bäckermeisterin bat [S. 16] ängstlich: »Mann, Käsmodel, setz den Jungens doch nicht solche Gedanken in'n Kopf, man weiß heute nie, was draus wird.« Sie sah sich scheu um. »Man muß vorsichtig sein.«
»Ih was,« knurrte der Meister, »Glut muß bleiben — bis die Zeit zum Backen kommt! Hab' ich nicht recht, Frau Nachbarin?«
Frau von Steinberg schloß sekundenlang die Augen; sie sah sich wieder am Sterbebett ihres Mannes stehen und hörte ihn mit versagender Stimme rufen: »Die Schmach muß ausgewetzt werden, vergiß es nicht, vergiß es nie!« — und ganz leise sagte sie: »Sie haben recht, Meister, die Glut muß bleiben — bis die Zeit kommt.«
Dann legte sie ihre Arbeit zusammen und nahm Abschied von ihren freundlichen Wirtsleuten, es war Zeit zur Nachtruhe. Raoul folgte bereitwillig der Mutter. Er hoffte noch auf ein Plauderstündchen, um ihr von allem zu erzählen, was er auf seinem Botengange gesehen und was er mit Gottlieb gelernt hatte, aber oben sagte die Mutter sanft, und ihre Stimme klang unendlich müde: »Erzähl mir morgen alles, Raoul, ich brauche heute Ruhe.«
Es dauerte nicht lange, und der Bube lag im Bett und schlief auf dem harten Strohsack fest wie ein Murmeltier. Seine Mutter aber fand keinen Schlaf. Brust und Rücken schmerzten, sie fror, und quälender noch als Schmerzen und Kälte peinigte sie der Gedanke an die Zukunft. Wieder wie so oft in den langen Wochen, da sie fühlte, daß ihre Kräfte mehr und mehr abnahmen, dachte sie an die Verwandten ihres Mannes, an seinen Bruder auf Hohensteinberg und — an seine Mutter. Sie hatte, seit sie selbst Mutter war, oft gedacht, daß sie und [S. 17] ihr Mann damals wohl zu rasch das Werben um die Verzeihung der alten Frau aufgegeben. Die hatte sie ja nicht gekannt, nichts von ihr gewußt, fremd war sie ihr, — wie durfte sie da gleich Liebe fordern! Vielleicht hätte die Mutter ihr gern geholfen, sie verstanden. Und wieder rang sie mit ihrem Stolz und nahm sich vor, an die Mutter, den Schwager zu schreiben und um Hilfe zu bitten, nicht mehr für sich, aber für ihren Sohn, damit er nicht verlassen und schutzlos war, wenn sie von ihm gehen mußte — vielleicht würde das bald sein, sehr bald.
Ein tiefes Stöhnen entrang sich der schmerzenden Brust der armen Frau, und Raoul, der im Winkel unter dem schrägen Dach schlief, wachte auf. »Riefst du mich, Mama?« Doch alles blieb still, vom Bett der Mutter kam keine Antwort, und so huschelte sich Raoul beruhigt wieder in seine Decke ein und schlief seinen festen, gesunden Jugendschlaf weiter.
Die Frau preßte die Lippen fest zusammen, damit kein Klagelaut wieder den Schlaf ihres Kindes stören sollte, über ihr Gesicht aber rannen Tränen, bittere, schwere Tränen. Draußen hatte sich der Wind erhoben, er sauste und brauste um die hohen, spitzgiebligen Häuser herum, drehte knarrend die Wetterfahne auf dem Dach und klapperte an der Dachrinne. Die Frau hörte das wilde Lied und dachte an den Sturm, der ihr Glück vernichtet hatte. Jetzt schwieg er, Friede herrschte, aber wie lange noch? Erst gegen Morgen, als sich auch draußen der Sturm legte, schloß der Schlaf für wenige Stunden die müden Augen, und ein heiterer Traum entführte ihre Seele für kurze Zeit der trüben, schweren Gegenwart.

»Mit der Frau von Steinberg steht's nicht gut, Mann,« sagte die Meisterin ein paar Tage später, als ihre Hausgenossin gerade von einem Ausgang zurückkehrte und langsam, die schlanke Gestalt vornübergeneigt, den dämmrigen, schmalen Flur durchschritt.
»Ach, Unsinn! Weiberleut müssen sich allweil ängstigen,« knurrte der behäbige Bäcker, aber auch er sah der bleichen Frau ernst nach. Stufe auf Stufe stieg diese die Treppe empor. So himmelhoch und endlos wie heut waren sie ihr noch nie erschienen. Sie hatte an diesem Tage selbst eine Haube forttragen müssen zu einer wohlhabenden Kaufmannsfrau, die verlangt hatte, sie solle ihr das Kunstwerk gleich einmal aufsetzen.
Der Weg bei dem rauhen, unwirtlichen Wetter war Madeleine von Steinberg sehr schwer geworden, und als sie auf der zweiten Treppe angelangt war, mußte sie sich einen Augenblick an die Wand lehnen; fast unmöglich erschien es ihr, hinaufzukommen, noch so viele Stufen, noch die mühsame Leiter gab es zu erklimmen.
»Mama, was fehlt dir?« Raoul von Steinberg fuhr ein paar Minuten später erschrocken auf und ließ das Buch, in dem er gelernt hatte, zu Boden fallen. »Um Gotteswillen, Mama, Mutter!«
»Ich — es ist nichts, mein Junge, mein — armer Junge!« Die Frau taumelte und wäre zu Boden gefallen, wenn nicht des Knaben starke junge Arme sie gehalten hätten.
Ein Hilferuf gellte durch das Haus, ein weher, verzweifelter Angstruf. Er drang auch hinunter in das warme Bäckerlädchen, schreckte die Meisterin auf und trieb Gottlieb aus seinem Ofenwinkel heraus. Der Meister kam auch, die Magd mit den beiden Kleinen lief herzu, oben im Hause, in dem ein Warenlager untergebracht war, wurden Türen geschlagen, man hörte rufen, und dann stand von allen Hausgenossen doch die rundliche Bäckermeisterin zuerst oben im Mansardenstübchen, hinter ihr tauchte Gottlieb auf, und beide sahen Frau von Steinberg wachsbleich, mit blutbeflecktem Kleid in Raouls Armen liegen.
»Die Mutter stirbt,« schrie der Knabe verzweifelt, und seine heißen Tränen mischten sich mit dem roten Blut der Mutter, das tropfenweise dem blassen Munde entströmte.
Die Meisterin griff herzhaft zu, und als nach wenigen Minuten auch die andern Hausgenossen im Zimmer erschienen, trieb sie alle hinaus, nur die Magd durfte bleiben und die Kranke in ihr Bett legen helfen. Gottlieb rannte zu einem Arzt, der in der nahen Nikolaistraße wohnte, und Raoul saß im Winkel und sah mit heißer Angst zu, wie die Meisterin die Mutter bettete, sie rieb und mit warmen Tüchern umwickelte. Auf seinem Herzen lag dumpf und schwer die Ahnung kommenden Leides.
Bange Tage folgten, lange Wochen des Leidens kamen, Frau von Steinberg siechte langsam dahin. Wohl stand sie nach etlichen Tagen wieder auf und machte den Versuch, wenigstens die bestellten Arbeiten zu vollenden, aber es war nur ein mühsames Ringen mit versagenden Kräften. Immer wieder entsank die Nadel ihren müden Händen, immer wieder mußte sie stundenlang still auf ihrem Lager ruhen, unfähig, auch nur etwas zu tun.
Raoul pflegte, von der Meisterin Käsmodel tatkräftig unterstützt, seine Mutter, so gut er nur konnte. »Du mußt ihr eine Stütze sein, darfst selbst nicht klagen und nicht trübselig dreinschauen,« hatte die Meisterin zu ihm am ersten Tage der Krankheit gesagt, und danach richtete sich der Knabe, wenn es ihm auch noch so schwer fiel. Er nahm seiner Mutter alle Arbeit in der kleinen Wirtschaft ab, er kehrte, wusch und kochte wie eine Dienstmagd, und dann rannte er draußen noch stundenlang herum und tat Botengänge für kargen Lohn. Die Geschäfte gingen schlecht, die Not der Zeit drückte alles nieder, jeder sparte, wo er konnte, und recht gering war das, was da ein halbwüchsiger Junge verdienen konnte. Er brachte jeden Pfennig mit strahlendem Gesicht heim, noch ahnte er ja nicht, wie schwer die Sorge auf der Mutter lag. Aber dann, an einem hellen, sonnigen Februartag war es, der wie ein erster heiterer Frühlingsgruß über die Erde ging, mußte Frau von Steinberg doch das erste Goldstück ihres heimlichen kleinen Schatzes nehmen. Sie konnte ihren Sohn nicht hungern lassen, sie wollte aber auch nicht von den gutherzig gegebenen Gaben der Bäckersleute leben, dazu war sie zu stolz.
»Zahl' unten die Miete und das Brotgeld! Käsmodels [S. 21] wollen es nicht, ich will aber nichts schuldig bleiben, Raoul,« sagte sie leise, und eine Träne fiel brennend auf die ausgestreckte Hand des Sohnes.
Tief erschrocken sah der Knabe aus, und in diesem Augenblick verstand er voll die Sorge der Mutter. In wild ausbrechendem Schmerz schlang er seine Arme um sie und flehte: »Weine nicht, ach, weine nicht! Im Frühling wird alles gut, du wirst gesund, und ich finde schon einen Verdienst.«
»Im Frühling — ja,« flüsterte die Mutter und küßte zärtlich ihr Kind, »du hast recht, dann wird alles gut.«
Ach, sie fühlte es ja gerade an diesem sonnigen Tage, der von dem kommenden Lenz zu erzählen wußte, daß ihre Stunden auf der Erde gezählt waren, und daß sie nicht mehr lange über ihrem Kinde wachen konnte. Und als Raoul gegangen war, überwand sie endlich ihren Stolz und schrieb an den Bruder ihres Mannes, an den Freiherrn Wolf-Friedrich von Steinberg auf Hohensteinberg, schilderte ihm ihre Lage und bat ihn, sich ihres Kindes anzunehmen, wenn sie tot sei. Sie schloß auch ein Brieflein für die Mutter mit ein. Für sich bat sie um nichts, nur Hilfe für den Sohn wollte sie. Den Brief trug die Meisterin Käsmodel selbst auf die Post, zahlte das Porto und sandte dem Schreiben ihre guten Wünsche nach, denn sie billigte im innersten Herzen den Schritt, den ihre Mieterin getan hatte. Sie ahnte nicht, daß ein böses Geschick den Brief tief im Grunde eines Postsackes festhielt, viele, viele Wochen lang.
Ein paar Tage später stürmte Raoul am Nachmittag hastig und aufgeregt in das Zimmer. »Mama,« rief er, »Herzensmama, denke doch, ach denke doch, welch ein Glück mir widerfahren ist!« Er umschlang stürmisch die bleiche Mutter, und an [S. 22] ihr vorbeisehend, damit sie ihm nicht in die Augen blicken konnte, denn die sahen gar nicht glücklich aus, erzählte er hastig: »Der Meister war mit mir beim Advokaten Schnabel in der Burgstraße; dem ist sein junger Schreiber davongelaufen, und der Meister meinte, schreiben könnte ich so gut wie er backen. Wir sind also hingegangen, und der Herr Advokat hat uns vorgelassen. Der hat gleich geschrieen: ›Das ist ein Kind, der ist zu jung, zu jung, zu jung, 's ist nichts damit!‹«
Bei der Erinnerung an diese Szene kam in Raouls Augen nun doch das Lachen. Er blickte seine Mutter froh an, als er fortfuhr: »Meister Käsmodel hat sich einfach auf einen Stuhl gesetzt, und allemal, wenn der Herr Advokat schrie: ›Zu jung, zu jung,‹ hat er genickt, und endlich hat er gesagt: ›Alleweil jetzt, Herr Advokat, ist der Junge schon etwas älter geworden, und Jugend hat noch nie jemanden geärgert, höchstens das Altwerden.‹ Erst machte der Herr Advokat ein ganz bitterböses Gesicht, dann fing er an zu lachen. Ich mußte schreiben, das gefiel ihm, und nun, Mama, bin ich angestellter Schreiber und bekomme — zwei Taler vorläufig auf den Monat. Ist das nicht schön? freust du dich auch?«
»Sehr schön,« flüsterte Frau von Steinberg, »ich freue mich sehr, mein guter Junge du.« Sie kämpfte krampfhaft die aufsteigenden Tränen zurück, und Mutter und Sohn hielten sich lange umschlungen. Sie sahen sich nicht in die Augen, denn jedes fürchtete den heimlich getragenen Schmerz sehen zu lassen. Ein Freiherr von Steinberg, Enkel des Grafen Turaillon, eines der vornehmsten Würdenträger am Hofe Ludwigs XVI., ein Schreiberlein mit zwei Talern Monatsgeld. Der Mutter zog sich das Herz zusammen, wenn sie daran dachte, und sie sah sich im Geist mit [S. 23] dem geliebten Gatten an der Wiege ihres Kindes sitzen und hörte wieder die so früh verklungene Stimme: »Mein Sohn soll einmal dem Namen Steinberg Ehre machen,« und nun mußte dieser Sohn als armes Schreiberlein ein kümmerliches Brot verdienen.
Raoul sollte am nächsten Morgen bereits seine Stellung antreten. Die Meisterin hatte ihm versprochen, sie wollte für seine Mutter sorgen, aber er stand doch noch früher als sonst auf und fegte erst die Stube aus, kochte fürsorglich die Morgensuppe für die Mutter und sich, und dann eilte er rasch nach kurzem Abschied davon. Er hatte es nicht weit, und geschwind lief er über den Marktplatz, bog in ein schmales Gäßchen ein und langte bald in der Burggasse an. Dort kletterte er eilfertig in einem uralten Hause zwei enge Treppen empor und zog die Klingel an Advokat Schnabels Wohnung. Eine Magd öffnete und brummte unwirsch: »Jemineh, der neue Schreibbursche! Nee, so'n Dreikäsehoch aber auch! Da hast'n Besen, nun kehre mal flink die Schreibstube aus. Rasch, rasch, tummle dich, sieh nicht erst 'n Loch in die Türe!«
Raoul stieg das Blut in das Gesicht. Er war ein stolzer, kleiner Bursche, und es demütigte ihn tief, daß er solche Dienste verrichten sollte und sich von der Magd so grob anfahren lassen mußte. Am liebsten wäre er gleich umgekehrt, aber er preßte die Lippen fest aufeinander, um nicht eine patzige Antwort zu geben. Das Zimmer, das er betrat, lag nach dem Hof hinaus, die graue Rückwand eines Hauses nahm jede Aussicht, nur wer sich weit aus dem Fenster bog, der konnte den Turm der nahen Thomaskirche aufragen sehen. Einen Augenblick blieb Raoul unschlüssig an der Türe stehen und überschaute den Raum, der [S. 24] ihm fortan tagaus, tagein Aufenthaltsort sein sollte. Bis zur Decke hinauf krochen die Ständer, angefüllt mit dicken Aktenbündeln, ein paar von Tintenflecken übersäte Tische standen dicht an den Fenstern, deren Scheiben gewiß lange nicht geputzt waren. Seufzend begann Raoul mit dem Auskehren, er dachte dabei immer nur: Zwei Taler, zwei Taler, wie wird sich die Mutter freuen!
Er war noch nicht mit seiner Arbeit fertig, denn Staub und Schmutz lagen dick in allen Winkeln, als die Türe mit einem lauten Krach geöffnet wurde und zwei noch junge Männer hereinkamen. Der eine war lang und dünn, sein Gesicht, seine Hände, sein Anzug sahen grau, ungewaschen und ungebürstet aus; der andere war klein, verwachsen, er hatte etwas Zartes, Sanftes in seiner ganzen Erscheinung. Der Lange schaute Raoul von oben bis unten an; er kniff dabei die Augen zusammen, und der Knabe erschrak vor dem unangenehmen Ausdruck des Gesichtes. »He, ist er der Neue, wie heißt er denn?«
Raoul sagte ruhig seinen Namen, ohne den Adel, den er auf Wunsch des Advokaten selbst nicht nannte, und sah dabei mit seinen schönen, dunklen Augen offen zu dem langen Schreiber empor. Der grinste und schrie dem Verwachsenen zu: »Ein halber Franzos! Du Napoleonfresser, das ist was für dich, hihihi! Da, junger Dachs, nehm er meinen Rock, mein Schreibkittel hängt dort im Schrank. Flink, er weiß wohl gar nicht, was sich gehört?«
Der Verwachsene war still an den Schrank getreten, hatte einen abgeschabten, zerflederten Rock herausgenommen, der so schmutzig war, daß Raoul sich ekelte, ihn anzugreifen. Den reichte er dem Knaben, damit er ihn dem Langen brächte, er selbst zog [S. 25] sich ein paar Schreibärmel über, und da gleichzeitig im Nebenzimmer Schritte laut wurden, eilten die Schreiber an ihre Plätze. Der Lange, der Paul Neumann hieß, wies Raoul grob einen Platz neben sich an, aber kaum saß der Knabe und hatte begonnen, mit dem Gänsekiel ein Aktenstück zu kopieren, als ihn sein Nachbar anfuhr: »Trag das hinüber, flink, marsch! Er schläft wohl?«
Da schrak Raoul so zusammen, daß ein dicker Klecks auf sein Papier tropfte, und ein Hagel von Scheltworten brauste auf ihn herab. Er hörte Worte, die er noch gar nicht kannte, die roh und gemein in seinen Ohren gellten. Er war froh, als ein paar Leute kamen und der lange Schreiber in das Nebenzimmer gerufen wurde. Den ganzen Vormittag ging das so fort: einer nach dem andern kam, und Paul Neumann lief wichtig hin und her, er war einmal von unterwürfiger Höflichkeit zu den Klienten seines Herrn, das andere Mal grob und hochfahrend, dann wieder vertraulich, machte alberne Späße, je nach Rang und Stellung der Kommenden.
Der kleine Verwachsene, Karl Wagner genannt, blieb immer ruhig an seinem Tisch sitzen und schrieb emsig. Raoul, der die Arbeit des andern übersehen konnte, staunte, wie schnell sich in schöner, klarer Schrift Wort an Wort reihte. Der Verwachsene sprach nichts, nur ein paarmal warf er seinem jungen Genossen einen guten, freundlichen Blick zu, einen, der zu trösten und aufzumuntern schien. Aber dennoch war es dem Knaben, als schlichen an diesem Tage die Stunden unendlich langsam dahin, und er atmete erleichert auf, als mit tiefem Dröhnen der Schall der Mittagsglocke in die Schreibstube hineintönte.
Raoul hatte gemeint, er würde nun eilig davonlaufen [S. 26] können und mit der Mutter die karge Freistunde genießen; das gab es aber nicht. Erst mußte er noch für Paul Neumann einen Gang tun, und es waren schon zehn Minuten seiner Freizeit verronnen, ehe er heimwärts laufen konnte. Dann rannte er freilich wie der Wind, und heiß und atemlos kam er oben im Mansardenstübchen an. Kaum sah er der Mutter in das liebe, sanfte Gesicht, da wurde es ihm auch wieder leicht ums Herz, und ganz heiter erzählte er von seinem ersten Vormittag als Schreiberlein. Ja, nun er nicht mehr in der Schreibstube saß, erschien ihm alles, was er gesehen und erlebt hatte, recht lustig und abwechslungsvoll zu sein, und er schwatzte so munter drauf los, daß ein Lächeln das Gesicht der Mutter verklärte.
Aber waren die Vormittagsstunden wie Schnecken dahingeschlichen, so raste die Freistunde vorbei wie ein wild gewordenes Pferd. Es hieß wieder scheiden, und Raoul nahm zärtlich Abschied. Er rannte zurück, und als er das graue Haus in der Burgstraße wieder betrat, war es ihm, als sinke eine schwere, schwere Last auf ihn herab.
Mit der Arbeit schien es am Nachmittag, solange der Advokat selbst nicht in seinem Zimmer war, gar nicht eilig zu sein. Karl Wagner schrieb zwar still und unverdrossen weiter, aber der lange Neumann hatte die Feder hinters Ohr gesteckt und redete laut von allerlei, und Raoul mußte ihm zuhören und antworten. Der Schreiber gehörte zu jenen, die in kriechender Schmeichelei Napoleon huldigten; er hatte sogar ein Gedicht angefangen, in dem er seinen Helden verherrlichte, zu seiner großen Betrübnis wollte ihm aber das Dichten nicht gelingen. »Kannst von Glück sagen, Bursche,« meinte er an diesem Nachmittag mit herablassendem Grinsen, »daß du einen französischen Vornamen [S. 27] hast. Ist doch was Feines! Aber ich, wenn ich auch nur einen elenden deutschen Namen führe, habe doch einmal den Kaiser gesehen, habe ihn gegrüßt und er hat mir gedankt! He, was sagt er zu der Ehre, Musjeh? Bewunderst ihn auch, gelt?«
»Ich? Nein,« schrie Raoul. Er war jung und unbesonnen und wollte gerade rasch und heiß seine Verachtung aussprechen, als ihn Karl Wagner ganz scharf anrief: »Reich mir dort den Aktenstoß her! Schnell, scheinst mir ein rechter Faulpelz zu sein!«
Erschrocken sprang Raoul auf, von dem sanften Genossen hatte er einen so groben Anruf nicht erwartet, und holte hastig das Gewünschte herbei. In diesem Augenblick ertönte nebenan eine Stimme, und der Advokat rief: »Neumann, die Akten Müller gegen Hohmann!«
Der Lange raffte geschwind ein Aktenbündel zusammen und entschwand im Nebenzimmer, Karl Wagner aber zog Raouls Kopf zu sich herab und flüsterte: »Halt deinen Mund, Junge, und hüte dich vor dem Neumann, sag' nichts gegen Napoleon!«
»Aber ich hasse ihn doch, er ist ein Tyrann, er —« Raouls Augen flammten; er war es nicht gewöhnt, seine Gedanken und Gefühle zu verschweigen. Daheim und bei Meister Käsmodel durfte man schon ein freies Wort sagen. Aber der Verwachsene legte ihm rasch die Hand auf den Mund: »Schweig, mein Kind, wir müssen stille sein und warten, bis die Zeit kommt. Und sie kommt,« fügte er hinzu; seine graublauen Augen leuchteten begeistert, das blasse kümmerliche Gesicht erstrahlte und schien dem Knaben auf einmal seltsam schön und anziehend zu sein. Er hätte gern noch mehr mit Karl Wagner gesprochen, aber der lauschte eine Sekunde nach dem Nebenzimmer hin und sagte dann leise: »Geh an deine Arbeit.«
Als kurze Zeit darauf der lange Neumann in das Zimmer trat, herrschte tiefe Stille. Die beiden schrieben eifrig, und Karl Wagner schien seine mißtrauischen Blicke nicht zu merken. Da der Advokat nebenan blieb und die Türe offen stand, konnte das Gespräch nicht fortgesetzt werden, denn Paul Neumann war immer dann fleißig, wenn es sein Herr sah, war der nicht daheim, rührte er keine Feder.
Wieder schlichen die Stunden langsam, träge dahin, und Raoul sehnte den Abend herbei. Dieser erste Arbeitstag war ihm bitterschwer geworden, aber dennoch trat er auch am Abend heiter bei der Mutter ein. Er schwatzte ein bißchen lauter und aufgeregter als sonst und ahnte nicht, daß die Mutteraugen tief in sein Herz hineinsahen und hinter aller erzwungenen Fröhlichkeit doch die Last sahen, die auf den jungen Schultern ihres Kindes ruhte.
Raoul dachte jetzt oft: Sind die Tage lang, und sind die Sonntage und Abende kurz! Wenn er bei der Mutter saß und die fiebrige Röte aus den eingefallenen Wangen kindlich für ein Zeichen wiederkehrender Gesundheit nahm, oder wenn er mit Gottlieb lernte und sie sich gegenseitig ihre Erlebnisse erzählten, dann war er glücklich und vergaß die düstere Schreibstube und seines langen Genossen Quälereien.
Paul Neumann hatte es, trotzdem Raoul schwieg, doch bald herausbekommen, daß der Bube kein Kaiserbewunderer war. Seitdem quälte und peinigte er ihn noch mehr, als er es sonst getan hätte. Der lange Schreiber war wohl unendlich demütig zu denen, die über ihm standen, aber er ließ gleich alle seine Roheit aus an denen, über die er Gewalt hatte, denen er befehlen durfte. Er war in der Schreibstube der Erste, und es half Karl Wagner nicht viel, wenn er Raoul in Schutz nahm; [S. 29] nur ganz heimlich durfte er dem Knaben helfen. Sah Paul Neumann das Einverständnis, dann rächte er sich und jagte Raoul hin und her, namentlich in der Mittagsstunde, und es kam oft genug vor, daß dem Knaben nicht einmal so viel Zeit blieb, zur Mutter zu laufen und sein Mittagbrot zu essen.
Endlich kam aber doch der Tag, an dem Raoul seine ersten zwei Taler nach Hause tragen konnte. Aber gerade an diesem Abend hielt ihn Neumann mit allerlei Aufträgen zurück, und Minute auf Minute verrann. Raoul zitterte vor Ungeduld heimzukommen, und er atmete erlöst auf, als der Advokat selbst kam und noch einmal seinen ersten Schreiber sprechen wollte. Da entwischte Raoul, obwohl er wußte, daß er es morgen doppelt schwer haben würde. Wie der Wind jagte er die steilen Treppen hinunter, die Burgstraße entlang, durch die Gäßchen über den Marktplatz. Er jagte so, die beiden Taler krampfhaft in der Hand, daß er den dicken Metzgermeister Mayer, der just zu einem Abendschöpplein gehen wollte, beinahe über den Haufen rannte. Bums! stieß er an dessen Bauch, es dröhnte ordentlich, und wütend holte der Meister zu einer gewaltigen Ohrfeige aus, aber hui, ging die in die Luft, denn Raoul war schon fort, die dunklen Laubengänge des Rathauses verbargen ihn den zornigen Blicken des Meisters. Atemlos kam er oben an. Die letzten Stufen der steilen Treppe hastete er so empor, daß er beinahe wieder hinuntergefallen wäre, und dann stand er vor seiner Mutter und hielt ihr stumm, glückstrahlend die beiden Taler hin.
Frau von Steinberg nahm sie wortlos, und wortlos umschlang sie ihr Kind, und Raoul fühlte, wie heiße Tropfen auf seine Stirne niederrannen. »Mama,« flehte er bang, »Mama, freue dich doch!«
»Ich freue mich, mein lieber, tapferer Junge du,« hauchte die Frau, kaum fähig, sich noch aufrecht zu halten. Ein Schwindel überfiel sie, und der Knabe mußte sie stützen und auf ihren Stuhl zurückleiten. »Bist du wieder krank?« forschte er angstvoll, »soll ich die Frau Meisterin heraufholen?«
»Nein, nein, ich bin gesund, ganz gesund, nur die Freude war es — allein die Freude,« murmelte die Mutter und strich liebkosend über ihres Kindes braunes Gelock. »Gott segne dich, mein Sohn, du mein Glück!«
Viel später dachte Raoul noch oft an diese Stunde zurück, an diesem Abend ließ die Freude, daß der erste Monat vorbei war, die ersten zwei Taler errungen waren, keine trüben Gedanken in ihm aufkommen. Er war sehr vergnügt, vergaß alle Quälereien des langen Schreibers und brachte mit seiner Heiterkeit zuletzt auch die Mutter zum Lachen. —
Weil es Frau von Steinberg jetzt so schwer fiel, die Treppen zu steigen, kam nach dem Abendbrot noch oft die Meisterin hinauf, mit einem Eimerchen glühender Holzkohlen beladen. »Weil es unten sonst unnütz verbrennt,« sagte sie jedesmal entschuldigend, damit die Hausgenossin nur ja nicht merken sollte, daß sie immer darnach trachtete, ihr eine warme Stube zu verschaffen. Auch Gottlieb folgte der Mutter an diesem Abend, und nach einem Weilchen tappte selbst Meister Käsmodel die Stiege herauf, und alle drei bewunderten ehrlich und herzlich den verdienten Reichtum.
»Aus dem wird allweil noch mal was,« sagte der Meister schmunzelnd zu Frau von Steinberg, »das ist gute Art.«
Dankbar sah die Mutter zu dem biederen Manne auf; die Freude über ihren Sohn, die feste Zuversicht, daß er eines tüchtigen [S. 31] Vaters Ebenbild werden würde, ließ sie an diesem Abend heiterer in die Zukunft sehen. Ein heller Glanz kam in ihre Augen, ihr Lachen mischte sich leise und froh in das der anderen, und die Meisterin sagte nachher zu ihrem Mann: »Vielleicht irrt der Doktor sich doch, und Frau von Steinberg wird gesund.«
Daß nach einem frohen Abend nicht immer ein heiterer Morgen folgt, merkte Raoul am andern Tag. Als er ging, schien ihm die Mutter wieder schwächer und matter als sonst zu sein, und als er das Schreibzimmer betrat, kam es ihm auch noch düsterer und dumpfiger vor als sonst, denn draußen braute ein dicker Nebel, und nur karges Licht fiel in das Gemach. Grau wie der Nebel draußen war auch Herrn Paul Neumanns Laune: er war an diesem Morgen entschieden mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Die Magd, zu deren Tugenden die Ordnung nicht gehörte, hatte vor der Türe einen Wischlappen liegen lassen, über den stolperte der lange Schreiber in das Zimmer hinein, und bei dem Versuch, sich an einem Stuhl festzuhalten, plumpste er mit samt dem Stuhl um und rutschte, so lang er war, in das Zimmer hinein.
Diesem bösen Anfang folgte eine Flut von Schimpfworten, die alle Raoul galten. »He, er spitznasiger, eingebildeter Zierbengel er, warum ist er gestern abend weggelaufen, he? Er hat wohl die Faulkrankheit, was? Denkt wohl, so ein Sündengeld verdient man mit Herumvagabondieren?«
Raoul sagte kein Wort, er wußte genau, daß eine Widerrede oder der leiseste Versuch, sich zu verteidigen, nur die Sache verschlimmern würde.
»Laß ihn sich austoben,« hatte einmal Karl Wagner geraten, aber an diesem Morgen dauerte das Toben recht lange. [S. 32] Zum Unglück war der Herr Advokat selbst nicht da, so konnte der lange Schreiber schimpfen und schreien nach Herzenslust, und Raoul bekam so viele Schelte, so viele harte Worte zu hören, daß es ihm war, als prassele ein Hagelwetter auf ihn herab.
Endlich, endlich, nachdem er dies hatte tun müssen und jenes holen, konnte er sich an seinen Arbeitsplatz setzen. Eben setzte er an, um zierlich und fein geschnörkelt einen Satz zu beginnen, als Paul Neumann ihn unsanft an den Arm stieß. Ein Schrei, und über den großen Aktenbogen rann eine dunkle Tintenflut.
»Was hat er da wieder angerichtet, er Dummerjan?« schrie der Schreiber wütend, aber da klang plötzlich ganz ruhig in das Schreien hinein Karl Wagners Stimme: »Du hast ihn gestoßen, er kann nichts dafür!«
Der kleine Verwachsene hatte zwar schon oft die Erfahrung gemacht, daß seine Verteidigung dem armen Schreiberlein wenig nützte, er brachte es aber nicht fertig, zu dieser Ungerechtigkeit zu schweigen, und just wollte er noch etwas sagen, als eine mächtige Ohrfeige auf Raouls Wange herniedersauste. »Will doch sehen, ob der nicht Strafe bekommt, der sie verdient,« rief der Lange zornig.
Mit einem Schrei war Raoul emporgefahren, Tränen der Wut und Scham entstürzten seinen Augen. »Ich lasse mich nicht schlagen,« schrie er, »ein Steinberg läßt sich nicht schlagen!« In leidenschaftlichem Zorn wollte er sich auf seinen Peiniger stürzen, aber da fühlte er sich von hinten festgehalten, und Karl Wagners ernste, graue Augen sahen ihn mahnend, liebevoll an. »Sei ruhig!« und ganz leise, nur ihm verständlich, klang es an sein Ohr: »Denk an deine Mutter!«
Stumm senkte Raoul den Kopf. Die Mutter, ihre Freude gestern, sein Stolz, seine Hoffnung, ihr immer mehr eine Stütze werden zu können, — alles fiel ihm ein. Er mußte still sein, aushalten, sein Amt durfte er nicht verlieren.
»Die Madame läßt sagen, das wär'n Lärm wie auf der Messe und nicht wie in 'ne anständige Schreibstube, und sie würd's dem Herrn berichten,« kreischte mit einemmal die Magd in das Zimmer hinein, und schwapp krachte sie die Türe mit solcher Gewalt wieder zu, daß leise der Kalk von den Wänden herabrieselte.
»Da sieht er's, was er angerichtet hat,« knurrte Neumann, dem es sehr unangenehm war, daß man drinnen in der Wohnung des Advokaten den Lärm gehört hatte. Herr Schnabel pflegte in solchen Fällen nicht ihn allein nach dem Grund zu fragen, und daß Karl Wagner nicht auf seiner Seite stand, fühlte er. Darum hielt er es für besser zu schweigen, der Blick aber, den er Raoul zuwarf, verhieß nichts Gutes für die Zukunft.
Als der arme, kleine Schreiber zu Mittag heimeilen wollte, — die Schreibstube war trotz des Langen Zorn zu rechter Zeit geschlossen worden, — hielt Karl Wagner ihn fest. »Komm mit mir,« sagte er freundlich. »Hast du ein paar Minuten Zeit?«
Raoul nickte nur, er konnte nicht sprechen, die gewaltsam unterdrückten Tränen erstickten ihn fast, und der Gedanke, so niedergeschlagen und gedemütigt vor seine Mutter treten zu müssen, lastete schwer auf ihm. Er war zum erstenmal froh, daß der Heimweg hinausgeschoben wurde, und willig folgte er Karl Wagner in die nahe Thomaskirche, die dieser durch eine Seitenpforte betrat.
Die Kirche war völlig leer. Das trübe Licht des Nebeltages [S. 34] fiel nur matt durch die bunten Fenster in den gewölbten Raum, den ein schönes, sanftes Klingen durchrauschte. Jemand spielte die Orgel, der Kantor von Sankt Thomas, Herr Müller, war es, wie Karl Wagner leise seinem Schützling zuflüsterte. Vorsichtig, den Schall der Schritte dämpfend, gingen die beiden bis in das Mittelschiff und setzten sich dort nieder.
Raoul war noch nie in einer leeren Kirche gewesen, er hatte auch noch nie ein so wundervolles Orgelspiel gehört.
»Den Anfang, Mitt' und Ende, ach Herr, zum besten wende,« sang Karl Wagner ganz leise die Worte des Liedes nach, das oben der Kantor spielte.
Immer rauschender und voller, wie Bittgesang und Dankesjauchzen tönte es durch die Kirche, und ganz wundersam feierlich wurde es dem armen, geplagten Schreiberlein ums Herz. Sein Kopf sank leise an die Schulter des Verwachsenen, und die schmerzlichen Tränen, die er vorher krampfhaft herabgeschluckt hatte, rannen und rannen, und als sie endlich versiegt waren, da konnte er den Kopf wieder heben und wieder frei und mutig um sich schauen. Er dachte an seine Mutter, an ihre Freude gestern abend, und auf einmal schien ihm alles nicht mehr so schwer zu sein. Ich ertrag's schon, dachte er mutig, es muß gehen, Mama darf nichts merken!
Ein Weilchen saßen die beiden Schreibgenossen noch still zusammen, bis die letzten Töne verhallt waren und ein Klappen und Schließen oben anzeigte, daß auch der fromme Spieler heimging. »Vielen Dank,« sagte Raoul draußen und schüttelte herzhaft Karl Wagner die Hand, »es war schön!«
»Kannst du nun zur Mutter gehen?« fragte der Schreiber freundlich.
Raoul nickte froh. »Sie soll nichts merken, bestimmt nicht. Ich schluck's hinunter!«
»So ist's recht, immer tapfer voran! Nach bösen Stunden kommen auch gute. Nun Gott befohlen! Am Nachmittag sind wir allein, da wollen wir zusammen fleißig sein und nachholen, was wir am bösen Morgen versäumt haben,« sagte Karl Wagner und wandte sich rasch dem kleinen Haus im Winkel des Thomaskirchhofes zu, in dem er wohnte.
Einen Herzschlag lang sah Raoul ihm noch dankbar nach, dann lief er eilig den vertrauten Weg entlang. Er flog fast, so geschwind ging es, und die frische Luft kühlte ihm die heißen Wangen und Augen. Er kam sehr vergnügt bei seiner Mutter an, und diese merkte nicht, wie schwer der Morgen gewesen war. Nur Gottlieb erfuhr am Abend den Auftritt in der Schreiberstube, und er geriet darüber in einen solchen Zorn, daß er seine lateinische Grammatik aus den Boden warf. »Man muß ihn verdreschen, aber feste,« schrie er.
»Den langen Neumann?« Raoul mußte doch lachen; sein kleiner, stämmiger Freund und der lange dünne Schreiber schienen ihm auch ein zu ungleiches Paar zu sein. »Wie wolltest du das anfangen?«
»Ach was, das krieg' ich schon fertig,« brummte Gottlieb, »David ist mit dem Goliath auch fertig geworden. Freilich, merken dürft' er's nicht, von wem die Dresche stammt, sonst geht dir's schlecht. Vater sagt, Lehrjahre sind nicht Herrenjahre, und Ohrfeigen gehören dazu, die müssen sein!«
»Wenn's aber ungerecht ist,« rief Raoul finster, »nur aus Niedertracht, dann« — er seufzte, »ich muß doch still halten, um der Mutter willen!«
»Ja freilich,« stimmte Gottlieb kleinlaut zu, »aber — seine Dresche kriegt er noch. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagte unser Geselle immer, wenn er nicht alles auf einmal essen konnte. Er kriegt sie noch, aber feste!«
Mit dieser düsteren Prophezeiung trennte sich Gottlieb Käsmodel von seinem bewunderten Freund. Wer dem was tat, dem war er gram, der sollte sich vor ihm in acht nehmen.

Leicht hatte es Raoul von Steinberg wirklich nicht als Schreiberlein mit zwei Talern Monatsgehalt im Dienst des Advokaten Schnabel. Es gab Arbeit in Hülle und Fülle und Plackerei und Quälerei Tag für Tag. Der lange Neumann suchte alles heraus, womit er den Knaben peinigen konnte, und es kamen immer und immer wieder Stunden, in denen Raouls Mut zu sinken drohte. Dann redete ihm Karl Wagner gut zu, und daheim tröstete die Mutter zart und lind, denn es gelang dem Knaben doch nicht, ihr all seine Kümmernisse zu verbergen. Mutteraugen sehen zu tief und scharf, und Frau von Steinberg hatte lange gemerkt, ehe es ihr der Sohn gestand, daß er kein leichtes Amt übernommen hatte. Ihr einziger Trost war, daß es nur eine kurze Zeit dauern würde; sie meinte, die Verwandten würden und müßten ihr doch antworten, ihr ihre Bitte erfüllen.
Doch die Tage wurden länger, der Frühlingssturm raste über das Land, und schon hingen zarte, grüne Schleier über Busch und Baum, und so sehnsüchtig Frau von Steinberg auch hoffte und harrte, kein Brief, keine Antwort kam. Als der [S. 38] Sommer ins Land ging, erstarb endlich die Hoffnung. »Man will meinem Kinde nicht helfen,« dachte sie bitter. In dieser Zeit sprach sie einmal mit Meister Käsmodel, und nach dieser Unterredung wurde sie ruhiger; der treue Mann hatte ihr das Versprechen gegeben, nie ihren Sohn zu verlassen, wenn sich die Verwandten seiner nicht annahmen. —
Es war an einem milden, warmen Sommertag, als Raoul von Steinberg noch schwereren Herzens als sonst die Treppe hinabstieg, um nach der Schreibstube zu wandern. Die Mutter war heute so seltsam bleich gewesen, und so trat er, ehe er ging, noch an das Schiebefensterchen und bat die Frau Meisterin, doch recht bald einmal nach ihr zu sehen. Dabei huschte Gottlieb aus der Ladenstube heraus und schloß sich ihm an. »Ich begleite dich,« sagte er kurz.
»Hast du denn heute keine Schule?« fragte Raoul.
»Nee, noch nicht, unser Lateiner ist krank, da fallen ein paar Stunden aus,« gab Gottlieb sehr vergnügt zur Antwort. »Du, ich muß dir aber ein Rätsel ausgeben: Wer ist der frechste Pferdedieb von Berlin?«
Raoul sah etwas verdutzt drein, und Gottlieb prustete vor Lachen, dann neigte er sich an das Ohr des Freundes und flüsterte: »Napoleon.«
»Aber Gottlieb!«
»Ja, det stimmt, sagt unser neuer Geselle, der ein Berliner ist, er hat mir's gestern erzählt; sie nennen ihn so, weil er die Siegesgöttin samt ihrem Wagen vom Brandenburger Tor weggemaust hat. Fein, was?«
»Sehr fein,« lobte Raoul anerkennend, »den Gesellen muß ich sehen!«
»Komm nur heute abend, der schimpft ordentlich auf den Pferdedieb.« Gottlieb quiekte vor Lachen. »Wenn ich Pferdedieb sage, weiß keiner, wen ich meine.«
»Tu's lieber nicht,« riet Raoul. »Karl Wagner sagt, es sei vernünftiger, seinen Mund zu halten, die Zeit sei noch nicht da.«
»Ist auch gut,« brummte Gottlieb und reckte seine Gestalt, »ich will erst so weit sein, um mal mitgehen zu können, denn wenn sie erst mal den Pferdedieb verhauen, dann lauf' ich nach Preußen rüber, wenn es hier stille bleibt.«
Da waren sie beide am Haus in der Burgstraße angelangt, und Raoul lief nach kurzem Abschied hastig hinauf, denn die Zeit war knapp, und wehe ihm, wenn er noch nicht ausgeräumt hatte, wenn der lange Neumann kam.
Gottlieb blieb vor dem Hause stehen. Er steckte die Hände in die Hosentaschen und summte leise, ganz leise den Anfang eines Verses vor sich hin, den ihm sein neuer Freund, der Berliner Geselle, beigebracht hatte: »Warte, warte, Bonaparte!« Eigentlich meinte er just aber nicht den Kaiser der Franzosen mit seinem: »Warte, warte!« sondern vielmehr den langen Schreiber, seines Freundes Quälgeist. Als er den die Straße entlang kommen sah, verschwand er geschwind im dunklen Hausflur, drückte sich fest in eine Nische an der Haustüre und schob gerade in dem Augenblick, in dem Paul Neumann die Stufen überschreiten wollte, einen Stock vor. Der Lange stolpert, rutschte aus und fiel die Treppe mit ziemlichem Gekrach hinauf.
»Das bedeutet Glück,« schrie Gottlieb unten und entwischte so eilig, daß der lange Schreiber nicht einmal mehr sehen konnte, wer ihn zu Fall gebracht hatte. Der Bäckerbube ging sehr befriedigt zur Schule. Strafe muß sein, dachte er, und mußte [S. 40] dann seufzend diese Erfahrung an sich selbst machen, denn seinem Lehrer rutschte an diesem Tage beim zweiundzwanzigsten Fehler die Hand einmal ordentlich aus und klatschte derb auf Gottliebs Wange nieder. Das war bös und trübte beträchtlich die Morgenfreude.
Gottlieb Käsmodel ahnte nicht, daß er seinem Freund einen schlechten Streich gespielt hatte, denn der Fall auf der Treppe hatte Neumann ordentlich in Wut gebracht, und diese Wut mußte das jüngste Schreiberlein büßen. Beim Eintritt schalt er gleich, es sei nicht ordentlich aufgeräumt worden, dies sei nicht recht und das. Raoul mußte noch einmal kehren, dann mußte er auf alle Aktenschränke klettern und Staub wischen, und er atmete auf, als nebenan der Advokat eintrat. Da wurde es stiller, und er konnte sich endlich an das Pult setzen und schreiben. Er hatte ein endloses Aktenstück zu kopieren: zwei Nachbarn hatten sich um einen Apfelbaum gezankt, von dem jeder glaubte, er sei sein Eigentum. Nun waren die Männer alt und grau geworden, wußten aber immer noch nicht, wem der Apfelbaum gehörte. Der Knabe fand die ganze Sache herzlich langweilig, und trotz aller Mühe, die er sich gab, machten seine Gedanken allerhand Kreuz- und Quersprünge. Gottliebs Erzählung und seine Tat, denn er hatte schnell erraten, daß der Missetäter unten im Hausflur sein Freund gewesen war, hatten seine Gedanken abgelenkt; nun kehrten sie zur Mutter zurück, und eine bange Angst quälte ihn. Es war ihm so seltsam unruhig zumute, daß er unwillkürlich auf seinem Sessel hin und her rutschte.
»An was denkt er denn? Kann er nicht ruhig sitzen?« schrie Paul Neumann ihn plötzlich an. »So'n Trantiegel, so'n Tagedieb! Er schreibt ja, als wär' er 'ne Schnecke. Zeige er mal [S. 41] her, gewiß hat er hundert Fehler gemacht, und ich hab' nachher den Ärger.«
Paul Neumann schrie absichtlich laut, damit es der Advokat nebenan hören sollte, welchen Ärger ihm der Schreibbursche bereitete. Und da er wirklich in der Abschrift einen Fehler entdeckte, brüllte er, am liebsten möchte er die Arbeit dem Jungen um die Ohren schlagen; zur Strafe müsse er über Mittag dableiben und die Sache noch einmal abschreiben.
Raoul zuckte zusammen. Heute, gerade heute, wo die Mutter so gebeten hatte: »Komm schnell heim!« Er warf einen hilfesuchenden Blick auf Karl Wagner, und der nickte ihm ermunternd zu. Wieder wie damals in der Kirche, und seitdem oft in den Wochen, die vorübergegangen waren, fühlte sich Raoul durch den ernsten, stillen Blick des kleinen Verwachsenen getröstet. Der war ihm längst ein guter Freund geworden, dem er all seine Sorgen anvertraute. Etlichemal war Karl Wagner auch Sonntags bei Frau von Steinberg gewesen, und er, der einst ein Arzt hatte werden wollen, aber um seiner Armut willen das Studium hatte aufgeben müssen, wußte bald, daß seines kleinen Freundes Mutter kränker war, als alle ahnten. Er fragte darum besorgt, als der Lange nach einem Weilchen in das Zimmer des Advokaten gerufen wurde: »Was ist heute?«
»Mama geht es nicht gut, sie bat so sehr, ich möchte heimkommen,« flüsterte Raoul zurück.
»Es wird schon gehen,« tröstete der Freund, und dann stand er auf, als Neumann zurückkehrte, und klopfte an die Tür des Advokaten.
»Was soll's?« schrie der Lange, »was will er drinnen?«
Er erhielt keine Antwort auf seine grobe Frage. Still schloß [S. 42] sich die Tür hinter Karl Wagner, und nach einigen Minuten kam er heraus und sagte sanft: »Du sollst heimgehen, Raoul, hast heute frei, Herr Schnabel hat es erlaubt.«
»Da hört doch alles auf!« schrie Neumann empört. »Der faule Strick, der Trantiegel soll frei haben? Nein, das leid' ich nicht!« Er sprang wütend auf, aber Raoul hatte schon seine Sachen genommen und war blitzschnell, mit einem dankbaren Gruß für seinen Helfer, hinausgeflitzt. Er ahnte nicht, daß der kleine Schreiber es übernommen hatte, auch noch seine Arbeit auszuführen, und ihm seine knappen Freistunden opferte.
Raoul überlegte überhaupt nicht viel an diesem Vormittag. Eine unerklärliche Unruhe trieb ihn vorwärts, und auf seinem kurzen Weg, den er wie immer im Trab zurücklegte, hatte er nur den einen Gedanken: Wie froh wird Mutter sein, daß ich komme!
Einen raschen Blick warf er unten durch das Schiebefensterchen in die Ladenstube. Niemand war drin, und eilig hastete er die Treppe hinauf. Oben wollte er stürmisch die Türe aufreißen mit dem Freudenruf: »Ich bin da!« aber dann öffnete er sie doch ganz zaghaft und leise; wieder war jene unerklärliche Angst über ihn gekommen.
Als er eintrat, sah er die Meisterin am Bett sitzen. Die wandte sich um, und nun sah er die Mutter.
Mit einem Schrei stürzte der Knabe vorwärts, so bleich, so verändert sah die Mutter aus. »Mama, o Gott, Mama,« flehte er, »was fehlt dir?«
»Mein Junge!« Weit öffneten sich die Augen der bleichen Frau, und ein Blick unendlicher Liebe, unendlichen Schmerzes traf den Knaben, der an ihrem Bett niedergesunken war. »Du [S. 43] kommst — gottlob!« Zitternd tastete die Hand der Mutter nach ihres Kindes Haupt, schwer und kühl sank sie darauf nieder: »Werde wie dein Vater! Gott — segne dich!«
Die letzten Worte klangen nur noch wie ein Hauch, aber Raoul hatte sie doch verstanden. Angstvoll umschlang er die Mutter und flehte jammernd: »Mama, Mama, ach, was fehlt dir?«
»Mußt nicht so schreien, mein armer Junge,« sagte die brave Meisterin, der dicke, dicke Tränen über die Wangen liefen, »sei tapfer und mach's deiner Mutter nicht so schwer!«
Raoul verstand nicht, was die Meisterin meinte, er hörte nur die Mahnung, tapfer zu sein um seiner Mutter willen, da bezwang er sich und streichelte nur zärtlich die weißen Hände. Unter diesem Streicheln schlief die Mutter sanft ein, um nicht mehr zu erwachen, sie war tot. – – –
Im dumpfen Schmerz der ersten Tage dachte Raoul gar nicht darüber nach, wie einsam und verlassen er nun auf der Welt war. Er saß unten im Bäckerstübchen. Gottlieb suchte ihn in seiner rauhen Art zu trösten, die Meisterin war gut zu ihm wie eine rechte Mutter, und dem Meister Käsmodel konnte es jeder, der ihn kannte, ansehen, daß er nur so ein grimmiges Gesicht machte, um nicht zu zeigen, wie leid ihm sein kleiner Hausgenosse tat. Er sorgte väterlich für den Knaben, ging selbst zu Herrn Schnabel und sprach mit diesem, und die beiden Männer kamen überein, es sei wohl am besten, wenn Raoul vorläufig weiter als Schreiber arbeitete, bis von den Verwandten eine Antwort gekommen sei.
»Ich schreib' selbst, schreib' ihnen aber mal richtig, wie sich die arme Frau gequält hat,« sagte der brave Meister. Er grollte dem Herrn von Steinberg von Herzen, weil er den Brief unbeantwortet [S. 44] gelassen, den ihm seine Schwägerin in ihrer Not geschrieben hatte.
Nach dem Begräbnis sprach Meister Käsmodel mit Raoul über seine Zukunft. »Du bleibst bei uns, bis eine Antwort von deinem Oheim kommt, und kommt keine, na, dann bleibst du alleweil erst recht, bleibst immer bei uns. Ich habe deiner Frau Mutter selig versprochen, dich nie zu verlassen, aber erst noch einmal an deinen Oheim zu schreiben. Sein Versprechen muß man halten, sonst hätte ich wahrhaftig kein Wort an die hochmütige Verwandtschaft da oben, wo sich die Füchse Gutenacht sagen, geschrieben. So, und nun beiß die Zähne zusammen, zeige, daß du ein Mann werden willst, so einer, wie dein Vater selig einer gewesen ist.«
Da biß Raoul wirklich die Zähne zusammen und half am nächsten Tage selbst die liebe, freundliche Mansardenstube räumen. Andere Mieter sollten hinaufziehen, er kam zu Gottlieb in die Kammer. Die Bilder und die wenigen Andenken an die Mutter verwahrte der Meister getreulich mit dem Rest des Geldes für seinen Pflegling. Der stieg am nächsten Morgen mit schwerem Herzen wieder zu der Schreibstube empor. Nun ihn nicht mehr der Gedanke bewegte, er könnte mit dem verdienten Gelde seiner Mutter die Sorgen erleichtern, erschien es ihm fast unerträglich, weiter in dieser düsteren Schreibstube seine Tage zu verbringen. An diesem ersten Morgen erlebte er aber eine große Überraschung: Paul Neumann war kriechend freundlich gegen ihn, er tat, als wären sie zusammen stets die allerbesten Freunde gewesen.
Was hat er? dachte Karl Wagner, der erstaunt den Gefährten beobachtete, Mitleid ist das nicht bei ihm!
Daß es nicht Mitleid war, erfuhr er bald genug. Der lange Schreiber hatte nun erfahren, woher Raouls Mutter gestammt hatte, und auf einmal erschien ihm der bisher so verächtlich behandelte Knabe ein anderer zu sein. Vielleicht lohnte es sich, dessen Vertrauen zu gewinnen, vielleicht hatte er noch einflußreiche Verwandte in Frankreich, und klug forschte und fragte er, wenn Karl Wagner nicht da war, nach den französischen Verwandten.
Raoul dachte: Ich tu ihm leid, weil meine Mutter gestorben ist, und so wenig er auch den langen Gesellen leiden konnte, so erzählte er ihm doch alles, was er wissen wollte. Er nannte den Namen seines Oheims und sagte, daß dieser am Hofe des Kaisers zu Paris eine hohe Stellung inne hätte. Als er später Karl Wagner sein Gespräch mitteilte, lachte der und sagte: »Nun wirst du wenigstens nicht gequält werden. Vor einem französischen Adelsnamen hat er Respekt; jetzt sieht er dich mit ganz andern Augen an.«
Da lächelte auch Raoul zum erstenmal wieder ein wenig und erzählte seinem Freund Gottlieb die Geschichte. »Feiger Kriecher,« rief er verächtlich, »er muß doch noch mal Dresche haben!«
Weiter sprachen die Knaben nicht darüber, sie ahnten nicht, welchem Plan der lange Schreiber nachhing.
Jedesmal, wenn Raoul von seiner Arbeit zurückkehrte, zuckte es ihm in den Füßen, in die Mansarde hinaufzusteigen. Dann stand er ein paar Minuten still an der Treppe, und immer wieder überkam ihn von neuem heiß die Sehnsucht nach der Mutter, und manche Nacht, wenn Gottlieb schon schlief, lag er wach und weinte heiße Tränen. Er wurde immer stiller und [S. 46] bleicher, und die Meisterin Käsmodel sagte manchmal seufzend: »Der paßt nicht zu einem Schreiber, ganz sicher nicht.«
»Allweil das tut er auch nicht,« rief Meister Käsmodel, »und wenn sich die Verwandtschaft nicht bald rappelt, dann geh' ich aufs Gericht und verlang' den Raoul für uns. Nachher mag er die leidige Schreiberei an den Nagel hängen!«
Doch dazu kam's nicht. An einem Spätsommertag erhielt Meister Käsmodel einen dicken Brief von Herrn Wolf-Friedrich von Steinberg auf Hohensteinberg. Der Freiherr schrieb selbst, und er schrieb so herzlich, daß die Meisterin Käsmodel vor Rührung in eine Tränenflut ausbrach und der Meister einmal über das andere schrie: »Allweil ein nobler, guter Mann muß das sein, aber allweil die Knochen möcht' man den Postleuten einschlagen, daß sie just so einen Brief verloren gehen ließen.«
Der Freiherr schrieb, er hätte den Brief seiner Schwägerin nie bekommen. Auf seine schon vor Jahren, eingezogene Erkundigung nach dem Tode seines Bruders habe er die Auskunft erhalten, seine Schwägerin sei mit ihrem Kinde nach Frankreich gezogen. Er bedaure es tief, daß er der armen Frau keine Stütze hätte sein können, ihr Sohn aber solle in seinem Hause eine Heimat finden. Wenn es möglich sei, möchte der Meister den Knaben jemand übergeben, der die Reise bis Berlin mache, von dort würde ein Freund ihn in wenigen Wochen mit nach Hohensteinberg bringen.
»Na, dann ist's bald zu Ende mit dem Musjeh und uns,« brummelte der Meister, »in drei Wochen muß er reisen.«
»Ich wollte, ich könnte ihn behalten,« sagte die Meisterin leise, »aber freilich, für ihn mag's besser sein. Wenn er doch bald heimkäme und die Sache erführe!«
Dieser Wunsch ging früher in Erfüllung, als sie ahnte, denn noch war sie dabei, mit ihrem Manne die Sache zu bereden, als plötzlich Raoul aufgeregt in die Ladenstube stürmte und schrie: »Frau Meisterin, mein Onkel hat geschrieben, ich soll nach Paris kommen!«
»Ja, biste allweil übergeschnappt? Nach Paris sollst du doch nicht kommen, Junge; Junge, wo haste deine Gedanken?« fuhr ihn der Meister an.
»Doch nach Paris und gleich!«
»Aber Raoul, nach Hohensteinberg, das liegt da oben bei Rußland herum,« rief die Meisterin nun auch.
»Nach Hohensteinberg? Aber es steht doch in dem Briefe nach Paris, ich hab' doch gelesen!«
»Daß dich das Mäuschen beißt,« schrie der Meister verdutzt, »wie kann er denn den Brief gelesen haben, wenn er ihn doch gar nicht gesehen hat? Das ist allweil eine kuriose Sache!«
»Aber, aber der Herr Advokat hat doch den Brief bekommen, von dem französischen Gesandten in Dresden und —«
»Nun schlägt's dreizehn!« Der dicke Bäckermeister fiel fast mit seinem Stuhl um, so heftig setzte er sich nieder, und die Frau Meisterin sank stöhnend auf einen Mehlsack. »Junge, Junge, was redest du da? Woher ist der Brief?«
Und Raoul erzählte. Von dem Bruder seiner Mutter war eine Anfrage nach ihm gekommen. Der Onkel wollte ihn zu sich nehmen und ihn als seinen Sohn erziehen lassen; morgen schon sollte ein Begleiter aus Dresden eintreffen, der ihn nach Paris geleiten würde.
»So,« murrte Meister Käsmodel, »na, da hat ja der Musjeh die Auswahl, ob er in Deutschland bleiben will oder nach Frankreich [S. 48] gehen und vielleicht um den Bonaparte herumscharwenzeln.« Dabei warf er dem Knaben den Brief höchst unwirsch zu. Der las erstaunt. Eine tiefe Glut überzog dabei langsam sein Gesicht. Da stand er am Scheidewege: des Vaters und der Mutter Heimat, sie standen ihm beide offen, und größerer Reichtum, höherer Rang, sie lockten aus Paris, denn Graf Turaillon besaß keine Kinder, er hatte sich bereit erklärt, den Neffen als seinen Erben zu erziehen.
Aber gab es denn noch ein Besinnen da, wo die Mutter ihm selbst den Weg gewiesen hatte? Raoul richtete sich auf, und seine dunklen Augen blitzten. »Nein, Herr Meister, ich werde nie um den Bonaparte herumscharwenzeln. Mein Vater fiel im Kampf gegen ihn, das vergesse ich nicht: ich bin ein Steinberg und will ein Steinberg bleiben.«
»Warte, warte, Bonaparte,« summte Gottlieb und schob sich in die Türe herein, gerade als Raoul seine Antwort gab. Heisa, was war das? Er drängte sich vor und schrie: »Soll's losgehen?«
»Verflixter Bengel, muß er denn seine Nase allweil in alles stecken?« schnauzte ihn der Vater an. Er sah aber nicht böse aus; sein finstres Gesicht hatte sich aufgehellt, und er streckte Raoul froh die Hand hin. »So ist's recht! Deine Frau Mutter selig hätte nicht anders entschieden. Da heißt's nun freilich, sich zur Reise rüsten, hm, allweil — da hilft nichts.«
Ein Besinnen kam Raoul. Der Brief, den ihm der Advokat vorgelesen hatte, fiel ihm ein: morgen schon sollte der Begleiter kommen, der ihn nach Frankreich bringen wollte, und hastig sprach er es aus. »Was wird er sagen, wenn ich nicht mitgehen will?«
»Na, wer nicht will, der will nicht,« entschied Gottlieb kaltblütig und reckte kühn seine freche, kleine Stubsnase hoch.
Dem Meister schien die Sache aber doch nicht so einfach zu sein, er machte ein bedenkliches Gesicht und murmelte: »Dresden ist nahe, und wenn der Herr Graf dort gute Freunde hat, dann könnte es sein, daß sie den Raoul nach Frankreich schaffen, ob er allweil will oder nicht.«
»Dann reiße ich lieber aus,« rief der Knabe empört, »mit Gewalt lasse ich mich nicht nach Frankreich schaffen, nein, nein, nie!«
»Ich reiß' mit aus, hurra, das —« klatsch fuhr die väterliche Hand Gottlieb etwas unsanft auf den Mund, und der Schluß seiner Rede blieb ungesagt. Da ihn die Mutter auch noch vorwurfsvoll ansah und leise fragte: »Ja, hast du denn einen Grund zum Ausreißen?« zog sich der Bube lieber etwas in den Hintergrund der Ladenstube zurück, die Sache mit dem Ausreißen konnte er sich ja noch überlegen.
Meister Käsmodel saß in tiefes Nachdenken versunken da. Vielleicht war es am besten, er ging zu Herrn Schnabel und fragte den um Rat; aber freilich, der Advokat war auch einer von denen, die sich ängstlich hüteten, es mit einem Franzosen zu verderben. Und ein Zögern erschien ihm, je mehr er die Sache überdachte, immer gefährlicher.
»Ich setze mich in die Post und fahre geschwind fort,« drängte Raoul; »ich will nicht nach Frankreich.«
»Die Post nach Berlin fährt morgen früh, und erfährt es der Herr, dann kann man dich im Preußischen allweil aufgreifen,« sagte der Meister nachdenklich. Doch plötzlich fuhr er auf: »Potzwetter, jetzt fällt mir etwas ein: Nachbar Koch fährt heute mittag nach Halle mit seinem Wagen, der nimmt dich [S. 50] schon mit, und von Halle aus fährst du mit der Post weiter, da merkt man's hier nicht; na, und nachher weiß ich ja nicht, wo du gerade bist. Flink, Frau, tummle dich, rüste die Sachen, in einer Stunde muß der Junge aus dem Hause sein.«
»So schnell, du meine Güte, so schnell?« rief die Meisterin erschrocken, und da kam es Raoul erst recht zum Bewußtsein, daß er scheiden mußte von den Menschen, die ihm doch auf der weiten Welt am liebsten waren. Die Verwandten, zu denen er reisen sollte, waren ihm ja so fremd wie die Gegend, in der sie wohnten. Es war gut, daß alles so schnell gehen mußte, da gab es keine Zeit zu Abschiedsgedanken; und daß es recht war, wie es der Meister vorgeschlagen hatte, bestätigte Karl Wagner, der kurz vor seines jungen Freundes Abreise in das Bäckerhaus kam. Herr Schnabel hielt es für Raoul für ein großes Glück, daß sein Onkel ihn zu sich nehmen wollte; er würde gewiß eine schnelle Abreise verhindert haben, hätte man ihn darum gefragt.
»Allweil, jetzt möcht' ich nur wissen, woher der gräfliche Onkel in Paris auf einmal darauf kommt, um den Jungen zu schreiben,« fragte der Meister.
Karl Wagner lächelte ein wenig: »Neumann hat nach Paris geschrieben. Er hat Raoul den Freundschaftsdienst erwiesen, weil er meint, es sei für jeden Menschen am besten, ein Franzose zu sein.«
»O, jetzt verstehe ich's,« rief Raoul, »er hat mich so genau um alles gefragt, und darum war er gewiß auch so freundlich in der letzten Zeit. Gestern sagte er auf einmal, er wolle mein Freund sein.«
»Der muß noch mal Dresche haben,« knurrte Gottlieb wütend, »der ist so falsch wie — wie —«
»Deine Rechenexempel, die stimmen auch nie,« sagte Meister Käsmodel lachend. »Na, ich gönn' dem Musjeh die Enttäuschung. Aber nun los, sonst fährt Nachbar Koch ab. Geschwind, zum Abschied ist allweil keine Zeit mehr, kommt auch nichts dabei raus. Zieh mit Gott, Junge, und vergiß nicht, was du deiner Frau Mutter selig gelobt hast, und vergiß auch nicht, daß die Käsmodels dir allweil gute Freunde sind und bleiben werden. Hier findest du immer einen Platz, eine Heimat, wenn du mal nicht aus noch ein wissen solltest.«
Draußen knallte eine Peitsche, ein langgezogenes Hoiho ertönte, Nachbar Koch wartete vor seinem Hause. Da mußte nun wirklich eins, zwei, drei Abschied genommen werden. Niemand kam mit vor das Haus, der Meister meinte, es sei besser, nicht erst die Neugier der Nachbarschaft zu erregen. Still huschte Raoul mit seinem Bündel hinaus, kletterte auf den Wagen, und fort ging es durch die in mittäglicher Glut und Stille liegenden Straßen. Noch einmal sah sich der Knabe um: da oben, da waren die Mansardenfenster, da hatte die Mutter so oft gesessen. Ein Schluchzen stieg in ihm auf, ein heißer, würgender Schmerz preßte ihm das Herz zusammen, und einen Augenblick war es ihm, als müßte er vom Wagen herabspringen und zurückeilen in das alte Haus, das ihm bis dahin eine Heimat gewesen war. Aber er bezwang sich und schluckte tapfer die Tränen hinab. Mama würde sich freuen, dachte er, sie hat es sich so gewünscht. Er versuchte an die neuen Verwandten zu denken, aber er konnte sich kein rechtes Bild von ihnen machen; seine Gedanken wirrten durcheinander und kehrten immer, immer wieder in das verlassene Bäckerhaus zurück.
Mit finsterem Blick hatte Gottlieb den Freund scheiden [S. 52] sehen. Er zog die Stirn ganz kraus und schob die Unterlippe trotzig vor, damit nur niemand merken sollte, daß ihm der Abschied bitter schwer wurde. Dann, als der Wagen nicht mehr auf der Straße zu hören war, entschlüpfte er und eilte in die Burgstraße; dort in des Advokaten Schnabel Haus stellte er sich wieder in den dunklen Flurwinkel und wartete, bis Paul Neumann kam.
»Schockschwerebrett!« schimpfte der, als er mit einem lauten Plumps wieder die Treppe hinauffiel. Oben in der Schreibstube zeterte er sich seine Wut vom Herzen herunter: »Ich möchte nur wissen, was das für ein infamer Bengel ist, der mir im Hausflur immer ein Bein stellt. Na wehe, wenn ich den erwische! Übrigens, wer weiß, wie lange es noch dauert, dann bin ich die Sache los. Der Graf Turaillon wird mir schon Dank wissen. Vielleicht, vielleicht reise ich auch nach Paris, dort werde ich mehr werden als ein simpler Schreiber!«
Während Paul Neumann so von seinem Ärger und seinen Luftschlössern redete, schlenderte Gottlieb pfeifend und gemütsruhig über den Marktplatz nach Hause. Er spürte gar keine Reue über seine Tat, leid tat ihm nur, daß er Raoul nicht mehr den wohlgelungenen Streich erzählen konnte. Brummig saß er dann lange in seinem Winkel, der Freund fehlte ihm überall, und zuletzt spielte er sogar in der Verzweiflung seines Herzens mit den beiden kleinen Schwestern, etwas, was er sonst sehr unter seiner Würde hielt. Als aber das vierjährige Lottchen fragte: »Kommt Raoul bald?« da warf er unsanft die Puppe hinweg und stürzte davon. Er verkroch sich in der dunkelsten Ecke der Mehlkammer, und dort heulte er so lange, bis der Schmerz von Hunger und Müdigkeit abgelöst wurde und er einschlief.
Am nächsten Tag, so um die dritte Nachmittagsstunde herum, sah Gottlieb endlich, er lag schon lange auf der Lauer, einen feinen Herrn das Haus betreten. Der ist's, dachte er, und schlüpfte eilig in seinen Horcherwinkel hinterm Ofen. Es war auch wirklich der erwartete Begleiter, ein eleganter, geschniegelter Herr. Mit unsäglichem Hochmut schaute er sich in der Ladenstube um, und ein Mehlstäubchen, das auf seinen Rock gekommen war, tupfte er hinweg, als hätte ein giftiges Insekt da Platz genommen. Breitbeinig und fest stand Meister Käsmodel vor dem jungen Mann und erzählte, Raoul sei als Wanderbursch nach Ostpreußen gezogen; von dem Umweg über Halle sagte er freilich nichts.
»Was?« schrie der Fremde, »der Neffe des Grafen Turaillon ist als Wanderbursch davongezogen? Das ist ja empörend! Wie konnten Sie das dulden? Sie werden es büßen müssen! Graf Turaillon wird sich beschweren, daß man seinen Enkelsohn entführt hat. Sie sind ein Räuber, ein Betrüger, ein – –«
»Allweil jetzt halten Sie den Mund,« sagte der Bäcker gelassen, aber seine Augen blitzten drohend, und der schlanke, feine, junge Herr wich unwillkürlich zurück. »Ich hab' der Frau von Steinberg mein Wort gegeben, für ihren Sohn zu sorgen nach ihrem Willen, das hab' ich gehalten, und von Ihrem Herrn Grafen ist nie die Rede gewesen. Was ich getan habe, kann ich verantworten, und nun wär's nur recht, wenn Sie sich mal mein Haus von draußen ansehen möchten, es nimmt sich ganz stattlich aus. Ich muß in die Backstube, und allweil muß erst die Arbeit kommen und dann das Vergnügen.«
»Sie werden noch daran denken müssen,« schrie der junge Mann wütend und verließ das Haus, aber Meister Käsmodel [S. 54] sah ihm ruhig nach. »Ich habe allweil nur meine Pflicht getan, mag kommen, was kommen will!«
Es kam aber nichts danach, nur ein paar Verhöre auf dem Rathaus, bei denen Meister Käsmodel klipp und klar seine Tat verantwortete, und ehe ein neuer Befehl aus Paris eintraf, war Raoul von Steinberg längst in der Heimat seines Vaters angelangt. Paul Neumann aber saß in grimmigster Laune an seinem Schreibpult, — die schöne Hoffnung, nach Paris zu kommen, war zerflossen wie eine Schneeflocke im Frühling.

Der Sommer rüstete sich bereits zum Abschiednehmen, weil er schon überall an Hecken und Hängen, im Garten, auf den Feldern und im Walde den Boten seines Bruders Herbst begegnete. Und weil die Sonne in Freundschaft von dem ihr so lieben Sommer scheiden wollte und auch dem Herbst einen guten Willkomm zu bereiten trachtete, strahlte sie in allerbester Laune auf die Erde herab, und es gab warme, schöne Tage. Am späten Nachmittag eines solchen sonnenhellen Tages rasselte über den Marktplatz der kleinen ostpreußischen Stadt Langenstein eine herrschaftliche Kutsche. Ein paar Kinder, die auf der Straße spielten, starrten mit offenem Munde dem Wagen nach, und die Postmeisterin Lebrecht schob neugierig das Schiebefensterchen in ihrer Wohnstube hoch und sah hinaus.
»Minettchen, sieh nur, die Frau Kammerherrin ist's wahrhaftig, die da gefahren kommt. Rasch, Mariell, sieh nach, ob meine Haube sitzt, ich muß dero doch meine Reverenz machen!«
Die kleine, rundliche Frau eilte aus dem Zimmer, noch ehe Minettchen, das blonde Postmeistertöchterlein, Zeit gefunden hatte, ihr Urteil über den Sitz der mütterlichen Haube abzugeben. [S. 56] Draußen hielt auch schon das Gefährt, neben seiner Gattin erschien der Herr Postmeister, und ehrerbietig verneigte sich das Ehepaar vor den Insassen des Wagens. Drinnen im Zimmer drückte Minettchen ihr Stumpfnäschen an die Fensterscheiben und blickte voll Bewunderung auf die gnädigen Fräuleins, die mit der Kammerherrin von Steinberg fuhren. Diese selbst, eine große, stattliche Frau, saß kerzengrade aufrecht auf dem Vordersitze des Wagens; ihr braunes Taftkleid, das, entgegen der herrschenden Mode, noch von recht beträchtlicher Weite war, bedeckte den ganzen Sitz. Der Großmutter gegenüber saßen schlank und jung, eng aneinander geschmiegt, ihre drei Enkelinnen. Es wäre gegen alle Schicklichkeit gewesen, hätte eines der jungen Mädchen neben der Großmutter auf dem Vordersitz gesessen. Die Schwestern Gottliebe und Gottlobe von Steinberg hatten ihre Base Karoline von Prillwitz zärtlich in die Mitte genommen, denn das Bäslein war Gast und genoß alle Vorteile eines gern gesehenen Besuches.
»Hat er Postsachen für mich?« fragte die Kammerherrin den Postmeister mit herablassender Freundlichkeit, der sich von der alten Dame noch das »Er« gefallen ließ, das er so leicht keinem andern verziehen hätte.
»Ei gewiß, Ihro Gnaden, aus Leipzig ist ein Päckchen gekommen, spekuliere, es wird ein Buch sein,« gab der Postmeister zur Antwort und begab sich eilfertig in die Schreibstube, das Gewünschte zu holen.
Bei dem Wort »aus Leipzig« schauten die drei Mädels neugierig auf, und über das Gesicht der alten Dame lief ein Schatten. Ihre Hände, die auf dem Schoß gefaltet lagen, zitterten leise, aber sie beherrschte sich, und die Postmeisterin bekam eine [S. 57] gnädige Nachfrage, wie es ihr gehe, und ob ihr der Tee, den sie jüngst vom Gute geholt, auch gegen den Brustkrampf geholfen habe.
Die Auskunft lautete befriedigend, die dicke Frau Postmeisterin sah auch blühend und gesund aus, trotzdem seufzte sie herzbrechend, als die Kammerherrin sie fragte, wie es sonst noch gehe.
»Unsereins kann ja nicht klagen,« sagte sie mit ehrlicher Betrübnis, »bisher hat's immer noch in unserem Hause zugelangt, aber bei den armen Leuten und draußen auf dem Lande, wie es da im Winter werden soll, das weiß unser lieber Herrgott!«
Ihr Mann, der wieder aus dem Hause trat, hatte die letzten Worte gehört, und sein sonst so freundliches Gesicht verdüsterte sich. »Der gnädigen Frau Kammerherrin braucht man nichts zu klagen, sie weiß, wie groß die Not im Lande ist,« sagte er bitter, »und ehe wir nicht die Franzosenwirtschaft los werden, gibt's keine Besserung.«
»Mann,« schrie seine Frau erschrocken, »du redest dich noch um Kopf und Amt.«
Frau von Steinberg aber reichte dem Postmeister die Hand. »Wie er, denkt heute jeder ehrliche deutsche Mann, ob er es sagt oder bei sich behält.«
Das Schelmenlächeln auf den Gesichtern der drei Basen, die mit dem Minettchen Blicke getauscht hatten, erstarb jäh bei diesem ernsten Gespräch, und alle drei schauten den Postmeister ehrfürchtig an: ein Lob aus Großmutters Munde, das bedeutete noch etwas.
Der Postmeister hatte die Blicke der jungen Mädchen bemerkt; [S. 58] er räusperte sich ein wenig verlegen und reichte mit einer abermaligen Verbeugung das vielfach versiegelte Päckchen in den Wagen hinein.
»Vielleicht ist es ein Almanach, der etliche neue Modekupfer bringt, an denen die gnädigen Demoiselles die neuen Moden, die man jetzo trägt, adorieren können,« sagte er mit verschnörkelter, altmodischer Höflichkeit. Er meinte, diese Art sei gar fein den vornehmen Damen gegenüber, aber grob schnitt ihm die Kammerherrin die Rede ab: »Halt er den Mund! Red er doch Deutsch, wie sein Schnabel gewachsen ist, und setz' er den drei Gänsen, meinen Enkeltöchtern, nicht Flausen in die Köpfe; sie sind schon eitel genug und denken mehr an Putz und Tand, als es sich für die heutige Zeit gebührt. Und sie, Frau Postmeisterin, lebe sie wohl; wenn sie Wurstgewürze braucht, dann kann sie sich welches holen lassen. Schick' sie mir ihr Minettchen, sie soll sich aber ja nicht wieder so aufputzen wie das vorige Mal; sie sah aus, als ginge sie zum Erntekranz. Putz und Tanz sind unserer Zeit unwürdig. Und nun Gott befohlen!«
Die Pferde zogen an, und der Wagen rasselte davon; etwas verdutzt sahen die Eheleute ihm nach. »Ja, ja, so ist sie einmal, immer rasch und streng; aber gut ist sie doch dabei, und in der Not kann man sich immer an die Steinbergs wenden, das ist was wert. Das Minettchen aber soll mir nicht mehr mit den vielen Firlefanzbändern herumlaufen, ich leid's nicht,« brummte der Herr Postmeister und ging wieder in seine Schreibstube. Seine Frau kehrte in das Wohnzimmer zurück, und das ahnungslose Minettchen bekam dort brühwarm die Schelte der Frau Kammerherrin zu hören. Sehr beschämt beugte es sich [S. 59] über seine Näharbeit und schickte dem verbotenen Putz manch heimlichen Seufzer nach.
Der Wagen rollte unterdessen auf dem Landwege dahin, der das Rittergut Hohensteinberg mit dem Städtchen Langenstein verband. Hell strahlte die Sonne auf kahle Felder herab, und der links an der Straße sich hinziehende Laubwald schillerte in lichtem Goldgelb.
In dem Wagen herrschte Schweigen, und die Großmutter sah düster auf die Stoppelfelder am Wegrand; ach, sie hatten nur spärliche Frucht in diesem Jahre getragen, so spärlich, daß das Gespenst des Hungers schon vor vielen Türen stand, um sich mit dem Winter zugleich einzuschleichen. Die drei Enkelinnen aber kämpften noch mit ihrem Ärger über die großmütterlichen »Gänse«.
Karoline von Prillwitz, deren Eltern in Königsberg lebten, — ihre Mutter war die einzige Tochter der Kammerherrin, — verstand weniger die Gedanken, die die Großmutter bewegten, als Gottliebe und Gottlobe, die tagtäglich all das bittere Klagen um den ausgebliebenen Erntesegen angehört hatten. Sie fand darum das tiefe Schweigen auch recht langweilig. Sie seufzte einigemal, nicht zu sehr, damit es die Großmutter nicht hörte, und spähte eifrig die Straße entlang. Kam denn nichts und niemand des Weges daher? Als ein Bauer ankam und ehrfurchtsvoll grüßte, schaute sich die neugierige kleine Städterin so lange nach ihm um, als sie seine Gestalt noch verfolgen konnte: dabei übersah sie fast einen schlanken, blassen Jungen, der an einer Wegbiegung stand und träumend in die Weite blickte.
»Heda,« rief der Kutscher, »aus dem Wege!«
Der Knabe sprang zur Seite, er grüßte höflich, und in dem [S. 60] Blick seiner Augen lag eine Frage: es war, als wollte er vortreten und sprechen.
Die alte Frau von Steinberg war durch den Zuruf des Kutschers aus ihren Gedanken aufgeschreckt. Auch sie sah nun den Knaben und verstand seine stumme Frage. Da sie auch fast jedes Gesicht in der Gegend kannte, fiel ihr ein Fremder sofort aus. Sie rief dem Kutscher ein Halt zu und winkte gebieterisch den Knaben zu sich heran.
Der folgte der Aufforderung. Unerschrocken sah er zu der alten Dame auf, die ihn fragte: »Wohin will er?«
»Nach Hohensteinberg.«
Ein scharfer, prüfender Blick ans den hellen, klugen Augen überflog das Gesicht des Knaben, und eine leise Unruhe trat in die Züge der Kammerherrin. Etwas zögernd fast fragte sie weiter: »Zu wem will er da?«
»Zu dem Freiherrn von Steinberg.«
Sechs Mädchenaugen schauten neugierig, erwartungsvoll den kleinen Fremdling an, und Gottliebes Lippen öffneten sich; aber das vorschnelle Wort blieb ungesprochen, denn die Großmutter sprach wieder, und ihre sonst so herbe Stimme schwankte ein wenig: »Wie heißt er?«
Der Knabe wurde rot. Diesmal kam seine Antwort nicht so rasch, er zögerte, aber dann sagte er doch so freimütig wie vorher: »Ich heiße Raoul von Steinberg!«
Ein dreifacher Aufschrei erfolgte, die blonden Mädels hopsten auf ihrem schmalen Sitz hoch, und der Kutscher vergaß allen sonstigen Respekt vor seiner Herrin. Er drehte sich um und rief mit breitem Grinsen: »Ne—in, is doch nich meechlich, das Jungchen will —«
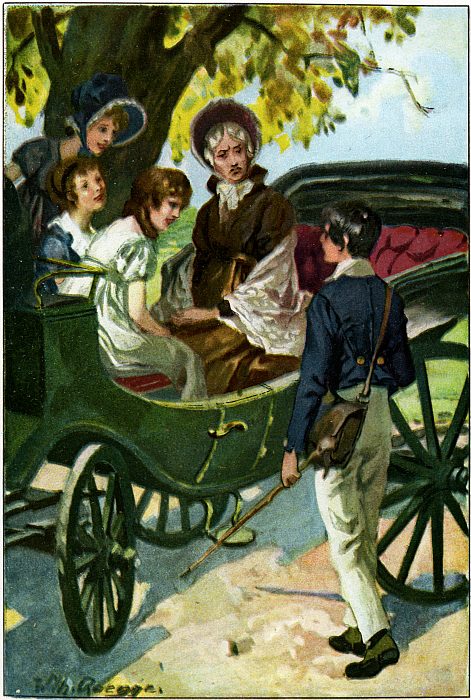
»Halt er den Mund,« wies ihn die Kammerherrin zurecht, und zu dem Knaben gewandt, sagte sie: »Steig er ein, er kann mitfahren. Rückt zusammen, Mariellen, er hat noch Platz zwischen euch. Das Bündel nimmt Heinrich auf den Bock.«
Aber Raoul folgte der Aufforderung nicht, so verlockend es für ihn war, seine müden Füße ausruhen zu können; die hochmütige Art verdroß ihn. So verneigte er sich nur mit dem feinen, zierlichen Anstand, den er der Erziehung seiner Mutter verdankte, und sagte höflich: »Ich danke sehr, gnädige Frau, aber ich kann noch gehen!« Und ohne Besinnen nahm er wieder sein Bündel über die Schulter und trabte die Landstraße entlang.
Die Augen der alten Frau blitzten. Wie ein Wetterleuchten zog es über das alte, herbe Gesicht, und ohne sich noch weiter um den Knaben zu kümmern, rief sie: »Fahr er zu, rasch, laß er die Pferde laufen!«
Heinrich folgte dem Befehl, und eine Minute später rollte das Gefährt an Raoul vorbei. Eine Staubwolke umhüllte den Jungen, der noch einmal stehen blieb und wartete, bis der Wagen einen weiten Vorsprung hatte, dann schritt er weiter, nicht schnell, denn das Wandern fiel ihm schwer, es war ihm ungewohnt, und ein Fuß war schon wund gelaufen. —
Raoul von Steinberg war glücklich mit Meister Koch nach Halle gekommen und von da in tagelanger Postfahrt über Berlin bis nach Thorn. Von hier aus war das Vorwärtskommen beschwerlicher gewesen. Er selbst wußte nicht die rechte Richtung, die Posten gingen seltener und waren besetzt, auch war seine Barschaft sehr zusammengeschmolzen. Meister Käsmodel hatte selbst noch nie eine so weite Reise gemacht und hatte gemeint, gar gut und reichlich für seinen Schützling gesorgt zu haben, [S. 62] und es wäre ihm selbst wohl bitter leid gewesen, wenn er gewußt hätte, wie mühselig dessen Reise war. Aber Raoul hatte sich schon in seiner Jugend in mancherlei Widerwärtigkeiten schicken müssen, er kam durch, lebte einfach, schlief in Scheunen und sah sich endlich dem Ziel seiner Reise nahe. Etlichemal hatten Bauern ihn ein Stück des Weges für einen freundlichen Dank mitgenommen, und er war gern gefahren; die stattliche Dame aber in dem wohlhäbigen Wagen hatte ihm das Mitfahren doch zu sehr als ein Almosen angeboten, und eine solche Behandlung wollte er sich nicht gefallen lassen.
»Ich komme schon hin,« dachte der Knabe mutig und schritt weiter, »lang kann's nicht sein!« Und wieder wie in all den vergangenen Reisetagen suchte er sich seine neue Heimat vorzustellen, und wie man ihn wohl empfangen würde, und ob der Oheim dem Vater ähnlich sah.
Endlich sah er das Gutshaus am Ende einer langen, schattigen Lindenallee auftauchen: ein schlichtes, zweistöckiges, aber umfangreiches Gebäude, an das sich links der Gutshof mit Scheunen und Stallungen anschloß, rechts dehnte sich weit, von einer niedrigen Lehmmauer umgeben, ein großer Park aus. An der Haustüre standen der Freiherr von Steinberg, neben ihm seine Frau Maria, und beide umdrängten die drei blonden Bäslein, die seit der Begegnung auf der Landstraße es vor Neugier einfach nicht mehr aushielten, sich den neuen Vetter näher anzuschauen. Joachim, der noch nicht ganz fünfzehnjährige Sohn des Hauses, stand etwas zurück in dem weiten Hausflur. Er wollte es nicht zeigen, daß auch ihn der unbekannte Vetter lebhaft beschäftigte, denn er hatte es den beiden Schwestern und der Base mehr als einmal gesagt, daß es ihm lieber wäre, wenn der Halbfranzose [S. 63] gar nicht käme; eine rechte Sache würde das doch nicht mit ihm.
»Die Großmutter tat recht, daß sie ihn auf der Landstraße stehen ließ,« hatte er erklärt, als die Mädels sehr lebhaft ihre Begegnung schilderten.
Darüber waren die Schwestern tief entrüstet gewesen, denn sie empfanden inniges Mitleid mit dem blassen Knaben. »Die Großmutter hätte ihn doch mitnehmen sollen, ihm sagen, wer wir waren,« grollte Gottliebe. Sie ahnte nicht, daß der alten Frau selbst schon ihr rasches Davonfahren leid tat.
»Wäre er doch endlich da, der arme Junge!« sagte die Hausfrau gerade leise, als Raoul am Anfang der Allee auftauchte.
»Dort kommt er,« riefen die Mädels, und als sie sahen, daß Vater und Mutter schnell dem Ankommenden entgegengingen, taten sie es ihnen nach, und so sah sich Raoul auf einmal von den neuen Verwandten umringt: man hatte ihn erwartet, wußte von seinem Kommen. Er sah die Bäschen an und errötete heiß, denn er erkannte sie gleich wieder, und zugleich wußte er auch, ohne daß es ihm jemand sagte, daß die alte Dame seine Großmutter gewesen war. Seines Vater Mutter! Er senkte stumm den Kopf, und in die tiefe Freude, die ihn erfüllt hatte, als er endlich das Heimatshaus seines Vaters erblickte, endlich am Ziel war, fiel der erste bittere Tropfen.
»Willkommen, mein Junge!« sagte der Oheim herzlich und hob das Gesicht des Knaben zu sich empor. Ernst, traurig sah dieser ihn an, und das gleiche Gefühl der Reue, das ihn ergriffen hatte, als Meister Käsmodels Brief eingetroffen war, bewegte wieder des Freiherrn Herz. Er zog den Knaben an seine Brust und sagte warm: »Gott segne deinen Eingang.«
Frau Maria empfing den Neffen mit gleicher Herzlichkeit. Auch die blonden Bäslein grüßten ihn froh, und schon wollte ein Gefühl der Befreiung über Raoul kommen, als Joachim hinzutrat. Dieser, der ihn ein beträchtliches Stück überragte, sah hochmütig, ja fast verächtlich auf den in abgetragenen, verstaubten Kleidern steckenden Vetter herab. Wie ein Betteljunge sieht er aus, dachte er, und dieser Gedanke stand so deutlich auf seinem Gesicht, daß Raoul rasch die schon ausgestreckte Hand sinken ließ. Vor ihm tauchte das derbe, gutmütige Gesicht seines Freundes Gottlieb Käsmodel auf, und eine heiße Sehnsucht nach dem Bäckerhaus wallte in ihm empor.
»Nun, da ist ja der Wanderbursch, der das Fußlaufen angenehmer findet als das Wagenfahren,« rief die Kammerherrin durch den Flur. Vor innerer Bewegung klang die Stimme der alten Frau härter und herber als sonst; sie mußte an sich halten, um das Kind ihres Sohnes, dieses Sohnes, um den sie zahllose Tränen geweint und tausend Schmerzen gelitten hatte, nicht weinend an ihr Herz zu ziehen. Raoul hörte nur die Härte, die Herbheit heraus; er dachte nur daran, daß es die Großmutter gewesen war, die ihn auf der Landstraße hatte stehen lassen. Unwillkürlich raffte er sich zusammen und verbeugte sich dann höflich und küßte die Hand der alten Frau, aber seine Lippen blieben fest geschlossen, und in seine sonnenverbrannte Stirn zog sich eine tiefe, senkrechte Falte, die seinem Gesicht etwas unendlich Hochmütiges, Trotziges gab.
Genau so hatte sein Vater einst die Stirn gezogen, und in diesem Augenblick glich er trotz den dunklen Augen und den dunklen Locken dem Vater so auffallend, daß die Kammerherrin diesen zu sehen vermeinte. Fast entsetzt starrte sie den Enkelsohn [S. 65] an, dann wandte sie sich stumm ab und verließ wortlos, nicht so aufrecht als sonst die Halle, — die alten Wunden waren von neuem aufgebrochen.
Frau Maria tat der arme, blasse Knabe leid. Sie zog ihn mütterlich liebevoll an sich und sagte herzlich: »Nun komm aber erst in deine Kammer, mein Kind, du wirst müde und hungrig sein. Heute sollst du Ruhe haben, morgen erzählst du uns dann von deiner Reise und siehst dich in deiner neuen Heimat um!«
»Morgen soll er erst erzählen?« rief Gottliebe namenlos enttäuscht, die schon immer vor Ungeduld von einem Bein auf das andere getreten war, »ich platze ja vor Neugier!«
»Dann wirst du wieder zusammengenäht, Mariell,« tröstete der Vater, und das heitere Lachen, in das alle einstimmten, fand nun selbst auf Raouls Gesicht einen schwachen Widerschein. Zum Erzählen war er aber doch zu müde, und er war froh, als er im Bett lag und schlafen durfte. Er schaute sich auch kaum noch in der freundlichen Stube um, in die ihn Frau Maria führte, und deren sanfte Stimme sowie Gottliebes zwitscherndes Lachen draußen aus dem Flur waren das letzte, was er noch mit wachen Sinnen hörte, dann schlief er ein. Tief und fest schlief er einem neuen Tage, einem neuen Leben entgegen.

Als Raoul am nächsten Morgen spät erwachte, schien die Sonne hell in sein Stübchen; in allen Winkeln lag das goldene Licht, und von seinem Bett aus konnte der Knabe noch in die Krone einer dicken Kastanie hineinsehen. Er lag ein Weilchen blinzelnd still, er mußte es sich erst überlegen, daß er nun wirklich in Hohensteinberg, der Heimat seines Vaters war. Dann aber sprang er eilig aus dem Bett, zog sich den Sonntagsanzug an, den ihm Meister Käsmodel noch gekauft hatte, und eilte die Treppe hinab. Er hatte es sich nicht recht gemerkt, wo das Wohnzimmer lag, und als er Stimmen hörte, ging er dem Schall nach und stand unversehens vor einer offenen Tür. In dem Gemach, das ganz wie sein Stübchen von Sonnenlicht durchflutet war, saßen die Kinder des Hauses beisammen mit ein paar jungen Gästen, die eben eingetroffen waren: Arnold und Fritz von Berkow, deren Vater der nächste Nachbar von Hohensteinberg war. Am Fenster saß die Großmutter, und neben ihr stand ein großer überschlanker Mann, Pfarrer Josua Buschmann. Dieser lebte auch auf dem Schlosse und versah zugleich neben seinem Pfarramt das eines Lehrers der Steinbergschen [S. 67] Kinder. Das Pfarrhaus im Dorf war 1807 in dem trübseligen, schweren Kriegswinter abgebrannt, und des Pfarrers Weib war wenige Wochen später gestorben. Da war der einsame Mann ins Schloß gezogen, um der Gemeinde nicht die Last aufzubürden, ein neues Pfarrhaus bauen zu müssen. Er war mit den Berkows zusammen gekommen, da er am Tage vorher über Land gewesen war.
Niemand hatte Raoul kommen hören, und einige Sekunden stand er zögernd und verlegen an der Türe, unschlüssig, was er tun sollte, als die Stimme Arnolds von Berkow sich laut aus den andern hervorhob: »Sagt, was ihr wollt, seine Mutter war doch eine Französin. Also ein halber Franzose ist euer Vetter doch und kein Verlaß auf ihn!«
Ein Schrei entrang sich Raouls Lippen, und plötzlich stand er mitten im Zimmer, stand vor dem langen Jungen, der ihn um einen halben Kopf überragte, und streckte ihm die drohend geballte Faust entgegen. »Meine Mutter, meine Mutter« — er konnte vor Empörung nicht sprechen, nur seine Augen blitzten in wildem Zorn.
Josua Buschmann sprang hinzu und zog den leidenschaftlich erregten Knaben fort, die Großmutter gebot scharf: »Geht hinaus, ihr Buben!« und einige Augenblicke später war Raoul allein mit der Großmutter, seiner Tante und dem Pfarrer. Die Buben und die Bäslein hatten alle zusammen das Zimmer verlassen.
Frau Maria sprach freundlich zu ihm, auch die Großmutter sagte ein paar Worte, aber Raoul war es doch, als hätte sich der helle Sommermorgen auf einmal in einen grauen, trüben Regentag verwandelt, und nur mühsam gab er auf alle Fragen Antwort. —
Raoul war mit einem Herzen voll Sehnsucht nach Liebe hergekommen, und auf der langen, beschwerlichen Reise hatte er sich die heitersten Bilder ausgemalt. Er hatte eine tiefe Dankbarkeit empfunden, daß er kommen durfte, und dabei hatte er auch wieder mit ein bißchen Stolz gedacht, daß die Verwandten sich gewiß recht freuen würden, daß er Hohensteinberg gewählt hatte und nicht nach Paris gezogen war. Ein grenzenloses Vertrauen zu der Mutter, dem Bruder seines Vaters war in ihm aufgeblüht; alles wollte er ihnen sagen, sein ganzes Leben schildern, und nun war es plötzlich, als habe sich da in seinem Herzen eine Türe geschlossen. Wie zugeschüttet war alles durch das eine unbedachte Wort. Er hatte es in seinem jungen Leben gelernt sich zu beherrschen, und so gab er sich auch alle Mühe, niemand merken zu lassen, wie es in seinem Herzen aussah. Kein Wort kam über seine Lippen, wenn er nicht gefragt wurde, und wenn er antwortete, tat er es so knapp und kurz, daß seine Verwandten wenig genug von seinem Leben erfuhren. Warum er eigentlich so rasch von Leipzig abgereist war, ahnte niemand in Hohensteinberg, niemand, wie tapfer Raoul für seine Mutter gearbeitet hatte, und wie lieb ihm die Bäckerfamilie war.
Nach ein paar Tagen hatten sich alle im Hause daran gewöhnt, daß Raoul da war, daß er schweigsam am Tisch saß, und daß er arbeitete und lernte. Kam er, merkte man es kaum, ging er, vermißte ihn niemand. »Er ist langweilig,« sagten die Basen; Joachim nannte ihn »verstockt, falsch, einen Franzosenfreund«, denn er grollte ihm, daß um seinetwillen sein Freund Arnold eine derbe Rüge empfangen hatte. Er ist wohl nur scheu, dachte Frau Maria, aber ihr Mann und seine Mutter empfanden es bitter, daß der Knabe so anders war als sein [S. 69] Vater; sie beide hätten so gern gut gemacht, was sie an Unversöhnlichkeit und Härte an seinen Eltern verschuldet hatten. Er ist von anderer Art, dachte die Großmutter schmerzvoll und verschloß auch ihr Herz vor ihm, wenn ihr gegenüber der Enkelsohn immer stumm blieb, ja ihr sichtlich aus dem Wege ging.
Nur der Pfarrer Josua Buschmann ahnte etwas von dem stillen Leiden des blassen Knaben. Er hatte ihn auf den Wunsch seines Onkels hin geprüft, und er war erstaunt gewesen, wie viel Raoul wußte, obgleich er doch, wie er selbst sagte, nie auf einer Schule gewesen war. Von dem Lernen mit dem Bäckerbuben zusammen erzählte Raoul nie. In den ersten Tagen nur hatte er einmal geantwortet: »Gottlieb hat mir das gesagt.«
Man hatte im Garten zusammengesessen, und Gottliebe rief verwundert: »Gottlieb, mein Namensvetter, wer ist das?«
»Mein Freund,« gab Raoul kurz zur Antwort.
»Wie heißt er denn weiter?« forschte Gottliebe neugierig, »erzähl doch!«
»Er heißt Käsmodel, sein Vater ist Bäcker,« sagte Raoul mit leisem Zögern. Er hätte gern noch mehr gesagt, denn auf einmal sah er deutlich Gottliebs gutes, treues Gesicht vor sich, und die Sehnsucht, von ihm sprechen zu können, erwachte jäh.
»Käsmodel,« schrie aber Karoline, »Käsmodel, nein, so ein Name! Und mit einem Bäckersohn hast du verkehrt?« Sie war ein etwas hochmütiges Jüngferlein und schnell und unbedacht in ihrer Rede; der Name erschien ihr auch so lächerlich, daß sie kichernd ihre kleine Nase hinter einem Buch verbarg. Auch Lobe lachte laut: »Käsmodel, nein, Käsmodel! Wie drollig!«— »Käsmodel!« rief auch Joachim spöttisch, »und von dem hast du was gelernt, von dem stammt deine Weisheit?«
»Er ist mein Freund,« erwiderte Raoul herb, und wieder grub sich auf seiner Stirn die senkrechte Falte ein, die ihn seinem Vater so ähnlich machte.
»Er ist gewiß sehr nett,« sagte Gottliebe schnell, der der Vetter leid tat, und auch Pfarrer Buschmann fragte freundlich nach dem Freunde und warf den Spöttern einen mahnenden, zürnenden Blick zu. Später fragte auch Frau Maria, und selbst der Oheim erkundigte sich nach den Bäckersleuten, aber Raoul gab immer nur kurze, ausweichende Antworten. Sie spotten doch nur über meine Freunde, dachte er bitter.
Er war durch diese Erfahrung noch scheuer geworden und fühlte sich bei den Verwandten durch Worte verletzt, die er früher kaum beachtet hätte.
Meister Käsmodel hatte oft herzhaft über die Franzosenwirtschaft geschimpft, und nie hatten Raoul und seine Mutter sich gekränkt gefühlt; jetzt auf einmal spürte der Knabe überall eine Feindseligkeit heraus.
Es wurde auf Hohensteinberg, als der Winter näher kam, viel von dem kommenden Krieg zwischen Rußland und Frankreich gesprochen, der drohte, und vor dem die Länder zitterten. An seinem Geburtstag, den 15. August, hatte Napoleon dem russischen Gesandten so scharfe Worte gesagt, daß alle den Krieg ahnten. Für Preußen war es durch die Mißernte des Jahres ohnehin eine harte Zeit, wie würde es werden, wenn der Zug Napoleons nach Rußland zur Wahrheit würde! Da ballte sich manche Faust heimlich in der Tasche, und mancher tapfere Mann hätte lieber dreingeschlagen als von einem Bündnis mit dem Eroberer gesprochen. Der König von Preußen Napoleons Verbündeter! Wie ein Hohn erschien das vielen, und zu denen, [S. 71] die des Landes Schmach mitfühlten, gehörte auch der Freiherr von Steinberg.
In der Wohnstube von Hohensteinberg wurde manches freie, kühne Wort gesprochen, wenn die Berkows da waren und Dr. Martinsen aus Langenstein, des Hauses alter Freund. Die Jugend des Hauses durfte zuhören. »Sie müssen die Not unserer Zeit erkennen lernen, sie müssen aufwachsen in der Sehnsucht nach Freiheit,« pflegte der Freiherr zu sagen.
Da war es Raoul aber manchmal, als stocke die Rede, wenn er dabei war; und wenn ihm zuweilen in heißem Mitgefühl das Blut in die Wangen stieg und er an seinen für das Vaterland gefallenen Vater dachte, da fühlte er, wie die Großmutter oder der Oheim ihn prüfend ansahen. Warum wurde er rot? Kränkten ihn die freien Worte?
Und warum schweigt er immer? dachte Joachim und sagte es dann zu seinen Freunden.
»Er ist für die Franzosen, natürlich!« spottete Arnold.
Den drei Knaben wäre es am liebsten gewesen, sie hätten gleich in den Kampf ziehen können. Was die Väter sprachen, erschien ihnen zu kühl und besonnen, und die Schwestern waren auf ihrer Seite. Die hatten auch die Köpfe voller Kriegsgedanken, am meisten Gottliebe, die war ungeduldiger und feuriger beinahe als die Buben.
Gottliebe war Joachims Lieblingsschwester, sie genoß sein volles Vertrauen, und die beiden hingen wie die Kletten zusammen. Die sanftere, ein Jahr jüngere Gottlobe pflegte eine zärtliche, schwärmerische Freundschaft mit Helene von Berkow, und seit Karoline auf Hohensteinberg weilte, auch mit dieser.
Seit Raoul gekommen war, gab es aber manchmal Streit [S. 72] zwischen Bruder und Schwester. Gottliebe tat der Vetter oft leid, sie konnte keine traurigen Menschen sehen. Weil sie wie der ferne Freund hieß, ruhten Raouls schöne, dunkle Augen oft, ihm selbst unbewußt, voll Traurigkeit gerade auf ihr, und Gottliebe fühlte, daß er litt, fühlte es wie Pfarrer Buschmann, und sie versuchte es auch wie der Geistliche immer wieder, des Vetters Vertrauen zu gewinnen. Sie suchte ihm kleine Gefälligkeiten zu erweisen; gab er eine gute Antwort in den Stunden, die sie gemeinsam hatten, dann rief sie wohl bewundernd: »Aber Raoul ist klug!«
Das verdroß Joachim. Der war begabt, aber er liebte es, mehr in Wald und Feld herumzustreifen oder mit den Berkows kühne Luftschlösser zu bauen, als eifrig zu lernen. Da mußte er dann sehen, daß der jüngere Vetter ihn, trotzdem er viel weniger Unterricht in seinem Leben empfangen hatte, manchmal überflügelte. »Natürlich, er ist ein Streber und Heimlichtuer,« sagte er, aber daß die Schwester den Verhaßten bewunderte, kränkte ihn tief, und manches scharfe Wort fiel darum zwischen den Geschwistern. Es gab Streit und Tränen, und die schöne Einigkeit war gestört.
Pfarrer Buschmann hörte das Streiten. Er sah, wie die Geschwister auseinanderkamen und Raoul doch einsam blieb, und versuchte zu versöhnen, aber Joachim besaß einen echten Steinbergschen Trotzkopf, der nicht so leicht zu brechen war. Je mehr der Pfarrer zum Guten sprach, desto mehr fühlte sich Joachim auch von dem so geliebten Lehrer zurückgesetzt und wurde auch gegen diesen mißtrauisch, sah mit Eifersucht auf Raouls rasches Vorwärtskommen und zeigte dem immer unverhohlener seine Abneigung.
So gärte und brodelte es im engen Kreise wie draußen in der weiten Welt, und darüber gingen die Tage dahin, und der Winter kam mit leisen Schritten gegangen. Er kam hier in Ostpreußen früher als in Sachsen, und er war schöner auf dem weiten, flachen Lande als drinnen in der engen Stadt. Der Schnee fiel schmeichelnd weich, weiß und still. Er lag bald in dicken Polstern auf den Dächern und Mauern, die Bäume neigten ihre Äste unter der weißen Last, und bald mußten die Wege zu den Scheunen und Stallungen und ins Dorf hinein geschaufelt werden. In dieser Zeit wuchs aber auch die Not im Lande. Auf Hohensteinberg freilich brauchte niemand Hunger zu leiden, und auch für die Dorfbewohner sorgten der Gutsherr und seine Frau, so gut sie es nur konnten. Doch der Klang der Not tönte auch von fern kommend in diese friedsame Stille hinein, und Raoul dachte in dieser Zeit oft daran, wie noch vor einem Jahr die Mutter gebangt und gesorgt hatte. Gar manchmal mußten in dieser Zeit die Töchter des Hauses in das Dorf gehen und den Kranken und Armen Speise aus der Schloßküche hintragen. An einem Dezembertag rüstete sich Gottliebe zu einem solchen Gang. Sie tat es gern, und die Dorfleute sahen sie gern kommen, denn wie ein lachender Sonnenschein kam sie in die niedrigen Stuben. Als Gottliebe durch den Hausflur ging, sah sie Raoul, und rasch bat sie: »Komm mit ins Dorf.«
»Mit dir allein?«
»Herr Pfarrer geht mit,« sagte Gottliebe und stellte ihren Korb an die Haustüre, »er kommt gleich, wir müssen nur ein Weilchen warten. Kommst du?«
Raoul nickte und trat neben die Base, und diese, die nicht gerade zu den Schweigsamen gehörte, erzählte ihm gleich: »Mutter [S. 74] schickt den alten, kranken Jakobsleuten Essen. Dort hinten im letzten Haus beinahe wohnen sie.« Da Raoul stumm blieb, fuhr sie lebhaft fort: »Ach, es muß schrecklich sein, arm zu sein, Hunger zu haben!«
»Sehr schrecklich ist's,« sagte Raoul, und die Falte grub sich in seine Stirn.
Gottliebe, der es plötzlich einfiel, daß Raoul und seine Mutter ja arm gewesen waren, sagte schnell, aus tiefstem Herzen heraus: »Armer Raoul!«
Das klang so kindlich lieb und herzlich, daß zum erstenmal wieder seit langer Zeit über Raoul der Wunsch kam, von der Mutter, von Leipzig und seinem Leben dort zu erzählen, aber es war, als wären ihm die Worte im Munde eingefroren: er, der sonst so lustig hatte plaudern können, wußte jetzt kaum noch etwas zu sagen. Doch Gottliebe schien seinen Wunsch zu ahnen, und herzlich bat sie: »Sag mir doch was von deinem Gottlieb! War er lustig?«
»Sehr,« gab Raoul zur Antwort, »und gut und tapfer.« Da kam ihm aus einmal das Erinnern an Gottliebs Zorn über den langen Schreiber, und er lächelte in den Gedanken daran ein wenig.
»Du lachst,« schrie Gottliebe erfreut, »dir ist was Vergnügtes eingefallen. Ach, und so was höre ich doch furchtbar gern. Bitte, los, erzähle, ich glaube, dein Gottlieb würde mir gefallen!«
»Natürlich, Gottlieb und Gottliebe, der Bäckerssohn paßt gut zu dir,« ertönte hinter den beiden auf einmal spöttisch Joachims Stimme, er war lautlos im Schnee am Hause entlang gekommen.
Ein heftiges Wort kam Raoul auf die Lippen, aber noch [S. 75] ehe er es ausgesprochen hatte, rief Gottliebe schon empört: »Pfui, wie du bist, Achim, wie hochmütig! Der Bäckerjunge, der ist gewiß sehr nett, vielleicht viel, viel netter und besser als du! Ja gewiß, er ist besser,« trumpfte Gottliebe noch auf, der im Zorn auch leicht Worte entfuhren, die ihr nachher selbst bitter leid taten.
Wortlos, blaß vor Wut drehte sich Joachim um und ließ die beiden stehen, und als er gegangen war, kam Gottliebe die Besinnung, daß sie mit ihrer Heftigkeit alles noch schlimmer gemacht hatte. »Ich bin zu dumm!« klagte sie. »Nun ist Achim fuchswild, und dabei will er immer recht sanft sein und alles gut machen und Frieden stiften und — —«
»Der Mund geht uns immer durch,« sagte Pfarrer Buschmann, der den letzten Ausruf gehört hatte, »was hat's denn gegeben?«
Treuherzig schilderte Gottliebe den Vorgang und stellte sich dabei noch einmal das Zeugnis aus, daß sie sehr dumm sei. »Manchmal stimmt es, aber nicht immer,« sagte der Pfarrer lächelnd und strich über die glühenden Wangen des Mädchens, und dann ging sein Blick von dieser hinweg zu Raoul, der finster in das weiße Land hinausstarrte. »Mußt es nicht zu schwer nehmen, mein Junge. Joachim ist ein Sprudelkopf, aber er kommt schon noch zur Besinnung.«
»Wär' ich doch nie hergekommen!« rief Raoul. »Es wäre schon besser gewesen, ich wäre nach .....« Er stockte, die Tränen stiegen ihm heiß in die Augen; in diesem Augenblick fühlte er tiefer noch als sonst seine Verlassenheit, und hastig drehte er sich um und eilte hinweg.
Traurig sah ihm der Pfarrer nach. »Armer Junge!« sagte [S. 76] er, dann nahm er Gottliebes Hand und schritt mit ihr dem Dorfe zu, und unterwegs sprach er mit dieser von Raoul, und daß der so einsam sei. »Du willst immer eine große Tat vollbringen, Gottliebe,« sagte er milde, »nun sieh einmal, hier könntest du es vielleicht, du könntest mit Geduld und Liebe Raouls Vertrauen zu gewinnen suchen und ihn mit deinen Geschwistern, mit den Berkows versöhnen. Da mußt du freilich dich selbst erst recht beherrschen lernen und darfst nicht verzagen, wenn es nicht gleich geht. Willst du das?«
Über Gottliebes Gesichtchen purzelten die Tränen nur so. »Ich will,« rief sie schluchzend, »ach ja, ich will ja ganz gewiß ein leibhaftiger Friedensengel werden, wenn's nur nicht so gräßlich schwer wäre. Hops! habe ich immer alles vergessen, und ich glaube, ich platze, wenn ich nicht sage, was ich denke.«
Pfarrer Buschmann lächelte linde, der kleine, zukünftige Friedensengel hatte doch noch recht viel zu lernen für sein Amt. »Mir scheint, Mariellchen,« sagte er, »du platzt recht oft, mal vor Wut, mal vor Neugier, mal vor Ungeduld, und schließlich werden wir doch einmal zu Meister Schramm nach Langenstein fahren müssen und dir einen Reifen umlegen lassen, oder die Flickmareike muß dich zusammennähen. Nimm dich nur in acht, sonst sehen wir alle nie etwas von dem Friedensengel.«
Halb lachend, halb weinend gelobte Gottliebe Besserung. »Ich geh nachher gleich zu Achim und bitte ihn, er soll gut sein,« sagte sie, »denn wenn er brummt, kann ich ihn doch nicht versöhnen, und zu Raoul will ich schrecklich nett sein.«
Nach ihrer Heimkehr fing Gottliebe gleich mit der Nettigkeit an, sie raste in Joachims Zimmer und fand dort die Berkows. Das kümmerte sie wenig. Mit einem lauten Schrei fiel [S. 77] sie dem Bruder um den Hals und bettelte: »Sei wieder gut, ich hab's ja nicht böse gemeint, und natürlich bist du viel, viel besser als alle andern.«
Joachim wollte zwar brummen, es tat ihm aber doch sehr wohl, daß ihn die Schwester in Gegenwart der Freunde so leidenschaftlich um Verzeihung bat. Er vergaß rasch, daß er eigentlich den Zank hervorgerufen hatte und die Hauptschuld trug, und sagte gnädig: »Na, laß nur, Liebe, es ist schon alles wieder gut. Aber nun geh, wir haben etwas zu besprechen. Vielleicht bekommt ihr Mariellen es auch bald zu erfahren, es ist etwas sehr Schönes, sehr Hohes, sehr Wichtiges. Erst müssen wir Männer es aber allein bereden.«
Beinahe wäre Gottliebe nun vor Lachen über die »Männer« geplatzt, aber sie bezwang sich, dachte an Pfarrer Buschmanns Mahnung und schlüpfte, die Schürze vor dem Gesicht haltend, hinaus. Draußen kicherte sie vergnügt hinter der Schürze und raste die Treppe hinab, dabei rannte sie beinahe Jungfer Rosalie um. Die Jungfer war eine wichtige Person in Hohensteinberg; sie waltete neben der Hausfrau in Haus und Hof und nichts entging leicht ihren scharfen Blicken, keine Unordnung, keine Nachlässigkeit blieb ungerügt.
»Hui,« brummte diese, »verdreht!« Die ältere, sehr hagere Person richtete sich nach dem Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, und schien eine wahre Abneigung gegen Silber zu haben. Wenn sie einmal mehr als zehn Worte hintereinander sagte, staunte das ganze Haus. Trotzdem führte sie in der Küche ein scharfes Regiment, und wenn sie ein Wort sagte, so war das oft so gut wie eine lange Strafpredigt. Auch Gottliebe entfloh ihr heute eilig, die Jungfer hatte so grimmig dreingesehen, [S. 78] daß es wohl besser war, nicht in ihre Nähe zu kommen. Doch kaum war sie ein paar Schritte gelaufen, da fiel ihr ein, Jungfer Rosalie könnte ihr doch einen Apfel geben. Diesen Apfel könnte sie Raoul bringen, und Raoul würde sich darüber freuen, und dann würden sie zusammen plaudern. Sie lief also hinter der Jungfer her, faßte sie am Rockzipfel und bettelte: »Schenk mir einen Apfel!«
»Jetzt?« Die Jungfer sah Gottliebe nur an, und hinter dem »Jetzt« meinte diese zu hören: »Jetzt ist es gar keine Zeit, Äpfel zu fordern. Äpfel sind Leckerbissen in dieser Zeit, und es ist sehr viel verlangt und sehr unbescheiden, so mitten am Tage einen Leckerbissen zu verlangen.«
»Ach Jungfer Rosalie, zuckersüße Jungfer Rosalie,« flehte Gottliebe, »es ist ja für Raoul, weißt du. Der arme Raoul ist traurig; Achim war so garstig zu ihm, und ich glaube, der arme, arme Raoul ist sehr unglücklich bei uns, und Herr Pfarrer Buschmann hat gesagt, ich möchte doch ein Friedensengel sein.«
»Schnapp!« knurrte die Jungfer, der die Rede viel zu lang war, aber dann nahm sie ihr Schlüsselbund und suchte sehr nachdrücklich einen Schlüssel, in dem Gottliebe sofort den zur Apfelkammer erkannte. Sie lief, selbst erstaunt über ihren schnellen Erfolg, vergnügt hinter der Jungfer her und erhielt auch wirklich den gewünschten Apfel, sogar einen besonders schönen roten. Sie ahnte nicht, daß Jungfer Rosalie ein tiefes Mitleid für den blassen Fremdling im Herzen trug. Sie bewohnte nämlich die Kammer neben Raouls Stube, und schon manche Nacht war das heiße, sehnsüchtige Schluchzen des Knaben an ihr Ohr gedrungen. Man muß ihm gut tun, dachte sie, und sie war froh, daß Gottliebe den gleichen Wunsch hegte. Sie drehte [S. 79] sich daher an der Tür noch einmal um und sagte: »Recht, daß d' gut bist!«
Zur selben Stunde sprach auch Josua Buschmann der Kammerherrin davon, daß man Raoul gut tun müsse. Die alte Dame hörte ihn schweigsam an, aber der herbe Ausdruck ihres Gesichts milderte sich nicht. Endlich sagte sie kühl: »Ich glaube, Sie irren sich, lieber Buschmann. Der Junge ist von anderer Art; er mag im Herzen doch mehr der Nation seiner Mutter angehören und fühlt sich darum fremd hier. Das macht ihn still und verschlossen.«
Der Pfarrer schüttelte den Kopf und erzählte wieder, was Raoul ausgerufen hatte. »Da klang ein tiefes Leid heraus. Ich weiß es nicht, aber mir ist es schon manchmal seltsam vorgekommen, daß Raoul damals so schnell kam, sich gar nicht nach der Anordnung seines Oheims gerichtet hat. Vielleicht hatte er einen Grund.«
Ein feines, kühles Lächeln umspielte die Lippen der alten Frau. »Lieber Buschmann, Sie sind ein Idealist und sehen mehr in dem Jungen, als in ihm steckt. Er ist ein Trotzkopf, das habe ich schon damals auf der Landstraße gemerkt. Darin gleicht er seinem Vater, aber freilich,« sie seufzte tief, »der war ehrlich und offen, und Raoul ist hinterhältig und verstockt. Vielleicht hat die Umgebung, in der er gelebt hat, auch einen schlechten Einfluß auf ihn gehabt, obgleich dieser Meister Käsmodel in Leipzig brav und ehrlich nach seinen Briefen schien. Ich will aber an Ihre Worte denken und mich meines Enkelsohnes mehr annehmen. Vielleicht gelingt es doch, ihn mehr zu einem Steinberg zu erziehen, zu einem echten deutschen Mann.«
Der Pfarrer neigte still das Haupt. »Solche brauchen wir in dieser Zeit, und vielleicht steckt in manchem ein Held, der stille seines Weges geht, und die Zeit enthüllt wohl das Gute, das verborgen ist.«

Weihnachten kam und ging vorbei. Es war ein stilles Fest in diesem Jahr, an dem die Sorgen nicht schwiegen. Teuerung im Lande und der Krieg in Aussicht. Was sollte da erst werden, wenn die französische Armee nach Rußland zog, wenn all die Tausende den Weg durch Deutschland nahmen? Immer lauter klang die Frage, immer fühlbarer wurde allen die Schmach, immer drückender empfand man das Joch der Fremdherrschaft.
Hohensteinberg lag im Winterschlaf, und im Hause ging alles seinen stillen Gang weiter. Raoul war noch immer ein Fremdling im Hause, nur mit Gottliebe sprach er manchmal vertraulicher. Ihr hatte er von Gottlieb erzählt und von der Mutter. Da hatte Gottliebe plötzlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen und gerufen: »Wie lieb muß die gewesen sein!« Seitdem war Raoul dem Bäslein im innersten Herzen zugetan, und wenn er es auch noch nicht fertig brachte, ihr von allem zu erzählen, so gab es doch manche heimliche Plauderstunde zwischen beiden, und Raoul empfand Gottliebes Freundschaft als besonderes Glück, und seitdem ertrug er die offene Feindschaft [S. 82] Joachims etwas leichter. Auch zu seiner Tante Maria und zu dem Pfarrer trug er eine stille Zuneigung im Herzen, aber immer wieder verschloß ihm eine unerklärliche Scheu den Mund, und die Großmutter sagte manchmal zürnend, wenn sie es in ihrer herben Art wieder versucht hatte, Raouls Vertrauen zu gewinnen: »Der ist doch von anderer Art.« Dann war sie so schroff und abweisend gegen den Knaben, konnte ihn so hart anlassen, daß sie wieder zerstörte, was Frau Marias Milde, Gottliebes zärtliche Freundschaft und Pfarrer Buschmanns klare Güte nach und nach aufgeweckt hatten. Und wie die Mutter dachte der Sohn; auch er wurde kühler und kühler gegen den Neffen, auch er sagte oft. »Er ist von anderer Art.«
Von Leipzig hatte Raoul noch keine Nachricht wieder. Er hatte einmal an Gottlieb und Karl Wagner geschrieben, sein Brief hatte traurig geklungen, und er hatte ihn lange liegen lassen, ehe er ihn absandte. Als er dann fort war, dachte er freilich oft: Wenn sie doch antworteten, mir erzählten, wie dort alles ist! Aber die Zeit verrann, der Brief kam noch immer nicht.
An einem Januartag war die Großmutter mit ihren Enkelinnen wieder einmal in Langenstein gewesen, und sie kehrten von der Fahrt zurück, als das erste leise Dämmern begann. Der Gutsherr kam eilig herbei, um seiner Mutter ritterlich beim Aussteigen zu helfen. An seinem Arm führte er sie in das Haus. Es waren Gäste gekommen, und die Erwachsenen saßen in dem Staatszimmer des Hauses.
In der Halle kam Joachim seinen Schwestern entgegen. »Kommt nach oben,« sagte er mit gedämpfter Stimme zu ihnen und Karoline, »ich habe mit euch zu reden.« Ein mißtrauischer Blick streifte dabei Raoul, der gerade dazukam.
Hurtig sprangen die drei Mädchen die breite Holztreppe hinauf, die in das erste Stockwerk führte, und langsam folgte ihnen Joachim.
Raoul starrte ihnen nach. Immer blieb er doch ausgeschlossen, immer allein. Jetzt hatten die andern wieder ein Geheimnis vor ihm, er merkte es an ihrem Flüstern und Tuscheln, an ihren verlegenen Mienen, wenn er plötzlich zu ihnen trat. Und wieder dachte er, wie er so verlassen in der Halle stand: Ich könnte weit weggehen, weit weg, und niemand würde mich vermissen.
Während sich Raoul in seinem Zimmer in ein Buch vertiefte, saßen in Joachims Kammer die andern Kinder mit den drei Berkows zusammen, denn auch Helene von Berkow, ein kräftiges, frohes Mädel von dreizehn Jahren, war mitgekommen. Die vier Mädchen hockten eng aneinandergeschmiegt wie drei Spätzlein auf dem Dachfirst auf einer großen, buntbemalten Truhe; Joachim selbst hatte seinen Platz aus dem einzigen Stuhl, der sich in dem Zimmer befand, während seine Freunde auf dem Bett saßen.
»Hiermit haben wir also heute den Tugendbund gegründet,« sagte Joachim und schlug kräftig auf ein kleines, grünes Buch, das vor ihm auf dem Tische lag. Auf der ersten Seite des Buches stand: »Gut preußisch alleweg,« darunter: »Heute wurde allhier der Tugendbund gegründet. Hohensteinberg, am 17. Januar 1812.« Auf der nächsten Seite stand: »Wir geloben alles, was in unserer Kraft steht, zum Wohle des Vaterlandes zu tun.« Arnold von Berkow hatte noch trotz des allgemeinen Widerspruchs darunter geschrieben: »Fluch Bonaparte, und Verderben allen Feinden des Vaterlandes!« Zuletzt kamen die Namen, und wohlgefällig besahen sich nun alle das Buch.
»Und es ist doch unrecht, daß wir Raoul nicht mit dazu nehmen,« sagte Gottliebe plötzlich, nachdem sie eine Weile schweigsam dagesessen hatte.
»Es geht nicht,« rief Joachim heftig, »er ist doch ein halber Franzose und ein Schleicher und Heimlichtuer dazu! Der gehört nicht in unsere Gesellschaft.«
Gottliebe stieß mit ihren Füßchen, die in schwarzen Kreuzbänderschuhen und weißen Zwickelstrümpfen steckten, nachdrücklich an die Truhenwand. »Er ist ein Steinberg wie wir, und ein Schleicher ist er nicht, und es ist abscheulich, daß wir ihn nicht in den Tugendbund aufgenommen haben. Wir behandeln ihn alle schlecht, und du bist am allerschlechtesten zu ihm.«
»Aber Liebe!« sagte die sanftere Gottlobe erschrocken, und Joachim warf der Schwester einen strafenden Blick zu.
»Frauenzimmer haben zu schweigen, wenn Männer reden,« rief Arnold von Berkow mit dem ganzen Stolz seiner fünfzehn Jahre. Gottliebe lachte hell auf. »Zwei Jahre bist du älter und redest wie ein Uralter; dabei sagt der Herr Pfarrer, deine Exerzitien wären voller Fehler,« spottete sie. Das Lachen steckte an, Karoline hielt sich kichernd ihre schwarze Taftschürze vor das Gesicht, und Gottlobe quiekte vor Vergnügen.
»Siehst du, Joachim,« rief Arnold erbost, »ich habe es immer gesagt: die Mariellen stören unsern ganzen Bund.«
»Sei doch nicht so ungalant,« sagte Karoline schmollend und verzog ihr hübsches Gesicht. Gottliebe aber sprang lachend auf. Schlank und feingliedrig stand sie da, wie goldene Fäden schimmerten ihre blonden Haare, ihre blauen Augen blitzten übermütig, und mit einem tiefen Knicks verneigte sie sich schelmisch vor Arnold von Berkow und sagte neckend: »Ich, ein Frauenzimmer, [S. 85] bitte um Verzeihung, daß ich hier bin und Luft schnappe, happ, happ!« machte sie dazu.
Arnold sah sie halb lachend, halb ärgerlich an, aber Joachim rief drohend: »Du bist ein Irrwisch, Liebe. Wenn du nicht still bist, wirst du hinausgesteckt!«
»Pah, du Brummbär!« sagte Gottliebe leichthin.
»Geh lieber hinaus — geh doch zu Raoul!« schrie der Bruder heftig. Blitzschnell verschwand bei diesen Worten der Ausdruck heiterer Schelmerei aus Gottliebes Gesicht; mit zornsprühenden Augen maß sie den Bruder, und wie sie beide so nebeneinander standen, da glichen sie sich Zug um Zug, beider Augen schimmerten fast schwarz vor Zorn.
»Liebe, aber Liebe, Joachim, zankt euch doch nicht!« rief Gottlobe ängstlich. Sie wußte schon, wenn Bruder und Schwester aneinander gerieten, gab es, trotz aller Liebe, heftige Worte. Doch Gottliebe warf den Kopf zurück und sagte trotzig: »Ich gehe. Gründet ihr alleine euren Tugendbund. Es ist doch Kinderei — ihr wißt ja gar nicht, was ihr wollt!«
»Ja geh, geh nur schnell, geh zu Raoul, du — du Franzosenfreundin du!« rief Joachim empört.
Einen Augenblick starrte Gottliebe den Bruder an, als wollte sie auf ihn losspringen, dann warf sie die blonden Locken in den Nacken und verließ lachend das Zimmer. Draußen aber stürzten ihr jäh die Tränen aus den Augen, und ein paar Sekunden lehnte sie fassungslos an der Wand. Dann eilte sie in das obere Stockwerk; dort gab es ein Kämmerchen, das nur zum Aufbewahren getrockneter Kräuter gebraucht wurde. Gottliebe hatte hier schon manchen Kummer verweint, und das dämmrige Kräuterkämmerchen war ein rechter Schmoll- und [S. 86] Trostwinkel für sie geworden. Sie weinte sich auch an diesem Tage die Last vom Herzen, und als sie genug geweint hatte, schüttelte sie sich wie ein ins Wasser gefallenes Kätzchen und sagte, überzeugt, daß bald alles wieder gut sein werde, ein paarmal in die kräuterduftende Stille hinein: »Der dumme Tugendbund ist an allem schuld, der dumme Tugendbund!«
»Wir wollen Gottliebes Namen ausstreichen,« sagte Joachim bedrückt, als die Schwester das Zimmer verlassen hatte. Er ergriff den Gänsekiel und strich den Namen aus, und dabei klangen in ihm die Worte nach: »Es ist ja Kinderei!« Hatte die Schwester vielleicht recht?
Joachim hatte viel durch einen Oheim von dem Königsberger Tugendbund gehört, dessen Auslösung König Friedrich Wilhelm III., dem französischen Drucke nachgebend, im Dezember 1809 verfügt hatte. Alle echten Vaterlandsfreunde waren durch diese Auflösung schmerzlich betroffen worden, auch in Hohensteinberg hatte man bitter darüber geklagt. Joachim sah auch die Not des Vaterlandes. Fest wurzelten in seiner Erinnerung noch die Schrecken des Kriegswinters von 1806/07, und in seinem jungen, feurigen Herzen reifte so der Plan, etwas zur Befreiung des Vaterlandes zu tun, irgend eine stolze, mutige Tat auszuführen. In den beiden Berkows fand er Gesinnungsgenossen. Alle drei schmiedeten schon lange abenteuerliche Pläne und gründeten endlich zusammen einen Bund, den sie mit einem gewissen Trotz den »Tugendbund« nannten, und für den sie eine glänzende Zukunft träumten. Weil Fritz von Berkow gemeint hatte, ein Bund müßte viele Mitglieder haben, und es auf den umliegenden Gütern wenig Altersgenossen gab, hatten die Brüder mit viel gnädiger Herablassung die Schwestern zum Beitritt aufgefordert, [S. 87] obgleich Helene von Berkow gleich sagte, die Sache wäre doch ein wenig unheimlich und vielleicht auch unrecht.
»Was sollen wir nun eigentlich tun?« fragte Karoline plötzlich gelangweilt; sie fand, Joachim brauche recht viel Zeit, Gottliebes Namen auszustreichen.
»Warten, bis die Zeit kommt. Ihr Frauenzimmer seid auch immer ungeduldig!« rief Arnold von Berkow ärgerlich.
»Ja, wir wollen etwas tun,« rief Fritz, dem die lange Pause auch nicht gefiel. »Joachim, mache einen Vorschlag, was wollen wir zuerst beginnen? Auch ein Freikorps bilden wie der Schill? Heisa, das sollte ein Kämpfen werden!«
Joachim klappte langsam das Buch zu und starrte den Freund an. Das war ein schmalbrüstiger, überlanger Junge, dessen wasserblaue Augen nicht gerade geistreich dreinsahen. Der ein zweiter Schill! Er hätte lachen mögen, so töricht kam ihm auf einmal die Sache vor, und dabei rötete sich doch seine Stirn vor Scham und Ärger. Hastig warf er das Buch in seine Truhe und rief ungeduldig: »Für heute ist's genug, ich schließe die Versammlung! Am Mittwoch treffen wir uns des Nachmittags im Freundschaftstempel, da sind wir ungestört.«
Die andern stimmten Joachims Vorschlag zu, Gottlobe und Karoline zwar etwas verstimmt über Gottliebes Austritt, sie wagten aber nicht recht, ihre Partei zu nehmen, und so verließen sie alle die Stube — die erste Sitzung des Tugendbundes hatte ihr Ende erreicht.
Nach einem Streit hatten sich sonst die Geschwister wohl noch ein bißchen angeknurrt oder waren ein paar Stunden um einander herumgegangen wie Muja, die Hauskatze, um ihre Suppenschüssel, wenn ihr der Dampf zu heiß ins Näschen stieg, [S. 88] aber dann hatte Liebe ein wenig geblinzelt, Joachim hatte irgend etwas Unverständliches geknurrt, und auf einmal hatten dann beide gelacht, herzlich befreiend, und die Schwester war wohl dem Bruder um den Hals gefallen, oder der hatte lachend die blonden Locken gezaust.
Diesmal war es anders, und die Versöhnung kam nicht mit solcher Windeseile, wie Gottliebe es gemeint hatte. Tage kamen, Tage gingen, und immer wich Joachim in stummem Trotz der Schwester aus. Er tat es, weil er sich schämte, und dieses Gefühl verbarg er hinter einer beleidigten Miene.
Er hatte rasch alle Lust an dem Tugendbund verloren, aber er wagte es nicht einzugestehen, daß er sich selbst mit seinen Ideen auf einmal sehr kindisch und unreif vorkam. Als das nächste Mal die Verbündeten zusammenkamen, hielt er dann die wildesten, blutdürstigsten Reden, sprach von Freischaren, und daß man, wenn die Franzosen nach Rußland ziehen würden, diese angreifen müßte; er betäubte die mahnende Stimme in seinem Herzen selbst durch seine wilden Worte.
Ich bitt' ihn nicht, wenn er nicht will, dachte Gottliebe, wenn ihr stummes Werben, ihr versöhnliches Entgegenkommen immer wieder zurückgewiesen wurde. Sie litt aber schwer unter dem Zwist mit dem Bruder. Sie wurde darüber still und nachdenklich, und nicht mehr wie sonst schallte ihre Stimme unter denen der Geschwister in hellster Fröhlichkeit heraus. Und weil sie selbst litt, begann sie immer besser zu verstehen, wie einsam und verlassen sich Raoul fühlen mußte. Sie suchte darum immer mehr, dem Vetter Freundlichkeiten zu erweisen, und ließ diesen nicht mehr so allein seines Weges gehen.
Pfarrer Buschmann, der viel in der Welt seiner Bücher [S. 89] lebte, freute sich darüber. Der sanfte, stille Mann ahnte nichts von dem unter den Geschwistern ausgebrochenen Streit, er dachte, nun würde Joachim bald dem Beispiel seiner Schwester folgen. Er lächelte darum auch nachsichtig und milde, als Gottliebe an einem sonnenhellen Nachmittag ziemlich ungestüm in die Bücherstube eindrang mit dem Ruf: »Kommst du mit nach Langenstein, Raoul?«
»Warum willst du denn so eilig dorthin, Liebe?« fragte Josua Buschmann und sah das errötende Mädel freundlich an.
Gottliebe hatte nicht gewußt, daß der Pfarrer anwesend war, und sie erzählte etwas verlegen: »Großmutter möchte von Jungfer Mahdissen allerlei haben, und weil Heinrich gerade nach Langenstein fährt, soll ich selbst mitfahren und alles holen.«
Jungfer Mahdissen war ein kleines, ältliches Persönchen. Sie besaß ein Lädchen, in dem es Zwirn, Nadeln, Wolle, auch allerlei Stoffe, Bänder und Perlen gab. Zu ihr gingen die Steinbergschen Mädchen himmelgern, der Laden — es war eine kleine Stube mit einer Türe nach dem Flur, an der ein Glöckchen bimmelte, wenn jemand kam — barg so viele Herrlichkeiten, alles darin erschien den jungen Dingern wundervoll, und Liebe in ihrer stürmischen Art hatte schon oft gewünscht: »Ich möchte einen Laden haben wie Jungfer Mahdissen!«
Seit Karoline von Prillwitz einmal die Kostbarkeiten des Lädchens ein wenig naserümpfend betrachtet hatte, meinte auch Gottlobe, es sei nicht mehr so reizvoll, zu Jungfer Mahdissen zu gehen, und so hatte sich Gottliebe allein erboten, für die Großmutter einzukaufen. Nachher hatte es den andern freilich leid getan, und sie wären gern mitgefahren, obgleich nur der alte Kastenschlitten benutzt wurde, aber Liebe, ärgerlich über [S. 90] Karolines Putenhaftigkeit, wie sie das Urteil der Base nannte, erklärte schnippisch: »Großmutter hat mir den Auftrag gegeben, nicht euch!«
»Ist auch besser,« spottete Line, »wir haben wichtigere Dinge vor.« Sie meinte damit eine Sitzung des Tugendbundes, die am Nachmittag stattfinden sollte, und Liebe, die sie wohl verstand, wurde blutrot und lief wütend hinaus. Sie ärgerte sich jedesmal, wenn sie an den Tugendbund dachte, und daß sie nicht dabei sein durfte, und vor lauter Schmerz und Ärger, und weil sie sich ganz verlassen fühlte, rannte sie, um Raoul zu holen.
»Also zu Jungfer Mahdissen,« sagte der Pfarrer schelmisch, »da fahre nur mit, Raoul, und sieh dir das Zauberreich an. So etwas Schönes hast du gewiß noch nie gesehen. Vergiß nur das Wiederkommen nicht, Liebe, und grüß mir die Jungfer auch.«
Liebe dankte und knickste und lief dann mit Raoul hinaus. Der Kastenschlitten stand schon zur Abfahrt bereit, und Heinrich brummelte bereits über die »Nölerei«. Geschwind stiegen die beiden hinein, wickelten sich in ein paar dicke Wolldecken, und fort ging es auf glatter, schimmernder Schneebahn dem Städtchen zu.
Joachim hatte die beiden fahren sehen, auch Lobe und Line, und alle drei fanden es empörend von der Schwester und Base, daß sie Raoul ihnen so vorzog, und alle drei gestanden sich die eigene Schuld nicht ein.
Auch die Kammerherrin hatte von ihrem Fenster aus die Abfahrt beobachtet, aber sie hatte sich darüber ein wenig gefreut, es war schon besser, die Kinder vertrugen sich zusammen.
»Wer ist denn Jungfer Mahdissen?« fragte Raoul das Bäslein.

Etwas Besseres, um ein Gespräch in Gang zu bringen, hätte Raoul nicht fragen können. Liebes Zünglein kläpperte förmlich, und mit bewundernder Begeisterung schilderte sie den kleinen Laden; dazwischen sagte sie immer wieder: »Wirst schon sehen!«
»Wie bei Käsmodels,« sagte Raoul sinnend, als Liebe sogar die bimmelnde Ladentür erwähnte, und auf der Base Gegenfrage erzählte er wieder von dem Bäckerhaus. Darüber verging den beiden die Zeit fast zu schnell, sie hatten beide kaum einen Blick für die weiße, im Sonnenglanz so schöne Landschaft. Wie eine tiefblaue Wand begrenzte fern der Nadelwald den Horizont. Sie waren der Stadt schon nahe gekommen, als über ihnen ein Krähenzug mit lautem Gekrächz hinwegzog, dem fernen Walde zu.
»Wohin geht es dort?« fragte Raoul, dessen Blicke den schwarzen Vögeln folgten.
»In einem weg nach Rußland, ein gut Stück bis hin ist's freilich noch,« sagte Kutscher Heinrich, der die Frage gehört hatte; er drehte sich um und wies mit dem Peitschenstiel nach Osten: »Dorthin will der Bonaparte ziehen, sagen jetzt alle. Einen weiten Weg hat er, wird manchem jungen Kerl das Leben kosten.«
Liebe schauerte zusammen und schmiegte sich unwillkürlich fester an den Vetter an. »Wenn die Franzosen nach Rußland ziehen, dann — dann —« sie stockte und sah in hilfloser Angst zu dem Knecht auf.
Der verstand die unausgesprochene Frage. Er nickte, und sein ehrliches Gesicht verfinsterte sich. »Dann kommen sie hier durch, und wir haben den schönsten Kladderadatsch. Gnade uns Gott, wenn das geschieht! Sie sagen zwar, unser König wollte [S. 92] jetzt dem Bonaparte sein Freund und Verbündeter werden, — na, den als Freund haben, da kommt doch eine böse Sache heraus.« Er drehte sich wieder um, knallte mit der Peitsche, und schneller holten die Pferde aus. Näher und näher kam das Städtchen.
»Wenn die Franzosen kommen,« flüsterte Gottliebe, »dann — nützt doch der Tugendbund auch nichts?«
»Was?« fragte Raoul erstaunt zurück.
»Leise,« bat Liebe, und tuschelnd vertraute sie dem Gefährten die Geschichte vom Tugendbund an. Auf einmal bedrückte sie die Sache, die sie vorher als Kinderei angesehen hatte: das Heimliche, Verborgene wollte ihr daran nicht recht gefallen, die Eltern hätten es doch wissen müssen. »Es ist vielleicht nicht recht, daß ich dir das verrate, aber — aber mir ist so bange!«
»Es ist nur eine Kinderei,« dachte Raoul, »und doch — es wäre besser, Joachim ließe solche Sachen,« sagte er nachdenklich. »Meister Käsmodel hat zwar oft auf Napoleon geschimpft, er hat uns aber oft gesagt, man müßte vorsichtig sein, und die Zeit sei noch nicht gekommen.«
»Meinst du, daß der Tugendbund eine — eine Verschwörung ist?« fragte Liebe angstvoll.
Da mußte Raoul doch lachen; so gefährlich erschien ihm der Bund nicht, und er tröstete das Bäslein und hatte es gerade erreicht, daß Liebe wieder vergnügt um sich blickte, als der Wagen vor Jungfer Mahdissens Lädchen hielt.
Raoul fand freilich die Herrlichkeiten der kleinen Ladenstube nicht so überwältigend, aber Gottliebe schaute sich einmal wieder in hellem Entzücken in dem Raume um, sie wurde auch von der Besitzerin mit sehr viel Freude begrüßt. »Ne—in, trautstes Mariellchen, Demoisellchen, ist das ein Freudchen!« rief Jungfer [S. 93] Mahdissen, die vielleicht um der eigenen Kleinheit willen die Gewohnheit hatte, allen Wörtern ein »chen« anzuhängen. So brachte sie denn Wollchen, Zwirnchen, Nadelchen, Stoffchen und allerlei herbei, pries wortreich die Güte ihrer Ware, nannte Raoul ein allerbastes Junkerchen, weil der Liebe an die Äpfel erinnerte, die die Mutter der Jungfer schickte.
»Nein, so ein Freudchen! Nun ist mir's ganze Tagchen lieb!« schrie die kleine Jungfer und warf vor lauter Freude erst ihr Ellenmaßchen, dann ihr Scherchen und zuletzt das ganze Bandchen unter das Tischchen. Nachher öffnete sie noch auf Gottliebes Bitten allerlei Kästen, zeigte Perlen und Bänder, angefangene spinnwebfeine Stickereien und behauptete kühn, »in ganz Parischen gäbe es nicht solche Sachchen,« was Liebe glaubte, aber Raoul etwas bezweifelte.
»Und so wundervolle Hauben kann Jungfer Mahdissen nähen,« rühmte Liebe deren Kunst dem Freund.
Eine tiefe Glut färbte jäh das Gesicht des Knaben, dann strömte das Blut schnell zurück, und Raoul sah noch bleicher und ernster aus als sonst. Die Erinnerung an die Mutter war ihm gekommen, wie sie — krank — Haube um Haube zierlich fein genäht und gefältelt hatte. Hastig bat er: »Wir sollten noch zum Posthalter gehen. Liebe, komm!«
Jungfer Mahdissen hätte die beiden gewiß nicht fortgelassen, wenn nicht eine Magd gekommen wäre, um für einen Groschen Zwirn zu kaufen; da nahm sie wortreich, mit sehr vielen »chens« Abschied von den Kindern. Draußen fragte Liebe: »Gefiel's dir nicht bei der Jungfer Mahdissen?«
»Doch!« sagte Raoul, und während sie beide den Weg aus dem schmalen Gäßlein, das den wunderlichen Namen »Katzenwinkel« [S. 94] trug, nach dem Marktplatz antraten, erzählte Raoul, wie fein und fleißig seine Mutter Hauben genäht hatte.
»Oh, du,« rief Gottliebe in ihrer warmherzigen Art, »wie gut, wie schrecklich gut muß deine Mutter gewesen sein! Weißt du, ich habe sie lieb. Ach, lebte sie doch noch, könnte ich sie einmal sehen!«
Raoul blieb stehen und sah das Bäslein dankbar an: »Du bist auch gut, Gottliebe, du und Pfarrer Buschmann, ihr seid gut zu mir.«
»Doch auch die Eltern, die doch auch!«
»Ja,« sagte Raoul mit leisem Zögern, »aber — dein Vater mag mich nicht leiden und die Großmutter auch nicht; von Joachim und Lobe sag ich erst gar nichts, und weißt du, es wäre viel, viel besser, ich ginge wieder fort.«
»Aber Raoul,« rief Liebe entsetzt. So hatte der Vetter ihr noch nie gezeigt, wie tief er litt, und ihr Herz floß über von innigem Mitleiden. Sie faßte Raouls Hand und gelobte, während ihr die hellen Tränen über die Wangen liefen: »Ich behalte dich immer, immer lieb, Raoul, du bist mein Bruder, und paß auf, die andern gewinnen dich auch lieb. Der Herr Pfarrer sagt es auch. Aber du darfst nie weggehen, nie! Versprich mir das, bitte, bitte!«
»Nein,« sagte Raoul leise, aber fest, »das kann ich dir nicht versprechen,« und sehnsüchtig sahen seine Augen die schmale Straße entlang, durch die sie schritten. Könnte er sie doch hinab gehen, zur Stadt hinaus, immer westwärts, Leipzig zu! Er schwieg aber davon, sagte jedoch tröstend: »Liebe, ich bin ja noch da, aber wenn du weinst, reiße ich gleich aus!«
Husch kam gleich das Lachen, wie Sonnenschein flog es [S. 95] über Gottliebes bewegliches Gesichtchen. Sie ergriff die Hand des Vetters und eilte lachend mit ihm schnell die Straße hinab über den Marktplatz hin.
Postmeisters Minettchen sah die beiden vom Fenster aus kommen. »Frau Mutter,« rief sie, »Gottliebe von Steinberg kommt, und sie lacht wieder, daß ich's beinahe höre!«
»Ei, sieh da, und der Französische ist auch dabei,« sagte der Herr Rentmeister Meldeling, der gerade bei Postmeisters einen Besuch abstattete.
In der Stadt war dieser kleine, immer lächelnde Mann nicht sehr beliebt; niemand hatte rechtes Zutrauen zu ihm, da er allgemein als Franzosenfreund galt. Er kniff die Augen zusammen und lächelte höhnisch: »Ja, ja, die vornehmen Herrschaften sind alle Tage lustig, Sorgen kennen die nicht!«
»Da ist Er schief gewickelt, — Er — —« Grasaffe — — wollte die Frau Postmeisterin sagen, sie schluckte aber das letzte Wort noch rechtzeitig herunter. »Die Steinberger Herrschaften leben nicht lustig, wenn es andern Leuten schlecht geht; sie haben ein Herz für die armen Leute, und — gut deutsch sind sie auch gesinnt.«
Das Wort klang dem Rentmeister übel in den Ohren, denn er war auch einer von denen, die sich der deutschen Art schämten. Er verabschiedete sich darum sehr eilig, aber an der Türe traf er doch noch mit den jungen Steinbergs zusammen. Er grüßte Gottliebe übertrieben höflich und schaute Raoul forschend und prüfend an.
»Der Mensch ist mir doch in der Seele zuwider,« rief die Frau Postmeisterin, nachdem sie die Eintretenden begrüßt hatte, »rein schlimm kann mir von seinem dummen Lächeln werden. [S. 96] Immer fragt er nach tausend Dingen, die ihn den Kuckuck was angehen. Mein Mann traut ihm auch nicht über den Weg, er sagt, er hält es mit den Franzosen. Und das ist einmal wahr: im schlimmen Jahr, als die Franzosen hier in Haufen durchzogen, da katzbuckelte er nur immer um sie herum und bonjourierte und dienerte in einem fort. Der stiftet noch mal ein Unheil an, das sage ich und —,« da brach die redselige Frau jäh ab, denn ihr fiel ein, daß ihr Mann sie immer ermahnte, nicht alles zu sagen, was sie dachte.
»Man könnte sich ordentlich fürchten,« sagte Gottliebe nachdenklich: »Mein Vater sagte erst neulich, der Rentmeister habe einen besonderen Haß auf ihn; ob das wahr ist, Frau Postmeisterin?«
»Hassen, das ist schon möglich, aber was kann das schaden?« meinte die Postmeisterin. »Dem gnädigen Herrn von Steinberg kann der falsche Mensch ja doch nichts anhaben; auf Hohensteinberg geschieht nichts, was nicht jeder wissen kann.«
Sekundenlang sahen sich Vetter und Base an, beide dachten bei diesen Worten: der »Tugendbund,« und beide durchrieselte eine leichte Angst. War es doch vielleicht mehr als eine Torheit?
Da kam der Postmeister in das Zimmer und brachte einige Postsachen. »Ein Brief für den Herrn Vater ist dabei,« sagte er, »aus Frankreich kommt er, es steht aber dabei, daß er nur dem Herrn Vater selbst ausgeliefert werden darf. Da will ich heute selbst noch hinauskommen; es muß alles seine Richtigkeit haben, alles hübsch nach der Ordnung!«
»Aber mein Vater ist in Königsberg, er kommt wohl erst morgen zurück,« rief Gottliebe und schaute neugierig auf den Brief. »Aus Frankreich? Ach, Herr Postmeister, ich graule mich.«
Der dicke Postmeister lachte: »Ich glaube gar, das gnädige Demoisellchen denkt, der Brief kommt von Napoleon selbst. Es sind ja viele gute Deutsche drüben, warum soll's davon nicht einem einfallen, an den Herrn Vater zu schreiben? Spekuliere, gar so wichtig wird die Sache nicht sein. Aber vielleicht sagen Sie daheim nichts, die Frau Mutter könnte sonst auch gleich Gespenster sehen. Weiberleut haben das so an sich.«
»Mann,« rief die Postmeisterin empört, »wie kannst du nur so despektierlich von der gnädigen Frau von Steinberg reden!«
»Na, na,« brummelte ihr Mann ein wenig verlegen, »eigentlich meinte ich ja dich. Du witterst ja überall eine Verschwörung und denkst, der Napoleon steckt hinter jeder Türe. Aber halt, da ist auch ein Brief für den Junker, aus Leipzig kommt er.«
Ein Brief aus Leipzig! Raouls Augen blitzten, und verlangend streckte er die Hand nach dem dicken Schreiben aus. Die Adresse da hatte Karl Wagner geschrieben, die klare, feste Schrift kannte er gut. Und wie er den Brief in der Hand hielt, kam die Sehnsucht wieder über ihn nach denen, die ihn lieb hatten, die ihn verstanden. Er konnte es kaum erwarten, den Brief zu lesen, aber trotzdem riß er ihn zu Liebes grenzenlosem Erstaunen nicht gleich auf; er behielt ihn in der Hand, auch als sie beide draußen wieder im Schlitten saßen und im ersten matten Abenddämmern Hohensteinberg entgegenfuhren. »Warum liest du den Brief nicht?« tuschelte Gottliebe dem Vetter zu. »Ich wäre schon geplatzt vor Neugier.«
»Erst versprich mir etwas, Liebe, gute Liebe,« bat Raoul, den Brief noch immer uneröffnet in der Hand haltend. »Erzähl' es niemand, daß ich einen Brief bekommen habe — sonst lachen [S. 98] sie wieder über meine Freunde, über den drolligen Namen, über —« Er zögerte und bat noch einmal: »Sag's niemand!«
»Ich bin stumm wie ein Fisch,« gelobte Gottliebe. »Es ist so fein, daß wir auch ein Geheimnis haben!« Und vor lauter Freude hopste und zappelte sie auf dem harten Sitz des schwerfälligen Schlittens hin und her, und es hätte nicht viel gefehlt, so wäre sie hinausgefallen. »Aber nun lies nur, lies, und dann, — bitte, bitte, mir sagst du doch, was drin steht?«
Raoul erbrach den Brief und las, während ein tiefrotes Glühen, der Widerschein der sinkenden Sonne, auf den Schneefeldern lag. Karl Wagner hatte geschrieben, einen klugen, herzlichen Brief, daß es nun ganz anders in der Schreibstube sei, der lange Neumann sei auf und davon gezogen. Er schrieb auch, er habe das Grab von Raouls Mutter manchmal aufgesucht und zuletzt Tannenzweige aus dem Universitätswald hingetragen; daneben sei ein frisches Grab: das kleine Lottchen von Meister Käsmodels sei gestorben, und die Eltern seien gar traurig um den Verlust des lieben Kindes. Der Schluß lautete: »Dein Brief klang nicht froh, Raoul, er klang nach Heimweh und Einsamkeit. Verzage nicht, wenn Dir die Heimat Deines Vaters nicht gleich Heimat wird, sondern Dir noch eine Weile fremd bleibt, eine Heimat gewinnt man nicht im Sturm. In Deiner Mutter Heimatland wärest Du vielleicht noch weniger glücklich gewesen, und der äußere Glanz hätte Dich auch nicht beglückt. Du tatest nach dem Willen Deiner Mutter: der Gedanke muß Dich trösten und aufrichten. Kopf hoch und mutig voran!«
»Wie gut er schreibt, dein Freund!« flüsterte Liebe. »Aber was meint er damit, von der Heimat deiner Mutter und dem äußeren Glanz?«
»Ich erzähle es dir später einmal,« sagte Raoul und schob den Brief in seine Tasche. Es war noch einer darin, und er ahnte, daß der von Gottlieb kam, und eine ihn wieder ergreifende Scheu hielt ihn ab, auch diesen Brief der neuen Freundin zu zeigen.
»Na, wenn ich nicht platze, so voll von Geheimnissen wie ich bin!« sagte Liebe nachdenklich, als der Schlitten sich wieder dem Schlosse näherte. »Es ist wirklich schwer. Bitte, Raoul, knuffe mich immer, wenn ich den Mund auftue, weißt du, sonst fährt mal was raus, ich weiß hinterher nicht wie!«
Der Knabe versprach das Knuffen gern, er hatte es aber nicht nötig: Gottliebe hielt an diesem Abend ihren Mund ängstlich geschlossen, sie war so schweigsam, daß es selbst der Großmutter auffiel; nicht einmal eine begeisterte Schilderung von Jungfer Mahdissens wundervollem Laden erfolgte. Und da auch Raoul schwieg, selbst mit Liebe nicht sprach, erklärte Joachim nachher den beiden anderen Mädchen mit grimmiger Freude: »Sie haben sich miteinander gezankt.«
Raoul aber las am Abend in der Stille seiner Kammer Gottliebs Brief, der nun nicht gerade ein Muster von Orthographie und Schönschrift war. »Lieber Raoul,« schrieb der Freund, »es ist fürchderliche Lankeweile seidtem daß Du fohrt bist und auch trauhrich denn unser Lottchen ist gestorben und wir sind alle trauhrich. Ich heuhle auch Mannichmal und habe keine Luhst mehr Lateinisch zu lernen, ich pleibe auch sihtzen. Raoul, komme doch nur wieder dann geht es allmahl besser. Vater sagt daß auch, reiße nur aus wenn sie Dich schlecht behanteln, den Weg weist Du ja schon und ich schicke Dir einen Thaler damit Du essen kannst. Reiße aus, reiße aus. Der [S. 100] lange Neumann ist fohrt und kann nicht mehr die Trepe rauf fallen. Reiße aus und alle grühsen Dich fielemahl.
Dein gantz getreuer liehber Freund Gottlieb.
Ich habe auch immer lauder Viehren und sie sagen ich bin am faulsten, aber es ist nicht war, Berger ist fiel fauhler und schreibt noch schlechter und macht noch mer Pfehler, wenn du komst geht es gewiehs besser.«
Raoul atmete tief auf und verbarg den Brief in seiner Tasche. Ausreißen, — vielleicht wäre es am besten!

Am nächsten Tag wurde der Hausherr zurückerwartet, und da man die Stunde seiner Ankunft nicht genau bestimmen konnte, entlief immer mal eines der Kinder der Stunde bei dem Pfarrer, und der ließ sie laufen und den Weg entlang spähen, ob der Vater noch immer nicht kam.
Auch seine Frau und seine Mutter sahen öfters hinaus, Frau Maria in doppelter Sorge: sie besaß einen Bruder, der um einiger Schriften willen das Land hatte verlassen müssen. Er war nach England gegangen, um dort zu warten, bis es Zeit war, in sein Vaterland zurückzukehren. Von diesem Bruder sollte auf dem Seewege nach Königsberg eine Nachricht kommen. Seit vielen Wochen hatten die Verwandten nichts von ihm gehört, und nun hoffte Frau Maria, ihr Mann werde einen Brief mitbringen.
Auch Joachim dachte an diesen Onkel Wolfgang, den er sehr bewunderte, und mitten in der Stunde — er war mit Raoul und Arnold von Berkow allein beim Pfarrer — sagte er plötzlich: »Ist's nicht eine Schande, daß der Oheim außer Landes gehen mußte?«
Pfarrer Josua Buschmann nickte trübe: »Das ist's, mein Sohn. Er war aber auch recht unvorsichtig in seinem Tun!«
»Pah,« rief Joachim, »soll ein Preuße nicht sagen dürfen, was er denkt? Was hat denn der Oheim getan? Dem Tugendbund hat er angehört und nachher nur seine Meinung gesagt, daß es ein Unrecht sei, den Bund aufzulösen.«
Raoul horchte auf. Das hatte er noch nicht gewußt; von dem Bruder Frau Marias war selten gesprochen worden. Hatte Joachim vielleicht in Gedanken an den Oheim den Tugendbund gegründet? Und wenn dieser hatte fliehen müssen, war die heimliche Sache nicht doch gefährlich? Recht lebhaft war Raoul dem Gespräche gefolgt, und als Pfarrer Buschmann antwortete, horchte er so aufmerksam zu, daß er nicht bemerkte, wie Joachim ihn beobachtete. In dem stieg die Wut heiß empor, und plötzlich sprang er auf. Seine blauen Augen waren fast schwarz vor Zorn, und den Stuhl heftig zurückschiebend, schrie er: »Wie er horcht, der Schleicher, der — der — Franzose — wie —«
»Achim!« Schwer fiel des Pfarrers Hand auf des unbändigen Schülers Arm, und die milden Augen des alten Mannes schauten mit einem so unaussprechlich leidvollen Ausdruck in das erregte Gesicht, daß Joachim sein Haupt senkte. Er fühlte, wieder hatte er sich von seinem ungerechten Zorn übermannen lassen, aber wieder hatte er nicht die Kraft, seine Schuld einzugestehen, und bissig grollte er: »Ich kann ihn nicht leiden!«
»Ich ihn auch nicht,« murmelte Arnold von Berkow leise nach, aber Raoul hatte auch das Wort gehört. Seine Brust hob und senkte sich, einen Augenblick war es, als wollte er sich auf die beiden Knaben stürzen, doch des Pfarrers Gegenwart bannte ihn. Er drehte sich um, verließ hastig das Zimmer [S. 103] und rannte den Flur entlang seiner Stube zu. Unten hörte er lautes Rufen, Hundegebell, — der Oheim war angekommen, Freude war im Haus.
Und über dieser Freude merkte es niemand recht, daß Joachim beim Mittagessen still war. Arnold von Berkow gab sich Mühe, laut und lustig zu antworten, wenn er gefragt wurde, er vermied es aber, Raoul anzusehen. Pfarrer Buschmann hatte von den Knaben gefordert, sie sollten dem gekränkten Kameraden Abbitte leisten. Noch nie hatte der gütige Mann so hart, so streng mit seinen Schülern gesprochen, noch nie ihnen so das Unedle, Niedrige ihrer Handlungsweise klar gemacht. Es hatte Joachim tief getroffen, und tief bohrte und nagte die Scham über sein Tun in dem Knaben. Arnold nahm es leichter; er wäre auch eher bereit gewesen, das Versprechen der Abbitte zu geben, aber Joachim hatte es nicht getan, und so hatte der Pfarrer seine Zöglinge entlassen mit den Worten, er würde ihren Eltern Mitteilung machen und eine Trennung bewirken, wenn sie seinen Willen nicht erfüllten.
Nach Tisch sprach Josua Buschmann auch mit Raoul, aber es schien, als hätte sich die Seele des Knaben, die sich dem Lehrer schon etwas geöffnet hatte, wieder geschlossen. Still, blaß, mit fest zusammengepreßten Lippen hörte er die gütigen Worte an. Er klagte nicht, er sprach den Namen seiner Gegner gar nicht aus, nur als der Pfarrer ihn entließ, drehte sich Raoul plötzlich auf der Schwelle wieder um, kehrte zurück und küßte rasch, wie bittend, die Hand des alten Mannes, und ein paar Sekunden sahen die beiden sich an. »Mein Junge, mein armer Junge!« rief der Pfarrer tief bewegt und zog Raoul an sich, denn ein so wilder Schmerz hatte ihm aus den dunklen Augen [S. 104] entgegengeblickt, daß er fühlte, hier war ein Leid, das über den Kummer eines Kindes hinausging. Es darf nicht so weiter gehen, dachte er, sonst geht an kindischem Trotz, an unvernünftiger Torheit eine junge Seele zugrunde. —
Gottliebe merkte nichts von der neuen Kränkung, die dem Freunde widerfahren war, sie hatte sich für den Nachmittag etwas ausgesonnen, was sie ganz allein ausführen wollte. Niemand im Hause ahnte etwas von dem Tugendbund, der allwöchentlich zweimal in einem kleinen Freundschaftstempel am Parkende tagte. Pfarrer Buschmann pflegte um die Nachmittagszeit in das Dorf zu wandern, und den andern fiel es nicht auf, daß die Kinder in den Freundschaftstempel gingen. Die beiden Berkows und Oswald Hippel, der Sohn des Marienfelder Amtmannes, der auch in den Bund eingetreten war, kamen auf heimlichen Waldwegen und fanden dies heimliche Kommen ungemein romantisch.
Seit ihrem stürmischen Austritt hatte Gottliebe kein Wort mehr über den Tugendbund von den Geschwistern gehört; sie war zu stolz und trotzig, um darnach zu fragen, aber sie war die einzige, die die heimlichen Zusammenkünfte merkte. Deshalb war sie auch brennend neugierig, einmal dabei zu sein, und so beschloß sie, es heimlich zu tun. Und dieser Nachmittag erschien ihr wundervoll geeignet, ihren Plan auszuführen.
Im Schatten hochstämmiger Ulmen lag am Ende des Gartens der Freundschaftstempel. Er war von einem Urgroßvater der Kinder erbaut, und manch heiteres Fest war einst darin gefeiert worden. Die Wände des Tempels waren mit Malereien bedeckt. Da wandelten zierliche Schäferinnen in Reifrock und hoher gepuderter Frisur einher und führten weiße Lämmchen an rosenfarbenen [S. 105] Bändern. Wohl waren die Malereien zum Teil zerstört, aber die Kinder betrachteten immer wieder die anmutigen Bilder mit neuem Entzücken. Über dem Eingang standen, ein wenig verwischt zwar, aber noch leserlich, die Worte:
Gartengeräte und allerlei altes Gerümpel wurden in dem Tempelchen aufbewahrt, das von den Erwachsenen nur selten noch betreten wurde, denn die ernste Gegenwart hatte keine Zeit mehr für die lustigen Gartengesellschaften vergangener Tage.
In ein dickes, graues Tuch gehüllt, huschte Gottliebe an diesem Nachmittag durch den Gartenausgang des Schlosses hinaus und eilte nach dem Tempelchen. So sehr war das lebhafte Jüngferlein von ihrem Vorhaben erfüllt, daß sie nicht merkte, wie Raoul den Versuch machte, mit ihr zu sprechen. Er hatte an der Haustüre auf sie gewartet, nun sie so rasch davonlief, kehrte er still und traurig in das Haus zurück. Sie purzelte fast hin vor Eile, und im Tempelchen angekommen, versteckte sie sich eilig hinter einer im Winkel stehenden mächtigen Wassertonne und kicherte übermütig vor sich hin, als nach einer Weile die Geschwister mit den Freunden den Raum betraten. Gottliebe lauschte gespannt, aber irgend etwas Neues, etwas Besonderes hörte sie nicht. Die Berkows, besonders Fritz, hielten wilde Reden gegen den Feind, und Karoline und Gottlobe, die auf einer umgestürzten Schiebkarre saßen, quietschten manchmal laut auf, wenn einer der Knaben gar zu heftige Worte sagte. Joachim saß schweigend und finster da, er schien kaum zuzuhören. Gottliebe konnte gerade sein Gesicht sehen, und sie dachte: Ihm [S. 106] ist die Geschichte nicht recht. Doch sie hatte die Gedanken des Bruders nur halb erraten: der Auftritt des Morgens, des Pfarrers Worte hallten in ihm nach, und noch törichter, kindischer als sonst fand er der Freunde Reden. »Es ist langweilig, albern!« sagte er plötzlich hart.
In diesem Augenblick hörte Gottliebe neben sich ein Knistern, sie sah auf und erblickte auf dem Deckel der Wassertonne — eine Ratte, die dort vergnügt auf und ab spazierte. Vor Ratten und Mäusen aber hatte Gottliebe eine schreckliche Furcht, und voller Grauen sah sie auf das Tierchen, dem es ganz behaglich zu sein schien.
Ich darf nicht schreien, dachte sie und preßte ihr Tuch fest vor den Mund; ach, wäre ich doch nur erst draußen! Die Ratte lief hin und her, dann versuchte sie an der Außenwand der Tonne herunterzuklettern.
»Sie kommt, sie kommt!« Gottliebe kroch immer mehr auf ihrem Platz zusammen. »Der dumme Tugendbund,« schalt sie wütend, »wäre ich nur nicht hierher gekommen!« Der Angstschweiß trat ihr auf die Stirn, und sie bebte vor Furcht: das wildeste Raubtier der Wüste hätte ihr keinen größeren Schrecken einjagen können. »Wenn sie mir ins Gesicht springt, sich in meine Haare verwickelt, wenn — wenn —« Tausend Fährnisse fielen ihr ein, und ihre Augen ruhten immer starrer, immer entsetzter auf dem Tiere, das sein Dasein ganz behaglich zu finden schien. Das lief nach rechts, nach links, und auf einmal schien es sich nach Abwechslung zu sehnen. Plumps, sprang es von der Tonne herunter, und Gottlobe und Karoline kreischten. »Hier sind Mäuse!«
»Nein, Ratten!« brüllte Gottliebe, der plötzlich die Ratte [S. 107] auf den Schoß hopste. Mit einem gellenden Schrei sprang sie auf und stieß an die Wassertonne, die ins Wanken geriet, und es rasselte und polterte laut. An den erschrockenen Tugendbundgenossen vorbei raste Gottliebe und stürmte in den Garten hinaus. Draußen stieß sie unversehens an eine dunkle Gestalt an; ein unterdrückter Aufschrei wurde laut, und kollernd wälzte sich ein Mann auf dem Rasen.
Verdutzt blieb Gottliebe einige Sekunden stehen, der Mann richtete sich auf, und das Mädchen erkannte in ihm einen ehemaligen Gärtner, den der Hofverwalter vor einiger Zeit wegen Untreue entlassen hatte. »Ach gnädigstes Fräulein,« stammelte der Mann, »ich wollte — ich dachte —!«
Da kamen die Tugendbündler schon aus dem Tempelchen heraus. Blitzschnell entschwand der Mann in dem nahen Gebüsch, dort duckte er sich nieder, und Gottliebe raste, von den andern verfolgt, dem Hause zu. »Haltet die Spionin, haltet sie auf!« schrie Joachim dicht hinter ihr.
Doch auf einmal stutzten alle und drängten verlegen rückwärts, — Raoul stand vor ihnen. Er hielt Gottliebe fest, trotzdem sie flehte: »Laß mich los, die andern — und in der Regentonne ist — die Ratte auf mich gehopst.« Der Knabe achtete gar nicht auf die verwirrte Rede. »Bleibt,« sagte er schroff, aber leise, »ich glaube, ihr seid verraten. Der Rentamtmann, Liebe, von dem du gestern gesagt hast, er haßt deinen Vater, ist bei ihm, ich sah ihn kommen. Ein Mann ist mit ihm gewesen, der lief nach dem Park, und ich sah von meinem Fenster aus, wie er an der Türe des Tempelchens horchte!« Kurz, stoßweise hatte der Knabe die Worte hervorgebracht, sie waren ihm sichtlich schwer geworden, aber plötzlich warf er einen schnellen Blick [S. 108] in das Dickicht neben dem Weg, rief nur noch: »Haltet ihn!« und setzte einem davoneilenden Manne nach.
»Er ist's,« rief Liebe, und einige Sekunden später raste auch sie dem Lauscher nach.
Doch Raoul hatte ihn schon gefaßt, und blitzschnell ersah er ein kleines, grünes Buch in seiner Hand. Von dem Buche hatte doch Gottliebe gesprochen. Mit einem Ruck entriß er es dem Manne, der wollte es wieder an sich reißen und versetzte Raoul einen Faustschlag, aber schon hatten die vier andern Knaben die beiden umringt, und der Lauscher dachte nur noch daran, sich in Sicherheit zu bringen. Er war ein starker Mann und warf erst Arnold, dann Fritz von Berkow in den Schnee, und ehe noch Joachim ihn halten konnte, war er fort und über die Gartenmauer gesprungen.
Wenige Minuten nur hatte das Schreien und Toben den Garten durchgellt, dann war eine tiefe Stille eingetreten, und die Verschwörer sahen alle verlegen, beschämt und ruhig auf Raoul, dem das Blut aus der Nase rann, — der Faustschlag hatte gut getroffen.
Gottliebe fand zuerst Worte. »Er blutet,« jammerte sie und hielt dem Vetter gleich hilfbereit die Schürze hin.
»Es ist nicht schlimm,« sagte der, »hier ist das Buch!« Er warf Joachim das Buch zu, drehte sich um und eilte in das Haus zurück. Er lief dort gerade Frau Maria in die Arme, die von dem Lärm herbeigelockt worden war und sich nun erschrocken liebevoll des Neffen annahm. Als sie beide durch den Hausflur gingen, schlüpfte ihnen Gottliebe nach, und alle drei hörten aus des Hausherrn Zimmer heraus heftige Stimmen klingen. Gottliebe schaute so entsetzt zur Mutter auf, daß diese [S. 109] sagte: »Es ist nicht schlimm: der Rentamtmann hat allerlei Klagen, brauchst keine Sorgen zu haben!«
Gottliebe atmete auf, aber dann dachte sie wieder an den entlassenen Gärtnerburschen, der das Buch gefunden hatte, und Raoul mußte von den gleichen Gedanken bewegt werden; er beugte sich vor und flüsterte so leise, daß es die Tante nicht hören konnte: »Sie sollten es verbrennen!«
»Lauf mal in die Küche und sage Jungfer Rosalie, sie solle Leinwand und Essig bringen,« gebot Frau Maria da, und eilig lief Gottliebe, den Auftrag auszurichten. Atemlos bestellte sie der Jungfer Rosalie, was die Mutter gesagt hatte, und just war sie fertig, als Joachim mit seinen langen Beinen durch das offene Fenster in die zu ebener Erde liegende Küche einstieg und zu Jungfer Rosalies grenzenlosem Erstaunen ein grünes Etwas in das hellbrennende Feuer warf.
»Na?« rief die treue Hüterin der Küche verdutzt.
»Ja,« brummte Joachim nicht minder lakonisch und starrte in die Flammen. Das Büchlein wandte und drehte sich, es sperrte seine Deckel weit auseinander, und dann — war es zu einem Häuflein glühender Asche verwandelt.
Gottliebe hatte mit der gleichen gespannten Aufmerksamkeit zugesehen, und als nichts mehr von dem unseligen Buch zu sehen war, schaute sie zu dem Bruder auf, und sekundenlang blickten die Geschwister sich wie befreit an. »Es war dumm,« murmelte Joachim und stieg dann eilig wieder zum Fenster hinaus, um den ziemlich verwirrten und verängstigten Tugendbündlern zu melden, daß das Werk vollbracht sei.
Gottliebe kehrte zur Mutter zurück. Sie sollte Raoul pflegen helfen. Es gab aber nicht viel zu pflegen, der Knabe bat nur, [S. 110] man möchte ihn allein lassen, schlafen lassen, er sei so müde. Und weil er so blaß aussah und jedes Wort ihm schwer zu fallen schien, willfahrte Frau Maria gern dem Wunsch und ließ den Neffen allein. Einigemal noch sah sie an dem Nachmittag in das Stübchen, und immer fand sie Raoul anscheinend in tiefem, festem Schlafe liegen. Still, wie sie gekommen war, verließ sie wieder das Zimmer und ahnte nicht, welche schwere, unruhige Gedanken den Knaben bewegten, wie er rang, um den rechten Weg für sein Tun zu finden.
»Der Raoul ist doch ein anständiger Kerl! Brav, wie er uns geholfen hat! Aber Liebe ist eine Klatschbase und Horcherin,« hatte Arnold von Berkow im Kreise der Tugendbündler erklärt, die noch immer mitten im Schnee des Parkes standen und gar nicht wußten, was sie beginnen sollten.
»Sie war vernünftiger als wir,« grollte Joachim. »Wißt ihr,« wandte er sich an die Freunde, »ihr geht nach Hause, und ich begleite euch. Vielleicht ist es jetzt am besten, wir sind nicht zu finden.«
Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen, die Mädels meinten, sie wollten in das Dorf gehen und einen Krankenbesuch machen, und die Knaben schlugen im Geschwindschritt den Heimweg an. Joachim ging eigentlich nur mit, weil er eine Frage des Vaters fürchtete. Zu feige, eine Schuld zu leugnen, war er nicht, aber es trieb ihn hinaus, weil Raoul im Hause war, Raoul, dem er so schweres Unrecht zugefügt hatte. Er fühlte, er mußte den Vetter um Verzeihung bitten, das war seine Pflicht, aber der harte Steinbergtrotz in ihm lehnte sich noch immer gegen die Demütigung auf. »Ich hasse ihn,« dachte er, und dabei sah er immer noch das blasse, blutige Gesicht vor [S. 111] sich, die schönen, traurigen Augen, und er fühlte dumpf und unklar, daß auch sein Haß nur Trotz war.
Schweigsam schritt er neben den Freunden hin, die noch laut und aufgeregt den Fall besprachen, und was hätte geschehen können, wenn das Buch mit all den wilden Schmähworten wirklich in die Hände des Gärtnerburschen gefallen wäre. »Es wäre uns schlimm ergangen,« meinte Fritz von Berkow kleinlaut, und Oswald Hippel rief immer wieder in ehrlicher Selbsterkenntnis: »Eigentlich war's doch eine dämliche Kinderei!«
Als Joachim von den Freunden Abschied nahm, bat Arnold: »Grüße Raoul. Ich sag's ihm morgen, daß mir die Geschichte leid tut.«
»Morgen, morgen ist Zeit genug,« dachte Joachim, »ja, morgen, da will ich's ihm auch sagen.« Und als er heimkam, atmete er erleichtert auf, als er hörte, daß Raoul schlief, da rückte doch auch die bittere Stunde für ihn in die Ferne.
Gottliebe hatte den Geschwistern gleich mitgeteilt, was die Mutter von dem Besuch des Rentamtmannes gesagt hatte, also wußte der Vater nichts davon, und der Sturm war an ihnen vorübergebraust. Sie hatten aber doch sein Sausen gehört, und sie saßen alle wie Vögel nach einem Gewittersturm am Abend am Familientisch. Auch Liebe war niedergeschlagen, obgleich weder Bruder noch Schwester und Base sie um des Horchens willen geneckt hatten. Zwischen ihnen waren auf einmal alle bitteren Worte vergessen, die gemeinsame Angst hatte sie wieder vereinigt.
Der Eltern Augen aber ruhten forschend auf den Kindern, und der Großmutter Blick haftete immer an Raouls leerem Platz. Nach dem Abendessen, als Jungfer Rosalie und der [S. 112] Vogt, die nach altem Brauch am Herrentisch aßen, gegangen waren, rief Herr von Steinberg: »Kinder bleibt! Joachim, erzähl' mal, wer hat Raoul geschlagen?«
»Der Jakeit,« gab Joachim zur Antwort, während eine heiße Röte über sein Gesicht lief, lügen konnte er nicht.
»Der Jakeit?« fragte der Vater erstaunt, »wie kam er dazu? wo war er?«
»Er trieb sich — im Park herum. Wir wollten ihn halten, da schlug er Raoul, warf Arnold und Fritz hin und riß aus!«
»Wie ist der Jakeit wieder in den Park gekommen?«
»Jungfer Rosalie sagt, er wäre als Begleiter des Rentamtmannes gekommen,« mischte sich Frau Maria ein.
»Was steckt aber dahinter? Ihr seid so verstört!« fragte die Großmutter scharf, und ihre Augen suchten prüfend die Gesichter der Enkelkinder. Die schwiegen, eins sah das andere an, sie wurden alle rot und wagten doch nichts zu sagen.
»Wieder ein Streit mit Raoul!« rief Pfarrer Buschmann traurig. »Wie junge Raben hacken sie auf den armen Burschen ein, es ist kein Vertragen, keine Liebe zwischen ihnen.«
»Die andere Art!« Die Kammerherrin murmelte es nur leise, aber Frau Maria hatte das Wort vernommen, und sie sagte sanft: »Und Raoul ist doch ein Steinberg, ist manchmal ganz sein Vater, so wie mir Georg-Wilhelm in der Erinnerung lebt, nur weicher, ernster, verschlossener ist er. Ich denke immer, wir tun allesamt dem armen Jungen unrecht und bringen ihm nicht genug Liebe entgegen!«
»Bei Gott, Maria,« rief der Freiherr, »du hast recht. Ein echter Steinberg ist der Raoul, und wir haben ihn alle verkannt. Hört, was ich heute erfahren habe.« Und bewegt erzählte [S. 113] er, daß Graf Turaillon an ihn geschrieben und ihm mitgeteilt habe, daß Raoul damals in Leipzig unauffindbar gewesen wäre. Bäckermeister Käsmodel hätte erklärt, auf Wunsch seiner Mutter hätte der Knabe sich zu den Verwandten seines Vaters begeben. Noch einmal bot der Graf dem Neffen an, er wolle ihn zum einzigen Erben seiner Reichtümer einsetzen, und bat den Freiherrn, der doch Kinder hatte, ihm den Knaben auszuliefern. »Darum ist der Junge damals so eilig gekommen! Er hat uns gewählt, hat sich zu uns Steinbergs gehalten,« rief der Vater, »aber er mag wohl nicht das rechte Zutrauen haben fassen können, sonst hätte er uns alles erzählt.«
»Jetzt versteh' ich's,« rief Liebe plötzlich und wurde dann namenlos verlegen, weil es nicht Sitte war, daß eins der Kinder ungefragt sich in das Gespräch der Erwachsenen einmischte.
Doch diesmal blieb ihre Vorwitzigkeit ungerügt, und der Vater fragte: »Was verstehst du jetzt?«
»Karl Wagners Brief,« stammelte Liebe, und dann erzählte sie sehr geschwinde, sehr kraus mit allerlei Abschweifungen, wer Karl Wagner sei, was er geschrieben habe, und daß Raoul nichts mehr von seinen Freunden sagen wollte, weil — weil — hier stockte sie und fuhr dann fort, tapfer die Schuld der Geschwister mit auf ihre Schultern nehmend, »wir so über den komischen Namen und die Bäckersleute gelacht haben. Aber sie sind gewiß alle gut, und sie können alle Napoleon nicht leiden, und Gottlieb singt immer: Warte, warte, Bonaparte, und —« Gottliebe mußte einmal nach Luft schnappen, die Rede war zu lang und eilig gewesen, und sanft strich die Mutter, neben der sie saß, über das heiße Gesicht des Kindes. »Wir [S. 114] haben Raoul wohl alle nicht verstanden, haben uns beeinflussen lassen, weil — seine Mutter eine Französin gewesen ist!«
»Ach, und sie muß himmlisch gut gewesen sein, und Hauben hat sie genäht, und Raoul hat sie so viel von der Großmutter und unserem Vater erzählt.« Wieder rügte an diesem Abend niemand Gottliebes lebhaften Zwischenruf, und wieder strich die Mutter liebkosend die blühende Wange ihres Kindes und dachte still: Du gutes Herzlein, du!
»Wer gefehlt hat, soll trachten, es gut zu machen, damit Raoul in diesem Hause auch die Heimat findet, die er gesucht hat,« sagte der Freiherr ernst, tauschte einen Blick mit seiner Mutter und sah dann auf Joachim. Der senkte den Kopf. Morgen, morgen, klang's in ihm.
Nachher ging Frau Maria noch einmal in des Neffen Zimmer, und da lag der still und gab keine Antwort auf den leisen Ruf. Morgen, morgen, dachte auch die Frau und klinkte die Türe ein und ermahnte dann ihre Kinder: »Geht leise, stört Raoul nicht, er schläft.«
»Wie dumm,« seufzte Gottliebe, »nun muß ich bis morgen warten, um ihm alles zu erzählen. Warum muß er auch heute so müde sein!«

Im Hause verloschen allgemach die Lichter, und ganz Hohensteinberg versank in tiefe, nächtliche Stille, nur aus dem Fenster der Kammerherrin fiel noch lange ein heller Schein in die Nacht hinaus. Zum zweitenmal in ihrem Leben beklagte die alte Frau, daß sie zu hart, zu streng gewesen war, aber diesmal konnte sie noch sühnen, konnte gutmachen, was sie einst nicht mehr gekonnt hatte. Damals, als sie die Nachricht von dem Tode ihres Sohnes erhalten hatte und die Witwe und sein Kind unauffindbar gewesen waren, hatte sie es nicht mehr können. Nun lebte des Sohnes Sohn in ihrem Hause, und wie hatte sie bisher die seinem Vater erwiesene Härte gesühnt? Die stolze Frau litt namenlos in dieser Stunde, als sie sich wieder einmal sagen mußte: Du tatest unrecht! Aber doch klang es auch in ihrem Herzen hoffnungsvoll: »Morgen, morgen.«
»Morgen soll ein neues Leben für den armen Jungen beginnen,« hatte auch der Freiherr zu seiner Frau gesagt. »Wie konnte ich nur bisher so wenig erkennen, daß das Fremde in seiner Art gut ist! Eine Prachtfrau muß die Mutter gewesen sein.«
Morgen, morgen, dachte auch Joachim unablässig; er, der [S. 116] sonst einen Bärenschlaf hatte, warf sich in dieser Nacht unruhig auf seinem Lager hin und her. Er rang immer noch mit seinem Trotz, und dazu hatte sich die Eifersucht gesellt: nun würden auf einmal alle Raoul lieben, er würde beiseite geschoben werden von den andern, wie es schon Gottliebe mit ihm getan hatte.
Draußen hatte sich der Wind erhoben; er sauste und brauste um das Haus herum, es knisterte und raschelte in dem alten Gebälk, ganz unheimlich klang es. Einmal fuhr Joachim empor, es war ihm, als hätte er tastende Schritte gehört. Aber nein, es war doch wohl nur der Sturm gewesen. Die Wetterfahne auf dem Dache drehte sich gerade knarrend, und irgendwo klappte ein Fenster — oder war es eine Tür?
»Unsinn!« murmelte Joachim und grub den Kopf tief in die Kissen hinein. Da schlug draußen ein Hund an, kurz, und er verstummte gleich wieder, und wieder war allein das Brausen des Windes hörbar. Noch eine Weile lauschte der Knabe, aber nichts, gar nichts war zu hören, und doch preßte eine seltsame, beklemmende Angst ihm das Herz zusammen. Und wieder sagte er »Unsinn!« zu sich und versuchte zu schlafen, aber es dauerte noch lange, ehe ihn der Schlaf übermannte. Er schlief so fest, daß er das laute Klopfen, mit dem Jungfer Rosalie morgens die Kinder zu wecken pflegte, überhörte und weiter schlief. Erst der Jammerruf: »Joachim, Joachim!« den Gottliebe ausstieß, ermunterte ihn völlig. Die Schwester stand in der offenen Türe, ihr liebes Gesichtchen war ganz von Tränen überflutet. »Raoul ist fort,« schluchzte sie, »Raoul ist fort!«
»Raoul — fort?« stammelte Joachim, »wie denn fort?«
»Fort ist er, seine Sachen hat er mitgenommen, er — ach Raoul, Raoul!« jammerte das Mädel.
Hinter Gottliebe trat rasch Pfarrer Buschmann in das Zimmer. Er schob das Mädel sanft hinaus, ihr über die verwirrten Locken streichend. »Geh zu deiner Mutter, Kind, sie verlangt nach dir,« sagte er milde, und dann wandte er sich an Joachim: »Steh auf, eile dich und hilf deinem Vater suchen; oder — weißt du etwa um seine Flucht?«
Joachim schüttelte verstört den Kopf. »Warum — warum nur?« stammelte er.
»Das fragst du noch?«
»Ich — ich wollte ihm abbitten — heute!«
»Warum tatest du es nicht gestern, warum verschobst du es?« fragte der alte Mann und sah traurig seinen trotzigen Schüler an. »Es kommt oft ein Morgen, an dem ein gutes Wort zu spät kommt. Raoul muß in der Nacht geflohen sein, er hat nur ein kleines Bündel Sachen mitgenommen, nur — was er hergebracht hat. Dein Vater ist schon unterwegs. Nach Langenstein ist geschickt worden, wir hoffen alle, den armen, lieben Jungen zu finden.«
»Ich finde ihn, ich muß ihn finden,« rief Joachim heftig. Er zog sich in zitternder Eile an und wollte hinaus.
»Halt, sachte, nicht so stürmisch!« Pfarrer Buschmann hielt ihn fest. »Willst du ohne Sinn und Verstand drauf los rennen, Wege, die schon andere abgesucht haben? Das nützt wenig. Du sollst zu Berkows reiten und von dort aus nachforschen. Es ist nicht unmöglich, daß Raoul den Waldweg eingeschlagen hat und dann —« Der alte Mann vollendete nicht, aber Joachim wußte genau, was er meinte. Den Waldweg, der ein großes Stück nach der nächsten Poststation hinter Langenstein abkürzte, konnten nur Kundige gehen, namentlich im Schnee [S. 118] konnte man sich leicht verirren. War Raoul ihn gegangen in der Sturmnacht? Wer weiß, in welcher weglosen Einsamkeit er sich schon verirrt hatte.
Raoul mußte sich von seinem Fenster aus an der Kastanie herabgelassen haben, abgebrochene Zweige deuteten darauf hin. Sonst hatte der Schneesturm in dieser Nacht jede Fußspur verweht. Jungfer Rosalie klagte mit einem ihr sonst fremden Wortreichtum: »Daß ich's nicht gehört habe, immer nur gemeint, der Sturm sei's, und das Fenster hat doch geklappt!«
An die Knie der Großmutter geschmiegt, weinte Gottliebe in fassungslosem Schmerz, und jedes Aufschluchzen fand in der Ecke des Zimmers ein leises Echo. Dort saßen Gottlobe und Karoline, und beide zuckten immer wieder zusammen und fühlten jedes ihr Teilchen Schuld, wenn die Schwester klagte: »Wir waren nicht gut genug zu ihm.« Ihr, die dem Entflohenen am meisten Liebe von den Kindern erwiesen hatte, fiel immer wieder etwas ein, was sie hätte tun können, und alles sagte sie und ahnte nicht, daß jeder Vorwurf, den sie gegen sich selbst erhob, die Großmutter bitter traf. Die sagte mit einer seltsam schweren, weichen Stimme: »Sei ruhig, mein Kind, Raoul kommt schon wieder, heute abend ist er wieder da. Sicher, er kommt wieder.« Und mit diesem Trost versuchte die Kammerherrin sich selbst zu trösten, versuchte sie ihre schwere Sorge zu bannen.
»Wir werden ihn schon finden,« hatte der Freiherr, der über des Neffen Flucht tief betroffen war, die Seinen getröstet, »er ist doch nur zu Fuß gegangen, unsere Pferde holen ihn schon ein!« Aber als der Abend kam, war noch keine Spur von dem Vermißten gefunden. Niemand hatte ihn gesehen, durch kein Dorf schien er gekommen zu sein! Auf allen Wegen, die [S. 119] süd- und westwärts führten, waren die Boten weit ins Land hinein gefahren und geritten, denn alle nahmen an, der Knabe habe nach Leipzig zurückkehren wollen, um vielleicht von dort aus zu seinem Onkel nach Paris zu wandern.
»Ich muß ihn finden, ich muß ihn finden,« dachte Joachim verzweifelt, und nur die ernsten Ermahnungen seiner Eltern und des Pfarrers konnten ihn nach dem Tage vergeblichen Suchens abhalten, ins Blaue hinein dem Vetter nachzuziehen. Wie eine schwere Last lag die Schuld gegen den Vetter auf seiner Seele, und als der Vater näher forschte und fragte, um den wahren Grund zur Flucht zu erkennen, da erzählte Joachim selbst die Geschichte des Tugendbundes, und wie sie Raoul von allem ausgeschlossen hätten. Er verschwieg nicht dessen tapferes Eintreten für die Tugendbündler, und während der Knabe dies alles bekannte, wurde ihm sein Unrecht immer klarer. »Ich bin schuld,« murmelte er, »ich allein!«
Die Kammerherrin sah von ihrem Enkelsohn zu ihrem Sohn, und der Freiherr nickte ihr trübe zu. »Wir wollen nicht untersuchen und fragen, wo die meiste Schuld liegt,« sagte er mit schwerem Ernst. »Euer Tugendbund war freilich eine Torheit, eine Kinderei: ihr paar Jungen und Mädels werdet das Vaterland nicht aus seiner tiefen Not befreien. Kindereien sind nicht am Platz in einer so schweren Zeit, das merkt euch alle, wir brauchen den Ernst und die Tat. Aber euch allen sei diese Torheit nicht angerechnet, weil diese Torheit aus Liebe zum Vaterland erwachsen ist. Diese Liebe haltet fest und erstarket in ihr, damit ihr dereinst fähig seid, wenn die Stunde kommt, in der das Vaterland euch braucht, Opfer zu bringen. Einen Tugendbund dürft ihr untereinander schließen, aber dazu braucht [S. 120] es keiner geheimen Versammlungen und törichter Bücher, euer Tun soll Zeuge sein von eurer Liebe zum Vaterland und eurer Liebe untereinander.«
Bei dem letzten Wort des Vaters sahen sich Joachim und Gottliebe unwillkürlich an, und mit einem Schrei flog das lebhafte Mädel auf den Bruder zu, hing an seinem Hals und rief schluchzend: »Wir wollen uns wieder lieb haben, und wenn Raoul — wiederkommt, dann haben wir ihn alle, alle lieb!«
»Ich will ihn suchen,« murmelte Joachim, und nicht mehr, wie so manchmal in der letzten Zeit, stieß er die Schwester unwirsch fort. Er hielt ihre Hand fest, fest in der seinen, und Liebe verstand den Bruder auch ohne Worte.
Joachim hielt Wort. Er suchte fieberhaft nach einer Spur des Verlorenen, er fragte da und dort, aber keine Spur fand sich, auch die Nachforschungen des Freiherrn blieben erfolglos. Der schrieb an den Grafen Turaillon, schrieb, daß der Neffe entflohen sei; wie er vermute, habe er sich nach Paris gewandt. Auch an den Bäckermeister Käsmodel schrieb er, und dieser Brief wurde ihm herzlich schwer; aus Leipzig kam rasch Antwort, Raoul sei nicht dort eingetroffen, und nach Wochen kam die gleiche, in einem scharfen, beleidigenden Tone abgefaßte Antwort aus Paris. Der Graf nahm an, man hätte den Neffen absichtlich entfernt, um ihn vor seinen Nachforschungen zu verbergen.
»Das wußte ich,« frohlockte Gottliebe, »nach Paris ist Raoul nicht gegangen, er haßt den Bonaparte.« Sie wurde aber gleich wieder traurig. »Aber wo mag er sein?«
Ja, wo war der Knabe? War er gestorben und verdorben in dem großen Wirrsal, in der tiefen Not, die von neuem über das deutsche Vaterland hereinbrach?
Mit dem Frühling kam von Westen her das Unheil. Napoleon zog wirklich nach Rußland, des Zaren Macht wollte er brechen. Wie ein Märchenland lockte und lockte den Eroberer das unermeßliche Reich des Ostens mit seinen endlosen Steppen und weiten Wäldern. Aber Deutschland, Preußen, lag zwischen ihm und seinem Ziel, und so zwang er dem Könige von Preußen ein Bündnis auf, das das arme Land förmlich der Plünderung der großen Armee preisgab. Und manche deutsche Mutter sah weinend den Sohn in die Ferne ziehen, denn zu Tausenden mußten deutsche Söhne den französischen Fahnen folgen, und zu denen gesellten sich noch manche, die freiwillig mitzogen, weil sie den Glauben an des eigenen Vaterlandes Kraft verloren hatten.
Als von eines solchen freiwilligen Kämpfers Mitzug, der ein Sohn alter Freunde war, die Kunde nach Hohensteinberg kam, schrie Joachim aus vor Empörung: »Ein Vaterlandsverräter!«
»Ein Armer, ein Unseliger,« sagte die Kammerherrin; die alte Frau war sehr milde geworden in dem Leid der letzten Wochen. »Wehe ihm, wehe uns! Wehe dem, der den Glauben an sein Vaterland verliert, und wehe uns, daß wir nicht mehr stolz auf unseres Vaterlandes Stärke sein können!«
Da schwieg Joachim, er schwieg jetzt oft und sann stille den Worten der Erwachsenen nach. Er, der Trotzige, Ungebärdige war in der Zeit des werdenden Frühlings zu einem ernsten Jüngling herangereift. Die Schuld, die ihn quälte, des Vaterlandes Not wandelte sein Wesen und machte ihn über seine Jahre hinaus ernst.
Es war überhaupt keine rechte Zeit für Jugendlust und Jugendübermut, und wenn die Steinbergschen Kinder mit ihren Freunden und Freundinnen zusammenkamen, dann gab es oft [S. 122] gar ernste, nachdenkliche Gespräche. Sie nannten sich untereinander Tugendbündler, die Eltern wußten es und widerstrebten nicht, nur mußte der Name verschwiegen bleiben, auch durfte kein Wort niedergeschrieben werden. Wohl war ringsum alles gut preußisch gesinnt, aber es gab doch etliche solcher Kreaturen im Land, wie der Rentamtmann Meldeling, und in Pillau saß eine französische Besatzung wie in manchen andern Festungen des Landes. Napoleon bewachte auch seine Bundesgenossen gut, er ahnte, daß niedergehalten in der Tiefe der Haß schlummerte.
Nur Gottliebes unverwüstliche Fröhlichkeit brach immer wieder durch, und so sehr sie sich um Raoul grämte, es kamen doch immer wieder Stunden, in denen ihr Lachen das Haus durchschallte, und einen Widerschein auf allen Gesichtern fand. Selbst Jungfer Rosalies mürrische Miene hellte sich dann ein wenig auf. Gottlobe hatte sich auch verändert. Sie schwärmte nicht mehr so überschwenglich mit ihren Freundinnen, sie hielt sich jetzt mehr zu Bruder und Schwester, und als eines Tages Karoline heimgeholt wurde, denn die Eltern wollten ihr Kind lieber bei sich in der Stadt haben in dieser Zeit, da weinte sich Lobe nicht, wie Liebe prophezeit hatte, die Augen aus dem Kopf. Ja sie lehnte sogar das Anerbieten, mit nach Königsberg zu kommen, ab; die Eltern hatten es ihr freigestellt, weil es Lobe sich immer so sehnlichst gewünscht hatte, in Königsberg sein zu dürfen.
»Sie bleibt bei uns,« schrie Gottliebe begeistert, als die Schwester ihr »Nein« sagte, »Achim, hörst du?«
In Joachims Augen leuchtete es auch freudig auf, er rief halb zweifelnd: »Bleibst du wirklich?«
»Ich bin doch eine Steinberg und gehöre hierher,« sagte Gottlobe ein wenig gekränkt, daß die Geschwister ihren Entschluß gar so verwunderlich fanden. Die sichtbare Freude stimmte sie aber froh, und von dieser Stunde an gab es eine schöne Dreisamkeit unter den Geschwistern, und in allen Sorgen erstarkte die Geschwisterliebe mehr und mehr.
»Die Franzosen kommen!« Unzähligemal ertönte in dem Frühling und Sommer des Jahres 1812 dies Wort im preußischen Land. Erst war es nur ein Ruf der Angst, der bangen Ahnung, bis dann eines Tages von Ort zu Ort die unheilschwere Kunde flog: »Sie kommen wirklich.«
Sie kamen als Freunde, Bundesgenossen und hausten wie Feinde, sie leerten die Kornkammern, trieben das Vieh aus den Ställen und zerstampften die blühenden Saaten.
Eines Tages hieß es auch in Hohensteinberg: »Sie kommen!« Und wie überall mußten es die Bewohner vom Schloß und Dorf mit ansehen, wie die Abteilung, die hier durchkam, »ihre Vorräte ergänzte«, so nannte es der führende Offizier, ein sehr höflicher Italiener. Er nahm, was er nur irgend an Lebensmitteln erhalten konnte, aber er war doch so menschlich, nicht den ärmsten Dorfleuten das letzte Stück Vieh aus den Ställen zu treiben. »Glauben Sie mir, mein Err,« versicherte er dem Freiherrn, »mir mackt dies Krieg kein Spaß, und es mackt viele keine Spaß. Dies Land da,« und er deutete mit der Hand finster in die Ferne, »ist wie der Maul von eine große Tier, er verschlingt uns! Sicker — er verschlingt uns!«
Nach diesen kamen noch andere, und Jungfer Rosalie schloß diesen bereitwillig die Speisekammer auf, stemmte die Hände in die Seiten und sagte kaltblütig. »Da!« Eine einzige Wurst [S. 124] bammelte an einem Faden, und ein paar Brocken lagen auf dem Brotschrank, sonst war die Kammer leer.
Die Soldaten schimpften und drohten, aber Jungfer Rosalie wischte sich mit der Hand über den Mund und zeigte kläglich auf den Magen, als wollte sie den eigenen Hunger andeuten. Dabei hatte sie selbst alle Vorräte in einen gut verborgenen Keller geschafft, den nicht einmal alle Bewohner des Hauses kannten. In dem dunklen Keller lagerte auch mancher Notgroschen, manche Wurst und manches Mehlsäcklein, das die Dorfbewohner vertrauensvoll ihrem Gutsherrn gebracht hatten.
Und als zum drittenmal Soldaten kamen, bammelte wieder nur eine Wurst in der Speisekammer, und wieder gab es nur dürftige Reste, und wieder schalten und drohten die Soldaten, und wieder blieb Jungfer Rosalie ungerührt mit in die Seite gestemmten Armen stehen. Als es aber einer der Leute gar zu schlimm machte und ihr mit dem Gewehr vor der Nase herumfuchtelte, da ergriff sie kurz entschlossen den Mann und stülpte ihn kopfüber in das leere Mehlfaß. »Sucht selbst!« sagte sie mürrisch.
Die Sache hätte freilich für die tapfere Jungfer recht übel ablaufen können, wenn sich nicht ein Offizier ihrer angenommen hätte. Er beruhigte den Soldaten, der in einem fürchterlichen Kauderwälsch Bestrafung der Untäterin verlangte, als er endlich wieder Augen und Mund von dem Mehlstaub frei hatte. Dem Offizier, einem Rheinländer von Geburt, schien der Zug nach dem weiten Rußland auch wenig Spaß zu machen, desto besser gefiel ihm die tapfere Jungfer. Er sagte beim Abschied lachend zu ihr: »Schade, daß sie kein Mann ist, sie hätte einen guten Gardisten abgegeben und gewiß tapfer gefochten!«
»Ja, wenn's gegen die Franzosen ginge,« sagte Jungfer Rosalie gelassen. Da schwieg der Offizier und nickte nur noch einmal grüßend zurück, — vielleicht hätte er auch lieber sein Leben für des Vaterlandes Freiheit eingesetzt!
Und als die Durchzüge beendet waren, die letzten Nachzügler der großen Armee den Niemen überschritten hatten, da war es, als wäre ein verheerendes Unwetter mit Hagel und Sturmflut über die Gegenden dahingebraust, die an der großen Landstraße lagen, und dem Heere folgten die Flüche, folgte das Jammern des gequälten Volkes nach.

In dieser Zeit, da die Frühlingsstürme den Winter vertrieben, und da über die deutschen Lande eine neue Not kam, wanderte Raoul von Steinberg durch viele Wirrsale in der Fremde herum. Er hatte gemeint, es sei am besten, das Haus zu verlassen, in dem ihm so wenig Liebe geworden war, und als er an jenem verhängnisvollen Tage stumm auf seinem Lager lag, so still, daß Frau Maria ihn schlafend wähnte, da hatte er nichts mehr von all den guten Vorsätzen vernommen, die im Familienzimmer laut wurden. Um Mitternacht war er aufgestanden, hatte sein Bündel gepackt und war durch das Fenster entflohen. Unten hatte er ein paar Minuten gezögert. Tat er recht? Da oben schliefen Frau Maria, Pfarrer Buschmann und Gottliebe, die hatten ihn doch lieb, waren gut zu ihm, ihnen würde seine Flucht vielleicht wehe tun. Er hätte ihnen schreiben mögen, sagen, daß er sie nie vergessen würde, aber dazu war es zu spät. Kehrte er in das Haus zurück, dann hörte ihn wohl jemand, man würde seine Absicht erraten, und Joachim würde lachen, spöttisch, verächtlich, wie er es so oft getan hatte. Nein, nur das nicht. Die Verachtung, mit der man auf ihn um [S. 127] der Mutter willen, der guten, geliebten Mutter willen herabsah, die konnte er nicht ertragen, lieber wollte er wieder Schreiber werden oder sonst eine Arbeit tun. Und ohne rechtes Ziel war er in das Schneewehen hinausgetrabt, nur die Straße mied er, die er gekommen war. Auf einem ihm unbekannten Pfade war er weiter und weiter geschritten, und der Wille, fortzukommen, hatte seine Kraft gestärkt.
Im Morgengrauen traf er einen Wagen, einen, der mit grauer Leinwand rund überdacht war, und den ein mageres Pferd nur mühsam durch den Schnee zog. Jahrmarktsleute waren es, die, von der russischen Grenze kommend, durch die winterliche Einsamkeit zogen. Hoch oben im Thüringerwalde war ihre Heimat, von da aus zogen sie mit Holzgeräten, Spielsachen und Topfwaren, mit Quirlen, Löffeln, Brettern, Butterformen und allerlei solchen Dingen in der Welt herum, von Markt zu Markt. Raoul stand erschöpft an einen Baum gelehnt, als die Leute an ihm vorbeikamen, und der Knabe, der so allein in dieser grauen Morgenstille war, fiel ihnen auf. Der Mann hielt an und forschte nach dem Weg. »Ich habe keine Heimat,« sagte Raoul traurig, »meine Eltern sind tot, in Leipzig leben gute Freunde, zu ihnen will ich.«
»Nach Leipzig kommen wir auch, aber erst im Frühling,« sagte die Frau, und über ihr blasses Gesicht ging ein Freudenschein. Von Leipzig aus nach dem Thüringerwald war es schon näher, und sie sehnte sich nach der Heimat.
»Willst en Linschen mitfohre jo—e? Dann kumm ruff,« sagte der Mann gutmütig in seinem Thüringerdialekt. »Es gäht uff Marienburg, jo—e, 's ist noch sähre weit!«
Raoul überlegte nicht lange. Konnte er ein Stück mit den Leuten fahren, dann verwischte sich am besten seine Spur, der [S. 128] Oheim fand ihn, wenn er wirklich nach ihm suchen ließ, nicht so leicht, und er kam wohl auch nach Leipzig.
So zog er mit den Händlersleuten. Als die sahen, daß der fremde Knabe etwas Geld besaß, — es war wenig genug, — willigten sie gern ein, ihn in ihrem Wagen mitzunehmen. »Dos Foahre hoaste for nischt,« sagte der Mann, »abersch 's Ässen mußte alleene kofen.«
Brot und Wasser reichen aus, dachte Raoul, und dafür langte seine Barschaft schon ein Weilchen, und seine Hoffnung wuchs, das ersehnte Ziel zu erreichen. In den ersten Tagen der gemeinsamen Wanderschaft hielt sich der Knabe immer fern, wenn man in ein Dorf, an ein Gutshaus kam und die Händlersleute versuchten, ihren Kram loszuwerden. Als aber nach einigen Tagen eine kleine Stadt erreicht wurde, bot Raoul der Frau an, er wolle ihr verkaufen helfen. Es wurde ihm nicht leicht, aber er mochte auch nicht gern ganz umsonst seine Mitfahrt genießen. Mit einem Bündel Holzlöffeln und Quirlen, ein paar Brettern und Töpfen trat er seinen Weg an, und er hatte Glück: sein sanftes, feines Wesen, der traurige Blick seiner schönen Augen bestimmten die Hausfrauen, dem kleinen Händler doch etwas abzukaufen, und als Raoul zum Wagen zurückkehrte, hatte er ein besseres Geschäft als die Frau gemacht. »Dich hat der Himmel geschickt!« rief sie. »So—e Glicke! Du mußt bei uns bleiben, gelle Mann?«
Auch der Mann freute sich über den jungen Gehilfen und teilte an diesem Tage seine Mahlzeit mit ihm: »Das haste verdient, und wenn de bleiben willst, mir is 's racht!«
Und wieder überlegte Raoul nicht lange, sondern sagte zu, bis Leipzig die Händlersleute zu begleiten. Die erzählten ihm [S. 129] viel von ihrem Leben. Im Winter lebten sie meist eine Zeitlang in ihrem Dörfchen im Thüringerwald, und sonst war nur immer der Mann mit dem Beginn des Frühlings ausgezogen, die im Winter geschnitzte Ware zu verkaufen. Doch der älteste Bube, der den Vater zu begleiten pflegte, war krank geworden im letzten Frühling, und da hatte die Frau ihre vier Kinder der Sorge der Großmutter anvertraut und hatte selbst den Mann begleitet. Weil die Geschäfte gar so schlecht gegangen waren, — in diesen Zeiten bedeutete in gar manchem Haushalt schon ein neuer Quirl eine Ausgabe, die man sich zehnmal überlegte, — waren die Leute weiter ostwärts gezogen. Im Herbst war der Mann erkrankt, er hatte sich einen Fuß gebrochen, und das Ehepaar hatte eine Zeitlang in Königsberg bleiben müssen. Dort hatten beide die Zeit benutzt und neue Geräte geschnitzt, und nun zogen sie mit vollem Wagen wieder von Stadt zu Stadt, hoffend, endlich im Frühling heimzukommen.
Die Frau sorgte sich um die Kinder, von denen sie nun fast das ganze Jahr getrennt gewesen war, und sie war froh, daß sie ihrem jungen Begleiter von ihrem Konrad, ihrer Rose, Liese und dem kleinen Peter erzählen konnte. Sie fragte gutmütig auch nach Raouls Leben, und der erzählte von der Mutter, von den Bäckersleuten, aber von Hohensteinberg nichts. Dahin kehrten aber seine Gedanken desto öfter zurück, und manchmal war's ihm, als flüstere leise, leise eine Stimme in seinem Herzen: Du hättest bleiben sollen.
Ein langes Wandern durch deutsche Gaue, deutsche Dörfer und Städte war es. Die alte Stadt Marienburg war der erste Ort, wo sie länger rasteten. Es war gerade Markt, und Raoul suchte eifrig zu verkaufen. Hier hörten die Händlersleute aber [S. 130] auch, daß die Franzosen wirklich bald kommen sollten, und sie beschlossen, auf den nächsten Wegen, jedoch abseits von der großen Heerstraße, heimzukehren. Um Berlin herum wollten sie einen großen Bogen machen, sie waren von namenloser Furcht vor den Franzosen erfüllt. 1806 hatte der Kriegslärm bis in ihr einsames Walddorf hinauf geschallt, und sie erzählten Raoul beide allerlei aus jener Zeit, erzählten, was Verwandte unten im Saaletal erlebt hatten.
Da sprach auch Raoul von seinem Vater, der bei Saalfeld gefallen war. Die Leute wunderten sich nicht, daß er ein Offizier gewesen war; sie hatten es bald gemerkt, daß ihr kleiner Begleiter aus gutem Hause war, aber sie forschten nicht weiter, sie hatten am eigenen Sorgenbündel genug zu tragen.
Und wohin auch die Wanderer kamen, überall sprachen die Leute von der neuen Not, dem neuen Krieg. Denn wie die Schrecken des Krieges selbst sahen alle den drohenden Durchzug der Franzosen an. Das Bündnis mit Frankreich, das nun wirklich der König von Preußen abgeschlossen hatte, gab ja das arme Land dem Eroberer förmlich preis. Jammer, Angst und glimmenden Haß sahen die drei, wohin sie kamen, und dabei hub sachte ein erstes, zartes Frühlingsgrünen an, und hier und da standen schon Büsche mit feinen, grünen Schleiern überhangen, und manchmal pflückte Raoul blaue Osterblumen und Himmelsschlüssel, steckte sie an seine vertragene Kappe und rief wohl froh: »Hier ist es schön!«
»Bei uns ist's scheener,« erwiderte immer die Frau, und der Mann nickte jedesmal zustimmend: »Da haste was Richtiges gesagt.«
Die Leute sehnten sich immer stärker danach, heimzukommen, es wurde ihnen zu unsicher auf den Straßen, und der Handel [S. 131] wurde auch immer kärglicher. Die Frau steckte jedesmal ein Sträußchen vertrockneten Quendel zu sich, wenn sie ging, nach dem alten Spruch: »Quendel, Quandel, mach mir Handel,« aber es nutzte nicht viel. Raoul lachte zwar über den Aberglauben, aber er nahm gutwillig doch auch immer das Quendelsträußchen mit. Einmal verlor er es, und um die Frau nicht zu kränken, steckte er rasch ein paar trockene, vorjährige Grashalme vom Wege in das Papiertütchen. Sie rasteten gerade in einem Dorf, und Raoul kam zu einer Bauersfrau, der war in diesen Tagen ihre Küche ausgebrannt, und die Handelsleute kamen zu guter Stunde. Raoul mußte noch mehr Ware bringen, und als am Abend der Verdienst überzählt wurde und das erlöste Sümmchen ihnen allen dreien fast märchenhaft erschien, rief die Frau froh: »Sihst de nu — e, Quendel, Quandel, mach mir Handel, jetzund hast de's erfoahren.«
Über Raoul kam ein fröhlicher Übermut wie seit langem nicht, er lachte aus vollem Halse, und lachend gestand er der Frau, daß er den Quendel verloren und dürres Gras genommen habe.
Aber so ein echtes Thüringer Waldfrauchen ließ nicht so rasch vom gewohnten Aberglauben, sie meinte nachdenklich: »Dann mag do — e was Gutes drunter gewesen sein. Gib mir 's Kraut.«
»Sin Faxen,« brummelte der Mann lachend, aber die Frau nahm doch das Grasbüschlein und verwahrte es sorgsam an ihrer Brust, man konnte doch nicht wissen! Am nächsten Tag ging sie dann mit sehr viel Mut aus den Handel und kehrte mit aller Ware heim, nur einen einzigen kleinen Quirl war sie los geworden. Gutmütig lachte sie dann sich selbst aus, und der Quendel verlor etwas sein Ansehen bei ihr.
Endlich langten die drei an einem Tage, früh im April, der sich aber ganz wie ein schöner, sonnenheller Maitag aufspielte, in Halle an. Hier wollte Raoul von seinen Gefährten Abschied nehmen, die nicht erst den kleinen Umweg über Leipzig machen wollten. »Sie kommen, sie kommen!« klang überall der Angstruf, und alles zitterte und zagte vor dem gewaltigen Heere, das seinen Marsch durch Deutschland schon angetreten hatte.
In einer Ausspannung am Roßmarkt, der außerhalb der Stadt lag, rasteten die Handelsleute. Sie wären am liebsten gleich weiter gezogen, doch das Pferdchen brauchte Ruhe. Raoul wollte bis zum nächsten Morgen warten und dann in aller Frühe seine Wanderung nach Leipzig antreten. Er lief rasch einmal durch die Straßen der Stadt, um das Wirtshaus zu suchen, in dem damals Meister Koch abgestiegen war. Vielleicht wußten die Leute was von ihm, der öfter hin und her fuhr, und vielleicht auch etwas von Käsmodels. Nun er Leipzig so nahe war, hatte ihn eine heftige Unruhe erfaßt, ob sie noch alle lebten, ob das Haus noch stand, und ob sie sich auch freuen würden, daß er so unerwartet kam.
Er lief und lief, dort mußte es doch sein, nein dort! Auf einmal blieb er mitten auf der Straße stehen und überlegte, er wußte ja gar nicht mehr den Namen des Wirtshauses. Es war ein Roß, dachte er, nein, ein Hirsch — und weil gerade ein Mann vorbeikam, fragte er hastig: »Ach, bitte, sagen Sie mir, ist hier ein goldenes Roß, nein, ein weißes Roß — nein, ein Schwan oder eine Gans — nein, ich glaube, es war ein —«
»Dummkopf!« schrie der Mann, »hältst mich wohl zum Narren!« Fuchsteufelswild drehte er sich um und rannte einem dicken Mann etwas unsanft gegen den Bauch, aber der schien das [S. 133] gar nicht zu spüren, er starrte nur Raoul an und rief: »Daß dich das Mäuschen beißt, das ist ja allweil unser Raoul!«
»Herr Meister — ich!« Mit einem Schrei hing Raoul an des dicken Meisters Hals, ein Tränenstrom brach aus seinen Augen, und fassungslos vor Freude umklammerte er den dicken Mann.
Der schluckte, prustete, brummelte, wischte sich die Augen und schneuzte sich laut, endlich brüllte er, daß es die Straße entlang schallte: »Da ist er ja, der Musjeh Raoul, allweil, nee so was! Junge, Junge, heule doch nicht so! Du bist da und bleibst da, und alleweil wieder fort, das gibt's nicht. Aber jetzt sag', wie du hergekommen bist!«
Doch Raoul konnte noch nicht sprechen, er hielt die Hand des Meisters so fest, als wollte ihn jemand mit Gewalt von dem Manne wieder trennen. »Na sachte, alleweil sachte,« brummte der, »ich nehm' dich gleich mit. Wärst du eine halbe Stunde später gekommen, dann hättest du laufen müssen. Zu uns willst du doch, oder bist du etwa auf dem Wege zu deinem französischen Onkel?«
»Nein!« rief Raoul, und ein Lachen flog nun über sein Gesicht, und dann sagte er ausatmend: »Ich bin ausgerissen!«
»Das wissen wir schon!« Der Meister schmunzelte so, daß sich sein rundes Gesicht in lauter Falten zog. »Dein Oheim hat's schon geschrieben, und danach tut es ihnen allen furchtbar leid. Ich habe geschwind geantwortet, daß ich nichts von dir wüßte, ich dachte aber doch, alleweil kommt er schon, wenn er noch 's Leben hat. Der Gottlieb, der verflixte Bengel, hat sich schon beinahe die Augen aus dem Kopf nach dir ausgeguckt. Daß die teuren Bücher auch zum Hineinsehen sind, das vergißt er alleweil. [S. 134] Doch nun komm, unterwegs erzählst du mir, warum du's mit dem Ausreißen so eilig hattest!«
Jetzt erst fielen dem Knaben wieder seine Weggenossen ein, und er erzählte eifrig und ein bißchen kraus durcheinander, auf welche Art er die Reise gemacht habe, und ein paarmal nickte der Meister anerkennend dazu. Nach kurzem Nachdenken wurde beschlossen, den kleinen Umweg zu machen und an der Ausspannung vorbeizufahren, wo die Handelsleute weilten. Es dauerte nicht lange, da saß Raoul neben seinem Beschützer, und mit Hühhott ging es durch die Stadt, und die braven Thüringer staunten nicht wenig, wie stattlich ihr junger Genosse auf einmal daherkam. Der Leipziger Bürger und Meister flößte ihnen gewaltigen Respekt ein, und da er ihnen noch als Mitbringsel für ihre Kinder ein kleines Geldgeschenk gab, sagte die Frau wieder zu Raoul: »Du hast uns Glicke gebracht!«
Es gab einen sehr herzlichen Abschied. Der Meister riet den Leuten dringend, möglichst schnell auf Nebenwegen in ihren Wald zurückzugehen. »Sie ziehen daher wie ein Heuschreckenschwarm,« sagte er finster. Der Händler nickte trübe: »Iche wollte meine Schecke und den Wagen verkaufen und zu Fuße ziehen, aber jetzund kauft das Pferd niemand; sie sagen alle, die Franzosen nehmen's uns vielleicht weg, jo—e es will jeder sein Geld im Sacke behalten.«
Noch einmal rief Raoul den Genossen ein Lebewohl und gute Heimkehr zu, dann zog der Meister die Zügel an, und fort ging die Fahrt, auf Leipzig zu.
Unterwegs erzählte Raoul dem Meister getreulich und ausführlich alles, was er erlebt hatte, er verschwieg nichts, auch nicht die erfahrene Güte, aber zu seiner Verwunderung schwieg [S. 135] der nachdenklich und sah sinnend auf den braunen Pferderücken vor sich, als gefiele ihm der ganz besonders. Da begann Raoul das Herz zu schlagen, und leise, scheu fragte er: »War's recht?«
»Alleweil nee, mein Junge,« rief der biedere Meister. »Sie haben dir übel mitgespielt, aber nicht alle; weil's doch deine Frau Mutter selig gewollt hat, darum hättest du noch etwas aushalten, lieber mal dem Hochhinaus, dem Joachim, ordentlich die Jacke vollhauen sollen. Na ja,« beschwichtigte er, als er Raouls erschrockenen Blick sah, »du bist von anderer Art als wir Käsmodels, und ich glaube beinahe, darin gleichst du deiner Frau Mutter selig. Schlecht behandeln, nee, das ließ die sich nicht, lieber arbeitete sie über ihre Kräfte und hungerte dazu. Einzig schade ist's, daß deine Verwandten nicht deine Mutter gekannt haben, alleweil, das war ihr größtes Unrecht, daß sie gleich nichts Gutes von ihr dachten, bloß weil sie eine Französin war. Aber wie es ist, so ist's, ich habe deiner Frau Mutter selig gelobt, dir ein Freund zu bleiben, und das halte ich. Du hast ihren Willen erfüllt, bist zu den Verwandten gereist und bist freiwillig wiedergekommen, und nun bleibst du bei uns und gehst mit dem Bengel, dem Gottlieb, auch aufs Gymnasium, 's wird euch beiden gut sein. Uff!« Der dicke Meister atmete tief nach dieser langen Rede, und Raoul schmiegte sich fest an ihn an. Er fühlte wohl, daß sein Beschützer recht hatte, daß er zu vorschnell gewesen war, aber die Freude, wieder in der alten Heimat zu sein, war doch größer als die Reue.
Die Nacht war schon heraufgekommen, als Meister Käsmodel mit seinem Schützling durch das Hallesche Tor in Leipzig einfuhr. Zum Ärger manches braven Bürgers rasselte das Wäglein laut durch die stillen, dunklen Gassen, und aus manchem Federbett [S. 136] heraus kam brummend das scheltende Wort: »Es ist unerhört, daß zu nachtschlafender Zeit wieder ein Wagen fährt. Nicht einmal in der Nacht hat man seine Ruhe.«
Als die Meisterin Käsmodel aber in der Backstube das Rollen vernahm, horchte sie freudig auf: ihr Mann kehrte zurück, um den sie schon sehr gebangt hatte, denn eine Fahrt auf der Landstraße bei Dunkelheit war in den unruhigen Zeiten nicht ungefährlich.
Sie eilte selbst, die Haustür zu öffnen, und mit einem Laternchen beleuchtete sie die Heimkehrenden. Es war aber gut, daß der Meister geschwind zusprang, sonst wäre das Laternchen hingefallen, so überrascht war die Frau, als sie Raoul erblickte. Sie zog den Knaben rasch gar liebevoll in die Arme, streichelte ihn mütterlich und sagte: »Nun sind's wieder drei!«
»Das Lottchen,« flüsterte Raoul, er wußte nicht viel zu sagen, aber die Meisterin verstand ihn: »Es hat eben jeder sein Kreuz zu tragen in der Welt,« sagte sie sanft. »Nun komm aber hinein, Gott segne deinem Einzug!«
»Und der Gottlieb, der Racker, schläft alleweil wie ein Bär,« rief der Meister. »Na, der wird morgen Augen machen. Kannst dich übrigens gleich in das Bett in seine Kammer legen. Der verflixte Bengel hat doch nicht geruht, das Bett mußte aufgestellt werden, noch an dem Tage, an dem der Herr Oheim geschrieben hat.«
Mit strahlenden Augen sah sich Raoul in der Backstube um. Der warme, kräftige Brotgeruch mutete ihn so heimatlich an, und daneben in dem Stübchen hatte er so oft mit der Mutter gesessen, wenn es oben in der Mansarde kalt gewesen war, und unwillkürlich sagte er laut: »Ich bin so froh, so froh!«
»Ist recht,« sagte der Meister, »und nun, Mutter, gib ihm mal was zu essen, und dann in die Federn. Den Gottlieb wecken wir heute nicht, der schreit uns sonst alleweil die ganze Nachbarschaft zusammen vor Freude.«
Ganz still kroch Raoul dann in des Freundes Kammer in das bereitstehende Bett, und Gottlob pustete und schnarchte und merkte nicht, daß der Ersehnte heimgekommen war. Der konnte freilich trotz seiner Müdigkeit nicht gleich einschlafen; wie ein wunderlich wirrer Traum lagen die letzten Wochen hinter ihm, und in alle Freude, endlich am Ziel zu sein, tönten ihm aber doch immer des Meisters Worte hinein, daß er es noch hätte aushalten sollen. Er meinte Gottliebes helles Lachen zu hören, ihr liebliches Gesicht zu sehen; vielleicht weinte sie um ihn, und die Tante war traurig, und Pfarrer Buschmann schüttelte bekümmert das Haupt über den entlaufenen Schüler. Aushalten, aushalten, nicht heimlich davonlaufen! klang es immer in ihm. Nun werden sie dich feige schelten und erst recht nicht für einen echten Steinberg halten. Da ballte er die Hände zur Faust in seinem Bett und sagte ganz leise zu sich wie ein festes, schweres Gelöbnis: »Sie sollen doch noch sehen, daß ich ein Steinberg bin.« Und in dem Schlummer, der nun endlich über ihn kam, sah er plötzlich Joachim vor sich stehen, der lachte spöttisch: »Bist doch kein echter Steinberg!« Halbwach fuhr Raoul noch einmal empor und murmelte drohend: »Warte nur, ich werde dir's doch beweisen!« — —
Als Gottlieb Käsmodel am nächsten Morgen erwachte, reckte und dehnte er sich gähnend in seinem Bett herum und schaute erst die Wand an, dann in das Zimmer hinein. Da fuhr er plötzlich mit einem gellenden Schrei in seinem Bett empor. Mit [S. 138] einem Sprung war er drüben am andern Bett und zog Raoul mit einer solchen Kraft aus dem Bett, daß im nächsten Augenblick beide Jungen auf der Erde lagen.
»Er ist da, er ist da,« brüllte Gottlieb, sprang auf, setzte über Raoul hinweg, riß die Türe auf und brüllte wie besessen die Treppe hinab: »Er ist da, er ist da, huuh, huuh!« Ein wildes, schauerliches Freudengeheul erfolgte, und im Nu öffneten sich Türen, man hörte ängstliche Stimmen, jemand schrie: »Es brennt, es brennt!« und dann klappten Schritte, oben, unten, überall waren die Bewohner aufgeschreckt.
Raoul aber saß auf seinem Bett und lachte, lachte, und Gottlieb tanzte im Hemd im Zimmer herum und stieß solche Siegesschreie aus, daß selbst Bonaparte vor diesem Gebrüll vielleicht auf und davon gelaufen wäre.
»Donnerwetter, ja!« mit diesem Ruf war Meister Käsmodel aus seinem süßen Morgenschlummer aufgefahren. Er wollte hinaus, aber dann besann er sich noch zur rechten Zeit und rief nur: »Mutter, halt doch dem Bengel, unserem Gottlieb, mal den Schnabel zu; der Junge bringt ja die Nachbarschaft in Aufregung. Nee, wenn der mal so backen kann wie schreien, dann wird er Obermeister oder gar Hofbäcker.«
Oben legte sich schon der Lärm, denn Gottlieb war von der unbezwinglichen Sehnsucht erfaßt worden, des Freundes Schicksale zu hören, und an diesem Tage verwünschte er die Schule noch mehr als sonst, und nur der Gedanke vermochte ihn zu trösten, daß künftig der Freund mit ihm die Plage teilen würde.
In der Mittagsstunde stand dann Raoul wie einst in der Burggasse, stand und wartete auf Karl Wagner, dessen Freude [S. 139] beim Anblick seines ehemaligen Schreibgenossen freilich nicht so laut und stürmisch war wie die von Gottlieb Käsmodel.
Die klaren Augen ruhten aber so warm und doch so ernst fragend auf dem Knaben, daß der den Kopf senkte. Es war ihm, als schaute der kleine Schreiber ihm tief auf den Grund der Seele. »Ich bin ausgerissen,« sagte er leise, »es war nicht recht, ich hätte aushalten sollen, aber —«
»Du bist froh, daß du hier bist, mein Junge. Nun, wir begehen alle Torheiten im Leben, und es kommen auch schon Stunden, in denen man gut machen und Fehler sühnen kann. Doch Gott zum Gruß, daß du wieder da bist, daran wollen wir uns heute freuen. Ich hab' es erwartet. Gottlieb hat mir erst gestern gesagt, du kämst so gewiß wie seine Vier in der nächsten lateinischen Arbeit!«
»Das stimmt,« rief Raoul, »er hat sie heute bekommen,« und mit einem strahlenden Lachen sah er zu Karl Wagner auf: »Ich bin so froh, so froh!« –
Das Bäckerhaus, das sich dem heimatlosen Knaben so bereitwillig geöffnet hatte, wurde ihm bald wieder eine liebe Heimat. Jetzt, da er freiwillig die Verwandten verlassen hatte, betrachtete ihn Meister Käsmodel als seinen Sohn und handelte wie ein guter, treuer Vater an ihm. Mit Gottlieb besuchte Raoul zusammen das Gymnasium, und mit seiner Hilfe umschiffte Gottlieb die Klippen der lateinischen Sprache, nahm sicherer die bösen Gräben der Orthographie, und schaute fortan die Schule nicht mehr wie einen Käfig an, in dem ein Raubtier eingesperrt werden soll.
Raoul hatte den Adel ablegen müssen, Meister Käsmodel meinte, es würde zu viel Gefrage drum geben. »Bleib nur adlig [S. 140] im Herzen, mein Junge, das ist die Hauptsache. Nachher, wenn du was Rechtes geworden bist, allweil kannst du dich wieder mit dem alten Namen nennen.« Der biedere Meister fürchtete immer, Graf Turaillon könnte doch wieder dem Neffen nachforschen, und nach Frankreich hätte er den Pflegesohn nur bitter schwer ziehen lassen. Zu seiner großen Beruhigung war der lange Schreiber Neumann aber wirklich aus Leipzig fortgezogen, der konnte also Raouls Anwesenheit nicht mehr verraten.
Es kam in diesem ersten Sommer aber noch einmal ein Briefchen aus Hohensteinberg ins Bäckerhaus, Gottliebe hatte es geschrieben. Sie schrieb darin, sie glaube bestimmt, daß Raoul da ist, und sie bat gar lieb und herzlich, der Vetter möchte zurückkehren. Da wurde dem Knaben das Herz doch schwer, und wenn er jetzt an alles dachte, was er in Hohensteinberg erlebt hatte, da fühlte er immer mehr und mehr, daß seine Flucht zu rasch, zu unüberlegt gewesen war. Aber zurückkehren wollte er doch nicht, und so schwer es ihm auch wurde, er ließ Gottliebes Brief unbeantwortet. Das Bäslein im fernen Osten weinte manche Träne darum, als der Brief, auf den sie gewartet hatte, ausblieb; sie hoffte und hoffte, und erst als der Winter kam, schwand ihre Hoffnung, und sie dachte nun auch wie die andern, Raoul sei untergegangen oder nach Frankreich zu seiner Mutter Bruder entwichen.

In dem Sommer von 1812 hatte in Preußen keiner die rechte Freude an aller Sommerlust, an Sonnenglanz, blühenden, grünenden Wiesen und kühlem Waldesschatten gehabt, und als sich der Winter früh meldete, da klagte niemand dem Sommer nach. Mit Schnee und Eis, mit frostklaren Tagen und Nächten kamen zugleich über die Grenze Nachrichten geflogen, die jedes vaterlandstreue Herz erbeben ließen. Napoleon sei geschlagen, raunte es erst leise, bis dann die gewisse Kunde kam von dem Untergang der großen Armee. Im Wintersturm flohen die letzten Reste des einst so glanzvollen Heeres aus dem unbesiegten Lande.
Da hob ein Singen und Klingen in viel tausend deutschen Herzen an, und überall blühte die Hoffnung empor, daß der Freiheitskampf, nach dem sich alle sehnten, der sie vom Joch der Fremdherrschaft erlösen sollte, nun beginnen würde. Wie ein Gottesgericht erschien ihnen allen der furchtbare Schlag, der die übermütigen Eroberer getroffen hatte, aber die Freude zeigte sich nicht, als in kleineren Trupps, manchmal gar nur zu zweien und dreien, die letzten Überlebenden der großen Armee über die russische Grenze kamen. »Man muß sie vernichten,« hatte mancher [S. 142] gerufen, wenn er an die Härten des Sommers dachte, der mancher Familie den letzten Wohlstand geraubt hatte. Doch als die Flüchtlinge kamen, wahre Jammergestalten, da schwieg der Haß, und das Mitleid regte sich.
Durch Hohensteinberg kam an einem der ersten Tage des Jahres auch ein Trupp Flüchtlinge, und Joachim in seinem überschäumenden Knabenhaß rief, als er von ihrem Nahen hörte: »Man darf sie nicht aufnehmen, es sind Feinde!«
Nachher stand er neben seinem Vater auf dem Hof und sah das Trüpplein vor sich. Wohl fünfzehn Männer waren es; von Hunger, Kälte, dem langen Marsch und Krankheiten waren sie so erschöpft, daß nur ein paar noch klare Antwort geben konnten über ihre Schicksale, die andern starrten dumpf vor sich nieder, ein paar waren kraftlos in den Schnee gesunken. Die Knechte, Mägde, die Dorfleute, alle waren herbeigeeilt und umstanden in finsterem Schweigen die Unglücklichen, und der Freiherr fragte nach den Namen, der Herkunft. Da klang ein deutscher Name nach dem andern an sein Ohr: die Leute waren alle Süddeutsche, sie alle hatten den französischen Fahnen folgen müssen.
Die Hausfrau hatte die Flüchtlinge kommen sehen. Sie hatte nicht viel geforscht und überlegt, nicht viel nach Namen und Art gefragt, sondern sie war selbst in die Küche gegangen und hatte mit Jungfer Rosalie eine kräftige Mehlsuppe gekocht, und bald kamen aus dem Haus die Hausfrau mit ihren Töchtern und Mägden, und alle trugen Töpfe voll dampfender Suppe und Körbe voll Brot.
Ein Schreien, ein gieriges Schreien gellte auf, die erloschenen Augen der Flüchtlinge blitzten, zitternd streckten sie die Hände aus: Essen, warmes Essen nach so vielen langen, langen Tagen wieder!
Die Frauen mußten mahnen: »Ihr verbrennt euch, nicht so hastig!« Doch die Flüchtlinge rissen ihnen die heißen Töpfe fast aus den Händen, sie schluchzten, schlangen, und manch einem Mann rannen die Tränen über das hohlwangige Gesicht. Essen, Essen, eine warme Suppe, wie wohl das tat!
In tiefem Schweigen sahen die Männer und Frauen zu. Kein Schmähwort wurde laut, keine Hand ballte sich mehr zur Faust, vor diesem Jammer schwieg der Haß. Und als der Freiherr sich zu seinen Knechten wandte: »Räumt eine große Stube für die Leute aus, ihr könnt in den leeren Gastzimmern wohnen,« da boten sich eilig ein paar Bauern zur Hilfe an, und ein paar Frauen sagten, sie könnten wohl noch allerlei Sachen aus ihrem Vorrat hergeben.
Schweigend folgte auch Joachim den Knechten und half räumen und Strohlager herrichten, und manchmal streifte sein Blick die Flüchtlinge voll tiefen Mitleids, die, in Lumpen gehüllt, die Beine mit alten Fellen und Stroh umwickelt, auf dem Kopfe wohl Frauentücher und Hauben, in nichts mehr den siegesfrohen Kriegern des Sommers glichen. Und alle waren Deutsche. Des Jünglings Herz krampfte sich zusammen, und in dieser Stunde begriff er völlig die Schmach seines Vaterlandes.
Man hatte auf Hohensteinberg noch manchmal Gelegenheit, den Flüchtlingen zu helfen, und alle auf dem Schloß und im Dorfe taten es mit christlichem Erbarmen. Ein paar der Leute starben, andere wurden gesund, einige kehrten in die Heimat zurück, andere aber blieben, blieben, um in das preußische Heer einzutreten und für ihrer Brüder Freiheit zu kämpfen.
Es regte sich überall. Laut sprachen die, die bisher hatten schweigen müssen, von dem bevorstehenden Freiheitskampf, und [S. 144] keinem Krieg hatte man in Preußen so entgegengejubelt wie diesem, den der Frühling von 1813 bringen sollte und dessen Ausbruch man kaum erwarten konnte.
An einem Märztag, an dem es schon lenzlich sproßte und Büsche und Bäume im jungen Safte schwollen, gab es in Hohensteinberg eine bittere Abschiedsstunde. Vater und Sohn zogen beide in den heiligen Kampf, und aus dem Dorfe folgten ihnen alle Männer, die noch die Kraft in sich fühlten, mitzustreiten und mitzusiegen, denn Sieg war aller Gebet und Hoffnung.
Joachim wollte mit seinen Freunden, den Tugendbündlern, in das ganz aus Freiwilligen gebildete Reiterregiment, das Graf Lehndorf in Königsberg sammelte, eintreten. Daß nur Arnold von Berkow gerade die vorgeschriebenen siebzehn Jahre zählte, kümmerte sie alle nicht, sie hofften, niemand werde es so genau damit nehmen.
Es hatte in Hohensteinberg auch niemand daran gezweifelt, daß Joachim mitziehen würde, und Frau Maria, die bei aller Sanftmut doch eine starke, tapfere Frau war, brachte ohne Klagen das schwere Opfer. Die Frauen des Hauses trugen in dieser Zeit eine stille, gefaßte Miene zur Schau, keine wollte es den Scheidenden schwer machen. Als Gottlobe zuerst in Strömen von Tränen Trost suchte, hatte die Großmutter sie in der alten herben Art, von der seit Raouls Flucht nur wenig noch zu spüren war, angerufen: »Schweig! Eine Steinberg heult nicht.« Da war Gottlobe jäh verstummt, und nur der Schwester klagte sie. »O der furchtbare Krieg! Wenn doch kein Krieg käme!«
»Bist dumm,« erklärte Gottliebe, und in ihr weiches Gesichtchen grub sich die feste, harte Steinbergfalte, »ich wollte nur, ich könnte mit wie Joachim!« Gottlobes Entsetzen ließ die [S. 145] Schwester ungerührt, und es ahnte niemand, wie oft Gottliebe es wünschte, ein Junge zu sein.
Wenige Tage vor dem Aufbruch trat sie zu dem Vater in das Zimmer. Zu ungewohnter Zeit und ohne Erlaubnis wagten es die Kinder selten, des Vaters Zimmer zu betreten, und der Freiherr, der über Büchern und Rechnungen saß, schaute erstaunt auf sein Mädel. »Was willst du?«
»Vater!« Gottliebe preßte beide Hände an die Brust, und wie sie so vor dem Vater stand im schlichten, dunklen Kleid, ein weißes, feines Tuch um Hals und Brust geschlungen, das junge Gesicht von den blonden Locken umrahmt, sah sie unendlich lieblich aus, und des Vaters Augen freuten sich an der jungen Schönheit seines Kindes. »Nun,« fragte er noch einmal freundlich, als Gottliebe stockte, »was will mein Mariellchen?«
»Vater — ich —« Purpurglut lief über das Gesichtchen, »ich — will mich als Achims Bruder verkleiden, weißt du, als ob ich sein Bruder wäre und nicht seine Schwester, und mitziehen in den Krieg. Ich kann's, Vater, gewiß! Bitte, bitte, lachen Sie nicht, ich habe die Kraft und — ich schäme mich, daß ich nichts, gar nichts für mein Vaterland tun kann, nur ein Mädchen bin.«
»Nur ein Mädchen!« Der Freiherr zog sein Kind an sich. »Meine Liebe, mein tapferes Kind, was sagst du da? Nur ein Mädchen — ist es denn nicht etwas Schönes, ein Mädchen zu sein, eine Frau zu werden, zu sorgen und zu schaffen für der anderen Wohl? Ei, Liebe, was sollten wir Männer tun, wenn wir in den Krieg ziehen müssen und daheim nicht unsere Mütter, Frauen und Schwestern unsere Arbeit täten?«
»Es ist so wenig,« flüsterte Gottliebe, »es sind — keine großen Taten.«
Ein ernstes Lächeln glitt über des Freiherrn Gesicht. »Keine großen Taten? Du Kind du! Auch wir, die wir in den Kampf ziehen, wissen nicht, ob uns das Schicksal für große Taten bestimmt hat. Es wird mancher an einem Zaun verbluten und sein Leben lassen, der ein Held war, und dessen Name nie jemand nennt. Sieh hinaus, meine Mariell, dort grünen die Saaten, dort wächst die Ernte des Jahres heran, und es würde schlimm darum bestellt sein, wenn die Frauen nicht den goldenen Segen hüten wollten, und unsere Ställe und Kornkammern würden leer sein ohne der Frauen Arbeit, und wer diese Arbeit leistet, der tut auch etwas für sein Vaterland. Ich ziehe fort und Joachim, und wir wissen nicht, wann wir wiederkehren, und ob wir noch einmal die Heimat sehen. Da lege ich denn auf deine Schultern einen Teil meiner Sorge und Last: du sollst deiner Mutter ein Segen, ein Trost sein, ihre Helferin in den Tagen der Mühe, die kommen werden. Es wird dir wenig Zeit für heitere Jugendlust bleiben, aber ich weiß, daß du treu an deiner Stelle stehen wirst, und an der Liebe für die Deinen, für das Vaterland wird deine Kraft, dein Wille erstarken. Gott hat jeden an seinen Platz gestellt, und es braucht keiner zu sagen: Ich bin nur dies, nur das! der seine Pflichten in Treue erfüllt. Die Frauen unseres Geschlechts waren immer tapfer und treu und verloren nicht ihren Mut in den Zeiten der Not. Sei auch du eine Steinberg, mein Kind, und draußen im Wirrsal des Krieges will ich froh denken: Meine Liebe schafft daheim, meine Tochter. Gott sei Dank, daß mir der Himmel zum Sohne auch Töchter gab!«
Gottliebe schmiegte sich bebend an den Vater an, sie fand keine Worte. Erst als der Vater sie prüfend anschauend fragte: [S. 147] »Willst du noch verkleidet mitziehen, und bist du nun noch traurig, nur ein Mädchen zu sein, meine kleine Tugendbündlerin?« da sagte sie leise, mit einem feierlichen, frommen Klang in der jungen Stimme: »Ich will daheim bleiben!«
Es wurde nicht viel geweint und keine Klagen ertönten, als ein paar Tage später die freiwilligen Kämpfer Abschied nahmen. Alle waren ernst und gefaßt, selbst die weichmütige Gottlobe versuchte, tapfer ihre Tränen zurückzudrängen; Gottliebe aber stand dabei mit einem so ernsten, reifen Ausdruck in dem Gesicht, daß der Vater diese Tochter noch einmal mit besonderer Liebe umfaßte. »Ich weiß, daß ich mich auf dich verlassen kann, mein Mädel,« sagte er ernst.
Und die Zurückgebliebenen nahmen tapfer und willig die vermehrte Arbeitslast auf sich, und so emsig auch jeder schaffte, sie staunten in Hohensteinberg doch alle über Gottliebe. Mit einem Ernst, der ihre Jahre weit überragte, suchte sie sich selbst ihre Arbeit. Pfarrer Buschmann willigte ein, daß vorläufig die Stunden ausgesetzt wurden, und Gottliebe packte die Bücher fort, die sie so liebte; auch für heitere Mädchenlust und zärtliche Freundschaftsbriefe fand sie keine Zeit mehr. Schon nach etlichen Wochen nannte Frau Maria ihre älteste Tochter ihren kleinen Minister, und Jungfer Rosalie wollte fast eifersüchtig werden, aber die Freude über des jungen Mädchens ernsten Fleiß war größer als das kleinliche Gefühl der Eifersucht. Die weichere, schwärmerische Gottlobe ließ sich von der Schwester fortreißen, aber wenn Liebe schon vor Tau und Tag aufstand, um auf dem Hof nach dem Rechten zu sehen, dehnte sie sich doch noch oft im Schlafe, und sie konnte auch das Seufzen und Klagen nicht ganz unterlassen; trotzdem wurde sie in dieser [S. 148] Zeit doch auch ein tüchtiges, pflichtgetreues Mädchen, eine rechte Tugendbündlerin, wie es die Schwester nannte. —
Und es wurde manche in dieser harten, schweren Zeit zur Heldin, manche Frau lernte das tapfere Aushalten, und für manches Mädchen gingen Jugendlust und Freude unter in dem ernsten Alltag. Das Gefühl, in einer großen, gewaltigen Zeit zu stehen, befreite viele von kleinlichem Kummer, kleinen Fehlern, kleinen Gedanken.
Eine große, eine wunderbare Zeit war es. Als Herr von Steinberg mit seinem Sohne, Freunden und Heimatgenossen nach Königsberg zog, da hatte der König von Preußen sein Volk noch gar nicht gerufen, aber doch strömten von überall her die Freiwilligen zu den Fahnen. Das Volk selbst forderte den heiligen Krieg, es forderte ihn so einmütig, mit solcher Opferwilligkeit, daß die meisten fühlten, nur Sieg oder ein völliger Untergang konnte das Ende sein. In Ostpreußen aber fühlte man es vielleicht am tiefsten, daß das herrliche, tapfere Preußenvolk nicht untergehen konnte.
Aber auch aus den andern Ländern deutscher Zunge außerhalb Preußens strömte die Jugend herbei, um dem Bruderlande zu helfen. Da litt mancher schwer, weil das engere Vaterland sich noch zu Frankreichs Bundesgenossen rechnete, und mancher kehrte dem kleinen Vaterland den Rücken und eilte über die Grenze nach Breslau, wo König Friedrich Wilhelm weilte, um unter dem preußischen Adler zu fechten. Sie fühlten, daß es diesmal für Preußen kämpfen für die deutsche Sache überhaupt kämpfen hieß.

Raoul von Steinberg träumte mit seinem Freunde Gottlieb auch viel von Kampf und Sieg, und in dem Ofenwinkel schmiedeten die zwei in den ersten Monaten des Jahres 1813 manchen kühnen Plan. Meister Käsmodel sagte nichts dagegen, wenn die Jungen laut von Kampf und Sieg sprachen; er war auch einer von denen, die voll Hoffnung auf den kommenden Sieg sahen, auch ihn bedrückte schwer die Schmach der deutschen Uneinigkeit, und er sagte manchmal: »Es ist wider die Natur, daß wir Sachsen Bonapartes Bundesgenossen sind. Herrgott, ich wollte, wir alle, die wir deutsch sprechen, hätten einen Kaiser, es wäre ein Reich.«
Das milde Klima des Pleißentales hatte in Leipzig schon im Februar hier und dort grüne Spitzen hervorgebracht, und es gab schon frühlingswarme Tage. Statt Schnee rann wohl auch der Regen in Strömen vom Himmel herunter, und an einem solchen platschenden, warmen Regentag kamen Raoul und Gottlieb mit einer solchen Eile, mit so viel Geschrei aus der Schule heim, daß ihr Rufen selbst das kleine blonde Minchen aus dem Puppenwinkel hervorlockte. Die Meisterin ließ den Kochherd im Stich, und der Meister kam mehlbestaubt aus der Backstube herbei. »Alleweil jetzt möcht' ich wissen, was das Geschrei soll, Bengels! Nächstens fällt noch unser guter, dicker Thomasturm um von eurem Geschrei.«
»Sie ziehen nach Breslau,« schrie Gottlieb und fuchtelte mit den Armen in der Luft herum, »und wir woll'n mit.«
»Wer — was zieht nach Breslau? Junge, rede doch vernünftig!« brummte der Meister.
»Die Hallenser Studenten ziehen nach Breslau, um dort als Soldaten einzutreten,« sagte Raoul heiß und erregt. »Sie sagen alle, dort würden neue Regimenter gebildet, und der Herr Konrektor [S. 150] hat's selbst erzählt, in einigen Tagen schon reisen die Studenten ab, sein Neffe ist auch dabei, und da — da — wollen wir mit.«
»Seid doch keine Studenten,« rief die Meisterin ärgerlich, die um ihren Sohn bangte, — »euch nehmen sie ja gar nicht, und die Studenten möchten sich schön umschauen, wenn so'n paar Dreikäsehochs mitwollten.«
»Hoho,« schrie Gottlieb empört, »wir sind fünfzehn Jahre, 'n paar Tage fehlen mir nur noch, sie nehmen uns schon.«
»Sie nehmen euch nicht! Mann, rede du doch etwas!« Die Meisterin sah bittend zu ihrem Manne hin. Sagte der denn kein Wort, redete der nicht den Buben den Unsinn aus?
Doch der Meister schwieg. Er sah von einem zum andern, und das Herz tat ihm weh, daß er die beiden Jungens aus dem Hause lassen sollte, aber — er selbst hätte es wohl verlangt, wenn er in ihrem Alter gewesen wäre, er verstand, daß die Jugend vor Kampfeslust glühte. »Du bist unser Einziger,« sagte er zögernd, »da ist's wohl allweil besser —«
»Das sagt Raoul auch,« schrie Gottlieb, und sein Gesicht flammte, »aber ich bleib' nicht hinterm Ofen sitzen, ich schäm' mich halbtot.«
»Mein Himmel,« stammelte die Meisterin entsetzt, »der Junge ist ja außer Rand und Band und soll nun mal ein richtiger, gesetzter Bäckermeister werden! Mann, schaff Ordnung!«
Doch dem Meister gelang es nicht, Ordnung nach dem Sinne des zagenden, sorgenden Mutterherzens zu schaffen. Er redete den Knaben gütlich und ernst zu, aber Gottlieb merkte wohl das heimliche Zögern des Vaters, und daß der im Herzen ihm recht gab, und er bat, flehte, trotzte auf, und im Bäckerhaus gab es ein paar stürmische, tränenvolle Tage. Die Meisterin [S. 151] wollte und wollte nicht einsehen, daß gerade sie ihren Sohn ziehen lassen müßte, und dabei schaute sie doch immer mit heimlichem Stolz auf Gottlieb. Es war, als wüchse der in diesen Tagen; er streifte viel Kindisches, Törichtes von sich ab, sein heißes Wollen, die brennende Sehnsucht, die in ihm gärte, reifte ihn, und endlich gab die Mutter nach und fügte sich mit blutendem Herzen darein, den Sohn ziehen zu lassen. Um des Vaters Einwilligung brauchte Gottlieb nicht zu ringen.
»Wartet es doch wenigstens ab, bis man wirklich weiß, ob es losgeht,« bat die Meisterin, der jeder Tag Aufschub ein Geschenk schien; aber dann brachte Meister Koch eines Tages die Nachricht, daß die Hallenser Studenten wirklich nach Breslau zu ziehen gedächten. Da gab es kein Halten mehr. Gottlieb und Raoul eilten zu ihrem Konrektor und erbaten sich einen Empfehlungsbrief an dessen Neffen, und der redete nichts dagegen, sondern gab ihnen das Schreiben. Beim Abschied sagte er dann: »Ich glaube, Gottlieb, du wirst ein besserer Soldat als Lateiner werden, trotz deiner Jugend. Nun, Gott befohlen, ihr Jungen! Es wird eine heiße Zeit werden, und ich wollte, ich könnte euch erst wieder auf der Schulbank sehen, dann freute ich mich wohl selbst an deinem Fehlergewimmel, Gottlieb!«
Auch Meister Käsmodel hatte sich ein paar Empfehlungsschreiben verschafft, und so fuhr er selbst eines Morgens die beiden Knaben heimlich nach Halle. Es schien ihm gut und vernünftig, wenn die beiden sich den Hallenser Studenten anschlossen. Das war eine bitterschwere Abschiedsstunde in der kleinen Ladenstube. Die Meisterin hielt ihr Minchen an der Hand und schluchzte herzbrechend: »Nun bleibt mir nur das eine von meinen Kindern.«
»Ich komme wieder, Mutter, haben Sie keine Sorge,« flüsterte Gottlieb, dem nun doch der Abschied so schwer wurde, daß er die Zähne zusammenbeißen mußte, um nicht laut zu heulen. Er starrte immer geradeaus an der Mutter vorbei. Da lagen die Brote auf dem Schrank, eins, zwei, drei, vier, fünf, zählte er in Gedanken, eins, zwei, drei, vier — er schluchzte auf und rannte plötzlich hinaus und kletterte auf den Wagen. Herrgott, das hätte er nicht gedacht, daß ein Abschied eine so schlimme Sache war!
Raoul war gefaßter, doch als er des Freundes Kampf, der Mutter Jammer sah, dachte er an die bitteren Abschiedsstunden, die er schon durchlitten hatte. »Frau Meisterin,« sagte er rasch und faßte die Hand der Frau, »ich halt' zu Gottlieb, wie's auch kommt!«
Da war's, als glitte ein schwaches Leuchten über das vergrämte Gesicht der guten Frau, und sie strich über des Knaben Haupt. »'s ist mir ein rechter Trost, daß du dabei bist,« murmelte sie. »Fahrt mit Gott!«
Ein letztes Winken und Grüßen, und wie damals, als er nach Hohensteinberg gefahren war, rasselte das Wäglein die Straße entlang, und Raoul warf einen letzten Blick auf das spitzgieblige Haus; nun eine Biegung, es war nicht mehr zu sehen. Gottlieb schaute sich nicht einmal um; er saß ganz zusammengekauert da, und erst als Leipzig weit, weit hinter ihm lag, richtete er sich auf und fragte ein wenig unsicher: »Glaubst du, Raoul, daß uns die Studenten auch mitnehmen?«
»Freilich,« antwortete der Freund sorglos, und auch der Meister meinte gewichtig: »Warum denn nicht? Ich habe gute Empfehlungsschreiben.«
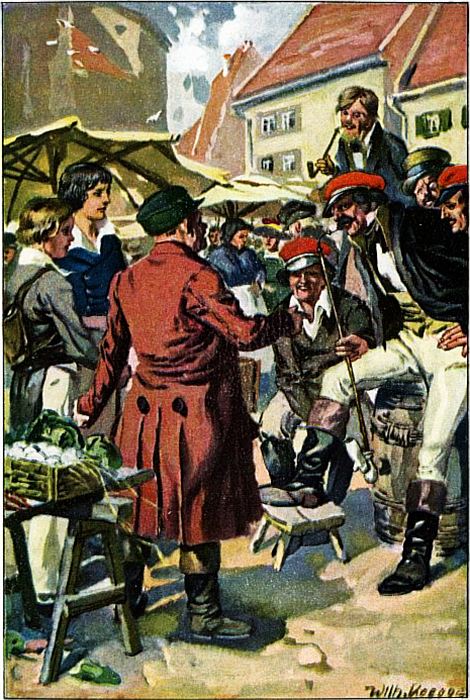
Es gab auf dem Marktplatz zu Halle aber ein lautes Hallo und Geschrei, als der Leipziger Bäckermeister auf ein dort versammeltes Häuflein Studenten zutrat und sein Anliegen vorbrachte. »Sind wir Kindermuhmen, sind wir Magister, die kleine Buben in Zucht und Lehre nehmen?« schrie ein baumlanger Kerl in Samtrock, der aus einer Pfeife rauchte, die beinahe so lang wie Meister Käsmodel selbst war.
»Euer Brot ist noch zu frischgebacken, wohllöblicher Bäckermeister,« spottete ein anderer und schaute lachend auf Gottlieb. Und ein dritter höhnte: »Schick den Backofen mit auf die Reise, damit die Büblein es gut warm haben.«
Heisa, da fuhr der Meister aus! Sein Gesicht glühte ihm wie ein gutgeheizter Backofen selbst, und seine Stimme dröhnte laut über die anderen hinweg. »Was schert es euch, ihr Herren, wenn den Buben ein paar Jährlein fehlen? Seid ihr der König von Preußen selbst? Sollte meinen, lang ist das allweil noch nicht her, als ihr selbst die Schulbänke drücktet! Nennt ihr das Vaterlandsliebe, aus langen Pfeifen schmauchen, in Samtkitteln einherlaufen und über ehrsame Bürgersleute spotten? Ein Paar junge Arme sind viel wert in dieser Zeit, und mein Gottlieb tut seine Sache vielleicht besser als so ein Bücherschnüffel, und mein Pflegesohn da, — dem sein Vater selig, der ist bei Saalfeld gefallen, und sein Sohn wird ihm Ehre machen. Gehabt euch wohl, ich meinte, in der Zeit müßte einer wie'n Bruder zum andern stehen, aber mir scheint, ihr zieht auf den Tanzsaal mit Lust und Übermut und allweil nicht in den heiligen Krieg fürs Vaterland.«
Der dicke Meister wischte sich danach den Schweiß von der Stirn, die Rede war kein leichtes Stück gewesen, aber sie hatte [S. 154] eine gute Wirkung getan. Die Studenten sahen einander betroffen an, dann trat einer vor und sagte höflich: »Nichts für ungut, so arg war's nicht gemeint, und wenn der Herr Meister uns die Söhne anvertrauen will, ich will sie wohl mitnehmen.«
Die andern fielen ein, so sei es recht, und nach ein paar Minuten war der Friede geschlossen, und es wurde abgemacht, daß Raoul und Gottlieb mit ungefähr zwanzig Studenten am nächsten Morgen die Fahrt nach Breslau antreten sollten. Mit festem Handschlag wurde brüderliche Treue gelobt, und Gottlieb, der schlechte Lateiner, der unerbittliche Feind aller Grammatik und Orthographie, hatte in dieser Minute beinahe Respekt vor sich selbst, vor diesem Gottlieb Käsmodel, der ein Genosse der Studenten geworden war. »Raoul,« flüsterte er, »von der Schule aus brächte ich's nie so weit, wenn — die nur nicht lateinisch reden.«
Aber daran dachten die Musensöhne nicht, sie redeten ein kräftiges, kernfestes Deutsch in dieser Zeit, und es zeigte sich bald, daß sie wirklich mit heiligem Ernst in den Krieg zogen. Der Meister wurde rasch gut Freund mit ihnen, und etliche versprachen ihm: »Wenn wir nach Frankreich marschieren und durch Leipzig kommen, dann vergessen wir es nicht, Meister, bei Ihnen Einkehr zu halten.«
»Das ist ein Wort,« rief der Meister, »aber so weit sind wir allweil noch nicht, und ehe ihr den Musjeh Bonaparte in seinem Frankreich selbst aufsuchen könnt, mag noch viel Wasser die Berge herabrennen.«
Mit schmetterndem Gesang ging es am nächsten Morgen frohgemut mit der Extrapost zur Stadt hinaus. Meister Käsmodel sah das Trüpplein davonfahren, und er lüftete ehrerbietig [S. 155] seine Kappe, als es stolz und froh in den kühlen Vorfrühlingsmorgen hinausschallte:
Schon von Mitte Februar an zogen in Breslau die ersten freiwilligen Kämpfer ein, und als nach einer Fahrt, mit mancherlei List und Vorsicht, denn noch gab es überall französische Besatzungen, die Hallenser mit Raoul und Gottlieb an einem Märztage ihr Ziel erreichten, da herrschte auf den engen Straßen schon ein ungewöhnliches Leben. In Scharen kamen die Freiwilligen an, jeder hatte sich ausstaffiert, wie es gerade ging, und manch einer trug noch einen alten Säbel, den sein Vorfahre schon unter des großen Fritzen siegreichen Fahnen geschwungen hatte. Die Uniformen waren wunderlich zusammengestoppelt: ein bunter Kragen auf dem Alltagsrock — das war manchmal das einzige Zeichen, welchem Regiment einer zugehörte. Auch Gottlieb und Raoul waren noch nicht ausgerüstet, sie liefen in ihren Schulkleidern mit, als die Studenten sich einschreiben ließen. In dem großen Saal, in der Menschenmasse, den vielen höheren Offizieren gegenüber wurde es den Buben dann seltsam beklommen zumute. »Sie nehmen uns nicht,« flüsterte Gottlieb entmutigt, aber Raoul beharrte: »Sie müssen uns nehmen, ich muß mitziehen.«
In einer Ecke des großen Saales standen einige ältere Offiziere zusammen in eifrigem Gespräch. Ein hochgewachsener [S. 156] Mann in der Uniform der preußischen Landwehr erzählte lebhaft, wie es droben in Ostpreußen aussehe, und die andern lauschten aufmerksam seinen Schilderungen. Nur manchmal warf einer einen Blick auf die Schar der eben angekommenen Freiwilligen, von denen einer nach dem andern vortrat und seinen Namen und Stand nannte. Doch plötzlich horchten alle auf, das Stimmengewirr hatte sich jäh gelegt, und in die Stille hinein gellte eine helle Knabenstimme: »Ich muß mit, ich muß mit! Nehmen Sie mich doch, ich bin stark genug! Ich heiße Steinberg, und mein Vater fiel bei Saalfeld.«
»Steinberg, hören Sie, da ist einer Ihres Namens,« wandte sich ein General an den stattlichen Mann in preußischer Landwehruniform, und der drehte sich blitzschnell um. »Ein Steinberg, wo?« Da traf sein Blick Raoul, der blaß, hochaufgerichtet vor dem Tisch stand, auf dem die Listen der Eingeschriebenen lagen. Senkrecht grub sich in die Stirn des Knaben die tiefe Falte, und seine Augen sprühten und blitzten, eine so feste Entschlossenheit lag in dem jungen Gesicht, daß der General unwillkürlich sagte: »Donnerwetter, um den wär's schade!«
»Raoul!« Der Freiherr von Steinberg war rasch vorgetreten, da stand er, der verlorene Neffe, der Knabe, der so eigenmächtig sein Schicksal in die Hand genommen hatte. »Raoul, du hier?«
O diese Stimme! Raoul wandte sich jäh um und stand nun seinem Oheim Auge in Auge gegenüber. Eine tiefe Glut überflog sein Gesicht, aber seine Augen hielten doch den Blick des Oheims aus, und dem war es, als schaute er durch diese dunklen, ernsten Augen hindurch auf einen lichten, reinen Grund. Er legte seine Hand auf des Knaben Haupt: »Was ist's denn mit dir?«
»Ich bin zu jung, Gottlieb und ich sind zu jung,« rief Raoul, der jetzt nur an die Gegenwart dachte, rasch des Freundes Hand ergreifend, der einen Schritt hinter ihm stand.
»Zu jung, zu jung! Erst fünfzehn Jahre. Siebzehn müssen es sein,« sagte der Protokollführer und wiegte bedauernd den Kopf.
»Tretet zurück,« sagte Herr von Steinberg, »ich werde sehen, was sich tun läßt,« und ohne ein Wort weiter zu sagen, schob er Raoul vor sich her, stellte ihn vor den General hin und sagte: »Mein Neffe, der Sohn meines Bruders, der bei Saalfeld fiel, und noch ein Steinberg, der mit will. Mein Sohn, der auch noch nicht seine siebzehn hat, zieht auch mit. Ein Steinberg kann nicht daheim bleiben in dieser Zeit.«
Der General musterte Raoul von Kopf bis zu Füßen. »Ein wackerer Bursche,« sagte er anerkennend, »und ein Steinberg, das ist ein guter Empfehlungsbrief. Ich denke, wir können hier auch über die fünfzehn hinwegkommen. Aber was ist der andere?«
»Mein Freund Gottlieb Käsmodel aus Leipzig,« sagte Raoul, denn Gottlieb war ganz verstummt. »Wir sind zusammen gekommen.«
»Auch nicht älter?«
»Nein!«
»Na, dann muß der schon heimziehen, nur Jungen können wir doch nicht gebrauchen. Ist er ein einziger Sohn? Was ist sein Vater?«
»Ja, sein Vater ist Bäckermeister in Leipzig.«
»Ein gutes Gewerbe! Zieh heim, mein Sohn, und hilf dem Vater ordentlich,« sagte der General freundlich.
Raoul atmete tief auf, dann trat er einen Schritt vor, und [S. 158] seine dunklen Augen unverwandt auf den General gerichtet, rief er: »Wir müssen beide mit. Der Gottlieb ist mein Freund, ich hab's ihm gelobt, zusammen oder — nicht.« Seine Stimme schwankte. »Er hat noch mehr Kräfte als ich, wir halten's beide ganz bestimmt gut aus!«
Nun irrte sein flehender Blick zu seinem Oheim hin, und dessen Herz schlug.
So war seines Bruders Sohn, so treu, so tapfer! Er trat an den General heran und erzählte ihm leise kurz des Neffen Geschichte, und immer wohlwollender ruhten die hellen Reiteraugen des Generals auf den beiden Knaben. »Uns wird's nicht fehlen, Kameraden,« sagte er zu den umstehenden Offizieren, »wenn solche Jugend für des Vaterlandes Freiheit ficht. Tretet jetzt zurück und wartet draußen, ihr beiden, ich werde an eure Sache denken.«
Und nebeneinander, Raoul größer, schlanker, Gottlieb kleiner und untersetzter, mit brennenden Wangen und strahlenden Augen gingen beide durch den Saal und harrten dann vor der Türe in Zuversicht, daß sich ihr Schicksal entscheiden werde. »Der Oheim zürnt nicht,« sagte Raoul leise, froh.
»Jetzt begreif' ich's allweil nicht,« flüsterte Gottlieb, des Vaters Lieblingswort unwillkürlich gebrauchend, »warum du da ausgerissen bist. Aber gut war's, denn ohne dich schickten sie mich heim.«
Sie saßen beide auf einem Holzbänkchen im Winkel, und es dauerte lange, ehe der Freiherr herauskam. »Das ist er,« flüsterte Raoul und schnellte in die Höhe, und kerzengerade, viel größer geworden in dem einen Jahr der Trennung, stand er vor seinem Oheim. »Junge, Junge,« rief der mit bewegter [S. 159] Stimme, »weißt du denn nicht, welche Sorge du uns gemacht hast? Ahnst du nicht, wie wir uns gegrämt haben um dich?«
»Es war eine Dummheit,« bekannte Raoul offenherzig, »es war unrecht.«
Da zog der Mann ihn an seine Brust. »Sieh von jetzt ab deinen Vater in mir, und wenn wir heimkehren, dann soll dir Hohensteinberg wirklich eine Heimat sein!«
Raoul drückte nur fest des Oheims Hand, er konnte nicht sprechen, und Gottlieb zog ein Gesicht, als wäre er dabei, eine Literflasche voll Essig auszutrinken. Da wandte sich der Freiherr zu ihm: »Du bist also der Gottlieb, von dem meine Mariell, deine Namensschwester, mir so viel erzählt hat! Schau nicht so finster drein, ich will dir den Freund nicht nehmen, so gute Freundschaft hält, meine ich, das ganze Leben. Gib mir die Hand, Gottlieb, auf gute Freundschaft auch zwischen uns zweien. Deinen Eltern und dir bin ich viel Dank schuldig für das, was ihr an meines Bruders Sohn getan habt!«
Gottlieb war puterrot geworden. Er hätte gern etwas recht Kluges, Feierliches gesagt, aber eine große Verlegenheit schnürte ihm fast die Kehle zusammen. Er trat von einem Bein auf das andere und platzte endlich heraus: »Raoul, warst du'n Esel! Vor so'nem Oheim wär' ich doch nicht davongelaufen!«
Der Freiherr lachte, daß ihm die Tränen über die Backen liefen, und herzhaft schüttelte er immer wieder die feste Bubenhand. »Du bist ein Prachtkerl, Junge!« sagte er. »Nun aber kommt noch hinein, es ist mir gelungen, eure Aufnahme durchzusetzen, da es euer Wille ist und deine Eltern, Gottlieb, doch einverstanden sind?«
»Freilich,« rief der und gab Raoul einen Puff. »Erzähl, [S. 160] wie's war!« Und Raoul erzählte dem Oheim kurz, wie sie hergekommen waren, und daß Meister Käsmodel sie selbst nach Halle gebracht hatte.
»Na, dann kommt!« sagte der Freiherr und betrat mit den beiden nochmals den Saal. Sie wurden eingeschrieben, und mancher wohlwollende Blick traf die beiden Jungen, und mancher dachte auch wie Herr von Steinberg: »Wie wird ihr Schicksal sein? Werden sie heimkommen aus diesem harten Kampf, der vor uns steht?«
Am nächsten Tage schon trennte die Unruhe der Zeit den Freiherrn von den beiden Knaben: er mußte nach Ostpreußen zurück, die Jungen aber blieben in Breslau. Es war ein kurzer Abschied. Auf Wiedersehen riefen die Knaben hoffnungsfroh, aber der besonnene Mann setzte ernst hinzu: »Gott gebe es uns, daß wir uns als Sieger wiedersehen.«

Der Sturm, der am Ende des Jahres 1812 durch Deutschland zu brausen begann, wurde stärker, sein Tosen gellte lauter und lauter, und immer höher schlugen die Flammen der Begeisterung. Als am 17. März König Friedrich Wilhelms »Aufruf an mein Volk« erschien, da strömten die Freiwilligen in immer größeren Scharen dem preußischen Adler zu, und es gab wohl kaum eine Familie, die nicht an Blut und Gut ihr Opfer dem Vaterland darbrachte. Und ein hartes, schweres Ringen um die Freiheit hub an. Die Völker vereinten sich, um Napoleons Joch abzuschütteln, doch der hatte nach der russischen Niederlage rasch neue Kräfte gesammelt. Ihn kümmerte es wenig, daß Frankreich selbst kriegsmüde und tief erschöpft war, er wollte nur seinen maßlosen Ehrgeiz befriedigen. Überall ließ er neue Soldaten ausheben, blutjunge Burschen mußten eintreten, und viele, viele Deutsche wurden wieder zum Kampf gegen die deutschen Brüder gezwungen. Das unglückliche Sachsen wurde zum Schauplatz des Krieges, sein König mußte Napoleons Bundesgenosse bleiben, der in Dresden residierte. Das Volk mußte namenlose Opfer aufbringen, das Landvolk namentlich war ganz [S. 162] der Willkür der Franzosen preisgegeben, und in Dresden und Leipzig lagen nach den Schlachten bei Großgörschen und Bautzen Tausende von Verwundeten. Die Lebensmittel wurden immer knapper, immer teurer, und in vielen Häusern, in denen einst blühender Wohlstand geherrscht hatte, war bittere Not eingekehrt.
Auch in dem Hause Meister Käsmodels sah es trübselig genug aus, und der Meister sagte manchmal: »Es ist keine Freude, Bäcker zu sein, wenn das Brot so sündhaft teuer ist.« Die Meisterin ging still und bedrückt einher. Sie zagte und bangte um den fernen Sohn. »Er steht bei den Feinden,« klagte sie oft.
»Er kämpft für die gerechte Sache,« sagte der Mann dagegen. Dieser einfache, schlichte Mann erkannte in dieser Zeit klarer als mancher gelehrte Würdenträger, wo das Heil für Deutschland lag, und so sorgenbeschwert ihm auch das Herz war, er hoffte doch unverzagt und gläubig, daß es den Verbündeten gelingen würde, das Land von der Fremdherrschaft zu erlösen.
Freilich der Sommer 1813 ging ins Land und wandelte sich zum Herbst, und noch immer schwankte die Wage hin und her. In einem langen Waffenstillstand suchte Napoleon von Dresden aus sein Heer zum entscheidenden Kampfe zu rüsten, aber seine Gegner waren in dieser Zeit nicht müßig gewesen: dem russisch preußischen Bündnis hatten sich Österreich und Schweden zugesellt. England gab Gelder her, und als sich im Oktober auf den weiten Ebenen um Leipzig herum die Völker zur entscheidenden Schlacht sammelten, da beseelte eine stolze Zuversicht die Führer der verbündeten Armeen.
Im grauen, feinen Regendunst sah Gottlieb Käsmodel seine Vaterstadt am Morgen des 16. Oktober zum erstenmal wieder. Als Feind stand er draußen vor den Toren, und wie er, so [S. 163] fragten sich zitternd die Bewohner der bedrohten Stadt: »Was wird unser Schicksal sein?«
Nebeneinander standen die Freunde an diesem Morgen. Der Frühling und Sommer dieses harten Jahres hatte in ihre jungen Gesichter tiefe Spuren gegraben, sie hatten im Schlachtenlärm gestanden, hatten Kameraden fallen sehen, hatten allen Jammer des Kriegs erlebt. Das hatte Gottlieb Käsmodels Knabenübermut gedämpft und Raoul noch stiller und ernster gemacht. »Wenn's zu einem Sturm auf Leipzig kommt!« murmelte Gottlieb und starrte in die Ferne, wo er ganz zart im Grau die vieltürmige Stadt liegen sah.
Raoul atmete schwer, auch seine Gedanken kreisten in dieser Stunde um das Bäckerhaus, in dem es ihm so wohl gewesen war. »Wir müssen unsere Pflicht tun,« sagte er herb und sah den Freund an. Der nickte: »Wir müssen durch — wenn ich nur wüßte, wie's drinnen aussieht!«
Seit Wochen fehlte den beiden jede Nachricht von dort, und drinnen weinte um diese Stunde die Meisterin in nicht enden wollendem Leid. »Mein Gottlieb, mein Gottlieb, wie mag's ihm ergehen! Nun steht er wohl draußen als Feind.«
Das kleine Minchen, das mit seinen fünf Jahren noch nicht den Ernst der Stunden erfaßte, hob plötzlich sein Fingerchen: »Mutter, das bummst so! Der liebe Gott donnert.«
Dumpf dröhnte und hallte der Kanonendonner über Leipzig hin, und im weiten Kreis um die Stadt herum raste der Kampf. Am Mittag wurde es stiller, und dann plötzlich fingen von den Türmen die Glocken zu läuten an, Sieg, Sieg!
»Herrgott,« schrie der Meister Käsmodel verzweifelt auf, »der Bonaparte hat wieder gesiegt! Verloren die gerechte Sache!«
Doch das Siegesläuten verstummte; nur ein Scheinsieg war es gewesen, den die Franzosen allzu schnell verkündet hatten: der alte Löwe Blücher hatte Bonaparte seine Klauen gezeigt und ihm schwere Wunden beigebracht.
Es waren fürchterliche Tage für Leipzig. Blutrot flammte der Himmel über der Stadt: es war der Widerschein der brennenden Dörfer ringsum. Die Straßen hallten wider vom Wehgeschrei der Verwundeten, die in Scharen in die Stadt hineinströmten, und Geschützwagen rasselten eilig dazwischen. Die öffentlichen Gebäude und Kirchen waren in Spitäler verwandelt worden. Am 17. Oktober, einem Sonntag, riefen die Glocken nicht wie sonst die Bewohner zur Kirche. In dumpfer Angst blieben alle in ihren Häusern. Wer nicht mußte, wagte sich nicht auf die Straße hinaus, viele verkrochen sich in die Keller und verrammelten Türen und Fenster ihrer Häuser. Am 18. Oktober stieg die Sonne in feuriger Glut über der Stadt und der weiten Ebene empor und bestrahlte den mörderischen Kampf dieses Tages. Zu Tausenden bedeckten Sterbende, Tote, Verwundete die Felder um Leipzig, wie Fackeln brannten die Dörfer, das Rollen und Donnern der Geschütze tönte unablässig fort, und die Bewohner von Leipzig sahen in dumpfer Verzweiflung ihrem völligen Untergang entgegen.
»Die Stadt wird gestürmt, die Stadt wird geplündert! Nun müssen wir das Bündnis mit Frankreich büßen, an dem wir schon so viel gelitten haben,« klagten die Bürger.
Dann flog plötzlich der Ruf durch die Stadt, wie ein Erlösungsschrei klang es: »Die Sachsen sind zu den verbündeten Heeren übergegangen.« Und als der Abend kam, drängten die fliehenden Franzosen in Scharen in die Stadt hinein und flohen in wilder Hast dem Ranstädter Tore zu, und Napoleon ließ die andern Tore noch verteidigen, um den Resten seiner Armee den Rückzug zu decken.
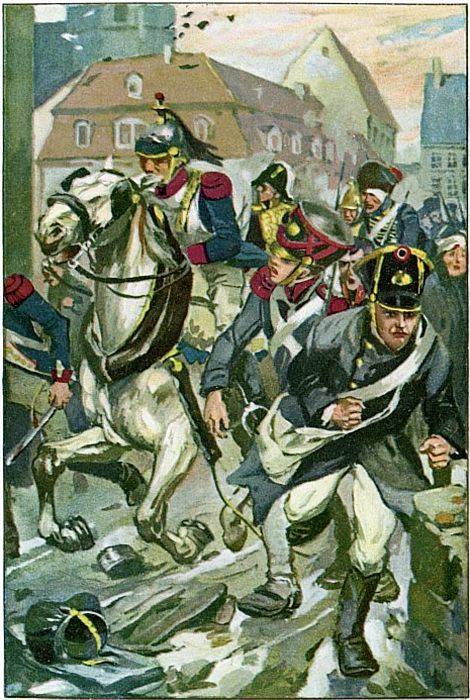
Doch schon am nächsten Morgen drangen die Verbündeten von drei Seiten auf die Stadt ein. Laut brauste der Jubel der Einwohner ihnen entgegen. »Sieg, Sieg, Sieg!« hallte es durch die Straßen, jeder fühlte, daß der Sieg der Franzosen nur neues Leid, neue Schmerzen bedeutet hätte. »Sieg, Sieg, Sieg!« läuteten die Glocken und übertönten das Stöhnen und Ächzen der vielen Verwundeten, die, ein Obdach suchend, durch die Stadt irrten.
An alle Türen klopften Hilfesuchende, und bald war alles überfüllt. Auf den Straßen, den Friedhöfen lagerten die Unglücklichen, frierend, hungernd in der rauhen Luft des Oktobertages. Die Bürger nahmen auf, so viele sie konnten, aber Mangel und Not waren so groß, daß selbst die wohlhabenden Leute nur knapp zu essen hatten. Auch Meister Käsmodel hatte das Backen einstellen müssen; er war ein Bäcker ohne Mehl, nur für das eigene Hans gab es noch einen kümmerlichen Vorrat. Dafür lagen in den Stuben Verwundete, und die braven Meistersleute sorgten, so gut sie es vermochten, für die Unglücklichen. Nur Gottliebs und Raouls Kammer war unbesetzt, die Betten standen bereit. »Wenn die Jungen heimkommen, sollen sie doch ihr Unterkommen haben,« hatte die Meisterin gesagt.
Und bei jedem Klopfen an der Türe schraken Mann und Frau zusammen und liefen hinaus, und immer wieder kehrten sie enttäuscht zurück, — die Erwarteten kamen nicht.
Gegen Abend des 19. Oktober klopfte es wieder laut an die Haustüre, und als der Meister hinauseilte, sah er einen hochgewachsenen preußischen Offizier draußen stehen. Er leuchtete [S. 166] ihm mit seinem Laternchen forschend ins Gesicht, der Offizier fragte: »Bin ich hier recht bei Meister Käsmodel?«
»Das stimmt,« sagte der Meister. »Wenn ich nur wüßte, wo ich das Gesicht schon sah!«
»Steinberg ist mein Name,« erwiderte der Fremde, »ich —«
»Daß mich das Mäuschen beißt, das ist doch alleweil der Oheim von unserm Raoul!«
»Sie haben mich also doch erkannt?« fragte Herr von Steinberg, der war es wirklich.
»Treten Sie ein, Herr Baron,« sagte der Meister. »Unsere Frau von Steinberg, Gott hab' sie selig, hatte ein Bild von ihrem Manne, dem gleichen Sie aufs Haar.« Er ließ den Gast vorangehen und schloß dann eilig wieder die Türe, denn schon drängten andere in den Lichtschimmer des Laternchens. Rasch prüfte des Meisters Blick den Freiherrn, der bleich und erschöpft aussah. »Mir scheint's, Sie brauchen Ruhe!«
Herr von Steinberg nickte. »Die brauchen wir wohl alle. Ich bin auch verwundet an der Schulter, es ist nicht arg; doch darum kam ich nicht. Ihr Sohn Gottlieb liegt verwundet in einer Scheune bei Gohlis, ich komme, Sie zur Hilfe holen.«
»Mein Junge,« schrie der Meister, »er ist verwundet, aber er lebt? Sagen Sie mir, daß er lebt!«
»Ich hoffe, er lebt,« sagte der Freiherr ernst. »Ich sah ihn selbst nicht. Heute in der Frühe erhielt ich Botschaft: mein Neffe Raoul hatte gestern schon einen Ordonnanzoffizier gebeten, wenn er mich treffen sollte, mir diesen Zettel zu bringen.« Herr von Steinberg gab dem Meister einen Zettel, auf dem stand in eiliger Schrift: »Gottlieb Käsmodel liegt in einer Scheune links von Gohlis, drei Bäume stehen rechts, in der Nähe ist ein [S. 167] Wassertümpel. Wenn Sie nach Leipzig kommen, sagen Sie es, bitte, Meister Käsmodel, lieber Onkel. Raoul.«
»Und Raoul?« fragte der Meister zurück.
Der Freiherr zuckte die Achseln. »Ich habe nichts mehr von ihm gehört, der Zettel kam nur durch einen glücklichen Zufall in meine Hände. Sein Regiment soll große Verluste gehabt haben. Wer kann in diesem Wirrsal wissen, wo der ist und jener! Ich weiß auch nichts von meinem Sohn.«
»Einen Wagen kann ich wohl beschaffen,« sagte der Meister hastig, »aber werde ich hinauskommen?«
»Ich werde Sie begleiten, vielleicht gelingt es mir, uns Durchfahrt zu verschaffen.«
»Aber Sie sind verwundet, Herr Baron!«
»Was schadet das! Ein Streifschuß nur. Es war eine böse Sache heute am Grimmaischen Tor, nur« — der Freiherr stockte — »Hunger habe ich!«
»Hunger? Kommen Sie herein, schnell, schnell,« drängte der Meister, »meine Frau soll für Sie sorgen, und allweil schaffe ich einen Wagen herbei.«
Nach wenigen Minuten saß der Freiherr in der Backstube, in dem Raum, in dem seine Schwägerin so oft mit ihrem Sohn sich an kalten Winterabenden erwärmt hatte, und die Meisterin gab ihrem Gast, was sie nur hatte. Ihr flossen die Tränen im Leid um ihren Sohn, und die gemeinsame Sorge knüpfte rasch ein festes Band um die einfache Frau und ihren vornehmen Gast. Der sagte: »Ich kann's Raoul nicht verdenken, daß es ihm hier wohl war,« und die Meisterin gab schlicht zur Antwort: »Wir haben ihn alle lieb.«
»Is Raoul totgeschoßt?« fragte Minchen weinerlich am [S. 168] Knie der Mutter, und die seufzte schwer: »Wo mag er sein? Und wird mein Gottlieb noch leben?«
Nach einer Stunde kehrte der Meister zurück, es war ihm nicht leicht geworden, einen Wagen aufzutreiben, und als er ihn hatte, wäre er ihm noch beinahe auf der Straße von preußischen Soldaten fortgenommen worden; nur der Hinweis, der Wagen solle Verwundete holen, hatte geholfen.
Ein mühsames Fahren war es durch die überfüllten, schlecht beleuchteten Straßen. Am Halleschen Tor staute sich wieder die Menge, und wäre Herr von Steinberg nicht mit gewesen, dann hätte der Meister nie das Ziel erreicht. Endlich, die Nacht war schon hereingebrochen, gelang es den beiden, mit ihrem Wäglein hinauszukommen, und der Meister, der wegkundig war, fuhr in einem Bogen nach Gohlis hin. Es war eine schauervolle Fahrt. Noch glühte der Himmel rot, da und dort brannte es noch in weitem Umkreis in den Dörfern. Überall lagen Verwundete, Sterbende, Tote, Jammerrufe durchhallten die Nacht, und dann huschten Lichtlein hin und her, Wagen rasselten dumpf über die Felder, die Verwundeten wurden geborgen. Es war auch schwer, die Scheune nach Raouls Angaben zu finden in der Nacht: da war eine und da drei und da ein Trümmerhaufen, auch Bäume standen da und dort, und Verwundete lagen unter jedem Dach, und alle flehten um Wasser, baten mitgenommen zu werden.
Der Meister hatte vorsorglich die letzten zwei Flaschen Wein, die er besaß, und Brot mitgenommen, und er teilte aus bis auf einen Rest. »Der muß für meinen Jungen bleiben, aber die da jammern, haben's allweil so nötig,« meinte er.
Schon graute leise der Morgen, als die beiden endlich die Scheune entdeckten, die drei Bäume daneben und ein paar Schritte [S. 169] weiter einen schmutzigen, kleinen Tümpel. »Dort ist's,« riefen beide zu gleicher Zeit, lenkten den Wagen darauf zu und sprangen ab. Seltsame Töne klangen ihnen entgegen, als sie die Scheune erreicht hatten, und unwillkürlich blieben beide stehen. Drinnen sangen zwei, eine helle, durchdringende Stimme war es und eine, die tiefer klang, und in den grauenden Tag hinaus tönte es:
»Das ist allweil mein Gottlieb, der singt,« schrie der Meister und stürzte voran. »Gottlieb, Junge, bist du's?« rief er in die dunkle Scheune hinein, und jubelnd klang es zurück: »Vater, Vater, hier!« Dann brach die Stimme jäh, und viel matter tönte es nach: »Wir versingen uns Schmerzen und Hunger!«
Mit seinem Laternchen leuchtete der Meister voran. Da kauerten zwei im Winkel, und einer lag stöhnend daneben. »Ist Raoul dabei?« rief Meister Käsmodel.
»Nein!« antwortete Gottlieb und richtete sich etwas auf, »der hat mich nur herausgehauen, aber feste! Vater, wär' ich der König, dreimal kriegte er das eiserne Kreuz. Am Abend hat er mich dann hierhergeschleppt, aber wo er jetzt ist, das weiß ich nicht,« fügte er leiser hinzu.
»Die Unseren sind weiter gezogen,« sagte der zweite, der im Winkel kauerte, und als der Meister ihm ins Gesicht leuchtete, erkannte er in ihm den einen der Hallenser Studenten. »Ich bin's, Herr Meister, und mein Bein ist zerschossen, aber Viktoria, wir haben gesiegt!«
»Das stimmt allweil,« brummte der Meister und hob sacht seinen Sohn auf, »aber jetzt gilt's die Glieder zusammenflicken. Komm, Junge, ich trag dich, Mutter wartet schon auf dich.«
»Aber meine Kameraden müssen mit,« bat Gottlieb ächzend, dem das Aufheben bittere Schmerzen bereitete, »zwei Tage und Nächte liegen wir schon zusammen, wir müssen zusammen bleiben.«
»Allweil, das versteht sich, Junge,« sagte der Meister und biß die Zähne zusammen, um seinem Sohn nicht zu zeigen, wie sehr der ihn jammerte.
Herr von Steinberg half, und bald lagen die drei im Wagen, und die beiden Männer schritten nebenher; das magere Pferdchen hatte schwer genug an den Verwundeten zu ziehen.
Der Rückweg über das Schlachtfeld und durch das erstürmte Tor war im Morgengrauen noch fürchterlicher, aber es ging nun schneller vorwärts, und ernst und schweigsam langte der Zug noch am Vormittag am Bäckerhause an. Die Mutter unterdrückte tapfer jede Klage, als sie ihren Sohn wiedersah. Der lachte sie aber trotz aller Schmerzen an: »Mutter, wir haben gesiegt, und das da heilt schon. Wenn ich nur wüßte, wo Raoul wäre!«
Vorläufig kam der lange Student in die Kammer und in Raouls Bett, der dritte wurde noch unten untergebracht; es war auch ein junger Bursch, doch ihn hatten die feindlichen Kugeln zu schwer getroffen, er war nur in das Haus gekommen zu einem friedlichen Sterben.
Herr von Steinberg mußte, so voll das Haus schon war, im Bäckerhause im Quartier bleiben, bis seine leichte Wunde geheilt war. Er war froh darüber, denn alles war überfüllt, und es war schwer, nur ein Bett zu finden. Er benutzte die Zeit, [S. 171] um nach seinem Sohn und nach Raoul zu forschen. Joachim sei gefallen, sagten ihm seine Kameraden; das Regiment aber, bei dem Raoul stand, war wirklich, wie der Student gesagt hatte, weitergezogen. Jemand in den Lazaretten während dieser schlimmen Tage zu suchen, war fast unmöglich, Meister Käsmodel aber wußte einen guten Führer. Karl Wagner, der um seines Gebrechens willen nicht hatte mitziehen können, hatte sich als Pfleger gemeldet. Der kleine Schreiber war auch einer von jenen, deren stilles Heldentum unbemerkt bleibt; ihm dankte nur mancher erlöste Blick der Verwundeten, deren Leiden er nach Kräften milderte. Mit Hilfe dieses treuen Freundes von Raoul gelang es dem Freiherrn wirklich, seinen Sohn zu finden. Er lag mit vielen andern in der Kirche von St. Nikolai, er hatte eine schwere Wunde im Rücken erhalten. Mit einer kleinen Abteilung war er bereits am Morgen des 16. Oktober in einen Hinterhalt gefallen und von rücklings niedergeschossen worden, die große Schlacht war dann an ihm vorübergerauscht, er war gar nicht zum Kampf gekommen.
»Ich habe nicht einmal meinen Säbel gezogen, Vater,« klagte er bitter, als der Freiherr ihn fand, »so mußte ich fallen, so, ich, ein Steinberg, so ruhmlos untergehen.«
»Es kann in dieser Zeit nicht jeder sich als Held hervortun, mein Junge,« tröstete ihn der Vater, »du hast deine Pflicht getan, was willst du mehr? Bist du ausgezogen um des Ruhmes willen, oder weil des Vaterlandes Not dich bewegte?«
Da schwieg Joachim, nur sein schweres Stöhnen verriet dem Vater, wie sehr doch das heiße, junge, ehrgeizige Herz litt.
Im Bäckerhause war inzwischen Platz geworden, und Meister Käsmodel holte sich eines Tages selbst Joachim aus dem Spital, [S. 172] und Herr von Steinberg dankte es ihm warm, denn in den Spitälern rafften Fieber und andere ansteckende Krankheiten viele hinweg, und Joachims Wunde war schwer, sie bedurfte langer, sorgsamer Pflege. Joachim sträubte sich nicht, er fühlte wohl, wie gut es ihm war, daß er aus der kalten, von Fieberdünsten erfüllten Kirche herauskam, aber als er dann in Raouls Kammer, in des Vetters Bett lag, Gottlieb Käsmodel als Stubengenossen, da brach er in ein wildes Weinen aus. Er kam sich auf einmal tief, tief gedemütigt vor: er, der von Heldentaten geträumt hatte, mußte hier in dem Hause liegen, über dessen Bewohner er oft so hochmütig gespottet hatte, und die ihm nun so viel Liebe und Güte erwiesen.
Die Meisterin wollte mitleidig trösten, der Freiherr bat sie aber: »Lassen Sie ihn jetzt allein, er wird schon zu sich kommen.« Das klang schmerzlich, und Joachim hörte es wohl, und er schämte sich seiner kleinlichen Empfindungen, er wurde aber wieder einmal nicht Herr über sich selbst.
Man ließ ihn allein, nur Gottlieb schaute von seinem Bett aus unverwandt zu dem neuen Kameraden hinüber. Also das war der Joachim, auf den er aus lauter Freundschaft für Raoul oft heftig gescholten hatte! Jetzt fühlte er aber gar keinen Groll gegen ihn, und so sagte er aus tiefstem Herzen heraus: »Heul' nur feste weiter! Als Raoul mich in die Scheune geschleppt hatte, und ich von drinnen das Geknatter hörte, da habe ich auch geheult vor lauter Wut, weil ich nicht mehr dabei sein konnte, nachher habe ich aber gesungen!«
Joachim hob ein wenig den Kopf, ganz jäh überkam ihn plötzlich das Bewußtsein, daß er nur einer unter vielen war, daß Tausende litten wie er. »Du bist Gottlieb,« murmelte er [S. 173] und fand das brüderliche Du, das Gottlieb angeschlagen hatte, selbstverständlich. »Wie bist du verwundet worden?«
Gottlieb stützte sich ein wenig auf seinen Arm und erzählte. »Ich hatte ja gedacht, mich würde der Blücher mindestens selbst loben; aber weißt du, ich hab's schon in Breslau gemerkt, daß man auch nicht mehr ist wie — wie 'n einzelnes Brot im vollen Backofen.«
Ein Lächeln ging über Joachims bleiches Gesicht, dann schloß er aufseufzend die Augen: der andere hatte recht, aber ja, er hatte auch gedacht, Blücher selbst oder York der Eiserne müßten seinen Heldenmut anerkennen.
Da klang wieder Gottliebs Stimme zu ihm herüber: »Erzähl' doch, wie war's bei dir, oder bist du zu schwach?«
»Nein,« murmelte Joachim sich zusammennehmend, »aber ich habe nicht viel zu erzählen. Immer habe ich einen Posten auf verlorener Stelle gehabt, habe Wache stehen müssen und dergleichen, habe alles nur von ferne gesehen. Nun sollten wir drankommen, hier bei Leipzig, sollten einen gefährlichen Ritt machen und einen wichtigen Punkt besetzen. Kaum sind wir ausgeritten, da fühle ich ein Sausen, einen heftigen Schmerz — und schon lag ich am Boden; ich hörte nur Schreien, Schießen, dann verlor ich die Besinnung, auf einem Karren erwachte ich wieder. Das war alles!«
»Na, ich danke,« rief Gottlieb, »Wache stehen während einer Schlacht ist kein Zuckerbrot, und fallen muß jemand; wärst du's nicht gewesen, hätte es einen andern getroffen. Weißt du, als ich so fuchswild und wütend in der Scheune lag und mich nicht rühren konnte, da habe ich gedacht: Na, all die Wut, all die langen, langen Stunden, — schließlich einer muß es leiden, da war [S. 174] ich es eben, und fürs Vaterland war es auch. Gesiegt haben wir doch, und dabei waren wir!«
»Erzähl mir von Raoul,« bat Joachim plötzlich, und dann lag er still mit geschlossenen Augen und ließ sich von dem Vetter erzählen, wie sich der so tapfer durchgeschlagen hatte als Schreiberlein und dann nicht nach Paris gewollt hatte. Wenn Gottlieb auf Raoul kam, dann fand er so leicht kein Ende, und er hätte wohl noch lange erzählt, wenn die Mutter nicht gekommen wäre und Ruhe geboten hätte.
»Kranke brauchen Schlaf,« sagte sie. Und Gottlieb schloß auch gehorsam die Augen. Er fand trotz der Wunde bald Ruhe; es lag sich so gut nach all den harten Kriegslagern in der stillen Kammer des Vaterhauses. Aber Joachim lag lange, lange noch wach; Fieber und Schmerzen peinigten ihn qualvoll, und doch dachte er zum erstenmal nicht an sein Leid, sondern an den großen errungenen Sieg, und eine tiefe, heilige Freude kam über ihn, und Gottliebs Wort klang in ihm nach: »Fürs Vaterland war es auch!«

Nach der großen, blutigen Schlacht auf Leipzigs Feldern kam der ersehnte Friede immer noch nicht über die Lande, nur zog sich der Krieg nach Frankreich hin. Der Marschall Vorwärts überschritt in der Neujahrsnacht den Rhein, und am 31. März zogen, nach mancher blutigen Schlacht auf Frankreichs Boden, die verbündeten Heere in Paris ein, und auch dort begrüßte das Volk den Kaiser von Rußland und den König von Preußen als seinen Befreier. Napoleon wurde seines Thrones für verlustig erklärt, nach Elba gebracht, und am 30. Mai kam der erste Friede von Paris zum Abschluß. Die Völker atmeten auf; für eine Weile war Ruhe eingekehrt, und niemand ahnte, daß noch ein schweres Ringen bevorstand, ehe sich für viele Jahre der Friede über die Lande breiten konnte.
Von den Steinbergs kam nur Raoul nach Paris. Sein Oheim blieb bei den Truppen im Lande, und Joachim konnte nicht mehr mitziehen. Raoul hatte sich tapfer geschlagen, hatte einige leichte Wunden davongetragen und war auf dem Schlachtfeld zum Leutnant befördert worden. Trotz allem Siegesjubel ringsum war ihm das Herz aber doch schwer, als er an einem [S. 176] der ersten Apriltage durch die Straßen von Paris ritt. Ihm fehlte jede Nachricht von den Freunden daheim, er wußte nicht, was aus Gottlieb geworden war, nichts von allem, was nach den heißen Tagen bei Leipzig geschehen war. Er hatte sich nach dem Palais des Grafen Turaillon, seines Oheims, erkundigt, denn auf einmal sehnte er sich darnach, das Haus zu sehen, in dem seine Mutter ein paar Kinderjahre verbracht hatte. Vor dem zierlichen, im Rokokostil erbauten Schlößchen, das inmitten eines weiten Gartens lag, dessen Wege von hohen Taxuswänden begrenzt wurden, stand ein preußischer Soldat Wache; ein paar hohe Offiziere bewohnten jetzt das Haus. Als Raoul einen vorbeieilenden Diener nach dem Besitzer fragte, erhielt er zur Antwort, daß der Graf schon lange auf dem Lande weile, er sei im Groll vom Hofe Napoleons geschieden.
Träumerisch schaute Raoul durch das offenstehende Tor in den Garten hinein und dachte: Ich könnte jetzt der Erbe von allem sein! Aber kein Bedauern überkam ihn, daß er es nicht war, und seine Armut dünkte ihn nicht schwer zu tragen. Er freute sich aber über des Onkels Scheiden von Napoleons Hof, und fast bedauerte er, daß er ihn nun nicht sehen konnte: er war doch der geliebten Mutter Bruder. Wie er so in Sinnen verloren stand, kamen zwei junge Offiziere aus dem Haus heraus. Sie schauten ihn prüfend an, und der eine rief überrascht: »Da ist er doch, wir haben hier doch recht gesucht!«
Erstaunt sah Raoul auf, und er mußte erst ein paar Sekunden nachsinnen, ehe er in dem langen, blonden Menschen Arnold von Berkow wiedererkannte. Er wich unwillkürlich zurück, ihm kam der Gedanke an die erlittenen Kränkungen, und sein Gesicht wurde finster. Doch der andere kümmerte sich nicht darum, er [S. 177] streckte ihm freimütig die Hand hin: »Wir haben dich gesucht, Raoul, wie eine Stecknadel, den ganzen Feldzug durch. Vor ein paar Tagen hatte ich von Achim einen —«
»Lebt er?« rief Raoul rasch.
»Ja, er lebt,« sagte Arnold von Berkow und schob seinen Arm in den Raouls. »Komm mit, ich erzähle dir alles. Laß die alte, dumme Feindschaft ruhen, wir Tugendbündler waren damals recht dumme Jungen, und Gottliebe hatte recht: du warst der Verständigste von uns allen, du wärst der beste Tugendbündler gewesen. Übrigens, ich trage seit Wochen einen Brief von Gottliebe an dich in der Tasche; die Mariellen denken, im Krieg trifft man sich wie auf den Gassen von Langenstein.«
»Und mich kennst du wohl gar nicht mehr?« fragte der andere, »war doch auch ein Tugendbündler!«
»Oswald Hippel,« rief Raoul, »doch wo ist Fritz —?«
»Der blieb bei Leipzig,« sagte Arnold trübe, »da sind so viele geblieben. Es ist fast ein Wunder, wenn man noch jemand wiederfindet. Aber dein Gottlieb lebt!«
»Er lebt?« Raouls Augen leuchteten. »Sag, woher du es weißt!«
»Kommt alles nach und nach, und Gottliebes Brief bekommst du auch. Die hat geschrieben, sie ist mir ewig böse, wenn ich dich nicht ausfindig mache. Aber was will der Kerl da?«
Ein hagerer, verkommen aussehender, zerlumpter Mensch drängte sich an die jungen Leute heran und flehte: »Ein armer Landsmann bin ich, halbverhungert.«
»Neumann,« rief Raoul von Steinberg und starrte dem Bettler ins Gesicht. Eine fliegende Röte huschte über dessen Wangen, scheu sah er den fremden Offizier an, es war ihm [S. 178] wohl nicht angenehm, bei seinem Namen genannt zu werden. »Paul Neumann,« sagte Raoul noch einmal, der seinen einstigen Peiniger gleich erkannt hatte.
Auch der hatte nun Raoul erkannt. Erschrocken taumelte er zurück, und ganz plötzlich kehrte er sich um und rannte mit schnellen Schritten wie gejagt davon, die Straße entlang, um eine Ecke herum, und noch ehe die drei die Sache recht erfaßt hatten, war er verschwunden. »Ich erzähl' euch auch nachher von ihm,« sagte Raoul, »ihn trieb wohl sein schlechtes Gewissen weg. Er war einer von Napoleons Bewunderern, das scheint ihm aber nicht gut bekommen zu sein.«
»Nein,« meinte Oswald Hippel, »jämmerlich genug sah er aus!«
Die drei sprachen aber nicht weiter von der Begegnung, sie hatten sich Wichtigeres zu erzählen, und bald saßen sie so einträchtig wie nie vorher in Arnolds Quartier, und der berichtete, daß sie das Palais des Grafen bereits zum drittenmal aufgesucht hätten, weil sie hofften, Raoul würde sich dort nach seinem Oheim erkundigen. »So wunderbar ist unser Zusammentreffen also nicht,« sagte Arnold, »viel wunderbarer ist's, daß die Steinbergs und Käsmodels sich zusammengefunden haben, und daß Joachim in deinem Bett gesund geworden ist.«
»Joachim?« fragte Raoul überrascht, »ist er bei Leipzig verwundet worden?«
Arnold erzählte, in dem großen Wirrsal nach der Schlacht habe er Joachim nicht gesehen, aber später in Frankfurt Herrn von Steinberg getroffen und von diesem alles erfahren. Er habe auch vor kurzem erst Briefe aus der Heimat erhalten. Joachim war wieder in Hohensteinberg und Gottlieb mit ihm, sie mußten [S. 179] sich beide noch von einem sehr langen, schweren Siechtum erholen und hatten beide nicht mehr zu ihren Regimentern zurückkehren können.
Gottlieb in Hohensteinberg! Es kam Raoul fast wie ein Traum vor, und dann ergriff ihn eine solche Sehnsucht, alles zu wissen, von allem einzeln zu hören, daß er Arnold mit einer förmlichen Flut von Fragen überschüttete. Der rief in heller Verwunderung: »O Raoul, so hast du früher nie reden können!«
»Habt ihr mich denn reden lassen?« antwortete der halb lachend, halb traurig, »aber nun laß mich dafür nicht warten, erzähle, erzähle!«
»Ich glaube, du sagst wie Gottliebe, du platzt vor Neugier,« erwiderte Arnold und begann ausführlich zu erzählen, was er von den Steinbergs wußte, von Joachims Verwundung, auch wie Gottlieb aufgefunden wurde.
»Armer Joachim,« sagte Raoul ernst, »er ersehnte den Ruhm und ist nun nie so recht dabei gewesen! Doch was schreibt Gottliebe? Du sagtest doch, es wäre ein Brief von ihr für mich da?«
»Da, du Nimmersatt!« Arnold reichte ihm den Brief, und Raoul erbrach ihn rasch und las: »Lieber, böser Raoul, das ist nun der dritte Brief, den ich an dich schreibe, immer denke ich, einen mußt du doch erhalten, und einmal mußt du mir antworten. Wir haben alle viel Sorge um dich, und Großmutter sagte oft, als sie jetzt krank war: Könnte ich Raoul nur einmal noch sehen! Jetzt reden wir noch mehr von dir, seit Joachim wieder da ist und Gottlieb mitgebracht hat. Achim sagte gestern zu mir: Ich wollte jetzt, Raoul wäre mein Freund. Es war sehr schlimm bei uns, weil alle Leute so arm sind und wir so viele, viele Sorgen hatten, aber als wir von den Siegen hörten, da [S. 180] wurden wir alle froh. Ich wollte aber doch, der Krieg wäre bald zu Ende und der Vater käme heim und du, Raoul, und es würde nie, nie mehr Krieg. Wenn Achim und Gottlieb davon erzählen, muß ich immer weinen, und weißt du, ich war einmal so dumm und wollte mitziehen, das hätte ich doch nicht fertig gebracht. Hier sind alle gesund, nur die Großmutter ist viel krank gewesen. Sie lassen dich alle grüßen, sie sehnen sich alle nach dir. Ich bete jeden Abend für dich. Ach Raoul, möchtest du doch gesund bleiben und bald wiederkommen!
Deine Base Gottliebe.«
Raoul war beim Lesen an das Fenster getreten, nun ließ er den Brief sinken und starrte auf die belebte Straße von Paris hinab. Er sah aber nichts von all dem bunten, fremdartigen Leben da unten, er war mit seinen Gedanken weit, weit weg, und eine große Sehnsucht überkam ihn nach dem Vaterland, nach den Menschen, die er lieb hatte. Er reckte sich und breitete die Arme aus: »Ach ja, es wäre gut, wenn es erst Frieden würde!«
»Und wir daheim,« rief Arnold von Berkow, und Oswald nickte: »Ich wär's zufrieden, bei Gott, es wäre gut.«
Die drei verlebten als gute Kameraden in Paris viele Stunden miteinander, bis endlich der Tag kam, da auch sie heimwärts ziehen konnten, zurück in das befreite Vaterland.

In Hohensteinberg war mit der Nachricht, daß endlich Friede geschlossen war, die rechte Sommerfreude eingekehrt. Endlich hatten sie alle wieder einmal Zeit, sich an dem Blühen, Wachsen und Reifen ringsum zu freuen, und auf den Feldern, [S. 181] über die vor zwei Jahren die Heere gestampft waren, wogte jetzt das Korn, und an den Rändern blühten rot und blau friedlich die Sommerblumen.
»Die Ernte steht gut,« sagte Herr von Steinberg froh, als er an einem sonnenhellen Junitag vom Felde heimkam, »es wird hoffentlich ein gutes Jahr werden.«
Die Seinen saßen alle vor dem Schloß und schauten, wie so oft in diesen Tagen, die schattige Allee entlang, und Gottliebe, die auf den Stufen vor dem Hause saß und mit nimmermüden Händen die ersten Frühbohnen schnitzte, sagte einmal wieder: »Ich könnte platzen vor Ungeduld. Warum Raoul nur noch immer nicht kommt!«
Arnold von Berkow und Oswald Hippel waren bereits heimgekehrt, Raoul aber war noch in Leipzig geblieben, und wurde nun jeden Tag auf Hohensteinberg erwartet. Des Posthalters Wäglein stand immer bereit, ihn gleich nach dem Gute hinauszufahren.
Gottlieb Käsmodel lachte. »Ja, mein Leipzig, das zieht halt den Raoul an sich!«
»Du mit deinem Leipzig,« rief Gottliebe schmollend, »sag es doch endlich einmal, daß es in Hohensteinberg schöner ist.«
»Nun geht der Streit schon wieder los. Ihr seid ja schlimmer als Bonaparte,« rief Joachim lachend. Der saß neben der Großmutter auf der Bank. Er war noch immer bleich, war noch immer nicht im Vollbesitz seiner Jugendkraft, aber seine Augen schauten viel heiterer drein, und nicht mehr wie einst überschattete so oft finstrer Trotz sein hübsches Gesicht.
Die andern lachten auch; der Streit zwischen Gottliebe und Gottlieb über die Vorzüge von Stadt und Land wollte nie ruhen, [S. 182] es gab immer wieder ein lustiges, neckendes Wortgeplänkel zwischen den beiden, das ihrer Freundschaft aber nie Abbruch tat.
»Ich bleib' dabei,« rief Liebe schelmisch und warf ihrem guten Kameraden und Namensvetter eine Bohne an die Nase, »daß es auf dem Lande am schönsten ist. Puh, gräßlich muß es sein, in einer dunklen Stadt zu wohnen. Da rennt man immer an die Häuser an, sieht nie Feld und Wald, und wenn man Brot essen will, muß man erst zu Herrn Meister Käsmodel gehen und eins kaufen; wir backen es uns allein!«
»Das ist gerade fein,« rief Gottlobe, »da kann man nicht unversehens einen Scheffel Mehl über den Kopf bekommen, wie ihn mir neulich Jungfer Rosalie übergestülpt hatte. Ich möchte gleich in einer Stadt wohnen.«
»Der Herr Pfarrer soll entscheiden, ob es in der Stadt besser ist als auf dem Lande,« rief Gottliebe und wandte sich bittend dem alten Freunde und Lehrer zu, der just zu ihnen trat. Ihm war das Haar völlig gebleicht in den letzten Jahren, wie Silber lag es aus seinem Haupt, seine Augen blickten mild und gütig wie immer auf die Jugend, die so heiter, den blühenden Blumen gleich, im Sommersonnenglanz dreinsah. »Ich werde nichts vom Lande und nichts von der Stadt sagen,« antwortete der Pfarrer fröhlich, »denn in einer Minute würdet ihr mir doch alle nicht mehr zuhören. Wollt ihr nicht sehen, wer dort kommt?«
Aller Blicke wandten sich der Allee zu. »Raoul!« schrie Gottliebe auf, und die Bohnenschüssel fiel krachend zu Boden, und »Raoul!« tönte es vielstimmig nach. Gottliebe aber raste dem jungen Offizier, der mit raschen Schritten den schattigen Weg entlang kam, entgegen. Doch plötzlich blieb sie betroffen stehen und fragte fast zaghaft: »Bist du das wirklich, Raoul?«
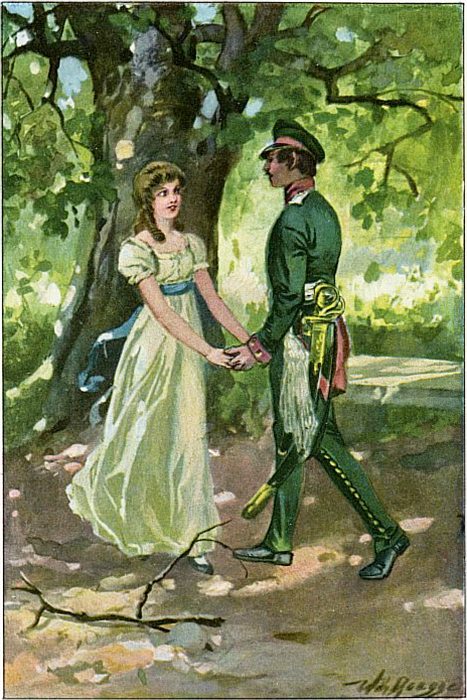
Der ergriff lachend des Bäsleins beide Hände. »Ich bin's, aber fast möchte ich fragen, bist du's, Gottliebe? Du siehst ja beinahe wie — eine junge Dame aus.«
Da hing sich Gottliebe lachend an seinen Arm. »Damit hat's noch gute Wege, aber weißt du, ich freue mich zum Platzen, daß du da bist.«
Raoul kam nicht dazu, ihr eine Antwort zu geben, die andern umdrängten ihn. Der Onkel zog ihn in seine Arme, Frau Maria küßte ihn liebevoll wie einen Sohn, Pfarrer Buschmann schüttelte ihm die Hand, Gottlobe wollte es auch tun, und Gottlieb schrie jauchzend: »Viktoria, Viktoria, er ist da, der Sieger ist da!«
Die Großmutter war still auf der Bank sitzen geblieben. Joachim stand neben ihr, und beide dachten unwillkürlich: Er muß erst die anderen begrüßen. Doch Raoul hatte die Großmutter schon von weitem gesehen, sie zuerst; sie war viel älter geworden und saß nicht mehr so aufrecht wie früher da, und es trieb ihn zu ihr hin. »Großmutter,« sagte er rasch und kniete neben ihr nieder, »verzeihen Sie mir!«
»Raoul, mein Kind, mein liebes, liebes Kind!« Die alte Frau zog des Enkels Kopf an sich. »O, daß ich dich wiedersehen kann, daß mir Gott diese Freude noch gab!« Und ganz leise, nur dem Jüngling verständlich, flüsterte sie: »Verzeih du mir, ich tat unrecht.«
»Das ist ja wie in der Kirche,« brummte Gottlieb vor sich hin. Er schnitt ein wütendes Gesicht vor lauter Rührung und wäre am liebsten davongelaufen, doch etwas hielt ihn, eine Art von Bangigkeit war's: Wie wird er Joachim begrüßen? Er hatte den einstigen Feind seines Freundes so lieb gewonnen, daß er [S. 184] den Gedanken schon unerträglich fand, die beiden könnten sich nicht verstehen.
Es war, als hätte die Großmutter seine Sehnsucht geahnt, sie ergriff Joachims Hand und legte die Hände der Enkelsöhne ineinander. »Ihr habt als Brüder für das Vaterland gekämpft, seid nun auch Brüder im Frieden!«
Raoul sprang auf, und sekundenlang standen die Jünglinge sich Auge in Auge gegenüber. Nur ein kurzes, stummes Zögern und Fragen war's nach alter Feindschaft, altem Haß, dann lagen sie sich in den Armen, und jeder rief froh des andern Namen, daß beide zusammenklangen wie ein Wort.
»Viktoria!« schrie Gottlieb wieder, und Liebe und Lobe fielen jauchzend ein. Aber trotz des Freudenrufes war Gottlieb das Herz auf einmal zentnerschwer geworden: nun gehörte Raoul, sein Raoul, ganz den Steinbergs an, und er hatte ihn verloren. Er wollte sich heimlich davonschleichen, aber Gottliebe sah es und hielt ihn fest. »Lauf doch nicht fort, du gehörst doch jetzt hierher. Was soll denn Raoul denken, wenn du nicht dabei bist?«
Da blieb Gottlieb und merkte es dann bald, daß er den Freund nicht verloren hatte, und daß der mit alter Liebe und Treue an ihm hing. Er brachte ihm Grüße von seinen Eltern und der kleinen Schwester, von Karl Wagner und etlichen Schulgenossen. Meister Käsmodel hatte es schwer in dieser Zeit. Auch ihn hatte der Krieg fast zum armen Manne gemacht, aber er sah darum doch unverzagt und froh der Zukunft entgegen. »Die Hauptsache ist, daß wir frei sind von all der Fremdherrschaft,« hatte er gesagt.
Das sagten viele mit dem braven Meister, wenn auch die [S. 185] fröhlichen, heiteren Friedenspläne, die an dem Tage von Raouls Heimkehr in Hohensteinberg geschmiedet wurden, nicht so bald in Erfüllung gingen. An diesem Tage wollte das Erzählen, Fragen, das Erinnern an vergangene Tage, das Pläneschmieden für künftige Zeiten kein Ende nehmen. Manchmal mahnten die Älteren: »Nun ist's genug! Alles muß nicht an einem Tage erzählt sein,« aber die Jugend fing immer wieder von neuem an mit »Weißt du noch?« und »Wie war dies und das?« So jubelnd, so herzenswarm hatte sich Raoul die Freude über seine Heimkehr nicht vorgestellt. Das Gefühl, so willkommen zu sein, tilgte an diesem Tage auch noch das letzte Restchen Bitterkeit aus seinem Herzen, und zuletzt erzählte er selbst mit lachendem Munde und strahlenden Augen die Geschichte seiner Flucht.
»Aber nun ist alles gut,« sagte Gottliebe leise, froh, »und nun ist Friede, und hoffentlich kommt nie, nie mehr Krieg!«
Doch Gottliebe mußte es erleben, daß noch einmal die Sturmglocken läuteten, daß noch einmal die Völker gegen Napoleon ziehen mußten. Wieder waren zwei Steinbergs dabei und kämpften tapfer. Raoul kehrte bald zurück, da er schon im ersten Gefecht verwundet wurde, Joachim aber konnte diesmal im siegreichen Heere mit in Paris einziehen und als Sieger heimkommen.
Raoul blieb nicht Offizier, wie es sein Oheim gedacht hatte. In dem harten, schweren Krieg, dem furchtbaren Ringen war er zur Erkenntnis gekommen, daß er besser für ein stilles Studium geeignet sei, daß es seiner Neigung mehr entsprach, Wunden zu heilen als Wunden zu schlagen. Er wurde Arzt, der erste der Steinbergs, der diesen Beruf erwählte, und obgleich des Neffen Studium ihm neue Sorgen aufbürdete, ließ ihn der Oheim gewähren. Die Steinbergs gehörten auch zu denen, die um vieles [S. 186] ärmer geworden waren in den langen Kriegsjahren, aber das störte nicht den fröhlichen Mut, mit dem alle schafften. Joachim blieb dem Lande treu. Ein Jahr nur studierte er in Berlin, und die beiden Vettern verlebten eine arbeitsfrohe, freudenreiche Zeit zusammen. Dann kehrte Joachim nach Hohensteinberg zurück. Raoul aber zog wieder einmal in das trauliche Bäckerhaus als willkommener Pflegesohn, um ein paar Semester an der Leipziger Universität zu studieren. Sein Freund Gottlieb schaffte schon tüchtig in der Backstube, und der rastlosen Arbeit von Vater und Sohn gelang es wieder zu erwerben, was der Krieg ihnen genommen hatte. Die verschiedenen Berufe trübten nicht die Freundschaft der beiden, sie blieben Zeit ihres Lebens in treuer Zuneigung verbunden, und als dritter im Bunde gesellte sich immer Karl Wagner zu ihnen, der neidlos sah, daß sein einstiger Schreibgenosse den Beruf erwählen konnte, auf den er hatte verzichten müssen.
Die Ferien verbrachte Raoul dann immer in Hohensteinberg, »zu Hause,« wie er oft dankbar sagte, wenn er wieder mit der Postkutsche über den Langensteiner Markt rollte und mit rüstigem Schritt den wohlbekannten Weg entlang lief.
Dann gab es auch einmal eine Hochzeit auf Hohensteinberg: Lobe wurde Oswald Hippels Frau und eine tüchtige, tätige Landwirtin. Sie behauptete nun kühnlich, auf dem Lande sei es doch am schönsten, sie hatte alle Stadtsehnsucht verloren. Liebe flocht der jüngeren Schwester frohgemut den Brautkranz, sie sah Helene von Berkow Joachims Braut werden und las voll Freude, daß der junge Meister Käsmodel in Leipzig sich eine junge Meisterin gesucht hatte.
Sie selbst blieb noch manches Jahr daheim, war des Hauses [S. 187] Sonnenstrahl, der Mutter erster Minister, des Vaters kluger kleiner Rat und der Geschwister treueste Freundin. Aber dann kam eines Tages Raoul und holte sich Gottliebe zur Frau, holte sie fort von Hohensteinberg gleich in die allergrößte Stadt Deutschlands, nach Berlin. Er hatte es mit unermüdlichem Eifer und Fleiß zu einem tüchtigen Arzt gebracht, sein Name wurde später weit über den Kreis seines Vaterlandes hinaus in hohen Ehren genannt. Doch weil Raoul sie holte, weil sie an Raouls Seite ging, erschien Gottliebe auch die fremde, große Stadt wie eine Heimat.
»Eine rechte Tugendbündlerin fürchtet sich auch nicht vor der Fremde,« sagte sie heiter. Und als Eltern und Geschwister sie fragten: »Wirst du denn wo anders als in Hohensteinberg glücklich sein?« erwiderte sie: »Mit Raoul immer und überall!«
»Raoul ist auch der einzige, dem ich dich gönne,« sagte Joachim am Hochzeitstag, und die Großmutter legte segnend die Hände auf der Enkelin blonden Scheitel: »Einen Besseren konntest du nicht finden!«

Gesperrter Text markiert durch: gesperrt.
Antiqua-Text markiert durch: Antiqua.
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert.
End of the Project Gutenberg EBook of Die Steinbergs, by Josephine Siebe
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE STEINBERGS ***
***** This file should be named 59374-h.htm or 59374-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/9/3/7/59374/
Produced by Norbert H. Langkau, Matthias Grammel and the
Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.