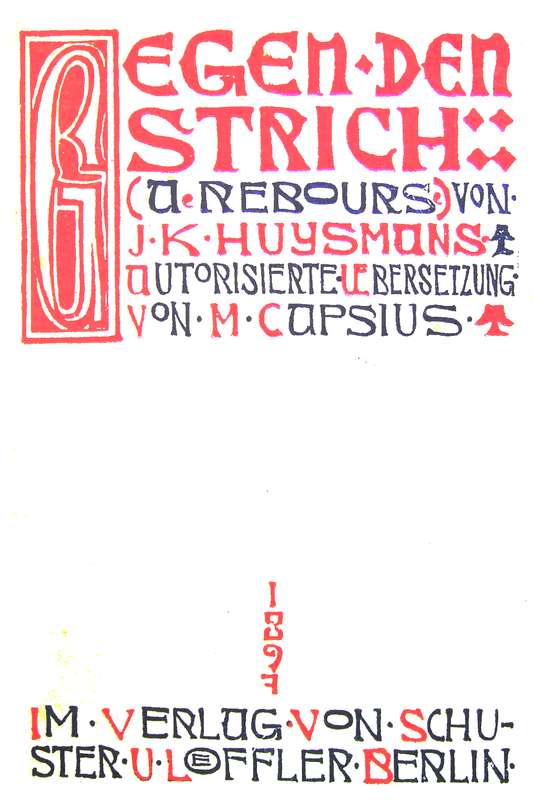
The Project Gutenberg EBook of Gegen den Strich, by Joris-Karl Huysmans This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Gegen den Strich Author: Joris-Karl Huysmans Translator: Marie Capsius Release Date: February 23, 2019 [EBook #58941] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GEGEN DEN STRICH *** Produced by Jens Sadowski and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by The Internet Archive
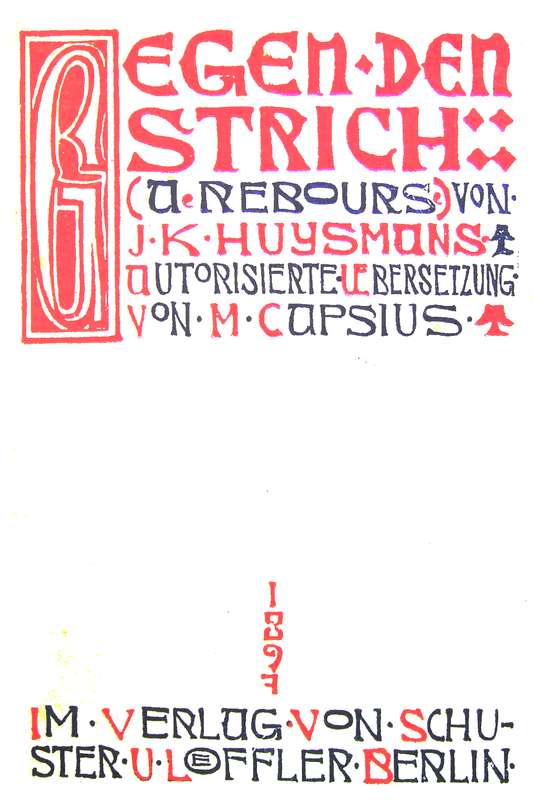
GEGEN DEN STRICH.

(À REBOURS) VON
J. K. HUYSMANS
AUTORISIERTE UEBERSETZUNG
VON M. CAPSIUS
1897
IM VERLAG VON SCHUSTER
U. LÖFFLER BERLIN
Wenn man nach den Porträts urteilen sollte, die im Schloss Lourps aufbewahrt werden, so müsste die Familie Floressas des Esseintes in alten Zeiten aus athletischen alten Haudegen und rauhen Kriegsmannen bestanden haben.
Gedrängt und eingeengt in ihre alten Rahmen, die sie mit ihren breiten Schultern gänzlich ausfüllen, könnten sie uns mit ihren starren Augen, den à la yatagans gedrehten Schnurrbärten und ihrer mit gewölbtem Panzer bedeckten Brust nahezu erschrecken.
So sahen die Ahnen der berühmten Familie des Esseintes aus; die Bilder der Nachkommen fehlen, da die Reihenfolge unterbrochen. Ein einziges Gemälde dient als Mittelglied, Vergangenheit und Gegenwart verbindend. Es war dies ein gar eigentümliches, schlaues Gesicht mit bleichen, schlaffen Zügen, die Backenknochen wie rot punktiert, das Haar wie angeklebt und von Perlen durchflochten, mit ausgestrecktem, geschminktem Hals, der aus den tiefen Falten einer steifen Krause hervortritt.
Schon auf diesem Bilde eines der intimsten Vertrauten des Herzogs von Epernon und des Marquis d’O machten sich die Gebrechen einer untergrabenen Gesundheit wie der Einfluss des lymphatischen Blutes bemerkbar.
Der Verfall dieser Familie hatte zweifellos seinen regelmässigen Verlauf genommen; die Verweichlichung der männlichen Linie war immer mehr hervorgetreten, und als ob die des Esseintes das Werk der Zeit hätten selbst vollenden wollen, hatten sie während zweier Jahrhunderte ihre Kinder unter sich verheiratet, wodurch der Rest ihrer Kraft in naher verwandtschaftlicher Verbindung noch mehr geschwächt worden war.
Von dieser einst so zahlreichen Familie, welche fast das ganze Gebiet von Isle-de-France und Brie bewohnte, lebte nur noch ein einziger Nachkomme, der Herzog Jean, ein schmächtiger junger Mann von dreissig Jahren, blutarm und nervös, mit eingefallenen Backen, kalten stahlblauen Augen, gerader feiner Nase und dürren schmalen Händen.
Durch ein seltsames Vorkommnis der Vererbung hatte dieser letzte Sprosse eine ganz auffällige Ähnlichkeit mit dem Urahnen, von dem er den spitzen Bart von ausserordentlich hellem Blond und den doppelsinnigen Ausdruck des sehr ermüdeten und doch lebendigen Gesichtes hatte.
Seine Kindheit war eine traurige gewesen; bedroht von Skrofeln und heimgesucht von hartnäckigen Fiebern war er dennoch mit Hülfe frischer Luft und Pflege so weit gediehen, dass er die Klippen der Reifezeit überschritt. Von da ab hielten seine Nerven stand, so dass er, die Schwächen der Bleichsucht überwindend, es schliesslich bis zur vollständigen Entwickelung brachte.
Seine Mutter, eine sehr blasse Frau, still und schweigsam, starb an Entkräftung, während sein Vater einer unbestimmbaren Krankheit erlag, als Jean des Esseintes eben sein achtzehntes Jahr erreichte.
Von seinen Eltern war ihm nur eine Erinnerung verblieben, die einer gewissen Furcht, die jedes kindliche Gefühl erstickte. Seinen Vater, der fast immer in Paris lebte, kannte er kaum; und seine Mutter vermochte er sich nur in einem dunklen Zimmer des Schlosses von Lourps unbeweglich auf dem Schlummerbette liegend vorzustellen. Selten nur waren die Gatten vereint gewesen, und von jenen Tagen erinnerte er sich nur noch der gar einförmigen Zusammenkünfte, wo beide sich gegenüber sassen, zwischen sich einen Tisch, auf dem eine grosse Lampe brannte, die durch einen Lampenschirm tief verhängt war, da die Frau Herzogin weder Licht noch Lärm zu ertragen vermochte, ohne einer Nervenkrisis zu verfallen. Hier im Halbdunkel wechselten die Gatten wohl einige wenige Worte, bis der Herzog aufstand, sich verabschiedete und gleichsam erleichtert den nächsten besten Zug nahm, der ihn wieder nach Paris zurückführte. –
Bei den Jesuiten, zu denen Jean zur Erziehung geschickt wurde, fand er wohlwollend freundliche Aufnahme. Die Pater gewannen das Kind, dessen Fassungskraft sie in Erstaunen setzte, recht lieb. Dennoch aber vermochten sie nicht, es trotz all ihrer Bemühungen dahin zu bringen, dass es sich den geregelten Studien widmete. Wohl fand es Geschmack an gewissen Arbeiten, so dass es frühzeitig der lateinischen Sprache mächtig ward, dagegen war es aber unfähig, nur zwei Worte griechisch zu erklären. Es hatte durchaus keine Befähigung für das Erlernen der lebenden Sprachen und zeigte sich geradezu stumpf, sobald man sich bemühte, es in die Anfangsgründe der exakten Wissenschaften einzuführen.
Seine Familie kümmerte sich wenig um Jean; dann und wann besuchte ihn sein Vater auf einen Augenblick in der Pension: „Guten Tag! – Adieu! – Sei artig! Arbeite tüchtig!“ – dies war alles, was er zu hören bekam.
Die Sommerferien verbrachte er im Schlosse von Lourps; doch vermochte seine Gegenwart nicht, die Mutter ihrem träumerischen Zustande zu entreissen. Sie bemerkte ihn oft kaum oder betrachtete ihn während einiger Sekunden mit fast schmerzlichem Lächeln und versenkte sich dann wieder von neuem in die durch dicke Gardinen erzeugte künstliche Nacht.
Die Dienstboten waren langweilig und alt. Der Knabe, sich selbst überlassen, durchstöberte an Regentagen die Bücher der Bibliothek und streifte bei schönem Wetter in der Umgegend umher.
Seine grösste Freude war, in das kleine Thal hinunter zu gehen bis nach Jutigny, einem kleinen Dörfchen, das sich am Fusse der Hügel ausdehnte und aus wenigen kleinen Häusern und Hütten bestand, die, meist mit Stroh bedeckt, gleichsam aus dem Moos herauswuchsen. Er warf sich dann wohl auf die Wiesen im Schatten eines hohen Heuschobers nieder, dem dumpfen Geplätscher der Wassermühle lauschend, oder auch die frische Luft der Voulzie einatmend. Manchmal dehnte er seinen Spaziergang bis zum Torfmoor oder bis zu dem grünen und schwarzen Weiler von Longueville aus, oder er kletterte gar die Anhöhen hinauf, wo der Wind schärfer wehte und von wo er eine schönere Aussicht genoss. An der einen Seite hatte er unter sich das Seine-Thal, das sich in weiter Ferne mit dem Blau des Himmels mischte; an der anderen Seite hatte er den Blick hoch oben gen Westen auf die Kirchen und den Turm von Provins, welche in der Sonne und dem goldigen Luftstaub zu zittern schienen.
Er las oder träumte, in vollen Zügen die Abgeschlossenheit einsaugend, wohl bis zur Dunkelheit; und da er sich immer grübelnd denselben Gedanken hingab, so konzentrierte sich sein Geist, und seine bis dahin noch unbestimmten Ideen begannen vorzeitig zu reifen. Nach den Ferien kam er jedesmal nachdenklicher und störrischer zu seinen Lehrern zurück, denen diese Veränderung keineswegs entging. Scharfsinnig und schlau – durch ihren Beruf daran gewöhnt, die Seelen bis ins Innere zu ergründen – liessen sie sich durch seine aufgeweckte, doch unlenksame Intelligenz durchaus nicht hinters Licht führen. Sie erkannten wohl, dass dieser Schüler niemals zum Ruhme ihrer Anstalt beitragen werde; da aber seine Familie reich war und sich wenig um seine Zukunft bekümmerte, so verzichteten sie vollständig darauf, ihn auf den einträglichen Schulberuf hinzulenken, obgleich er gern diejenigen der theologischen Doktrinen mit ihnen erörterte, welche ihn durch ihre Spitzfindigkeit und ihren Scharfsinn reizten. Dachten sie doch nicht einmal daran, ihn für ihren Orden zu gewinnen; denn trotz aller ihrer Bemühungen blieb sein Glaube schwach, weil sie ihn, aus Klugheit und Furcht vor etwas Unvorhergesehenem, auch ruhig die Studien verfolgen liessen, die ihm eben zusagten, und andere dagegen vernachlässigen, damit ihnen sein selbständiger Charakter nicht durch die Plackereien weltlicher Studienlehrer noch mehr entfremdet werde.
So lebte er vollständig zufrieden, das väterliche Joch der Priester kaum fühlend, indem er mit seinen lateinischen und französischen Studien ganz in seiner Weise fortfuhr, und, obgleich Theologie nicht auf dem Schulplan stand, widmete er sich doch den Lehren derselben, deren Studium er bereits im Schlosse Lourps in der vom Urgrossonkel, dem Domherrn Prosper, dem vormaligen Prior der Ordensstiftsherren von Saint-Ruf, hinterlassenen Bibliothek begonnen hatte.
Als er die Erziehungsanstalt der Jesuiten bei seiner Grossjährigkeit verlassen musste, wurde er Herr seines Vermögens; sein Vetter und Vormund, der Graf von Montchevrel, legte ihm Rechenschaft über seinen Besitz ab. Die Beziehungen zwischen ihnen aber waren nur von kurzer Dauer, da es keinen Berührungspunkt zwischen beiden gab, weil der eine alt, der andere jung war. Aus Neugier, Langeweile und Höflichkeit setzte der junge Herzog dennoch eine Weile den Umgang mit der Familie fort. Er machte einige Besuche in ihrem Palais in der Rue de la Chaise; entsetzlich langweilige Abende, an denen die steinalten Verwandten sich über adelige Familien, heraldische Monde und veraltetes Ceremoniel unterhielten.
Mehr noch als diese vornehmen alten Damen hier erschienen ihm jene hochadeligen Herren, welche die Whisttische umsassen, als verknöcherte, höchst unbedeutende Menschen.
Die Nachkommen der alten Helden, die letzten Zweige der feudalen Geschlechter erwiesen sich dem Auge des Herzogs Jean des Esseintes nach Lüftung ihrer Maske meist nur als vom Katarrh geplagte arg verschrobene Käuze, die immer wieder dieselben faden Redensarten und hundertjährigen Phrasen im Munde führten.
Nachdem er einige Abende in solcher Gesellschaft zugebracht, fasste er den Entschluss, trotz aller Einladungen und Vorwürfe nie wieder dort hinzugehen.
Jetzt fing er an mit jungen Leuten seines Alters und seines Standes zu verkehren.
Einige von ihnen waren mit ihm in der Ordensschule erzogen und hatten durch diese Erziehungsweise gleichsam einen besonderen Stempel aufgedrückt erhalten. Sie gingen regelmässig zur Messe, beichteten zu Ostern, besuchten die katholischen Kreise und hielten jeden ihrer Angriffe, die sie auf schöne Mädchen niedergeschlagenen Auges unternahmen, geheim wie ein Verbrechen. Es waren dies meist geistlos unselbständige Zierpuppen, welche die Geduld ihrer Lehrer ermüdet hatten, die aber trotzdem ihren Wünschen soweit nachgekommen waren, sie in der menschlichen Gesellschaft als gehorsame und fromme Wesen hinzustellen.
Die andern, meist Schüler der Staats-Gymnasien, waren weniger Heuchler, sondern im allgemeinen freier, aber sie waren weder interessanter noch aufgeweckter als jene. Sie liebten die Vergnügungen jeder Art, waren grosse Freunde der Operette und des Turfs, waren an jedem Spieltisch zu finden, ihr Vermögen auf Pferde und Karten verwettend.
Nach Verlauf eines Jahres war der junge Herzog dieser Gesellschaft müde und überdrüssig. Ihren Ausschweifungen sich hinzugeben, die sie ohne Unterscheidung, ohne fieberhafte Vorbereitung, ohne wirkliche Wallung und Aufregung des Blutes und der Nerven durchmachten, erschien ihm mehr als flach und geradezu gemein.
Nach und nach zog er sich daher von ihnen zurück und schloss sich den Litteraten an, bei denen er mehr geistige Verwandtschaft zu finden und sich wohler zu fühlen hoffte. Dies aber führte nur neue Enttäuschungen mit sich, denn er war empört, ihre kleinlichen und rachsüchtigen Urteile zu erkennen, ihre banale Unterhaltung und ihre widerlichen Streitigkeiten zu hören, wonach der Wert eines Werkes einfach nach der Zahl der Auflagen und dem Ertrag des Verkaufes bemessen wurde.
Er lernte zu gleicher Zeit die Freidenker wie die Prinzipienreiter des Bürgerstandes kennen, Leute die alle Freiheit beanspruchten, um die Meinungen der andern zu ersticken; habsüchtige, schamlose Puritaner, deren Bildung er noch geringer schätzte als die des ersten besten Eckenstehers.
Seine Menschenverachtung nahm immer mehr zu; er erkannte, dass die Menschheit zum grossen Teil aus leeren Prahlhänsen und Dummköpfen besteht, so dass er die Hoffnung aufgab, bei anderen wahre Seelengrösse oder reinen Hass zu entdecken. Er verzichtete darauf, einer Fassungskraft zu begegnen, die sich wie die seine in einer arbeitsamen Abgeschlossenheit gefiel, oder in einem Schriftsteller oder Gelehrten den scharf durcharbeiteten Geist zu finden, der sich dem seinen anschliessen konnte.
Er fühlte sich nervös und mehr als unbehaglich, war von der Flachheit der Ideen, die man gegenseitig austauschte, angewidert, und wurde wie die Leute, von denen Pierre Nicole sagt, dass sie überall empfindlich und gereizt seien. Es kam so weit, dass er sich fortwährend seine Haut aufritzte. Geradezu unerträglich litt er bei der Lektüre patriotischer oder sozialer Thorheiten, die jeden Morgen von den Zeitungen unter die Leute gebracht und mit denen die ehrsamen Leser abgespeist wurden.
Er begann schon von einer abgeschiedenen Thebaïde, einer komfortablen Wüstenei, einer unbeweglichen und angenehm durchwärmten Arche zu träumen, wohinein er sich vor der wachsenden Flut des schon mehr unmenschlichen Blödsinns zu flüchten gedachte.
Eine einzige Leidenschaft, das Weib, hätte ihn von dieser allgemeinen Verachtung, welche ihn erdrückte, zurückhalten können, aber diese Saite war ja leider auch verbraucht.
Hatte er doch an dieser Fleischestafel mit dem launenhaften Heisshunger eines Menschen gelagert, der an krankhafter Esslust leidet, und dessen Gaumen bald abgestumpft und übersättigt ist. Während der Zeit, in der er mit den Junkern verkehrte, hatte er an ihren tollen Gelagen teilgenommen, bei denen trunkene Dirnen sich zum Nachtisch die Kleider lüften und mit dem Kopfe, wenn nicht unter, so doch auf dem Tische liegen. Selbstredend war er hinter den Coulissen gewesen; er hatte es mit Schauspielerinnen und Sängerinnen versucht und ausser der den Frauen angeborenen Dummheit die rasende Eitelkeit elender Künstlerinnen zu ertragen gehabt; er hatte mit galanten, ihrer Schönheit wegen berühmten Frauenzimmern in Verbindung gestanden und gewaltiges Geld an gewisse Agenturen bezahlt, wofür er sehr zweifelhafte Vergnügungen genossen, um sich schliesslich übersättigt und dieses gleichförmigen Luxus, dieser erkünstelten Zärtlichkeiten überdrüssig, in die untersten Schichten der Gesellschaft zu stürzen. Hier hoffte er seine nimmersatte Gier durch den Kontrast neu aufstacheln und seine schlummernde Sinnlichkeit durch die aufreizende Unreinheit des Elends wieder anfachen zu können.
Doch was er auch versuchen mochte, ein ungeheurer Weltschmerz drückte ihn nieder. Er gab dennoch den Kampf nicht auf. Er nahm seine letzte Zuflucht zu den gefährlichen Liebkosungen der Virtuosinnen; seine Gesundheit wurde schwach und seine Nerven zermürbten mehr und mehr. Sein Nacken wurde empfindlich und seine Hand fing schon zu zittern an. Allerdings hielt er sie noch gerade, sobald er einen schweren Gegenstand ergriff, doch war sie kraftlos, sobald er etwas Leichtes, zum Beispiel ein Glas zu Munde führen wollte.
Die Prognose der Ärzte beunruhigte ihn. Es war Zeit, diesem Leben Einhalt zu thun und auf jene Experimente zu verzichten, die nur die letzten Kräfte raubten. Während einiger Zeit verhielt er sich ruhig; aber sein Gehirn erhitzte sich bald von neuem und rief ihn wieder zu den Waffen. Wie die jungen Mädchen in der Reife ein Verlangen nach allen möglichen aufreizenden Dingen empfinden, kam er dahin, sich ganz absonderlich sinnliche Freuden und Genüsse auszumalen und sich solchen hinzugeben. Dies aber war der Anfang vom Ende. Übersättigt und erschöpft von allem verfielen seine überreizten Sinne einer Art Lethargie – das sichere Anzeichen eines herannahenden Unvermögens.
Er kam dann wieder von seinen Verirrungen ernüchtert, entsetzlich ermattet zurück, ein Ende herbeisehnend, vor dem die Feigheit seines in Sinnlichkeit versunkenen Charakters zurückschauderte.
Seine Idee, sich irgendwo fern von der Welt niederzulassen, sich gleichsam in einem Winkel einzunisten und wie ein Kranker zu leben, der die Strasse mit Stroh bedecken lässt, um den Lärm des unerbittlichen Lebens zu dämpfen, wurde immer stärker in ihm.
Zudem war auch der Zeitpunkt gekommen, einen Entschluss zu fassen, denn seine Vermögensverhältnisse erschreckten ihn. Den grössten Teil seines Erbgutes hatte er thörichterweise längst vergeudet, und der Rest steckte in Ländereien, die ihm lächerlich wenig einbrachten.
Er entschloss sich daher, Schloss Lourps zu verkaufen, wohin er doch nicht mehr ging, und wo ihn keine Erinnerung und kein Bedauern fesselte; er liquidierte ebenfalls seine andern Güter, kaufte sich Staatspapiere und machte sich in solcher Weise ein jährliches Einkommen von 50,000 Franken. Er behielt ausserdem noch eine ansehnliche Summe zurück, die er für den Kauf und die Einrichtung des Häuschens bestimmte, in welchem er in völliger Stille und Zurückgezogenheit leben wollte.
Er suchte die Umgegend von Paris ab und entdeckte ein kleines Häuschen hoch oben in Fontenay-aux-Roses, das billig zu verkaufen war, weil es an einem entlegenen Platze ganz ohne Nachbarn in der Nähe der Feste lag. Sein Traum erfüllte sich, denn in diesem Orte, der wenig von Parisern heimgesucht ist, war er ziemlich sicher, die gewünschte Zurückgezogenheit zu finden. Die Schwierigkeit der unzuverlässigen Verbindung mittels Eisen- und Pferdebahn, die am Ende des Städtchens stationiert waren, und die gingen und kamen, wie es ihnen passte, beruhigte ihn sehr. Wenn er an diese neue Existenz dachte, die er sich daselbst gründen wollte, empfand er eine grosse Freude, und dies um so mehr, als die Wohnung ziemlich weit vom Seineufer entfernt lag, so dass ihn der Menschenstrom selbst nicht erreichte, während er dennoch in der Nähe der Hauptstadt verblieb, so dass ihm seine Zurückgezogenheit nicht gerade fühlbar wurde.
Er schickte die Maurer in das neu erstandene Haus, und eines Tages, ohne irgend jemand etwas von seinen Plänen zu verraten, verkaufte er sein Mobiliar, entliess seine Diener und verschwand, ohne seine Adresse zu hinterlassen.
Mehr als zwei Monate vergingen noch, bevor sich Herzog Jean in die stille Zurückgezogenheit seines Häuschens in Fontenay vergraben konnte. Einkäufe aller Art nötigten ihn, noch eine Weile in Paris zu verbleiben und die Stadt oft von einem Ende bis zum andern zu durchlaufen.
Lange hatte er nachgeforscht und gegrübelt, ehe er die neue Wohnung endlich den Tapezierern überlassen konnte. –
Vormals, da er noch schöne Frauen zu sich kommen liess, hatte er ein Boudoir nach seiner Angabe einrichten lassen, wo sich inmitten kleiner geschnitzter Möbel aus hellem japanischen Kampferholz unter einem Zelt von indischem Rosa-Atlas der nackte Körper beim künstlichen Wiederschein des bauschigen Stoffes noch zarter färbte.
Jenes Gemach, dessen grosse Spiegel sich beständig reflektierten und so eine ganze Reihe von Rosa-Boudoirs darstellten, war bei den Damen der galanten Welt sehr berühmt gewesen; denn es machte ihnen grosses Vergnügen, ihre Nacktheit in dieses sanfte Inkarnat zu tauchen, wie auch den starken Duft der Möbel einzuatmen.
So hatte er unter anderem aus Hass und Verachtung seiner Kindheit unter dem Plafond dieses Boudoirs einen kleinen Käfig aufgehängt, in dem ein kleines Heimchen zirpte, wie er’s oft in der Asche der hohen Kamine im Schlosse Lourps gehört, während jener langen stillen Abende, die er bei seiner Mutter zubringen musste; und die Erinnerung daran, wie an das Alleinsein in seiner traurigen Jugend stieg in wirrem Durcheinander vor ihm auf. Bei den Bewegungen des Weibes, welches er liebkoste, und dessen Geschwätz oder Lachen seine Vision verscheuchte und ihn plötzlich in die Wirklichkeit versetzte, – in diesem so weltlichen Boudoir entstand ein Kampf in seiner Seele, ein Bedürfnis, alle die erlittenen Trübsale zu rächen, eine Wut, durch schändliche Gemeinheiten die Familienerinnerungen zu besudeln, das rasende Verlangen, auszukeuchen auf diesem Menschenleib, bis zum letzten Tropfen die wahnsinnigsten der sinnlichen Verirrungen auszukosten.
Dann wieder einmal, wenn der Spleen ihn packte und wenn bei nassem Herbstwetter der Widerwille gegen sein Heim und gegen den trüben wolkenschweren Himmel draussen ihn erfasste, dann flüchtete er sich an das verborgene Plätzchen, bewegte leise den Käfig und beobachtete, wie derselbe sich rings herum unzählige Male wiederspiegelte, bis es seinen trunkenen Augen endlich vorkam, als ob der Käfig sich nicht mehr bewegte, dass aber das ganze Boudoir schwanke und sich drehe wie in einem sanften rosa Walzer.
Ein anderes Mal, als Jean des Esseintes sich wieder durch seine Sonderbarkeit auszeichnen wollte, hatte er ein Möblement nach seltsamem Geschmack zusammengestellt. Er teilte seinen Salon in eine Reihe von Nischen, die alle verschieden ausgeschmückt waren und die miteinander vereinigt werden konnten. Es waltete hier eine tolle Übereinstimmung von freundlichen und düstern, von zarten und krassen Farben. Dann liess er sich in einer dieser Nischen nieder, deren Dekoration ihm am besten mit der Eigenart des Werkes, welches er gerade las, zu harmonieren schien.
Schliesslich hatte er noch einen hohen Saal herrichten lassen, in dem er seine Lieferanten empfing. Sie mussten sich nebeneinander in eine Art von Kirchenstühlen setzen. Hier bestieg er eine hohe Kanzel, von der herab er ihnen eine Predigt über die Eitelkeit und das Geckentum der Welt hielt. Er forderte von hier aus seinen Schuhmacher und Schneider feierlich auf, sich aufs genaueste nach seinem päpstlichen Schreiben hinsichtlich des Schnittes zu richten, wobei er sie mit einem pekuniären Kirchenbann bedrohte, so sie nicht die in seinem väterlichen Ermahnungsschreiben und seinen Encykliken gegebenen Anweisungen buchstäblich zur Ausführung brächten.
So erlangte er bald den Ruf eines höchst excentrischen Menschen, den er dadurch zu krönen suchte, dass er sich Anzüge aus weissem Sammt anfertigen liess; wie er auch Westen aus Goldbrokat trug und statt der Krawatte einfach einen grossen Veilchenstrauss in den weiten Ausschnitt seines Hemdes steckte. Dann gab er den Litteraten oft grossartige Diners, unter anderm ein Trauerdiner nach dem Muster des achtzehnten Jahrhunderts, um ein ganz unbedeutendes kleines Missgeschick, das ihm zugestossen, klassisch zu feiern.
Der Esssaal war ganz schwarz ausgeschlagen. Er führte nach dem völlig umgestalteten Garten hinaus, dessen Alleen zu diesem Zweck mit feinem Kohlenstaub bestreut waren; das kleine mit Basaltstein umrandete Wasserbecken war mit schwarzer Tinte gefüllt, die Gebüsche bildeten Fichten und Cypressen. Die Mahlzeit wurde auf einem schwarzen Tischtuch serviert, auf dessen Mitte sich Blumenkörbe, mit Veilchen und Skabiosen gefüllt, befanden. In hohen Kandelabern brannten grünliche Flammen, und Wachskerzen in Armleuchtern erhellten den Saal. Ein unsichtbares Orchester spielte Trauermärsche, und die Gäste wurden von nackten Negerinnen, bekleidet mit Pantoffeln und kleinen Strümpfen aus Silbergewebe, die mit glänzenden Kügelchen besäet waren, bedient.
Man ass von Tellern mit schwarzem Rande: Schildkrötensuppe, russisches Schwarzbrot, reife türkische Oliven, Kaviar, Seebarben (ein im Süden von Frankreich sehr beliebtes Gericht), Wildpret in schwarzer Sauce, so schwarz als wär’s Lakritzensaft und Stiefelwichse, Trüffelpurée, Schokoladenpudding, dem dann ganz dunkle Blutpfirsiche, blauschwarze Trauben, Maulbeeren und schwarze Kirschen folgten. Man trank aus dunklen Gläsern die Weine von Limagne und Roussillon, von Tenedos, Val de Peñas und Porto und labte sich schliesslich nach dem Kaffee mit Nussschnaps, Kwas, Porter und Stout.
Die Einladungen zu diesem Diner waren auf Papier mit breitem, schwarzem Trauerrand geschrieben. – –
Aber diese Extravaganzen und Tollheiten, in denen er früher seinen Ruhm suchte, hatten sich erschöpft.
Heute gedachte er nur mit Verachtung jener kindischen Albernheiten und veralteten Prahlereien, jener absurden Kleidung und seltsamen Ausschmückungen seiner Wohnung. Jetzt beabsichtigte er, sich einfach ein bequemes Heim zu seinem persönlichen Vergnügen zu schaffen und nicht das Staunen anderer zu wecken. Er hatte jetzt nur vor, sich eine ruhige, wenn auch barocke Wohnung einzurichten, die sich für seine künftige einsame Lebensweise am besten eignen sollte.
* *
*
Als das Haus in Fontenay von seinem Architekten schliesslich hergestellt und nach seinen Wünschen und Plänen eingerichtet war, und als ihm nur noch die innere Ausschmückung zu erledigen übrig blieb, da stellten sich ihm die ersten Schwierigkeiten in den Weg.
Das was er wollte, waren nämlich Farben, welche beim Lampenlichte Stich hielten. Ob sie bei Tage hart oder unschön, war ihm gleich, da er die Nacht zum Tage zu machen gedachte, da er sich sagte, dass man dann erst ganz allein sei, und der Geist erst wirklich bei der näheren Berührung der Schatten der Nacht belebt und erregt werde. Er fand eine gewisse Befriedigung darin, sich ganz allein in einem grossen, hell erleuchteten Raume aufzuhalten, während alles um ihn herum wie ausgestorben war.
Sorgfältig überlegend wählte er die Farben.
Blau wird bei Licht ein ungewisses Grün; und wenn es Kobalt oder Indigoblau ist, so wird es schwarz aussehen; ist es hell, so verändert es sich in grau, und ist es blau wie der Türkis, so nimmt es eine trübe eisige Färbung an, es sei denn, dass man es mit einer anderen Farbe mischt; sonst kann man es kaum in einem Raum verwerten. Andererseits nimmt das Eisengrau ebenfalls eine unfreundlich schwere Färbung an; Perlgrau verliert seine Zartheit und verwandelt sich in schmutziges Weiss; Braun wirkt trübe und erkaltend; und was Dunkelgrün, Kaisergrün und Olivengrün anbelangt, so hat es denselben Nachteil wie Dunkelblau und verschmilzt mit Schwarz; bleiben also nur noch die blassgrüneren Farben, wie Pfauengrün, dann Zinnober, die Lackfarben, hier aber verjagt das Licht das Blau und lässt das Gelb hervortreten, welches wieder einen unnatürlich verschwommenen Ton annimmt.
Es war auch nicht daran zu denken, Lachsfarbe, Maisgelb oder Rosenrot zu nehmen, denn diese weichen Farben standen im Widerspruch mit den Gedanken seiner Abgeschiedenheit; unmöglich war ebenfalls Veilchenblau, da es bei Licht verschwimmt und das Rot darin allein des Abends hervortritt, doch was für ein Rot! Dick und klebrig! Es schien ihm ausserdem überflüssig, zu dieser Farbe seine Zuflucht zu nehmen, denn wenn man ein wenig Santonine einmischt, so erscheint es violett; diese Farbe ist nicht leicht zur Wandbekleidung zu verwenden.
Er nahm daher von diesen Farben Abstand, und so blieben ihm nur noch drei übrig: Orangegelb, Citronengelb und Rot.
Er zog das Orangegelb vor, indem er durch sein eigenes Beispiel die Wahrheit einer Theorie bestätigte, welche er im Übrigen für mathematische Richtigkeit erklärte: nämlich, dass eine Harmonie zwischen der sinnlichen Natur eines Menschen, der wirklich Künstler ist, und der Farbe existiert, welche sein Auge besonders lebhaft sieht.
Wenn man die grosse Menge beiseite lässt, deren grobe Netzhaut weder die eigenartige Harmonie der Farben bemerkt, noch den geheimnisvollen Reiz ihrer Abstufungen und ihrer Zusammenstellung kennt; wenn man gleichfalls die Bürger-Philister beiseite lässt, welche unempfänglich für die Pracht und den Sieg der starken kräftigen Nuancen sind, und um sich nur auf diejenigen zu beschränken, deren Augen durch Litteratur und Kunst verfeinert sind, so erscheint es zweifellos, dass das Auge desjenigen, der Ideales träumt und der Illusionen bedarf, gewöhnlich eine Vorliebe für Blau und dessen Abstufungen, sowie für die lila und perlgraue Farbe habe, vorausgesetzt, dass diese Nuancen weich und verschwommen bleiben und nicht die Grenze überschreiten, wo sie in ein bestimmtes Violett und scharfes Grau übergehen.
Diejenigen aber, die frei und ungebunden leben, kräftige Sanguiniker, starke energische Menschen sind, gefallen sich meistens in schimmernden Farben, wie Rot und Gelb, wie sie auch die Zimbelschläge des Zinnobers und der Chromfarben lieben, die sie blenden und berauschen.
Die geschwächten und nervösen Menschen dagegen, deren sinnlicher Appetit nach Speisen sucht, welche scharf gewürzt sind, – die Augen dieser hektischen, überreizten Naturen lieben fast alle die krankhaft aufregende Farbe mit täuschendem Glanze, mit scharfem, unruhigem Wechsel: das Orangegelb.
Die Wahl, welche der Herzog Jean treffen würde, liess also kaum Zweifel zu; dennoch aber entstanden neue Schwierigkeiten, denn wenn auch das Rot und Gelb sich bei Lichte glänzend bewährten, so geschieht das nicht immer bei ihrer Zusammenstellung. Das Orangegelb verschärft und verwandelt sich oft in Dunkelrot oder gar in Feuerrot.
Bei Kerzenlicht versuchte er alle seine Farbenzusammenstellungen und entdeckte eine, welche gleich zu bleiben und sich nicht den Anforderungen zu entziehen schien, die er an sie stellte. Nachdem diese Vorkehrungen beendet waren, bemühte er sich, so viel es eben möglich war, für sein Arbeitszimmer die orientalischen Farben und Teppiche zu vermeiden, die prahlend und gewöhnlich geworden sind, seit Parvenüs sie sich in den grossen Modemagazinen zu herabgesetzten Preisen leicht verschaffen können.
Nach reiflicher Überlegung entschloss er sich dazu, die Wände wie seine Bücher mit Saffian-Leder mit breitgedrückten Narben oder mit satiniertem Kap-Leder bekleiden zu lassen.
Als das Getäfel derartig geschmückt war, liess er die Leisten und Gesimse mit dunkler Indigofarbe und einer blauen Lackfarbe bestreichen, so, wie sie die Wagenbauer für das Äussere der Wagen verwenden; und der etwas gewölbte Plafond, ebenfalls mit Saffian-Leder bezogen, öffnete sich wie ein ungeheures rundes Fenster, eingefasst von orangegelbem Leder: ein kreisförmiges Himmelszelt von königsblauer Seide, in dessen Mitte silberne Seraphine mit ausgebreiteten Flügeln schwebten.
Er hatte richtig kalkuliert: Das Getäfel veränderte sein Blau nicht, es wurde gehalten und erwärmt durch das Orangegelb, welches ebenfalls Farbe hielt, unterstützt und belebt durch den kräftigen Zug der blauen Farben.
Was die Möbel anbetrifft, so hatte Herzog Jean keine allzu grosse Mühe, da der einzige Luxus dieses Zimmers nur aus Büchern und seltenen Blumen bestehen sollte; er begnügte sich damit, an den Wänden Bücher- und Fachschränke aus Ebenholz aufzustellen, indem er sich für später vorbehielt, die frei gebliebenen Zwischenräume mit einigen Bildern und Zeichnungen zu schmücken. Dann liess er den getäfelten Fussboden mit Fellen von wilden Tieren belegen. In der Nähe eines grossen massiven Tisches aus der Mitte des 15. Jahrhunderts standen tiefe Lehnstühle und ein altes Kirchenpult aus Schmiedeeisen – eines jener antiken Chorpulte, auf welches ehemals der Diakonus das Chorbuch gelegt, und auf dem jetzt einer der schweren Folianten des Glossarium mediae et infimae latinitatis von dem Gerichtsschreiber du Cange stand.
Die Fenster, mit Scheiben aus bläulichen Flaschenböden von rissigem Schmelz und Goldrand, schnitten die Aussicht auf das Land ab und liessen nur ein gedämpftes Licht eindringen; sie wurden ausserdem mit Vorhängen aus alten Messgewändern verhängt, deren dunkles, fast rauchiges Gold sich in einem matt rotgelben Gewebe verlor.
Und endlich noch befand sich auf dem Kamine, dessen Bekleidung ebenfalls aus einem prachtvollen florentinischen Messgewand hergestellt war, zwischen zwei Monstranzen aus vergoldetem Kupfer byzantischen Stils, welche der alten Abtei Bois-de-Bievre entnommen waren, eine wunderbar schöne Messtafel mit drei getrennten Fächern von ausserordentlicher Zartheit; unter dem Glas ihres Rahmens sah man ferner auf Pergament in entzückender Messbuchschrift kopiert und mit kostbarer Ausmalung versehen drei Werke von Baudelaire: zur Rechten und Linken Sonette mit dem Titel „der Tod der Verliebten“, „der Feind“ – und in der Mitte in Prosa: „Any where out of the world“.
Nach dem Verkauf seiner Güter nahm Herzog Jean die alten verheirateten Dienstleute zu sich, welche seine Mutter gepflegt und die zu gleicher Zeit dem Amte als Verwalter und Kastellane in Schloss Lourps vorgestanden hatten, das bis zur Feststellung des gerichtlichen Verkaufs unbewohnt und leer geblieben war.
Er liess das Ehepaar nach Fontenay kommen. Sie waren an die Thätigkeit der Krankenwärter, an die Regelmässigkeit, mit der von Stunde zu Stunde die Arzeneien verabreicht wurden, wie an das starre Schweigen des Klosterslebens gewöhnt. Ohne mit der Aussenwelt im geringsten zu verkehren, verblieben sie stets in geschlossenen Zimmern hinter verschlossenen Fenstern.
Dem Mann wurde die Reinigung der Zimmer und das Einholen übertragen, die Frau mit dem Kochen beauftragt. Er überliess ihnen den ersten Stock des Hauses, doch mussten sie dicke Filzschuhe tragen. Er liess Windfänge vor den gut geölten Thüren anbringen und ihre Fussböden mit dicken Teppichen belegen, so dass er ihre Schritte über seinem Kopfe nicht hörte.
Er verabredete ebenfalls mit ihnen eine gewisse Art zu klingeln und bestimmte die Bedeutung der einzelnen Klingelzeichen nach ihrer Kürze und Länge; bezeichnete auf seinem Schreibtisch den Platz, wo sie jeden Monat das Rechnungsbuch hinlegen mussten – kurz er richtete sich so ein, dass er nicht oft genötigt war, sie zu sehen.
Ebensowenig wollte er, da die alte Dienerin manches Mal am Hause vorüber gehen musste, um aus einem kleinen Schuppen Holz zu holen, dass ihn ihr Schatten störe, welcher dann durch die Scheiben seiner Fenster fiel. Er liess ihr daher ein besonderes Kostüm aus flandrischer Seide mit weisser Mütze und niedergeschlagener breiter schwarzer Kapuze anfertigen, in der Art, wie sie die Frauen des Beguinenklosters in Gent tragen.
Wenn der Schatten dieser Kopfbedeckung in der Dämmerung an seinen Fenstern vorüberglitt, so gab er ihm das Gefühl, dass er sich in einem Kloster befinde. Es erinnerte ihn an die stillen frommen Dörfer, die toten und versteckten Stadtviertel einer thätigen und lebhaften Stadt.
Er regelte und stellte auch die Stunden der Mahlzeiten fest, die übrigens wenig gewählt, vielmehr überaus einfach waren, denn die Schwäche seines Magens erlaubte ihm nicht, verschiedene oder schwere Gerichte zu geniessen.
Um fünf Uhr im Winter, beim Herannahen der Dunkelheit, nahm er ein leichtes Frühstück ein, welches aus zwei Eiern, kaltem Fleisch und Thee bestand. Um elf Uhr hielt er seine Hauptmahlzeit; manchmal trank er etwas Kaffee, Thee oder Wein während der Nacht, und gegen fünf Uhr morgens naschte er wohl noch ein paar leichte Sachen, worauf er sich schlafen legte.
Er nahm diese Mahlzeiten, deren Anordnung und Reihenfolge ein für alle Mal zu Anfang jeder Jahreszeit festgesetzt wurde, an einem Tisch in der Mitte eines kleinen Zimmers ein, welches von seinem Arbeitszimmer durch einen ganz mit dickem Stoff ausgeschlagenen Korridor getrennt und ganz hermetisch verschlossen war, so dass weder Geruch noch Lärm in die beiden andern Gemächer dringen konnte.
Dieses Esszimmer glich einer Schiffskajüte mit gewölbtem Plafond, im Halbkreis mit Balken, Wänden und Fussböden aus hellem Fichtenholz versehen, mit dem kleinen, runden, ins Holz eingelassenen Fenster, das der Luftöffnung an den Seiten eines Schiffes nicht unähnlich war.
Gleich japanischen Schachteln, von denen die eine immer in die andere hineinpasst, war dieser Raum vom Architekten in einen grösseren eingeschaltet, der als eigentlicher Esssaal erbaut war.
Dieser hatte zwei Fenster, eines unsichtbar durch eine leichte Bretterwand den Blicken entzogen, das aber durch eine Feder nach Wunsch niedergelassen werden konnte, damit frische Luft durch die Öffnung eindringe, um die Fichtenholzkajüte cirkuliere und sich hier verbreite. Das andere sichtbare Fenster befand sich grade gegenüber dem runden Kajütenfensterchen in der Holzbekleidung, jedoch zugesetzt durch ein grosses Aquarium, welches den ganzen Raum zwischen dem kleinen runden und dem wirklichen Fenster in der Mauer ausfüllte. Das Tageslicht drang also durch das grosse Fenster, durch das Wasser und schliesslich durch das runde Fenster in die Kajüte.
Wenn dann der Samowar auf dem Tische dampfte und die Sonne im Herbste unterging, so rötete sich das Wasser im Aquarium trübe und gläsern und warf einen leichtfeurigen Schimmer auf das helle Getäfel.
Nachmittags manchmal, wenn der Herzog Jean zufällig wach war und aufstand, setzte er den Betrieb der Wasserröhren welche das Aquarium leerten, in Bewegung, und liess es sich wieder von neuem mit frischem Wasser füllen. Indem er dann einige Tropfen farbiger Essenz hineinthat, erzeugte er grünliche und gelbliche, milchweisse oder silberne Färbungen, wie die natürlichen Gewässer je nach der Farbe des Himmels, der mehr oder minder starken Glut der Sonne, oder des nahenden Regens erscheinen, mit einem Wort: wie es die Jahreszeit der Atmosphäre verursacht.
Er bildete sich dann ein, in dem Zwischendeck einer Brigg zu sein; und neugierig betrachtete er wunderbar gearbeitete Fische, die, aufgezogen durch ein Uhrwerk, vor der Scheibe des runden Kajütenfensters vorbeischwammen und in dem künstlichen Gras hängen blieben. Oder er betrachtete, während er den Theergeruch einsog, mit dem man den Raum besprengt hatte, bevor er ihn betrat, die an den Wänden aufgehängten farbigen Stiche, welche – wie in den Agenturen der Schiffahrtsgesellschaften – Dampfschiffe auf dem Weg nach Valparaiso oder La Plata vorstellten. Oder er besah die eingerahmten Tabellen, auf welchen die Reiseroute der Linie der Postdampfer der Compagnieen Lopez und Valéry, die Frachtgelder, die Häfen des Postdienstes im Atlantischen Meer verzeichnet waren.
Dann, wenn er müde war diese Fahrpläne zu Rate zu ziehen, liess er seine Blicke über die Chronometer und Kompasse schweifen, über die Winkelmesser und Zirkel, die Fernrohre und Karten, die zerstreut auf dem Tisch lagen, auf dem sonst nur ein einziges Buch aufgestellt war, gebunden in Seehundsleder: Arthur Gordon Pyms Abenteuer, welches besonders für ihn auf streifiges Papier reinster Faser gedruckt war, jedes Blatt sorgfältig ausgesucht und mit einer Schwalbe im Wasserzeichen.
Da waren ausserdem Fischereigeräte, durch Lehm gezogene Netze, aufgerollte braune Segel, ein kleiner schwarz gestrichener Anker aus Kork, zu einem Haufen nahe der Thür vereinigt, welche durch einen kleinen ausgepolsterten Flur in die Küche führte, und der ebenso wie der Korridor den Esssaal mit dem Arbeitszimmer verband, um die Gerüche und den Lärm aufzusaugen.
Auf diese Art verschaffte er sich ohne grosse Mühe sofort die augenscheinlichsten Eindrücke einer Seereise. Besteht doch das Vergnügen der Abwechslung im Grunde genommen einzig in der Erinnerung und fast niemals in der Gegenwart, in dem Augenblicke selbst. Er kostete sonach diese Abwechslung in vollen Zügen, mit aller Bequemlichkeit, ohne jede Anstrengung und ohne die sonst unvermeidlichen Verdriesslichkeiten in dieser erdachten Kajüte.
Bewegung schien ihm zudem überflüssig, da ihm die Einbildung leicht die gewohnte Wirklichkeit des Lebens zu ersetzen vermochte.
Nach seiner Ansicht war es nämlich möglich, sich die Wünsche, die für die schwierigsten gelten, im normalen Leben künstlich selbst zu befriedigen und dies mittels Täuschung durch eine genaue Fälschung der erwünschten Gegenstände zu thun. Ist es doch klar, dass jeder Feinschmecker heutigen Tages entzückt ist, wenn er in einem wegen der Vortrefflichkeit seines Kellers berühmten Restaurant die teuren Weine schlürft, welche nach Pasteurs Methode aus leichten billigen Weinen hergestellt sind. Falsch oder echt, diese Weine haben ganz dasselbe Aroma, dieselbe Farbe, dieselbe Blume, und verursachen also auch dasselbe Vergnügen, das man beim Kosten und Geniessen echter und reiner Weine empfindet, die infolge starker Nachfrage schliesslich für Gold kaum aufzutreiben sein möchten.
Es unterliegt nach alledem keinem Zweifel, dass sich diese berauschende Abweichung, diese geschickte Lüge und Täuschung des Geistes in die Welt des realen Verstandes übertragen lassen, und dass man mithin ebenso leicht wie in der materiellen Welt eingebildete Wonnen geniessen kann, die fast in allen Punkten den wirklichen gleichen. Kein Zweifel zum Beispiel, dass man im Notfall dem störrisch langsamen Geiste nachhelfen, beim Lesen einer fesselnd geschriebenen Reisebeschreibung ruhig am Kamin verweilen und sich erfolgreich angenehmen Forschungen hingeben kann. Wie man sich auch – ohne Paris zu verlassen – das wohlthuende Gefühl eines Seebades suggerieren kann, da es ja genügt, sich nach Vigier zu begeben, dessen Bäder mitten in der Seine liegen.
Wenn man dort das Wasser der Wanne salzen lässt und nach der Vorschrift des Arzeneibuches schwefelsaures Sodasalz und Magnesia hinzufügt und ein kleines Ende Kabeltau aus einer Seilerei mitnimmt und dann den Duft, welchen dieses Tau noch bewahrt hat, einsaugt und dabei eifrig Joanne’s Handbuch liest, welches die Schönheiten des Strandes, an dem man sein möchte, beschreibt; und wenn man sich dann schliesslich noch leise von den Wellen schaukeln lässt, welche die Dampfschiffe, die an der schwimmenden Badeanstalt vorbeifahren, in der Badezelle aufwerfen, wenn man das Ächzen des Windes hört, der sich unter den Brücken fängt, und dem dumpfen Lärm der Omnibusse lauscht, die wenige Schritte weiter über Pont-Royal hinwegrollen – ist da nicht die Illusion des Meeres unleugbar da?
Es handelt sich eben nur darum, seinen Geist auf einen bestimmten Punkt zu richten.
Da ist nicht eine ihrer Erfindungen, möge sie für noch so feinsinnig oder noch so grossartig gelten, die das Genie des Menschen nicht zu schaffen imstande wäre! Da ist kein Wald von Fontainebleau, kein Mondschein, welchen nicht eine von elektrischem Licht überflutete Dekoration hervorzuzaubern vermöchte; kein Wasserfall, welchen die Wasserleitungskunst nicht täuschend nachahmen könnte, kein Felsen, der nicht durch Papiermaché herzustellen wäre, keine Blume, die nicht durch besonderen Taffet und zart bemaltes Papier genau so wiedergegeben werden könnte!
Unzweifelhaft hat diese uralte Schwätzerin Natur die gutmütige Bewunderung der wirklichen Künstler erschöpft, und der Augenblick ist gekommen, sie verbessert zu ersetzen, so weit es sich eben durch die Kunst ermöglichen lässt.
Und dann, um ehrlich zu sein: dasjenige ihrer Werke, welches fraglos als das künstlichste gilt, diejenige ihrer Schöpfungen, deren Schönheit nach Aller Ansicht die ursprünglichste und vollkommenste ist, das Weib! Hat der Mensch nicht seinerseits ein ebenso künstliches Wesen voll von Leben geschaffen, welches vom Gesichtspunkt der plastischen Schönheit aus ihr vollkommen gleichwertig ist? Giebt es wohl hienieden ein Wesen, das, in Freuden der Brunst empfangen und mit Schmerzen aus der Mutterschaft hervorgegangen, an Form und Race strahlender und prächtiger sei, als dasjenige der beiden Lokomotiven, die auf der Nordbahn ihren Dienst verrichten?
Die eine, die Crampton, eine entzückende Blondine, mit scharfer Stimme, von hohem, schlankem Wuchs, eingeschnürt in ein glänzendes Kupferkorsett, geschmeidig – nervös wie eine Katze – eine schmucke goldige Blondine, deren aussergewöhnliche Anmut nahezu erschreckt, wenn sie ihre Stahlmuskeln steift und den Schweiss ihrer warmen Schenkel dadurch erhöht, dass sie die ungeheure Rosette ihres zarten Rades in Bewegung setzt und wie rasend an der Spitze des Schnellzuges vorwärts stürmt!
Die andere, die Engerth, eine monumentale, dunkle Brünette mit dumpfen rauhen Tönen, mit stämmigen Lenden, eingepresst in ihren gusseisernen Panzer, ein unförmiges Wesen mit wilder Mähne schwarzen Rauches und mit sechs niedrigen gepaarten Rädern; welche erdrückende Macht, wenn sie die Erde erzittern macht und plump und langsam den schweren Güterzug hinter sich drein schleppt!
Sicherlich giebt es unter den zarten blonden und den majestätischen brünetten Schönheiten keine derartigen Typen zarter Schlankheit und erschreckender Kraft; auch kann man mit Recht sagen: der Mensch hat, in seiner Art, ebenso Gutes geschaffen wie Gott. –
Diese Betrachtungen kamen des Esseintes, wenn ihm der Wind das sanfte Pfeifen der kleinen Eisenbahn zutrug, welche sich wie ein Kreisel zwischen Paris und Sceaux hin und her bewegt.
Sein Haus war ungefähr zwanzig Minuten von der Station Fontenay entfernt; aber die Höhe, auf welcher es stand, und seine einsame Lage liessen nicht den Lärm des gemeinen Lebens bis zu ihm dringen.
Das Dorf selbst kannte er kaum. Durch seine Fenster hatte er eines Nachts die stille Landschaft betrachtet, die sich vor ihm ausbreitete und hinunterzog bis zum Fuss des Hügels, auf dessen Spitze die Batterieen des Gehölzes von Verrières aufgepflanzt sind.
In der Dunkelheit rechts und links stiegen verworrene Massen stufenweise auf, in der Ferne von anderen Batterieen und anderen Forts überragt, deren hohe Böschungen im Mondlicht wie in Wasserfarben mit schimmerndem Silber auf dunklem Himmelsgrund gemalt erschienen.
Zusammengeschrumpft im Schatten der Hügel erschien die Ebene in der Mitte wie mit Mehl bestreut und mit weissem Cold-cream bestrichen. In der warmen Luft, die leise die farblosen Gräser fächelte und würzigen Duft verbreitete, schüttelten die wie mit Kreide übertünchten Bäume im Mondlicht ihr fahles Laubwerk und vergrösserten ihre Stämme, deren Schatten den Gipsboden mit schwarzen Streifen furchten, auf dem die Kieselsteine wie Tellerscherben glänzten. Ihres verkünstelt geschminkten Aussehens wegen missfiel dem Herzog Jean diese Landschaft nicht. Seit dem Nachmittag, den er auf der Suche nach dem Hause im Dörfchen von Fontenay zugebracht hatte, war er niemals mehr am Tage den Weg gegangen. Das grüne Laub dieser Gegend flösste ihm ausserdem kein Interesse ein, bot es doch nicht einmal den zarten melancholischen Reiz dar, welcher der oft rührend kränklichen Vegetation entströmt, die notdürftig zwischen dem Schutt des Weichbildes nahe den Wällen hervorschiesst.
Überdies waren ihm an jenem Nachmittage im Dörfchen einige dickbäuchige Einwohner mit Backenbärten und Leute in Gehröcken mit Schnurrbärten begegnet – Köpfe, die ohne Zweifel der Obrigkeit oder dem Militär angehörten; und seit dieser Begegnung hatte sein Widerwille gegen jedes menschliche Gesicht noch mehr zugenommen.
Während der letzten Monate seines Aufenthaltes in Paris, als er alles überwunden hatte, empört durch die allgemeine Heuchelei und vom Weltschmerz niedergedrückt, war die Überreiztheit seiner Nerven derartig gestiegen, dass sich der Anblick mancher Gegenstände oder Wesen seinem Gehirne so tief einprägte, dass es mehrerer Tage bedurfte, um nur die Spuren davon zu verwischen. Unangenehme Gesichter, die sein Blick auf der Strasse streifte, waren ihm zur wahren Qual geworden.
So litt er entschieden beim Anblick gewisser Physiognomieen, deren hausbackener unfreundlicher Typus ihm wie eine Beleidigung erschienen; es wandelte ihn eine wahre Lust an, diejenigen zu ohrfeigen, welche da langsamen Schrittes mit gelehrter Miene und gesenkten Augen über die Strasse gingen, wie auch jene, die sich in den Hüften wiegen und sich gar wohlgefällig in Spiegelscheiben zulächeln, oder jene anderen wieder, die eine ganze Welt von Gedanken zu bewältigen scheinen, indem sie mit der wichtigsten Miene den albernsten Klatsch und den haarsträubendsten Blödsinn der Tagesblätter verschlingen und einfach wiederkäuen.
Er witterte bei allen eine so eingewurzelte Dummheit, einen solchen Abscheu gegen seine eigenen Ideen, eine solche Verachtung der Litteratur, der Kunst, kurz, was er verehrte, als wäre es ihnen erblich angeboren oder in ihre beschränkten Krämerseelen eingeankert, die, schliesslich nur auf Gaunerei und Geld erpicht, wie alle unbedeutenden und schwachen Geister, nur für niedrige Zerstreuungen der gemeinen Politik eingenommen sind, so dass er wütend nach Hause ging, um sich mit seinen Büchern einzuschliessen.
Kurz, er hasste mit ganzer Kraft die neuen Generationen, diese Vertreter moderner Flegelei, die das Bedürfnis haben, überall in den Speisesälen und Kaffeehäusern laut zu schreien und unverschämt zu lachen, die uns auf der Strasse wüst anrennen, ohne um Verzeihung zu bitten, oder einem auch wohl einen Kinderwagen zwischen die Beine schieben, ohne sich zu entschuldigen oder kaum den Hut zu lüften.
Ein Teil der Büchergestelle, die an den Wänden seines orangegelben und blauen Arbeitszimmers aufgestellt waren, enthielten ausschliesslich lateinische Werke; doch nur solcher Autoren, die von den in der Sorbonne gedrillten Fachgelehrten mit dem Sammelnamen „Dekadenten“ abgethan werden.
War doch die lateinische Sprache so, wie sie Mode war zu jener Zeit, welche die Gelehrten hartnäckig als das grosse Jahrhundert zu bezeichnen belieben, in der That wenig dazu angethan, ihn zu reizen. Jene lackierte Sprache mit ihren berechneten, fast unveränderlichen Wendungen, ohne irgend eine Geschmeidigkeit der Syntax, ohne Farbe, ohne Unterscheidungen. Jene an allen Nähten abgetragene, von holperigen Ausdrücken befreite, wenn auch zuweilen bilderreiche Sprache vermag allenfalls die seichten Redensarten, die unbestimmten Gemeinplätze amtlicher Perrückenstöcke und Laureat-Poeten auszudrücken, erzeugt aber eine solche Langeweile, dass man sich beim Studium ihres Stils fast ins grosse Jahrhundert des französischen Sonnengottes – Ludwigs XIV. – versetzt wähnen dürfte, wo man einzig einer gleichen Kraftlosigkeit und Entmannung begegnet.
Da ist unter andern der sanfte Virgil, den Schulfüchse gern den Schwan von Mantua nennen, wahrscheinlich darum, weil er nicht in dieser Stadt geboren ist. Virgil kam ihm als einer der schrecklichsten Pedanten und unausstehlich langweiligsten Schwätzer vor, den jemals das Altertum erzeugt; was waren denn seine so sauber gewaschenen und herausgeputzten Schäfer, die sich der Reihe nach ganze Töpfe voll gezierter, eiskalter Verse über den Kopf schütten? Vergleicht er seinen Orpheus doch mit einer weinenden Nachtigall! Sein Aristeus, der Sohn des Apollo, ist ein jammernder Bienenzüchter, während sein Aeneas, eine überaus verwaschene schmächtige Persönlichkeit, die mit steifen Gebärden wie ein Schattenbild in dem fadenscheinigen, lose gebundenen und öligen Gedichte umherwandelt. Alles dieses brachte ihn natürlich ausser sich.
Die langweiligen Albernheiten, die diese Gliederpuppen in den Coulissen austauschen, würde er wie die unverschämten Entlehnungen, welche bei Homer, Theokrit, Ennius und Lucrez gemacht sind, selbst nach dem Plagiat, das uns Makrobius als fast wörtliche Abschrift eines Gedichtes von Pisander nachweist, – kurz, all die unaussprechliche Leere seiner als klassisch geltenden Gesänge noch allenfalls ruhig hingenommen haben. Wobei ihn aber wirklich die Gänsehaut überlief, das waren seine sechsfüssigen Verse, dieses wahre Blech, wie eine leere Kanne klingend.
Jene starre Verskunst, der Meisterschmiede des Catull entnommen, phantasiearm, einförmig, vollgestopft mit unnützen Wörtern und Lückenbüssern, eine Anhäufung feststehender Wendungen und dem Homer sklavisch nachgebildeter Epitheta, die schliesslich nichts bezeichnen und nichts zeigen – dieser ganze armselige Wortschwall klanglos platter Vergleiche spannte ihn geradezu auf die Folter.
Es muss noch hinzugefügt werden, dass, wenn seine Bewunderung für Virgil schon mehr als mässig war, der offene Unflat des Ovid noch geringere Anziehungskraft für ihn hatte, wie auch sein Widerwille gegen die ungeschlachte Grazie und das hohle Geschwätz des Horaz, jenes trostlosen Tölpels, der sich mit übertüncht alten Clown-Zoten zierte, schon mehr als grenzenlos war.
Auch Ciceros und Cäsars berühmter Lakonismus vermochte ihn wenig zu begeistern, denn da zeigte sich eine Trockenheit des Redestils, eine Armut des Gedächtnisses, eine unglaubliche Hartleibigkeit.
Somit fand er seine Rechnung weder hier noch dort, ebensowenig bei den Lieblingsschriftstellern, die als Tonangebende falscher Gelehrsamkeit in den Himmel gehoben wurden, wie bei den übrigen allen: Sallust, der weniger farblos als die andern; Titus Livius, der sentimental und schwülstig; Seneka, aufgedunsen und matt; Suetonius, lymphatisch und fiebernd; Tacitus, der nervöseste, obgleich in seiner Kürze der schärfste und der muskulöseste von Allen.
In der Poesie liessen ihn Juvenal trotz seiner zeitweilig gestiefelten und gespornten Verse, Persius trotz seiner geheimnisvollen Zuflüsterungen völlig kalt. Indem er Tibull und Properz, Quintil und Plinius, Statius und Martial gern überging, vermochte ihm Terenz und selbst Plautus, deren Kauderwälsch von neugebildeten Wörtern und zusammengesetzten Diminutiven wimmelte, schon eher zu gefallen; aber die niedrige Komik und das grobe Salz widerten ihn an.
Herzog Jean fing erst beim Lucan an sich für die lateinische Sprache zu interessieren, denn da war sie schon reicher und ausdrucksvoller. Seine sorgfältig gearbeiteten, mit Schmelz bedeckten und mit Juwelen gezierten Verse fesselten ihn; aber diese ausschliessliche Pflege der leidigen Form, dieser Klang hellschreiender Töne, dieser metallische Glanz verdeckte ihm keineswegs die arge Gedankenleere, das Geschwollene und Aufgeblasene.
Der Schriftsteller aber, welchen er wirklich gern hatte und der ihn für immer vom Lesen der tönenden Schriften eines Lucan entfernte, war Petronius.
Dieser war ihm ein scharfsichtiger Beobachter, ein zarter Analytiker, ein vortrefflicher Maler; ruhig, ohne vorgefasste Meinung und ohne Hass beschreibt er das tägliche Leben in Rom, die Sitten seiner Zeit als munterer satirischer Erzähler.
Er zeichnet Thatsachen im richtigen Licht und Verhältnis, er stellt sie in der bestimmten Form und Ordnung fest, enthüllt das Kleinleben des Volkes, seine Erlebnisse, seine Rohheiten wie sein sinnliches Treiben.
Hier ist es ein Inspektor, der im Hôtel garni die Namen der kürzlich angekommenen Reisenden zu wissen verlangt; da sind es verrufene Häuser, in denen Männer um nackte Weiber herumschleichen, während man durch die schlecht schliessenden Thüren der Kammern den Belustigungen der Paare zusieht; dann wieder in den Villen des tollen Luxus und der unsinnigen Pracht übermütigen Reichtums, wie in den armen Herbergen mit ihren durchwühlten Gurtbetten voll Wanzen bewegt sich die Gesellschaft der Zeit: Schurken wie Ascyltus und Eumolpus auf der Suche nach einem unverhofften Fund; alte Knabenschänder im aufgeschürzten Kleide mit weiss und rot bemalten Backen; sechzehnjährige Liederlinge, feist mit gekräuseltem Haar; Weiber, die eine Beute ihrer hysterischen Anfälle werden; Erbschaftsjäger, die ihre Knaben und Mädchen den Ausschweifungen der Erblasser überliefern – alle diese Typen folgen einander auf der Strasse streitend, die Bäder besuchend, sich krumm und lahm schlagend, wie solches wohl in einer Pantomime zu geschehen pflegt.
Und dies mit einer Frische erzählt, in schönstem Kolorit und kräftigem Stil aller Mundarten, die Ausdrücke allen in Rom untergegangenen Sprachen entlehnt, alle Grenzen und alle Fesseln des sogenannten grossen Jahrhunderts überschreitend. Er lässt jeden seinen Jargon reden: die Freigelassenen und jeglicher Bildung baren das Pöbellatein und gemeine Kauderwälsch, die Fremden ihre barbarischen Mundarten, vermischt mit Afrikanisch, Syrisch und Griechisch, und die pedantischen Dummköpfe, wie jenen Agamemnon des Buches, seine gemachte Redeweise zum besten geben. Diese Menschen sind alle mit einem Federstrich gezeichnet; sie lagern um einen Tisch, tauschen den abgestandenen Ideenbrei Trunkener aus und überbieten sich in der Verausgabung verschimmelter Grundsätze und alberner Sticheleien, das Maul stets gegen Trimalchio gerichtet, der sich in den Zähnen stochert, über die Gesundheit seines Innern und seine Blähungen spricht, indem er die Gäste einladet, es sich bequem zu machen und sich ja keinen Zwang anzuthun.
Dieser realistische Roman, dieses aus dem vollen Fleisch des römischen Lebens geschnittene Stück, ohne ängstliche Sorge, wie man darüber urteilen werde, voll von lebendiger Satire, ohne Schielen nach Sitte noch Moral, diese Geschichte, ohne Intrigue, fast ohne Handlung, welche dieses sodomitische Treiben darstellt und mit seltener Feinheit die Freuden und Schmerzen der Liebeleien in farbenprächtiger Sprache malt, ohne dass der Verfasser nur ein einziges Mal in den Vordergrund tritt – sie packte den Herzog Jean, denn er ersah in der Verfeinerung des Stils, in der Schärfe der Beobachtung, in der Festigkeit der Methode eine eigentümliche Ähnlichkeit mit den wenigen modernen französischen Romanen, die er erträglich fand.
Ernstlich bedauerte er, „Eustion“ und „Albutia“ nicht zu besitzen, jene beiden Werke des Petronius, die auf immer verloren sind; aber der Bücherliebhaber in ihm tröstete den Gelehrten, besass er doch die prächtige Ausgabe in Oktav des „Satyricon“ mit der Jahresziffer 1585 und dem Drucker J. Dousa, Leyden.
Von Petronius ab leitete seine lateinische Sammlung in das zweite Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung über, zu dem schwülstigen Phrasenhelden Fronto sowie zu den Attischen Nächten des Aulus Gellius, seinem Schüler und Freund, den er ebenfalls überging, um Halt zu machen bei Apulejus, von dem er eine erste Ausgabe in Folio aufbewahrte, gedruckt zu Rom 1469.
Dieser Afrikaner machte ihm Vergnügen. Die lateinische Sprache zeigte sich in seinen „Metamorphosen“ in ihrem vollen Glanze.
Er öffnete nur noch selten Tertullians „Schutzrede der Christen“ und die „Abhandlung über die Geduld“; höchstens las er einige Seiten aus „De cultu feminarum“, worin Tertullian die Frauen rügt, die sich mit Kleinodien und kostbaren Stoffen putzen und ihnen den Gebrauch von Schönheitsmitteln verbietet, weil sie zu täuschen versuchen, indem sie die Natur zu verbessern und zu verschönern sich bemühen.
Diese Ideen, die den seinigen schnurstracks widersprachen, machten ihn lächeln. Doch die Rolle, die Tertullian in seiner bischöflichen Residenz Karthago spielte, schien ihn zu süssen Träumereien zu verleiten; mehr als seine Werke zog ihn in Wirklichkeit aber der Mann selbst an.
Hatte er doch während der aufrührerischen Zeiten gelebt, heimgesucht von schrecklichen Aufständen unter Caracalla, unter Macrin, unter dem sonderbaren Hohenpriester Heliagabal, dessen Predigten und dogmatischen Schriften, dessen Verteidigungsreden und Auszüge aus den Homilien der Kirchenväter er verfasste, während das Kaiserreich in all seinen Fugen krachte. Mit grösster Kaltblütigkeit lehrt er die fleischliche Enthaltsamkeit, Genügsamkeit beim Mahl und Einfachheit der Kleidung, während zur selben Zeit Heliagabal in Silberstaub und Goldsand herumspazierte, auf dem Kopfe die dreifache päpstliche Krone trug, seine Kleider mit kostbaren Steinen besetzte und, umgeben von Eunuchen, sich mit weiblichen Handarbeiten beschäftigte, sich Kaiserin nennen liess und jede Nacht den Kaiser, den er mit Vorliebe unter Barbieren, Köchen und Zirkusleuten auswählte, wechselte.
Dieser Gegensatz entzückte den Herzog; denn die lateinische Litteratur, unter Petronius zur höchsten Reife gelangt, fing an sich aufzulösen. Die christliche Litteratur brach sich Bahn und brachte mit neuen Ideen nie gebrauchte Ausdrücke und neue Satzbildungen, sowie bislang unbekannte Zeit- und Eigenschaftswörter mit weit hergeholten Bedeutungen, abstrakte Begriffe, die in der römischen Sprache selten angewendet und von denen Tertullian als einer der ersten Gebrauch gemacht hatte.
Alles was nach dem Tode Tertullians von seinen Schülern, dem heiligen Cyprianus, von Arnobius und dem unklaren Lactantius verfasst wurde, war ohne Reiz für ihn. Jene unvollkommene schwerfällige Mache war ein linkischer Rückschritt zum ciceronianisch hochtrabenden Ton. Ihr fehlte jener besondere Duft des vierten wie der folgenden Jahrhunderte, jener Duft des Christentums, der der heidnischen Sprache den Hautgout des Wildprets verliehen hatte, der aber mit der Civilisation der alten Welt gleichzeitig aufhörte.
Ein einziger Dichter, Commodian aus Gaza, vertrat in seiner Bibliothek die Kunst des dritten Jahrhunderts.
Das „Carmen apologeticum“, im Jahre 259 geschrieben, ist eine Sammlung von Sprüchen in den beliebten Hexametern, die hier manchmal gereimt sind und schon an das Kirchenlatein späterer Zeiten erinnern.
Seine überspannt dunklen Verse, voll von Ausdrücken der Tagessprache, von Wörtern ursprünglich verdrehter Bedeutung, fesselten ihn mehr als der reife gesättigte Stil der Geschichtsschreiber: Ammianus Marcellinus und Aurelian Victor, der berühmte Briefschreiber Symmachus und der Kompilator und Grammatiker Macrobius; er zog sie sogar den wirklich skandierten Versen jener buntscheckig herrlichen Sprache vor, wie sie Claudius, Rutilius und Ausonius sprachen.
Waren jene doch damals die Meister der Kunst. Sie erfüllten das untergehende Reich mit ihren Warnungen, der christliche Ausonius mit seinem Cento nuptialis und seiner üppigen Dichtung von der Mosella; Rutilius mit seinen Hymnen zum Ruhme Roms, seiner Verfluchung der Juden und Mönche, der Reisebeschreibung von Italien nach Gallien, in der es ihm gelingt, bestimmte Eindrücke des Gesehenen gut wiederzugeben: Landschaften, die sich zitternd im Wasser spiegeln, aufsteigende Nebel, schwere Wolken, die um die Berge brauen.
Endlich im fünften Jahrhundert Augustin, Bischof von Hippo. Diesen kannte Herzog Jean nur zu gut, denn er ist ja der angesehenste Schriftsteller der Kirche, der Gründer der christlichen Orthodoxie, der den Katholiken als ein Orakel gilt, und vor dem sie sich alle beugen. Diesen öffnete er nicht mehr, obgleich Augustin in seinen „Bekenntnissen“ den Widerwillen gegen das Irdische ebenfalls besungen und in seiner „Gottesstadt“ versucht hatte, das entsetzliche Elend des Jahrhunderts durch Vertröstung auf eine bessere Zukunft zu besänftigen.
Die zweite Hälfte des fünften Jahrhunderts war gekommen, die entsetzliche Zeit, in der die gewaltigsten Stösse die Erde erschütterten.
Die Barbaren verwüsteten Gallien; Rom, der Plünderung der Westgoten preisgegeben, fühlte sein Leben erstarren, sah seine äussersten Grenzen, den Occident und den Orient, sich im Blute wälzend von Tag zu Tag mehr erschöpfen und dem Untergange verfallen.
In dieser allgemeinen Auflösung, diesem Meuchelmorde der Cäsaren, welche rasch aufeinander folgten, in diesem Lärm bluttriefenden Gemetzels, welches sich von einem Ende Europas zum andern wälzte, ertönte ein fürchterliches Hurrageschrei, das allen Unwillen und alles Geheul zum Schweigen brachte.
An dem Ufer der Donau erschienen Tausende von Männern auf kleinen Pferden, eingehüllt in weite Oberkleider von Rattenfell, scheussliche Tartaren mit enormen Köpfen, platter Nase, das Kinn durch Schmarren und Narben entstellt, bartlose, citronengelbe Gesichter stürzten sich vorwärts im gestreckten Galopp, alle Reiche gleichsam in einen Wirbelwind einhüllend und niederreissend.
Alles verschwand in den Staubwolken dieser wilden Reiter wie in Rauch von Feuerbrünsten. Die Finsternis verbreitete sich, und die bestürzten Völker erzitterten, wenn sie diesen entsetzlichen Staubwirbel mit dem Getöse des Donners vorübersausen hörten. Jene Hunnenherde machte Ost-Europa dem Erdboden gleich, stürzte sich auf Gallien, wo sie in den Ebenen von Châlons durch den römischen General Aetius niedergeworfen und im Sturm vernichtet wurde. Die mit Blut überschwemmten Wiesen kräuselten sich wie ein Purpurmeer; zweihunderttausend Leichen versperrten den Weg und brachen den Anlauf dieser aus der Richtung gekommenen Lawine, die wie mit Donnerschlägen in Italien einfiel, wo die zerstörten Städte gleich Heuschobern brannten.
Das weströmische Reich brach unter dem Stoss zusammen; sein mit dem Tode ringendes Dasein, das es stumpfsinnig im Kot hinschleppte, erlosch; es schien überdies das Ende der Welt nahe; die Städte, welche von Attila vergessen, wurden durch Hungersnot und Pest dahingerafft, das Latein schien unter den Ruinen der Welt mit zu versinken.
Jahre vergingen; die barbarischen Idiome fingen an sich zu regeln und wirkliche Sprachen zu bilden. Das Latein, das während der allgemeinen Zerrüttung in die Klöster geflüchtet war, verblieb dort, wie in den Pfarrhäusern; hier und da erstanden einige Poeten frostig und träge: der Afrikaner Dracontius mit seinem „Hexameron“; Claudius Mamertius mit seinen liturgischen Poesien; Avitus von Wien. Dann die Biographen, wie Ennodius, der die Wunder des heiligen Epiphanias erzählt, jenes scharfsichtigen, verehrten Diplomaten, des biederen und umsichtigen Seelsorgers; wie Eugippius, der uns das unvergleichliche Leben des heiligen Severinus wieder vor Augen führt, diesen geheimnisvollen Einsiedler und demütigen Asketen, der den trostlosen, vor Furcht und Schmerz wahnsinnigen Völkern wie ein Engel der Barmherzigkeit erschien; Schriftsteller wie Veranius du Gévaudan, der eine kleine Abhandlung über die Enthaltsamkeit verfasste; wie Aurelian und Ferreolus, die die kirchlichen Satzungen zusammengestellt; Geschichtsschreiber wie Rotherius, berühmt durch ein Geschichtswerk, das aber verloren gegangen ist.
Die Werke der nachfolgenden Jahrhunderte wurden in der Bibliothek des Herzogs Jean spärlicher. Indessen war das sechste Jahrhundert noch durch Fortunatus, Bischof von Poitiers, durch Boëthius, den alten Gregor von Tours, und Jornandes vertreten.
Wenig entzückt von der Schwerfälligkeit der karolingischen Lateiner, wie Eginhart und Alcuin, begnügte er sich als Sprachprobe des neunten Jahrhunderts mit den Chroniken des Anonymus von St. Gallen, des Frechulf und des Regino, mit dem Gedichte von der Belagerung von Paris, verfasst von Abbo le Courbé, mit dem „Hortulus“, mit der Dichtung von Ermold le Noir, die Thaten Ludwigs des Frommen preisend, und einigen nicht zu klassificierenden moderneren Werken ohne Jahreszahl, Werken der Geheimlehre, der Arzeneikunde, der Pflanzenkunde, einzelnen Bänden der Kirchenväterkunde von Migne, welche nirgends mehr zu findende christliche Poesieen enthielten, und mit der Blumenlehre der kleinen lateinischen Poeten von Wernsdorff.
Mit dem Anfang des zehnten Jahrhunderts hörte seine lateinische Bibliothek auf.
Die alten Ausgaben, die Herzog Jean sorgfältig gesammelt hatte, waren hiermit erschöpft, und mit einem jähen Sprunge über Jahrhunderte hinweg leiteten seine Bücher direkt zu der französischen Sprache des jetzigen Jahrhunderts über.
Eines Nachmittags hielt ein Wagen vor dem Hause in Fontenay. Da Herzog Jean keine Besuche empfing und sich selbst der Briefträger nicht einmal in dieser unbewohnten Gegend zeigte, weil er niemals einen Brief oder eine Zeitung zu bestellen hatte, so zögerten anfänglich die beiden alten Dienstboten, nicht wissend, ob sie öffnen durften. Auf das laute Geklingel der Glocke, die mit aller Kraft gezogen wurde, wagten sie es endlich, durch das kleine Schiebfenster, welches in der Thür angebracht war, zu sehen; vor derselben stand ein Herr, dessen ganze Brust vom Hals bis zum Leib mit einem ungeheuren goldenen Schild bedeckt war.
Sie benachrichtigten hierauf ihren Herrn, der am Frühstückstisch sass.
„Ganz richtig, führen Sie ihn herein,“ sagte er – denn er erinnerte sich, dass er vor einiger Zeit einem Edelsteinhändler, der eine schwierige Bestellung für ihn ausführen sollte, seine Adresse gegeben hatte.
Der Herr grüsste und setzte ohne Umstände auf den Boden des Esszimmers seinen Schild nieder, der sich bewegte, sich dann ein wenig erhob, unter dem der kleine schlangenartige Kopf einer Schildkröte hervorlugte, um sich plötzlich wieder erschrocken unter die Schale zurückzuziehen.
Diese Schildkröte war eine phantastische Idee des Herzogs Jean, die ihm einige Zeit vor dem Verlassen von Paris gekommen war.
Eines Tages, da er einen orientalischen Teppich besah und die Reflexe desselben bewunderte, die je nach dem Silberglanz, der über das Gewebe lief, bald aladingelb, bald pflaumenblau leuchteten, sagte er sich, dass es sich nicht übel ausnehmen müsse, etwas Bewegliches auf den Teppich zu setzen, um den Farbenreiz durch einen dunklen Ton zu erhöhen.
Von dieser Idee ganz eingenommen, war er aufs Geratewohl durch die Strassen geschlendert und bis zum Palais-Royal gekommen. Als er hier im Schaufenster bei Chevet eine Schildkröte in einem Bassin bemerkte, da schlug er sich vor die Stirn, wie jemand, dem plötzlich ein Gedanke gekommen.
Er kaufte das Tier, setzte es dann auf den Teppich und sich davor. Lange hatte er das Tier mit halbgeschlossenen Augen aufmerksam betrachtet.
Der Ton des harten Braunes des Rückenschildes verdunkelte die Reflexe des Teppichs, ohne sie zu beleben; der vorherrschende Silberglanz strahlte jetzt kaum und streifte mit seinem kalten zinkfarbigen Ton den Rand dieser harten glanzlosen Schale.
Er biss sich auf den Finger, ein Mittel suchend, diese Missverbindung zu versöhnen und die offenbare Scheidung der Töne zu verhindern, wobei er schliesslich entdeckte, dass seine erste Idee, die darin bestand, die Flammen des Gewebes mit einem darauf gesetzten beweglichen dunklen Gegenstand zu schüren, falsch war. Im Grunde genommen war dieser Teppich noch zu auffällig, zu lebhaft und zu neu. Die Farben waren noch nicht genügend abgestumpft und gedämpft; es handelte sich darum, den Satz umzukehren, die Töne abzuschwächen, sie durch den Kontrast eines glänzenden Gegenstandes zu erlöschen, alles um sich zu erdrücken und goldiges Licht auf das matt silberne zu werfen.
In dieser Weise dargestellt, war die Frage leichter zu entscheiden. Er beschloss infolgedessen, den Panzer der Schildkröte mit einer Goldglasur überziehen zu lassen.
Als das Tier von dem Praktikus, der es in Arbeit gehabt hatte, wieder zurückkam, leuchtete es wie die Sonne.
Anfänglich war Herzog Jean ganz entzückt von der Wirkung; dann kam ihm der Gedanke, dass dieses riesengrosse Schmuckstück bis jetzt nur flüchtig entworfen, und dass es erst vollendet wäre, wenn es mit eingelegten seltenen und kostbaren Steinen besetzt sein würde.
Er wählte aus einer japanischen Sammlung eine Zeichnung, die ein Arrangement von Blumen vorstellte, die von einem dünnen Stengel wie Raketen ausgingen. Er brachte das Muster zu einem Goldschmied, zeichnete eine Einfassung darum, die das Bouquet in einen ovalen Rahmen einschloss, und erklärte dem verdutzten Juwelenhändler, dass die Blätter und die Kelche jeder der Blumen in Edelsteinen ausgeführt und in das Schild des Tieres selbst eingelassen werden sollten.
Die Wahl der Edelsteine war nicht leicht: der Diamant ist zu gewöhnlich geworden, seit die Kaufleute ihn am kleinen Finger tragen; die Smaragde und die Rubinen des Orients sind weniger entwürdigt, aber sie erinnern zu sehr an die grünen und roten Omnibus-Laternen. Was die Topase anbelangt, geglüht oder roh, so sind es nur wohlfeile Steine, der kleinen Bürgersfrau überaus wert, die ihre Schmucksachen noch mit Wohlgefallen in ihren Leinenschrank verschliesst; anderseits hat der Amethyst, obgleich ihm die Kirche den priesterlich-ernsten Charakter bewahrt, in den roten Ohren und an den feisten Händen der Schlächterfrauen, welche sich für einen bescheidenen Preis gern mit schwerfälligem Schmuck behängen, an Wert sehr verloren. Dem Saphir allein ist sein unverletztes Feuer nicht durch spekulative Ausnutzung genommen. Seine Strahlen rieseln wie klares kaltes Wasser und haben sozusagen seinen zurückhaltenden und hochmütigen Adel gegen jeden Schmutz bewahrt. Unglücklicherweise funkeln seine frischen Farben nicht bei Licht; das blaue Wasser geht in sich selbst zurück, scheint einzuschlafen, um erst wieder beim Anblick des Tages aufzuwachen und zu blitzen.
Schliesslich befriedigte nicht einer von diesen Steinen den Herzog Jean; ausserdem waren sie zu civilisiert und zu bekannt. Er liess wunderlichere und seltsamere Steine durch seine Finger gleiten, und zuletzt suchte er eine Serie von wirklichen und künstlichen Steinen aus, deren Mischung eine bezaubernde und überraschende Harmonie hervorbringen sollte.
Er setzte in folgender Weise das Bouquet seiner Blumen zusammen: die Blätter wurden von klarem bestimmten Grün gefasst mit dem Chrysoberill, einem spargelgrünen Edelstein; grünem Chrysolith; dunkelgrünem Olivin. Diese hoben sich von den Zweigen aus Almadin und Ouwarovit ab, einem blauroten Stein, der in kaltem Glanze flimmert, wie etwa das Glimmen des Weinsteins im Innern der Fässer.
Für die Blumen, die strahlenförmig vom Stengel ausgehen, benutzte er bläuliche Aschfarbe; aber er vermied streng den orientalischen Türkis, den man für Busennadeln und Ringe verwendet und der mit der alltäglichen Perle und der abscheulichen Koralle das Entzücken des Kleinbürgertums ist. Dagegen wählte er schliesslich die Türkise des Abendlandes, Steine, die im eigentlichen Sinne des Wortes nur fossiles Elfenbein sind, von einer kupferfarbigen Substanz durchdrungen, wie von schmachtendem Blau erfüllt, undurchsichtig, schwefelhaltig und wie mit Galle gefärbt.
Als dies geschehen, machte er sich daran, die Kelche seiner aufgeblühten Blumen mitten im Strausse einzufassen und für die Blumen, die dem Stengel am nächsten standen, durchsichtige Steine mit gläsern-krankhaftem Glanz, mit fieberhaft scharfem Strahl zu wählen.
Er setzte sie einzig und allein aus indischen Katzenaugen, Cymophanen und saphirartigen Steinen zusammen.
Von diesen drei Steinen ging in der That ein geheimnisvoll-wunderlicher Schimmer aus, der schmerzlich aus dem kalten Grunde trüben Wassers herausgerissen schien: das Katzenauge von einem grünlichen Grau, von schwachen Adern durchzogen, welche sich zu bewegen schienen und jeden Augenblick den Platz wechselten, je nach dem darauf fallenden Lichte; der Cymophan mit dem moirierten Azurblau, das über die milchweisse Farbe hinläuft, die im Innern lebt; der Saphirin, der auf dunkelbraun-schokoladefarbigem Grunde phosphorbläuliche Feuer entzündet.
Der Juwelenhändler machte sich Notizen betreffs der Stellen, in welche die Steine eingesetzt werden sollten.
„Und die Einfassung der Schale der Schildkröte?“ fragte er schliesslich.
Herzog Jean hatte zuerst an einige Opale und Hydrophane, – eine Art Opal, welcher Wasser einsaugt und dadurch durchsichtiger und farbenspielender wird, – gedacht; aber die Verwendbarkeit dieser interessanten Steine ist wegen der Unbestimmtheit ihrer Farben und des Zweifelhaften ihres Feuers zu schwierig. Der Opal hat eine geradezu rheumatische Empfindlichkeit. Das Spiel seiner Strahlen verändert sich je nach der Feuchtigkeit, der Wärme oder Kälte; und was den Hydrophan anbelangt, so blitzt er nur im Wasser und scheint seine Glut zu entzünden, wenn man ihn anfeuchtet.
Zuletzt entschloss er sich zu den Steinen, deren Reflexe sich abwechseln: zu dem Hiazinth von Compostella, einem rötlich-gelben Edelstein; Aquamarin, meergrün; Ballas-Rubin, blassrot; Südermannlands-Rubin, rotgelb. Ihr schwaches Schimmern genügte, um die dunklen Schatten des Rückenschildes zu erhellen und das Blühen der Edelsteine nicht zu beeinträchtigen, welche sie mit einer schmalen Guirlande von unbestimmter Leuchtkraft umgaben. –
Und nun setzte sich Herzog Jean in eine Ecke seines Esszimmers und betrachtete mit Wohlgefallen die im Schatten goldglänzende Schildkröte.
Er fühlte sich vollkommen glücklich; seine Blicke berauschten sich an dem hellen Glanz der Blumenkronen auf goldenem Grund. Dann aber – ganz gegen seine Gewohnheit – stellte sich eine gewisse Esslust bei ihm ein. Er tunkte seine gerösteten Brotschnitte, die mit einer ganz besonderen Butter bestrichen waren, in eine Tasse Thee, eine treffliche Mischung von Si-a-Fayoune, Mo-you-tann und Khansky, gelben Theesorten, die von China nach Russland durch besondere Karawanen geschickt werden, wodurch sie den famosen Kameelduft angenommen haben.
Der Herzog trank diese duftige Flüssigkeit aus dem feinsten chinesischen Porzellan, das man wegen seiner Durchsichtigkeit als Eierschalen bezeichnet. Zu diesen entzückenden Tassen benutzte er nur Bestecke aus altem vergoldeten Silber, das die Vergoldung schon etwas verloren hatte, so dass das Silber unter dem Gold ein wenig zum Vorschein kam und ihm so die Färbung vormaliger Zartheit ganz diskret wiedergab.
Nachdem er einen letzten Schluck genommen, ging er in sein Arbeitszimmer zurück und liess sich durch den Diener die Schildkröte bringen, die in ihrer hartnäckigen Unbeweglichkeit verharrte.
Der Schnee fiel in dichten Flocken. Bei dem Licht der Lampen bildeten sich Eisblumen hinter den bläulichen Scheiben, und der Reif, der in den Flaschenböden der mit Gold besprenkelten Fenster glänzte, glich geschmolzenem Zucker.
Ein tiefes Schweigen hüllte das Häuschen wie in Finsternis erstarrt ein.
Herzog Jean träumte; die brennenden Holzscheite im Kamin erfüllten mit ihrer wärmenden Ausströmung das Gemach; er öffnete halb das Fenster.
Wie ein hoher Vorhang verkehrten Hermelins hob sich der Himmel vor ihm schwarz mit weissen Tüpfchen ab. Ein eiskalter Wind wehte, der den Schneeflug beschleunigte. Der heraldische Vorhang des Himmels kehrte sich bald um und wurde ein wirklich weisser Hermelin, nun wieder schwarz getupft.
Er schloss das Fenster wieder. Der schroffe Wechsel von grosser Hitze und der Kälte des Winters hatte ihn gepackt; er zog sich ans Feuer zurück. Es kam ihm der Gedanke, ein geistiges Getränk zu geniessen, das ihn wieder erwärmte.
Er ging ins Esszimmer, wo ein Wandschrank in der Mauer angebracht war, in dem sich eine Reihe kleiner Tonnen dicht nebeneinander auf kleinen Blöcken von Sandelholz befanden, die alle mit kleinen silbernen Hähnchen am unteren Ende versehen waren.
Er nannte diese Sammlung von Likören seine Mundorgel.
Eine Röhre konnte alle Hähne vereinigen. Wenn das Instrument richtig gestellt war, brauchte er nur auf den Knopf, der in dem Holzwerk verborgen war, zu drücken, um alle Hähne auf einmal aufzudrehen, worauf sich die winzigen Becher, die unter ihnen standen, mit Likör füllten.
Diese Orgel, auf die bezeichneten Stimmen Flöte, Waldhorn, Vox Divina u. s. w. gestellt, war stets zu seiner Benutzung bereit. Herzog Jean trank von diesem und jenem Likör einige Tropfen, spielte sich innere Symphonieen vor, und es gelang ihm, seinem Gaumen ähnliche Genüsse zu verschaffen, wie solche die Musik dem Ohre bereitet. Ausserdem stimmte jeder Likör seiner Ansicht nach mit dem Ton eines Instrumentes überein.
Der trockene Curaçao zum Beispiel mit der Klarinette, deren Töne spitz und weich sind; der Kornbranntwein mit der Hoboe, deren Klang näselt; der Pfefferminz und Anisette mit der Flöte, süss und scharf, schrill und sanft zugleich; das Kirschwasser mit der Trompete; Gin und Whisky erschraken den Gaumen durch ihren schrillen Schall, wie Klapphorn und Posaune das Ohr heftig mitnehmen, während der Weinträberschnaps gleichsam den betäubenden Lärm der Tuba verursacht, und der russische Raky und der Mastic der Mundhaut die Schläge der Zimbel und der Pauke mitteilen.
Er meinte auch, dass diese Vergleiche sich auf Quartett-Saiteninstrumente übertragen lassen, indem unter dem Gaumengewölbe die Geige den alten Cognac vorstellt, berauschend und zart, scharf und spröde, während die Bratsche kräftiger, voller, dumpfer den Rum simuliert; der Magenbitter zerreissend, melancholisch und schmeichelnd wie ein Violoncell erklingt, die Bassgeige dagegen schwer, stark und düster wie ein scharfer alter Bitter wirkt. Man könnte selbst – ein Quintett bildend – die Harfe hinzufügen, die mit einer gleichen Wahrscheinlichkeit die mächtige Kraft und ihre silbernen Klänge, frei und zart wie der Kümmel wiedergäbe.
Diese Voraussetzungen einmal angenommen, war er so weit gekommen, infolge rastloser Versuche auf seiner Zunge stille Melodieen zu spielen, stumme Trauermärsche mit grossem Gepränge aufzuführen, Soli von Pfefferminz, Duette zwischen Bittern und Rum zu hören.
Es gelang ihm so, in seine Kinnbacken wirkliche Musikstücke den Wünschen des Komponisten gemäss zu übertragen, Takt für Takt seine Gedanken, seine Wirkungen, seine Nüancen wiedergebend und durch nahe Verbindungen oder Kontraste der Liköre, durch geschickte Mischungen Accorde erzeugend.
Früher komponierte er seine Melodieen selbst und führte seine Idyllen mit dem gutmütigen Johannisbeerlikör auf, der ihm den perlenden Gesang der Nachtigall in der Kehle trillern machte, oder er sang mit dem sanften Kakao-Chouva die süsslichen Schäferlieder, wie: die Romanzen von Estella und die „Ach! ich sage Ihnen, Mama“ aus der alten Zeit.
Aber heute Abend hatte der Herzog durchaus keine Lust, der Musik zu fröhnen; er begnügte sich damit, einen einzigen Ton auf der Klaviatur seiner Orgel anzuschlagen; er nahm seinen kleinen Becher, den er zuvor einfach mit echtem irländischen Whisky gefüllt hatte und machte es sich in seinem Sessel bequem, ganz langsam diesen aus Hafer und Gerste gegohrenen Saft schlürfend, der seinen Mund mit einem starken Kreosotgeruch erfüllte.
Nach und nach beim Trinken folgten seine Gedanken wieder dem belebten Eindruck seines Gaumens; er erweckte so durch eine fatale Ähnlichkeit von Gerüchen eine seit Jahren verwischte Erinnerung.
Dieser scharfe Karbolduft erinnerte ihn an den gleichen Geruch, der zu einer Zeit, da die Zahnärzte an seinem Zahnfleisch herumarbeiteten, seinen Mund erfüllt hatte.
Einmal auf diesen Weg gebracht, erging er sich zuerst in Träumereien über all die Praktikusse, die er kennen gelernt hatte, er sammelte sich und konzentrierte seine Erinnerung auf einen, dessen seltsame Erscheinung ihm besonders im Gedächtnis verblieben.
Es war vor drei Jahren, als er mitten in der Nacht von einem rasenden Zahnschmerz befallen wurde; er wickelte sich den Kopf ein, stiess in Verzweiflung gegen alle Möbel und rannte wie ein Wahnsinniger im Zimmer umher.
Es war ein schon plombierter Backenzahn und keine Heilung möglich; die Zange des Zahnarztes allein konnte dem Übel abhelfen.
Fieberhaft erwartete er den Tag, entschlossen, die schrecklichsten Operationen zu erdulden, wenn sie nur seinem Leiden ein Ende machen würden.
Sich fortwährend den Mund zuhaltend, fragte er sich, was er thun solle. Die Zahnärzte, die ihn gewöhnlich behandelten, waren reiche Leute, die man nicht so nach seinem Gefallen sprechen konnte; da mussten erst mit ihnen die Besuche und die Stunden der Konsultationen ordentlich verabredet werden. Das war jedoch unmöglich. „Ich kann es nicht länger hinausschieben,“ sagte er sich; und er entschloss sich, zu dem ersten besten zu gehen, zu einem Zahnausreisser gewöhnlichen Schlages, einem jener Leute mit eiserner Faust, welche mit einer Geschwindigkeit ohnegleichen die hartnäckigsten Zahnstümpfe zu entfernen wissen. Diese sind vom frühen Morgen an zu sprechen und bei ihnen braucht man nicht zu warten.
Endlich schlug es sieben Uhr. Er lief aus dem Hause, sich des Namens eines bekannten Technikers erinnernd, der sich „Volkszahnarzt“ nannte und an der Ecke eines Quais wohnte. Er durchrannte die Strassen und biss verzweiflungsvoll in sein Taschentuch, um die Thränen zurückzuhalten.
Er war eben vor dem Hause angelangt, das man schon von weitem an dem grossen schwarzen Holzschilde erkennen konnte, auf dem mit enorm grossen Buchstaben der Name „Gatonax“ gemalt war; in zwei kleinen Glaskästen sah man Zähne in Zahnfleisch aus rosa Wachs sorgfältig aufgereiht und durch eine mechanische Feder aus Draht miteinander verbunden. Er keuchte, der Schweiss trat ihm auf die Stirn und eine wahnsinnige Angst befiel ihn, ein Schauer durchrieselte seine Haut, worauf sich urplötzlich eine Linderung fühlbar machte: er litt nicht mehr, der Zahn that nicht mehr weh.
Wie verdummt blieb er auf dem Trottoir stehen; schliesslich aber stemmte er sich gegen die Angst und kletterte eine dunkle Treppe bis zum dritten Stock hinauf. Da stand er vor einer Thür; ein Porzellanschild mit himmelblauen Buchstaben: es war derselbe Name wie unten an der Thür.
Er zog die Klingel; doch entsetzt durch die Blutauswürfe, die er auf den Treppenstufen bemerkte, wollte er jetzt umkehren, entschlossen, sein ganzes Leben lang Zahnschmerz zu erdulden, als ein Schrei das Treppenhaus erfüllte, der den Entsetzten auf seinen Platz bannte. Im selben Augenblick öffnete sich die Thür und eine alte Frau bat ihn einzutreten.
Die Scham überwand die Furcht. Man führte ihn in das Esszimmer, eine andere Thür ward zugeschlagen, und ein grosser vierschrötiger Mann im schwarzen Gehrock und schwarzen Beinkleidern trat ein und forderte ihn auf, ihm in ein anderes Zimmer zu folgen.
Seine Empfindungen wurden von diesem Augenblicke ab undeutlich. Er erinnerte sich, sich auf einen Sessel neben dem Fenster niedergesetzt und etwas gestammelt zu haben, während er den Finger auf seinen Zahn legte: „Schon mal plombiert ... fürchte, es ist nichts zu machen ...“
Der Mann hob schnell die Auseinandersetzung auf, indem er dem Herzog seinen enormen Zeigefinger in den Mund schob; dann etwas in seinen gewichsten und spitz gedrehten Schnurrbart brummend nahm er ein Instrument vom Tisch, womit er die grosse Szene begann.
Herzog Jean hatte sich krampfhaft an die Lehne des Sessels geklammert und gefühlt, wie etwas Kaltes seine Backe berührte; hierauf hatte er vor den Augen nur Funken gesehen; er wurde von entsetzlichsten Schmerzen erfasst, und so brüllte er, mit den Füssen strampelnd, wie ein wildes Tier.
Man hörte ein Knacken, der Backenzahn war beim Herausziehen abgebrochen; ihm war, als ob man ihm den Kopf abrisse oder den Schädel einschlüge. Er hatte aus Leibeskräften geheult und sich wütend gegen den Mann gewehrt, der sich von neuem auf ihn stürzte, als ob er mit seinem Arm ihm in den Leib dringen wolle.
Der Arzt war nach der zweiten Operation einen Schritt zurückgetreten, hatte den Herzog wieder in den Sitz zurückfallen lassen, worauf er an das Fenster ging, schwer Atem holte und am Ende seiner Zange einen blauen Zahnstumpf hielt, an dem etwas Rotes hing.
Wie vernichtet hatte Herzog Jean eine ganze Schale voll Blut ausgebrochen, mit einer heftigen Bewegung den Zahnstumpf verweigert, welchen ihm die alte Frau, in ein Stück Zeitungspapier gewickelt, darreichte und war davongestürzt, nachdem er zwei Franken gezahlt hatte.
Auf der Strasse war er ganz heiter, wie um zehn Jahre jünger, sich für alles und jedes interessierend. – – –
„Brr!“ murmelte er jetzt, ganz erschreckt von dem Gang, den seine Gedanken genommen hatten.
Er stand auf, um diese Vision zu zerstören, und um in die Wirklichkeit zurückzukehren, fing er an, sich wieder mit der Schildkröte zu beschäftigen.
Sie rührte sich noch immer nicht, er befühlte sie, sie war tot. Sie war an eine ruhige Existenz, an ein demütiges Leben, das sie unter ihrer ärmlichen Schale zubrachte, gewöhnt; sie hatte den glänzenden Luxus, den man ihr aufdrang, den goldglänzenden Überzug, mit dem man sie bekleidet, die Edelsteine, mit denen man ihr den Rücken gepflastert, nicht vertragen können.
Zur selben Zeit, da sich sein Wunsch verschärfte, sich einem hassenswerten Zeitalter von unwürdigen Stockfischen zu entziehen, machte sich das Bedürfnis, keine Bilder mehr zu sehen, welche das menschliche Antlitz darstellten, Bilder solcher Personen, die in Paris nur zwischen ihren vier Wänden herumkrauchen, oder auf den Strassen auf der Suche nach Geld lungern, immer gewaltsamer geltend.
Nachdem er sich mit dem Leben und Treiben seiner Zeit abgefunden, hatte er sich vorgenommen, keine Larven, die ihm nur Widerwillen oder Bedauern einflössten, in seine Zelle einzuführen; er wünschte Gemälde, welche zarte und köstliche Phantasieen alter Zeit und klassischer Verderbtheit vorstellten, die unsern Tagen und Sitten fern liegen.
Er brauchte zum Ergötzen seines Geistes wie zur Freude seiner Augen einige Gemälde, die ihn in eine unbekannte Welt einführen, ihm die Spuren neuer Ideen enthüllen und sein Nervensystem durch hysterische Sensationen erschüttern sollten.
Da gab es einen Künstler vor allen, der ihn zu grosser Begeisterung hinriss: Gustav Moreau.
Zwei seiner Meisterwerke befanden sich in seinem Besitz; und während der Nacht sass er oft träumend vor einem derselben, dem Gemälde der Salome:
Ein Thron, dem Hochaltar einer Kathedrale gleich, stand unter gewaltigen Wölbungen, die aus niedrigen Säulen emporwachsen, ähnlich römischen Pfeilern, glasiert mit bunten Ziegeln, in Mosaik gefasst und mit Lasursteinen und Sardonyxen eingelegt: ein Palast, einer Basilika ähnlich, in muhammedanisch-byzantinischer Architektur aufgeführt.
In der Mitte des Tabernakels, welches den Altar überragte, zu dem einige Stufen in halbrunder Form hinanführten, sass der Tetrarch Herodes, auf dem Kopfe die Tiara, die Beine emporgezogen und die Hände auf den Knieen ruhend.
Sein Gesicht war gelb wie Pergament, alterzerstört und voller Falten; sein langer Bart wallte wie eine weisse Wolke über das Edelgestein, mit dem sein aus Goldstoff gefertigtes und die Brust bedeckendes Gewand besäet war.
Um diese unbewegliche Statue, die in der eigentümlichen Stellung des Hindu-Gottes wie erstarrt dasass, brannten Spezereien, die leichte Rauchwolken verbreiteten und den Glanz der Edelsteine, die in den Thronhimmel eingefügt waren, weckten. Der Dampf stieg höher und verbreitete sich unter den Bogengängen, wo der bläuliche Rauch sich mit dem Goldstaube der hellen Sonnenstrahlen mischte, die durch die Kuppel fielen.
In dieser heissen, von Wohlgerüchen geschwängerten Luft des Tempels steht Salome, den linken Arm gebieterisch ausgestreckt, den rechten gebogen, eine grosse Lotusblume in Gesichtshöhe haltend; sie nähert sich langsam auf den Fussspitzen nach den Klängen einer Guitarre, deren Saiten eine am Boden hockende Frau schlägt.
Das Gesicht andächtig, feierlich, beginnt sie fast erhaben ihren wollüstigen Tanz, der die schlummernden Sinne des alten Herodes wecken soll. Ihr Busen wogt und bei der Berührung der im Kreise wirbelnden Halskette richten sich ihre Brüste in die Höhe. Auf der feuchten Haut blitzen die Diamanten, ihre Armbänder, ihre Gürtel, ihre Ringe warfen strahlende Funken über ihr prunkhaftes, mit Perlen benähtes, mit Gold und Silber gesticktes Gewand.
Es ist ein zarter Panzer aus feiner Goldarbeit, dessen Maschen je ein Edelstein ziert, deren Feuer sich schlangenartig kreuzt über der matten, theerosen-zarten Haut, wie glänzende Insekten mit strahlenden Flügeldecken, rot marmoriert, hochgelb punktiert, stahlblau gefleckt, pfauengrün getigert.
Die Augen, denjenigen einer Nachtwandlerin ähnlich, sind starr auf einen Punkt gerichtet und sehen weder den Tetrarchen, der erbebt, noch ihre Mutter, die entsetzliche Herodias, welche sie beobachtet, noch den Eunuchen, der am Fusse des Thrones mit dem Säbel in der Hand unbeweglich dasteht, sein schreckliches Gesicht bis an die Backen verhüllt, seine Brust wie ein vertrockneter Kürbis unter der gelbbunten Tunika hervorhängend.
Dieses Urbild der Salome verfolgte seit Jahren den Herzog Jean. Wie oft hatte er in der alten Bibel, von Peter Variquet, dem Gottesgelehrten der Universität Löwen, übersetzt, das Evangelium des heiligen Matthäus gelesen, der in kurzen, naiven Sätzen die Enthauptung des Vorgängers Christi erzählt. Wie oft war er nicht in tiefes Nachdenken versunken beim Lesen jener Zeilen:
„Am Jahrestagfeste des Herodes tanzte die Tochter der Herodias und gefiel dem Herodes sehr.
Da versprach er ihr und schwur’s mit einem Eide, ihr alles zu geben, was sie erbitten würde.
Und sie, von ihrer Mutter verleitet, sagte: Gieb mir das Haupt Johannes des Täufers auf einer Schüssel.
Der König aber wurde betrübt; doch um des Eides und derer willen, die mit ihm am Tische sassen, befahl er, dass es ihr überbracht würde.
Und er schickte alsbald hin und liess Johannes im Kerker enthaupten.
Und man brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab’s dem Mägdelein; und diese überreichte es ihrer Mutter.“
Aber weder Matthäus, noch Markus, noch Lukas verbreiten sich über den berauschenden Zauber, über die moralische Versunkenheit der Tänzerin. Sie bleibt verwischt, geheimnisvoll und verloren in dem fernen Nebel der Jahrhunderte, unfassbar für die realen, alltäglichen Geister, nur den erschütterten und geschärften Gehirnen zugängig, die durch Nervenkrankheit hellsehend geworden; spröde auch gegenüber dem Maler des Fleisches, Rubens, der sie in eine flanderische Schlächtersfrau verwandelte; unverständlich allen Schriftstellern, die niemals die aufregende Begeisterung der Tänzerin, die raffinierte Geistesgrösse der Mörderin darzustellen vermochten.
In dem Werk von Gustav Moreau, in seinem Entwurfe frei von aller Tradition, sah Herzog Jean endlich diese übermenschliche und seltsame Salome verkörpert. Sie war nicht allein die Tänzerin, welche durch wollüstige Windungen ihrer Hüften einem geschwächten Greise den Schrei frivoler Begier entlockt, indem sie sich den Willen eines Königs durch die Bewegungen ihres Leibes und das Zittern ihrer Schenkel unterwirft; sie wurde sozusagen die sinnbildliche Gottheit unzerstörbarer Wollust, die Göttin der unsterblichen Hysterie; jenes einfache Sinnentier, ungeheuer, gefühllos, unempfindlich, alles, was sich ihr nähert, sie berührt und sie sieht, vergiftend.
Ein unwiderstehlicher Zauber ging von diesem Bilde aus. Aber das Aquarell, betitelt „Die Erscheinung“, wirkte vielleicht noch aufregender.
Auf diesem Gemälde hob sich der Palast des Herodes wie eine Alhambra, auf schlanken regenbogenfarbigen Säulen von maurischen Kacheln, wie mit silbernem Mörtel und goldenem Cement zusammengefügt, ab; Arabesken gingen von Lasursteinen aus, schlängelten sich um Kuppeln und auf den mit Perlmutter eingelegten Arbeiten entlang, die in regenbogenfarbige, prismatische Strahlen ausliefen.
Hier war der Mord vollzogen; der Henker stand jetzt unbeweglich, die Hände auf den Knauf seines langen mit Blut befleckten Schwertes stützend.
Das abgeschlagene Haupt des Heiligen hatte sich in der Schüssel, die auf den Steinplatten stand, in die Höhe gerichtet, fahl, den bleichen Mund offen, den Hals karmoisinrot, triefend von Blut. Eine Musivarbeit umgab den Kopf, von dem ein leuchtender Glorienschein seine Lichtstrahlen auf die Säulenhalle warf, die schreckliche Erhebung des Kopfes beleuchtend, die gläsernen Augäpfel entzündend, die sozusagen fest auf der Tänzerin haften.
Mit einer Gebärde des Entsetzens stösst Salome die schreckliche Vision zurück, die sie unbeweglich auf den Fussspitzen festhält. Mit weitgeöffneten Augen, die Hand krampfhaft ihren Busen umklammernd, starrt sie die Erscheinung an.
Sie ist fast nackt; in der Aufregung des Tanzes haben sich die Schleier gelöst, die Goldstoffe sind herabgefallen; sie ist nur noch mit dem Goldschmuck und den durchsichtigen Juwelen behangen.
Der schreckliche Kopf strahlt, immer noch blutend, kleine dunkelpurpurne Kiesel an den Spitzen des Bartes und Haares ansetzend. Sichtbar ist er für Salome allein. Sie streift mit ihrem düstern Blick weder die Herodias, die an ihren endlich gestillten Hass denkt, noch den Tetrarchen, der, etwas vorgebeugt, die Hände auf den Knieen, keuchend dasitzt und wahnsinnig bethört ist durch die Nacktheit dieses jungen Körpers, der von wild aufregenden Wohlgerüchen, von Weihrauch und Myrrhen umduftet ist. –
So wie der alte König blieb auch Herzog Jean zermalmt und vernichtet, vom Schwindel ergriffen vor dieser Tänzerin, die weniger majestätisch, weniger hochmütig, aber verwirrender als die Salome des Ölgemäldes auf ihn wirkte.
Verloren in diese seine Betrachtungen versuchte der Herzog dem Ursprung dieses grossen Künstlers, dieses mystischen Heiden, dieses Illuminaten, der sich so völlig von der Welt abzusondern vermochte, um mitten in Paris grausame Visionen, feenhafte Apotheosen der vergangenen Zeitalter erstrahlen zu sehen, auf die Spur zu kommen.
Mantegna und Jacopo de Barbarj, hie und da verworrene Verbindung mit Vinci, Farbenfieber à la Delacroix; aber der Einfluss dieser seiner Meister blieb im ganzen genommen unmerklich. Ohne wirkliche Anlehnung blieb Moreau in der Kunst seiner Zeit einzig. Er stieg bis zu den ethnographischen Quellen hinauf, zu den Entstehungen der Götterlehre, deren blutige Rätsel er verglich und entwickelte; er vereinigte die Legenden des äussersten Orients, die sich danach mit dem Glauben der andern Völker zu einer einzigen verschmolzen.
Er rechtfertigte somit seine architektonischen Verschmelzungen, sein verschwenderisch unerwartetes Gemisch von Stoffen, seine unheimlich sinnbildlichen Darstellungen, verschärft durch die aufregende Deutlichkeit einer modernen Nervosität.
Es war in seinen Werken ein eigentümlicher Zauber, ein Reiz, der einen bis ins tiefste Innere bewegt, wie in einigen Dichtungen von Baudelaire; man bleibt erstaunt, träumerisch und bestürzt von dieser Kunst, die die Grenzen der Malerei überschreitet und der Dichtung ihre zartesten Gestaltungen entlehnt. Diese zwei Bilder der Salome, für welche Herzog Jean eine Bewunderung ohne Grenzen hegte, lebten unter seinen Augen, an den Wänden seines Arbeitszimmers.
Aber darauf beschränkten sich keineswegs seine Bilderankäufe.
Obgleich er den ersten und einzigen Stock seines Hauses, den er selbst nicht bewohnte, geopfert hatte, hatte das Erdgeschoss allein schon eine ganze Reihe Bilder verlangt.
Das Erdgeschoss war folgendermassen eingeteilt: Ein Ankleidezimmer, das mit dem Schlafzimmer in Verbindung stand, befand sich in einem Flügel des Hauses; von dem Schlafzimmer ging man in das Bibliothekzimmer, von dort ins Esszimmer, welches den anderen Flügel bildete.
Diese Zimmer, welche die eine Vorderseite der Wohnung darstellten, dehnten sich in gerader Linie aus und die Fenster sahen auf das Thal von Aunay hinaus.
Die andere Seite der Behausung bestand aus vier, den ersteren ganz gleichen Zimmern. Die Küche, auf der entsprechenden Seite, stand mit dem Esszimmer in Verbindung; dann folgte ein grosser Hausflur, der als Eingang in das Bibliothekzimmer diente; eine Art Boudoir in Verbindung mit dem Schlafzimmer.
Diese letzteren Zimmer gingen nach der entgegengesetzten Seite des Thales hinaus und sahen auf den Turm von Croy und Châtillon.
Die Treppe war an einem der Flügel des Hauses von aussen angebracht; Herzog Jean hörte dadurch die Tritte seiner Dienstboten weniger deutlich.
Er hatte das Boudoir mit einem lebhaft roten Stoff ausschlagen lassen, und an allen Wänden des Raumes hingen in schwarzen Ebenholzrahmen Kupferstiche von Johann von Luyken, einem alten holländischen Kupferstecher, der in Frankreich fast unbekannt war.
Er besass von diesem phantastischen, unheimlichen und grausamen Künstler die Serie seiner „Religionsverfolgungen“, wahrhaft entsetzliche Blätter, die die Martern des religiösen Wahnsinns vorstellten, Bilder, auf denen der Anblick unheimlicher menschlicher Qualen geboten wurde: Körper auf Kohlenglut gebraten, der Schädelhaut beraubte Köpfe, von Nägeln durchbohrt, tiefe Einschnitte von Sägen herrührend, Eingeweide aus dem Leibe gerissen und auf Knäule gerollt, langsam mit Zangen losgelöste Fingernägel, ausgestochene Augäpfel, Augenlider, die mittels spitzer Instrumente umgekehrt waren, verrenkte Glieder, mit Sorgfalt gebrochen, blossgelegte Knochen, langsam mit der Klinge des Messers abgeschabt.
Diese Werke, abscheuliche Phantasiegebilde, die nach verbranntem Menschenfleisch rochen, Blut schwitzten und erfüllt waren vom Schrei des Entsetzens und der Verfluchung, liessen dem Herzog Jean, den sie mit verhaltenem Atem in dieses rote Kabinett bannten, geradezu die Gänsehaut überlaufen.
Aber ausser dem Schauder, den sie ihm bereiteten, ausser der gewaltigen Begabung dieses Künstlers, dem ausserordentlichen Leben seiner Figuren entdeckt man bei seinem erstaunlichen, seltenen Talent zur Gruppierung, die er mit einer an Callot erinnernden Geschicklichkeit und Schärfe zur Ausführung bringt, wunderbare Fähigkeiten zur Wiedergabe gewisser Zeitstadien: z. B. seine Architekturen, Kostüme und Sitten zur Zeit der Makkabäer, dann während der Christenverfolgung zu Rom; in Spanien, unter der Herrschaft der Inquisition; in Frankreich im Mittelalter, sowie zur Zeit der Pariser Bluthochzeit und der Dragonaden, die alle mit peinlicher Sorgfalt aufgefasst und mit ausserordentlicher Kunst wiedergegeben sind.
Diese Kupferstiche waren treffliche Quellen für mancherlei Aufschlüsse; man konnte sie stundenlang betrachten, ohne zu ermüden; sie führten zum Nachdenken und halfen dem Herzog Jean oft die Zeit töten, wenn er keinen Sinn zum Lesen hatte.
Auch das Leben von Luyken hatte einen gewissen Reiz für ihn. Eifriger Calvinist, verstockter Sektierer, vernarrt in Hymnen und Gebete, stellte er religiöse Poesien zusammen, die er gleichsam illustrierte. Er schrieb die Psalme in Verse um, vertiefte sich in die Bibel, von der er entzückt und gleichzeitig erschüttert wurde.
Dabei die Welt verachtend überliess Luyken all seinen Besitz den Armen und lebte von trockenem Brot; schliesslich hatte er sich mit einer alten, durch ihn fanatisierten Dienerin eingeschifft. Er fuhr aufs Geratewohl hinaus, lief mit seinem Schiff hier und dort an und predigte überall das Evangelium, versuchte selbst ohne Essen zu leben, bis er beinahe verrückt geworden. –
In dem grösseren Raum nebenan, in der mit Cedernholz in Cigarrenkistenfarbe bekleideten Vorhalle hingen andere Kupferstiche, andere Zeichnungen übereinander.
Die „Todes-Komödie“ von Bresdin. In einer unmöglichen Landschaft, mit Bäumen, Dickicht und Gehölz bedeckt, welche die Formen von Dämonen und Gespenstern angenommen und zwischen welchen sich Vögel mit Rattenköpfen mischten, auf einem Boden, der mit Rippen, Wirbelknochen und Schädeln besäet war, richteten sich knorrige, gespaltene Weiden in die Höhe, von Skeletten überragt, die die Arme in der Luft bewegen; ein Strauch stimmt einen Siegesgesang an, während Christus in den mit Wölkchen bedeckten Himmel flieht, ein Einsiedler im Hintergrunde einer Grotte, den Kopf in den Händen vergraben, nachdenkend sitzt, und ein Bettler, durch Entbehrungen und Hunger abgezehrt, ausgestreckt auf dem Rücken, die Füsse in einem Pfuhl, der Entkräftung erliegt.
Der „Gute Samariter“ von demselben Künstler, als grosse Federzeichnung auf Stein abgezogen. Ein wunderlicher Wirrwarr von Palmenbäumen, Ebereschen und Eichen, die nebeneinander wachsen, ohne Rücksicht auf Jahreszeit und Klima; ein Stück Urwald, übersäet mit Affen, Eulen, Nachtfaltern und bucklig-alten Baumstümpfen, so missgestaltet wie die Wurzeln des Alrauns.
Aber obgleich Herzog Jean die Feinheit der Details und die hohen Schönheiten dieses Kupferstiches schätzte, so hielt er sich doch noch öfter vor den Zeichnungen auf, die den Raum schmückten.
Es waren in ihren Leisten aus rohem Birnbaumholz mit schmalem Goldrand unbegreifliche Erscheinungen von Odilon Redon. Das Haupt eines Merowingers auf einer Schale; das eines bärtigen Mannes, ein Mittelding zwischen einem chinesischen Priester und einem Volksredner, der mit seinem Finger eine kolossale Kanonenkugel berührt; dann eine abscheuliche Spinne, die in der Mitte ihres Körpers ein menschliches Angesicht trägt. Ferner Kohlenzeichnungen, die den Schrecken des Träumers darstellen, der von Verdauungsqualen gepeinigt wird.
Dann wieder ein grosser Würfel, aus dem ein halbgeschlossenes trauriges Auge blinzelt; dort dürre unfruchtbare Landschaften, kalcinierte Ebenen, Umwälzungen des Erdbodens, vulkanische Aufruhre, vom Sturm gepeitschte Wolken und unbeweglich fahle Himmel; ein unnatürlicher Blumenreichtum entfaltet sich auf Felsen; überall erratische Blöcke, schmutzige Eisgruben, Gestalten, deren affenartiger Typus und dicke Backenknochen, deren hervorstehende Augenbrauen, schiefe Stirn und eingedrückte Schädel an die Köpfe unserer Vorfahren erinnern.
Diese Zeichnungen waren ohne Beispiele in der Kunst, sie überschritten die Grenzen der Malerei und führten wunderlich phantastische Neuerungen ein, Gebilde der Krankheit und des Fieberwahns.
Diese Gesichter, diese masslos vergrösserten und missgestalteten wie durch eine Karaffe gesehenen Körper riefen bei Herzog Jean Erinnerungen an Typhus wach, Erinnerungen, die ihm von fieberhaften Nächten und schrecklichen Visionen seiner Kindheit geblieben waren.
Erfasst von einem unbeschreiblichen, durch diese Zeichnungen erzeugten Unbehagen, wie er es empfand bei gewissen „Sprichwörtern“ Goyas, an die sie erinnerten, oder wie beim Schluss einer Lektüre von Edgar Poë, von dem Odilon Redon die Fata Morgana der Sinnestäuschungen und die Wirkungen der Furcht in verschiedenartiger Kunst ererbt zu haben schien, rieb er sich die Augen und betrachtete eine strahlende Figur, betitelt die „Schwermut“, die vor der Sonnenscheibe in einer gedrückten, trüben Stellung auf einem Felsen sitzt.
Wie durch Zauber verschwinden diese Schatten, eine sanfte Traurigkeit, eine kraftlose Verzweiflung bemächtigt sich seiner Gedanken und er stellt lange Betrachtungen vor diesem Werke an.
Ausser dieser Sammlung von Zeichnungen von Redon, die fast alle Wände des Vorzimmers zierten, hatte Herzog Jean in seinem Schlafzimmer eine sonderbare Skizze von Theocopuli: einen Christus. Es war ein Bild in unnatürlichen Farbentönen, von übertriebenen Linien und grausamer Färbung, ein Bild der zweiten Periode dieses Künstlers, als er die Idee aufgegeben hatte, nicht mehr Tizian ähnlich zu sein.
Diese unheimliche Malerei, die in Wachsfarbe und Leichengrün ausgeführt zu sein schien, entsprach nach des Herzogs Ansicht einer gewissen Übereinstimmung mit dem Mobiliar.
Seiner Meinung nach gab es nur zwei Arten, um ein Schlafzimmer einzurichten: entweder ein Alkoven, der Ort nächtlicher Ergötzung, oder ein Plätzchen der Ruhe und Einsamkeit, eine Zufluchtsstätte des Gedankens, eine Art Betzimmer.
Nachdem er die Frage von allen Seiten beleuchtet hatte, folgerte er, dass das zu erreichende Ziel sich darin zusammenfassen liesse: mit freundlichen Gegenständen eine traurige Sache zu schaffen, oder vielmehr, wenn man dem Schlafgemach auch den Charakter der Hässlichkeit lässt, doch dem Ganzen eine Art von Eleganz und Vornehmheit aufzudrücken. Durch die Optik des Theaters, dessen gemeiner Flitterkram wie kostbare und teure Gewebe aussieht, die absolut entgegengesetzte Wirkung zu erzielen, indem man sich prächtiger Stoffe bedient, um ihnen den Anstrich der Dürftigkeit zu verleihen; mit einem Wort eine Karthäuserklause herzustellen, die aussah wie eine wirkliche.
Er verfuhr in folgender Weise: um die ockerartige Mauerfarbe, das vorgeschriebene geistliche Gelb, nachzuahmen, liess er die Wände mit safrangelber Seide bekleiden. Um aber die Schokoladenfarbe der Panele wiederzugeben, liess er sie mit violettfarbenen Holzleisten, die mit Amarantfarbe dunkel gebeizt waren, bekleiden. Die Wirkung war frappant; sie konnte von weitem an die düstere Starrheit des Vorbildes erinnern. Der Plafond wurde in Gelbweiss tapeziert, das den Kalk ersetzte, ohne dessen grellen Schein zu haben. Die kalten Steine der Zelle gelangen in der Nachbildung ziemlich gut dank einem Teppich, dessen Muster rote Fliesen vorstellte, mit weisslichen Stellen in der Wolle, welche die Abnutzung durch Sandalen und die Reibung durch Stiefel darstellen sollten.
Er möblierte dieses Gemach mit einem kleinen eisernen Bett, einer Art Mönchsbett, aus antikem Eisen geschmiedet und poliert, am Fussende mit reich aufgetragenen Verzierungen versehen.
Die Stelle eines Nachttisches vertrat ein Betstuhl, dessen Inneres ein Nachtgeschirr enthalten konnte und dessen Aussenseite eine Kirchenagenda trug. Gegenüber an der Mauer liess er einen Kirchenstuhl anbringen, der von einem durchbrochenen Altarhimmel überragt wurde, verziert mit vorspringenden Stützen. Die hohen Kirchenleuchter ersetzte er durch Lichter aus reinem Wachs, die er in einem besonderen Geschäft kaufte, das nur Kirchenartikel führte, denn er hegte eine grosse Abneigung gegen Petroleum oder Stearin, kurz gegen alle und jede moderne Beleuchtung, da sie ihm zu grell und unzart erschien. –
Des Morgens in seinem Bett, ehe er einschlief, den Kopf auf dem Kopfkissen, seine Umgebung betrachtend, stellte er sich leicht vor, dass er sich hundert Meilen von Paris befinde, weit weg von der Welt, im Innern eines Klosters.
Und im Grunde genommen war die Täuschung leicht, da er ein Leben führte, das dem eines Mönches fast gleichkam. Er hatte sich auf diese Weise die Vorteile der Abgeschlossenheit verschafft. Wie er seine Zelle zu einem warmen, angenehmen Zimmer gemacht, hatte er sein Leben regelmässig und bequem gestaltet, umgeben von Wohlbehagen, beschäftigt und dennoch frei. –
Vom Leben abgenutzt, von dem er nichts mehr erwartete, ward er einem Einsiedler gleich, reif für die Einsamkeit. Niedergedrückt wie ein Mönch und voll unendlicher Müdigkeit, war er beseelt von dem Bedürfnis nach Ruhe, von dem Wunsche, nichts mehr gemein zu haben mit den Profanen, die bei ihm für Utilitarier und Dummköpfe galten.
Tief in seinen bequemen Lehnsessel vergraben, die Füsse auf den vergoldeten Kugeln der Feuerböcke, die Pantoffel fast brennend von den Holzscheiten, die knisternd lebhafte Flammen ausstrahlten, legte Herzog Jean den alten Quartanten, in welchem er las, auf einen Tisch, dehnte sich, zündete sich eine Cigarette an und verfiel dann in köstliche Träumereien, mit verhängten Zügeln die Spur der Erinnerung verfolgend, die ihm seit Monaten entfallen und jetzt plötzlich wieder, durch das Beifallen eines Namens, hervorgerufen wurde.
Mit wunderbarer Deutlichkeit sah er nämlich die Verlegenheit seines Kameraden d’Aigurande vor Augen, als derselbe in einer Versammlung standhafter Junggesellen die letzten Vorbereitungen zu einer Heirat offen gestehen musste. Man protestierte laut dagegen, man malte ihm die Abscheulichkeit eines Zusammenschlafens in demselben Bette aus. Nichts half; vollständig in ihrem Banne glaubte er an die Intelligenz seiner künftigen Frau und behauptete sogar bei ihr aussergewöhnliche Eigenschaften von Hingebung und Zärtlichkeit erkannt zu haben.
Herzog Jean war es, der von all den jungen Leuten allein den Freund in seinem Entschluss ermutigte, und dies von dem Augenblick ab, als er in Erfahrung gebracht hatte, seine Braut wünsche an der Ecke eines neuen Boulevards eine der modernen Wohnungen in Rotundenform zu beziehen.
Überzeugt von der unbarmherzigen Macht kleiner Misèren, die unheilvoller für starke Naturen sind als grosse, sowie sich auf die Thatsache stützend, dass d’Aigurande kein Vermögen besass und die Mitgift seiner Frau so gut wie Null war, sah er in diesem einfachen Wunsch eine unendliche Aussicht für lächerliche Unannehmlichkeiten.
D’Aigurande kaufte Möbel von runder Form, Spiegeltische, die, hinten ausgehöhlt, einen Kreis bildeten, die Gardinenstützen in Bogenform, Teppiche in Halbmondform, kurz ein ganzes Mobiliar, wie es eben auf Bestellung angefertigt wird.
Er bezahlte das Doppelte dafür. Als später seine Frau für ihre Toilette zu knapp bei Geld und endlich der Rotundenwohnung überdrüssig war und eine viereckige Etage beziehen wollte, da passte eben keins der Möbel mehr. Nach und nach wurde dieses lästige Mobiliar eine Quelle endlosen Verdrusses. Das frühere gute Einvernehmen, das schon durch das gemeinschaftliche Leben etwas locker geworden war, schrumpfte von Woche zu Woche mehr zusammen; sie gerieten in Zorn, warfen sich gegenseitig vor, nicht in einem Salon bleiben zu können, wo die Kanapees und Spiegeltische nicht einmal die Wände berührten und bei der geringsten Bewegung, trotz aller Keile, die man darunter gelegt, wackelten. Auch fehlte das nötige Geld für die Ausbesserungen. Alles wurde ein Gegenstand des Streites und der Bitterkeit, von den Schubladen an, die sich in den nicht ordentlich feststehenden Möbeln gezogen hatten, bis zu den Spitzbübereien des Dienstmädchens, das von der Unachtsamkeit und den Zwistigkeiten profitierte, um die Kasse zu erleichtern. Mit einem Wort: das Leben wurde ihnen unerträglich. Er amüsierte sich ausserhalb des Hauses; sie suchte daheim durch Übertretung des Ehegebotes das Vergessen ihrer trüben und langweiligen Existenz zu ermöglichen.
„Mein Schlachtplan war richtig,“ hatte sich damals der Herzog gesagt, der dies mit der Befriedigung eines Strategen vernahm, dessen Manöver gelungen waren. –
Er dachte jetzt vor seinem Feuer sitzend an die Trümmer dieses ehelichen Heims, deren Veranlassung sein guter Rat gewesen war. Er warf neue Scheite Holz in den Kamin und nahm flugs seine Träumereien wieder auf.
Andere Erinnerungen kamen ihm jetzt, die derselben Gedankenreihe angehörten.
Es war schon einige Jahre her, als er eines Abends in der Rue de Rivoli einem Laufburschen von ungefähr sechzehn Jahren begegnete, einem blassen, verschmitzt aussehenden Jungen, verführerisch wie ein Mädchen. Derselbe sog mühevoll an einer Cigarette, deren Papier geplatzt war. Schimpfend rieb er gewöhnliche Küchenstreichhölzer an seiner Hose ab, die nicht fangen wollten, bis ihm keins mehr übrig blieb. Jetzt bemerkte er den Herzog, der ihn beobachtete. Er näherte sich ihm und an den Rand seiner Mütze greifend bat er ihn um Feuer. Herr des Esseintes reichte ihm einige duftige Cigaretten von Dubêque, knüpfte dann eine Unterhaltung mit ihm an und veranlasste ihn, seine Geschichte zu erzählen.
Diese war äusserst einfach. Der Junge hiess Auguste Langlois und war bei einem Papparbeiter in der Lehre; er hatte seine Mutter früh verloren und wurde von seinem Vater oft nach Noten geprügelt.
Herzog Jean hörte ihn nachdenklich an: „Komm, wir wollen etwas zusammen trinken,“ sagte er und führte ihn in eine Wirtschaft, wo er ihm starken Punsch vorsetzen liess. Der Junge trank, ohne ein Wort zu sprechen. – „Möchtest Du Dich heute Abend amüsieren?“ fragte der Herzog. Dann hatte er den Kleinen zu Madame Laura, einer Dame geführt, die in der Rue Mosnier in der dritten Etage eine Auswahl von Blumenmacherinnen wie eine Reihe roter Zimmer, die mit runden Spiegeln, Kanapees, etc. etc. ausgestattet waren, hielt.
Dort hatte Auguste ganz verdutzt seine Mütze zwischen seinen Fingern drehend ein kleines Bataillon Frauenzimmer gesehen, die alle wie aus einem Munde riefen:
„Ach, der hübsche Junge!“
„Aber sag mal, Kleiner, Du hast noch nicht das richtige Alter,“ fügte eine stattliche Brünette mit gebogener Nase und grossen dunklen Augen hinzu, die bei Madame Laura die unvermeidliche Rolle der schönen Jüdin vertrat.
Herzog Jean schien dort zu Hause zu sein und unterhielt sich leise mit der Wirtin.
„Sei doch nicht bange, Dummkopf,“ rief er dem Jungen zu. „Triff Deine Wahl, ich bezahle.“ Und er gab dem Kleinen einen leichten Stoss, so dass er auf den Divan zwischen zwei der Schönen fiel.
Auf ein Zeichen der Wirtin rückten diese etwas zusammen, hüllten die Kniee des Jungen mit ihren Röcken ein und hielten ihm ihre entblössten Schultern, die stark nach einem betäubenden Puder rochen, unter die Nase. Der arme Kleine rührte sich nicht mehr; sein Kopf wurde ganz heiss und rot, der Mund trocken; die Augen niederschlagend wagte er nur verstohlen einige neugierige Blicke.
Wanda, die schöne Jüdin, küsste ihn und gab ihm gute Ratschläge, empfahl ihm, seinem Vater und seiner Mutter zu gehorchen und zur selben Zeit glitten ihre Hände langsam über den Jungen hin, dessen veränderte Gesichtszüge konvulsivisch zuckten.
„Es ist also nicht Deinetwegen, dass Du heute Abend kommst?“ fragte Madame Laura den Herzog. „Aber zum Teufel, wo hast Du nur den Schlingel aufgetrieben?“ fing sie wieder an, als Auguste mit der Schönen in einem Nebenzimmer verschwunden war.
„Auf der Strasse, meine Beste.“
„Du bist doch nicht betrunken?“ murmelte die alte Wirtin. Und nach einiger Überlegung fügte sie mit einem mütterlichen Lächeln hinzu: „Du liederlicher Strick, Dir steht nach frischer Ware der Sinn!“
Herzog Jean zuckte mit den Achseln. „Du irrst Dich gehörig! ja vollständig,“ entgegnete er. „Die Wahrheit ist, dass ich einfach versuche, mir einen Mörder zu bilden. Folge einmal aufmerksam meiner Beweisführung. Dieser Junge ist noch rein, doch hat er das Alter erreicht, wo das Blut zu wallen anfängt; er würde hinter den jungen Mädchen in seinem Viertel herlaufen, sich amüsieren und doch noch rechtschaffen bleiben, um schliesslich sein bescheidenes Teil an einem momentanen Glück zu geniessen, wie es den Armen eben beschieden ist. – So aber, wo ich ihn hierher führe, in die Mitte Eures Paradieses, das er gar nicht ahnt und das ihm notgedrungen im Gedächtnis verbleibt, und indem ich ihm alle vierzehn Tage eine solch unverhoffte Wonne zuteil werden lasse, wird er sich an den Genuss des Fleisches gewöhnen. Es wird ihm systematisch zum Bedürfnis werden! Nehmen wir selbst an, dass er drei Monate braucht, bis der Genuss ihm absolut notwendig geworden – und mit den langen Zwischenräumen, die ich mache, laufe ich keine Gefahr, ihn zu übersättigen – nun, am Ende dieser drei Monate werde ich die kleine Rente, die ich Dir einzahlen werde, aufheben, und dann wird er stehlen wie ein Rabe, um hierher kommen zu können; er wird alle Hebel in Bewegung setzen, um sich auf diesem Divan und unter diesem Gas wälzen zu können.
Die Sache zum äussersten getrieben: er wird, wie ich hoffe, eines Tages seinem Herrn, der ihn dabei betrifft, wie er dessen Geldschrank öffnet, einfach den Hals umdrehen, und so ist, wie Du siehst, mein schöner Zweck erreicht. Ich werde im Verhältnis meiner Mittel eben dazu beigetragen haben, einen Schurken mehr zu schaffen, ein Nahrungsmittel der edlen Justitia, was mir als Feind dieser verabscheuten Gesellschaft, die uns brandschatzt, gerade recht ist.“ –
Die Frauenzimmer sahen ihn mit grossen Augen an.
„Da bist Du ja!“ fing er wieder an, als er Auguste in den Salon zurückkommen sah, der sich rot und verlegen hinter der schönen Jüdin zu verstecken suchte.
„Nun, mein Junge, es ist schon spät, sag diesen netten Damen gefälligst Adieu.“
Und auf der Treppe teilte er ihm mit, dass er alle vierzehn Tage, ohne dass es ihn einen Heller koste, zu Madame Laura gehen könne; dann auf der Strasse angelangt, sah er den ganz betäubten Jungen einen Augenblick lang an, und schloss:
„Wir werden uns wohl nicht wieder sehen; geh schnell heim zu Deinem Vater, dessen Hand ihm unthätig juckt und behalte das gewissermassen schöne evangelische Wort: ‚Thue den andern das, was Du nicht willst, das sie Dir thun‘ wohl im Gedächtnis. Mit dieser Lebensregel wirst Du weit kommen. – Gute Nacht! Vor allen Dingen sei nicht undankbar, lass so bald wie möglich von Dir hören, das heisst auf dem Wege der hochlöblichen Gerichtszeitung.“ – – – –
„Der kleine Judas!“ murmelte Herzog Jean vor sich, das Feuer schürend; – „sich sagen zu müssen, dass ich seinen Namen noch niemals unter Vermischtes gelesen habe! – Es sei denn, dass er schon mit dem Gericht zu thun gehabt hätte, seit ich in Fontenay bin, wo ich keine Zeitungen mehr lese.“
Er stand auf und ging ein paarmal im Zimmer auf und ab.
„Es wäre trotz alledem schade,“ sagte er sich, „denn indem ich so handelte, machte ich das weltliche Gleichnis wahr, die Allegorie der allgemeinen Lehre, die nach nichts Geringerem strebt, als alle Menschen in einen ‚Langlois‘ zu verwandeln, und sich den Kopf zerbricht, statt endlich den Elenden aus Mitleid die Augen auszustechen, um sie ihnen ganz und mit Gewalt zu öffnen, damit sie um sich herum nur unverdiente und mildere Schicksale sehen, verfeinerte und schärfere Genüsse wittern, die ihnen darum um so ersehnter und begehrenswerter erscheinen. –“
„Und die Thatsache ist,“ fuhr der Herzog in seiner Schlussfolgerung fort, „die Thatsache ist die, dass der Schmerz eine Wirkung der Erziehung ist, dass er sich erweitert und schärft, je nachdem die Ideen entstehen: je mehr man sich also befleissigt, den Verstand und das Nervensystem der armen Teufel zu verfeinern, desto mehr wird man die gewaltig lebenskräftigen Keime des moralischen Leidens und Hasses in ihnen anfachen und entwickeln.“ – –
Die Lampen kohlten. Er zog sie auf und sah nach der Uhr: drei Uhr Morgens. – Er zündete sich eine Cigarette an und vertiefte sich von neuem in die durch seine Träumereien unterbrochene Lektüre des lateinischen Gedichts „De laude castitatis“, das unter der Regierung des Gondebald von Avitus, des Erzbischofes von Wien, geschrieben worden ist.
Seit jener Nacht, in der er ohne augenscheinliche Ursache die melancholische Erinnerung an Auguste Langlois wachgerufen, lebte sein ganzes früheres Leben wieder in ihm auf.
Er war unfähig, ein Wort der Bücher zu verstehen, die er zu Rate zog; selbst seine Augen lasen nicht mehr; es war ihm, als wenn sein Geist, von Litteratur und Kunst übersättigt, sich weigerte, mehr in sich aufzunehmen.
Er lebte nur noch in sich selbst, nährte sich von seinem eigenen Mark, gleich Tieren während des Winterschlafes; denn die Einsamkeit hatte wie ein Schlaftrunk auf sein Gehirn gewirkt. Nachdem diese ihn anfangs entkräftet und hingehalten hatte, brachte sie schliesslich eine Empfindungslosigkeit mit unbestimmten Träumereien in ihm hervor; sie vernichtete seine Absichten, brach seinen Willen, führte ihm eine Reihe von Träumen vor, die er passiv ertrug, ohne auch nur zu versuchen, sich ihnen zu entziehen.
Die verworrene und ungeregelte Lektüre, das künstliche Denken, dem er sich seit seiner Zurückgezogenheit hingegeben hatte, glich einem Damm, mit dem er seine alten Erinnerungen umgab; dieser Damm war plötzlich gewaltsam durchbrochen, die Flut setzte sich in Bewegung, riss Gegenwart und Zukunft mit sich, um alles gleichsam unter Wasser zu setzen und seinen Geist mit einer unendlichen Traurigkeit zu erfüllen, auf der unbedeutende Ereignisse seines Lebens und alberne Nichtigkeiten wie Strandgut umherschwammen.
Das Buch, welches er in der Hand hielt, fiel oft achtlos auf den Boden; er liess sich gehen, liess voll Widerwillen und Scham die Jahre seines vergangenen Lebens an sich vorüberziehen.
Was war das für eine Epoche!
Er versetzte sich in die Zeit der vornehmen Abendgesellschaften, der Rennen, des Spiels, seiner Liebeleien. Er erinnerte sich der Gesichter, der Mienen, der nichtssagenden Worte, welche ihn mit der Hartnäckigkeit jener trivialen Melodieen verfolgten, die man wohl gegen seinen Willen summt, die sich aber schliesslich mit einem Mal und ohne dass man daran denkt wieder verlieren. Diese Periode war von kurzer Dauer. Es trat darauf Gedächtnisruhe ein; er versenkte sich aufs neue in seine lateinischen Studien, um die Rückblicke selbst bis zum Eindruck zu verwischen.
Doch der Reigen war eröffnet, fast unmittelbar folgte eine zweite Phase, nämlich die Erinnerungen seiner Kindheit, besonders diejenigen der Jahre, welche er bei den Jesuiten zugebracht hatte.
Diese Erinnerungen waren die entferntesten und doch klarsten seines Gedächtnisses, ihm scharf und tief eingegraben: der schattige Park, die langen Alleen, die Blumenbeete, die Bänke – alle die kleinen Einzelheiten stiegen in seiner Einsamkeit vor ihm auf. Er sah die Gärten sich beleben, hörte das Geschrei der Schüler, das Lachen der Lehrer, die sich während der Erholungsstunden unter die Schüler mischten und sich, den hochgeschürzten Priesterrock zwischen den Knieen haltend, dem Ballspiel hingaben oder auch mit den jungen Leuten ganz ungezwungen wie Kameraden unter den Bäumen plauderten.
Die Jesuiten erlangten durch diese Methode einen wirklichen Einfluss auf das Kind, brachten es dahin, die geistigen Gaben, welche sie kultivierten, gewissermassen zu kneten, sie in eine bestimmte Richtung zu lenken, sie gleichsam mit besondern Ideen zu pfropfen, ihre Gedankenzunahme durch eine eindringlich einschmeichelnde Methode zu fördern, indem sie sich bemühten, ihren Schülern später, beim Eintritt in die Welt, zu folgen und sie zu unterstützen, indem sie ihnen liebevolle Briefe sandten, wie sie der Dominikaner Lacordaire an seine ehemaligen Zöglinge zu schreiben verstand.
Herzog Jean gab sich von dem Erziehungs-Verfahren Rechenschaft, welches er, wie er sich einbildete, ohne Resultat hatte über sich ergehen lassen; sein Charakter, der allen Ratschlägen gegenüber rebellisch, spitzfindig, argwöhnisch und zum Widerspruch geneigt war, hatte ihn verhindert, durch ihre Zucht gebildet, ihren Lehren unterworfen zu werden. Einmal dem Kollegium entwachsen, hatte sein Skepticismus nur noch zugenommen; sein Weg durch eine legitimistisch-unduldsame und beschränkte Welt, die Unterhaltung mit unwissenden Kirchenvorstehern und niedrigen Geistlichen, deren Ungeschicktheit den Schleier zerrissen, der so kunstgerecht von den Jesuiten gewebt war, bestärkten nur noch seinen unabhängigen Geist und vermehrten sein Misstrauen gegen jeden Glauben.
Er erachtete sich im ganzen genommen frei von jedem Band, von jedem Zwang; er hatte einfach, anders als alle andern, die im Lyceum oder in weltlichen Pensionaten erzogen waren, der Anstalt und seinen Lehrern ein vortreffliches Andenken bewahrt; und jetzt, wo er mit sich zu Rate ging, kam er dahin, sich zu fragen, ob der Same, bislang auf unfruchtbaren Boden gefallen, nicht anfinge aufzugehen.
Und wirklich, seit einigen Tagen befand er sich in einem unbeschreiblichen Seelenzustand. Während eines Augenblickes glaubte er sich instinktmässig der Religion zugeführt; bei der geringsten Beweisführung aber verflog seine Hinneigung zum Glauben; trotzdem blieb er voll Unruhe und Verwirrung.
Er wusste indessen wohl, indem er in sich ging, dass er niemals den Geist der wahrhaft christlichen Demütigung und Reue haben würde; er wusste, dass der Augenblick, von dem der Pater Lacordaire spricht, dieser Augenblick der Gnade, „wo der letzte Lichtstrahl in die Seele dringt und die dort zerstreuten Wahrheiten in einem gemeinsamen Centrum wieder fixiert“, für ihn niemals kommen würde; er fühlte nicht das Bedürfnis der Demütigung und des Gebetes, ohne welches nach der Wahrheit der Priester keine Bekehrung möglich ist; er empfand nicht den Wunsch, Gott anzuflehen, dessen Barmherzigkeit ihm am wenigsten wahrscheinlich schien; und doch brachte es die Sympathie, die er für seine ehemaligen Lehrer bewahrte, dahin, ihn für sie und ihre Doktrinen zu interessieren. Diese unnachahmliche Sprache der Überzeugung, diese begeisternden Stimmen höherer Intelligenz fielen ihm wieder ein und hatten zur Folge, dass er an seinem Geist und seinen Kräften zweifelte. In seiner Einsamkeit, ohne neue Nahrung, ohne frisch empfundene Eindrücke, ohne Erneuerung der Gedanken und Austausch von Empfindungen, die von aussen kommen, in dieser unnatürlichen Verbannung, in der er eigensinnig verharrte, stellten sich alle Streitfragen, die er während seines Aufenthaltes in Paris vergessen hatte, von neuem wie aufregende Rätsel vor seinem Geist dar.
Die Lektüre der lateinischen Werke, die ihm sonst angenehm war, Werke meist von Bischöfen und Mönchen verfasst, hatte ohne Zweifel zu dieser Krisis beigetragen. Eingehüllt in eine Klosteratmosphäre, in einen Duft von Weihrauch, der ihm den Kopf benahm, hatten sich die Nerven aufgeregt; durch eine Ideenverbindung hatten diese Bücher die Erinnerungen an seine Jugendzeit bei den Jesuiten wieder ans Licht gefördert.
„Die Sache ist klar,“ sagte sich der Herzog Jean, indem er vernünftig nachzudenken und dem Gang dieser Einführung des Jesuitenelementes in Fontenay zu folgen versuchte – „ich habe seit meiner Kindheit, und ohne es je gewusst zu haben, diesen Stoff, der noch nicht gegärt hatte, in mir selbst; diese Vorliebe, die ich immer für alle religiösen Sachen gehabt habe, ist vielleicht ein Beweis dafür.“
Dennoch versuchte er sich vom Gegenteil zu überzeugen; unzufrieden, nicht mehr unumschränkter Herr über sich selbst zu sein, holte er Gründe herbei. Er hatte sich notgedrungen der Geistlichkeit zuwenden müssen, da die Kirche allein die verlorengegangene Kunst und Form der Jahrhunderte gesammelt hatte; sie hat selbst bis zu den gewöhnlichen modernen Erzeugnissen herab die Formen der Goldschmiedekunst bewahrt, den Zauber der schlanken Kelche und der Hostiengefässe in ihrer edlen Rundung auf uns gebracht, sie hat sogar in dem modernen Aluminium, in unedlen Metallen, in farbigem Glas die Grazie der mittelalterlichen Formen beibehalten.
Die meisten der kostbaren Gegenstände, welche im Museum von Cluny klassifiziert und wie durch Wunder der gemeinen Raubgier der Sansculotten entgangen sind, stammen aus den alten Abteien Frankreichs her. Ebenso wie die Kirche im Mittelalter die Philosophie, die Geschichte und Sprache vor dem Verfall geschützt hat, so hat sie auch die plastische Kunst hinübergerettet.
Bis zu unsern Tagen haben sich jene wunderbaren Muster von Geweben und Goldschmiedekunst erhalten, welche die Fabrikanten kirchlicher Gegenstände verhunzen, ohne ganz auf die ursprüngliche entzückende Form verzichten zu können. Es war daher durchaus nicht überraschend, dass er hinter antiken Nippsachen hergejagt, dass er mit Hilfe zahlreicher Sammler die Reliquien bei den Antiquitätenhändlern in Paris und den Trödlern auf dem Lande aufgestöbert hatte.
Aber vergebens berief er sich auf diese Gründe; es gelang ihm nicht, sich vollständig zu beruhigen. Gewiss, indem er alles kurz zusammenfasste, beharrte er dabei, die Religion als eine herrliche Legende, als eine grossartige Betrügerei zu betrachten, und doch trotz all seiner Auslegungen fing sein Skepticismus an zu wanken.
Die seltsame Thatsache bestand: er war jetzt weniger sicher als in seiner Kindheit, wo die Fürsorge der Jesuiten unmittelbar auf ihn gewirkt, als er in ihren Händen, ohne Familienbande, ohne Einfluss von aussen her, ihnen sozusagen mit Körper und Geist angehörte. Sie hatten ihm ebenfalls einen gewissen Geschmack für das Wunderbare eingeflösst, der sich langsam und unbemerkt in seiner Seele verzweigt hatte und der jetzt in der Einsamkeit aufblühte.
Beim Prüfen dieser seiner Gedanken, beim Suchen, ihre Fäden zu verbinden, die Quellen und Ursachen zu entdecken, kam er zu der Überzeugung, dass seine Handlungsweise während seines gesellschaftlichen Lebens von seiner Erziehung herrührte. Waren nicht seine Neigungen für das Verkünstelte, sein Verlangen nach dem Excentrischen die Resultate besonderer Studien und Raffiniertheit? Gewissermassen theologische Forschungen? Es waren im Grunde Erregungen und Begeisterungen zum Idealen, zum unbekannten Weltall, zu einer fern ersehnten Glückseligkeit, wie jene, die uns die heilige Schrift verspricht.
Er hielt plötzlich an und brach den Faden seiner Betrachtungen ab.
„Mir scheint,“ murmelte er verdriesslich, „dass ich noch mehr getroffen bin, als ich glaubte, da ich mich selbst mit Worten, wie ein Kasuist, bekämpfe.“
Er verblieb nachdenklich, von einer unbestimmten Furcht bewegt.
„Ach! ich werde stumpfsinnig,“ sagte sich der herzogliche Einsiedler; „die Furcht vor dieser Krankheit wird, wenn das so weitergeht, schliesslich die Krankheit selbst herbeiführen.“
Es gelang ihm, diesen Einfluss etwas abzuschütteln; seine Erinnerungen liessen nach, aber andere krankhafte Symptome machten sich bemerkbar; jetzt waren es die Gegenstände der Streitigkeiten allein, die ihn heimsuchten. Der Park, die Lehrer, die Jesuiten waren entschwunden. Er war gänzlich vom Abstrakten beherrscht; gegen seinen Willen dachte er an die widersprechenden Auslegungen der Glaubenssätze, an die verloren gegangenen Lossagungen von den Klostergelübden, die Pater Labbe in dem Werk über die Konzilien erwähnt. Brocken von diesen Kirchenspaltungen, Überbleibsel dieser Ketzereien, die während mehrerer Jahrhunderte die Kirchen des Westens und des Ostens trennten, fielen ihm wieder ein. Hier war es Nestorius, der der Jungfrau Maria den Titel Muttergottes streitig machte, weil im Mysterium der Inkarnation nicht Gott, sondern nur die menschliche Kreatur vorhanden war, die sie in ihrem Leibe getragen habe; da war es Eutyches, der da erklärte, dass das Bildnis Christi nicht demjenigen der andern Menschen gleichen könnte, da die Gottheit, in seinem Körper domizilierend, die Form ganz und gar verändert habe; dann waren es wieder andere Zänker, welche behaupteten, dass der Erlöser gar keinen Körper gehabt, dass dieser Ausdruck der heiligen Schrift nur bildlich zu nehmen sei; während Tertullian sich in seinem berühmten, beinahe materialistischen Axiom äussert: „Nichts, das ist, ist unverkörpert; alles was ist, hat einen Körper, der ihm eigen;“ und schliesslich diese alte, während langer Jahre erörterte Frage: „Ist Christus allein ans Kreuz geschlagen, oder hat die Dreieinigkeit, eins in drei Personen, in ihrer dreifachen Persönlichkeit am Kreuze Golgathas gelitten?“
Alles das trieb ihn an, drängte ihn – und mechanisch wie eine einmal gelernte Aufgabe stellte er sich selber Fragen und suchte sich dieselben zu beantworten. –
Während einiger Tage war es in seinem Gehirn wie ein Wimmeln von Paradoxen, wie ein Flug von Haarspaltereien. Dann verwischte sich aber die abstrakte Seite und eine ganz plastische folgte ihr unter der Wirkung der Gustav Moreauschen Bilder, die an den Wänden aufgehängt waren.
Er sah eine ganze Prozession von Prälaten an sich vorüber ziehen: Archimandriten, Patriarchen, die ihre goldbekleideten Arme emporheben, um die knieende Menge zu segnen, und ihre weissen Bärte beim Lesen und Gebeteleiern schütteln; er sah ganze Züge schweigender Büsser in die dunklen Totengrüfte hinabsteigen, dann wieder sich unermessliche Dome erheben, in denen weiss gekleidete Mönche von der Kanzel herunter donnerten.
Nach und nach verschwanden schliesslich diese Gesichte. Er sah von der Höhe seines Geistes herab das Panorama der Kirche wie ihren erblichen Einfluss auf die Menschheit seit Jahrhunderten; er stellte sie sich verzweifelnd und grossartig vor, dem Menschen das Schreckliche des Lebens und die Unfreundlichkeit des Schicksals darthuend, Geduld, Reue und Aufopferung predigend, versuchend die Schmerzen zu heilen durch den Hinweis auf die blutenden Wunden Christi, göttliche Vorrechte versichernd, den Betrübten den besten Teil des Paradieses versprechend, die menschliche Kreatur zum Leiden ermahnend, damit der Mensch Gott seine Trübsale und Sünden, seine Missgeschicke und seine Sorgen als Sühnopfer darbringe.
Hier fasste Herzog Jean wieder Fuss. Gewiss war er durch dieses Geständnis der sozialen Schändlichkeit befriedigt, wieder aber empörte ihn das unbestimmte Heilmittel der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Schopenhauer war ehrlicher, seine Doktrinen und die der Kirche gingen von einem gemeinschaftlichen Standpunkt aus; er stützte sich ebenfalls auf die Ungerechtigkeit und Schändlichkeit der Welt, er stiess auch mit seiner „Nachfolge Jesu Christi“ den schmerzlichen Ruf aus: „Es ist wirklich ein Elend, auf der Welt zu sein!“ Er predigte auch die Erbärmlichkeit der Existenz, die Vorteile der Zurückgezogenheit, warnte die Menschheit, dass, was sie auch thun möge und nach welcher Seite sie sich auch drehe, sie immer nur unglücklich bleibe: arm wegen der Leiden, die aus den Entbehrungen hervorgehen, reich im Verhältnis zu der unbesiegbaren Langenweile, welche der Überfluss erzeugt; aber er pries kein Universalmittel an, vertröstete mit keinem Köder, um dem unvermeidlichen Übel abzuhelfen.
Er unterstützt nicht das empörende System der Erbsünde; versucht nicht zu beweisen, dass derjenige ein allgütiger Gott sei, der die Spitzbuben beschützt, der den Dummköpfen hilft, die Kindheit vernichtet, das Alter verdummt und die Unschuldigen bestraft; er rühmt nicht die Wohlthaten einer Vorsehung, die diese nutzlose, unverständliche, ungerechte und alberne Abscheulichkeit, das physische Leiden, erfunden hat; er versucht keineswegs zu rechtfertigen, wie die Kirche die Notwendigkeit der Qualen und Prüfungen. Ruft er doch in seiner empörten Barmherzigkeit aus: „Wenn ein Gott diese Welt gemacht hat, so möchte ich nicht dieser Gott sein; das menschliche Elend würde mir das Herz brechen!“
Ach! er allein hatte das Richtige getroffen! Was waren alle die evangelischen Quacksalber neben seinen Abhandlungen von geistiger Gesundheitspflege? Er beabsichtigte nichts zu heilen, bot dem Kranken keine Entschädigung, keine Hoffnung an; aber seine Theorie des Pessimismus war im Grunde genommen die grosse Trösterin der auserwählten Geister, aller erhabenen Seelen. Sie offenbarte die Gesellschaft so wie sie ist und hob die angeborene Dummheit der Frauen hervor.
Diese Betrachtungen erleichterten den Herzog von einer schweren Last. Dieser grosse Deutsche bannte seinen Gedankenschauer und brachte ihn durch die Berührungspunkte seiner beiden Doktrinen dahin, dass er diesen ebenso poetischen wie rührenden Katholizismus, in dem er erzogen war und von dem er in seiner Jugend die Essenz in allen Poren eingesogen hatte, nicht zu vergessen vermochte.
Diese Rückgänge zur Gläubigkeit quälten ihn, besonders seit sich Verschlimmerungen seiner Gesundheit zeigten; sie trafen mit den neu hinzugetretenen nervösen Störungen zusammen.
Seit seiner jüngsten Kindheit war er von unerklärlichen Abneigungen gemartert worden, von Schauern, welche ihm den Rücken kalt hinunterliefen, ihm die Zähne zusammenpressten, wenn er zum Beispiel nasse Wäsche sah, die von einem Mädchen ausgewrungen wurde. Diese Wirkungen waren verblieben; noch heute litt er ganz besonders, wenn er einen Stoff zerreissen oder mit dem Finger auf Kreide reiben hörte, oder wenn er moirierte Seide anfasste.
Die Ausschweifungen seines Junggesellenlebens, die übertriebenen Anstrengungen seines Gehirns hatten sein ursprüngliches Nervenleiden ausserordentlich verschlimmert und das schon von seinen Vorfahren arg verbrauchte gesunde Blut nur noch verringert. In Paris hatte er bereits Kuren der Kaltwasserheilkunst durchmachen müssen, vornehmlich gegen das Zittern der Hände und gegen die entsetzlichen Schmerzen der Neuralgie, die ihm das Gesicht zerrissen, die Schläfen wie mit Hammerschlägen bearbeiteten, ihm die Augenlider wie mit Nadeln zerstachen und ihm Übelkeit erzeugten, die er nicht anders zu bekämpfen vermochte, als dadurch, dass er sich im Dunkeln auf den Rücken legte.
Diese Zufälle waren infolge seines geregelteren, ruhigeren Lebens langsam verschwunden. Jetzt machten sie sich aber von neuem in anderer Form geltend, indem sie den ganzen Körper durchliefen; die Schmerzen gingen vom Schädel zum Leib, ihm denselben gleichsam mit einem glühenden Eisen durchbohrend. Dann folgte ein nervös trockner Husten, der zu einer bestimmten Stunde anfing, eine immer gleiche Anzahl von Minuten währte, ihn aufweckte und ihn im Bett fast erstickte. Sein Appetit hörte ebenfalls auf. Nach jedem Versuch zum Essen konnte er kein zugeknöpftes Beinkleid, keine fest zugemachte Weste mehr ertragen.
Er enthielt sich aller geistigen Getränke, des Kaffees und Thees, trank nur noch Milch, nahm seine Zuflucht wieder zu den kalten Abwaschungen, stopfte sich voll Assa foetida, Baldrian und Chinin, wollte selbst das Haus verlassen, um ein wenig im Freien zu spazieren, als eben die Regentage eintraten, die das Land schweigend und eintönig machten. Als letztes Mittel verzichtete er vorläufig auf jede Lektüre und, von Langeweile verzehrt, entschloss er sich, um sein müssiges Dasein zu ändern, ein Projekt auszuführen, welches er aus Bequemlichkeit und Hass gegen jede Störung fortwährend aufgeschoben, seitdem er sich in Fontenay niedergelassen hatte.
Da er sich nicht mehr an den bezaubernden Wirkungen des Stils zu berauschen vermochte, sich nicht mehr an den entzückenden Überraschungen des schönen Pathos aufregen konnte, beschloss er die Ausstattung seiner Wohnung zu vollenden, sich seltene Treibhausblumen anzuschaffen, um sich auf diese Weise eine materielle Beschäftigung zuzugestehen, die ihn zerstreuen, seine Nerven erholen, sein Gehirn ausruhen lassen würde. Er hoffte, dass der Anblick ihrer seltsamen und prachtvollen Schattierungen ihn etwas entschädigen würde für die wahrhaft wunderlichen Farben des Stils, welchen seine litterarische Diät ihn momentan vergessen oder verlieren liess.
Von jeher hatte der Herzog für Blumen geschwärmt.
Seit langem schon verachtete er die gewöhnlichen Pflanzen, denen man wohl in den flachen Körben auf den Pariser Märkten in angefeuchteten Töpfen unter den grünen Zelttüchern und roten Schirmen begegnet.
Wie sich sein litterarischer Geschmack und sein Kunsturteil verfeinert und sich sein Überdruss an allgemein verbreiteten Ideen verstärkt hatte, so hatte sich auch seine Zärtlichkeit für Blumen von jedem Bodensatz und jeder Hefe losgemacht und geklärt.
Er verglich den Laden eines Gärtners mit einem Mikrokosmus, wo alle Klassen der Gesellschaft vertreten sind: jämmerliche, elende und erbärmliche Blumen, die sich nur auf den Fensterbrettern der Dachkammern wohl befinden, deren Wurzel oft in Milchtöpfe und alte Schalen gesteckt wird, wie zum Beispiel der Goldlack; anspruchsvolle und dumm gefallsüchtige Blumen, wie sie von jungen Mädchen auf Porzellantöpfe, wie zum Beispiel die Rose, gemalt werden; schliesslich die Blumen hohen Geschlechtes, wie die Orchideen, zart und reizend, zitternd und fröstelnd, exotische Blumen, die, nach Paris verbannt, warmen Glaspalästen gezüchtet werden, Prinzessinnen des Pflanzenreichs, die, für sich lebend, nichts gemein haben mit den Pflanzen der Strasse und dem bürgerlichen Blumenflor.
Nichtsdestoweniger fühlte er ein gewisses Mitleid mit den niederen Blumen, die durch die Ausströmungen der Kloaken und Dünste aller Art in den ärmlichen Vierteln entkräftet werden; seine wirkliche Augenfreude waren die vornehmen und seltenen Pflanzen von weit her, die mit grösster Sorgfalt durch künstliche Ofenwärme erhalten werden.
Dieser entschiedene Vorzug für die Treibhausblume hatte sich ebenfalls durch den Einfluss seiner allgemeinen Ideen modifiziert. Damals in Paris hatte seine natürliche Vorliebe für das Künstliche ihn dahin geführt, die wirkliche Blume gegen ihr treu nachgeahmtes Bild aufzugeben, das dank den Wundern des Gummis, des Drahtes, des Taffets, des Papiers und des Sammets sein buntes Scheinleben führte.
Er besass eine wunderbare Sammlung künstlicher tropischer Pflanzen, von den Händen tüchtiger Arbeiter angefertigt.
Diese bewunderungswürdige Kunst hatte ihn lange bezaubert, aber er träumte jetzt von der Zusammenstellung einer andern Flora.
Er machte sich daher daran, die Treibhäuser der Avenue de Châtillon und des Dorfes d’Aunay zu besuchen, kam todmüde nach Hause, die Börse leer, aber entzückt über die Tollheiten der Pflanzenwelt, die er gesehen hatte.
Er dachte nur noch an die Sorten, die er erworben, ruhelos verfolgt von dem Gedanken an die prachtvollen und seltsamen Blumenbeete.
Zwei Tage später kamen mehrere Wagen. Mit der Liste in der Hand rief der Herzog seine Einkäufe auf und prüfte einen nach dem andern.
Die Gärtner hoben von ihrem Karren eine Sammlung von Caladien, die an gedunsenen haarigen Stielen enorme schildförmige Blätter trugen. Alle hatten einen Zug von Verwandtschaft miteinander, ohne sich indessen gleich zu sein.
Es waren darunter ganz ungewöhnliche rosenfarbige, solche wie die Virginale, die aus Wachstuch oder englischem Pflaster geschnitten zu sein schien; ganz weisse, wie der Alban, den man aus einer durchsichtigen Schweinsblase hergestellt glaubte; einige, besonders Madame Mame, sahen aus wie Zink, auf dem kleine Stückchen gestanzten Metalls glänzen, in kaisergrüner Farbe, wie mit Tropfen Ölfarbe, rotem Bleioxyd oder Bleiweiss bespritzt; andere, wie der Bosporus, glichen täuschend gestreiftem Kattun, rot und myrtengrün gesprenkelt; wieder andere, wie die Aurora Borealis, breiteten ihre fleischfarbenen Blätter aus, mit purpurroten Rändern und violetten Fäserchen, ein aufgeschwollenes Blatt, das rötlichen Wein und Blut schwitzte.
Die Gärtner brachten neue Varietäten, die einer künstlichen Haut, von roten Adern durchzogen glichen; und die Mehrzahl, wie zerfressen von Aussatz, spannten ihr bleiches Fleisch aus, gefleckt mit Ausschlag und behaftet mit Flechten; andere hatten den hellen rosa Ton von sich schliessenden Wunden, oder die bräunliche Färbung des sich bildenden Schorfes; noch andere waren wie von Ätzmitteln verbrüht und von Brandwunden zerstört; wieder andere zeigten eine haarige Haut wie von Geschwüren ausgehöhlt und vom Krebs zerfressen; noch andere schienen mit Verband belegt, mit quecksilberhaltiger schwarzer Schmiere und grüner Belladonnasalbe bestrichen, mit dem gelben Glimmer des Jodpulvers gesprenkelt.
„Potztausend!“ rief er entzückt aus.
Eine neue Pflanze von gleichartigem Modell wie das des Caladium, die Alocasia Metallica begeisterte ihn noch mehr. Diese war wie mit einer Schicht grüner Bronze überstrichen, über welche silberne Reflexe hinliefen; es war ein Meisterwerk der Unnatürlichkeit, man möchte sagen, es gliche einem Stück Ofenrohr, von einem Töpfer aus grünem Eisen gefertigt.
Die Leute luden dann rautenförmige, flaschengrüne Blattpflanzen ab, in deren Mitte ein Stäbchen aufstieg, an dessen Ende ein grosses Herzass schwankte, gelackt wie die spanische Pfefferschote. Wie um die alltäglichen Erscheinungen der Pflanzen zu verhöhnen, sprang aus der Mitte von scharfem Rot ein fleischiger, faseriger, weiss und gelber Schwanz hervor, aufrecht bei den einen, bei den anderen geringelt wie der Schwanz eines Schweines.
Es war das Anthurium, eine Arumart, kürzlich von Kolumbia nach Frankreich eingeführt; sie bildete einen Teil dieser Familie, zu welcher auch ein Amorphophallus gehörte; eine Pflanze aus Kochinchina mit fischstecherartig geschnittenen Blättern, mit langen schwarzen, mit Narben bedeckten Stielen, gleich vernarbten Gliedern eines Negers.
Herzog Jean frohlockte.
Man hob einen neuen Schub von Ungeheuern vom Wagen: Echinopsen, deren in Watte gehüllte Blüten das hässliche Rosa eines verstümmelten Gliedes hatten; Nidularium, in Säbelscheiden eine gähnende Öffnung zeigend; Tillandsia Lindeni, schartige Messer von dicker roter Farbe hervorsteckend; Cypripedium, mit wirrigen, zerrissenen Rändern, eine wahnsinnige Hervorbringung der Natur. Sie glichen einer kleinen Schale, einem Holzschuh, über welchem sich eine menschliche Zunge aufschürzte mit ausgestrecktem Zungenband, wie man sie wohl in Werken, die Hals- und Mundkrankheiten behandeln, abgebildet findet. Zwei kleine Flügelchen, rot wie Ebereschen, die einer Kindermühle entnommen zu sein schienen, vervollständigten dieses lächerliche Gesamtbild.
Er konnte seine Augen nicht abwenden von dieser unglaublichen aus Indien kommenden Orchidee. Die Gärtner, durch die Zögerung gelangweilt, fingen jetzt selbst an, mit lauter Stimme die an den Töpfen steckenden Zettel vorzulesen.
Herzog Jean setzte seine Betrachtungen fort; er hörte nahezu bestürzt die rauhen Namen der grünen Pflanzen ankündigen: Encephalartos Horridus, eine riesenhaft eiserne Artischocke, rostfarbig gezeichnet, so, wie man sie auf die Thüren der Schlossmauern steckt, um das Übersteigen zu verhindern; Cocos Micania, eine Art Palme, zackig und schlank, allseitig von hohen Blättern gleich indianischen Rudern umgeben; Zamia Lehmanni, eine ungeheure Ananas, wie ein gewaltiger Chesterkäse in Heideland gepflanzt und auf seiner Spitze mit widerhakigen Wurfspiessen besät; Cibotium Spectabile, alle Gattungen durch seine wahnsinnige Form überbietend: aus einem palmigen Blätterwerk schiesst der enorme Schwanz eines Orang-Utang heraus, ein haarig brauner Schwanz, am Ende wie zu einem Bischofsstab abgerundet.
Aber der Herzog beachtete sie kaum und wartete nur mit Ungeduld die Serie von Pflanzen ab, welche ihn vor allen bezauberten, die vegetabilischen leichenfressenden Kobolde, die fleischverzehrenden Pflanzen, Gobe-Mouche, der Fliegenfänger der Antillen, mit dem faserigen Rand, eine Verdauungsflüssigkeit absondernd, mit gebogenen Stacheln versehen, die sich übereinander krümmen, ein Gitter über dem Insekt bildend, welches er einschliesst; die Drosera des Torflandes, mit drüsenartigen Haaren besetzt; die Sarracena, der Cephalothus, seine gefrässigen Hörnchen öffnend, fähig, wirkliches Fleisch zu verdauen und aufzuzehren; schliesslich noch Nepenthes, dessen Phantasieen alle Grenzen der excentrischen Form überschreiten.
Er wurde nicht müde, den Topf in seinen Händen zu drehen und umzudrehen, aus dem diese Extravaganz der Flora hervorkam. Die Pflanze erinnerte an den Gummibaum, von dem sie auch die länglichen Blätter hatte, mit ihrem dunklen metallischen Grün; aber am Ende dieses Blattes hing ein grüner Bindfaden, der sich einer Nabelschnur vergleichen lässt, eine grünliche Urne tragend, violett marmoriert, eine Art deutsche Porzellanpfeife oder sonderbares Vogelnest, welches sich ruhig hin und her wiegte, ein mit Haaren besetztes Inneres zeigend.
„Diese hat es weit gebracht,“ murmelte der Herzog.
Er musste sich seinem Entzücken entreissen, denn die Gärtner, die es eilig hatten, leerten den Boden ihrer Karren und stellten knollige Begonien und schwarze Krebsblumen auf die Erde.
Der Herzog bemerkte, dass noch ein Name auf der Liste blieb. Der Cattleya von Neu-Granada; man bezeichnete ihm eine geflügelte Glocke von verwischtem, fast verblasstem Lilablau; er ging näher und steckte seine Nase hinein, doch prallte er erschrocken zurück; sie strömte nämlich einen Geruch von lackiertem Tannenholz aus, wie der von Spielzeugschachteln, die ihm die Schrecken eines Neujahrstages wachriefen.
Er dachte, dass es gut wäre, ihr zu misstrauen, bedauerte fast, zwischen den geruchlosen Pflanzen, die er besass, diese Orchidee zugelassen zu haben, die so unangenehme Erinnerungen erweckte.
Als er allein war, betrachtete er diese Menge von Gewächsen, die sein Vorzimmer füllte; sie mischten sich miteinander, kreuzten ihre Degen, ihre langen Dolche, ihre eisernen Lanzen, sie bildeten eine grüne Gewehrpyramide, über welcher, gleich barbarischen Lanzenfähnlein, Blumen von blendendem, hartem Ton schwebten.
Die Luft in dem Raum verdünnte sich; bald darauf, im Dunkel eines Winkels und nahe dem Fussboden, schlängelte sich ein weisses, sanftes Licht.
Er trat hinzu und bemerkte, dass es die Rhizomorphen waren, welche beim Atmen gleichsam einen Nachtlampenschimmer ausstrahlen.
„Diese Pflanzen sind geradezu erstaunlich,“ sagte er zu sich; dann trat er zurück und warf einen Blick auf den Haufen: sein Zweck war erreicht. Keine einzige machte den Eindruck des Natürlichen; Stoff, Papier, Porzellan, Metall, sie schienen der Natur vom Menschen geliehen zu sein, um solche Extravaganzen hervorzubringen.
„Es ist wahr,“ fuhr Herzog Jean fort, „dass in den meisten Fällen die Natur allein unfähig ist, solche ungesunden, verdorbenen Gattungen zu erzeugen; sie liefert den ersten Stoff, den Keim und den Boden, die Nährmutter und die wesentlichen Bestandteile der Pflanze, die der Mensch aufzieht, modelliert, malt und schnitzt je nach seinem Gefallen.
So eigensinnig, so verworren, so beschränkt sie auch ist, sie hat sich schliesslich ergeben und ihr Meister hat es dahin gebracht, durch chemische Gegenwirkungen die Substanzen der Erde zu verändern, lang gereifte Zusammenstellungen, langsam vorbereitete Kreuzungen anzuwenden, sich geschickter Ableger, methodischer Pfropfreiser zu bedienen, und er bildet jetzt auf demselben Zweig Blumen verschiedener Farbe, erfindet für sie neue Nüancen und ändert nach seinem Willen die hundertjährige Form ihrer Pflanzen; er schleift die Blöcke ab, vollendet die Entwürfe, zeichnet sie mit seinem Stempel, drückt ihnen sein Kunstsiegel auf.
Kein Zweifel,“ meinte er, seine Betrachtungen zusammenfassend, „der Mensch kann in wenigen Jahren eine Zuchtwahl herbeiführen, die die faule Natur nur nach Jahrhunderten hervorzubringen vermag; heutzutage sind entschieden die Gärtner allein die wahren Künstler.“
Er fühlte sich etwas angegriffen und erstickte fast in der Atmosphäre der eingeschlossenen Pflanzen; die Wege, die er seit ein paar Tagen gemacht, hatten ihn ermüdet; der Wechsel der freien Luft und der lauwarmen Temperatur seiner Wohnung, die Unbeweglichkeit eines zurückgezogenen Lebens und die Bewegung eines freien Daseins waren zu schroff gewesen. Er verliess sein Vorzimmer und legte sich aufs Bett; aber mit einem einzigen Gegenstand beschäftigt, wie durch eine Federkraft in Bewegung gesetzt, fuhr der Geist, obgleich eingeschläfert, fort, seine Kette abzuwickeln; und es dauerte nicht lange, bis er der düstern Macht des Alps verfiel.
Er befand sich in einer Allee mitten im Gehölz. Es dämmerte; er ging an der Seite einer Frau, die er nie gekannt, noch je gesehen hatte. Sie war mager, hatte flachsgelbes Haar, ein Bulldoggengesicht voller Sommersprossen, schiefe Zähne, die unter der Stumpfnase hervorstanden. Sie trug eine grosse weisse Schürze, ein Tuch aus Büffelleder über die Brust geschlagen, halbhohe preussische Soldatenstiefel und eine schwarze Haube mit Rüschen verziert.
Sie schien eine Fremde und sah aus wie eine dem Jahrmarkt entlaufene Gauklerin.
Er fragte sich, wer dieses Weib sein möge, das er schon seit langem in seiner Intimität fühlte; er suchte vergeblich nach ihrem Ursprung, ihrem Namen, ihrem Gewerbe, ihrem Recht, neben ihm zu sein; ihm kam keine Erinnerung an diese unerklärliche Bekanntschaft, die doch zweifellos war.
Er forschte noch immer in seinem Gedächtnis, als plötzlich vor ihnen eine seltsame Figur zu Pferde erschien, die plötzlich herantrabte und sich dann im Sattel herumdrehte.
Jetzt erstarrte sein Blut vor Schreck in den Adern, wie gebannt blieb er an seinem Platz. Dieses doppelsinnige Gesicht, ohne Geschlecht, war grün, mit entsetzlichen Augen von kaltem, klarem Blau, die unter violetten Augenlidern hervorsahen; Ausschlag umgab den Mund; aussergewöhnlich magere Arme, wie die eines Skelettes, nackt bis zum Ellbogen, steckten aus zerrissenen Ärmeln hervor, zitternd vor Fieber, und fleischlose Lenden klapperten in übergrossen Reiterstiefeln.
Der entsetzliche Blick dieser Augen heftete sich auf Herzog Jean, durchdrang ihn, erstarrte ihn bis zum Mark; die Frau mit dem Bulldoggengesicht klammerte sich in wahnsinniger Angst an ihn, stiess ein Todesgeheul aus, den Kopf auf den steifen Hals hintenüber geworfen.
Und sogleich begriff er den Sinn dieser furchtbaren Erscheinung. Er hatte das Bildnis der Lustseuche vor sich.
Ausser sich und von Furcht getrieben warf er sich in einen Querweg, erreichte laufend einen Pavillon, der zwischen Ebenholzbäumen stand; dort sank er in einem Korridor auf einen Stuhl nieder.
Nach einigen Minuten, als er anfing wieder zu Atem zu kommen, vernahm er ein Schluchzen neben sich, er richtete den Kopf in die Höhe ... die Frau mit dem Bulldoggenkopf stand vor ihm; und jämmerlich grotesk weinte sie heisse Thränen, jammernd, dass sie während der Flucht ihre Zähne verloren habe, indem sie aus der Tasche ihrer grossen weissen Schürze Thonpfeifen hervorzog, die sie zerbrach, und die Stücke der weissen Röhren in die Löcher ihres Zahnfleisches steckte.
Teufel, jetzt wird sie ganz verrückt, dachte der Herzog, die Pfeifenrohrstücke werden niemals festsitzen, – und in der That, sie fielen auch alle eines nach dem andern wieder aus.
Im selben Augenblick vernahm er den Galopp eines Pferdes. Ein furchtbarer Schreck erfasste den Herzog; fast brachen seine Kniee unter ihm zusammen; der Galopp kam näher; die Verzweiflung trieb ihn wie mit einem Peitschenhieb in die Höhe. Er warf sich auf das Weib, das auf den zerbrochenen Thonstücken herumtrampelte, sie anflehend, ruhig zu sein, sie beide nicht zu verraten durch den Lärm ihrer Stiefel. Sie schlug mit Händen und Füssen um sich, er schleifte sie bis zum Ende des Korridors, sie fast erwürgend, um sie am Schreien zu hindern; plötzlich bemerkte er eine Wirtshausthür mit grünem Laden, ohne Klinke; er stiess sie auf, nahm einen Anlauf, blieb aber plötzlich stehen.
Vor sich, mitten in einer weiten Lichtung, sah er riesige, weisse Pierrots bei hellem Mondschein Bocksprünge machen.
Thränen der Entmutigung stiegen ihm in die Augen; niemals, nein niemals würde er die Schwelle der Thür überschreiten können.
Ich würde zertreten werden, dachte er, – und wie um seine Befürchtungen zu rechtfertigen, vervielfältigte sich die Zahl der ungeheuren Hanswurste; ihre Sprünge nahmen jetzt den ganzen Horizont und den ganzen Himmel ein, gegen welchen sie abwechselnd bald mit ihren Köpfen, bald mit ihren Füssen stiessen.
Jetzt hielt das Pferd an. Es war da, ... hinter einem runden Fenster in dem Korridor; mehr tot als lebendig drehte sich der Herzog um und sah durch das Fensterchen hindurch die steifen graden Ohren, die gelben Zähne, die Nasenlöcher, aus denen Dampf strömte, der nach Phenol roch.
Er sank nieder, auf ferneren Kampf wie auf die Flucht verzichtend; er schloss die Augen und machte sich auf alles gefasst, ersehnte selbst, nur um zu endigen, den Gnadenstoss. Ein Jahrhundert, das zweifellos nur eine Minute dauerte, verging; zitternd und schaudernd öffnete er wieder die Augen. – Alles war verschwunden; ohne Übergang, wie durch einen Aussichtswechsel, wie durch einen Dekorationstrick sah er eine abscheuliche Landschaft von Gestein in der Ferne verschwinden, eine wüste, bleiche, durchwühlte, tote Landschaft; diese schaurige Gegend war von einem ruhigen weissen Licht erhellt, das an die Strahlen des in Öl aufgelösten Phosphors erinnerte.
Auf dem Boden bewegte sich etwas, das sich als ein sehr blasses, nacktes Weib erwies, dessen Beine mit grünen Strümpfen bekleidet waren.
Er betrachtete sie neugierig; wie mit heissem Eisen gebrannte Pferdehaare kräuselte sich ihr Haar, an der Spitze gespalten; Urnen von Nepenthes hingen an ihren Ohren; wie gekochtes Kalbfleisch glänzte das Innere ihrer weit geöffneten Nasenlöcher. Mit verzückten Augen rief sie ihn leise.
Er hatte nicht Zeit zu antworten, denn schon veränderte sich das Aussehen dieses Weibes; Flammen schossen aus ihren Augen; ihre Lippen färbten sich mit wildem feurigen Rot.
Eine plötzliche Erkenntnis überkam ihn: das ist die Blume, sagte er sich.
Er entdeckte auf der Haut des Körpers schwarzbraune, kupferrote Flecke; er schreckte verstört zurück, aber das Auge des Weibes zog ihn zauberisch an und langsam trat er näher, versuchend, nicht weiter zu gehen, niedersinkend, und sich dennoch wieder aufraffend, um sich ihr zu nähern. Schon berührte er sie fast, als plötzlich schwarze Amorphophallen von allen Seiten hervorsprangen und sich auf den Leib des Weibes losstürzten, der sich hob und senkte wie ein wildbewegtes Meer. Er schob sie beiseite, stiess sie zurück, einen grenzenlosen Widerwillen empfindend, während er zwischen seinen Fingern diese warmen aber festen Stengel wimmeln sah; dann waren die abscheulichen Pflanzen plötzlich wieder verschwunden und zwei Arme suchten ihn zu umschlingen; die Angst machte sein Herz heftig schlagen, denn die Augen, die schrecklichen Augen des Weibes hatten einen kalten grausamen, entsetzlichen Ausdruck angenommen. Er machte eine übermenschliche Anstrengung, um sich ihrer Umarmung zu entwinden, aber mit unwiderstehlicher Gewalt hielt sie ihn zurück, erfasste ihn, und mit irrem Blick sah er unter dem hochgehobenen Schenkel das wilde Nidularium sich klaffend und blutend entfalten.
Er streifte mit seinem Körper die scheussliche Wunde dieser Pflanze; er fühlte sich dem Tode nahe ... da fuhr er plötzlich aus dem Schlafe auf, halb erstickt, eiskalt, fast wahnsinnig vor Angst, und erleichtert aufatmend seufzte er:
„Gott sei Dank, dass es nur ein Traum!“
Dieses Alpdrücken wiederholte sich; er fürchtete sich vor dem Einschlafen. Er blieb stundenlang auf seinem Bett ausgestreckt, bald in anhaltender Schlaflosigkeit und fieberhafter Aufregung, bald in schrecklichen Träumen, in denen er den Boden unter den Füssen verlor, eine Treppe hinunterstürzte oder in einen Abgrund fiel, ohne sich festhalten zu können.
Das während einiger Tage eingelullte Nervenleiden gewann wieder die Oberhand und trat heftiger und eigensinniger unter neuen Formen auf.
Jetzt belästigten ihn die Decken; er erstickte unter ihnen, hatte ein Kribbeln im ganzen Körper, Hitze im Blut. Ein Prickeln peinigte ihn am ganzen Leibe. Zu diesen Symptomen kam bald ein dumpfer Schmerz in den Kinnbacken hinzu und das Gefühl, als wenn seine Schläfen in einen Schraubstock gepresst würden.
Seine Befürchtungen wuchsen; unglücklicherweise fehlten die Mittel, diese hartnäckige Krankheit zu bezwingen.
Ohne Erfolg hatte er Kaltwasserapparate in seinem Ankleidezimmer herrichten zu lassen versucht. Die Unmöglichkeit, das Wasser auf die Höhe, auf der sein Haus lag, hinaufzuleiten, die Schwierigkeit, es sich in genügender Quantität zu verschaffen in einem Dorf, wo die Brunnen sparsamkeitshalber nur zu gewissen Stunden im Betrieb waren, verhinderte die Benutzung; da er sich nicht durch den Wasserstrahl peitschen lassen konnte, der, kräftig auf die Wirbelsäule gerichtet, mächtig genug war, um die Schlaflosigkeit zu bekämpfen und die Ruhe herbeizuführen, musste er sich mit kurzen Abwaschungen in seiner Badewanne oder mit einfachen Übergiessungen begnügen, worauf er sich von seinem Diener mit Pferdehaarhandschuhen frottieren liess.
Aber dieses schwache Mittel hemmte das Vorschreiten des Nervenleidens keineswegs; höchstens empfand er während einiger Stunden etwas Erleichterung, übrigens teuer genug bezahlt durch die Rückfälle, die sich immer heftiger erneuerten.
Seine Unzufriedenheit nahm mehr und mehr zu; die Freude, einen seltenen Blumenflor zu besitzen, war verflogen; er war schon gegen ihre Farben und Formen abgestumpft; denn trotz aller Sorgfalt, mit der er sie pflegte, verwelkten die meisten seiner Pflanzen. Er liess sie daher aus seinen Zimmern entfernen.
Jetzt ärgerte ihn wieder bei seiner Reizbarkeit der leere Raum, den sie vorher eingenommen hatten.
Um sich zu zerstreuen und die endlosen Stunden zu töten, nahm er Zuflucht zu seinen Kupferstichen und ordnete seine Goyas. Die ersten Drucke der „Capriccios“, an ihrem rötlichen Ton erkennbar, früher einmal mit schwerem Gelde erstanden, heiterten ihn auf. Er vertiefte sich in sie, den Phantasieen des Künstlers folgend, verliebt in seine phantastischen Scenen, seine auf Katzen reitenden Hexen, seine Weiber, die da versuchen, einem Gehängten die Zähne auszureissen, seine Räuber, seine Dämonen und Zwerge.
Dann durchblätterte er alle andern Serien seiner Radierungen und Aquatintazeichnungen, seine unheimlichen „Sprichwörter“, seine wilden Kriegs-Skizzen, seinen Kupferstich des Garot, von dem er einen wunderbaren Künstlerabdruck auf dickem Papier von sichtbaren Wasserstreifen durchzogen, besonders gern hatte.
Das wilde Feuer, das herbe, stürmische Talent von Goya fesselte ihn; aber die allgemeine Bewunderung, die seine Werke erlangt hatten, brachten ihn trotzdem etwas von ihm ab, und er hatte daher davon abgesehen, sie einrahmen zu lassen, aus Furcht, dass, wenn er sie zur Schau stellte, der erste beste Einfaltspinsel es für nötig hielte, Dummheiten darüber loszulassen oder vor Entzücken ausser sich zu geraten.
Es ging ihm ebenso mit seinen Rembrandts, die er dann und wann mit heimlichem Entzücken betrachtete; denn wie die schönste Arie der Welt unausstehlich wird, sobald sie der Pöbel summt und die Strassenorgel sich ihrer bemächtigt, so wird das Kunstwerk, das den unselbständigen Künstler zur Nachahmung reizt, das die Dummköpfe loben und das sich nicht damit begnügt, die Begeisterung von wenigen zu erregen, ebenfalls für die Kenner entweiht, banal, ja widerwärtig.
Dieses Schwanken in seiner Bewunderung war übrigens mit sein grösster Kummer; äusserliche Erfolge hatten ihm Bilder und Bücher, die ihm ehemals teuer waren, für immer verleidet; infolge des Beifalls der Stimmenmehrheit entdeckte er zuletzt Mängel, die gar nicht da waren, er wies sie zurück, indem er sich fragte, ob sein Scharfsinn sich nicht abstumpfe und ihn betrüge.
Er schloss seine Mappen und verfiel wieder einmal seinen schwankenden Gefühlen und unfruchtbaren Grübeleien. Um den Lauf seiner Gedanken zu ändern, nahm er besänftigende Lektüre zur Hand, versuchte sich das Gehirn abzukühlen. Er las die Romane von Dickens, an denen sich die Genesenden und die Unglücklichen entzücken.
Aber diese Bücher brachten die entgegengesetzten Wirkungen hervor, als er erwartet hatte: er sah nur keusch Liebende, steif gekleidete Heldinnen, die nur beim Sternenlicht lieben und sich begnügen, die Augen zu senken, zu erröten oder vor Glück zu weinen, indem sie sich die Hände drücken. Diese übertriebene Keuschheit führte ihn der entgegengesetzten Übertreibung zu; so dass er von einem Extrem ins andere fiel, sich mächtig bewegter Scenen erinnerte, an die sexuellen Beziehungen zwischen Mann und Weib und an ihre Küsse dachte.
Er unterbrach seine Lektüre und grübelte weiter über die Prüderie Englands. Er wurde von einer seltsamen Aufregung befallen. Die Zeugungsunfähigkeit seines Gehirns und seines Körpers, die er für eine permanente gehalten hatte, verschwand. Die Einsamkeit wirkte belebend auf seine Nerven. Die sinnliche Seite, seit Monaten ganz unempfindlich, war zuerst wieder durch die entnervende fromme Lektüre angeregt, dann durch die englische Ziererei zu einer Nervenkrisis gesteigert und stand jetzt in voller Blüte da; durch die Erregtheit seiner Sinne in die Vergangenheit zurückgeführt, watete er im Schmutz seiner alten Erinnerungen herum. –
Er stand auf und öffnete schwermütig eine kleine vergoldete Dose, deren Deckel mit glitzernden Steinen besetzt war.
Sie war voll von violetten Bonbons; er nahm einen heraus und ihn mit den Fingerspitzen leicht berührend, dachte er an die seltsamen Eigentümlichkeiten dieses Bonbons. Damals, als er sich seiner Impotenz klar ward, als er noch ohne Bitterkeit, ohne Bedauern, ohne neues Verlangen an das Weib dachte, legte er einen dieser Bonbons auf die Zunge, liess ihn zergehen, und plötzlich stiegen mit einer unendlichen Sanftheit verwischte Rückerinnerungen an wollüstige Ausschweifungen in ihm auf.
Diese Bonbons, von Siraudin erfunden und mit dem lächerlichen Namen „Perles de Pyrénées“ bezeichnet, enthielten einen Tropfen Sarcanthusöl. Sie drangen in die Schleimhäute ein und erinnerten ihn an die Wollust aromatischer Küsse.
Gewöhnlich lächelte er beim Einatmen dieses verliebten Aromas, das ihm ein Teilchen Nacktheit vor das geistige Auge führte und für einen Augenblick wieder das Verlangen nach dem noch vor kurzem angebeteten Geruch bestimmter Frauen in ihm rege machte.
Jetzt wirkten sie nicht mehr heimlich und leise, sie beschränkten sich nicht mehr darauf, das Bild ferner und konfuser Ausschweifungen anzufachen – im Gegenteil, die Schleier zerrissen, und vor seinen Augen entstand die verkörperte, zudringliche, brutale Wirklichkeit.
An der Spitze der Fata morgana ehemaliger Geliebten, welche der Genuss dieses Bonbons in klaren Zügen zu zeichnen half, befand sich eine mit grossen weissen Zähnen, mit einer Haut wie von rosa Atlas, die Nase wie gemeisselt, mit kleinen Mäuseaugen und kurz abgeschnittenem blonden Haar.
Sie hiess Miss Urania, war Amerikanerin und eine der berühmtesten Akrobatinnen des Cirkus, deren schön proportionierter Körper, kräftige Schenkel und Muskeln von Stahl und Eisen Aufsehen erregte.
Herzog Jean hatte sie während langer Abende aufmerksam beobachtet; die ersten Male war sie ihm wie sie wirklich war erschienen, das heisst kräftig und hübsch, aber der Wunsch, sich ihr zu nähern, packte ihn nicht; sie besass nichts, was sie der Lüsternheit eines blasierten Menschen begehrlich machen konnte, und doch ging er wieder nach dem Cirkus hin, angelockt, ohne zu wissen wovon, getrieben von einem schwer zu erklärenden Gefühl.
Während er ihre Bewegungen verfolgte, machte er eine sonderbare Beobachtung; in dem Masse, wie er ihre Geschmeidigkeit und ihre Kraft bewunderte, sah er eine Geschlechtsveränderung mit ihr vorgehen: ihre zierlichen und weiblichen Bewegungen verwischten sich mehr und mehr, während sich die gewandten und kräftigen Reize des Mannes dafür vordrängten; kurz, nachdem sie sich zuerst als Weib gezeigt, dann für eine kurze Zeit geschlechtslos gewesen war, schien sie vollständig Mann geworden zu sein. „Diese Akrobatin könnte sich, wie sich ein kräftiger Kerl in ein zartes Mädchen verliebt, auch in einen Schwächling, wie ich es bin, verlieben,“ sagte sich der Herzog; und indem er sich betrachtete und Vergleiche zog, wurde es ihm klar, dass er immer femininer wurde; und er sehnte sich nach dem Besitz dieser Frau und begehrte sie, wie sich ein bleichsüchtiges junges Mädchen wohl nach einem robusten Manne sehnt, dessen Liebkosungen sie zu erdrücken drohen.
Dieser Austausch des Geschlechtes zwischen der Akrobatin und ihm begeisterte ihn. „Wir sind für einander bestimmt,“ überzeugte er sich selbst.
Eines schönen Abends entschloss er sich, die Logenschliesserin abzuschicken. Aber Miss Urania hielt es für angemessen, ihm nicht eher Gehör zu schenken, bis er ihr den üblichen Hof gemacht; doch zeigte sie sich wenig grausam, denn durch Hörensagen wusste sie, dass der Herzog des Esseintes reich war und dass sein Name genügte, um eine Frau in Mode zu bringen.
Aber sobald seine Wünsche Erhörung gefunden hatten, übertraf seine Enttäuschung alle bisherige Erfahrung. Er hatte sich die Akrobatin dumm und roh wie einen Jahrmarktsringer vorgestellt, ihre Dummheit war aber unglücklicherweise nur weiblich. Gewiss, es fehlte ihr an Erziehung und an Takt, sie hatte weder Verstand noch Geist und sie bewies bei Tisch einen tierischen Eifer, anderseits aber waren alle kindlichen Gefühle des Weibes in ihr vorhanden; sie schwatzte auch und kokettierte wie alle von ihren Albernheiten eingenommenen Frauenzimmer.
Dabei bewahrte sie im Bett eine puritanische Zurückhaltung und zeigte keine jener athletischen Roheiten, die er ersehnte, aber auch gleichzeitig fürchtete. Sie war nicht, wie er es einen Augenblick gehofft, den Aufregungen ihres Geschlechts unterworfen. Doch wenn er den Mangel ihrer Sinnlichkeit recht untersucht hätte, so würde er eine Neigung zu einem zarten, schmächtigen Wesen, zu einem ihm ganz entgegengesetzten Temperamente, einem mageren Clown, entdeckt haben.
Unglücklicherweise trat der junge Herzog wieder in die einen Moment vergessene Männerrolle zurück; seine Eindrücke von weiblicher Natur, von Schwäche, verschwanden; die Illusion war nicht mehr möglich. Miss Urania war eine ganz gewöhnliche Maitresse, die in keiner Weise den neugierigen Erwartungen des Gehirns entsprach, die sie anfangs hervorgerufen hatte.
Obgleich der Reiz ihrer weichen, frischen Haut, ihrer prächtigen Schönheit den Herzog zuerst überrascht und bei ihr zurückgehalten hatte, suchte er dieses Verhältnis schnell wieder zu lösen und den Bruch zu beschleunigen, denn seine frühzeitige Impotenz verschlimmerte sich noch bei den eisigen Liebkosungen, bei dem gezierten Wesen dieses Mädchens.
Und doch war sie die erste, die vor ihm stehen blieb bei dem ununterbrochenen Vorbeimarsch dieser wollüstigen Bilder; wenn sie sich aber schliesslich seinem Gedächtnis doch fester eingeprägt hatte als eine Menge anderer, deren Reize weniger trügerisch und deren Genüsse weniger beschränkt gewesen waren, so lag das an dem gesunden und kräftigen Geruch ihres weiblichen Körpers; dieser Überfluss an Gesundheit war das Gegenteil der Blutarmut, die man mit Parfüms auffrischte, deren feinen Geruch er in dem zarten Siraudin-Bonbon wiederfand.
Er gedachte seiner andern Geliebten. Sie drängten sich wie eine Herde in seinem Gehirn zusammen, doch alle überragte ein Weib, dessen eigentümlicher Reiz ihn während mehrerer Monate aussergewöhnlich gefesselt hatte.
Es war eine kleine, magere Brünette mit schwarzen Augen und pomadisierten Haaren, die auf dem Kopfe wie mit einem Pinsel angeklebt waren, mit einem Scheitel auf der linken Seite, der ihr das Aussehen eines Jungen gab.
Er hatte sie in einem Café-Konzert kennen gelernt, wo sie Bauchredner-Vorstellungen gab.
Zum Erstaunen der Zuschauer, die sich fast unbehaglich bei diesen Ausführungen fühlten, liess sie abwechselnd Kinder aus Pappe sprechen, die wie Orgelpfeifen auf Stühlen aufgestellt waren.
Herzog Jean war bezaubert gewesen; eine Menge von Ideen keimten in ihm auf. Zuerst beeilte er sich, die Bauchrednerin mit Haufen von Banknoten zu bändigen, da sie ihm gerade wegen des Kontrastes, den sie zu der Amerikanerin bildete, gefiel. Diese kleine Brünette brannte wie ein Krater; aber trotz all ihrer angewandten künstlichen Mittel erschöpfte sich der Herzog in wenigen Stunden; er fuhr indessen fort, sich willfährig von ihr ausziehen zu lassen, denn mehr als die Geliebte zog ihn das Phänomen an.
Endlich waren die Pläne, die er gemacht hatte, gereift.
Er liess eines Abends eine Sphinx aus schwarzem Marmor bringen, in der klassischen Stellung liegend, mit ausgestreckten Tatzen, mit steifem, geradem Kopf, und eine Chimäre aus buntem Thon, mit gesträubter Mähne, wilde Blicke werfend, mit den Strähnen ihres Schweifes ihre geschwollenen Seiten fächelnd. Er stellte die beiden Tiere in seinem Zimmer auf und löschte die Lampen aus. Die glühenden Kohlen im Kamin glommen weiter und vergrösserten alle Gegenstände, die wie im Schatten verschwanden.
Dann streckte er sich auf dem Sofa aus, nahe seiner Geliebten, deren unbewegliches Gesicht von dem Schein der Glut erleuchtet wurde, und wartete.
Mit seltsamen Tönen und Ausdrücken, welche er sie lange und geduldig vorher hatte einüben lassen, belebte sie, ohne die Lippen zu bewegen, ohne sie nur anzusehen, die beiden Ungeheuer.
Und in der Stille der Nacht begann jetzt der wunderbare Dialog zwischen der Chimäre und der Sphinx, vorgetragen mit tiefen, rauhen Kehllauten, dann in scharfer, feiner Stimme:
„Hier, Chimäre, halte still.“
„Nie und nimmer.“
Gewiegt von der entzückenden Prosa Flauberts, hörte er schwer atmend das schreckliche Duett, und ein Schauder durchflog ihn vom Nacken bis zur Zehe, als die Chimäre die feierlichen und zauberhaften Worte ausspricht:
„Ich suche neue Wohlgerüche, prächtigere Blumen, unbekannte Genüsse.“ –
Ach! es war ihm, als ob diese Stimme zu ihm selbst, geheimnisvoll, wie in einer Beschwörung, sprach.
Das ganze Elend seiner eigenen nutzlosen Anstrengungen strömte ihm zum Herzen zurück. Sanft umfasste er das schweigende Weib wie ein ungetröstetes Kind; nicht einmal das verdriessliche Gesicht der Komödiantin beachtete er, die genötigt war, eine Scene zu spielen und ihr Handwerk noch während ihrer Mussestunden auszuüben.
Ihr Verhältnis dauerte fort, doch bald verschlimmerte sich die Schwäche des Herzogs; die Aufwallungen seines Gehirns schmolzen nicht mehr das Eis seines Körpers; die Nerven gehorchten nicht mehr seinem Willen; die leidenschaftlichen Thorheiten der Greise beherrschten ihn. Da er sich mehr und mehr bei seiner Geliebten schwach werden fühlte, nahm er seine Zuflucht zu dem wirksamsten Hilfsmittel der alten und unbeständigen Aufreizung, zu der Furcht.
Während er seine Maitresse in seinen Armen hielt, erscholl hinter der Thür eine rauhe Säuferstimme: „Wirst du gleich öffnen? Ich weiss sehr gut, dass du mit einem reichen Gimpel zusammen bist, na warte nur, du Schlange!“
Wie die Wüstlinge in der Gefahr einen Reiz empfinden und im Freien, auf den Böschungen, im Garten der Tuilerieen, im Wald oder auf einer Bank ihre Sinnlichkeit befriedigen, so fand der Herzog vorübergehend seine Kräfte wieder und stürzte sich auf die Bauchrednerin, deren Stimme hinter der Thür tobte, und empfand unerhörte Genüsse in diesem Herumstossen, in dieser Angst des Mannes, der sich in Gefahr befindet.
Unglücklicherweise waren diese Freuden von kurzer Dauer, denn trotz der enormen Summen, die er der Bauchrednerin bezahlte, verabschiedete ihn diese schliesslich und gab sich noch demselben Abend einem strammen Burschen hin, dessen Ansprüche weniger kompliziert, dessen Lenden aber kräftiger waren.
Diese Komödiantin hatte er wirklich bedauert und bei der Erinnerung an ihre Geschicklichkeit schienen ihm die andern Frauen anmutlos.
Eines Tages, da er allein in der Avenue de Latour-Maubourg spazieren ging, in seine Betrachtungen und seinen Widerwillen gegen das weibliche Geschlecht vertieft, wurde er nahe bei der Esplanade des Invalides von einem jungen Menschen angeredet, der ihn bat, ihm den kürzesten Weg nach der Rue de Babylone zu zeigen.
Herzog Jean bezeichnete ihm den Weg, welchen er einzuschlagen hatte, und da auch er die Esplanade entlang ging, so schritten sie zusammen weiter.
„Sie glauben, dass es, wenn ich links gehen würde, ein Umweg wäre,“ fuhr der junge Mann zu fragen fort, „man hatte mir gesagt, die Avenue in schräger Richtung zu verfolgen“ ... seine Stimme klang leise und schüchtern, fast bittend.
Der Herzog betrachtete ihn näher. Er schien aus dem Gymnasium gekommen zu sein, war ärmlich gekleidet, trug eine kurze Jacke aus Cheviot, eine schwarze enge Hose, niedergeschlagenen Kragen und eine lose dunkelblaue Krawatte mit weissen Punkten.
In der Hand hielt er ein Schulbuch und hatte auf dem Kopf einen runden braunen Hut mit glattem Rand.
Sein Gesicht war beunruhigend; blass und müde, doch ziemlich regelmässig und von langem, schwarzem Haar umrahmt; er hatte grosse feuchte Augen mit blauen Rändern, um die Nase herum einige Sommersprossen und einen kleinen Mund mit starken Lippen, die in der Mitte wie eine Kirsche gespalten waren.
Sie sahen sich eine Weile an, gerade ins Gesicht, dann schlug der junge Mensch die Augen nieder und kam näher; sein Arm streifte bald den des Herzogs, der seinen Schritt mässigte und nachdenklich den wiegenden Gang des Jünglings betrachtete.
Und aus dieser zufälligen Begegnung war eine Freundschaft entstanden, die sich Monate lang hinzog.
Der Herzog dachte mit Schaudern an sie zurück, niemals hatte er einen anziehenderen und herrischeren Pakt ertragen, niemals hatte er solche Gefahren gekannt und niemals noch sich so schmerzhaft befriedigt gefühlt.
Unter allen Erinnerungen, die ihn in seiner Einsamkeit bestürmten, beherrschte dieses Liebesverhältnis alle andern. –
Jetzt erwachte er aus seinen Träumereien, gebrochen, vernichtet, sterbend, und schnell alle Lichte und Lampen anzündend, hoffte er in dieser Flut von Licht weniger deutlich das dumpfe, unaufhörliche, unausstehliche Klopfen der Pulsadern zu vernehmen.
Während dieser seltsamen Krankheit, die blutarme Menschen hinwegrafft, traten plötzlich kurze Pausen der Krisen ein. Ohne dass er sich ihren Grund zu erklären vermochte, wachte der Herzog eines Tages ganz kräftig auf. Da war nichts mehr von aufreibendem Husten zu spüren, keine stechenden Schmerzen mehr im Nacken, nur ein unbeschreibliches Gefühl von Wohlbehagen, eine Leichtigkeit des Hirns, dessen Gedanken sich erhellten.
Dieser Zustand währte mehrere Tage; dann plötzlich zeigten sich eines Nachmittags wiederum Hallucinationen des Geruchssinnes.
Sein Zimmer duftete wie von Backwerk und Parfüm; er sah nach, ob nicht ein geöffnetes Flacon umherstand; doch nirgends war ein solches zu finden. Er lief durch alle seine Gemächer: der Geruch dauerte fort.
„Riechen Sie nichts?“ fragte er.
Der alte Mann erklärte, dass er keinen Blumengeruch bemerke: es konnte kein Zweifel mehr bestehen, das Nervenleiden zeigte sich wieder unter einer neuen Sinnestäuschung.
Gelangweilt von der Hartnäckigkeit dieses eingebildeten Aromas, beschloss er, sich in wirkliche Parfüms zu tauchen, hoffend, dass diese Nasenhomöopathie ihn heilen, oder wenigstens die Verfolgung des lästigen Geruches aufhören würde.
Er begab sich in sein Ankleidezimmer. Dort standen nahe bei einem antiken Taufbecken, das ihm als Waschgefäss diente, unter einem breiten Spiegel von getriebenem Eisen Flaschen in allen Grössen und allen Formen auf Etageren aus Elfenbein übereinander.
Er stellte sie auf einen Tisch und teilte sie in zwei Serien: die eine mit einfachen Parfüms, Extrakten und Spiritussen, die andere mit zusammengesetzten Parfüms, die man mit dem allgemeinen Ausdruck „Bouquets“ bezeichnet.
Er drückte sich in seinen Sessel und sammelte sich.
Er war schon seit Jahren in der Wissenschaft des Riechens geübt und war überzeugt, dass man durch den Geruch die gleichen Genüsse empfinden könne wie durch das Gehör und das Gesicht, indem jeder Sinn infolge einer natürlichen Neigung und Angewöhnung genugsam empfindlich sei, neue Eindrücke aufzunehmen, sie zu verzehnfachen und zu verarbeiten.
In der Kunst der Parfümbereitung hatte ihn eine Seite vor allem angezogen, nämlich die der künstlichen Genauigkeit.
Das Parfüm stammt fast niemals von den Blumen, deren Namen es trägt; der Fabrikant, der es wagen würde, nur einzig der Natur ihre Elemente zu entlehnen, würde doch nur ein unechtes Werk schaffen, ohne Natürlichkeit.
Mit Ausnahme des unnachahmlichen Jasmin, welcher keine Fälschung zulässt, sind alle Blumengerüche genau durch Verbindungen mit aromatischem Weingeist und Spiritus darstellbar.
Nach und nach hatten sich die geheimen Operationen dieser so arg vernachlässigten Kunst vor dem Herzog erschlossen, der ihren geheimen Wegen nachging.
Um dies zu erreichen, hatte er zuerst die Grammatik durchgearbeitet, die Syntax der Gerüche erlernt, wie auch die Regeln, die sie regieren, ergründet. Mit dieser Sprache einmal vertraut, musste er die Werke der Meister wie Atkinson und Lubin, Chardin und Violet, Legrand und Piesse vergleichen, die Konstruktion ihrer Sätze zerlegen, das Verhältnis ihrer Worte und die Aufstellung ihrer Satzgefüge abwägen.
Die klassische Parfümerie war ziemlich einförmig, fast farblos, vor langer Zeit von Chemikern in eine gleichmässige Form gegossen.
Ihre Geschichte folgte Schritt für Schritt der Sprache unserer Zeit.
Der parfümierte Stil Ludwigs XIII., aus teuren Bestandteilen zusammengesetzt, aus Iris, Moschus, Zibeth-Puder, Myrtenwasser, schon damals unter dem Namen „Eau des Anges“ bekannt, war kaum genügend, um die ungezwungenen Reize, die etwas rohen Färbungen jener Zeit auszudrücken, welche uns gewisse Sonette von Saint-Armand aufbewahrt haben.
Später, mit der Myrrhe, dem Oliban, einer Art Weihrauch, wurden die mystischen Wohlgerüche kräftig und streng; die pomphafte Art des grossen Jahrhunderts, die weitschweifigen Feinheiten der Redekunst, der breite, getragene Stil Bossuets und der Kanzelredner fanden ihren Niederschlag. Noch später fanden die erschlafften, kunstvollen Reize der französischen Gesellschaft unter Ludwig XV. leichter ihren Dolmetscher in dem Frangipan und dem Maréchale, die gleichsam die Synthese dieser Epoche selbst gaben. Dann, nach der Langeweile und Gleichgültigkeit des ersten Kaiserreichs, in dem man die Eaux de Cologne sowie die Präparationen von Rosmarin missbrauchte, stürzte sich die Parfümerie hinter Victor Hugo und Gautier her in das Land der Sonne; sie schuf orientalische Wohlgerüche, scharfwürzige Bouquets, entdeckte neue Zusammenstellungen, bis jetzt nicht gewagte Gegensätze, wählte aus und nahm wieder alte Nüancen auf, welche sie komplizierte, verfeinerte und passend zusammensetzte. Sie verwarf schliesslich energisch diese freiwillige Abgelebtheit, zu welcher sie Malesherbes, Boileau, Andrieux, Baour-Lormian herabgesetzt hatten, diese niedrigen Destillateure ihrer Gedichte.
Aber auch seit der Periode von 1830 war diese Sprache nicht stehen geblieben. Sie hatte sich noch weiter fortentwickelt und, sich nach dem Gang des Jahrhunderts formend, war sie gleichlaufend mit den andern Künsten vorgeschritten, hatte sich auch den Wünschen der Kunstfreunde und Künstler gefügt, sich auf die Chinesen und Japaner gestürzt, duftende Stammbücher erfunden, Blumensträusse von Takéoka nachgeahmt, durch Mischungen von Lavendel und Goldlack den Geruch des Rondeletia, durch eine Verbindung von Patschuli und Kampfer den sonderbaren Duft der chinesischen Tinte, durch die Zusammensetzung von Citrone, Levkoje und Pommeranzblütessenz die Ausströmung des japanesischen Hovénia erhalten.
Der Herzog studierte und analysierte die Seele dieser Fluida, machte die Exegese dieser Texte; er gefiel sich zu seiner eigenen Befriedigung darin, die Rolle eines Psychologen zu spielen, das Räderwerk auseinander zu nehmen und wieder zusammenzustellen, die Stücke abzuschrauben, die die Struktur einer zusammengesetzten Ausströmung bildeten, und bei dieser Ausübung hatte sein Geruchssinn die Sicherheit eines fast unfehlbaren Prüfsteins erlangt.
Wie ein Weinhändler das Gewächs an einem Tropfen, den er schlürft, erkennt, wie ein Hopfenhändler an dem Geruch des Sackes den genauen Wert der Ware bestimmen kann, wie ein chinesischer Kaufmann sofort die Herkunft des Thees, der ihm vorgehalten wird, anzugeben vermag und sagen kann, auf welchen Pachtungen des Berges Bohées, in welchen buddhistischen Klöstern er gezogen ist, und selbst den Zeitpunkt, an dem seine Blätter gepflückt, und den Grad des Dörrens zu bezeichnen weiss, sowie den Einfluss, dem er in der Nähe der Pflaumenblüte, der Aglaia, der duftenden Olea, aller dieser Wohlgerüche ausgesetzt gewesen ist, die dazu dienen, seine Natur zu verändern, eine unvermutete Steigerung hervorzurufen und in seinem trockenen Geruch einen Duft ferner frischer Blumen zu erzeugen – ebenso konnte der Herzog auch, wenn er nur ein Tröpfchen Parfüm einatmete, gleich die Dosis seiner Mischung hernennen, die Psychologie seiner Mixtur erklären und den Künstler erkennen, der das Aroma hergestellt und ihm die persönliche Marke seines Stils aufgedrückt hatte.
Es versteht sich von selbst, dass er die Sammlung aller von den Parfümeuren angewendeten Produkte besass; er hatte selbst das echte Mekkabalsamkraut, dieses seltene Kraut, das nur in gewissen Teilen des steinigen Arabiens wächst und dessen Monopol dem Sultan gehört. –
Und nun sass Herzog Jean in seinem Ankleidezimmer und sann darauf, ein neues Bouquet zu erfinden, er war von dem Augenblick des Zögerns erfasst, den die Schriftsteller nur zu gut kennen, wenn sie nach Monaten der Ruhe ein neues Werk beginnen.
Ebenso wie Balzac, der von dem unabweislichen Bedürfnis verfolgt war, erst viel Papier zu bekritzeln, ehe er imstande war zu schreiben, so erkannte Herzog Jean die Notwendigkeit, sich erst durch einige leichtere Arbeiten in Gang zu bringen.
Er fing an, die Flaschen mit Mandeln und Vanille zu wägen, um Heliotrop herzustellen, dann besann er sich anders und entschloss sich, mit der Riecherbse zu beginnen.
Die Formel, das Verfahren waren ihm entfallen; er tastete. Im allgemeinen herrscht bei dem Duft dieser Blume die Orange vor; er versuchte mehrere Zusammensetzungen und erreichte schliesslich den richtigen Ton, indem er der Orange die Tuberose und die Rose hinzufügte, welche er mit einem Tropfen Vanille verband.
Die Ungewissheiten verschwanden; ein leichtes Fieber erfasste ihn, er fühlte sich zur Arbeit angeregt und beschloss, weiter zu gehen und einen fulminanten Satz loszulassen, dessen stolzes Geprassel das Geflüster dieses arglistigen Parfüms niederwerfen würde, der noch immer im Zimmer lastete.
Er experimentierte mit dem Amber, dem Tonkin-Moschus, dem Patschuli, dem schärfsten aller vegetabilischen Parfüms, dessen Blume einen Geruch von Schimmel und Rost ausströmt.
Aber was er auch versuchte, die Liebeleien des XVIII. Jahrhunderts verfolgten ihn; die Reifröcke und seidenen Garnierungen schwebten vor seinen Augen, die Erinnerungen der Venusse von Boucher, aus vollem Fleisch, ohne Knochen, in üppigster Gestalt, liessen sich an seinen Wänden nieder; der Rückblick auf den Roman Thermidor, auf die entzückende Rosette mit hochgeschürztem Rock peinigte ihn.
Wütend stand er auf, und um sich frei zu machen, sog er mit aller Kraft die reine Essenz des Spika-Nard ein, der den Orientalen so teuer und den Europäern so unangenehm ist wegen seines zu starken Geruchs von Baldrian. Er war fast betäubt von der Heftigkeit der Erschütterung.
Wie durch einen Hammerschlag zermalmt verschwand das Filigran des zarten Duftes.
Früher hatte er sich gern in Akkorden von Düften gewiegt; er gebrauchte ähnliche Effekte wie die der Poeten, wendete gewissermassen die vortreffliche Anordnung der Stücke von Baudelaire an, wie zum Beispiel in „L’Irréparable“ und „Le Balcon“, wo der letzte der fünf Verse, welche die Strophe bilden, das Echo des ersten ist und wie ein Refrain zurückkommt und die Seele in die Unendlichkeit von Schwermut und Sehnsucht taucht.
Er verlor sich in den Träumen, welche diese duftenden Stanzen in ihm hervorriefen; ihn verlangte, in einer wunderbaren und wechselnden Landschaft herumzustreichen, und deshalb fing er mit einem vollen und stattlichen Satz an, der plötzlich einen Durchblick auf eine grossartige Landschaft eröffnete.
Mit seinen Vaporisateuren spritzte er im Zimmer eine Essenz, aus Ambrosia, Mitcham-Lavendel, Riecherbse und Bouquet gebildet, umher, eine Essenz, die, wenn sie von einem Künstler destilliert, den Namen verdient, den man ihr zuerkannt hat: „Extrait de Pré fleuri“; in diese blühende Wiese führte er dann eine genaue Fusion von Tuberose, Orangeblüte und Mandel ein; und alsbald entstand künstlicher Flieder und der Wind schien leise durch blühende Linden zu streichen, ihre zarten Ausströmungen auf den Boden niederdrückend, welche dem Extrakt der englischen Tilia ähneln.
Dann liess er durch einen Ventilator die duftenden Wellen entfliehen, nur die Landschaft beibehaltend, die er erneute und deren Dosis er verstärkte, um ihre Rückkehr zu erzwingen.
Bald stiegen Hüttenwerke gen Himmel auf.
Ein starker Geruch von Fabriken, von chemischen Produkten verbreitete sich, und doch hauchte die Natur noch in dieser verpesteten Luft ihre süssen Düfte aus.
Der Herzog bearbeitete und wärmte zwischen seinen Fingern eine Storax-Kugel, und ein höchst eigentümlicher Geruch verbreitete sich im Zimmer, ein Geruch, widerlich und köstlich zugleich, dem entzückenden Geruch der Jonquille und dem hässlichen Gestank der Guttapercha und dem Steinkohlenöl ähnlich.
Er desinfizierte sich die Hände, legte sein Harz in einen hermetisch verschlossenen Kasten, und die Fabriken verschwanden. Dann schleuderte er zwischen die wieder belebten Linden und Wiesen einige Tropfen New Mown Hay, und mitten in der zauberhaften Landschaft, ihres Flieders beraubt, stiegen Heugarben empor, eine neue Jahreszeit suggerierend und ihre feinen Ausströmungen aushauchend.
Endlich, als er diesen Anblick genügend genossen, versprengte er eiligst noch einige exotische Parfüms, leerte seine Vaporisateure, verflüchtete seine konzentrierten Spritsorten, liess all den Balsamen die Zügel schiessen, und in dem heissen aufregenden Dunst des Raumes entwickelte sich eine wahnsinnig sublimierte Temperatur, die seinen Atem beschleunigte.
Plötzlich empfand er einen heftigen Schmerz. Es war ihm, als wenn man ihm mit einem Instrument die Schläfen durchbohre. Er öffnete die Augen und befand sich in der Mitte seines Ankleidezimmers, vor seinem Tisch sitzend; mühevoll erhob er sich und schleppte sich zum Fenster, das er halb öffnete. Ein Luftstoss klärte die erstickende Atmosphäre, die ihn einhüllte; er ging im Zimmer auf und ab, die Augen gegen den Plafond gerichtet, wo Krabben und salzgepuderte Algen auf einem gekörnten Grund hell wie der Sand des Meeresufers im Relief aufstiegen. Eine gleiche Dekoration schmückte auch die Fussgesimse, die, mit japanesisch wassergrüner, etwas zerdrückter Kreppseide die Wände einfassend, das Gekräusel eines Flusses, von Wind bewegt, nachahmten, und in diesem leicht fliessenden Wasser schwamm das Blatt einer Rose, um welches ein Schwarm kleiner Fische wirbelte, mit leichten Federstrichen gezeichnet.
Aber seine Augenlider blieben schwer; das Hin- und Hergehen ermüdete ihn, er lehnte sich auf die Fensterbrüstung; allmählich verschwand seine Betäubung. Sorgsam korkte er die Fläschchen wieder zu und benutzte diese Gelegenheit, um die Unordnung in seiner reichen Schminksammlung zu beseitigen. Er hatte seit seiner Ankunft in Fontenay nicht daran gerührt, und er verwunderte sich fast, diese Kollektion jetzt wiederzusehen, die früher von so vielen Frauen besichtigt und bewundert worden war.
Die Kruken und Fläschchen häuften sich auf- und übereinander. Hier war es ein Porzellantopf, Schnouda enthaltend, diesen wunderbaren weissen Creme, der, wenn er auf der Wange aufgerieben, unter dem Einfluss der Luft in zartes Rosa, dann in ein so echtes Inkarnat übergeht, dass er die wirklich genaue Täuschung einer durch Blutwallung geröteten Haut hervorbringt. Dort sind es mit Perlmutter eingelegte Lackkasten, die japanesisches Gold und athenisches Grün einschliessen, die Farbe des Flügels einer spanischen Fliege, Gold und Grün, das sich in ein tiefes Purpur verwandelt, sobald man es anfeuchtet. Nahe den vollen Kruken mit Pasten von Lambertsnuss, Serkis des Harems, Emulsinen der Kaschmirlilie, Waschwasser von Erdbeeren und Holunder für den Teint und bei den kleinen Flaschen, die mit einer Auflösung von chinesischer Tinte und Rosenwasser zum Gebrauch der Augen bestimmt waren, lagen Utensilien aus Elfenbein, Perlmutter und Silber durcheinander mit Bürsten aus Luzern für das Zahnfleisch: Pinsel, Scheren, Wischer, Schminkläppchen und Puderquasten, Rückenkratzer und Schönheitspflästerchen.
Er betrachtete all diese Toilettengeräte, die er auf die Bitte einer seiner Geliebten gekauft hatte, die unter dem Einfluss gewisser Gerüche, gewisser Balsame vor Entzücken verging.
Er grübelte über die Erinnerungen nach und es fiel ihm ein Nachmittag ein, den er mit dieser Frau, aus Langeweile und Neugier, in Pantin bei ihrer Schwester zugebracht hatte und der in ihm eine ganze Welt vergessener Ideen und alter Parfüms wachrief.
Er flüchtete in sein Arbeitszimmer zurück und öffnete das Fenster weit, glücklich, sich in der frischen Luft zu baden. Aber plötzlich war es ihm, als wenn der Wind ihm einen unbestimmten Geruch von Bergamottenessenz entgegentrieb, mit welchem sich der Jasminsprit, die Cassie und das Rosenwasser verband.
Er atmete schwer auf.
Der Geruch wechselte und veränderte sich, ohne zu verschwinden. Ein unbestimmter Duft von Tolutinktur, von Perubalsam, von Safran, verschmolzen mit einigen Tropfen Amber und Moschus, stieg jetzt aus der schlafenden Stadt empor, von dem Fusse der Anhöhe her, und plötzlich vollzog sich eine Metamorphose, die getrennten Gerüche verbanden sich und von neuem verbreitete sich der Frangipan, dessen Geruch die Elemente und die Analyse herbeigeführt hatten, über das Thal Fontenay bis zum Festungswerk hinauf. Sie erschütterten seine erschöpften und angegriffenen Nerven noch mehr, so dass er ohnmächtig an der Fensterbrüstung niedersank.
Die erschrockenen Dienstboten beeilten sich, einen Arzt aus Fontenay herbeizuholen, der absolut nichts von dem Zustand des Herzogs verstand.
Er brummte einige medizinische Ausdrücke, fühlte den Puls, besah die Zunge des Kranken, versuchte, allerdings vergebens, ihn zum Sprechen zu bringen, verordnete lindernde Mittel und grosse Ruhe und versprach, den andern Tag wieder zu kommen.
Auf ein verneinendes Zeichen des Herzogs, der Kraft genug fand, den Eifer seiner Dienstboten zu missbilligen und diesen lästigen Eindringling zu verabschieden, ging dieser fort und machte sich daran, im ganzen Dorf von den Excentrizitäten dieses Hauses zu erzählen, dessen Einrichtung ihn geradezu mit Verwunderung erfüllt und ihn verblüfft hatte.
Zum grössten Erstaunen der beiden alten Diener, die nicht mehr das Dienstzimmer zu verlassen wagten, erholte sich ihr Herr in einigen Tagen wieder. Sie überraschten ihn, wie er an die Scheiben trommelte und den Himmel mit ungeduldiger Miene betrachtete.
Eines Nachmittags klingelte der Herzog mehrere Male hintereinander und befahl dem eintretenden Diener, seine Koffer für eine längere Reise fertig zu machen.
Während das alte Ehepaar auf seine Angaben hin die als notwendig mitzunehmenden Gegenstände wählte, durchschritt er fieberhaft erregt die Kabine seines Esszimmers, studierte die Abfahrtszeiten der Packetboote, durcheilte hastig sein Arbeitszimmer, wobei er ungeduldig die Wolken mit zufriedener Miene beobachtete.
Das Wetter war schon seit einer Woche abscheulich, dicke Nebel lagerten über der Erde. Starke Regengüsse hatten das Thal in einen schwarzen See verwandelt.
An jenem Tage war der Himmel heller geworden.
Der Regen stürzte nicht mehr wie den Tag vorher in Strömen herab, sondern fiel unablässig fein und durchdringend und schien mit seinen unzähligen Fäden die Erde mit dem Himmel zu verbinden.
Das Licht trübte sich; ein fahler Tag beleuchtete das Dorf, und in dieser Trostlosigkeit der Natur verschwammen alle Farben und nur die Dächer glänzten in diesem Grau in Grau.
„Welch ein Wetter!“ seufzte der alte Diener, der die Kleidungsstücke, die sein Herr verlangt hatte, auf einen Stuhl legte.
Statt jeder Antwort rieb sich der Herzog die Hände und setzte sich vor einen Schrank mit bunten Scheiben, in dem ein Stoss von seidenen Socken in Fächerform aufgehäuft lag. Er war über die Nüancen unschlüssig. Seine Wahl fiel in anbetracht der Trostlosigkeit des Tages und des düsteren Graus seines Anzuges, sowie im Hinblick auf sein Ziel auf ein Paar in mattgrüner Seide. Er zog ein Paar Halbstiefel darüber und den mausgrauen karrierten Anzug an, setzte sich einen kleinen runden Hut auf und hüllte sich in einen dunkelblauen Wettermantel. Von seinem Diener gefolgt, der unter dem Gewicht eines Koffers, einer Reisetasche, einer Hutschachtel und einer Reisedecke, in welche Schirme und Spazierstöcke gewickelt waren, fast zusammenbrach, kam er auf dem Bahnhof an.
Hier erklärte er dem Diener, dass er nicht das Datum seiner Rückkehr bestimmen könne, er würde in einem Jahr, in einem Monat, in einer Woche, vielleicht noch früher zurückkommen, befahl, dass nichts in seiner Wohnung geändert würde, händigte ihm die nötige Summe, die zum Unterhalt des Hauses während seiner Abwesenheit nötig war, ein und stieg in den Waggon, den alten Diener ganz verstört mit schlotternden Armen und offenem Mund auf dem Perron zurücklassend.
Er war in seinem Coupé allein. Eine verschwommene, schmutzige Landschaft, wie durch das trübe Wasser eines Aquariums gesehen, flog in grösster Eile an dem vom Regen gepeitschten Zug vorbei. In Nachdenken versunken, schloss der Herzog die Augen.
Das Schweigen, das ihm bisher wie eine Entschädigung für die Albernheiten, die er jahrelang über sich hatte ergehen lassen müssen, erschienen war, drückte ihn plötzlich mit unerträglicher Schwere.
Eines Morgens nämlich war er aufgewacht, erregt, wie ein Gefangener, der in einer Zelle eingeschlossen ist; seine entnervten Lippen murmelten unzusammenhängende Worte, Thränen stiegen ihm in die Augen, ihm war es, als sollte er ersticken.
Das Verlangen, ein menschliches Gesicht zu sehen, mit einem andern Wesen zu sprechen, sich in das flutende Leben zu stürzen, verzehrte ihn. Es kam sogar dahin, dass er seine Dienstboten unter einem Vorwand zu sich kommen liess und in Gespräche verwickelte. Aber die Unterhaltung war unmöglich; denn die alten Leute waren durch jahrelanges Schweigen und durch die Gewohnheit der Krankenpflege fast stumm geworden; dann verhinderte auch die Entfernung, in welcher sie der Herzog immer von sich gehalten, jedes Plaudern.
Übrigens besassen sie nur ein träges Gehirn und waren fast unfähig, anders als einsilbig auf die Fragen, die man an sie richtete, zu antworten.
Er konnte also auf sie nicht rechnen.
Die Lektüre von Dickens, welche er unlängst gepflegt, um seine Nerven zu beruhigen und die nur die entgegengesetzte Wirkung hervorgebracht hatte, begann langsam in einer unerwarteten Weise zu wirken.
Er vertiefte sich in das englische Leben. Seine Betrachtungen vermischten sich mit den Eindrücken aus der Lektüre.
So hoffte er durch eine Reise den erschlaffenden Ausschweifungen seines Geistes zu entgehen.
Er hielt es nicht länger aus; eines Tages entschloss er sich plötzlich, dem allen ein Ende zu machen. Seine Eile war so gross, dass er lange vor der anberaumten Zeit schon die Flucht ergriff.
Er wollte sich der Gegenwart entziehen und sich herumgestossen fühlen in dem Strassenlärm und in dem Getöse der Welt.
„Ich atme auf,“ murmelte er, als der Zug seine Bewegungen einstellte und in der Pariser Bahnhofshalle anhielt.
Auf dem Boulevard d’Enfer rief er einen Kutscher an, ganz vergnügt, mit seinen Koffern und Decken so ins Gewühl geraten zu sein. Durch ein reichliches Trinkgeld verständigte er sich mit dem Mann in nussbraunem Beinkleid und roter Weste:
„Auf Zeit,“ sagte er, „zunächst nach der Rue de Rivoli zu ‚Galignani’s Messenger‘!“
Er beabsichtigte, vor seiner Abreise einen Führer durch London zu kaufen.
Der Wagen schwankte schwerfällig durch den entsetzlichen Schmutz vorwärts.
Der Regen schlug schräg in den Wagen, so dass der Herzog die Fenster schliessen musste.
Bei dem monotonen Geräusch des auf seine Koffer und den Lederschutz niederströmenden Regens, der sich wie ein Sack geschüttelter Erbsen anhörte, träumte der Herzog von seiner Reise; dies war schon ein Vorspiel von England, das ihm Paris bei diesem schauderhaften Wetter bot. Das regnerische, riesengrosse, weite London, das unablässig im Seenebel lag, entrollte sich vor seinen Augen. Lange Reihen Docks breiteten sich unabsehbar vor ihm aus, besät mit Hebemaschinen, Schiffswinden und Ballen; allerwärts wimmelt es von Menschen, die hier an Masten hängen, dort rittlings auf Raaen sitzen.
Alles das lebte und bewegte sich an den Ufern in den riesigen Docks, die von dem grünlichen Wasser der Themse bespült werden, in einem Wald von Masten und Balken.
Es bereitete dem Herzog ein Gruseln, dass er sich in eine Welt von Kaufleuten stürzen sollte, in diesen Nebel, in diese atemlose Thätigkeit, dieses unbarmherzige Räderwerk, das Millionen Enterbter zermalmt.
Dann verschwand diese Vision plötzlich durch einen Stoss des Wagens, der ihn auf seinen Sitz zurückprallen liess.
Er sah durch das Fenster; es war Nacht geworden. Die Gasflammen blinzelten mitten in einem gelblichen Hofe durch den Nebel, Lichtstreifen schwammen auf den Pfützen.
Er versuchte sich zurechtzufinden; er erblickte das Carrousel. Plötzlich, aus seinen Träumen aufgescheucht, fiel ihm ein höchst trivialer Umstand ein: sein Diener hatte beim Kofferpacken eine Zahnbürste vergessen.
Er unterwarf die Liste der eingepackten Gegenstände einer Musterung, alle lagen geordnet in seiner Reisetasche, nur die Bürste fehlte, und sein Ärger darüber dauerte fort, bis ihm das Halten des Wagens ein Ende machte.
Er befand sich in der Rue de Rivoli, vor „Galignani’s Messenger“. Neben einer Thür von mattem Glas, die mit Zeitungsausschnitten und Telegrammen beklebt war, hingen zwei grosse Glaskasten mit Albums und Büchern. Er trat näher, angezogen von den buntfarbigen Büchereinbänden, die in allen Formen und Grössen dort ausgestellt waren. Alles hatte einen kaufmännisch antiparisischen Anstrich, die Einbände waren gröber, aber weniger geschmacklos als die schlechten französischen.
Dann öffnete er die Thür und trat in ein grosses Bibliothekzimmer, das mit Menschen angefüllt war. Fremde sassen umher und entfalteten Karten und radebrechten in unbekannten Sprachen.
Ein Kommis brachte ihm eine ganze Kollektion von Reisehandbüchern. Er setzte sich nieder und sah sich die Bücher, deren biegsamer Pappband sich unter dem Druck seiner Finger bog, durch. Er durchblätterte sie und blieb bei einer Seite des Baedeker stehen, auf welcher die Museen Londons beschrieben sind.
Er interessierte sich für die kurzen und graziösen Details des Führers; seine Aufmerksamkeit ging von der alten englischen Malerei zu der neuen über, die ihn mehr reizte. Er erinnerte sich einiger Bilder, die er in internationalen Ausstellungen gesehen hatte, und hoffte, dass er sie vielleicht in London wiederfinden würde, wie die Gemälde von Millais: „die Krankenwache der heiligen Agnes“, mit jenem seltsamen grünlich-silbernen Mondlicht, dann Bilder von Watts, von eigentümlichem Farbengemisch, die von einem kranken Gustav Moreau entworfen und von einem blutarmen Michel-Angelo ausgeführt sein konnten.
Unter anderm erinnerte er sich einer „Denunziation des Kain“ und einer „Ida“.
Alle diese Gemälde traten vor sein Gedächtnis. Der Kommis, erstaunt, diesen Käufer so in Gedanken verloren am Tische sitzen zu sehen, fragte ihn endlich, ob er schon eine Wahl getroffen habe.
Der Herzog starrte ihn ganz verdutzt an, entschuldigte sich, kaufte einen Baedeker und ging hinaus.
Die feuchte Luft machte ihn schaudern, der Wind blies von der Seite her und peitschte den Regen unter die Arkaden.
„Fahrt ein paar Schritte weiter!“ rief er dem Kutscher zu, indem er ihm mit dem Finger einen Laden am Ende des Bogenganges bezeichnete, der die Ecke der Rue de Rivoli und der Rue Castiglione bildete und, von innen erhellt, mit seinen weisslichen Scheiben einer riesigen Nachtlampe glich, die in dem Missbehagen dieses Nebels und in dem Elend dieses abscheulichen Wetters den Spaziergänger lockte.
Es war die „Bodega“.
Der Herzog ging in einen grossen Saal, der sich zu einem langen Gang formte und von gusseisernen Pfeilern getragen war. An den Seitenwänden lagerten hohe Fässer, die mit königlichen Wappen bemalt waren und in farbigen Aufschriften den Namen ihres Inhalts bezeichneten.
In dem freigelassenen Raume zwischen den Fässern, unter den summenden Flammen einer abscheulich hässlichen, eisengrau bemalten Gaskrone standen Tische mit Körben voll trockenen oder salzigen Gebäcks, mit Tellern, auf welchen Brötchen gehäuft lagen, die mit scharfer, senfhaltiger Butter bestrichen oder mit altem Holländerkäse belegt waren.
Ein Dunst von Alkohol schlug dem Herzog entgegen, als er in dem Saal Platz nahm.
Der Saal war mit Menschen angefüllt; um ihn herum wimmelte es von Engländern: blasse Geistliche von lächerlichem Aussehen, vom Kopf bis zu den Füssen in Schwarz gekleidet, mit weichen Hüten, geschnürten Schuhen, in endlosen Röcken, die auf der Brust mit kleinen Knöpfen besetzt waren, mit glattem Kinn, runden Brillen und glattem, fettigem Haar; aufgedunsene Weingesichter früherer Schweinehändler und Bulldoggengesichter mit Ohren wie Tomaten, blauroten Backen und Nase, blöden, blutunterlaufenen Augen und Bärten, die ihnen ein Pavian-Ansehen gaben.
Eine eigentümliche Erschlaffung befiel den Herzog in dieser Wachtstubenatmosphäre; betäubt von dem Geschwätz der um ihn herumsitzenden Engländer träumte er, und aus dem purpurnen Inhalt seines mit Portwein gefüllten Glases stiegen die Dickens’schen Typen herauf, die so gern tranken, und bevölkerten so den Raum mit neuen imaginären Gestalten.
Er sah hier die weissen Haare und den feuerroten Teint Wickfields; dort das phlegmatische und schlaue Gesicht mit dem unversöhnlichen Blick Tulkinghorns, des unheimlichen Sachwalters von Bleak-House.
Ganz klar und bestimmt sonderten sich jetzt alle diese Figuren in seiner Erinnerung ab und liessen sich mit ihren Bewegungen in der Bodega nieder; sein Gedächtnis, durch die kürzliche Lektüre aufgefrischt, vergegenwärtigte ihm alles in den klarsten Farben.
Die Stadt, in der der Romanschreiber gelebt, das hell erleuchtete Haus, schön durchwärmt, gut versorgt und verschlossen, wo der Wein sorgsam eingeschenkt wurde von der kleinen Dorrit, Dora Copperfield und der Schwester des Tom Pinch, erschienen ihm eine wohlige Arche in einer Sündflut von Schmutz.
Er faulenzte in diesem erträumten London, glücklich, in Sicherheit zu sein.
Sein Glas war leer. Trotz des dichten Dunstes, der in dem grossen Raum herrschte, erhöht durch den Rauch von Cigarren und Pfeifen, empfand er ein leichtes Frösteln.
Er bestellte ein Glas Amontillado. Dieser herbe, helle Wein zerstörte die sanften Geschichten des englischen Dichters sehr bald und die aufregend rauhen Phantasieen des Edgar Poë tauchten wieder vor ihm auf. Plötzlich bemerkte er, dass er beinahe ganz allein in dem grossen Saal war, die Dinerstunde war nahe; er zahlte und erhob sich hastig von seinem Sitz und gewann ganz betäubt die Thür.
Als er hinaustrat, schlug ihm der Regen heftig ins Gesicht, die Flammen der Strassenlaternen flackerten ängstlich hin und her.
Der Herzog betrachtete die Arkaden der Rue de Rivoli, die mit Wasser überschwemmt sich im Schatten verloren, und es war ihm, als wenn er sich im düstern Tunnel unter der Themse befand; doch eine gewisse Leere im Magen, die sich sehr fühlbar machte, rief ihn in die Wirklichkeit zurück.
Er ging zu seinem Wagen und befahl dem Kutscher nach einem englischen Restaurant in der Rue d’Amsterdam, nahe dem Bahnhof, zu fahren. Er sah nach der Uhr: es war gerade sieben. Er hatte also noch Zeit zu speisen; der Zug ging erst um acht Uhr fünfzig Minuten, und an seinen Fingern zählend, berechnete er ungefähr die Stunden der Überfahrt von Dieppe nach Newhaven und sagte sich:
„Morgen Mittag um halb eins werde ich in London sein.“
Der Fiaker hielt vor dem Restaurant still; wiederum stieg der Herzog aus und schritt in einen langen schmucklosen Saal.
Zahlreiche Bierpumpen waren auf dem Schenktisch aufgestellt, daneben lagen Schinken, so stark geräuchert, dass sie wie alte Violinen aussahen, Hummern wie mit rotem Bleioxyd gefärbt, marinierte Makrelen, die in einer trüben Sauce schwammen.
Er nahm in einer der leeren Nischen Platz und rief einen jungen Mann in schwarzem Anzug, der sich verbeugte und ihm etwas in einem unverständlichen Kauderwelsch erzählte.
Während man den Tisch deckte, musterte der Herzog seine Nachbarn. Es waren wie in der Bodega Söhne Albions, mit den bekannten Fayence-Augen, mit karmoisinrotem Teint, die mit bedächtiger und anmassender Miene auswärtige Zeitungen lasen.
Damen ohne Herrenbegleitung speisten miteinander, robuste Engländerinnen mit männlichen Zügen und Zähnen so breit und gross wie Klaviertasten, mit vorstehenden Backenknochen, langen Händen und noch längeren Füssen.
Sie fielen mit wahrem Heisshunger über die gebrachten Gerichte her, die mit überraschender Geschwindigkeit verschwanden.
Da er schon seit langem keinen Appetit mehr verspürt, war er von der Gefrässigkeit dieser Frauenzimmer ganz verblüfft, fühlte aber, dass seine Esslust dadurch angeregt wurde.
Er bestellte eine Oxtailsuppe und ass mit nicht geringem Behagen diese kräftige Brühe. Darauf wählte er einen Haddock, eine Art geräucherten Stockfisch, der ihm sehr schmackhaft schien, und da er die anderen so einhauen sah, so ass auch er noch ein Roastbeef mit Kartoffeln und trank zwei Glas Ale dazu, das ihn durch seinen herben, eigentümlichen Geschmack reizte.
Sein Hunger war bald gestillt, doch verarbeitete er noch ein Stück Stiltonkäse und beendete sein Diner mit einer Rhabarbertorte und der Abwechslung wegen befriedigte er seinen Durst noch mit einem Glas Porter.
Er atmete auf; seit Jahren hatte er nicht soviel gegessen und getrunken, diese Veränderung in seinen Gewohnheiten, diese Wahl unvermuteter, schwerer Nahrung hatte seinen Magen seiner schwerfälligen Ruhe entzogen. Er drückte sich tiefer in seinen Stuhl, zündete eine Cigarette an und machte sich daran, eine Tasse Kaffee, in den er Gin goss, zu schlürfen.
Der Regen fiel noch immer in Strömen vom Himmel, er hörte ihn auf das Glasdach prasseln, das den Hintergrund des Saales überdeckte, und wie in Wasserfällen aus den Dachrinnen stürzen. Niemand rührte sich im Saal, alle Gäste waren froh, hier im Trockenen und vor ihren gefüllten Gläsern zu sitzen.
Die Zungen lösten sich, und da fast alle diese Engländer beim Sprechen die Augen in die Höhe hoben, schloss der Herzog daraus, dass sie sich über das schlechte Wetter unterhielten. Nicht einer lachte. Fast alle waren in grauen, gelb und rosa gesprenkelten Cheviot gekleidet.
Er warf einen entzückten Blick auf seinen Anzug, der in Farbe und Schnitt wenig von dem der andern abstach, und es war ihm eine Befriedigung, in ihrer Mitte durchaus nicht aufzufallen.
Da schreckte er plötzlich auf.
„Und die Stunde der Abfahrt?“ ...
Er zog rasch seine Uhr, sie zeigte jetzt sieben Uhr fünfzig Minuten.
„Ich habe also noch eine halbe Stunde Zeit hier zu bleiben,“ murmelte er und überdachte nochmals den Plan, den er gemacht hatte.
In seinem zurückgezogenen Leben hatten ihn nur zwei Länder angezogen: Holland und England.
Er hatte den ersten seiner Wünsche befriedigt; eines schönen Tages, als er es nicht mehr aushalten konnte, hatte er Paris verlassen und die Städte der Niederlande eine nach der andern besichtigt.
Im ganzen genommen hatte er nur Enttäuschungen auf dieser Reise erlebt. Hatte er sich doch ein Holland nach den Werken von Teniers und Steen, von Rembrandt und Ostade vorgestellt; er hoffte Kirmesse, beständige Schmausereien auf dem Lande und die von den alten Meistern so gepriesene patriarchalische Gutmütigkeit und joviale Liederlichkeit zu finden.
Zwar hatten ihn Haarlem und Amsterdam bezaubert mit dem noch ungehobelten Benehmen des Volkes auf dem Lande. Aber von der ungezügelten Fröhlichkeit und der harmlosen Völlerei hatte er keine Spur bemerkt. Kurz, er musste zugeben, dass ihn die holländische Schule des Louvre genasführt hatte. Sie war ihm nur ein Sprungbrett zu seinen Träumen gewesen.
Von alledem war nichts zu sehen; Holland war ein Land wie alle anderen.
Er sah von neuem nach der Uhr: es fehlten noch zehn Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Es war die höchste Zeit, die Rechnung zu begleichen und hinüberzugehen.
Er verspürte plötzlich eine ausserordentliche Schwere im Magen wie im ganzen Körper.
„Mut!“ murmelte er, und noch schnell ein Glas Brandy hinunterstürzend, verlangte er seine Rechnung.
Ein Individuum in schwarzem Frack und einer Serviette unter dem Arm, mit spitzem, kahlem Schädel, steifem grauen Backenbart trat heran, einen Bleistift hinter dem Ohr, und ein Bein vor das andere stellend, zog er ein Notizbuch aus seiner Tasche und, ohne sein Papier anzusehen, die Augen auf die Gaskrone gerichtet, schrieb er alles auf und berechnete die Zeche.
„Hier,“ sagte er, das Blatt aus seinem Buche reissend und es dem Herzog überreichend, der ihn neugierig ansah.
„Welch seltsamer John Bull,“ dachte er.
In diesem Augenblick öffnete sich die Thür der Kneipe, Leute kamen herein, die einen Geruch wie von durchnässten Pudeln mitbrachten. Eine süsse und wohlige Erschlaffung bemächtigte sich des Herzogs Jean; er fühlte sich unfähig, seine Beine zu bewegen, ja selbst die Hand auszustrecken, um sich eine Cigarre anzuzünden.
„Vorwärts, es ist die höchste Zeit!“ sagte er sich, ohne sich zu rühren.
Wozu war es nötig, in grösster Eile fortzustürzen, wenn man so bequem und so prächtig auf einem Stuhl reisen konnte?
War er nicht eigentlich schon in London, dessen Geruch, dessen Atmosphäre, dessen Einwohner, dessen Futter, dessen Geräte ihn umgaben?
Was konnte er denn erhoffen, wenn nicht neue Enttäuschungen, wie in Holland?
Er hatte gerade noch so viel Zeit, um nach dem Bahnhof gegenüber zu laufen, doch ein gewaltiger Widerwille gegen die Reise erfasste ihn und ein unabweisliches Bedürfnis, ruhig zu sitzen, drängte sich ihm mit Gewalt auf.
Nachdenklich liess er einige Minuten verstreichen, sich auf diese Weise den Rückweg abschneidend, und sagte sich: „Jetzt würde ich mich in die Billetausgabe stürzen, mich mit meinem Gepäck herumstossen müssen; wie verdriesslich!“ –
Dann wiederholte er sich von neuem: „Im ganzen genommen habe ich gesehen und empfunden, was ich sehen und empfinden wollte. Ich bin mit englischem Leben seit meiner Abreise von Fontenay übersättigt und müsste wahnsinnig sein, wenn ich durch Umherirren meine Eindrücke zerstören sollte.“
„Sieh da,“ fuhr er in seinem Monolog fort, seine Uhr ansehend, „die Zeit ist da heimzukehren!“
Jetzt stand er wirklich auf, ging hinaus und befahl seinem Kutscher, ihn nach dem Bahnhof von Sceaux zurückzufahren, und er kam wieder in Fontenay an mit seinen Koffern, Paketen, Reisedecken, Regenschirmen und Spazierstöcken und empfand die körperliche Abgehetztheit, die moralische Ermüdung eines Menschen, der nach einer langen, gefahrvollen Reise endlich wieder zu Hause anlangt.
Während der Tage, die seiner Rückkehr folgten, betrachtete Herzog Jean mit Wohlgefallen seine Bücher, und bei dem Gedanken, dass er sich lange Zeit von ihnen hatte trennen können, empfand er eine ebenso wirkliche Befriedigung, wie er sie genossen, wenn er sie nach einer ernstlichen Reise wiedergefunden hätte. Unter dem Impuls dieses Gefühls schienen ihm die Gegenstände neu, denn er nahm an ihnen Schönheiten wahr, die er vergessen, seitdem er sie erworben hatte.
Alles: Bücher, Nippsachen, Möbel, nahm in seinen Augen einen neuen Reiz an. Sein Bett schien ihm weicher im Vergleich zu dem Lager, das er in London eingenommen haben würde; der diskrete, schweigsame Dienst des alten Ehepaares entzückte ihn, da er sich von dem Gedanken an die lärmende Redseligkeit der Hotelkellner ermüdet fühlte.
Er schöpfte frische Lebenskraft aus dem Bad der Gewohnheit.
Aber seine Bücher beschäftigten ihn hauptsächlich. Er prüfte sie, ordnete sie von neuem auf den Gestellen, sah genau nach, ob seit seiner Ankunft in Fontenay die Hitze und Feuchtigkeit ihre Einbände nicht beschädigt und ihr kostbares Papier nicht zerfressen hatte.
Er fing an, seine ganze lateinische Bibliothek umzuordnen, dann stellte er die Werke von Archelaus, Albert le Grand, Lulle, Arnold de Villanova, welche die Kabbala und geheimen Wissenschaften behandelten, in neuer Ordnung auf. Dann sah er seine modernen Bücher nacheinander durch und stellte mit Vergnügen fest, dass alle trocken und unversehrt geblieben waren.
Diese Sammlung hatte ihn bedeutende Summen gekostet. Denn er hatte sich die von ihm bevorzugten Verfasser in besonderen Luxus-Ausgaben angeschafft. In seiner Pariser Zeit hatte er für sich allein bestimmte Bücher herstellen lassen. Er liess von England und Amerika neue Buchstaben für die Anfertigung von Werken dieses Jahrhunderts kommen; oder wendete sich an ein Geschäft in Lille, das einen ganzen Satz gotischer Typen besass.
Er hatte es ebenso mit seinem Papier gemacht, denn er war eines Tages der silbernen Chinas, der perlmutternen und goldenen Japans überdrüssig geworden, wie auch der weissen Wathmans, der dunkelbraunen Holländischen, der Turkeys und Seychal-Mills in Gemsfarben. Ebenso befriedigte ihn nicht mehr das mit Maschinen angefertigte Papier. Deshalb hatte er besonders gestreiftes Papier in den alten Fabriken von Vire bestellt, wo man sich noch der Stampfe bediente, die man früher anwendete, um Hanf zu verarbeiten.
Um ein wenig Abwechselung in seine Sammlungen zu bringen, hatte er sich verschiedentlich Ripspapier aus London schicken lassen; auch bereitete ihm ein Lübecker Fabrikant ein Pressbalkenpapier, bläulich, kräftig, etwas spröde, in dessen Stoff die Fasern durch Goldkörnerchen, wie sie in dem Danziger Goldwasser flimmern, ersetzt waren.
Dadurch hatte er sich Bücher einzig in ihrer Art verschafft. Sie waren in ungebräuchlichem Formate, die er von Künstlern in antiker Seide, geprägtem Ochsen- und Coy-Leder artistisch einbinden liess. Auch besass er kostbare Einbände aus moirierter Seide und Taffet und einige sogar mit oxydiertem Silberbeschlag und hellem Email ausgelegt.
So hatte er sich von dem bekannten alten Geschäft Le Clere die Werke von Baudelaire in grossem Format wie Messbücher mit grossen steilen Buchstaben auf sehr feinem japanischen Filzpapier drucken lassen.
Der Herzog hatte dieses unvergleichliche Werk aus seinem Bücherschrank herausgezogen; er befühlte es andächtig und las gewisse Stellen wieder durch, die ihm in diesem einfachen aber unschätzbaren Rahmen ergreifender als gewöhnlich erschienen.
Seine Bewunderung für diesen Schriftsteller war grenzenlos. Seiner Meinung nach hatte man sich bis jetzt in der Litteratur darauf beschränkt, das Äussere der Seele zu erforschen. Baudelaire war weiter gegangen; er war bis zum Grund der unerschöpflichen Mine hinabgestiegen, hatte sich weit in die verlassenen und unbekannten Gänge hineingewagt, war in den Distrikten der Seele angelangt, wo sich die widernatürliche Vegetation der Gedanken verzweigt.
Zu einer Zeit, wo die Litteratur fast ausschliesslich den Lebensschmerz dem Unglück einer verkannten Liebe oder den Eifersüchteleien des Ehebruchs zuschrieb, hatte Baudelaire diese kindischen Krankheiten überwunden und die unheilbareren, tieferen Schäden untersucht, die durch Übersättigung und Enttäuschung die Gegenwart martern, die Vergangenheit anwidern und die Zukunft erschrecken und beunruhigen.
Und je mehr der Herzog wieder Baudelaire durchlas, desto mehr erkannte er einen unendlichen Zauber in diesem Schriftsteller, der in einer Zeit, wo Verse nur dazu dienten, die äusseren Erscheinungen von Wesen und Sachen wiederzugeben, es dahin gebracht hatte, das Unaussprechliche auszudrücken, dank einer kräftigen und vollen Sprache, die mehr als jede andere diese wunderbare Macht besass, mit einer seltenen Gesundheit von Ausdrücken krankhafte Zustände der flüchtigsten und zitterndsten Art, der erschöpften Geister und traurigen Seelen festzustellen.
Ausser Baudelaire waren die französischen Bücher in seiner Bibliothek ziemlich beschränkt. Er war gänzlich unempfänglich für die Werke, vor denen es zum guten Ton gehört, in Entzücken zu geraten.
„Der herzhafte Humor von Rabelais“ und „die gesunde Komik Molières“ brachten ihn nicht zum Lachen und seine Antipathie gegen diese Possen ging sogar so weit, dass er sich nicht scheute, sie mit Jahrmarktstand zu vergleichen.
Von den alten Dichtern las er nur Villon, dessen melancholische Balladen ihn rührten; hier und da einige Sachen von Aubigné, die durch die unglaubliche Heftigkeit ihrer Ausfälle und durch ihre Flüche sein Blut in Wallung brachten.
Von den Prosaisten beschäftigten ihn Voltaire und Rousseau sehr wenig, noch weniger Diderot, dessen so sehr gerühmte „Salons“ ihm ganz besonders mit moralischen Abgeschmacktheiten und einfältigen Bestrebungen angefüllt schienen; aus Hass gegen all diesen Plunder vertiefte er sich fast ausschliesslich in die Lektüre der christlichen Beredsamkeit, wie Bourdaloue und Bossuet, deren kräftige und bilderreiche Sprache ihm imponierte. Aber vorzugsweise erquickte er sich an den ernsten und markigen Sätzen, welche Nicole und besonders Pascal aufbauten, dessen strenger Pessimismus und schmerzliche Zerknirschung ihm zu Herzen gingen.
Diese wenigen Bücher ausgenommen, fing die französische Litteratur in seiner Bibliothek erst mit dem neunzehnten Jahrhundert an.
Sie teilte sich in zwei Gruppen: die eine bestand aus der gewöhnlichen, profanen, die andere aus der Kirchen-Litteratur.
Aus der Menge seichter Schwätzer, die die Kirchenlitteratur auf ihrem Gewissen hatte, ragte besonders Lacordaire hervor, einer der wenigen wirklichen Schriftsteller, den die Kirche seit Jahren hervorgebracht hatte.
Höchstens waren noch einige Seiten seines Schülers, des Abtes Peyreyve, lesbar. Dieser hatte eine rührende Biographie seines Lehrers hinterlassen, einige liebenswürdige Briefe geschrieben, Artikel in klangvoller Rednersprache verfasst und Lobreden gehalten, in denen aber ein schwülstiger Ton zu sehr vorherrschte.
In Wahrheit aber hatte der Abt Peyreyve weder die Erregung noch die flammende Begeisterung eines Lacordaire.
Der im allgemeinen abgedroschene bischöfliche, von den Prälaten gehandhabte Stil war wieder etwas männlicher geworden. Dies zeigte sich besonders bei dem Grafen de Falloux.
Unter dem Schein der Mässigung schwitzte dieser Akademiker geradezu Galle. Seine im Parlament 1848 gehaltenen Reden waren dagegen weitschweifig und matt, aber seine in dem „Correspondent“ veröffentlichten und seitdem in Sammlungen vereinigten Artikel waren beissend und scharf und von einer übertriebenen Höflichkeit in ihrer Form.
Er war ein gefährlicher Polemiker wegen seiner Hinterhalte, ein schlauer Logiker, seitwärts gehend und unvermutet treffend.
Etwas geschraubter, gezwungener, ernster war Ozanam, der geliebte Schutzredner der Kirche, der Glaubensrichter der christlichen Sprache.
Obgleich Herzog Jean schwer zu überraschen war, war er dennoch erstaunt über die Dreistigkeit dieses Schriftstellers, der von den unerklärlichen Absichten Gottes redete, als ob er die Beweise der unwahrscheinlichen Behauptungen, die er vorbrachte, hätte beibringen können.
Ein Buch, das sein Interesse in hohem Grade zu erwecken vermocht hatte, war: „Der Mensch“ von Ernest Hello.
Dieser war die absolute Antithese seiner religiösen Mitbrüder. Fast isoliert in der gottesfürchtigen Gruppe, die seine Art abschreckte, hatte Ernest Hello schliesslich den grossen Verbindungsweg, der von der Erde zum Himmel führt, verlassen. Ohne Zweifel angewidert von der langweiligen Einförmigkeit der Strasse und von dem Gewühl dieser Schriftpilger, die im Gänsemarsch seit Jahrhunderten hintereinander dieselbe Chaussee gingen, einer in des andern Fussstapfen tretend, an denselben Orten anhaltend, um dieselben Gemeinplätze über die Religion, die Kirchenväter, über ihre gleichen Überzeugungen und ihre gleichen Meister auszutauschen, war er durch die Seitenpfade gegangen und war in der düstern Waldlichtung von Paschalis gemündet, wo er lange gehalten hatte, um Atem zu schöpfen. Dann hatte Hello seinen Weg fortgesetzt und war weiter als der Jansenist vorgedrungen, den er übrigens verspottete.
Gewunden und geziert, pedantisch und verwickelt, wie Hello war, erinnerte er den Herzog durch die eindringlichen Spitzfindigkeiten seiner Analyse an die forschenden, kritischen Studien einiger Psychologen des vergangenen und dieses Jahrhunderts.
In diesem eigentümlich gebildeten Geist existierten wundersame Gedankenverbindungen, unvermutete Annäherungen und Widersprüche. Ihm imponierte Hellos seltsame Art, von der Etymologie der Wörter auf geistreiche Beziehungen zu kommen, die manchmal etwas dünn wurden, aber fast immer blendend waren. –
Zwei Werke von Barbey d’Aurévilly reizten den Herzog ganz besonders: „Le Prêtre marié“ und „Les Diaboliques“. In diesen eigentümlichen Büchern hatte der Verfasser beständig zwischen den beiden Extremen der katholischen Religion laviert, die sich vereinigen: Mysticismus und Sadismus.
In diesen zwei Büchern, die der Herzog wieder durchblätterte, hatte Barbey jede Klugheit verloren, seinem Pferde die Zügel schiessen lassen und war in gestrecktem Galopp auf Wegen davon geritten, die er bis zu ihrem äussersten Ende verfolgte.
Der ganze Schrecken des Mittelalters schwebte über diesem unwahrscheinlichen Buch des „verheirateten Priesters“; die Magie vermischte sich mit der Religion, und unbarmherziger und grausamer als der Teufel quälte der Gott der Erbsünde die unschuldige Calixte, seine Verstossene, die er mit einem roten Kreuz auf der Stirne gezeichnet, wie er ehemals von seinem Engel die Häuser der Abtrünnigen, die er verderben wollte, hatte zeichnen lassen.
Nach diesen mystischen Abschweifungen hatte der Schriftsteller eine Periode der Ruhe gehabt; dann aber war ein schrecklicher Rückfall eingetreten.
In dem „verheirateten Priester“ wurde das Lob Christi von Barbey d’Aurévilly gesungen; in „Les Diaboliques“ hatte sich der Verfasser dem Teufel ergeben, den er pries; und jetzt erschien der Sadismus, dieser Bastard des Katholizismus, den die Religion in allen Formen mit Exorcismen und Scheiterhaufen durch alle Jahrhunderte verfolgt hat.
Mit Barbey d’Aurévilly nahm die Serie der religiösen Schriftsteller ein Ende. Eigentlich gehörte dieser Paria in jeder Hinsicht mehr zur weltlichen Litteratur als zu jener andern, bei der er einen Platz beanspruchte, den man ihm verweigerte. Seine Sprache war die des wilden Romantismus, voll gewundener Wendungen und übertriebener Vergleiche, und eigentlich erschien d’Aurévilly wie ein Zuchthengst unter diesen Wallachen, die die ultramontanen Ställe füllen.
Dem Herzog kamen diese Betrachtungen beim gelegentlichen Wiederlesen einiger Stellen dieses Schriftstellers, und wenn er diesen nervösen, abwechslungsreichen Stil mit der lymphatischen und unbeweglichen Art seiner Mitbrüder verglich, gedachte er ebenfalls der Fortentwickelung der Sprache, die uns Darwin so klar dargestellt hat.
Mittlerweile kündigte der silberne Ton einer Glocke, die auf den Ton der Angelusglocke abgestimmt war, dem Herzog an, dass das Frühstück aufgetragen sei.
Er liess seine Bücher liegen, trocknete sich die Stirn und ging nach dem Esszimmer, indem er sich sagte, dass von all den Büchern, die er soeben geordnet hatte, die Werke von Barbey d’Aurévilly noch die einzigen waren, bei denen Gedanken und Stil an den Hautgoût der decadenten lateinischen Schriftsteller der alten Zeit, die ihm so sympathisch waren, erinnerten.
Das Wetter war in diesem Jahre ganz ungewöhnlich: nach den Stosswinden und Nebeln lag ein weissglühender Himmel über der Gegend ausgebreitet.
In zwei Tagen war ohne jeden Übergang der feuchten Kälte und den Regengüssen eine brennende Hitze, eine Luft von entsetzlicher Schwere gefolgt. Wie mit Feuerhaken geschürt strahlte die Sonne, gleich der Öffnung eines Backofens, ein fast weisses Licht aus, das das Auge blendete; ein heisser Staub erhob sich von den kalkigen Chausseen und verdorrte die Bäume und den Rasen. Die Sonne, die auf die weiss getünchten Mauern, die Zinkdächer und die Fensterscheiben niederbrannte, blendete förmlich. Die Glut einer Giesserei lag auf dem Hause des Herzogs Jean.
Halb nackt öffnete er ein Fenster, eine Welle heisser Luft schlug ihm ins Gesicht; in dem Esssaal, in den er sich flüchtete, war es glühend.
Er setzte sich ganz verzweifelt nieder, denn die Überreizung, die ihn aufrecht hielt, solange er beim Ordnen seiner Bücher seinen Träumen nachgehangen hatte, war jetzt vorüber.
Wie alle nervösen Leute wurde er durch die Hitze sehr angegriffen. Die Bleichsucht, durch die Kälte zurückgehalten, machte sich wieder bemerkbar und schwächte den ohnedies schon matten Körper noch mehr durch übermässigen Schweiss.
Das Hemd auf dem nassen Rücken klebend, die Beine und Arme kraftlos, die Stirn mit Schweiss bedeckt, der in salzigen Tropfen die Backen hinablief, lag der Herzog wie gebrochen in seinem Sessel. Der Anblick des Fleisches, das auf dem Tische stand, widerte ihn in diesem Augenblick an und er befahl, es fortzutragen; er bestellte sich Eier und versuchte Stückchen Brot, ins weiche Gelbe getunkt, hinunter zu würgen; aber sie blieben ihm in der Kehle sitzen. Die Neigung zum Erbrechen kam. Er trank einige Tropfen Wein, die ihm wie Feuer im Magen brannten.
Er wischte sich das Gesicht ab; der Schweiss, noch eben warm, floss kalt an den Schläfen entlang. Er sog einige Stückchen Eis langsam auf, um die Übelkeit zu vertreiben. Doch vergeblich.
Eine grenzenlose Mattigkeit drückte ihn nieder; er meinte zu ersticken und stand auf.
Noch nie hatte er sich so beunruhigt, so zerrüttet, so elend gefühlt. Dabei quollen seine Augen, er sah die Gegenstände doppelt und um sich selbst drehend. Bald verschwand ihm das Gefühl für die richtigen Entfernungen, sein Glas schien ihm eine Meile von ihm zu stehen. Er verhehlte sich nicht, dass er der Spielball seiner sensationellen Täuschungen war, und unfähig, dagegen zu reagieren, legte er sich auf das Sofa im Salon.
Da aber wiegte ihn ein Schwanken, wie das Schwanken eines Schiffes, und die Übelkeit wurde stärker; er stand wieder auf und entschloss sich, durch ein Verdauungsmittel die Eier, die ihn nahezu erstickten, hinunterzubringen.
Er ging nach dem Esszimmer zurück und verglich sich in dieser Kabine melancholisch mit einem Seereisenden. Er kam sich wie ein von Seekrankheit befallener Passagier vor.
Schwankenden Schrittes wendete er sich dann zu dem Wandschrank, prüfte seine Mundorgel, doch öffnete er sie nicht, sondern nahm von dem oberen Brett eine Flasche mit Benediktiner, die er ihrer Form wegen aufbewahrte.
Aber für den Augenblick war ihm alles gleichgültig; mit mattem Auge betrachtete er die dickbäuchige dunkelgrüne Flasche, die sonst in ihm die Vorstellung eines mittelalterlichen Klosters wachgerufen hätte: mit ihrem antiken Mönchsbauch, ihrem Kopf und Hals, mit einer Pergament-Kapuze versehen, ihrem roten Wachssiegel mit den drei silbernen Bischofshüten am Halse, gesiegelt wie eine Bulle, und einer Etikette, auf deren gelblichem Papier in Mönchslatein stand: „Liquor Monachorum Benedictinorum Abbatiae Fiscanensis“.
Diese klösterliche Hülle barg einen safrangelben Likör von entzückender Zartheit.
Er trank einige Tropfen von diesem Likör und fühlte während eines Augenblicks etwas Erleichterung, aber bald brannte das Feuer wieder von neuem in seinen Eingeweiden.
Er warf verzweifelt seine Serviette hin und begab sich wieder in sein Arbeitszimmer, wo er langsam auf und ab ging.
Es war ihm, als sei er unter einer Luftglocke, in der ihm die Luft nach und nach entzogen wurde, und eine wonnige grausame Schwäche bemächtigte sich seiner, vom Rückenmark durch alle Glieder gehend. Er sträubte sich dagegen, und da er es nicht mehr aushalten konnte, flüchtete er sich, vielleicht zum ersten Mal seit seiner Ankunft in Fontenay, in seinen Garten und suchte Schutz unter einem Baum, der einen runden Schatten warf.
Auf dem Rasen sitzend, sah er mit stumpfer Miene auf die viereckigen Gartenbeete, auf denen seine alten Dienstboten Gemüse gepflanzt hatten.
Er sah sie wohl an, aber erst nach Verlauf einer Stunde bemerkte er sie, denn ein gräulicher Nebel schwebte vor seinen Augen und liess ihn nichts unterscheiden, ähnlich wie auf dem Meeresgrund, wo man nur unbestimmte Bilder gewahrt.
Schliesslich fand er sein geistiges Gleichgewicht wieder und unterschied deutlich Zwiebeln vom Kohl, sowie etwas weiter ein Feld mit Kopfsalat und im Hintergrunde die ganze Hecke entlang eine Reihe weisser Lilien, die unbeweglich in der schweren Luft ihren Duft ausströmten.
Er durchstöberte den Garten, sich für die in der Hitze verwelkten Pflanzen und den heissen Erdboden interessierend, der in dem glühenden Staub der Luft dampfte. Dann bemerkte er oberhalb der Hecke, die den tiefer gelegenen Garten von der erhöhten Strasse, die nach dem Vorwerke führte, trennte, einige Jungen, die sich in vollem Sonnenbrand im Staube wälzten.
Er konzentrirte seine Aufmerksamkeit eben auf sie, als ein anderer, kleinerer erschien; er sah schmutzig aus, hatte Haar wie Seegras und war voll von Sand; zwei grüne Blasen hatte er unter der Nase, widerliche Lippen, weiss beschmiert mit weichem Käse, der auf Brot gestrichen und mit gehackten Zwiebeln bestreut war.
Der Herzog sog den Geruch davon ein; ein krankhaftes Gelüst bemächtigte sich seiner. Die schmutzigen Brotschnitte liessen ihm das Wasser in den Mund treten. Es schien ihm, als wenn sein Magen, der jede Nahrung verweigerte, dies abscheuliche Essen verdauen würde und sich sein Gaumen wie an einem Leckerbissen daran laben könne.
Er sprang auf, lief nach der Küche, befahl, aus dem Dorf einen Laib Brot, weissen Käse und Zwiebeln zu holen, bestimmte, wie man ihm die Brotschnitte bereiten solle, genau wie die, an denen der Junge herumwürgte, und ging zu seinem Baum zurück, unter dem er sich wieder niederliess.
Jetzt schlugen sich die Jungen. Sie entrissen sich Stücke Brot, die sie sich in die Backen stopften, wobei sie sich die Finger ableckten. Es hagelte dabei Fusstritte, Faustschläge, und die Schwächsten, die zur Erde geworfen wurden, schlugen mit den Beinen um sich und heulten.
Dieses Schauspiel belebte den Herzog; das Interesse, das er an dem Kampf nahm, wendete seine Gedanken von seinem Übel ab; bei der Erbitterung der Bengel dachte er an das grausame Gesetz vom Kampf ums Dasein, und obgleich diese Jungen nur aus niedrigem Stande waren, konnte er sich doch nicht erwehren, sich für ihr Los zu interessieren und zu glauben, dass es besser für sie gewesen wäre, wenn ihre Mütter sie nicht in die Welt gesetzt hätten.
„Welcher Wahnsinn,“ dachte der Herzog, „Kinder zu zeugen!“
Der Diener unterbrach die wohlgemeinten Betrachtungen, über welche der Herzog nachgrübelte, und überreichte ihm auf einem silbernen Teller das gewünschte Käsebrot.
Eine Übelkeit überkam ihn; er hatte nicht den Mut, dieses Butterbrot zu essen, denn die krankhafte Überreizung seines Magens war vergangen. Ein Gefühl entsetzlicher Zerrüttung befiel ihn von neuem; er musste aufstehen. Die Sonne drehte sich und nahm nach und nach seinen Platz ein, die Hitze wurde noch drückender und lästiger. – „Werfen Sie das Butterbrot jenen Jungen hin,“ sagte der Herzog zu dem alten Diener, „mögen die sich darum schlagen; mögen sich die Schwächeren verkrüppeln und keinen Teil an den Leckerbissen haben; mögen sie obendrein von ihren Eltern tüchtig durchgeprügelt werden, wenn sie mit zerrissenen Hosen und blauen Augen nach Hause kommen; das wird ihnen einen Vorgeschmack von dem Leben, das ihrer wartet, geben!“
Mit diesen Worten ging er langsam seinem Hause zu und sank halb ohnmächtig auf einem Sessel nieder.
„Ich muss indessen versuchen, etwas zu essen,“ murmelte er, und er tunkte einen Zwieback in einen alten Constantia, von dem er noch einige Flaschen im Keller hatte.
Dieser Wein in der Farbe leicht angebrannter Zwiebelschale, die Mitte zwischen Malaga und Portwein haltend, doch mit einem besonders zuckrigen Bouquet und einem Nachgeschmack von Weintrauben hatte ihn oft gestärkt und manchmal sogar seinem durch gezwungenes Fasten geschwächten Magen neue Kraft eingeflösst. Aber diese Herzstärkung, sonst treu und zuverlässig, verfehlte heut ihre Wirkung.
Nun hoffte er, dass ein linderndes Mittel die glühenden Eisen, die ihm gleichsam den Magen zerrissen, vielleicht abkühlen würde, und er nahm seine Zuflucht zu dem Nalifka, einem russischen Likör in einer mattgolden glasierten Flasche. Aber dieser ölige und himbeerartige Saft war ebenfalls wirkungslos.
Leider! Die Zeit war fern, wo der Herzog sich noch einer guten Gesundheit erfreute, wo er in voller Hundstagshitze auf seinem Besitztum einen Schlitten bestieg und da, eingewickelt in Pelze, die er bis zur Brust hinaufzog, zu frösteln versuchte und sich sagte, indem er sich mit den Zähnen zu klappern bemühte: „Ah! dieser Wind ist eisig, man erfriert fast, man erstarrt wirklich!“ bis es ihm fast gelang, sich zu überzeugen, dass es recht bitterlich kalt sei!
Unglücklicherweise wirkten diese Mittel nicht mehr, seit seine Leiden thatsächlich überhandgenommen hatten.
Dabei blieb ihm nicht einmal die Zuflucht, zur Opiumtinktur zu greifen; denn anstatt ihn zu beruhigen, regte ihn dies schmerzstillende Mittel derartig auf, dass es ihm die Ruhe raubte.
Früher hatte er sich mit Opium und Haschisch Visionen erzeugen wollen, aber diese beiden Substanzen hatten Erbrechen und heftige nervöse Aufregungen herbeigeführt, er hatte sofort darauf verzichtet und ohne Hilfe dieser derben Reizmittel von seinem Gehirn allein verlangt, ihn weit von dem Leben ab ins Reich der Träume zu führen.
„Welch ein Tag!“ seufzte der Herzog, sich den Hals trocknend und fühlend, dass das, was ihm noch an Kräften geblieben war, sich in neuem Schweiss auflöste. Eine fieberhafte Erregung verhinderte ihn still zu sitzen. Von neuem irrte er durch alle Zimmer, alle Sitze nacheinander versuchend.
Des Kampfes müde sank er endlich vor seinem Schreibtisch nieder. Den Ellbogen auf die Platte gestützt, bewegte er mechanisch, ohne an etwas zu denken, einen Sternhöhenmesser, der anstatt eines Briefbeschwerers auf einem Haufen Bücher und Notizen stand.
Er hatte dieses Instrument aus graviertem, vergoldetem Kupfer, aus Deutschland stammend und im siebzehnten Jahrhundert gearbeitet, bei einem Trödler in Paris gekauft nach einem Besuch des Cluny-Museum, wo er lange in Entzücken vor einem wunderbaren Astrolabium aus geschnitztem Elfenbein gestanden hatte, dessen kabbalistische Art ihn geradezu bezauberte.
Dieser Briefbeschwerer rief einen ganzen Schwarm Erinnerungen in ihm wach. Der Anblick dieser Seltenheit liess ihn vergessen, wo er sich befand, seine Gedanken schweiften zurück zu dem Trödler in Paris, der ihm das Instrument verkauft hatte.
Er sah sich im Geist wieder im Museum vor dem Astrolabium aus Elfenbein, während seine Augen fortfuhren, den Sternhöhenmesser aus Kupfer vor sich auf dem Tische zu betrachten, ohne ihn zu sehen.
Einige Tage lang war sein Zustand erträglich, dank der Mittel, die er seinem Magen anbot. Aber eines Morgens wollte er die marinierten Gerichte nicht mehr annehmen, und der Herzog fragte sich beunruhigt, ob seine grosse Schwäche nicht noch zunehmen und ihn nötigen würde, das Bett zu hüten.
Es fiel ihm plötzlich ein, dass einer seiner Freunde es mit Hilfe eines gewissen Nahrungsmittels erreicht hatte, seiner Blutarmut Einhalt zu thun und sich das bisschen Kraft zu erhalten.
Er schickte schnell seinen Diener nach Paris, um sich dieses kostbare Mittel zu verschaffen; nach dem Prospekt, den der Fabrikant beigelegt hatte, unterrichtete er selbst seine Köchin, wie das Rindfleisch in kleine Stücke zu schneiden und zuzubereiten sei.
Den durch diese Prozedur gewonnenen Saft nahm er löffelweise ein.
Durch diese Kur wurde das Nervenleiden aufgehalten und der Herzog sagte sich:
„Das hätten wir immerhin erreicht; vielleicht dass die Temperatur sich ändert und der Himmel etwas Asche auf diese abscheuliche Sonne wirft, die mich völlig erschöpft, und dass ich mich ohne grosse Schwierigkeit bis zur ersten Kälte durchschlagen werde.“
In dieser Erschlaffung und müssigen Langeweile, in die er versunken, ärgerte ihn seine Bibliothek, deren Ordnung unvollendet geblieben war; da er nicht mehr aus seinem Lehnstuhl aufstehen konnte, hatte er unaufhörlich seine profanen Bücher vor sich, die wie Kraut und Rüben in den Fächern standen und lagen. Die Unordnung verletzte ihn um so mehr, da sie zu der sorgfältigen Ordnung der religiösen Bibliothek in schreiendem Widerspruch stand.
Er versuchte dieser Verwirrung ein wenig abzuhelfen, aber nachdem er zehn Minuten gearbeitet, war er wie in Schweiss gebadet; die Anstrengung erschöpfte ihn. Wie gebrochen legte er sich aufs Sofa und klingelte seinem Diener.
Auf seine Angabe hin machte sich der alte Mann ans Werk, ihm einzeln die Bücher zuzutragen, die er prüfte und deren Platz er bezeichnete.
Diese Arbeit war von kurzer Dauer, denn die Bibliothek des Herzogs Jean schloss nur eine ausserordentlich kleine Zahl moderner weltlicher Werke ein.
Er war nämlich zu dem Resultat gelangt, dass er nicht mehr ein Buch entdecken könne, das seinen geheimen Wünschen entsprach; und seine Bewunderung liess sogar für diejenigen Bücher nach, die dazu beigetragen hatten, seinen Geist zu schärfen und ihn so argwöhnisch und so wählerisch zu machen.
In der Kunst waren seine Ideen von dem eigentlich selbständigen Standpunkt ausgegangen: für ihn existierten keine Schulen, das Temperament des Schriftstellers allein war für ihn massgebend. Die Arbeit seines Gehirns interessierte ihn, welches Thema er sich auch gestellt haben mochte.
Leider war in Wahrheit diese Schätzung, eines La Palisse würdig, beinahe undurchführbar, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil jeder, wenn er es auch wünscht, sich von allen Vorurteilen loszumachen, und sich jeder Parteinahme zu enthalten sucht, sich aber doch mit Vorzug zu den Werken hingezogen fühlt, die mit seinem Temperament am meisten übereinstimmen.
Dieser Prozess der Auswahl hatte sich langsam in ihm vollzogen; er hatte vor kurzem noch den grossen Balzac angebetet, aber zur selben Zeit, als sein Organismus aus dem Gleichgewicht geriet und seine Nerven die Herrschaft übernahmen, hatten sich auch seine Neigungen modifiziert und seine Bewunderungen vermindert.
Seit kurzem sogar, und obwohl er sich Rechenschaft von seiner Ungerechtigkeit gegen den trefflichen Verfasser der „menschlichen Komödie“ ablegte, war er dahin gekommen, seine Werke nicht mehr zu öffnen. Andere Wünsche bewegten ihn jetzt, die kaum definierbar waren.
Er sah bei einiger Prüfung zwar ein, dass ein Werk, das ihn anziehen sollte, den Stempel der Seltsamkeit tragen müsse, wie zum Beispiel Edgar Poës Kunst; aber er wagte sich häufig noch weiter vor auf diesem Wege.
Er wollte durchaus ein Kunstwerk, das für sich Bedeutung hatte. Er wollte ihm folgen, wie gestützt und getragen von einem freundlichen Helfer, in eine Sphäre, in der ihm die erhabenen Empfindungen eine ungeahnte Sensation einflössten, bei denen er lange nach der Ursache forschen konnte.
Er entfernte sich mehr und mehr von der Wirklichkeit und besonders von der heutigen Gesellschaft, gegen die er einen wachsenden Abscheu empfand. Dieser Hass hatte notgedrungen auf seinen litterarischen und künstlerischen Geschmack gewirkt, und er wandte sich soviel wie möglich von den Bildern und Büchern ab, deren in der Stoffwahl eng begrenzte Themata sich auf das moderne Leben beschränkten.
Somit verlor er die Fähigkeit, die Schönheit, unter welcher Form sie sich auch darbot, gleichgültig zu bewundern und zog bei Flaubert „die Versuchung des heiligen Antonius“ der „sentimentalen Erziehung“, bei Goncourt „die Faustina“ der „Germinie Lacerteux“, bei Zola „die Schuld des Abtes Mouret“ dem „Assommoir“ vor.
Dieser Gesichtspunkt schien ihm logisch. Diese weniger unmittelbar wirkenden, aber so mächtigen, so menschlichen Werke liessen ihn tiefer in den Schacht des Temperamentes dieser Meister eindringen, die mit aufrichtiger Ungezwungenheit die geheimnisvollsten Erregungen ihres Wesens offenbarten.
Und so trat er in vollständige Ideenübereinstimmung zu ihren Verfassern, weil sie sich wohl in einer gleichen Geistesverfassung wie er befunden haben mochten.
Bei Flaubert waren es die feierlichen, ungeheuren Gemälde, grossartiger Prunk in barbarisch prachtvoller Umrahmung, auf welchen entzückend zarte, geheimnisvolle und stolze Wesen Leben annahmen: Frauen in höchster Vollendung ihrer Schönheit, mit kranken Seelen, in ihrem Innern schreckliche Verwüstungen und wahnsinnige Wünsche.
Das ganze Temperament des grossen Künstlers zeigte sich in den unvergleichlichen Seiten der „Versuchung des heiligen Antonius“ und in „Salambo“, wo er weit ab von unserm armseligen Leben den Glanz der alten Zeiten heraufbeschwor mit ihren mystischen Gebeten, ihrem Verfall und ihren Grausamkeiten.
Bei Edmond de Goncourt war es das Heimweh nach dem vorigen Jahrhundert, eine Rückkehr zu der Eleganz einer für immer verschwundenen Gesellschaft; der begeisterte Lobgesang auf das Meer, das sich an den Hafendämmen bricht. Die Wüsten, die sich in endloser Ferne unter dem heissen Himmel verlieren, existierten nicht in seinem Heimweh-Werk, das sich in einen königlichen Park oder in ein Boudoir zurückzog, das durch die wollüstigen Ausströmungen eines Weibes mit müdem Lächeln, lüsternem Mund und sinnenden Augen erwärmt wird. Die Seele, mit denen Goncourt seine Menschen belebte, war nicht die Seele, die Flaubert seinen Geschöpfen eingab.
Obgleich sie unter uns gelebt hatte, obgleich sie ganz Leben und Körper unserer Zeit, war die Faustina dennoch durch erbliche Einflüsse ein Wesen des vergangenen Jahrhunderts, von dem sie die Würze der Seele, die geistige Müdigkeit und die sinnliche Ausschweifung hatte.
Dieses Buch von Goncourt war eins der Lieblingsbücher des Herzogs. Sein Verlangen, über einem Werke träumen zu können, wurde in diesem Werke gestillt, wo man überall zwischen den Zeilen lesen konnte.
Es war nicht die Sprache Flauberts, diese Sprache unnachahmlicher Pracht, sondern es war ein durchsichtig-krankhaft-nervöser Stil, ein Stil, der fähig war, die komplizierten Nüancen einer Epoche auszudrücken, welche an und für sich schon ausserordentlich verwickelt waren.
In Paris war das in der Litteraturgeschichte beinahe Unglaubliche geschehen: die mit dem Tode ringende Gesellschaft des achtzehnten Jahrhunderts, das Maler, Bildhauer, Musiker, Architekten in Fülle hervorgebracht hatte, die von seinem Stil durchdrungen und seinen Doktrinen erfüllt waren, hatte nicht einen wirklichen Schriftsteller gehabt, der seine morbide Grazie darzustellen verstand. Man hatte das Auftreten Goncourts abwarten müssen, dessen Kunst aus Erinnerungen bestand, aus wieder aufgefrischten Klagen über den leidigen Anblick des geistigen Elends und des niedrigen Trachtens seiner Zeit, damit er, nicht nur in seinen Geschichtsbüchern, sondern auch in seinem Heimweh-Werk, wie die „Faustina“, die Seele dieser Epoche wieder auferwecken, ihre nervösen Zartheiten in dieser Künstlerin verkörpern konnte.
Bei Zola war das Heimweh nach dem Jenseits anders geartet.
In ihm war nicht der Wunsch nach Auswanderung in verschwundene Regionen, nicht das Bedürfnis, in vergangene Zeiten zu flüchten. Sein mächtiges zielbewusstes Temperament, verliebt in die Üppigkeiten des Lebens, in die sanguinischen Kräfte und moralische Gesundheit, liess ihn sich von den künstlichen Reizen und der geschminkten Blutarmut des vergangenen Jahrhunderts fern halten, wie auch von der hierarischen Feierlichkeit, der brutalen Grausamkeit und den verweichlichten, zweideutigen Träumereien des alten Orients.
An dem Tage, an dem auch er von diesem Heimweh, von dem Bedürfnis und Sehnen erfasst worden war, das im Grunde die Poesie selbst ist, da hatte er sich in ein ideales Gefilde gestürzt, wo der Saft in voller Sonne schäumte; er hatte von der phantastischen Brunst des Himmels, von dem berauschenden Entzücken der Erde, von dem befruchtenden Regen des Blütenstaubes, der in die lechzenden Organe der Blumen fällt, geträumt. So war er zu einem riesenhaften Pantheismus gekommen, hatte, gegen seinen Willen vielleicht, mit diesem paradiesischen Milieu, in das er seinen Adam und seine Eva stellte, eine wunderbare indische Dichtung geschaffen, in einem Stil, dessen kühne, roh aufgetragene Farbe einen seltsamen Glanz, wie die der indischen Malerei hatte, indem er die Hymne der Fleischeslust anstimmte, das belebte und lebende Sinnliche feierte und durch das Betonen des Fortpflanzungsdranges der menschlichen Kreatur die verbotene Frucht der Liebe, ihre instinktiven Liebkosungen, ihre natürliche Stellung offenbarte.
Mit Baudelaire waren diese drei Meister in der französischen modernen profanen Litteratur diejenigen, die den Geist des Herzogs am meisten gefesselt hatten; aber dadurch, dass er sie zu oft gelesen, war er von diesen Werken übersättigt.
Er kannte sie auswendig, und um sich noch wieder in sie versenken zu können, hatte er sich bemüht, sie zu vergessen und sie einige Zeit in ihren Fächern ruhen zu lassen.
Deshalb öffnete er sie auch kaum, als der Diener sie ihm jetzt hinhielt. Er begnügte sich, den Platz zu bezeichnen, den sie einnehmen sollten, nur beachtend, dass sie auch richtig und gut geordnet wurden.
Der Diener brachte ihm einen neuen Stoss Bücher. Es waren dies zwar weniger bedeutende Werke, zu welchen er aber doch nach und nach eine Neigung gefasst hatte.
Gerade ihre Unvollkommenheiten gefielen ihm, vorausgesetzt, dass sie nicht unselbständig waren; und vielleicht enthält die Behauptung eine Dosis Wahrheit, welche meint, dass uns der Schriftsteller zweiten Ranges, der wohl eine Individualität darstellt, aber seiner Selbständigkeit noch nicht bewusst geworden ist, einen noch kräftigeren Trank zumutet, als der Künstler derselben Zeit, der wirklich gross und wirklich vollkommen ist.
Daher wendete er sich notgedrungen von den Meistern ab und den Schriftstellern zu, die ihm dadurch noch teurer wurden, dass sie das Publikum, das sie nicht verstand, verachtete.
Einer von ihnen, Paul Verlaine, hatte mit einem Band Verse „Poèmes Saturniens“ debütiert, einem ziemlich schwachen Werk, in dem sich die Nachahmungen von Leconte de Lisle und romantische Rhetorik berührten, aber in dem schon in gewissen Teilen, wie in dem Sonett: „Rêve familier“ die wirkliche Persönlichkeit des Poeten durchschimmerte.
Beim Studium seiner frühen Gedichte erkannte der Herzog unter seinen unselbständigen Versuchen ein Talent, das schon von Baudelaire tief durchdrungen war, dessen Einfluss sich später noch mehr geltend machte, ohne dass er ein erdrückender geworden wäre.
Seine späteren Bücher, die „Bonne Chanson“, die „Fêtes galantes“, die „Romances sans paroles“, schliesslich sein letzter Band „Sagesse“ enthielten Gedichte, in denen sich der originelle Schriftsteller offenbarte und sich von dem grossen Haufen seiner Kollegen glänzend abhob.
Im Gegensatz zu Verlaine, der direkt von Baudelaire abstammte und besonders durch die psychologische Seite, durch die köstliche Färbung des Gedankens, durch die gelehrte Quintessenz des Gefühls mit ihm verwandt war, näherte sich Théodore Hannon besonders dem Meister in der plastischen Form, in der äusserlichen Erscheinung der Wesen und Dinge.
Seine entzückende Korruption stimmte merkwürdig mit den Neigungen des Herzogs überein, der bei Nebel und Regentagen sich in den von dem Poeten erdachten Schmollwinkel einschloss und seine Augen an dem Schillern seiner Stoffe, an dem Funkeln seiner Edelsteine, an der ausschliesslich materiellen Pracht berauschte, die zu den Aufreizungen des Gehirns beitrugen.
Mit Ausnahme dieses Poeten und Stéphane Mallarmé’s, die er seinem Diener beiseite zu legen befahl, um sie abseits aufzustellen, fühlte sich der Herzog nur wenig von den Dichtern angezogen.
Trotz ihrer prächtigen Form, trotz der imposanten Wendung seiner Verse, die sich mit solchem Glanz ausbreiteten, dass die Hexameter von Hugo sogar im Vergleich düster und klanglos schienen, konnte ihn Leconte de Lisle jetzt nicht mehr befriedigen.
Das Altertum, das Flaubert so wunderbar wieder belebt hatte, blieb unter seinen Händen leblos und kalt. Es war kein Blut in diesen Versen, alles war nur Aussenseite; nichts atmete in diesen öden Gedichten, deren kaltblütige Mythologieen ihn schliesslich erstarrten.
Auch an Gautiers Werken fand er kein Interesse mehr, nachdem er ihn lange gern gehabt hatte; seine Bewunderung für einen so unvergleichlichen Maler, wie dieser Mann es war, war von Tag zu Tag mehr verschwunden, und jetzt war er erstaunter als entzückt über diese indifferenten Beschreibungen.
Zweifellos liebte der Herzog die Werke dieser beiden Poeten, wie er seltene und kostbare Steine liebte, aber keine der Variationen dieser vollkommenen Instrumentisten konnte ihn mehr entzücken, denn keine war dem Träumen zugänglich, keine zeigte, wenigstens nicht für ihn, einen jener lebhaften Durchblicke, die ihm erlaubten, den langsamen Flug der Stunden zu beschleunigen.
Er ging hungrig von diesen Büchern weg; ähnlich erging es ihm bei Victor Hugo.
Die psychologischen Labyrinthe Stendhals, die analytischen Irrgänge Durantys lockten ihn, aber ihre farblose, steife Sprache, gut genug für die gewöhnlichen Theaterstücke, stiess ihn andrerseits ab.
Um sich an einem Werk zu erfreuen, das nach seinem Geschmack einen prägnanten Stil mit einer scharfsinnig-katzenhaften Beweisführung verband, musste er auf Edgar Poë zurückgreifen, für den seine Liebe nur gewachsen war, seitdem er sich öfter mit ihm beschäftigt hatte.
Mehr als jeder andere entsprach gerade dieser durch eine geistige Verwandtschaft den Träumereien des Herzogs.
Dem Tod, den alle Dramatiker so sehr gemissbraucht hatten, hatte er ein anderes Aussehen gegeben; es war eigentlich weniger der wirkliche Todeskampf eines Sterbenden, den er beschrieb, sondern der moralische Todeskampf des Überlebenden, der vor dem elenden Bett von grässlichen Hirngebilden, welche der Schmerz und die Ermüdung erzeugt, erfasst wird. Mit grausamem Zauber hob er besonders die Handlungen des Entsetzens, den Zusammenbruch des Willens hervor, begründete sie kaltblütig, schnürte nach und nach die Kehle des keuchenden erstickenden Lesers vor diesem künstlich zurecht gemachten Alpdrücken des heissen Fiebers zu. Von erblichem Nervenleiden krampfhaft verzerrt, halb wahnsinnig von dem moralischen Veitstanz lebten seine Kreaturen nur durch die Nerven; seine Frauengestalten, wie Morella, Ligeia, besassen eine ungeheure Gelehrsamkeit, durchdrungen von dem Nebel der deutschen Philosophie und den kabbalistischen Geheimnissen des alten Orients, und alle hatten sie Knabenbrüste und waren geschlechtslos.
Baudelaire und Poë, diese beiden Geister, die man oft zusammengestellt hatte wegen ihrer poetischen Berührungspunkte, ihrer gleichen Neigung in dem Vorwurfe geistiger Krankheiten, waren vollständig verschieden durch ihre Auffassungen vom Gemüt, das in ihren Werken einen so grossen Platz einnahm. Baudelaire mit seiner gierigen Liebe, deren grausame Lust an die Verfolgungen einer Inquisition erinnert; Poë mit seinen keuschen ätherischen Leidenschaften, in denen keine Sinnlichkeit lebte, in denen das Gehirn allein Geltung hatte, ohne Zusammenhang mit den Organen, die, wenn sie überhaupt vorhanden waren, nur kalt und jungfräulich blieben.
Diese Klinik, in der der geistreiche Chirurg in einer bedrückenden Atmosphäre Gehirne zerlegte, war für den Herzog eine Quelle unermüdlichen Nachdenkens; aber seitdem sein Nervenleiden zugenommen hatte, gab es Tage, wo diese Lektüre ihn vollständig niederwarf, Tage, wo er mit zitternden Händen ängstlich lauschend dasass und sich, wie der verzweifelte Usher, von einer unsinnigen Todesangst, einem dumpfen Schrecken erfasst fühlte.
Notgedrungen musste er sich schonen und diese fürchterlichen Reizmittel vermeiden. Ebenso vermochte er nicht mehr ungestraft sein rotes Vorzimmer zu besichtigen und sich an dem Anblick der Unheimlichkeiten Odilon Redons und den Martern Jan Luykens zu berauschen.
Und doch schien ihm, wenn er in dieser Geistesverfassung war, jede Litteratur ungeniessbar nach diesem amerikanischen Poeten.
Er wendete sich dann wohl zu Villiers de l’Isle-Adam, in dessen zerfahrenem Werke er wohl noch Anreizendes fand, das ihn jedoch nicht mehr wirklich packte, mit Ausnahme allerdings seiner Claire Lenoir, einem wahrhaft beunruhigenden Scheusal.
Es existierte wohl kein anderes Buch in Frankreich in diesem Stil des ernsten und zugleich herben Spottes, ausser der Novelle von Charles Cros: „la science de l’amour“. Diese konnte noch durch ihren stichelnden Humor und ihre kalt spasshaften Beobachtungen auffallen, aber das Vergnügen war nur relativ, denn die Ausführung liess alles zu wünschen übrig.
„Mein Gott! mein Gott! giebt es doch wenig Bücher, die man zweimal lesen kann,“ seufzte der Herzog, seinem Diener zusehend, der vom Schemel herunterstieg, indem er zur Seite ging, damit der Herzog alle Fächer überblicken konnte.
Herzog Jean nickte Genehmigung mit dem Kopfe. Es blieben nur noch zwei dünne Einbände auf dem Tische. Eine Handbewegung verabschiedete den alten Diener. Er ergriff eines der Bücher, das in Eselshaut gebunden war, eingehüllt in eine Schutzdecke aus altem chinesischen Seidenstoff, der verblasst war und den Reiz verblasster Stoffe hatte, wie sie Mallarmé in einem entzückenden Gedichte rühmte.
Das Buch bestand aus nur neun Seiten und enthielt Auszüge aus Mallarmés ersten beiden Büchern. Sie waren auf Pergament gedruckt und unter dem Titel: „Einige Verse von Mallarmé“ vereinigt. Sie waren von einem geschickten Kalligraphen in goldenen und farbigen Buchstaben mit der Hand im Stil der alten Handschriften gemalt.
Einige dieser Stücke interessierten ihn, aber besonders ein Bruchstück der Herodias wusste ihn in gewissen Stunden wie durch einen Zauber zu bannen.
Wie oft hatte er sich nicht des Abends unter der Lampe, die mit ihrem gedämpften Licht das stille Zimmer beleuchtete, hingerissen gefühlt von dieser Herodias, die in dem Bilde Gustav Moreaus, das jetzt im Schatten hing, nur noch die undeutlichen Umrisse ihres Körpers durch ihren Behang von Edelsteinen durchblicken liess.
Die Dunkelheit unterdrückte das Leben, dämpfte die Reflexe und den goldigen Hintergrund, warf Schatten auf den Tempel, bedeckte die Nebenpersonen, begrub sie in ihren toten Farben, und nun das Weisse des Bildes verschwand, liess sie das Weib aus ihrem Juwelenbehang noch leuchtender heraustreten und sie noch nackter erscheinen.
Unwillkürlich hob er zu ihr das Auge empor, erkannte sie in ihren unvergesslichen Umrissen und sie wurde wieder lebendig und rief auf ihren Lippen die seltsamen und süssen Verse wach, die ihr Mallarmé eingiebt.
Er liebte diese Verse, wie er die Werke dieses Dichters liebte, der im Jahrhundert des allgemeinen Wahlrechts und in einer Zeit der Geldgier abseits vom litterarischen Wege lebte, geschützt durch seine Verachtung vor der ihn umgebenden Dummheit. Er gefiel sich, fern von dem Treiben der Welt in dem wechselnden Spiel des Verstandes, in den Visionen des Gehirns, indem er noch mit den schon an sich gekünstelten Gedanken jonglierte und ihnen byzantinische Lichterchen aufsetzte.
Von allen Formen der Litteratur war die des Gedichtes in Prosa diejenige, die der Herzog am meisten liebte. Von einem Genie gehandhabt, musste sie in ihrem kleinen Raum die Gewalt eines Romans, dessen zergliederte Längen und beschreibende unnütze Wiederholungen sie wegliess, einschliessen.
Schon oft hatte der Herzog über das grosse Problem nachgegrübelt, einen Roman in wenige Sätze zusammengedrängt zu schreiben, die die kondensierte Last von hunderten von Seiten enthielten. Dann würden die gewählten Worte an ihrem richtigen Platze stehen, so, dass man keines umstellen könnte.
Der auf diese Weise abgefasste Roman, in eine oder zwei Seiten zusammengedrängt, würde eine Gedankenübereinstimmung zwischen dem Dichter und dem idealen Leser, eine geistige Zusammenarbeit zwischen wenigen auserwählten Personen, die in der Welt zerstreut sind, ein nur wenigen Feinsinnigen zugänglicher Genuss werden.
Mit einem Wort, das Gedicht in Prosa stellte für den Herzog den Extrakt der Litteratur, das Rückgrat der Kunst vor.
Dieser auf ein Minimum kondensierte Extrakt existierte schon bei Baudelaire und ebenfalls in den Gedichten von Mallarmé, den er mit tiefem Entzücken in sich sog.
Als er dieses letzte Buch zuklappte, sagte sich der Herzog, dass sich jetzt wohl seine Bibliothek nie mehr vermehren würde.
Die nervöse Verdauungsschwäche zeigte sich von neuem. Das neue Mittel brachte eine solche Reizung in seinem Magen hervor, dass der Herzog so schnell wie möglich mit seinem Gebrauch aufhören musste.
Die Krankheit nahm ihren gewöhnlichen Verlauf; unbekannte Erscheinungen begleiteten sie. Nach den Alpdrücken, den Geruchseinbildungen, Gesichtsstörungen, dem harten, hartnäckigen Husten, dem Klopfen der Pulsadern und des Herzens, dem kalten Schweiss traten Täuschungen des Gehörs ein, Verschlimmerungen, die sich nur in der letzten Periode des Übels zu zeigen pflegen.
Von einem hitzigen Fieber verzehrt, hörte der Herzog plötzlich ein Wasserrauschen, das Summen von Bienenschwärmen; dann verschmolzen diese Geräusche zu einem einzigen zusammen, das dem Schnarren einer Drehbank ähnelte. Dieses Schnarren wurde nach und nach schwächer und löste sich in hellen Glockenklängen auf.
Bald fühlte er sein fieberndes Hirn wie emporgetragen in musikalischen Wellen, eingehüllt in den mystischen Taumel seiner Kindheit.
Die bei den Jesuiten erlernten Gesänge fielen ihm wieder ein, durch sie wieder das Pensionat und die Kapelle, in dem sie erklangen.
Bei den Patern wurden die religiösen Feierlichkeiten mit grosser Pracht ausgeführt; ein vortrefflicher Organist und ein ausgezeichneter Chorknabengesang machten diese religiösen Übungen zu einem künstlerischen Genuss, der dem Kultus zu gute kam.
Der Organist war in die alten Meister verliebt und bei hohen Festtagen spielte er Messen von Palestrina und Orlando Lasso, Psalmen von Marcello, Oratorien von Händel, Motetten von Sebastian Bach und trug gerne des Paters Lambilottes weiche und leichte Kompositionen vor, wie auch die „Laudi spirituali“ des sechzehnten Jahrhunderts, deren priesterliche Weihe den jungen Herzog oft entzückt hatte.
Besonders aber empfand er eine unbeschreibliche Wonne beim Hören des einstimmigen Kirchengesangs, den der Organist beibehalten hatte.
Die jetzt für veraltet und altertümelnd geltende Liturgie war das Wort und der Geist der antiken Kirche, die Seele des Mittelalters; es war das ewig gesungene Gebet, nach den Begeisterungen der Seele harmonisiert, eine beständige Hymne, die seit Jahrhunderten zu dem Allerhöchsten hinaufgesandt wurde.
Diese traditionelle Melodie war die einzige, die sich mit ihrem mächtigen Gleichklang, ihren feierlich massiven Harmonieen den Quadersteinen der alten Basiliken anpasste und die römischen Gewölbe ausfüllte.
Wie oft war der Herzog nicht ergriffen und niedergedrückt gewesen von dem unwiderstehlichen Hauch, als der „Christus factus est“ des gregorianischen Gesanges zu dem Kirchenschiff emporstieg, dessen Pfeiler unter den schwebenden Wolken des Weihrauchkessels zu zittern schienen; oder wenn die einförmige Melodie des „De profundis“ klagend ertönte, traurig wie ein Schluchzen, durchdringend wie der verzweifelte Ruf der Menschheit, die ihr sterbliches Schicksal beweint, die rührende Barmherzigkeit ihres Erlösers anfleht!
Im Vergleich zu diesem prachtvollen Gesang, den kein Einzelner, sondern der Genius der Kirche geschaffen, unpersönlich, namenlos wie die Orgel selbst, deren Erfinder unbekannt ist, schien ihm jede religiöse Musik profan.
Dagegen war in allen den Werken Jomellis und Porporas, Carissimis und Durantes, in den bewundernswürdigsten geistigen Schöpfungen von Händel und Bach keine Verzichtleistung auf einen öffentlichen Erfolg, keine Aufopferung einer Kunstwirkung, keine Entsagung des menschlichen Stolzes zu finden.
Höchstens in der imposanten Hochamtsmusik von Lesueur bestätigte sich der religiöse Stil ernst und streng und näherte sich der erhabenen Majestät des alten Chorals.
Übrigens waren die Ideen des Herzogs in absolutem Widerspruch mit den Theorieen, die er in Bezug auf alle andern Künste bekannte. Was die religiöse Musik anbelangte, so billigte er eigentlich nur die klösterliche Musik des Mittelalters, diese abgezehrte Musik, die instinktmässig auf die Nerven wirkt. Dann gestand er auch selbst zu, dass er unfähig war, die Schliche zu verstehen, die die Meister der Gegenwart in der katholischen Kunst eingeführt hatten; auch hatte er die Musik nicht mit derselben Leidenschaft studiert, mit der er sich zur Malerei und zu den litterarischen Wissenschaften hingezogen fühlte.
Er spielte wie der erste beste Klavier, war nach längerem Studium imstande, eine Partitur zu entziffern, aber er verstand nichts von der Harmonie und der nötigen Technik, um wirklich eine Feinheit zu schätzen und mit Sachverständnis zu geniessen.
Mit der profanen Orchestermusik konnte er sich nicht befreunden, weil man sie nicht bei sich allein hören kann, wie man ein Buch zu lesen pflegt. Um sie zu geniessen, hätte er sich unter dieses immer gleiche Publikum mischen müssen, das die Theater füllt und den Winter-Cirkus belagert, wo man in einer Waschhausatmosphäre einen Menschen bewundert, welcher in der Luft herumfuchtelt und aus Wagner herausgerissene Episoden zur ungeheuren Freude eines unwissenden Haufens grausam zu Tode hetzt.
Er hatte nicht den Mut gehabt, sich in dieses Volksbad zu tauchen, um Berlioz zu hören, von dem ihn indessen einige Bruchstücke durch ihre leidenschaftliche Begeisterung und ihr schwungvolles Feuer gefangen genommen hatten; und er sah auch ein, dass keine Scene, ja selbst nicht mal ein Satz einer Oper des wunderbaren Wagner aus ihrem Gefüge ungestraft losgelöst werden durfte.
Und deshalb war der Herzog auch der Meinung, dass von diesem Haufen von Musikfreunden, die des Sonntags ausser sich gerieten, kaum zwanzig die Partitur kannten, die man verhunzte.
Die bekanntere, leichtere Musik und die unabhängigen Stücke der alten Opern fesselten ihn sehr wenig; die leichten Piècen von Auber und Boïeldieu, Adam und Flotow und die Banalitäten eines Ambroise Thomas und Bazin widerten ihn in gleichem Masse an, wie die veralteten Zierereien und die pöbelhaften Reize der Italiener.
Er hatte sich deshalb von der Musik fern zu halten entschlossen und seit den Jahren dieser seiner Enthaltung erinnerte er sich nur gewisser Kammermusik-Soiréen, in denen er Beethoven und besonders Schumann und Schubert gehört hatte, die seine Nerven derart zermürbt hatten wie die innigsten und qualvollsten Dichtungen Edgar Poës.
Gewisse Partieen für Violoncello von Schumann hatten ihn ganz atemlos gelassen; es waren besonders die Lieder von Schubert, die ihn vor Entzücken ausser sich gebracht hatten.
Diese Musik drang in sein tiefstes Inneres und machte sein Herz erbeben wie von vergessenen Leiden alter Melancholie; und er fühlte sich ganz betäubt, plötzlich so viel wirres Elend und unbestimmten Schmerz zu empfinden.
Diese Musik der Verzweiflung, die aus dem Tiefsten des Seins aufschrie, entsetzte und entzückte ihn zugleich. Niemals hatte er „des Mädchens Klage“ hören können, ohne dass ihm nicht nervöse Thränen in die Augen stiegen, denn es war in diesem Klagelied mehr als Betrübnis, etwas Entrissenes, das ihm das Herz zerwühlte, wie das Sterben eines Lieben in einer düsteren, öden Landschaft.
Und immer wieder, wenn ihm diese entzückend traurigen Klagen über die Lippen kamen, riefen sie in ihm diese einsame Landschaft wach, in der geräuschlos in der Ferne vom Leben abgehetzte Menschen in der Dämmerung verschwanden. Er fühlte sich dann in dieser trostlosen Natur so allein, durch Herzeleid und Widerwillen verbittert, von einer namenlosen Melancholie erdrückt, von einer tödlichen Herzensangst erfasst, deren geheimnisvolle Macht jeden Trost, jedes Mitleid, jede Ruhe ausschloss.
Gleich einem Totengeläute verfolgte ihn dieser verzweiflungsvolle Gesang, jetzt, wo er durch Fieber vernichtet darniederlag, von toller Angst erregt, die zu beschwichtigen ihm um so weniger gelang, als er deren Ursache nicht erkannte.
Er überliess sich schliesslich dem Spiel der Wellen. Des Kampfes müde, liess er sich von dem Strom der Angst hin und her werfen, der sich in klagenden Tönen durch seinen schmerzenden Kopf und stechende Schläfe ergoss.
Eines Morgens hörte aber dieses Singen und Klingen auf; der Herzog war wieder seiner mächtig und ersuchte den Diener, ihm einen Spiegel zu bringen. Vor Entsetzen glitt ihm dieser fast aus der Hand; er erkannte sich kaum wieder.
Sein Gesicht hatte eine Erdfarbe angenommen, die Lippen waren aufgedunsen und trocken, die Zunge welk, die Haut runzelig. Sein Haar und Bart, seit seiner Krankheit nicht geschnitten, erhöhten noch das Entsetzliche seines eingefallenen Gesichtes mit den hohlen, verschwommenen Augen, die im Fieberglanz in seinem borstigen Schädel brannten.
Mehr als seine Schwäche, als seine Erbrechungen, die jeden Versuch von Nahrung zurückwiesen, mehr als dieser Marasmus, in dem er steckte, erschreckte ihn diese Veränderung seines Äussern.
Er glaubte sich verloren; doch trotz der Ermattung, die ihn niederdrückte, richtete ihn die Energie eines gehetzten Menschen plötzlich auf und gab ihm die Kraft, einen Brief an seinen Arzt in Paris zu schreiben und seinem Diener zu befehlen, denselben auf der Stelle aufzusuchen und ihn um jeden Preis sofort herzuschaffen.
Sein vollständiges Sichgehenlassen ging in plötzliche Hoffnung über; denn dieser Arzt war ein berühmter Spezialist, ein Doktor, bekannt durch seine Kuren nervöser Krankheiten.
„Er hat sicher schon eigensinnigere und gefährlichere Fälle als den meinen behandelt,“ sagte sich der Herzog; „er wird mich zweifellos in einigen Tagen wieder auf die Beine bringen.“
Dann aber folgte diesem Vertrauen eine vollständige Hoffnungslosigkeit.
„So gelehrt, so geschickt sie auch sein mögen, von Nervenleiden verstehen die Ärzte nichts, ja sie kennen nicht einmal ihren Ursprung. Wie alle anderen wird auch dieser mir das ewige Zinkoxyd, Chinarinde, Bromkali und Baldrian verschreiben.“
„Aber wer weiss,“ fuhr er dann fort, sich an eine letzte Hoffnung klammernd, „wenn mir diese Mittel bis jetzt nicht geholfen haben, so kommt es vielleicht daher, dass ich sie nicht in richtiger Dosis gebraucht habe.“
Trotz alledem aber gab ihm die Erwartung einer möglichen Linderung schon neuen Lebensmut.
Dann befiel ihn die neue Befürchtung, ob sich der Arzt in Paris befände und sich hierher bemühen würde. Und wieder überwältigte ihn die Furcht, dass der Diener ihn nicht antreffen könnte.
Er fühlte aufs neue seine Kräfte schwinden, er ging von einer Sekunde zur andern von tollster Hoffnung zur wahnsinnigsten Angst über, übertrieb die Aussichten plötzlicher Heilung, wie die Befürchtungen einer nahen Gefahr. So verflossen die Stunden und der Augenblick kam, wo es zu Ende war mit seiner Kraft, wo er an dem Kommen des Arztes verzweifelte und sich wütend sagte, dass er sicherlich gerettet würde, wenn ihm rechtzeitig beigestanden worden wäre. Dann wieder verflog sein Zorn gegen den Diener und den Arzt, die er beschuldigte, ihn sterben zu lassen, und schliesslich raste er gegen sich selbst und warf sich vor, so lange gewartet zu haben, um Hilfe zu holen, und bildete sich ein, dass er jetzt geheilt sein würde, wenn er nur einen Tag früher kräftige Arzeneien und vernünftige Pflege gehabt hätte.
Nach und nach besänftigte sich dieser Wechsel von Beunruhigungen und neuen Hoffnungen, die sich in seinem leeren Hirn jagten. Diese Widersprüche rieben ihn vollends auf. Er verfiel in einen Schlaf der Ermattung, den unzusammenhängende Träume durchzogen, in eine Art von Ohnmacht, die von bewusstlosem Erwachen unterbrochen wurde. Er hatte den Begriff seiner Wünsche und Befürchtungen derart verloren, dass er ganz apathisch war und kein Erstaunen und keine Freude empfand, als der Arzt plötzlich ins Zimmer trat.
Der Diener hatte ihn jedenfalls von der Lebensweise des Herzogs unterrichtet und auch von den verschiedenen Symptomen, die er selbst beobachtet hatte seit dem Tage, als er seinen Herrn nahe dem Fenster, von der Heftigkeit der Parfüms ohnmächtig, aufgehoben hatte; denn der Arzt stellte nur wenige Fragen an den Kranken, dessen Verhältnisse er übrigens seit Jahren kannte. Er untersuchte ihn, klopfte und horchte an ihm herum und prüfte aufmerksam den Urin, in welchem ihm gewisse weisse Streifen eine der ausgesprochensten Ursachen des Nervenleidens offenbarten.
Er schrieb ein Rezept, und ohne noch etwas hinzuzufügen, ging er fort, seine baldige Rückkehr zusagend.
Dieser Besuch tröstete den Herzog, den jedoch das Schweigen sehr befremdete, und er beschwor seinen Diener, ihm nicht länger die Wahrheit vorzuenthalten. Dieser bestätigte ihm, dass der Arzt keinerlei Beunruhigung an den Tag gelegt hätte, und so misstrauisch auch Herzog Jean war, er fand kein Anzeichen, welches eine Lüge auf dem ruhigen Gesicht des alten Mannes verriet.
Bald heiterten sich seine Gedanken auf; überdies waren seine Leiden verstummt und zu der Schwäche, die er in allen Gliedern verspürte, gesellte sich eine gewisse Sanftheit, eine gewisse Wohligkeit, leise und unbestimmt. Und endlich war er ganz zufrieden, nicht mit Arzeneien und Flaschen überbürdet zu sein. Ein schwaches Lächeln glitt um seine blassen Lippen, als der Diener ein mit Pepton gemischtes Klystier brachte und ihm bedeutete, dass er dasselbe dreimal in vierundzwanzig Stunden wiederholen müsse.
Es müsste köstlich sein, dachte er, wenn man bei voller Gesundheit dieses einfache Mittel fortsetzen könnte! Welch eine Ersparnis an Zeit, welch eine radikale Erlösung der Abneigung, welche das Fleisch den Leuten ohne Appetit einflösst! Welch endgültige Befreiung des Überdrusses, der immer aus der notgedrungen beschränkten Wahl der Speisen sich ergiebt! Welch energische Verwahrung gegen die gemeine Sünde der Gefrässigkeit!
Einige Tage darauf brachte der Diener ein Klystier, dessen Farbe und Geruch anders war als das von Pepton.
„Aber das ist ja nicht dasselbe!“ rief der Herzog aus, der sehr aufgeregt war über die in das Instrument gegossene Flüssigkeit.
Er verlangte wie in einem Restaurant die Karte, und das Rezept des Arztes entfaltend las er:
| Leberthran | 20 | Gramm |
| Kraftbouillon | 200 | Gramm |
| Burgunderwein | 200 | Gramm |
| Eigelb | 1 | Gramm. |
Aber er brauchte bald nicht mehr über die nährenden Flüssigkeiten nachzudenken, denn es gelang dem Arzt, nach und nach die Erbrechungen zu bezwingen und ihm auf gewöhnlichem Wege einen süsslichen Punsch mit Fleischpulver gemischt beizubringen, dessen unbestimmtes Aroma von Kakao seinem Mund zusagte.
Wochen vergingen, und sein Magen entschloss sich endlich wieder zu arbeiten; zu gewissen Zeiten kam die Übelkeit noch wieder, die indessen durch das Ingwerbier und durch eine Arzenei von der Riviera eingeschränkt wurde.
Schliesslich kräftigten sich auch nach und nach die Organe wieder, und mit Hilfe der Pepsine konnte er wirkliches Fleisch verdauen. Die Kräfte nahmen zu, und bald konnte der Herzog schon in seinem Zimmer aufrecht stehen und versuchen zu gehen, sich auf einen Stock stützend und an den Ecken der Möbel festhaltend. Anstatt sich dieses Erfolges zu freuen, vergass er seine vergangenen Leiden, wurde gereizt über die Länge der Rekonvalescenz und warf dem Arzt vor, dass er seine Genesung hinauszögere.
Endlich war er so weit wieder hergestellt, dass er während ganzer Nachmittage aufbleiben konnte und ohne Hilfe in seinem Zimmer umherzugehen vermochte.
Jetzt ärgerte ihn sein Arbeitszimmer; Fehler, an die er sich durch die Länge der Zeit gewöhnt hatte, fielen ihm in die Augen, als er nach langer Zwischenzeit wieder dorthin kam.
Die Farben, die gewählt waren, um bei Licht gesehen zu werden, erschienen ihm bei Tageslicht unharmonisch. Er dachte daran, sie zu ändern und stellte stundenlang künstliche Farbenharmonieen zusammen.
Es ist kein Zweifel, ich bin auf dem Wege der Besserung, dachte er, die Rückkehr zu seinen früheren Beschäftigungen und alten Liebhabereien wahrnehmend.
Eines Morgens, während er seine orange-gelben und blauen Wände betrachtete und dabei von den idealen Wandbekleidungen träumte, die aus griechischen Kirchenstolas, russischen Messgewändern in Goldstoff, Chormänteln aus Brokat, mit slavonischen Buchstaben gemustert, aus Edelsteinen des Ural und aus Reihen Perlen gebildet waren, trat der Arzt ins Zimmer, und die Blicke seines Kranken beobachtend, erkundigte er sich nach seinem Befinden.
Der Herzog teilte ihm seine unausführbaren Wünsche mit und fing an, neue Farbenmischungen vor ihm zu entwickeln, von Paarungen und Auflösungen der Nüancen zu sprechen, als ihm der Arzt einen energischen Dämpfer aufsetzte und ihm in einer keinen Widerspruch duldenden Weise erklärte, dass er jedenfalls nicht in dieser Wohnung seine Pläne zur Ausführung bringen werde.
Und ohne ihm die Zeit zu einer Entgegnung zu lassen, setzte er ihm auseinander, dass er zuerst zum wichtigsten geschritten sei, indem er die Verdauungsfunktionen wieder hergestellt habe, und dass er jetzt das Nervenleiden selbst in Behandlung nehmen müsse, das keineswegs geheilt sei und Jahre der Schonung und Pflege erfordere.
Er fügte hinzu, dass, bevor er irgend ein Mittel versuchen oder eine Kaltwasserkur anfangen könne, was ausserdem in Fontenay unmöglich sei, er diese Zurückgezogenheit aufgeben, nach Paris zurückkehren, in das allgemeine Leben wieder eintreten und endlich versuchen müsse, sich wie jeder andere Mensch zu zerstreuen.
„Aber die Vergnügungen der Anderen zerstreuen mich nicht!“ rief der Herzog empört aus.
Ohne sich in Diskussion einzulassen, versicherte der Arzt einfach, dass die gänzliche Lebensveränderung in seinen Augen eine Lebensfrage wäre.
„Das heisst also der Tod oder die Galeerenstrafe!“ rief der Herzog erbittert aus.
Der Arzt, von allen Vorurteilen eines Weltmannes durchdrungen, lächelte und schritt ohne zu antworten der Thür zu.
Der Herzog hatte sich in seinem Schlafzimmer eingeschlossen und sich die Ohren verstopft, um nicht die Hammerschläge zu hören, die vom Zunageln der Packkisten, die die beiden alten Diener fertig machten, herüberhallten. Jeder Schlag traf sein Herz und schlug ihm eine tiefe Wunde ins volle Fleisch.
Der Ausspruch des Arztes verwirklichte sich. Die Furcht, nochmals die Schmerzen, die er ertragen hatte, durchmachen zu müssen und die Angst vor einem grässlichen Todeskampf hatten mächtiger auf den Herzog gewirkt, als der Hass der niederträchtigen Existenz, zu welcher ihn das Urteil des Arztes verdammte.
„Und doch giebt es Leute,“ murmelte er, „die zurückgezogen leben, ohne mit jemand zu sprechen, die sich fern von der Welt verzehren, so wie die Zuchthäusler und die Trappisten, und nichts beweist, dass diese Unglücklichen, wie auch die Weisen wahnsinnig oder schwindsüchtig werden.“
Er hatte diese Beispiele dem Doktor ohne Erfolg angeführt. Dieser hatte ihm in trocknem Ton wiederholt, der keine Einrede zuliess, dass seine Ansicht, die übrigens durch die Ansicht aller Krankheitsbeschreiber des Nervenleidens bestätigt wurde, dass allein Zerstreuung, Vergnügen, Freude auf die Krankheit Einfluss haben könnte, die richtige wäre. Ungeduldig gemacht durch die Gegenklagen seines Kranken, hatte er ein für allemal erklärt, dass er sich weigere, seine Behandlung fortzusetzen, wenn er nicht einwillige, die Luft zu wechseln und nach den neuen Vorschriften der Gesundheitslehre zu leben.
Herzog Jean hatte sich nach Paris begeben und andere Specialisten zu Rate gezogen, ihnen unparteiisch seinen Fall vorgelegt, und nachdem alle ohne Zögern die Verschreibungen ihres Fachgenossen gebilligt, hatte er eine leere Wohnung in einem neuen Hause gemietet, war nach Fontenay zurückgekehrt und hatte, ausser sich vor Wut, den alten Dienern befohlen, die Koffer zu packen.
Tief in seinen Sessel gedrückt, grübelte er jetzt über die Wandlung nach, die seine Pläne umstürzte, die die Neigungen seines jetzigen Lebens zerstörte, seine zukünftigen Projekte begrub. Er musste diesen Hafen, der ihn schützte, verlassen, wieder von neuem in den Sturm von Albernheiten hinaustreten, der ihn früher niedergeworfen hatte!
Die Ärzte sprachen von Vergnügungen, Zerstreuungen; ja aber mit wem und womit sollte er sich denn erheitern und zerstreuen?
Hatte er sich nicht selbst aus der Gesellschaft gestossen? Kannte er einen Menschen, der es versuchen möchte, so wie er sich in Betrachtungen zu verbannen, sich in Träumereien zu verlieren? Kannte er auch nur einen Menschen, der imstande war, den Scharfsinn eines Satzes, die Feinheit einer Malerei, die Quintessenz eines Gedankens zu schätzen, einen Menschen, dessen Seele fein genug war, einen Mallarmé zu verstehen, einen Verlaine zu lieben?
Wo, wann und in welcher Gesellschaft sollte er suchen, einen Geistesgenossen zu finden, einen Geist, abgesondert von allen Gemeinplätzen, der das Schweigen wie eine Wohlthat, den Undank wie eine Erleichterung, das Misstrauen wie einen Schutz, wie einen Hafen segnete? In der Welt, in der er vor seiner Abreise nach Fontenay gelebt hatte? – Die meisten dieser Junker, mit denen er verkehrt, hatten sich seit jener Zeit noch mehr in den Salons verdummt, waren noch mehr an den Spieltischen versumpft, an den Küssen der Dirnen noch mehr verliedert. Die meisten mochten sogar verheiratet sein.
„Welch hübscher Wechsel, welch schöner Tausch war doch diese von der sonst so prüden Gesellschaft angenommene Gewohnheit!“ träumte der Herzog vor sich hin.
War denn nicht auch der alte Adel in Fäulnis geraten? War die Aristokratie nicht dem Stumpfsinn und der Versumpfung anheimgefallen? Sie erlosch in der Herabgekommenheit ihrer Nachkommen, deren Fähigkeiten bei jeder Generation schwächer wurden und deren Gorilla-Instinkte eines Stallknechtes und Jockeys würdig waren.
Die Klöster waren in Apotheken und Likörfabriken verwandelt. Sie verkauften Rezepte oder machten sie selbst: der Orden der Cistercienser zum Beispiel Schokolade; Trappisten Nudeln und aromatische Weingeistarnika; die Dominikanermönche fabrizierten gegen den Schlagfluss wirkende Elixiere; die Jünger des heiligen Benedikt Benediktiner-Likör; die Mönche des heiligen Bruno Chartreuse.
Der Handel hatte die Klöster überschwemmt: statt der Chorbücher standen grosse Handels-Register auf den Kirchenpulten. Dem Aussatze gleich zerstörte die Gier die Kirche, sie beugte die Mönche über die Inventuren und Rechnungen, verwandelte die Kirchenväter in Zuckerbäcker und Quacksalber, die Laienbrüder und Klosterdiener in gewöhnliche Packer und Krukenverschliesser.
Und dennoch waren es nur noch die Geistlichen, bei denen der Herzog Verbindungen erhoffen konnte, die bis auf einen gewissen Grad seinem Geschmack gleichkamen. In der Gesellschaft der Stiftsherren, im allgemeinen gelehrt und wohlerzogen, würde er einige angenehme und interessante Abende verbringen können. Aber dazu war es nötig, dass er ihren Glauben teilte, dass er nicht zwischen skeptischen Ideen und Überzeugungssprüngen schwankte, die von Zeit zu Zeit, durch die Erinnerungen seiner Kindheit unterstützt, auftauchten.
Er hätte identische Meinungen hegen müssen und nicht, wie er es gern in den Augenblicken der Erregung that, einen mit etwas Magie gesalzenen Katholizismus anerkennen dürfen.
Dieser besondere Klerikalismus, dieser verderbte und künstlich lasterhafte Mystizismus, auf welchen er in gewissen Stunden lossteuerte, konnte sogar mit einem Priester nicht besprochen werden, der ihn nicht begriffen und ihn sofort mit Entsetzen verbannt haben würde.
Zum zwanzigsten Mal erregte ihn dies unlösliche Rätsel. Er hätte gewünscht, dass dieser argwöhnische Zustand, gegen den er vergeblich in Fontenay gekämpft hatte, ein Ende nähme, jetzt, wo er aus sich herausgehen sollte; er hätte sich zwingen mögen, den wahren Glauben zu besitzen, sich ihn tief einzuprägen, sobald er ihn halten würde, ihn mit Klammern in seiner Seele zu befestigen, ihn endlich in Sicherheit zu bringen vor allen Grübeleien, die ihn schwankend machten.
„Könnte man doch jedes Grübeln aufgeben!“ murmelte der Herzog mit einem schmerzlichen Seufzer; „man müsste die Augen schliessen können, sich durch die Strömung forttreiben lassen und diese verfluchten Entdeckungen vergessen können, die das religiöse Gebäude seit zwei Jahrhunderten von oben bis unten erschüttert haben.“
„Und noch dazu sind es nicht einmal die Ungläubigen, noch die Physiologen,“ seufzte er, „die den Katholizismus niederreissen; es sind die Priester selbst, deren ungeschickte Werke die hartnäckigsten Überzeugungen ausrotten können.
Hatte sich nicht ein Doktor der Theologie, ein Predigerbruder, der hochwürdige Pater Rouard de Card, erdreistet, in einer Broschüre: ‚Die Fälschungen der sakramentalen Substanzen‘ unumstösslich zu beweisen, dass der grösste Teil der Messen aus dem Grunde nicht gültig war, weil die dem Kultus dienenden Stoffe durch die Verkäufer gefälscht waren?“
Seit Jahren waren die heiligen Öle mit Hühnerfett, das Wachs mit verkalkten Knochen, das Weihrauch mit gewöhnlichem und altem Benzoeharz verfälscht worden.
Aber was noch schlimmer, war, dass Substanzen, die dem heiligen Opfer unentbehrlich waren, verfälscht wurden; der Wein durch mannigfaltiges Verschneiden, durch unerlaubte Einführung von Fernambukoholz, Attichbeeren, Alkohol, Alaun, Salicylsäure, Bleiglätte; das Brot, dies Brot des heiligen Abendmahls, das aus dem feinsten Weizen geknetet werden soll, durch Erbsenmehl, Pottasche und Pfeifenerde.
Ja man war noch weiter gegangen, man hatte gewagt, das Korn vollständig wegzulassen und schamlose Händler fabrizierten fast alle Hostien aus Kartoffelmehl!
Ach! die Zeit war fern, wo Radegonde, Königin von Frankreich, selbst das für den Altar bestimmte Brot bereitete, wo nach den Gebräuchen von Cluny drei Priester oder drei Diakonen, nüchtern, mit weissem Chorhemd und Achseltüchern bekleidet, sich das Gesicht und die Hände wuschen und den Weizen Korn für Korn aussuchten, ihn unter dem Mühlstein zermalmten, den Teig in kaltem reinen Wasser kneteten und ihn selbst auf einem hellen Feuer backten und Psalme dabei sangen!
Diese Betrachtungen verdüsterten noch mehr die Aussicht auf sein künftiges Leben und färbten seinen Horizont noch drohender und dunkler.
Wahrlich, ihm blieb keine Rhede, kein Ufer offen! Was würde aus ihm werden in diesem Paris, wo er weder Familie noch Freunde besass? Kein Band verknüpfte ihn mehr mit dem Faubourg Saint-Germain, das vor Altersschwäche zitterte, sich im Staub des Verfalls abbröckelte und in einer neuen Gesellschaft wie eine zerbrochene, leere Schale dalag!
Und welch eine Verbindung konnte zwischen ihm und der bürgerlichen Klasse existieren, die nach und nach emporgestiegen war, die Vorteil aus allen Missgeschicken zog, um sich zu bereichern?
Nach der Aristokratie der Geburt war es jetzt die Geldaristokratie, der Despotismus des Handels mit feilen und engherzigen Ideen, eitlen und schurkischen Instinkten.
Gemeiner, ruchloser als der entartete Adel und die gesunkene Geistlichkeit war das Bürgertum, das ihnen ihre eitlen Prahlereien, ihre einfältige Ruhmredigkeit entlehnte, die es durch seinen Mangel an Lebensart erniedrigte, während es ihre Fehler in heuchlerische Laster verwandelte. Und wie herrisch und tückisch, wie niedrig und feige schoss es mitleidslos auf seinen ewigen und doch unentbehrlichen Geprellten, den Pöbel, seine Kartätschen ab, dem es selbst den Maulkorb abgenommen und entmündigt hatte, um den alten Ständen den Garaus zu machen.
Das war jetzt eine abgemachte Thatsache. Nun, wo seine Arbeit gethan, hatte man gesundheitshalber den Pöbel bis aufs Blut geschröpft; und der nun beruhigte Bürger herrschte vergnügt durch die Macht des Geldes und die Ansteckung seiner Dummheit.
Die Folge seiner Erhebung war die Vernichtung aller Intelligenz, die Verneinung aller Rechtschaffenheit, der Tod jeder Kunst. So lagen die verächtlichen Künstler auf den Knieen und küssten inbrünstig die Füsse der hohen Pferdehändler und gemeinen Satrapen, deren Almosen sie ernährte!
Es war über die Malerei eine Sintflut von kraftlosen Albernheiten, in der eine Völlerei glatten Stils und feiger Ideen herrschte, hereingebrochen. Denn der Geschäftsintrigant will Rechtschaffenheit; der Freibeuter will Tugend; wer nach einer Mitgift für seinen Sohn jagt, sträubt sich, sie für seine Tochter zu zahlen; der Anhänger Voltaires sucht keusche Liebe; wer die Geistlichkeit der Notzucht beschuldigt, treibt sich dumm und heuchlerisch in den unordentlichen Zimmern der Dirnen herum.
Es war die grosse Galeere Amerikas, die nach Europa verschlagen war. Es war die ungeheure und unerhörte Anmassung des Geldmenschen und Emporkömmlings, die wie eine gemeine Sonne über die götzendienerische Stadt strahlte, die im Staube vor dem ruchlosen Tabernakel der Bankhäuser zotige Gesänge ausstösst.
„Stürze doch zusammen, Gesellschaft! Stirb doch, alte Welt!“ rief der Herzog empört über das gemeine Schauspiel, das er heraufbeschwor; dieser Schrei brach den Alp, der ihn bedrückte.
„Ach!“ seufzte er, „und sich sagen zu müssen, dass dies alles kein Traum ist! Dass ich wieder in das schändlich gemeine Gewühl des Jahrhunderts hineingeworfen werde!“ Um sich zu beschwichtigen, rief er die tröstenden Lebensregeln Schopenhauers zu Hilfe; er wiederholte sich den schmerzlichen Grundsatz Pascals: „Die Seele sieht nichts, was sie nicht betrübt, wenn sie daran denkt.“ Aber die Worte hallten in seinem Gehirn wider wie Laute ohne Sinn; sein Verdruss zersplitterte sie, entzog ihnen jede Bedeutung, jede beruhigende Wirkung, jede wirkliche und sanfte Kraft.
Er sah schliesslich ein, dass die Beweisgründe des Pessimismus ohnmächtig waren ihn zu erleichtern, dass der unmögliche Glaube an ein zukünftiges Leben allein beruhigend wirken würde.
Ein Wutausbruch fegte gleich einem Orkan seine Versuche der Entsagung und der Gleichgültigkeit hinweg. Er konnte es sich nicht mehr verhehlen, es gab nichts, garnichts mehr. Alles war vernichtet!
Würde der schreckliche Gott der Schöpfung und der blasse Losgenagelte von Golgatha nicht einmal wirklich zeigen, dass er existierte, nicht die Sintfluten wieder erneuern, die Flammenregen wieder anzünden, die einst die verdammten und toten Städte verzehrt hatten!?
Würde dieser Schlamm fortfahren zu fliessen und mit seinem Pesthauch die alte Welt vergiften, wo nur noch Saaten von Frevelthaten und Ernten von Schande aufgingen!? – – –
Plötzlich ging die Thür auf. In der Ferne, von den Thürpfosten umrahmt, sah man kräftige Männer in Arbeitstracht, die grosse Kisten und Möbel auf den breiten Nacken hinaustrugen. Dann schloss sich die Thür wieder hinter dem alten Diener, der Packete mit Büchern geholt hatte.
Der Herzog fiel vernichtet auf einen Stuhl.
„In zwei Tagen werde ich in Paris sein,“ murmelte er, „nun ist alles zu Ende! Wie eine Springflut steigen die Wogen der menschlichen Mittelmässigkeit bis zum Himmel und sie werden den Zufluchtsort verschlingen, dessen Dämme ich wider meinen Willen öffnen muss. Ach! Mir fehlt der Mut!
Jesus Christus habe Mitleid mit dem Christen, der zweifelt, mit dem Ungläubigen, der glauben möchte, dem Sklaven des Lebens, der allein hinaussteuert in die Nacht unter einen Himmel, an dem keine tröstenden Sterne alter Hoffnungen mehr leuchten.“
Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillscheigend korrigert. Weitere Änderungen, teilweise unter Verwendung anderer Ausgaben und des französischen Originals, sind hier aufgeführt (vorher/nachher):
End of the Project Gutenberg EBook of Gegen den Strich, by Joris-Karl Huysmans
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GEGEN DEN STRICH ***
***** This file should be named 58941-h.htm or 58941-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/8/9/4/58941/
Produced by Jens Sadowski and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This file was
produced from images generously made available by The
Internet Archive
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.