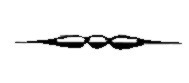
The Project Gutenberg EBook of Die gerichtliche Arzneikunde in ihrem
Verhältnisse zur Rechtspflege, mit b, by Franz von Ney
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Die gerichtliche Arzneikunde in ihrem Verhältnisse zur Rechtspflege, mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Gesetzgebung, Erster Band
Zum Gebrauche für Ärzte, Wundärzte und Rechtskundige
dargestellt und mit entscheidenden Thatsachen begründet
Author: Franz von Ney
Release Date: January 16, 2018 [EBook #56382]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE GERICHTLICHE ARZNEIKUNDE ***
Produced by Franz L Kuhlmann, Sandra Eder and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive)
Das Deckblatt ist vom Einband des Originals übernommen.
Offensichtliche typografische und Fehler bei der Zeichensetzung sind stillschweigend bereinigt.
Etliche Worte sind jedoch unterschiedlich geschrieben, z. B. "hiervon" oder "hievon", "Irrsinnes" oder "Irrsinns", "ebenso" oder "eben so", des "Irrthumes" / des "Irrthums", "hierzu" / "hiezu". Dies wurde wie im Original belassen.
in ihrem
Verhältnisse zur Rechtspflege,
mit
besonderer Berücksichtigung der österreichischen Gesetzgebung.
Zum Gebrauche für
Aerzte, Wundärzte und Rechtskundige
dargestellt
und mit entscheidenden Thatsachen begründet.
Von
Franz von Ney,
k. k. Pfleger zu Gastein,
Erster Band.
WIEN.
Kaulfuss Wwe, Prandel & Comp.
1847.
Multum magnorum virorum judicium credo,
aliquid autem et meum existimo.
Seneca.
Seiner Excellenz
dem hochgebornen Herrn
LUDWIG GRAFEN von TAAFFE,
obersten Justiz-Präsidenten, Herrn der Herrschaft Ellischau und der Güter Kolinetz, Auczin und Wlczkovitz in Böhmen, Grosskreuz des österr. kais. Leopoldordens, Ehren-Bailli und Grosskreuz des Johanniterordens, k. k. wirklichem geheimen Rathe und Kämmerer, Präsidenten der Hofkommission in Justiz-Gesetzsachen, Präsidenten des obersten Gefällsgerichtes, Kurator der theresianischen Ritterakademie, D. d. R., Mitgliede der juridischen Fakultät und emeritirtem Rector Magnificus an der Wiener Universität, Landstand in Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Böhmen, Mähren und Galizien, Mitgliede der Landwirthschafts-Gesellschaften in Wien, Grätz und Laibach, des Schafzüchtervereines in Böhmen, des Museums Francisco-Carolinum für Oesterreich ob der Enns und Salzburg und des geognostisch-montanistischen Vereines von Tirol und Vorarlberg; Ehrenmitgliede der Akademie der bildenden Künste in Wien, der gelehrten Gesellschaft degli Arcadi, der Accademia Tiberina und des Cäcilienvereines zu Rom,
in tiefster Ehrfurcht gewidmet
von dem
Verfasser.
Euer Excellenz!
Die gerichtliche Medizin wurde in den hierüber bisher erschienenen Werken vorzugsweise als ein die Arzneiwissenschaft berührender Gegenstand behandelt, daher das Unternehmen des Verfassers, diesen Gegenstand auch und vorzugsweise von dem juridischen Standpunkte zu besprechen, immerhin als ein gewagtes erscheinen dürfte, welches seine Entschuldigung nur in der anerkannten Nothwendigkeit, diesen wichtigen Gegenstand auch von dieser Seite zu beleuchten, und in dem Umstande findet, dass der Verfasser nicht ohne sich des Beifalles mancher erfahrener Gerichtsärzte zu erfreuen, dabei zu Werke gegangen ist.
Indem daher Euer Excellenz dem Verfasser die Gnade zu gewähren geruhten, dieses Werk Ihnen ehrerbietigst widmen zu dürfen, liegt hierin nur ein neuer Beweis von jener huldvollen Nachsicht, mit welcher Euer Excellenz ein redliches Streben, etwas für die Justizpflege Erspriessliches zu leisten, zu würdigen und aufzumuntern gewohnt sind.
Geruhen demnach Euer Excellenz diesem Buche, indem Sie demselben erlaubten, mit Ihrem hochverehrten Namen geziert in die Welt zu treten, Ihr Wohlwollen und Ihren Schutz angedeihen zu lassen.
Wien, im März 1846.
Euer Excellenz
gehorsamster
Autor.
Wenn es irgendwo nothwendig ist, nach einem bestimmten Plane vorzugehen, um zu dem erwünschten Ziele zu gelangen, so ist dies bei gerichtlich-medizinischen Erhebungen der Fall, bei welchen es sich darum handelt, die Grundsätze zweier Wissenschaften, nämlich jene der Medizin und jene des Rechtes, welche weder in ihrem Prinzipe noch in ihrer Anwendung Berührungspunkte darbieten, zu einem Zwecke zu vereinigen.
Eine nothwendige Bedingung dazu ist, dass diejenigen Personen, welche bei einem solchen Akte die eine und die andere dieser Wissenschaften zu vertreten berufen sind, nicht nur ihr eigenes Fach vollkommen inne haben, sondern auch in derjenigen Wissenschaft, welche der andere Theil vertritt, wenigstens so weit sich diese Wissenschaft auf den Gegenstand bezieht, welcher untersucht werden soll, nicht unbewandert seien, denn ohne dieser Bedingung ist nicht einmal ein Verständniss, viel weniger aber eine plan- und sachgemässe Ausführung möglich.
Diese erste unabweisliche Bedingung, ein Verständniss zwischen Arzt und Richter herbeizuführen, ist die Aufgabe meines bei Mörschner und Bianchi im Jahre 1845 erschienenen Werkes: „Systematisches Handbuch der gerichtsarzneilichen Wissenschaften, mit besonderer Berücksichtigung der Erhebung des Thatbestandes im Straf- und viii Civilverfahren für Aerzte und Wundärzte, dann Justiz- und politische Beamte und Advokaten in den k. k. Staaten,” welches den Hauptzweck verfolgte, durch eine in leichte Uebersicht gebrachte Sammlung und Erläuterung der in gerichtsarzneilicher Beziehung in den österreichischen Staaten bestehenden Gesetze und Verordnungen, dem Arzte gewissermassen ein materia juridica für seine Aufgabe als Gerichtsarzt, dem Richter aber die nöthigsten und unentbehrlichsten Winke zu geben, deren Ausserachtlassung Fehlgriffe oder Lücken in der Untersuchung zur unausbleiblichen Folge haben müsste.
Durch diese mir gestellte Aufgabe war jedoch zugleich die Grenze ausgesprochen, welche dieses Werk nicht überschreiten durfte, es musste nämlich ein Handbuch, d. h. ein so beschaffenes Buch sein, dass man es allenfalls als vade mecum zu gerichtlichen Kommissionen mitnehmen konnte, und musste daher in den Grenzen eines einzelnen Bandes bleiben, denn ein Handbuch in mehreren Bänden ist ungefähr dasselbe, was ein Taschenbuch in Quart oder Folio; auch durfte es den Zweck, eine leichte Uebersicht zu gewähren, nicht verfehlen, welches durch einen grösseren Umfang zuverlässig geschehen wäre.
Aus diesem Grunde konnte ich mich bei gewissen Materien, welche, wie z. B. die Erhebung von Gemüthszuständen, so wie jene gewisser Gattungen von Verbrechen, eine umständliche Besprechung fordern, nur auf einige Blätter beschränken, und musste es mir zur besonderen Aufgabe machen, nicht mehr zu thun, als die einschlägigen Verordnungen vollständig zu liefern, und nicht mehr zu sagen, als eben nothwendig war, um den Zusammenhang der Theile von den angeführten einzelnen Gesetzesstellen und die nächsten Beziehungen, in welchen sich dieselben zu ihrer praktischen Anwendung befinden, ersichtlich zu machen. — Es war eine Vorarbeit zu einer ix Lehre über die gerichtliche Medizin, jedoch eine solche, ohne welche es geradezu unmöglich ist, über diesen Gegenstand etwas Gründliches zu sagen.
Obwohl ich mir nun mit der Hoffnung schmeichle, die Aufgabe, welche dieses Werk hatte, wenigstens nicht verfehlt zu haben, so bin ich jedoch vollkommen überzeugt, dass damit nur ein Theil Desjenigen, welches für jenen Zweig der Rechtspflege, der die gerichtliche Arzneikunde zum Vorwurfe hat, erreicht, hingegen aber noch das Wesentlichste zu thun, nämlich die Aufgabe zu lösen sei, in einer fasslichen Darstellung die Anweisung zu geben, von welchem Standpunkte sowohl der Arzt als der Richter auszugehen, und welches Verfahren sie zu beobachten haben, um in den einzelnen Fällen der gerichtsarzneilichen Erhebungen nach einem gemeinschaftlichen Plane zu verfahren, in welchem sich die Grundsätze beider Wissenschaften zu dem einen Zwecke mit entsprechendem Erfolge vereinigen.
Diesen Zweck soll nun das gegenwärtige Werk erfüllen.
Was mich, ungeachtet der Schwierigkeiten, welche eine solche Unternehmung darbietet, dennoch bestimmte, mich derselben zu unterziehen, ist die Ueberzeugung, dass den zu derlei Erhebungen berufenen Personen diejenige klare Ansicht ihrer Aufgabe und der zu ihrer Lösung geeigneten Mittel zu erhalten nur dann möglich ist, wenn sie ihre Aufgabe vom Standpunkte der Gesetzgebung desjenigen Staates, in welchem sie zu wirken berufen sind, auffassen, und dass in allen mir bekannten medizinischen gerichtlichen Werken gerade dieser Standpunkt gewöhnlich als der untergeordnete betrachtet wird, während er doch entschieden um so mehr die Hauptsache ist, als alle gerichtlich-medizinischen Erhebungen für die Rechtspflege bestimmt sind, und der Richter in seiner Entscheidung x doch immer nur von dem Standpunkte der positiven Gesetzgebung auszugehen, und ihm daher nur ein solches Einschreiten und nur eine solche Darstellung von Seite der ärztlichen Personen zu genügen vermag, welche den Erfordernissen der bestehenden Gesetzgebung entspricht.
Ausländische Werke, so viel Wahres und Verdienstliches darinnen enthalten ist, können doch an und für sich niemals diesem Zwecke, in Bezug auf das Inland, vollkommen entsprechen, weil sie entweder nur von einem allgemeinen Gesichtspunkte ausgehen, der für die praktische Anwendung in vielen Fällen nicht genügt, oder sich auf die Gesetzgebung ihres Staates gründen, welche in einem fremden Staate keine Anwendung leidet; jedoch auch für den Arzt, welcher im Inlande schreibt, bleibt es immerhin eine schwierige Aufgabe, so tief in den Sinn der Gesetze einzudringen, und zugleich die nöthige praktische Anschauung in Bezug auf Anwendung damit zu verbinden, um den nöthigen Anforderungen in den mannigfaltigen, durch das Eigenthümliche der positiven Gesetzgebung eines Staates herbeigeführten Beziehungen zu entsprechen.
Es ist also unumgänglich nothwendig, dass auch von Seite der Rechtskundigen hierin etwas geleistet werde.
Ob der Verfasser dieses Werkes dieser Aufgabe gewachsen war, möge der verehrte Leser entscheiden, ich vermag nur so viel zu meinen Gunsten anzuführen, dass ich dabei nur den Weg der selbstständigen Forschung wählend, keiner Autorität folgte, keinem Systeme huldigte, sondern mich in meiner Darstellung nur durch diejenige Ansicht leiten liess, welche mir nach der Natur des zu behandelnden Gegenstandes die richtige zu sein schien.
Die Thatsachen, welche ich anführte, um die Richtigkeit der vorgestellten Grundsätze zu beweisen, sind darum gewählt, weil ihre xi Wahrheit aktenmässig erwiesen ist; ich scheute mich nicht die schwierigsten Materien zu besprechen, wo sich mir die Möglichkeit, etwas Gründliches darüber zu sagen, darbot, und eben so wenig anerkannten Autoritäten entgegenzutreten, wenn ich die Ueberzeugung hatte, dass ihre Aussprüche mit den Anforderungen der Gesetzgebung im Widerspruche sind, und glaube daher mich der Hoffnung hingeben zu dürfen, dass, wenn mein Buch, wie es gegenwärtig beschaffen ist, auch vielen gerechten Anforderungen nicht entspricht, es doch im Stande ist, dem Leser Stoff und Veranlassung zu eigenem selbstständigen Nachdenken zu geben, und es dadurch einem grösseren Talente als dem meinigen zur Aufforderung gereichen könne, denselben Pfad mit besserem Erfolge zu betreten, eine Wirkung, welche zu erzielen zuverlässig nicht ohne einiges Verdienst ist. Zitationen von klassischen Autoren glaubte ich vermeiden zu müssen, da nach meiner Ansicht es die Pflicht des Schriftstellers ist, durch seine Darstellung den Leser von der Wahrheit seiner Behauptungen zu überzeugen, eine dem Leser als irrig scheinende Behauptung in den Augen eines denkenden Menschen aber zuverlässig dadurch nicht zur Wahrheit wird, wenn er erfährt, dass auch Andere, als der Schriftsteller, mit welchem er sich eben beschäftigte, in demselben Irrthume befangen waren; und es ihm auch in diesem Falle noch immer unbenommen bleibt, von der in vielen Fällen zuverlässig nicht ungegründeten Voraussetzung auszugehen, dass der Schriftsteller seinen Gewährsmann nicht richtig verstanden habe, oder, wie es schon geschehen ist, unrichtig zitire.
Ueber Dinge, welche man aber selbst so darzustellen vermag, dass man mit Grund hoffen kann, den Leser überzeugt zu haben, noch fremde Autoren zu zitiren, ist nach meiner Ansicht nichts weiter, als ein Bestreben, mit seiner Belesenheit zu glänzen, welches xii Bestreben mir um so mehr überflüssig erscheint, als es für den Leser sehr gleichgiltig ist, zu erfahren, auf welche Art ein Schriftsteller seine Zeit verbringt, oder welche Studien er gemacht hat, um zu gewissen Resultaten zu gelangen, auch wohl Niemand bezweifelt, dass ein Autor, welcher über einen Gegenstand schreibt, auch etwas darüber gelesen habe. Ein Schriftsteller hat nach meiner Ansicht die Pflicht, dem Leser die Frucht, nicht aber die Zweige des Baumes seiner Erkenntniss darzureichen.
Der Verfasser.
| Seite | |||||
| Vorrede | VII | ||||
| Die Verfassung gerichtlich-medizinischer Gutachten vom Standpunkte der Rechtskunde betrachtet. Einleitung | 1 | ||||
| I. | Ueber den Zweck und die Verfassung vom Befunde und Gutachten im Allgemeinen | - | |||
| Unterschied der Rechtswirkung des Gutachtens im Civil- und im Strafrechte. §. 1 | - | ||||
| Der Grund der Beweiskraft eines Gutachtens im Strafverfahren ist die Ueberzeugung des Richters von dessen objektiver Wahrheit. §. 2 | 3 | ||||
| Der Richter hat die Pflicht, sich wo es möglich ist die eigene Anschauung von dem Corpus delicti zu verschaffen. §. 3 | - | ||||
| Ausnahme hiervon. Der Richter ist niemals verpflichtet, dem Gutachten gemäss zu erkennen, so lange er Gründe hat, dessen Richtigkeit in Strafrechtsfällen zu bezweifeln. §. 4 | 5 | ||||
| Im Falle eines Zweifels des Richters an der Richtigkeit des Gutachtens in Strafrechtsfällen ist die Behebung des Zweifels zu verlangen. §. 5 | 6 | ||||
| Die Erhebung des Gutachtens im Strafverfahren ist ein zwischen Richter und Kunstverständigen gemeinschaftlicher Akt. §. 6 | 7 | ||||
| Bei Ausnahmsfällen, in welchen der Richter auf das Gutachten keinen Einfluss nehmen kann, ist die Ursache dieser Ausschliessung durch klare Darstellung im Befunde zu begründen. §. 7 | 8 | ||||
| Das Gutachten ist für den Richter bestimmt. Erfordernisse, welchen es daher entsprechen muss. Fehler dagegen. §. 8 | 9 | ||||
| Beispiel eines objektiv richtigen, für die Strafrechtspflege aber unbrauchbaren Gutachtens. §. 9 | 11 | ||||
| Richter und Kunstverständige sind vermöge ihrer Stellung zu einander berufen, sich gegenseitig zu kontrolliren. §. 10 | 12 | ||||
| Die Aufgabe der Kunstverständigen ist immer ein selbstständiges Beobachten des zu untersuchenden Gegenstandes. §. 11 | 13 | ||||
| Gerichtliche Fragen. Deren Zweck. Durch dieselben wird die Pflicht der Kunstverständigen zur selbstständigen Beobachtung nicht aufgehoben. §. 12 | - | ||||
| Der Grad, wie weit der gegenseitige Einfluss des Richters und der Kunstverständigen zu gehen habe, wird durch die Natur des speziellen Falles, xiv nicht durch die Wissenschaft oder Kunst bestimmt, welche die Kunstverständigen üben. §. 13 | 14 | ||||
| Von dem ärztlichen Kunstbefunde. Auch Aerzte stehen in der Kategorie der Kunstverständigen in gerichtlichen Fällen. Instruktionen derselben in den k. k. Staaten. §. 14 | 17 | ||||
| Besondere Beschaffenheit der Stellung des Arztes zum Richter in Folge der Beschaffenheit der ärztlichen Bildung. §. 15 | 21 | ||||
| II. | Verhältniss der gerichtlichen Arzneikunde zur Rechtswissenschaft | 23 | |||
| Legislative und positive gerichtliche Arzneikunde. §. 16 | - | ||||
| Folgen der Nichtbeachtung dieses Unterschiedes in den von diesem Gegenstande handelnden Schriften. Irrige Anwendung ausländischer Schriften. Zweck der gerichtlichen Arzneikunde. §. 17 | 24 | ||||
| Gegenstände, welche dahin gehören. §. 18 | 26 | ||||
| Folgen von der abgesonderten Behandlung der gerichtsarzneilichen Wissenschaft von jener des Rechtes. Falsche Anwendung der Gesetze, Folter unter einem anderen Namen. §. 19 | 27 | ||||
| III. | Ueber die bei Verfassung des ärztlichen Gutachtens bei Kriminalfällen zu beobachtenden rechtlichen Grundsätze | 31 | |||
| Angabe der zur Erstattung eines entsprechenden Gutachtens im Strafverfahren nothwendig einzuschlagenden Verfahrungsweise. §. 20 | - | ||||
| Der Arzt hat auf die Ergebnisse des Untersuchungsprozesses die geeignete Rücksicht zu nehmen. Einsicht der Akten. §. 21 | 34 | ||||
| Vorläufiges Benehmen mit dem Untersuchungsrichter. §. 22 | 36 | ||||
| Gutachten in dem Falle, wo das Corpus delicti gar nicht oder nur theilweise vorhanden ist. §. 23 | - | ||||
| Beispiel hierüber. §. 24 | 38 | ||||
| Gutachten über Nebenumstände. §. 25 | 40 | ||||
| IV. | Ueber den Einfluss der Richters auf die ärztliche Untersuchung und die Abgabe des Gutachtens | 41 | |||
| Soll oder darf der Richter medizinische Kenntnisse besitzen? §. 26 | - | ||||
| Wie sind die nachtheiligen Folgen, welche eine medizinische Bildung von Seite des Richters für die Untersuchung haben kann, zu vermeiden? §. 27 | 43 | ||||
| Schlussbemerkung | 46 | ||||
| Unerlässliche Pflicht der angestellten Gerichtsärzte, sich mit den Gesetzen vertraut zu machen. — Eintheilung dieses Werkes. §. 28 | - | ||||
| I. Abtheilung. | |||||
| Ueber die gerichtlich-medizinische Erhebung von Gemüthszuständen. | |||||
| Einleitung | 51 | ||||
| Um zu bestimmen, wie weit die Kompetenz des Arztes und jene des Richters in dieser Art gehe, muss man über den Zweck der Erhebung und die Beschaffenheit des Gegenstandes sich vereinigen. §. 1 | - | ||||
| xv Jede Wissenschaft, insbesondere aber die medizinische, ist auf allgemein bekannte Erfahrungen theilweise gegründet. §. 2 | 51 | ||||
| Zu welchem Ende die medizinische Wissenschaft bei der gerichtlichen Erhebung von Gemüthszuständen angewendet werde. §. 3 | 53 | ||||
| Pflicht des Richters, bei derlei Erhebungen sich von der Richtigkeit des ärztlichen Ausspruches, so weit es ihm möglich ist, zu überzeugen. §. 4 | 54 | ||||
| Welche Anhaltspunkte der Richter habe, um Gemüthszustände zu beurtheilen. Gegenseitige Stellung des Arztes und des Richters bei solchen Erhebungen. §. 5 | 55 | ||||
| Eigenschaften des ärztlichen Gutachtens, welche die diesfälligen Rücksichten nöthig machen, zu welchem Zwecke der Arzt wissen muss, welche Grundsätze aus der nichtwissenschaftlichen Beobachtung des Menschen sich in gerichtlich-medizinischer Beziehung ergeben. §. 6 | 57 | ||||
| I. | Allgemeine Bemerkungen über das Verhältniss des Menschen zu anderen Geschöpfen der Aussenwelt | - | |||
| Der Irrsinn ist für den Richter nur insofern von Bedeutung, als er eine gewisse Thätigkeit in der Aussenwelt zur Folge hat. §. 7 | - | ||||
| Die irreguläre Thätigkeit im Aeusseren ist die einzige mögliche Veranlassung der gerichtlichen Erhebung des Irrsinnes. §. 8 | 58 | ||||
| Der Arzt kann seiner Aufgabe dabei nur durch ein genaues, zu dem Ende angestelltes Beobachten der Natur, um die für die richterlichen Definitionen passenden Momente aufzufinden, genügen. §. 9 | 60 | ||||
| Entwicklung solcher Momente, welche die Natur dem Nichtarzte in dieser Beziehung darbietet. Eintheilung der Geschöpfe a) in unorganische, b) organische, c) animalische Wesen. Empfindung. Vorstellung. Kunsttriebe. §. 10 | 62 | ||||
| Fortsetzung. Reproduktion. Nexus causalis. Gedächtniss. Einbildungskraft. Triebe. §. 11 | 65 | ||||
| Fortsetzung. Unterschied des Thieres von der Pflanze und vom Menschen. §. 12 | 68 | ||||
| Fortsetzung. Vernünftig-sinnliche (animalische) Wesen. Der Mensch. Dessen charakteristische Merkmale. §. 13 | 69 | ||||
| Fortsetzung. Sprache. §. 14 | - | ||||
| Fortsetzung. Begriffe. §. 15 | 70 | ||||
| Fortsetzung. Verhältniss der Sprache zu dem Begriffe. §. 16 | 71 | ||||
| Fortsetzung. Sittliche Anlage. Deren charakteristisches Merkmal. Freiheit. §. 17 | 72 | ||||
| Fortsetzung. Die Anlage zur Sittlichkeit ist bei allen Menschen vorhanden. §. 18 | 74 | ||||
| Fortsetzung. Tugend. Ehre. §. 19 | 75 | ||||
| Fortsetzung. Nachweisung der Art und Weise der Entwicklung der sittlichen Anlage bei dem Menschen. Gewissen. Wille. Nothwendigkeit der Festhaltung des Grundsatzes, dass diese Funktionen nur Aeusserungen xvi derselben Anlage sind. Missverständnisse, welche die Ausserachtlassung dieses Grundsatzes zur Folge hätte. Krankheit des Willens. Unterschied der Reproduktion sittlicher Lehren und sittlicher Vorstellungen. §. 20 | - | ||||
| II. | Allgemeine Bemerkungen über den Irrsinn vom psychologischen und rechtlichen Gesichtspunkte | 82 | |||
| Der Zweck der Erhebung des Irrsinns ist die Richtigstellung des Verhältnisses der inneren Thätigkeit eines Menschen zu dessen äusserer Umgebung. §. 21 | - | ||||
| Diese Nachweisung muss von Seite des Arztes durch in die Sinne fallende Thatsachen geliefert werden. §. 22 | 85 | ||||
| Die Thatsache, welche zum Behufe der Erhebung des Irrsinns richtig zu stellen ist, ist, dass eine bestimmte Thätigkeit nicht normal gewesen sei. Was unter einer nicht normalen Thätigkeit zu verstehen ist. §. 23 | 86 | ||||
| Die Veranlassung jeder nicht normalen Thätigkeit eines Menschen in rechtlicher Beziehung ist Zwang oder Irrthum. §. 24 | - | ||||
| Wie ist Irrthum möglich? Mangelhafte Beschaffenheit der Sinneswerkzeuge. §. 25 | 87 | ||||
| Fortsetzung. Mangelhafte Reproduktionsthätigkeit. §. 26 | 89 | ||||
| Die Straflosigkeit einer sonst sträflichen Handlung wird durch Nachweisung des Statt gefundenen Zwanges oder Irrthums begründet. §. 27 | - | ||||
| Diese beiden Momente können, durch Erwägung der äusseren Verhältnisse, oder durch Erhebung der individuellen Beschaffenheit des Subjektes richtiggestellt werden. §. 28 | 90 | ||||
| Dieses Resultat wird in letzterer Beziehung durch die Erhebung des Irrsinns bezweckt. §. 29 | - | ||||
| Der Zweck der gerichtlichen Erhebung des Irrsinns ist daher die Nachweisung, dass der Mensch vermöge seiner individuellen Beschaffenheit sich in Bezug auf eine bestimmte That im Zustande des Zwanges oder Irrthums befunden habe. Das Mittel dazu ist die Beobachtung desselben, mit Anwendung der Grundsätze der medizinischen Wissenschaften. §. 30 | - | ||||
| Irrige Ausdrücke in Bezug auf den Irrsinn, in seiner gerichtlich-medizinischen Bedeutung. Grade des Irrsinns. §. 31 | 92 | ||||
| Der Ausdruck Seelenstörung. Innige Verbindung der Psyche und des Körpers. §. 32 | 94 | ||||
| Der Ausdruck Verstandeskrankheit. §. 33 | 95 | ||||
| Der Ausdruck Gemüthskrankheit. §. 34 | 96 | ||||
| Der Ausdruck Krankheit des Gefühls. §. 35 | 97 | ||||
| Der Ausdruck Krankheit des Willens. §. 36 | 98 | ||||
| Der Ausdruck Krankheit der Vernunft. §. 37 | 99 | ||||
| Der Ausdruck Krankheit der Sinne. §. 38 | - | ||||
| Ueberflüssigkeit einer Definition des Irrsinns in gerichtlich-medizinischer Beziehung. §. 39 | 100 | ||||
| Angabe derjenigen Momente, durch deren Darstellung das ärztliche xvii Gutachten bei Erhebung des Irrsinns dem richterlichen Zwecke entspricht §§. 40, 41, 42 | 101 | ||||
| III. | Aus Grundsätzen des Rechtes zu nehmende Rücksichten bei Erhebung des Irrsinns. | ||||
| A. | Im Strafverfahren | 104 | |||
| 1. Der Fall dass an Jemanden, welcher vor Gericht gestellt wird, sich Spuren von Irrsinn äussern. §. 43 | - | ||||
| 2. Erhebung zum Behufe der Ausmittlung der Zurechenbarkeit der That. §. 44 | 106 | ||||
| Fortsetzung. Es ist für den Richter nicht möglich in allen Fällen, alle Momente durch Fragen anzugeben. §. 45 | 107 | ||||
| Wann die Nothwendigkeit der Einleitung eines besondern Aktes der Erhebung des Geisteszustandes zur Ausmittlung der Zurechenbarkeit eintrete. §. 46 | 108 | ||||
| Der wesentlichste Moment, worüber der Ausspruch gewärtigt wird, ist, ob der Thäter in dem Augenblicke, wo er die That verübte, nicht im Stande war, sich in Bezug auf diese That, nach Vorstellungen, welche mit der äusseren Objectivität übereinstimmen, zu bestimmen. Nothwendiges Verfahren zu diesem Zwecke. §. 47 | 110 | ||||
| Wechselseitiger Einfluss des Arztes und Richters dabei. §. 48 | 111 | ||||
| Verschiedenheit der Rechtswirkung eines auf apodiktische, und eines auf hypothetische Grundsätze der Wissenschaft sich gründenden Gutachtens. §. 49 | 114 | ||||
| 3. Erhebung des Gutachtens zum Behufe der Urtheilverkündigung. §. 50 | 116 | ||||
| B. | Im Civilverfahren | 117 | |||
| Zweck und rechtliche Wirkung eines solchen Gutachtens. §. 51 | - | ||||
| IV. | Ueber die Erhebung zweifelhafter Gemüthszustände. | ||||
| Allgemeine Bemerkungen | 124 | ||||
| Geisteskrankheit ist nicht die einzige Veranlassung, durch welche ein Gemüthszustand zweifelhaft wird. §. 52 | - | ||||
| Die Schwierigkeit der diesfälligen Erhebung liegt in der Verschiedenartigkeit der Arznei- und Rechtswissenschaft. §. 53 | 126 | ||||
| Fortsetzung. In der Arzneiwissenschaft als solcher, sind nach ihrem Zwecke diejenigen Momente, auf welche es bei der gerichtlichen Erhebung der Seelenzustände ankommt, nicht gegeben. §. 54 | - | ||||
| Um die Grundsätze der Arzneiwissenschaft auf die gerichtliche Erhebung von Gemüthszuständen anzuwenden, müssen vor Allem die aus den positiven Gesetzen sich ergebenden Forderungen berücksichtigt werden. Bestimmungen des österreichischen Strafgesetzes. §. 55 | 128 | ||||
| Das Mittel, diese Bestimmungen zu erfüllen, ist das Studium der menschlichen Natur im Allgemeinen. §. 56 | 130 | ||||
| Unrichtigkeit und Schädlichkeit der Ansicht, dass zur Aufhebung der xviii Sträflichkeit, immer die Nachweisung einer absoluten Unzurechnungsfähigkeit erfordert werde. Frage, auf deren Beantwortung es ankommt. §. 57 | 131 | ||||
| Die Geisteszustände müssen vor Allem vom rein menschlichen Gesichtspunkte betrachtet werden. §. 58 | 132 | ||||
| Diesfällige Erfahrungssätze. Die Triebe des Menschen äussern sich mehr in der Vorstellungsthätigkeit, als beim Thiere. §§. 59, 60, 61 | 133 | ||||
| Fortsetzung. Verschiedenartige Aeusserung des Geschlechtstriebes bei dem Menschen im Vergleiche mit dem Thiere. §. 62 | 136 | ||||
| Das Leben des Menschen ist vorzugsweise ein geistiges. §. 63 | 137 | ||||
| Rückwirkung des geistigen Lebens auf körperliche Zustände. Rechtliche Folge hieraus im Allgemeinen und in Bezug auf gewisse Zustände, als: Affekte, Leidenschaften, Schwärmerei etc. §. 64 | 139 | ||||
| A. | Affekte | 142 | |||
| Allgemeines Merkmal dieses Zustandes. §. 65 | - | ||||
| Jeder Affekt bedingt nothwendig eine ihm entsprechende Thätigkeit, sofern deren Ausübung nicht durch entgegengesetzte Vorstellung gehemmt wird. §. 66 | 143 | ||||
| Nur der Beweis des gänzlichen Mangels wirklich vorhandener, hinlänglich intensiver, dem Affekte entgegengesetzter Vorstellungen kann die Straflosigkeit der verbrecherischen That begründen. Lieferung dieses Beweises aus der Beschaffenheit der menschlichen Natur überhaupt. §. 67 | 144 | ||||
| Beweis aus der individuellen Stimmung im Augenblicke der That. Einfluss der Vorstellung des Sittlichen. §. 68 | 146 | ||||
| Fortsetzung. Gründe der Unwirksamkeit von sittlichen Vorstellungen. Krankhafte Verstimmungen. §. 69 | - | ||||
| Einfluss des Affektes auf die Unzweckmässigkeit der äusseren Thätigkeit. §. 70 | 148 | ||||
| Wie die Erhebung des Einflusses des Affektes in Bezug auf eine bestimmte That zu geschehen hat. §. 71 | 149 | ||||
| B. | Leidenschaften | 150 | |||
| Was ist Leidenschaft? §. 72 | - | ||||
| Die Leidenschaft, als ein durchaus psychischer Zustand, kann nur nach psychischen Gesetzen beurtheilt werden, und hebt als solche niemals die Zurechnung auf. §. 73 | 153 | ||||
| Eine Leidenschaft kann unter gewissen Umständen Gemüthszustände zur Folge haben, welche die sittliche Zurechnung aufheben. §. 74 | 155 | ||||
| Inwiefern derlei Zustände die strafrechtliche Zurechnung aufheben können. §. 75 | 156 | ||||
| Grundsätze, welche sich für die gerichtlich-medizinischen Erhebungen von Zuständen, denen eine Leidenschaft zu Grunde liegt, hieraus ergeben. §. 76 | 158 | ||||
| C. | Schwärmerei | 163 | |||
| xix Merkmale dieses Zustandes. Ob es denkbar ist, dass Jemand aus dem Bestreben, einen sittlichen Zweck zu erreichen, eine ihm als unsittlich bekannte Handlung verübe, und ob ein solches Vorgeben die Vermuthung einer Geistesverwirrung begründen könne. §. 77 | 163 | ||||
| Strafbarkeit einer, wenn auch im Zustande der Schwärmerei verübten rechtswidrigen Handlung. §. 78 | 166 | ||||
| Vergleichung mancher durch Schwärmerei hervorgebrachten Zustände mit jenen des Traumes. Pöschlianer. §. 79 | 168 | ||||
| Charakteristisches Merkmal der im Zustande der Schwärmerei begangenen unzurechenbaren Thaten. §. 80 | 172 | ||||
| D. | Blödsinn | - | |||
| Rechtliche Bedeutung dieses Zustandes. §. 81 | - | ||||
| Art und Weise der Erhebung. §§. 82, 83 | 173 | ||||
| Dummheit. §. 84 | 176 | ||||
| E. | Monomanie. Fixe Idee. §. 85 | - | |||
| F. | Melancholie. Mania occulta. §. 86 | 177 | |||
| G. | Berauschung. §. 87 | 178 | |||
| H. | Unwiderstehlicher Hang zu gewissen Verbrechen | 181 | |||
| Um zu erfahren, ob ein Hang zu einem bestimmten Verbrechen möglich sei, muss man die Beschaffenheit des Verbrechens selbst untersuchen. §. 88 | - | ||||
| Pubertätsentwicklung, Hysterie etc. als veranlassende Ursachen eines solchen Hanges. §. 89 | 182 | ||||
| Aufzählung der Verbrechen nach dem österreichischen Strafgesetzbuche, und Erörterung, warum bei manchen Verbrechen ein Hang zu deren Begehung unmöglich sei. Bezeichnung derjenigen Verbrechen, zu welchen denkbarer Weise ein besonderer Hang Statt finden kann. §. 90 | 183 | ||||
| 1. Verbrechen, welche durch den Geschlechtstrieb veranlasst werden. Unzucht wider die Natur. §. 91 | 187 | ||||
| Nothzucht. §. 92 | 189 | ||||
| 2. Tödtung und Verletzung. Unterschied des psychologischen Motives bei gewaltsamen und bei künstlichen Tödtungen. §. 93 | 190 | ||||
| 3. Hang zum Diebstahl. Verschiedenheit der Motive, und zwar: | |||||
| a) Lust zum Besitze. §. 94 | 192 | ||||
| b) Neigung zu dem Genusse, weil er verboten ist. §. 95 | 194 | ||||
| c) Vergnügen an Beseitigung der Schwierigkeiten. §§. 96, 97 | 197 | ||||
| 4. Brandlegung. §. 98 | 198 | ||||
| Anwendbarkeit dieser Unterscheidungen zum Behufe der Rechtspflege. §. 99 | 200 | ||||
| I. | Dämonomania. §. 100 | 201 | |||
| K. | Verstellter Wahnsinn. §. 101 | 207 | |||
| Schlussbemerkung. §. 102 | 209 | ||||
| xx V. Kriminalfälle mit Erhebung des Irrsinnes. | |||||
| A. | Der wahnsinnige Brandstifter Joseph G. | 210 | |||
| B. | Der Brudermörder Kaspar Roth | 233 | |||
| C. | Matthäus Grotz, ein Epileptiker, erschlägt seinen leiblichen Vater | 258 | |||
| D. | Der phränologisch untersuchte Brandleger J. Kläger, nebst Bemerkungen über das Heimweh | 285 | |||
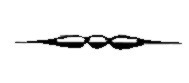
Der nachfolgende Aufsatz möge als Einleitung zu dem übrigen Inhalte dieses Buches dienen, dessen Zweck die möglichst praktische Anschaulichmachung der Aufgabe sowohl, als deren Lösung erscheint, welche dem Arzt und Richter bei gerichtlichen Akten gegenseitig gegeben ist.
Obwohl ich mich hierin bestreben werde, mich von jeder blossen Theorie möglichst fern zu halten, und so viel möglich die Sache, nicht eine blosse Argumentation dem verehrten Leser zu geben, so fordert es doch das Wesen der Sache selbst, welche hier verhandelt werden soll, vor Allem diejenigen Begriffe und Abstractionen vorzuführen, welche zur Vermittlung zwischen zwei so verschiedenen Gegensätzen, wie das Recht, ein reines Abstractum, und der medizinischen — nämlich einer auf concrete Fälle basirten — Wissenschaft, unumgänglich nöthig sind.
Ich glaube daher, vor Allem Einiges über die Verfassung gerichtlicher Gutachten sagen zu müssen, wobei ich mir die Bemerkung erlaube, dass dasjenige, was ich hierüber zu sagen habe, dem verehrten Leser den Gegenstand von einer Seite darstellen und beleuchten werde, welche, wie ich hoffe, nicht nur den Gegenstand Jedem klar zu machen, sondern vielen meiner Leser eine ganz neue Ansicht der Sache eröffnen wird.
Es ist ein grosser Unterschied zwischen einem Gutachten im Civilverfahren und einem Gutachten im Strafverfahren, nicht sowohl nach seinem Inhalte — denn dieser muss in beiden Fällen wahr und sachgemäss sein — als nach seiner Veranlassung, Zweck und Wirkung.
2 Im Civilverfahren wird das Gutachten oder überhaupt ein Kunstbefund nur dann erhoben, wenn eine Partei durch die Nachweisung, dass irgend eine Sache eine gewisse Eigenschaft habe oder nicht habe, irgend eine Leistung von einem Dritten zu erlangen, oder sich irgend einer Verpflichtung zu entschlagen hofft.
Die Veranlassung dieses Gutachtens ist daher das Einschreiten der Partei; dessen Zweck: der Partei als Beweismittel zu dienen; dessen Wirkung — in dem Falle, als das Gutachten dasjenige sagt, was die Partei beweisen soll, und es sonst die in der Gerichtsordnung vorgeschriebenen Eigenschaften hat — als Beweismittel vor dem Richter zu dienen.
Der Richter hat dabei keine andere Obliegenheit, als nachzusehen, ob das Gutachten wirklich das Nämliche sagt, was es nach der Behauptung des Beweisführers sagen soll, wenn der Gegner gegen dessen formelle Eigenschaft keine giltigen Einwendungen vorgebracht hat.
Dasjenige, was scheinbar die Hauptsache ist, nämlich ob das Gutachten seinem Inhalte nach wahr ist, geht den Richter gar nicht, sondern nur die Gegenpartei an, welche allenfalls einen Gegenbeweis liefern und sich dadurch gegen die Folgen, welche die Unwahrheit des Gutachtens für sie haben könnte, wenn sie will, schützen kann.
Unterlässt die Partei den Gegenbeweis, oder liefert sie ihn nicht genügend, z. B. dadurch, dass sie beweist, dass die Kunstverständigen nicht beeidet waren, dass sie nicht das rechte Objekt in Augenschein genommen haben u. s. w., so ist das Gutachten giltig, und der Richter muss selbst im Falle, wo er von der Widersinnigkeit des Gutachtens überzeugt, ja sogar im Stande wäre, selbst den Beweis zu liefern, dass es durchaus falsch ist, gerade so urtheilen, wie es das nach seiner festen Ueberzeugung durchaus falsche Gutachten bedingt.
Dies ist nun, so sonderbar es dem Nichtjuristen auch vorkommen mag, durchaus nothwendig, denn die Parteien führen untereinander, nicht mit dem Richter Prozess, die Parteien sind daher schuldig, dem Richter ihre Beweise und Gegenbeweise vorzulegen, deren Werth oder Unwerth der Richter nur nach den in der Gerichtsordnung vorgeschriebenen Formen beurtheilen kann. — Sind bei einem Beweismittel die Formen in der Ordnung, so ist es Sache der Gegenpartei, die Unrichtigkeit des Inhaltes, wenn sie kann, zu beweisen. Thut sie es nicht, so ist es ihre eigene Schuld, wenn der Richter von der Unrichtigkeit des vom Gegner aufgeführten Beweismittels nichts auf 3 ämtlichen Wege, d. i. aktenmässig erfährt. — Was aber nicht in dem Prozessakte steht, ist für den urtheilenden Richter so viel als gar nicht vorhanden, sondern der Richter urtheilt oder verurtheilt aus keinem andern Grunde, als weil nach der Aktenlage dieses und kein anderes Urtheil möglich ist.
Ganz anders ist es im Strafverfahren, besonders dort, wo kein Anklagsverfahren, sondern ein Inquisitions- (Untersuchungs-) Verfahren Statt findet. Hier ist der Richter nicht nur dahin verantwortlich, dass sein Urtheil demjenigen, was im Untersuchungsakte steht, entspreche, sondern auch dafür, dass Alles, was zum Beweise der grössern oder geringern Schuld oder Schuldlosigkeit dient, auch in den Akt komme, und dass nichts, was nicht objektiv wahr ist, als wahr dargestellt werde.
Der Grund dieser vom Civilverfahren ganz verschiedenen Stellung des Richters liegt darin, weil es sich hier nicht darum handelt, ein Beweismittel für irgend ein Recht, welches Jemand anspricht, dahin zu prüfen, ob es die in der Gerichtsordnung angegebenen Eigenschaften habe, sondern vielmehr darum, einem Menschen nie Uebel zuzufügen, um auf seinen, und durch Abschreckung Anderer auch auf deren Willen zu wirken, damit sie gewisse Handlungen unterlassen, die der Staat nicht dulden kann.
Die Zufügung eines solchen Uebels wäre daher nicht nur ungerecht, sondern auch ganz zwecklos, wenn Jemand, welcher ein Verbrechen nicht begangen hat, gestraft würde, weil er vielleicht gar niemals den Willen hatte, eine solche That zu begehen, und auch Andere darin, dass Jemand für eine That gestraft wird, die er nicht begangen hat, nichts weiter als eine Ungerechtigkeit sehen würden.
Es kann also nur der Umstand, dass Jemand wirklich ein Verbrechen begangen hat, der Grund sein, aus welchem Jemand bestraft werden kann.
Bei strafgerichtlichen Erhebungen kommt jedoch auch noch folgendes Verhältniss zu berücksichtigen:
Der Zweck einer solchen Erhebung ist immer die Ausmittlung der Beschaffenheit einer That, somit eines Ereignisses, welches in dem Augenblicke, wo die Untersuchung Statt findet, bereits der Vergangenheit angehört, dessen Ausmittlung somit niemals durch unmittelbare 4 Wahrnehmung, sondern nur dadurch möglich ist, dass man entweder Zeugen vernimmt, welche gesehen haben, wie die eben vorliegende Wirkung entstanden ist, oder durch genaue Untersuchung der eben vorliegenden Wirkung, mit Zuhilfenahme anderer Erfahrungen, auf die Ursache schliesst.
Ob man nun auf diese Art die wahre Entstehungsart der vorliegenden Thatsache erfährt, wird im ersten Falle davon abhängen, dass die Zeugen richtig beobachtet haben und die Wahrheit sagen wollen, im letztern Falle, dass man alle jene Merkmale, welche die Thatsache darbietet, und welche so beschaffen sind, dass sie einen Schluss auf die Ursache gewähren, nicht nur wahrnimmt, sondern auch richtig beobachtet und mit solchen Erfahrungen in Verbindung bringt, welche einen richtigen Schluss auf die Veranlassung gestatten.
Findet man z. B. den Leichnam eines Menschen, so folgt aus diesem Umstande nichts weiter, als dass jener Mensch gestorben ist; will man jedoch wissen, was seinen Tod veranlasst hat, so kann man Leute befragen, welche bei seinem Tode zugegen waren; findet man solche Zeugen nicht, oder gewährt ihre Aussage keinen genügenden Aufschluss, so erübrigt noch immer die Untersuchung des Leichnams. — Liefert diese das Resultat, dass der Mensch eine Flintenkugel im Herzen habe, so gibt dieser Umstand, verglichen mit der Erfahrung, dass eine solche Erscheinung niemals eintrete, wenn nicht ein Schuss Statt gefunden, wodurch die Kugel an den Ort gebracht wurde, an welchem sie gefunden wurde, das Resultat, dass Derjenige, dessen Leichnam hier liegt, einen Schuss erhalten habe, und die weitere Erfahrung, dass ein Schuss durch das Herz immer tödtlich sei, liefert den Schluss, dass der Tod dieses Menschen die Folge des beigebrachten Schusses sei.
Hieraus erhellt nun, dass nur dann der Schluss von der Wirkung auf die Ursache von Seite des Richters als richtig anerkannt werden kann, wenn er die Ueberzeugung hat, dass in den Akten wirklich alle Merkmale vorkommen, welche die Thatsache wirklich darbietet, dass dieselben durchaus richtig geschildert, und dass die Erfahrungen, welche zu dem Zwecke, um die Ursache der vorliegenden Wirkung zu ergründen, in Anwendung gebracht wurden, ebenfalls richtig seien, und keine derlei Erfahrung, welche zu dieser Vermittlung nothwendig war, ausser Acht gelassen wurde.
Die Ueberzeugung, dass allen diesen Erfordernissen Genüge gethan wurde, erwirbt sich der Richter am natürlichsten dadurch, dass er sich 5 selbst die Anschauung von der noch vorhandenen Wirkung verschafft, und so viel es ihm möglich ist, seine eigenen Erfahrungen zur Ausmittlung der Ursache anwendet.
Zu dieser eigenen Beobachtung ist nur der Richter, so weit es ihm möglich ist, verpflichtet, welche Verpflichtung auch von der Gesetzgebung anerkannt ist, da bei Erhebung des Thatbestandes im §. 244 ausdrücklich vorgeschrieben ist: „Alles, was von den, das Verbrechen darstellenden, Stücken (corpora delicti) gefunden wird, stückweise genau zu beschreiben und dem Akte beizulegen, sofern dieses thunlich ist.”
Der Grund dieser gesetzlichen Anordnung ist kein anderer, als jener, weil es für den Menschen unmöglich ist, eine sicherere und festere Ueberzeugung, als auf dem Wege der eigenen Anschauung zu erhalten, denn wo diese einmal eingetreten ist, muss jede dem Resultate derselben entgegengesetzte Ansicht nothwendig als eine unrichtige betrachtet werden.
Da nun der Richter verbunden ist, sich die möglichst feste Ueberzeugung von der objektiven Wahrheit der Thatsachen zu verschaffen, welche sein Urtheil im Strafverfahren bestimmen sollen, so kann kein Zweifel obwalten, dass er bei jeder solchen Erhebung nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet ist, so viel es nur geschehen kann, sich durch eigene Anschauung seine Ueberzeugung zu gründen.
Von dieser Regel machen auch diejenigen Erhebungen, welche zu ihrer vollständigen und richtigen Beurtheilung besondere Kunstkenntnisse erfordern, mit wenigen Beschränkungen, keine Ausnahme, denn auch derlei Erhebungen sind in der Regel so beschaffen, dass Vieles davon ein Gegenstand der blossen Sinneswahrnehmung ist, und viele Beziehungen in Betreff der Wirkung zur Ursache auch durch Anwendung der gewöhnlichen Lebenserfahrung können ausgemittelt werden. Auch bei Erhebungen, welche Kunstkenntnisse erfordern, ist daher weder die Intervention, noch die eigene Beurtheilung des Richters ausgeschlossen, und eine Ausnahme tritt nur insofern ein, als es überhaupt unmöglich ist, ohne Kunstkenntnisse auch dasjenige nur wahrzunehmen, was beobachtet werden soll. Ein solcher Ausnahmsfall tritt insbesondere bei der Touchirung geheimer weiblicher Theile ein. Hier kann nur Derjenige, welcher mit der Anatomie dieser Theile genau bekannt ist, seine Aktion so einrichten, dass er eine Abnormität oder sonst ein besonderes Merkmal gewahr wird, und diese Kenntnisse können 6 nur bei dem Arzte, nicht aber bei dem Richter vermuthet werden, daher der Letztere hievon sich ausschliessen kann, und insofern auch ausschliessen muss, als ein solcher Akt, zwecklos vorgenommen, eine unnütze Beleidigung des Schamgefühls der untersuchten Personen wäre, auf dessen Respektirung dieselbe das unbestrittene Recht hat.
Würde aber das Urtheil der Kunstverständigen mit der selbst erworbenen Anschauung des Richters, oder mit dessen auf eigene Erfahrung gegründeten Schlüssen im Widerspruch sein, so ist der Richter ebenso berechtigt, als verpflichtet, die Richtigkeit des Ausspruches der Kunstverständigen in Zweifel zu ziehen, weil, wie bereits oben bemerkt wurde, Niemand im Stande ist, eine fremde Ansicht auch dann für wahr zu halten, wenn sie der eigenen Sinnenwahrnehmung und der eigenen Erfahrung nicht entspricht; der Richter ist daher schon in seiner Eigenschaft als vernünftiges Wesen verpflichtet, von seiner Ansicht nicht eher abzugehen, als bis ihm von den Kunstverständigen nachgewiesen wird, dass und in welcher Art und Weise er sich in einem Irrthume befinde.
Obwohl es nun nach dieser Ansicht der Sache keinem Zweifel unterliegen kann, dass der Richter, auch bei einem Kunstbefunde, nicht von der Mitbesichtigung und Mitbeurtheilung ausgeschlossen sein kann, so ergibt es sich doch aus der Natur der Sache, dass sowohl die Wahrnehmung, als auch die Beurtheilung des Gegenstandes von Seite der Kunstverständigen in vielen Fällen weiter gehen könne und müsse, als jene des Richters, denn ein in gewissen Wahrnehmungen geübtes Auge sieht an demselben Gegenstande offenbar mehr, als das ungeübte, und ein Mensch, dessen Studien ihm Erfahrungen geliefert haben, die dem Andern mangeln, wird in vielen Fällen anders urtheilen, als jener, dem diese Erfahrungen mangeln, weil er durch die letzteren in die Lage gesetzt ist, die Mangelhaftigkeit des Resultates, welches Jener aus seinen beschränkten Erfahrungen abstrahirte, einzusehen. In dieser Beziehung kann es daher keinem Zweifel unterliegen, dass in einem Falle, wo die Kunstverständigen anders urtheilen, als der Richter, die Wahrscheinlichkeit dafür spreche, dass die Kunstverständigen Recht, der Richter aber Unrecht habe.
Mehr als diese Wahrscheinlichkeit folgt jedoch aus dieser Differenz nicht; da nun der Richter besonders dort, wo es sich darum handelt, eine Strafe auszusprechen, nicht blos Wahrscheinlichkeit, 7 sondern Gewissheit bedarf, so folgt, dass der Richter bei einer solchen Differenz zwischen seinem Urtheile und jenem der Kunstverständigen niemals verhalten werden kann, sein Urtheil, gegenüber des andern, unbedingt aufzugeben, sondern nur, dass er verlangen muss, dass die Kunstverständigen ihm vorerst seine Bedenken heben, d. h. ihm nachweisen, inwiefern und warum seine Ansicht irrig sei.
So könnte z. B. in dem Falle, wo Jemand bei einem Wortwechsel einen unbeträchtlichen Stoss erhielt, auf einen Heuhaufen hinfällt und darauf vom Schlage gerührt starb, der Richter den Ausspruch eines Arztes, dass der Tod eine Folge des Fallens auf den Grashaufen sei, niemals als wahr annehmen, sondern er müsste hier das Zeugniss seiner eigenen Sinne und jenes seiner Erfahrung: dass man auf einen Grashaufen fallen und sich dabei ganz wohl befinden kann, so wie die fernere Erfahrung, dass man auch ohne alle äussere Verletzung vom Schlag gerührt werden kann, dem ärztlichen Ausspruche entgegensetzen, und müsste daher an dessen Wahrheit so lange zweifeln, bis nicht diese Bedenken behoben sind.
Der Fall, von dem hier die Rede ist, hat sich wirklich ereignet. Der Arzt begründete seine Ansicht dadurch, dass der nachher Verstorbene vom Trunke und Zorn bereits aufgeregt war, und bei seinem hohen Alter und sonstigem apoplektischen Habitus eine geringe Erschütterung ihm den Schlagfluss zuziehen konnte.
Es darf wohl nicht bemerkt werden, dass dieser Erklärung keine rechtliche Folge gegeben wurde, da der Umstand, auf den es hier einzig und allein ankam: ob der Tod eine Folge des Werfens auf den Grashaufen gewesen sei, und ihn ohne dieses Ereigniss nicht eben so der Schlag getroffen hätte, nicht im Mindesten richtig gestellt war, ja sogar durch die in Folge ämtlicher Aufforderung von dem Arzte selbst abgegebene Erklärung, dass es auch möglich gewesen wäre, dass den so Behandelten auch ohne Auffallen auf den Grashaufen der Schlag gerührt haben möchte, jedes Bedenken gehoben wurde.
So wie es aber keinem Zweifel unterliegen kann, dass der Kunstbefund den Richter, so weit dessen Einsicht reicht, von seiner objektiven Richtigkeit überzeugen muss, wenn demselben eine rechtliche Folge gegeben werden soll, so wenig kann es einem Zweifel unterliegen, dass auch der Kunstverständige verbunden, und daher auch berechtigt sei, alle diejenigen Wahrnehmungen, welche der Richter 8 gemacht hat, oder welchen der Richter irgend einen Einfluss auf seine Beurtheilung einräumen zu können glaubt, zu beobachten und in ihrer Bedeutung zu würdigen, da ohne diese Vorsicht ein Irrthum des Richters nothwendig auch einen Irrthum im Kunstbefunde mit sich bringen muss, der Natur der Sachen nach aber der mit den nöthigen Vorkenntnissen nicht versehene Richter auch in Bezug auf Gegenstände, welche sich auch wohl durch die gewöhnliche Sinnenthätigkeit wahrnehmen lassen, leichter in einen Irrthum verfallen, oder aus Mangel der hinlänglichen Erfahrung leichter zu einem Fehlschlusse verleitet werden kann, als der ihm hierin bedeutend überlegene Kunstverständige.
Hieraus folgt nun, dass die Erhebung eines Kunstbefundes im Strafverfahren ein Akt sei, bei welchem, so weit es nur möglich ist, der Richter den Kunstverständigen und dieser wiederum den Richter controlliren muss, und daher eigentlich ein ihnen Beiden gemeinschaftlicher Akt sei.
Es gibt jedoch, wie bei §. 4 bemerkt ist, Ereignisse, deren Beschaffenheit von der Art ist, dass man ohne besondere Vorkenntnisse weder die Richtigkeit des gewonnenen Resultats beurtheilen, noch auch die Bedeutung der zur Gewinnung dieses Resultates eingeleiteten Operationen würdigen kann.
Diese Stellung ist von Seite des Richters gegenüber dem Kunstverständigen allerdings möglich.
Diese Möglichkeit bildet jedoch nicht die Regel, sondern den Ausnahmsfall, und muss daher wie jede andere Ausnahmsregel, und zwar hier um so mehr bewiesen werden, weil der Richter verpflichtet ist, so weit er es vermag, sich seine eigene Ueberzeugung zu gründen.
Dieser Beweis, dass es für den Richter unmöglich ist, sich eine weitere Ueberzeugung zu verschaffen, kann nun nur durch den möglichsten Grad von Klarheit in der von den Kunstverständigen zu verfassenden Darstellung geliefert, und jedem Bedenken des Richters dadurch entgegengearbeitet werden, wenn der Richter selbst bei der Vornahme einer ihm sonst unbekannten Operation, auf das Vorkommen gewisser in die Sinne fallender Erscheinungen, auf deren Vorkommen Schlüsse gegründet werden wollen, aufmerksam gemacht, und so auf diese Weise die nach den gegebenen Umständen mögliche Kontrolle herbeigeführt wird.
9 Es scheint nun allerdings ein Widerspruch zu sein, wenn man die Deutlichkeit der Beschreibung zum Beweise der Unverständlichkeit einer Sache fordert, allein es ist ganz und gar kein Widerspruch in dieser Behauptung, denn dass sich über Sachen, welche für jeden, der die Sache sieht, vollkommen verständlich sind, Beschreibungen machen lassen, aus denen kein Mensch klug wird, hat zuverlässig jeder meiner verehrten Leser schon erfahren. — Der Grund, dass die Beschreibung in einem solchen Falle nicht verstanden wird, liegt aber dann nicht in der Unbegreiflichkeit der Sache, oder in dem Mangel von Auffassungsfähigkeit desjenigen der sie nicht versteht, sondern in der mangelhaften Darstellung. — Der Beweis nun, dass die gelieferte Darstellung des Kunstbefundes nicht die Schuld trage, wenn der Richter ihre objektive Richtigkeit nicht zu würdigen verstehe, kann daher nur in ihrer vollkommenen Deutlichkeit bestehen.
Eine solche Darstellung ist nur für den Richter, nicht aber für einen andern Kunstverständigen bestimmt. Soll sie daher dem Erfordernisse der Deutlichkeit entsprechen, so muss deren Verfassung mit dem Bestreben Statt finden, alle jenen Begriffe, welche dem Richter zu deren Verständlichkeit noch mangeln, zu ergänzen; diese Aufgabe ist bei weitem nicht so schwer zu erreichen, als es dem ersten Anblicke nach scheint, wenn der Kunstverständige sich anders den Zweck vor Augen hält, welche jede gerichtliche Erhebung erreichen soll. Es ist dieser Zweck kein anderer als der, dem Richter das Verständniss zu eröffnen, ob die vorliegende Erscheinung in irgend einer Beziehung mit dem Strafgesetze und in welcher Beziehung sei, d. h. welches Strafgesetz auf dieselbe angewendet werden kann. Der Kunstverständige bedarf zu diesem Zwecke nichts weiter als die Strafgesetze, welche möglicher Weise angewendet werden, zu kennen, und etwas nachzudenken, welche vermittelnden Begriffe ihm seine Studien geliefert haben, um diese Verbindung einzusehen, und diese Begriffe dann in einer fasslichen Darstellung zu Papier zu bringen. Dasjenige, dessen Kenntniss er nur seinen Studien verdankt, mangelt dem Richter, er muss also in seiner Darstellung von demjenigen, welches ein Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung und gewöhnlicher Lebenserfahrung ist, und daher auch von dem Richter aufgefasst wird, ausgehen, und seine Darstellung so weit verfolgen, bis er dahin kommt, das Resultat seiner Darstellung mit Ausdrücken 10 zu geben, in welchen der Richter die in den Worten des Gesetzes enthaltenen Begriffe wieder zu erkennen vermag. Je näher daher die Ausdrücke des Kunstbefundes den in dem Gesetze enthaltenen Ausdrücken kommen, desto brauchbarer wird der Kunstbefund sein, und je mehr es den Richter in Ungewissheit lässt, ob dasjenige was der Kunstverständige gefunden haben will, sich unter die Worte des Gesetzes subsummiren lassen, um so weniger wird es seinem Zwecke entsprechen.
Zur Erreichung dieser Aufgabe genügt es aber nicht, dass etwa nur die Schlusssätze des Befundes Ausdrücke enthalten, in welchen der Richter die Worte des Gesetzes wieder erkennt, sondern es muss auch die ganze Entwicklung des Ideenganges in einem solchen Operate so beschaffen sein, dass der Richter auch alles dasjenige, was er selbst von der Sache gesehen, oder was ihm seine eigene Erfahrung bestätigt, wieder zu erkennen, und zugleich zu beurtheilen vermag, ob nicht etwas vorkomme, was hiermit im Widerspruche ist, ob nicht etwas ausgelassen sei, welches ihm seine eigene Beobachtung geliefert hat, oder etwas vorkomme, von dessen Dasein er sich noch die unmittelbare, ihm bisher noch mangelnde eigene Anschauung verschaffen kann. — Die Nothwendigkeit, auch diesem Erfordernisse zu genügen, ergibt sich aus demjenigen, was eben bei §. 3. und 4. gesagt wurde.
Gegen diese Ansicht wird nun insbesondere in ärztlichen Befunden nicht selten auf eine Weise verstossen, dass man zu dem Gedanken verleitet wird, dass die Aussteller solcher Gutachten den Umstand, dass solches für den Richter bestimmt sei, gänzlich ausser Acht lassen; man findet solche Befunde (freilich ganz entschieden gegen den Inhalt des §. 18. der Instruktion für die Aerzte bei Vornahme gerichtlicher Leichenbeschau) mit lateinischen und griechischen Ausdrücken angefüllt, welche dem Aktuar, der sie niederschreibt vorbuchstabirt werden müssen, für den Richter aber nicht mehr leisten, als wenn ein leerer Raum an dieser Stelle gelassen worden wäre, was wirklich auch manchmal geschieht, wenn der Aktuar sich geschämt die Vorbuchstabirung zu verlangen, dem Ganzen die Krone der Unbrauchbarkeit aber dadurch aufsetzen, dass sie mit einem technischen Ausdrucke schliessen, z. B.: es erhellt, dass der N. N. an einer apoplexia sanguinea verstorben sei.
Diese Nothwendigkeit ergibt sich aber noch mehr durch die Betrachtung, dass man niemals im Stande ist mit Gewissheit zu sagen, 11 ob man die Ansicht eines Dritten auch richtig verstehe, wenn man nicht auch die Ideenfolge zu gewahren vermag, welche ihn zu dieser Ansicht geführt hat, denn es ist sehr möglich, dass jener Dritte mit den von ihm gebrauchten Worten am Ende noch andere Begriffe verbindet, als Derjenige, der von seiner Ansicht Gebrauch machen soll.
Dadurch können die grössten, und für die Strafrechtspflege schädlichsten Missverständnisse entstehen. — Es ist also schon aus dieser Rücksicht die dringendste Aufgabe für den Kunstverständigen, alles zu beobachten, wodurch einem solchen Missverständnisse vorgebeugt wird.
Um ein Beispiel zu geben, wie ein Gutachten richtig, und doch für den Richter, und daher für den Zweck, für welchen es ausgestellt ist, ganz unbrauchbar sein kann, wenn der Ausstellende nicht den Grundsatz befolgt, dass er die Ausdrücke so wähle, dass sie jenen, deren das Gesetz sich bedient, möglichst nahe kommen, möge die Textirung eines über einen Todtfall durch Ertrinken abzugebenden Befundes berücksichtigt werden.
Niemand stirbt am Ertrinken, d. i. am Trinken des Wassers, und doch ist dies der vulgare Begriff, den daher der Richter möglicher Weise theilen kann, welcher vulgare Begriff dieser Todesart sich praktisch dadurch ausspricht, dass der gemeine Mann, wenn er nicht besser belehrt ist, im Falle wo Jemand aus dem Wasser gezogen wird, nichts Dringenderes zu thun weiss, als den Verunglückten umzustürzen, um ihn von der vermeintlich eingedrungenen Wassermenge zu befreien. Der Arzt, der ein solches Gutachten abzugeben hat, wird nun natürlich diese Ansicht nicht theilen und wird daher sein Gutachten nicht dahin abgeben, der Mensch sei ertrunken, sondern er wird nach Massgabe des Sektionsbefundes aussprechen, der Mensch sei am Schlagflusse, oder an der Erstickung durch Hemmung der Respiration etc. gestorben.
Damit ist aber dem Richter, welcher möglicher Weise mit dem Zusammenhange, in welchem sich der Schlagfluss mit dem Untergehen im Wasser befindet, nicht bekannt ist, nicht gedient, denn so lange nichts weiter hervorgeht, als dass ein Mensch am Schlagflusse gestorben ist, lässt sich noch immer die Möglichkeit denken, dass der Tod ganz unabhängig von der Handlung eines Dritten, durch welche jener Mensch in das Wasser gerieth, erfolgt sein könne. — Hier muss daher der das Gutachten abgebende Arzt, um dem Zwecke der Erhebung zu genügen, noch weiter gehen und erklären, dass die Ursache 12 dieses Schlagflusses bei diesem Individuum lediglich von dessen Lage im Wasser entstanden sei, oder dass die Hemmung der Respiration eine nothwendige Folge der entweder durch besonders angewandte Gewalt, oder des durch die natürliche Schwere des Menschen Statt gefundenen Untergehens sei, und erst diese Erklärung wird dem Richter den gehörigen Aufschluss geben, um auf die Thatsache, bezüglich auf den Urheber derselben, das Gesetz anwenden zu können.
Wenn man nun die gegenseitige Stellung, welche zwischen einem Kunstverständigen und dem Richter obwaltet, genau bezeichnen will, so ergibt sich Folgendes:
a) Der Richter ist berufen alles dasjenige mit eigenen Sinnen zu gewahren, was auf diese Art zu gewahren möglich ist, und hat daher die Pflicht, vom Kunstverständigen zu verlangen, dass er ihm jede Entdeckung, wo es möglich ist, so vor Augen bringe, dass er sich von deren Wirklichkeit überzeugen kann; er ist ferner befugt, von dem Kunstverständigen zu verlangen, dass er alles untersuche, was ihm (dem Richter) zu untersuchen nöthig scheint, und dasjenige, was er (der Kunstverständige) gefunden hat, so (schriftlich) darstelle, dass dem Richter dessen Bedeutung in rechtlicher Beziehung vollkommen klar werde.
b) Dort aber, wo der Kunstverständige in Folge seiner, dem Richter mangelnden, Vorkenntnisse Erhebungen zu machen für nöthig findet, muss er sie einleiten, zwar nicht ohne den Richter auf die Nothwendigkeit dieser Einleitung aufmerksam zu machen, jedoch auch ohne zu erwarten, dass der Richter ihm einen ins Detail gehenden Auftrag gebe, weil dieses ohne Vorkenntnisse nicht möglich ist; sondern er hat von sich selbst zu wissen und zu thun, was nöthig ist.
c) Der Richter kann und muss ferner von dem Kunstverständigen verlangen, dass er auch ihn, den Richter, in seinen Erhebungen controllire, nämlich mit Anwendung seiner Kenntnisse beurtheile, ob die Beobachtungen des Richters auch allseitig und richtig waren, denn wo einmal eine Sache Theile hat, die sich mit der blossen Sinnenwahrnehmung nicht erkennen lassen, ist es bei einem Menschen immerhin möglich sich in etwas zu irren, oder etwas zu übersehen, wo die blos sinnliche Wahrnehmung eines andern, der jedoch in dieser Art von Beobachtung eine grössere Uebung hat, allerdings genügt hätte.
13 Der Kunstverständige kann von dem Richter fordern, dass er ihm alles angebe, was er von der Sache gewahrt, und ihm alle jene Beziehungen der Thatsache zum Gesetze andeute, welche nach seiner, des Richters, Ansicht daran möglicher Weise zu finden sein können.
Da jedoch diese Möglichkeit der Angabe nur so weit geht, als die Kenntnisse des Richters von der Sache überhaupt reichen, diese aber dort, wo Vorkenntnisse nöthig sind, welche dem Richter abgehen, nicht anders als mangelhaft sein könne, so folgt von selbst, dass die Aufgabe des Kunstverständigen immer weiter geht, als der Richter sie ihm zu geben vermag, dass er daher keineswegs blos an die ihm vom Richter angedeuteten Beziehungen sich zu halten, sondern selbst nachforschen, und daher mit Gegenwärtighaltung des richterlichen Zweckes, selbstständig die Daten zu verfolgen habe, um die möglichste Vollständigkeit der Erhebung zu erreichen. (§. 10.)
Durch dasjenige, was im vorigen Paragraphe gesagt worden ist, ergibt sich von selbst die Obliegenheit des Kunstverständigen gegenüber den Fragen des Gerichtes.
Hier herrscht nun insbesondere bei manchem Gerichtsarzte noch immer die ganz falsche Ansicht, dass dort, wo gerichtliche Fragen gestellt werden, sich das Gutachten auch auf Beantwortung dieser Fragen zu beschränken habe.
Durch diese Ansicht wird nun der Richter in ein höchst unangenehmes dilemma versetzt; denn stellt er keine Fragen, so erfährt er vielleicht gerade das nicht, was nach seiner Ansicht zu erfahren nothwendig ist, und stellt er Fragen, so ist er in Gefahr, dasjenige nicht zu erfahren, was nach der vielleicht vollkommen richtigen Ansicht des Kunstverständigen ihm zu erfahren nothwendig wäre, und um welches er auch gefragt hätte, wenn ihm die Möglichkeit, diesen Umstand zu erfahren, vorgeschwebt hätte.
Der einzige Weg, welcher zu einem vernünftigen Ziele führen kann, besteht daher nur darin, dass der Kunstverständige sich vor der Untersuchung mit dem gesetzlichen Zwecke, welchen dieselbe haben kann, vertraut mache, die richterlichen Fragen sodann zwar nicht unbeantwortet lasse, sich dadurch aber nicht hindern lasse, die Sache selbstständig aufzufassen und sein Gutachten so abzugeben, dass dessen 14 Ausdrücke den Worten des Gesetzes möglichst nahe kommen, wie dies oben bei §. 6. bemerkt wurde1.
Keine Wissenschaft oder Kunst lässt sich denken, welche gar nicht auf solchen Erfahrungen beruhte, welche nicht jeder Mensch machen könnte, und wirklich gemacht hat, und welche daher nicht solche Resultate aufzuweisen hätte, welche rein aus dieser Erfahrung des gewöhnlichen Lebens geschöpft sind; man braucht eben nicht Astronomie studirt zu haben um zu wissen, dass die Tage im Dezember kürzer sind als im Juli, ein Satz, von dessen Wahrheit der grösste Astronom unmöglich eine festere und richtigere Ueberzeugung haben kann, als der nächst beste Leinweber.
Umgekehrt aber werden die Kunstverständigen eben so die Aufgabe haben, in dem Falle, als der Gegenstand, um den es sich handelt, von ihnen als ein solcher erkannt wird, welcher sich von den gewöhnlichen Begebnissen entfernt, auch die Beobachtungen des Richters einer besonderen Aufmerksamkeit zu unterziehen, um die Gewissheit zu erlangen, dass sie nicht etwa wegen Mangel an Sachkenntniss ungenau oder unrichtig seien.
Dasjenige Moment, welches in einem und dem andern Falle über den Grad und die Beschaffenheit dieses gegenseitigen Einflusses entscheidet, ist jedoch in jedem Falle die specielle Beschaffenheit des vorliegenden Gegenstandes im Allgemeinen, und in dem speciellen Falle in Bezug auf die Art und Weise, wie sich diese Einflussnahme praktisch gestalten wird, der Grad und das Verhältniss der Bildung, in welchen sich Richter und Kunstverständiger zu einander befinden. Es lässt sich nämlich nicht sagen, dass weil etwa irgend ein Gegenstand die Beiziehung von medizinischen Kunstverständigen fordert, der Richter ihren Aussprüchen blindlings folgen müsse, weil sie als 15 medizinische Kunstverständige urtheilen, sondern es lässt sich nur so viel sagen, keine Beurtheilung des Richters ist gültig, so lange dieselbe von den Kunstverständigen nicht bestätiget wird, und eben so kein Ausspruch der Kunstverständigen ist gültig, so lange demselben ein auf eigener Sinnenwahrnehmung oder erprobten Erfahrungen gegründetes Bedenken des Richters entgegensteht, und dasselbe durch Nachweisung des Irrthumes, auf welchem es beruht, nicht beseitiget ist.
Je mehr Kenntnisse der Richter von dem Fache der Kunstverständigen hat, um so mehr wird er aber in der Lage sein zu entdecken, ob, und wo allenfalls noch eine Mangelhaftigkeit, oder ein Irrthum in dem Befunde vorhanden ist und um so mehr wird er auf Ergänzung zu dringen im Stande sein, und eben so, je weiter die Rechtskenntnisse des Kunstverständigen gehen, um so mehr wird er vermögen zu beurtheilen, ob und was von dem Richter allenfalls in seiner rechtlichen Bedeutung irrig aufgefasst, oder zu erheben übersehen wurde. Es wird daher der Einfluss eines mit den Rechten vertrauten Kunstverständigen offenbar weiter gehen, und sich in vielen Fällen wohlthätiger äussern, als dies ohne dieser Voraussetzung möglich ist, und umgekehrt.
Das österreichische Strafgesetzbuch hat dieses Verhältniss offenbar ganz richtig aufgefasst, indem es im §. 240 I. Th. hierüber erklärt: „Ist das Verbrechen von solcher Art, dass, um die Beschaffenheit desselben aus den Merkmalen gründlich zu erforschen, besondere wissenschaftliche oder Kunstkenntnisse erfordert werden, so ist ein dergleichen Kunstverständiger, und wenn es ohne bedenklichen Verzug geschehen kann, sind deren zwei beizuziehen.”
Ueber den Zweck dieser Beiziehung spricht sich nun der §. 241. dahin aus: „Wenn der Kunstverständige nicht schon beeidet ist, soll er dahin beeidet werden, dass er nach Eid und Pflicht a) den Gegenstand genau zu untersuchen, und b) alles was davon (dem Richter) zu wissen nöthig ist, wahrhaft und bestimmt anzugeben habe.”
Zu wissen nöthig von einem Kunstverständigen ist aber a) ob dasjenige, was der Richter als objektiv richtige Thatsache annimmt, sich auch nach den zahlreichern und gründlichern Beobachtungen der Wissenschaft als solches bestätige; b) ob nicht etwas vom Richter unbemerkt gelassen wurde, was zur Sache gehört, und worin dieses bestehe, was der Richter nach eigener Lebenserfahrung hätte beurtheilen 16 können; c) ob sonst Merkmale vorhanden sind, welche ohne Beihülfe der Kunst oder Wissenschaft, welche der Kunstverständige übt, unbemerkt geblieben wären; d) eine solche Darstellung dieser Merkmale, dass der Richter das Verhältniss, in welches durch diese Merkmale die untersuchte Thatsache zum Gesetze gestellt wird, aufzufassen in den Stand gesetzt wird; e) und endlich die Angabe, was nach dem in Folge der nach Massgabe der Punkte a, b, c, d gewonnenen Resultate weiter in der Sache zu thun und einzuleiten ist.
Das Erforderniss d) ist wesentlich, — denn wenn der Richter mit dieser Beziehung der Merkmale nicht bekannt gemacht wird, so dienen sie zu keiner rechtlichen Beurtheilung, und die Darstellung bleibt daher mangelhaft, weil sie ihren Zweck nicht erreicht. Im Gegensatze wird die von dem Kunstverständigen gemachte Darstellung um so vollständiger sein, je mehr sie die Bedeutung der Merkmale in solcher Art entwickelt, d. h. je näher deren Beziehung zum Gesetze gebracht wird.
So wird das Gutachten über einen Sectionsbefund einer Vergiftung unvollständig sein, wenn es nichts weiter enthält als die Angabe: es erhellt, dass der N. N. an in den Magen eingedrungenes Vitriolöl, welches nach toxikologischen Grundsätzen unter die Gifte gehört, gestorben sei. Es wird aber vollständig sein, wenn es zugleich noch enthält, dass bei dem Umstande, wo dieses Vitriolöl im konzentrirten Zustande im Magen vorgefunden wurde, diese Substanz aber von der Art ihre Wirkung auf die Geschmackswerkzeuge äussert, dass ein unbemerktes Verschlucken desselben nicht möglich ist, der Verstorbene aber noch einige Zeit nach sichtbar gewordener Wirkung der Vergiftung gelebt, und sich weder geäussert, dass es ihm durch einen Dritten mit Gewalt beigebracht wurde, obwohl er nicht ausser Stande war sich zu äussern, noch auch Spuren eines geleisteten Widerstandes sichtbar sind, endlich auch von ihm, ungeachtet des durch die Verschluckung nothwendig sogleich eingetretenen heftigen Schmerzes Hülfe nicht gesucht wurde, so lässt sich nicht denken, dass diese Verschluckung durch gewaltsame Einwirkung eines Dritten, oder zufällig geschah, sondern es lässt sich nicht anders annehmen, als dass er absichtlich diese Substanz verschluckt habe, wahrscheinlich um durch die allgemein bekannte tödtliche Wirkung des Verschluckens dieser Substanz seinem Leben ein Ende zu machen.
17 Dass nun Aerzte und Wundärzte, wenn sie bei gerichtlichen Fällen interveniren, in die Kategorie der Kunstverständigen gehören, wird wenigstens keinem Juristen zweifelhaft sein. — Für den Arzt mag dieser Gedanke insofern etwas minder Zusagendes haben, weil er sich dadurch gewissermassen auf gleiche Stufe mit einem Handwerker, welcher, sofern er ein Gutachten in einem gerichtlichen Akte abzugeben hat, ebenfalls Kunstverständiger genannt wird, gestellt sieht2. Allein diese Rücksicht ist denn doch wohl von keiner Bedeutung, und wird wohl bei einigem Nachdenken Niemand verletzen, so wenig es für den Präsidenten einer hohen Behörde ein Gegenstand des Anstosses sein wird, ein Diener des Staates zu heissen, weil auch ganz untergeordnete, jedoch ebenfalls bei einer Staatsbehörde angestellte Individuen Staatsdiener sind; beide dienen dem Staate; so gut als ein Arzt, und ein Handwerker ihre Kunst bei einem gerichtlichen Akte nach ihrem besten Wissen zum gerichtlichen Zwecke anwenden, und in dieser Verpflichtung daher allerdings auf gleicher Stufe stehen; die Kunst, die sie üben, und die Rangordnung, welche sie sonst in der bürgerlichen Gesellschaft einnehmen, wird immer im höchsten Grade verschieden bleiben; da man also in dieser Rücksicht keinen Grund hat, Aerzte nicht unter die Kunstverständigen zu zählen, so ist wohl kein Zweifel vorhanden, dass alles, was wir bisher von dem Kunstverständigen gesagt haben, auf die in gerichtlichen Akten beigezogenen Aerzte und Wundärzte vollkommen Anwendung leide.
Dennoch wird kein vernünftiger Mensch zweifeln, dass zwischen den Beurtheilungen eines Arztes, welcher ein Gutachten über einen wichtigen Fall abgibt, und dem Gutachten eines Schusters, welchem ein gestohlenes Paar Stiefel schätzt, ein wichtiger Unterschied sei; allein der Unterschied liegt nicht darin, dass der Arzt gegenüber dem Gerichte sich in einer andern Stellung befände, sondern darin, weil die Wissenschaft, welche er ausübt, eigene Beziehungen zwischen ihm und dem Gerichte herbeiführt, welche bei einem gewöhnlichen Kunstverständigen entweder gar nicht, oder in einem viel geringeren Grade vorhanden sind.
18 Gerade die Wichtigkeit dieser letzten Rücksicht, so wie der Umstand, dass diejenigen Fälle, in welchen die Intervention ärztlicher Personen erfordert wird, bei der Strafrechtspflege nicht nur sehr mannigfaltig und zahlreich, sondern auch nicht selten von grösster Erheblichkeit sind (man denke an die auf Mord, Todtschlag, Nothzucht etc. gesetzten strengen Strafen), und der weitere Umstand, dass denn doch bei den Aerzten und Wundärzten nicht unbedingt eine solche Vertrautheit mit der strafgesetzlichen Erhebung vorausgesetzt werden kann, dass ohne nähere Anleitung in jedem Falle ein solches Gutachten zu gewärtigen ist, welches dem richterlichen Zwecke vollkommen entspricht, veranlasste die Gesetzgebung, diesem Mangel durch eigene Belehrungen, insbesondere in Bezug auf jene wichtigen Fälle, wo der Tod eines Menschen erfolgt ist, abzuhelfen, in welchen die für den Richter wichtigsten Momente, auf die der Arzt seine Aufmerksamkeit zu richten, und die Art und Weise, wie deren Darstellung Statt zu finden hat, näher bezeichnet werden.
Eine solche Erläuterung war die mit Hof-Dekret vom 18. September 1733 erlassene, und in die peinliche Gerichtsordnung vom Jahre 1768 Beilage Nr. 2. aufgenommene Instruktion, welche in Ermanglung einer später erschienenen noch galt, als das gegenwärtige Strafgesetzbuch vom Jahre 1803 eingeführt wurde.
Obwohl nun diese Instruktion bei den Fortschritten, welche die Arzneikunde überhaupt und insbesondere die gerichtliche Arzneikunde seit jenem Zeitpunkte gemacht hatte, den neueren Anforderungen nicht mehr entsprechen konnte, so verdient doch die Art und Weise, wie sich diese Instruktion über die Beurtheilung der Tödtlichkeit von Verletzungen ausspricht, bemerkt und anerkannt zu werden.
„Bei der Untersuchung eines Leichnams,” heisst es, „sind alle innerlichen Gegenden zu öffnen, um zu sehen, ob dieser Mensch lediglich von der überkommenen Wunde unumgänglich habe verscheiden müssen,” und bei Vergiftungen, „wie viel Gift dieses Individuum in specie umzubringen erfordert wurde.” Es war daher schon damals durch gesetzliche Autorität ausgesprochen, dass nicht die absolute, sondern die individuelle Legalität das charakteristische Merkmal sei, welches bei gerichtlichen Erhebungen entscheide, ein Umstand, welcher 19 seither in vielen gerichtlich medizinischen Schriften vielfältig ausser Acht gelassen, und dadurch jene heillose Verwirrung der Begriffe herbeigeführt wurde, deren nachtheilige Wirkungen sich noch bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte erstrecken, da es ungeachtet der diesen Gegenstand sachgemäss behandelnden Schriften eines Henke noch immer Aerzte gibt, von welchen man, wo sich nicht eine absolute Tödtlichkeit der Verletzung auffinden lässt, vergebens einen für den Richter brauchbaren Ausspruch erwartet. Ueber die Stellung des Arztes zum Richter enthält diese Instruktion nichts weiter als die Verordnung für Aerzte und Wundärzte, derlei Untersuchungen allezeit in Gegenwart der dazugezogenen Gerichtsmänner vorzunehmen.
Im Jahre 1814, kundgemacht mit Hofkanzlei-Dekret vom 19. Jänner 1815, erfolgte eine neuerliche Instruktion für gerichtlich angestellte Aerzte und Wundärzte in den k. k. Staaten, wie sie sich bei gerichtlichen Leichenbeschauen zu benehmen haben.
Diese Instruktion enthält eine umständliche Bezeichnung des, bei gerichtlichen Sektionen sowohl im Allgemeinen, als in Bezug auf gewisse Todesarten, z. B. Schuss, Stich oder andere Verwundungen, Vergiftungen, bei Leichnamen neugeborner Kinder etc., zu beobachtenden Verfahrens, und der dabei zum Behufe des gerichtlichen Zweckes zu berücksichtigenden Momente, in Bezug der Stellung des Arztes zum Richter aber wird §. 14. ein williger Gehorsam, alle obrigkeitlichen Befehle auf das genaueste zu vollziehen, damit der Zweck der gerichtlichen Leichenbeschau in keiner Hinsicht verfehlt werde, als eine nothwendige Eigenschaft der Obduzenten erklärt. Es wird ferner in §§. 9 und 16 die Führung des Protokolls sowohl durch die Obduzenten, als durch die Gerichtspersonen, welche als die eigentlichen legalen Zeugen dieses Aktes erklärt werden, und die Vergleichung dieser Protokolle miteinander, — „damit so lange der Gegenstand der Untersuchung noch vorhanden ist, das Vergessene oder Mangelnde auf der Stelle nachgetragen, das Unrichtige berichtigt, und so den Abweichungen abgeholfen werde, die sich ausserdem würden gefunden haben” — angeordnet.
Endlich wird §. 17 der Fundschein als diejenige schriftliche Ausarbeitung erklärt, welche von den Medizinalpersonen über die Art und Weise der Untersuchung, und über die Resultate derselben als Beantwortung der von Seite des Gerichts über den Gegenstand 20 der Untersuchung vorgelegten Fragen an die betreffende Behörde einzusenden ist.
Dieser Fundschein hat nach §. 21 das Gutachten, d. i. die Darstellung derjenigen Resultate, welche aus den aufgefundenen Daten und Erscheinungen der Leichenbeschau selbst, nach physisch medizinischen Grundsätzen gefolgert werden können, zu enthalten, um die von Seite der Obrigkeit über den Gegenstand der Untersuchung vorgelegten Fragen zu beantworten.
Durch diese Instruktion ist nun klar ausgesprochen, dass jede Handlung der Medizinalpersonen dabei dem richterlichen Zwecke zu dienen habe. Würde diese Weisung in dem Sinne, wie die Instruktion dieselbe ertheilt, immer befolgt, so könnte der Fall eines mangelhaften oder verfehlten Gutachtens wohl nicht eintreten, allein leider lassen sich in dieser letzten Obliegenheit manche Aerzte dadurch irre machen, dass sie durch die letztangeführte Stelle sich berechtigt, ja auch verpflichtet glauben, ihr Gutachten lediglich auf die Beantwortung der gerichtlichen Fragen zu beschränken, und selbst dann nicht weiter zu gehen, als die Fragen lauten, wenn die Veranlassung dazu in den Erhebungsdaten offenbar enthalten ist, oder wenn die Fragen des Richters den Fall auch offenbar nicht erschöpfen, weil es dem Richter hiezu an der nöthigen, ohne medizinische Vorkenntnisse oft gar nicht möglichen, Sachkenntniss gefehlt hat.
Dass eine solche Ansicht dem Sinne des Gesetzes nicht entspreche, erhellt nicht nur aus den Worten der zitirten §§. 240 241 des Strafgesetzbuches, und aus der Natur der Sache, sondern wenn man die einzelnen §§. der Instruktion gehörig erwägt und vergleicht, so findet man darin die direkte Aufgabe für den Arzt, ein Gutachten auch dann in gewissen Fällen auszusprechen, wenn es auch vom Richter nicht verlangt wäre.
Solche Fragen, welche sich der Arzt auch ohne Aufforderungen des Richters von Amtswegen zu stellen, und daher von Amtswegen zu beantworten hat, sind vermöge dieser Instruktion folgende: Ob einzelne Verletzungen noch bei Lebzeiten oder erst nach dem Tode zugefügt worden (§. 51) und nicht etwa ein Produkt der Fäulniss sind (§§. 74, 78), oder ob die als eine Wirkung der Fäulniss sich scheinbar zeigenden Beschädigungen nicht etwa ein Produkt einer Verletzung sind (§. 58), ob nicht aus der Beschaffenheit des Körpers selbst sich etwa eine vorzügliche Disposition ergibt, durch welche die nachtheilige Folge der schädlichen Einwirkungen erhöht wurde, 21 (§§. 51. 62. 63. 66. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87), ob nicht eine andere Todesart als jene, welche die Verletzung zur Folge hätte haben können, vorhanden ist (§§. 56. 62. 66. 68. 69. 70. 72. 73. 78. 79. 87), ob keine Hilfe gegen die tödtliche Folge durch Kunst möglich war (§§. 52. 86), ob nicht besondere, auf eine bestimmte Todesart hinweisende, früher nicht bekannte Erscheinungen vorhanden sind (§§. 51. 52. 53. 56. 58. 59. 60. 64. 66. 69. 70. 71. 74. 75. 76. 88. und 91). Bei Vergiftungen hat auch (§. 94) der Arzt selbst Nachfrage bei dem Angehörigen des Verstorbenen anzustellen, und die Akten einzusehen.
Dass die Todesursache vor allem aufgefasst und daher im Gutachten besonders bezeichnet werden müsse, erhellt aus dem Inhalte des §. 92.
Es folgt daher, dass der Arzt nicht nur nach dem Sinne der obzitirten zwei §§. des Strafgesetzbuches, welche durch diese Instruktion keineswegs aufgehoben, wohl aber näher erörtert sind, sondern durch den Inhalt der Instruktion selbst, zu einer selbstständigen Auffassung des vorliegenden Faktums berechtigt und verpflichtet sei, und dass er wohl die Pflicht habe, die gerichtliche Frage vorzugsweise zu berücksichtigen und zu beantworten, sich aber durch dieselben nicht im mindesten abhalten lassen dürfe, alles was er selbst als zur Sache gehörend von Wichtigkeit findet, zu erheben und in seinem Gutachten anzuführen.
Wie kann nun der Arzt wissen, welche Erhebungen und welche Aussprüche sachgemäss sind, und den allerdings möglichen Umstand vermeiden, dass er nicht durch zu viel sagen Missverständnisse oder Unrichtigkeiten für die richterliche Beurtheilung herbeiführt?
Die einfachste Beantwortung dieser Frage wäre nun wohl die Hinweisung des Arztes auf die Befolgung der Instruktion, allein abgesehen davon, dass diese Instruktion nur von Sektionen handelt, und daher die Untersuchung an lebenden Personen nicht berührt, wird jeder erfahrene Arzt, und jeder geübte Richter, mit der Behauptung einverstanden sein, dass fast jeder besondere Fall seine Eigenthümlichkeit habe, deren richtige Auffassung eine Gewandtheit erfordert, welche keine Belehrung zu geben, sondern nur deren Aneignung zu erleichtern, 22 vermag, welche daher nur die Folge einer besondern natürlichen Anlage oder vielfältigen praktischen Uebung sein kann.
Aus dieser Rücksicht wird es immer ein missliches Unternehmen bleiben, durch allgemeine Grundsätze haarscharf angeben zu wollen, wie weit der Einfluss des Richters und wie weit jener des Arztes bei einer gerichtlichen Erhebung gehen soll, denn sind beide ihrem Fache vollkommen gewachsen, so werden sie sich sehr leicht über die Sache einverstehen, und das Gutachten wird so ausfallen wie es sein soll, ohne dass man in vielen Fällen der gelieferten Arbeit auch nur ansehen wird, wie viel dazu dem Richter und wie viel der Arzt beigetragen hat.
Ist aber der Richter erfahren und der Arzt noch ungeübt, so wird der Richter, wenn die Sache gut ausfallen soll, den Arzt auf mancherlei aufmerksam machen, und seine Aeusserungen daher sorgfältiger überwachen müssen, als wenn er sich einem erfahrenen Gerichtsarzte gegenüber befindet, und ebenso wird ein erfahrener Gerichtsarzt gegenüber einem ungeübten Richter sich nicht darauf verlassen, von diesem alles zu erfahren, was er allenfalls von ihm erfahren sollte, sondern ohne eine Aufforderung abzuwarten selbst nachforschen, ob und was allenfalls zu wissen Noth thut.
Sind aber beide Theile schwach, so wird der Umstand, ob die Begutachtung auch eine in jeder Beziehung entsprechende sein wird, immer höchst problematisch bleiben3.
Der Verfasser dieses Aufsatzes ist weit davon entfernt zu glauben, dass irgend eine Abhandlung über diesen Gegenstand den Mangel an praktischer Uebung hierin zu ersetzen vermag, allein so viel ist möglich, durch Darstellung des richtigen Verhältnisses manche unrichtige 23 Ansicht, welche störend auf die richtige Auffassung der praktischen Fälle einwirkt, zu beseitigen. — Solche Gegenstände sind insbesondere: 1. Die Darstellung des richtigen Verhältnisses der gerichtlichen Medizin zur Strafrechtspflege und 2. eine aus der Natur der Sache hergeleitete Darstellung über die Art und Weise, wie die Befunde und Gutachten verfasst werden müssen, um dem richterlichen Zwecke zu entsprechen.
Die gerichtliche Arzneikunde ist der Natur der Sache nach nichts anderes, als die Lehre von der Anwendung der auf dem Gebiete der medizinischen Wissenschaft im Allgemeinen gewonnenen Resultate auf gerichtliche Fälle; sie kann daher ihren Gegenstand in zweifacher Beziehung auffassen, nämlich a) um auszumitteln, welche Gesetze in Folge der auf dem Gebiete der medizinischen Wissenschaft gewonnenen Resultate sich in Bezug auf die möglichen Fälle als zu erlassen nothwendig darstellen, oder b) um auszumitteln, welche Grundsätze und in welcher Art dieselben in Bezug auf die bereits bestehende Gesetzgebung eines bestimmten Staates anzuwenden kommen, um den Grundsätzen dieser Gesetzgebung zu entsprechen. Die erste dieser Aufgaben, die legislative, kann nur durch eine umfassende Berücksichtigung, nicht nur der Ergebnisse der medizinischen Wissenschaft, sondern der rechtlichen und sonstigen in dem einen Staate, für welchen derlei Gesetze erlassen werden sollen, bestehenden Verhältnisse überhaupt, die letztere nur durch eine genaue Kenntniss und Vertrautheit mit der Anwendung der in dem bestimmten Staate, in welchem die Grundsätze der gerichtlichen Arzneiwissenschaften betrieben werden sollen, bestehenden Gesetzgebung, ihren Zweck erreichen, die letztere Art könnte man die positive gerichtliche Arzneikunde nennen.
Nur in ersterer Beziehung kann die gerichtliche Arzneiwissenschaft als eine selbstständige, d. i. ihrer Form nach unabhängige, nämlich als eine solche Wissenschaft gedacht werden, welche dabei nichts anderes, als die Natur der Erscheinungen, auf welche durch die zu erlassenden Gesetze eingewirkt werden soll, zu berücksichtigen hat, in letzterer Beziehung ist ihre Form durch die bestehenden 24 Gesetze gegeben, d. h. sie muss, um ihrem Zwecke zu entsprechen, solche Eintheilungen der auf dem Felde der medizinischen Wissenschaft genommenen Resultate treffen, und eine solche Art und Weise ihrer Anwendung lehren, welche dem Inhalte der positiven Gesetzgebung entspricht.
So wird z. B. die Definition einer schweren Verletzung, d. i. die Aufzählung der, als schwer bezeichneten Fälle von Verletzungen sich wesentlich anders gestalten, wenn das Gesetz eine Anzahl von mehr als drei Tagen, als zur Heilung erforderlich, als charakteristisches Merkmal annimmt, als wenn es eine Zahl von acht Tagen bezeichnet, oder wenn, wie es bei dem österreichischen Strafgesetzbuche sehr zweckmässig geschieht, sie eine solche Zeitbestimmung gar nicht unter die Merkmale des Verbrechens aufnimmt.
Gegen diese sich aus der Natur der Sache ergebende Nothwendigkeit der Trennung des legislativen von dem positiven Gesichtspunkte wird nun in den über gerichtliche Medizin handelnden Schriften nicht selten gefehlt, ja man darf sagen, dass es vielen Schriftstellern ganz und gar nicht beifällt, nur an diesen Unterschied zu denken, sondern die gewöhnliche Art, wie derlei Schriften verfasst werden, ist die Benützung eigener Erfahrungen und der Erfahrungen und Systeme anderer Schriftsteller, gewöhnlich ganz abgesehen von dem Umstande, ob sie im Inlande oder im Auslande geschrieben wurden, wodurch es geschehen kann, dass Eintheilungen, welche in dem Lande, wo die Schrift erschien, ganz richtig sind, in die Schriften eines Autors übergehen, welcher in einem Lande schreibt, auf dessen positive Gesetzgebung sie nicht passen. — So ist in Herrn Professor Bernt's „Handbuch der gerichtlichen Medizin,” §§. 224 und 225 als ein Merkmal des Verbrechens der Nothzucht: Missbrauch der natürlichen Geistesschwäche bei einem blödsinnigen Frauenzimmer, angeführt, während nach §. 110 des österreichischen Strafgesetzbuches nach der gesetzlichen Definition: „Wer eine Weibsperson durch gefährliche Drohung, wirklich ausgeübte Gewaltthätigkeit oder arglistige Betäubung ihrer Sinne ausser Stand setzt, seinen Lüsten Widerstand zu thun, und in diesem Zustande sie schändet, begeht das Verbrechen der Nothzucht” — dieses Merkmal für sich allein entschieden nicht im Stande ist, dieses Verbrechen zu begründen; würde daher ein Arzt in einem Falle, wo eine Person von solchem Gemüthszustande, jedoch ohne Gewalt oder arglistige 25 Betäubung ihrer Sinne, geschändet wurde, sein Gutachten ohne weiters dahin abgeben, sie sei genothzüchtiget worden, so wäre der Ausdruck offenbar ganz unrichtig, und könnte, wenn der Richter dieses Versehen nicht zeitlich genug bemerkt, eine Gesetzwidrigkeit durch Einleitung einer Kriminaluntersuchung wegen eines gar nicht begangenen Verbrechens zur Folge haben.
In dieser Voraussetzung muss daher der Ausspruch Heinroth's: „dass die gerichtliche Arzneiwissenschaft durchaus nicht für den Rechtsgelehrten gehöre” („Lehrbuch über die Seelenstörungen,” Theil II. §. 418), eine wesentliche Einschränkung leiden, denn wenn es auch richtig ist, dass der Richter die Ergebnisse derselben, sofern sie sich auf Daten der medizinischen Beobachtung gründen, nicht zu beurtheilen vermag, so muss er, um deren Anwendung in concreten Fällen unbedingt gestatten zu können, doch die Ueberzeugung haben, dass der Arzt mit seinen Ausdrücken auch dieselben Begriffe verbindet, wie diejenigen Gesetze enthalten, zu deren Anwendung diese Aussprüche die Basis liefern sollen, und diese Ueberzeugung ist ohne ein Statt findendes Eingehen des Richters in die Lehre der gerichtlichen Arzneikunde wohl unmöglich.
Hieraus folgt nun, dass die gerichtliche Arzneikunde, sofern sie zur Erreichung des richterlichen Zweckes bestimmt ist, nichts anderes ist, noch sein kann, als eine mit Zugrundelegung der positiven Gesetzgebung eines bestimmten Staates gelieferte Darstellung derjenigen Ergebnisse der medizinischen Wissenschaft, von welchen sich eine Anwendung auf gerichtliche Fälle denken lässt, verbunden mit einer Anweisung über die Art und Weise, wie die Darstellung der hiedurch gewonnenen Resultate zu geschehen hat, um dem durch eben diese positive Gesetzgebung ausgesprochenen Standpunkte des Richters zu entsprechen, sie ist und kann daher nichts anderes sein, als ein Kommentar des Gesetzes mit Rücksicht auf solche praktische Fälle, so weit zu dessen richtiger Auffassung und Erhebung Anwendung medizinischer Kenntnisse nöthig sind, und hat daher in ihren einzelnen Theilen nur insoweit auf juridische Giltigkeit Anspruch, als sie die Uebereinstimmung ihrer Aussprüche mit dem Gesetze dem Richter darzuthun vermag.
Aus dieser Ansicht ergibt sich nun, dass Ergebnisse der medizinischen Wissenschaft, ihre Richtigkeit möge übrigens in medizinischer 26 Beziehung noch so zweifellos sein, ohne alle Folgen für die richterliche Anwendung sein werden, so lange die Beziehung, in welcher sie sich zu einem Gesetze befinden, nicht nachgewiesen wird, und dass jede Aufführung medizinisch-wissenschaftlicher Resultate nur dadurch und insofern in dieser Lehre an ihrem Platze sei, als dadurch eine Beziehung des Gesetzes zu irgend einem gerichtlichen Falle dargestellt oder erläutert wird4.
Als Beleg dieser Behauptung möge die Beantwortung der Frage dienen, warum gerade die Lehre von Verletzungen, und nicht etwa jene von Fiebern, Lungenleiden, Magenbeschwerden etc. in das Gebiet der gerichtlichen Arzneikunde gehören? — Die Antwort kann wohl nur sein, weil es Strafgesetze gibt, mit welchen die Thatsache von vorhandenen Verletzungen in Beziehung steht, und weil es keine Gesetze gibt, auf welche die Thatsache einer vorhandenen Lungensucht oder eines Magenübels, sofern diese Krankheiten nicht Folgen von vorausgegangenen Verletzungen sind, bezogen werden können.
Ebenso wird sich die Frage beantworten, warum man die Verletzungen in absolut, individuell, per se, per accidens lethales eingetheilt hat, und warum diese Eintheilung jetzt von keinem Werthe mehr ist. Das Erste geschah nämlich, weil man voraussetzte, dass die bestehenden Gesetze einen Unterschied der Strafbarkeit in diesen verschiedenen Verhältnissen von deren Tödtlichkeit anerkennen, und das Letztere, weil man endlich wahrnahm, dass eine solche Unterscheidung weder ausdrücklich im Gesetze enthalten ist, noch dem Sinne der Gesetze entspreche5.
27 Es folgt aus der oben dargestellten Ansicht aber auch, dass die gerichtliche Arzneikunde um so vollkommener ihrem Zwecke entsprechen werde, je mehr sie Denjenigen, welcher sich ihr widmet, in die Lage setzt, bei vorkommenden Fällen alle jene Beziehungen zu entdecken, welche zwischen der untersuchten Thatsache und dem Gesetze bestehen, und diese Beziehungen in diesem Sinne darzustellen, bei der hierzu nothwendigen Erhebung aber ein Verfahren zu beobachten, welches nicht nur zu diesem Zwecke führt, sondern auch mit keinem bestehenden Gesetze sich im Widerspruche befindet.
So mag es immerhin nach den Grundsätzen der Medizin als ein zweckmässiges Mittel zur Entdeckung einer möglichen Verstellung bei dem Vorgeben einer vorhandenen Krankheit erscheinen, allenfalls ein Glüheisen zur Erforschung der Wahrheit zu appliziren. Die gerichtliche Arzneikunde kann sich nur gegen ein solches Mittel aussprechen, denn vom Standpunkte der positiven Gesetzgebung ist, selbst wenn eine erwiesene Lüge des Inquisiten vorliegt, keine andere Strafe gegen ihn anzuwenden, als Fasten oder Züchtigung mit Streichen, wenn er ungeachtet des vorgehaltenen klaren Beweises auf seiner Lüge oder Verstellung beharrt, wo aber die Sache zweifelhaft ist, darf gar kein Zwang angewendet werden. Die Applizirung eines Glüheisens oder ähnlicher, wenn auch minder heroischer Mittel wäre im letzten Falle entschieden eine Folter, und im ersten Falle beiläufig dasselbe, oder eine Züchtigung in einer viel empfindlicheren Art.
Wie kann man aber auch dem Arzte zumuthen, dass er zu einem andern Zwecke, als um zu heilen, irgend ein Uebel einem Dritten zufüge? Eine solche Zumuthung, noch mehr aber die Ausführung, wäre die grösste Entwürdigung der ärztlichen Wissenschaft! Sind nun die Vorschläge zur Anwendung solcher Mittel in Schriften, welche über gerichtliche Arzneikunde handeln, etwa unerhört? — Folgende Stelle, deren Verfasser hier absichtlich nicht genannt wird, findet sich wirklich 28 vor: „Schmerzhafte Mittel sind nur erst nach begründetem Verdacht6 eines Betruges anzuwenden; dahin gehört die Anwendung von Senfpflastern, Canthariden, der Haarseile, Fontanellen, des Nesselpeitschens, der Aetzmittel, der moxa, des Glüheisens, der Douche und Tropfbäder, die Androhung schmerzhafter und gefährlicher Operationen7.”
Ich bin wohl fest überzeugt, dass die zitirte Stelle nach dem Sinne des Autors nur in dem Sinne zu nehmen sei: dort wo man einen begründeten Verdacht eines Betruges hat, und es nach pathologischen Grundsätzen in dem Falle, wo der Zustand wirklich so wäre, wie er von dem Inquisiten angegeben wird, angezeigt ist, Glüheisen u. dgl. anzuwenden, dürfe eine solche Anwendung erfolgen, um den Betrug zu entdecken.
Allein auch in diesem Falle ist der Satz nicht richtig, denn es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der Arzt, als Arzt, nur dann 29 ein Uebel einem Kranken zufügen dürfe, wenn er es zur Heilung für nothwendig findet. Wo er aber einen gegründeten Verdacht hat, die Angabe sei Betrug, kann er die Anwendung des Mittels unmöglich als einen Weg zur Heilung betrachten, sondern sie ist in seinen eigenen Augen nichts Anderes, als eine Tortur, und er selbst, indem er einem Menschen, um ein Geständniss eines Betruges zu erhalten, ein Uebel zufügt, nichts anderes, als ein Mensch, welcher in einem andern Berufe arbeitet, als in dem seinen.
Dabei darf aber auch nicht unberücksichtiget bleiben, dass Niemand verhalten werden kann, sich gegen seinen Willen einem Heilungsprocesse, am wenigsten aber einem schmerzhaften, welcher ihm sonst noch Gefahr zu bringen scheint, zu unterziehen. Wie soll es nun gehalten werden, wenn der Inquisit erklärt, er wolle sich nicht brennen oder ein Haarseil ziehen lassen? — Man müsste den Menschen dann binden, und es hätte dann ein Verfahren Statt, wie man es in den Akten des vergangenen Jahrhunderts mit Schauder liest, nur dass statt dem Scharfrichter der Arzt mit dem Glüheisen vor dem Wehrlosgemachten stünde8.
Solche grelle Szenen liegen aber implicite in diesen Sätzen, deren Aufstellung nur dadurch möglich wird, dass man die gerichtliche Arzneikunde ohne Zugrundelegung der Rechtslehre behandelte.
Solche Szenen können sich aber ereignen, wenn der Satz Heinroth's: dass die gerichtliche Arzneiwissenschaft nicht für den Juristen gehöre, unbedingt als wahr angenommen wird.
Die Zeit, wo man an die ausschliessliche Kompetenz einer Wissenschaft glaubte, ist indess glücklicher Weise vorüber. Jeder will, wo es sein kann, mit eigenen Augen sehen, und handelt hierin sehr vernünftig, denn es kann nicht geläugnet werden, dass durch die in neuerer Zeit in's Leben getretene Verbindung verschiedenartiger Wissenschaften 30 die einzelnen Wissenschaften mehr gewonnen haben, als durch die in den vorigen Zeiten üblich gewesene abgeschlossene Behandlungsweise der einzelnen Zweige des menschlichen Wissens. — Diese Ansicht Heinroth's gehört daher in eine frühere Epoche.
Obwohl es ausserhalb des Zweckes dieses Aufsatzes liegt, die Kritik der über gerichtliche Arzneikunde handelnden Werke zu schreiben, so dürfte es sich doch nach dem bisher Gesagten als ausgemacht annehmen lassen, dass es nur einen Weg gibt, auf welchem die gerichtliche Arzneiwissenschaft, insofern sie nicht sowohl für die Legislation, als für die gerichtliche Praxis bestimmt ist, behandelt werden muss. Es ist dies nämlich der Weg, dass Aerzte, welche in ihrer Wissenschaft es auf einen hohen Grad von Vollkommenheit gebracht haben, sich entschliessen, mindestens denjenigen Theil der Gesetzgebung, welcher nicht entschieden nichts mit der medizinischen Wissenschaft gemein hat, genau und gründlich zu studiren, und auf diese erworbene Kenntniss der positiven Gesetzgebung eines bestimmten Staates gestützt, Grundsätze aufzustellen, deren Richtigkeit sie auf eine auch für den Richter verständliche Weise aus der positiven Gesetzgebung nachweisen, welche aber zugleich den gerichtlichen Arzt in die Lage setzen, unter den Ergebnissen der medizinischen Wissenschaften diejenigen auszuwählen, welche auf den speziellen Fall anzuwenden kommen, und ihm zugleich die Anleitung geben, wie diese Darstellung zu liefern ist, damit der Richter nicht im Zweifel bleibe, dass der das Gutachten abgebende Arzt auch wirklich im Sinne der Gesetze gesprochen habe.
Dies kann nur dadurch geschehen, dass diese in dem speziellen Falle zu liefernde Darstellung zuvörderst von solchen Daten ausgeht, welche sich dem Richter entweder als ein Gegenstand seiner eigenen sinnlichen Wahrnehmungen darbietet, oder ihm durch die bei ihm vorauszusetzenden Lebenserfahrungen als bekannt und erprobt erscheinen, auf diese Daten gestützt aber sonach der Anschauung des Richters dasjenige, welches ihm minder bekannt oder unbekannt ist, so viel möglich näher bringt, in dieser letzten Beziehung aber so verfährt, dass auch alle dem Richter zur Anwendung des bestimmten positiven Gesetzes auf den vorliegenden Fall noch mangelnden Begriffe geliefert werden, dass daher mit Einem Worte die gerichtliche Arzneikunde nicht als ein selbstständiger Zweig der medizinischen Wissenschaft, sondern als diejenige Methode 31 der Anwendung der medizinischen Wissenschaft betrachtet werde, wodurch das dem bestimmten positiven Gesetze, im Verhältnisse zu den möglichen Fällen, entsprechende Verfahren, so wie die zweckmässige Darstellung der ärztlichen Einsichten und Erfahrungen in Bezug auf jene Fälle gelehrt wird.
Es ergibt sich dadurch von selbst, dass das eigentliche Kriterium der Gediegenheit der Behandlung des Gegenstandes darin liegen wird, dass dem eine solche Anleitung benützenden Arzte entweder keine, oder doch nur solche Differenzen des ärztlichen Ausspruches mit der richterlichen Ansicht vorkommen, welche nach der angezeigten Methode leicht zu beheben wären, denn es kann keinem Zweifel unterliegen, der Richter, welcher seine Ansicht durch den Ausspruch des Gesetzes und der eigenen Sinnenwahrnehmung und Erfahrung begründet, kann und darf von seiner Ansicht nicht abgehen, so lange er nicht eines Irrthums überwiesen wird, wo daher der ärztliche Ausspruch mit jener Ansicht des Richters nicht übereinstimmt, kann bei dem Umstande, als über einen Gegenstand nicht zwei entgegengesetzte Ansichten wahr sein können, die Differenz nur in einer mangelhaften Darstellung von Seite des Arztes liegen, dem es wenigstens nicht gelungen ist, den Irrthum, in welchem der Richter sich befindet, zu entdecken und aufzuklären.
Wir kommen nun zu dem zweiten Punkte, nämlich zu der Art und Weise, wie der Arzt vorzugehen habe, damit sein Gutachten in jedem Falle den richterlichen Erfordernissen entspreche.
Der wesentlichste Theil dieser Frage ist schon in dem vorigen Titel beantwortet; die wichtigste Bedingung ist nämlich, dass er ausser seinem Fache, nämlich der medizinischen Wissenschaft überhaupt, auch jenen Theil der positiven Gesetzkunde, welcher eine Anwendung medizinischer Kenntnisse erfordert, genau inne habe und in den Geist der Gesetze eingedrungen sei, denn ohne dieses Erforderniss ist der Gerichtsarzt gegenüber dem Gesetze ungefähr das Nämliche, was ein 32 blosser Empiriker gegenüber der Krankheit ist. — Er wird in dem Falle, als er einem Richter sich gegenüber befindet, welcher die Geschicklichkeit hat, ihm den Fall so darzustellen, wie dieser Fall gerade in seinem Erfahrungs-Lexikon enthalten ist, und sofern dieses Erfahrungs-Lexikon richtig ist, das Wahre treffen, wo dieses jedoch nicht der Fall ist, aber immer hinter seiner Aufgabe zurückbleiben, nie aber jene Selbstständigkeit der Auffassung und Darstellung geltend machen können, zu welcher der Arzt insbesondere, vermöge seiner Wissenschaft und die Erfahrung des Richters in diesem Fache weit überragenden Bildung, mehr als jeder andere Kunstverständige berufen ist.
Unter dieser Voraussetzung lässt sich daher in dem Falle, wo ein Thatbestand zu erheben, und nicht etwa nur eine Auskunft über eine rein wissenschaftliche Frage verlangt wird, folgender Weg als der richtige angeben.
Vor Allem muss der in Frage stehende Gegenstand besichtiget werden, und zwar muss diese Besichtigung ohne alle vorgefasste Meinung in derjenigen Gemüthsart geschehen, in welcher man einen ganz unbekannten Gegenstand betrachtet, um zu erfahren, was er eigentlich vorstellt.
Diese Besichtigung wird nun gewöhnlich schon von einigem Erfolge begleitet sein; man wird z. B. sehen, es liegt ein Leichnam vor, es ist ein Individuum vorhanden, welches angibt, beschädigt zu sein etc. Sohin berücksichtige der Arzt dasjenige, was durch das Gericht über den Fall bereits erhoben ist, wodurch er dahin kommen wird, durch die etwa bereits erhaltenen gerichtlichen Mittheilungen sich wenigstens bis auf einen gewissen Grad klar zu machen, welche gesetzliche Anordnungen hier möglicher Weise angewendet, und welche entschieden nicht angewendet werden können. Z. B. bei der Leiche eines Erwachsenen wird Jeder sogleich wissen, dass alle etwa bei den Untersuchungen eines neugebornen Kindes besonders vorgeschriebenen Erhebungen ausgeschlossen sind.
Ist man nun so weit gekommen, so wird es sehr anzuempfehlen sein, alle jene Gesetzes-Paragraphen und die etwa hierüber sonst bestehenden Verordnungen, von welchen sich denken lässt, dass sie auf ähnliche Fälle sich beziehen, nachzulesen, damit man sich selbst die beruhigende Ueberzeugung verschaffe, dass man nichts vergessen habe, und um das etwa Vergessene zu ergänzen, auch sofern ein bestimmtes Verfahren bei der Erhebung vorgeschrieben ist (wie 33 etwa in der Instruktion für die Vornahme von gerichtlichen Leichenbeschauen der Fall ist), sich gegen die Folgen eines möglichen Gedächtnissfehlers zu schützen. — Es versteht sich daher von selbst, dass man, wenn man sich zu einem solchem Akte begibt, dasjenige Gesetzbuch oder diejenigen Verordnungen, um welche es sich handeln kann, bei der Hand haben müsse9.
Hat man sich nun über diesen Theil seiner Aufgabe die nöthige Klarheit verschafft, zu welchem Zwecke es gewiss nur sehr nützlich sein kann, sich mit dem Richter oder dem Abgeordneten des Gerichtes in's Einvernehmen zu setzen, so ist es an der Zeit, zu überlegen, was man nun ferners beginnen soll, um durch ein zweckmässiges Verfahren die Anwendung des Gesetzes möglich zu machen.
Hierzu ist nun vor Allem nothwendig, dass der einschreitende Arzt erfahre, aus welchem Gesichtspunkte der Richter die Sache betrachte, wenn er durch etwa Statt gefundene Vorerhebungen dahin gelangt ist, bereits eine Ansicht der Sache gebildet zu haben. Diese Ansicht kann und soll der Richter in den aufzustellenden Fragen aussprechen, welche zugleich den Zweck erfüllen sollen, die Kunstverständigen mit jenen Erhebungen bekannt zu machen, welche sie entweder aus der ihnen bekannt werdenden Thatsache nicht entnehmen, oder doch möglicher Weise nicht gehörig würdigen könnten. Damit aber solche Fragen gestellt werden können, muss der Richter schon eine bestimmte Ansicht von dem Vorfalle haben, und damit diese Fragen zweckmässig und erschöpfend seien, muss diese Ansicht richtig und den ganzen Komplex der Thatsache umfassend sein. Beides ist aber oft aus Gründen, welche im §. 12 dieses Aufsatzes dargestellt sind, nicht möglich10, es muss daher in jedem Falle eine selbstständige 34 Beurtheilung von Seite des Arztes eintreten, und zwar im Falle, wo der Richter noch keine Ansicht von der Sache hatte, um ihm dazu zu verhelfen, in dem Falle, wo er eine richtige hatte, ihm diese als richtig zu bestätigen, und sofern sich seine Ansicht als unrichtig darstellt, ihm, so weit dies durch ärztliche Vorkenntnisse und sinnliche Wahrnehmung möglich ist, zu der richtigen Auffassung des Falles zu führen. — Ein Beispiel der letzten Art ist, wenn etwa aus den Fragen des Richters bei einer behaupteten Nothzucht blos der Umstand erwähnt wird, ob Spuren angewandter Gewalt an der Beschädigten zu finden seien, der Arzt erfährt aber durch sie, sie habe sich in dem Zeitpunkte, wo die Schändung Statt fand, in einem Zustande von Betäubung befunden, es würde dann ganz gefehlt sein, etwa blos zu erklären, es seien keine Spuren von Gewalt vorhanden, sondern es müsste auch vom Arzte ausdrücklich gesagt werden, dass nach Angabe der Beleidigten sie sich in einem Zustande befunden habe, welcher, wenn er sich so verhält wie sie angibt, allerdings von einer durch einen Dritten verursachten arglistigen Betäubung der Sinne herrühren könne (§. 18).
Eben so würde der Arzt in dem Falle, wo der Richter die Todesursache bei einem vorgefundenen weiblichen Leichname etwa in einem Selbstmorde vermuthete, und weil es schon Nacht ist, sich begnügen möchte, die Thüren zu versiegeln und etwa eine Wache hinzustellen, sehr Unrecht haben, sich einem solchen Begehren wenigstens ohne aktenmässiger Protestation zu fügen, und sich mit der Betrachtung, dass etwa der Hals abgeschnitten sei und das Messer neben ihr liege, sie selbst schon kalt sei etc., zu begnügen, sondern er müsste hier wenigstens sich vor Allem die Gewissheit verschaffen, ob sie nicht schwanger und der Kaiserschnitt möglich sei, und daher vom Richter verlangen, alle möglicher Weise zu erhebenden Daten, deren richtige Erhebung durch die Untersuchung des Leichnams gestört werden könnten, z. B. Beschreibung der Lage, in welcher der Leichnam gefunden wurde, dessen Bedeckung etc., sogleich zu erheben, und das zur Rettung der Frucht nothwendige Verfahren dann selbst einleiten.
Je complicirter der Fall ist, d. h. je mehr einzelne, aus der Betrachtung der Sache selbst nicht erhellende Umstände auf die richtige Auffassung der Thatsache Einfluss nehmen, um so weniger ist die Möglichkeit einer vollständig richtigen Ansicht von Seite des Richters gegeben. So wie daher der Richter in einem solchen Falle die Pflicht hat, seinerseits 35 alles ihm Mögliche zu thun, damit von Seite des Arztes nichts übersehen werde, so hat auch der Arzt die Verpflichtung, dort, wo er sich die Möglichkeit denken kann, dass ihm der Richter etwas, welches zur Sache gehören könnte, aus Unkenntniss seiner Bedeutung nicht mitgetheilt haben könnte, die Einsicht der Akten zu verlangen, oder den Richter sonst zu befragen, um das Bestehen von solchen Umständen zu erfahren und sich über deren Beschaffenheit die möglichste Gewissheit zu verschaffen.
Dies Verfahren ist dort, wo es sich als nothwendig zeigt, schon früher anzuwenden, als noch ein besonderer Akt der Erhebung Statt findet, etwa z. B. die Sektion vorgenommen wird, damit man dabei nichts durch die Umstände als wesentlich Gebotenes übersehe. Es ist aber nicht weniger dann nothwendig, wenn die Untersuchung der Thatsache Statt gefunden hat, und es sich als möglich darstellt, dass irgend ein aus der Thaterhebung sich nicht ergebender, jedoch in den sonstigen Aktenstücken, z. B. in einer Zeugenaussage enthaltener Umstand, von Einfluss auf das abzugebende Gutachten sein, oder durch weitere Nachforschungen erhoben werden könnte.
Um nun die vorhandenen Aktenstücke gehörig benützen zu können, muss der Arzt nothwendig einen richtigen Begriff von deren Bedeutung haben, wohin insbesondere die Berücksichtigung des Umstandes gehört, dass nicht Alles darum, weil es im Akte aufgenommen ist, z. B. der Inhalt einer Zeugenaussage, auch wahr, oder dass darum, weil etwas nicht im Akte steht, es auch nicht vorhanden gewesen sei, weil es nicht nur geschehen kann, sondern auch sehr oft geschieht, dass entweder mit oder ohne Absicht falsche Angaben gemacht und daher protokollirt werden.
So wie daher der Richter die Pflicht hat, den ärztlichen Befund zu dem Zwecke zu durchgehen, um zu entdecken, ob nicht irgend etwas übersehen, irgend ein Satz ausgesprochen ist, welcher ihm, dem Richter, nicht gehörig begründet zu sein scheint, so muss daher auch der Arzt mit einer sachgemässen Kritik bei der Durchlesung der Akten zu Werke gehen, und in seinem Befunde bezeichnen, ob und was ihm nach der Aktenlage, nach wissenschaftlicher Beurtheilung des Falles, unwahr, was zweifelhaft, oder noch einer weiteren Erhebung und welcher Art von Erhebung bedürftig erscheine, in seinem Gutachten aber genau ersichtlich machen, wo und inwiefern er die mitgetheilten Aktenstücke benützte, damit der Richter 36 in die Lage gesetzt werde, wo es ihm nöthig scheint, etwa weitere Erhebungen zur Ausmittlung der Wahrheit von derlei Angaben einzuleiten, und überhaupt erfahre, dass und inwiefern das Gutachten, selbst in den Augen des Arztes, nur eine bedingte Giltigkeit habe, denn dort, wo das Gutachten nicht mehr auf die eigene Wahrnehmung des Arztes oder auf Ergebnisse der medizinischen Wissenschaft, sondern auf den Inhalt eines Aktenstückes basirt ist, ist es nur insofern objektiv richtig, als in den fraglichen Aktenstücken die Wahrheit enthalten ist, es zerfällt von selbst, wenn die Unwahrheit des Inhaltes dieses Aktenstückes nachgewiesen würde.
Ein solcher Fall wäre etwa, wenn ein Mensch aufgegriffen wird, an dessen Rücken sich runde Narben befinden. — Er gibt an: es sind Narben von Geschwüren; kann nun der Arzt nicht mit Gewissheit sagen, und zwar aus der Betrachtung der Form der Narben etc., dass es Geschwür-Narben und nicht etwa Schrottschuss-Narben sind, so darf er sich durch den Umstand, dass der Aufgegriffene diese Narben für Geschwür-Narben angegeben hat, und diese Angabe ihm, dem Arzte, nicht unrichtig zu sein scheint, nicht etwa verleiten lassen, zu sagen: „N. N. hat Geschwür-Narben” — denn er steht dann in Gefahr, selbst einer Unwahrheit im Parere überwiesen zu werden, wenn etwa in der Folge herauskäme, dass es Schussnarben sind, sondern das Parere muss lauten: „Der N. N. hat auf dem Rücken Narben, welche nach seiner Angabe Geschwür-Narben sind, welche Angaben nach dem Zustande, in welchem sich die Narben gegenwärtig befinden, auch richtig sein kann, es ist jedoch, nach der Form dieser Narben zu schliessen, allerdings die Möglichkeit vorhanden, dass es Schrottschuss-Narben sind.”
Ist es nothwendig, zur Aufklärung mancher Umstände den Inquisiten oder ein drittes, von den Gerichtspersonen verschiedenes Individuum zu befragen, so darf dies nie ohne vorläufiges Einvernehmen mit dem Untersuchungsrichter geschehen, damit nicht die eine oder andere Frage, indem sie jenem Dritten mittheilt, dass man Umstände weiss oder Umständen auf der Spur ist, welche noch von ihm als ein Geheimniss vermuthet werden, störend auf den Gang der Untersuchung einwirke.
Eine besondere Betrachtung muss noch jener Art von Befunden gewidmet werden, welche der Richter bedarf, ohne dass der Gegenstand, 37 welcher eigentlich zu untersuchen nothwendig wäre, ganz oder zum Theile vorgelegt werden kann; z. B. bei dem Geständnisse eines Kindsmordes, wenn die Kindesleiche gar nicht mehr aufgefunden werden kann, oder etwa nur ein Theil derselben, z. B. der Kopf, allein vorhanden ist. Der kürzeste Weg, von der Sache wegzukommen, ist wohl jener, wenn anders der Richter kurzsichtig genug wäre, sich damit zu begnügen — dass erklärt wird: „man könne über dasjenige, was man nicht gesehen hat, auch kein Gutachten abgeben;” der Richter kann und darf sich aber in den wenigsten Fällen mit einer solchen Aeusserung begnügen, denn abgesehen davon, dass zu einem solchen Ausspruche eben kein tiefes Ergründen der Geheimnisse der Natur gehört, ist es nicht einmal richtig, denn man kann sehr oft über eine Sache, die man nicht selbst gesehen, von welcher man jedoch eine sehr deutliche Beschreibung vor sich hat, sehr richtig und sehr gründlich urtheilen; es kommt daher nur darauf an, dass man Geschicklichkeit genug besitze, sich eine richtige Beschreibung zu verschaffen.
Hier ist es daher die Pflicht des Arztes, vor Allem den Akt einzusehen, und daraus sich diejenigen Daten zusammenzustellen, welche einen Aufschluss entweder wirklich geben, oder, wenn sie gehörig verfolgt werden, einen Aufschluss zu geben versprechen, und im letzteren Falle deren Verfolgung vom Richter, allenfalls mit dem Antrage, selbst bei dem diesfälligen Erhebungsakte, z. B. dem Verhöre oder der Zeugenvernehmung, zu interveniren, zu verlangen, und so fortzufahren, bis wenigstens alles zu geschehen Mögliche gethan ist.
Die richterlichen Fragen können in einem solchen Falle den Arzt noch weniger als in einem andern, wo das Corpus delicti vorliegt, an der selbstständigen Auffassung der Sache, und daher an der Abgabe eines Gutachtens hindern, welches den Forderungen der positiven Gesetzgebung über das möglicher Weise in Frage stehende Verbrechen entspricht, da es sich leicht denken lässt, dass der Richter bei so mangelhaften, oft erst noch durch Veranlassung des Arztes zu ergänzen möglichen Prämissen nicht in der Lage sein kann, diese Fragen vollkommen sachgemäss und erschöpfend zu stellen.
Ist aber auf die angedeutete Weise der Thatbestand ergänzt, so muss das Gutachten, so weit es nach den vorliegenden Daten möglich ist, auch vollständig abgegeben, und vor Allem dabei die Angabe nicht unterlassen werden, in wie weit der Inhalt der Aussage, auf welchen sich 38 das Gutachten stützt, nach Grundsätzen der medizinischen Wissenschaft Glauben verdient oder nicht. Es ist möglich, dass ungeachtet aller auf diese Weise erreichten Vollständigkeit des Gutachtens doch kein bestimmtes Resultat erzielt werden kann, und das Gutachten daher zweifelhaft bleiben muss, allein dann hat der Arzt seine Pflicht erfüllt und ist gegen alle nachtheiligen Folgen gesichert, welche ohne diese gewissenhafte Genauigkeit eintreten und darin bestehen könnten, dass bei Vorlage des Aktes an die medizinische Fakultät seine Ausarbeitung als eine oberflächliche erkannt werden würde.
Um das Gesagte deutlich zu machen, möge folgender Fall dienen, welcher sich erst vor einigen Monaten wirklich zugetragen hat.
Eine Weibsperson hatte sich hochschwanger aus ihrer Heimat entfernt, und war nach einigen Wochen, ohne mehr schwanger zu sein, in ihre Heimat zurückgekehrt. Zu Verhaft gebracht, gestand sie, sie habe an einem bestimmten Orte ein todtes Kind geboren, und gab einmal an, sie habe des Kindes Leiche ins Wasser geworfen, ein anderesmal, sie habe sie an einem Zaune liegen gelassen. Auch über den Akt der Geburt differirten ihre Aussagen, indem sie einmal angab, sie habe in einem Stalle neben den Pferden, das andere Mal, sie habe in einer kalten Kammer (im November) geboren.
Die Fragen, auf die es ankam, waren nunmehr:
a) hat sie geboren?
b) ist es richtig, dass das Kind todt zur Welt kam?
c) ist es nicht anzunehmen, dass sie es umgebracht oder aus Mangel an nöthigem Beistande habe umkommen lassen?
Ueber die erste Frage konnte bei dem bereits verstrichenen Zeitraum und bei dem Umstande, dass die Inquisitin früher schon einmal geboren hatte, keine Gewissheit erlangt werden, da übrigens die Inquisitin die behauptete Schwangerschaft nicht läugnete und dieselbe von glaubwürdigen Personen bemerkt worden war, so war dieser Mangel minder erheblich.
Ueber das Zweite lag die bestimmte Abrede der Inquisitin vor, es musste also der Gang der Untersuchung dahin geleitet werden, irgend einen für oder gegen ihre Angabe streitenden Grund zu finden.
Zu diesem Ende wurde ausser der Untersuchung der Person der Inquisitin, nach welcher dieselbe ganz normal gebaut war, auf Veranlassung des intervenirenden Arztes (Herrn k. k. Bezirksarztes Dr. N. zu Hofgastein), 39 sehr zweckmässig ihr Gesundheitszustand während ihrer letzten Schwangerschaft sowohl, als während ihrer ersten Schwangerschaft, nach welchem sie erhobenermassen ein todtes Kind geboren hatte, erforscht, und sie über den Verlauf der Geburt selbst umständlich verhört.
Es ergab sich: dass sie einmal auf den Bauch gestossen wurde (im vierten Monate), eben so die ersten Monate am Blutflusse gelitten, und auch sonst Anfälle von heftigen Krämpfen gehabt habe, die Geburt aber schnell und ohne besondere heftige Schmerzen vor sich gegangen sei, so dass sie keinen Schmerzenslaut von sich gegeben habe, und daher auch nicht von den in der Nähe schlafenden Leuten gehört worden sei.
Bei diesen Verhältnissen wurde nun von Seite des Herrn Bezirksarztes ganz sachgemäss erklärt, dass alle diese Umstände zwar kein entscheidendes Gutachten gestatten, dass aber bei dem Umstande, wo eine Frühgeburt nicht Statt hatte, — die Inquisitin behauptete im Gegentheile 10 Monate und 9 Tage schwanger gewesen zu sein — auch kein positiver Grund vorhanden ist, aus welchem die Angabe, dass das Kind schon vor der Geburt gestorben gewesen sei, für wahr gehalten werden müsse, dass aber bei den vorausgegangenen nachtheiligen Einflüssen zu vermuthen sei, dass das Kind klein und schwächlich war, daher es denkbar ist, dass, wenn die Geburt in der Kammer vor sich ging, sie der Wöchnerin keinen so grossen Schmerz verursacht habe, dass sie zur Ausstossung von Schmerzenstönen, wodurch die in der Nebenkammer schlafenden Leute wären aufmerksam gemacht worden, gedrungen gewesen sei, dass es daher ebenso denkbar ist, dass das Kind während oder nach der Geburt an der eigenen Schwächlichkeit gestorben sei, dass aber im Falle sie in einem Stalle geboren, die dort herrschenden mephytischen Dünste die Entwicklung der Respirationsorgane gehindert und ehe die Mutter es gewahrte, dem Leben ein Ende gemacht haben können; — dass endlich die Entbindung in der kalten Kammer, wenn das Kind nicht unbedeckt liegen blieb, keinen lebensverkürzenden Einfluss könne gehabt haben, und daher nicht als ein den Tod herbeiführender Mangel an Beistand könne betrachtet werden.
Ueber die behauptete Dauer der Schwangerschaft über 10 Monate erklärte der Herr Bezirksarzt, dass diese Angabe allerdings in Zweifel gezogen werden müsse, wenn sie aber wahr wäre, so würde sie eine Anomalie vermuthen lassen, welche wirklich dafür spreche, dass das Kind todt zur Welt gekommen sein könnte, während bei dem wahrscheinlichen 40 normalen Zeitverlaufe, kein positiver Grund für den Tod vor der Geburt, jedoch auch kein Grund vorhanden sei, die Unmöglichkeit, dass das Kind schon todt zur Welt gekommen sei, zu behaupten.
Alle diese Angaben wären ohne genaue Durchgehung der Akten und die Statt gefundene zweckmässige Auffassung unmöglich gewesen, und das Kriminalgericht war nur dadurch, dass wenigstens der kompetente Ausspruch, es sei keineswegs ein Grund vorhanden, das Kind für todtgeboren annehmen zu müssen, vorlag, in Gemässheit der übrigen gegen die Inquisitin streitenden Gründe (ihre widersprechenden Aussagen, sonstigen schlechten Leumund u. s. w.) in die Lage gesetzt, die Kriminaluntersuchung gegen sie einzuleiten, welches ohne diesen, nur durch die von Seite des einschreitenden Arztes Statt gefundene umsichtige Erwägung der Aktenlage möglich gewesenen Ausspruch nicht hätte geschehen können11.
Wird endlich ein Gutachten über einen bestimmten Gegenstand verlangt, dessen Natur und Beschaffenheit nicht von selbst andeutet, was man von demselben von Seite des Gerichts zu wissen verlangt, so ist es wohl in der Ordnung, dass das Gericht angebe, welche Art von Auskunft es bedürfe, z. B. ob es wahr ist, dass ein aufgefundener Körper, z. B. Rhabarber, eine Arznei sei.
Sollte jedoch das Gericht es unterlassen haben, sich bestimmt hierüber auszudrücken, und ergibt sich nicht schon aus den übrigen dem Arzte bekannten Erhebungen der Zweck einer solchen Mittheilung, so ist es wohl der natürlichste Weg, dass der Arzt an das Gericht die Frage stellt, was es eigentlich wissen will. Ein Fall der ersten Art wäre, wenn etwa das Gericht nach Statt gefundener Sektion eines durch Messerstiche getödteten Menschen einen blutigen Stock mit der Bemerkung übersendet hätte, dass dieser Stock eben jetzt in dem Lokale, wo der Mord Statt hatte, aufgefunden worden sei. Die Erklärung des Arztes dürfte nun nicht etwa dahin lauten, es sei wahrscheinlich, dass das am Stocke befindliche Blut von dem Ermordeten herrühre, oder dass, wie es wirklich in einem solchen gedruckten Gutachten 41 zu lesen ist: der Stock wahrscheinlich Zeuge der That gewesen sei12, sondern er müsste die Frage beantworten, ob an der Leiche Spuren vorhanden seien, welche von der Anwendung dieses Stockes zeigen. — Das Gutachten darf sich aber auch im Falle, als das Gericht sich ausgesprochen hat, nur dann auf die Beantwortung der richterlichen Frage beschränken, wenn der Arzt nach Massgabe der ihm bekannt gewordenen Umstände findet, dass durch die Beantwortung die volle Bedeutung des Gegenstandes erschöpft ist, findet er dieses nicht, so muss er dasjenige beisetzen, wovon er vermuthet, dass es für die gerichtliche Untersuchung von Einfluss sein kann, wäre z. B. in dem Falle einer Arsenik-Vergiftung ein Mörser mit der Frage mitgetheilt worden, ob der darin befindliche Körper Arsenik sei, und der Arzt fände, dass es zwar Arsenik sei, aber etwa gelber Arsenik, während die Vergiftung mit weissem Arsenik geschah, so wäre es nicht hinreichend zu sagen, es ist Arsenik, sondern es müsste ausdrücklich gesagt werden, es ist Arsenik, jedoch eine andere Gattung als derjenige, welcher im Magen vorgefunden wurde, weil diese Angabe von grosser Bedeutung für die Untersuchung werden kann.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich von selbst die Beantwortung der Frage, wie weit der richterliche Einfluss bei Abgabe eines Gutachtens gehen dürfe.
Die Frage ist jedoch besonders im gegenwärtigen Zeitpunkte, wo so vieles für gerichtliche Medizin, insbesondere in der Art geschieht, dass von Seite der zum Richteramte sich bildenden Rechtskundigen eigene gerichtlich medizinische Studien gemacht werden, viel zu wichtig, um nicht eine besondere Besprechung zu bedürfen.
Es wurde in der That schon im Ernste die Frage aufgeworfen, ob es gut oder übel sei, dass der Richter medizinische Kenntnisse habe, und 42 diese Frage bald bejahend, bald verneinend beantwortet. — Gegen die Bejahung lässt sich allerdings sagen, dass der Richter seine Privatansicht durchaus nicht in die Wagschale legen dürfe. Hat aber der Richter medizinische Kenntnisse, so hat er auch nothwendig eine Privatmeinung über die medizinische Bedeutung eines Falles, er kann also in die Lage kommen, in dem Falle, wo die Meinung der Kunstverständigen gegen seine Ansicht ist, zwischen seiner Ansicht und jener der Kunstverständigen eine Wahl treffen zu müssen, und da nicht leicht jemand seine Ueberzeugung gegen die eines Andern aufgibt, so kann ein solches Wissen schädlich auf die objektive Richtigkeit seines Urtheils wirken, besonders wenn seine Ansicht falsch, jene der Kunstverständigen aber die richtige wäre.
Eben so kann man für die Behauptung anführen, dass der Richter, welcher medizinische Kenntnisse besitzt, sehr leicht veranlasst werden kann, bei der Erhebung dasjenige herauszustellen, was eben in seinem Gesichtskreise liegt, und dasjenige, welches darin nicht gelegen ist, oder ihm unbedeutend scheint, unberücksichtigt zu lassen, welches bei mangelhaften Kenntnissen sehr leicht Irrthümer und Lücken in der Erhebung herbeiführen kann.
Beide Einwürfe kommen mir jedoch nicht sehr grundhältig vor, da sie viel zu viel beweisen. Was nämlich vom medizinischen Wissen des Richters gilt, gilt überhaupt von jedem Wissen desselben; es würde daher, wenn dieser Satz wahr wäre, folgen, dass der Richter in seinem Gewissen verpflichtet sei, sich jedes Wissens mit Ausnahme jenes der Gesetze zu enthalten! — denn überall können ihm Fälle vorkommen, wo sein Wissen mit irgend einer Ansicht von Kunstverständigen kollidirt. Nun möchte man wohl fragen, ob man es im Ernste für möglich halte, dass Jemand die Gesetze praktisch anwende, wenn er nicht in die Natur der möglichen Fälle eingeht. Ein solcher Richter wäre beiläufig wie ein Geometer, der nur mit Wasserwage und Masskette zu nivelliren verstände, aber gar kein Augenmass hätte. Dies ist nun wohl ein undenkbares Wesen, — eben so wenig kann man sich aber einen seinem Berufe entsprechenden Richter denken, welcher, wenn er ein Gesetz, besonders aber ein Strafgesetz anzuwenden hat, nicht von dem Aktentische aufsähe, wenn der Gegenstand, um den es sich handelt, vor ihm liegt, um sich zu überzeugen, ob denn dasjenige, was im Akte steht, nach dem Zeugnisse seiner eigenen Sinne auch wirklich vorhanden, und nicht etwa anders beschaffen sei, als die Akten besagen.
43 Was das Augenmass für Jeden ist, welcher über eine Entfernung zu urtheilen hat, ist das eigene praktische Wissen für Jeden, welcher über ein Verhältniss einer Thatsache zum Gesetze zu urtheilen hat; man wird weniger durch eine falsche Berechnung einer Entfernung getäuscht, wenn man neben der geometrischen Berechnung noch das Augenmass anwendet. — Ebenso geht es dem Richter, wenn er sein, durch sie erworbenes Wissen geschärftes Beobachtungsvermögen anwendend, seine Beobachtung mit jener der Aerzte vergleicht, — er wird sie nicht minder giltig finden, wenn sie richtig ist, und er wird dadurch wesentlich beitragen, den Irrthum zu entdecken, wenn sie unrichtig war, und wenn er, wie er es in seiner ämtlichen Stellung gar nicht anders kann, keinen anderen Gebrauch von seinem Wissen macht, als dass er dort, wo ihm ein Zweifel gegen das ärztliche Gutachten aufstösst, die Behebung dieses Zweifels verlangt, so ist in der That nicht einzusehen, welcher Nachtheil hieraus für die Gerichtspflege entstehen solle.
Eben so gewiss ist es aber, dass es für einen Richter, welcher viel mit gerichtlich medizinischen Geschäften zu thun hat, rein unmöglich ist, nicht unwillkürlich einige Kenntnisse dieser Art anzunehmen. Wer daher von einem praktisch geübten Richter im Ernst verlangt, er dürfe nicht wissen, wo der Magen oder die Milz liegt, oder dass nach einer Gehirnerschütterung ein Extravasat sich bilden könne, oder dass es eine tödtliche Verletzung sei, wenn etwa Jemanden der Kopf abgeschnitten wird, fordert geradezu etwas Unmögliches.
Da somit eine gänzliche Unwissenheit in medizinischen Sachen bei dem Richter unter die Unmöglichkeiten gehört, ein unvollkommenes, und noch mehr ein falsches Wissen aber unter allen denkbaren Fällen schädlicher ist, als ein gänzliches Nichtwissen, weil es immerhin zu ungegründeten Zweifeln Anlass gibt, so kann man das Bestreben der neueren Zeit, dass auch Rechtskundige sich gründliche und umfassende medizinische Kenntnisse zu erwerben suchen, gewiss nur loben, da es in manchen Fällen dahin führen kann, dass ein Irrthum, wo nicht in der Sache, doch in dem Ausdrucke, welcher doch gewiss nicht unmöglich ist, bemerkt, und ohne Nachtheil für die Rechtspflege berichtiget wird.
Diese Ansicht der Sache darf uns aber nicht abhalten, auch die Schattenseite, welche diese Studien in Praxi haben können, zu beleuchten, 44 sie liegt nämlich darin, dass mancher Inquirent dadurch in Versuchung geräth, entweder den Arzt nicht zu rufen, wo er hingehört, oder mit dem herbeigerufenen Arzte, wenn dieser mit ihm verschiedener Meinung ist, sich in einen medizinischen Disput einzulassen, welcher, wenn beide Theile etwas lebhaften Temperaments sind, sehr leicht in eine andere Art des Streites übergeht, in jedem Falle aber sehr unnütz ist, oder endlich, wenn er sich einem etwa noch minder seiner Sache gewachsenen, oder einem charakterschwachen Arzte oder Chirurgen gegenüber befindet, diesen zu einer Ansicht bestimmen kann, nach welcher er, wo nicht gegen seine Ueberzeugung, doch aber ohne sich wirklich eine Ueberzeugung gebildet zu haben, in die richterliche Ansicht, aus übelverstandener Deferenz, einstimmt.
Dies kann geschehen; es muss sich daher jeder angehende Richter, welcher medizinische Studien beginnt, zum unverbrüchlichen Grundsatze machen, Alles zu vermeiden, was zu einem oder dem andern der bemerkten Uebelstände führen könne. Er muss daher seine gewonnenen medizinischen Kenntnisse dahin anwenden, um
1. bei jedem Falle, wo ihm seine gemachten Studien die Möglichkeit erscheinen lassen, dass die Sache medizinische Kenntnisse erfordere, sogleich den Arzt beizuziehen, damit nicht etwas, welches erhoben werden soll, unerhoben, oder, was dasselbe ist, auf eine incompetente Art erhoben bleibe, denn ob der Richter über die medizinische Eigenschaft richtig urtheilt, ist für einen Dritten nur dann gewiss, wenn auch der Arzt hiermit übereinstimmt.
Er wird
2. dort, wo der Arzt ein nach seiner Meinung irriges Urtheil abgibt, vor Allem darauf sehen, ob auch alle Umstände, welche er, der Richter, für erheblich hält, vom Arzte berücksichtigt wurden, und wo dies nicht der Fall ist, deren Berücksichtigung verlangen, welches ohne allen Streit durch Aufstellung passender Fragen, zu deren zweckmässiger Stellung ihm gerade seine medizinischen Kenntnisse vorzüglich behilflich sein werden, geschehen kann und muss; er wird ferner auf gleiche Weise bemüht sein, zu entdecken, ob der Arzt nicht Umstände berücksichtigt und darauf sein Gutachten gegründet habe, welche ihm, dem Richter, entgangen sind, sonach aber darauf hinwirken, dass diese Umstände auch im Befunde gehörig hervorgehoben werden, ein Verfahren, zu dessen zweckmässiger Einleitung ebenfalls medizinische Kenntnisse von sehr wesentlichem Nutzen sein werden.
45 Sollte er sich demungeachtet mit der Ansicht des Arztes nicht vereinigen können, so wird er seine Bedenken mit Hilfe der erworbenen Kenntnisse schriftlich ausdrücken und hierüber Aufklärung verlangen, und erfolgt auch dann noch keine ihm genügende Aeusserung, das Gutachten der medizinischen Fakultät einzuholen wissen.
Befindet er sich jedoch
3. einem minder Bewanderten oder des Ausdruckes minder mächtigen Kunstverständigen gegenüber, so wird er mit Hilfenahme seiner medizinischen Kenntnisse dahin wirken, dass dieser nichts übersieht, und ihn entweder durch mündliche Bemerkungen oder durch passend gestellte Fragen schriftlich auf das zu beachten Nöthige aufmerksam machen, vorzugsweise aber darauf sehen, dass der Kunstverständige sich nicht durch etwa früher erhobene Umstände, als Zeugenaussagen u. dgl. irre machen lasse, sich an die objektiven Ergebnisse der Erhebung zu halten; dort aber, wo er gewahrt, dass der Arzt nur aus mangelhafter Bekanntschaft mit der rechtlichen Bedeutung seiner Ausdrücke einen unpassenden wählt, einem solchen Anstande dadurch begegnen, dass er den Kunstverständigen aufmerksam macht, worin das Unpassende liege und wie es heissen sollte13. Gewähren ihm aber seine erworbenen Kenntnisse die Ueberzeugung, dass die etwa zufällig in Abwesenheit des ordentlichen Kreis- und Bezirksarztes beigezogene Sanitätsperson in der That ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist, so wird er dadurch sich in die Lage gesetzt finden, noch bei Zeiten dem Uebel zu begegnen, welches bei einem zu einer solchen Amtshandlung nicht befähigten Kunstverständigen zu besorgen stünde.
46 Im Allgemeinen kann es einem Arzte, welcher sich dem Staatsdienste widmet, nie genug anempfohlen werden, sich mit den Gesetzen, zu deren Anwendung er mitzuwirken berufen ist, vertraut zu machen. Es ist dies nicht nur ein Vortheil für das Gericht, mit welchem er eben zu thun hat, sondern eine wesentliche Pflicht seines ihm vom Staate verliehenen Amtes, von welcher ihn nichts dispensiren kann, denn Jeder, welcher ein Amt übernimmt, ist verpflichtet, sich in jeder Beziehung zur entsprechendsten Ausübung desselben zu qualifiziren. Der Umstand, dass er keine juridischen Studien gemacht hat, enthebt ihn keineswegs der Verbindlichkeit, sich diejenigen Gesetze eigen zu machen, deren Nichtkenntniss einen Nachtheil in seiner ämtlichen Leistung herbeiführen könnte. So wenig sich daher der angestellte Arzt entschlagen kann, diejenigen Verordnungen zu kennen und sich darnach zu richten, welche vorschreiben, wie die Ausweise bei Epidemien, bei Impfungen u. dgl. zu machen sind, obwohl auch über diese Verordnungen keine besonderen Vorlesungen gehalten werden, so wenig darf der Arzt die Mühe scheuen, die auf sein Fach Bezug nehmenden Justizgesetze zu studiren, ein Studium, ohne welches ihm wahrscheinlich, ungeachtet aller Bemühungen des Richters, mündlich oder schriftlich auf die Verfassung eines entsprechenden Gutachtens hinzuwirken, nicht gelingen wird, den Ansprüchen, welche der Staat mit Recht an ihn stellt, zu genügen, denn es ist dem Richter nicht möglich, dem intervenirenden Arzte in dem vorkommenden Falle sogleich alle jene Begriffe zu geben, welche nur die Frucht eines zwar weder schwierigen noch weitläufigen, aber doch eines solchen Studiums sind, welches man sich aber auch nicht ohne eigenes ernstliches und selbstthätiges Mitwirken erwerben kann, da dessen Frucht eine doch nicht ganz unbedeutende Zahl Begriffe sind, deren klare Auffassung man sich unmöglich nur so im Vorbeigehen aneignet, welche aber noch weniger ohne eigenes Studium zu der zum Zwecke der Amtshandlung unumgänglichen Klarheit gebracht werden können.
Nur das Studium der Gesetze kann aber zu dieser Klarheit führen, das Lesen von gerichtlichen Gutachten allein, ohne das vorausgegangene Studium, wird nie vollkommen zu diesem Ziele führen, denn je sachgemässer ein Gutachten ist, um so mehr hat es das Ansehen, 47 als hätte es gar nicht anders gegeben werden können; der Gerichtsarzt, welcher daher dadurch zu der Ansicht verleitet würde, er dürfe sich bei einem vorkommenden Falle nur ein in einem ähnlichen Falle abgegebenes Gutachten aufschlagen und diesem nachschreiben, steht in Gefahr, auf eine sehr unangenehme Weise daran erinnert zu werden, dass der Satz: duo quum faciunt idem non semper est idem, keine Ausnahme leide. Ein Ausdruck, der in dem als Muster dienenden Gutachten sehr an seinem Platze ist, ist oft ganz verkehrt, und gibt zu sehr nachtheiligen Missverständnissen Anlass, wenn er in einem andern Gutachten angebracht wird, denn ein Umstand, welcher in dem als Muster dienenden Befunde nicht erwähnt ist, weil er nicht vorhanden war, oder welcher durch sein Vorhandensein den Ausdruck veranlasste, in dem vorliegenden Falle aber nicht vorhanden ist, macht oft eine ganz verschiedene Wendung des Ausdruckes nothwendig.
Weit entfernt, durch die gegenwärtige Schrift etwas anderes erzwecken zu wollen, als meine verehrten Leser auf den innigen Zusammenhang zwischen der positiven Gesetzgebung und der gerichtlichen Arzneikunde aufmerksam zu machen, glaube ich daher der Rechtspflege einen Dienst zu erweisen, indem ich dem verehrten Leser durch einige praktische Abhandlungen den innigen Zusammenhang beider Wissenschaften anschaulich zu machen bestrebt war, um dadurch zur richtigen Auffassung der dem Arzte obliegenden selbstständigen Aufgabe zu führen.
Die dargestellten Fälle haben daher nicht im Mindesten den Zweck, in irgend einer Beziehung als Formularien zu dienen, denn ein solches Beginnen ist nach meiner Ansicht eine Satyre auf die Wissenschaft; wo ich mir aber — wie bei den Fällen des Raufhandels und bei ein paar Fällen des Kindesmordes und der Vergiftung — solche Formularien aufzustellen erlaubte, geschah es nur darum, um bestimmt auszudrücken, welche Merkmale nicht übersehen werden dürfen, wenn das Gutachten seinem Zwecke entsprechen soll, nicht aber um einer sachgemässen, selbstständigen Auffassung der objektiven Erscheinung hemmend entgegenzutreten.
Seiner Bestimmung nach zerfällt übrigens das gegenwärtige Werk in zwei Abtheilungen, wovon die erste diejenigen Grundsätze darstellt, welche bei Erhebung von Gemüthszuständen in Bezug auf Verbrechen in rechtlicher Beziehung beobachtet werden müssen, die zweite Abtheilung aber diejenigen Grundsätze entwickelt, welche bei der Erhebung einzelner, die gerichtliche Arzneiwissenschaft berührender Verhältnisse in gerichtlich-medizinischer 48 Beziehung zu beobachten nothwendig sind. Das Erste ist Gegenstand des ersten, das Zweite Gegenstand des zweiten Theils, und ich glaube nur die Bemerkung beifügen zu müssen, dass der verehrte Leser von diesem Werke um so mehr Nutzen zu erwarten hat, je geläufiger ihm die bestehenden Gesetze sind; den Mangel an eigenem Studium dieser Art vermag dieses Buch so wenig, als irgend ein Buch in der Welt, zu ersetzen; die Mittel zu diesem Studium enthält mein in der Vorrede erwähntes „Handbuch der gerichtsarzneilichen Wissenschaft.”
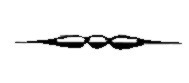
I. Abtheilung.
Ueber die gerichtlich-medizinische Erhebung von Gemüthszuständen.
Willst Du die Andern versteh'n, blick' in Dein eigenes Herz.
Schiller.
Die gerichtliche Erhebung des Irrsinnes ist ohne Zuziehung ärztlicher Personen nicht möglich. — Dieser Satz bedarf keines Beweises, da man darüber längst einig ist. — Zweifelhaft kann es aber sein, wie weit die Kompetenz des Richters und jene des Arztes dabei zu gehen habe. Um nun hierüber zu einer entscheidenden Ansicht zu gelangen, muss man sich vor Allem über die Bedeutung gewisser Vorbegriffe vereinigen, welche sich sowohl durch den Zweck der Erhebung, als auch durch die Natur der Sache darstellen, und eben aus dem Grunde, weil sie sowohl für den Arzt, als für den Richter mehr oder weniger wahrnehmbar sind, die Basis zu bilden geeignet erscheinen, aus welcher sich sowohl die gegenseitige Stellung, als die Art und Weise, wie die Einschreitung des einen oder des andern Theiles zu geschehen habe, und wie weit jeder Theil hierin zu gehen berechtigt und verpflichtet sei, begründen lässt.
Um diese Grundlage weiterer Argumentation richtig zu bestimmen, erlaube ich mir auf folgende Verhältnisse aufmerksam zu machen.
Es gibt keine Wissenschaft, welche nicht in einigen ihrer Grundprinzipien auf die Erfahrungen des gemeinen Lebens gegründet wäre, selbst die Astronomie oder die höhere Mathematik macht hievon keine Ausnahme; so lässt es sich nicht läugnen, dass die praktische Kenntniss und Anschauung der im Einmaleins enthaltenen Sätze eben so gut die Grundlage der Resultate astronomischer Berechnungen ist, als sie einer gewöhnlichen Küchenrechnung als Grundlage dienen wird.
Diejenigen Resultate, welche sich daher lediglich durch die Kenntnisse des Einmaleins beurtheilen lassen, sind nun eben darum eben so dem mit den Regeln der Astronomie ganz unbekannten Menschen, als dem Mathematiker oder Astronomen in Bezug auf ihre Richtigkeit zu beurtheilen möglich.
52 Der Unterschied zwischen der wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Beurteilung einer Sache liegt daher nicht darin, dass der nicht wissenschaftlich Gebildete nicht in einzelnen Fällen eben so sicher dasselbe Resultat erreichen kann, als der wissenschaftlich Gebildete, sondern die Ueberlegenheit des wissenschaftlich Gebildeten über den nicht wissenschaftlich Gebildeten wird sich vielmehr dadurch kundgeben, dass der wissenschaftlich Gebildete durch die im Wege des Studiums erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten einen schärferen Blick besitzt, als der nicht Gebildete, und dass er daher auch mehr Eigenschaften in der Sache entdecken wird, als der Andere; ferner darin, dass er gegen einen möglichen, durch Unrichtigkeit in der Beobachtung, oder durch unrichtige Anwendung von Prämissen in der durch diese Beobachtung erhaltenen Schlussfolge eintretenden Irrthum mehr geschützt ist, als der Erstere. — Die Wissenschaft ist für die Richtigkeit des Resultates der angestellten Beobachtungen dasjenige, was das Fernglas für den Beobachter ist, man braucht das Fernglas nicht nur, um Gegenstände zu entdecken, welche ausser dem Bereiche des Auges sind, sondern man sieht auch dann durch ein Fernglas, wenn man den Gegenstand schon mit freiem Auge erkannt hat, und man nur wissen will, ob man nicht etwa von einer Täuschung befangen ist, oder sonst etwas an dem Gegenstande vorhanden sei, was man mit freiem Auge nicht gewahren konnte.
In jedem Falle kann jedoch, wie bereits in dem ersten Aufsatze dieses Werkes nachgewiesen wurde, einem Urtheile, es mag nun auf einer wissenschaftlich angestellten Forschung beruhen oder nicht, nur dann eine strafrechtliche Folge gegeben werden, wenn über die objektive Richtigkeit desselben die rechtliche Gewissheit vorhanden ist.
Was nun die medizinische Wissenschaft betrifft, so lässt sich von derselben noch weniger, als von anderen Wissenschaften behaupten, dass sie in allen ihren Zweigen und Ergebnissen dem Laien ganz fremd sei, sondern es muss als bekannt angenommen werden, dass Manches, welches dem Arzte durch gewisse Lehrvorträge eröffnet wird, dem Laien eben so gut und eben so sicher bekannt ist. Jeder Mensch weiss, und zwar Derjenige, welcher etwa einige Stunden lang bei heftigem Winde auf einer sehr staubenden Strasse gehen musste, gewiss mit eben solcher Zuverlässigkeit, als nur irgend ein Arzt es wissen kann, dass Staub den Augen sehr unangenehm und schädlich ist.
53 Da nun jeder denkende Mensch auch in der Lage ist, durch Anstellung von Vergleichungen u. s. w. sich gewisse Regeln zu abstrahiren, welche, sofern die Erfahrungen, auf welchen sie beruhen, richtig sind, ebenfalls richtig sein werden, so lässt sich nicht läugnen, dass jeder Mensch, besonders wenn er selbst schon krank war oder andere Kranke zu besorgen hatte, nicht nur ein gegründetes Interesse an derlei Erfahrungen nehmen, sondern auch dahin kommen werde, seine eigene Pathologie und seine eigene materia medica über manche Gegenstände zu bilden, an welchen auch der wirkliche Arzt nicht Alles falsch und nicht Alles mangelhaft finden würde.
Was von der medizinischen Wissenschaft im Verhältnisse zum Nichtarzt im Allgemeinen gilt, leidet seine volle Anwendung auch auf die Beurtheilung von Seelenzuständen. So wie es nämlich offenbar zu viel gesagt wäre, nur ein Arzt könne in allen Fällen einen Gesunden von einem Kranken unterscheiden, so gibt es auch Fälle, in welchen jeder Laie sich mit Gewissheit überzeugt hält, dieser oder jener Mensch sei ein Narr, oder er sei vernünftig. Zeigt mancher Narr sich auf der Gasse, so lauft der Gassenpöbel hinterd'rein, und würde man fragen, so würden sie als Kennzeichen angeben: weil er konfus spricht und handelt, sein Blick verwirrt ist, und dergleichen Merkmale, welche als charakteristische Kennzeichen anzugeben auch ein Arzt kein Bedenken tragen würde.
Wenn es daher als eine ausgemachte Sache zu betrachten kommt, dass die gerichtliche Erhebung des Irrsinns nicht ohne Arzt Statt finden dürfe, so kann und darf dies nicht so viel sagen, als es könne und dürfe von dem Richter nicht vorausgesetzt werden, dass er im Stande sei, einen Narren von einem vernünftigen Menschen zu unterscheiden, sondern der Zweck dieser Beiziehung kann nur darin liegen: 1. in zweifelhaften Fällen durch Anwendung von wissenschaftlichen Kenntnissen, welche dem Richter mangeln, über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Wahnsinnes Gewissheit zu erhalten; 2. sich zu versichern, ob auch die Beobachtungen und Ansichten des Richters die Probe einer wissenschaftlichen Forschung bestehen, und ob nicht 3. durch die nach wissenschaftlichen Prinzipien angestellten Forschungen noch Erscheinungen beobachtet werden, welche dem Richter entgangen und von irgend einem Einflusse auf die Untersuchung und Entscheidung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Irrsinnes sein können.
54 Hieraus ergibt sich nun im Allgemeinen, dass dort, wo es sich um Erhebung des Wahnsinnes handelt, der Richter weder berechtigt noch verpflichtet sei, gegen das Zeugniss seiner eigenen Beobachtung nach dem Ausspruche der Aerzte Jemanden als wahnsinnig oder als vernünftig anzunehmen, sondern dass, wo ihm ein Zweifel gegen die von den Aerzten ausgesprochene Ansicht aufstösst, er vor Allem von ihnen verlangen und erwarten müsse, dass sie diesen Zweifel lösen, d. h. den Irrthum, welcher diesem Zweifel zu Grunde liegt, nachweisen, denn so lange irgend ein Zweifel gegen den Ausspruch der Aerzte besteht, muss angenommen werden, dass irgend ein Missverständniss obwaltet, und ein Missverständniss darf wohl nicht die Grundlage einer richterlichen Entscheidung sein.
Damit ist nun wohl nicht gesagt, dass die Aerzte auch die Pflicht haben, in jedem Falle den Richter, d. i. die Person des Richters zu überzeugen, sondern die Person des Richters muss ganz ausser dem Spiele bleiben, und die Aeusserung des Arztes darf nicht um eine Sylbe anders lauten, wenn ein anerkannter geistreicher Mann das Richteramt ausübt, als wenn nach der Ueberzeugung des Arztes dieses nicht der Fall ist; sondern der Arzt hat seine Pflicht vollkommen erfüllt, wenn er die Thatsachen oder die Axiomen, welche ihm seine Wissenschaft an die Hand gibt, in einer klaren Weise darstellt und sowohl seine Meinung überhaupt, als dasjenige, welches er zur Berichtigung der vom Richter etwa aufgeworfenen Bedenken anzuführen für nöthig erachtet, erörtert, und mit logisch-richtigen Schlussfolgen hierauf seine Widerlegung oder Berichtigung begründet.
Der Richter selbst kann aber dasjenige, welches den Grundsätzen der Wissenschaft gemäss entwickelt ist, nur insofern zweifelhaft finden, als er Gründe hat, anzunehmen, dass entweder dasjenige, welches der Arzt ihm als einen Grundsatz der Wissenschaft dargestellt hat, kein Grundsatz der Wissenschaft sei, d. h. insofern er Gründe hat, anzunehmen, dass der Arzt, sei es nun wegen nicht hinlänglicher praktischer Uebung oder aus einem andern Grunde, nicht hinlänglich tief seine Wissenschaft aufgefasst habe, oder dass der Arzt in facto nicht hinreichend klar sei.
In beiden Voraussetzungen ist der Richter, wo sich Gründe dazu darbieten, nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, die Behebung seiner Bedenken zu verlangen, denn es wäre wohl eine nicht 55 zu rechtfertigende Deferenz für die Person des Arztes, wenn auch in dem Falle, wo dieser einen unrichtigen Ausspruch gethan hat, auf den Grund dieses Ausspruches, obwohl er unrichtig ist, eine Strafe gegen einen Beschuldigten erkannt, oder sonst eine Ungerechtigkeit begangen werden sollte, und wenn in einem solchen Falle der Richter nicht berechtigt sein sollte, dort, wo er wirklich Gründe hat, den ärztlichen Ausspruch für unrichtig zu halten, die Beseitigung dieses Zweifels zu veranlassen.
Um daher nicht schon Gesagtes zu wiederholen, wird sich auf dasjenige, welches in dem ersten Aufsatze dieser Schrift, §. 3 u. s. w., über die Verfassung gerichtlicher Gutachten gesagt wurde, bezogen, so wie überhaupt alles dort Angeführte auf die Begutachtung des Wahnsinnes in gerichtlichen Fällen überhaupt volle Anwendung leidet.
Gemüthszustände sind nun überhaupt solche aus der menschlichen Natur hervorgehende Zustände, zu deren Beurtheilung daher Jeder einen Schlüssel besitzt, welcher, gehörig benützt, einem Jeden viele Gemächer dieser wundervollen Welt aufschliesst; es ist dies der Schlüssel, von welchem Schiller sagt:
Es ist der Weg der Selbstkenntniss und der Beobachtung Anderer, welcher zuverlässig sehr weit führt, auf welchem sehr viele Resultate gewonnen werden können, und ohne welchen alle Wissenschaften zusammen genommen, nie ein entsprechendes Resultat herbeiführen, ja man kann sagen, ohne welchen überhaupt kein Verständniss menschlicher Zustände möglich ist. Dieses Eingehen in das Innere menschlicher Zustände ist somit in allen Fällen, wo nicht besondere, auf das Vorhandensein einer ganz abnormen Stimmung deutende Umstände vorkommen, nicht nur ein Befugniss des Richters, sondern dessen unbedingte Pflicht, denn wo es sich um nichts weiter handelt, als die Motive einer That oder die Ausbrüche gewöhnlicher Leidenschaften zu erforschen, hat noch Niemand an der Kompetenz des Richters gezweifelt.
Aber auch dort, wo die Gemüthsstimmung, welche eine That begleitet, eine ungewöhnliche genannt werden muss, lässt sich nicht alle Kompetenz des Richters in Abrede stellen, denn immer bleibt dem Richter das Urtheil über die Zurechnungsfähigkeit des Menschen in Bezug auf eine gewisse That überlassen, da er im Strafverfahren mindestens das Urtheil zu sprechen hat, ob die That aus bösem 56 Vorsatze entsprungen ist, welches ohne tieferes Eingehen in die inneren Zustände nicht möglich ist; auch muss der Richter doch so viel von Gemüthszuständen verstehen, um beurtheilen zu können, ob und wann er eine ärztliche Untersuchung über einen Inquisiten einleiten soll und muss, und dazu gehört jedenfalls einige Kenntniss der Merkmale vorhandener Seelenstörungen.
Man kann daher im Allgemeinen sagen, dem Richter müsse so viel Kompetenz des Urtheils über Gemüthszustände zugetraut werden, dass dort, wo es ihm gelingt, die That oder das Benehmen des Beschuldigten auf rein menschliche Motive zurückzuführen, er auch nicht verpflichtet sei, eine ärztliche Untersuchung des Geisteszustandes eines Inquisiten zu veranlassen; waltet aber ein Zweifel ob, ob auch die vom Richter gelieferte Nachweisung vollkommen richtig sei, oder stellt sich die Möglichkeit dar, dass irgend ein krankhafter oder sonst anomaler Zustand auf die Verübung der That eingewirkt haben könne, so ist es nicht mehr blos räthlich, sondern absolut nothwendig, dass die ärztliche Untersuchung eintrete, denn um den Einfluss eines solchen Zustandes auf einen bestimmten Akt der Thätigkeit eines Menschen zu beurtheilen, genügen nicht mehr die aus einer, wenn auch geläuterten Lebensansicht gewonnenen Resultate, sondern es gehören hierzu spezielle Kenntnisse, und zwar nicht blos über menschliche Geisteszustände überhaupt, sondern es gehört Alles dazu, wodurch der Beobachter in die Lage gesetzt wird, über Krankheitszustände zu urtheilen, also Anatomie, Physiologie und Pathologie überhaupt, und spezielle Erfahrungen über denjenigen Zustand der Krankheit, welche sich durch Geistesverwirrung ausspricht, eine Kenntniss, welche selbst nicht jeder Arzt, sondern nur Derjenige im hinreichenden Grade zu besitzen vermag, welcher derlei Zustände zum besonderen Gegenstande seines Studiums macht — es ist also klar, dass solche Kenntnisse niemals bei dem Richter vorausgesetzt werden dürfen.
Die Stellung des Arztes zum Richter ist jedoch auch in diesem Falle keine solche, wie jene eines Dolmetschers, welcher eine Urkunde übersetzt, welche in einer dem Richter ganz fremden Sprache geschrieben ist, denn es lässt sich nicht verkennen, dass der Richter Vieles von Demjenigen, wodurch sich der abnorme Zustand des Untersuchten charakterisirt, nicht nur selbst wahrnehmen, sondern, sofern die durch eigenes Nachdenken über die menschliche Natur und eigene Lebenserfahrung gewonnene Anschauung dazu hinreicht, Vieles auch richtig 57 auffassen werde, welches zur richtigen Beurtheilung eines solchen Zustandes gehört.
Soll nun der Richter die Ueberzeugung erlangen, dass der Ausspruch des Arztes auch in solchen Beziehungen, welche dem Richter fremd sind, richtig sei, so muss er vorerst die Bemerkung machen können, dass der ihm bekannte Theil des in Frage stehenden Zustandes von dem Arzte richtig aufgefasst und beurtheilt worden sei.
Damit nun die Darstellung des Arztes ihrem Zwecke entspreche, muss sie daher nicht nur auf richtigen und umfassend medizinisch-wissenschaftlichen Gründen beruhen, sondern sie muss sich auch den bei dem Richter vorhandenen, aus der praktischen Lebensanschauung gewonnenen Begriffen anschliessen, und zu diesem Zwecke ist es nothwendig, dass der Arzt eine genaue und richtige Ansicht von jenen Begriffen habe, welche bei dem Richter, welcher keine medizinischen, wohl aber solche Kenntnisse besitzt, die aus der praktischen Lebensanschauung entnommen werden, vorhanden sein können und vorhanden sein sollen (§§. 7 und 8 des vorigen Aufsatzes).
Um den Arzt in Kenntniss zu setzen, wie weit die Einsicht des Richters in dieser Beziehung gehen könne und dürfe, scheint es nun zweckmässig, darzulegen, welche Ansichten eine blos auf menschliche Erfahrungen, mit Ausschluss eigentlicher medizinisch-wissenschaftlicher Studien gegründete Beobachtung zu geben vermag, eine Darstellung, welche zugleich den Vortheil gewährt, in ihren Ergebnissen als gemeinschaftliches Gut vom Richter und Arzte benützt werden zu können.
Das Symptom, durch welches sich der Irrsinn für jeden Menschen, somit insbesondere für den Nichtarzt, darstellt und sich dadurch von andern Krankheitszuständen unterscheidet, ist eine Thätigkeit oder auch eine Unthätigkeit des Menschen, welche dessen gewöhnlichem Begehrungsvermögen im Verhältniss zu den von Aussen kommenden Anregungen nicht entspricht.
58 Es ist möglich und wohl auch gewiss, dass die ärztliche Wissenschaft noch andere, und wohl auch zuverlässigere Kennzeichen auffindet, allein für den Nichtarzt, unter welche Klasse entschieden auch der Richter gehört, gibt es keine andere Veranlassung, bei einem Individuum den Irrsinn zu vermuthen, als das Vorhandensein dieses Symptoms, und es wird nur immer ein glücklicher Zufall sein, wenn das mit einem solchen, sich auf diese Art nicht aussprechenden, Zustande behaftete Individuum einem solchen Arzte begegnet, welcher ohne durch dieses Symptom aufmerksam gemacht worden zu sein, bei demselben das Vorhandensein des Irrsinnes zu entdecken vermag.
Da jedoch kein anderes Merkmal sich dem Nichtarzte als wahrnehmbar darstellt, als die abnorme Thätigkeit des Individuums in der Aussenwelt, so muss in der gegenwärtigen Abhandlung gerade dieses Merkmal vorzugsweise berücksichtiget werden.
Nicht jedes, wenn auch sonst ganz widersinniges, Verhalten eines Menschen gegen seine Umgebung ist jedoch darum ein Beweis, und daher auch ein Symptom des Irrsinnes. Erziehung, Lebensweise, Launen, Vorurtheil bewirken, obwohl ihre Veranlassung in ganz reellen Einwirkungen ihrer Umgebung gelegen ist, oft eine solche Abweichung von dem Benehmen anderer Menschen, dass die dadurch herbeigeführten Handlungen gänzlich jenen eines Irrsinnigen gleichen, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht sind. — Zu solchen Erscheinungen gehören die Kontraste, welche die Sitten verschiedener Völker hervorbringen. Ein Beduinen-Araber würde die Frage nach dem Befinden seiner Frau Gemahlin für einen Schimpf halten, welcher nur mit dem Blute des Fragers und seiner Verwandten ausgewaschen werden könnte, während mancher Europäer in der Unterlassung dieser Frage nur einen Mangel an Theilnahme oder an Höflichkeit erblickt.
Eben so gibt es Gemüthsstimmungen, welche an und für sich nicht unnatürlich, sondern im Gegentheile gerade das Produkt einer Thätigkeit des Geistes sind, die für den Menschen sehr ehrenvoll ist, dabei aber ihn zu äusseren Thätigkeiten veranlassen, welche für den Dritten, welcher von dem, welches in dem Innern des Erstern vorgeht, keine Ahnung hat, wie ein Produkt des Wahnsinnes erscheinen. — So soll Ritter Gluck, als er auf freiem Felde den Furientanz zur „Iphigenia auf Tauris” komponirte, von einigen Bauern eingefangen und auf das Amthaus geführt 59 worden sein, weil er während des Komponirens taktmässige Sprünge machte.
Was Laune vermag, ist so ziemlich allgemein bekannt. Es ist dies der Zustand, in welchem den Menschen die Lust anwandelt, sich in dem Diorama seiner Phantasiegemälde einmal wirklich zu ergehen. Ich kannte persönlich einen jungen Mann, welcher, als ihm von seinen Eltern eine Parthie Kerzen geschickt wurden, die ihm zu seinen winterlichen Studien dienen sollten, nichts Eiligeres zu thun hatte, als die Läden zu schliessen und sich mit Verwendung des ganzen Vorrathes eine splendide Beleuchtung zu verschaffen. Der junge Mann war übrigens in seinem Fache ausgezeichnet, und nichts weniger als geisteszerrüttet.
Die Regel bleibt jedoch immer, dass der Mensch dasjenige, welches er gethan hat oder thun werde, auch beschlossen habe oder beschliessen werde, dass er daher für alle ihm möglicher Weise erkennbaren Folgen seiner Handlungen verantwortlich, und wo ein Strafgesetz auf eine solche Folge eine Strafe setzt, auch strafbar bleibe. — Hat ein Mensch keine Handlung begangen, welche in diese Kategorie gehört, so ist — sein Geisteszustand mag wie immer beschaffen sein — von einer strafrechtlichen Untersuchung und daher auch von keiner Erhebung des Irrsinnes im Wege des Strafverfahrens die Rede; erst wenn er eine solche Handlung begangen hat, tritt das Strafverfahren ein, und dieses wird zum Zwecke haben, zu erheben, ob er dasjenige, welches er gethan, auch beschlossen, oder aber aus bösem Vorsatze gehandelt habe.
Obwohl nun die Rechtsverletzung, welche der Mensch begangen hat, schon an und für sich eine Irregulärität, nämlich eine Abweichung von den Regeln der Sittlichkeit oder des Rechtes ist, denen er als vernünftiger Mensch gehorchen soll, so wird hierdurch die Voraussetzung, dass ein Mensch aus bösem Vorsatze, und daher strafbar, gehandelt habe, nicht ausgeschlossen.
Von der andern Seite lässt sich nicht verkennen, dass eine irreguläre Thätigkeit im Aeussern auch durch eine Irregulärität der innern Funktionen entstanden sein kann. Wo also diese Möglichkeit des Ursprunges einer äusseren irregulären Thätigkeit durch eine irreguläre innere Funktion nicht schon durch die richterliche Erfahrung sogleich von selbst zerfällt, muss das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieses letzten Umstandes besonders nachgewiesen werden.
60 Es ist daher im Strafrechte gerade das Verhältniss zwischen der inneren zur äusseren Thätigkeit, welches durch die gerichtliche Erhebung ausgemittelt, und dadurch richtiggestellt werden muss, ob die in Frage stehende irreguläre äussere Thätigkeit nur durch die Irregulärität im Innern veranlasst sei, oder von welchem Einflusse die sonstigen nicht normalen inneren Thätigkeiten des Menschen darauf gewesen sind.
Der Umstand, dass von Jemand wegen Störungen im Innern schädliche Handlungen zu besorgen sind, gehört nicht in das Strafrecht.
Um nun hier nicht irre zu gehen, und sich nicht durch eine Aufstellung verschiedener Begriffe Missverständnisse zu bereiten, muss man sich vor Allem klar machen, was man sich unter den inneren Funktionen eigentlich denke, denn wenn der eine etwa unter Vernunft dasjenige sich denkt, was der andere Verstand nennt u. s. w., so kann man unmöglich zurecht kommen.
Ueberhaupt haben die Benennungen der Schule den Nachtheil, dass man sehr leicht verführt wird zu vergessen, dass sie eben nur Benennungen, und insofern nichts Reelles sind. — Man spricht von Gedächtniss, Einbildungskraft etc., vergisst aber dabei, dass diese Eintheilung doch nur von gewissen wahrgenommenen Thätigkeiten abstrahirt, nicht aber durch eigene Wahrnehmungen in der Art gewonnen sind, als ob man die Funktion wirklich gesehen hätte.
Bei der Unmöglichkeit, in die Tiefen des menschlichen Geistes, und überhaupt in das Innere der schaffenden Natur einzudringen, kann ein, blos aus der Zusammenstellung von Definitionen gewonnenes Urtheil eben so unrichtig sein, als wenn man von einer Maschine, welche in einem Kasten so verschlossen ist, dass man nur hie und da ein Kammrad, dort ein Zahnrad oder eine Schraube erblickt, während die bewegende Kraft unsichtbar bleibt, ihre Thätigkeiten nach Aussen in der Art so eintheilen wollte, dass man sagte, dies ist ein Produkt des Zahnrades, dies des Kammrades u. s. w. Es ist falsch, denn alles ist nur Produkt der bewegenden Kraft, modifizirt durch die Räder, die zunächst nach Aussen wirken, aber auch diese Wirkung nicht ohne Hilfe der übrigen Räder äussern würden.
Die Funktion des Gedächtnisses setzt eben so jene der Einbildungskraft etc. voraus, als die Bewegung des Stundenzeigers bei einer Uhr das Rad voraussetzt, welches den Minutenzeiger treibt. — Was ist aber eine Maschine, im Vergleiche mit dem Körper des 61 Menschen, und was ist die Zusammensetzung einer Maschine im Vergleiche mit der Genesis und der Entwicklung der unbedeutendsten Pflanze, wie erst mit jener des Menschen!
Definitionen sind in jeder Wissenschaft unentbehrlich, weil man ohne sie keine grössere Zahl von Erscheinungen übersehen kann, zu einem Mehreren, nämlich zu einer Benützung als etwas Selbstständigen sind sie in dem Masse weniger tauglich, als es sich um die empirische Anwendung handelt. Der Jurist kann und muss sich an Definitionen halten, denn er muss die Gerechtigkeit handhaben, d. h. sorgen, dass keine Ungerechtigkeit begangen wird. Eine Ungerechtigkeit ist aber bei bestehenden positiven Gesetzen nur dasjenige, welches gegen den ausdrücklichen Inhalt der Gesetze verstösst.
Dem Richter ist daher das Gesetz die Grundlage seiner Wirksamkeit, und die Thatsachen sind das Zufällige, was ihn nur insofern berührt, als richtiggestellt werden kann, dass dieses Zufällige die Merkmale habe, welche sich unter das positive Gesetz subsummiren lassen.
Ganz anders ist die Stellung des Arztes oder eines anderen eine praktische Wissenschaft Uebenden. — Der Arzt behandelt nicht deswegen einen Kranken auf diese und keine andere Weise, weil ihn seine Wissenschaft zur Behandlung auffordert und ihm diese oder jene Behandlungsweise vorschreibt, sondern weil eine Krankheit vorhanden, und ihm keine zweckmässigere Art und Weise der Behandlung bekannt ist die Krankheit zu heilen, als jene, welche ihm die Wissenschaft lehrte. Hat ein Arzt durch gemachte Erfahrungen, oder sonst auf irgend eine Weise die Ueberzeugung erlangt, dass eine andere, als die von der Wissenschaft als die richtige gelehrte Behandlungsweise zweckmässiger sei, so wird er mit vollem Rechte diese letztere anwenden, und eben so wird er sich dadurch, dass etwa die in Behandlung stehende Krankheit alle Merkmale habe, welche etwa in der wissenschaftlichen Definition in Bezug auf eine gewisse Krankheitsform enthalten sind, nicht irre machen lassen, und seine Behandlungsart ganz anders einrichten, als es das Lehrbuch vorschreibt, wenn er sich von der Mangelhaftigkeit des Systems überzeugt hat.
Der Arzt hat also kein anderes Gesetzbuch, als die Natur, in dieser muss er zu lesen verstehen, oder seine Bestimmung ist verfehlt, und da die Natur ihre Produktionen nach einem unendlichen Plane erzeugt, daher nicht nach bestimmten Kategorien arbeitet, so sind für den Arzt Definitionen nichts weiter als gewisse Merkzeichen, 62 die er sich in das Buch der Natur einlegt, um zu wissen, wie weit er gelesen hat, die aber bei fortgesetztem Studium nothwendig auch ihre Bedeutung verlieren.
Da nun Definitionen in dem medizinischen Studium überhaupt weder vollständig, noch von besonderem Werthe in der Anwendung sein werden, in dem Falle aber, wo es sich um die Anwendung medizinischer Erfahrungen auf Gesetze, somit gerade auf Definitionen handelt, sich doch die Nothwendigkeit ergibt, diese Erfahrungen in einer Art auszudrücken, womit dieselben mit den gesetzlichen Definitionen in Verbindung gebracht werden können, und diese Nothwendigkeit insbesondere dort, wo es sich um Beurtheilung des Irrsinns in gerichtlichen Fällen handelt, im hohen Grade vorhanden ist, so bleibt nichts übrig, als die Natur mit dem Bestreben zu betrachten, gewisse Momente zu erhaschen, welche sich mit einem solchen Ausdrucke wiedergeben lassen, dass darauf die gesetzlichen Definitionen entweder unmittelbar angewendet werden können, oder man doch durch Vermittlung dieser Momente zwischen den minder definirbaren Momenten der Naturproduktion, und den gesetzlichen Definitionen Anhaltspunkte zu gewinnen im Stande ist.
Wenn wir nun die uns umgebende Natur mit dem Bestreben betrachten, nach dem Verhältnisse der einzelnen Gegenstände zur Aussenwelt eine Eintheilung dieser Gegenstände zu treffen, so gewahren wir, zwar nicht im Allgemeinen scharf gesondert, aber doch im Vergleiche einzelner Gegenstände mit anderen, folgende Abstufungen:
a. Unorganische Körper. Das Verhältniss, in welchem sich gewisse Körper zur Aussenwelt befinden, ist nämlich in der Art gestaltet, dass jede uns bemerkbare Einwirkung der Aussenwelt sich an denselben dadurch darstellt, dass sie die Form solcher Körper ganz oder zum Theile vernichtet. — Z. B. aus einem Würfel werden zwei Polygone, oder aus einem Stück Eisen wird Eisenoker — somit ist die vorige Form vernichtet. Diese Körper geben den Begriff der Materie, welche die alte Schule in vier Elemente theilte. Wo jedoch kein Vernichten der Form eintritt, dort gewahren wir auch gar keine Einwirkung durch die Aussenwelt.
b. Organische Wesen. Die Pflanzen. Auch hier ist die Materie der Hauptbestandtheil, auch hier tritt bei vielen Eindrücken der Aussenwelt eine Vernichtung der Form, oder gar keine Spur eines Eindruckes 63 ein, bei gewissen Eindrücken findet aber nur eine Veränderung der Form, ohne Aufhebung derselben Statt. Die Pflanze wächst, wenn sie begossen wird, sie hört aber, obwohl sie dadurch eine Veränderung in ihrer Form erleidet, nicht auf, dieselbe Species einer Pflanze zu bleiben, zu welcher sie früher gehörte. Hier ist daher nicht mehr ein blos passives Zerstörtwerden durch die Aussenwelt, sondern ein aktives Reagiren, wenigstens gegen gewisse Eindrücke bemerkbar, es ist eine Veränderung durch Assimilirung zu gewahren, die in der vorigen Klasse gänzlich mangelt.
c. Animalische Wesen. Die Erscheinungen der beiden vorigen Gattungen sind vorhanden, ausserdem bewirken Eindrücke gewisser Gattung auch noch die besondere Erscheinung, dass durch den Eindruck eine Thätigkeit entsteht, welche wohl dem Verhältnisse entspricht, in welchem sich der Eindruck machende Gegenstand zu dem Individuum nach dessen eigenthümlicher Beschaffenheit befindet, ohne deswegen eine unmittelbare Folge des Eindruckes zu sein. — Das vom Feuer beschädigte Thier verbrennt nicht, es flieht aber das Feuer. Es übt daher eine Thätigkeit, welche nicht aus der Berührung des Feuers folgt, sondern lediglich dem Eindrucke entspricht, welchen das Feuer auf dessen Individualität gemacht hat. Diese Verbindung zwischen Eindruck und Thätigkeit können wir daher nach dieser Wahrnehmung, und nach der Analogie unserer eigenen Erfahrungen an uns selber, nicht anders bezeichnen, als mit einem Bewusstwerden der, durch den äusseren Eindruck in dem Individuum hervorgebrachten Veränderung, mit einem Worte, durch das Eintreten der Empfindung des Erregtseins, d. h. einer durch einen äusseren Eindruck hervorgebrachten Veränderung in seinem Gesammtleben, es mag diese Veränderung nun wie z. B. ein Brandmahl Jedermann bemerklich sein, oder nur darin bestehen, dass irgend ein Glied desselben mehr, als es früher der Fall war, und auch nur eine Sekunde lang, erhitzt ist.
Dies Vorhandensein einer Empfindung lässt daher zwei Momente unterscheiden, nämlich das Erregtsein des Individuums, und die Vorstellung des Erregtseins, d. i. das Bewusstsein der Nothwendigkeit, sich entweder dem Eindrucke hinzugeben, oder sich demselben zu entziehen, denn die Beobachtung lehrt uns, dass, wo ein Erregtsein ohne Vorstellung Statt findet, z. B. bei der ordnungsmässig vor sich gehenden Funktion des Athmens, des Verdauens etc., obgleich diese Funktion immer mit äusseren Eindrücken, z. B. mit dem Einwirken der Luft, 64 mit den genossenen Nahrungsmitteln etc. in Verbindung steht, auch keine Empfindung davon da ist, und nur dann, wenn die Vorstellung einer Hemmung, oder einer besondern Befriedigung eintritt, diese Thätigkeit erst empfunden wird.
Je grösser die Kapazität eines animalischen Wesens für Empfindungen ist, auf einer desto höheren Stufe in der Rangordnung der thierischen Wesen befindet sich dasselbe, oder richtiger zu sagen, wir gewahren bei Thieren, welche in ihrer Thätigkeit sich dadurch von dem Pflanzenleben entfernen, dass wir ihnen die Fähigkeit zuerkennen müssen, sich mehr nach Vorstellungen zu bestimmen, als andere, auch einen feineren, zur Aufnahme von Veränderungen durch äussere Eindrücke weit empfänglicheren Organismus, als bei anderen.
Auf der untersten Stufe, z. B. bei Polypen, gewahren wir sehr wenig Organe, ihre Entwicklung und Erhaltung ist mehr vegetativ als selbstthätig. Eine Stufe höher treffen wir bei den Insekten entweder nur die Funktionen der Ernährung und der Fortpflanzung, oder die sogenannten Kunsttriebe, welche eigentlich nichts anderes sind als ein Entwickeln einer ganz unbewussten, und daher mehr vegetativen als animalischen Thätigkeit. Die Raupe spinnt sich ein, weil sie sich des animalischen Saftes nicht anders entledigen kann, dessen sie sich entledigen muss. — An der Biene bleibt der Blüthenstaub, indem sie ihre Nahrung auf Blumen sucht, ohne ihr Zuthun kleben, sie ist an die Königin, wie der Baum mit den Wurzeln an die Erde gebunden, und geht, wenn die Königin stirbt, zu Grunde, wie eine Pflanze, deren Wurzel abgeschnitten ist, — sie muss also, wie sie ihre Nahrung geholt hat, zur Königin fliegen, streift dort ihren Blüthenstaub von selbst ab, und gibt eben so unwillkürlich den Honigsaft von sich. — Sie kriecht durch das noch weiche Wachs, und die Form ihres Körpers bildet die Form der Zelle.
Aehnliches geschieht, obwohl mit einer geringeren Vollkommenheit, bei höheren Klassen der Thiere, z. B. bei Vögeln14 bei dem Bau ihrer 65 Neste, oder bei dem Biber, dem Dachse u. s. w.; nur bemerken wir dabei die sehr auffallende Erscheinung, dass die Kunsttriebe in dem Masse abnehmen, je vollkommener der Organismus ist; eine Erscheinung, welche zu der Ansicht berechtigt, welche ich mir eben auszusprechen erlaubte, dass die Thätigkeit, welche diese Kunsttriebe erzeugt, noch unter der Region der Empfindung, somit noch unter der Region der Vorstellung steht, und bei dem Thiere erst dann eine Empfindung, d. i. eine Vorstellung erzeugt, wenn sie gehemmt wird.
So wie nun jede Empfindung ein Verändertwerden der Individualität des Geschöpfes nothwendig voraussetzt, so gewahren wir auch, dass mit der Einwirkung, welche diese Veränderung bewirkte, nicht auch die Veränderung selbst verschwindet, sondern dass wenigstens derjenige Theil dieser Veränderung, welcher in Hervorbringung einer Vorstellung bestand, bleibend ist, und zwar um so mehr bleibend, je stärker die Veränderung, d. i. die Erregung des Individuums war, und je vollkommener der Organismus des Thieres ist.
Diese Erscheinung gibt sich dadurch kund, weil wir deutlich gewahren, dass das Thier bei wiederholtem Eintreten gewisser Momente, welche an und für sich noch keineswegs ein besonderes Erregtsein bedingen, aber einem gewissen Zustande des Erregtseins vorangegangen sind, schon eine solche Thätigkeit anwendet, wie sie dem, diesen Momenten erst folgenden Eindrucke entspricht. Der Hund lauft dem Gemache zu, wo gespeist wird, wenn er die Teller klingeln hört; er flieht, wenn sein Herr den Stock ergreift u. s. w.; es muss daher nothwendig die Reproduktion des früheren Eindruckes Statt finden, welcher dem nun vorhandenen gefolgt ist. — Derlei Thätigkeiten sind nun 66 wohl in vielen Fällen ganz richtig angebracht, und insofern lässt es sich sagen, dass das Thier den nexus causalis, d. i. die Folge gewisser Erscheinungen richtig aufgefasst habe. — Es lässt sich aber auch nicht verkennen, dass das Thier auch bei Eindrücken, welche mit jenen, die einem bestimmten früheren Ereignisse vorangingen, nur Aehnlichkeit haben, zuweilen eine solche Thätigkeit äussert, welche jenem Ereignisse entspricht, obgleich diese Eindrücke keineswegs jenes Ereigniss wirklich bedingen; z. B. lauft der Hund, welcher durch den Schuss eines Gewehres erschreckt wurde, davon, wenn nur ein Stock in eine ähnliche Richtung wie ein Gewehr gebracht wird. Es folgt daher, dass das Thier seine Thätigkeit nur nach der Reproduktion des früheren Eindruckes, nicht nach der Auffassung des Zusammenhanges von zwei Begebenheiten, als Ursache und Wirkung, bestimme.
Eben so finden wir aber auch, dass das Thier bei dem Wiedervorkommen mancher schon früher vorhanden gewesenen Eindrücke zuweilen nicht diejenige Thätigkeit äussert, welche dem nun kommenden Ereignisse entspricht, sondern bei einem Eindrucke entweder ganz unthätig bleibt, oder etwas beginnt, zu welchen das dem Eindrucke folgende Ereigniss keine Veranlassung gibt, woraus folgt, dass bei den Thieren sowohl ein richtiges, als ein dem objektiven Eindruck nicht entsprechendes, somit unrichtiges Reproduziren Statt finde.
Da also diese Reproduktion sowohl eine richtige als eine unrichtige, d. h. eine dem Causalnexus, von welchem der gegenwärtige Moment das erste Glied ausmacht, zuweilen entsprechende, oder auch zuweilen nicht entsprechende sein kann, so folgt, dass zuweilen die vorausgegangenen Vorstellungen gerade so reproduzirt werden, wie sie vorausgegangen sind, zuweilen aber eine Vermischung dieser Vorstellungen Statt gehabt haben muss.
Die erste Art der Reproduktionen nennen wir die Funktion des Gedächtnisses, die zweite, jene der Einbildungskraft, eine Unterscheidung, welche für uns, zum Behufe der Darstellung psychischer Funktionen, von entschiedenem Werthe ist, welche aber nicht so weit getrieben werden darf, dass man darunter zwei verschiedene Funktionen als vorhanden annimmt, denn dazu mangelt offenbar jede begründete Erfahrung.
Der Umstand, dass wir jedoch auch in manchen Fällen, ungeachtet des wiederkehrenden, einem bestimmten vorhergegangenen Ereignisse entsprechenden Eindruckes, welcher eine Thätigkeit zur Folge hatte, keine 67 den reproduzirten Vorstellungen entsprechende Thätigkeit entstehen sehen, berechtigt zu der Voraussetzung, dass in einem solchen Falle entweder gar keine Reproduktion vorhanden war, oder dass die wirklich vorhandene zu schwach, oder doch zu sehr mit anderen reproduzirten Vorstellungen verbunden war, um eine bestimmte Thätigkeit zu veranlassen, denn wir sehen die Thätigkeit eintreten, wie die jener Erregung vorhergegangenen Momente sich vermehren, woraus folgt, dass die Reproduktion in genauer Verbindung mit den äusseren Eindrücken stehe.
Damit wir aber annehmen können, dass bei einem Geschöpfe ein Bestimmen der Thätigkeit nach einer Vorstellung möglich sei, muss nothwendig vorausgesetzt werden, dass dasselbe schon vermöge seiner eigenthümlichen Beschaffenheit thätig, d. h. so eingerichtet sei, dass sein eigenthümliches Wesen gewisse äussere Eindrücke bedürfe, andere aber fliehe, dort aber, wo diese Eindrücke grösstentheils mangeln, oder grösstentheils seiner Individualität entgegen sind, nothwendig in seiner Individualität zerstört werden müsse, eine Voraussetzung, welche die Erfahrung so unbedingt bestätigt, dass jede Nachweisung überflüssig scheint.
Da nun viele dieser Eindrücke, deren das Thier nothwendig bedarf, von der Art sind, dass sie nothwendig Empfindung, und daher auch Vorstellungen erzeugen müssen, so lässt sich daher, in Bezug auf die animalischen Wesen als charakteristisches Merkmal zu dem Zwecke unserer Darstellung Folgendes aussprechen:
Animalische Wesen unterscheiden sich von unorganischen und blos organischen Wesen dadurch, dass die Thätigkeiten derselben, sofern sie durch äussere Eindrücke veranlasst sind, nur durch Empfindungen und die Reproduktion der mit den Empfindungen verbundenen Vorstellungen möglich erscheinen, dass daher die Aeusserung der Vorstellungsthätigkeit ein nothwendiges Merkmal des Verkehres des animalischen Lebensprinzipes mit der Aussenwelt darstellt.
So weit nun das animalische Lebensprinzip gewisse Eindrücke zu seiner individuellen Existenz bedarf, oder solche, zur Vermeidung der Vernichtung seiner individuellen Existenz fliehen, d. h. ihnen widerstreben muss, nennen wir diese Aeusserung Trieb, und in Bezug auf die verschiedenen einzelnen Aeusserungen Triebe, ohne jedoch auch mit dieser Benennung eine besondere, für sich bestehende Funktion 68 des Thieres bezeichnen zu wollen, es lässt sich daher auch das charakteristische Merkmal des animalischen Lebens damit ausdrücken, dass das Leben des Thieres in einem Bestimmen des Triebes durch Empfindungen, d. i. durch Vorstellungen der durch äussere Eindrücke Statt findenden, oder Statt gefundenen Erregung bestehe.
Insoweit spricht sich der Unterschied zwischen Thier und Pflanze, besonders bei den höheren Gattungen, klar aus. Die einzelnen Gattungen der Thiere lassen unter einander wohl einen bedeutenden Unterschied in der Menge der vorhandenen Vorstellungen und in dem Einflusse, welche dieselben auf dessen Thätigkeit im Verhältnisse zu den Eindrücken der Aussenwelt, d. i. auf dessen Triebe nehmen, gewahren, so dass bei den minderen Rangordnungen die Triebe mehr blind wirken, und sich hierin deren Entwicklung mehr dem Entwicklungsgange der Pflanze nähert, die Eindrücke von Aussen auch bei niederern Stufen mehr den bei dem Pflanzenleben Statt findenden Assimilirungs-Prozessen gleichen, bei den höheren Gattungen aber ein blosses Assimiliren ohne Empfindung seltener wird, allein weiter lässt sich der Unterschied nicht mehr verfolgen, immer bleibt aber dieses Merkmal wesentlich, dass dort, wo eine Funktion gehemmt oder befriedigt wird, somit bei allen Aeusserungen der Lebensthätigkeit, Empfindungen möglich sind, welches bei der Pflanze niemals der Fall ist. Das Thier wird daher in allen Anregungen von Aussen, d. h. so oft es angeregt wird, immer als animalisches, niemals als blos organisches Wesen angeregt.
Dagegen aber darf man nicht übersehen, dass bei dem Thiere jene Erscheinungen, welche schon in der frühesten Kindheit bei dem Menschen eintreten, wozu insbesondere die Sprache, und das Bestreben der Nachahmung nicht nur fremder Thätigkeit, sondern des Erzeugens der Produkte fremder Thätigkeit gehören, mangeln, und zwar die erste und letzte dieser Erscheinungen gänzlich, und auch die zweite derselben, nämlich das Nachmachen fremder Thätigkeit, ist nur bei sehr wenig Thieren, und auch bei diesen in einem sehr unvollkommenen Grade vorhanden. — Das Kind, indem es sich hinsetzt, eine Feder ergreift und etwas auf dem Papier kritzelt — wie es etwa den Vater schreiben gesehen hat, — will nicht blos sich so bewegen wie der Vater, sondern es will dabei schreiben, kurz es sind bei dieser Nachahmung Vorstellungen thätig, von welchen bei 69 dem Affen, welcher etwa das Auge an ein Fernrohr hält, gar keine Spur zu gewahren ist.
Alle jene Aeusserungen der Thierwelt, wodurch, wie man behauptet hat, sich eine wirkliche Intelligenz kund gibt, sind an und für sich sehr problematisch, und erhalten ihre scheinbare Evidenz gewöhnlich erst durch die mangelhafte Beobachtung, und durch die absichtlichen oder unabsichtlichen Zugaben des Erzählers. Man darf nur nie vergessen, dass wenn das Thier keine Intelligenz besitzt, es auch durch die Afterprodukte der Intelligenz, Vorurtheile, Irrthum und dergleichen, nicht gestört wird. Die zwischen Eindruck und Trieb liegenden Vorstellungen sind viel weniger zahlreich und intensiv, es empfängt daher den Eindruck viel reiner, und reproduzirt seine Vorstellungen viel richtiger als der Mensch, daher die Möglichkeit eines Irrthums in Folge einer irrigen Reproduktion in viel geringerem Grade vorhanden ist, als bei dem Menschen, welcher, wie wir später darthun werden, weit mehr als dies bei den Thieren der Fall ist, durch Vorstellungen angeregt wird, welche mit seinem Triebe in keiner unmittelbaren Verbindung stehen.
d. Vernünftig sinnliche (animalische) Wesen. Der Mensch.
Obgleich der Mensch mit dem Thiere das Merkmal gemein hat, dass auch bei ihm sich der sinnliche Eindruck zur Vorstellung gestaltet, und durch diese Vermittlung seine Thätigkeit anregt, so gewahren wir doch an ihm Erscheinungen, welche er mit keinem Thiere gemein hat. Diese sind die Sprache, die Bestimmung seiner Thätigkeit nicht blos nach seinen Trieben, sondern nach Produkten einer Kombinirung von Vorstellungen, d. i. nach Begriffen, endlich diejenigen Erscheinungen, welche wir unter dem Ausdrucke Sittlichkeit verstehen, nämlich als Funktionen betrachtet, Gewissen, Willen und (sittliches und religiöses) Gefühl, als äussere Thätigkeit betrachtet, sittliches und religiöses Handeln, Moral und Religion, und als allgemeine Anlage betrachtet, Vernunft.
Dass das Thier keine Sprache, d. i. nicht die Gabe besitzt, sich durch Zeichen, welche der Vorstellung entweder nur in einzelnen Theilen entsprechen, oder nur konventionell als derjenige Ausdruck angenommen sind, durch welchen bestimmte Vorstellungen oder bestimmte Begriffe angedeutet werden, verständlich zu machen, 70 bedarf wohl keines Beweises. — Das Thier drückt durch Laute höchstens die Empfindung aus, von welcher es im Augenblicke erregt wird, dort aber, wo es die menschliche Sprache zu verstehen scheint, sind ihm die Worte nichts weiter, als ein Laut, welcher das erste Glied eines ihm bekannten nexus causalis darstellt. Wenn man dem Pudel zuruft: wie spricht der Hund! so bellt er nicht etwa darum, weil er die Frage versteht, sondern weil ihm bekannt wurde, dass wenn er nicht bellt, er Schläge bekommt, oder einen guten Bissen, wenn er bellte, und ihm dieser nexus causalis nach und nach geläufig wurde.
Ein Hühnerhund, welcher Rebhühner sieht, wedelt mit dem Schweife, weil es ihm so eingeprügelt wurde, und weil es überhaupt in seiner Natur liegt, zu wedeln, nicht als Zeichen. Dass der Gesang der Vögel ein ganz unwillkürliches Vonsichgeben von Tönen sei, ist längst anerkannt.
Was die Erscheinung betrifft, dass der Mensch nach Begriffen handelt, so ist sie eben so unbezweifelt richtig. Wir nennen nämlich Begriffe solche Kombinationen von Vorstellungen, in welchen dasjenige, welches ein Individuum mit dem andern gemein hat, festgehalten wird, die Unterscheidungsmerkmale aber verschwinden.
Dass nun der Mensch wirklich nach solchen Vorstellungen der Gattung handle, denen unmittelbar keine reelle Erscheinung der Aussenwelt entspricht, ist eben so ungezweifelt wahr; — denn wir sehen, dass der Mensch urtheile, d. i. durch Kombination mehrerer Vorstellungen eine ganz neue gewinnt und schliesst, d. i. aus mehreren Urtheilen wieder ein neues Urtheil über das Vorhandensein einer Thatsache in der Aussenwelt entwickelt.
Wenn man nun gleich nicht absolut die Unmöglichkeit behaupten kann, dass das Thier nicht auch Gattungsbegriffe entwickeln, und durch deren Kombination auch ein gewisses Urtheilen und Schliessen ausüben könne, so sind für diese Möglichkeit doch so wenig und nur so zweifelhafte Erscheinungen vorhanden, dass man selbst hierin noch einen unendlichen Unterschied zwischen dem am vollkommensten organisirten Thiere und einem Kinde von etwa zwei Jahren, oder einem geistig höchst verwahrlosten Menschen zu bemerken im Stande ist, so dass man das Vermögen, Begriffe zu bilden, und darnach seine Thätigkeit zu entwickeln, immer noch als eine Eigenthümlichkeit der menschlichen Natur erklären muss.
Das neugeborne Kind zeigt weder Sprache noch Begriffe noch Sittlichkeit, sondern es ist ein blos passives Wesen, welches Eindrücke empfängt, und seine Lebensthätigkeit dadurch gewahren lässt, dass es bei erhaltenen Eindrücken, wenn sie der Individualität seines Lebens nicht entsprechen, Laute des Schmerzes von sich gibt. — Bald aber steigert sich diese nur passive Thätigkeit zu einer aktiven, und wir gewahren nun deutlich, dass es nicht blos vegetire, sondern in die Reihe der animalischen Wesen gehöre.
Die Sprache ist in dem Zustande, in welchem wir uns derzeit befinden, bereits ein Gegebenes, doch können wir aus der Art und Weise, wie Kinder sich entwickeln, wenigstens bis auf einen gewissen Grad, auf die Art und Weise schliessen, wie sich die Sprache überhaupt entwickelt habe, denn jedes Kind bildet sich wenigstens bei Gegenständen, welche ihm besonders auffallen, und bei welchen es die sprachübliche Bezeichnung nicht sogleich erfährt oder wieder vergisst, seine eigene Bezeichnungsweise.
Es ahmt den Laut nach, den das Thier, was es sieht, von sich gibt, hält die Hände an den Kopf, wenn es z. B. einen Bock bezeichnen will u. s. w.
Dies setzt nun als nothwendige Bedingung voraus, dass es bereits Begriffe, d. h. Merkmale aufgefasst habe, welche einer Gattung, z. B. der der Thiere, im Allgemeinen zukommen, und dass es durch diese Angabe des individuellen Unterschiedes das Individuum bezeichnen will.
Sprache ist daher ohne Begriffsbildung unmöglich, so wie der Ausdruck derjenigen Vorstellung, welche wir Begriffe nennen, auf keine andere Art, als eben nur durch Sprache möglich ist, denn obwohl es nicht zweifelhaft sein kann, dass die Begriffsbildung früher vorhanden sein muss, als der Ausdruck durch Sprache Statt finden kann, so setzen sich doch beide zu ihrer Entwicklung nothwendig voraus, so dass es in der That nicht möglich ist, zu unterscheiden, welche von beiden Thätigkeiten sich früher entwickle, da ohne Sprache sich nur wenige Begriffe und diese nur sehr unvollkommen bilden können, wie wir dieses bei sehr rohen Völkern gewahren, und bei sehr wenig Begriffen die Sprache immer auf einer sehr geringen Entwicklungsstufe bleiben wird, wie wir dieses bei Menschen gewahren, welche einen ziemlichen Grad blödsinnig sind.
72 Was die sittliche Anlage betrifft, so wäre es wohl das Einfachste, sich auf die eigene Erfahrung eines jeden verehrten Lesers und auf das Zeugniss der Weltgeschichte zu berufen, welche Beispiele von sittlichen, d. i. solchen Handlungen in Menge liefert, welche sich nur durch die Voraussetzung dieser Anlagen des Menschen erklären lassen; allein diese Argumentation genügt nicht zu dem Zwecke dieses Aufsatzes, welcher die Aufgabe verfolgt, durch Anführung von solchen Thatsachen, welche Jedermann so nahe stehen, dass sie Jeden auch zur unmittelbaren Anschauung Desjenigen führen, was hier nachgewiesen werden soll, zu wenig, um dabei stehen bleiben zu können, ein richtiges Verständniss herbeizuführen.
Weit näher als diese übrigens unbezweifelte Wahrheit liegt für den Zweck dieses Aufsatzes die Betrachtung, dass jeder Mensch, selbst der unsittlich Handelnde, selbst das kaum noch zum animalischen Leben recht erwachte Kind seine Thätigkeit in der Art entwickelt, dass man einerseits das Bestreben wahrnimmt, ohne physische Nöthigung seine Thätigkeit zu äussern, anderseits das Bestreben in seiner Thätigkeit gewahrt, einer fremden Autorität zu folgen.
Der erste dieser Sätze bedarf keines Beweises, da es Jedermann bekannt ist, dass schon die kleinsten Kinder, und zwar diejenigen, welche viele geistige Anlagen haben, nicht am wenigsten eigensinnig sind; der zweite ist eben so bekannt, nur wird er nicht immer so klar ausgesprochen, er ist aber durchaus wahr, denn es ist bekannt, dass die sich entwickelnden Kinder den Worten ihrer Eltern mehr zutrauen, als ihren eigenen Sinnen, dass rohe oder schwachsinnige Leute eben so, gegen ihr eigenes Urtheil dem Willen anderer, welche eine gewisse Macht über sie ausüben, sich unterwerfen, und dass Leute von hellem Geiste nach Grundsätzen handeln; und was sind Grundsätze wohl anders, als die als wahr angenommenen Aussprüche einer Autorität, sei es nun die Autorität des Lehrmeisters oder die Autorität der eigenen Erfahrung, denn auch die Annahme, dass die Ergebnisse der eigenen Erfahrung wahr, d. h. der Objektivität der äusseren Erscheinungen entsprechend seien, setzt voraus, dass man diese Erfahrungen, und diejenige Funktion, welche daraus gewisse Folgerungen ableitet, als etwas absolut Richtiges genommen hat.
Dieses Erkennen und Annehmen einer Autorität ist es daher, welches den Beweis liefert, dass der Mensch das unabweisbare Bedürfniss 73 habe, ein Drittes, welches weder in seinen eigenen Funktionen, noch in den ihn umgebenden Erscheinungen liegt, als das eigentliche Prinzip anzunehmen, welches seine Thätigkeit zu leiten bestimmt ist, und jeder Bestimmung seiner Thätigkeit zu widerstreben, welche nicht von diesem Prinzipe ausgeht.
Dieses Prinzip wirkt sonach in keiner Art nöthigend auf seine Thätigkeit, sondern der Mensch empfindet nur dann die seinem innersten Wesen entsprechenden Lebensgefühle, wenn er ohne allen Zwang seine Thätigkeit so äussert, wie es der Autorität entspricht, unter deren Einfluss er sich befindet.
Hieraus folgt nun, dass Freiheit, d. i. die Entwicklung seiner Thätigkeit ohne physischen Zwang, und zugleich das Bedürfniss, einer höheren Autorität zu gehorchen, — ein Bedürfniss, welchem in der höheren Entwicklung des Menschen die Religion entspricht, das eigentliche Element der menschlichen Thätigkeit sei, ein Element, welches in der Thierwelt auch nicht einmal dem Grade nach vorkommt, sondern eben darum, weil es Begriffe und Sprache nothwendig voraussetzt, bei der Thierwelt gänzlich mangelt, oder höchstens in einer Art von Analogie vorkommt, in welcher der Hund den Menschen folgt und seinem Winke gehorcht, weil er durch den Einfluss des menschlichen Organismus auf den hundischen physisch genöthigt ist, diesem Einflusse zu gehorchen.
Es mag immerhin Fälle geben, wo der eine Mensch durch seinen überlegenen physischen und psychischen Organismus einen ähnlichen Einfluss auf andere Menschen ausübt, — allein man übersehe dann auch nicht die andere Erscheinung, welche damit verbunden ist. Die Menschen werden ihm folgen, allein mit innerem Widerstreben, wie der Hund knurrend seinem Herrn folgt, wenn er ihn gegen seine Neigung ruft, denn sie fühlen, dass sie nicht frei sind, und werden ihre Freiheit wieder gewinnen, wenn die Uebermacht des Organismus, welcher sie leitete, gebrochen ist.
Ganz anders stellt sich die psychische Erscheinung in dem Falle dar, wo der Mensch seine Thätigkeit demjenigen Prinzipe gemäss entwickelt, welches wir das Sittliche nennen. Hier mangelt jede physische Nöthigung, und daher ist auch die Erscheinung, dass Jemand mit innerem Widerstreben sittlich handelt, undenkbar. — Es gibt Fälle, wo die sittliche Handlung mit dem herbsten physischen oder geistigen Schmerze verbunden ist, allein das Gefühl, das gegen sein inneres 74 Streben Bestimmtwerden, ist mit jeder sittlichen Handlung unvereinbar, wohl aber kann das Gegentheil, dass man mit innerem Widerstreben unsittlich handelt, eintreten, und tritt auch häufig ein, wie manche Arten von Erfahrungen, insbesondere die gerichtlichen, zur Genüge lehren; denn Niemanden wird die Thatsache unbekannt sein, dass selten Jemand eine verbrecherische Laufbahn mit grossen Verbrechen beginnt, sondern die ersten bösen Handlungen sind meistens minder erheblich, oder wenn mit grösseren Verbrechen von einem Individuum begonnen wird, so sind meistens solche Umstände vorhanden, welche auf die Bestimmung desselben zu der verbrecherischen That einen mächtigen sinnlichen Einfluss, und daher wenigstens eine Art von physischer Nöthigung ausüben15.
Wenn wir jedoch uns nicht verbergen können, dass das Unterwerfen der Thätigkeit unter eine, von dem handelnden Menschen unabhängige, Autorität, dem Menschen angeboren, und dieses Bedürfniss ein mit allen seinen Thätigkeiten innigst verbundener Theil seines Wesens ist, so können wir uns doch auch die Ueberzeugung verschaffen, dass es gar keine äussere Erscheinung gibt, welche einen solchen Einfluss ausübte, dass sich alle Menschen derselben unterwerfen müssten, oder dass es auch nur dem einzelnen Menschen unmöglich wäre, sich derselben zu entziehen. Dennoch aber lehrt uns sowohl der Blick in unser eigenes Leben, als in das Leben der anderen Menschen, dass es in demjenigen Prinzipe, welches wir als eine Autorität anerkennen, welche unbedingte Unterwerfung fordert, einen Vereinigungspunkt gebe, welcher in jeder Autorität, welcher wir freiwillig zu folgen uns bleibend entschliessen können, aufzufinden ist, dieser Vereinigungspunkt ist die Idee des Sittlichen — und in der That kann eine Autorität nur dann bleibend, auf den Menschen im Allgemeinen nur insoferne einwirken, als sie die Idee des Sittlichen, d. i. einer höheren, in der physischen Welt nicht sich aussprechenden Weltordnung darstellt.
Kein Volk, selbst kein einzelner Mensch ist ohne alle Religion, der einzelne Mensch kann irreligiös handeln, allein indem er es thut, fühlt er ein Unbehagen, das Gewissen regt sich, oder er 75 betäubt sich, sei es nun durch physische Genüsse, oder durch das Laster selbst, ein Zustand, welchen man jedoch sehr irrig mit dem Ausdrucke bezeichnet, der Mensch sei zum Thiere herabgesunken, denn der Zustand des Thieres ist ein vollkommen normaler Zustand, jener des Menschen aber ist ein seinem eigenthümlichen Wesen vollkommen entgegengesetzter, somit nicht normaler Zustand, welcher mit einer am Ende sichtbar werdenden Störung seines Wesens enden muss, eine Folge, welche das Laster in mancherlei Gestalten, wie die Erfahrung lehrt, nicht selten begleitet, und sich dadurch kund gibt, dass die lange unterdrückte Reue endlich durchbricht, und geistige Störungen im Gefolge hat, oder dass die physische Natur der fortwährenden Betäubung endlich unterliegt, ohne dass dieses Unterliegen lediglich aus den physischen Folgen des Lasters immer erklärt werden kann.
So verschieden auch die Sitten und Lebensweisen der einzelnen Menschen und Völker sind, so stimmen doch alle darin überein, dass gewisse Handlungen des Menschen, sofern sie ein Ausdruck einer gewissen Gesinnung sind, geachtet, andere aber, eben weil sich eine gewisse Gesinnung darin ausspricht, verachtet werden, und zwar liegt die verachtete Gesinnung darin, dass der Mensch einen augenblicklichen Vortheil oder Nachtheil höher hält, oder doch zu halten scheint, als ein gewisses Prinzip, welches ihm in diesem Augenblicke wenigstens keinen Vortheil gewährt. Diese Ansicht liegt dem Begriffe der Ehre, so wie jenem der Tugend zu Grunde, nur in dem Prinzipe sind beide Begriffe verschieden, indem der Begriff von Ehre ein äusseres Verhalten in sich begreift, jenes der Tugend aber eine innere Stimmung ausdrückt, welcher kein äusserer Zustand geopfert werden darf.
In dem Zustande, in welchem wir leben, ist diejenige Form, in welcher wir die Sittlichkeit zu üben haben, so wie die Sprache, ein bereits Gegebenes, wir brauchen nicht mehr erst zu erfinden, wie wir unsere Thätigkeit zu äussern haben, damit sie auch sittlich sei, sondern Religion und Offenbarung entheben uns des Bestrebens, erst durch eigene Erfahrung darauf zu kommen, ob irgend eine Handlung sittlich sei oder nicht. Würde dieses glückliche Ereigniss für uns nicht vorhanden sein, so müsste wahrscheinlich jeder Mensch erst eine ungeheure Irrfahrt durch 76 die Pfade des Lasters machen, ehe er dahin käme, zu wissen, was er eigentlich hätte thun sollen, und es bliebe dann mehr als zweifelhaft, ob das kurze menschliche Leben hinreichte, ihn aus dem Schlamme der Sinnlichkeit, in welchen er durch sein unklares Ringen nach einer seiner wahren Natur entsprechenden Thätigkeit versunken wäre, wieder zu erheben.
Dieser Fall tritt aber glücklicher Weise für uns nicht ein, sondern jeder erhält wenigstens einige Begriffe von dem, was er als sittlich zu betrachten hat, bereits in klaren Worten ausgesprochen von anderen Menschen mitgetheilt.
Ungeachtet dieses Umstandes können wir doch durch Beobachtung des kindlichen Alters uns eine ziemlich deutliche Anschauung von der Art und Weise verschaffen, wie die menschliche Natur die Anlage zur Sittlichkeit allmälig entwickle.
Das Kind ist, wenn es diese Welt betritt, ein scheinbar blos passives Wesen. Erst allmälig zeigt es, besonders bei schmerzhaften Eindrücken, Empfindungen, welche, wie bei dem Thiere, reproduzirt werden, und, wie man aus manchen unzweideutigen Erscheinungen schliessen muss, bei demselben eine anfangs undeutliche, jedoch immer klarer werdende Auffassung des Causalnexus zur Folge haben.
Das Kind, indem es einen äusseren Eindruck auffasst, kann ihn aber nicht anders als so auffassen, wie es ihm (dem Kinde) nach seiner Individualität, und daher nach der durch vorausgegangene Eindrücke bedingten Modifikation (Stimmung) seiner Lebensthätigkeit möglich ist, d. h. jeder Eindruck kann sich nur im Wege der Reproduktionsthätigkeit mit jenen Vorstellungen verbinden, welche bereits vorhanden waren.
Die ersten Vorstellungen, welche das Kind nun erhält, sind jene der eigenen Empfindung; diese werden sich daher mit allen Eindrücken verbinden, welche es erfährt, es wird daher diese Art Vorstellungen auf alle Gegenstände der Aussenwelt zu übertragen sich genöthigt finden, wodurch bei dem Kinde jene Erscheinung bedingt wird, welche wir wirklich gewahren, nämlich, dass dem Kinde alles lebt, d. i. nach seiner Vorstellung eben so Empfindung hat, wie das Kind selbst, denn die erste Empfindung ist die des eigenen Lebens.
Diese Erscheinung muss nun wohl auch bei dem Thiere eintreten, und tritt wohl auch ein, denn wir sehen, dass ein Hund einen Stock, an welchen er sich stösst, beisst, so wie das Kind den Stuhl schlägt, an dem es sich wehegethan hat; — allein da der Organismus des Kindes 77 zur Aufnahme mehrerer und lebhafterer Eindrücke geeignet, und dadurch eine weit umfassendere Reproduktion in der Vorstellungsthätigkeit bedingt ist, als beim Thiere, so tritt diese Erscheinung viel entschiedener hervor, als man dieses beim Thiere zu gewahren vermag.
Hiedurch ist nun offenbar eine viel öftere und lebhaftere Aeusserung der sympathetischen Triebe bedingt.
Dennoch kann es nicht fehlen, dass manche Eindrücke, z. B. jene, welche Zorn u. dgl. hervorbringen, von der Art sein werden, dass sie eine Anregung enthalten, gegen die sympathetischen Triebe zu handeln. — Das Kind folgt diesem Eindrucke, und handelt wirklich gegen den sympathetischen Trieb, — welcher dadurch auf einen Augenblick unterdrückt, sonach mit desto grösserer Stärke hervortritt; hiedurch wird nun das Kind jene Empfindung gewahren, welche mit der Reue beinahe identisch ist.
Aehnliches findet sich nun wohl auch bei Thieren, allein bei dem Kinde tritt hier noch ein Moment hinzu, der bei dem Thiere fehlt: dasjenige, was es empfindet, wird ihm durch seine Eltern etc. klar gemacht, so dass es zu dem Begriff gelangt, dass es etwas gethan habe, was es nicht hätte thun sollen, und dass das hiedurch entstandene unangenehme Gefühl der Reue eine Folge dessen sei, weil es einem augenblicklichen Eindruck gegen ein in ihm sich äussernden Gefühl gefolgt ist.
Von dieser Wahrnehmung ist allerdings noch ein unendlich weiter Schritt zur Auffassung des sittlichen Verhältnisses, denn kein einziges der, auf dem ihm bisher einzig nur möglichen Weg des sinnlichen Empfindens erlangten, Gefühle ist von der Art, dass es für sich allein zur Auffassung des Sittengesetzes führen könnte, allein hier kommt die bereits berührte Thatsache zu Hilfe, dass der Mensch das Bedürfniss fühlt, sich einer Autorität in seiner Thätigkeit zu unterwerfen.
Dass seine Thätigkeit eine freie sei, erfährt das Kind bei der ersten Empfindung der Reue, denn es empfindet dabei, dass es ihm möglich gewesen wäre, einer anderen Vorstellung als jener zu folgen, zu welcher es derjenige äussere Eindruck, dem es sich hingab, bestimmt hat. — Es wird aber diese Empfindung in einem noch höheren Grade gewahren, wenn es jener Autorität entgegenhandelt, welche es anzuerkennen sich gedrungen fühlt.
Diese Autorität, nämlich jene der Eltern und Lehrer, wirkt nun auf dasselbe nicht blos als unmittelbar bestimmend, — sondern vielfältig in der Art, dass dem Kinde gesagt wird: dies musst du thun, oder dies 78 darfst du nicht thun, weil es überhaupt auch für uns (die Eltern) selbst geboten oder verboten ist.
Diese Vorstellung einer solchen dritten, für das Kind nicht wahrnehmbaren Autorität wird nun zwar das Kind anfangs nicht besonders deutlich auffassen, es wird aber durch die Lehren und das Beispiel seiner Eltern u. s. w. angeregt werden, diese Vorstellung zu immer grösserer Deutlichkeit zu bringen, bis es endlich dahin gelangt, deren Richtigkeit durch seine eigene Erfahrung und sein eigenes Gefühl bestätigt zu finden, wo es dann in dasjenige Stadium der Entwicklung eingetreten erscheint, wo es als selbstständig handelndes sittliches Wesen betrachtet werden kann.
Wie sich aber auch das Individuum in sittlicher Beziehung entwickle, so bleibt so viel ungezweifelt, dass es nie Schöpfer irgend einer Wirkung sein wird, sondern immer den Weg der sinnlichen Erregung insoweit nicht wird entbehren können, als einerseits ohne Trieb kein Streben überhaupt, und ohne äusseren Gegenstand auch keine Entwicklung des Triebes möglich ist.
Wo daher irgend ein Trieb Befriedigung fordert, und sonst kein anderer Trieb und kein anderer Gegenstand, welcher das Streben des Menschen nach einer anderen Richtung sich zu äussern anregt, vorhanden ist, wird und muss der Mensch auch dieser Richtung folgen, — indem er aber dieses thut, d. h. einer solchen Richtung sich hingibt, gehorcht er lediglich den Gesetzen seiner sinnlichen Natur, er handelt dabei weder sittlich noch unsittlich. Ein solches Verhältniss tritt z. B. dann ein, wenn sich ein Mensch schläfrig fühlt, und er keine Anregung hat wach zu bleiben. Jeder wird unter diesem Verhältnisse sich dem Schlafe hingeben.
Je mehr jedoch die Vorstellungen des Menschen mit seinen Beziehungen zur Aussenwelt sich vervielfältigen, um so seltener wird er sich in der Lage befinden, gerade nur von einem Triebe angeregt zu werden, denn es werden dann verschiedene Anregungen entweder durch sinnliche Triebe, oder durch gewisse Komplexe von Vorstellungen erfolgen, wovon jedes eine verschiedene Thätigkeit verlangt; und insbesondere wird der Fall eintreten, dass dasjenige, welches seinem sinnlichen Triebe entspricht, eine andere Richtung von ihm fordert, als jene, welche diejenige Autorität verlangt, der er sich in seiner Thätigkeit unterwerfen zu sollen fühlt. Unter diesen Umständen tritt nun der Fall ein, wo er sich entscheiden muss, ob er seine Handlung nach einer für ihn höher 79 stehenden Autorität, oder nach dem Streben seiner Sinne bestimmen soll. Hier fühlt er daher die Möglichkeit der Selbstbestimmung, und zwar die Freiheit der Wahl, ob er sich dem Zwange der Sinnlichkeit unterwerfen oder der höhern Autorität, welche keinen Zwang auf ihn ausübt, gehorchen, d. i. ob er seiner Freiheit entsagen oder davon Gebrauch machen wolle. — Geschieht dies Letzte, so lohnt das Gefühl der behaupteten Freiheit seine Thätigkeit; geschieht das Erstere, so fühlt sein ganzes Wesen, dass er den vorherrschenden Trieb seines Wesens, jenen nach Beibehaltung seiner natürlichen Freiheit, unterdrückt habe. — Er fühlt Reue und die Vorwürfe seines Gewissens darüber, dass er von seiner Freiheit der höheren Autorität entsprechend, seine Thätigkeit zu üben, keinen Gebrauch gemacht hat, d. h. dass er nicht das Gute, sondern das Entgegengesetzte davon, das Böse, gewollt, d. i. sich ohne unwiderstehliche Nöthigung mit Willen dem Einflusse seines sinnlichen Triebes gegen die Forderung jener Autorität hingegeben habe.
Dies sind die Thatsachen, welche wir in Bezug auf die sittlichen Erscheinungen bemerken, und nach welchen man verschiedene Funktionen des Menschen, als: vorausgehendes und nachfolgendes Gewissen, den Willen, nämlich die Fähigkeit, sich nach Willkür zum Guten oder zum Bösen zu bestimmen, unterschieden hat. Gegen diese Abtheilungen lässt sich auch, insofern sie zur bessern Uebersicht des Ganzen dienen können, nichts erinnern, nur darf man nicht vergessen, dass die Natur des Menschen keine solchen Unterabtheilungen kennt, sondern dass alle diese Unterscheidungen nur Aeusserungen eines und desselben Prinzipes, nämlich des die menschliche Natur charakterisirenden Triebes nach (sittlicher) Freiheit im Verhältnisse zur Aussenwelt sind.
Geht man jedoch von dieser Ansicht ab, und erkennt man diese Aeusserungen als verschiedene Funktionen an, so kommt man auf jene Begriffsverwirrungen, welchen man nicht selten in psychologischen Werken begegnet.
Man findet da die Frage abgehandelt, ob der Mensch zum Guten oder zum Bösen seiner Natur nach geneigt sein könne, es ist von Krankheiten des Willens oder auch von einem verkehrten Willen die Rede, wodurch man deutlich an den Tag legt, dass man den Willen, d. i. die Fähigkeit, mit Bewusstsein seiner Freiheit frei zu handeln oder sich seiner Freiheit zu begeben, mit dem Wollen, d. i. mit dem Bestreben, einen bestimmten Gegenstand zu erreichen (abgesehen 80 von der Sittlichkeit oder Unsittlichkeit dieses Bestrebens) verwechsle. So wenig es in meiner Absicht liegt, irgend Jemanden in seinen metaphysischen Ansichten zu nahe treten zu wollen, so kann ich doch nicht umhin, darauf aufmerksam zu machen, dass mindestens für die Rechtspflege bei Erhebung des Irrsinnes eine solche Begriffsverwirrung von grossem Nachtheile ist. Man spricht von Verkehrtheit des Willens bei manchen Menschen! Was soll dies wohl heissen? Etwa einen Willen, welcher das Böse beschliesst, weil es dem Menschen, welcher diesen verkehrten Willen hat, als gut erscheint? Ein solcher Mensch aber kann nur in einem Irrthume befangen sein, oder er müsste gegen seine sinnlichen Triebe handeln, nämlich sich ohne irgend eine Aussicht auf eine angenehme Empfindung Schmerz zufügen, blos weil dadurch etwas Böses entsteht. Wo hat noch Jemand dieser Art existirt? Es gibt Menschen, welche ihrer sinnlichen Kraft gewahr werden, wenn sie Böses thun, sich dieser Empfindung freuen und darum Böses thun. — Dieses sind nun wohl allerdings sehr grosse Bösewichter, allein sie thun das Böse aus keinem andern Grunde, als aus jenem, welcher auch jeden Andern, welcher böse handeln will, zu einer solchen Richtung bestimmt, aus dem Grunde nämlich, weil sie die Verlockung, welche ihnen das Vergnügen gewährt, das sie sich aus ihren bösen Handlungen gewärtigen, höher schätzen, als die Aufforderung zum Guten.
Soll es aber bedeuten, dass das moralische Gefühl bei ihnen so schwach sei, dass es, verbunden mit einem in ihrer sinnlichen Natur begründeten Hang zu gewissen als Verbrechen bezeichneten Handlungen16, die Kraft der sittlichen Anlage überwiegt und daher ihr Wollen gegen die Sittlichkeit kehrt, so ist es sehr sonderbar, diesen Zustand mit dem Ausdrucke verkehrter Wille oder verkehrtes Wollen zu bezeichnen, denn dieses verkehrte Wollen ist dann die Wirkung ihrer physischen Anlage, und diese, nicht das verkehrte Wollen, ist die Grundursache ihrer Verbrechen.
In diesem Falle setzt aber der Ausdruck verkehrter Wille den Richter in Verlegenheit, ob er einen solchen Menschen auch für zurechnungsfähig halten soll, während in dem Falle, wo gesagt wird, der Mensch besitzt einen, seine Sittlichkeit weit überwiegenden Hang zu diesem Verbrechen, 81 nichts weiter folgt als der Schluss: folglich muss man ihn strafen, damit er in dem sinnlichen Uebel der Strafe ein für ihn näher liegendes Motiv finde seinen Hang zu bezähmen, wenn sein Sittlichkeitsgefühl nicht hinreicht.
Eine ähnliche Frage, ob der Mensch so von der Sünde besessen sein kann, dass er sündigen müsse, beantwortet sich, wenigstens in rechtlicher Beziehung, auf eine ähnliche Weise. Es kann sein, dass die Wiederholung der Sünde einen solchen Einfluss auf seine Thätigkeit habe, dass kein sittliches Gefühl ihn abhält, seinem sinnlichen Hange zu folgen; um so nothwendiger aber ist Strafe. — Bei der Erziehung begegnen wir ja ganz ähnlichen Erscheinungen. — Alles Zureden, ja oft selbst der augenblickliche wirkliche Vorsatz, sich eine gewisse üble Gewohnheit u. dgl. abzugewöhnen, beseitigen das Uebel oft nicht. Werden aber gewisse materielle Mittel mit einer gewissen Konsequenz angewendet, so erfolgt die gewünschte Wirkung oft schneller als man meint.
Beinahe Dasselbe gilt von dem Ausdrucke Krankheit des Willens! Es kann Erscheinungen geben, welche entschieden dahin deuten, dass bei ihnen das Subjekt ohne Einfluss des Willens gehandelt habe. Dies beweist nun nichts mehr, als dass entweder überhaupt das Subjekt in einem seine Vorstellungsthätigkeit lähmenden Zustande, oder in einem solchen Zustande der Vorstellungsthätigkeit gehandelt hat, wodurch jede andere Vorstellung als jene, welche die That hervorrief, insbesondere aber jene, in welcher sich der Wille hätte thätig bezeigen können, ausgeschlossen war. — Nun in diesem Falle lässt sich höchstens sagen, dass der Wille sich nicht äussern konnte, nicht aber, dass er sich krankhaft geäussert hat, oder selbst krank war!
Krankheiten des Menschen aller Art können allerdings solche Erscheinungen hervorbringen, niemals aber sollte man sich verleiten lassen, von einer krankhaften Funktion zu sprechen, nicht einmal die Funktion der Verdauung kann krank sein, selbst nicht bei Demjenigen, der eben an einer Indigestion oder am Magenkrebs stirbt, denn die Funktion des Verdauens ist die Abstraktion derjenigen Thätigkeit des Körpers, wodurch verdaut wird. Es kann daher sein, dass der Mensch gar nicht oder doch viel zu wenig verdaut, allein so weit er die Funktion der Verdauung wirklich übt, ist es immer eine normale Funktion.
Dass nun diese Bemerkung nicht blos eine Spitzfindigkeit sei, dürfte sich wenigstens, sofern es sich um eine juridische Anwendung solcher Ausdrücke handelt, aus dem vorher Gesagten mit ziemlicher Gewissheit ergeben.
82 Noch muss hier einer psychologischen Erscheinung, wegen ihrer besondern Wichtigkeit für die rechtliche Zurechnung, ausdrücklich gedacht werden. Es ist dies nämlich der Umstand, dass eben aus dem Grunde, weil die Begriffe von Demjenigen, welches in der Welt sittlich ist, nicht blos, und zwar grösstentheils nicht, durch die Abstraktion des Individuums gewonnen, sondern ihm vielfältig von Aussen gegeben werden, diejenige Thatsache eintritt, von welcher es heisst, dass das Samenkorn auf nackten Felsen fällt. — Der Mensch kann sich zur Zeit, als ihm gewisse Wahrheiten gelehrt werden, noch in einem solchen Zustande der unvollkommenen Entwicklung seiner Vorstellungsthätigkeit befinden, dass diese Lehren in ihm keine Vorstellung finden, an welche sie sich anschliessen können. In einem solchen Zustande kann es nun geschehen, dass der Mensch die Worte behält, in denen diese Lehren gegeben sind, dass aber dieselben isolirt in seiner Vorstellungsthätigkeit liegen bleiben, und, wenn er auch für andere sittliche Verhältnisse nicht ohne Sinn ist, sich auch in solchen Beziehungen sittlich beträgt, er doch gegen den Inhalt dieser Lehren handelt, obwohl sich nicht läugnen lässt, dass die Worte, in denen sie abgefasst waren, seinem Gedächtnisse nicht gänzlich entschwunden sind. — Diese Thatsache darf insbesondere dann nicht unberücksichtigt bleiben, wenn es sich um Erhebung des als Blödsinn bekannten Zustandes in Bezug auf gewisse Verbrechen handelt. Ein solcher Mensch kann die zehn Gebote hersagen, er kann auch einige Sätze von der Erklärung derselben, z. B.: Stehlen heisst, einem Andern das Seinige nehmen, behalten haben, allein er denkt dabei nichts weiter, als dass diese Worte herzusagen eine Schulaufgabe ist, deren Inhalt für sein übriges Leben eben so wirkungslos bleibt, als wenn Jemand, der nicht Latein kann, seinem Gedächtnisse einige lateinische Sätze in einer gewissen Reihenfolge einprägt.
Der verehrte Leser möge dem Verfasser diese Verirrung in das Gebiet der Metaphysik vergeben, allein wenn man über einen schwierigen 83 Gegenstand zu sprechen hat, so kann man nur dadurch der Gefahr, missverstanden zu werden, entgehen, wenn man über die Bedeutung derjenigen Ausdrücke, welche man in der Folge zu benützen gedenkt, mit dem Leser einverstanden ist, und dieses Einverständniss kann ein Autor nur dadurch erreichen, wenn er, wo ein Missverstand möglich ist, die Bedeutung seiner Ausdrücke auf solche Vorstellungen reduzirt, in welchen Jedermann übereinstimmt.
Weit entfernt daher, zu glauben, dass die von mir gebrauchten Ausdrücke alle vollkommen richtig gewählt sind, glaube ich doch jedem meiner verehrten Leser anschaulich gemacht zu haben, was ich darunter verstehe, und dies dürfte zum Zwecke dieses Aufsatzes eben so nothwendig gewesen, als hinreichend sein.
Es wurde im Eingange dieses Aufsatzes bemerkt, dass der Irrsinn sich für die gewöhnliche, d. i. die nicht wissenschaftlich geübte Beachtung durch eine abnorme Thätigkeit in der Aussenwelt kundgebe, woraus folgt, dass bei dem Umstande, wo die rechtliche Beurtheilung lediglich eine Beurtheilung des äussern Verhaltens eines Menschen ist, auch für die strafrechtliche Beurtheilung Irrsinn nur insofern ein Gegenstand der besondern Betrachtung werden könne, als durch denselben eine gewisse strafbare äussere Thätigkeit veranlasst wurde, welche ohne das Vorhandensein dieses Gemüthszustandes unterblieben wäre.
Die wissenschaftliche Erfahrung, dass der Irrsinn sich nicht immer in abnormen äusseren Thätigkeiten ausspreche, und auch von dem praktisch-geübten Seelenarzte ohne wahrgenommene abnorme äussere Thätigkeit erkannt werden kann, steht dieser Ansicht keineswegs entgegen, denn es lässt sich nicht verkennen, dass alles Annehmen der Richtigkeit eines Resultates, welches die wissenschaftliche Forschung liefert, so lange sich deren Richtigkeit nicht durch entschiedene Versuche auch dem nicht wissenschaftlich Gebildeten anschaulich machen lässt, nur im Vertrauen auf die Persönlichkeit Desjenigen beruht, welcher sie erhalten zu haben behauptet. Persönliches Vertrauen kann nun niemals die Stelle objektiver Gewissheit, am wenigsten aber in dem Falle vertreten, wo es sich um Anwendung der Strafgesetze handelt17. Betrachtet man daher den Irrsinn nur von der pathologischen 84 Seite, so muss man nothwendig zugeben, dass ein auch von dem erfahrensten Arzte abgegebenes Gutachten hierüber blos darum, weil es ein Gutachten dieses Arztes ist, für den Richter nie diejenige objektive Gewissheit haben werde, welche die strafrechtliche Beurtheilung der Sache erfordert, und da, wie bereits im Eingange dieses Aufsatzes erwähnt wurde, die objektive Gewissheit eines Ausspruches die unabweisliche Bedingung zu dessen rechtlicher Anwendbarkeit ist, so folgt, dass auch der ärztliche Ausspruch, sofern er zum Behufe der Gerichtspflege gegeben wird, nothwendig vorzugsweise die äussere Thätigkeit des Untersuchten berücksichtigen und hervorheben müsse, wenn er seinem Zwecke entsprechen soll, weil gerade die äussere Thätigkeit dasjenige ist, welches hier die objektive Anschauung gestattet.
Da wir auf diesen Gegenstand im Verlaufe dieses Aufsatzes zurückkommen müssen, so möge folgendes Beispiel die Sache erläutern:
Es sei der Fall eines nach mehreren Stunden heftiger Leibesschmerzen, Erbrechen, Beängstigung etc. erfolgten Todes eines Menschen vorgekommen, 85 und die pathologische Untersuchung würde alle Erscheinungen einer Vergiftung durch Arsenik darstellen. Würde wohl, ungeachtet der Arzt sich für vollkommen überzeugt hält, die Todesursache sei keine andere als eben die Arsenikvergiftung, dieser Ausspruch genügen, und die chemische Untersuchung entbehrlich sein? Gewiss nicht, denn für den Richter ist immer noch die Möglichkeit denkbar, dass der Arzt sich doch könne getäuscht haben, weil er (der Richter) sein Vertrauen auf die Persönlichkeit des Arztes nicht so weit ausdehnen darf, um sich nicht anschauliche Beweise von dessen objektiver Richtigkeit zu verschaffen. Ist aber durch die chemische Untersuchung der Arsenik aufgefunden, so ist erst objektiv bewiesen, dass der Arzt sich nicht geirrt, und seine pathologische Ansicht das Wahre getroffen habe.
Eben so ist es bei dem Irrsinn. So lange der Arzt nur aus pathologischen Gründen argumentirt, z. B. aus einer abnormen Beschaffenheit gewisser Organe, oder aus den abnormen Aeusserungen gewisser Funktionen, deren normale Aeusserung dem Richter nicht bekannt ist, muss der Richter als Richter immer noch die Möglichkeit voraussetzen, dass der Arzt sich geirrt haben könne, wenn er gleich als Mensch, dort wo es sich um seine eigene pathologische Behandlung handelt, nicht den mindesten Anstand nehmen würde, sich dem erprobten Scharfblicke des Arztes anzuvertrauen. Erst wenn der Arzt ihm die äusseren abnormen Thätigkeiten des Untersuchten nachgewiesen hat, darf er als Richter den Ausspruch des Arztes als zweifellos richtig annehmen.
Dieser Unterschied zwischen der Ueberzeugung des Richters in seiner richterlichen und in seiner blos menschlichen Stellung wurde und wird in Praxi von Gerichtsärzten nicht selten übersehen, und darin liegt allein der Grund einer Menge von ungenügenden Gutachten. Der Arzt glaubt nicht selten durch Darlegung seiner auf Gründe der Wissenschaft gestützten Ueberzeugung und durch die Gründe der Wissenschaft dem Richter genügen zu können. — Der Richter aber darf gerade durch Gründe der Wissenschaft am wenigsten sich zu irgend einer Ansicht bestimmen lassen, weil ihm diese gerade am fernsten liegen, sondern er verlangt einen Beweis ad oculum, den der Arzt vielleicht für unbedeutend hält, und hat oft nicht das nöthige Geschick, den Arzt dahin zu führen, ihm diesen Beweis ad oculum zu 86 liefern; am Ende gehen beide Theile auseinander, ohne sich verstanden zu haben, wo doch das Verständniss gar nicht schwer gewesen wäre, wenn der Arzt bestrebt gewesen wäre, seine Ansicht durch in die Sinne fallende Thatsachen zu begründen.
Wenn wir nun zum Behufe der medizinisch gerichtlichen Darstellung das Verhältniss der menschlichen Thätigkeit zu dessen Umgebung als das wesentliche Moment anzunehmen genöthiget sind, so muss man billig fragen, was ist eine normale Thätigkeit des Menschen in Bezug auf dessen Umgebung? da ohne Zweifel die Abweichung von der normalen Thätigkeit diejenige Thatsache bildet, worauf es bei dieser Erhebung ankommt.
Die Antwort wird wohl einstimmig dahin ausfallen: diejenige Thätigkeit ist normal, welche der Objektivität der äusseren Erscheinungen entspricht, und diejenige ist nicht normal, welche dieser Objektivität entgegengesetzt ist. Wer durstig ist, ein passendes Getränk vor sich, und nicht besondere, ebenfalls objektiv richtige Gründe hat, sich dieses Getränk zu versagen, und trinkt, handelt normal, wer unter solchen Verhältnissen nicht trinkt, handelt nicht normal.
Diese Ansicht von normal und nicht normal ist aber nicht nur in der Erfahrung gegründet, sondern sie ist auch aus der Natur der Sache hervorgehend. — Die Sinne sind nämlich nicht Schöpfer der im Menschen vorhandenen Vorstellungen, sondern sie sind nur das vermittelnde Prinzip zwischen dem inneren Lebenstrieb und der Aussenwelt, sie können daher unmöglich anders, als objektiv richtig vermitteln, d. h. wo sie vermitteln, ist ihre Vermittlung eine richtige, die Thätigkeit, welche durch diese Vermittlung hervorgerufen wird, kann daher vom Standpunkte des Subjekts aus betrachtet keine andere sein, als eine objektiv richtige.
Wo daher eine den äusseren Verhältnissen nicht conforme Thätigkeit eintritt, ist es ganz richtig, zu sagen, dass sie nicht normal, d. i. für den Dritten, welcher diese nicht conforme Thätigkeit bei dem Subjekte gewahrt, von seinem Standpunkte aus unbegreiflich sei.
Wie ist nun eine solche nicht normale, d. i. den objektiven Verhältnissen nicht entsprechende Thätigkeit vom Standpunkte des Subjektes aus zu erklären?
87 Die Erfahrung gibt auch hier die entsprechende richtige Antwort, nämlich entweder: a) dasjenige, was hier eine Thätigkeit zu sein scheint, ist keine Thätigkeit, d. h. keine durch Vorstellungen bestimmte Aeusserung der Kräfte, sondern eine entweder mechanisch durch Einwirkung einer von Aussen wirkenden Gewalt, oder eine durch dynamischen Einfluss bedingte Kraftäusserung, z. B. der Mensch fällt und hält sich unwillkürlich an einen Strohhalm, oder ein Epileptischer oder Rasender schlägt um sich — oder b) der Mensch ist in einem Irrthume befangen.
Die erste Veranlassung ist zu sehr in der täglichen Erfahrung begründet, als dass es nothwendig wäre, hierüber ein Weiteres zu sagen.
Wie ist aber Irrthum möglich, wenn die Behauptung, dass die Sinne nicht trügen können, richtig ist?
Auch hier ergeben sich zwei Erklärungsarten, welche beide richtig sind:
Die erste liegt in der nicht zu läugnenden Möglichkeit, dass die Sinne die äusseren Eindrücke nicht so vollkommen auffassen, dass nicht die sich entwickelnde Vorstellung gegenüber der objektiven Beschaffenheit der äusseren Gegenstände mangelhaft bliebe, und daher die Thätigkeit sich im Verhältnisse zur Objektivität mangelhaft äussert.
Die zweite dieser möglichen Veranlassungen liegt darin, dass ein Mensch dasjenige, was nur Gegenstand seiner Vorstellung ist, für etwas Objektives hält.
Die erste Veranlassung bedarf keine weitere Erörterung, die zweite ist dadurch minder begreiflich, weil, wenn es richtig ist, dass die Sinne nur das zwischen äusserer Erscheinung und Vorstellung vermittelnde Prinzip sind, es nicht möglich scheint, dass der Mensch eine andere Vorstellung haben kann, als jene, welche der Wirklichkeit entspricht.
Dieser Einwurf ist allerdings gegründet und lässt sich nur dadurch beseitigen, dass man den Satz als wahr zugibt, noch nie habe ein Mensch oder ein sonstiges animalisches Wesen eine Vorstellung gehabt, welche der Wirklichkeit in ihren einzelnen Theilen nicht entsprochen hätte; diesen Satz kann man aber auch als wahr zugeben, denn wenn man sich z. B. ein Flügelpferd vorstellt, so ist dies auch ein Gegenstand einer wirklichen Anschauung, denn Jeder hat schon Flügel und hat schon Pferde gesehen, nur die Kombination dieser beiden Objekte entspricht nicht der Wirklichkeit.
88 Eine solche der Wirklichkeit nicht entsprechende Vorstellung ist daher grösstentheils eine Wirkung der Reproduktionsthätigkeit, und besteht so zu sagen aus einem Mosaikbild von, der Wirklichkeit zwar entsprechenden, jedoch in eine Zusammensetzung gebrachten Vorstellungen, welche Zusammensetzung der Wirklichkeit nicht entspricht.
Dass aber diese Art und Weise, das Vorhandensein solcher, der Wirklichkeit nicht entsprechender Gebilde zu erklären, die richtige sei, ergibt sich daraus, weil bei Thieren, deren Vorstellungen an Zahl jenen, welche bei den Menschen vorkommen, bedeutend nachstehen, so wie auch bei Kindern in den ersten Lebensjahren derlei Gebilde viel weniger wahrzunehmen sind, als bei entwickelten Menschen, bei denen die Zahl der vorhandenen Vorstellungen, und daher auch jene der durch Reproduktion Statt gefundenen Kombinationen viel geringer ist18.
89 Nachdem sich nun die Möglichkeit einer Vorstellung, welche der Aussenwelt nicht entspricht, auf solche Art ganz naturgemäss erklärt, so kann man nur noch fragen, wie es möglich ist, dass der Mensch oder das animalische Wesen nicht alle Kombinationen seiner Reproduktionsthätigkeit für Wirklichkeiten hält?
Diese Erscheinung lässt sich nun wohl nur dadurch erklären, dass die Empfindung bei der unmittelbaren Wahrnehmung eine andere ist, als jene, welche die Gebilde der Reproduktionsthätigkeit begleitet.
Wenn man einen kalten Gegenstand anrührt, so empfindet man offenbar etwas Anderes, als wenn man sich diese Empfindung vorstellt.
Da nun der Mensch oder das animalische Wesen seine Lebensthätigkeit mit wirklichen Empfindungen beginnt, welche im Verhältnisse zu der anfangs nur wenig intensiven Reproduktionsthätigkeit ohne Vergleich stärker sind, so muss er auch den Unterschied, welcher zwischen einem wirklichen und einem blos vorgestellten Eindrucke obwaltet, auffassen, und somit Wirklichkeit von blosser Vorstellung bis zu einem gewissen Grade unterscheiden.
Diese Unterscheidung kann nun auf diese Art nur bis zu einem gewissen Grade gehen, da bei sehr lebhaften Vorstellungen die Empfindungen den durch die Wirklichkeit erregten möglicher Weise so nahe kommen können, dass eine Unterscheidung nicht mehr möglich ist.
Dass aber in der That ein solcher Mangel an Unterscheidung oft wirklich eintritt, lehrt uns die Erfahrung. Man denke an die Bilder des Traumes, an die Gebilde des Wahnsinnes, und was noch näher liegt, an die Täuschungen, die uns täglich widerfahren.
Man begegnet Jemanden, hält ihn für einen erwarteten Bekannten, und gewahrt nun, dass es ein Fremder sei u. s. w.
Hieraus folgt nun, dass die gewöhnliche Ansicht, der Irrthum könne dadurch entstehen, dass Jemand seine blosse Vorstellung für etwas Wirkliches halte, vollkommen psychologisch richtig sei.
Wenn nun ein Mensch durch eine gewisse Thätigkeit Rechte verletzt, so ist er dafür verantwortlich, und zwar strafbar, wenn Gesetze bestehen, welche wegen dieser Verletzung der Rechte eine Strafe verhängen; er muss jedoch von dieser Strafe verschont bleiben, wenn nachgewiesen wird, dass entweder seine Thätigkeit eine unfreiwillige, d. i. 90 nicht von einer bestimmten Vorstellung hervorgerufene war, weil er in diesem Falle nicht als Mensch, sondern als ein durch eine blind wirkende Kraft bestimmtes Wesen thätig war, oder dass er zwar nach einer Vorstellung handelte, dass jedoch diese eine irrige, d. i. der Objektivität nicht entsprechende gewesen ist, d. h. mit anderen Worten, dass er aus Irrthum so gehandelt habe, wenn dieser Irrthum die verübte Thätigkeit bedingte.
Wo daher in einem speziellen Falle eine Vermuthung für die eine oder die andere abnorme Bestimmung seiner Thätigkeit eintritt, ist es die Aufgabe des Gerichtes, die Nachweisung zu liefern, dass und warum seine Thätigkeit die Wirkung einer blinden Kraft oder eines Irrthumes gewesen ist.
Zu dieser Ausmittlung gibt es nur zwei Wege, den objektiven, wo durch Erhebung der obgewalteten Umstände dargethan wird, dass der Mensch wirklich ohne alle Selbstbestimmung gehandelt habe, oder in einem Irrthume befangen war, oder den subjektiven, wo aus der Beschaffenheit des Individuums dargethan wird, dass die ausgeübte Thätigkeit eine Wirkung einer blind sich äussernden Naturkraft oder eines durch die Beschaffenheit des Individuums erzeugten, und daher für denselben nothwendigen Irrthumes gewesen sei.
Ein Beispiel solcher subjektiven Nachweisung erster Art ist der Fall, wo etwa ein Epileptischer in seinem Paroxismus einen Dritten durch Herumschlagen beschädigt; ein Beispiel der zweiten Art ist, wo nachgewiesen wird, dass Derjenige, welcher etwa einer Wache auf ihr Zurufen, einen bestimmten Ort nicht zu betreten, keine Folge leistet, und sich dann bei angewandter Gewalt widersetzt, taub war, und sich wegen Nichterkennung der Wache von einem Räuber angefallen hielt.
In diese Kategorie gehört nun insbesondere der Irrsinn, nämlich derjenige Zustand, in welchem der Mensch aus einer krankhaften Stimmung entweder nach Vorstellungen handelt, weil er sie für wirklich hält, oder für gewisse Eindrücke, obgleich die Sinnesorgane zu deren Aufnahme geeignet sind, keine entsprechenden Vorstellungen produzirt.
Der Zweck jeder gerichtlichen Erhebung des Irrsinnes ist daher kein anderer, als die Erhaltung des rechtlich giltigen, somit von Kunstverständigen abzugebenden, oder von diesen zu bestätigenden 91 Ausspruches, dass der Mensch, welcher eine bestimmte, sonst sträfliche That beging, dieselbe in einem Zustande begangen habe, in welchem er entweder von keinen Vorstellungen, sondern (wie in der Raserei) nur durch eine blinde Naturkraft geleitet wurde, oder dass er zwar von Vorstellungen bestimmt wurde, die jedoch aus dem Grunde der Wirklichkeit nicht entsprachen, weil er vermöge seines eigenthümlichen krankhaften Zustandes entweder nicht im Stande war, die Nichtobjektivität seiner ihn bestimmenden Vorstellung einzusehen, oder nicht vermochte, die der Wirklichkeit entsprechende Vorstellung zu produziren.
Dies ist der Zweck der gerichtlichen Erhebung, und daher die Aufgabe des Arztes, seine Untersuchung und Darstellung so einzurichten, dass Pro oder Contra bezüglich dieses Resultates deutlich, d. i. auf eine für den Richter vollkommen verständliche Weise hervorgehe. Das Mittel dazu ist die durch das Studium der sämmtlichen Zweige der medizinischen Wissenschaften geschärfte Beobachtung, unter Anwendung der auf diesem Felde gewonnenen Erfahrungen, denn es handelt sich darum, die Gewissheit zu erhalten, dass alle hierüber Aufschluss gebenden Momente benützt seien; diese Momente liegen aber entschieden sowohl in der besondern Beschaffenheit des Subjektes, als in der pathologischen und physiologischen Beschaffenheit der menschlichen Natur, es kann daher nur ein solcher Ausspruch hierüber als rechtlich giltig angesehen werden, welcher von einem hierin vollkommen Bewanderten gegeben wird, und diese Vermuthung kann in Bezug auf den in Frage stehenden Gegenstand nur bei dem Arzte eintreten19, 92 der aber seinerseits wieder nicht blos die Verhältnisse des Individuums als solches zu berücksichtigen haben wird, sondern auch die Aufgabe erhält, das Verhältniss darzustellen, wie die äusseren Verhältnisse, in denen sich das Individuum zur Zeit der verübten That befand, auf seine innere Thätigkeit vermöge seines individuellen Zustandes eingewirkt haben.
Diejenigen wissenschaftlichen Daten anzugeben, oder die Art und Weise darzustellen, wie die als der Zweck der gerichtlichen Erhebung 93 des Irrsinnes im vorigen Paragraphe dargestellte Aufgabe nach medizinisch wissenschaftlichen Grundsätzen zu lösen sei, ist ausserhalb den Gränzen des Zweckes dieses Aufsatzes, und auch ausserhalb den Gränzen des Wissens des Verfassers, der sich mit der Ueberzeugung beruhigt, dass die medizinische Wissenschaft hierin so Vieles geleistet habe, dass es jedem gebildeten, lebenserfahrenen Arzte, welcher sich diesem Zweige der Wissenschaft widmet, möglich sei, sich hierin die zu dem gerichtlichen Zwecke nöthige Vollkommenheit zu erwerben; es erübrigt daher nur auf einige, insbesondere in gerichtlich medizinischen Werken vorkommende Ausdrücke hinzuweisen, weil diese Ausdrücke, eben weil sie unrichtig sind, zu Missverständnissen führen müssen, welche der Verständlichkeit der Darstellung schaden.
Der schlimmste Fehler, in den man verfallen konnte, war wohl jener, dass man die pathologische Eintheilung der krankhaften Gemüthszustände, nach welcher man die Seelenstörungen in gewisse Rubriken, als: Krankheiten des Verstandes und Krankheiten des Gemüthes, die ersteren in Blödsinn und Narrheit, die letzteren in Melancholie oder Wahnsinn, Tollheit oder Manie eintheilt, in Lehrbücher der gerichtlichen Arzneikunde aufnahm, zum Ueberflusse aber dabei gewisse Grade bei den einzelnen derartigen damit befallenen Subjekten feststellte.
Ich lasse den Werth oder die Nothwendigkeit, solche Eintheilungen in pathologischer Beziehung zu machen, natürlich dahingestellt, allein in rechtlicher Beziehung konnte man nicht leicht etwas Zweckwidrigeres beginnen, denn es musste dadurch, insbesondere aber durch die Eintheilung in Grade nothwendig, wenigstens bei dem Richter, die Voraussetzung begründet werden, dass der geringste Grad dieser Störungen, die Zurechnung weniger aufhebe als der höchste, und auch der Arzt musste auf ähnliche Voraussetzungen verfallen, denn wenn er durch das Lehrbuch angewiesen wird auf diesen Unterschied zu reflektiren, so konnte dies doch nur darum geschehen, weil derselbe von irgend einem Einflusse für die Beurtheilung des Richters ist, diesem daher um den Ausspruch, das Subjekt leide z. B. an Narrheit im ersten oder dritten Grade, wesentlich zu thun sein müsse, während doch in der That der Richter durch diesen Ausspruch nicht mehr Zweckdienliches erfährt, als wenn der Arzt gesagt hätte, das Subjekt leide am Typhus oder an einem Magenübel, da in der Benennung der Krankheitsform nicht der mindeste Anhaltspunkt zu einer rechtlichen Beurtheilung liegt.
94 An und für sich kann übrigens der Ausdruck Seelenstörung nicht gebilligt werden, denn er zeigt, dass man sich die Seele des Menschen als einen gewissermassen abgesonderten, gleichsam nur durch eine Art Landzunge mit dem Körper verbundenes, oder wenn man will in den Körper eingeschaltetes Wesen denkt, und diese Ansicht ist durch keine Erfahrung objektiv begründet, — die Annahme dieses Dualismus von Seele und Körper ist eine Hypothese, welche selbst von denjenigen, welche ihr huldigten, dadurch als unhaltbar anerkannt wurde, dass sie noch ein drittes Verbindendes, den Geist, anzunehmen genöthigt waren, und dadurch stillschweigend das Geständniss ablegten, dass die Annahme des Menschen als eines aus Theilen bestehenden Wesens unhaltbar sei, und man daher nothwendig dahin zurückkehren müsse, den Menschen als ein ungetheiltes, d. h. nicht aus, wenn auch ideellen, Theilen bestehendes Wesen zu betrachten20.
Der Mensch, so lange er hier auf Erden wandelt, ist in allen seinen Funktionen nur ein Wesen, er besteht nicht aus Theilen, welche etwa auch einer ohne den anderen bestehend gedacht werden können, sondern zum Wesen des Menschen gehört zugleich Körper und Seele, es lässt sich daher auch kein Seelenleiden denken, was nicht ein Leiden des Menschen überhaupt wäre, nur ist es möglich, dass dessen Wirkung sich so ausspricht, dass es uns als eine Abnormität in der durch Vorstellungen bedingten äusseren Thätigkeit erscheint. Wenn man daher von Seelenkrankheit spricht, und dadurch die Krankheit selbst bezeichnet, so ist es eben so nur figürlich gesprochen, als wenn man irgend eine Krankheit nach dem Symptom bezeichnet, in welchem sich die Krankheit ausspricht, wenn man z. B. von einer Brechkrankheit sprechen wollte.
Betrachtet man aber den Ausdruck Seele, als den Inbegriff alles physischen Vermögens, so ist es durchaus unlogisch, von einer Seelenkrankheit zu sprechen, denn der Ausdruck Vermögen bedeutet 95 nichts anderes als die Kraft, welche eine bestimmte Wirkung hervorbringt. — Eine Kraft kann nun wohl irgendwo nicht vorhanden sein, dann aber wird sie auch gar keine Wirkung hervorbringen, von deren Vorhandensein man auf ihre Existenz schliessen könnte.
Man kann daher eben so wenig von einem gestörten Seelenvermögen sprechen, als von einem gestörten Athmungsvermögen. Die Respirationswege können krank, und dadurch zur Ausübung des Athmungsvermögens minder geeignet sein, nicht aber das Athmungsvermögen. (S. §. 20.)
Noch weniger kann es gebilliget werden, wenn man von Verstandeskrankheiten spricht, denn der Verstand ist nicht einmal ein Vermögen.
Wenn wir nämlich auf diejenigen Ergebnisse sehen, welche man als Wirkung des Verstandes bezeichnet, so sind dies Urtheile und Schlüsse.
Urtheile und Schlüsse sind nun wohl längst vorhanden gewesen, ehe man ihr Dasein bemerkte, man kam jedoch dahin, dieses ihr Dasein zu bemerken, weil man fand, dass, wenn richtige, d. h. der Aussenwelt entsprechende Vorstellungen kombinirt, und daraus Begriffe, aus deren Kombination aber weitere Begriffe, d. i. Urtheile und Schlüsse entwickelt wurden, deren Ergebnisse ebenfalls der Aussenwelt entsprachen; und dieses Ergebniss nannte man ein Produkt des Verstandes.
Also wo richtige Urtheile und Schlüsse erfolgen, kann man die diesfällige Thätigkeit Verstand nennen, andere als richtige Urtheile sind aber gar nicht möglich, denn Dasjenige, was man ein unrichtiges Urtheil nennt, ist entweder ein richtiges Urtheil, und entspricht nur darum nicht der Wirklichkeit, weil demselben objektiv unrichtige Vorstellungen zu Grunde lagen, oder es ist gar kein Urtheil, sondern es klingt nur so. Wer z. B. sagt: eins und eins ist Eins, der hat gar nicht geurtheilt, d. h. hier nicht gezählt, sondern ein ihm bekanntes Wort reproduzirt und ausgesprochen.
Eben so wenig steht es aber in der menschlichen Willkür, über gegebene Vorstellungen anders, als auf eine Art zu urtheilen. Selbst der Weise urtheilt nicht anders als der Thor, wenn Beiden dieselben Vorstellungen vorschweben. — Eins und eins ist Zwei, spricht das Kind, welches rechnen lernt, aus eigener Ueberzeugung, mit gleicher Gewissheit, wie der grösste Mathematiker; der Unterschied besteht darin, 96 dass dem Weisen mehreres und gediegeneres Materiale und zur rechten Zeit zu Gebote steht, während der Thor wegen ihm vorschwebender mangelhafter, oder sonst irriger Vorstellungen, entweder unrichtig oder gar nicht urtheilt. — Man kann daher ganz entschieden sagen, dass bei der Funktion des Urtheilens, so wenig als bei dem Kreislaufe des Blutes, irgend eine Willkür Statt findet; denn wenn man die Funktion des Denkens in einem gewissen Grade willkürlich ausüben kann, so geschieht dies nur dadurch, dass man willkürlich die Reproduktionsthätigkeit reizt.
Die Produkte dieser erhöhten Reproduktionsthätigkeit, nämlich die entstehenden Urtheile u. s. w. zu regeln, steht nicht in der Macht des Menschen.
Eine Thätigkeit, bezüglich deren jedoch gar keine Willkür Statt findet, kann man auch nach logischen Grundsätzen unmöglich ein Vermögen nennen, so wenig als man den Kreislauf des Blutes ein Vermögen nennen kann.
Von dem Ausdrucke Gemüthskrankheit gilt ungefähr dasselbe, was von jenem „Verstandeskrankheit” gilt, nur kommt noch hinzu, dass man, während sich die meisten Menschen, unter dem Ausdrucke Verstand beiläufig das Nämliche, d. h. das Vermögen zu urtheilen und zu schliessen, denken, selten zwei Menschen finden wird, welche gleiche Begriffe mit diesem Ausdrucke, und selten einen, welcher im Stande ist, eine, einigermassen erträgliche Definition zu geben.
Ein Ausdruck, dessen Begriff man nicht wieder geben kann, ist ein Wort, und mit Worten darf man sich nicht abspeisen lassen, wenn es sich um Sachen handelt.
Ich habe ein Werk vor mir, in welchem die Krankheiten des Gemüthes als solche bezeichnet werden, „wo ebenfalls (nämlich wie bei den Verstandeskrankheiten) das Erkenntnissvermögen des Menschen mit den Gesetzen der allgemeinen Erfahrungen und der Vernunft in Widerspruch geräth, dieses Abweichen jedoch sich zugleich durch eine auffallende Störung des Gemüthes in Rücksicht auf Gefühle und Willensbestimmung ausspricht.”
Wissen meine verehrten Leser jetzt, was Gemüthskrankheit ist? Ich bringe aus dieser Definition nur so viel heraus, Gemüthskrankheit sei eine Krankheit des Gemüthes, und das Gemüth spreche sich in Gefühlen und in der Willensbestimmung aus.
97 Omnis definitio periculosa ist ein allen Rechtskundigen zur Genüge bekannter Satz.
Will man daher für die Rechtskunde etwas Brauchbares liefern, so muss man sich vor Definitionen hüten, und bei der Sache bleiben, um die es sich handelt, nie aber Definitionen statt materiellen Verhältnissen vorlegen, sonst wird und muss Derjenige, der einen solchen Weg einschlägt, an sich selbst irre werden.
Da übrigens die Ausdrücke Gefühl und Wille in den Abhandlungen über Wahnsinn eine bedeutende Rolle spielen, weil sie vielfältig darin vorkommen, so glaube ich es nicht unterlassen zu dürfen, auch hierüber Einiges zu sagen.
Gefühl und Empfindung ist zweierlei, darüber ist man so ziemlich einverstanden, über den Unterschied zwischen Gefühl und Empfindung ist man sehr wenig im Reinen. Man muss jedoch, ohne paradox zu werden, sagen, dass manchmal zwei Menschen in demselben Augenblicke, und wohl auch derselbe Mensch in verschiedenen Augenblicken bei derselben Empfindung verschiedene Gefühle haben.
Das Ausbrechen eines Zahnes ist immer die Empfindung des Losbrechens eines mit dem Körper verwachsenen Theiles — es ist aber für Denjenigen, an welchem diese Operation vollzogen wird, in einem Augenblicke, wo er gerade nicht an Zahnschmerzen leidet, das Gefühl des Schmerzes, wenn aber der Schmerz bis zum Beginn der Operation heftig wüthet, so ist selbst der Schmerz der Operation eine Art Erleichterung, weil dadurch der frühere Schmerz aufhört; man kann daher sagen, dass der Letztere durch das Zahnausziehen gewissermassen ein angenehmes Gefühl hat, während der Andere nur ein unangenehmes, nämlich jenes durch das Losbrechen verursachten Schmerzes erleidet, den auch der Andere, jedoch mit dem Gefühle einer Erleichterung, empfindet.
Wenn man daher schon definiren will, so könnte man Gefühl als ein Bewusstwerden des Totaleindruckes bezeichnen, welchen eine bestimmte Empfindung, d. i. ein wahrgenommener sinnlicher Eindruck auf das Gesammtleben macht, oder mit anderen Worten, die Empfindung der Reaktion der Lebensthätigkeit gegen den Eindruck auf den Sinn.
Hierin kann nun wohl kein Irrsinn, nicht einmal eine Täuschung obwalten, denn man nimmt nicht wahr, dass etwas angenehm ist, wenn man sich nicht angenehm, wenigstens in dem Augenblicke, angeregt fühlt.
98 Was den Willen betrifft, so nennen wir also (jedoch mit Unrecht, denn man sollte sagen Wollen, nicht Wille) (§. 20) diejenige Bestimmung der Thätigkeit des Menschen, wodurch er den Gegenstand einer Vorstellung in der Aussenwelt zu erreichen bemüht ist. Wo also keine Bestimmung der Thätigkeit zur Erreichung des Gegenstandes einer bestimmten Vorstellung vorkommt, dort ist auch kein Wille. Wie kann darin eine Störung vorkommen? Dasjenige, was ein Mensch will, kann dem zweiten, und allen übrigen sehr verkehrt vorkommen, der Wille selbst aber bleibt immer das Nämliche21.
Selbst bei Irrsinnigen findet man aber kein verkehrtes Wollen, so wenig als eine verkehrte Willensbestimmung. — Der Irrsinnige, welcher zum Fenster hinausspringen will, weil er sich von Räubern verfolgt wähnt, springt wirklich hinab; Derjenige, welcher glaubt, Sonnenstrahlen verspeisen zu können, legt sich mit offenem Munde unter die Sonne u. s. w., also auch nicht einmal hier ist eine Verkehrtheit des Willens zu gewahren.
Spricht man aber von dem Willen als einer moralischen Funktion, so kann man unter diesem Ausdrucke auch nichts anderes verstehen, als die mit dem Bewusstsein, d. i. mit der Vorstellung der Sittlichkeit einer Handlung, oder gegen das Bewusstsein der Sittlichkeit derselben stattfindende Anwendung der Thätigkeit. Hier kann es sich nun wohl treffen, dass ein Mensch etwas thut, weil er es nach seiner Vorstellung der Verhältnisse für sittlich hält, während diese nämliche Handlung von einem andern, welcher die Unrichtigkeit der Voraussetzung des andern von seinem Standpunkte aus gewahrt, für unsittlich gehalten wird. Der Wahnsinnige, welcher in der Vorstellung, er schlachte ein Kalb, einen Menschen tödtet, will nichts Unsittliches, ebenso will Derjenige, welcher in sich den Drang zur Ermordung eines Andern verspürt, jedoch diesem Drange entgegenarbeitet, nicht etwas Unsittliches, 99 sondern er will vielmehr die ihm als unsittlich erscheinende Wirkung vermeiden.
Wenn er also ungeachtet seines inneren Widerstrebens doch den Mord vollbringt, so kann man diese That nicht aus einem verkehrten Willen, sondern nur dadurch erklären, dass sein Wollen durch eine psychische Gewalt unwiderstehlich besiegt worden sei, wie etwa Derjenige, welcher sich anhält, um nicht in einen Abgrund zu fallen, ohne sein Wollen hinabfällt, wenn seine Muskeln ihre Kraft verlieren und er daher den Gegenstand, an den er sich gehalten hat, auslässt.
Es lässt sich daher in der That weder von einer Krankheit, noch von einer Störung der Willensbestimmung sprechen.
Eben so wenig lässt sich aber auch von einer Störung oder einer Krankheit der Vernunft als derjenigen Anlage sprechen, wodurch der Mensch das Sittliche auffasst, denn der Mensch kann nur sittlich handeln, oder unsittlich, d. h. gegen die Bestimmung des Sittengesetzes seinen Sinnen folgen; er kann seiner Vernunft entgegenhandeln, nicht aber ihr Wesen verändern, so wie man wohl das Auge von etwas wegwenden, nicht aber etwas anderes sehen kann, als man eben sieht.
Als Krankheit der Sinne kann übrigens der Irrsinn ebenfalls nicht bezeichnet werden, denn eine Krankheit der Sinne kann nur entweder eine Stumpfheit derselben gegen gewisse Eindrücke, z. B. Blindheit, Taubheit u. dgl. oder eine Anregung sein, welche der Empfindung, die dieser nämliche Eindruck auf ein gesundes Organ hervorbringen würde, nicht entspricht; z. B. ein krankes Auge wird bei dem Reflex des Lichtes von einem glänzenden Körper den nämlichen Eindruck empfinden, wie etwa ein gesundes Auge, welches in die Sonne sieht, allein die Vorstellung, welche dadurch entsteht, ist dennoch eine richtige, denn sie entspricht ganz und gar der Art und Weise, wie das Subjekt durch diesen Eindruck wirklich erregt wurde.
Der am Podagra Leidende ist nicht wahnsinnig, wenn er sich vor der geringsten Berührung scheut, welche seinem Fusse droht, sondern sein Abscheu gegen jede Art von Berührung kommt von der sehr richtigen Erfahrung her, dass jede Berührung ihm grosse Schmerzen verursacht u. s. w.
100 Wenn nun der Irrsinn weder als Seelenkrankheit, noch als eine Krankheit des Verstandes, noch des Gemüthes, noch des Gefühles, noch des Willens, noch endlich als eine Krankheit oder Störung der Sinne erklärt werden kann, so scheint es wohl billig zu fragen, was denn der Irrsinn eigentlich sei.
Ist es aber auch nothwendig, diese Frage zu beantworten22, ja ist es überhaupt nothwendig zu wissen, was das Wesen einer Krankheit ist? Ein solches Wissen ist selbst in pathologischer Beziehung nicht nothwendig, weil es nicht möglich ist, denn alles medizinische Wissen gründet sich auf Erfahrung, und die Erfahrung kann nichts weiter lehren, als dass krankhafte Zustände von gewissen abnormen Erscheinungen begleitet sind, und dass ihnen gewisse abnorme Erscheinungen zu folgen pflegen. Warum aber z. B. der Erkältung eine Entzündung der Schleimhäute folgt, darüber lassen sich nur Vermuthungen, keine Gewissheit geben; es ist aber auch gar nicht nothwendig, hierüber etwas zu wissen, denn auch ohne alle Kenntniss hierüber wird jeder Arzt wissen, wie er einen auf Erkältung gefolgten Husten zu behandeln hat.
Wenn also ein solches Kennen des eigentlichen Wesens der Krankheit schon für den praktischen Arzt entbehrlich ist, so ist es noch mehr für die Gerichtspflege, von welcher jede Hypothese, eben weil sie keine rechtliche Gewissheit ist, ausgeschlossen sein muss. Der Arzt entspricht daher seiner Aufgabe als Gerichtsarzt nie mehr, als wenn er sich strenge an die Resultate seiner eigenen ärztlichen Erfahrung und jener seiner Vorgänger hält, denn diese sind objektive Thatsachen, über welche seine Aussage, als jene eines vollkommen giltigen Zeugen23, vollkommen rechtliche Glaubwürdigkeit verdient, da 101 man nur bei dem Arzte hierin die nöthige Beobachtungsgabe voraussetzen kann.
Wenn der Richter zu wissen benöthiget, ob eine That nicht wegen Statt gefundenem Irrsinne straflos zu halten sei, so bedarf er nicht unbedingt zu wissen, ob das Subjekt überhaupt irrsinnig, oder wie manchmal gesagt wird, überhaupt, oder in Bezug auf die bestimmte That unzurechnungsfähig sei, sondern er bedarf zu wissen, ob die, unter den gegebenen Umständen verübte That nicht ihr Motiv in einem solchen abnormen Zustande des Individuums habe, durch welchen es entweder ohne Vorstellung von dem, was es bewirkte, seine Thätigkeit äusserte, oder durch welchen ein solcher Irrthum erzeugt wurde, welcher ihm die begangene That als eine erlaubte Thätigkeit unter eben diesen gegebenen Umständen erscheinen liess24.
102 Diesem zu Folge wird nach der Natur der Sache jedes ärztliche Gutachten dieser Art folgende Momente zu unterscheiden haben:
1. Ob der Mensch vermöge der Unvollkommenheit oder Abnormität seiner Sinnesorgane überhaupt im Stande sei, Vorstellungen zu solcher Deutlichkeit zu bringen, dass sie als Bestimmungsgrund seiner Handlungen erscheinen können.
2. Ob die Unvollkommenheit oder Abnormität der Sinneswerkzeuge von der Art sei, dass sie das Individuum ausser Stand setzte, unter den gegebenen Umständen eine richtige Vorstellung von der durch ihn ausgeübten Thätigkeit zu haben.
Diese beiden Fragen werden bei Untersuchung eines Blödsinnigen vorzugsweise zur Sprache kommen.
3. Ob die Beschaffenheit der Vorstellungsthätigkeit im Allgemeinen von der Art ist, dass zwischen ihr und der sich äussernden Thätigkeit gar kein Zusammenhang wahrnehmbar ist. — Dies ist die bei vorkommender Raserei oder Tobsucht zu beantwortende Frage.
4. Ob im Allgemeinen ein solches Verhältniss der Vorstellung zur äusseren Thätigkeit vorhanden ist, dass der Mensch entweder durchaus nicht im Stande ist, die Gegenstände seiner Vorstellung von der Wirklichkeit zu unterscheiden, oder in dem vorgekommenen Falle doch hiezu nicht fähig war. — Diese Frage wird zu beantworten sein, wo es sich um Wahnsinn handelt, unter welchem Ausdrucke die fixe Idee (d. i. ein für Wirklichhalten einer Vorstellung ohne äussere Thätigkeit), Monomanie (ein für Wirklichhalten einer vorhandenen Vorstellung, mit einer diesem Wahne entsprechenden Thätigkeit), Melancholie (d. i. eine Stimmung, in welcher auf den Leidenden traurige Vorstellungen so intensiv wirken, dass er sich von deren Nichtobjektivität nicht überzeugen kann), und dem Gegentheile davon, in welchem der Leidende keiner ernsten Vorstellung fähig ist, d. h. alles was ernsthaft ist, für nicht vorhanden hält25, verstanden werden dürfte.
103 5. Ob die Thätigkeit, welche die in Frage stehende Wirkung hervorbrachte, durch eine solche für wirklich gehaltene Vorstellung einzig und allein veranlasst ist.
6. Ob das Individuum für eine gewisse Art Vorstellung, durch deren Mangel sich die verübte That erklären lässt, etwa wirklich unzugänglich sei; (von dieser Art scheint der in der vorigen Anmerkung berührte Fall zu sein).
Die eine oder die andere dieser Fragen wird, wo es sich richterlicher Seits darum handelt, zu erheben, ob eine That zurechenbar sei, nothwendig durch den Arzt beantwortet werden müssen, nur wird es aber auch die Aufgabe des Arztes bleiben, zu beurtheilen, ob mit einer oder der anderen Frage allein der Gegenstand der Untersuchung erschöpft ist, oder ob um den Zustand des Menschen im Augenblicke der That zu beurtheilen, es nicht nothwendig sei, durch eine, auch mehrere der aufgestellten Fragen umfassende Darstellung, die Nachweisung zu liefern, inwieweit in dem Augenblicke der begangenen That das Verhältniss der Psyche zur physischen Thätigkeit ein abnormes war, inwieweit daher die physische Thätigkeit von der Psyche sich unabhängig, oder sich in Folge eines in den physischen Verhältnissen gegründeten Irrthumes, oder in Folge des Vorhandenseins beider Momente unter den gegebenen Verhältnissen geäussert hat.
Mit dem bisher Gesagten dürfte sowohl dem Leser, welcher Arzt ist, die Richtung angedeutet sein, welche seine Untersuchung und seine Darstellung zu nehmen hat, als demjenigen Leser, welcher dem juridischen Stande angehört, das Verständniss geöffnet sein, was und wie er vom Arzte das ihm zu wissen Nöthige erlangen soll.
104 Auf diesem Wege ist wohl jede Streitfrage über die ärztliche und richterliche Kompetenz undenkbar, denn der richterliche Einfluss kann und darf auch hier nur so weit und nicht weiter gehen, als dies überhaupt bei jedem Gutachten der Fall sein kann und muss, so weit nämlich, dass vom Arzte nichts übersehen bleibe, was dem Richter wichtig, und nichts behauptet werde, was dem Richter unwahr scheint. — Hier bitte ich meine verehrten Leser Dasjenige zu berücksichtigen, welches ich mir in dem ersten Aufsatze dieses Werkes zu sagen erlaubte.
Ich könnte hier meine Abhandlung schliessen, da es jedoch gewisse Zustände des Menschen gibt, in welchen sich das Verhältniss der psychischen zur physischen Thätigkeit nicht so klar ausspricht, wie es die oben aufgestellten Fragen voraussetzen, so erlaube ich mir noch den nächstfolgenden Aufsatz nachzutragen, welcher die rechtliche Bedeutung der Affekte und Leidenschaften, und die Erhebung anderer zweifelhafter Gemüthszustände behandelt.
Für Diejenigen meiner verehrten Leser, welche dem ärztlichen Stande angehören, dürften folgende Bemerkungen jedoch noch von einiger Wichtigkeit sein.
Die Erhebung des Irrsinns kann im Wege des Strafverfahrens oder im Wege des Civilverfahrens Statt finden. Ueber den Zweck der Untersuchung im Strafverfahren ist sich im Verlaufe dieses Aufsatzes bereits umständlich ausgesprochen worden.
Was nun das Strafverfahren betrifft, so lassen sich drei verschiedene Gesichtspunkte unterscheiden, von welchen nach Beschaffenheit der Umstände diese Darstellung von Seite des Arztes aufgefasst werden muss.
Der erste dieser Gesichtspunkte betrifft den Umstand, dass Jemand vor Gericht gestellt wird, und der Richter bei ihm Spuren von Geisteszerrüttung wahrzunehmen glaubt. In diesem Falle handelt es sich ganz und gar nicht darum, ob die ihm angeschuldigte That zugerechnet 105 werden kann, ja nicht einmal darum, ob er sie wirklich begangen habe, sondern lediglich um die Frage, ob er überhaupt verhört werden kann; d. h. ob er seiner geistigen Beschaffenheit nach im Stande sei, die an ihn gestellten Fragen aufzufassen und zu beantworten.
Das österreichische Strafgesetz drückt sich im §. 363 1. Thl. hierüber folgendermassen aus:
„Wird die Beantwortung (beim Verhöre) mit einer auffallenden Sinnenverwirrung gegeben, so hat das Kriminalgericht den Verhafteten von zwei Aerzten und Wundärzten untersuchen, und von denselben das Gutachten schriftlich geben zu lassen, ob sie die anscheinende Sinnenverwirrung für einen wahren Anfall oder für Verstellung halten. Fällt das Gutachten dahin aus, dass es Verstellung sei, so ist der Verhaftete durch drei aufeinanderfolgende Tage bei Wasser und Brot zu halten, dann aber, nach wiederholter Warnung, mit Streichen von drei zu drei Tagen dergestalt zu bestrafen, dass mit zehn Streichen der Anfang gemacht, die Zahl jedesmal mit fünf vermehrt, und bis auf dreissig hinaufgestiegen wird. Lässt der Verhaftete auch dann noch von der Verstellung nicht nach, so ist der Vorfall mit Beilegung sämmtlicher Akten dem Obergerichte vorzulegen, und die Entscheidung hierüber abzuwarten. — Ist nach Meinung der Aerzte die Sinnenverwirrung wahr, oder können sie nach Pflicht und Rechtschaffenheit hierüber keinen Schluss fassen, oder wären sie in ihrer Meinung getheilt, so ist ebenfalls dem Obergerichte die umständliche Anzeige zu machen. — In dieser Anzeige sind auch die Bemerkungen einzurücken, welche dem Kriminalgerichte entweder selbst, oder dem Gefangenenwärter, bei Beobachtung des Gefangenen aufgefallen sind.”
Bei diesem Stadium der Untersuchung handelt es sich daher blos um das Gutachten über den gegenwärtigen pathologischen Zustand des Untersuchten, und es wird nur richtig zu stellen sein, a) ob diejenigen Aeusserungen, welche der Richter für ein Zeichen der Geisteszerrüttung hält, wirklich von diesem Zustande zeugen, und b) ob sie nicht in einer Verstellung ihren Grund haben.
Weiter als so weit hat daher der untersuchende Arzt in diesem Stadium der Untersuchung nicht einzugehen, jede Darstellung, welche dahin zielt, bezüglich der Zurechenbarkeit der That Aufschlüsse zu erhalten, wäre daher am unrechten Orte, sondern es wird das Gutachten des Arztes seinen Zweck nur dann vollkommen erreichen, 106 wenn es den klaren Ausspruch enthält, ob der in Frage stehende Anfall ein wahrer Anfall von Geisteszerrüttung, oder nur Verstellung sei; — der Arzt hat daher in einem solchen Falle weiter nichts zu berücksichtigen, als was ihm die Wissenschaft zu berücksichtigen vorschreibt, und sich nur zu hüten, das in Frage stehende Verbrechen, oder sonst Verhältnisse, welche, wenn sie vor der Zeit zur Sprache kämen, störend auf die gerichtliche Untersuchung einwirken könnten, in seiner Untersuchung mit dem Beschuldigten zu berühren.
Es handelt sich in diesem Falle nicht einmal um Beobachtung gerichtlicher Formen, wie bei der Erhebung des Thatbestandes, ja selbst die Intervention des Richters bei diesem Akte ist nicht einmal nothwendig, sondern die Erhebung ist eben so der Gegenstand eines rein pathologischen Krankenexamens, als wenn es sich etwa darum handelt, einen Menschen zu untersuchen, welcher an Brustbeschwerden, oder an einem andern pathologischen Zustande zu leiden vorgibt.
Der zweite Gesichtspunkt, ohne Zweifel der schwierigste, ist, wenn es sich darum handelt, dem Richter durch eine ärztliche Darstellung des Gemüthszustandes die nöthigen Anhaltspunkte zu liefern, um über die Zurechenbarkeit der That zu entscheiden.
Aus Demjenigen, welches bisher gesagt wurde, erhellt zur Genüge, dass es für den Richter niemals nothwendig ist, an die Aerzte die Frage zu stellen, ob die That zurechenbar sei, oder, wie wohl auch schon gefragt wurde, ob der Mensch sich in einem Gemüthszustande befinde, welche jede Zurechenbarkeit ausschliesst. Diese Frage hätte nur dann einigen Sinn, wenn der Gemüthszustand überhaupt von der Art ist, dass kein vernünftiger Mensch an der Unzurechnungsfähigkeit zweifeln wird, — dann entscheidet aber der Grund, welchen der Arzt für die Unzurechnungsfähigkeit anführt, nicht der Ausspruch, dass er unzurechnungsfähig ist; z. B. der Arzt sagt, der Mensch sei unzurechnungsfähig, weil er sich in dem Zustand vollkommener Raserei befindet, weil der Ausspruch vollkommene Raserei in der Sprache des Richters eben so viel heisst, als unzurechnungsfähig.
Ist aber der Fall nicht so klar, so ist eben so widersinnig, den Arzt zu fragen, ob der Mensch in Bezug auf eine bestimmte That als zurechnungs- oder unzurechnungsfähig zu betrachten ist, als wenn man fragen wollte, ob eine Handlung, durch welche ein Mensch um's 107 Leben kam, als Mord, Todtschlag oder Verwundung sollte zugerechnet werden, oder als ein Akt der Nothwehr erscheine etc. Jeder Arzt wäre daher berechtiget, eine solche Frage zurückzuweisen.
Bei Erhebungen dieser Art darf die gerichtliche Form nie fehlen, sonst kann der Akt niemals gegen den Beschuldigten beweisen, denn nur durch die gerichtliche Form wird der nöthige Beweis für die Wahrheit der Erhebung geliefert; dieser Beweis muss aber geliefert werden, weil die Erhebung des Irrsinns zum Behufe der Ausmittlung der Zurechenbarkeit einen wesentlichen Bestandtheil der Thatbestandserhebung bildet, sofern nämlich die gerichtliche Untersuchung überhaupt nichts anderes, als die Erhebung des (subjektiven und objektiven) Thatbestandes ist.
Nur in dem Falle ist eine Ausnahme vorhanden, wenn es sich um Erhebung der Aeusserungen eines solchen Menschen, wenn auch mit Bezug auf das Verbrechen, zur Erforschung seines Ideenganges handelt.
Hier ist es nicht nothwendig, ein ordentliches Verhör anzustellen, denn dieses hätte keine Giltigkeit, da ein unsinniger Mensch keine rechtlich giltige Erklärung abgeben kann, sondern er kann und darf nur in Bezug auf seine That zu dem Zwecke gefragt werden, damit man erfahre, wie er überhaupt darüber denkt und fühlt. Dies kann nun wohl im Wege eines Verhörs geschehen, weil dieser Weg die verlässlichste Protokollirung liefert; allein dieser Weg kann und muss aber auch unterlassen werden, wenn eine andere Prozedur, etwa wegen grösserer Unbefangenheit des Beschuldigten, ein besseres Resultat verspricht.
Eine rechtliche Wirkung wird jedoch eine solche Aussage auch dann nicht haben, wenn sie ordentlich protokollirt ist, da die Aussagen eines Menschen, selbst wenn er sich närrisch stellt, und daher seine Rolle konsequent fortspielt, unmöglich als ein Beweis für deren objektive Richtigkeit betrachtet werden können, eben daher scheint es, wo die förmliche gerichtliche Prozedur einen Nachtheil besorgen lässt, ohne weiteres dem Gesetze zu entsprechen, dieselbe zu unterlassen, und den Inhalt der Unterredung (auf deren einzelne Details es dann ohnehin nicht mehr besonders ankommen wird) nur durch Gerichtspersonen, die sich etwa in der Nähe, ohne von dem Inquisiten bemerkt zu werden, befinden, nach seiner Wesenheit schnell aufzeichnen zu lassen.
Bei dieser Gelegenheit kann ich jedoch auch die Bemerkung nicht unterdrücken, dass die Frage, wie weit die Kompetenz des Richters und 108 des Arztes gehe, zuverlässig nie diese Richtung genommen hätte, die sie wirklich nahm, und endlich sogar dahin führte, dass sich eine Stimme erhob, nach welcher es zur Beurtheilung dieser Zustände gar keines Arztes bedürfe, wenn nicht von Seite der Aerzte an den Richter die unbillige Forderung gestellt worden wäre, dass dieser die Erhebung durch Aufstellung von Fragen so leiten sollte, dass am Ende der Arzt nichts anderes als ja oder nein zu sagen brauchte. — Mit Aufstellung solcher Fragen ist es gerade so, wie mit der Frage über die Zurechenbarkeit. So wie es Fälle gibt, wo man ohne alle Gesetzeskenntniss entscheiden kann, dass eine That nicht zurechenbar sei, so gibt es auch Gemüthszustände, welche für Jedermann, insbesondere aber für den Kriminalrichter, welcher doch auch einige psychologische Kenntnisse haben muss, so klar sind, dass es nicht schwer ist, so bestimmte Fragen zu stellen, dass mit deren Beantwortung alles erschöpft wird, was man zu wissen bedarf.
Solche Fälle, in welchen das Gutachten eigentlich nichts weiter ist, als die Kontrolle der richterlichen Ansicht, sind jedoch die Ausnahme, nicht die Regel. Die Regel bleibt immer, dass, ehe noch von einer Frage die Rede sein kann, erst eine, nach den Grundsätzen der Wissenschaft angestellte technische Erhebung und Beurtheilung vorausgehen müsse, und wenn dieses Statt hatte, kann erst eine Frage von Seite des Richters gestellt werden.
Das dem Zwecke einer gerichtlichen Untersuchung und der gegenseitigen Stellung des Richters und des Arztes entsprechende Verfahren dürfte daher Folgendes sein.
Bei keinem Menschen ist ohne besondere Veranlassung eben so wenig ein Grund vorhanden, zu vermuthen, dass er wahnsinnig sei, als dass er eine andere bestimmte Krankheit habe; es wird daher auch bei keinem Inquisiten die Nothwendigkeit vorhanden sein, desselben Geisteszustand ärztlich erheben zu lassen, wenn nicht besondere Erscheinungen, entweder an der Person des Inquisiten, oder in seinen Handlungen, dem Richter als ungewöhnlich auffallen.
Solche ungewöhnliche Erscheinungen an der Person oder an dem Benehmen des Inquisiten zu entdecken, reicht die richterliche Beobachtung in der Regel hin, und für den schlimmsten Fall ist der Richter, wenigstens nach dem österreichischen Strafgesetze, auch hierin unter eine Kontrolle gesetzt, weil derselbe nach §. 373 I. Thl. nicht nur verbunden 109 ist, alles Dasjenige, was während der Untersuchung über die körperliche und sittliche Beschaffenheit des Verhafteten (durch ihn selbst, oder durch das Gefangenwärterpersonale, welches hiezu eigens angewiesen ist) beobachtet worden, im Akte zu bemerken, sondern auch die Besichtigung eines Verhafteten durch einen Leib- und Wundarzt, einer verhafteten Weibsperson aber durch eine Hebamme und die genaue Beschreibung von der Leibesbeschaffenheit, von den Kräften und den Gebrechen der besichtigten Person in den Akten vorgeschrieben ist.
Fällt nun auf diese Art kein derartiges Bedenken auf, und ergibt sich aus der Untersuchung, dass das Verbrechen aus Motiven begangen ist, welche dem gewöhnlichen Bestreben des menschlichen Begehrungsvermögens entsprechen, und ist der Thäter dabei auf eine Art zu Werke gegangen, in welcher die gewählten Mittel in einem nach den vorhandenen Umständen richtigen Verhältnisse zu dem angestrebten Zwecke stehen, so ist wohl kein Grund vorhanden, die Zurechnungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen, und deshalb eine ärztliche Untersuchung in Bezug auf die Geisteskräfte des Inquisiten zu veranlassen.
Fällt jedoch ein Bedenken dieser Art auf, ist nämlich entweder die körperliche Beschaffenheit des Menschen von der Art; dass der Richter, oder die, die körperliche Untersuchung desselben pflegende, ärztliche Person eine solche Abnormität bemerkt, welche möglicher Weise das Zeichen oder die Veranlassung einer Geisteszerrüttung sein kann, oder kommen bei demselben Aeusserungen vor, welche nicht in dem Laufe der gewöhnlichen menschlichen Handlungsweise begründet sind, oder ist die That entweder von so gearteten Umständen begleitet, oder unter solchen Umständen begangen worden, unter welchen von vernünftigen Menschen ähnliche Thaten entweder gar nicht, oder doch nicht auf solche Art, wie es durch den Beschuldigten geschehen ist, begangen werden, oder ist endlich die That selbst von der Art, dass sie entweder dadurch, dass sie mit dem sympathetischen Gefühle, oder einem anderen auf menschliche Handlungen sonst mächtig wirkenden Motive, im Widerspruche, oder überhaupt von der Art ist, dass sie nach der Erfahrung in jene Klasse von Handlungen gehört, welche auch in Folge einer Geisteszerrüttung begangen werden (z. B. Mord, Brandlegung u. s. w.), so ist die hinreichende Veranlassung vorhanden, den Geisteszustand eines solchen Menschen einer besonderen ärztlichen Begutachtung zu unterziehen.
110 Der Arzt hat nun in einem solchen Falle die Aufgabe, richtig zu stellen, ob der Zustand des Menschen von der Art sei, dass derselbe zur Zeit der Begehung der That sich in einem solchen Zustande der Geisteszerrüttung befand, dass er nicht im Stande war, seine Thätigkeit, so weit sie die verübte That zur Folge hat, nach Vorstellungen, in Uebereinstimmung mit der Objektivität der äussern Eindrücke zu bestimmen (siehe hierüber das im §. 40 Gesagte), oder ob sich nach ärztlichen Prinzipien bestimmt erklären lasse, dass kein solcher abnormer Zustand vorhanden gewesen sei.
Der Grund dieses ersten Ausspruches kann nur sein, dass die abnorme geistige oder physische Beschaffenheit des Menschen, welche diesen Ausspruch motivirt, im Augenblicke der Untersuchung von der Art ist, dass sie sich unmöglich geändert haben konnte, oder weil aus den bereits erhobenen Umständen erhellt, dass sie damals gerade so sich verhielt, wie im Augenblicke der Untersuchung. Aus Grund des, der letzteren Ansicht entgegengesetzten, Ausspruches muss die Nachweisung geliefert werden, warum das als Abnormität vom Richter Bemerkte entweder keine Abnormität, oder wenigstens keine solche sei, welche als Zeichen oder als Veranlassung einer Geisteszerrüttung erscheint.
Lässt sich der erstere Ausspruch geben, so ist überhaupt kein Gegenstand zur weiteren strafgerichtlichen Untersuchung vorhanden, sondern es muss die Kriminaluntersuchung unterbleiben, weil kein Verbrechen begangen wurde.
Lässt sich dieser Ausspruch jedoch nicht geben, entweder weil der Zustand sich nicht so deutlich ausspricht, um ohne weitere Erhebung sogleich die Gewissheit zu liefern, dass sich der Mensch im Augenblicke der That im gleichen Zustande wie in dem Zeitpunkte, wo die ärztliche Untersuchung Statt hatte, befunden habe, oder weil die Entscheidung über den Umstand, ob die That, und inwiefern ganz allein durch die vorhandene Abnormität seines Zustandes bedingt sei, ohne weitere gerichtliche Erhebung nicht gegeben werden kann, so muss die gerichtliche Untersuchung ihren Gang weiter fortsetzen, in welcher Beziehung dann die ärztliche Beurtheilung des Gemüthszustandes einen wesentlichen Bestandteil der gerichtlichen Untersuchung bilden wird.
111 Zu diesem Zwecke ist es dann nothwendig, dass nicht nur der Arzt von jeder, gegen den Inquisiten gepflogenen Erhebung, sofern sie dessen persönliche Verhältnisse betrifft, in Kenntniss gesetzt werde, sondern dass er auch angebe, welche Erhebungen in dieser Beziehung nöthig sind, und diese Erhebungen, sofern hiezu besondere ärztliche Kenntnisse gehören, im Einverständnisse mit dem Gerichte auch selbst vornehme, z. B. Unterredungen mit dem Verhafteten pflege, oder zwischen letzterem und seinen Angehörigen veranstalte u. s. w.
Der Arzt wird sich auch hierin nur durch die Grundsätze der Wissenschaft, durch die vorhandenen Umstände, und durch den Zweck der Erhebung, welcher die Ausmittlung des Verhältnisses der bestimmten That zu dessen Vorstellungsthätigkeit zum Gegenstande hat, bestimmen lassen, in formeller Beziehung aber nur so viel zu beobachten haben, dass kein Schritt seinerseits ohne Einvernehmen mit dem Gerichte geschehe, damit dieses einerseits in der Lage sei, das Ergebniss einer solchen Erhebung sogleich zu konstatiren, was besonders dort nothwendig ist, wo dasselbe zum Nachtheile des Inquisiten ausfällt, und er (Inquisit) darüber zur Verantwortung gezogen werden kann, und andererseits darüber zu wachen, dass nicht ärztlicherseits Schritte geschehen, welche auf die gerichtliche Untersuchung von nachtheiligem Einflusse sein könnten, was z. B. bei Fragen der Fall wäre, welche Umstände an dem Inquisiten verriethen, welche diesen, besonders im noch nicht entschiedenen Falle, ob der Inquisit sich verstellte, zur Zeit ihm nicht eröffnet werden dürfen, oder endlich, um überhaupt darüber wachen zu können, dass von Seite des Arztes nichts geschehe, was die Gesetze nicht gestatten.
Dass etwas von letzterer Art von Seite des Arztes nicht leicht geschehen wird, leidet keinen Zweifel, allein da das Gericht für den Akt überhaupt verantwortlich ist, so liegt die Ueberwachung der letzteren Art entschieden in seinem Berufe, und muss daher hier besonders aufgeführt werden.
Die natürliche Folge dieser Prozedur wird sein, dass jede Erhebung des Richters von Seite des Arztes in ihrer pathologischen oder psychischen Bedeutung gewürdigt werde, und dass eben so der Ausspruch des Arztes insofern der richterlichen Beurtheilung unterzogen wird, ob die Thatsachen, worauf er sich stützt, richtig, 112 und gerade so und nicht anders seien, als der Arzt sie annimmt, und wenn ein Widerspruch in der Ansicht des Arztes und jener des Richters obwaltet, die Aufklärung, worin dieser Widerspruch bestehe, und dessen mögliche Behebung veranlasst werde.
Wenn es anders möglich ist, zu einem für die Gerichtspflege entscheidenden Resultate zu gelangen, so kann es nur auf diesem Wege geschehen, denn jeder andere Weg muss Lücken und Widersprüche erzeugen. — Auf diesem Wege aber ist es dem Richter erst möglich — seine Bedenken gegen den normalen Geisteszustand des Untersuchten, oder sein Bedenken gegen den Ausspruch des Arztes, welche auch dem Richter nur auf diesem Wege hinlänglich klar werden können, in ordentliche Fragen zu kleiden, die sich aber nicht auf einmal, oder in einem bestimmten Stadium der Untersuchung, sondern nur allmälig, wie sich die verschiedenen Ergebnisse eben gestalten, werden stellen lassen. Eben auf diesem Wege wird es aber auch für beide Theile erst möglich werden, die übrigen vorhandenen Umstände in ihrer Beziehung zum Geisteszustande des Untersuchten zu gewahren und recht würdigen zu können, so wie überhaupt einen sachgemässen Gang der Untersuchung zu erzielen.
Ist nun auf diese Art der ganze Untersuchungsprozess durchgeführt, und nichts mehr zu erheben, so ist erst von Seite des Arztes ein umfassendes Gutachten möglich.
Dieses Gutachten muss nun der Natur der Sache nach von dem ersten Schritte, nämlich der ersten pathologischen Untersuchung beginnen, und historisch die zur Erhebung des Geisteszustandes eingeleiteten Schritte und deren Ergebnisse darstellen.
Es muss sich sodann, zur möglichen Beurtheilung, inwiefern der gegenwärtige, oder der zur Zeit der verübten That vorhanden gewesene Zustand nicht etwa nur fingirt war, über das frühere Leben des Inquisiten verbreiten, und aus Thatsachen, welche angeführt, und über deren Wahrscheinlichkeit, sofern sie nicht vollkommen erwiesen sind, so wie über deren pathologische Bedeutung, sich in ärztlicher Beziehung ausgesprochen werden muss, die Nachweisung geliefert werden, ob und inwieweit der gegenwärtige, oder zur Zeit der That Statt gefundene Zustand des Inquisiten sich als ein früher schon vorhandener, und daher nicht verstellter oder blos fingirter darstelle.
113 Sofern es in medizinischer Beziehung nöthig scheint, ist auf die Zustände der Eltern, Geschwister des Inquisiten u. s. w. zurückzugehen, insbesondere aber darzustellen26, ob in seinem Leben nicht Momente vorkommen, welche zu einer Abnormität bei demselben Veranlassung gegeben haben konnten, ein Stoss, ein Fall, eine Krankheit, geheime Sünden, Eintritt oder Ausbleiben der Catamönien, oder Schwangerschaft beim weiblichen Geschlechte etc., und ob und von welchem Einflusse diese Ereignisse auf den gegenwärtigen Zustand sind oder sein können; wenn allenfalls ein Bedenken von Seite des Richters obwaltet, welches der Arzt nicht theilt, so ist auszusprechen, ob sie den vom Richter als möglich angenommenen Einfluss etwa entschieden nicht haben können, oder wo ein bestimmter Ausspruch nicht möglich ist, so ist ausdrücklich anzugeben, dass und warum ein solcher Ausspruch nicht möglich ist.
Nach dieser Darstellung, deren Wichtigkeit und Unerlässlichkeit wohl keiner meiner verehrten Leser verkennen wird, kann erst derjenige Theil des Befundes und das Gutachten kommen, welches der Richter bedarf, um über die Zurechenbarkeit der That überhaupt, so wie über den Grad der Strafbarkeit der That, d. h. inwiefern der sich als sträflich darstellende Theil desselben als ein Produkt der freien Selbstbestimmung kann betrachtet werden27, zu entscheiden.
114 Die auf solche Art zu liefernde Nachweisung hat nun die Aufgabe, aus den genommenen Daten die Ideenassociation, welche den Beschuldigten bei Begehung der That begleitet hat, nachzuweisen, und nach Möglichkeit darzuthun, ob und inwiefern die That das Produkt einer krankhaften Ideenassociation ist oder nicht, oder ob sie etwa gar aus keiner Ideenassociation entspringt, sondern (wie bei der Raserei) das Produkt einer abnormen überwiegenden physischen Thätigkeit, oder, wie beim Blödsinn, die Folge des mangelnden Gegengewichtes durch die dem Subjekt mangelnden, bei jedem andern normal beschaffenen Subjekte sonst vorhandenen, einer entstandenen Vorstellung oder einem geäusserten Triebe entgegengesetzte Vorstellung sei.
Lässt sich auf diese Weise kein bestimmter Ausspruch erzielen, so müssen die Gründe, welche der Richter für die Geistesfreiheit zu haben glaubt, noch einer besondern ärztlichen Begutachtung unterzogen werden, um richtigzustellen, ob ihrer objektiven Richtigkeit nicht ärztlicher Seits gegründete Bedenken entgegenstehen.
Wenn also der Befund auf obige Weise abgegeben ist, so stelle der Richter seine Fragen in diesem Sinne, um das etwa noch Mangelnde oder einer näheren Aufklärung Bedürfende ergänzen zu machen, und der ärztliche Ausspruch wird dann zuverlässig dem Bedürfnisse der Strafrechtspflege entsprechend sein, oder wenn er es nicht sein sollte, mit geringer Nachhilfe entsprechend gemacht werden.
Was die Rechtswirkung eines solchen Ausspruches betrifft, so wird sie verschieden sein, je nachdem dieser Ausspruch auf apodiktische Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft selbst, oder ob sich derselbe auf hypothetische Schlussfolgen des untersuchenden Arztes gründet, es mögen diese letzteren nun auf Hypothesen, bezüglich der Thätigkeit des Untersuchten selbst (z. B. als Ergänzungen von Thatsachen, die nicht vollkommen erörtert werden können), oder auf hypothetische Annahmen der Medizin selbst gegründet sein.
Nur die ersteren Stützen, nämlich die apodiktischen Sätze, liefern einen rechtlichen Beweis zum Nachtheile des Inquisiten.
Die letzteren, so wahrscheinlich sie übrigens an und für sich, oder nach der Autorität derjenigen Personen, welche sie ausgesprochen 115 haben, sein mögen, können nicht als ein Beweis gegen den Beschuldigten gelten, sofern ihre Beweiskraft nicht durch Thatsachen, welche objektive Gewissheit haben, vollkommen erwiesen wird.
Im Gegentheile aber können derlei Behauptungen zu Gunsten des Inquisiten als ein ihn von Strafe freisprechendes oder die Strafe milderndes Argument angenommen werden, weil sie immerhin so viel beweisen, dass die Sache sich möglicher Weise so verhalten könne, wie die Sachkundigen sagen; wenn daher nicht nachgewiesen werden kann, dass ihre Angabe auf einem Irrthume beruhe, so ist kein Grund vorhanden, sie nicht zu Gunsten des Inquisiten gelten zu lassen, während sich in dem Falle, wo es sich darum handelt, den Inquisiten auf Grund ihrer Angaben straffällig zu finden, noch immer die Möglichkeit einwenden und nicht widerlegen lässt, dass sich die Kunstverständigen geirrt haben können.
Ist z. B. der Fall vorhanden, dass Jemand, welcher erwiesenermassen in einer fixen Idee lebt, eine sträfliche, dieser fixen Idee entsprechende That begangen hat, so wird, wenn die Aerzte nachweisen, die That liege blos in der durch diese fixe Idee hervorgebrachten physischen Thätigkeit, die Lossprechung erfolgen müssen, weil sich ihre Behauptung einerseits durch die Beobachtung des Untersuchten, wonach der Umstand, dass er von dieser fixen Idee behaftet ist, ausser Zweifel gesetzt erscheint, andererseits aber auf Axiome der medizinischen Wissenschaft über die Möglichkeit und den Einfluss der fixen Idee gründet.
Ihre Ansicht würde aber vom Richter nicht so unbedingt anzunehmen sein, wenn sie etwa dahin lautet: „Der Mensch litt zwar an der fixen Idee N. N., die That entspricht auch derselben, allein da hier nach genauer Beobachtung diese Idee nicht im Spiele war, so kann die That nicht als ein Produkt derselben angesehen werden,” denn dieser Ausspruch wäre zweifelhaft, da immerhin der Zweifel erübrigt, ob der Arzt, der dieses sagt, den psychischen Zustand auch richtig aufgefasst und nicht etwas übersehen und unberücksichtiget gelassen habe, welches, wenn es gewürdigt worden wäre, doch Anwendbarkeit des wissenschaftlichen Axioms auch in diesem Falle würde gestattet haben.
Es folgt daher, dass der Arzt verpflichtet ist und vom Richter eben so sehr darauf gedrungen werden müsse, dass bei jeder Behauptung im Befunde oder im Gutachten angegeben werde, ob sie blos die Ansicht des begutachtenden Arztes enthalte, oder ein durch objektive und 116 durch welche objektive Beobachtungs-Ergebnisse vom untersuchenden Arzte gewonnenes Resultat, oder ob sie ein entschiedenes Ergebniss der Wissenschaft sei, und im letzteren Falle, warum die Behauptung ein Axiom der Wissenschaft genannt werde, d. h. ob bereits Schriftsteller, und welche, sie als ein solches Axiom betrachten, und auf welcher, etwa für jeden Menschen zu beobachtenden, Erfahrung sie beruhen.
Von der Richtigkeit der ersten Art von Behauptungen kann und muss sich der Richter so viel möglich durch eigene Anschauung, von der Richtigkeit der letzteren, im Falle des Zweifels, durch Einholung von Fakultätsgutachten die Gewissheit verschaffen.
Der dritte Fall, wo ein ärztliches Gutachten über den Geisteszustand eines Inquisiten benöthiget werden kann, tritt dann ein, wenn sich nach geschlossener Kriminaluntersuchung und nach bereits erflossenem Urtheile Spuren von Verrücktheit an dem Inquisiten zeigen.
Da ein Verrückter den Sinn eines Strafurtheiles aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auffassen, eben so wenig aber in dem Uebel, welches ihm zugefügt wird, eine Strafe erkennen kann, ja sogar das Uebel der Strafe auf seinen Zustand nachtheilig wirken könnte, so verordnet das österreichische Strafgesetzbuch §. 445, I. Theil, „dass in diesem Falle die Kundmachung des Urtheiles zu unterbleiben habe, bis der Verrückte wieder zur Vernunft gelangt ist.”
Aus diesen Worten des Gesetzes ergibt sich daher, dass die ärztliche Untersuchung hier lediglich eine pathologische sei, und der Ausspruch daher nichts weiter, als die auf pathologische Gründe gestützte Erklärung enthalten dürfe, der Inquisit sei verrückt, oder er sei wieder genesen.
Nur in dem Falle wäre seine Pflicht, in seinem Ausspruche weiter zu gehen, wenn ihm etwa aus sonstigen Daten die Möglichkeit auffiele, dass dieser Zustand auch schon früher vorhanden und auf die That von Einfluss gewesen sei. — Eine solche Bemerkung müsste ausdrücklich gemacht werden, um dem Richter als Anhaltspunkt zur weitern Erhebung zu dienen.
Es scheint daher der Tendenz des Gesetzes vollkommen gemäss, dass der Richter durch Mittheilung der nöthigen Aktenstücke an den Arzt sich die Gewissheit verschaffe, dass kein solches Bedenken obwaltet, weil im Falle der Begründung eines solchen Bedenkens das Urtheil selbst nothwendig eine Abänderung erleiden müsste.
117 Der Zweck der Erhebung des Irrsinnes im Civilverfahren ist ein ganz anderer als jener im Strafverfahren, denn hier handelt es sich in der Regel nicht darum, in welchem Verhältnisse die Vorstellungsthätigkeit zu einer bestimmten äusseren Thätigkeit stehe, sondern lediglich darum, ob man einem Menschen, ohne ihn der Gefahr auszusetzen, dass er sich oder einem Anderen an der Person oder an bürgerlichen Rechten Schaden zufüge, seiner Freiheit überlassen könne.
Eine Ausnahme von dieser Regel bildet lediglich der Fall, wo es sich darum handelt, einen bestimmten rechtlichen Akt als ungiltig zu erklären, weil er in einem Zustande Statt hatte, von welchem es glaublich ist, dass der Handelnde nicht genau wusste was er that.
Es ergibt sich daher, dass es sich in einem solchen Falle der ersteren Art lediglich um die Frage handelt: besitzt der Mensch jene Richtigkeit der geistigen Funktionen, welche man bei Denjenigen voraussetzt, denen vermöge der gesetzlichen Bestimmung die Verwaltung ihrer Rechte freigestellt ist? — Also diejenige Ueberlegung und Beurtheilung, welche dort, wo das Gesetz etwa das Alter von 24 Jahren als jenes der bürgerlichen Freiheit festsetzt, einem minder begabten, jedoch nicht schwachsinnigen Menschen in diesem Alter zukommt.
Da es sich hier nun nicht darum handelt, dem zu Untersuchenden ein Uebel zuzufügen, sondern im Gegentheile ihn gegen ein Uebel, das er sich selbst oder Anderen zufügen könnte, zu bewahren, so wird auch die Erhebung nicht mit jener Strenge durchzuführen sein, wie beim Strafverfahren, sondern es wird in der Regel genügen, wenn nur eine oder die andere unmotivirte Thatsache vorliegt und durch ein ärztliches Gutachten nachgewiesen wird, dass das Motiv dieser Thatsache, wenn auch nur theilweise, in einer Geisteszerrüttung liege.
Ja es wird auch genügen, wenn der Richter nach genauer Untersuchung mehrere Thatsachen entdeckt, welche unmotivirt und von nachtheiligem Einflusse sind, sich aber durch den ärztlichen Ausspruch die Ansicht, dass der Mensch geistesverwirrt sei, nicht bestimmt widerlegt.
Nach dem für das Civilverfahren in Oesterreich geltenden Verfahren des Gesetzes gehört auch der Ausspruch, ob ein Mensch für wahn- oder 118 blödsinnig solle gehalten werden, nach §. 273 des bürgerlichen Gesetzbuches: „dass nur Derjenige dafür soll gehalten werden, welcher nach genauer Erforschung seines Betragens, und nach Einvernehmung der vom Gerichte ebenfalls hierzu verordneten Aerzte gerichtlich dafür erklärt ist,” entschieden der Gerichtsbehörde zu.
Um übrigens in dieser Beziehung nicht schon Gesagtes zu wiederholen, kann ich nur auf Dasjenige verweisen, welches in meinem „Handbuche der gerichtlichen Arzneikunde” im VIII. Hauptstücke der II. Abtheilung über diesen Gegenstand bereits gesagt wurde.
Zum Schlusse dieses Aufsatzes erlaube ich mir hier noch eine am 24. März 1843, Z. 11,500, ergangene Verordnung der hochlöbl. k. k. niederösterr. Regierung aufzuführen, weil dieselbe ein Formular zur Verfassung der Krankengeschichte irrsinniger Personen zum Behufe der Abgabe in eine öffentliche Irrenanstalt enthält, welches sowohl an und für sich für den Fall, als eine solche Abgabe vorkommt, als auch in gerichtlich-medizinischer Beziehung von Wichtigkeit ist, weil dieses Formular in der That die wesentlichsten Punkte enthält, welche in dem Befunde bei einem solchen gerichtlichen Akte aufzunehmen kommen.
Diese Verordnung lautet folgendermassen:
Da sich der Fall so oft wiederholt, dass bei Ueberbringung eines Geisteskranken in die öffentlichen k. k. Irrenanstalten ungenügende und höchst mangelhafte Krankengeschichten einlangen, so fand sich die Regierung veranlasst, ein Formular zur Ausstellung solcher Krankheitsgeschichten zu entwerfen und in Druck legen zu lassen, zur Vertheilung an die angestellten und praktischen Aerzte, welche sämmtlich anzuweisen sind, sich die im Formulare enthaltenen Fragepunkte bei Erstattung von Krankengeschichten, Behufs der Ueberbringung eines Geisteskranken in eine öffentliche Irrenanstalt, gegenwärtig zu halten.
Formular zur Ausstellung von Krankengeschichten geisteskranker Personen, Behufs ihrer Aufnahme in eine öffentliche Irrenanstalt.
1. Name, Alter, Stand, Beschäftigung, Geburtsort und letzter Aufenthaltsort des (der) Kranken.
2. Was für Krankheiten (Kinder-, Entwicklungs- und andere Krankheiten) 119 überstand dieses Individuum bis zum Beginne dieser Geisteskrankheit? Hier sind auch die erlittenen Verletzungen, besonders die des Kopfes, anzumerken.
3. Litt das Individuum früher schon an Irrsinn? Wie oft und wie lange war es schon in einer Irrenanstalt? Wie wurde es aus solcher entlassen28?
4. Hinsichtlich der disponirenden und veranlassenden Momente sind besonders noch folgende zu berücksichtigen:
a) Physische Momente, als erbliche Anlage, wobei zu erforschen ist, welche Blutsverwandte des (der) Kranken an Irrsinn litten, oder noch leiden, körperliche Entwicklung, Geschlechtsleben, monatliche Reinigung, Schwangerschaften, Kindbetten u. s. w.29
b) Psychische Momente, als: Erziehung, Entwicklung der intellectuellen und moralischen Fähigkeiten, religiöse Tendenz, moralische Aufführung, Umgang mit Anderen, vorherrschende Neigungen und Lieblingsbeschäftigungen, Leidenschaften, häusliche Verhältnisse, die merkwürdigeren Lebensereignisse und der Einfluss, den diese auf das Gemüth und den Geist des (der) Kranken gehabt hatten30.
5. Wann und wie äusserten sich die ersten Spuren dieser Geisteskrankheit?
6. Welchen Verlauf nahm diese Geisteskrankheit von ihrem ersten Auftreten bis zum Tage der Untersuchung? Welche abnorme Erscheinungen zeigten sich von physischer und psychischer Seite? Wodurch 120 wurden Rückfälle und Verschlimmerungen, wenn solche Statt fanden, veranlasst31?
7. Wurde diese Geisteskrankheit schon ärztlich behandelt? Worin bestand diese Behandlung und was hatte sie für einen Erfolg?
8. Was für ein Bild bietet diese Geisteskrankheit bei der gegenwärtigen Untersuchung dar? Hier sollen alle physischen und psychischen Krankheitssymptome32, wie sie eine genaue und umfassende Erforschung entdeckt, aufgezeichnet werden.
9. Diagnostische Entwicklung und Benennung der speziellen Krankheitsform33.
10. Eignet sich der (die) Kranke mehr für die Abtheilung der heilbaren oder für jene der unheilbaren Geisteskrankheiten, und worin besteht die Gefahr, die man für ihn (sie) oder für seine (ihre) Umgebung und öffentliche Sicherheit zu besorgen hat?
Eine ähnliche Verordnung über die Verfassung der Krankengeschichte enthält auch die obderennsische Regierungsverordnung vom 5. Oktober 1833, Z. 28,281, welcher noch folgende hierher gehörige Weisung beigefügt ist:
121 Die Angehörigen des Irrgewordenen sind verpflichtet, alsogleich nach dem Ausbruche der Krankheit die Anzeige hiervon bei der gehörigen Ortsobrigkeit zu machen, widrigens hat in Gemässheit des Strafgesetzbuches II. Theil, §. 140 (siehe mein „Systematisches Handbuch” §. 106) die Strafe des Arrestes von drei Tagen bis zu einem Monate einzutreten, je nachdem nämlich ein solcher Zustand lange verhehlt worden war, oder aber dessen Folgen wichtiger und nachtheiliger gewesen sind. Es liegt ihnen ferner ob, sobald der herbeigerufene Arzt in Anbetracht der Ungewissheit eines guten Erfolges der häuslichen Pflege die Unterbringung des Kranken in der Irrenanstalt für räthlich erklärt, um ihre Vermittlung bei der obrigkeitlichen Behörde anzusuchen, und die Anordnung des Arztes, gleichwie die Verfügung der Obrigkeit genau zu befolgen. In solchen Fällen hat demnach die Behörde, sobald die Angehörigen eines Irrgewordenen dessen Unterbringung in die Anstalt verlangen, oder wenn selbe schon an und für sich als nothwendig erscheint, das mit dem ärztlichen Zeugnisse über die eingetretene Geisteszerrüttung, ferner mit der Krankengeschichte und der ämtlich beglaubigten Haftungsurkunde zur Sicherstellung der Verpflegsgebühren belegte diesfällige Ansuchen schleunigst und nach voranstehender Weisung vollständig instruirt an die k. k. Landesregierung einzusenden, als jede wahrgenommene Nachlässigkeit geahndet werden soll.
Da es in jenen Fällen, in welchen der Kranke keine ärztliche Behandlung genossen hat, unmöglich ist, eine vollständige Krankengeschichte einzusenden, so hat der zeugnissausstellende Arzt die vorausgegangenen Ereignisse, Umstände und Krankheitszufälle, so viel ihm möglich ist, einzuholen, und den Zustand, in welchem er den Irren fand, genau zu beschreiben; ist aber der Geisteskranke ein völlig Fremder, oder nur weniger bekannt, dann soll von Seiten der Behörde mit jenen Personen, die den Erkrankten zu kennen vorgeben und Einiges über seine Verhältnisse auszusagen im Stande sind, ein Protokoll, welches die nöthigen Aufklärungen über die vorwärts (bei der Krankengeschichte) angedeuteten Punkte gewährt, aufgenommen und eingesendet werden, um hierdurch die ausserdem unentbehrliche Krankengeschichte zu ersetzen.
Der zur Aufnahme in die Heilanstalt bestimmte Kranke ist, nachdem der Irrenhausarzt das ihm zugekommene ärztliche Zeugniss sammt der Krankengeschichte, die Versorgungsverwaltung aber den Zahlungsrevers zur ferneren Benützung zurückbehalten hat, wenn es nöthig sein sollte einer allgemeinen Säuberung seines Körpers zu unterziehen, und nach Thunlichkeit mit reiner Leibwäsche so wie mit Kleidungsstücken in hinreichender 122 Menge zum fernern Wechsel zu versehen, und sobald es geschehen kann auf die angemessenste Art und mit der nöthigen Vorsicht an die Anstalt einzusenden. Dass er übrigens in den meisten Fällen weder völlig frei noch in Ketten transportirt werden dürfe, versteht sich in unserer Zeit wohl von selbst; eine feste Zwangsjacke wird jedoch beinahe jederzeit den Zweck der Beschränkung vollkommen erfüllen, und nur bei jenen, welche einen mächtigen Trieb zum Entspringen äussern, dürfte das Anlegen einer einfachen Fussgurte genügen.
Mit Regierungsdekret von 5. Oktober 1833, Zahl 28,281, wurden die Erfordernisse zur Aufnahme in das Linzer Irrenhaus bekannt gegeben.
Unter diesen Erfordernissen ist auch die Anordnung begriffen, dass das Dasein des Wahnsinnes durch das Zeugniss eines Kreis-, oder Bezirks-, oder Stadtarztes darzuthun kommt. Es wurden daher bisher vorzüglich auf den Grund des Zeugnisses Eines Arztes die betreffenden Individuen als irrsinnig anerkannt, in das Irrenhaus abgegeben, folglich faktisch als irrsinnig erklärt. Allein dieser Vorgang gewährt nicht die vollkommene Beruhigung, dass jeder Missgriff oder jede Irrung hinsichtlich der Unterbringung eines Individuums in die Irrenanstalt, ohne der Rechtlichkeit der die Zeugnisse ausstellenden Aerzte nahe zu treten, hintangehalten werde, besonders, da oft die vorgeschriebenen Krankengeschichten mangelhaft verfertiget sind oder gar nicht beigebracht werden können. Dagegen wird durch die genaue Beobachtung des §. 273 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches die grösstmöglichste Beruhigung verschafft, dass Niemand als irrsinnig behandelt, daher in die Irrenanstalt abgegeben wird, welcher nicht wirklich mit Wahnsinn behaftet ist, denn nach diesem für die Behörden und für die Unterthanen verbindenden Gesetzbuche darf blos Derjenige als irrsinnig anerkannt und behandelt, folglich in einer Irrenanstalt untergebracht werden, welcher von der kompetenten Gerichtsbehörde, nach der vorausgegangenen Erforschung seines Betragens über Einvernehmen zweier Aerzte, als wahnsinnig erklärt wird. Daraus folgt nun, dass in der Regel die gerichtliche Irrsinnigkeitserklärung eines Individuums vorauszugehen hat, bevor dasselbe in das Irrenhaus abgegeben werden darf.
Die Regierung fand daher zum Schutze der Freiheit und Ehre der Personen, so wie zur Hintanhaltung jedes Missbrauches laut Dekret vom 10. Dezember v. J., Zahl 31,269, sich bewogen, die 123 erwähnte Regierungsverordnung vom Jahre 1833 dahin zu modifiziren, dass die Aufnahme eines Individuums in das Irrenhaus nur in dem Falle bewilligt werden wird, wenn von Seite der kompetenten Gerichtsbehörde die Irrsinnigkeitserklärung desselben erfolgt sein, und diese gerichtliche Verfügung sammt der Anzeige des aufgestellten Kurators des Irrsinnigen dem Einschreiten der Unterbehörden um die Aufnahme in das Irrenhaus beigelegt sein wird.
Wenn jedoch der Geisteskranke dergestalt in Tobsucht und Raserei verfallen sollte, dass derselbe ohne Gefahr für die Lebens- oder Eigenthumssicherheit überhaupt, oder nur seiner nächsten Umgebung, nicht mehr länger bei seiner Familie, oder bei den Angehörigen, oder in seiner Wohnung belassen werden kann, so wird auf das Einschreiten der politischen Unterbehörden, insofern in demselben diese mit Gefahr für die Umgebung verbundene Irrsinnigkeit von zwei Aerzten bestätiget ist, wegen Gefahr auf Verzug die Aufnahme in die Irrenanstalt alsogleich, jedoch nur provisorisch und blos gegen dem bewilligt werden, dass die vorschriftmässige gerichtliche Irrsinnigkeitserklärung der hohen Regierung bald thunlichst nachträglich vorgelegt werde.
Um Missverständnissen vorzubeugen, wird ausgesprochen, dass unter dem Ausdrucke: Aerzte, keineswegs die Wundärzte, sondern blos die Doktoren der Medizin verstanden werden, weil nicht die Ersteren, sondern die Letzteren berufen sind, über Geisteskranke ein Gutachten abzugeben.
(Cirkular des Kreisamtes zu Salzburg vom 15. Februar 1843, Zahl 1485.)
Aus diesen Verordnungen erhellt, dass von Seite der höheren Behörden die Aufnahme in eine Irrenanstalt nicht nur als eine Sanitätsmassregel, sondern auch in der Beziehung betrachtet wurde, dass nicht etwa ein Individuum aus Böswilligkeit für irrsinnig erklärt und dadurch seiner Freiheit verlustig werde.
So wie für das Land unter und ob der Enns, bestehen nun ähnliche Verordnungen in allen Provinzen, in welchen Irrenhäuser bestehen, es ist daher die Pflicht eines jeden praktizirenden Arztes, sich mit den für die Provinz, in welcher er seine Praxis ausübt, bestehenden Verordnungen bezüglich dieses Gegenstandes bei Zeiten bekannt zu machen, um in einem vorkommenden Falle dieser Art keine Missgriffe zu begehen.
124 Nachfolgende Verordnung, als von der Hofbehörde erflossen, ist in allen österreichischen Staaten, mit Ausnahme der ungarischen und siebenbürgischen Länder, giltig:
Zufolge Hofdekretes vom 28. August 1837, Zahl 4647, wurde sämmtlichen Gerichtsbehörden aufgetragen, dass sie jedesmal, wenn eine Person als wahn- oder blödsinnig erklärt wird, das Resultat der diesfälligen über den Geisteszustand gepflogenen Amtshandlung, so wie den Namen des Vaters, Vormundes oder gerichtlich bestellten Kurators des irr- oder blödsinnigen Individuums der betroffenen Behörde, welcher die Verwaltung des Irrenhauses oder der diesfälligen Anstalt, worin der Wahn- oder Blödsinnige untergebracht wird, zugewiesen ist, unverweilt bekannt geben sollen, um sogleich entnehmen zu können, wem die Vormundschaft oder Kuratel anvertraut worden sei.
(Band 19. der Provinzial-Gesetzsammlung für Oesterreich ob der Enns Nr. 105, Seite 172.)
Der bekannte italienische Dichter Graf Alfieri erzählt aus seinem Leben folgendes Ereigniss:
Er hatte in England eine sehr vertraute Bekanntschaft mit einem Frauenzimmer, in welche er in der That sterblich verliebt war, wurde auch durch dieses Verhältniss in ein Duell verwickelt, in welchem er mit einer leichten Wunde davon kam, welches Duell jedoch einen Ehescheidungsprozess zur Folge hatte, der öffentlich verhandelt und daher in den öffentlichen Blättern besprochen wurde.
Man denke sich nun seine Empfindung, als ihm ein solches Blatt eines Morgens zu Gesicht kam, in welchem die Liebesintriguen seiner Geliebten dargestellt waren, woraus jedoch hervorging, dass nicht er darin die Hauptrolle spielte, sondern dass diese bereits vor ihm von einem Bedienten derselben besetzt war, und ihm also nur die Nebenrolle zugetheilt gewesen sei.
Dennoch konnte er es nicht über sich gewinnen, sie zu verlassen; er zog mit ihr auf den Kontinent, besuchte Italien, wurde von wüthender 125 Eifersucht geplagt, in der er ihr täglich die bittersten Vorwürfe machte, und sie seiner tiefsten Verachtung versicherte, aber doch noch immer bei ihr blieb.
In dieser Stimmung, die sein ganzes Wesen in eine fieberhafte Aufregung versetzt hatte, liess er sich eines Abends von seinem Bedienten, mit dem er nicht nur sehr zufrieden, sondern auch in einer Art von Vertraulichkeit war, die Haare kräuseln. Unglücklicher Weise rupfte ihn dieser ein wenig. Alfieri sprang nun wüthend auf, ergriff den auf dem Tische stehenden Armleuchter und warf ihn dem Bedienten zum Kopfe, welcher dadurch glücklicher Weise nicht bedeutend verletzt wurde, und nichts Anderes glaubte, als sein Herr sei toll geworden — worin er in der That nicht ganz unrecht gehabt zu haben scheint. — Er rief daher die anderen Domestiken gegen seinen Herrn zu Hilfe, welcher sich nun mit dem Degen zur Wehre setzte, dabei aber doch so weit zur Besinnung kam, dass eine Verständigung erfolgte, so dass der Vorfall ohne weitere nachtheilige Folgen blieb.
Nehmen wir nun an, Alfieri hätte seinen Bedienten todt geworfen oder sonst schwer verletzt, oder einem seiner Domestiken den Degen durch den Leib gerannt, so würde es zuverlässig nicht zu billigen sein, wenn er so geradezu wegen Todtschlag oder wegen schwerer Verletzung wäre verurtheilt worden, denn Jeder fühlt zuverlässig, dass hier etwas im Mittel liegt, welches diesen Fall von andern Fällen der Tödtung oder der Verwundung wesentlich unterscheidet.
Betrachten wir aber nun noch einen anderen Fall, welcher zuverlässig noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts nicht zu selten war, den Fall nämlich, wo Jemand, welcher der Erfindung der Goldtinktur auf der Spur zu sein glaubte, sich zu diesem Ende Jahre lang in sein chemisches Laboratorium verschloss, durch Nachtwachen, Einathmen schädlicher Dünste u. s. w. seine Gesundheit zerrüttete, und durch die Aufregung, in die ihn Hoffnung und Misslingen, und dann wieder die gewonnene, nach seiner Meinung untrügliche Aussicht auf die baldige Lösung des Problems versetzte, in jene Stimmung gerieth, in welcher dieser sein Lieblingsgedanke zur fixen Idee wurde, zur Realisirung derselben fremde Gelder durchbringt, so wird man schwerlich eine solche Handlung, wenn sie auch zum Besten seiner Lieblingsidee geschah, für unsträflich halten, denn es ist Jedem klar, dass, wenn auch die Lösung des Problems die fixe Idee des Adepten war, er doch dadurch nicht gehindert war, die Rechtswidrigkeit einzusehen, welche darin liegt, wenn Jemand ein Geld, welches 126 ihm zur Aufbewahrung übergeben war, anstatt es aufzubewahren, zu irgend einem anderen Zwecke verwendet.
Dies ist in einem und in dem anderen Falle nun diejenige Ansicht, welche sich jedem Unbefangenen so zu sagen von selbst darbietet; wenn es sich jedoch darum handelt, diese Ansicht aktenmässig in einer Art darzustellen, dass darauf ein richterliches Urtheil gegründet werden könne, so begegnet man mancherlei Schwierigkeiten, denn es kann nicht geläugnet werden, dass man im ersten Falle nicht sagen kann, Alfieri sei krank gewesen, und dass man daher, wenn man Geisteskrankheit als den einzigen Entschuldigungsgrund einer sonst sträflichen That gelten lässt, es in der That schwer fällt, einen annehmbaren Entschuldigungsgrund vorzubringen.
Nach meiner Ansicht liegt die Schwierigkeit, welche dieser Gegenstand darbietet, jedoch weder in der Sache, noch in einer Insuffizienz der ärztlichen Wissenschaft, sondern lediglich in der ganz heterogenen Beschaffenheit der Rechts- und in der Arzneiwissenschaft, welche, indem sie einen ganz verschiedenen Zweck auf ganz verschiedene Weise verfolgen, so zu sagen aller Berührungspunkte und daher auch fast aller Mittel sich zu verständigen entbehren, wodurch am Ende das Resultat erzeugt wird, dass jede der beiden Wissenschaften ihre eigene, für Diejenigen, welche die fremde Wissenschaft üben, ganz unverständliche Sprache hat, dass der Jurist nur von dem Juristen, und der Mediziner nur von dem Mediziner verstanden wird, und verstanden sein will, und dass am Ende beide Theile sich auch dann nicht verstehen, wenn sie wirklich Dasselbe sagen.
Der Grund dieser Erscheinung scheint nun insbesondere in Bezug auf den in Frage stehenden Gegenstand in Folgendem zu liegen:
Jede Wissenschaft bedarf zu ihrem Zwecke gewisser Eintheilungen, und zwar um so nöthiger, je reicher und je mannigfaltiger der Gegenstand ist, den sie behandelt. Diese Eintheilungen sind nun selbst auch dann, wo es sich blos um Gegenstände handelt, welche die Natur darbietet, nicht immer durch die Natur der Sache geboten, wie z. B. der Unterschied zwischen Thier und Pflanze, sondern sie sind der leichteren und besseren Uebersicht wegen, welche der Zweck der Wissenschaft fordert, aufgestellt. Je nachdem daher eine Wissenschaft einen verschiedenen Zweck verfolgt, wird auch eine verschiedene Eintheilung und 127 Zusammenstellung nothwendig werden; so können in einer Lehre über die Gartenkunde, Rose und Datura fastuosa neben einander stehen, während sie in einer Pharmacopöe möglichst weit entfernt sein müssen.
Abgesehen daher von dem Umstande, dass bei keiner Erfahrungswissenschaft mit den getroffenen Eintheilungen immer ausgelangt werden kann, weil die Entdeckung neuer Spezies auch wieder neue Eintheilungen erfordert, muss sich daher eine höchst bedeutende Schwierigkeit in dem Falle ergeben, wo es sich darum handelt, die Resultate der einen Wissenschaft zum Zwecke einer anderen anzuwenden, deren Zweck ein ganz verschiedener ist, und daher solche Eintheilungen der anzuwendenden Erfahrungen erfordert, welche Eintheilungen die andere Wissenschaft nie gemacht hat, weil sie solche zu ihrem Zwecke nie bedurfte.
Der Zweck der medizinischen Wissenschaften ist nun die Heilung von Krankheiten; Seelenzustände kommen daher in derselben nur insofern in Betrachtung, als sie Krankheiten oder Symptome von Krankheiten sind, oder auf Verschlimmerung oder Behebung von Krankheiten influiren, die absolute Bedeutung derselben, oder auch nur das Verhältniss, in welchem sich Seelenzustände zu anderen Beziehungen des Menschen, z. B. zur Moral, zum Rechte befinden, liegt offenbar nicht mehr im Bereiche des Zweckes dieser Wissenschaft.
Bei der Rechtswissenschaft, insbesondere aber bei der Wissenschaft des Strafrechtes, ist es gerade umgekehrt, denn hier kann es keinem Zweifel unterliegen, dass der gesunde so wie der kranke Mensch die gleiche Verpflichtung habe, sich von jeder Rechtsverletzung zu enthalten; es kann somit hier nur zwei Fälle geben, in welchen ein Mensch, welcher eine Thätigkeit ausgeübt hat, durch deren Folge er ein Strafgesetz verletzte, von der Strafe verschont bleiben darf, nämlich, dass nachgewiesen wird, es sei seine Thätigkeit eine solche gewesen, auf welche sein Wille gar keinen Einfluss geübt hat (z. B. wenn Jemand von einer Höhe herabfällt, und einen Anderen durch den Fall todtschlägt), oder wenn nachgewiesen wird, dass er sich in einem Irrthume, d. i. in einer solchen Gemüthsverfassung befunden habe, in welcher er wohl die materielle Folge seiner Thätigkeit beschlossen hat, jedoch aus einer dieselbe begründenden Vorstellung, welche, wenn sie richtig gewesen wäre, die hervorgebrachte Folge als straflos erscheinen gemacht haben würde, oder wenn diejenige Vorstellung, durch deren Vorhandensein die Sträflichkeit der That eingesehen worden wäre, gänzlich mangelte. Ein solcher Fall wäre etwa jener, wo Jemand in der Nacht in einer wegen Räubereien übel 128 berüchtigten Gegend von einem betrunkenen, jedoch sonst nichts Böses im Schilde führenden Menschen angefallen wird, und in der Meinung, er sei ein Räuber, welcher ihn angreife, diesen todtsticht.
Ist aber andererseits nachgewiesen, dass ein Mensch eine Wirkung nur darum hervorbrachte, weil er genöthigt war, eine Thätigkeit zu äussern, oder sonst eine Folge hervorzubringen, ohne mit seinem Willen diese Aeusserung hindern zu können, oder, weil er in einem Irrthume war, so ist es für die Straflosigkeit desselben in krimineller Beziehung auch ganz gleichgiltig, wodurch er in diesen Zustand gerieth, ob durch Krankheit oder durch einen anderen Zufall, denn gegenüber von der hervorgebrachten Wirkung ist alles Zufall, was nicht Absicht ist.
Da nun die medizinische Wissenschaft mit Recht die Seelenstörungen als eine besondere Form der Krankheit betrachtet, so ist es klar, dass Dasjenige Merkmal, worauf es der Rechtswissenschaft ankommt, nämlich ob die Seelenstörung in einem bestimmten Falle auf das bestimmte Individuum so wirkte, dass es entweder sich in einer unwillkürlichen Thätigkeit, oder in einem Irrthume befand, kein Gegenstand sei, zu dessen Auffindung die medizinische Wissenschaft nach ihrem Zwecke eine besondere Anweisung zu geben sich bestimmt finden könne, während dadurch, dass sie einen bestimmten Gemüthszustand als Krankheit erklärt, unmöglich dem richterlichen Bedürfnisse genügt werde.
Es ergibt sich daher, dass wenn, wie es oft geschieht, beide Wissenschaften sich in der Beurtheilung eines konkreten Falles nicht vereinigen können, das Hinderniss nicht darin liege, weil die Gränze zwischen beiden Wissenschaften nicht scharf genug gezogen ist, sondern dass man vielmehr bekennen muss, diese beiden Wissenschaften seien, nach der Art und Weise wie die Sache gewöhnlich betrieben wird, noch gar nicht in der Richtung, in welcher sie aneinander gränzen können, da sie überhaupt nicht in gleicher Richtung laufen.
Um nun eine gleiche Richtung zwischen dem Laufe zweier mechanischen Grössen zu bewirken, muss man einen festen Punkt aufgefunden haben, auf welchen man fussen kann. Eben so geht es, wenn man eine Linie aufsucht, in welcher zwei Wissenschaften sich berühren können.
Der Punkt, auf welchen im gegenwärtigen Falle beide Theile fussen können, ist hier offenbar das positive Gesetz selbst, denn indem man sich, und zwar in der Art wie das Gesetz es andeutet, auf den von demselben gegebenen Standpunkt stellt, sieht man genau die Richtung, welche 129 die Forschungen beider Wissenschaften nehmen müssen, um wirklich nebeneinander zu bleiben, und sich nicht ins Unbestimmte zu verlieren.
Das österreichische Strafgesetzbuch ordnet hierüber Folgendes an:
§. 2. Daher34 wird jede Handlung oder Unterlassung als Verbrechen nicht zugerechnet:
a) wenn der Thäter des Gebrauches der Vernunft gänzlich beraubt ist;
b) wenn die That bei abwechselnder Sinnenverwirrung zur Zeit da die Verrückung dauerte;
c) in einer ohne Absicht auf das Verbrechen zugezogenen vollen Berauschung, oder in einer anderen Sinnenverwirrung, in welcher der Thäter sich seiner Handlung nicht bewusst war, begangen wurde.
Da der Irrsinn den Menschen des Gebrauches der Vernunft beraubt, so muss man daher dem Gesetze gemäss erklären, dass eine That im Irrsinne verübt straflos sei, nicht aber lässt es sich sagen, dass eine That, welche nicht im Irrsinne verübt ist, und ein Strafgesetz verletzt, auch nothwendig ein Verbrechen sei, denn der Gesetzgeber beschränkt die möglichen Fälle der Straflosigkeit nicht darauf, dass die That in immerwährender oder abwechselnder Sinnenverwirrung, im letzteren Falle, so lange der Anfall der Krankheit dauerte, geschehen sei (lit. a und b), sondern er nimmt noch einen dritten Zustand als möglich und als hinreichenden Grund für die Entbindung von der Strafe an, nämlich was immer für eine Sinnenverwirrung (wenn auch keine krankhafte), wenn sie nur die Eigenschaft hatte, den Thäter, d. i. a) den Menschen, welcher eine bestimmte That beging, b) in dem Augenblicke, wo er sie beging, c) im Allgemeinen, oder d) in Bezug auf diese That des Bewusstseins seiner Handlung zu berauben. — Als ein Beispiel dieser Art von Zustände führt der Gesetzgeber denjenigen Zustand an, welcher als volle Berauschung allgemein bekannt ist.
Als ein Beispiel des Falles d) erlaube ich mir den Fall vorzuführen, wo Jemand, der sich vor einer Kreuzspinne im hohen Grade ekelt, von einem Andern, in dem Augenblicke als er gerade ein Messer in der Hand hat, in der Art geneckt wird, dass ihm dieser ein solches Thier ins Gesicht zu werfen sich anschickt, und dieser ihm in der Aufregung des heftigsten Entsetzens einen Stich mit dem Messer beibringt.
130 Nur die in den mit a) und b) bezeichneten Punkten der obigen Gesetzesstelle ausgedrückten Fälle werden sich als in das Gebiet der Krankheit gehörend durchaus nach arzneiwissenschaftlichen Grundsätzen beurtheilen lassen. Denn nur in diesen Fällen liefert die Arzneiwissenschaft als solche die nöthigen Behelfe dahin, ob der Krankheitszustand vorhanden ist oder war, und bestätigt zugleich den Satz, dass dieser Krankheitszustand seiner Natur nach die Eigenschaft habe, jede willkürliche Bestimmung für das mit dieser Krankheitsform behaftete Individuum aufzuheben.
Frägt es sich aber, welche Zustände der Gesetzgeber in dem Punkte c) noch ausser dem angeführten Beispiele der vollen Trunkenheit gemeint haben könne, so lässt sich nur die bereits oben angeführte Antwort dahin geben, dass darunter jeder Zustand zu verstehen sei, in welchem der Mensch sich nicht seiner Thätigkeit, als einer von seinem Willen abhängigen Aeusserung seiner Kraft, bewusst war, also z. B. der Zustand des Traumes, eines heftigen, ohne Absicht auf die That von ihm in sich erregten Affektes u. s. w.
Raserei, selbst ein hoher Grad von Wahn- oder Blödsinn, sind daher keineswegs die einzigen, noch diejenigen Zustände, deren Erhebung so wie bezüglich deren die Bestimmung des Verhältnisses der Strafbarkeit eines Individuums in Rücksicht auf eine bestimmte That, besondere Schwierigkeiten darbieten wird, auch sind derlei Zustände gewöhnlich von so in die Augen fallenden Kennzeichen begleitet, dass es selbst für einen Laien meistens nicht schwierig ist, in seiner Beurtheilung hierin der Wahrheit sehr nahe zu kommen. Es wird daher der Arzt in solchen Fällen vielfältig nichts Anders thun können, als die sich dem Richter so zu sagen von selbst darbietende Ansicht der Sache auf wissenschaftliche Prinzipien zurückzuführen, und zu bestätigen. (Siehe hierüber den ersten Aufsatz in diesem Buche §. 4 und fg.)
Weit schwieriger ist jedoch die Aufgabe, wenn es sich darum handelt, dass von einem Menschen ein Verbrechen begangen wurde, von welchem entweder gar kein besonderer Krankheitszustand, oder doch kein solcher sich erheben lässt, von welchem sich sagen liesse, dass er unter diejenige Krankheitsform gehöre, welche als immerwährende oder abwechselnde Sinnenverwirrung durch die Arzneiwissenschaft bezeichnet werden, und wenn doch wieder andererseits Gründe vorliegen, welche es zweifelhaft machen, ob wirklich das in Frage stehende Individuum nicht unter 131 einem Einflusse gestanden ist, welche seine Thätigkeit ohne den Einfluss seines Willens bestimmte, wie z. B. der hier im §. 53 erwähnte Fall.
Die Lösung einer solchen Aufgabe ist immerhin schwierig, aber doch nur schwierig und nicht unmöglich, denn es lässt sich ohne Ueberschätzung behaupten, dass umsichtiges und tiefes Studium der menschlichen Natur, verbunden mit eigentlichen medizinischen Kenntnissen, und umsichtige Erwägung der sich darbietenden Verhältnisse, zur Lösung dieser Aufgabe führen müssen, ja es ist hier noch der Vortheil vorhanden, dass derlei Zustände vielfältig durch die Auffassung rein menschlicher Zustände sehr gründlich beurtheilt werden können, während zur Beurtheilung eigentlicher Krankheitszustände gerade nur diejenige beschränktere Zahl von Erfahrungen benützt werden kann, welche die Pathologie geliefert hat. Es wird sich also, um hier zu einem entsprechenden Resultate zu gelangen, weniger darum handeln, wie man es anfangen soll, um über solche Zustände klar zu sehen, als was zu geschehen habe, um die gewonnenen Resultate in einer solchen Form darzustellen, welche deren Ergebniss für den richterlichen Zweck brauchbar macht.
Richterlicherseits hat man sich die Lösung dieser Aufgabe nicht selten dadurch erschwert, dass man von der Ansicht ausging, es müsse, um Jemanden bezüglich einer bestimmten, als Verbrechen sich darstellenden, That straflos zu finden, dargethan sein, dass sein subjektiver Zustand, entweder überhaupt, oder im Augenblicke der verübten That absolut unzurechnungsfähig war, oder mit anderen Worten, dass er in einem solchen Zustande sich befand, in welchem er, — er mochte nun was immer verübt haben, für unzurechnungsfähig müsse gehalten werden.
Diese Ansicht ist nicht richtig, denn sie ist nicht nur nicht in den Worten des Gesetzes enthalten (sieh §. 55 und den mit lit. d) bezeichneten Fall), sondern sie lässt sich selbst nach psychologischen Grundsätzen nicht rechtfertigen, denn selbst beim Wahnsinne befindet sich der Mensch nicht in einem Zustande, der alle willkürliche Bestimmung ausschlösse. Das Materielle der Handlung eines Wahnsinnigen erscheint, wie bei einem Vernünftigen, willkürlich bestimmt, er wählt unter den Mitteln zur Ausführung nicht selten nach ganz richtiger Beurtheilung, er ist mit Einem Wort keine Maschine, die da getrieben wird, sondern er ist und bleibt 132 Mensch, d. i. ein sich selbst nach Vorstellungen willkürlich bestimmendes Wesen, nur sind seine Vorstellungen von anderer Beschaffenheit, als jene anderer Menschen, er ist also nicht darum straflos, weil er absolut unzurechnungsfähig ist, sondern weil man, wenn man in seine Ideen eingeht, entweder wirklich findet, dass in der Art, wie er die Sache sieht, das Recht auf seiner Seite ist, oder weil man sich zugesteht, dass man in das Chaos seiner Gedanken nicht einzudringen vermag.
Indem man sich daher die Aufgabe so stellt, wie sie oben ausgedrückt ist, spricht man einen Satz aus, den man in der Anwendung schon dadurch als unhaltbar erklärt, dass noch keinem vernünftigen Kriminalrichter eingefallen ist, einen Menschen, welcher ärztlich als wahnsinnig erklärt ist, und der in diesem Zustande ein Verbrechen verübte, blos darum in Kriminaluntersuchung zu ziehen, weil er bei Verübung des Verbrechens mit zweckmässiger Wahl der Mittel zu Werke gegangen ist, und dadurch kundgab, dass er allerdings in einem gewissen Grade einer vernünftigen Ueberlegung fähig war.
Die Aufgabe der Erhebung muss daher anders und zwar in der Formel gestellt werden: Ist die hervorgebrachte Wirkung (die That), sofern sie gesetzwidrig erscheint, eine Folge eines mit Willkür gefassten Entschlusses über die ihm möglich gewesene Disposition mit seinen Kräften, oder ist sie es nicht? — Denn ist einmal nachgewiesen, dass ein Mensch unter den inneren und äusseren Umständen, unter denen er sich befand, irgend eine Thätigkeit üben oder unterlassen musste, und dass es ihm an Ueberlegung gebrach, einen anderen Entschluss fassen zu können, als jenen, von dessen Vorhandensein die geübte Thätigkeit zeugt, so hat er zwar nach den Gesetzen der menschlichen Natur, d. h. nicht nach blos mechanischen Gesetzen, jedoch nicht als freier, eines zwischen bös und gut unterscheidenden Vorsatzes wählender Mensch gehandelt, dessen That ist daher keiner Zurechnung fähig, da ihr kein böser Vorsatz zu Grunde liegt. (Siehe §. 20.)
Um nun das bisher Gesagte noch mehr zu begründen, sei es mir vergönnt, einen Blick in das geheimnissvolle Getriebe der Tiefen des menschlichen Geistes zu thun, und das dortselbst Wahrgenommene in dem Sinne und zu dem Zwecke zu schildern, welchen ich mir im §. 5 dieses Aufsatzes aufzustellen erlaubte. Dieses Befugniss glaube ich, obwohl Laie in 133 den medizinischen Wissenschaften in meiner Eigenschaft als Richter hier um so mehr in Anspruch nehmen zu dürfen, als es sich hier um Zustände handelt, welche, zu ihrer richtigen Auffassung, von dem rein menschlichen Standpunkte aufgefasst sein wollen, ein Standpunkt, welchen einzunehmen Niemand ausschliesslich, Jeder aber berufen ist, welcher zu diesem Geschlechte zu gehören sich bewusst ist.
Es ist oben bei §. 10 und dem Folgenden der Unterschied zwischen animalischen und den blos organischen Wesen angegeben worden, auch wurde daselbst auf den Unterschied hingedeutet, welcher zwischen dem Menschen und den übrigen blos animalischen Wesen obwaltet, und es wurden insbesondere zwei Erscheinungen angeführt, welche blos bei dem Menschen, sonst aber bei keinem animalischen Wesen zu gewahren sind, nämlich Sprache und Handeln nach Begriffen, als vorzügliches charakteristisches Merkmal der Menschheit aber die Vernunft, nämlich die Anlage des Menschen zur Sittlichkeit dargestellt.
Betrachten wir nun aber auch die Verhältnisse, in welchen sich selbst jene Anlagen des Menschen, welche er mit dem Thiere gemein hat, gegen einander im Vergleiche mit dem Verhältnisse befinden, welches bei Thieren obwaltet.
Der Mensch hat im Allgemeinen entschieden so viel mit dem Thiere gemein, dass seine Lebensthätigkeit eine aktive, d. i. eine solche ist, in welcher sich die Eindrücke der Aussenwelt nicht blos abspiegeln, oder denselben blos mechanisch oder chemisch verändern, sondern dass er gegen die äusseren Eindrücke einerseits reagirt, andererseits aber gewisse äussere Eindrücke bedarf, ohne deren Vorhandensein sich die Lebensthätigkeit selbst aufheben würde (Luft, Nahrung u. s. w.) und dass die Befriedigung oder Hemmung der Lebensthätigkeit nach Aussen mit einer eigenthümlichen Modifikation derselben verbunden ist, welche sich durch die Empfindung, nämlich durch das Bewusstwerden des Verhältnisses der Lebensthätigkeit zu dem äusseren Eindrucke kund gibt; endlich dass die Empfindung ihrerseits seine Thätigkeit nothwendig in eine entsprechende Bewegung setzt.
So weit kommt der Mensch mit dem Thiere überein, dessen verschiedene Gattungen sich nach der Verschiedenheit der Vollkommenheit ihres Organismus darin unterscheiden, dass sie zu einer grösseren oder geringeren Zahl von Empfindungen, und in dieser Beziehung zu einem mehr 134 oder minder klaren Bewusstsein derselben, also zu mehr oder minder zahlreichen und lebhaften Empfindungen geeignet sind.
Sehen wir aber weiter, so finden wir eine Erscheinung, welche den Menschen wesentlich vom Thiere unterscheidet.
Diejenige Aeusserung der Lebensthätigkeit, welche der Empfindung entspricht, der Trieb und nach den verschiedenen Arten der Empfindungen, die Triebe, sind nämlich bei dem Thiere die einzigen Motive seiner Thätigkeit gegen die Aussenwelt, und zwar in derjenigen Unmittelbarkeit, in welcher die Aussenwelt auf die Lebensthätigkeit wirkt.
Das Thier äussert sich nicht nur durch seinen Trieb, sondern es äussert seine Thätigkeit nicht ohne seinen Trieb, und auch nicht anders, als sein Trieb es fordert; hat es aber seinen Trieb befriedigt, und hat dadurch das Motiv zur Aeusserung seiner Thätigkeit zu wirken aufgehört, so äussert es dieselbe, wenigstens in dieser Richtung, so lange gar nicht mehr, als sich der Trieb nicht wieder einstellt.
Bei dem Menschen findet man nicht selten die entgegengesetzte Erscheinung, wenigstens gibt es Leute genug, welche, wenn sie ihre Triebe vollkommen befriedigt, oder wenn dieselben schon zu wirken aufgehört haben, noch immer nach Wiederholung des die Befriedigung dieser Triebe begleitenden Genusses streben. Diese Erscheinung, so verwerflich eine solche Aeusserung in moralischer Beziehung ist, ist doch eine zu charakteristische Abweichung von der Entwicklung der blos thierischen Thätigkeit, um nicht in psychologischer Beziehung gewürdigt zu werden, besonders da dieser Abweichung noch eine andere entspricht, die Erscheinung nämlich, dass kein Thier einen anderen Weg sucht seinen Trieb zu befriedigen, als den ihm von der Natur gebotenen, der Mensch aber sich Genüsse raffinirt, ja sogar Genüsse erfindet, welche oft naturwidrig sind, ja er bringt es sogar dahin, und dieses ist der eigentliche Kulminationspunkt seiner Abweichung vom Thiere in der Art und Weise der Befriedigung seiner Triebe, dass er sich, wie z. B. die Opiumesser und Raucher, mit Zerstörung seiner physischen Natur einen Genuss schafft, der nur in der Phantasie besteht, und diesen sogar den reellen Genüssen vorzieht.
Das Thier lebt nur für seinen Trieb. Was seinen Trieb nicht berührt, ist — wenn es auch nicht ohne allen Eindruck auf seine Sinne bleibt — doch für dasselbe so viel als gar nicht vorhanden. Asinus ad lyram ist ein bekanntes Sprichwort, wenn man vollkommene Unempfindlichkeit für 135 irgend einen in die Sinne fallenden Gegenstand ausdrücken will. Ebenso ist es unmöglich ein Thier zu etwas abzurichten, wozu es nicht ein gewisser, entweder allen Thieren, oder ein seiner Gattung eigenthümlicher Trieb leitet. Man kann einem Hunde, nicht aber einem Kalb apportiren lehren, einen Falken, nicht aber eine wilde Gans zur Jagd abrichten.
Andererseits sehen wir aber auch, dass das Thier dort, wo es seine Triebe seiner organischen Natur gemäss entwickelt, auch unmittelbar der Befriedigung entgegengehe, ohne sich durch irgend eine Vorstellung, es müsste denn eine solche sein, welche einen noch stärkeren Trieb aufregt, von der Befriedigung abhalten zu lassen. Das hungernde Thier frisst, wo es etwas bekommt, und was es bekommt, wenn es seiner Natur angemessen ist, es kennt nicht Ekel noch irgend eine Rücksicht, z. B. auf das Bedürfniss Anderer u. s. w., höchstens die Aussicht auf Züchtigung oder gewisse sympathetische Triebe, z. B. der Liebe zu den Jungen, sind vermögend dieses Streben zu überwiegen.
Wir sehen aber auch, dass der Trieb eines Thieres, wenn er einmal eine gewisse Stärke erreicht hat, jede andere Vorstellung überwiegt. Der gezähmte Wolf verschont, wenn er hungert, seinen Herrn nicht mehr, der läufige Hund ist durch keine Züchtigung abzuhalten der möglichen Befriedigung nachzulaufen u. s. w.
Ganz anders verhält sich die Sache bei dem Menschen.
Wir sehen hier die verschiedenartigsten Entwicklungen bei einem im Wesentlichen gleichen Organismus, denn es ist bekannt, dass die Verschiedenheit der organischen Beschaffenheit zwischen einem normalen Menschen und einem (nur nicht verkrüppelten) Dummkopf beinahe Null ist, im Vergleiche mit der ungeheuren Verschiedenheit zwischen irgend einem Menschen und irgend einem Thiere, und eben so sehen wir, dass es beinahe keine Anlage gibt, in welcher ein Mensch etwas geleistet hat, in welcher nicht auch jeder Andere etwas leisten könnte. Es ist freilich ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Gemälde eines Raphael und einem Fratzengesichte, welches irgend ein Stümper, der nichts besseres zu Wege bringt, an eine Wand mit Kohle hinzeichnet, allein Beide kommen doch darin überein, dass zu beiden die Gabe der Nachahmung gehört, ohne welche es unmöglich bleibt auch nur ein Fratzengesicht aufzuzeichnen.
136 Dass endlich der Mensch im Stande sei, seine stärksten Triebe, ja selbst jenen der Erhaltung seines Lebens, einer Vorstellung zu opfern, ist eine Thatsache, deren Exemplifikation sich Jeder aus seiner geschichtlichen Erinnerung zu geben vermag.
Noch auffallender ist der Unterschied in der Art und Weise, wie der Mensch der Befriedigung gewisser Triebe entgegengeht, und hier tritt insbesondere die Aeusserung des Geschlechtstriebes entgegen.
Das Thier geht hier mit der entschiedensten Unmittelbarkeit zu Werke, es sucht sich ein Geschöpf seiner Gattung und befriedigt damit seinen Trieb mit Gewalt, wenn das andere die Befriedigung nicht gutwillig gestattet, und kümmert sich auch nicht darum, ob es dem anderen angenehm oder unangenehm ist, wie man dieses beim Hornvieh sehen kann, wo es sich ereignet, dass ein schwerer Stier einer Kuh das Rückgrath abdrückt, und er doch von seiner Bemühung nicht eher ablässt, als bis sie am Boden liegt und nicht mehr aufstehen kann.
Bei dem naturgemäss Entwickelten, d. h. weder in stumpfer Roheit aufgewachsenen, noch moralisch verdorbenen Menschen ist die erste thätige Aeusserung des erwachenden Geschlechtstriebes die Geschlechtsliebe, welche sich aber oft so sonderbar äussert, dass man Mühe hat, die wahre Veranlassung in ihren Aeusserungen aufzufinden. Nicht selten geschieht es, dass beide Theile gar nicht daran denken, dieses Motiv als die Veranlassung ihrer wechselseitigen Zuneigung zu vermuthen; man nennt das Gefühl, welchem man sich hingibt, Freundschaft, Hochachtung, und sucht die Zuneigung des anderen Gegenstandes auf jede andere Weise eher, als auf diejenige zu gewinnen, welche das bezeichnete Motiv klar an den Tag legte.
In der That lässt sich auch nicht verkennen, dass durch diese Art und Weise, wie sich der erwachende Geschlechtstrieb in vielen Fällen ausspricht, der Entwicklung des Sittlichkeitsgefühles vortrefflich gedient ist, denn der Mensch lernt Selbstbeherrschung und aufopfernde Hingebung dadurch mehr und besser üben, als er bis dahin noch wahrscheinlich in den wenigsten Fällen Veranlassung hatte, er fühlt sich selbstständig, weil er nicht mehr blos seinen eigenen Empfindungen, sondern für ein anderes Wesen zu leben fühlt.
Diese Art der Aeusserung des Geschlechtstriebes ist aber auch die, jedem unverdorbenen Menschen natürliche, weil sie sich in der That bei jedem unverdorbenen Menschen findet, wo sie sich aber findet, es 137 unverkennbar ist, dass der Mensch gerade in dieser Art Entwicklung seines Wesens vielleicht die grösste Seligkeit empfindet, deren er auf Erden fähig ist, es ist das Paradies der Unschuld; ehe sie zum vollen Bewusstsein erwacht ist, denn in diesem Zustande, wo der Mensch Alles, was sein durch den erwachenden Trieb aufgeregtes Lebensgefühl Schönes und Erhabenes in seiner Phantasie erzeugt, auf den geliebten Gegenstand überträgt, ist ihm Dasjenige goldene Zeitalter gegeben, in welchem die Gottheit noch sichtbar auf Erden wandelte. Es ist freilich ein Traum, dem Erwachen folgen muss, allein so viel ist gewiss, wenn die Liebe einmal sieht, so hat sie aufgehört Liebe zu sein.
Diese Thatsachen, deren Wahrheit zu tief in dem menschlichen Gefühle gegründet ist, als dass man sie im Ernste bezweifeln könnte, wären nun entschieden unmöglich, wenn der Mensch gleich dem Thiere lediglich auf eine seinen Trieben unmittelbar entsprechende Thätigkeit angewiesen wäre, sie beweisen vielmehr35, und zwar sowohl in ihrer verderblichen, als in ihrer den sittlichen Zustand befördernden Erscheinung, dass die Lebensthätigkeit des Menschen so konstituirt sei, dass die Thätigkeit des Organismus desselben von dessen Vorstellungsthätigkeit bedeutend überwogen werde, und dass daher das eigentliche Leben des Menschen ein geistiges, ein Leben in der Vorstellungsthätigkeit sei.
Diese Wahrheit findet sich aber auch bestätigt, wenn man den Organismus des Menschen selbst betrachtet.
Der bei dem Menschen, im Vergleiche mit allen Thiergattungen, am meisten ausgebildete Theil ist das Nervensystem, also gerade derjenige organische Theil, welcher der Vorstellungsthätigkeit zuverlässig am nächsten steht, dagegen aber gibt es kein einzelnes Sinneswerkzeug eines Menschen, welches nicht von jenem einer bestimmten Thiergattung übertroffen würde. — Alle Sinneswerkzeuge eines normal organisirten Menschen sind aber wieder so beschaffen, dass sie, wie bereits im §. 61 138 bemerkt wurde, nicht nur einer Ausbildung fähig sind, welche jener der hierin am besten begabten Thiergattungen nahe kommt, sondern dass diese Ausbildung einzelner Sinne ohne Nachtheil, ja sogar mit gleichzeitiger Entwicklung auch der übrigen Sinne Statt finden kann. Als Beispiel möge der feine Geruch- und Gehörsinn der Wilden und der hohe Grad von Gelenkigkeit dienen, welchen die Jugend unserer Zeit in orthopädischen Instituten etc. erwirbt, ohne dass man noch ein Beispiel erlebte, dass ein Jüngling, dessen Körperkräfte auf diese Art entwickelt wurden, dadurch an irgend einem Sinne oder gar in seinen geistigen Funktionen schwächer geworden sei, wohl aber dürfte es eben nicht schwer sein, Beispiele vom Gegentheile aufzufinden36.
Ebenso begegnet man der Erfahrung, dass der Mensch im Stande ist, die Thätigkeit der am meisten in gewissen Beziehungen begabten Thiere, sofern ihre Organe, wie etwa jene der Insekten, nicht gar zu verschieden sind, beinahe zu erreichen, nicht einmal der Biegsamkeit der menschlichen Stimme zu gedenken, durch welche er vermag, die Laute der Thiere, vom Miauen der Katze bis zum Schlag der Nachtigall, oft täuschend nachzuahmen, eine Fähigkeit, welche, im Vorbeigehen gesagt, nicht wenig zur Bildung der menschlichen Sprache beigetragen haben mag, sobald einmal der Mensch das Bedürfnis fühlte, seine Vorstellungen Anderen mitzutheilen.
139 Mit dieser Bildungsfähigkeit aller Organe des Menschen ist es nun entschieden nicht zu vereinbaren, dass ein einzelnes Organ die übrigen überragte, denn wäre dieses der Fall, so könnten wir nicht willkürlich das eine oder das andere der menschlichen Organe in so hohem Grade ausbilden, wie es wirklich geschieht. Es folgt daher, dass die Organe des Menschen und daher auch die ihren Aeusserungen entsprechenden Triebe so im Gleichgewichte stehen, dass der Mensch nicht zur Entwicklung gewisser einzelner Triebe bestimmt sei, sondern seine Bestimmung in dem Resultate der Kombination seiner Triebe durch die Vorstellungsthätigkeit liege.
Bei keinem Thiere finden wir endlich die Erscheinung des Wahnsinns, wir finden sie aber bei dem Menschen, und zwar insbesondere in jenem Falle, wo irgend eine Funktion (z. B. die Geschlechtsfunktion bei dem furor uterinus) eine übermässige Stärke erlangt, und also ein Theil des menschlichen Organismus aus seiner coordinirten Stellung zu den übrigen heraustritt. Dennoch dürfte der bei dem Furor erregte Trieb an Stärke schwerlich jenem, welchen ein Thier zur Brunstzeit empfindet, gleichkommen37.
Es erhellt daher, dass ohne gänzliche Zerrüttung des menschlichen Sein's die Beschaffenheit keines einzelnen Organes sich so gestalten kann, dass es sich zum Triebe in der Weise entwickle, wie dieses bei dem Thiere der Fall ist, und dass daher selbst der physische Organismus des Menschen so eingerichtet ist, dass alle dessen einzelne Theile in einem, der Bestimmung des Menschen, ein geistiges Leben zu führen, entsprechenden Verhältnisse stehen, welches Verhältniss, wo es gestört ist, jedenfalls eine Anomalie, entweder durch eine fehlerhafte ursprüngliche Anlage oder durch den Zustand der Krankheit, bildet.
Bereits bei §. 32 wurde der Satz ausgesprochen, dass der Mensch in seiner irdischen Laufbahn nur ein Wesen, d. i. ein vollkommenes in allen seinen den verschiedenen Aeusserungen desselben entsprechenden Anlagen innig verbundenes Ganzes sei, ja dass die Annahme von verschiedenen Anlagen desselben Menschen nicht in der objektiven Beschaffenheit 140 des Subjektes, sondern nur in der subjektiven Vorstellung des Beobachters desselben gegründet sei, welcher, um sich die Uebersicht des Ganzen zu erleichtern, gewisse Abstufungen festsetzen muss.
Aus dieser Ansicht folgt nun auch die Nothwendigkeit, den Satz, an dessen Richtigkeit übrigens ohnehin Niemand zweifelt, hier besonders auszusprechen, dass auch kein einzelnes Organ des Menschen ein für sich bestehendes Ganzes, sondern nur immer ein Theil jenes Wesens sei, welches wir Mensch nennen, und sich daher nur für den dritten Beobachter als ein Theil jenes Wesens ausspricht, weil es eine besondere Verrichtung übt, welche nur dieses, nicht aber ein anderes Organ zu leisten im Stande ist. — Nur das Auge übt die Funktion des Sehens, nur das Ohr jene des Hörens, allein es lässt sich nicht sagen, das Auge sieht, oder das Ohr hört, sondern, wenn man nicht figürlich sprechen will, so muss man sagen: der Mensch sieht mittelst des Auges, der Mensch hört mittelst des Ohres u. s. w., welches mit anderen Worten so viel sagen will, als: er entwickelt Vorstellungen, die einer Empfindung entsprechen, welche in dem Angeregtwerden durch äussere Eindrücke mittelst des Auges, des Ohres u. s. w. entstanden sind.
Jeder mögliche neue Eindruck, welchen der Mensch durch die Sinne erhält, trifft nun auf alle durch die früheren Eindrücke veranlassten, noch vorhandenen Vorstellungen, und bildet mit diesen ein neues Ganzes, wodurch daher in dem ganzen Wesen des Menschen nothwendig eine Veränderung entsteht.
Diese Veränderung gibt sich nun durch jene Erscheinung kund, welche wir Ideenassociation nennen, und bezüglich deren uns die Erfahrung lehrt, dass jeder Eindruck, dessen sich der Mensch bewusst wird, somit jede Empfindung eine eigene Ideenassociation zur Folge hat.
So richtig diese Erfahrung ist, so wenig darf man sich dadurch verleiten lassen, diese Erscheinung als etwas Selbstständiges zu betrachten, sondern sie ist, von Fall zu Fall, eine Wirkung der Gesammtthätigkeit eines Menschen, auf welche jedes einzelne (physische) Organ so gut seinen Einfluss hat, als auf die entstandene Empfindung selbst. Der etwa an Kopfschmerzen leidende Mensch empfindet bei dem Lärme einer Trommel etwas Anderes, als der Gesunde, der blosse Anblick einer Trommel wird ihm daher eine andere Ideenassociation erregen, als wenn er gesund wäre u. s. w.
141 Die Richtigkeit dieser Ansicht ergibt sich aber noch mehr daraus, wenn man erwägt, welche Rückwirkung die Ideenassociation auf die physischen Organe hat, denn es gibt bekanntlich Nachrichten, die im Stande sind, einen Gesunden krank und einen Kranken gesund zu machen. Es ergibt sich daher, dass es sehr irrig wäre, anzunehmen, dass an der Ideenassociation nicht auch die körperlichen Organe ihren wesentlichen Antheil haben, dass daher die Ideenassociation selbst, wie jeder andere Zustand, eine Veränderung im Gesammtleben des Menschen sei.
Hieraus ergibt sich nun der weitere Satz, dass bei jedem Eindrucke, welchen der Mensch erfährt, sich eine doppelte Wirkung in Bezug auf das Individuum als Ideenassociation aussprechen wird, nämlich nach der Art und Weise, wie er das Organ affizirt, welches denselben aufnimmt, und auf welche Disposition des Gesammtlebens, d. i. auf welche allgemeine Stimmung er in dem Augenblicke trifft, als er aufgenommen wird, insbesondere aber, welche Vorstellungen bei seinem Eintritte bereits vorhanden oder auch nicht vorhanden sind38.
Da sich nun die Handlungsweise des Menschen nach diesen beiden Momenten, nämlich nach der Beschaffenheit des wirklich vorhandenen äusseren Eindruckes und nach der Stimmung richten kann, in welcher er aufgenommen wird, so ergibt sich, dass, um das Verhältniss der Handlungsweise zu einem dritten Gegenstande, z. B. zu einem Strafgesetze, zu beurtheilen, es unumgänglich nothwendig ist, über die Stimmung des Menschen in dem Augenblicke, als irgend ein äusserer Eindruck eine gewisse Handlungsweise bei ihm hervorbrachte, im Klaren zu sein, um dadurch die Gewissheit zu erlangen, welche Vorstellungen 142 auf seine Thätigkeit wirkten, und welche etwa bei einem Andern gewirkt hätten, bei diesem Individuum aber nicht vorhanden waren.
Zur Ausmittlung dieses Verhältnisses ist nun insbesondere die Betrachtung gewisser Gemüthszustände vom objektiven Gesichtspunkte geeignet.
Ich erlaube mir zu diesem Ende über folgende Gemüthszustände, nämlich über
Affekte und Leidenschaften und Schwärmerei
Einiges zu sagen, Zustände, welche in der Regel nicht unter die Krankheiten gehören.
Dieser Darstellung folgen einige Bemerkungen über Blödsinn und Dummheit, weil diese Zustände nur zum Theile in die Kategorie von Krankheiten gehören.
Diesen folgen einige Worte über einige wirkliche krankhafte Zustände, nämlich monomania und fixe Idee, ferner Melancholie und mania occulta, weil, ungeachtet diese Zustände zu den entschieden krankhaften gehören, es doch in einzelnen Fällen zweifelhaft sein kann, ob und wiefern ihr blosses Vorhandensein die Strafbarkeit in Bezug auf eine bestimmte That aufzuheben geeignet sei; endlich Einiges über verstellte Gemüthszustände und Berauschung.
Bei jedem dieser Zustände habe ich mich bemüht, so viel es mir möglich war, die besondern Modificationen anzugeben, welche der juridische Zweck einer solchen Erhebung erfordert, um zu einem, dem Zwecke dieser Erhebung entsprechenden Resultate zu gelangen, welcher Darstellung sodann einige im gleichen Sinne gesprochene Worte über verstellten Wahnsinn und über den Hang zu gewissen Verbrechen folgen.
Das Wort Affekt, zu deutsch angeregt sein (nicht Anregung), bedarf in diesem allgemeinen Sinne keiner Erklärung. Gewöhnlich wird es jedoch in einem engeren Sinne genommen, wo es das spezielle, sich durch gewisse Aeusserungen kund gebende Angeregtsein eines bestimmten Triebes, eines animalische Wesens bezeichnet, wo dann dieser Begriff durch die Benennung der Aeusserung der Empfindung des in solcher Art angeregten Individuums näher bestimmt wird. Man unterscheidet auf diese Art einen Affekt des Schreckens, des Zornes, der Furcht, der Freude etc.
143 Es wäre nun wohl eine vergebene Mühe, die charakteristischen Merkmale aufzusuchen, wodurch sich die einzelnen Affekte von einander unterscheiden, denn Jedem steht frei, die Zahl dieser Benennungen nach Gutdünken zu vermehren oder zu vermindern, die Wissenschaft, wenigstens die Rechtskunde, wird dabei weder gewinnen noch verlieren, so wenig als die Heilkunde dadurch gewinnen oder verlieren wird, wenn man mehr oder weniger Krankheitsformen, welche aber alle auf dieselbe Weise geheilt werden, aufstellt, wenn man nur in erster Beziehung das charakteristische Merkmal des sich äussernden speziellen Triebes nicht aus dem Auge verliert.
Damit nämlich ein Trieb sich so entschieden äussere, dass man ihn von seiner Aeusserung mit Bestimmtheit zu erkennen vermag, muss nothwendig vorausgesetzt werden, dass dieser Trieb mehr als andere Triebe angeregt gewesen sei, und dass daher das Gleichgewicht der Funktionen gestört wurde.
Diese Erscheinung ist nun, und zwar auf zweierlei Art, möglich, nämlich dadurch, dass ein Trieb in seiner natürlichen Aeusserung gehemmt und dadurch zu einer sonst nicht normalen Stärke gebracht wurde, oder dass ein der natürlichen Entwicklung des Triebes entgegenstehendes Hinderniss plötzlich aufgehoben wird.
In dieser Rücksicht lassen sich die Affekte, jedoch ohne viel Gewinn für die Wissenschaft, in angenehme und unangenehme, und je nachdem das Hinderniss plötzlich oder allmälig eintritt oder gehoben wird, in erregende und deprimirende eintheilen u. s. w.
Wichtiger als diese Eintheilungen wird es für den Zweck der richterlichen Erhebung sein, das Vorhandensein des Affektes und dessen Einfluss auf den Willen des Individuums zu bestimmen, zu welchem Behufe folgende Bemerkungen nicht überflüssig sein dürften.
Wenn wir diejenigen Erscheinungen betrachten, welche man als Affekte bezeichnet, so finden wir, wie bereits im vorigen Paragraph angegeben wurde, als gemeinschaftliches Merkmal eine Empfindung eines angeregten Triebes, d. i. (laut §. 10) das Bewusstwerden der Befreiung oder der Hemmung eines sich äussernden Triebes durch einen äusseren Eindruck. Der Affekt gehört also in das Gebiet der Vorstellung, und kann sich daher nur nach den Gesetzen der Vorstellungsthätigkeit äussern, d. h. er wird und muss auf die äussere Thätigkeit reagiren.
144 Die einzige Art und Weise, wie die Vorstellung eines angeregten Triebes auf die äussere Thätigkeit reagiren kann, ist nun der Natur der Sache nach, dass er diese zur Befriedigung, wo diese möglich ist, und zur Hinwegräumung des Hindernisses, wo ein solches vorhanden ist, antreibt. — Die eine oder die andere Wirkung muss also erfolgen, und wo sie nicht erfolgt, kann dieses Nichterfolgen nur darin seinen Grund haben, weil Vorstellungen vorhanden waren, welche hinlängliche Stärke besitzen, um diese Wirkung des Affektes zu beseitigen.
Mangeln aber solche Vorstellungen, so ist es ganz undenkbar, dass der Affekt sich nicht gerade so äussern sollte, wie es nothwendig ist, um, und zwar auf dem möglich kürzesten Wege, zu seiner, d. i. des angeregten Triebes, Befriedigung zu gelangen.
Soll daher eine im Affekte begangene That strafbar sein, so muss vor Allem nachgewiesen werden, dass bei dem Menschen, welcher die That beging, wirklich zur Zeit der Begehung der That Vorstellungen vorhanden waren, welche genug Stärke besessen haben, ihn von der Hingebung an den Einfluss seines Affektes abzuhalten, wenn er nur gewollt hätte.
Dieser Beweis ist auch in dem Falle, wo das wirkliche Eintreten eines Affektes nachgewiesen wird, meistens gar nicht schwierig, es wolle daher der verehrte Leser wegen der Konsequenzen, welche daraus etwa hervorgehen, dass die Motivirung einer That durch den Affekt hier so zu sagen als ein Grund der Straflosigkeit dargestellt wird, sich immerhin einstweilen beruhigen, und mit Aufgebung aller Besorgnisse weiter lesen.
Zur Richtigstellung des Umstandes, ob wirklich bei dem Individuum, welches eine bestimmte Handlung verübte, Vorstellungen vorhanden waren, welche hinreichend stark waren, ihn von der Begehung der That abzuhalten, wenn er ihrem Impulse hätte folgen wollen, hat man nun zwei Anhaltspunkte, nämlich a) die durch die Beschaffenheit der menschlichen Natur überhaupt bedingte Stimmung in Bezug auf die vollbrachte That; b) die durch die individuellen Verhältnisse des betreffenden Subjektes bedingte Stimmung desselben in gleicher Beziehung.
In erster Beziehung darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Mensch, wie dies bei §. 20 erwähnt ist, immer ein ganzes, nicht ein getheiltes Wesen ist, dass daher kein Eindruck denkbar ist, der nicht sein ganzes Wesen affizirte. Wenn daher irgend ein Eindruck auf ihn wirkt, so kann dieser wohl eine bestimmte Funktion besonders anregen, 145 immer bleibt jedoch der ganze Mensch angeregt, er wird daher immer als Mensch, niemals als Thier empfinden, und es werden daher seine Affekte ebenfalls immer die Affekte eines Menschen, niemals die Affekte eines Thieres sein.
Zu den charakteristischen Merkmalen der Menschheit gehören nun einerseits deutlichere und lebhaftere Vorstellungen, somit eine viel lebhaftere und reichlichere Ideenassociation, und wie bei §. 20 nachgewiesen wurde, darunter die jedenfalls sehr lebhafte Vorstellung des Vorhandenseins der sittlichen Freiheit; es ist daher nur im Ausnahmsfalle, dessen Möglichkeit im folgenden Paragraph näher erörtert wird, denkbar, dass der Mensch auch im Affekte ohne das Bewusstsein der sittlichen Freiheit handle.
Begeht daher der Mensch im Affekte eine strafbare Handlung, so bleibt er dennoch strafbar, weil er gegen das Sittengesetz, dessen Bewusstsein ihm seiner Natur nach auch im Affekte nicht mangelte, gehandelt hat; der Affekt beweist dann gegen die Strafbarkeit seiner Handlung nichts weiter, als dass es ihm etwas schwerer gewesen ist, auch in diesem Falle dem Sittengesetze zu folgen; es beweiset aber gar nichts gegen die Strafbarkeit seiner Handlung, wenn er bei sonst ruhigem Zustande die That beschloss, und sich willkürlich, um die That sicherer zu begehen, in einen Affekt versetzte. Ein Fall der letzteren Art wäre z. B., wenn Jemand beschlossen hätte, einen Anderen zu ermorden, dazu aber im ruhigen Gemüthszustande nicht sich entschliessen zu können fühlend, mit diesem einen Streit anfängt, um in dem dadurch hervorgerufenen Affekt des Zornes die zum Morde nöthige Stimmung zu gewinnen39, eben so wenig gereicht es zur Entschuldigung, wenn er zwar im Affekte die That beschloss, jedoch dabei das Bewusstsein hatte, dass die That unerlaubt 146 sei, welches Bewusstsein auch durch den Affekt nicht nothwendig aufgehoben wird.
Vom Gesichtspunkte der menschlichen Natur aus betrachtet kann daher der Affekt nie die Straflosigkeit wegen eines begangenen Verbrechens begründen.
Anders stellt sich die Sache dar, wenn man die Wirkung des Affektes von dem Standpunkte der durch die individuellen Verhältnisse des betreffenden Subjektes bedingten Stimmung desselben betrachtet.
Der Mensch ist nämlich in seiner Totalität nicht blos ein sittliches, sondern er ist auch ein sinnliches Wesen, während er sich nämlich in dem Stoffe, aus welchem seine Vorstellungen gewebt sind, dadurch, dass diesem Stoffe wirklich ein Uebersinnliches beigemischt ist, wesentlich von dem Thiere unterscheidet, muss die Entwicklung der Vorstellungen, da hiezu die wirklich sinnlichen Organe das Werkzeug sind, auch den organischen Gesetzen gehorchen.
Unter diese Gesetze gehört es nun auch, dass zwar keine Affektion des einen Organes, ohne den Gesammtorganismus zu berühren, möglich ist, dass aber in dem Masse, als das einzelne Organ stärker berührt wird, die Berührung, welche der Gesammtorganismus dadurch erleidet, weniger empfunden wird, und dass daher, je heftiger ein Affekt hervortritt, um so geringer das Bewusstsein von dem Eindrucke, welchen das Gesammtleben dadurch erfährt, werde, am Ende aber, wenn der Affekt auf das Höchste gestiegen ist, auf den Nullpunkt herabsinken muss.
Auch bei dem höchsten Affekte sind daher die Vorstellungen des Sittlichen nicht ausgeschlossen, in dem Masse jedoch, als der Affekt steigt, werden alle Vorstellungen, die mit dem Gegenstande des Affektes nicht im unmittelbaren Zusammenhange sind, schwächer werden, und daher minder im Stande sein, auf die Thätigkeit, welche der Affekt fordert, hemmend zu wirken, und daher im heftigsten Grade des Affektes ihre Wirksamkeit ganz verlieren.
Je heftiger ferner der Affekt ist, um so weniger können durch solchen selbst andere Vorstellungen erzeugt werden, als solche, welche sich eben auf die Entwicklung des sich äussernden Triebes40 beziehen. 147 Wenn also in dem Augenblicke, als ein solcher Affekt eintritt, nicht schon bestimmte sittliche Vorstellungen, und zwar mit einem gewissen Grade von Intensität vorhanden sind, so werden sie auch die Wirkung des Affektes nach Aussen zu nicht hemmen können.
Der Grund eines solchen Mangels der Entwicklung sittlicher Vorstellungen gegenüber dem Affekte kann jedoch auch in der subjektiven Beschaffenheit des Individuums liegen, welches entweder durch natürlichen Stumpfsinn (Dummheit) oder durch Mangel an Statt gefundenem Eintritte deutlicher sittlicher Vorstellungen (Roheit) wenig derlei Produkte in sich aufgenommen hat, wo dann ein weit geringerer Grad des Affektes hinreicht, die im vorigen Paragraph angedeutete Wirkung zu erzeugen.
Eben dieselbe Folge kann in dem Falle eintreten, wo bereits eine krankhafte Disposition im Menschen vorhanden ist, durch welche eine, wenn auch nicht vollkommen die Objektivität der Auffassung aufhebende, jedoch theilweise Geistesverwirrung entsteht, oder wodurch die sonst gewöhnliche Entwicklung der Ideenassociation entweder gehemmt (wenn auch nicht aufgehoben), oder nach einer besonderen Richtung geleitet, oder an der Verfolgung einer gewissen Richtung gehindert wird. Einiges in dieser Art wird beinahe jeder nur einigermassen erhebliche Krankheitszustand, so wie auch Trunkenheit, wenn sie auch den Menschen der Besinnung noch nicht vollständig beraubt hat, bewirken.
Da nun, wie es bei §. 20 gezeigt wurde, die Vorstellung Desjenigen, was unter gewissen Verhältnissen das Sittengesetz von dem Menschen fordert, auf doppeltem Wege zum Bewusstsein gelangt, nämlich durch das eigene Sittlichkeitsgefühl und durch traditionelle Mittheilung, dass unter gewissen Verhältnissen ein gewisses Benehmen den Forderungen des Sittengesetzes entspreche oder nicht entspreche, so kann es geschehen, dass einem in einem heftigen Affekte befangenen Subjekte nur die durch Tradition erhaltene Vorstellung seiner Verpflichtung zum Bewusstsein kommt, 148 während das Gefühl, welches dieses bestimmte Verhalten von ihm fordert, sich gar nicht, oder doch nicht mit solcher Energie, äussert, dass das Subjekt eine Empfindung von der hierdurch erfolgten Anregung erhielte.
Da nun in solchen Fällen die Erinnerung an die blos traditionell überkommene Vorstellung ohne besondere Anregung bleiben wird, so ist es dann ganz natürlich, dass sie der durch den Affekt hervorgebrachten Anregung entweder gar keinen oder nur einen ganz unbedeutenden Widerstand zu leisten vermag, eine Stimmung, durch welche allein die Thatsache sich erklären lässt, dass zuweilen ein Subjekt angibt: ich wusste, dass Dasjenige, welches ich that, Unrecht sei, allein ich konnte nicht anders — eine Stimmung, deren psychologische Möglichkeit sich daher nicht schlechterdings läugnen lässt.
Dasjenige, welches hier von dem Einflusse der Affekte auf die Macht der sittlichen Vorstellungen in Bezug auf eine bestimmte Handlungsweise gilt, gilt um so mehr dann, wenn es sich um die Macht der Mittel handelt, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Der Zorn ist bekanntlich der schlechteste Fechter. Eben so geht es aber beinahe in allen Fällen, wo es sich darum handelt, ein taugliches Mittel zur Erreichung eines bestimmten Zweckes während der Dauer eines Affektes aufzufinden.
Bei dem Schrecken, welchen eine entstandene Feuersbrunst verursacht, geschieht es nicht selten, dass Leute ihr Geld oder ihr Geschmeide liegen lassen und irgend einen werthlosen Plunder mit grosser Anstrengung ihrer Kräfte forttragen. Mir selbst kam die Thatsache vor, dass Jemand bei einer solchen Gelegenheit einen Korb voll Porzellain über die Kellertreppe hinab ausleerte.
Es ergibt sich daher folgender, für die Rechtspflege höchst folgenreicher Satz:
Ein Affekt kann möglicher Weise entweder für sich allein, oder in Verbindung mit andern, bei dem demselben unterworfenen Individuum Statt findenden, auf seine Stimmung wirkenden Einflüssen, die Wirkung haben, dass für den Augenblick, in welchem der Affekt seine Wirkung auf die äussere Thätigkeit äussert, die Vorstellung von der Unsittlichkeit oder von sonstigen Eigenschaften der Handlung (somit also insbesondere von der Unrechtmässigkeit derselben) ganz unmächtig zur Bestimmung seiner Thätigkeit, in Betreff der seinem Affekte entsprechenden Handlungsweise, bleibt.
Aus diesem Satze, dessen Richtigkeit nach dem Vorausgegangenen kaum mehr einem erheblichen Zweifel unterworfen sein dürfte, ergibt sich nun eine, für die Erhebung eines solchen Zustandes zu dem Ende, um hiernach die Strafbarkeit einer Handlung auszumitteln, höchst wichtige Folge.
Es kann nämlich keinem Zweifel unterliegen, dass das Entstehen der Affekte nicht nothwendig die Folge eines Krankheitszustandes ist, sondern vielmehr in dem natürlichen Verhältnisse des Menschen zur Aussenwelt beruhe, dass daher zur Beurtheilung der Gewalt des Affektes die Materialien zunächst nicht im Gebiete der Pathologie, sondern recht eigentlich im Gebiete der durch die gewöhnliche Lebenserfahrung gewonnenen Resultate entnommen werden müssen; es ergibt sich aber auch, dass bei dem Umstande, wie wir gehört haben, auch solche Zustände, welche wirklich in das Gebiet der Pathologie gehören, auf die Wirkung der Affekte, insbesondere auf Ausschliessung von solchen Vorstellungen, welche ohne Vorhandensein dieses pathologischen Zustandes der Aeusserung des Affektes entgegengetreten wären, von grossem Einflusse sein können, dort, wo ein solcher Zustand vermuthet wird, auch die Erhebung die Beiziehung eines Arztes erfordere, dessen Aufgabe es dann sein wird, nicht blos nach pathologischen Grundsätzen allein, sondern mit genauer Berücksichtigung aller auf die That Beziehung nehmender Umstände darzustellen, welche Vorstellungen die That veranlassten, welche Vorstellungen, die etwa sonst geeignet waren, das Subjekt von der That abzuhalten, mangelten, oder zu wenig intensiv waren, um der That, als dem natürlichen Produkt des Affektes, hemmend entgegenzutreten, und warum, insbesondere aus welchen pathologischen Gründen sich für diesen Abgang ausgesprochen werden müsse.
Wird aber diese Aufgabe in dieser Art mit Umsicht gelöst, so lässt sich auch erwarten, dass mit dieser Darstellung dem Bedürfnisse der Rechtspflege vollkommen entsprochen sein wird, indem in dem Falle, wenn eine solche Darstellung vorliegt, der Ausspruch des Richters: ist die That zurechenbar oder nicht? keinem, oder doch mindestens keinem erheblichen Anstande mehr unterliegen kann, denn es kann nicht bezweifelt werden, dass dort, wo die Vorstellung von der Strafbarkeit der Handlung nicht vorhanden oder erwiesenermassen nach seiner Stimmung unwirksam bleiben musste, auch die Zufügung der Strafe ihren Zweck verfehlen würde, 150 der doch nur darin liegt, von der Begehung einer Handlung in Fällen abzuhalten, wo eine Abhaltung möglich ist, und zur Möglichkeit gehören eben sowohl die psychischen als die physischen Naturgesetze.
Als ein Beispiel dieser Art Erhebung dürfte etwa der Fall dienen, in welchem bei einer Statt gefundenen Rauferei Jemand von einem Anderen so heftig am Halse gewürgt wird, dass er zu ersticken glaubt, dabei aber doch so viele Besinnung behält, sich zu erinnern, dass er ein Messer im Sacke habe, dieses zieht und dem Anderen einige Stiche beibringt, von denen Dieser todt bleibt.
Hier lehrt die gewöhnliche Lebenserfahrung, dass das Gewürgtwerden eine sehr beängstigende Empfindung hervorbringt, welche die Thätigkeit der Menschen dahin bestimmt, sich aus dieser Lage zu befreien. — Zur Richtigstellung dieses Umstandes bedarf es nun eben nicht nothwendig des ärztlichen Ausspruches. Es bedarf aber des ärztlichen Ausspruches zur Erhebung des Umstandes, ob nach den vorhandenen Spuren oder sonst nach der Art und Weise, wie das Würgen Statt hatte, insbesondere nach der physischen Beschaffenheit des gewürgten Subjektes, es denkbar sei, dass die Beängstigung einen so hohen Grad gewonnen habe, dass ihm unter anderen, vielleicht nach den Statt gefundenen Verhältnissen etwa wirklich vorhandenen Hilfsmitteln gerade nur das Eine, der Gebrauch des Messers nämlich, beigefallen sei etc.
Was ist Leidenschaft? Jede Wissenschaft, in welcher dieses Wort vorkommt, hat darüber ihre eigenen Ansichten, welche jenen anderer Wissenschaften oft schnurgerade entgegengesetzt sind. Die Moral findet in den Leidenschaften gerade den Weg, welcher den Menschen von seiner Bestimmung ablenkt, während der Geschichtschreiber in den menschlichen Leidenschaften gerade das Vehikel erblickt, welches ihn seiner Bestimmung zuführt u. s. w., und die Physiologie beweiset, dass gewisse Leidenschaften eine nothwendige Folge gewisser organischer Verhältnisse sind, und ohne diese Verhältnisse gar nicht eintreten können.
Um nun bei diesen abweichenden Ansichten einen festen Grund zu finden, auf welchem man diesem Gegenstande die richtige Seite abzugewinnen vermag, erübrigt nichts, als solche Thatsachen aufzusuchen, welche hierüber ein hinreichendes Licht gewähren, und zugleich so allgemein bekannt 151 oder doch Jedermann so vor Augen liegend sind, dass sie nicht wohl bestritten werden können.
Leidenschaft und Affekt sind verschiedene Begriffe. Es gibt nämlich Affekte ohne Leidenschaft, auch sind die Thiere mancherlei Affekten unterworfen, Niemand hat jedoch von einer Leidenschaft eines Thieres im Ernste gesprochen41. Es ist also das Vorhandensein von Leidenschaften eine Erscheinung, welche man dem Menschen im Unterschiede von dem Thiere zuschreibt.
Man spricht aber ferner von der Leidenschaft als etwas, welches der Mensch zum Besten der Sittlichkeit bekämpfen soll, es muss daher unter Leidenschaft ein Zustand verstanden werden, welcher in naher Beziehung mit der Sittlichkeit steht.
Man nennt ferner einen Menschen leidenschaftlich, wenn er von allen, oder doch verhältnissmässig von vielen Gegenständen, mit welchen er in Berührung kommt, so heftig angeregt wird, dass er dann Dinge, welche sonst entweder wirklich zur Sache gehört hätten oder für ihn doch sonst von Wichtigkeit gewesen wären, nicht mehr berücksichtigt. Man sagt, ein Mensch habe für einen bestimmten Gegenstand eine Leidenschaft, wenn er, um diesen Gegenstand zu erreichen, Dinge unberücksichtigt lässt, die er nach vernünftiger Beurtheilung der Sache nicht hätte ausser Acht lassen sollen.
Die Leidenschaft besteht aber endlich nicht in dem Streben des Affektes nach Befriedigung, denn Niemand spricht bei Jemanden, welcher 152 nun schon ein paar Tage gehungert hat, von einer Leidenschaft für das Essen, so wenig, als man von Jemanden, der auf einer schiefen Fläche steht, sagt, er habe einen Trieb zum Fallen, sondern man erkennt an, dass der Mensch im ersten Falle nothwendig einen heftigen Trieb zum Essen empfinden müsse, im letzteren aber durch eine äussere Gewalt zum Umfallen bestimmt wurde.
Ein aufgeregter Trieb kann endlich wohl Leidenschaften veranlassen, allein es lässt sich nicht sagen, dass eben ein aufgeregter Trieb immer die Quelle der Leidenschaften sein müsse, denn bei den meisten jener Zustände, welche man als Leidenschaften bezeichnet, lässt sich gar nicht einmal nachweisen, dass ein und welcher Trieb ihnen zu Grunde liegen soll, z. B. bei der Leidenschaft des Spieles, des Trunkes u. s. w., ja es lässt sich nach dem, was eben gesagt wurde, behaupten, dass, wenn eine Handlungsweise blos durch einen aufgeregten Trieb bedingt wird, diese Veranlassung nur Affekt und niemals Leidenschaft genannt werden könne.
Dagegen aber ist der Umstand unverkennbar, dass man Zustände als Leidenschaften bezeichnet, welche, wie oben erwähnt, gar nicht aus bestimmten Trieben, sondern nur aus solchen Vorstellungen hervorgehen, welche selbst nur die Folge einer langen und oft sehr komplicirten Reihe von Vorstellungen sind, z. B. Eifersucht, Herrschsucht, Geiz u. s. w., ja wir begegnen sogar der Erscheinung, dass der in Leidenschaft befangene Mensch im Stande ist, die stärksten Triebe zu unterdrücken, wenn sie dem Ziele seiner Leidenschaft entgegen sind, und zwar tritt hier noch der besonders zu berücksichtigende Umstand ein, dass diese Wirkung der Leidenschaft sich in um so höherem Grade und in desto grösserem Umfange gewahren lässt, je mehr der Gegenstand, welchen die Leidenschaft anstrebt, sich als ein Begriff darstellt, und daher entfernt ist, der Gegenstand eines bestimmten Triebes zu sein. Der Wollüstling, welcher einem bestimmten Gegenstände nachstrebt, wird gewöhnlich noch Musse genug behalten, noch andere Dinge zu treiben und sich noch anderen Genüssen hingeben; der Ehrgeizige wird blos seinem Ehrgeize leben, und was dieser Leidenschaft nicht dient, für schal und seines Strebens unwürdig halten.
Es ergibt sich daher aus allen diesen Daten, dass Leidenschaft keineswegs ein physischer Hang des Menschen, sondern ein, durchaus durch seine Vorstellungsthätigkeit erzeugtes Resultat sei, welches durch physische Triebe wohl veranlasst, niemals aber durch diese 153 Veranlassung allein hervorgebracht sein kann. — Will man daher Leidenschaft definiren, so kann eine solche Definition nicht anders lauten, als: Leidenschaft sei derjenige Zustand des Menschen, in welchem er den Gegenstand einer ihm einen Genuss versprechenden Vorstellung mit Unterordnung jedes diesen Gegenstand nicht berührenden Strebens, anzustreben sich angeregt fühlt.
Es folgt jedoch aus dieser Ansicht von dem Wesen der Leidenschaft, dass dieser Zustand, eben weil derselbe ein rein psychischer Zustand ist, nur nach psychischen Gesetzen betrachtet und beurtheilt werden könne. Es folgt daher, weil gerade in der Region der Vorstellungsthätigkeit (wie dies bei §. 58 nachgewiesen wurde) das der menschlichen Natur nothwendige, und dieselbe charakterisirende Gleichgewicht herrscht, dort, wo nur Leidenschaft, nicht aber ein durch einen äusseren Eindruck bedingter Affekt, auf den Menschen wirkt, das Bewusstsein der Freiheit und Selbstbestimmung niemals aufgehoben sein könne, sondern dass der Zustand des Menschen, welcher eine Leidenschaft in sich entwickelt hat, sich immer so gestalten wird, dass er zwar sich der Anregung zur Erstrebung des Gegenstandes derselben bewusst ist, zugleich aber auch sich dabei als ein freies Wesen fühlt, welches, wenn er sich die Lust der Erreichung versagen will, sich dieselbe auch versagen kann.
Leidenschaft ist daher als solche niemals ein moralischer Zwang für den Menschen, und daher niemals ein Grund, welcher die Strafbarkeit einer Handlung, welche zur Erreichung des Gegenstandes der Leidenschaft unternommen wurde, aufhebt.
Diese Ansicht ergibt sich nun ausser aus der eben angeführten Rücksicht noch insbesondere aus der Betrachtung der früher bezeichneten Zustände, welche man Leidenschaft nennt. Keiner darunter ist unmittelbar aus dem Bedürfnisse der menschlichen Natur hervorgegangen, sondern jeder darunter kann nur durch eine Kombination von Begriffen entstanden sein, er muss daher die mannigfaltigsten, d. i. alle dem Menschen seiner Natur nach möglichen, und daher insbesondere diejenigen Vorstellungen in sich begreifen, welche mit dem Bewusstsein seiner sittlichen Freiheit verbunden sind.
Umgekehrt lässt sich aber behaupten, dass das Entstehen einer Leidenschaft ohne die Bedingung des freien Hingebens an den Gegenstand derselben gar nicht einmal denkbar ist, — denn wo kein 154 freies Ergeben an die Macht einer Vorstellung Statt findet, kann diese entweder auf die Thätigkeit des Menschen gar nicht wirken, oder sie wirkt — wie gewisse Affekte — so schnell und so heftig, dass die Wirksamkeit jeder anderen Vorstellung ausgeschlossen ist, nicht aber in der Art, dass sich alle anderen Vorstellungen, ohne aus dem Bewusstsein zu verschwinden, nur dem durch die herrschende Vorstellung angeregten Streben unterordnen. Ist sich der Mensch aber anderer Vorstellungen bewusst, und er folgt ihnen nicht, wenn sie einer bestimmten Vorstellung entgegengesetzt sind, so handelt er nicht mehr auf eine bestimmte Weise so und nicht anders, weil er nicht anders kann, sondern weil er nicht anders handeln will, d. h. weil er der ihm minder zusagenden Vorstellung, gegenüber der ihm angenehmeren, keine Macht einzuräumen entschlossen ist; er entsagt somit der in der minder intensiven Vorstellung enthaltenen Aufforderung zu Gunsten der ersteren, und wenn diese minder intensive Vorstellung jene der sittlichen Autorität ist, so begibt er sich daher ungezwungen seiner sittlichen Freiheit, er handelt also mit Willen unsittlich.
Betrachten wir aber nun in concreto alle jene Zustände, welche man als Leidenschaften unter bestimmten Benennungen bezeichnet, so ist nicht ein einziger darunter, von welchem sich sagen liesse, dass er plötzlich entstehen könne, sondern jeder darunter setzt ein wiederholtes freiwilliges Nachgeben gegen gewisse Anregungen, und dort, wo das Endresultat ein Unsittliches ist, sogar ein wiederholtes unsittliches Handeln, oder mindestens wiederholte Gedankensünden voraus. — Selbst die Leidenschaft der Liebe, obwohl derselben ein mächtiger, sinnlicher Trieb zunächst zu Grunde liegt, macht hievon keine Ausnahme. Shakespeare lässt, um es wahrscheinlich zu machen, dass sein Romeo im Augenblicke von einer heftigen Leidenschaft für Julien ergriffen wird, denselben früher für eine Rosalinde schwärmen, — die Leidenschaft war also schon vorhanden, als er Julien erblickte, nur der Gegenstand wechselte. Ausserdem finden sich Beispiele von unwiderstehlicher, im Augenblicke entstandener, unvertilgbarer Liebe, in Lafontaine'schen und ähnlichen Romanen und — sonst nirgends42.
155 Obwohl aus dem bisher Gesagten sich wohl der unbezweifelte Schluss ergibt, dass Leidenschaft die Strafbarkeit einer Handlung niemals aufzuheben vermag, so gilt diese Behauptung doch nur von der Leidenschaft als solcher, z. B. in Bezug eines Geizigen, welcher, weil er sich von seinem Mammon nicht trennen will, einem Anderen sein Geld vorenthält, nicht aber auch dann, wenn dadurch Gemüthszustände hervorgerufen werden, welche, einmal vorhanden, selbstständig auf die Vorstellungsthätigkeit wirken, und dann eine strafbare Handlung zur Folge haben. Diese Zustände können nämlich von der Art sein, dass sich mit Bestimmtheit sagen lässt, ihr Eintritt sei eben so wenig in der Absicht Desjenigen gelegen, welcher sich der Leidenschaft hingibt, als es in der Absicht Desjenigen, welcher sich blos aus Neigung zum Trunke voll betrinkt, gelegen ist, in diesem Zustande das Haus anzuzünden. — Es lassen sich daher in Beziehung auf die Wirkung der Leidenschaften folgende Momente unterscheiden:
I. Es kann geschehen, dass ein Mensch, welcher sich einer Leidenschaft hingibt, von dem Gegenstande derselben so ergriffen wird, dass der ganze Komplex der Vorstellungen, durch welche seine Handlung sich als eine unsittliche darstellt, ihm gar nicht erscheint, d. h. dass der Mensch sich hier in dem Zustande des Vergessens43 befindet. In einem solchen Zustande lässt sich nicht sagen, dass der Mensch der Forderung 156 der Sittlichkeit nicht folgen wollte, sondern er konnte dieser Forderung nicht folgen, weil sie an ihn in diesem Augenblicke nicht gestellt wurde.
Ob aber ein solcher Zustand wirklich vorhanden war, muss nach den über die Beurtheilung und Erhebung der Affekte aufgestellten Grundsätze beurtheilt werden. Die Vermuthung gilt immer für die Regel, das Erinnern. Es muss also die Erhebung von der Voraussetzung ausgehen, dass der Beschuldigte sich wirklich erinnert habe, dass die That unsittlich sei, und hiernach die Frage gestellt werden.
II. Die Leidenschaft kann durch die aufgeregten Vorstellungen auf den Trieb zurückwirken, und dadurch einen heftigen Affekt erzeugen, besonders wenn die Anregung dazu durch einen äusseren Eindruck plötzlich gegeben wird.
III. Die Leidenschaft kann durch die Rückwirkung der Vorstellungsthätigkeit auf den Organismus Krankheiten, und unter diesen wirklichen Wahnsinn erzeugen, in welchem von einer Strafverhängung, mindestens von dem Standpunkte aus, in welchem sich dritte Personen im Verhältnisse zu den Kranken befinden44, keine Rede ist.
Bisher wurde nur immer davon gesprochen, wie die sittliche Strafbarkeit der in verschiedenen Gemüthszuständen vorkommenden Handlungen zu beurtheilen sei, der strafrechtlichen Beurtheilung solcher Fälle aber nur im Vorbeigehen erwähnt.
Der Grund, warum die sittliche Zurechnungsfähigkeit bisher nur vorzugsweise berücksichtigt werden konnte, ist, weil aus der menschlichen Natur als solcher wohl die Sittlichkeit, nicht aber das Recht abgeleitet werden kann, da der Begriff des Rechtes erst dadurch entsteht, dass mehrere Menschen zusammen leben.
157 Nur aus der Vereinigung mehrerer Menschen, und zwar, wenn sich dieselben in eine Verbindung begeben, welche man unter der Benennung Staat versteht, ist aber ein positives Recht, und insbesondere ein Strafrecht denkbar, indem dann der Einzelne das Recht der unbeschränkten Selbstverteidigung zu dem Ende aufgibt, damit der Staat ihm den nöthigen Schutz verleiht, welcher Aufgabe der Staat dadurch entspricht, dass er gewisse Handlungen unter Androhung von Strafe verbietet.
Der Grund, aus welchem daher der Staat eine Handlung verbietet, und auf die Uebertretung des Verbotes eine Strafe setzt, ist daher, auf das Wollen derjenigen Staatsbürger zu wirken, welche allenfalls geneigt sind, eine Handlung zu begehen, welche der Staat als schädlich für einen oder mehrere Staatsbewohner oder für den Staatsverband selbst erkennt.
Da nun sehr viele Handlungen, welche unsittlich sind, auch zugleich schädlich für Andere wirken, so ist es natürlich, dass die Unterlassung von vielen Handlungen bei Androhung von Strafe geboten ist — welche zugleich unsittlich sind; allein der Grund der Strafe ist nicht die Unsittlichkeit, sondern die Schädlichkeit der Handlung.
Aus eben diesem Gesichtspunkte findet sich der Staat auch nach Massgabe der bestehenden Verhältnisse veranlasst, Handlungen bei Strafe zu verbieten, welche an und für sich ganz und gar nicht sittenwidrig sind, aber wegen den obwaltenden Verhältnissen schädlich werden, z. B. Ueberschreitung des Pestkordons u. dgl.
Die Handlungen, welche für den Staat schädlich werden können, sind nun von zweierlei Art, nämlich solche, deren Schädlichkeit Jeder von seinem Standpunkte aus gewahren kann, z. B. Aufruhr, Mord, Raub, Diebstahl etc., oder dieses Verhältniss ist von seinem Standpunkte aus nicht erkennbar, sondern sie wird vorläufig nur von der Staatsverwaltung bemerkt, — von dieser Art wäre z. B. der Umstand, dass in einem Orte die Pest ausgebrochen ist, welchen Umstand die Staatsverwaltung früher erfährt, als die einzelnen Bewohner.
Die erste Gattung der Handlungen kann der Staat nach den Forderungen der Gerechtigkeit auch dann strafen, wenn Demjenigen, welcher eine solche That begeht, das Bestehen eines Gesetzes hierüber nicht bekannt gewesen wäre, denn Jeder kennt die sittliche Verpflichtung, nichts zu thun, wodurch für den Anderen oder für das Allgemeine Nachtheil entsteht. Handelt er daher gegen sein Pflichtgefühl, so ist dann die rechtliche Strafe die physische Folge seiner Unsittlichkeit. Das Vorgeben, 158 dass das Individuum die Handlung zwar für schädlich, aber nicht für unsittlich gehalten habe, würde als widersinnig gar nicht in Betrachtung kommen.
Erklärt aber das Individuum, dass es die Handlung nicht für schädlich gehalten habe, und ergibt sich, dass ihm das dagegen obwaltende Strafgesetz wirklich unbekannt gewesen sei, so wird zwar der Umstand, dass er die That für unsittlich gehalten habe, nicht die Strafbarkeit begründen, wohl aber in den meisten Fällen den Weg bahnen, dass er auch die Kenntniss der Schädlichkeit derselben zugebe, weil die meisten unsittlichen Handlungen eben darum unsittlich erscheinen, weil sie schädlich sind.
Ist jedoch zwar nicht zu erweisen, dass das Individuum die Schädlichkeit oder Unsittlichkeit einer Handlung gekannt habe, es wird aber bewiesen, dass er das, eine Strafe auf die Handlung anordnende Gesetz gekannt habe, so ist er darum strafbar, weil es das ihm bekannte Gesetz übertreten hat.
Bei Gesetzen, deren Grund nur die, auf besondere Verhältnisse sich gründende Schädlichkeit einer gewissen Handlung ist, wird die Strafbarkeit des Individuums natürlich nur davon abhängen, ob er das verbietende Gesetz gekannt habe, oder dasselbe zu kennen schuldig gewesen ist.
Die Fragen, auf welche es bei Bestimmung der Strafbarkeit einer gewissen Willensbestimmung ankommt, können daher sein:
1. Hat das Individuum das Gesetz gekannt, welches diese Handlung verbietet, oder doch die Schädlichkeit der Handlung eingesehen?
2. Hat es seine Thätigkeit als eine solche erkannt, wodurch gegen ein Gesetz gehandelt wird, oder als eine solche welche Schaden hervorzubringen geeignet war?
Diese Punkte müssen richtig gestellt werden, und hiezu kann man die ärztliche Intervention benöthigen, um auszumitteln:
Ob das Individuum nach seiner physischen und psychischen Beschaffenheit geeignet war a) das Gesetz, b) die Bedeutung seiner eigenen Thätigkeit und insbesondere den Nachtheil derselben, c) das Verhältniss seiner Handlung zum Gesetze aufzufassen, und d), ob diese Vorstellungen nach seiner und individuellen Stimmung hinreichende Energie gehabt haben, um neben der Statt gefundenen Anregung wirksam sein zu können (§. 70).
Der Ausspruch, das Individuum sei zur Zeit der That wahnsinnig 159 gewesen, befreit, sofern er gegründet ist, das Individuum nicht nur von der Strafe, sondern, sofern derselbe noch vor der eingeleiteten Untersuchung erfolgt, wie wir bei §. 47 gesehen haben, auch von der Untersuchung.
Ausser diesem Ausspruche gibt es jedoch noch andere, welche im Vereine mit dem Gerichte zu geben sein werden, welche mindestens die Befreiung von der Strafe bewirken können, als:
1. Es sei durch eine im Augenblicke entstandene heftige Einwirkung, entweder durch einen sinnlichen Eindruck von Aussen oder durch eine erregte Vorstellung ein bestimmter Trieb so angeregt worden, dass gar keine andere Vorstellung als jene, welche dem Trieb entsprach, mit einiger Intensivität hervortreten konnte. In diese Klasse gehört der bei §. 70 bemerkte Fall des Würgens.
2. Eine bei sehr gereiztem Zustande plötzlich hinzutretende Anregung, wodurch ein Trieb, nach der Beschaffenheit der Anregung zu schliessen, wenn auch im minderen Grade gereizt wird.
Hier gleicht der Mensch einem Gefässe, welches bis zum Rande gefüllt ist. Ein Tropfen dazu und es geht über, d. h. der angeregte Trieb findet keine Vorstellung mehr, welche ihm das Gegengewicht zu halten vermochte, hier mangeln alle Vorstellungen, welche das Gesetz als Bedingung der Strafe voraussetzt, denn der Mensch hat hier (im Augenblicke) ohne freie Besinnung gehandelt, wenn er auch bei der Handlung selbst nicht ohne alle Wahl der Mittel zu Werke ging.
Eine solche Thätigkeit kann nun allerdings nicht zurechenbar sein, allein sie ist nicht deswegen nicht zurechenbar, weil der Mensch krank ist, sondern aus dem Grunde, weil besondere Verhältnisse wirkten, welche ihn in eine zwar durchaus naturgemässe, jedoch so gestaltete Aufregung versetzten, welche ihn unfähig machten, das durch seine Thätigkeit herbeigeführte widerrechtliche Verhältniss aufzufassen oder zu vermeiden.
Auch in diesem Falle kann das Gutachten des Arztes von erheblichen Folgen für die Rechtspflege sein, indem es aus physiologischen Daten die besondere Disposition des Individuums für eine gewisse Art Aufregung und die darauf herbeigeführte Unmöglichkeit des Vorhandenseins einer hinlänglich intensiven Vorstellung, welche das Individuum von der Begehung der Rechtsverletzung abzuhalten im Stande gewesen wäre, nachweiset. — In diese Klasse würde übrigens der bezüglich des Dichters Alfieri erzählte Fall gehören, wo sich, wahrscheinlich durch 160 Betrachtung des physischen und psychischen Organismus desselben und das durch den obgewalteten, durch die angeführten Verhältnisse herbeigeführten höchsten Grad von Aufregung die Wahrscheinlichkeit hätte darstellen lassen, dass derselbe sich in einem Zustande befand, welcher jenem gleichkam, in welcher sich ein im heftigen Fieber-Paroxismus liegender Kranker befindet, welcher durch eine geringe äussere Veranlassung in einen Zustand von Wuth versetzt wird, welchem keine Vorstellung Schranken zu setzen im Stande ist.
3. Es ist endlich noch der Fall denkbar, dass sich ein Mensch nicht in einem Zustande befindet, wo er allen Vorstellungen in der Art unzugänglich ist, dass sich sagen liesse, dass er keiner Forderung des Rechtsgesetzes sich bewusst sei, dass aber gerade jene Vorstellungen mangelten, welche nöthig gewesen wären, ihn von der Begehung derjenigen Rechtsverletzung, welche er wirklich begangen hat, zurückzuhalten, oder doch zu verhindern, dass er die nachtheilige Folge so weit trieb, als sie wirklich vorliegt.
Wenn z. B. Jemand von sehr heftigem Temperamente, und dabei sehr kräftigem Körperbau, durch wiederholte Kränkungen von sehr empfindlicher Art gereizt wird, so kann es geschehen, dass er noch mit freiem Entschlusse sich bestimmt, dem Beleidiger mit dem Stocke, den er, der Beleidigte, gerade in der Hand hält, einen Schlag zu versetzen, dabei aber in der heftigen Aufregung, in welcher er sich befindet, vergisst, welches Gewicht der Stock hat, und inwiefern er seine Kraft mässigen muss, um nicht mehr als seine Absicht, den Beleidiger zu beschimpfen und ihm einigen körperlichen Schmerz zu verursachen, zu erreichen. Wird nun der Beleidiger durch einen solchen Schlag getödtet, oder schwer beschädigt, so kommt eigentlich nur der Umstand, dass er schlug, auf Rechnung des Vorsatzes des Beleidigten, der Umstand, dass er mit einem gefährlichen Werkzeuge und so stark schlug, dass diese nachtheilige Folge daraus entstand, kommt auf Rechnung der ohne sein Verschulden verursachten Aufregung, es kann ihm daher nur zugerechnet werden, dass er, ungeachtet er fühlte in einem Zustande zu sein, welcher eine sorgfältigere Bemessung seiner Kraft nicht gestattete, es nicht unterliess, davon einen unter diesen Umständen gefährlichen Gebrauch zu machen.
Obwohl nun diese Rücksicht in den wenigsten Fällen das Wesen des verübten Verbrechens ändern wird, so wird sie doch als ein, seine Strafbarkeit mildernder Umstand erscheinen, muss daher durch 161 die Untersuchung herausgestellt, und in ihrem vollen Umfange der Beurtheilung zugänglich gemacht werden.
Der medizinische Theil der Erhebung erhält daher die Aufgabe, sich über das wirklich vorhandene Uebermass an Körperkraft bei dem Verbrechen, und über dessen Disposition zu heftigen, auf seine körperliche Thätigkeit Einfluss nehmenden Gemüthsbewegungen, mit sorgfältiger Prüfung der allenfalls vorhandenen, richterlicher Seits erhobenen Thatsachen über bereits Statt gefundene ähnliche Ausbrüche auszusprechen, und, wenn es der Richter unterlassen haben sollte, ähnliche Daten aufzusuchen, den Richter auf die Nothwendigkeit solcher Erhebungen in seinem Befunde ausdrücklich aufmerksam zu machen, und sie dadurch herbeizuführen.
4. Wie bereits erörtert wurde, ist Leidenschaft wohl ein prä-disponirendes Moment zu heftigen Gemüthsbewegungen, und diese letzteren können Verbrechen veranlassen, niemals darf aber gesagt werden, dass die Leidenschaft der Grund der Rechtsverletzung sei, da dieser Grund ohne den Eintritt einer solchen, das Bewusstsein aufhebenden, momentanen Gemüthsbewegung nur in dem Umstande liegt, dass der Verbrecher sich dem Hange nach Erreichung des Gegenstandes seiner Leidenschaft mit freiem Entschlusse hingab. Es muss also der Arzt, welcher ein Gutachten über den Gemüthszustand eines solchen Individuums abzugeben hat, immer die Leidenschaft vom Affekt zu unterscheiden wissen, und sein Gutachten so abgeben, dass diese Unterscheidung für den Leser auch klar hervortrete.
5. Von der Leidenschaft ist der Hang zu gewissen Verbrechen wesentlich verschieden, denn Leidenschaft setzt immer die Richtung nach einem individuell bestimmten äusseren Gegenstande, oder nach einer ebenso individuell bestimmten Richtung der physischen oder psychischen Thätigkeit voraus. Das Verbrechen aber, es möge wie immer Namen haben, ist immer ein allgemeiner Begriff von einer ganzen Gattung unter einander in materieller Beziehung wesentlich verschiedener Handlungen. Derjenige, welcher z. B. einen besondern Hang zeigt zu morden, wird nicht auf alle mögliche Weise morden, wozu sich ihm Gelegenheit darbietet, sondern gewisse Methoden darin üben; Derjenige, welcher einen Hang hat zu stehlen, stiehlt nicht alles Mögliche, was er stehlen kann, sondern nur gewisse Gegenstände, oder unter gewissen Verhältnissen. Es ist also nicht sowohl das Vergnügen an der Verübung des Verbrechens, was ihn zu seiner Thätigkeit antreibt, sondern es 162 sind gewisse materielle Beziehungen, welche ihn zu der bestimmten That veranlassen.
Da jedoch dieser Gegenstand eine besondere Besprechung erfordert, so ist derselbe im Verlaufe dieses Aufsatzes unter einer besondern Aufschrift behandelt.
6. Es kann nie genug empfohlen werden, bei einem Gutachten über Gemüthszustände alle Ausdrücke zu vermeiden, deren psychologische Richtigkeit einem gegründeten Bedenken unterliegt, sondern wenn ein Zustand sich so gestaltet, dass derselbe unter keinem anerkannt richtigen, und allgemein unter derselben Bedeutung anerkannten und angenommenen Ausdrucke subsumirt werden kann, ist es unerlässlich, diesem Mangel dadurch abzuhelfen, dass eine in das möglichste Detail gehende, alle bekannt gewordenen, oder sich als wahrscheinlich darbietenden Nebenumstände umfassende Schilderung des Zustandes, mit Einem Worte, dass ein Bild der Sache, und nicht Worte gegeben werden. Nur auf diese Weise lassen sich die ganz unlogischen, und daher unwahren Ausdrücke, halbe Freiheit, halber Wille u. dgl., welche nur geeignet sind, eine für die Rechtspflege höchst schädliche Begriffsverwirrung zu veranlassen, vermeiden, da alle diese Funktionen eben so wenig, wie dies am gehörigen Orte nachgewiesen wurde, einer Theilung fähig sind, als der Begriff der Sittlichkeit; der Mensch kann das sittliche Princip noch wenig entwickelt haben, er kann aber nicht halb sittlich handeln, denn dort wo auf eine Handlung der Begriff von Sittlichkeit angewendet werden kann, lässt sich nur sagen, er sei sittlich oder unsittlich. Der Wille kann durch psychische Zustände so beschränkt sein, dass er nur in einer gewissen Beziehung und in einem gewissen Grade auf die Thätigkeit eines Menschen Einfluss zu nehmen vermag; dies ist möglich, wo man aber dieses Verhältniss gewahrt, steht auch nichts entgegen, die Gründe durch Anführung von thatsächlichen Umständen auseinander zu setzen, warum in dem speziellen Falle der Wille gerade so weit, und nicht weiter, oder nicht in einem höheren Grade seinen Einfluss zu äussern vermochte, und man wird, wenn Derjenige, welchem eine solche Schilderung zu geben obliegt, anders die nöthigen psychologischen und anderen Kenntnisse besitzt, welche zur allseitigen Auffassung eines solchen Gegenstandes gehören, und die nöthigen Daten hiezu aufzufinden und zu würdigen versteht, immer zu dem Resultate kommen, dass es des Ausspruches, der Mensch habe nur mit halbem Willen gehandelt, eben so wenig bedarf, als sich bestimmt finden, 163 einen Ausspruch über einen Divisor des Willens zu geben oder zu verlangen.
7. Bei der Darstellung muss immer so zu Werke gegangen werden, dass ohne Einbeziehung der That, um welche es sich handelt, diese als eine nothwendige Folge der bei dem Subjekte beobachteten Abnormitäten, in Verbindung mit den auf die Hervorbringung der That influirenden Verhältnisse nachgewiesen werde, nicht aber dass, wie es auch schon geschehen ist, die That selbst als einer der Gründe erklärt wird, aus welchen der Wahnsinn folgen soll. — Obwohl es nicht geläugnet werden kann, dass ein solches Verfahren den Gesetzen einer richtigen Beweisführung widerstreitet, deren Regeln ein jeder ärztlicher Befund entsprechen muss, so ist es doch nicht unerhört, dass etwas dergleichen geschehen sei. Da aber in dem Falle, wo das Thema, welches zu beweisen ist, nämlich: die That NN. ist eine „Folge des Wahnsinns” — wieder in den Beweissätzen oder gar im Schlusse vorkommt, z. B. es würde gesagt, weil der A die Thaten BCD und die That NN. beging, so folgt dass er wahnsinnig sei — das ganze Raisonnement und daher auch der darauf gestützte Schluss den Gesetzen der Logik widerstreitet, so folgt, dass dieser Fehler nothwendig vermieden werden muss, weil sonst das Gutachten, als auf einem erweislichen Fehlschlusse beruhend, seine Giltigkeit verliert. — Dieser Fehler rührt, wo er Statt findet, von gar nichts Anderem her, als weil man das eigentliche Thema, zu dessen Erörterung die ganze Erhebung Statt hatte, entweder sich nicht klar zu machen verstand, oder wieder aus den Augen verlor, und Beides ist nach der bisherigen Darstellung eben nicht schwer zu vermeiden.
Es ist in der That nicht leicht zu sagen, was unter diesem Zustande zu verstehen sei. So viel ist indessen gewiss, dass man von keiner Schwärmerei für das Spielen, für das Trinken spricht, und dass man jedenfalls darunter ein lebhaftes Anstreben eines Gegenstandes versteht, welcher anderen Menschen keineswegs einer so aufgeregten Thätigkeit werth scheint. Schwärmerei dürfte daher etwa so viel, als eine Leidenschaft für einen sittlichen, oder wenigstens dem Schwärmer selbst sittlich scheinenden Gegenstand bedeuten.
164 Da nun Leidenschaft dem Menschen natürlich ist, so ist es auch die Schwärmerei, welche übrigens gerade darum, weil ihr Gegenstand zunächst ein nicht sinnlicher ist, eine besondere Thätigkeit der Einbildungskraft, und daher auch eine solche allgemeine Disposition des Individuums, durch welche eine besonders lebhafte Thätigkeit der Einbildungskraft bedingt ist, voraussetzen wird, woher es zuverlässig kommt, dass man sich Schwärmerei nicht ohne den Begriff von dem Nachjagen nach einem Phantasiegebilde denken kann, und dass überhaupt dieser Zustand nur bei phantasiereichen Leuten vorkommt.
Dieser Zustand ist nun an und für sich kein krankhafter Gemüthszustand, er kann aber sowohl aus einer krankhaften Verstimmung entstehen, als eine krankhafte Verstimmung zur Folge haben, wie dieses in der Abhandlung B. nachgewiesen wurde, es lässt sich daher nicht läugnen, dass durch Schwärmerei, d. h. durch die, in Folge dieses Zustandes verursachte Krankheit verbrecherische Handlungen veranlasst werden können.
Darüber kann nun wohl kein vernünftiger Zweifel obwalten, so wie an dem Umstande, dass es sich dann um die Frage handeln wird, ist der Mensch, indem er diese Handlung verübte, wahnsinnig gewesen, oder befand er sich in einem, wenn auch durch Schwärmerei erzeugten, Zustande heftigen Affektes, in welchem er in einer Stimmung war, worin sittliche Vorstellungen oder doch jene von der rechtswidrigen Schädlichkeit der That nicht mehr dem Ausbruche seines Affektes Einhalt zu thun vermochten.
Dies ist nun allerdings die sich als nothwendig ergebende Ansicht der Sache, durch welche, wenn sie gehörig durchgeführt wird, sich zuverlässig ein für die richterliche Entscheidung vollkommen genügendes Resultat wird erzielen lassen.
Gewöhnlich betrachtet man den Gegenstand jedoch noch von einer anderen Seite, man stellt sich nämlich die Frage auf: ist es möglich, dass ein Mensch, ohne wahnsinnig zu sein, eine ihm offenbar als unsittlich bekannte That, z. B. einen Mord, zur Erreichung eines sittlichen Zweckes begehen, und diese in den Augen eines jeden anderen Menschen als unsittlich erscheinende That für sittlich halten könne, und darum straflos bleiben müsse (oder mit anderen Worten unzurechenbar sei)?
Dies ist nun viel auf einmal gefragt, viel mehr als man vernünftiger Weise fragen sollte, und noch dazu auf eine recht suggestive Weise 165 gefragt, wodurch demjenigen, welcher die Mühe scheut, die Frage in allen ihren Punkten gehörig zu beleuchten, für den letzten Punkt eine Antwort in den Mund gelegt wird, weil sich in der That nicht verkennen lässt, dass aus den übrigen Theilen der Frage sich wirklich keine Anhaltspunkte ergeben, um diesen letzten Punkt beantworten zu können.
Wir wollen daher die Frage in ihre einzelnen Theile zerlegen und sehen, in welchen Verhältnissen sie zur Rechtspflege sich befinden.
Die Frage schliesst nämlich in ihrem ersten Theile: ist es möglich, dass ein Mensch zu einem sittlichen Zwecke eine unsittliche Handlung begehen könne? die Unterscheidung in sich: a) ist es möglich, dass ein Mensch zu einem sittlichen Zwecke eine Handlung begehen könne, die er selbst für unsittlich erkennt, oder b) ist es möglich, dass er in der Aufregung, in welcher er den sittlichen Zweck anstrebt, den Umstand, dass das Mittel, dessen er sich bedient, ein unsittliches sei, übersehen könne?
Das Letztere kann man im Allgemeinen bejahen, ohne dass die Bejahung gerade irgend einen wesentlichen Nachtheil bringen könnte, denn der Mensch, welcher sittlich zu handeln entschlossen ist, wird sich schwerlich bedeutende Uebersehen dieser Art zu Schulden kommen lassen, er wird allenfalls fremdes Geld verschenken, weil er vergisst, dass es nicht ihm gehört, nicht aber, um einen Menschen aus dem Wasser zu ziehen, einen anderen, der nicht schwimmen kann, hineinwerfen.
Der erste Punkt muss aber geradezu verneint werden, denn jeder Mensch fühlt, dass er selbst nicht das Mittel ist, um einzelne sittliche Zwecke zu erreichen, sondern dass er für seine Person sittlich zu sein habe. Handelt er daher für seine Person unsittlich, so handelt er gegen die Bestimmung, zu welcher er selbst auf der Welt ist.
So viel zur Beantwortung der Frage vom moralischen Gesichtspunkte aus, von welchem daher nothwendig die Frage dahin beantwortet werden muss, dass Derjenige, welcher zu einem sittlichen Zwecke unsittlich handelt, schon dadurch sich gegen die Sittlichkeit verfehlt, weil er aus seinen Schranken als Mensch hinaustritt, und sich, ohne die göttliche Weisheit zu besitzen, die göttliche Gerechtigkeit zu exequiren anmasst.
Eine Frage, welche nun so gestellt ist, dass man darauf ja und nein antworten, und in beiden Fällen Recht haben kann, ist entschieden mangelhaft gestellt.
Noch weniger ist aber die Tendenz dieser Frage zu billigen, nämlich, der Schlusssatz: wenn es nicht möglich ist, dass Jemand mit dem Bestreben 166 einen sittlichen Zweck zu erreichen, unsittlich gehandelt hat, — so muss Derjenige, welcher eine solche That begangen hat, wahnsinnig und daher unzurechenbar sein; diese Wendung ist sogar den logischen Gesetzen entgegen, denn es heisst nach einer logischen Formel ausgedrückt dieser Schluss folgendermassen:
Ein wirklich sittlicher Mensch handelt nicht unsittlich zu einem sittlichen Zwecke.
Ein Wahnsinniger kann zu einem ihm als sittlich erscheinenden Zwecke unsittlich handeln, — folglich ist Derjenige, welcher zu einem sittlichen Zwecke unsittlich handelt, wahnsinnig.
Welcher vernünftige Mensch wird so schliessen, es folgt daher in der That nichts weiter aus dieser Formel, als dass unter die möglichen Fälle, in welchen sich jemand einer unsittlichen Handlung zur Erreichung eines sittlichen Zweckes bedient, auch dieser gehören kann, dass der Mensch wahnsinnig und daher an und für sich unzurechenbar ist, nicht aber, dass es in allen Fällen so sei.
Wo daher ein solcher Fall vorkommt, wird es allerdings auch zur Aufgabe der Erhebung gehören, auszumitteln, ob der Mensch nicht wahnsinnig und daher überhaupt, oder doch in Betreff seiner That unzurechenbar sei, allein wenn aus den hierüber angestellten Erhebungen sich das Vorhandensein eines wirklichen Wahnsinns nicht herausstellt, so folgt auch gar nichts, um die Zurechenbarkeit in Zweifel zu ziehen.
Dieses Resultat ergibt sich, wenn man die Sache vom sittlichen Gesichtspunkte betrachtet. Noch weniger ergeben sich aber Gründe für die nicht Zurechenbarkeit einer solchen That vom psychologischen und vom rechtlichen Gesichtspunkte aus betrachtet.
In erster Beziehung lässt sich nämlich nicht verkennen, dass keine Vorstellung des Menschen eine rein sittliche ist, sondern jede Vorstellung ist nur zum Theil ein sittliches Bild. Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass Jemand, welcher einen Anderen mit Gefahr seines Lebens aus dem Wasser zieht, sehr sittlich handle, allein die Motive, welche ihn zu dieser Rettung bestimmten, liegen doch wohl auch in anderen Vorstellungen, als z. B. in dem erregten sympathetischen Gefühle, in der Vorstellung der Freude, welche der Gerettete und seine Angehörigen haben werden, auch hat vielleicht der Gedanke an den Ruhm, der durch eine solche That zu erwerben ist, einigen Antheil. — Es liegt auch gar nicht in der menschlichen 167 Natur, grosse Entschlüsse zu fassen, wenn nicht lebhafte Vorstellungen auf ihn wirken, und dazu gehören allerdings auch sinnliche Bilder (§. 20).
Dieses Verhältniss benimmt nun der That allerdings nicht ihren sittlichen Werth, da es sehr möglich ist, dass ohne das rege Pflichtgefühl die That ungeachtet der übrigen Aufforderungen unterblieben wäre; kein Mensch, nicht einmal das handelnde Subjekt selbst, sondern nur Gott allein sieht aber, wie viel wirklich Sittliches an der Handlung war.
Strebt nun ein Mensch nach einem Zwecke, von dem sich wirklich annehmen lässt, dass er ihn für sittlich gehalten habe, so lässt sich wohl eben so wenig bestimmen, ob es das Sittliche, was er daran gewahrte, gewesen ist, was sein Bestreben bestimmte, oder das mit Erreichung des Zweckes sinnlich Angenehme. Es kann daher sehr wohl geschehen, dass gerade diese letztere Vorstellung, ohne dass er es selbst ganz klar erfahren hätte, ihn bestimmt habe, den ordentlichen Weg des fortwährenden Anwendens sittlicher Mittel zu verlassen, oder das Sittliche an dem Zwecke selbst aufzugeben, nachdem er die Ueberzeugung gewann, dass er ihn auf dem Pfade der Sittlichkeit nicht erreichen kann, und sich zur Anwendung eines unsittlichen Mittels, den Weg abzukürzen, oder sich einen neuen Weg zu bahnen, und in diesem Falle ist seine That nichts weiter, als ein unsittliches Mittel zur Erreichung eines egoistischen, wenn auch gerade nicht objektiv unsittlichen Zweckes. — Er bleibt daher für das angeordnete Mittel eben so sehr in moralischer Beziehung verantwortlich, als für die nachtheilige Folge rechtlich strafbar.
So schwierig nun für jeden Dritten die Unterscheidung sein wird, ob nicht ein solches Individuum über den Umstand, dass es nicht sittlich erlaubt sei, zum Besten eines sittlichen Zweckes ein bestimmtes Mittel anzuwenden, sich etwa in einem Irrthume befand, so wenig schwierig scheint die Frage in rechtlicher Beziehung zu beantworten, ob ein Mensch strafbar ist, wenn er zur Erreichung eines sittlichen Zweckes sich eines Schaden bringenden Mittels bediente.
In sittlicher Beziehung wird der Mensch zur Begehung oder Unterlassung einer Handlung durch sein Gefühl oder seine Grundsätze bestimmt, welche von einem Dritten am Ende doch nie vollständig controllirt werden können. Der Staat fordert von seinen Unterthanen jedoch nicht Gefühle oder Grundsätze, sondern Handlungen und Unterlassungen. Begeht nun Jemand, wie es sehr vielfältig geschieht, 168 keine gesetzwidrigen Handlungen aus dem Grunde, weil er, und zwar mit Recht, die bürgerlich strafbaren Handlungen zugleich für unsittlich hält, so ist er ein um so besserer Bürger, und eines besonderen Vertrauens würdig. Begeht er aber verbotene Handlungen, oder macht er sich strafbarer Unterlassungen schuldig, weil er sie nicht für unsittlich hält, so legt er dadurch an den Tag, dass seine Sittlichkeit keine hinlängliche Bürgschaft für die Unschädlichkeit seines Benehmens gewähre, und setzt daher den Staat in die Nothwendigkeit, diejenigen Massregeln anzuwenden, wodurch er und Seinesgleichen genügende Motive zu einem legalen Benehmen erhalten, nämlich die Zufügung der für die Begehung oder Unterlassung gewisser Handlungen angedrohten Strafen.
Wir kehren nun wieder zu dem als Schwärmerei bezeichneten Gemüthszustände zurück, und wollen nun die besonderen Modificationen betrachten, welche die gerichtlich medizinische Untersuchung eines Individuums, welches in diesem Zustande ein Verbrechen begangen hat, berücksichtigen müsse.
Es lässt sich nämlich nicht verkennen, dass der als Schwärmerei bekannte Zustand eben darum, weil derselbe besonders die Thätigkeit der Einbildungskraft in Anspruch nimmt, von gewissen Erscheinungen begleitet sein werde, welche bei anderen Leidenschaften, welche gewöhnlich materielle Bedürfnisse und Wünsche zum Gegenstande haben, oder doch durch materielle Bedürfnisse und Wünsche veranlasst werden, entweder gar nicht, oder doch in viel geringerem Grade vorkommen.
Wir wenden uns daher unmittelbar an eine Erscheinung, in welcher die vorherrschende Thätigkeit der Einbildungskraft unverkennbar ist, nämlich den Traum.
Wem ist es nicht schon begegnet, dass er, nach der Anhörung einer Erzählung von einem Verbrechen, nicht nur von der That geträumt, sondern im Traume selbst das handelnde Individuum war, ihm dabei wohl einfiel, dass Dasjenige, was er da beginne, nicht in der Ordnung sei, dieser Gedanke ihn aber doch nicht hinderte, die That mit allen den Nebenumständen, wie er sie gehört oder gelesen hatte, zu Ende zu führen.
Diese Erscheinung erklärt sich nun allerdings dadurch, dass die im Schlafe wirkende Vorstellungsthätigkeit nur die That mit ihren Nebenumständen, nicht aber auch diejenigen sittlichen Vorstellungen reproduzirte, 169 welche im Wachen die Ausführung einer solchen That bei ihm zuverlässig unmöglich gemacht haben würden.
Es frägt sich aber, ob der Mensch nicht auch wachend träumen und in einem solchen wachenden Schlummer nicht auch Thaten verüben könne, welche er bei vollkommen reger Besinnung zuverlässig unterlassen hätte.
Folgende zwei Fälle, welche sich bei der, nunmehr kaum dem Namen nach mehr bekannten Sekte der Pöschlianer45 zutrugen, scheinen für die Bejahung dieser Frage zu sprechen.
170 Der Held des ersten dieser Fälle (er wurde mir von dem damaligen Herrn Bezirksarzte, jetzt quieszirten k. k. Kreisarzte, Dr. Maffei, der dabei selbst intervenirte, mitgetheilt) war ein Bauer, welcher sich einbildete der Erzvater Abraham zu sein, und wie Dieser den Beruf zu haben, seinen kleinen Sohn zu schlachten. In Ermanglung eines Berges ging er auf das flache Dach seines Hauses, errichtete dort einen Scheiterhaufen, führte seinen Sohn hinauf und hatte schon das Schlachtmesser in Bereitschaft. — Sein Beginnen war jedoch glücklicher Weise von einem Nachbar bemerkt worden, der davon sogleich dem Gerichte die Anzeige machte, welches zum Glücke nicht weit entfernt war. — Man verfügte sich eiligst an Ort und Stelle, fand das Haus verschlossen, ihn selbst aber eben im Begriffe das Opfer an seinem Sohne zu vollziehen. — Das Eindringen in sein Haus würde die That beschleuniget haben, man verfiel daher auf das Mittel, dass einer der Anwesenden auf das Dach des gegenüberstehenden Hauses stieg, mit einer Flinte auf ihn anschlug und ihn zu erschiessen drohte. Dies störte ihn etwas in seinem Wahnsinne, er starrte den Mann mit der Flinte an, der seine Drohungen wiederholte. — Indess waren Leute mit einer Leiter auf das Dach gestiegen und überfielen ihn von rückwärts, und so war das Opfer gerettet. Er selbst wurde der ärztlichen Behandlung übergeben und wieder zu Vernunft gebracht.
Der andere Fall besteht in folgendem Ereignisse:
Einige solche Schwärmer hatten sich in einem Hause zur Nachtszeit versammelt und übten ihre inspirirten Predigten.
Mit Einemmale fiel ihnen bei, dass ein alter Mann, der in ihrer Nähe sein Haus hatte, nichts von ihrem neuen Glauben wissen wolle, und sie waren bald einverstanden, dass dieser jetzt bekehrt werden müsse. Sie begaben sich nun, unter ihnen ein achtzehnjähriges Mädchen, zu dem Hause desselben, und verlangten, er solle herauskommen. Erst als sie ihm drohten das Haus anzuzünden, öffnete er die Thüre und fragte sie, was sie wollen. Er solle mit ihnen kommen, ihren neuen Glauben annehmen u. s. w. Der Unglückliche antwortete ihnen nun, dass er von ihnen nichts wissen wolle — da trat jenes junge Mädchen hervor und schlug ihn mit dem Ausrufe: „Der Geist befiehlt, der Ungläubige muss sterben!” mit einer Hacke zum Kopfe, dass er tödtlich getroffen zu Boden stürzte.
Derlei Erscheinungen sind wohl entschieden wahnsinnige Thaten, 171 allein lässt sich wohl annehmen, dass Hunderte von Menschen zugleich wahnsinnig wurden46?
Solche Szenen ereigneten sich in mehr als Einer Versammlung, sie loosten wer von ihnen als Opfer sterben müsse, und wen das Loos traf, liess sich ruhig langsam tödten. Einer der mit der Erhebung dieser That beauftragten Inquirenten, der gegenwärtig pensionirte Herr k. k. Pfleger von Neumarkt, Joseph Gruber, hatte sich in den Verhaftort begeben, um eine Mutter, welche einer Versammlung beigewohnt hatte, in welcher ein solches Opfer gebracht worden, und nun mit den Uebrigen in einem grossen Saale in Verhaft gebracht war, zum Verhöre abzuholen. — Alle lagen auf den Knien und es herrschte Todtenstille. Als er nun mit dieser Verhafteten, welche ihr Kind auf den Armen hatte, das Arrestlokale verlassen wollte, sprang, als der Gerichtsdiener die Thüre öffnete, ihr Mann hervor, riss dem wachestehenden Soldaten das Bajonnet vom Gewehre und brachte seiner Frau einen Stich bei, der dem Kinde gegolten hatte, damit, wie er sich ausdrückte, die Seele des Kindes nicht in die Hände der Ungläubigen falle.
Kann man nun wohl annehmen, dass Hunderte von Menschen zugleich von demselben Wahne befallen werden, wenn dieser ein Produkt einer Krankheit sein soll? — Die Leute waren früher vernünftig und wurden es wieder, als man sie in eine vernünftigere Umgebung brachte, auch trugen ihre Thaten zu entschieden das Gepräge ihrer schwärmerischen Ansichten, als dass man nicht eben diese ihre Schwärmerei als die einzige Ursache ihrer Thaten betrachten sollte, sondern es lässt sich, besonders wenn man die Thaten betrachtet, die sie verübten, als sie in corpore versammelt waren, nichts Anderes behaupten, als dass sie alle in einen Zustand versetzt waren, in welchem sie willenlos, sobald nur der Eine aus ihnen einen Impuls gab, welcher dem Ideengange ihrer Schwärmerei entsprach, diesem zu folgen und ihn auszuführen sich gedrungen fühlten, wobei nur Jeder nach seinem eigenen Ideengange etwas Weniges dazu oder davon that. Sie waren recht eigentlich im Zustande des wachenden Traumes, in welchem sie ihre Thaten gerade so begingen, wie sie ihnen ihre Phantasie vorgaukelte.
Wie bereits oben erwähnt wurde, habe ich selbst solche Individuen gekannt, welche dieser Schwärmerei anhingen. Sie waren zwar von ihrer früheren Schwärmerei geheilt, allein sie waren düster und träumerisch 172 gestimmt, gerade wie es nach einem schweren Traume zu geschehen pflegt.
Was jedoch die krankhafte Aeusserung, welche durch den exaltirten Zustand der Schwärmerei bei jenen Individuen entstanden war, vollkommen charakterisirt, ist der Umstand, dass sie ihre Thaten eben so ausführten, wie sie von ihnen ursprünglich konzipirt wurden, ohne dabei irgend einen materiellen Zweck erreichen zu wollen; Derjenige, welcher seinen Sohn schlachten wollte, schoss ihn nicht etwa mit einer Pistole todt, sondern er benahm sich ganz so, wie sein Vorbild es ihm darstellte. — Hierauf muss man daher sehen, wenn es sich darum handelt auszumitteln, ob eine bestimmte That eine Folge der durch die Schwärmerei hervorgebrachten Lähmung der Willenskraft war. — Ist eine solche That nicht irgend einem Vorbilde ähnlich oder in allen ihren Theilen nicht eine Folge des eingetretenen Impulses, sondern hat der Thäter zwischen den Mitteln in der Verübung seines Verbrechens gewählt, oder wird dadurch ein materieller Nutzen erreicht, so ist sie nach aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr eine unwillkürliche Folge seiner schwärmerischen Aufregung, sondern ist mit Willen vollbracht und daher strafbar. — Dieser Unterschied muss bei der Erhebung daher berücksichtiget und verfolgt werden, um eine vorgegebene unwillkürliche Handlungsweise von einer willkürlichen zu unterscheiden.
Im Uebrigen dürfte die Schwärmerei, d. h. Dasjenige Individuum, welches aus solcher ein Verbrechen verübte, nach denjenigen Grundsätzen zu beurtheilen sein, welche in den bisherigen Abhandlungen über Gemüthszustände erörtert wurden.
Wie schon die Benennung ausdrückt, ist dieser Zustand eine Abnormität der Sinnesthätigkeit, und da die Natur des Menschen so beschaffen ist, dass die geistige und physische Thätigkeit des Menschen sich in innigster Beziehung befinden, so ist gegen die Möglichkeit des hierin bezeichneten Zustandes nicht das Mindeste zu erinnern, ja es lässt sich hierdurch vollkommen begreiflich machen, dass gewisse Störungen des äusseren Sinnes gewissen Störungen des inneren Sinnes entsprechen, andere Funktionen aber dabei ungestört bleiben.
173 Die Erklärung, wie dies geschieht, ist nun wohl für die gerichtliche Erhebung ganz überflüssig, diese wird sich vielmehr in einem solchen Falle auf nachfolgende Punkte zu erstrecken haben:
1. Ist der Zustand des Beschuldigten von der Art, dass ihm überhaupt jede Kenntniss von der Bedeutung seiner Thätigkeit abgesprochen werden muss?
2. Ist im Falle der Verneinung dieser Frage seine That nicht von der Art, dass sie gerade dem Mangel an jenen Vorstellungen ihr Dasein verdankt, durch welche sich der Blödsinn bei diesem Menschen charakterisirt, z. B. ein Blödsinniger, welcher sich durch besondere Gleichgiltigkeit gegen die Leiden seiner Nebenmenschen auszeichnet, lässt ein von ihm zufällig in's Wasser gestossenes Kind umkommen.
3. Ist sein Blödsinn von der Art, dass eine seine Thätigkeit reizende Vorstellung nur darum zur That wurde, weil ihm alle jene Vorstellungen mangelten, durch welche die Ausführung der That gehindert, oder doch seine Thätigkeit so modifizirt worden wäre, dass sie nicht diese verbrecherische Wirkung gehabt hätte. Als nähere Beleuchtung dieses Satzes erlaube ich mir auf den dritten dieser Abhandlung folgenden Kriminalfall, den Vatermord des M. Krotz, hinzudeuten.
4. Ist der Blödsinn nicht etwa mit einer fixen Idee oder Monomanie verbunden, oder ergibt sich etwa aus den Erhebungen, dass der Blödsinnige von einer herrschenden Vorstellung befangen ist, welche das Verbrechen bedingte, und eben darum, weil sie die einzige ist, welche er mit einiger Energie zu entwickeln vermag, aus Mangel jeder anderen intensiven Vorstellung, welche dieser das Gleichgewicht zu halten vermochte, ihn mit Nothwendigkeit zur Verübung des Verbrechens bestimmte. In diese Klasse gehört offenbar der Fall, wo eine dritte Person auf ein solches Individuum eine grosse psychische Macht ausübt und es zur Verübung der That aufforderte.
Als Mittel, diese Fragen zu beantworten, ist nun wohl die ärztliche Untersuchung der physischen Beschaffenheit unumgänglich nothwendig, allein diese wird, den Fall des entschiedenen Kretinismus ausgenommen, nicht genügen. — Ebensowenig wird eine blosse mit ihm angestellte Unterredung genügen, um hierüber ins Klare zu kommen, sondern es wird nothwendig sein, alles Dasjenige zu beobachten, was im §. 43 und den folgenden hierüber angedeutet wurde, denn nur die Aufstellung des vollständigen Bildes eines solchen Zustandes vermag über das 174 richtige Verhältniss desselben zu seiner That die nöthigen Anhaltspunkte zu geben.
Nicht genug kann man aber vor einem Fehler warnen, welcher bei solchen Erhebungen nicht selten begangen wird, und welcher darin besteht, dass man eine Art Katechisirung mit einem solchen Menschen anstellt, und wenn er darin erträglich besteht, insbesondere Fragen, welche sich auf sein Verbrechen beziehen, so beantwortet, dass aus den Antworten hervorgeht, er habe die Benennung, welche die That führt, unter die Rubrik der unerlaubten Handlungen in seiner Gedächtnisstafel eingetragen, und wenn er dabei noch auf Fragen, die sich auf das gewöhnliche Treiben beziehen, ziemlich passende Antworten gibt, sogleich den Schluss zu ziehen — also ist der Mensch im Stande gewesen, das Gesetzwidrige seiner That einzusehen.
Denkt man sich noch dazu, dass der Richter in seinem Verhöre Dasjenige, was der Inquisit unzusammenhängend und widersinnig vorbringt, in zusammenhängender Erzählung zu Protokoll diktirt, so kann man wohl nicht ohne ängstliche Empfindung auf die Folgen denken, welche, besonders bei wichtigen Verbrechen, eine solche Prozedur haben kann. Jedes Spruchgericht dürfte, besonders wenn etwa aus Zeugenaussagen oder durch den beliebten Beisatz im Gutachten: „der Mensch sei zwar auf einer sehr niederen Stufe der Bildung, aber sonst von richtigem Urtheile,” sich im Vergleiche mit dem Inhalte des Verhörsprotokolles ein solches Bedenken ergibt, sich bestimmt finden, eine genaue Erhebung über den Gemüthszustand zu verlangen, und sich die protokollarische Verhandlung hierüber vorlegen zu lassen, damit es in die ihm sonst unmögliche Lage komme, entweder selbst beurtheilen zu können, ob wirklich mit Sachkenntniss vorgegangen worden sei, oder hierüber ein Fakultätsgutachten einholen könne, ehe es, besonders bei solchen Verbrechen, worauf Todesstrafe oder eine langjährige Kerkerstrafe verhängt werden muss, eine Verurtheilung ausspricht.
Der Grund aber, aus welchem ein solches Verfahren, wie es oben erwähnt wurde, nicht genügend scheint, um ein verlässliches Urtheil über die Zurechnungsfähigkeit des Subjektes darauf zu gründen, ist der bereits bei §. 20 entwickelte. Es lässt sich nämlich die Möglichkeit nicht verkennen, dass bei dem Unterrichte, welchen ein solches Subjekt in der Schule erhält, sich gewisse Lehren, d. h. die Worte, in welchen diese Lehren gegeben sind, seinem Gedächtnisse einprägen, und dass, wenn die ihm wohl wohlbekannte Frage gestellt wird, diese Worte, 175 welche die Antwort hierauf bilden, reproduzirt und von ihm ausgesprochen werden. — Geschieht dieses, so beweiset es nichts weiter, als dass ihm nicht alles Gedächtniss mangle, nicht aber, dass er die behaltenen Worte verstehe, d. h. ihren Sinn fühle, und noch weniger, dass sie auch dort irgend eine Wirkung auf seine Handlungsweise zu äussern vermögen, wenn irgend ein wirklich vorhandenes Gefühl ihn zu einer, wenn auch widersinnigen, Thätigkeit veranlasst. Es kann sein, dass ein Blödsinniger, welcher einen Anderen getödtet hat, die zehn Gebote weiss, es ist auch möglich, dass er nach der Frage: „Welches Gebot glaubst Du übertreten zu haben?” bei dem fünften Gebote richtig einfällt; es kann sich aber auch treffen, dass er über seine Antwort Freude äussert, wenn er aus den Mienen der Fragenden die Bestätigung entnimmt, dass er seine Lektion richtig gekannt habe.
Es ergibt sich daher bei einer solchen Erhebung die Nothwendigkeit eines zwischen Arzt und Richter durchaus gemeinschaftlichen Verfahrens. Nur die Beurtheilung der physischen Beschaffenheit bleibe dem Arzte allein überlassen, bei allen sonstigen Erhebungen muss, und zwar in der Art, wie es zu geschehen hat, wenn der Thatbestand über einen für die Untersuchung wichtigen Umstand erhoben werden soll, mit steter Intervenirung der Gerichtspersonen, und mit sogleicher Aufzeichnung der angewendeten Prozedur und der gewonnenen Resultate verfahren werden, zwar nicht gerade im Wege eines artikulirten Verhöres, aber doch so, dass das Gericht unmittelbar von den Ergebnissen Kenntniss erhalte. Wo sich daher eine Unterredung des Gefangenen mit dem Arzte allein oder mit seinen Angehörigen als zweckmässig zeigt, ist sie zu gestatten, es auch so einzuleiten, dass das Subjekt sich unbeachtet glaubt, dass er es aber nicht wirklich ist, überhaupt aber so zu verfahren, wie dieses bei §. 43 und den folgenden bezüglich der Erhebung des Wahnsinnes dargestellt wurde.
Dass übrigens Blödsinn, dann Roheit und Mangel an Ausbildung nicht mit einander verwechselt werden dürfen, bedarf keiner Erinnerung. Um aber nicht in einen solchen Fehler zu verfallen, ist es nothwendig, dass man mit dem Subjekte in dem Dialekte spreche, den es zu hören gewohnt ist, nicht um Dinge frage, von denen es vielleicht nie etwas gehört hat, und bei Dingen, die nicht unbekannt sein können, sich solcher 176 Ausdrücke bediene, die es zu hören gewohnt ist, sonst erhält man entweder gar keine oder verkehrte Antworten. Gibt ein solcher Mensch scheinbar unpassende Antworten, so forsche man nach, ob nach den ihm zugänglichen Begriffen nicht etwa doch ein vernünftiger Sinn in seinen Worten liege. — Es gehört also zu einer solchen Unterredung, dass Derjenige, welcher sie einleitet, genau mit den Sitten und der Lebensweise derjenigen Klasse in demjenigen Orte, in welchem sie Statt fand, bekannt ist, widrigens man unmöglich zu einem entscheidenden Resultate gelangen kann.
Derjenige Zustand, welchen man als Dummheit bezeichnet, kommt im Wesentlichen, wenigstens in rechtlicher Beziehung, mit dem Blödsinne überein, denn es ist dies ein Zustand, welcher ebenfalls aus einer mangelhaften Anlage des Menschen entspringt, und daher in keinem Verschulden desselben begründet ist. — Der physiologische Unterschied zwischen diesen beiden Zuständen hat aber mit der rechtlichen Bedeutung eines solchen Zustandes nichts zu schaffen.
Was im Allgemeinen vom Wahnsinne gesagt wurde, gilt auch von diesem Zustande, insbesondere wird, sofern es sich um die Beurtheilung des Einflusses eines solchen Zustandes auf die Zurechenbarkeit einer bestimmten That handelt, Vieles von Demjenigen anzuwenden sein, was von dem Zustande des Blödsinnes gesagt wurde. Namentlich werden aber folgende zwei Fragen zu beantworten sein:
a) Ist wirklich eine und welche fixe Idee, oder welche Art von Monomanie vorhanden?
b) Entspricht die That der herrschenden fixen Idee oder Monomanie in der Art, dass sie durchaus nur als ein Produkt der durch diesen Zustand im Verhältnisse zu den eingetretenen Umständen angeregten Thätigkeit ist?
Ist jedoch die That von der Art, dass sie nicht als eine erweisliche Folge der herrschenden fixen Idee oder der herrschenden Monomanie betrachtet werden kann, so ist es für den richterlichen Zweck nicht hinreichend, nur auszusprechen, es lasse sich kein erweislicher Zusammenhang darthun, sondern es muss der positive Beweis geliefert werden, dass ein solcher Zusammenhang entschieden nicht bestehe, und wenn 177 sich dieser Beweis nicht liefern lässt, so muss ärztlicherseits ausdrücklich erklärt werden, dass und warum dieses nicht möglich sei.
Der Grund, aus welchem in diesem Falle für den richterlichen Zweck eine solche entschiedene Erklärung nothwendig ist, liegt darin, dass dort, wo einmal die Erscheinung zu bemerken ist, dass von einem Individuum, welches in seiner äusserlichen Thätigkeit so weit von anderen Menschen abweicht, dass es gegen die Verhältnisse der Aussenwelt seine Vorstellungen für etwas Wirkliches oder die Erscheinungen der Aussenwelt für etwas Unwirkliches hält, nothwendig vermuthet werden muss, dass seine ganze Vorstellungsthätigkeit auf ganz anderen, für dritte Personen, zuverlässig aber für den Richter ganz unzugänglichen Prinzipien beruhe.
Diese Voraussetzung, welche sich durch die Natur der Sache von selbst rechtfertigt, kann insofern irrig sein, als die Arzneikunde möglicher Weise Wege entdeckt haben kann, um hierin klar zu sehen. Damit aber der Richter in einem solchen Falle seine durch die Natur der Sache begründete Vermuthung aufgeben könne und dürfe, ist das Geringste, was er zu fordern berechtiget und verpflichtet ist, eine entschiedene Erklärung von Seite der Kunstverständigen, dass und warum seine Vermuthung in diesem Falle irrig sei.
Uebrigens dürfte es kaum von wesentlichen Folgen für die Rechtspflege sein, zwischen Monomania und fixer Idee scharf zu unterscheiden. Die erste Art von Geisteszerrüttung scheint sich mehr auf äussere Thätigkeit, die letztere mehr auf die Vorstellungsthätigkeit zu beziehen, sofern sie aber auf die äussere Thätigkeit, auf die es hier allein ankommt, von einigem Einflusse sind, dürften sie wohl das Gleiche bedeuten.
Dieser Zustand bedeutet eigentlich eine Krankheit, welche noch in keine Thätigkeit ausgeartet ist, welche aber, sofern sie eine gesetzwidrige Thätigkeit zur Folge hat, entweder nach dem unter der vorigen Aufschrift bezeichneten Grundsatze, oder nach denjenigen Grundsätzen, welche über Wahnsinn überhaupt oder über Affekte und Leidenschaften ausgesprochen wurden, in rechtlicher Beziehung zu betrachten kommt. Jedenfalls war es ein Missgriff, dass man diesen Zuständen eine besondere Abtheilung in der gerichtlichen Arzneikunde widmete, insbesondere 178 aber, dass man von Mania occulta als einer besonderen Erscheinung sprach, als ob der Umstand, dass eine Krankheit noch nicht so heftig ist, dass man sie gewahr wird, oder weil der Leidende bisher nur an Theilen befallen wurde, die man nicht sieht, im Mindesten etwas an der Natur der Krankheit änderte! — Die Krankheit, welche im Zunehmen ist, wird und muss sich einmal äussern, wann und wo sie sich aber so kräftig äussert, dass ihr Vorhandensein von einem Dritten bemerkt wird, ist wenigstens nach meiner unmassgeblichen Meinung zur Bestimmung des Charakters der Krankheit sehr gleichgiltig, wenn die Art und Weise, wie sie sich äussert, an ihrem Charakter keinen Zweifel lässt, denn das erstere hängt von Zufällen ab, die mit der Entstehungsart und dem Entwicklungsgange der Krankheit vielleicht gar nichts gemein haben. Es kann daher allerdings geschehen, dass die erste Erscheinung, welche die Existenz der Mania bei einem Individuum kundgibt, ein Verbrechen ist, was er begeht, allein es folgt auch nicht im Mindesten daraus, dass er nicht schon früher mit derselben Mania behaftet war, sondern nur, dass die Personen, welche seine Umgebung bildeten, nicht Scharfblick genug besassen, dieselbe zu entdecken, und dieser Umstand ist doch wahrlich nicht erheblich genug, und überhaupt zu sehr dem Zufalle unterworfen, um darauf eine wissenschaftliche Eintheilung zu gründen, die eben darum, weil sie eines jeden Grundes entbehrt, welcher für die richterliche Beurtheilung von irgend einer Bedeutung ist, nur schaden, in keiner Beziehung aber nützen kann.
Berauschung ist ein durch Genussmittel künstlich hervorgerufener ungewöhnlicher Zustand der Aufregung oder Herabstimmung der Organe, welcher auf die Vorstellungsthätigkeit ebenfalls einwirken kann, so dass dadurch entweder im Allgemeinen ein schnellerer Gang der Vorstellungen erfolgt, oder dass gewisse Vorstellungen zu einer besondern Energie gesteigert werden, andere aber dadurch nothwendiger Weise an der sonst gewöhnlichen Energie verlieren. — Da nun ein Aehnliches auch in Bezug der einzelnen Organe Statt finden kann, so ergibt sich, dass die Berauschung in ihren Folgen nach aussen nach denselben Grundsätzen beurtheilt werden muss, wie Gemüthszustände überhaupt, denn wenn man nur die in diesem Zustande verübte That selbst 179 betrachtet, so erscheint sie als eine in einem ungewöhnlichen Gemüthszustande Statt gefundene Wirkung der Kraftentwicklung eines Menschen, und der Gemüthszustand selbst aber als die Folge einer Statt gefundenen Aufregung des Organismus.
Die Veranlassung zu dieser Aufregung ist in dem Falle, als sich nicht ergibt, dass sie der Mensch absichtlich herbeigeführt hat, um zur Verübung der That gestimmt zu sein, entweder ein blosser Zufall, welcher daher für die Beurtheilung des Verhältnisses der Willensäusserung in Bezug auf die That von gar keiner Bedeutung ist, oder es ist der Mensch nur dadurch strafbar, weil er sich durch seine Nachlässigkeit, mit welcher er sich dem Gelüste nach unmässigem Genusse hingab, der Gefahr aussetzte, in einen Zustand der Bewusstlosigkeit zu gerathen, in welchem er den Ausbruch seiner natürlichen Kraft nicht mehr zu regeln vermag47. Diese Art von strafbarer Unterlassung hat daher mit der Strafbarkeit derjenigen Thätigkeit, welche er in diesem selbstverschuldeten Zustande ausübte, nichts mehr gemein. Die gerichtliche Erhebung wird daher in solchen Fällen zwei Momente auf verschiedenen Wegen auszumitteln haben, nämlich a) ob in der Thätigkeit, durch welche er sich die Trunkenheit zuzog, eine strafbare Unterlassung liege, und b) ob die That, welche er beging, in einer, wenn auch durch die Trunkenheit hervorgebrachten Sinnenverwirrung motivirt sei.
Das österreichische Strafgesetz spricht sich hierüber folgendermassen aus:
§. 120, II. Theil des Strafgesetzbuches: „Trunkenheit ist an Demjenigen zu bestrafen, der in der Berauschung eine Handlung ausgeübt hat, die ihm ausser diesem Zustande als Verbrechen zugerechnet würde.”
Es erhellt daher, dass das Gesetz das Faktum der Trunkenheit überhaupt als eine zu missbilligende Handlung erkennt, die Sträflichkeit der dieser Thatsache zu Grunde liegenden Nachlässigkeit aber auf den Fall beschränkt, wenn in diesem Zustande eine Handlung begangen wurde, welche den objektiven Thatbestand eines Verbrechens bildet.
Diese Ausschliessung der Strafe für die Handlung selbst tritt aber nur insofern ein, als die Trunkenheit oder Berauschung nicht selbst als ein von dem Thäter gewähltes Mittel zur sicheren Verübung des Verbrechens war, denn das Gesetz erklärt ferner als von Strafe für das Verbrechen befreiend im §. 2: c) eine volle, ohne Absicht auf das Verbrechen 180 zugezogene Berauschung. Betrinkt sich aber Jemand, um ein Verbrechen auszuführen, zu welchem ihm sonst die nöthige Entschlossenheit fehlen würde, so ist die Thatsache des Betrinkens für ihn Dasjenige, was eine Feuerwaffe für seine Hand ist, denn Mancher, welcher zu feige ist, einen Anderen anzugreifen, würde ohne das Vertrauen auf die Kraft der Kugel, welche der Druck seines Fingers weiter befördert, die That unterlassen.
Das Gesetz fordert volle Berauschung, damit eine in der Trunkenheit begangene, sich sonst als Verbrechen darstellende Handlung oder Unterlassung nicht als Verbrechen zugerechnet werden könne, und was volle Trunkenheit ist, erklärt sich durch den Nachsatz des §. 2, lit. b) dahin, dass darunter eine Sinnenverwirrung, in welcher der Thäter sich seiner Handlung nicht bewusst war, verstanden werde; wenn er also in eine Art Tobsucht verfiel, oder in einen Irrthum gerieth, der ihm in diesem Augenblicke seine Handlung als eine erlaubte erscheinen liess, z. B. er eignet sich die Dose eines Anderen zu, weil er in den Wahn geräth, sie gekauft zu haben.
Es kommt daher bei Beurtheilung des rechtlichen Einflusses der Trunkenheit nicht gerade immer auf den Ausspruch an, dass die Trunkenheit eine volle Besinnungslosigkeit zur Folge hatte, sondern vielmehr darauf, ob der Mensch in Bezug auf die ihm zur Last liegende Thatsache sich in einer Sinnenverwirrung befand, in welcher ihm seine Thätigkeit nicht als Verbrechen erschien, und in dieser Beziehung lässt es sich dann sagen, dass der Ausspruch über den Einfluss der Trunkenheit auf seine Zurechnungslosigkeit auf zweifache Art sich gestalten könne, nämlich a) es sei nach seiner physischen Beschaffenheit und nach der Quantität und Qualität des zu sich genommenen Getränkes gewiss, dass er sich in einem alles Bewusstsein seiner Handlungen ausschliessenden Zustande befand, oder b) es ergäbe sich aus seiner körperlichen und geistigen Beschaffenheit, verbunden mit anderen Umständen, z. B. seiner augenblicklichen, durch andere Ereignisse bedingten Stimmung im Verhältnisse zur That selbst, welche etwa zu ihrer richtigen Beurtheilung einen gewissen Grad Umsicht verlangte, dass er das Bewusstsein seiner Handlung nicht hatte.
Hieraus folgt nun, dass die Erhebung über den Einfluss der Berauschung in Bezug auf die Erhebung des Einflusses anderer Arten von Sinnenverwirrung sich nur darin unterscheide, dass bei der ersten auch ausgemittelt werden muss, ob die Trunkenheit eine in Absicht auf das 181 Verbrechen zugezogene war, welche Rücksicht bei anderen Arten von Sinnenverwirrungen in der Regel wegfällt.
Die Gall'sche Schädellehre hat ein Diebsorgan, ein Organ der Mordsucht etc. ausgemittelt, die Aufstellung dieses Grundsatzes kann jedoch nur auf der Wahrnehmung beruhen, dass man bei einigen Dieben ein solches craniologisches Organ wahrnahm, das man bei einigen Menschen, welche keine Diebe waren, nicht bemerkte. Ob es jedoch nicht sehr viele Personen gibt, welche mit demselben Organe versehen sind, und doch nie eine Lust zum Stehlen hatten, bleibt immerhin zweifelhaft, daher der ganze Grundsatz an und für sich von gar keinem wesentlichen Nutzen für die Rechtspflege ist.
Von ähnlicher Erheblichkeit ist es mit den Grundsätzen, welche die Physiognomik über derlei Anlagen des Menschen aufgestellt hat, denn ein geübtes Auge kann wohl den Hang zu gewissen Affekten bei einem Menschen entdecken, welche Thaten aber diese Affekte hervorbringen werden, lässt sich unmöglich aus der Physiognomie entnehmen, da diese Thaten von Zufälligkeiten des Lebens abhängen, die man eben so wenig aus der Physiognomie voraussagen kann, als die Zukunft eines Menschen aus dem Kaffeesatze. Ob nun ein Mensch gewisse Verbrechen begehen werde, hängt nun zuverlässig von äusseren Zufälligkeiten ab, welche sich unmöglich vorhersehen lassen, ja manche Verbrechen sind in der That von der Art, dass ein seltenes und für manchen Menschen sogar unmögliches Zusammentreffen von Umständen dazu gehört, um die Begehung derselben nur denkbar zu machen.
Ehe man also sich die Mühe gibt, physiologische Thatsachen in Betreff der Anlage zu Verbrechen aufzusuchen, ist es zuverlässig sehr rathsam, die Beschaffenheit der möglichen Verbrechen selbst zu betrachten, um daraus zu entnehmen, ob wirklich in einer oder der anderen Art der Verbrechen Motive für das menschliche Begehrungsvermögen vorhanden sind, welche die besondere Disposition eines Menschen zu dessen Begehung denkbar erscheinen lassen, und worin diese Disposition bestehen könne, ein Verfahren, dem man die Möglichkeit des Gelingens eben so wenig absprechen kann, als man es für unmöglich halten wird, einem Menschen aus der Betrachtung seiner Gesichtszüge vorherzusagen, 182 ob er auf Andere einen angenehmen oder unangenehmen Eindruck machen werde.
Wenn man von einem besonderen Hange zum Verbrechen spricht, so kann man darunter doch wohl nur einen Hang zu derjenigen Gattung von Handlungen verstehen, welche das Gesetz unter einer bestimmten Benennung als Verbrechen bezeichnet, zum Diebstahl, zur Brandlegung etc., man darf aber damit denjenigen Zustand nicht verwechseln, welcher den Menschen mit einem besonderen Drange zur Entwicklung seiner Thatkraft nach Aussen erfüllt, in welchem Zustande dem Menschen jede derartige Manifestation, abgesehen von ihrem Gegenstande, angenehm und wünschenswert ist. Dies ist offenbar der Zustand der Jugend in der Periode der Pubertäts-Entwicklung. Wenn in diesem Zeitalter des Menschen, in welchem der Augenblick, d. h. die Wirkung der vorhandenen Anregung noch eine grössere Rolle spielt, als im späteren Leben, und wo der Drang, sich thätig zu äussern, mit Einem Worte der Drang, sich der eigenen Kraft an ihrer Wirkung zu freuen, gewöhnlich den Gedanken an Dasjenige, was dadurch hervorgebracht wird, überwiegt, zuweilen auch Verbrechen begangen werden, so darf man sich darüber gar nicht wundern, oder die Ursache einer solchen Aeusserung in einer besonderen krankhaften Verstimmung suchen, sondern vielmehr muss man darüber erstaunen, dass nicht mehr Verbrechen, als wirklich von jungen Leuten begangen werden, durch die jugendliche Kraftperiode, verbunden mit dem leichten Sinne der Jugend, ihre Veranlassung finden.
Der Grund dieser Erscheinung liegt nun einerseits in der Erziehung, andererseits aber in der geringen Anziehungskraft, welche die meisten Verbrechen für die Jugend haben. Selbst denjenigen gesetzwidrigen Handlungen, welche die Jugend wirklich begeht, z. B. Obstdiebstahl, Beschädigungen fremden Eigenthumes u. s. w., liegen so nahe und überwiegende Motive zu Grunde, dass man gar nicht in Zweifel sein kann, dass kein besonderer Hang zur verbrecherischen That, sondern nur der augenblickliche Genuss, welcher durch die Handlung erworben werden soll, die Neigung, seine Geschicklichkeit zu üben oder zu zeigen, verbunden mit dem Leichtsinne der Jugend, welcher weder die Vorstellung der Folgen, welche die That in entfernterer Beziehung haben kann, noch jene auf die allgemeinen Verhältnisse der Gesellschaft, welche dadurch beeinträchtigt werden, aufkommen lässt, die That veranlassen. Mir ist selbst 183 der Fall vorgekommen, dass einige Burschen, welche im Begriffe waren einen Obstgarten zu bestehlen, einen Kerl gewahr wurden, welcher in einen Weinkeller einbrach und ihn sogleich für seine That tüchtig durchprügelten. Sie schienen also ganz und gar nicht zu bemerken, dass Dasjenige, welches jener Kerl that, und das, was sie selber thaten, im Wesentlichen Eines und Dasselbe war.
Etwas Aehnliches wie bei der Pubertäts-Entwicklung kann bei der Hysterie und dergleichen Krankheitszuständen eintreten.
Doch der verehrte Leser möge selbst urtheilen, und die Physiognomie jener Handlungen, welche das österreichische Strafgesetzbuch und eben so die Gesetzgebungen aller Nationen beiläufig mit denselben Benennungen als Verbrechen erklären, näher betrachten:
Das österreichische Strafgesetzbuch erklärt folgende Handlungen als Verbrechen:
1. Hochverrath und andere die öffentliche Ruhe störende Handlungen.
2. Aufstand und Aufruhr.
3. Oeffentliche Gewaltthätigkeit (hierher gehören: Gewaltthätigkeit gegen die Obrigkeit oder Wache, gewaltsame Verletzungen des unbeweglichen Eigenthumes unter gewissen erschwerenden Umständen, ebenso gewaltsame Störungen des Hausfriedens, unbefugte Einschränkung der persönlichen Freiheit, Entführung).
4. Rückkehr eines Verwiesenen.
5. Missbrauch der Amtsgewalt.
6. Verfälschung öffentlicher Kreditspapiere.
7. Münzverfälschung.
8. Religionsstörung.
9. Nothzucht und andere Unzuchtfälle (insbesondere gewisse Gattungen von Unzucht wider die Natur ).
10. Mord und Todtschlag.
11. Abtreibung der Leibesfrucht.
12. Weglegung eines Kindes.
13. Verwundung oder andere körperliche Verletzungen.
14. Zweikampf.
15. Brandlegung.
16. Diebstahl und Veruntreuung.
17. Raub.
184 18. Betrug.
19. Zweifache Ehe.
20. Verleumdung.
21. Verbrechern geleisteter Vorschub.
Es bedarf wohl keines besonderen Scharfsinnes, um die Ueberzeugung zu erhalten, dass mehrere dieser Verbrechen unmöglich aus einem besondern Hange dazu, sondern nur dann entstehen können, wenn Umstände vorhanden sind, wo die Begehung dieser als Verbrechen bezeichneten Handlung einen Vortheil gewährt, dass daher die meisten dieser Verbrechen nur unter der Voraussetzung denkbar sind, dass sie als Mittel zu einem ausserhalb des Verbrechens liegenden Zweck erscheinen, der entweder nur durch das Verbrechen, oder doch unter den Verhältnissen, in welchen sich der Verbrecher befindet, auf kürzerem Wege durch das Verbrechen, als durch erlaubte Mittel, erreicht wird.
Das Verbrechen der Rückkehr eines Verwiesenen gehört insbesondere zur letzten Art, denn die meisten Menschen, nämlich alle die, welche nicht verwiesen sind, können dieses Verbrechen gar nicht begehen, und selbst Derjenige, welcher es begehen kann, vollbringt dasselbe durch eine Handlung, welche jedem nicht Verwiesenen erlaubt ist, nämlich durch Ueberschreitung der Landesgrenze. Das Motiv, welches denselben zur Begehung dieses Verbrechens bestimmt, kann daher kein anderes sein als derselbe Beweggrund, welcher einen Anderen zur erlaubten Handlung der Grenzüberschreitung veranlasst hätte.
Das Gegentheil tritt bei der Vorschubsleistung ein. Hier hat der Verbrecher den Zweck, einen anderen Menschen der bürgerlichen Strafe zu entziehen, und darum ist seine Handlung sträflich; das Materielle der Handlung ist etwas durchaus den Umständen Angemessenes, nämlich Verbergung, Unterstützung u. dgl., somit Thätigkeiten, welche ohne diesen Zweck vollkommen erlaubt sein würden.
Die mit 1., 2., 3. bezeichneten, die Sicherheit des Staates verletzenden Handlungen sind nur in der Voraussetzung denkbar, dass der Verbrecher dadurch etwas erreichen will, welches ihm ohne dieses Verbrechen zu erreichen unmöglich, zweifelhaft oder zu mühsam scheint. Wer mit Demjenigen, welches die Obrigkeit durchsetzen will, einverstanden ist, und nicht etwa zu irgend einem Zwecke es für tauglich hält, die Thätigkeit der Obrigkeit zu vereiteln, wird sich, sofern er nicht wahnsinnig ist, nicht derselben gewaltsam widersetzen. Wenn sich aber Jemand gewaltthätig widersetzt, so thut er es auf dieselbe Art und Weise, wie es 185 die Umstände mit sich bringen, er kämpft mit der Wache, ruft Leute zu Hilfe, um seinen Widerstand kräftiger zu machen etc., lauter Handlungen, welche keine andere Anziehungskraft haben, als wenn sie unter Umständen begangen wurden, wo sie nicht als Verbrechen behandelt werden könnten, z. B. zur Abwehrung einer unerlaubten Gewaltthätigkeit.
Kreditspapiere werden nachgemacht oder falsche Münzen werden geprägt nicht des Vergnügens des Nachmachens oder des Prägens wegen, sondern wegen des Nutzens, welchen die Verausgabung derselben schaffen soll, denn wenn auch der Fall denkbar ist, dass Jemand ein unwiderstehliches Bedürfniss zu zeichnen fühlt, so kann er diesem Bedürfnisse eben so gut durch Nachzeichnung eines Kupferstiches genügen. Sollte aber auch jemals der Fall vorkommen, dass Jemand, der kein anderes Original findet, als eben eine Banknote, diese nachzeichnet und sich dann durch seinen unwiderstehlichen Hang zum Zeichnen entschuldigt, so lässt sich doch nur sagen, weil er keine Gelegenheit hatte, einem Talente auf eine erlaubte Art zu genügen, ist er auf eine unerlaubte Manifestation desselben verfallen, nicht aber er habe einen unwiderstehlichen Hang zum Verbrechen der Verfälschung öffentlicher Kreditspapiere gehabt.
Wer eine bestehende Religionsübung stört, thut dieses entweder aus Fanatismus oder aus Mutwillen, um Unfug zu machen. Er muss aber im letzteren Falle wissen, dass eine Religionsübung dadurch gestört wird, sonst hört die That auf ein Verbrechen zu sein. In beiden Fällen, so wie auch dann, wenn eine Aufforderung dritter Personen eintritt, setzt dieses Verbrechen eine Kombination von Begriffen voraus, deren Komplex gar nicht in der Anlage der menschlichen Natur begründet sind, sondern welche zu ihrem Bestehen eine Menge von Zufälligkeiten voraussetzt, die auf gar keine bestimmte natürliche Anlage zurückwirken.
Zur Abtreibung der Leibesfrucht kann unmöglich ein besonderer Hang Statt finden, da an und für sich die That nichts sinnlich Angenehmes enthält und nur durch die Vorstellung des Unangenehmen, welches durch die That vermieden werden soll, veranlasst werden kann. Das Materielle der Handlung ist nichts Anderes, als was bei jeder Krankheit geschieht. Es werden Arzneistoffe eingenommen etc., und mit Einem Worte Thätigkeiten geübt, die nur durch den Zweck, welchen sie erreichen sollen, sträflich sind.
Die Weglegung eines Kindes ist nur dann ein Verbrechen, wenn sie zu dem Zwecke geschieht, um dasselbe der Gefahr des Todes auszusetzen, oder um seine Rettung dem Zufalle zu überlassen. Wer also den 186 einen oder den anderen Zweck nicht hat, kann dieses Verbrechen gar nicht begehen, somit auch keinen Hang dazu haben. Von einem Hange zu diesem Verbrechen kann daher nur insofern die Rede sein, als man überhaupt von einem Hange zur Tödtung oder Verletzung sprechen kann, von welchen später die Rede sein wird.
Schwerlich hat man noch von einem unwiderstehlichen Hange zum Zweikampfe gesprochen. Es gibt allerdings Raufbolde, die sich ihrer natürlichen Kraft und Geschicklichkeit in Raufhändeln erfreuen, allein diese Gemüthsstimmung entsteht nicht aus dem Hang zum Raufen, sondern im Gegentheile ihr Hang zum Raufen ist die Folge einer herrsch- oder rachsüchtigen, oder zornigen Gemüthsstimmung, es ist daher ihre Neigung zu derlei Unternehmungen nur eine der durch ihre Gemüthsstimmung bedingten Aeusserungen. Es wäre daher eben so unrichtig zu sagen, dieselbe entspringe aus einem besonderen Hange zu diesem Verbrechen, als wenn man von Jemanden, welcher überhaupt sehr genäschig ist und alles Süsse gern verzehrt, sagen wollte, er habe einen besonderen Hang, Zucker zu naschen.
Diebstahl, Raub, Betrug gehören in psychologischer Beziehung, wie in der Folge gezeigt wird, in Eine Klasse.
Dass es einen besonderen Hang zum Verbrechen der zweifachen Ehe, d. i. zu derjenigen Handlung gebe, durch welche eine bereits verheiratete Person, noch ehe das Eheband gelöst ist, einen zweiten Ehevertrag schliesst, oder dass Jemand sich mit einer Person blos aus dem Grunde trauen liesse, weil sie schon verheiratet und noch nicht verwitwet ist, ist sicher noch keinem vernünftigen Menschen eingefallen. Die Leidenschaft oder das Verlangen nach der Mitgift kann allerdings ein sehr kräftiges Motiv sein, dieses Verbrechen zu begehen, dann aber ist es nicht mehr der Hang zum Verbrechen dieses Namens, sondern der Hang zu etwas ganz Anderem, welches den Menschen veranlasste, eine seinem Zwecke dienende Handlung ungeachtet ihrer Sträflichkeit zu unternehmen.
Es gibt ferner allerdings Leute genug, welche ihrem Nächsten Dinge nachsagen, welche seinem Rufe nachtheilig sind, von deren Unwahrheit sie überzeugt sind, weil sie dieselben selbst erfunden haben. Allein diese Handlung ist nur dann ein Verbrechen, wenn sie mit der Absicht geschieht, denselben als Verbrecher der obrigkeitlichen Nachforschung auszusetzen, und nur dann eine schwere Polizeiübertretung, wenn durch die Unbestimmtheit in Bezug auf die Folge der Beschuldigung der gute 187 Name angegriffen wird, ohne dass jedoch eine wirkliche Untersuchung dadurch veranlasst worden wäre, oder wenn die Anschuldigung zwar zur gerichtlichen Untersuchung, aber nicht zu jener wegen eines Verbrechens führt.
Ein Hang zum Verbrechen der Verleumdung wäre daher eine spezielle Neigung, andere Leute zum Gegenstande einer gerichtlichen Untersuchung zu machen, und eine solche spezielle Neigung wird sich doch wohl schwerlich aus irgend einer physischen oder psychischen Anlage, es sei denn jene des ausgebildeten Wahnsinns, erklären lassen.
Die blosse Sucht, den guten Namen des Nebenmenschen zu verunglimpfen, entspringt aber ihrerseits aus zu bekannten Motiven, als dass man zu ihrer Erklärung einen speziellen Hang anzunehmen brauchte. — Die Sucht zu spotten, sich selbst einen Vortheil auf Kosten des Anderen zuzuwenden, das Bedürfniss etwas zu sagen, was die Anderen interessirt, verbunden mit einer Dosis Leichtsinn, endlich Neid und Schadenfreude genügen vollkommen, um diese Erscheinung zu erklären.
Vergehen, welche blos in Unachtsamkeit ihren Grund haben, wie die meisten schweren Polizeiübertretungen, gehören nicht hierher, es sind also an und für sich sehr wenige sträfliche Handlungen, von welchen sich Erfahrungen aufweisen lassen, dass dazu ein besonderer Hang bei manchen Personen bestehe, und diese sind:
1. Verbrechen, welche die Geschlechtslust veranlasst.
2. Verbrechen, welche in Verletzung des Körpers, und
3. des Eigenthumes dritter Personen bestehen.
4. Verbrechen der Brandlegung48.
1. Was die durch die Geschlechtslust veranlassten Verbrechen betrifft, so gibt insbesondere das Verbrechen der Unzucht wider die Natur den eigentlichen Typus derjenigen Handlungen ab, welche in gewissen Fällen aus einem Hange zur Verübung eines bestimmten Verbrechens entspringen können.
Wenn man nämlich von einem Hange zur Verübung eines bestimmten Verbrechens spricht, so versteht man, sofern man diesem Hange 188 einen gewissen rechtlichen Einfluss auf die Strafzurechnung einräumt, nicht etwa ein Produkt eines bereits ausgesprochenen Wahnsinns, z. B. eine fixe Idee, sondern man nimmt an, dass der Mensch mit Ausnahme jenes Hanges sonst normale Geisteskräfte und normale physische Funktionen äussert, denn ist einmal das Vorhandensein einer Gemüthskrankheit ausgesprochen, deren Produkt ein solcher Hang ist, so kann kein Zweifel mehr sein, dass jener Gemüthszustand, somit die Ursache, die Folge, nämlich die in Folge eines solchen Hanges geäusserte Thätigkeit als unzurechenbar darstelle.
Soll daher der Hang zu einem gewissen Verbrechen eine rechtliche Bedeutung haben, so muss er sich bei dem davon behafteten Subjekte gewissermassen als isolirte Thatsache darstellen.
Was nun insbesondere das oben berührte Verbrechen betrifft, so leidet die Thatsache keinen Zweifel, dass es Menschen gibt, welche den Weg naturgemässer Befriedigung des Geschlechtstriebes verlassend, sich einer naturwidrigen Befriedigung hingeben, und dabei nicht nur die Fähigkeit zur naturgemässen Befriedigung verlieren, sondern bei ihrer entarteten Aeusserung nicht nur diejenige heftige Leidenschaft äussern, welche der ordentlichen Entwicklung des Geschlechtstriebes natürlich ist, sondern eben dadurch, weil durch ihr natur- und sittenwidriges Treiben sowohl das sittliche Gefühl, als auch der Geist abgestumpft wird, in einen Zustand verfallen, welchem man zu viel Ehre anthut, wenn man ihn „viehisch” nennt, da das „Vieh” doch immer auf dem natürlichen Wege bleibt.
Genug, bei diesem Verbrechen spricht es sich klar aus, dass der sich demselben hingebende Mensch dabei nichts Anderes will, als das Verbrechen selbst, d. h. er will nichts Anderes als die naturwidrige Sünde, in der er zugleich seinen Zweck findet, nicht aber dadurch einen anderen Zweck erreichen.
Die zur Strafmilderung gereichende Rücksicht kann hier offenbar nur darin liegen, dass bei dem zur Verhandlung kommenden Akte der Mensch bereits einen so hohen Grad von geistiger Abstumpfung erreicht hatte, dass es ihm nicht möglich war, sich von der ekelhaften Sünde durch irgend eine Vorstellung abhalten zu lassen, weil er entweder nicht im Stande war, eine solche zu reproduziren, oder so von der Vorstellung seiner Sünde befangen war, dass keine Vorstellung mehr gegenüber derselben eine hinlängliche Intensivität erlangt.
Dass es solche Abscheu erregende Subjekte gebe, wird wenigstens keiner meiner medizinischen Leser bezweifeln. Ich selbst lernte ein Paar 189 dieser Art kennen. Der eine davon studirte schon in den höheren Schulen, — wie kann man sich denken. — Ein junger Mann, der das saure Geschäft hatte ihn zu unterrichten, war manchmal genöthigt, ihn bei dem Ohre zu zupfen, um seine Gedanken auf die gehörige Bahn zu bringen, was er sich jedoch ohne Widerrede gefallen liess. Der andere, ein junger Mann, 23 Jahre alt, in glänzenden Vermögensumständen, hatte die Kräfte und den Verstand eines Kindes von etwa 6 Jahren, eine etwas laute unvermuthete Anrede brachte epileptische Zufälle bei ihm hervor, er konnte nur auf den Arm seines Begleiters gestützt gehen, und — seine Sünde wiederholte er täglich, ungeachtet er stets die heftigsten Rückgratschmerzen darauf empfand, wie man mich versicherte.
Handelt es sich bei Fällen, welche diese Sünde als Verbrechen darstellen, daher um den Umstand, inwiefern wirklich ein unwiderstehlicher Hang ihn zu der That veranlasste, so müssen solche und ähnliche Daten, wie die vorbenannten, aufgesucht und hieraus, und überhaupt aus der Beschaffenheit der physischen Organe und geistigen Kräfte argumentirt werden, ob und inwiefern das Subjekt wirklich nicht im Stande war, seinem, durch die Uebung des naturwidrigen Lasters erworbenen Hange Widerstand zu leisten.
Bei dem eigentlichen Verbrechen der Nothzucht, welches nämlich darin besteht, dass eine Weibsperson durch angethane Gewalt, gefährliche Drohung, oder arglistige Betäubung der Sinne ausser Stand gesetzt wird, den Lüsten des Angreifers Widerstand zu leisten, ist es durchaus unmöglich, diese That durch einen unüberwindlichen Hang zur Verübung des Verbrechens zu erklären. — Es ist der Fall möglich, dass Jemand einen sehr heftigen Trieb hat, mit einer Person den Coitus zu pflegen, das Verbrechen bleibt aber dann doch nur das Mittel, diesen Zweck zu erreichen.
Hier darf daher niemals gesagt werden, der Mensch habe einen besonderen Hang zu diesem Verbrechen, sondern es kann höchstens zuweilen der Fall eintreten, dass der Mensch, der sich in heftiger Geschlechtsaufregung befindet, und auf keine andere Weise zum Ziele gelangen konnte, durch die Heftigkeit seines Triebes zum Verbrechen hingerissen wird. Hier werden daher zur Bemessung des Grades seiner Strafbarkeit diejenigen Momente hervorgehoben werden müssen, in welchen sich die ungewöhnliche Heftigkeit seines Triebes im Allgemeinen 190 kundgibt oder -gab, und die in dem speziellen Falle besonders eingetretenen diesfälligen Momente berücksichtigt werden müssen.
2. Dass die Erfahrung wirklich Beispiele von Menschen liefere, welche ein Vergnügen an Grausamkeiten49 besitzen, leidet keinen Zweifel, es kann also wohl geschehen, dass ein Individuum in gerichtliche Untersuchung kommt, welches über einen Mord ertappt, keinen anderen Grund seines Verbrechens anzugeben weiss, als eine unüberwindliche Mordlust.
Da ein solcher Fall nothwendig eine ärztliche Intervenirung bedarf, so ist es wichtig, über den Zweck dieser Erhebung im Klaren zu sein.
Die erste Frage ist in einem solchen Falle immer: ist der Mensch nicht etwa wahnsinnig? und zur richtigen Beantwortung dieser Frage wird dann Dasjenige zu berücksichtigen sein, welches im Verlaufe dieser Darstellung hierüber gesagt wurde.
Lautet nun die Antwort dahin, es sei keine Spur des Wahnsinns zu finden, wodurch dann diese Mordsucht als eine isolirte Thatsache zu stehen kommt, so handelt es sich darum, richtig zu stellen, ob es möglich ist, dass eine solche Mordsucht bei einem sonst normalen Menschen bestehen und sich thätig äussern könne, ohne dass der Mensch vermag, ihren Ausbruch durch seinen Willen zu hindern.
Um bei dieser wichtigen Sache nicht irre zu gehen, darf man nicht übersehen, dass es zweierlei Arten des Mordes der Erscheinung und der physiologischen Motivirung nach gibt, nämlich den gewalttätigen Mord, und jenen, welcher durch Anwendung einer gewissen Geschicklichkeit vollbracht wird, wie z. B. Giftmord, oder der Mord durch Erschiessen u. s. w. Eine jede von diesen beiden Arten setzt bei dem Mörder eine wesentlich von der anderen verschiedene Gemüthsstimmung voraus. — Bei der ersten ist es nämlich physische Aufregung, welche — wie es im Felde bei den Kriegern der Fall ist — ohne Verschulden durch den Anblick des Blutes, durch den Gedanken an die Todesgefahr entstehen kann. Jeder etwas heftige Mensch, der von 191 Räubern angefallen, einen oder ein Paar davon zusammenhaut, wird schwerlich den dritten mehr schonen. Das Gewaltige der That, die Fülle von Kraft, deren sich der Mensch durch die Besiegung eines Feindes bewusst wird, muss nothwendig eine Anregung mit sich führen, welche dort, wo sich eine ähnliche Veranlassung zeigt, zur Wiederholung stimmt. Tritt hier nun sittliche Roheit, ein verwildertes Gemüth hinzu, so lässt es sich allerdings denken, dass der Mensch, um sich noch einmal jenes Bewusstsein der Fülle seiner Kraft zu verschaffen, sich angeregt fühlt, ohne sonstiges Motiv einen neuen Mord zu begehen, und dass er eben wegen seiner sittlichen Roheit bei einer sich zeigenden Gelegenheit diesen Drang unwiderstehlich angibt, oder dass er bei einem sonst sehr geringen Motive sich zur Begehung eines Mordes angeregt und bestimmt fühlt. — Das Merkmal, dass ein geringes Motiv den Menschen bestimmte, d. h. ein solches, welches bei einem Anderen nicht eine so grässliche That veranlasste, ist übrigens hier von wesentlicher Bedeutung, denn hatte er ein für seine Verhältnisse wichtiges Motiv, so ist ohnehin die Voraussetzung, dass die That Mittel zum Zwecke war, ihre Zurechenbarkeit wird daher nicht zweifelhaft sein.
Jedoch auch in der erstbezeichneten Voraussetzung erscheint eine solche That immerhin psychisch motivirt, es ist daher kein Grund vorhanden, das Motiv der That als unbegreiflich in den Bereich der Krankheiten zu versetzen, und es wird sich dann nur darum handeln, auszumitteln, ob der Mensch wirklich von einem so heftigen Affekte ergriffen war, welcher ihm alle Besinnung bezüglich der Gesetzwidrigkeit seiner That raubte. Ein solcher Fall wird daher lediglich nach denjenigen Grundsätzen sowohl von Seite des Richters, als von jener des Arztes zu beurtheilen sein, welche in der Lehre von den Affekten dargestellt wurden.
Anders verhält sich die Sache bei der zweiten Gattung. — Hier mangelt offenbar das die vorige charakterisirende Merkmal des Bewusstseins physischer Kraftentwicklung, sondern es tritt hier nur das Bewusstsein der Macht des Wissens und der erworbenen Geschicklichkeit ein. — Der Giftmischer fühlt, dass er mit dem Staube, den zwei Finger fassen, der Schütze, dass er mit dem Drucke seines Fingers ein Leben vernichten kann. Bei der ersten Gattung des Mordes gehört offenbar der Anblick des Todeskampfes des Opfers mit unter die Motive der That, der leidenschaftliche Giftmischer bleibt kalt bei dessen Todesqual, und vermeidet auch wohl den Anblick; bei dem 192 ersten ist das Morden, bei dem letzteren der Tod Dasjenige, welches ihm Genuss gewährt.
Zu der ersten Gattung gehört Roheit als nothwendige Bedingung, die letztere Gattung erfordert, dass der Mensch nicht in der starken Erregung, sondern im Gegentheile in dem Bewusstsein der Unterdrückung menschlicher Gefühle einen Genuss finde.
Dieser Zustand ist nun allerdings möglich, denn er ist die grässliche Parodie der Sittlichkeit. So wie nämlich der Sittliche in dem Bewusstsein der Entsagung mancher Wünsche sich seiner Unabhängigkeit bewusst wird, und dieses Bewusstsein ihm ein angenehmes Gefühl gewährt, so kann auch der Bösewicht sich durch das Bewusstsein, dass ihn gewisse menschliche Gefühle nicht mehr anregen, in einem gewissen Grade behaglich fühlen, und sich der ihm hiedurch gewordenen Ueberlegenheit freuen.
Auch dieser Zustand ist daher ohne Annahme einer Gemüthskrankheit psychologisch zu erklären, schwerlich werden jedoch, den Fall ausgenommen, wo der Mensch in wirklichen Wahnsinn verfallen ist, sich Motive der Strafmilderung finden lassen, denn der Mensch handelt frei, da er mit Bewusstsein dem bösen Principe huldigte, er hat sich freiwillig zum Teufel gemacht, und wenn er glaubte, einer unwiderstehlichen Macht zu folgen, so war es nur jene, die er selbst heraufbeschwor, und der er alles Dasjenige freiwillig zum Opfer brachte, was dem Menschen sonst in Stunden der Versuchung zum Schilde dient. — Nur die Furcht vor Strafe kann noch auf solche Menschen wirken, sie mögen daher jener Menschheit zur Sühne fallen, welche sie sich selbst zum frevelhaften Opfer gebracht haben.
3. Was den Hang zum Diebstahl, Veruntreuung und wohl auch vielleicht zu Betrügereien betrifft, so lässt sich deren Vorhandensein bei manchen Menschen allerdings nicht in Abrede stellen, allein auch hier lässt sich nicht behaupten, dass dieser Hang, wo er sich zeigt, und nicht allein die Folge eines sich als Geistesverwirrung darstellenden Krankheitszustandes ist, als ein Hang zu diesem Verbrechen, oder zu dieser schweren Polizeiübertretung (sofern der Werth des Gutes 25 fl. nicht übersteigt, oder die That nicht unter besonderen erschwerenden Umständen begangen wird) betrachtet werden könne.
Damit nämlich eine Handlung als Diebstahl betrachtet werden kann, müssen folgende Momente eintreten: a) es muss von Jemanden um seines 193 Vortheils willen, b) fremdes (bewegliches) Gut, c) aus eines andern Besitz, d) ohne dessen Einwilligung entzogen werden.
Hier muss also Derjenige, welcher als Dieb soll betrachtet werden, fünferlei Begriffe in sich entwickelt haben, und es gehörte also, um den Hang zum Diebstahl als eine Anlage anzunehmen, dazu, dass man zugibt, es könne ein Mensch von Natur so gestimmt sein, dass ihm die Vorstellungen, welche diesen fünf Begriffen entsprechen, durchaus widerstreiten.
Dieses ist nun in der That von einer natürlichen Anlage viel gefordert. — Die Unmöglichkeit der Annahme einer solchen natürlichen Anlage ergibt sich aber noch mehr, wenn man die Vorstellungen, welche diesen Begriffen entsprechen, näher analysirt.
Dass der Mensch geneigt ist, um seines Vortheils willen zu handeln, ist ganz natürlich und bedarf nicht der Voraussetzung eines besonderen Hanges bei irgend einem Menschen, es ist dies ein allgemeines Merkmal aller Handlungen des Menschen, denn auch die sittlichen geschehen zu Gunsten eines, wenn auch unmateriellen Gutes.
Dass es ferner möglich ist, zwischen eigenem und fremdem Gute zu unterscheiden, setzt nothwendig voraus, dass der Mensch den Begriff des Eigenthums in sich entwickelt habe. Dieser Begriff folgt nun nicht nothwendig aus der menschlichen Natur als solcher, wie etwa jener der Sittlichkeit, sondern aus der Natur des geselligen Verhältnisses, und erst von der Beschaffenheit des letzteren wird es abhängen, was, d. i. welche Sachen ein Gegenstand des Eigenthums werden können. — Selbst in unserem entwickelten geselligen Zustande ist nicht alles Eigenthum, über welches Jemand zu disponiren berechtigt ist. Niemanden fällt es ein, dass es verboten sein könnte aus dem Brunnen zu trinken, der einem Anderen gehört, sich in den Schatten eines Baumes zu setzen u. s. w.
Der Grund davon ist, weil die Gegenstände, von denen hier die Rede ist, z. B. das abfliessende Wasser u. s. w., keinen Werth, oder doch keinen solchen Werth haben, dass diese unbedeutende Benützungsart von irgend einem merkbaren Einflusse für den Dritten sein könnte. Gäbe es einen Goldbrunnen, so würde sich bald dessen Besitzer auch die unbedeutendste Consumtion verbieten.
Welche Gegenstände nun aber so viel Werth haben, dass sie als Eigenthum von einzelnen Personen angesprochen werden mögen, hängt lediglich davon ab, ob und wieferne sie die Mühe einer besonderen Besitzergreifung 194 lohnen, denn wenn sich auch Niemanden das Recht absprechen lässt, so steht doch weder zu erwarten, noch zu vermuthen, dass Jemand Sachen, welche für ihn ganz werthlos sind, weil er sie in jedem Augenblicke sich zur Genüge verschaffen kann, zu einem Gegenstande einer besonderen Besitzergreifung machen werde; so wird auf einer ganz mit Wald bewachsenen Insel, welche nur von wenigen Personen bewohnt wird, sich wohl Niemand die Mühe geben, diejenigen Bäume, die er umzuhauen gedenkt, in grösserer Anzahl früher zu bezeichnen.
Es folgt daher, dass der Begriff, ob und was Eigenthum sei, erst durch das gesellige Verhältniss entwickelt wurde, und zwar dadurch, dass man zuerst das Bedürfniss fühlte, einen Gegenstand mit Ausschluss Anderer zu besitzen, und das Verhältniss, welches dadurch zwischen dem Besitzergreifer und dritten Personen in Bezug auf die fragliche Sache entstand, Eigenthum nannte. Das Gebot: du sollst nicht stehlen, kann daher nur dort und insofern übertreten werden, als der Begriff des Eigenthums entwickelt ist, während das Gebot: du sollst nicht tödten, überall und ohne Ausnahme gilt, wo ein Mensch dem andern begegnet.
Dasjenige, was aber nur durch Aeusserlichkeiten bedingt ist, davon lässt sich nicht sagen, dass es mit einer menschlichen Anlage in so naher Verbindung ist, dass es durch sein blosses Dasein eine natürliche Anlage so aufregen könne, dass der blosse Begriff im Stande wäre, abgesehen von den Wünschen, welche die einzelnen Vorstellungen in ihm erzeugen, ihn schon zu einer die Aufhebung des Begriffes bezweckenden Thätigkeit zu veranlassen. — Es kann eine Idiosynkrasie geben gegen Spinnen, nicht aber gegen den Begriff des Eigenthums.
Wir haben hier daher zwei Begriffe, welche nothwendig zum Verbrechen des Diebstahls gehören, von denen sich nachweisen lässt, dass sie mit dem sinnlichen Hange eines Menschen nichts zu schaffen haben, weil der eine zu allgemein ist, um einem speciellen Hange zum Gegenstande dienen zu können, der andere aber eine reine Abstraction ist, zu deren richtiger Auffassung eine bedeutende Menge anderer abstracter Begriffe gehört; es lässt sich daher mit vollkommener Bestimmtheit sagen, dass zu derjenigen Handlung, welche das Gesetz als Diebstahl erklärt, von welcher also in gerichtlich-medicinischer Beziehung allein die Rede sein kann, ein besonderer Hang gar nicht denkbar ist.
Indess der Hang zu Diebereien steht als Thatsache da, welche Niemand läugnet, man muss daher die Sache von einem anderen Gesichtspunkte 195 auffassen, nämlich zu erforschen suchen, worin denn das Motiv oder die Motive liegen, welche den Menschen veranlassen können diejenige Thätigkeit auszuüben, welche den materiellen, den objektiven Thatbestand des Diebstahls bilden.
Das Materielle dieser Handlung besteht nun in folgenden Momenten:
1. In der Besitzergreifung einer Sache.
2. In der Besitzergreifung einer Sache, von der der Thäter sich bewusst ist, dass er sie nicht an sich bringen soll.
3. In der Entziehung derselben ohne Wissen und Willen, oder (wodurch sich das Verbrechen als Raub charakterisiren kann) gegen den Willen, und mit Beseitigung des Widerstandes des Besitzers.
Jeder dieser drei Momente kann für sich betrachtet etwas Reizendes für manchen Menschen haben, so dass der eine dieser Momente ihn bestimmt, die Bedingungen zu erfüllen, welche in den beiden übrigen Momenten enthalten sind, obgleich dieselben sonst für ihn nicht besonders anziehend wären.
Bei dem ersten dieser Momente lässt sich aber noch der Unterschied gewahren, dass man aus dem doppelten Grunde den Besitz einer Sache ergreifen kann, nämlich um sie zu haben, oder um sie zu gebrauchen, d. i. entweder um ihrer selbst willen, oder um sich damit irgend einen Genuss zu verschaffen.
Die Handlung des Diebstahls wird daher nach ihren Motiven folgende Erscheinungen darbieten:
Die letzte Gattung von dem Merkmale a) charakterisirt den wahren Dieb, dem das Verbrechen das Mittel zum Zwecke des Genusses ist. Er stiehlt nicht um zu stehlen, sondern um den gestohlenen Gegenstand zu verwenden, wird sich auch in der Wahl Desjenigen, was er stiehlt, nur darin beschränken, dass er nur Sachen stiehlt, die ihm nach seinen Verhältnissen Vortheil versprechen, Gegenstände aber, deren Gebahrung ihm nicht geläufig ist, liegen lassen. Diese Art des Diebstahls ist kein Gegenstand eines besonderen Hanges, sondern sie erklärt sich vollkommen aus dem natürlichen Bestreben, sich mit der möglichst geringen Anstrengung Vortheil zu verschaffen. Zunächst stiehlt also der Dieb Dasjenige am liebsten, was seiner Denkungsweise am meisten zusagt. Trifft es sich nun dabei, dass durch irgend einen Eindruck sich der Diebstahl gewisser Gegenstände als besonders schmählich seiner Phantasie eingedrückt hat, so wird er diese nicht, oder doch nur im Nothfalle stehlen, und bei je mehr Gegenständen er diese Ansicht wirklich hat, um so geringer 196 wird die Anzahl derjenigen Gegenstände sein, bezüglich deren er sich kein Gewissen daraus macht, sich derselben auch dann zu bemächtigen, wenn er weiss, dass sie bereits Jemands Eigenthum sind. Immer aber muss berücksichtigt werden, dass der gewöhnliche Dieb nicht etwa darum stiehlt, weil er dem Eigenthumsrechte im Allgemeinen den Krieg erklärt hat, sondern nur des Gegenstandes willen, den er auf keine andere Art zu bekommen weiss. Wenn also der eine Dieb blos Pferde, ein anderer blos Uhren, ein dritter — wie mir selbst ein solches Individuum vorkam, das Eisenzeug mit grösster Beschwerde meilenweit nach seiner Behausung trug — nur Eisenzeug stiehlt, so liegt die Veranlassung zu dieser Erscheinung in einem vollkommen normalen Gange menschlicher Vorstellungen. Er stiehlt blos den einen Gegenstand, weil bezüglich dieser Art von Diebstahl seine moralische Abneigung bereits überwunden ist, und er stiehlt andere Gegenstände nicht, weil er in ihrer Beziehung erst noch einen moralischen Widerstand zu überwinden hat.
Die erste Abteilung des Merkmales a), wo Jemand eine Sache blos darum stiehlt, um sie zu haben, kommt mit der vorigen auf Eins hinaus, wenn der Besitz allein irgend einen Vortheil gewährt, z. B. der Gegenstand des Diebstahls ein Kleinod ist, mit welchem man Staat machen kann; indess ist hier bereits der Fall denkbar, dass Jemand durch eine Art Idiosynkrasie geleitet, einen unwiderstehlichen Trieb fühlt, die Sache in seine Gewalt zu bekommen. Dieser Zustand ist möglich, da er, wie die Erfahrung lehrt, wirklich vorkommt, und lässt sich allerdings nur aus irgend einer Abnormität im Menschen erklären, welche eben darum, weil sie eine Abnormität ist, und zwar ganz die Natur der fixen Idee an sich hat, auch nach den hierüber dargestellten Grundsätzen erhoben werden muss.
Das Erste, worauf es dabei ankommt, ist die Nachweisung, dass der Mensch wirklich nur in Folge eines solchen Einflusses handle, und das Mittel, diese Nachweisung zu liefern, ist der Umstand, dass der Mensch wirklich nur diese bestimmte Sache, oder doch nur eine bestimmte Gattung von Sachen, wo er sie findet, sich zueigne, und die Nachweisung des Abganges aller sonstigen Motive zu dieser Art von Thätigkeit.
Das Gegenstück zu diesem Zustande ist jene Art von Dieberei, welche nicht selten die Begleiterin desjenigen Zustandes ist, welchen man Knauserei nennt, und welcher in einem sehr grossen Abscheu vor kleinen Ausgaben besteht, welcher Abscheu sich entweder darauf bezieht, dass 197 man kleine Geldausgaben oder die Verwendung gewisser Gegenstände, z. B. eines Bogens feinen Briefpapiers, der Federkiele u. s. w. scheut. Wenn durch eine solche Stimmung der Mensch zu kleinen Diebereien verleitet wird, so liegt der Grund in der Vorstellung, dass einerseits durch die Aneignung des fremden Gegenstandes dieser Art die Verwendung des eigenen überflüssig gemacht wird, andererseits aber dass der Andere, weil derselbe keinen solchen Werth auf diesen Gegenstand legt, den Abgang nicht rügen, und daher die Entfremdung, auch wenn er sie bemerkte, stillschweigend gestatten werde. — Weit davon, dass ein solcher Zustand selten genannt werden kann, findet man ihn oft bei Leuten, bei welchen man etwas dergleichen in der That nicht vermuthen sollte. Derlei Aeusserungen gehören in die sehr weite Gattung der Schmutzereien, und fallen daher nur dort besonders auf, wo sie ein besonderes lächerliches Ansehen haben, oder wo sie Denjenigen, welcher sich ihnen ergibt, einmal veranlassen, das durch ein stillschweigendes Uebereinkommen der Gesellschaft festgesetzte Mass zu überschreiten, oder endlich wenn sie auf ein Subjekt gerathen, weiches auf eine ähnliche Weise, wie jene, denkt und fühlt.
Kommt nun eine solche Thatsache zur gerichtlichen Erhebung, so wäre es wohl kaum die richtige Ansicht, wenn man sie als eine Folge irgend einer Abnormität betrachten würde, sondern sie ist in Wahrheit nichts Anderes, als eine Folge des Sichgehenlassens in dem Hange zu Schmutzereien, und verdient daher nur höchstens insofern eine Entschuldigung, als der Thäter voraussetzen konnte, dass ihm der Beeinträchtigte auch im Falle der Entdeckung die Sache hingehen lassen werde.
So wenig sich, wie bereits früher bemerkt wurde, eine eigentliche Idiosynkrasie wider den Begriff des Eigenthums denken lässt, so ist doch der Fall möglich, dass Jemanden eine Sache, so lange er sich bewusst ist, sie auf erlaubtem Wege nicht haben zu können, viel besser gefällt, als wenn er sie hat oder auf eine erlaubte Weise haben kann. Nitimur in vetitum etc. ist ein längst bekannter Satz. Stiehlt nun Jemand eine Sache, die er sich nach dem Zustande seines Vermögens leicht hätte kaufen können, so liegt dieser That wahrscheinlich die Erfahrung zu Grunde, dass ihm eine Sache, auf rechtliche Weise erworben, bei weitem nicht so viel Vergnügen mache, als wenn er sie auf eine unerlaubte Weise erwirbt.
So psychologisch richtig nun eine solche Ansicht an und für sich ist, so wenig wird sie als ein Grund der Straflosigkeit erscheinen, wohl aber 198 kann es geschehen, dass die fortwährende Uebung in Kleinigkeiten oder unter Verhältnissen, wodurch der Thäter straflos blieb, eine solche Gewohnheit in dieser Art Praxis zur Folge hatten, dass er endlich stiehlt, wie ein Anderer eine Prise Tabak nimmt, ohne etwas dabei zu denken.
Tritt jedoch wirkliches Bewusstsein ein, und hat der Thäter gewusst, dass er stehle, entschuldigt sich aber mit unwiderstehlichem Hange, fremdes Eigenthum sich zuzueignen, so ist entweder eine wirkliche Krankheit vorhanden, deren Folge dieser Zustand der unwiderstehlichen Bestimmung ist, oder es hat doch nur an Willen gefehlt, dem Hange Widerstand zu leisten, und die Strafe kann um so weniger vermieden werden, als nicht zu läugnen ist, dass die Vorstellung davon geeignet ist, den Widerstand gegen die Neigung beträchtlich zu verstärken.
Nicht minder als die in den vorigen Paragraphen ausgesprochenen Motive kann die Rücksicht auf die Schwierigkeit, welche zu überwinden, auf die Gefahr, welche zu bestehen ist, um in den Besitz einer Sache zu gelangen, Manchen bestimmen, sich einen Diebstahl zu erlauben, und zu dieser „einladenden” Gefahr gehört auch die Vermeidung der auf das „Ertapptwerden” gesetzten Strafen. Auch der Diebstahl hat seine poetische Seite; man denke an manche Diebereien, welche sich die Kinder erlauben, und man wird diese Bemerkung richtig finden. Schon die Griechen scheinen deren Richtigkeit erkannt zu haben, weil sie den Diebstahl zu einer eigenen Gottheit erhoben. Es kann sich daher allerdings treffen, dass das Motiv, welches den Menschen zum Diebstahl treibt, nicht eigentlich der Diebstahl, d. h. die Zueignung der fremden Sache, sondern die Ausführung der Besitzergreifung ist; es ist daher allerdings der Fall denkbar, dass ein Mensch, welcher einen oder mehrere Diebstähle verübte, nur darum stahl, weil ihn die Schwierigkeiten der Ausführung dieser That ausserordentlich anzogen.
Das Verbrechen der Brandlegung kann begangen werden: a) aus demjenigen Motive, aus welchem sonst jedes Verbrechen entspringt, nämlich zu dem Zwecke, um dadurch einen Vortheil zu erzielen oder irgend eine Leidenschaft, z. B. Rache, zu befriedigen; b) aus Vergnügen, brennen zu sehen; c) aus dem Drange, mit leichter Mühe eine grosse Wirkung hervorzubringen.
Das erste Motiv bedarf keiner besondern Erörterung, denn wenn ein solches Motiv zu Grunde liegt, das Verbrechen daher als Mittel zum 199 Zwecke erscheint, so lässt sich von keiner besonderen Neigung zur Brandlegung mehr sprechen, sondern es lässt sich höchstens sagen, dass der Verbrecher, seiner individuellen Stimmung oder Stellung nach, dieses Mittel einem anderen vorgezogen habe, welcher Umstand in rechtlicher Beziehung keinen wesentlichen Unterschied begründen wird, so wenig als es einen Unterschied macht, dass ein geschickter Schütze es vorzieht, einen Menschen zu erschiessen, als ihn zu erschlagen, wenn er einmal des Vorsatzes zu tödten überwiesen ist.
Dass ein Mensch einen besonderen Geschmack an einem grossartigen Feuer haben könne, ist ganz in der menschlichen Natur gegründet. Jede Feuersbrunst hat an und für sich etwas Erhabenes, und auch für Jedermann etwas Anziehendes. Jeder würde auch dieses Gefühl in sich wahrnehmen, wenn es nicht durch den Anblick des Unglückes der dadurch betroffenen Personen, und durch das Bewusstsein der eigenen Gefahr, seiner Person, seiner Angehörigen und des Eigenthums wieder aufgehoben würde.
Diese Ansicht der Sache ist so wahr, dass ich mich darüber auf das eigene Bewusstsein jedes meiner verehrten Leser zu berufen erlaube.
Es kann nun allerdings Menschen geben, bei welchen diese letzten Rücksichten so in den Hintergrund treten, und vielleicht gar nicht vorhanden sind, dass auf sie blos der Gedanke nach dem Genusse des Schauspieles, welches sie sich durch die Brandlegung verschaffen können, einwirkt.
Da jedoch nicht zu läugnen ist, dass die Vorstellung des Unglücks, welches eine Feuersbrunst mit sich bringt, sich bei jedem nicht ganz geistesschwachen Menschen mit dem Gedanken daran verbindet, so folgt, dass nur Derjenige sich durch eine solche Vorstellung zur Brandlegung wird bestimmen lassen, der entweder wirklich im hohen Grade geistesschwach ist oder an einer Geisteszerrüttung, oder, was das Nämliche ist, an einer Krankheit leidet, welche zuweilen eine Geisteszerrüttung, d. i. einen solchen Zustand zur Folge hat, in welchem er nicht im Stande ist Vorstellungen zu produziren oder festzuhalten, welche die Wirkung der einzigen, welche lebhaft auf ihn einwirkt, hemmen könnte. — Solche Stimmung mag durch den Zustand der Hysterie, Melancholie etc. erfolgen.
Ganz etwas Aehnliches findet bei dem dritten Motive, dem Gedanken an die durch den Brand entstehende Verwirrung Statt, und diese Ansicht der Sache macht es erklärlich, wie ein Mensch nach gelegtem Brande nun selbst thätig löschen hilft, denn diese Mithilfe kann sehr wesentlich mit zu dem ganzen Bilde gehören, welches er sich von seiner That entworfen hat.
200 Die Anwendung und der Nutzen des bisher Gesagten ergibt sich sehr leicht, wenn man den Zweck jeder gerichtlich-medizinischen Erhebung betrachtet, in welcher Beziehung es in dem Falle, wo es sich darum handelt, die Gemüthsverfassung eines Menschen, welcher eine bestimmte That begangen hat, zum Behufe der Bestimmung über die Zurechnungsfähigkeit klar darzustellen, es offenbar nicht gleichgiltig ist, ob man von einer richtigen oder von einer unrichtigen Ansicht ausgeht. Es mag immerhin für Denjenigen, welchem etwas gestohlen oder das Haus angezündet wurde, oder dem man eine Verletzung beibrachte, sehr gleichgiltig sein, warum ihm diese Beschädigung zugefügt wurde, für den Richter, welcher den Thäter bestrafen soll, ist es sehr nothwendig, das Motiv der Handlung genau und richtig zu erfahren. Wird nun von dem Arzte erklärt, es sei die That aus einem besonderen Hange zu gewissen Verbrechen entstanden, so ist diese Erklärung eben so wenig eine genaue, als eine richtige, denn es gibt keinen natürlichen Hang zu Verbrechen, weder überhaupt noch zu speziellen Verbrechen insbesondere, sondern es kann nur einen Hang zu gewissen Handlungen geben, welche unter gewissen Umständen auch als Verbrechen erscheinen können, weil sie sich unter gewissen Umständen nicht ohne Verletzung fremder Rechte in der Art, dass sie dann ein mit einem bestimmten Namen bezeichnetes Verbrechen darstellen, ausführen lassen.
Nimmt man aber diese Ansicht nicht als die richtige an, und bleibt bei jener, wo man von einem Diebssinne, von einem Hange zum Brandlegen spricht, so lauft man Gefahr, entweder Handlungen, die vollkommen zurechenbar sind, als die Folge einer natürlichen unwiderstehlichen Anlage zu erklären, z. B. in dem Falle, wo Jemand eine Idiosynkrasie für eine gewisse Sache besitzt, und sich dieselbe wo er kann zueignet, und nun aus einem anderen Motive eine ganz verschiedene Sache, z. B. eine Summe Geldes stiehlt, oder man erklärt eine Handlung für zurechenbar, d. h. nicht aus einem unwiderstehlichen Drange erfolgt, die im Grunde nach dem Verhältnisse, in welchem sich die Beschaffenheit des Gesammtorganismus eines Menschen zu einer gewissen vorherrschenden Anlage, unter gewissen gegebenen Umständen befindet, für eine freie Handlung, die es im Grunde entweder gar nicht ist, oder doch nur in sehr geringem Grade als eine selbstständige Handlung erscheint, weil man keine solche Anlage wahrnimmt, welche den Menschen als 201 mit dem Diebssinne etc. behaftet darstellt. — Solche Fälle kommen insbesondere bei sehr jugendlichen Verbrechern, bei hysterischen Frauenspersonen, bei Schwangeren etc. vor. Man kann und darf nicht sagen, dass die Jugend oder hysterische Frauenspersonen als solche eine besondere Anlage zum Brandlegen besitzen, denn unter tausend Jünglingen und derartigen Frauenspersonen sind gewiss neunhundert neunundneunzig, denen das Brandlegen nie eingefallen ist, es kann aber Fälle geben, wo — insbesondere vorausgegangene — Beispiele so auf ihre Phantasie wirken, dass sie bei dem wenig entwickelten oder überreizten Zustande ihrer Geisteskräfte sich nicht enthalten können, dem Triebe der Nachahmung zu folgen; sie ahmen hier nach, weil der Effekt der That ihrer Phantasie imponirt und sie sich von diesem Bilde nicht losmachen können. Es ist hier weder Pyromanie noch sonst eine wirkliche Geistesverwirrung, so wenig als bei Demjenigen, welcher gähnt, weil er einen Anderen gähnen sieht, ein besonderer Sinn für das Gähnen.
Will man daher nicht zahllose Sinne für gewisse Handlungen, darunter wieder zahllose unbegründete Ausnahmen annehmen, und dadurch in zahllose Inkonsequenzen verfallen, so muss man nothwendig alle derlei willkürliche Annahmen bei Seite setzen und den Zustand eines solchen Inquisiten vom rein menschlichen Gesichtspunkte in der Art darstellen, dass genau erhelle, was er eigentlich mit seiner Handlung, die nun als Verbrechen erscheint, erreichen wollte. Wo man dieses kann, ist die Aufgabe der Erhebung gelös't, wenn es möglich ist, darzuthun, ob und inwiefern wirklich ein unwiderstehlicher Hang, eben dieses zu wollen, zu Grunde lag, und wo es nicht möglich ist, so tief in seine geistige Thätigkeit einzudringen, um hierüber in's Klare zu kommen, ist es vollkommen unnütz, diese seine Stimmung dadurch zu erklären, dass man ihr eine Benennung gibt, von welcher sich, wie z. B. vom Diebssinne, nachweisen lässt, dass ihr ein reeller Gemüthszustand in der Wirklichkeit nicht entspreche, und dadurch Verwirrung in die Rechtspflege zu bringen.
Derjenige Zustand, in welchem Jemand ein überirdisches Wesen ausser sich zu sehen oder zu hören vermeint, gehört, wie jede andere 202 fixe Idee, in das Gebiet der Pathologie, und ist daher kein Gegenstand der gerichtlichen Arzneikunde.
Irrig wäre es jedoch, ein solches Vorgeben, z. B. dass ein Verbrecher behauptet, eine Gestalt gesehen oder eine Stimme gehört zu haben, welche ihn zur Begehung des Verbrechens aufforderte, geradezu für eine lügenhafte Vorspieglung oder für das Produkt einer krankhaften Verstimmung des geistigen Zustandes eines solchen Menschen zu erklären, da zur Erklärung dieser Erscheinung allerdings noch eine dritte Möglichkeit vorhanden ist.
Man darf nämlich nicht übersehen, dass solche Vorgeben, wenn sie nicht von hysterischen Frauenzimmern oder überhaupt von solchen Personen gemacht werden, an deren normalen Geisteskräften man ohnehin zu zweifeln Ursache hat, doch nur vorzugsweise bei Mord und Brandlegung vorzukommen pflegen. Schwerlich wird noch ein Fall vorgekommen sein, dass ein Verfertiger falscher Wechsel oder ein Taschendieb solche Erscheinungen gesehen oder gehört zu haben vorgibt, oder wenn ein solches Vorgeben bei ähnlichen Verbrechen vorkommt und dasselbe nicht auf einer Lüge beruht, so ist der Grund dazu meistens in dem inneren Kampfe enthalten, den es einen sonst ehrlichen Menschen kostet, ehe er sich zur Begehung eines solchen Verbrechens entschliesst. Nun gibt es aber im Inneren des Menschen zuverlässig einen grösseren Widerstand, ehe sich der Mensch entschliesst, einen persönlichen Angriff auf seinen Nebenmenschen zu unternehmen, oder einen Brand zu verursachen, als irgend etwas zu beginnen, welches weniger den sympathetischen Gefühlen entgegen ist, als ein Mord, der weniger furchtbar auftritt, als eine Feuersbrunst. Es ist also ganz natürlich, dass, so lange ein Mensch mit dem Entschlusse, ein solches Verbrechen zu begehen, umgeht, oder wenn er zur Ausführung schreitet, und endlich gar wenn er das Verbrechen vollführt hat, sein ganzes Wesen und insbesondere seine geistige Thätigkeit in die heftigste Aufregung geräth. — In diesem Zustande werden nun natürlich gewisse sonst im Hintergrunde seiner geistigen Thätigkeit schlummernde Bilder, wenn sie sonst mit Demjenigen, welches er beginnen will, in einigem Zusammenhange stehen, zu einer Lebendigkeit gesteigert, welche es ihm bei dem sonstigen, durch sein der sittlichen Natur widerstreitendes Beginnen verstörten Zustande unmöglich machen, sich von deren Nichtrealität zu überzeugen.
Dies sind längst bekannte Dinge, und auf diese Art werden solche Erscheinungen auch gewöhnlich erklärt, die Erklärung ist auch vollkommen 203 richtig, denn es erklärt sich dadurch auch noch manches Andere, z. B. die nicht seltene Erscheinung, dass Jemand, der eine zur Ausführung des Verbrechens dienende, mit sehr wenig körperlicher Anstrengung verbundene Verrichtung ausübt, sich dabei im Schweisse gebadet fühlt, dass es ihm in einer warmen Sommernacht kalt überläuft u. dgl.
Es gibt jedoch ausser dieser psychologischen noch eine in der That der Aeusserlichkeit angehörige Veranlassung solcher Erscheinungen, die man bei solchen Fällen oft viel zu wenig würdigt, ich meine jene Täuschungen des Gesichtes und Gehöres, denen fast jeder Mensch unterworfen ist, welche auf einer Aehnlichkeit, welche die zufällige Zusammenstellung mancher Gegenstände mit solchen dritten Gegenständen hervorbringt, die wir bereits gesehen, gehört oder uns doch schon vorgestellt haben, beruhen. Betrachtet man z. B. eine einfache oder doppelte Reihe aufgehäufter Garben auf einem Felde in Mondbeleuchtung, so kann man gar nicht umhin, darin eine Prozession verhüllter weiblicher Gestalten, denen ein weites Gewand nachschleppt, zu erblicken; es gehört die feste Ueberzeugung dazu, dass es Garben sind, um nicht an die Wahrheit des Gesehenen zu glauben; hört man einige Personen im richtigen Takte dreschen, und es fällt uns eine Melodie bei, die in diesem Takte spielt, so hört man die Melodie selbst und kann nicht umhin, immer die Melodie fort zu hören, so lange Jene im Dreschen den Takt einhalten.
Bei derlei Dingen kommt es nun vorzüglich auf die Thätigkeit der Einbildungskraft und auf die Bilder an, die darin schlummern und durch solche Zufälligkeiten aufgeweckt werden, ob man etwas sieht oder hört, und was dieses Gesehene oder Gehörte sein soll; es kann sein, dass während der Eine gar nichts sieht, der Andere bereits eine bestimmte Gestalt entdeckt hat und es gar nicht mehr vermag, die wahrgenommene Gestalt nicht mehr zu entdecken.
Ein Beispiel dieser Art ist insbesondere jene Abbildung des Grabmahles eines bekannten Helden, wo innerhalb der Bäume, welche darauf stehen, dessen Schatten erscheint. Hat man diese Schattengestalt einmal herausgefunden, so ist es ganz unmöglich, den Kupferstich oder das Gemälde zu betrachten, ohne diese Gestalt zu sehen, und doch gibt es Leute, welche ungeachtet aller Mühe, die sich ein Anderer gibt, ihnen die Umrisse dieser Schattengestalt zu zeigen, doch nichts sehen, als ein paar Bäume und einen Strauch zwischen ihnen.
Da hier dies Gemälde absichtlich so eingerichtet ist, dass die Schattengestalt sich ausdrückt, so kann man nicht sagen, dass Diejenigen, 204 welche die Gestalt sehen, in einer Täuschung befangen sind, sondern umgekehrt, Diejenigen, welche die Gestalt nicht sehen, sind Diejenigen, welche sich in der Täuschung befinden, dass nichts zu sehen sei.
Was nun hier durch die Kunst geschah, kann auch durch Zufall geschehen. Wer daher in einem solchen Falle eine Gestalt sieht oder einen bestimmten Ton hört, hält daher nicht etwa eine bestimmte Vorstellung für etwas Reelles, sondern er sieht oder hört wirklich, und sein Fehler besteht nur darin, dass er nicht noch andere Sinne zu Hilfe nahm, um sich von der Realität des Gesehenen oder Gehörten, oder von dem Umstande, dass dieses sein Sehen oder Hören nur auf der Täuschung eines einzelnen Sinnes beruhe, zu überzeugen.
Sagt also ein Verbrecher, dass eine Gestalt zur Nachtzeit im Zimmer gestanden sei u. dgl., so liegt daher gar nichts Unmögliches darin, dass er die Gestalt wirklich gesehen habe, weil ihm die Gestalt, d. i. deren Umrisse durch irgend eine Reflexion der Lichtstrahlen wirklich gegeben war, und der Umstand, dass ein Anderer, der vielleicht bei ihm war, dieselbe nicht erblickte, beweiset ganz und gar nicht, dass der Erste diese Gestalt nicht wirklich gesehen haben könne.
Da es nun um so leichter ist, solche Gestalten zu erblicken, je aufgeregter die Phantasie ist, und da ferner gerade der Gedanke an die Ausführung gewisser Verbrechen eine starke Aufregung der Phantasie mit sich bringt, so sind derlei Visionen zuverlässig eine ganz natürliche, ohne Krankheit des Geistes mögliche, subjektiv richtige Thatsache.
Von dieser Seite betrachtet erklärt sich Manches vollkommen, wozu man ohne Berücksichtigung dieser Thatsache vergebens den Schlüssel sucht, insbesondere manche Geistererscheinung.
Folgender Fall gehört offenbar in die Klasse dieser Thatsachen.
Der Sohn eines Bauers hatte seinen Vater ermordet, um sich einen Beutel mit Geld zuzueignen, den dieser in seiner Truhe hatte. Er wurde alsbald nach verübter That ergriffen, und gestand sein Verbrechen mit allen Nebenumständen; obwohl jedoch nicht die geringste Spur einer Geisteszerrüttung an ihm wahrzunehmen war, so gab er doch in Bezug des Geldbeutels an, dieser sei, als er die Truhe öffnete und darnach greifen wollte, davongelaufen und dann verschwunden, und bei dieser Behauptung blieb er, ungeachtet aller gemachten Gegenvorstellungen.
Sollte hier nicht etwas Aehnliches eingetreten sein? Der Beutel konnte nun wohl nicht davonlaufen, allein es konnte der Fall sein, dass nicht der Beutel, wohl aber eine Ratte oder eine Maus in der Truhe war, die 205 er in seiner Aufregung bei dem ersten Blicke, den er auf die Truhe machte, für den Beutel hielt, und die davon lief, als die Truhe geöffnet wurde; seine Angabe, dass der Beutel davonlief, war dann subjektiv richtig.
Schwerer, als solche Irrthümer durch den Gesichtssinn, sind indess dergleichen Irrthümer durch den Gehörssinn möglich, obgleich es leichter ist, durch das Gehör als durch das Gesicht getäuscht zu werden.
Der Gesichtssinn ist nämlich immerwährend thätig, man sieht niemals nichts, sondern nur ein Blinder sieht nicht. Wenn man die Augen zumacht oder in einem Gemache ist, wo kein Licht brennt und keine Fenster sind, so sieht man die Finsterniss, man sieht schwarz. Hört man aber nichts, so hört man auch nicht, und zwar so lange nicht, als nicht das Trommelfell durch einen Schall affizirt wird; man hört etwas, es ist aber möglich, dass man nicht unterscheide, mit welcher Art von Tönen das Gehörte Aehnlichkeit habe, oder dass man durch die Aehnlichkeit der Töne verleitet wird zu glauben, eine gewisse Art Schall gehört zu haben. — Dieser Mangel an Unterscheidung kann jedoch nur so weit reichen, als der durch den Schall hervorgebrachte Ton selbst unbestimmt auf das Ohr wirkt, und kann daher nur von einem ebenfalls unbestimmten Tone nicht scharf unterschieden werden, man kann z. B. im Zweifel sein, ob Dasjenige, was man hört, der Ton einer Trommel oder das Rauschen eines Wassers, der Pfiff eines Windes oder der Ruf einer Stimme sei, schwerlich aber ist eine solche Verwechslung eines Klanges mit einzelnen gesprochenen Worten möglich. Wenn also Jemand z. B. behauptet, im Gesange eines Vogels gewisse Worte gehört zu haben, so lässt sich diese Erscheinung wohl nur durch einen sehr hohen Grad wahrscheinlich krankhafter Aufregung der Einbildungskraft erklären, wenn der Vogel, welcher Worte gesprochen haben soll, nicht etwa ein Guckguck, welcher nichts Anderes als seinen Namen rief, oder ein abgerichteter Papagei gewesen ist. Man kann in Gegenständen, welche klingen, mit einer nicht krankhaften Einbildungskraft wohl musikalische Töne, auch wohl Melodien, nicht aber Worte wirklich hören, denn wenn Schiller sagt:
so glauben wir gerne seinen Worten; wäre es möglich gewesen, dass der Dichter gesagt hätte: da sprach die Quelle, oder gar, was sie gesprochen, so würde man das Gedicht wahrscheinlich nicht weiter lesen, denn Niemand würde es ihm glauben.
206 Hieraus folgt, dass in dem Falle, als ein Beschuldigter behauptet, irgend eine ausserordentliche Erscheinung gesehen zu haben, und wenn sonst keine Spuren einer Geisteszerrüttung an ihm wahrzunehmen sind, die Wahrscheinlichkeit für eine wirkliche, durch eine zufällige Aehnlichkeit hervorgebrachte Wahrnehmung, dagegen bei gehörten Worten die Wahrscheinlichkeit für eine verstörte Einbildungskraft einträte, und zwar in dem Grade mehr für eine krankhafte Störung, als der Beschuldigte die Worte bestimmt gehört zu haben behauptet, und nicht etwa selbst im Zweifel ist, ob er sie auch wirklich gehört habe.
Es ist indess nicht unmöglich, dass Jemand etwas, welches ihm im Augenblicke des Sehens oder Hörens eine auffallende Aehnlichkeit mit irgend einem bereits Gesehenen oder Gehörten darbot, in diesem Augenblicke nicht wirklich für etwas Reelles hält, später aber durch seine Einbildungskraft verleitet wird, zu glauben, dass Dasjenige, welches ihm im Augenblicke des Sehens oder Hörens nicht als etwas Wirkliches vorkam, doch etwas Wirkliches gewesen sei. Gibt es doch Leute, die, wenn sie irgend eine Begebenheit mit einer Menge Uebertreibungen einige Mal erzählt haben, am Ende selbst glauben, es sei dabei wirklich gerade so zugegangen, wie sie die Begebenheit Anderen zum Besten geben. Ich selbst hörte einmal mit grösstem Vergnügen der Erzählung eines alten Soldaten zu, der behauptete, er sei einmal schon todt gewesen. Das Wahre an der Sache schien zu sein, dass er nach einer erhaltenen Wunde in der Schlacht sich todt stellte und wahrscheinlich einige Zeit lang das Bewusstsein verloren hatte.
Derlei Spiele der Einbildungskraft sind nun aber ebenfalls nicht selten, und es können dadurch, besonders wenn Derjenige, welcher sie vorbringt, abergläubisch oder sonst auf einer geringen Stufe der Bildung befindlich ist, manchmal von ihm Dinge, als von ihm wirklich erlebt, behauptet werden, welche, wie man glauben sollte, nur einem Tollhäusler beifallen können, ohne dass derselbe deswegen wirklich an einer Geisteszerrüttung leidet.
Es folgt daher, dass, wenn derlei Erscheinungen von Beschuldigten behauptet werden, deren Nichtrealität jedem Vernünftigen klar ist, man deswegen allein noch nicht Ursache hat, eine Geisteszerrüttung vorauszusetzen, sondern dass man vielmehr trachten muss, diejenigen Verhältnisse, welche derlei Angaben bei dem Beschuldigten zur subjektiven Wahrheit machten, zu erheben, und so viel als möglich richtigzustellen, welches einerseits dadurch geschehen kann, dass man die Lokalumstände, 207 unter welchen derlei Erscheinungen Statt gehabt sollen, sorgfältig untersucht, andererseits aber den sonstigen Charakter eines solchen Individuums, z. B. ob er sonst in seinen Angaben von der Wahrheit abzuweichen pflegt, ob er abergläubisch und in welcher Art abergläubisch ist, oder ob er sich einer besonderen Leichtgläubigkeit hingibt u. dgl., durch Vernehmungen von Zeugen u. s. w. darzulegen sich bestrebt.
Der verstellte Wahnsinn ist eben so wenig ein Wahnsinn, als eine verstellte Krankheit ein besonderer pathologischer Zustand ist, sondern diese Verstellung ist eine aus freiem Willen hervorgebrachte That, so gut als das Spielen einer Rolle auf dem Theater. Ob nun ein Zustand, welcher im Aeusseren die Thätigkeiten des Wahnsinnes nachahmt, ein wahrer oder ein verstellter sei, wird im Wesentlichen nach pathologischen Grundsätzen beurtheilt werden müssen, nämlich ob sich derjenige Komplex von Erscheinungen darbiete, welcher nach pathologischen Erfahrungen immer vereinigt angetroffen wird; ausserdem muss ein solcher Zustand auch nach denjenigen Grundsätzen beobachtet werden, welche sich aus der Natur der Sache ergeben, um überhaupt eine Verstellung zu entdecken.
Die erste Rücksicht, welche man daher bei Erhebung eines solchen Zustandes zu nehmen hat, wird daher wohl immer darin liegen, ob alle Erscheinungen vorhanden sind, welche die Pathologie als einen solchen abnormen Zustand begleitend entdeckt hat, ergibt sich aber dann noch ein Zweifel, oder lässt sich die Möglichkeit denken, dass der Zustand, welchen der vorgebliche Patient äussert, ihm zu einem bestimmten Zwecke dienen könne, so muss nachgeforscht werden, ob der Zustand schon früher vorhanden war, als er den in Frage stehenden Zweck anzustreben begann, oder nicht. Ist Letzteres der Fall, so entsteht jedenfalls der Verdacht einer absichtlichen Täuschung, welche Voraussetzung auch dann viele Wahrscheinlichkeit erhält, wenn der Zustand selbst ihm irgend einen Vortheil, z. B. die Erhaltung einer Versorgung, zu gewähren verspricht.
Je mehr nun von dieser Art Gründe eintreten, um eine Verstellung für wahrscheinlich zu halten, um so genauer muss die pathologische Beobachtung sich gestalten, es erhalten aber überhaupt alle diejenigen Personen, 208 welche die Umgebung eines solchen in gerichtlicher Untersuchung befindlichen Menschen bilden, die Aufgabe, ihre Beobachtung dahin zu richten, jeder Verstellung auf die Spur zu kommen, wozu folgende Rücksichten nicht unerheblich sein dürften.
Jede Krankheit, wohin auch der Wahnsinn gehört, ist ein Originalzustand, d. h. der Mensch braucht, um die verschiedenen Aeusserungen und Symptome der Krankheit darzustellen, nicht etwa ein besonderes Nachdenken oder einen besonderen Entschluss, sondern alles dieses lernt sich ohne alle Bemühung von selbst; dagegen ist jede Verstellung eine Nachahmung, welche, wie alle Nachahmungen, entweder hinter dem Originale zurückbleibt, oder gewisse Seiten des Originals verzerrt. — Wer übrigens nicht ein vollendeter Künstler ist, wird mehr oder weniger in einem solchen Falle ein bestimmtes Original kopiren.
Hat man daher den Fall eines wahrscheinlich verstellten Wahnsinnes, so forsche man nach, ob das Individuum, bei dem man die Verstellung vermuthet, nicht etwa in der Lage war, ein ähnliches Original beobachtet zu haben. Findet man diesen Umstand bestätigt, so suche man sich nähere Notizen über das fragliche Original zu verschaffen, und bringe den Ersteren dann in Lagen, zu denen ihm sein Original nicht gesessen ist. Sehr möglicher Weise wird er aus der Rolle fallen. — Solche Originale können übrigens sowohl wirklich lebende Personen, als solche sein, welche aus Büchern entnommen sind, man frage daher bei gewissen Personen sein Gedächtniss, ob man nicht etwas Aehnliches irgendwo gelesen habe.
Verstellung ist wie jede der Individualität nicht angemessene Thätigkeit etwas Lästiges für den Menschen, ein unbequem anliegendes Kleid, das man auszieht, wenn man schlafen geht. Man beobachte daher ein solches Individuum vorzüglich zu der Zeit, wo er sich unbemerkt glaubt, ob er nicht eine Blösse gibt.
Wer Wahnsinn oder eine andere Krankheit simulirt, hat gewöhnlich einen für ihn wichtigen Zweck. Je wichtiger dem Menschen eine Sache ist, um so mehr vernachlässigt er Kleinigkeiten, die mit der Sache, um die es sich handelt, nichts zu schaffen haben. Man beobachte daher Kleinigkeiten, in denen sich seine Thätigkeit ausspricht50. Wenn 209 man in dieser Art seine Beobachtungen fortzusetzen nicht ermüdet, wird man selten seinen Zweck verfehlen und nicht nöthig haben, seine Zuflucht zur Anwendung von schmerzhaften Mitteln zu nehmen, die zur Richtigstellung des Verdachtes nie gebilligt werden können51.
Eben so verdient der Umstand Berücksichtigung, dass der sich Verstellende seine Verstellungskunst nicht selten gegenüber von Personen zu üben unterlässt, welchen er nicht Scharfsinn oder Interesse genug zutraut, ihn zu beobachten. Man unterlasse daher nicht, solche Personen, wozu insbesondere Kinder gehören, wo es nöthig ist, zu seiner Beobachtung zu benützen.
Obwohl ich nicht im Mindesten zweifle, dass sich über einzelne Gemüthszustände noch Vieles und Nützliches sagen lasse, so dürfte doch das bisher Gesagte genügen, um anzudeuten, worauf es bei der Erhebung gewisser Gemüthszustände in rechtlicher Beziehung eigentlich ankomme. Eine vollständige Exemplifikation zu liefern, in welcher zugleich eine vollkommene praktische Anweisung enthalten wäre, wie in einzelnen Fällen diese Aufgabe zu lösen ist, überschreitet die Grenzen dieses Werkes um so mehr, als hierzu die Anwendung medizinischer Kenntnisse nöthig wäre, die ich nicht besitze; ich kann mir daher nur die Bemerkung erlauben, dass in vorkommenden Fällen, wo sich ergibt, dass mehrere solcher von mir geschilderter Gemüthszustände thätig waren, auch alle diejenigen Grundsätze, welche ich in Bezug auf die einzelnen derartigen Gemüthsstimmungen schilderte, Anwendung finden werden. Mein Zweck, den ich bei diesen Erörterungen verfolgte, war, wie es sich von einem 210 Autor voraussetzen lässt, welcher für einen solchen Leserkreis sich zu schreiben berufen fühlt, wie von jenen, für welchen dieses Werk bestimmt ist, nicht, eigenes Nachdenken überflüssig zu machen, sondern im Gegenteile dieses zu veranlassen und höchstens zuweilen die Bahn zu bezeichnen, auf welcher die eigene Forschung ihr Ziel verfolgen muss, um nicht auf Abwege zu gerathen.
Mehr also, um dem Leser die Beruhigung zu geben, dass der von mir angedeutete Weg wirklich zu dem richtigen Ziele führe, als in dem Bestreben, dadurch dem Leser ein Muster zu geben, wie er sich in praktischen Fällen zu benehmen habe, erlaubte ich mir die drei nachfolgenden, durchaus wirklichen Kriminalakten entnommenen Fälle mitzutheilen.
Der erste Fall mit dem wahnsinnigen Brandstifter Joseph G. ist in mancher Beziehung auf eine ungenügende Weise erhoben. Ich erlaubte mir die Fehler zu rügen und die Gründe beizusetzen, warum und worin gefehlt wurde, und wie ähnliche Missgriffe zu vermeiden sind. — Der zweite Fall, unstreitig von Seite des Untersuchungsrichters ohne Tadel geführt, lässt von Seite der ärztlichen Begutachtung viel zu wünschen übrig; ich bestrebte mich, zu zeigen, wie es, wenigstens nach meiner geringen Einsicht, hätte besser gemacht werden können.
Der dritte Fall, mit Matthäus Grotz, ist von Seite des Richters sowohl als von Seite des Arztes mit solcher Umsicht und solcher Sachkenntniss behandelt, dass er in der That als Muster zur Nachahmung empfohlen zu werden verdient.
Der vierte Fall gehört der neuesten Zeit an.
Am 27. Jänner 1810 machte der Ortsseelsorger im O—thale dem grundherrlich von G.'schen Amte zu G. folgende Anzeige: „Joseph G. ist mir längst als ein bösartiger und gefährlicher Narr bekannt, ich brachte 211 ihn nun durch Zureden und kleine Geschenke dahin, ihn geschwätzig zu machen, und da vertraute er mir, dass er
1. seiner Mutter eigenes Haus durch in Lumpen gewickeltes Feuer angezündet habe. Eben so wurde
2. das Berghaus des Nachbarn Lorenz S., in welchem seine Mutter nachher mit den Kindern aus Barmherzigkeit aufgenommen wurde, von ihm angezündet;
3. seien es noch nicht vier Wochen, so hat er wieder im Sinne gehabt, einen oder zwei Bauernhöfe anzuzünden, welches ihn aber jetzt reue, so dass er versichere, es nie thun zu wollen.
Da jedoch der Versicherung des Joseph G. bei seinem Geisteszustände nicht zu trauen sei, so werde, um Unglück zu verhüten, das Amt hiervon in Kenntniss gesetzt.”
G. wurde nun am 29. Jänner zu Verhaft gebracht. Es ergab sich, dass wirklich das Haus der Mutter des Joseph G. im Jänner 1803, und ungefähr vier Wochen darauf das Berghaus des Lorenz S. (am 19. Februar 1803) abgebrannt sei. — Beide Brände hatten sich daher schon vor sieben Jahren ereignet. Joseph G. wurde übrigens als Dasjenige Individuum erkannt, welches das Amt X. bereits in das Irrenhaus unterzubringen versucht habe.
Joseph G. wurde nun verhört, da jedoch seine Aussagen nur summarisch eingetragen wurden, so genügt die Anschauung des wesentlichen Inhaltes desselben, welcher in Folgendem bestand:
Joseph, seinen Zunamen wusste er nicht anzugeben, Sohn des Webers Michael, welcher ein vagabundirendes Leben führt, und dessen Eheweibes Johanna, lebt in dürftigen Umständen. In der Schule hat er nichts gelernt. Er hat an ein paar Orten gedient, war aber wieder fortgerannt, er sei ledig, habe, wenn es sein konnte, gebettelt. Er habe Niemanden etwas gestohlen. Zu A. habe er sich in den Bach gelegt, um sich zu ersäufen, die Bauern haben ihn wieder herausgethan. Einmal hat er sich in dem Hause des H. im J—thale gehängt, ein altes Weib hat ihn wieder losgemacht, zwei Knechte haben ihm gesagt, dass er sich hängen soll. Als er einmal in Z. aus der Kirche kam, hat er sich wieder gehängt, die Leute haben ihn herabgenommen. Das Leben sei ihm ganz verleidet gewesen, weil sein Bruder, der Weber Hanns, so mit seiner Mutter und ihm umgeht und sie schlägt.
Ueber die Feuersbrünste äusserte er sich in einem späteren Verhöre, dass er den ersten Brand um die Mittagszeit angelegt habe, nachdem sich 212 sein ältester Bruder Johann entfernt hatte; den Brand habe er mit brennenden Kohlen gelegt, die er unter einem Hafen in der Küche hervorgenommen und in einen Lumpen gewickelt, welchen er schon am Morgen zu diesem Zwecke zu sich gesteckt, in das neben dem Hause befindliche Stroh warf. Dieses fing sogleich an zu brennen. Seine Mutter ergriff die Flucht, er aber blieb, ungeachtet ihres Zurufes, zurück; er hatte, wie er sagte, eben Lust zu verbrennen, da ihm aber seine Mutter zurief, so fiel ihn die Reue an, er änderte deshalb seinen Entschluss und sprang aus dem Hause fort. Er half seiner Mutter jedoch nicht, als sie ein Schwein aus dem Stalle rettete, da er, nach seiner Angabe, zu erschrocken war, weil er das Haus angezündet hatte.
Frage: Warum er das Haus angezündet habe.
Antwort: Ich zündete es aus dem Grunde an, damit mein ältester Bruder das Haus nicht bekomme, da dieser mich und die Mutter misshandelt hatte.
Frage: Ob er nicht bedacht habe, dass er durch das Anzünden des Hauses seine Mutter selbst unglücklich mache.
Antwort: Es fiel mir freilich bei, aber der Zorn gegen meinen Bruder wegen den von ihm erlittenen Misshandlungen überwog den Gedanken.
Frage: Ob er nicht bedachte, dass er sich durch das Anzünden, dadurch dass seine in der Kiste der Mutter verwahrten Kleider auch mit verbrannten, selbst schade.
Antwort: Dieses fiel mir zwar auch ein, aber ich that es doch, wie schon gesagt, in Hinsicht meines Bruders.
Joseph G. war indess wegen Mangel an Gefängnissen (freilich ein etwas sonderbarer Mangel bei einem Kriminalgerichte) einem Bürger in Verwahrung gegeben worden. — Am 26. Februar wurde das Verhör wegen des Brandes im Berghäuschen gehalten. — Seine Angabe bestand in Folgendem:
„Ich legte im Berghause zweimal Feuer an. Es war schon finstere Nacht, als ich allein in der Küche war und auf Geheiss meiner Mutter Suppe kochen musste. Bei dieser Gelegenheit fiel mir mein Bruder, der Johann, ein, und ich dachte: „Wart', Bruder, nun will ich das Berghaus anzünden, damit du nicht mehr hinein und mich d'rin schlagen kannst.” Aus Zorn gegen meinen Bruder Johann steckte ich in der Stube kurz vorher einen Lumpen, ohne dass es meine Mutter bemerkte, in den Hosensack, und in der Küche ergriff ich in aller Eile aus dem Ofen, worin ich die Suppe kochte, eine feurige Kohle; wickelte sie in den Lumpen und 213 warf sie augenblicklich durch den Rauchfang, welcher nur sechs Schuh vom Boden der Küche entfernt war, auf das Dach. Diese Kohle zündete aber das Haus nicht an, weil sie nur neben demselben auf die blosse Erde fiel. Der Bruder Christian hatte die Kohle hinabfallen gesehen, und auf seinen Ruf lief ich auch hinaus und half ihm die Kohle auslöschen. — Am anderen Tage, als ich allein zu Hause war, nahm ich wieder eine Kohle aus dem Ofen und steckte sie, in einen Lumpen gewickelt, in das Strohdach. — Um keinen Verdacht zu erregen, sprach ich mit meinem Bruder Mathes gleichgiltige Sachen; als ich aus der Nebenkammer das Feuer aufgehen sah, rief ich dem Mathes zu: „Komm, Mathes, es brennt.” — Ich half nun dem Mathes beim Heraustragen der Kleider, weil es mich reute, dass ich das Berghaus angezündet hatte. Indessen kamen Leute herbei — die Hilfe war jedoch vergebens.”
So weit die Erzählung des Joseph G. über seine Thaten, mit welcher die Erhebungen des Gerichtes über den Statt gefundenen Vorgang ziemlich übereinstimmten.
Am 20. März 1810 fand noch ein Verhör Statt, aus welchem wir folgende Fragen und Antworten herausheben:
Frage: Warum er diese Brandstiftung so lange verschwiegen habe.
Antwort: Weil ich fürchtete, in's Zuchthaus zu kommen.
Frage: Er habe angegeben, dass ihn der erste Brand sehr gereut habe, warum er gleich darauf den zweiten gestiftet habe.
Antwort: Mein Bruder Johann hat mich eben in diesem Berghause geschlagen, und darum nahm ich es mir aus Zorn gegen denselben vor, damit er nicht mehr dahinkomme53.
Frage: Ob er nicht gewusst habe, dass die Brandstiftung ein schweres Verbrechen ist.
Antwort: Ja.
Frage: Warum er es doch begangen.
Antwort: Hätte mein Bruder mich nicht geschlagen, die beiden Häuser stünden noch.
Frage: In welcher Gemüthsstimmung er gewesen sei, als er sich habe erhängen wollen.
Antwort: Ich war damals nicht bei Sinnen und wusste nicht, 214 was ich that. Als ich hingegen das Haus meiner Mutter und das Berghaus anzündete, war ich meiner Handlungen wohl bewusst54.
Frage: Warum er sich schon zu wiederholten Malen habe umbringen wollen.
Antwort: Das Leben ist mir eben verleidet, wenn ich mit meinem bösen Zustande befallen werde, und ich komme dann gewöhnlich ganz von Sinnen.
Frage: Was er zu seiner Entschuldigung und Rechtfertigung anzugeben habe.
Antwort: Ich weiss nichts anzugeben, als dass mich mein Bruder Johann durch seine Misshandlungen zum Zorne gereizt hat.
Am 22. März registrirte das Kriminalgericht ein Attestat des Physikus zu den Akten, worin gesagt wird, dass Inquisit sowohl in physischer Hinsicht ohne Gebrechen und Krankheit sei, als auch in einem dreiviertelstündigen Tentamen55 seine inneren Sinne unverletzt56 und dermal ohne Fehler gefunden worden seien57. — Hierauf wurde der Akt dem Obergerichte zur Urtheilsschöpfung vorgelegt58.
Am 14. September 1810 erstattete der dortige Referent seinen Vortrag, und stellte sich zur Ausmittlung der Zurechenbarkeit des Inquisiten und Bemessung der Strafe folgende Fragen:
a) Ist Inquisit wahnsinnig?
b) Ist er es anhaltend oder nur zeitlich?
c) War er es, als er die erwähnten Brände theils veranlasste, theils versuchte59?
d) In welcher Geisteslage hat er seine Geständnisse abgelegt?
215 Ad a) und b) deponirt die Mutter des Inquisiten hierüber Folgendes: Ja, es ist wahr, zu Zeiten ist er ganz von Sinnen, und besonders wenn der Frühling anrückt; zu Zeiten ist er ganz bei Sinnen, wie jeder andere gesunde Mensch; und
dieser mein Sohn war schon von Kindheit an mit dieser Krankheit behaftet, und je älter er wurde, um so mehr hat sie zugenommen.
Eben so sagt Johann G., Bruder des Inquisiten: Er ist mit dieser Krankheit bereits von Jugend auf behaftet, er wird aber nur zu Zeiten damit befallen, wo er sich dann bald erstechen, bald erhängen will60, und zu anderen Zeiten ist er wieder ganz bei sich, spricht sodann ganz vernünftig und führt sich ordentlich auf.
Eben so sagt der zweite Bruder des Inquisiten: Er selbst sagt: Das Leben ist mir halt verleidet, wenn ich mit meinem bösen Zustande behaftet werde, und ich komme gewöhnlich bei demselben ganz von Sinnen.
Und dann wieder: Ich that solches (d. i. ich wollte mich erhängen oder ersäufen), wann ich mit dieser Krankheit behaftet wurde.
Hieraus ergibt sich nun nach der Ansicht des Referenten, dass eine chronische Geistesabwesenheit, ein Wahnsinn, eine Verrücktheit des Inquisiten nicht zweifelhaft sei61.
Ad c) Ungeachtet dieses Umstandes kann es jedoch (nach Ansicht des Referenten) nicht zweifelhaft sein, dass er die Brände frei von einem solchen Zustande nicht nur verübt und versucht, sondern auch einbekannt habe. Weder die Mutter noch die Brüder des Inquisiten wollen Spuren des Wahnsinnes bei ihm entdeckt haben, als die Brände Statt hatten62, und er, der seinen gesunden von seinem kranken Zustande 216 wohl zu unterscheiden weiss (?), gesteht, dass er jede dieser Brandlegungen mit Wissen und Willen, ohne von seinem sonstigen Paroxismus etwas zu spüren, verübt habe. Er gibt sogar das Motiv seiner That — Hass gegen seinen Bruder — an63.
Die Art selbst, wie er seine Entschlüsse ausgeführt, enthält die deutlichsten Beweise von Ueberlegung und Vorsatz64 mit Beseitigung alles dessen, was den Verdacht auf ihn leiten konnte.
Ad d) Inquisit hat ferner die vollkommene Erinnerung alles dessen, was er gethan. Wahnsinn hat aber keine Erinnerung65. Auch entwickelte er, nach dem Zeugnisse des Untersuchungsrichters, bei Ablegung des Geständnisses nicht die mindeste Geisteszerrüttung.
Das Zeugniss des Amtsphysikus setzt den sowohl physisch als psychologisch gesunden Zustand des Inquisiten vollends ausser allen Zweifel66.
Der Inquisit sei also für zurechnungsfähig, und in Betreff des Geständnisses für geistesfrei zu halten, und daher nur insofern einer Strafmilderung würdig, als er bei Verübung der Verbrechen kaum das fünfzehnte Jahr überschritten hatte.
Die Selbstmordversuche seien zu umgehen, eben so wie die geäusserten Vorsätze, die Höfe des Schultheissen in M. anzuzünden, weil die Ersteren nur polizeilich, die Letzteren aber gar nicht strafbar seien, da keine äussere entsprechende Thätigkeit sie begleitete.
Der Referent trug auf dreissigjährige Zuchthausstrafe mit Willkomm' und Abschied (d. i. Prügel und Schläge) an.
217 Das Kollegium konformirte sich jedoch mit dem Antrage des Referenten nicht, sondern verordnete:
1. Die Lebensweise des Inquisiten von seiner frühesten Jugend bis zu seiner Verhaftung durch glaubwürdige Zeugen zu Protokoll zu bringen67.
2. Die Selbstmordversuche näher zu erheben.
Dies geschah nun.
Ad. 1. Erklärten die Vorgesetzten von G., dass Joseph G. gewöhnlich alle Monate einmal vom Wahnsinne befallen worden, und dieser habe dann immer einige Tage über angehalten. In diesem Zustande sei er auf Bergen und in Wäldern herumgelaufen und habe wie ein Vieh gebrüllt. Mitunter habe er sich in seinem Wahnsinne auch geäussert, dass er sich hängen wolle, den Teufel gerufen, dass er ihn holen solle, und Gott gelästert, dass er ihn nicht sterben lasse. Im gesunden Zustande habe er wenig gegessen und sei arbeitsam und ordentlich gewesen. Am stärksten habe ihn der Wahnsinn im Frühling und Herbste befallen.
Die nächsten Nachbarn erklärten Aehnliches.
Der Schulmeister gab an: Der Joseph G. war sehr unfleissig und lernte kaum die Buchstaben kennen. So lange er die Schule besuchte, war er meines Wissens nicht krank, aber ein einfältiger Bursche und boshaft gegen die übrigen Schulkinder. Einen Wahnsinn bemerkte ich an ihm nicht. Vor ungefähr drei Jahren kam er einmal zu mir und trug einen Strick und Brodsack bei sich; ich fragte ihn, was er mit dem Stricke wolle, worauf er sagte, ich will mich hängen, weil mich Gott nicht sterben lassen will, wenn mich nur der Teufel holte. Der Joseph G. ist ein wahrer Schalksnarr68, setzte der Schulmeister bei.
Die Mutter des G. fügte zu ihren früher erwähnten Angaben noch bei, sie vermuthe, dass er die Krankheit mit auf die Welt gebracht habe, denn als sie mit ihm schwanger ging, war sie wegen der gräulichen Schulden ihres Mannes sehr melancholisch, und hatte noch besonders vielen Kummer und Verdruss darüber, dass ihr Mann öfters äusserte, er wolle sich hängen.
Der Pfarrer aus G. sagte, Joseph G. habe sich in der Schule sehr 218 halsstärrig und boshaft gezeigt, so dass weder Ermahnungen noch Schläge bei ihm gefruchtet haben. Er habe durchaus keine Empfänglichkeit für den Unterricht gezeigt. So lange er denselben kenne, sei er wahnsinnig gewesen und habe vorzugsweise die Neigung blicken lassen, Anderen zu schaden, wogegen weder Drohung noch Strafe gefruchtet hätten, er könne sich jedoch einzelner Handlungen der Art nicht mehr erinnern. Uebrigens habe er bei der Mutter des Joseph G. ähnliche Zufälle bemerkt69, welches wahrscheinlich ihren Mann verleitet habe, sie zu verlassen.
Die Erhebungen über die Selbstmordversuche liefern folgende Resultate:
1. Wegen dem Erhängen im Buchenwalde im U—thale konnte nichts erhoben werden, da die Zeugen, welche den Vorfall gesehen hatten, nicht mehr aufzufinden waren.
2. Wegen dem Erhängen im J—thale erklärte die alte Frau Katharina S.: der Joseph G. heischte bei ihr ein Almosen, die Knechte entgegneten ihm hierauf, ob er seinen Haftpfennig schon habe, worauf er sagte: Nein, das Leben ist mir verleidet. Aus Narrheit entgegneten ihm hierauf die Knechte, er solle sich hängen, dort an der Wand hänge ein Strick. Er nahm diesen Strick machte ihn an den Nagel fest und liess sich wieder herab. — Ich zankte nun mit den Knechten, und warnte den Joseph G., von seinen Streichen abzulassen, allein er trieb sein Wesen fort. Endlich kam ihm jedoch der Strick zu nahe, so dass ihm Blut aus der Nase floss. Als ich dieses sah, nahm ich eine Ofengabel und ging zankend damit auf ihn los. Auf dieses machte er sich vom Stricke los, sprang vor den Spiegel und lachte laut, ich aber trieb ihn zum Hause hinaus. Im Fortgehen jauchzte er hell auf70.
3. Wegen dem Erhängen in Q. ergab es sich, dass er keineswegs schon gehangen sei, sondern angetroffen wurde, als er an dem herabgezogenen Aste eines Apfelbaumes ein Seil angemacht und es sich um den Hals geschlungen hatte. Noch hielt er den Ast mit der Hand fest. Hätte er ihn losgelassen, so hätte der Ast ihn aufziehen und ihm Schaden thun können. Die Zeugen riefen ihm zu, er solle sich losmachen, sonst bekomme er Schläge, und so machte er das Seil von seinem Halse und nachher von dem Aste los.
219 Die auf solche Art vervollständigten Akten legte das Kriminalamt am 10. November dem Obergerichte vor, an welches indess von der Verwaltung des Zuchthauses, in welches Joseph G. einstweilen untergebracht worden war, folgender Bericht erstattet wurde:
„Vom Anfange seiner Einlieferung bis auf die Zeit, wo die Verwaltung ihn durch Geldversprechung zum Arbeiten bestimmte, staunte Joseph G. mit verirrten Augen vielmal und oft halbe Stunden lang an einen gewissen Punkt hin, ohne Jemand gewahr zu werden, bis man auf ihn zulief und ihn anredete, dann gab er, wenn man ihn anredete, weiter keine Antwort als Ja und Nein. Wollte man von ihm etwas wissen, so musste man ihn von Wort zu Wort auf seine Reden helfen, denn er scheint das Gedächtniss nicht zu besitzen, dass er eine Konstruktion ordentlich nach einander hersagen könnte.”
„Oefters, und besonders wenn der Mond wächst, verlässt ihn seine wenige Heiterkeit, und er verfällt in eine Art Trübsinn und Hypochondrie, in welcher er sich zu entleiben wünscht.”
„Eines Tages vor ungefähr fünf Wochen war er ebenfalls des Lebens müde, lief geradezu an den mitten im Zimmer stehenden Pfosten, woran ein für die Züchtlinge bestimmtes Messer zum Brotschneiden an Ketten befestigt hängt, setzte es an die Kehle und wollte eben zuschneiden, als glücklicherweise ein anderer Gefangener es gewahr wurde, und ihm noch zur rechten Zeit das Mordinstrument entwand.”
„Ein anderes Mal fällt ihm ein, dass er durch Hungerleiden sein Leben verkürzen wolle, und er ass auch wirklich mehrere Tage nichts, bis ihn der Hunger überwältigte und er der Natur nicht länger mehr Trotz bieten konnte.”
„Sein Verhalten ist übrigens ruhig, gerade wie bei Kindern beschaffen, welche bei Spielsachen sich aufhalten und die Zeit vertreiben können, oder durch Versprechungen und Schenkungen Alles von sich erzwecken lassen. So z. B. findet er sein grösstes Vergnügen mit Glinkern oder Rieblingen, welche er unter Tages bei sich trägt und während des Schlafes unter seinem Kopfe verwahrt. Die Verwaltung konnte ihn übrigens blos durch Schenkung einiger Kreuzer zum Wollschlumpen vermögen, die er in guter Verwahr zu seinen Glinkern legt.”
„Uebrigens ist und bleibt Joseph G. ein äusserst blödsinniger, einfältiger und sinnloser Mensch.”
Das Obergericht trug nun dem Lokalbeamten auf, in Gegenwart des Medizinalreferenten mit G. noch einige auf dessen Seelenzustand passende 220 Verhöre vorzunehmen, wonächst dann der Medizinalreferent mit seinem Gutachten sowohl über diese Verhöre als über das in den Akten71 über den Gemüthszustand des Joseph G. Vorkommende zu hören sei.
Die ernannten Kommissarien fanden es, wie sie in ihrem Protokolle vom 28. Hornung 1811 bemerkten, nothwendig, das zu untersuchende Subjekt hinsichtlich seiner Fassungskraft kennen zu lernen, um sich bei der Wahl der Materie der an ihn zu stellenden Fragen darnach richten zu können72. Man liess ihn also vorführen: er war heiter, seine Mienen, Gestikulationen und die Art sich auszudrücken73 zeigten jedoch einen höchst einfältigen, blödsinnigen Menschen. Ueberhaupt zeigte er den niedersten Grad des Erkenntnissvermögens, und man abstrahirte hieraus die Nothwendigkeit, in der Wahl der Verhörsmaterialen zu den einfachsten Begriffen herabzusteigen und nur nach und nach sich Begriffen zu nähern, aus welchen auf eine grössere Denkkraft des Inquisiten geschlossen werden könne74. Uebrigens glaubte man sich über solche Gegenstände verbreiten zu müssen75, welche über die im gewöhnlichen Leben vorkommenden, sodann über die religiösen und moralischen Begriffe des Inquisiten, endlich insbesondere über die von ihm verübten Verbrechen76 einigen Aufschluss zu geben im Stande sein möchten.
221 Frage: Wie er heisse.
Antwort: Sepp heiss' ich, aber mit dem Zunamen sell weiss ich nicht.
Frage: Was ein Zuname sei.
Antwort: Sell weiss ich nicht.
Frage: Ob er nie gehört, dass die Leute zwei Namen haben.
Antwort: Nein.
Frage: Ob er noch Eltern habe.
Antwort: Ja, zwei Brüder, einen Vater und zwei Schwestern.
Frage: Ob er keine Mutter habe.
Antwort: Ajjo, ich hab' noch eine Mutter.
Frage: Wie sein Vater mit dem Zunamen heisse.
Antwort: Sell weiss ich nicht.
Frage: Er (Inquisit) heisse G., wie er glaube, dass sein Vater mit dem Zunamen geheissen.
Antwort: Sell weiss ich nicht.
Nun stellte Joseph G. einmal eine Frage an die Kommissarien, deren Zweckmässigkeit Jedermann bei weitem mehr einleuchten wird, als jene des Fragens der Kommissarien nach dem Zunamen; er fragte nämlich:
„Ob er das Leben verschuldet habe, und wenn er es verschuldet habe, so möge man es ihm lieber nehmen, als ihn länger im Zuchthause sitzen lassen.” — Als er die Frage, woher er dies vermuthe, dahin beantwortet hatte, dass es ihm ein Sträfling im Zuchthause gesagt habe, fing er an allerlei undeutliches Zeug zu schwatzen, so dass man ihn nur schwer beruhigen konnte. — Als man damit einigermassen zurechtgekommen zu sein glaubte, erfolgte von Seite der Kommissarien an ihn die
Frage: Ob er nie gehört habe, dass die Kinder den Namen ihrer Eltern führen.
Antwort (nach langem Besinnen): Ich kann mich jetzt nicht darauf verstehen77.
222 Frage: Ob er nicht glaube, dass sein Vater auch G. heisse.
Während die Frage diktirt wurde, sagte Joseph G. von freien Stücken: „Mein Bruder ist mit der Mutter auch wüst gewesen, er hat sie gewürgt und auf die Bank niedergesetzt.”
Auf Wiederholung der Frage:
Antwort: Sell weiss ich nicht.
Frage: Wie alt er sei.
Antwort: Sell weiss ich nicht.
Nun folgte eine ähnliche Abhandlung über die Zeit, nämlich wie viel Tage das Jahr, wie viel Tage die Woche habe etc., die er bald schlecht, bald besser beantwortet.
Frage: Was ist der Sonntag für ein Tag?
Antwort: Dass wir sollen in die Kirche gehen und beten.
Frage: Was heisst das: beten?
Antwort: Den Rosenkranz-Vaterunser thu' ich beten.
Frage: Er soll das Vaterunser beten.
Antwort (betet es ohne Anstoss zu Ende).
Frage: Wer denn das sei, der Vater im Himmel.
Antwort (nach gemachter Erklärung der Frage78): Gott.
Frage: Warum er zu Gott bete.
Antwort: Dass ich in den Himmel komme.
Frage: Wann man in den Himmel kommt.
Antwort: Wenn man todt ist, geht die Seel' in den Himmel hinauf.
Frage: Ob alle Seelen in den Himmel kommen.
Antwort: Alle Menschen kommen in den Himmel.
Frage: Ob er nie etwas von der Hölle gehört habe.
Antwort: Ja freilich, wenn man flucht und wüst thut, kommt man in die Höll'.
Frage: Wohin er gern kommen möchte.
Antwort: In den Himmel möcht' ich.
Frage: Wie er sich dann aufführen müsse.
223 Antwort: Brav beten.
Frage: Ob er nicht auch Niemanden etwas zu leid thun dürfe.
Antwort: Ajjo, Niemanden etwas zu leid thun.
Hiermit schlossen die Kommissarien das Verhör, wie sie es nannten, setzten es aber am 26. Februar noch weiter fort.
Frage: Was er mit dem Gelde gemacht hat, was man ihm am Schlusse des letzten Verhöres geschenkt hat79?
Antwort: I hab's wölle vertrinke. Sie haben mir noch kein' Wein gebracht.
Frage: Wie viel es gewesen sei.
Antwort: Ein Zwölfer und ein Sechser80.
Frage: Ob er Freude am Gelde habe.
Antwort: 's Geld isch no mei Freud'.
Frage: Warum ihn das Geld freue.
Antwort: Darum! — dass ich allig Geld hab'.
Frage: Was er mit dem Gelde mache.
Antwort: Ich trink' Bier d'rum und Wein.
Frage: Ob er sich sonst nichts anschaffe.
Antwort: Manchmal ein' Rettich oder ein' Zwiebel.
Frage: Ob er nicht bessere Kleider zu haben wünsche.
Antwort: Ja.
Frage: Warum.
Antwort: Dass ich auch hübsch wäre und nit so wüst daher käme.
Frage: Ob er glaube, dass er sich für einen Zwölfer oder Sechser bessere Kleider schaffen könne.
Antwort: 's isch z'weni.
Frage: Wie viel Geld er dazu brauche.
Antwort: Ich meine so Ein' Gulden.
Frage: Wer ihm bisher die Kleider angeschafft habe.
Antwort: Die Mutter.
Frage: Ob sonst Niemand.
224 Antwort: In des Cheizbauern Haus hab' ich ein wenig gedient und ein Brusttuch erhalten. Ich bin aber wieder fortgerennt.
Frage: Warum.
Antwort (lachend): Ich bin halt herumgelaufen wieder.
Frage: Ob ihm das Herumlaufen besser gefalle, als das Schaffen.
Antwort: Ich schaffe lieber, ich hab' Freud' am Schaffen.
Frage: Warum er doch das Herumlaufen dem Schaffen vorgezogen.
Antwort: Ich hab' halt müssen herumlaufen, was ich angestellt habe, hat mich gedrückt, es ist mir alleweil Angst gewesen.
Frage: Was ihm Angst gemacht.
Antwort (lachend): Dass ich's Haus anzunden hab'.
Frage: Warum ihm Angst gewesen.
Antwort: Darum, es ist mir im Kopf gesteckt, dass wenn ich stürb', ich in die Höll' komm'.
Frage: Woher er gewusst habe, dass er deswegen in die Hölle komme.
Antwort: Weil's eine Sünde ist, weil's nicht recht ist.
Frage: Wer ihm dieses gesagt habe.
Antwort: Kein Mensch hat mir es gesagt, kein Mensch, kein Mensch.
Frage: Woher es ihm denn bekannt war.
Antwort: Sell isch nicht recht, wenn mer's Haus anzünden thut.
Frage: Warum es nicht recht sei.
Antwort: Weil ich meiner Mutter ihr' Sache verbrannt habe, weil es eine grosse Sünd' ist.
Frage: Wann ihm dieses in den Sinn gekommen ist81.
Antwort: Wie ich's thun g'habt hab', ist mir's in den Sinn gekommen, dass es nicht recht ist.
Frage: Warum es ihm erst hintennach in den Sinn gekommen ist82?
Antwort: Es hat mich halt im Gewissen gedruckt, und ich hab' es müssen sagen.
Frage: Warum er es so lange verschwiegen habe.
225 Antwort: Ich hab' gefürchtet ich werd eingesperrt, hernach hab' ich's müssen sagen, ich hab' keine Ruh' gehabt.
Frage: Woher er gewusst hat, dass er eingesperrt werde.
Antwort: In L. hab' ich einmal Einen prügeln g'sehen, der auch e' Haus anzunden hat, derselbe hat zwanzig Jahr (Zuchthausstrafe) überkommen.
Frage: Ob es vor oder nach seiner Brandlegung war.
Antwort: Ich hab' d'Häuser schon lang' anzunden g'habt.
Frage: Ob er also wirklich seiner Mutter Haus angezunden habe.
Antwort (lachend): Jo, ich hab's anzunden, jo, ich hab's anzunden.
Frage: Warum er es angezunden.
Antwort: Warum ich's thun hab'? Mein Bruder hat mich g'schlagen. Wann er mich nicht g'schlagen hätt', hätt' ich's nicht thun; 's hat mich schon vielmal g'reut.
Frage: Er hat ja damit nur seiner Mutter, nicht seinem Bruder Schaden gethan.
Antwort: Mein Bruder ist auch darin gewesen; ich hab's gethan, dass er nimmer hineinkommen sollt'.
Frage: Das Haus habe ja nicht seinem Bruder gehört.
Antwort: Er ist doch d'rinne g'west, er hat drinne gewoben, er ist ein Weber.
Frage: Wann ihm beigefallen, das Haus seiner Mutter anzuzünden.
Antwort: Er hat mich gar wüst g'schlagen, da bin i gangen und hab's anzunden.
Frage: Ob es ihm nicht eingefallen, dass es eine Sünde ist.
Antwort: Es ist mir freili eing'fallen.
Frage: Wann es ihm eingefallen.
Antwort: Wie ich's than g'habt hab', is mir's eingefallen.
Frage: Ob er nicht auch vor der That daran gedacht habe.
Antwort: Nein.
Frage: Ob das Anzünden des mütterlichen Hauses das einzige Böse sei, das er begangen habe.
Antwort (lachend): Nein, ich hab' noch eins anzunden, das Berghaus des Lorenz S.
Frage: Warum er dies gethan habe.
Antwort: Mein Bruder hat mich auch in dem Haus g'schlagen, da hab' ich's halt im Zorn gethan.
226 Frage: Ob er schon gebeichtet habe.
Antwort: Ja, aber ich bin aus der Kirche weggelaufen.
Frage: Warum?
Antwort: Weil mir Angst gewesen ist.
Frage: Wofür er sich gefürchtet habe.
Antwort: Ich fürchtete, ich sag's nicht recht, was ich gesündigt hab'. (Lachend.)
Frage: Was er für eine Sünde halte.
Antwort: Wenn mer flucht83.
Frage: Ob er schon geflucht habe.
Antwort: Schon vielmal.
Frage: Ob er nicht glaube, dass der Mutter Haus anzünden eine Sünde sei.
Antwort: Das Fluchen ist Sünde, der Mutter Haus anzünden ist Sünde.
Frage: Ob er von den zehn Geboten nichts gehört habe.
Antwort: Freili hab' i davon gehört, die Mutter hat sie mit mir betet.
Frage: Er solle sie hersagen.
Antwort: (Er rezitirt einige Gebote unverständlich her.)
Frage: Ob er gehört hat, dass Tödten eine Sünde ist.
Antwort: Sell han i g'hört, dass Tödten eine grosse Sünde ist.
Frage: Ob er schon Jemanden etwas zu leid gethan habe.
Antwort (zuerst): Nein, nein! (Gleich darauf:) Ajjo, ich hab' mich e' mal g'henkt.
Frage: Warum?
Antwort: Das Leben ist mir verleid't gewesen.
Frage: Warum es nicht erlaubt ist, sich selbst das Leben zu nehmen.
Antwort: Weil Niemand sich selbst darf richten.
Frage: Woher er dieses wisse.
Antwort: Sie haben's g'sagt, wie ich mich g'henkt hab' g'habt.
Frage: Ob er nicht erst neuerdings einen Versuch gemacht habe, sich das Leben zu nehmen.
Antwort: Ja, im Zuchthaus hab' ich mir wollen die Gurgel abhau'n.
227 Frage: Warum er dies habe thun wollen.
Antwort: Weil mer halt Alles verleid't g'wesen ist.
Frage: Er habe ja aber doch gewusst, dass dies eine Sünde ist.
Antwort: 's ischt halt so an mich komme.
Frage: Ob es öfter so an ihn komme.
Antwort: Ja wohl, i hab' allweil lange Zeit.
NB. Hier wurde Joseph G. sehr düster, und man fand nöthig, davon abzubrechen.
Frage: Ob er sich allenfalls über etwas im Zuchthause zu beschweren habe.
Antwort: Nein, 's geht mer nix ab84.
Die Kommissarien schlossen hiermit diese Vernehmung mit der Bemerkung: sie glauben, dass die abgehaltenen Verhöre hinreichen, um den auffallenden Blödsinn und den geringen Grad des Erkenntnissvermögens des Inquisiten zu beurkunden.
Der Medizinalkommissär erstattete nun folgendes Gutachten:
Aus dem Erwägen der Untersuchungsakten; aus den Beobachtungen bei den Verhören des Joseph G.; aus seiner bald freudigen, lächelnden Miene, wo es keinen Stoff zur Freude und zum Lachen gab; aus der plötzlichen Abänderung der Miene in starren, auf einem ganz unbedeutenden Gegenstand haftenden, bald ängstlichen Blick; aus seinen Geberden und seinem Betragen bei Beantwortung seines Verhöres; aus dem öfteren Mangel seiner Fassungsfähigkeit für die deutlichsten Fragen, bis man ihm solche auf mehrfache Art wiederholte, und ihm solchermassen das Gedächtniss aufweckte; endlich aus seinem so schnellen Ueberfalle von einer Art Wahnsinnes, das er nach der Beantwortung der Frage (wegen dem Zunamen) sich im Geiste verirrte, und dann schnell trotzend den Tod forderte, wenn er ihn verschuldet habe85, sich hierzu höchst gefasst zeigte, 228 und nachhin weinend viel ungereimtes Zeug schwatzte, aus welcher Gemüthsstimmung man ihn nur langsam, mit guten Vorstellungen, mit Schmeicheln und Versprechungen von Geldschenkungen wieder zu guter Laune bringen konnte86; ferner noch vorzüglich aus dem wahnsinnigen Beginnen des Inquisiten bei dem ersten Brande, ob er seiner ihm zurufenden Mutter folgen und sich aus dem brennenden Hause retten wolle, und dem Martertode so gleichgiltig entgegensah — aus allen diesen Daten stimmt Referent in seinem Resultate mit dem des Civilkommissärs, der Zuchthausverwaltung und des Zuchthaus-Physikates dahin ganz überein, dass Joseph G. ein höchst einfältiger und durchaus blödsinniger Mensch mit dem niedersten Grade des Erkenntnissvermögens, ja als ein sogenannter Halbverrückter anzusehen sei, wie er dieses im niedersten und höchsten Grade von Jugend auf war, wobei ihn dennoch augenblicklich ein solcher Tiefsinn und Grad von Narrheit befallen kann, dass er seiner inneren Sinne gar nicht mehr mächtig ist und sogar sich selbst gefährlich wird, wie er denn wiederholte Versuche gegen sein Leben machte.
Aus diesem und dem Angeführten (aus der oben zitirten Frage des Verhöres) erachtet Referent, dass, wenn Joseph G. sich in seinem Betragen und Sprechen die Zeit vor und nach Anlegung des Brandes auch von ziemlichem Verstande ausgewiesen habe, man hieraus dennoch nicht unfehlbar auf seinen Geisteszustand in der Mittelzeit bei Anlegung der Brände folgern könne, wie auch Keiner, der ihn nur vor oder nach der obigen Zeitfrist (nach dem Vorgange bei der zitirten Frage) beobachtet hatte, auf den Vorgang seiner Geistesverwirrung in der Zwischenzeit hätte schliessen können.
229 Das Obergericht forderte noch die Aufklärung, wie es komme, dass Joseph G., welcher in seinem Verhöre als eine mit Verstandesfähigkeit begabte, aller Ueberlegung fähige Person in einem gesunden Gemüthszustande erscheine, nun als ein Mensch geschildert werde, welcher nicht einmal im gesunden Zustande die gewöhnliche Verstandesfähigkeit besitzt, im kranken aber wahnsinnig und melancholisch ist.
Diese Aufklärung gab das Kriminalgericht (der Medizinalreferent wurde nicht vernommen, was sehr zu tadeln ist) dahin:
1. dass die ersteren Verhöre die Antworten nur der Wesenheit nach, ohne auch den Provinzialdialekt nachzuahmen, sonst aber ganz getreu, enthalten;
2. die bessere Verpflegung im Arreste gegen die spätere im Zuchthause, wo er noch von der Bestrafung anderer Verbrecher Zeuge war, auf ihn vortheilhaft gewirkt habe, wodurch die Differenz in den ärztlichen Arbitrien entstanden sein mag;
3. auch in den letzten Protokollen sich mehrere Antworten finden, welche eben von keiner Geistesverwirrung zeigen.
Das Obergericht fand sich hierdurch genügend in die Lage gesetzt, ein Urtheil zu fällen87, und erkannte, mit Berücksichtigung der Jugend des Inquisiten (er war zur Zeit der Aburtheilung 22 Jahre), der Verschiedenheit der bei der Untersuchung der Kommissarien und des Kriminalamtes gefundenen Resultate88, den Joseph G. wegen seiner offenbar in lichten 230 Zwischenräumen89 begangenen Verbrechen mit einer achtjährigen schweren Zuchthausstrafe zu belegen, jedoch mit der Beschränkung, ihn vorläufig in dem Zuchthause noch nicht als Sträfling zu behandeln, sondern unter ärztlicher Aufsicht für Veredlung seiner Seelenkräfte zu sorgen.
Dieser Antrag wurde höheren Ortes auch genehmigt, und zugleich angeordnet, das Urtheil erst nach hinlänglich gebessertem Zustande des Joseph G. kund zu machen.
Dieser Zeitpunkt war aber nach sechs Jahren noch nicht gekommen.
Der verehrte Leser wird mit dem Verfasser die Ansicht theilen, dass dieses Urtheil keineswegs ein den Prinzipien der Gerechtigkeit entsprechendes war. Der Grund seiner Schöpfung liegt aber offenbar darin, dass die Differenz der Ansicht des Kriminalgerichtes mit dem Medizinalreferenten nicht zu beheben versucht wurde, oder sofern dies nicht möglich war, der Ausspruch des Medizinalreferenten, als des eigentlichen Sachkundigen, nicht als der giltige angenommen wurde.
Der Standpunkt, von welchem die Sache schon vom Anbeginne der Untersuchung hätte angegriffen werden sollen, wäre nach meiner Meinung folgender gewesen:
Joseph G. hatte sich zu zwei Brandlegungen bekannt. Diese Brände hatten wirklich Statt gefunden. — Joseph G. war notorisch von Zeit zu Zeit verrückt, oder benahm sich doch so, dass man ihn dafür halten musste.
231 Diese drei Thatsachen mussten daher als die Grundlage weiterer Untersuchung dienen. Es handelte sich also vor allem Anderen darum, durch ärztliche Erhebung auszumitteln, ob man seinen Zustand für so geartet halten könne, dass anzunehmen sei, er wisse was er sagt.
Dazu gehörte nun vor Allem eine Prüfung seiner Aussagen durch einen zum Verhöre zugezogenen Arzt, nicht aber genügte es, dass er, wenn auch drei Viertelstunden lang, erst längere Zeit nach dem Verhöre von einem Arzte geprüft wurde, denn es lässt sich die Möglichkeit denken, dass diese Prüfung gerade während eines lichten Zwischenraumes Statt hatte, in welchem er, wenn er wäre verhört worden, das Geständniss nicht abgelegt haben würde.
Da nun wohl die Brände, nicht aber auch der Umstand, dass die Brände gelegt waren, erhoben wurden, auch sonst kein Umstand vorlag, welcher ihn als den Thäter bezeichnete, so war diese Lücke wesentlich, und konnte auch nicht durch das von den Kommissarien aufgenommene Verhör als ergänzt betrachtet werden, weil zufolge dieses Verhöres Joseph G. entschieden als mit abwechselnder Sinnenverwirrung behaftet erkannt wurde.
Es fehlte daher die erste Bedingung zur Verurtheilung, die Gewissheit, dass das Geständniss wahr sei, und dieser Mangel hätte sollen auf die früher erwähnte Art und Weise behoben werden.
Was nun den Zustand bei Verübung der That betraf, so stand, auch abgesehen von dem früher gerügten Mangel objektiver Gewissheit über die Wahrheit des Geständnisses, noch der Umstand entgegen, dass aus den Erhebungen hervorging, Joseph G. sei schon seit seiner früheren Jugend im Allgemeinen schwachsinnig, zuweilen jedoch entschieden närrisch gewesen.
Es hätte nun sollen ein besonderes Gutachten über den Umstand erhoben werden, ob aus den durch die Aussagen seiner Mutter etc. sich ergebenden Umständen sich die Gewissheit einer bereits zu jener Zeit Statt gefundenen, wenn auch intermittirenden Geisteszerrüttung, oder doch deren Wahrscheinlichkeit ergäbe, und dann im wahrscheinlichen Falle der Bejahung, unter Mittheilung der Akten an den Arzt, an diesen die Frage gestellt werden sollen, ob sich bei einem Menschen, welcher, wie Joseph G., zugleich schwachsinnig und zeitweise vollkommen verrückt ist, bezüglich dieser That unter den Umständen, unter welchen sie begangen wurde, mit Gewissheit darstelle, dass er damals in einem lichten Zwischenraume gewesen sei.
232 Der Arzt hätte zur Beantwortung dieser Frage wahrscheinlich eine umständlichere Vernehmung mehrerer Zeugen bedurft, welches, und zwar mit Beiziehung des Arztes, hätte geschehen müssen, dann aber wäre höchst wahrscheinlich der Ausspruch erfolgt: „dass sich bei einem so schwachsinnigen und zeitweise wirklich verrückten Subjekte unmöglich bestimmen lasse, dass er bei dieser That, welcher noch dazu ein widersinniges Motiv zu Grunde liegt, in einem lichten Zwischenraume sich befunden habe, weil er sich dabei, wenigstens bei dem ersten Brande, auf eine ähnliche Art benahm, wie bei den Selbstmordversuchen.”
Dieser Ausspruch hätte nun die Sache, und zwar dahin entschieden, dass gegen Joseph G. nicht weiter wäre prozessirt worden, da man dann die Ueberzeugung gewonnen hätte, dass sowohl der objektive als der subjektive Thatbestand mangle.
Nimmt man aber selbst an, dass das Geständniss richtig ist, ja dass sich Alles gerade so verhält, wie Joseph G. angibt, so erscheint dieser als ein höchst schwachsinniges Geschöpf, welches nur wenigen Vorstellungen zugänglich ist. Eine von diesen wenigen war die des Zornes gegen seinen Bruder, weil er ihn geschlagen hatte, alle anderen, die ihm doch so nahe gelegen, z. B. dass der Brand des Hauses seinem Bruder nur wenig, ihm selbst und seiner Mutter und Anderen aber sehr viel schaden, blieben von seiner Seele fern, um so mehr mussten alle Vorstellungen von der Unsittlichkeit der Handlung (er wusste, dass Fluchen eine Sünde sei und fluchte dennoch, von der Sündlichkeit des Brandlegens hatte er, wenigstens nach seinem Wissen, nichts gehört), und eben darum auch von der Rechtswidrigkeit, von welcher er gar keinen Begriff hatte, ausgeschlossen sein. Er fasste den Entschluss als ein Schwachkopf und führte ihn aus mit der Konsequenz eines Wahnsinnigen, für den ausser dem, was zu seiner fixen Idee passt, nichts vorhanden ist.
Ein solcher Entschluss kann nun, ungeachtet der wirklichen Ausführung, nicht bestraft werden, weil gegen ein solches Subjekt jede bürgerliche Strafe wirkungslos bleibt und bleiben muss.
Zur Ausmittlung des Zustandes zur Zeit der That geschah nun in der vorliegenden Untersuchung zu wenig, und der gegenwärtige Zustand des Joseph G. war wieder von zu geringer Bedeutung für Dasjenige, was vor sieben Jahren geschehen war; so geschah es nun lediglich durch die unrichtige Art der Auffassung des Gegenstandes, dass Joseph G. verurtheilt wurde, der sonst der Verurtheilung zuverlässig entgangen wäre.
233 Kaspar Roth ist der Sohn eines dürftigen Schneidermeisters zu Frankfurt a. M., welcher ihn in zweiter Ehe, und zwar in seinem 57. Jahre, gezeugt hat.
Schon in seiner frühesten Kindheit wurde er von einem Nervenfieber befallen, und die gleiche Krankheit wiederholte sich in seinem 11. Jahre. Der von Natur nicht starke Körperbau des Knaben wurde durch diese Krankheiten geschwächt, und auf der anderen Seite dessen Entwicklung weder durch nahrhafte Kost noch durch gesunde Wohnung befördert. Im Gegentheile hatte er das gemeinsame Schicksal armer Kinder in grossen Städten: keine frische Luft, keine freie Bewegung, kraftlose Speisen, erkünstelte Bedürfnisse und — lasterhafte Gewohnheiten.
Gegen seinen Vater finden sich keine besonders nachtheiligen Zeugnisse in den Akten, sein Einfluss auf den Sohn war durch die Stumpfheit seines Alters beinahe Null; die Mutter dagegen ist eine für ihren Stand gebildete und gottesfürchtige Frau, so dass durch die häusliche Erziehung wenigstens nicht nachtheilig auf die moralische Seite seines Charakters scheint eingewirkt worden zu sein. Allein in seinem zehnten Jahre erlernte er von einem anderen Jungen das Laster der Onanie. Er war damals noch in einer Trivialschule, besuchte aber darauf das Gymnasium und wurde hier von dem Lehrer der Religion (jedoch ohne persönliche Beziehung) auf die nachtheiligen Folgen aufmerksam gemacht. Von dieser Zeit an, seinem 14. Jahre, bestrebte er sich, jenes Laster abzulegen, und es gelang ihm nach einem jährigen Kampfe. Nicht weniger suchte er in anderer Beziehung der Anleitung seiner Lehrer zu folgen. Seine geistigen Fähigkeiten waren gering, jedoch gelang es ihm durch unermüdlichen Fleiss, in den alten Sprachen bedeutende Fortschritte zu machen, sieben Preise zu erringen, und einer der ausgezeichneten, leider! auch der geliebten Schüler zu werden. Die angestrengte Arbeit war denn wieder eine Ursache, 234 den Körper des jungen Roth noch mehr zu schwächen, so dass er sich in einem höchst elenden Zustande gerade zu einer Zeit befand, wo er neuer Kräfte und neuer Anstrengung am meisten bedurft hätte, nämlich als die Schulstudien sich ihrem Ende nahten und die der Universität beginnen sollten. Obwohl er in seinem 19. Jahre, um Ostern 1825, eine Abschiedsrede von dem Gymnasium gehalten hatte, besuchte er dasselbe doch noch bis Ostern 1826, allein schon mit den häufigsten durch seine Kränklichkeit veranlassten Unterbrechungen91. Zu den damals eingetretenen Unterleibs-, Nerven- und Gehirnleiden gesellte sich ein neues Erwachen des Geschlechtstriebes, und dieser wirkte, obwohl von dem unglücklichen Jüngling standhaft bekämpft, mit erschütternder Kraft auf den schon allgemein affizirten Körper zurück.
Kaspar Roth befand sich um diese Zeit in einem erbarmungswürdigen Zustande, in dessen Krisis die schaudervolle That fällt, welche der Gegenstand nachfolgender Blätter ist.
Ehe ich diesen Zustand näher beschreibe, wende ich mich noch etwas zurück, um auch die innere Lebensgeschichte desselben bis zu dieser Periode zu verfolgen und einige andere Thatsachen anzugeben, die von wesentlichem Einflusse auf Vollbringung jener That waren, oder ihre Ursachen näher beleuchten.
Dass die geistigen Fähigkeiten des Kaspar Roth nie ausgezeichnet waren, ist schon berührt worden. Dessen ungeachtet brachte er es in manchen gelehrten Studien weit, in anderen dagegen konnte er nicht vorwärts kommen. Charakteristisch ist, dass ihm immer die Mathematik gänzlich unzugänglich war, und dass er darin auch nicht die einfachsten Sätze begreifen konnte, wogegen er sich gern mit Aufsätzen in deutscher Sprache befasste, und durch grossen Fleiss einer der ersten Stylisten wurde. Jedoch war auch in diesen Aufsätzen keine produktive Kraft, sondern nur ängstliche Sorgfalt für die Sprachwendungen zu erkennen, so dass seine vertrautesten Briefe immer von Korrekturen wimmelten. Einer seiner Lehrer sagt in einem nach der Ermordung des Bruders über ihn gegebenen 235 Bericht, dass zuweilen seine Gedanken wie still gestanden, und man ihm auch nicht das Leichteste hätte begreiflich machen können. Bei solchen zum sophsophiren gewiss nicht geeigneten Anlagen hatte er dazu dennoch einen unglücklichen Hang. Es ging ihm damit wie dem Zauberlehrling: Zweifel konnte er leicht heraufbeschwören aus dem unendlichen Ideenreiche über die Natur und Bestimmung des Menschen — sie zu lösen war er nicht im Stande; ohne Lösung ruhen und vertrauen auf die Vorsehung gelang ihm gleichfalls nicht. Dieser innere Zwiespalt erschütterte, wie begreiflich, sein Denkvermögen. Besonders einflussreich auf sein und seines unglücklichen Bruders Schicksal scheint aber die Idee von einer ewigen und unzertrennlichen Verbindung des Geistes und des Körpers geworden zu sein.
Mit dem Hinscheiden und dem Untergange des Letzteren dachte er sich auch den Untergang des Ersteren verbunden92.
236 Jene Idee wurde durch folgenden Umstand von der grössten Bedeutung für Roth: er hatte das erlernte Laster der Onanie, damals, als er dessen Sündlichkeit nicht kannte, seinem jüngeren Bruder Remigius weiter gelehrt. Später von den nachtheiligen Folgen dieses Lasters unterrichtet, wollte er es demselben auch wieder abgewöhnen. Es gelang ihm nicht. Er merkte nun, wie sich dessen Munterkeit in mürrisches Wesen, seine Lebendigkeit in Zerstreuung veränderte, wie sein Gedächtniss schwächer wurde, seine Gesundheit herabsank, häufige Brust- und Leibschmerzen sich einstellten. Er fürchtete sonach den Untergang der sinnlichen und übersinnlichen Natur seines geliebten Bruders zugleich; er hielt dessen Tod für die einzige mögliche Errettung93.
So weit sich die Lebensgeschichte des Kaspar Roth in den Akten verfolgen lässt, zeigte er immer ein sehr weiches, folgsames und religiöses Gemüth und ein sehr reges Pflichtgefühl. Dieses bewog ihn, dem Laster der Onanie zu entsagen, nachdem er dessen Sündlichkeit erfahren hatte, und in den Knabenjahren den ernstlichen Kampf mit einem schon durch vierjährige Uebung zu grosser Höhe gesteigerten Sinnenreiz zu beginnen. Nach Verlauf eines Jahres, wo seine moralische Willenskraft bald siegte, bald erlag, gewann sie die entschiedene Ueberhand, die Sinnlichkeit war überwunden.
Es kommt in den sämmtlichen Akten nicht eine Spur irgend einer leidenschaftlichen Aufwallung des zum Brudermörder gewordenen Jünglings vor. Seine Geschwister liebten ihn, und nie hatte er mit ihnen einen ernstlichen Streit, seine Freunde achteten ihn, seine Eltern — verehrten ihn, seine Lehrer schätzten ihn, viele Leute niederen Standes bewunderten ihn, 237 eben sowohl wegen seiner feineren sittlichen Bildung, als wegen seiner Kenntnisse; in den angesehensten Häusern gab er Unterricht und erwarb sich durch sein bescheidenes Benehmen Freunde.
Seine religiösen Gesinnungen waren rein, wie sich aus vielen vorgefundenen Aufsätzen und Briefen ergibt.
Durch dieses in vielen Beziehungen reine Gemüth zieht sich jedoch von früher Jugend herauf ein dunkler Streif kränkelnder Schwermuth, frühreifer und überspannter Empfindelei.
Man erkennt die unter dem Gefühle der früheren Sünde und der Zerknirschung, so wie durch übertriebene geistige Anregung emporgeschossene, aber matte und welke Treibhauspflanze. Peinlich ist besonders dieses Ringen nach Oben und zum Erfassen des Unendlichen bei der innewohnenden Gedankenarmuth des unglücklichen Roth.
Ob die Entwicklung dieses kränkelnden Gemüthszustandes bis zur völligen Krankheit mehr eine Folge dessen war, dass er bei seinem Bruder das von ihm erlernte zerstörende Laster nicht mehr tilgen konnte, so wie, dass er bei zunehmenden Jahren in sich selbst den Sinnenreiz mit doppelter Kraft erwachen fühlte und ihn auf's Neue bekämpfen musste, oder ob daran sein durch vieles Sitzen und durch die früher getriebene Onanie angegriffener Unterleib und die eingetretenen hypochondrischen Leiden Schuld waren, lässt sich nicht mit Gewissheit bestimmen. Wahrscheinlich wirkten alle diese Ursachen zusammen.
Eine auffallende Reizbarkeit des Gefühles bei dem leisesten Tadel bemerkten und rügten zuerst um Ostern 1824 einige Lehrer des Gymnasiums. Der sonst folgsame Jüngling konnte jedoch diesen Fehler nicht ablegen, vielmehr stieg seine Reizbarkeit.
Zur selben Zeit fingen seine geistigen Kräfte offenbar an mehr herabzusinken; Zerstreuung, Schwierigkeit im Festhalten und Aneinanderknüpfen der Ideen, Ermüdung durch jede anhaltende Arbeit, nahmen zu.
Jene Progressionsrede (um Ostern 1825) umfasste einen reichhaltigen Stoff: über die christlichen Märtyrer, war aber in der Ausführung äusserst dürftig und schwach. Roth hatte seine ganze Kraft und seinen ganzen Fleiss daran gesetzt, sie umgearbeitet und wieder umgearbeitet, aber es wurde doch nur ein glatter Rahmen zu einem matten Bilde. Die Anstrengung der darauf gewandten Arbeit blieb ihm noch lange fühlbar. Er schränkte die Zahl seiner Unterrichtsstunden ein, obwohl er in den dürftigsten Verhältnissen war. Die Vorbereitung zu seinen Universitätsstudien 238 ging so wenig von der Hand und wurde mit solcher Zerstreuung betrieben, dass er die Autoren der Werke wieder vergass, die er lange und anhaltend studirt hatte. Festhalten seiner Gedanken, ohne äussere Beschäftigung durch die Feder, wurde ihm immer schwerer.
Das Selbstgefühl einer geistigen und körperlichen Ermattung erzeugte eine grosse Mutlosigkeit und Melancholie; die Trauer über seinen früheren Fall vereinte sich mit dem Abscheu vor der wieder erwachenden Sinnlichkeit, und erzeugte ein Chaos trüber und verwirrter Gedanken94.
Die Nächte brachte er mit Wachen und Weinen zu, welches oft so laut wurde, dass es seine bekümmerten Eltern aus dem Schlafe erweckte.
Vorzüglich richteten sich seine Gedanken auf den durch sein Beispiel verdorbenen Bruder Remigius. Freilich, Gedanken, die den Festesten erschüttern und den Gottvertrauendsten niederwerfen konnten! Sein Bruder, sein geliebter Bruder, durch ihn dem zeitigen und — nach seinem Wahne — auch dem ewigen Verderben dahingegeben! Und keine Rettung!
Früher wollte er Theologie studiren, jetzt wandten sich seine Ideen zur Pädagogik, wobei er (nach mehreren früheren Notizen) vorzüglich im Sinne getragen zu haben scheint, dass er die an seinem Bruder begangene Sünde durch Bewahrung anderer Kinder wieder austilgen möchte, und dies wollte er gleich beginnen, ohne sich vorher durch Universitätsstudien auszubilden95.
Später dachte er auch daran, Rechtswissenschaft zu studiren, und arbeitete deshalb kurze Zeit bei einem Advokaten. Dass er den Geschmack an einer seinem ganzen Wesen so widerstreitenden Wissenschaft bald verlor, ist leicht zu begreifen; nicht so, wie er dazu kam.
Dieses Schwanken über die Wahl eines Standes fiel in die Zeit, nachdem er das Gymnasium gänzlich verlassen hatte (Ostern 1826) und der Kampf in seinem Inneren wurde nun immer heftiger, es nahte die Entscheidung.
239 Den 12. Juni 1826 wollte sein Bruder Remigius auf dem Marktschiffe nach Hanau fahren, um das dortige Lamboyfest zu schauen96.
Kaspar Roth erbot sich, ihn zu begleiten, bat aber, dass sie lieber zu Fuss gehen möchten. Die Nothwendigkeit, Remigius von der ewigen Vernichtung durch den Tod zu retten, war nunmehr feste Ueberzeugung bei Jenem geworden; er hatte beschlossen, das Instrument des Todes und der Rettung zu werden; auf jenem Gange nach Hanau wollte er den Mord vollbringen. Aber noch redeten gegen die Ausführung innere Stimmen seines Herzens.
Nicht weit von Frankfurt wollte er umkehren. Remigius bat ihn, weiter zu gehen. Sie gingen, und Kaspar dachte nun wieder in Hanau zu bleiben, sich dort durch Informiren der Kinder zu erhalten und seinen Bruder unter beständige Aufsicht zu nehmen. Dann siegten abermals die Mordgedanken; er fühlte den Moment der Entscheidung nahen — da stiegen schwarze Gewitterwolken empor, sie erkennt er als ein Zeichen des göttlichen Unwillens über sein Vorhaben, und umarmt weinend seinen Bruder mit den Worten:
„Lasse uns zurückkehren! Du bist ja mein lieber Bruder!”
Remigius getraute sich nicht mehr der Rückkehr zu widersprechen, er fühlte die Bewegung in der Brust seines Bruders und das Ausserordentliche in seinem Wesen. Gerührt, erschüttert, bang, folgte er gern zur Heimat.
Niemand durfte dort Kaspar über jenen Vorgang befragen. Jede Erinnerung daran war ihm augenscheinlich schmerzvoll und beängstigend.
Seine Stille und sein dumpfes Hinbrüten nahm seitdem zu; am 24. Juni war er plötzlich verschwunden; die Eltern vermutheten Selbstmord.
Nach einigen Tagen schrieb das Justizamt in Königstein an das Polizeiamt zu Frankfurt, dass man in der Gegend einen geisteskranken Menschen, ohne Pass, festgehalten habe, und liess einen Tag später Kaspar Roth auf dem Schub nach Frankfurt zurückbringen.
Die Ursache, warum er sich so heimlich entfernte und seine Eltern dadurch in die grösste Besorgniss versetzte, ist schwer auszumitteln; er schrieb wenige Tage zuvor an einen Freund in Idstein, dass er ihn besuchen wolle, und nahm am 24. Juni auch wirklich den Weg dahin. Warum verbarg er denn ein so einfaches Vorhaben?
240 Der wahrscheinlichste Grund ist, dass er den ihn immer umlagernden Mordgedanken entfliehen wollte. Diese Gedanken traute er sich Niemandem zu offenbaren. Statt aber nur sie zu verbergen, verbarg er, in Folge der schon herrschenden Geistesverwirrung, seine vorhabende Reise selbst. Da er von mehreren seiner Lehrer nach der Rückkehr um die Ursache seines heimlichen Verschwindens befragt wurde, gab er freilich jene beängstigenden Mordgedanken nicht an, so wie es überhaupt bemerkenswerth ist, dass er sie vor der That ganz heimlich hielt. Er behauptete vielmehr, dass er verschiedenen, seiner Keuschheit von mehreren Mädchen und Frauen gemachten Nachstellungen habe entrinnen wollen. Diese Nachstellungen waren jedoch lediglich in seiner Einbildung gegründet; die in ihm mit neuer Macht erwachte Sinnenlust hatte er auf Andere übertragen (seine subjektiven Gefühle objektirt).
Alles, was er von seinem Zustande während jener kurzen Abwesenheit später erzählt hat, deutet darauf hin, dass damals der Sinnenreiz eine furchtbare Höhe und eine alle anderen Fähigkeiten verwirrende Kraft erreicht hatte. Es mag also auch darin zum Theile eine Veranlassung seiner plötzlichen Entfernung gelegen haben.
Jene Erzählung ist folgende: Roth begab sich am 24. Juni auf den Weg nach Idstein; da er auf dem Gipfel des Stauffen (eines unweit Königstein gelegenen Berges) angelangt war, erschienen ihm plötzlich alle Gegenstände doppelt, Bäume und Blumen begannen mit ihm zu reden, er fühlte, dass er so nicht unter Menschen gehen könne, und folgte Berg auf Berg ab dem Gesange der Vögel; sie sangen von seiner Keuschheit. Dann begegnete er, als Engel, zwei Jungfrauen, und hielt ihnen eine blaue Blume entgegen; endlich sank er ermüdet in einen Busch. Hier war es ihm, als müsse er sich seiner gebrüsteten Keuschheit entledigen, gleichsam seinen Stolz auf Tugend durch Sünde büssen. Im Wahnsinne beging er zum ersten Male wieder Onanie. Kaum war aber der Reiz befriediget, so erhielt wieder Alles eine andere Gestalt vor seinen Augen; wahnsinnige Reue folgte der unwillkürlichen Sünde; zur Busse wollte er sich zuerst als Rinderhirt, dann als Schweinhirt verdingen. Die Frau (aus dem Dorfe Elhalten), welcher er diesen Dienst anerbot, ahnte seinen Zustand, lud ihn zu sich in's Haus und übergab ihn dem Schulzen des Dorfes, dieser dem Amte zu Königstein. Aus seiner zerrissenen und durchnässten Kleidung (zwei Tage war er durch Wald und Busch geirrt und beim Verfolgen einer grünen Wasserlibelle in einen Bach gefallen), seinem sonderbaren, obwohl nicht unvernünftigen Benehmen, seinem hartnäckigen Zurückweisen 241 aller Speise, davon er doch zwei Tage lang nichts genossen — schlossen die Behörden und Bauern zu Königstein und Elhalten, dass er geisteskrank sei.
Als K. Roth nach Frankfurt zurückgebracht war, zeigten sich zwar keine so offenen Spuren dieses kranken Zustandes mehr — er kehrte zu seinen gewöhnlichen Beschäftigungen mit anscheinender Ruhe und Fassung zurück, doch war es gerade damals, wo sein sonderbares Wesen, seine angenommene Heiterkeit, sein oft verzerrtes Lachen, verbunden mit einem scheuen und ängstlichen Benehmen97, seinem Arzte und mehreren seiner Lehrer auffiel; auch gab er damals, wenn er den Fragen über sein Verschwinden nach Königstein nicht ausweichen konnte, jene widersinnigen Gründe an, die oben berührt wurden. Zu Hause war sein Benehmen durchaus verschlossen und still. Seine Verwandten indessen hofften noch immer auf eine Wiederherstellung.
Weil ihm Bewegung und Erheiterung angerathen ward, ermunterte ihn seine Schwester am 18. Juli 1826 zu einem Spaziergange in den öffentlichen Anlagen. An diesem Tage, so wie wahrscheinlich auch an den vorhergehenden, bewegten Roth wieder die trüben Gedanken über das Schicksal seines Bruders Remigius, der zu einem Schreiner in die Lehre gekommen war, jedoch die Anstrengung der Arbeit nicht wohl ertragen konnte. Die Idee, dass diesen nur der Tod erretten könne, war mit doppelter Gewalt zurückgekehrt.
Die bessere Einsicht des unglücklichen Jünglings, wodurch er diese Idee hätte verscheuchen sollen, war noch mehr zerfallen. Sonderbare Vorstellungen über göttliche Mittheilungen durch Zeichen der äusseren Natur hatten sich festgesetzt98 und waren in Verbindung mit den düsteren Mordgedanken getreten.
Des Einflusses, welchen das Aufsteigen eines Gewitters bei seinem Gange mit Remigius nach Hanau hatte, ist schon erwähnt worden, ebenso, dass er 242 auf dem Gipfel des Stauffen die Stimme der Bäume und Vögel vernommen; dass der Gesang der Letzteren einen inneren Sinn habe und göttliche Worte verkünde, dieses war zu dieser Zeit in ihm eine fixe Idee geworden99.
Auf der einen Seite nun die düsteren Gedanken über das zeitliche und ewige Verderben seines Bruders, über die einzige Möglichkeit von dessen Errettung durch den Tod, über seinen eigenen Beruf: das Instrument dieser Rettung zu werden, im Sinne tragend; auf der anderen Seite zur Ausführung dieser von höherer Pflicht erheischten Gräuelthat durch äussere zufällige Zeichen der Natur bald abgeschreckt, bald dazu hingezogen, bald durch sie die göttliche Missbilligung, bald die göttliche Billigung seines Vorhabens erkennend; mit einem so schwankenden Ruder in den reissenden Wellen seines bis in die Tiefe erschütterten Gefühles und seiner gewaltig drängenden Gedanken wurde Roth, obwohl seine innere Stimme noch immer der That widerstrebte, dennoch zu ihr fortgerissen.
Nach dem Spaziergange mit seiner Schwester war er ruhiger nach Hause gekommen; um 10 Uhr Morgens stiegen die Gedanken wieder mit 243 Uebermacht empor; er war mit seinem Bruder allein im Zimmer, ergriff den Stiefelknecht seines Vaters und hob ihn mit Verzerrung seines Gesichtes und knirschenden Zähnen. Remigius glaubte, er wolle sich selbst ein Leid zufügen und fiel ihm mit den Worten in die Arme:
„Thue dir doch nichts!”
Erschüttert von den Worten des seine Gefahr nicht ahnenden Bruders liess Kaspar den schon zum Morde gehobenen Arm sinken, beide Brüder weinten, der eine den anderen betrauernd.
Nachmittags suchte Kaspar seine immer wieder aufsteigenden Mordgedanken abermals durch einen Spaziergang zu zerstreuen, aber an einem Weiher in den öffentlichen Anlagen vernahm er den Gesang eines Vogels, dessen Lieblichkeit er auf das göttliche Wohlgefallen an seinem Vorhaben deutete, mithin in diesem auf's Neue bestärkt wurde. Abends 5 Uhr gab er eine Unterrichtsstunde, während welcher Niemand zu Hause war, als sein Bruder Remigius, der, erschöpft und schlummernd, seinen Kopf auf den Tisch gelehnt hatte. Dieser Umstand führte entscheidend zu dem traurigen Ende des Armen. Seine Erschöpfung musste in dem düsteren Bruder mit neuer Kraft den Gedanken erwecken, dass das Laster der Onanie seinen Körper der Vernichtung entgegenführe; mit der Vernichtung des Körpers sah Jener auch die Seele dahinschwinden. Der Schlummer des Unglücklichen bot auf der anderen Seite das Bild der ewigen Ruhe durch den Tod. Von diesen Gedanken erfasst, durch den Unterricht (den er mit der grössten Anstrengung und sichtbarer Zerstreuung fortsetzte) an die Stelle gefesselt, gewann der Sturm in Kaspar's Innerem völlige Ueberhand, er war nun seiner nicht mehr mächtig. Kaum hat der Schüler das Zimmer verlassen, so ergreift er ein schweres Holz in der benachbarten Küche, springt mit gellendem furchtbaren Schrei auf Remigius los, und schmettert ihn mit wenigen Schlägen todt zu Boden. Während der That glaubt er ihn als Engel zum Himmel schweben zu sehen, wirft sich weinend auf die Leiche, überlässt ruhig den auf das Geschrei herbeieilenden Männern das Mordinstrument und sagt wiederholt:
„Ihm ist wohl; er ist gut aufgehoben, er ist im Himmel!”
Kaspar Roth war unmittelbar nach dem grausamen Morde seines Bruders, der nur noch einige Zeichen des konvulsivischen Lebens gegeben 244 hatte, nicht aber zum Bewusstsein zurückgekehrt war, in das Gefängniss abgeführt worden, ohne den geringsten Widerstand und ohne die mindesten Anstalten zur Flucht. Wer sollte bei einem von Natur so gutmüthigen, seinen Eltern und vorzüglich seiner Mutter so anhänglichen Jüngling, der offenbar den Bruder nur aus Liebe erschlagen hatte, nicht nach der That die grösste Reue, nicht beim Anblicke der Mutter, die an einem Tage zwei Söhne, und den einen durch den anderen, verloren hatte, die grösste Erschütterung vermuthen? — Davon zeigte sich keine Spur. Er bedauerte die Mutter, er war gerührt bei dem Gedanken an den geliebten Bruder, aber Reue über die That zeigte er nicht, und hat sie eigentlich nie gezeigt.
Mehrmals ist er später, wie es scheint in lichten Zwischenmomenten, zu der Ansicht gekommen, dass er das Schicksal seines Bruders hätte Gott überlassen sollen, so wie er auch vorher oft gegen den Entschluss angekämpft hatte, aber die Reue, welche ein das Gute wollender Mensch bei dem Gefühle eines wider besseres Wissen verübten Unrechts und eines schuldvoll verursachten unersetzlichen Verlustes empfindet, dieses herbe und erschütternde Gefühl hat sich niemals bei Kaspar Roth gezeigt. Dass sein Bruder sterben musste, dass ihm der Tod eine Wohlthat, eine Errettung war: davon war er zu aller Zeit, und davon ist er, wenn nicht Alles trügt, noch jetzt überzeugt. Deshalb konnte er wohl zweifeln über seinen eigenen Beruf zu dieser Errettung, niemals aber beklagen, dass sein Bruder diese Welt verlassen habe100.
In den Verhören, welche bald nach der Erschlagung des Remigius Roth veranstaltet wurden, ergab sich durch einstimmige Aussage aller vernommenen Zeugen, dass dessen Mörder immer die sanfteste Gemüthsart 245 gezeigt, und namentlich mit dem Erschlagenen im besten Einverständnisse, ohne allen Streit, gelebt hatte; dass er die Menschen im Allgemeinen nicht hasste, seine Verwandten, insbesondere aber den Bruder Remigius, aufrichtig liebte.
Seinen bedenklichen Geisteszustand hatten zwar, namentlich nach der Rückkehr von Königstein, einige seiner Lehrer bemerkt; allein von der finsteren Richtung, welche seine Gedanken im Stillen genommen hatten, auch nicht das Mindeste geahnt. Alle Aufschlüsse hierüber, so wie seinen Glauben an göttliche Offenbarungen durch die äussere Natur, sind erst von ihm selbst nach der That gegeben worden, jedoch mit der vollkommensten inneren Uebereinstimmung, und mit einem unverkenntlichen Streben nach Wahrheit.
In dem ersten Verhöre antwortete er auf die Frage: warum er diese grausenvolle That gethan: „Weil mein Bruder selig werden sollte und ich das an ihm wieder gut machen wollte, was ich an ihm verdorben; das muss man ja! Ich habe weinen und es doch thun müssen.”
Die furchtbarste Gemüthsbewegung offenbarte sich immer in ihm, wenn er näher über das befragt wurde, was er denn eigentlich an seinem Bruder verbrochen, und was er denn gut machen wollen. Erst im zweiten Verhöre konnte er dieses Geständniss in gebrochenen Worten ablegen. Seine Erschütterung vor Scham und bitterer Reue stieg hier auf den höchsten Grad.
Mit der wahrhaftesten Genauigkeit schilderte er seinen inneren Zustand kurz vor der That. Der Untersuchungsrichter brauchte für seine Mordgedanken den Ausdruck Vorsatz. Hierauf bemerkte er:
„Sie nennen es Vorsatz, dieses war es aber nicht, sondern es hat mich während der Lektion so gefasst, um es gleich nach der Lektion auszuführen, die ich jedoch desfalls nicht abgekürzt.”
Bei Vorlesung des Protokolls bemerkte er hierzu:
„Ich kann nicht genau unterscheiden, ob Gefühl oder Vorsatz mich überwältigt hat. Ich glaubte etwas Gutes gethan zu haben; ich weiss für mein damaliges Gefühl keine andere Benennung.”
Nämlich ein Vorsatz zur That war allerdings schon lange bei Kaspar Roth vorhanden, er glaubte sie zur Rettung seines Bruders nothwendig; aber die Ausführung geschah durch die Ueberwältigung des Affektes (Gefühl).
Einer seiner Lehrer besuchte ihn mehrmals allein in dem Gefängnisse, und gab den Inhalt seiner Unterredungen mit ihm zu den Akten. Nichts 246 war ihm schrecklicher, als der Gedanke, welcher ihm auch einst während des Lesens einer Predigt gekommen war: dass ihn vielleicht nicht Gott, sondern Satan zur That getrieben, und dass der Böse in ihm sei.
Uebrigens stieg eine Zeit lang während des Aufenthaltes im Gefängnisse seine Sinnenverrückung, wovon sich in jenen Unterredungen die deutlichsten Spuren zeigten. Vorzüglich trat auch hier, wie so häufig bei solchen Zuständen, das Verwechseln des Subjektiven mit dem Objektiven, und dieses mit jenem hervor. Seine Gedanken wurden ihm zugerufen, er glaubte selbst zu sprechen, was er las. Bei jener zunehmenden Geistesverwirrung schweiften auch seine Gedanken von dem Morde seines Bruders auf den seiner übrigen Verwandten; der Zweifel über ihre ewige Seligkeit, welcher bei dem Bruder noch ein scheinbar vernünftiges Gewand getragen hatte, bemächtigte sich seiner ganz ohne begründendes Motiv, so wie Sorge um ihr irdisches Fortkommen. Er fürchtete sich vor dem Anblicke seiner Mutter und rief im Schmerze:
„Ich kann doch nicht immer ein Würgeengel sein!”
Später kehrte wieder ein ruhiger Zustand zurück, und gegenwärtig besucht ihn seine Mutter zuweilen.
Die Medizinalbehörde zu Frankfurt am Main hatte in ihrem Sektionsberichte vom 19. Juli 1826 ausgesprochen:
„Dass Remigius Roth an den am Abend vorher erhaltenen Wunden eines nothwendig schnellen und unaufhaltsamen Todes gestorben sei.”
Nach vollendeter Untersuchung wurden ihr von dem Appellationsgerichte daselbst (der ersten Instanz in peinlichen Fällen) folgende Fragen vorgelegt:
„Ob die Geisteskräfte des Kaspar Roth verletzt seien; von welcher Beschaffenheit und welchem Grade in solchem Falle die Geisteszerrüttung sei, und in welchem Zusammenhange sie mit der von Roth begangenen Ermordung seines Bruders stehen möchte.”
Diese Fragen wurden in einem ausführlichen Gutachten wieder beantwortet, welches in seinem ersten Theile das Leben des Kaspar Roth vor und nach der That, so wie sein Benehmen während derselben, historisch darstellte.
247 Hier wurde zuerst hervorgehoben die schwächliche Konstitution desselben, seine Zeugung im 57. Lebensjahre seines Vaters, dessen Tochter erster Ehe gleichfalls schon in dem Irrenhause wegen Geisteskrankheit eine Zeitlang befindlich gewesen; ferner seine früheren Nervenkrankheiten, die von ihm getriebene Onanie, seine dürftige Lebensweise und sein angestrengtes Arbeiten, welche Umstände zusammen die Entwicklung einer Seelenstörung hinlänglich erklärten.
Nachgewiesen wurde sodann, wie solche wirklich schon bei seinem Abschiede vom Gymnasium (um Ostern 1825) begonnen hatte, und von dieser Zeit bis zum Gange mit dem Bruder nach dem Lamboyfeste, am 12. Juni 1826, der kränkliche Zustand des K. Roth mit schweren Gemüthsleiden verknüpft war und sich bei ihm vielfache Spuren eines hohen Grades von Hypochondrie zeigten.
Endlich wurden alle diese Krankheitssymptome und der Ausbruch des Uebels in den Begebenheiten bei jenem Gange nach dem Lamboyfeste, dem Verschwinden nach Königstein, der Erschlagung des Bruders und dem späteren Verhalten des Kaspar Roth weiter verfolgt.
In einem zweiten Theile jenes Gutachtens wurden sodann die Ansichten berühmter Lehrer der Arzneikunde über einen solchen Gemüthszustand dargelegt, und zwar vorzüglich folgende:
Nicht allein das Vorstellungsvermögen, sondern auch andere Grundkräfte der Seele könnten angegriffen werden, weshalb die Quelle der Freiheitslosigkeit nicht immer in einem zerrütteten Verstande zu suchen sei, wie auch schon die Melancholie und Manie an und für sich bewiesen. Deshalb könnte auch als Kriterium freier Handlungen nicht allein der Verstand gelten. — Hierzu wurden als Autoritäten angeführt:
Masius, „Grundsätze der gerichtlichen Arzneiwissenschaft,” Bd. II., 2. Abtheilung S. 485, 538.
Heinroth, „System der psychologisch-gerichtlichen Medizin,” S. 133. Der Affekt könne bei einer Seelenstörung bald in den Regionen des Geistes, bald in denen des Gemüthes und bald in denen des Willens vorherrschend primär sein.
Zu den Affektionen des Geistes gehören: Blödsinn, Wahnwitz, Verrücktheit, Narrheit; zu denen des Gemüthes: Wahnsinn und Melancholie; zu denen des Willens: Manie und Willenlosigkeit101.
248 Als Veranlassung zu psychischen Störungen kämen vor: erbliche Anlagen, fehlerhafte Kultur der Seelenkräfte, Temperament (vorzüglich das cholerische und melancholische), ferner die alienirte Stimmung des Nervensystems (Hypochondrie und Hysterie).
Die Hypochondrie stehe zwischen psychischen und physischen Uebeln gleichsam in der Mitte, besonders der Melancholie und dem Wahnwitze nahe. Der im Unterleibe kranke Hypochondrist habe das Gefühl herannahenden Unglückes, grosser begangener Verbrechen, woraus sich oft ein Zustand völliger Verwirrung, ein blinder Drang, der qualvollen Angst auf irgend eine Art zu entgehen, erzeuge.
Sehr ähnliche psychische Symptome erschienen in der Melancholie, nämlich ebenfalls das Gefühl eingebildeter Verbrechen, herannahenden Unglückes, verbunden mit verkehrten Ideen, wodurch der Melancholische zum Selbstmord oder zum Morde Anderer getrieben werde, im Wahne, dass er diese befreien wolle, oder dass es ihm Gott befohlen habe. — Als Autorität wird hier angeführt: Böhmer, „Medit. in const. Cur. crimin.” §. 865, und schliesslich wurden die körperlichen Symptome dargestellt, welche man bei Melancholischen gewöhnlich findet.
In einem dritten Theile jenes Gutachtens wurde entwickelt, dass die in dem vorhergehenden Theile angeführten möglichen Ursachen einer psychischen Störung: 1. erbliche Anlage, 2. fehlerhafte Ausbildung der Seelenkräfte, 3. melancholisches Temperament und 4. Hypochondrie, laut der in dem ersten Theile des Gutachtens gegebenen historischen Lebensdarstellung des Kaspar Roth, alle bei diesem unglücklichen Jünglinge vereinigt vorhanden wären, und da, nach Meckel's „Beiträgen zur gerichtlichen Psychologie,” S. 38 u. f., der Mangel egoistischer Motive in zweifelhaften Fällen allein schon zu Gunsten eines Angeklagten entscheide, so stehe als Beantwortung der aufgeworfenen Frage fest: „dass die Geisteskräfte des Kaspar Roth verletzt102 seien und gewesen wären, und dass der hohe Grad von Melancholie und Geisteszerrüttung insofern im innigsten Zusammenhange mit der von ihm begangenen Ermordung seines Bruders stehe, als Roth der Freiheit und Selbstbestimmung hierdurch immer mehr beraubt worden, und in einem völlig gebundenen Zustande die That verübt habe103.
249 Diesem Gutachten wurde noch ein Anhang über die sogenannte amentia occulta beigefügt, mit Bezug auf Platner („Quest. med. for.”), wornach diese sogenannte amentia occulta als eine noch unreife persönliche104 Krankheit zu betrachten, und der partielle Wahnsinn daher zu erklären wäre, dass oft wiederkehrende Gefühle und Affekte sogar die Freiheit eines Gesunden eine Zeit lang in Anspruch nehmen können105.
Wenn nun die unreife Seelenstörung den damit Behafteten an Verrichtung seiner Lebensgeschäfte hindert106, oder die fixe Idee auf seine Handlungen Einflüsse äussere, so höre die Zurechnung auf. (Heinroth's „System der psychologisch-gerichtlichen Medizin,” §.64 und 65.)
Wir übergehen nun Dasjenige, was der Defensor zu Gunsten des Kaspar Roth anführt, und welches sich im Wesentlichen auf die allerdings nicht unbegründete Behauptung beschränkte, dass bei den Grundsätzen, welche er in seiner Erziehung angenommen und in seinem sonstigen 250 Lebenswandel an den Tag gelegt hatte, eine solche That durchaus nicht motivirt sei, und daher nur als Folge einer Seelenstörung erklärt werden könne.
Nachdem diese Verteidigungsschrift eingelangt war, wurden die Akten zum Spruche an die juristische Fakultät zu Tübingen versandt.
Diese Fakultät bemerkte, nachdem in den Entscheidungsgründen der faktische Hergang der ganzen Sache auf das Genaueste angegeben war, in der juristischen Beurtheilung vorzüglich das Folgende:
Der objektive Thatbestand des angeschuldigten Verbrechens sei gewiss; in Bezug auf den subjektiven Thatbestand erkläre das ärztliche Gutachten den Inquisiten für unzurechnungsfähig. Die Streitfrage, ob der Richter gegen ein solches Gutachten entscheiden dürfe, könne hier umgangen werden, da keine verschiedene Ansicht des Richters obwalte. Eine Prüfung des ärztlichen Gutachtens erschiene aber schon deshalb als nothwendig, weil solches auf ungegründeten faktischen Voraussetzungen beruhen, oder aus anderen Gründen als unzulänglich erscheinen könne, wornach denn eine weitere Erklärung einer anderen Medizinalbehörde erforderlich werden würde. — Ebenso könne die Streitfrage über Vermuthung der Zurechnungsfähigkeit und über das qualifizirte Geständniss hier umgangen werden, weil selbst Diejenigen, welche Zurechenbarkeit vermutheten und dem Inquisiten den Beweis der Qualifikation seines Geständnisses aufbürden wollten, im vorliegenden Falle seine Aussagen über seinen Zustand und seine Motive als wahr annehmen müssten; denn seine Wahrhaftigkeit bezeugten sämmtliche Akten, die Zeugnisse seiner Lehrer, Eltern und Freunde, seine Vorgefundenen Skripturen, die genaue Uebereinstimmung aller erwiesenen Thatsachen mit diesen Aussagen, und dass Erstere nur durch Letztere erklärt werden könnten.
Nach diesen Vorbemerkungen schritten nun die Entscheidungsgründe zur näheren Beurtheilung der Sache selbst:
Die Medizinalbehörde habe zwar in ihrem Gutachten gesagt, dass sich kein egoistischer Zweck der fraglichen That auffinden liesse, und dass dieses allein für sich, wenn der Zustand des Inquisiten zweifelhaft wäre, sprechen und entscheiden würde. Diesem Grundsatze scheine auch Heinroth („System der psychologisch-gerichtlichen Medizin,” S. 277) beizustimmen.
251 Allein, wenn zwar unzweifelhaft sei, dass das Dasein eines egoistischen Motivs ein Beweisgrund der Zurechenbarkeit sei, so könne man doch den Satz keineswegs umkehren, und schon den Mangel eines solchen an sich für einen Beweisgrund der Zurechnungslosigkeit erklären.
(Hitzig, „Zeitschrift für die Kriminal-Rechtspflege,” Bd. I., S. 267. Mittermaier, „Disquis. de alienat. ment.” p. 53, sqq.)
So z. B. sei die That Sand's nach der Aeusserung von Heinroth (in der Schrift gegen Mark und für Klarus, S. 39) rein aus einer der Vernunft angehörigen und an sich nicht widersinnigen Idee, nämlich aus der Idee der Freiheit, hervorgegangen107.
„Ohne Beachtung der Nebenumstände könnte die That des Inquisiten eben so erscheinen, nämlich aus der Ueberzeugung hervorgegangen, dass sein Bruder äusserlich in diesem Leben nicht glücklich werden könne, und innerlich und moralisch jeden Tag nur mehr in Versunkenheit gerathen, und sofort sein Seelenheil gefährdet werde, dass es also für denselben in jeder Hinsicht besser sei, er sterbe. Er fasste, wie es scheint, aus brüderlicher Liebe den Entschluss, den Bruder zu tödten. Er kämpfte aber gegen diesen Entschluss an, weil er, wie es scheint, ihn nach göttlichen und menschlichen Gesetzen für unrecht hält, und überwindet ihn mehrmals. Wo aber noch Kampf ist, da ist in der Regel noch Freiheit. Es ist hier in keiner Beziehung die Freiheit, weder des Urtheiles noch des Willens, aufgehoben, sondern es entschloss sich hier Inquisit zu einer That, bei der er gegen das Gesetz blos seinen individuellen Ansichten und besonderen Gefühlen, wenn gleich in einem Affekte, aber doch nicht durch wahre Seelenstörung krankhaft bestimmt folgte. Zwar, möchte man dagegen einwenden, deutet die Auslegung des Vogelgesanges vor der That, deutet die Ruhe bei seinem Ertapptwerden und bei seiner Verhaftung, ferner die Stimmen, welche, wie Herr Professor H. berichtet, Inquisit in seinem Gefängnisse hören, und die Visionen, die er daselbst haben will, auf Gemüthskrankheit hin, allein auch hier scheint wieder gesagt werden zu können, dass hieraus sich noch nicht auf Seelenstörung schliessen lässt. Denn was die Stimme betrifft, so sind solche Einbildungen, fremde Stimmen zu hören, namentlich bei Personen, die, wie Inquisit, an Unterleibsbeschwerden leiden, gar nicht seltene Erscheinungen, und lassen an sich noch gar nicht auf wahre Seelenstörung schliessen. (Klarus, 252 S. 41, 46, 47, „Ueber die Zurechnungsfähigkeit des Mörders Woyzeck.”) Was aber die Visionen des Inquisiten im Gefängnisse betrifft, welche sich sämmtlich auf seine That beziehen, so lassen sich solche eben so leicht durch eine aufgeregte Phantasie des über eine verbrecherische That bekümmerten und wehmüthigen Thäters erklären. Eben so scheint es mit der Auslegung des Vogelgesanges zu sein. Es könnte dieses auch ein blosses Hineintragen des Subjektiven in etwas Objektives sein, das auch noch gar nicht an sich Seelenstörung beweist. Was aber die Ruhe, mit der er sich ertappen und verhaften liess, betrifft, so könnte man sich daraus erklären, dass er entweder unmöglich, oder doch seinem Inneren nicht zusprechend fand, den Händen der Gerichte sich zu entziehen. — Freilich ist nicht zu läugnen, dass Inquisit zur Zeit der That und vorher körperlich krank und auch allerdings geistig nicht ganz gesund gewesen; ob aber diese Krankheit eine die Zurechenbarkeit, die Freiheit im Urtheile oder Wollen und Handeln aufhebende war, dies scheint auf den ersten Anblick zweifelhaft. Alle die Uebel, woran Inquisit litt, sind noch keine Beweise wahrer Seelenstörung, sondern, wie Klarus a. a. O. S. 43 sagt: „blos Symptome der Hypochondrie, welche, wie unzählige Erfahrungen bei den achtbarsten, geistreichsten und thätigsten Männern lehren, den freien Gebrauch des Verstandes und die Selbstbestimmung nicht hemmen oder gar aufheben.”
Nachdem nun auch in den Zweifelsgründen erwähnt worden war, dass Inquisit kurz vor der That zu allen gewöhnlichen Geschäften fähig gewesen, zum Unterrichte und zum zusammenhängenden Sprechen und Schreiben, lenkt das Urtheil zu den die Freisprechung bestimmenden Motiven folgendermassen ein:
„So scheint, wenn wir die einzelnen Erscheinungen beim Inquisiten als einzelne und isolirte herausheben, das Resultat auf Zurechnungslosigkeit nicht zu führen. Allein ganz anders wird das Resultat, wenn man jene Erscheinungen, wie man muss, in ihrem Zusammenhange alle als zugleich beim Inquisiten vorhanden betrachtet, und dann noch einige andere ebenfalls vorhandene Fakta hinzunimmt.”
Diese besonderen Fakta wurden in der Entweichung des Inquisiten nach Königstein und seinem Benehmen während derselben, auch bei der Erschlagung seines Bruders, gefunden, und der Zustand desselben als ein anfangs hypochondrischer, dann in Melancholie übergegangener geschildert, mit welchem sich eine fixe, mit unwiderstehlicher Gewalt treibende Idee und Verrücktheit verbunden habe.
253 Die in Heinroth's System, S. 199 u. f., 299 u. f., 350, im „Lehrbuche der Seelenstörungen,” Th. I. S. 330 u. f., angegebenen Symptome der Melancholie wurden, als in dem Inquisiten vorhanden, aufgeführt, und noch besonders des Versuches zum Selbstmorde gedacht. Ueberhaupt habe (nach Klarus, a. a. O. S. 49) ein blinder (mithin entschuldigender) Antrieb zu der verbrecherischen Handlung in dem Inquisiten Statt gefunden, indem bei der Uebermacht ungewöhnlicher und individueller Anreizungen, die gewöhnlichen und egoistischen Motive dazu gefehlt hätten. Amentia occulta könne aber nicht angenommen werden, da sich der Wahnsinn schon bei der Entweichung nach Königstein offenbart habe, und auch später von einem scharfen Auge nicht schwer zu entdecken gewesen sei.
Hierauf wurde der vorliegende Fall noch mit mehreren anderen, namentlich mit dem des Woyzeck und Schmolling, verglichen, ferner bemerkt, dass man in dem Gutachten der Medizinalbehörde eine spezielle Beweisführung über die Geisteskrankheit des Inquisiten in ihren besonderen Verhältnissen zu seiner That vermisse, und sodann folgendes Urtheil gefällt:
Dass Inquisit, Kaspar Roth, wegen Mangel des Requisites der Zurechenbarkeit, von dem ihm angeschuldigten Verbrechen der Tödtung und aller Strafe freizusprechen sei, und die Kosten des verhängten Inquisitionsprozesses der Fiskus zu tragen habe; Inquisit der Medizinalpolizeibehörde zur Vorkehrung der geeigneten Sicherheitsmassregeln übergeben werden solle.
V. R. W.
So zweckmässig diese Untersuchung geführt erscheint, und so sehr sie in ihrem Resultate die Ansicht des verehrten Lesers befriedigen dürfte, so sehr scheint doch auch die Bemerkung des Referenten: dass man in dem Gutachten der Medizinalbehörde eine spezielle Beweisführung über die Geisteskrankheit des Inquisiten, in ihren Verhältnissen zu seiner That, vermisse, gegründet, denn es lässt sich nicht verkennen, dass das Endurtheil nur darum den Inquisiten für nichtschuldig erklärte, weil man seine That als eine Folge seiner Krankheit ansah.
Dies war die ohne Zweifel richtige Ansicht des Gerichtes, nicht aber der ausdrückliche Ausspruch des Medizinalkollegiums, denn dieses sagte nichts Anderes, als: der hohe Grad von Melancholie des K. R. hat denselben der Geistesfreiheit immer mehr beraubt, und steht mit der That insofern in Verbindung, als er in einem völlig gebundenen Zustande 254 die That verübt habe; dies heisst mit anderen Worten: Kaspar Roth hat die That in einem gebundenen Zustande verübt, weil er in einem hohen Grade von Melancholie und Geisteszerrüttung sich befand.
Dieser Ausspruch ist nun nichts Anderes, als eine Tautologie, denn er sagt nichts weiter, als: er hat die That in einem gebundenen Zustande verübt, weil er sie in einem gebundenen Zustande verübt hat; über den Umstand aber, dass er in einem gebundenen Zustande war, wird nichts weiter gesagt, als: die physischen Veranlassungen zur melancholischen Stimmung waren bei Kaspar Roth vorhanden; eines der Zeichen der Melancholie, nämlich dass der Leidende sich zur Ermordung Anderer bestimmt fühlt, sei nebst anderen vorhanden.
Da man nun in zweifelhaften Fällen zu Gunsten des Angeklagten entscheiden muss und keine egoistischen Motive da sind, so sei er als in einem gebundenen Zustande befindlich anzunehmen.
Es bedarf nun wohl keiner Erinnerung, dass die letzten beiden Gründe ganz und gar nicht im Stande sind, ein ärztliches Gutachten zu motiviren; es erübrigt daher nur der erstere Grund, nach welchem das Gutachten ungefähr so viel sagt, als: Kaspar Roth hat darum seinen Bruder in einem gebundenen Zustande umgebracht, weil er aus dem Grunde, dass er ihn umgebracht hat, für in einem gebundenen Zustande befindlich gehalten werden muss.
Zu solchen Resultaten kommt man nun, wenn, anstatt eine freie, selbstständige Beurtheilung des Gegenstandes eintreten zu lassen, sich lediglich an die Beantwortung der richterlichen Fragen gehalten wird.
Viel zweckmässiger würden die Kunstverständigen gethan haben, wenn sie ihrem Befunde etwa folgende Form gegeben hätten:
Es erhellt aus den Daten des Untersuchungsaktes, dass Kaspar Roth an und für sich schon mit einem sehr sensiblen Naturell begabt, sich in früher Zeit dem Laster der Onanie ergeben habe, woraus nach medizinischen Erfahrungen eine Schwächung der Körperkräfte in vielen Fällen zu erfolgen pflegt, bei K. R. aber wirklich erfolgt ist, wie dies aus seiner Lebensgeschichte mit grösster Bestimmtheit hervorgeht.
Dass dieses Laster, besonders wenn es, wie bei Kaspar Roth, mit einer so auffallenden Schwächung des Körpers verbunden ist, auch auf die geistigen Fähigkeiten den nachtheiligsten Einfluss äussere, ist gleichfalls durch medizinische Erfahrungen erwiesen, und dass sich die geistigen Fähigkeiten des K. R. in einem sehr herabgestimmten Zustande befinden 255 und befunden haben, zeigt die Beobachtung so wie die Lebensgeschichte desselben.
Ein Mensch, der bei so schwachen, insbesondere durch das Laster der Onanie noch mehr herabgestimmten Geistesfähigkeiten, noch eine dieser Veranlassung ohnehin vollkommen entsprechende Anlage zur Hypochondrie, und durch diese zur Melancholie, besitzt, welche, wie bei K. R., noch dazu bedeutend ausgebildet ist, ist nun an und für sich wirklichen Seelenstörungen mehr ausgesetzt, als jeder Andere, da diese physischen Anlagen schon an und für sich eine, wenn auch minder bemerkbare Seelenstörung zur Folge haben, durch welche der Leidende zu Befürchtungen etc. veranlasst wird, zu welchen keine objektive, sondern nur die subjektive Veranlassung durch seine Krankheit besteht.
Für die entschiedene Entwicklung einer Geisteszerrüttung sind nun unter solchen Verhältnissen insbesondere solche Umstände besonders günstig, bei welchen durch eine reelle, immer wiederkehrende oder fortdauernde Veranlassung das Gemüth des Leidenden heftig angeregt wird, denn bei einem ohnehin der nöthigen Energie entbehrenden Gemüthe ist es noch weniger, als bei einem im gewöhnlichen Zustande des Gleichgewichtes befindlichen möglich, der durch dieses wirkliche Leiden entstehenden traurigen Stimmung und den dadurch entstehenden Gedanken etwas entgegenzusetzen, wodurch der Mensch im Stande bliebe, die seinen sonstigen Verhältnissen entsprechende Haltung zu bewahren.
Ein solches wirkliches Leiden war nun bei K. R. allerdings vorhanden. Es war die Reue über die Verführung seines Bruders, verbunden mit dem fortwährenden Anblicke der traurigen Folgen dieser Verführung.
In dieser seiner traurigen Stimmung war es nun, nach der sonstigen Beschaffenheit seines Charakters und seiner Geistesentwicklung, ganz natürlich, dass er zu metaphysischen Spekulationen seine Zuflucht nahm, und unter diesen erfasste er, unglückseliger Weise, den Gedanken, „dass die übersinnliche Natur durch die sinnliche in einem Menschen zu Grunde gehen könne.” Die natürliche Folge davon war der Schluss: „dass es erlaubt, ja sogar Pflicht sein könne, die sinnliche Natur zu zerstören, um die übersinnliche zu retten.”
Anfänglich hatten diese Gedanken lediglich die Beschaffenheit eines anderen Problems, bezüglich dessen, wenigstens nach dem Ideengange des K. R., pro und contra Gründe vorhanden waren, allein in dem sichtbaren Verfalle des geistigen und körperlichen Zustandes seines Bruders 256 lag für K. R. eine viel zu heftige Veranlassung zur Anwendung dieses Satzes, als dass der Gedanke, dass er nun berufen sei, seinen Bruder durch Zerstörung seiner sinnlichen Natur zu retten, nicht die blos spekulative Forschung verdrängt hätte, welche, wie man aus den schwachen Verstandeskräften und der Art und Weise, wie er dabei zu Werke ging, schliessen muss, ihn nie zu einem Resultate, sondern immer nur im Kreise herumführen konnte.
Durch diesen Gedanken erhielt seine durch die bereits berührten physischen und moralischen Einwirkungen bedingte melancholische Stimmung eine bestimmte Richtung, und zwar eine für seinen Zustand um so gefährlichere, weil bei der schwächlichen Beschaffenheit der geistigen und physischen Kräfte des K. R. der Gedanke an eine so fürchterliche That, wie die Ermordung seines geliebten Bruders, ihn bis in die innersten Tiefen seines Wesens erschüttern musste.
Sein noch nicht gänzlich erloschenes klares Bewusstsein kämpfte nun wohl gegen den Gedanken an den Brudermord, allein mit schwachen, ungleichen Kräften, denn die noch vorhandene ruhige Ueberlegung war durch das Sophisma, welches er sich selbst geschaffen hatte, gelähmt. Es war also nur sein moralisches, jedoch ganz unklares Gefühl, so wie die Sympathie für seinen Bruder, welches noch der Ausführung entgegenstand.
Dieser Gegensatz in seinem Inneren, welcher noch durch den fortdauernden Anblick der physischen und moralischen Zerstörung seines Bruders immer heftiger werden musste, musste nothwendig von einer ihm jedes klare Bewusstsein raubenden Aufregung begleitet sein, und war es auch, wie sein sinnloses Herumirren und seine physische Aufregung zeigt, in welcher er das Laster der Onanie wiederholte.
Wie sehr diese Aufregung sich aller seiner Geisteskräfte bemächtigt hatte, zeigt der Umstand, dass bereits bei ihm jene Erscheinung eintrat, welche sonst wirklich den Wahnsinn charakterisirt, dass er nämlich seine subjektiven Empfindungen für etwas Objektives nahm, nämlich denjenigen Gedanken, der ihn nun ausschliesslich beschäftigte, sich von dem Gesange der Vögel zugeflüstert wähnte etc.
K. R. musste in solchen Augenblicken bei dieser aufgeregten Stimmung und bei dieser bereits sich nach Aussen kundgebenden Macht derselben, wirklich als ein sinnenverwirrter Mensch betrachtet werden, und wenn er damals nicht schon die That beging, so kann dieses Unterlassen nur entweder dem Mangel an Gelegenheit oder dem Umstande zugeschrieben 257 werden, dass seine krankhafte Stimmung noch nicht gänzlich den Widerstand überwältigt hatte, welchen sein moralisches Gefühl, seine Sympathie für den Bruder, und überhaupt der Gedanke an das Entsetzliche der That noch ihrer Vollziehung entgegensetzte.
Bei diesem Zustande konnte es daher gar nicht anders kommen, als dass bei einer wiederholten und mächtigen Aufregung von Aussen dieser ohnehin immer schwächer werdende Widerstand durch die bereits zur fixen Idee gewordene Vorstellung von der Nothwendigkeit dieses Mordes besiegt werden musste. Die Anregung fand sich durch den Anblick der Erschöpfung und des Schlafes seines Bruders, und so wurde die That vollendet, welche sich bei K. R. als eine reine und einzige Folge seines krankhaften Seelenzustandes darstellt, weil ohne diesen alle übrigen äusseren und inneren Momente die That nicht veranlasst hätten, durch denselben aber er dahin gebracht wurde, dass der Gedanke an den Brudermord bei ihm zur fixen Idee wurde, welche einen seiner ihm möglichen Willenskraft nicht mehr gehorchenden Einfluss auf seine äussere Thätigkeit äusserte.
Durch diese Darstellung ergibt sich nun folgende Beantwortung der gerichtlichen Fragen:
1. Dass es keinem Zweifel unterworfen sei, dass die Geisteskräfte des K. R. sich in einem verletzten, nämlich in einem krankhaften Zustande zur Zeit der Verübung der That befunden haben.
2. Dass seine Geisteskräfte und überhaupt sein Zustand der That sich so beschaffen darstellte, dass er in Dingen, welche in irgend einer Beziehung zu seiner herrschenden Vorstellung standen, zu keiner anderen äusseren selbstständigen Thätigkeit fähig war, als jener, zu welcher ihn die ihn beherrschende Vorstellung bestimmte.
3. Dass die That daher einzig als Folge der krankhaften Verstimmung seiner Seelenkräfte angesehen werden müsse.
So lautete das Gutachten nun nicht; dass aber die Untersuchung dennoch mit einem Resultate endigte, welches eine Entscheidung lieferte, welche eben so lautete, als sie hätte erfolgen müssen, wenn das Gutachten auf eine ähnliche Weise, als wie es oben steht, gelautet hätte, lag nur in dem glücklichen Ereignisse, dass der Inquirent sowohl, als das urtheilende Kollegium selbst mit tiefer psychologischer Anschauung zu Werke gingen, und dadurch das Mangelhafte, welches in dem, wie man zu sagen pflegt, sehr auf Schrauben gestellten, und 258 wie oben gezeigt wurde, nicht einmal den Gesetzen der Logik entsprechenden ärztlichen Ausspruch lag, glücklich ergänzte, denn es lässt sich nicht verkennen, dass in dem ärztlichen Ausspruche die nöthigen Elemente zur Schuldloserklärung des K. R. nicht enthalten waren.
Nicht jeder Richter besitzt jedoch eine solche psychologische Anschauung, wie der Inquirent, welcher diese Untersuchung führte, und bedarf daher, um den richtigen Gesichtspunkt zu treffen, eine weit umfassendere Unterstützung von Seite der Aerzte, als sie im vorliegenden Falle gegeben wurde, wenn nicht die ganze Untersuchung vergriffen werden soll. — Wie der Arzt es aber anstellen kann und soll, um diese Unterstützung zu leisten, ist in dem vorigen Aufsatze angedeutet.
In dem Dorfe Thieringen, zum würtembergischen Oberamte Balingen gehörig, geschah in der Nacht vom 22. auf den 23. April 1827 folgende Missethat:
Der Sohn des dortigen Nachtwächters sah in dieser Nacht um 1 Uhr zum Fenster hinaus, in der Nähe der Wohnung des Webers Grotz, eines Witwers und Vaters eines einzigen bereits erwachsenen Sohnes, Namens Matthäus, der sich bei ihm aufhielt; er bemerkte nun, dass zwei Mannspersonen einander nachsprangen, und hörte dann rufen, zuerst: „O! Matthäus! Da lieg' ich!” und gleich darauf weiter: „O, schlägt mich mein Bube zu todt!”
Bald nach Diesem kam der Nachtwächter selbst nach Hause, und als ihm sein Sohn erzählt hatte, was er eben gehört, gingen sie noch mit einem Schaarwächter vor das Haus des Webers Grotz und klopften an der Hausthüre, durch die sie einen Augenblick zuvor Jemanden hatten in's Haus springen gesehen; gleichwohl regte sich Niemand in demselbem. Nun kam ein anderer Schaarwächter herbei; Alle riefen und klopften jetzt wiederholt an der Hausthüre und drohten, sie einzusprengen. Jetzt erst öffnete der Sohn Grotz das Fenster und fragte was sie wollten, sich dabei 259 stellend, als wache er eben vom Schlafe auf. Auf die Frage, wo sein Vater sei, erwiderte er sodann, dieser liege im Hausären, habe ein Loch im Kopfe; auch öffnete er sofort die Hausthüre.
Hier fanden nun die Herbeigekommenen den alten Grotz in dem Aeren (der Hausflur) auf dem Rücken liegend, mit dem Kopfe auf der steinernen ersten Stufe der Treppe, die Füsse übereinander gelegt, mit am Körper herabhängenden Händen und mit Kopfwunden bedeckt, todt hingestreckt. Der Ortschirurg wurde herbeigeholt, es kamen auch noch andere Männer, und nun wurde der Leichnam, unter Anleitung des Chirurgen, sorgfältig in die Stube hinaufgetragen. Hier wusch Letzterer die Wunden am Körper aus und hielt nach seiner Wahrnehmung dafür, dass derselbe schon seit einer Stunde abgelebt sein müsse. Bis zur Vornahme der gerichtlichen Leichenbeschau wurde dann der Leichnam in demselben Hause bewacht.
Der Sohn Grotz hatte zwar sogleich bei der Ankunft der genannten Männer ihnen ohne alle nähere Veranlassung geäussert, dass er über seinen Vater hergefallen sei, dadurch ein blutiges Hemd bekommen und dieses ausgezogen habe; man fand auch eine blutige Axt unter der Treppe, so wie das blutige Hemd in der Kammer, worin Vater und Sohn zusammen zu schlafen pflegten; dessen ungeachtet erklärte er, an dem Tode seines Vaters unschuldig zu sein, bis zum Morgen vor seiner Abführung an das Oberamtsgericht in Balingen. Nachdem er nun aber zuerst geäussert, er werde, ob er gleich unschuldig sei, gestehen, wenn man ihm nichts thun und ein Weib in's Haus geben wolle, so gestand er darauf dem Dorfschulzen unter vier Augen die Tödtung seines leiblichen Vaters ein, und erzählte die That umständlich. Diese umständliche Erzählung wiederholte er bald nachher auch vor dem untersuchenden Oberamtsgerichte.
Bevor wir jedoch diese Erzählung und überhaupt das Nähere der That anführen, scheint es angemessen, vorerst über die Persönlichkeit des jungen Grotz, dessen Erziehung und früheren Lebenswandel Folgendes aus den aktenmässigen Erforschungen zu erwähnen.
Der junge Matthäus Grotz, das einzige Kind seines nicht unvermögenden und für einen rechtschaffenen Mann bekannt gewesenen Vaters, evangelischer Religion, war zur Zeit der That beinahe 28 Jahre alt, und lebte, noch unverheirathet, bei seinem Vater. Er hatte die Schule und Kinderlehre fleissig besucht und wurde im gewöhnlichen Alter konfirmirt. Er galt zu jener Zeit für einen gesitteten Menschen und für einen der fähigsten Schüler, der im Lesen und Schreiben gute Fortschritte gemacht hatte. 260 Nach der Konfirmation erlernte er bei seinem Vater das Weberhandwerk, und wurde auch darin zum Gesellen gemacht. Doch blieb er nie lange in fremden Diensten und arbeitete auch bisweilen als Taglöhner. Er machte sich in dieser Zeit eines kleinen Gelddiebstahles auf einem Pachthofe, wo er als Taglöhner arbeitete, schuldig, und wurde dafür mit einer kurzen Gefängnissstrafe belegt. Seit acht Jahren hielt er sich immer in Thieringen auf und arbeitete mit dem Vater theils in der Werkstätte, theils auf dem Felde.
Indessen erklärte der Ortsvorstand bei der gerichtlichen Untersuchung: dass Grotz schon seit 15 Jahren an dem fallenden Weh (der Epilepsie) leide, seine Eltern hätten jedoch dieses Uebel immer zu verheimlichen gesucht, und erst im Jahre 1820 sei es wirklich dorfkundig geworden, dass derselbe gedachte Krankheit habe. Es fanden sich auch mehrere Zeugen, die zu verschiedenen Zeiten und auch schon vor mehreren Jahren epileptische Anfälle bei Grotz wahrgenommen hatten. Nach ihrer Beschreibung dauerten dergleichen Anfälle bei ihm einen Vaterunser lang bis zu einer halben Stunde. Während derselben sei er ganz bewusstlos gewesen, vor ihrem Eintritte habe man nichts Auffallendes an ihm bemerkt. Wenn die Anfälle dagegen vorübergegangen, sei Grotz fortgesprungen, habe keine Antwort gegeben, nicht mehr gewusst, was er thun solle, und sei manchmal noch eine Viertelstunde lang weggewesen.
Grotz selbst fing in der gerichtlichen Untersuchung aus freien Stücken von seinem Uebel, das er Gichter nannte, zu reden an, und äusserte sich darüber also: er sei daheim oft umgefallen und wie maustodt gewesen, dann sei er aber alsbald wieder wohl gewesen. Wenn ihn die Gichter todt gemacht haben, so habe es, meine er, einen Vaterunser lang gedauert. Es habe schon Tage gegeben, an welchen er sie zwei- bis dreimal bekommen habe. Sie seien überhaupt nie lange ausgeblieben. Wenn der Mond hell geschienen, habe er sie nicht viel, wenn dieser aber finster gewesen sei, habe er sie viel bekommen. Wann diese Krankheit überhaupt bei ihm den Anfang genommen, wollte er aber nicht wissen, und obschon ein Zeuge behauptete, Grotz habe auch den Anfall an dem Tage vor der Nacht, worin er seinen Vater tödtete, gehabt, doch nicht so stark wie sonst, so wollte sich Grotz auch dessen nicht mehr erinnern.
Obschon mit der Epilepsie behaftet, arbeitete er dennoch immer fleissig auf seinem Handwerke, und verdiente seinem Vater dadurch viel Geld, wie er sich dessen selbst auch vor Gericht rühmte. Dabei liebte er aber, was er nicht in Abrede zog, den Branntwein sehr. Sein Vater hütete ihn 261 jedoch immer möglichst davor, so dass er nicht oft dergleichen zu trinken bekam. Ueberhaupt hielten ihn, nach glaubwürdigen Zeugenaussagen, seine Eltern (seine Mutter starb erst vor einigen Jahren) unter einer steten und strengen Aufsicht, und liessen ihn selten irgendwo allein hingehen; gleichwohl sei er, sagen eben diese Zeugen, bisweilen, wenn er Geld gehabt habe, in's Bäckerhaus gesprungen und habe da einen halben oder auch einen ganzen Schoppen Branntwein auf einmal ausgetrunken, wie ein Vieh.
Um diese grosse Neigung zum Branntweintrinken zu befriedigen, entwendete er schon seit längerer Zeit seinem Vater öfters Geld im Betrage von 3, 6 bis 24 Kreuzern, wofür er dann in dem Bäckerhause sich Branntwein und Brot geben liess.
Um diese Geldentwendungen zu bewerkstelligen, wartete er jedesmal die Zeit ab, bis sein Vater im Bette lage, dann ging er zur Thüre hinaus, um demselben glauben zu machen, dass er auf den Abtritt gehe, und bei dieser Gelegenheit nahm er nun das Geld aus dessen daliegenden Beinkleidern.
Dieses Verfahren erzählte er selbst, ganz übereinstimmend mit den Aussagen einiger Anverwandten, die auch darum wussten, und bemerkte weiter: bisweilen habe sein Vater dergleichen Entwendungen entdeckt, bisweilen auch nicht. Wenn er es aber bemerkt habe, habe derselbe grausig gethan. So oft er aber seinem Vater Geld genommen, habe er auch etwas verdient gehabt. Sein Vater habe ihm jedoch nie etwas Geld gegeben; „er hätte ihm wohl auch einen Kreuzer geben dürfen, denn er habe ihm Alles verdient durch's Weben.” Hierüber hätte er sich denn auch manchmal, wie bezeugt wurde, gegen andere Personen beschwert.
Uebrigens gab er weiter an, sein Vater sei meistens gut gegen ihn gewesen, und er habe auch seinen Vater schier immer leiden mögen. Nur wenn er etwas nicht recht gethan, habe ihn derselbe ausgezankt. Auch gehen die Zeugenaussagen durchgängig dahin, dass Vater und Sohn im Wesentlichen gut miteinander gestanden seien, und der Vater dem Sohne nur Zurechtweisungen gegeben habe, wenn er dazu Grund gehabt. Indessen erklärte der Ortsvorstand noch insbesondere: der alte Grotz habe sich einmal, beiläufig vor einem Jahre, jedoch mit dem Beifügen, dass er keine ämtlichen Vorkehrungen verlange, bei ihm über seinen Sohn beklagt, dass dieser öfters gegen ihn meisterlos sei und sich seinen Anordnungen nicht immer fügen wolle. Hierbei habe er bemerkt, dass er seinem Sohne schon mehrere Mal gedroht, er wolle ihn bei dem Schultheissen verklagen, 262 was auch bisher geholfen habe. Im vorangegangenen Winter habe der alte Grotz, im Vertrauen, über die epileptischen Zustände seines Sohnes geklagt, und dass derselbe dabei seit einigen Jahren so vergesslich sei.
Gegen eben diesen Schultheissen betrug sich, nach dessen Angabe, der junge Grotz, immer sehr gut, und erwies ihm stets eine besondere Achtung, wenn er ihm begegnete, wogegen es auch der Schultheiss gegen ihn an Ermahnungen zu seinem Besten nicht fehlen liess. Bemerkenswerth ist aber ferner, dass sich Grotz, wie er im Verhöre selbst erklärte, schon seit einiger Zeit mit Heirathsgedanken beschäftiget hatte, die er jedoch vor seinem Vater geheim hielt. Eine bestimmte Weibsperson will er dabei nicht im Auge gehabt, sondern nur gedacht haben: er heirathe, wenn er Jemanden bekomme. Einmal, erklärte er indess in dieser Beziehung weiter, habe er zwar auch seinem Vater so etwas von seiner Absicht zu heirathen gesagt, dieser ihm aber erwiedert, dass er nirgends eine Person bekomme, und er (der Vater) ihn fortschicken würde. Dann habe er gedacht, er schweige lieber, und habe überhaupt die Sache aus sein lassen. Uebrigens besorgte dem alten Grotz seit seinem Witwenstande eine ledige Weibsperson die Haushaltung, ohne jedoch im Hause zu schlafen. Nach ihrer Angabe soll ihr auch der Witwer Heirathsanträge gemacht, sie aber noch nicht ihr Jawort gegeben gehabt haben; der junge Grotz erfuhr zwar nichts Näheres davon, doch besorgte er wohl eine Wiederverheirathung seines Vaters, und dass dann das Vermögen an andere Leute komme. Durch Zeugen ist ferner erhoben, dass Grotz ungefähr ein Jahr vor der verübten Tödtung seines Vaters demselben einmal von der Werkstatt entlief, im Freien mit sonderbaren Blicken und auffallenden Geberden herumsprang und nur mit Mühe von einigen ihm begegnenden Einwohnern des Dorfes wieder nach Hause gebracht werden konnte.
Uebrigens gibt ihm die Ortsobrigkeit das Zeugniss, dass er ein fleissiger Arbeiter gewesen, so lange er nicht mit dem fallenden Weh behaftet war, und dass er sich sowohl gegen seinen Vater als gegen andere Personen im Ganzen ordentlich betragen habe. Zugleich erklärte sie sich aber auch hinsichtlich des physischen Zustandes des Grotz dahin: dass derselbe, so lange er mit der Epilepsie befallen sei, kaum den nothdürftigsten Verstand zum geselligen Leben besessen habe. Und auf ähnliche Weise sprachen sich darüber Verwandte und andere Zeugen aus, indem sie erklärten, dass sich zwar bei Grotz in seinem bisherigen Leben keine Spuren von Verrücktheit gezeigt hätten, dass er aber schwache Verstandeskräfte und ein sehr schwaches Gedächtniss habe, welches Alles 263 wahrscheinlich durch den epileptischen Zustand allmälig herbeigeführt worden sei. Zum Zorne, bemerkten sie weiter, sei er zwar nicht besonders geneigt gewesen, doch habe er öfters einen eigenthümlichen scharfen Blick gehabt, mit dem er Andere anstarrte, wenn er über etwas, welches man ihn thun hiess oder an ihm tadelte, unzufrieden war. Wenn man ihn im ersteren Falle fragte: „Thust du das?” habe er nur geantwortet: „Wenn ich muss.”
Die Geschichte der That selbst und der damit in Verbindung stehenden Umstände ist nun diese:
Am Sonntage (den 22. April), an dem Tage der That, bemerkte die Haushälterin des alten Grotz an dessen Sohn gegen sonst durchaus nichts Auffallendes. Nur einmal hatte derselbe, nach ihrer Aussage, einen epileptischen Anfall, der nicht stark war, indem Grotz nur umfiel und sogleich wieder aufstand. Er selbst wollte nachher von diesem Anfalle gar nichts wissen. Uebrigens war er an diesem Tage gestimmt wie immer, und sprach, wie sonst auch, nicht viel; er und sein Vater betrugen sich gegeneinander wie gewöhnlich, und die Haushälterin bemerkte nicht im Geringsten, dass Beide einander geärgert oder gezankt hätten. Den Nachmittag brachten Vater und Sohn in einem Nachbarhause ganz einig mit einander zu, und gegen 7 Uhr Abends gingen sie, wie gewöhnlich an den Sonntagen, zusammen in die Branntweinschenke und tranken, nach den Zeugenaussagen, mit einander nicht mehr als einen halben Schoppen Branntwein, wozu sie Brot assen.
Sie waren auch da freundlich beisammen, und gingen um 10 Uhr, ohne dass sie, wie mehrere Zeugen versichern, im Mindesten betrunken gewesen wären, mit einander ruhig nach Hause.
Die nun zu Hause, wo jetzt Vater und Sohn allein waren, dem Verbrechen zunächst vorangegangenen Umstände blieben durch die vor Gericht geschehenen Aussagen des jungen Grotz in einiges Dunkel gehüllt, während er dagegen die That selbst, jedoch nur allmälig auf wiederholte Fragen, umständlich und klar eingestand.
Als sie in jener Nacht nach Hause gekommen, gibt nämlich derselbe zuerst an, seien er und sein Vater miteinander in das gemeinschaftliche Bett gegangen und hätten geschlafen. Dann habe ihn sein Vater durch Schütteln aufgeweckt und mit ihm Händel angefangen, zu welcher Zeit aber dies geschehen, wusste er nicht anzugeben; dass übrigens das Bett wirklich in jener Nacht gebraucht wurde, davon fand man nachher noch Spuren.
264 Auf die verschiedenen, deshalb an Grotz gemachten Fragen blieb derselbe auch anfänglich bei der bestimmten Behauptung stehen, dass nach dem Erwachen sein Vater in der Kammer am Bette mit ihm Streit angefangen habe, sehr erzürnt gewesen sei, ihn gescholten und ihm erklärt habe: er gehe nun zum Schulzen, lasse ihn aus dem Hause jagen und lasse ihn nicht mehr herein.
Ueber die Veranlassung dieses Aufweckens und dieses zornigen Ausbruches seines Vaters gab jedoch Grotz vorerst keinen genügenden Aufschluss. Er erklärte in dieser Beziehung, er wisse den Anfang nicht, sein Vater habe ihn aber verscholten, er wisse selber nicht, warum sein Vater so erzürnt gewesen sei, derselbe habe aber viel Branntwein getrunken gehabt.
Auf den Vorhalt aber, dass sein Vater damals nicht betrunken gewesen sein könne und doch einen Grund gehabt haben müsse, warum er über ihn unzufrieden gewesen sei, äusserte er nur: „ich habe ihm Geld genommen, schätz' wohl —” und legte dann auf weitere Fragen folgende nähere Geständnisse ab:
Nachdem sie des Nachts von dem Bäcker nach Hause gekommen, habe er aus den Hosen des Vaters, die auf der Bank in der Stube gelegen seien, ihm Geld aus seinem Beutel genommen und habe es in seinen eigenen Beutel gethan, damit er es habe, wenn er es brauche; wozu er es aber gebrauchen wolle, das habe er noch nicht gewusst. Wo sein Vater gerade gewesen, als er das Geld genommen habe, wisse er nicht. Sein Vater habe die Entwendung wahrgenommen, indem er in seine Hosen gelangt und den Geldsäckel nimmer gefunden habe. Hierauf habe sein Vater ihn gezankt und ihm erklärt, er verklage ihn beim Schulzen und lasse ihn fortjagen, und wie er dann so darüber gelärmt habe, habe er ihn todtgeschlagen, und zwar aus dem Grunde, weil er so gelärmt und gebalgt (gezankt) und gesagt habe: er wolle ihn fortthun lassen. Alles Geld, erklärte Grotz weiter, habe er seinem Vater anfangs nicht aus dem Beutel genommen, erst wie er seinen Vater todtgeschlagen gehabt, habe er es vollends genommen.
Obschon nun Grotz auch in weiteren Verhören und Aussagen über die Veranlassung und die Motive des an seinem Vater begangenen Verbrechens wieder variirte, obige Geständnisse zum Theile widerrief, und auch wieder bestätigte, somit über die Veranlassungs- und Bestimmungsgründe zur That kein ganz sicherer und vollkommener Aufschluss unmittelbar von ihm selbst erhalten werden konnte (wie auch aus seiner psychischen 265 Individualität leicht erklärbar ist), so ist doch so viel mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass zur Zeit des Entschlusses zur That bei dem Grotz eine zornige, feindselig aufgeregte Stimmung gegen seinen Vater und grosse Angst vor dem Herbeikommen des Schultheissen Statt gefunden haben müsse; denn so äussert er einmal bestimmt: „Weil er (der Vater) gesagt hat, er wolle mich aus dem Hause jagen lassen und nimmer hineinlassen, da bin ich zornig geworden über ihn;” und ein anderes Mal erwiederte er auf einige Fragen hinsichtlich seiner etwaigen Reue über die That: „Weil wir eben einander feind geworden sind; weil er gesagt hat, er wolle mich fortjagen lassen. Es sei ihm Angst gewesen wegen des Vogtes, wenn der in's Haus komme; er habe freilich eine grosse Sünde gethan, dass er seinen Vater todtgeschlagen; jetzt reue es ihn, wenn er so darüber nachdenke.”
Auch gestand er später noch ein, ehe er seinen Vater todtgeschlagen, habe er (nach gefasstem Entschlusse zur That) bei sich gedacht: wenn es Niemand gesehen hat, dann sage ich, er wäre gestorben. Er habe auch gedacht, es gebe genug Leute, die auch zu ihm gehen wegen dem Kochen, und ein Weibsbild, das ihm koche. An eine bestimmte Weibsperson und an's Heirathen habe er aber damals noch nicht gedacht.
Ueber die Vollführung der That ist nun Folgendes das Resultat der von ihm mit Bestimmtheit abgelegten Geständnisse.
Nachdem ihm sein Vater die obenerwähnte drohende Erklärung gemacht hatte, stand derselbe vom Bette auf und ging mit der Aeusserung, dass er sich nun zum Schulzen begeben werde, die Treppe hinab und zum Hause hinaus. Sein Sohn folgte ihm aber unangekleidet und nur im Hemde mit dem schon jetzt gefassten Vorsatze, ihn zu tödten, alsbald nach, ohne gegen seinen Vater etwas zu äussern. Sein Weg führte von der Stubenkammer in die Stube, aus derselben über den nur vier Schritte langen oberen Hausgang und die zwölf Stufen hohe Treppe hinab in den unteren Hausgang. Nahe an der Treppe geht, wenn man von derselben herabkommt, rechts hinein in den sieben Schuh langen Hausgang die Thüre zu dem Webergewölbe. In Letzteres, worin damals, wie gewöhnlich, der Schlüssel stak, ging der junge Grotz, und holte daraus eine unter einigen daselbst befindlichen Aexten gewählte Axt der schwersten Art, um damit seinen Vater todtzuschlagen: Mit dieser Axt in der Hand, die er auch nachher bei der gerichtlichen Untersuchung als das Werkzeug seines Verbrechens anerkannte, ging er nun seinem Vater nach, welcher, wie er angibt, sprang, und traf ihn vor dem Hause des Nachbars Oppler. 266 Dieses Haus liegt der Richtung des Weges, der zu der Wohnung des Schultheissen führt, entgegengesetzt, über der Strasse hinüber, etwas abwärts von dem Hause des Grotz. Wie und warum der alte Grotz zu diesem Hause gekommen, darüber erklärt sich der Sohn nicht genügend. Indess erreichte dieser seinen Vater, als derselbe ganz nahe an dem Thore der mit dem Hause des Oppler verbundenen Scheuer war, und versetzte ihm dort mit der Haube, d. i. dem breiten Theile der Axt, zwei Streiche hinten auf den Kopf, ohne dass er dabei gegen seinen Vater eine Aeusserung machte. Dieser soll nun aber, so wie er die Streiche erhalten, arg gelärmt und auf seinen Sohn geschimpft haben, was dann Letzteren, wie er sagt, noch in der Vollbringung der That bestärkte. Er führte dann seinen Vater, der nach den Streichen noch laufen konnte, indem er ihn über den Hals herum hielt, quer über die Strasse hinüber, neun Schritte weit bis nahe an die Ecke der gleichfalls mit dem Hause verbundenen eigenen Scheuer (wo sich nachher auch starke Blutspuren fanden), und dort versetzte er demselben mit der Haube der Axt drei weitere Streiche vornehin an den Kopf, überall, wie er sagt, wo es hin ging. Auch nach diesen weiteren Streichen fiel der Vater, nach der Behauptung des Sohnes, noch nicht um, sondern lief noch zwölf Schritte weit zu seinem Hause hin, wobei aber das Blut von ihm strömte, und besonders die Thürschwelle, die Thür am Hause und den Eingang des Hauses selbst stark befleckte. Jetzt aber war der Verletzte nicht mehr im Stande weiter zu laufen. — Damit nun, erzählt der Thäter weiter, die Leute nicht sähen, dass sein Vater blute, und dass sie etwas mit einander haben, fasste er, mit dem Gesichte gegen des Vaters Gesicht gekehrt, denselben unter den Schultern um den Leib, trug ihn zur Thüre hinein, durch den Hausgang bis zur Treppe, und dort liess er ihn fallen, so dass der Verletzte mit Kopf und Schultern auf die untersten Stufen der Treppe zu liegen kam und das Gesicht in die Höhe kehrte. Er lebte noch etwas, und rief noch, nach des Thäters Behauptung, indem er durch den Hausgang geschleppt worden, seinem Sohne zu: „Du Hund!” Nachdem nun dieser zuvor die Hausthür zugeschlagen hatte, damit, wie er sagt, Niemand hereinkomme, schlug er seinen Vater, wie er sich selbst ausdrückte, an der Stiege vollends todt, indem er ihm in der schon beschriebenen Lage mit der Haube der Axt noch drei Streiche vornehin an den Kopf versetzte. Die Ueberzeugung, dass sein Vater durch diese Streiche vollends getödtet worden sei, sprach Grotz wiederholt und insbesondere mit den Worten aus: „Und Alles ist nun aus gewesen.” Nach diesem nahm er dem Getödteten, 267 kurz ehe die Wächter herbeikamen, das Geld vollends aus dem in dessen Hosentaschen befindlichen Beutel, so viel noch darin war, und zwar, wie er wiederholt erklärte, damit er es gewiss habe, dass es niemand Anderer bekomme, da so Leute zu ihm hineingeschrien haben.
Die Axt, womit er die That verübt hatte, verbarg er blos unter der Stiege, wo sie auch bald nachher gefunden wurde. Nach der Verbergung der Axt begab er sich in die Schlafkammer und zog dort, weil sein Hemd blutig geworden war, ein frisches an, damit (wie er sagte) Niemand das Blut sehen sollte. Jenes Hemd fand sich auch nachher in der Schlafkammer vor, an der ganzen Vorderseite und vorzüglich an der Brust sehr blutig. Als sich Grotz dieses Hemdes entledigt hatte, hielt er sich, ohne dass er sich wieder in das Bett legte, theils in der Wohnstube auf dem Lotterbette auf, theils auch einige Zeit auf der Bühne, wohin er von der Küche aus eilte, um sich zu verstecken, als er vor dem Hause Lärmen hörte. Dort verweilte er aber nicht lange, sondern ging bald wieder, durch das Lärmen und Anklopfen der herbeigekommenen Wächter beunruhigt, hinunter in die Stube und öffnete sodann, wie schon erzählt worden, die Hausthüre.
Am anderen Morgen wurde nun derselbe zu dem Untersuchungsgerichte abgeführt, und am folgenden Tage die Legalinspektion und Sektion des Getödteten, eines 66jährigen Mannes, der von einer sehr kräftigen und gesunden Körperbeschaffenheit gewesen, in gehöriger Form vorgenommen. Nach dem Befunde dieser Leichenschau erklärten die obduzirenden Aerzte die am Leichnam wahrgenommenen Wunden für absolut tödtlich, und gaben dann ihr Schlussurtheil dahin ab: dass der Tod des alten Grotz die unvermeidliche Folge der ihm von seinem Sohne beigebrachten Verletzungen gewesen sei.
Nach diesem Resultate der Leichenschau und nach den oben angegebenen ausführlichen und wiederholten Bekenntnissen des jungen Grotz, verbunden mit den übrigen erhobenen Umständen, war somit in diesem Falle der Thatbestand einer von Grotz an seinem Vater verübten vorsätzlichen Tödtung ausser Zweifel gestellt. Nicht eben so leicht konnte aber die Frage entschieden werden, ob diese vorsätzliche Tödtung für einen wirklichen Mord oder nur für eine im Affekte begangene Tödtung, d. i. einen Todtschlag, anzunehmen sei, denn für die eine und für die andere dieser Annahmen gab die sehr genaue gerichtliche Untersuchung, wobei jedoch die Individualität des Angeschuldigten, wie seine oben dargelegten verschiedenen Aussagen selbst beweisen, manche Schwierigkeiten darbot, mehrere Momente an die Hand, doch würde eine ohne Zweifel überwiegende 268 Zahl und die Beschaffenheit der für einen blossen Todtschlag sprechenden Daten den Entscheidungsrichter, wenn er sich über diesen Punkt näher auszusprechen aufgefordert gewesen wäre, zu dieser Annahme eines blossen Todtschlages wohl bestimmt haben. Allein die Frage über diesen Punkt bedurfte unter den übrigen gegebenen Umständen eigentlich keiner besonderen Entscheidung, weil es sich in dem vorliegenden Falle hauptsächlich und vor Allem um die durchgreifende Frage handelte, ob der, der Tödtung seines Vaters geständige Grotz überhaupt, und in Bezug auf diese That insbesondere, für zurechnungsfähig anzunehmen sei, denn gegen seine Zurechnungsfähigkeit hatten sich allerdings aus seinem ganzen Benehmen während der Untersuchung, und vorzüglich aus einzelnen bei derselben von ihm geschehenen auffallenden Aeusserungen, so wie aus den über seine Persönlichkeit, seine epileptischen Anfälle, geschwächten Geisteskräfte und seine bisherige Aufführung erhobenen näheren Notizen, so bedeutende Zweifel ergeben, dass sich für das Entscheidungsgericht diese Frage wegen der Zurechnungsfähigkeit des Angeschuldigten als die eigentlich zu fixirende und zu lösende Hauptfrage darbot. In Beziehung hierauf haben wir daher noch folgendes Nähere zu bemerken.
Während des Transportes nach Balingen (zur gerichtlichen Untersuchung) sagte Grotz einmal zu seinen Begleitern: „Jetzt will ich weiben (ein Weib nehmen), jetzt darf ich weiben; mein Vater hat mich nicht wollen weiben lassen; jetzt bin ich Meister, jetzt gehört die Sache Alles mein.” Ein anderes Mal fragte er sie aber auch: „Bringt man mich um? Thut man mir etwas?” und äusserte dabei lebhaft den Wunsch, dass er nur noch leben dürfte.
Im ersten gerichtlichen Verhöre sprach er, gegen seine Gewohnheit und bäuerische Uebung, in möglichst reindeutschen Ausdrücken, und gab dabei manche ungereimte Antworten, doch legte er allmälig auf eine zwar abgebrochene, aber doch deutliche Weise das Geständniss seines Verbrechens ab. In einem weiteren Verhöre benahm er sich jedoch sehr verschlossen, antwortete häufig auf die ihm vorgelegten Fragen: „ich weiss mit Wissen nix (nichts),” und machte auch öfters sinnlose, ungereimte Aeusserungen. In anderen späteren Verhören sprach er dagegen wieder mit Zusammenhang, und wiederholte seine Geständnisse mit aufrichtiger Reumüthigkeit. Uebrigens bekam er auch einige Male während der Verhöre selbst seine epileptischen Anfälle, und neben seinen in mehreren Verhören abgelegten klaren Geständnissen kamen immer auch von Zeit zu Zeit sonderbare Aeusserungen zum Vorscheine. So sagte er 269 z. B. einem Gerichtsbeisitzer, der zugleich Webermeister, folglich von seiner Profession ist: „So, Ihr seid mein Obermeister; wenn ich einmal ein Weib habe, will ich auch zu Euch kommen.” Gegen den inquirirenden und zugleich protokollirenden Oberamtsrichter zeigte er sich bald finster bald auffallend zutraulich, nannte denselben bald Ihr, bald Sie, und heftete insbesondere seine Aufmerksamkeit auf dessen Protokolliren. Er sagte ihm unter Anderem: „Ich meine, Ihr solltet doch einmal aufhören mit dem Schreiben, es wird ja so gross wie ein Buch, aus dem man beten kann.” Anzeigen von seinem schwachen Gedächtnisse ergaben sich auch bei den Verhören, und er selbst beschwerte sich dabei öfters über sein schlechtes Gedächtniss, indem er z. B. sagte: wenn man ihn viel frage, erinnere er sich nichts; und ein anderes Mal: „Wenn man so viel denken muss und schreibt, du lieber Gott! ich weiss nichts mehr, man mag mich fragen, was man will.” Bei wichtigeren Fragen, welche seine Besinnungskraft in Anspruch nahmen, wurde er zuweilen ungeduldig, zornig, gab aber doch Auskunft; auch bemerkte der Inquirent überhaupt, dass Grotz bei Fragen, die sein Gedächtniss anstrengten oder Vorhalte enthielten, einsylbig und verdriesslich war, und zuweilen einen ihm eigenthümlichen zornigen Blick machte; wogegen er, wenn man den Gegenstand der Fragen auf eine ihm angenehme Weise wechselte, zu seiner etwas grinsenden, tölpischen Freundlichkeit überging, die er besonders auch dann annahm, wenn er von seiner Freilassung sprach. Häufig gab er in den Verhören den dringenden Wunsch zu erkennen, bald wieder nach Hause entlassen zu werden; erzählte dabei, wie er sich dann in seinem väterlichen Hause beschäftigen würde, und erklärte auf die ihm deshalb gemachten Fragen: „es wäre freilich grausig, im Hause seines getödteten Vaters zu sein, aber er wüsste sonst nirgends hin.” Reumüthig über die That zeigte er sich jedoch im Ganzen nicht; nur traten zuweilen Augenblicke ein, wo einige Gewissensvorwürfe, gemischt aber mit Angst über die Folgen seiner That, bemerkbar wurden. In einem der letzten Verhöre machte ihm der Inquirent nähere Instanzen über seine Kenntniss der Strafbarkeit des verübten Verbrechens. Als er zu diesem Behufe über die zehn Gebote befragt wurde, wollte er sie anfangs nicht kennen, zeigte aber doch nachher das Gegentheil. Auf die Frage, was vom Tödten darin stehe, sagte er das Gebot her: du sollst deinen Vater und Mutter ehren; auf wiederholte Fragen das: du sollst nicht stehlen; endlich aber, nachdem man ihm vorgesagt hatte: du sollst nicht — fügte er hinzu: „tödten.” Auf die Frage, ob er bei der That an die zehn Gebote gedacht habe, erklärte er: „Ich habe 270 nichts gedacht.” Die Frage: ob er nicht gedacht habe, dass es eine grosse Sünde sei, was er gethan, beantwortete er damit: „Ich sage nicht Nein und nicht Ja; ich weiss nichts davon; da könnt Ihr schreiben, was Ihr wollt, ich hab' an nichts so gedacht.” Auf die Frage: ob er denke, dass er eine grosse Strafe verdient habe, sagte er: „Ich denke es jetzt freilich; er wisse aber nicht, was für eine Strafe man ihm gebe; es reue ihn, dass er seinen Vater todtgeschlagen habe.” Gegen das Ende der Untersuchung zeigte sich bei ihm vorzügliche Angst über sein Schicksal. Als er nun um diese Zeit mit einem ihm näher bekannten Einwohner von Thieringen konfrontirt wurde, sagte er zu diesem: „Ich habe jetzt immer gebeten, Gott solle es mir eingeben, wer schuldig sei daran, ich oder mein Vater, weil er immer so gebalgt (gezankt) hat; ich habe das ganze Büchle (das Spruchbuch) ausgebetet, und da ist es eben immer gekommen, dass ich es habe thun müssen, weil er so gebalgt hat.” Und nun erzählte und zeigte er näher dem Inquirenten, dass er in seinem Gefängnisse durch Aufschlagen von Zahlen im Spruchbuche und durch Losen mit Strohhalmen darüber, ob er oder sein Vater schuldig sei, Entscheidung gesucht habe, und dass es richtig so ausgefallen, dass sein Vater also schuldig gewesen sei. Er zeigte sich mit diesen Versuchen sehr zufrieden, und schien der Sache völlig Glauben beizumessen. Gleichwohl gab er hinwieder auf eine spätere Frage: warum er an diese Proben glaube, die Antwort: „Ja, weil es mir so fürgegangen ist; ich glaube es weiter nicht, ich sag's nur.” Auf die Frage im Schlussverhöre: ob er nicht denke, eine grosse Strafe verdient zu haben, antwortete er: „Ich glaube nicht,” und auf die weitere Frage: ob er sich mit etwas vertheidigen könne: „Ich weiss nix mehr, und wenn man nix weiss, kann man auch nix sagen.”
Gegen das Ende der Untersuchung bewies sich Grotz einmal so unbotmässig gegen einen seiner Wächter, und hielt ihn am Wamms, weil dieser Wächter nicht mehr geduldet hatte, dass Grotz sein Wasser statt in den Nachtstuhl vor der Thüre abschlage. In der darauffolgenden Nacht lief er von 12 Uhr bis Morgens 7 Uhr schlaflos im Gefängnisse auf und ab, verlangte vom Wächter, er solle ihm aufschliessen, er wolle nach Thieringen, er bleibe nicht mehr in diesem Hause; er hatte dabei die Beinkleider offen, sah in den leeren Nachtstuhl und äusserte: es sei so viel Wasser darin, er könne nicht fort wegen dem Wasser. Als ihm dabei der Wächter mit einem Stecken drohte, erklärte er: er wisse nichts, er thue ihm nichts, und zeigte überhaupt Spuren davon, dass er nicht recht bei sich war. Er hatte auch weiterhin manche unruhige Nächte, und konnte wegen gestörter 271 Phantasie nicht schlafen, was er selbst mit den Worten erzählte: er könne nicht schlafen, er habe so Angst, und es komme Nachts ein Männlein zu ihm, das sage, er müsse sterben. So lange sein Untersuchungsarrest gedauert, hatte er, mit wenigen Ausnahmen, jeden Tag wenigstens einen epileptischen Anfall, oft auch zwei, etliche Male drei. Die gewöhnliche Dauer dieser Anfälle war einige Minuten, und einmal eine Viertelstunde. Uebrigens zeigten diese Anfälle in ihren Erscheinungen nichts besonders Abweichendes von denen anderer Epileptiker; sie stellten sich ebenfalls häufiger und heftiger dann ein, wenn Grotz in Folge der Verhöre oder anderer Veranlassungen in Zorn gerathen war.
Spuren von wirklicher Verrücktheit wollte der Inquirent während des ganzes Laufes der Untersuchung an Grotz nicht bemerkt haben. Dagegen ergab sich ihm deutlich, dass derselbe an Gedächtnissschwäche und Stumpfheit der Geisteskräfte überhaupt leide. Er schilderte ihn auch in seinem ganzen Benehmen als ziemlich tölpisch, launisch und zum Zorne geneigt, und wenn er im Zorne sei, habe sein Blick etwas Bösartiges und Grausendes.
Das Gutachten des Oberamtsarztes über den Seelenzustand des von ihm während der Untersuchung mehrmals beobachteten Angeschuldigten ging im Wesentlichen auf den Grund seiner Beobachtungen und auch der aus den Akten geschöpften Notizen dahin: derselbe sei weder als ganz noch als periodisch wahnsinnig, auch nicht als wirklich blödsinnig anzusehen. Dagegen habe schon bei ihm vor der Zeit der That Dummheit (Stupidität) Statt gefunden. Ausserdem sei aber derselbe zur Zeit der That neben seiner Dummheit in einem wirklichen Zustande eines ausserordentlichen Antriebes zur That gewesen, in welchen Zustand der Grotz von dem Getödteten durch Furcht, Argwohn, Zorn und eine Art von Verzweiflung gebracht worden, und habe somit auch unbestritten die That in diesem kranken Seelenzustande und in einem Furor (in der Raserei) verübt.
Mit diesem gerichtsärztlichen Gutachten konnte sich indessen, bei der Wichtigkeit der Sache, der Kriminalsenat des Gerichtshofes zu Tübingen nicht begnügen, sondern fand zum Behufe seines definitiven richterlichen Ausspruches in Ansehung der Zurechnungsfähigkeit des Grotz auch noch die Einholung des Gutachtens der medizinischen Fakultät daselbst nöthig. In dieser Beziehung wurde dieselbe, unter Mittheilung sämmtlicher Akten, insbesondere um die Beantwortung folgender Fragen ersucht:
272 1. ob der Angeschuldigte an dauernder Geisteskrankheit oder Geistesschwäche leide, und im bejahenden Falle
2. an welcher Art;
3. in wie weit dadurch dessen Willensfreiheit als aufgehoben zu betrachten sei, und
4. ob nicht der Angeschuldigte zu der Zeit, als er den Entschluss zu dem Verbrechen gefasst und ausgeführt, in einem Zustande völliger Unfreiheit seiner Seele gehandelt habe.
Diese Fragen beantwortete nun die Fakultät mit aller durch die Sache gebotenen Genauigkeit und Umsicht, und der Inhalt ihres Gutachtens, den wir um seines psychologischen Interesses willen in allen Hauptpunkten hier ausheben, ist dieser:
„Die bei dem Grotz schon vor mehreren Jahren eingetretenen und sich so häufig wiederholenden epileptischen Anfälle bezeichneten in ihrer Erscheinung ganz diejenige Art von Fallsucht, bei welcher das Gehirn selbst die Ursache des Uebels enthalte, und wo es nicht blos aus Mitleidenschaft von einem anderen Theile des Nervensystemes aus leide; dass aber besonders diese Art von Epilepsie allmälig immer mehr das Gedächtniss und zuletzt den Verstand selbst schwäche, und am Ende zu wirklichem dauerndem Blödsinne führe, sei eine allgemeine Beobachtung. Diesem Erfahrungsgrundsatze entsprechend, hätten sich denn auch nach den aktenmässigen Notizen die Seelenkräfte des Grotz schon vor seiner That mehr und mehr abnehmend gezeigt. Da nun derselbe ausser seiner Epilepsie nie krank gewesen, aber nachdem ihn dieses Uebel befallen, immer unbrauchbarer geworden sei, so könne man mit Sicherheit die erste der obigen Fragen dahin beantworten: der Verbrecher ist ein Kranker und leidet, auch ausser seinen epileptischen Anfällen, durch diese seine körperliche Krankheit an erkennbarer dauernder Geistesschwäche.
Diese aber ist bei ihm, ausser Gedächtnissschwäche, auch Verstandesschwäche, und zwar in letzterer Bedeutung zugleich Dummheit und Blödsinn, insofern man unter Dummheit (im engeren Sinne) diejenige Beschränktheit des Verstandes begreift, bei welcher ein Mensch sich unfähig der nöthigen Umsicht im Handeln zeigt, weil er immer nur einen Gegenstand auf einmal aufzufassen vermag, wobei er zwar nicht ohne Causalnexus handelt, aber ohne alle Klugheit verfährt, eben weil er nicht fähig ist wahrzunehmen, dass auch andere gleichzeitige Umstände so wichtigen Einfluss haben, dass sein Handeln, sobald er jene ausser Acht lässt, völlig den vorgesetzten Zweck verfehlen muss. In einigem Gegensatze 273 zur Dummheit wird mit Recht der Blödsinn dahin bestimmt, dass er eine Geistesschwäche ist, die hindert, überhaupt vernünftige Folgerungen aus dem, was man wahrnimmt, zu ziehen, auch wenn das noch vorhandene Wahrnehmungsvermögen nicht blos einen beschränkten Gegenstand umfasst, wie dieses die Dummheit thut. Im höheren Grade von Blödsinn fehlt es zwar schon an der gehörigen Kraft des Wahrnehmungsvermögens für äussere Gegenstände, in den mittleren Graden des Blödsinnes kann aber die Wahrnehmung für mehrere gleichzeitige äussere Gegenstände noch hinreichend vorhanden sein. Der Blödsinnige vermag aber überhaupt nicht das, was er wahrnimmt, verständig so zu bearbeiten, dass ein Resultat seines Nachdenkens dadurch entstände, welches seinen Willen zu einem zweckmässigen Handeln zu bestimmen vermöchte.
Mehr oder minder Schwäche aller Seelenfunktionen begleitet nothwendig den Blödsinn, aber nicht nothwendig die Dummheit, die trotz der Beschränktheit ihres geistigen Wahrnehmungsvermögens in Hinsicht ihres einzelnen Gegenstandes sehr energisch handeln kann.
Hartnäckigkeit bei einem einmal gefassten Entschlusse ist sogar bei der Dummheit sehr gewöhnlich, aber auch natürlich, da bei ihr die Seele unfähig ist, einen Entschluss durch Vergleichung mit anderen und mit den entfernteren wahrscheinlichen Folgen zu berichtigen. Insofern will zwar immer der Dumme, aber im Verhältnisse zum Grade seiner Dummheit nur mit Einseitigkeit, d. h. ohne vorausgegangene Wahl, die er nicht vornehmen kann. Vergesslichkeit und Gedächtnissschwäche sind die gewöhnlichen Begleiter des Blödsinnes, weil Schwäche des Hirnes zunächst auch Gedächtnissschwäche verursacht, und nun wieder nichts so sehr den Gebrauch des Verstandes einschläfert, als wenn Wahrgenommenes nicht mehr verglichen werden kann mit anderen Thatsachen, die das Gedächtniss liefern sollte. Bei der Dummheit ist aber nicht nothwendig eben so sehr allgemeine Gedächtnissschwäche, wenigstens nicht für den einzelnen einmal eingeprägten Gegenstand, vorhanden. — „Ich habe nicht daran gedacht,” sagt der Dumme bei dem einfachsten Vorhalte, den man ihm macht; der Blödsinnige aber antwortet: „Ich habe an nichts gedacht.” Bei dem Kranken nun, von dem hier die Rede ist, spricht ein allgemeines Abgestumpftsein, eine allgemeine Schwäche seiner Seelenfähigkeiten für einen bedeutenden Grad von Blödsinn. Doch hat er dabei eine Neigung, seine geringe Geistesthätigkeit auf eine unbesonnene Art auf einzelne Gegenstände mit Eifer 274 anzuwenden, z. B. auf die Aussicht auf die Erbschaft von seinem erschlagenen Vater; auf die, ein Weib zu nehmen; auf den Wunsch, aus seinem Gefängnisse ohne Weiteres wieder nach Hause entlassen zu werden.
Er ist also in bedeutendem Grade blödsinnig und in noch höherem dumm. Zwei Vorstellungen spielen eine Hauptrolle in seiner Seele: er hätte gern ein Weib gehabt; mehr aber als darüber hatte er ohne Zweifel Sorge, weil er wusste er sei der einzige Erbe seines Vaters, dass das ihm künftig zufallende Vermögen nicht durch Wiederverheirathung seines Vaters an andere Leute komme.
Bei der Vollführung des Verbrechens wusste Grotz zwar wohl, was er thun wollte und was er that. Allein wie unfähig er war, auch nur an das Allernächste daneben zu denken, welcher tiefe Grad von Dummheit also bei ihm Statt hatte, ergibt sich schon ausser vielem Anderen daraus, dass er glaube konnte, man werde seinen Vater, der blutend mit so viel furchtbaren Wunden an der Treppe lag, ohne weitere Nachfrage für gestorben oder todtgefallen halten, dass er denselben im Hausären liegen liess und die Axt, womit er ihn erschlagen hatte, nur unter die Treppe steckte, wo sie Jedermann gleich finden konnte.
Dass er aber auch im bedeutenden Grade überhaupt blödsinnig sei, wenn Blödsinn in dem oben angeführten Sinne genommen werde, ergebe sich aus dem Benehmen und vielen Aussagen des Angeschuldigten während der ganzen Untersuchung.
Wenn auf der anderen Seite der Verbrecher in seinem Dorfe nicht gerade als völlig blödsinnig bekannt war, und in den Verhören selbst einzelne Aeusserungen von ihm vorkommen, die wenigstens einige Verstandesreflexionen verrathen, so kommt hier dagegen in Rechnung, dass der Verbrecher nicht an einem angebornen oder schon in der frühesten Jugend vorhandenen, oder aus einem plötzlichen, durch eine Krankheit entstandenen, schlagflussartigen Blödsinne leidet, sondern dass er früher, noch am Ende der Schulzeit, gute Fähigkeiten hatte, und dass Epilepsie nur allmälig den Verstand schwächt. Vieles wird er also aus Gewohnheit noch vernünftig thun, und das, was im gemeinen Leben verhandelt wird, gleichsam mechanisch besorgen können, ohne von anderen Leuten darin abzuweichen. Da auch sein Verstand nicht in völliger gleichförmiger Allgemeinheit zum Blödsinn herabgesunken zu sein scheint, so wird er sogar in einzelnen, ihm besonders wichtigen Dingen immer noch einige Spuren von Ueberlegung zeigen können, bis 275 etwa die zunehmenden Folgen seiner Krankheit ihn zum völligen simpelhaften Blödsinn, falls er nicht früher seinen Anfällen unterliegt, werden gebracht haben.
Es könnte jedoch immer noch die Frage gemacht werden, ob nicht der Verbrecher sich nur blödsinnig stelle; allein die Gewissheit, dass er schon vor der That epileptische Anfälle hatte, nach ihnen häufig in einem verwirrten Zustande sich befand, dass er durch sie an Gedächtniss und Verstand geschwächt wurde, dass dieselbe gleichsam nothwendig sogleich entdeckt werden musste: alle diese Umstände entfernen völlig den Verdacht, als ob das ganze Benehmen des Verbrechers blosse Verstellung sei. Dazu kommt, dass alle Blödsinnigen und Verrückten zuweilen etwas Boshaftes zeigen, und nicht selten wirklich sich zu verstellen suchen, dass aber Leute gemeinen Standes, sobald sie an einem vollkommen Blödsinnigen und Verrückten so etwas bemerken, sogleich nun schliessen, die ganze Krankheit sei nichts als Bosheit und Verstellung.
Wichtiger wird hier die Untersuchung, ob Grotz nicht zuweilen verrückt, nicht blos blödsinnig sei, um so mehr, als Fallsucht und Verrücktheit nicht ganz selten miteinander verbunden sind. In diesem Falle wäre nicht blos davon die Rede, dass Grotz gewöhnlich nach seinen Anfällen zwar wieder aufsteht und willkürlich seine Glieder bewegt, aber eine kurze Zeit lang sein Bewusstsein offenbar noch nicht völlig wieder hat, nicht wahrnimmt, was eigentlich äusserlich mit ihm vorgeht, und auch nachher von diesem Zustande gar nichts mehr weiss. Es wäre die Rede davon, ob Grotz nicht auch zuweilen längere Perioden von eigentlicher Verrücktheit hätte, in welchen er unwillkürlich, oder nach falschen ihm vorschwebenden Einbildungen handeln müsste, und wobei er doch zugleich die äusseren Verhältnisse mehr oder minder deutlich wahrnehme, auch wenn die Periode vorüber wäre, mehr oder minder dessen, was in ihr vorgegangen, sich noch erinnern könnte, was fast immer bei eigentlichem Wahnsinne der Fall ist.
Es kommen auch in den Akten einige Vorfälle (die auch oben angeführt worden) vor, welche es sehr wahrscheinlich machen, dass zuweilen etwas der Art in dem Kranken vorgehe, und insbesondere zeigen die gegen das Ende der Untersuchung bei Grotz vorgekommenen nächtlichen Auftritte und Visionen, dass wenigstens in dieser Zeit der Kranke einem eigentlich verwirrten Zustande sich immer mehr näherte, dass also um so wahrscheinlicher auch schon früher wenigstens eine Neigung zu längeren Anfällen von wirklicher Verrücktheit bei ihm Statt hatte.”
276 Hierauf wurde die zweite der oben bemerkten Fragen von der medizinischen Fakultät dahin beantwortet:
„Die dauernde Geisteskrankheit oder Geistesschwäche ist eine allgemeine Abnahme seiner Seelenkräfte, besonders sehr grosse Gedächtnissschwäche; ausserdem Schwäche der Ueberlegungskraft überhaupt, vorzüglich aber Beschränktheit derselben blos auf den nächsten, den Inquisiten gerade stark interessirenden Gegenstand mit Unfähigkeit, auch die natürlichsten Folgen davon einzusehen, und endlich Stumpfheit alles moralischen Gefühles. Der Inquisit ist im höchsten Grade dumm und moralisch stumpfsinnig, überhaupt aber in bedeutendem Grade blödsinnig. Diese durch Epilepsie erzeugte krankhafte Abnahme seiner Geisteskräfte droht zugleich gegenwärtig immer mehr in ausbrechende Krankheit derselben, d. h. der allgemeinen Schwäche des Gehirns ungeachtet, in einseitige und die Freiheit der Seele aufhebende Aufreizung der Hirnfunktion, in wirkliche Verrücktheit, besonders der Einbildung und selbst der unwillkürlichen Triebe überzugehen.”
In Bezug auf die aufgestellte dritte Frage wird bemerkt:
„Selbst jetzt findet noch keine dauernde, wirklich krankhafte Verrücktheit bei dem Inquisiten Statt. Dummheit aber allein hebt nicht an sich das moralische Gefühl auf, sie also lässt selbst in der Beschränkung, dass der Wille nur nach einer Vorstellung handeln kann, die Einsprache des Gefühles von Recht oder Unrecht, ob überhaupt gehandelt werden solle, noch zu. Blödsinn stumpft zwar, sich überlassen, gleichförmig Wahrnehmung, Ueberlegung, moralisches Gefühl und Willen ab, damit aber lässt er noch ein relatives Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Seelenfähigkeiten zu, womit Freiheit der Wahl oder Willensfreiheit in ihm entsprechendem Grade doch noch möglich bleibt. Damit ist auch bei dem Inquisiten anzunehmen, dass weder ehemals, noch jetzt im gewöhnlichen Leben, wenn nichts seinen geringen Grad von Ueberlegungsfähigkeit Uebersteigendes vorkommt, und wenn er nicht einen Anfall, weder von halber Bewusstlosigkeit, wie nach seinen Paroxismen von Fallsucht, noch von verwirrter Unruhe, wie sie sich in neuerer Zeit bei ihm ausspricht, hat, seine Willensfreiheit nicht absolut aufgehoben sei.
Aber bei der krankhaften Dummheit, dem Blödsinne und der Abstumpfung des moralischen Gefühles, worin der Inquisit durch die Epilepsie verfallen ist, können eben so leicht Vorfälle sich ereignen, deren 277 Eindruck seine schwache Ueberlegungskraft übersteigt, die völlig sein moralisches Gefühl übertäuben, seinen schwachen Verstand ganz gefangennehmen und ihn gänzlich blos dem Antriebe, den Furcht oder eine andere überwältigende Gemüthsaffektion erzeugt, überlassen, in welchem Falle er dann keine Kraft, also auch kein Mittel mehr hätte, anders als dieser Furcht gemäss zu handeln. In solchem Falle wird er keine Willensfreiheit mehr besitzen, selbst wenn er dabei das Bewusstsein des einen, hierbei seine ganze Seele unwillkürlich und ausschliessend erfüllenden Gedanken, so wie der äusseren Umstände und seiner eigenen Handlungen behielte, und deswegen nachher noch angeben könnte, wie es zugegangen sei.
Wenn also nach der ganzen Ansicht des Seelenzustandes des gegenwärtigen Verbrechers, wie sie aus den Akten hervorgeht, die dritte Frage dahin beantwortet werden muss, dass bei dem Inquisiten Alles auf die jedesmaligen Umstände ankommt, ob Willensfreiheit, also auch Zurechnung bei ihm Statt finde, oder ob jene im minderen oder höheren Grade beschränkt sei oder ganz aufgehoben, so wird, bemerkt nun das Gutachten weiter, auch die vierte Frage: „Erscheint es nicht als zweifelhaft oder gar als wahrscheinlich, dass der Angeschuldigte zur Zeit, als er den Entschluss, seinen Vater zu tödten, fasste und ausführte, sogar in einem Zustande völliger Unfreiheit seiner Seele handelte?” blos aus der wahrscheinlichen Stärke der damaligen Beweggründe zu dieser einzelnen That, aus ihren Verhältnissen zu der Geistesschwäche und Krankheit des Verbrechers zu der Zeit, oder aus ihrem wahrscheinlichen Einflusse auf Erregung einer, wenn schon vorübergehenden, doch wirklich krankhaften Verrücktheit sich beantworten lassen.
Der Verbrecher beging seine That nicht in der Trunkenheit, ungeachtet er den Branntwein sehr liebte, wie überhaupt Blödsinnige stark aufreizende Sinneseindrücke lieben, und wie die aus den gemeinen Ständen namentlich gern Branntwein zu sich nehmen, weil sie ein dunkles Gefühl ihrer Kopfschwäche haben; und obschon der Inquisit am Abend vor seiner That mit seinem Vater in der Branntweinschenke gewesen war und dort getrunken hatte. Es wird ausdrücklich durch Zeugenaussagen bestätigt, dass weder der Vater noch der Sohn von jenem Branntweine im Mindesten betrunken geworden seien. Eben so wenig bestand eine eingewurzelte Feindschaft zwischen ihm und seinem Vater. Zwar hielt dieser ihn unter genauer Aufsicht, zankte viel mit ihm, drohte öfters, ihn wegzujagen, und der Sohn beschwert sich, dass er ihm so wenig oder beinahe 278 kein Geld gegeben habe, ungeachtet er dem Vater mit seiner Weberarbeit so Vieles verdiente. Gleichwohl lebten Beide friedlich miteinander, und der Sohn gibt selbst an: der Vater sei meistens gut gegen ihn gewesen. „Er (der Sohn) habe ihn (den Vater) schier immer leiden mögen. Der Vater sei meistens nur mit ihm verzürnt gewesen, manchmal habe er aber auch nichts gesagt.”
Aber der Inquisit fürchtete sich so sehr vor allem Zanke selbst, dass er, aus Abneigung vor solchem, lieber seinen Wunsch, ein Weib zu nehmen, unterdrückte, so viel dieser Gedanke zu heiraten ihn auch, wie selbst seine oben angeführten Aeusserungen nach der That zeigen, beschäftigte.
Am meisten fürchtete er aber, von seinem Vater aus dem Hause gejagt zu werden und um sein Erbtheil dadurch zu kommen; was freilich einem Menschen, der wusste, dass er an einer für unheilbar gehaltenen Krankheit leide, und der ohne Zweifel, dunkel wenigstens, seiner zunehmenden Verstandesschwäche selbst zuweilen sich bewusst wurde, nicht viel weniger, als ein völliger Untergang erscheinen musste.
Da er, wie schon angeführt wurde, eine zweite Heirat seines Vaters vorauszusehen glaubte, so besorgte er, wenn er nicht mehr im Hause sein würde, dass dann um so gewisser an Fremde das Vermögen kommen werde, welches nach des Vaters Tod ihm gehört haben würde.
Erst jetzt, an dem Abende vor der That, nahm er sich vor, seinen Vater todtzuschlagen. „Am Abend,” sagt er, „ist es geschehen; so ist es angegangen: dass er gebalgt hat, und hat gesagt, er wolle mich fortjagen, und wenn so was ist, da weiss man nimmer, was man thut.”
Auch lange nachher noch gibt er bei Gelegenheit, als er in seinem Gefängnisse durch das Loos mit dem Gebetbuche und den Strohhalmen erfahren wollte, ob er oder der Vater Schuld gehabt habe, an: da ist es denn immer gekommen, dass ich's hab' thun müssen, weil er so gebalgt hat.
Eben so, als er im Verhöre weinte und über die Ursache befragt wurde, antwortete er: „Ich muss eben greinen, dass ich so was hab' müssen thun — und so da (im Gefängnisse) sein muss.”
Jene Beweggründe zu der Tödtung und ihr Einfluss auf den Seelenzustand des Verbrechers ergeben sich bei aller Verwirrung und dem theilweisen Widerspruche, der nicht selten in den Aussagen des verstandesschwachen Inquisiten herrscht, allein konstant und klar. Das Verbrechen war nicht vorbereitet, nicht vorbedacht, und wenn nach des Verbrechers 279 oben angeführten Aeusserungen, als er verhaftet abgeführt wurde, es scheinen könnte, als wäre vielleicht der Entschluss zu dem Verbrechen schon vorher, und zwar zu dem Zwecke, ein Weib nach des Vaters Tod nehmen und ihn beerben zu können, gefasst worden, so widerspricht solcher Annahme das, was in den Aussagen des Inquisiten beharrlich sich gleich bleibt; auch die innere Uebereinstimmung dieser einfältigen Angaben unter sich und mit dem ganzen Seelenzustande des Kranken, wie er sich auch durch andere Umstände darstellt, spricht gegen eine solche Vermuthung. Jene Aussagen des Inquisiten erscheinen um so mehr als blosse Aeusserungen blödsinniger Freude über Errettung von dem gedrohten höchsten Uebel, dem, durch Wegjagen um die Erbschaft zu kommen, als hierbei auf die dümmste Art der Inquisit als Folge der Errettung diese für ihn wichtigsten, heiteren Aussichten in die Zukunft sich vormalt. Jetzt durfte er ja auch keine Furcht mehr haben, von seinem Vater wegen seiner Heiratspläne ausgezankt zu werden, was zu vermeiden ihm doch noch mehr am Herzen lag, als selbst ein Weib zu nehmen; denn auch auf die Fragen: „Was habt Ihr wegen des Heiratens (damals, als der Vater ihn deswegen ausgezankt hatte) weiter bei euch gedacht? Dachtet ihr, ihr wolltet doch heiraten, oder habt ihr den Gedanken (damals) aufgegeben?” antwortete er: „Nichts mehr habe ich gedacht, aus sein lassen, ich hab' an nichts mehr gedacht.”
Der Inquisit gibt zwar selbst an, er sei bei der That zornig auf seinen Vater gewesen, doch scheint es kein Anfall solchen blinden Zornes gewesen zu sein, dass er darin nicht mehr gewusst habe, was er thue; er gibt zu bestimmt den Zweck an, warum er die That begangen habe. Und obschon er im Verhöre und im Gefängnisse leicht zornig wurde, und selbst durch solche zornige Stimmung häufiger seine epileptischen Anfälle bekam, so brach doch nie — einen Fall offenbarer Verwirrung im Gefängnisse ausgenommen — sein Zorn in Heftigkeit oder in ein Toben aus, in welchem er blos aus Zorn seiner nicht recht mächtig gewesen wäre. Da auch keine Spur vorkommt, dass die That in einem jener oben angeführten Anfalle geschehen wäre, wo der Kranke längere Zeit untermischt seiner bewusst und doch dabei auch krankhaft verwirrt ist, so scheint die Meinung des Oberamtsarztes, als sei die ganze That wirklich „in einem Furor, in der Raserei” verübt worden, nicht ganz begründet zu sein, denn Verwirrtes kommt bei der ganzen That, wenn man die Verstandesschwäche des Inquisiten und den Zweck, den er seinen eigenen Angaben nach vorhatte, beachtet, eigentlich gar nichts vor. Auch hatte 280 der Kranke am Tage des Verbrechens nur Vormittags einen nicht starken, ihm sonst auch gewöhnlichen epileptischen Anfall. Er und sein Vater betrugen sich den Tag über gegen einander wie gewöhnlich, und ein Weibsbild, das dem Vater die Haushaltung führte, spürte nicht das Geringste, dass sie wären übereinander erzürnt gewesen. Auch Nachmittag zeigte sich nichts Auffallendes an dem Inquisiten, er hatte auch einen epileptischen Anfall, und zwischen ihm und seinem Vater war Einigkeit. Selbst Abends, als Vater und Sohn mit einander in der Branntweinschenke waren, waren sie in ganz gewöhnlicher Verfassung, gegenseitig sehr friedlich, und insbesondere der Sohn ganz ordentlich; sogar noch beim Nachhausegehen Nachts um 10 Uhr verhielten sie sich eben so. Auch bemerkte man, da die That bald entdeckt wurde, gleich nach ihr am Angeschuldigten nichts Auffallendes. Sogar wollte er damals die That mit einiger Schlauheit läugnen, sagte: „sein Vater habe ein Loch in den Kopf gefallen. Er (der Sohn) habe das fallende Weh gehabt, und sei die Stiege herab auf seinen Vater hingefallen.”
Nur nach völlig vollbrachter Tödtung scheint der Sohn, wahrscheinlich aber erst durch die Grausamkeit seiner That selbst, einige Augenblicke lang verwirrt geworden zu sein, wenn er nicht anders aus Gedächtnissschwäche Umstände, die vorfielen, als schon Leute hingekommen waren, mit Umständen, die, während er noch allein war, sollten vorgekommen sein, späterhin beim Verhöre verwechselt hat. Er gibt nämlich an, er habe seinem ermordeten Vater (zur Zeit, wo er noch allein mit diesem im Hause war) das Geld genommen, „weil so Leut 'rein geschrien haben zu mir.”
Späterhin sagte er, nachdem er angegeben, wo er seinem Vater noch drei Streiche gegeben habe, und nun gefragt wurde, ob damals schon die Wächter dazu gekommen seien: „Nicht gerad' Wächter, eben Leut', und haben grausig gebalget.” Aber selbst wenn dieses nicht Verwechslung der Zeit und der Umstände ist, wenn es Verwirrung war, so ist zu bemerken, dass sie nicht während des Todtschlages, sondern erst wie der Vater schon todt war, eintrat, und schon, ehe bald darauf die Wächter kamen, wieder aufgehört haben musste. Wenn nun gleich kein Anfall von eigentlicher Raserei als Grund des Verbrechens angenommen werden kann, so muss doch schon das Grässliche eines Vatermordes109, besonders eines so grausamen, 281 als dieser ist, und wenn er aus so nichtiger Veranlassung auf eine so ganz unkluge Art begangen wird, den Verdacht erwecken, dass es mit den Seelenkräften des Thäters nicht richtig könne gewesen sein. Der Blödsinn des Inquisiten war offenbar so gross, dass er ihn nicht einsehen liess, dass sein Vater noch Nachts nicht werde zum Vogt gehen und werde ihn fortjagen lassen, dass der Vogt nicht einen einzigen Sohn ohne Weiteres werde fortjagen dürfen, und dass sein Vater ihm also mit seinem Weggehen nur heftig drohen wolle. Der Inquisit musste, eben wegen seiner grossen Verstandesschwäche, glauben, dass Alles dem Buchstaben nach und sogleich so folgen werde, wie der Vater drohte. Er musste also auch glauben, im Augenblicke werde für ihn das grösste Unglück, das sein ganzes künftiges Leben bedrohe, erfolgen, und weil er unfähig war, durch Ueberlegung auf einen anderen Gedanken zu kommen, so musste er völlig dieser seiner Furcht sich hingeben, und zwar in einer Gemüthsstimmung, wo ihm schon das Zanken des Vaters und die Drohung mit dem Vogte den grössten Widerwillen erregt hatte. Seine fast thierische Dummheit musste ihn nun beim einfachsten Schlusse stehen bleiben lassen: das drohende Unglück lasse sich nicht anders verhindern, als wenn der Vater gleich jetzt verhindert werde, es herbeizuführen. Der Vater selbst konnte dabei nicht in Betracht kommen, da der nämliche Blödsinn selbst nachher noch den Angeschuldigten hinderte, die Strafbarkeit des Todtschlages eines Vaters auch nur einzusehen (so gänzlich also auch das moralische Gefühl des Sohnes abgestumpft und geschwächt hatte), und da derselbe dumme Blödsinn hinderte, dass der Sohn hätte überhaupt verschiedenartige Gedanken oder Vorstellungen von der Sache gleichzeitig nach einander sich machen können. Einen Gedanken hatte er aber schon, der seine ganze Seele schnell erfüllte, den der Furcht für eigene Existenz. Also konnte in seiner Seele kein innerer Streit entstehen, es konnte in ihr damals nichts für den Vater sprechen. Der Sohn musste sich also unwillkürlich entschliessen, um sich zu retten, den Vater sogleich unthätig zu machen, das Unglück auszuführen. Daher gab er auch so oft bei der Untersuchung auf alle Fragen, ob er denn sonst bei seinem Entschlusse oder seiner That an nichts weiter gedacht habe, zur Antwort: er habe an nichts gedacht. Zurückhalten konnte er den Vater nicht, weil dieser, den Akten nach, ein sehr starker Mann war, so viel sah er wohl noch ein. Aber von hinten todtschlagen konnte er ihn, wenn er eine Axt nahm, das begriff diese, alle die wenige noch mögliche Ueberlegung auf einen 282 Punkt der Selbsterhaltung beschränkende Dummheit. Weitere Auskunftsmittel, als dieses nächste, konnten dem Blödsinnigen, der an nichts Weiteres denken konnte, nicht einfallen. Er musste also, weil er keine Wahl zwischen verschiedenen Empfindungen und Gedanken, sondern nur Eine Empfindung und Eine Vorstellung hatte und haben konnte, da ihn doch die grösste Furcht, die sich seiner ganzen Seele bemächtigt hatte, sogleich zum Handeln trieb, den Vater todtschlagen, weil ihm unglücklicher Weise nur dieses einfiel und nichts Zweites dabei einfallen konnte. Er musste nun in seiner zornigen Angst dieses mit all' dem Eifer und der Beharrlichkeit, was der aufgeregten Dummheit eigen ist, thun, ohne dass er daran denken konnte, dass er durch seine Handlung seinen ganzen eigentlichen Zweck selbst wieder vernichte, und er das gefürchtete Unglück, sein Haus und Vermögen zu verlieren und kein Weib zu bekommen, viel gewisser selbst herbeiführe.
Dass dieses der eigentliche Hergang der That gewesen sei, ergibt sich aus der Betrachtung aller Aussagen und des sonstigen Benehmens des Inquisiten. Es kann ihm bei der That der Gedanke immerhin dunkel vorgeschwebt haben, dass, da er seinem Vater, der ehemals Schulden hatte, so viel verdient habe, das Erbe, dessen ihn dieser berauben wolle, eigentlich sein sei, und dass, wenn er jetzt den Vater so gewiss verhindere, ihn unglücklich zu machen, jener auch für immer daran verhindert sei. Der Inquisit konnte in seiner Dummheit hoffen, mit dem Tode des Vaters sei er selbst überhaupt für immer aller Besorgnisse, die ihn früher schon so manchmal gepeinigt hatten, überhoben. Es ist ebensowohl gewiss, dass der gerade jetzt durch das Zanken wieder erweckte augenblickliche Hass gegen seinen Vater, da dieser alles seiner Seele Unangenehme in der Zeit auf ihn gehäuft hatte, seinen Entschluss vollends zum einzigen ihm möglichen Gedanken erhob, und auch gar kein moralisches Gefühl mehr aufkommen liess.
Höchstens schienen seine Sinne noch etwas „Grausiges” beim Schlagen und beim Anblicke des Blutes empfunden zu haben, daher ihn vielleicht am Ende des Todtschlages einige oben bemerkte Verwirrung befiel. Aber selbst im Gefängnisse noch musste ihn der Oberamtsrichter erst fragen, ob es ihm denn nicht grausig wäre, in dem Hause zu sein, wo er den Vater todtgeschlagen, bis er zugab: „Grausig wäre es mir g'sein, aber sonst weiss ich nirgends hin.”
Wäre es blos Zorn gewesen, der etwa schnell den Inquisiten übermannt hätte, so wäre nach der argen That mit dem Aufhören des Zornes 283 früher oder später verhältnissmässige Reue erfolgt. Da dieses nicht der Fall war, da der Inquisit gleichsam erst mit Mühe durch den Oberamtsrichter darauf geleitet werden musste, so beweist dieses wohl noch mehr, dass der Inquisit so gut lange nachher noch, wenigstens dunkel, sich bewusst blieb, er habe damals bei seinem Verstande nicht anders denken, empfinden und handeln können. Auch kommt in den Aussagen des Inquisiten nie etwas vor, das anzeigte, er habe seinem Vater gleichsam nur zur Wiedervergeltung Leid zufügen wollen; der Eifer, womit er ihn nur „gewiss todt haben wollte,” zeigt im Gegentheile, dass der herrschende Gedanke bei der schrecklichen That blos der an die sicherste Abwendung des dem Inquisiten selbst drohenden grossen Unglückes war.
Daher weiss er auch in der ganzen Untersuchung nur das noch mit Bestimmtheit anzugeben, was Bezug auf diesen einzigen Gedanken und auf das Mittel, nämlich auf das „Gewisstodthaben” des Vaters, hat; in allen übrigen Umständen: in dem Geldwegnehmen, in der Zeit, wann der Vater zum Balgen angefangen, ob er und der Vater schon im Bette gewesen u. s. w., verwickelt er sich immer in Widersprüche, offenbar weil diese unwesentlichen Umstände noch nicht tiefen Eindruck genug auf sein schwaches, damals noch nicht stark genug erregtes Vorstellungsvermögen gemacht hatten.
Dabei ist aber schon angezeigt worden, dass die That selbst auch nicht in eigentlicher kranker Verwirrung, die gar nicht mehr weiss, was sie thut, geschah. Wäre zuletzt eine solche auch eingetreten, so ist sie mehr als zufällige Folge, welche durch die That hervorgebracht wurde, anzusehen, als dass sie die That veranlasst hätte, ohne dass deswegen in anderen Fällen eine offenbare Verwirrung, wie solche ein Jahr vor der That und nach ihr den Inquisiten im Gefängnisse befiel, ein Entstehen derselben auch aus der Krankheit in Zweifel gezogen werden könnte. Einerlei Ursache, nämlich seine Hirnkrankheit, verursacht seine blödsinnige Dummheit, die im einzelnen Falle in ihrer Art noch konsequent und mit Bewusstsein des Zweckes verfahren kann, so wie, zuweilen gesteigert, die Annäherung zu vorübergehender eigentlicher Verrücktheit.
Wenn aber dieser Todtschlag selbst keiner damaligen eigentlichen Verrücktheit, die das Bewusstsein aufhebt, zugeschrieben werden kann, so war dessen ungeachtet die Seele des Inquisiten damals bei dieser That ganz unfrei, denn Freiheit der Seele kann nicht ohne Wahl zwischen Gegenüberstehendem bestehen; wo aber nur Ein Gedanke oder nur Eine 284 Vorstellung möglich ist, da ist keine Wahl mehr möglich, sondern es findet völlige Gebundenheit des Willens Statt.”
Nach allem Diesem beantwortete die Fakultät die ihr vorgelegte vierte Frage dahin: es sei anzunehmen, dass der Angeschuldigte zur Zeit, als er den Entschluss, seinen Vater zu tödten, fasste und ausführte, in einem Zustande völliger Unfreiheit seiner Seele gehandelt habe. Sie schloss dann ihr Gutachten mit der Aeusserung: dass, da Grotz bei der fraglichen That seinem kranken Zustande gemäss habe handeln müssen, so würden ihm wohl auch die daraus nothwendig unter den damals gegebenen Umständen entspringenden Ereignisse nicht zugerechnet werden können. Aber eben deswegen sei er ein für die Sicherheit Anderer gefährlicher Kranker, den der Staat so lange verwahren und in eine Lage versetzen müsse, wo ihm das Vollbringen ähnlicher Thaten, fühlte er sich auch dazu gedrungen, unmöglich werde, bis einmal seine Krankheit selbst ihn erlöse. Diese sei aber wegen ihrer langen Dauer, und ihrer Art nach (als idiopathische Hirnepilepsie ) für unheilbar zu achten.
Auf den Grund dieses Gutachtens, welches nach seiner sorgfältigen Ausführung und bestimmten Fassung für den Richter keinen Zweifel mehr über die Zurechnungsfähigkeit des Grotz übrig lassen konnte, fasste sonach der Kriminalsenat des hiesigen Gerichtshofes, ohne den Ausspruch eines förmlichen Urtheiles angemessen zu finden, blos den Beschluss: den Angeschuldigten rücksichtlich der an seinem Vater verübten Tödtung, als einer im Zustande völliger Zurechnungslosigkeit beschlossenen und vollbrachten That, straflos zu belassen, die erwachsenen Arrest- und Untersuchungskosten aus seinem Vermögen zu erheben, und ihn sofort als einen der öffentlichen Sicherheit gefährlichen und wohl unheilbaren Kranken der polizeilichen Behörde Behufs seiner Verwahrung in dem Irrenhause oder einer anderen angemessenen Anstalt zu übergeben.
In Gemässheit dieses Beschlusses wurde dann Grotz in das Irrenhaus zu Zwiefalten überliefert, wo er sich auch jetzt noch befindet110.
285 Noch bevor dieses Werk vollendet war, erschien in der „Allgemeinen Zeitung” vom 3. Dezember 1845 nachfolgender Artikel, welcher eine Nachricht bringt, an deren Möglichkeit ich sowohl, als wahrscheinlich der grösste Theil meiner verehrten Leser, gezweifelt haben würde, dass man es nämlich im Ernste unternommen habe, die Phränologie zur Ausmittlung der Zurechnungsfähigkeit eines Verbrechers in Bezug auf seine verübte That anzuwenden.
Der Artikel, von dem die Rede ist, lautet folgendermassen:
„Würtemberg. (Tübingen.) Vor Kurzem stand hier wiederum ein jugendlicher, kaum 15 Jahre alter Verbrecher vor Gericht, der Brandlegung geständig. — Er habe, sagt der Beschuldigte, während seiner zwölftägigen Abwesenheit von seinen Eltern arg Heimweh gehabt; als seine Eltern nicht darauf hätten eingehen wollen, ihn zurückzurufen, sei es ihm in den Sinn gekommen, dass er durch Anzünden des Hauses sich die Rückkehr sichern könne. Zwei Tage vor dem Brande habe ihm geträumt, das Ritterwirthshaus stehe in Flammen und seine Kleider seien verbrannt. Als das Heimweh wieder über ihn gekommen, habe er sich auf die Bühne geschlichen und dort ein Zündhölzchen in's Stroh gehalten. Nach der That sei er ruhig hinab gegangen, habe die Stiefel ausgezogen und der Magd zum Reinigen übergeben, um durch solche Unbefangenheit den Verdacht von sich abzulenken. Sonst habe er geglaubt, höchstens der Dachstuhl werde niederbrennen, nicht aber das ganze Haus. Das Gutachten des Oberamtsarztes hatte zu seiner Entschuldigung angeführt, dass die starke Entwicklung des Mittelhauptwirbels sich nach Carus dem Verbrechertypus nähere, die 286 Entwicklungsjahre die natürliche Anlage111 zum Ausbruche gebracht hätten, und ausserdem das krankhafte Heimweh einen Zustand des Irrsinnes herbeigeführt haben kann112. Die medizinische Fakultät in Tübingen verwarf aber solche Argumentation auf das Bestimmteste, und bemerkte dagegen, dass die Kopfformation des Beschuldigten auch nach Carus113 nicht auf Inklination zu Verbrechen hinweise; übrigens sei die ganze Phränologie in solcher Beziehung zweifelhaft, Heimweh beeinträchtige die Zurechnungsfähigkeit nicht, und die körperliche Entwicklung des Verbrechers stehe durchaus im normalen Verhältnisse. Das Streben des oberamtsärztlichen Gutachtens sei offenbar darauf gerichtet, den Begriff der Pyromanie zu retten, sie könne solche nicht anerkennen. — Der Gerichtshof verurtheilte den Beschuldigten zu siebenjähriger Zuchthausstrafe.”
Da unter den im Verlaufe des von Gemüthszuständen handelnden Aufsatzes das Heimweh nicht vorkommt, so glaube ich hierüber erinnern zu müssen, dass dasselbe in seiner Entstehung nicht etwa eine Krankheit, sondern derjenige Gemüthszustand ist, der nothwendig bei jedem nicht ganz gefühllosen Menschen entstehen muss, welcher aus gewohnten ihm liebgewordenen Verhältnissen hinaustritt, welche Empfindung den 287 natürlichen Wunsch erzeugt, wieder in die gewohnten Verhältnisse zurückzutreten. — Ob dieser Wunsch entsteht, wird von der Lebhaftigkeit des früheren Eindruckes, von dem Kontraste der Gegenwart und von der moralischen Gewalt, welche der Mensch über seine Phantasie hat, ferner von dem Grade seiner Empfänglichkeit für äussere Eindrücke überhaupt, und endlich von dem grösseren oder geringeren Kreise abhängen, in welchem er seine Vorstellungen zu üben gewohnt ist. Der Gebirgsbewohner, dessen Vorstellungen in jene, welche ihm seine Berge liefern, wie mit einem natürlichen Rahmen eingefasst sind, wird mehr zum Heimweh geneigt sein, als der Flachländer, dessen Phantasie nicht mit so stereotypen Randzeichnungen in ihren Thätigkeiten versehen ist, der Letztere vermisst daher nicht immer etwas, wenn er seine physische Existenz ändert, wohl aber empfindet ein Flachländer, welcher mit Einemmale in das Gebirge versetzt wird, ein Etwas in seinem Inneren, welches etwa ein in einem Käfige eingesperrter Vogel empfinden mag; es ist nicht Heimweh, wohl aber ein Sehnen, einmal wieder frei in der Welt umher sehen zu können.
Das Heimweh ist daher nichts Anderes, als das Gefühl der Entbehrung des Anblickes gewisser sehr bestimmter Gegenstände, und unterscheidet sich daher von der Sehnsucht, aus einer gewissen Lage zu kommen, dadurch, dass es eine Sehnsucht nach etwas Positivem ist, während die Unbehaglichkeit eines anderen Menschen, welcher irgendwo verweilen muss, wo er lieber nicht wäre, nur ein negativer Zustand, nämlich das Hinwegwünschen gewisser unbehaglicher Eindrücke ist. Die Richtigkeit dieser Bemerkung ergibt sich auch durch den Umstand, den ich mehr als einmal zu beobachten Gelegenheit hatte, dass nämlich der Gebirgsbewohner schon von Heimweh geplagt wird, wenn er nur von dem Thale A, in dem er geboren ist, in das nur ein paar Meilen davon entfernte Thal B versetzt wird, welche Erscheinung sich dadurch erklärt, weil er bei der Beschränktheit des Lokales, in dem er lebt, und bei der geringen Anzahl von Familien, die es bewohnen, gewohnt ist, eben so jeden einzelnen Menschen, als jeden einzelnen Felsen genau zu kennen, es ihm daher ganz unerträglich scheinen muss, unter Verhältnissen zu leben, wo er die Menschen erst kennen lernen soll, was sich früher Alles von selbst machte, und wo ein jeder Berg nach dem Grundsatze, dass es nicht zwei ganz gleiche Gegenstände gibt, eine andere geometrische Figur hat.
Hierin liegt die entschiedene Veranlassung des Heimwehes; es ist eine Sehnsucht nach einem Komplex bestimmter Gegenstände, und ist eben darum von weit dauerhafterer Wirkung, als jede andere Sehnsucht 288 nach einem einzelnen bestimmten Gegenstande, z. B. nach einer abwesenden oder verstorbenen Geliebten u. s. w., weil es auch viel mehr Gegenstände gibt, die ihm das Entbehrte in Erinnerung bringen. Jeder Stein sieht am Ende dem anderen gleich und ruft ihm die Steine seiner Heimat zurück, jede Hirtenschalmei hat am Ende einige Aehnlichkeit mit dem Kuhreigen, eine Kuh brüllt wie die andere. Es ist eine auffallende Erscheinung, dass diejenigen Gebirgsbewohner, welche wegen eines Vergehens eingesperrt sind, viel weniger am Heimweh leiden, als diejenigen, welche entfernt von ihrer Heimat frei herumgehen; die Nothwendigkeit, sich mit ihren eigenen Angelegenheiten zu beschäftigen, und der Mangel an Gegenständen, welche sie an ihre Heimat erinnern, weil sie ausser den Mauern ihres Gefängnisses sonst nichts zu sehen bekommen, erklärt jedoch diese Erscheinung vollkommen.
Heimweh ist also eine Sehnsucht nach Etwas, welches nicht da ist, und zwar nach Gegenständen, die dem Menschen durch seine Gewohnheit und Ungewohntheit, sich ohne dieselben im Leben zu bewegen, schwer zu entbehren sind. Dieser Zustand ist aber ein ganz natürlicher, wenn man die Verhältnisse betrachtet, in welchen ein solcher Mensch früher zu leben gewohnt war. Es ist also auch ganz natürlich, dass ein solcher Mensch wieder in seine vorige Lage zu kommen wünscht. Darin liegt aber weder mehr noch weniger Motiv zur Begehung eines Verbrechens, als bei jedem anderen Menschen vorhanden ist, welcher irgend ein Uebel von sich zu entfernen, oder irgend ein wahres oder erträumtes Glück zu erreichen strebt.
Heimweh kann aber so wie jede andere nicht gestillte Sehnsucht durch seine Rückwirkung auf den Organismus Krankheiten, und zwar um so mehr Krankheiten erzeugen, welche sich durch ein gestörtes Seelenvermögen aussprechen, weil dasselbe überhaupt grösstentheils durch die Seelenthätigkeit entsteht. Dies kann geschehen, es muss aber nicht geschehen, wie es unzählige Beispiele von Leuten gibt, die allerdings an Heimweh leiden, sich aber durchaus vernünftig benehmen.
Wo also in einem bestimmten Falle nichts mehr vorliegt, als dass Jemand am Heimweh leide, so folgt auch daraus nichts mehr, als dass er eine Anlage habe, krank zu werden, dass er aber krank wurde, dass diese Krankheit eine Seelenstörung, und dass diese Seelenstörung der einzige Grund eines bestimmten Verbrechens sei, muss ganz auf dieselbe Art, nicht durch das Vorhandensein des Heimwehs, sondern durch andere Thatsachen, welche für die Verübung des Verbrechens als Folge 289 der Seelenstörung sprechen, geliefert werden, wie es in anderen Fällen, wo ein solcher Beweis zu liefern ist, zu geschehen hat.
Es erhellt daher, dass man sehr Unrecht hat, das Heimweh ohne Weiteres für eine Krankheit zu halten, und dass man noch mehr gegen die Gerechtigkeitspflege sich versündige, wenn man dem einzigen Umstande, dass Jemand sich nach seiner Heimat sehne, irgend einen rechtlichen Einfluss einräumt, ohne weitere, für das Vorhandensein einer Seelenstörung sprechende Thatsachen zu verlangen.
Ganz sonderbar muss es jedoch jeden Leser überraschen, die Phränologie zur Ausmittlung der Zurechnungsfähigkeit angewendet zu sehen. Man wird unwillkürlich dadurch an jene Gerichtssitzung erinnert, wovon in den „physiognomischen Reisen114” Erwähnung geschieht, bei welcher man gegen einen Kerl, welcher auf falsche Brandbriefe gebettelt hatte, mit der Tortur vorgehen wollte, weil seine Physiognomie von der Art war, dass man ihn für den Bösewicht halten musste, der den Kelch vergiftet habe. Der vermeintliche Giftmischer entsprang, und nachträglich zeigte es sich, dass das vermeintliche Gift nichts Anderes, als ein ganz unschädlicher Staub gewesen sei, der durch einen Zufall in den Kelch der protestantischen Kirche gerathen war.
Phränologie und Physiognomik können möglicher Weise irgendwo gute Erfolge haben, denn jede Forschung, welche mit Eifer und einem tieferen Eingehen in die Sache betrieben wird, kann durch einen glücklichen Zufall auf eine wichtige Entdeckung führen.
Im Mittelalter forschte man nach Universalarzneien, und erfand das Schiesspulver, welches eine sehr wichtige Entdeckung ist, und wodurch das Problem der Auffindung einer Universalarznei, wenn man sich nicht an der Form der Dispensirung und an der allerdings etwas heftigen Primärwirkung stossen will, sogar als gelöst betrachtet werden kann. So kann auch die Phränologie zu wichtigen psychologischen Entdeckungen führen, allein ehe diese Entdeckungen gemacht und über allem Zweifel erhaben begründet sind, ist es widersinnig, darauf Resultate für das praktische Leben, am wenigsten in der Art gründen zu wollen, dass man den Weg einer praktischen, bewährten Beobachtung verlässt, und um die Wahrheit 290 zu entdecken, zur Phränologie seine Zuflucht nimmt. Das Höchste, welches in dieser Art jemals erreicht werden kann, wird nur darin bestehen, dass einzelne Menschen, welche mit einer sehr scharfen Beobachtungsgabe begabt sind, und dem phränologischen Studium einen wesentlichen Theil ihres Lebens gewidmet haben, das Vorhandensein oder den Abgang gewisser Anlagen bei einem Subjekte entdecken werden.
Selbst diese Kenntniss bleibt aber für die Rechtspflege unfruchtbar, da Niemand zweifelt, dass Derjenige, welcher eine gewisse That beging, irgend eine Anlage zu derselben müsse gehabt haben, da ohne Anlage zu Etwas gar kein Streben zur Ausführung denkbar ist. Ein Mann, dessen Sexualsystem nicht entwickelt ist, wird keine Nothzucht begehen, dies ist gewiss, allein daraus folgt nicht im Mindesten, dass Derjenige, welcher dieses Verbrechen begeht, darum, weil er durch seinen Stimulus sexualis dazu veranlasst wurde, auch nothwendig das Verbrechen habe begehen müssen. Was man also durch die phränologische Untersuchung im besten Falle zum Behufe der Rechtspflege erfahren kann, ist daher eine Thatsache, die ohnehin Niemand bezweifelt, nämlich, dass ohne Anlage zu einer bestimmten Thätigkeit eine solche niemals erfolgen wird, der Schluss aber, ob die Anlage wirklich so überwiegend sei, dass der Mensch unter allen möglichen Verhältnissen dieser Anlage gemäss handeln oder irgend eine Thätigkeit unterlassen muss, wie etwa ein Blindgeborner unter allen möglichen Verhältnissen keine Thätigkeit üben kann, wozu die Funktion des Sehens gehört, bleibt immer ausserhalb der Grenzen der Phränologie, da es unmöglich ist, durch die Befühlung oder Betrachtung der Schädelknochen auch die Stärke der auf den Menschen sonst einwirkenden Verhältnisse zu berechnen.
Leistet aber die Phränologie dieses nicht, so kann sie auch nichts über die Möglichkeit, von der natürlichen Freiheit des Willens gegen die Anlage, welche die Schädelknochen ausdrücken, Gebrauch zu machen, entscheiden, und könnte daher höchstens dort von einigem Einflusse sein, wo entschiedene Missbildungen, wie z. B. bei Kretins, vorhanden sind, welche Missbildungen aber bisher ohne phränologisches Studium auf einem anderen Wege entdeckt wurden.
Selbst in der Hand des Meisters kann die Phränologie daher nur in solchen Fällen für die Rechtspflege etwas Entscheidendes leisten, wo man auch auf anderen Wegen Dasselbe erfahren kann; ausser diesen Fällen, wo man ihrer jedoch nicht bedarf, wird sie, auch von der 291 Hand des Meisters geübt, nie zu einer Entscheidung führen, und könnte höchstens dort von einiger Bedeutung sein, wenn ein Subjekt eine charakteristische Art von Thätigkeit wiederholt ausübte, und dadurch auf die Vermuthung führt, dass ihr eine krankhafte Verstimmung zu Grunde liege, um nachzuweisen, dass auch die Wirbelformation bei dem Subjekte eben so gestaltet sei, wie bei anderen Subjekten, bei welchen sich eine ähnliche krankhafte Aeusserung gewahren liess, woraus sich dann, in Verbindung mit anderen Erhebungen, der Schluss rechtfertigen liesse, die verübte That sei die Folge einer durch eine besondere Anlage eingetretenen krankhaften Verstimmung gewesen. Der Ausspruch des Phränologen wäre hiermit höchstens einer von den Gründen, das Subjekt für krank zu halten, welcher wohl in Verbindung mit den übrigen Erhebungen, niemals aber ohne oder gar gegen dieselben berücksichtigt werden könnte.
Selbst dieses gilt nur höchstens in dem Falle, wo ein Mann, welcher entschiedene Proben von Erfahrungen in dieser Beziehung abgelegt hat, derlei ausspricht; es ist also selbst diese unbedeutende Giltigkeit des Einflusses des phränologischen Wissens nur ein Ausnahmsfall. Dagegen erscheint der Ausspruch eines jeden Anderen, bei welchem diese Voraussetzung nicht auf eine vollkommen erprobte und anerkannte Weise eintritt, als vollkommen bedeutungslos, denn es ist zuverlässig nicht leichter, ohne eigene vielfältige Beobachtung nur einigermassen ein erträgliches Resultat aus der Konstruktion der Wirbelknochen zu abstrahiren, als — das Wetter zu prophezeien. Ein Uebersehen einer ganz unbedeutenden veränderten Lage dieser Theile muss nothwendig zu eben so grossen Missgriffen führen, als wenn man z. B. übersieht, dass die Scala eines Barometers, statt nach Pariser, nach Wiener Zollen eingetheilt ist. Wer Vorliebe für derlei Beobachtungen hat, wird freilich nicht in Verlegenheit sein, auch die unrichtigsten Aussprüche zu rechtfertigen, und in dieser Beziehung wird es der Phränologie ohne Zweifel so ergehen, wie es der Physiognomik erging. Lavater erkannte in der Physiognomie Gellert's, dessen Rechtschaffenheit über allem Tadel erhaben war, die Züge eines Erzspitzbuben, und Gellert in seiner Gutmüthigkeit erklärte, dass er in seiner Kindheit wirklich einige Diebereien verübt habe. Was beweist also ein solches Urtheil, welches der Wirklichkeit so ganz entgegen ist? Auf diese Art lässt es sich auch rechtfertigen, wenn man in der Physiognomie 292 eines Cartouche die Züge eines grundehrlichen Mannes erblickt, denn wahrscheinlich gab es eine Zeit, wo Cartouche noch nicht gestohlen hat. Es ist nicht schwer, ein Prophet zu sein, wenn falsche Voraussagungen auch für Prophezeiungen gelten; wer sich aber darnach richten wollte, bleibt angeführt.
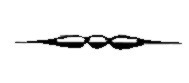
„Ist es erlaubt, Solche, von denen man sagt, dass ihre übersinnliche Natur, wenn sie noch länger mit der Körperwelt in Verbindung stehe, verloren gehe, von dieser Körperwelt zu trennen? Sorgfalt bei der Untersuchung (das könnte denn gewiss bei scharfblickenden Aerzten eine grosse Frage sein). Wer spricht von einer solchen Vernichtung des Uebersinnlichen statt des Irdischen?
Der Philosoph.
Frage wegen Erlaubtheit des Selbstmordes für Solche, die sich unrettbar erkennen.
Theolog.
Dürfen sie denn keine Erlösung glauben?”
„Du nahst heran, mein letzter Tag!”
„Ist es erlaubt, Solche, von denen man sagt, dass ihre übersinnliche Natur, wenn sie noch länger mit der Körperwelt in Verbindung stehe, verloren gehe?”
„Ist es erlaubt, Solche, deren übersinnliche Natur bei einer längeren Verbindung mit der Körperwelt verloren geht, von dieser Körperwelt zu trennen?”
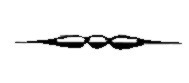
Gedruckt bei J. P. Sollinger.
End of the Project Gutenberg EBook of Die gerichtliche Arzneikunde in ihrem
Verhältnisse zur Rechtspflege, mit b, by Franz von Ney
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE GERICHTLICHE ARZNEIKUNDE ***
***** This file should be named 56382-h.htm or 56382-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/6/3/8/56382/
Produced by Franz L Kuhlmann, Sandra Eder and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org Section 3. Information about the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.