
The Project Gutenberg EBook of Gesammelte Schulhumoresken, by Ernst Eckstein This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Gesammelte Schulhumoresken Author: Ernst Eckstein Release Date: May 16, 2016 [EBook #52083] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GESAMMELTE SCHULHUMORESKEN *** Produced by The Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt.
Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet.
Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so ausgezeichnet.
Weitere Anmerkungen zur Transkription finden sich am Ende des Buches.

enthaltend die früheren Sammlungen
Besuch im Karzer – Katheder und Schulbank –
Schulmysterien – Stimmungsbilder aus dem
Gymnasium – Samuel Heinzerlings Tagebuch
und eine Anzahl in Buchform noch nicht veröffentlichter Geschichten
Von
Ernst Eckstein

Neudamm
Verlag von J. Neumann
| Seite | |
| Schülertypen | 9 |
| Wie der Quartaner Holzheimer Primus wurde | 17 |
| Ein Familienereignis | 23 |
| Knebelii discipuli Threnodia | 34 |
| Aus den Privataufzeichnungen des Sekundaners Heppenheimer: | |
| Erstes Bruchstück | 35 |
| Zweites Bruchstück | 44 |
| Doktor Veit | 54 |
| Erinnerungsbilder | 60 |
| Allerlei Unarten | 74 |
| Der entrüstete Oberlehrer | 95 |
| Der Bierparagraph | 96 |
| Vom Rauchen | 103 |
| Die Lyrik auf dem Gymnasium | 110 |
| Die Primanerliebe | 120 |
| Aus dem Schuldbuche Wilhelm Rumpfs | 127 |
| Eindrücke aus dem Karzer | 137 |
| Der Besuch im Karzer | 163 |
| Samuel Heinzerlings Tagebuch | 181 |
| Aus Samuel Heinzerlings nachgelassenen Papieren: | |
| I. Der schnöde Primaner-Triumph | 200 |
| II. In der Bierstube | 201 |
| Die Klassenprüfung | 203 |
| Ferien | 211 |
| Das Maturitätsexamen | 218 |


Die vorliegende Sammlung vereinigt zum erstenmal Ernst Ecksteins sämtliche Schulhumoresken in einem Band. Einige davon, wie »Der Besuch im Karzer«, »Samuel Heinzerlings Tagebuch«, »Schulhumor« u. a., sind als Einzelbände erschienen und haben in vielen Tausenden von Exemplaren Verbreitung gefunden; andere sind aus dem Buchhandel gänzlich verschwunden oder wurden nur in Zeitschriften veröffentlicht; alle aber haben sich so zahlreiche Freunde erworben, daß in dem großen Kreise derselben zum mindesten die Sammlung sicher freudig begrüßt werden wird. Daß sie auch Widerspruch erfahren dürften, wird ihrer Verbreitung vermutlich ebensowenig schaden, wie dies bei den verschiedenen Einzelausgaben der Fall gewesen ist. Ist doch »Der Besuch im Karzer« – an einem regenschweren Herbsttage in Rom entstanden und in den »Fliegenden Blättern« zuerst veröffentlicht – bis auf den heutigen Tag eines der gelesensten deutschen Bücher geblieben, obgleich er von verknöcherten Pädagogen von jeher in Acht und Bann getan und als ein Schädling bezeichnet worden ist, geeignet, die Autorität der Lehrer und damit die in der Schule so nötige Disziplin zu untergraben.
Aber lassen sich solche, für den Wert oder Unwert der Humoresken übrigens ganz gleichgültige Behauptungen im Ernste aufrecht erhaben? Wer, der je eine Schulbank gedrückt, hat nicht mit scharfen Augen alle die kleinen Schwächen seiner Lehrer im Fluge[8] herausgefunden und an lustigen Schülerstreichen sich erfreut? Aber hat dies alles vermocht, in Tausenden von Schülerherzen Liebe und Verehrung, Anhänglichkeit und Dankbarkeit zurückzudämmen, die tüchtige Lehrer allezeit überreich gefunden haben? So haben auch Ernst Ecksteins Schulhumoresken niemals auch nur den geringsten Schaden gestiftet oder gar mit zu der Verrohung unserer Jugend beigetragen, über die man jetzt so vielfach klagen hört. Aber sie haben manch' müdes und trübes Auge hell aufleuchten lassen in der Erinnerung an die, ach! so lange entschwundene sonnige und goldene Schülerzeit, und manches herzliche Lachen haben sie ausgelöst bei vielen, die im Ernste des Lebens das Lachen beinahe verlernt hatten. Möge ihnen dies auch in Zukunft immer gelingen, dann werden sie ihre Aufgabe auch im Sinne und nach dem Wunsche ihres Autors voll erfüllt haben.

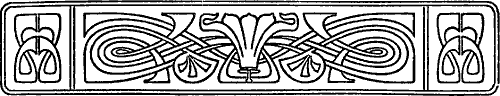

Das Gymnasium ist für den, der ein offenes Auge besitzt, so recht eigentlich die Schule der Menschenkenntnis. Später im bürgerlichen Leben hat man kaum je die Gelegenheit, so eingehende Charakterstudien zu machen, wie hier, wo der tägliche Verkehr und die noch mangelnde Routine des Komödiespielens die überraschendsten Blicke in die verschiedenen Individualitäten gewährt. Im Gymnasiasten, zumal im Primaner, ist das künftige Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft bereits bis auf wenige unbedeutende Retouchen vorgezeichnet. Wer in diesem aufgeschlagenen Buche zu lesen versteht, der wird jedem einzelnen schwerlich ein unrichtiges Prognostikon stellen. Selbst mit der geringen Erfahrung, die ich in Prima besaß, wußte ich mir doch von gar manchem unter meinen Kameraden ein Zukunftsbild zu entwerfen, das sich nachmals in seinen wesentlichen Zügen verwirklicht hat.
Da die Menschheit überall die gleiche ist, so wiederholen sich auch die Schülertypen mit einer fast mathematischen Regelmäßigkeit. Fassen wir die hervorragendsten etwas näher ins Auge.
Da finden wir zunächst den von seiner eigenen Tüchtigkeit mannhaft durchdrungenen Kernschüler, meist Sohn einer armen Witwe, der er durch fleißige Privatstunden einen Teil ihrer Sorgen abnimmt. Er besitzt einen lobenswerten Eifer und eine klare, ruhige Intelligenz, die hin und wieder kleine, von ihm krankhaft überschätzte Anläufe in der Richtung der Phantasie nimmt; daher er denn zuweilen den Versuch macht, die Themata des deutschen Aufsatzes novellistisch zu behandeln. Er ist sich eines tief sittlichen Ernstes[10] bewußt und übt gegen diejenigen seiner Kameraden, über die er sich hoch erhaben dünkt, das heißt also gegen alle, einen gewissen väterlichen Sarkasmus. Klein von Statur, sucht er diesem Mangel durch eine straffe Haltung und durch eine biedermännliche Art des Auftretens abzuhelfen. Über die jugendlichen Schwärmer, die da halbe Nachmittage vertrödeln, nur um ein einziges Mal dem blonden Töchterchen des Professors zu begegnen, zuckt er mitleidig die Achseln. Sein Herz ist zwar nicht unempfindlich; vielmehr hat auch er bereits eine stille Neigung; aber konsequent und logisch, wie er ist, betrachtet er solche zwecklosen Huldigungen als Zeitvergeudung. Er lebt sich und der Wissenschaft, absolviert das Maturitäts-Examen mit Nummer eins, scheint nach Erlangung dieses Resultates um zwei Zoll gewachsen zu sein, gebärdet sich wie der bedeutende Mann kat' exochen, studiert Philologie, beendet sein Triennium gleichfalls mit Auszeichnung, ist ein halbes Jahr später vierzehnter Oberlehrer in Liegnitz und heiratet seine Mathilde nach einer verhältnismäßig kurzen Brautschaft. Er hält seine Zöglinge streng im Zaum, sendet seiner Mutter alljährlich eine kleine Unterstützung und erzeugt drei oder vier Kinder. Hiermit aber ist seine »Tüchtigkeit«, die in Prima so selbstbewußt auf den Troß der Nichttüchtigen herabschaute, ein für allemal erschöpft; von irgend einer bedeutenden Leistung bekommt die erwartungsvolle Heimat nichts zu hören. Er, der sich als der Mann seines Jahrhunderts gerierte, ist ganz und gar aufgegangen in der Ernährung und Fortpflanzung. Im vierzigsten Jahre schreibt er vielleicht eine lateinische oder französische Grammatik, die unbekannt bleibt wie der Name ihres Verfassers. Trotz alledem und alledem hält er sich nach wie vor für das Ideal eines Menschen; er ist nur darum nicht Lessing und Goethe, weil seine Tätigkeit als Gymnasiallehrer ihn so sehr in Anspruch nimmt, daß ihm für alle anderen Dinge die Zeit fehlt. Auch in der Malerei – er hat seiner Frau zu ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag ein Album überreicht, dessen Titelblatt er eigenhändig gezeichnet – auch in der Malerei mangelt ihm nur die Muße. Da aber Raphael einem bekannten Ausspruch zufolge selbst dann ein großer Maler gewesen sein würde, wenn er ohne Arme auf die Welt gekommen wäre, so fühlt sich auch unser ehemaliger Kernschüler im tiefsten Grund seines Wesens dem[11] großen Urbinaten oder doch etwa den Herren Maratta und Domenichino ebenbürtig.
In politischen Dingen huldigt er einem ernsten, gemessenen Liberalismus. Was seine religiösen Überzeugungen angeht, so liegt ihm das Dogma ferne; doch ist er fest überzeugt, daß dereinst in den unbekannten Regionen des Jenseits eine Vergeltung, das heißt in seinem speziellen Fall eine Belohnung, eintreten wird; unter welcher Form, ist ihm gleichgültig.
Eine höchst traurige Erscheinung im Schülerkreise ist der ausgesprochene Dummkopf. Wer kennt ihn nicht? Mit blöden Augen und einem Gesichtsausdruck, der die vollkommenste Gleichgültigkeit gegen alle Erscheinungen der Außenwelt bekundet, so sitzt er da, stramm, breitschulterig, nichts weiter als eine Raumerfüllung. Richtet der Lehrer eine Frage an ihn, so erhebt er sich schwerfällig und glotzt: niemals ist eine Antwort über seine Lippen geglitten; aber auch niemals hat ihn diese Unfähigkeit, zu antworten, aus dem Gleichgewichte gebracht. Er ist zwar nicht imstande, das Horazische Nil admirari ins Deutsche zu übersetzen; dagegen scheint ihm der Kern dieser Worte vollkommen in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Der Dummkopf ist gleich unempfindlich gegen den Fluch der Lächerlichkeit, wie gegen eine dröhnende Standrede. In jeder Klasse haftet er zwei bis drei Jahre lang; in Sekunda sproßt ihm bereits ein erfreulicher Vollbart; in Prima weist seine Statur ein kräftiges Embonpoint auf. Er avanciert indes selten bis in die erste Klasse: meist haben sich seine Angehörigen schon vorher überzeugt, daß die akademische Bildung nicht das Feld ist, auf welchem der Dummkopf zu reüssieren vermag, daher er denn in der Regel als Sekundaner die Karriere des Landwirts ergreift – eine Umwandlung, die mit einemmal Leben in die träge Masse bringt. Der Dummkopf, der im Gymnasium zu faul schien, nur ein Glied zu rühren, treibt sich jetzt tagelang auf den Äckern herum und verrichtet die schwersten Arbeiten. Nach Verlauf von zehn Jahren finden wir ihn nicht selten als Rittergutsbesitzer wieder; ja, wenn er aus guter Familie ist, läßt er sich vielleicht in den Reichstag wählen, wo seine Tätigkeit, je nach Umständen, in »lautem Murren« oder in »Heiterkeit« besteht. Mit vierzig Jahren wird er Ökonomierat; auch entgeht ihm selten der Rote Adlerorden.
Sehr häufig verwechselt der Unverstand der Lehrer eine andere Spezies, nämlich den einseitig begabten Schüler, mit dem Dummkopf. Das zukünftige naturwissenschaftliche Genie legt nicht selten für das Studium der Sprachen eine absolute Talentlosigkeit an den Tag, die höchstwahrscheinlich mehr aus dem Mangel an Lust, als aus dem an wirklicher Begabung hervorgeht. So wurde dem berühmten Chemiker Justus Liebig von seinen Lehrern insgesamt das trübste Prognostikon gestellt. Die Naturwissenschaften hatten damals an den öffentlichen Schulen so gut wie keine Vertretung. Der junge Liebig, der sich schon früh eifrig mit seinem Lieblingsstudium beschäftigte, ist gewiß hundertmal vom Katheder herab in der bekannten Weise apostrophiert worden: »Denken Sie an mich, Liebig! Wenn Sie so fortfahren, so werden Sie über kurz oder lang Schiffbruch leiden!« Oder: »Was wollen Sie eigentlich einmal werden? Ich für meinen Teil bin ratlos.« Oder: »Wenn Sie nicht endlich zur Besinnung kommen, so werden Sie der Schandfleck Ihrer Familie werden!« Wie muß sich Justus von Liebig in späteren Jahren bei der Erinnerung an diese Prognostika amüsiert haben! Er, der Schöpfer der modernen Chemie, dem Tausende von Wißbegierigen aus allen Ländern der Erde zuströmten, er, der scharfsinnige, philosophische Kopf, der, im Gegensatz zu den aberwitzigen Apothekergehilfen und Barbiergesellen, den Gedanken, die Verstandesoperation als das Wesentliche, das Experiment aber gewissermaßen nur als die Probe auf das Exempel bezeichnete! Was ist aus den Lehrern geworden, die dem genialen Forscher den »unvermeidlichen Schiffbruch« weissagten? Ihr Gedächtnis ist mit ihren Leibern zu Grabe gegangen, während der Name Liebigs leuchten wird, so lange es eine Wissenschaft gibt.
Hier gilt es also, sehr wohl zu unterscheiden. Nicht jeder ist ein Dummkopf, der einen schlechten lateinischen Aufsatz schreibt, denn alles Genie reicht hier nicht aus, sobald die positiven Kenntnisse mangeln, und diese sind nur durch Fleiß oder doch durch Aufmerksamkeit zu erwerben. Ein universell begabter Kopf wird allerdings, selbst wenn er eine ausgesprochene Vorliebe für ein spezielles Fach besitzt, auch die übrigen Fächer spielend bewältigen. So läßt sich denn z. B. nicht denken, daß ein Mann wie Schopenhauer auf[13] irgend einem Gebiet hinter seinen Mitschülern zurückgestanden hätte. Aber solche Naturen sind äußerst selten, daher wir sie den Schülertypen nicht beizählen dürfen.
Eine weitverbreitete Spezies von Schülern repräsentiert der humoristisch beanlagte Autoritätsfeind, wie ich ihn mit großer Ausführlichkeit in der Gestalt meines unvergeßlichen Freundes Wilhelm Rumpf zu zeichnen versucht habe.
Der humoristisch beanlagte Autoritätsfeind ist das sanguinische Element auf der Polhöhe. Mit einer edlen Sorglosigkeit erträgt er die empfindlichsten Freiheitsberaubungen. Von überaus leichter Fassungsgabe, bedarf er durchaus keiner Vorbereitung, um in den meisten Fächern mit Glanz zu bestehen. Der krankhafte Ehrgeiz, wie er den oben gezeichneten »tüchtigen« Schüler beseelt, ist ihm fremd. Auch ihm wird von ernsten Pädagogen vielfach der bevorstehende Schiffbruch angekündigt, eine Prophezeiung, die er mit dem freundlichsten Lächeln von der Welt hinnimmt. Er macht in der Regel eine mehr oder minder glänzende Karriere, gleichviel auf welchem Gebiete.
Eine sehr unangenehme Erscheinung ist der frühreife Schüler. An den erheiternden Störungen und sonstigen Zwischenfällen nimmt er nur beiläufig Teil; dagegen ist er anerkannt als Sachverständiger auf dem Gebiete des Tabaks und des Bieres. Er trägt in elegantem Futteral eine Meerschaumspitze bei sich, deren kunstgerechtes Anrauchen ihm wochenlang als Ideal vorschwebt. Er verkehrt fast nur mit Studenten. Jene platonischen Regungen, die man unter der Bezeichnung der Primanerliebe versteht, sind ihm fremd. Er wirft sein Auge vorzugsweise auf die Feminina der dienenden Klasse, da seine Wünsche durchaus realistischer Natur sind. Seinem späteren Entwicklungsgang sind sehr verschiedene Wege vorgezeichnet. Nicht selten wird er ein brauchbarer Mediziner. Mitunter benutzt er die geringe Konkurrenz auf dem Gebiete der Theologie und entpuppt sich so schließlich als ehrsamer Landprediger, der die Bauern auffordert, die Lüste des Fleisches zu töten und dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Oft auch ereilt ihn als Folge seiner schon so früh begonnenen Exzesse ein vorzeitiger Tod.
Noch unangenehmer als diese Spezies ist der hämische Denunziant. Er gehört unter die Stillen im Lande und benutzt jede Gelegenheit, wo er einem Mitschüler einen Schabernack spielen kann. Seine Haltung ist gebeugt, sein Blick unstet und lauernd. Soll irgendwo in der Umgebung der Stadt eine Orgie gefeiert werden, so benachrichtigt er den Direktor in einem anonymen Briefe. Findet eine Untersuchung statt, so ist er stets »wahrheitsliebend«, wenn nicht etwa die Furcht vor den Fäusten seiner Kameraden ihn zum Schweigen veranlaßt. Die Lehrer geben sich zwar den Anschein, als ob sie diese Gattung von Schülern sehr hoch schätzten; im Grund ihres Herzens widmen sie ihnen jedoch eine unbegrenzte Verachtung. Auch diese Sorte macht unter Umständen Karriere, materielle wenigstens; zu Ruhm und Ansehen freilich bringen sie es höchstens für kurze Zeit.
Fast jede Klasse hat ferner ihren genial sein wollenden Wirrkopf. Ich meinesteils entsinne mich der köstlichsten Exemplare. Der Wirrkopf ist frühzeitig Mitglied des städtischen Gesangvereins. Er komponiert selbstgedichtete Texte, er treibt Ästhetik, ja, er liest vielleicht Hegel oder Schopenhauer. Von alledem sieht es in seinem Gehirn so wüst aus, daß kein logischer Gedanke mehr aufzukeimen vermag. Seine deutschen Aufsätze strotzen von widernatürlichen Bildern. Ich erinnere mich, daß wir in Prima eine Arbeit über das böse Gewissen zu liefern hatten. Der Wirrkopf der Klasse schloß seinen Aufsatz mit der pathetischen Phrase: »Und so liegt denn das böse Gewissen wie ein eiserner Klotz vor der Tür, der in jedem Augenblick wie Gift durch die Adern strömt und selbst im Tode kein Ende nimmt.« Der Wirrkopf war verblendet genug, mir dieses unglaubliche Zeug am Tage vor der Einlieferung vorzulesen, in der Erwartung, meinen bewundernden Beifall zu ernten. Ich setzte ihm auseinander, daß hier eine heillose Vermischung der heterogensten Dinge vorliege; aber mit geringschätzigem Lächeln wies er meinen Einwand zurück, so daß er denn später vom Katheder herab vor der corona commilitonum des Blödsinns bezichtigt wurde. Aber selbst diese Konstatierung der Sachlage blieb fruchtlos. Der Wirrkopf war von seiner Leistung so eingenommen, daß er sie später als Broschüre drucken und an seine Freunde verteilen ließ.
Jede wirkliche Leistung betrachtet der Wirrkopf als etwas Geringfügiges. Er hat hierin eine gewisse Verwandtschaft mit dem »Tüchtigen«, nur daß der gleiche Irrwahn hier aus einer anderen Quelle fließt. Der Wirrkopf macht in der Regel eine sehr obskure, sang- und klanglose Karriere; aber er trägt sich nach wie vor mit dem Bewußtsein, daß er das einzige wahrhafte Genie seines Jahrhunderts ist. Hat einer seiner früheren Schulkameraden später eine hervorragende Stellung errungen, so lächelt er über diese »ephemeren« Erfolge. Er schreibt vielleicht ein Tagebuch, in welchem ab und zu Betrachtungen über das rasche Vergehen der Zeit (die ganz im Gegensatz zu dem eisernen Klotz des Gewissens durchaus nicht vor der Tür liegen bleibt) mit Ausrufen über die Verblendung des Menschengeschlechts und die Verwerflichkeit der Pariser Moden abwechseln. Die Titelseite dieses Tagebuches trägt die Aufschrift: Erga paralipomena, ein bescheidener Anklang an die kleinen Schriften des Frankfurter Philosophen. Der Wirrkopf ist in die Welt gekommen, um seinen Mitmenschen die wahre Einsicht über das Wesen der Kunst und der Philosophie zu bringen; freilich, wie alle großen Geister wird er erst nach seinem Tode anerkannt werden. Dieses Bewußtsein verleiht allem, was er tut, eine eigentümlich groteske Würde. Er setzt kein Seidel an den Mund, ohne sich die Frage aufzuwerfen, ob dieses Glas nicht im Grunde ein beneidenswertes Objekt sei, da es von den Lippen eines so hervorragenden Sterblichen ausgeschlürft werde. Wenn er sich kämmt, so lächelt er bei dem Anblick der ihm allenfalls ausgehenden Haare still vor sich hin … Wie manche junge Dame würde sich glücklich schätzen, wenn sie drei oder vier dieser Haare für ihr Medaillon erwerben dürfte! Denn – das hätten wir beinahe vergessen – der Wirrkopf hält sich dem weiblichen Geschlecht gegenüber für unwiderstehlich. Mit edler Offenheit spricht er von seinem geistvollen Auge, auf das er sich ja durchaus nichts einbildet. In der Tat besitzt er einen schwärmerischen Aufschlag, der namentlich bei jungen Pfarrerstöchtern von ergreifender Wirkung ist. Nach langem Hin- und Herwählen verlobt er sich mit einem herzlich unbedeutenden Frauenzimmerchen. Da er vermöge seiner Wirrköpfigkeit nur langsam auf der Skala der bürgerlichen Existenz emporklimmt, so dauert sein Brautstand sieben, acht, neun[16] und mehr Jahre. Er heiratet dann seine Braut aus Grundsatz; die eigentliche Verliebtheit ist längst zu Grabe gegangen. Aber der Wirrkopf tröstet sich mit der Tatsache, daß alles Glück in diesem Jammertale nur ein Phantom ist. In stillen Sommernächten überläßt er sich ganz und gar dem Weh über sein im Grunde verfehltes Dasein. Er singt dann das von ihm selbst verfaßte Klagelied »Herbstschauer« mit dem Refrain »Die Blätter, sie fallen« zu einer heftig verstimmten Gitarre und erzeugt dadurch ein Echo in der Brust sämtlicher benachbarten Hofhunde. Plötzlich stürzt seine dicke Jeanette auf den Altan und ruft ihm schwer keuchend die Worte zu:
»Aber um Himmels willen, Eduard, du weckst ja die Kinder!«
Im Innersten geknickt, stellt er die Gitarre an die Wand. Die Prosa des Lebens hat seine Seele aus den Regionen des Äthers wieder herabgerissen in die dunklen Tiefen Sansaras; voll stummer Ergebung besteigt er sein Lager an der Seite Jeanettens.
Mit diesem Wirrkopf schließen wir. Die Zahl der Schülertypen ist natürlich noch lange nicht erschöpft; erschöpft aber ist vielleicht die Geduld des Lesers.

Hochgeehrter Herr Redakteur!

Ihr geschätztes Blatt erörtert mit Vorliebe charaktervolle Ereignisse aus dem alltäglichen Leben. In der Tat scheint mir der Ausspruch unseres vortrefflichen Schiller:
aus mehr als einem Gesichtspunkt – veraltet; womit ich keineswegs gesagt haben will, daß Schiller nicht gewisse Verdienste besäße. Erklärt doch derselbe Schiller, – ich habe das betreffende Gedicht erst vorgestern in der Deklamationsstunde rezitiert und infolge einer empörenden Verstimmung des Herrn Professors die Note »ungenügend« davon getragen, – erklärt doch derselbe Schiller, daß der Lebende recht hat. Das Deklamieren ist, beiläufig gesagt, meine Force, während ich im Griechischen durch allerlei Verkettungen häuslicher Übelstände in betrüblicher Weise zurückgeblieben und kaum imstande bin, die ersten Beispiele aus Jakobs zu übersetzen. Nichtsdestoweniger und dessenungeachtet gelang es mir neulich, just im Griechischen den Ehrenplatz eines Primus zu erobern und bis zum Schluß der Lehrstunde unbeeinträchtigt zu behaupten. Sie denken jetzt natürlich an unlautere Manipulationen, an abgeschriebene Exerzitien, an frech gehandhabte Spicker. Aber Sie irren: ich ward Primus auf ganz legitimem, ich möchte sagen, auf höchst honorigem Wege, und kraft jenes Grundsatzes, den schon die Bibel[18] betont: »Wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöhet werden«. Fahren Sie nur getrost in der Lektüre dieser meiner Darlegung fort.
Professor Dr. Schmelzle, der uns den Jakobs erklärt, hat nämlich die befremdliche Angewohnheit, eine mangelhafte Leistung durch Degradation zu bestrafen. Kaum habe ich meinen Mund geöffnet, um den ersten Aor. Ind. Act. von βλέπω mit »ich wurde gesehen« zu verdeutschen, so ertönt schon das verhängnisvolle »Setz' Dich zu unterst!« Beim Repetieren wie beim Extemporieren, beim Hersagen der Paradigmen wie beim Abfragen des Wörterverzeichnisses – überall und jedesmal ernte ich dieses ungebührliche »Setz' Dich zu unterst!«, sobald ich auch nur zwei Silben über die Lippen gebracht habe. Es ist dies, wie Sie in Anbetracht meines sonstigen Bildungsgrades leicht ermessen werden, eine sogenannte Tücke des Schicksals, eine μοῖρα, ein fatum, das auf gewöhnlichem Wege nicht zu ändern ist. Wenn ich, der gehorsamst Unterzeichnete, gleichwohl ein Mittel fand, das anscheinend so unnahbare Ziel des ersten Platzes unter Zweiundzwanzigen zu erreichen, so danke ich dies lediglich meinem diplomatischen Scharfsinn, der allerdings in unserer Familie schon seit mehreren Generationen heimisch ist, wie denn mein Onkel mütterlicherseits, der bekannte Papierfabrikant Heinerle, die Schreibmaterialien in das Reichskanzleramt liefert, während mein Großvater vor der Schlacht bei Königgrätz die Äußerung getan haben soll: »Wenn das Schlachtenglück sich auf die Seite der Preußen neigt, so glaube ich der österreichischen Armee eine ernstliche Niederlage prophezeien zu dürfen!« Habeat sibi! wie Professor Gordon zu sagen pflegt, wenn ich im Bilden eines lateinischen Partizipialsatzes nicht von der Stelle komme. Sie selbst sollen entscheiden, ob ich zu viel behaupte.
Professor Schmelzle – so viel wird Ihnen seit Beginn dieses Briefes klar sein – stellt an die Leistungsfähigkeit seiner Quartaner höhere Anforderungen, als er, streng genommen, vor dem Richterstuhle der Humanität verantworten könnte. Es fehlt ihm für die Beurteilung unserer Kenntnisse jeglicher Maßstab. Diese Tatsache fühlt er selbst, daher er denn von Zeit zu Zeit gewissermaßen an unser eigenes Urteil appelliert und am Schluß der Lehrstunde die bedeutsamen Worte spricht: »So, hm, hm! Fürs nächste Mal[19] mögt Ihr Euch die Klassenaufgabe einmal selber auswählen. Schlagt mir, hm, hm! ein paar Themata vor, ich werde dann endgültig resolvieren!« Da ruft dann der eine: »Ach, Herr Professor, lassen Sie uns bei dem ganzen Pensum von heute das Perfektum ins Präsens verwandeln.« … »Nein, nein,« ruft der zweite, »lassen Sie uns die Erzählung vom Diogenes auswendig lernen!« Kurz, vier, fünf der hervorragendsten Schüler beantragen ihre meist sehr unverfänglichen Aufgaben, und der Herr Professor entscheidet dann. Leider bin ich, wie bereits angedeutet, infolge häuslicher Umstände selbst diesen leichteren Aufgaben nicht gewachsen, und wenn am folgenden Tage die Aufforderung des Lehrers mich trifft, so heißt es immer wieder unfehlbar: »Zu unterst!«
Nun muß ich bemerken, daß Professor Schmelzle ein Dichter ist. Von Zeit zu Zeit veröffentlicht er im städtischen Anzeiger ein Kind seiner Muse, – sei es nun ein Hymnus auf die Rückkehr des Herzogs, ein Frühlingslied oder ein Festgesang beim Antritt des neuen Jahres.
Es war nun am 10. Januar, als Professor Schmelzle uns wiederum die Wahl der Aufgabe für den folgenden Mittwoch freigab. In der Neujahrsnummer des städtischen Anzeigers hatte just eine Ode unseres allverehrten Lehrers gestanden, ein »Rückblick« von zwanzig Strophen, der die Ereignisse des verflossenen Jahres in tiefsinniger, ja, ich möchte fast sagen, unverständlicher Weise behandelte. Poeten sind eitel, und Professor Dr. Schmelzle ist, was diesen Punkt betrifft, ein Poet ersten Ranges. Als er daher am Schluß der Lehrstunde vom 10. Januar zu Vorschlägen aufforderte, erhob ich mich selbstbewußt und sagte mit Stentorstimme: »Herr Professor, lassen Sie uns das schöne Gedicht ›Rückblick‹, das Sie in der Neujahrsnummer unseres städtischen Anzeigers zu veröffentlichen die Güte hatten, ins Griechische übersetzen!«
Sie stutzen, geehrter Herr Redakteur! In der Tat war das eine Aufgabe, an der selbst die Gewandtheit eines Primaners unausbleiblich gescheitert wäre. Aber gerade das wollte ich. Ich wollte diesen fünf, sechs Auserlesenen, die stets die Note »Vortrefflich« einheimsten, auch einmal zeigen, was es heißt, ein Problem lösen zu sollen, das unsere Kraft übersteigt. Aber noch mehr. Ich selbst wollte[20] mich durch dieses glorreiche Strategem an die Spitze der Quarta schwingen und meinen Mitschülern dartun, daß ein offener Kopf praktisch mehr bedeutet als ein Wust von Optativen, die sich schließlich endigen mögen, wie sie wollen, – mir soll's egal sein.
Der Professor war im ersten Moment über meine Kühnheit verblüfft, aber gleich darauf spielte um seine Lippen jenes eigentümliche Dichterlächeln, das mir den Sieg gewährleistete. Der Gedanke, daß dreiunddreißig mehr oder minder geistvolle Knaben sich stunden- und tagelang mit dem »Rückblick« beschäftigen, daß sie ihn analysieren und gewissermaßen in seine Einzelschönheiten aufdröseln sollten, – dieser Gedanke hatte für Professor Schmelzle etwas Verführerisches. Die Autoren-Eitelkeit überwog alle Bedenken, und die idealistische Auffassung bezüglich unseres Wissens machte ihn ja so wie so geneigt, uns allerlei Sisyphusarbeiten zuzumuten.
»Gut,« sagte er schmunzelnd, »übersetzt mir den ›Rückblick‹ ins Griechische. Die Sache wird Euch zwar Mühe machen, aber ein deutsch-griechisches Lexikon tut das übrige. Notabene, selbstverständlich braucht Ihr Euch nicht an das Metrum zu halten.«
Mit diesen Worten verließ er das Schulzimmer, während ich von meinen Kommilitonen mit drohenden Vorwürfen überhäuft wurde, die ich stoisch lächelnd zurückwies.
Der entscheidende Mittwoch kam unter den mannigfachsten Qualen der gepeinigten Quarta heran.
»Nun,« sagte der Herr Professor, indem er sich behaglich über das rundliche Kinn strich, »wer will mir denn einmal zuerst den griechischen ›Rückblick‹ vorlesen oder aufsagen?«
Nicht ein einziger meiner Mitschüler meldete sich, denn alle fühlten die entsetzliche Unzulänglichkeit ihrer Arbeit; ich aber fuhr stolz in die Höhe und sagte mit fester, gemessener Stimme:
»Ich, Herr Professor.«
»Du, Holzheimer?« fragte der Professor erstaunt; »nun, da bin ich denn doch in der Tat begierig.«
Ich hob mein Heft und begann. Kaum aber hatte ich zwei Zeilen meiner unglückseligen Übersetzung vorgetragen, als schon ein wütendes »Zu unterst! Zu unterst!« mir das Wort von den Lippen nahm. Da ich bereits zu unterst saß, so brauchte ich mich nicht[21] weiter vom Platz zu bemühen. Ich setzte mich und wartete siegesgewiß der Dinge, die da kommen sollten.
»Lies Du einmal, Kurschmann!« rief der Professor ärgerlich.
Stotternd und stammelnd begann der sonst vortreffliche Schüler die Lektüre seines Elaborates.
»Was?« unterbrach ihn der Lehrer beim dritten Worte. »Wie übersetzt Du diesen Passus: ›Im herben Mischkrug schnöder Vergangenheit?‹ Bist Du von Sinnen? Augenblicklich zu unterst!«
Das Haupt gesenkt schritt Kurschmann von der Bank der Erlesenen nach dem Strafplatze. Ich aber rückte einen hinauf.
»Engelbach!« sagte der Herr Professor, »beschäm' einmal dieses barbarische Griechisch!«
Engelbach las, aber er kam nicht weiter als Kurschmann. Die Aufgabe war eben für einen Quartaner unlöslich.
»Zu unterst!« schrie der Professor, der die Unfähigkeit seiner Schüler wie eine persönliche Injurie empfand. Bei den Göttern! War denn diese Neujahrsode so verworren, so unklar, daß zwei der besten Jakobs-Übersetzer, daß ein Kurschmann, ein Engelbach daran scheiterten! …
»Kleewitz!« rief Schmelzle mit geröteter Stirn, als Engelbach neben Kurschmann Platz genommen und mich so abermals um einen herauf befördert hatte. »Du bist doch ganz gewiß imstande gewesen … Es müßte ja mit dem Teufel zugehen … Ich verlange ja keineswegs den vollendeten Attizismus, aber mein Gott … Was? Du hast überhaupt nichts geschrieben? Die Arbeit war Dir zu schwer? Du bist ja ein ganz erbärmlicher Junge! Zu unterst! Augenblicklich zu unterst!«
Und abermals rückte ich einen hinauf.
Dieser vierfache Mißerfolg hatte den Professor hitzig gemacht.
»Ich will denn doch einmal sehen, ob nicht ein einziger in der ganzen Klasse so viel Griechisch besitzt, um dieses schlichte, einfache, ich kann wirklich sagen: edel-einfache Poem wiederzugeben! Einer wird doch von den rastlosen Bemühungen, die ich dieser Klasse fortwährend opfere, etwas profitiert haben. Grazmüller, Veltliner, Stechhuber! Beim Pluto, seid Ihr denn alle vernagelt? Grazmüller, lies einmal vor!«
Und Grazmüller las. Aber auch Grazmüller kam zu Fall, wurde im Tagebuch durch persönliche Eintragung des Professors mit Nachsitzen belegt, und dann ertönte das traditionelle »Zu unterst!«
So rutschte ich Bank um Bank aufwärts, und als es drei Viertel schlug, – Sie mögen's nun glauben oder nicht, – als es drei Viertel schlug, war ich, Otto Leberecht Holzheimer, ich, das Opfer mißglückter Aoristformen, Primus!
Der Professor bebte am ganzen Leibe.
»Das ist zu viel!« raunte er mit erstickter Stimme. »Ich muß ein Exempel statuieren. Die ganze Klasse kann ich nicht einsperren, aber schon im Altertum pflegte man rebellische Legionen zu dezimieren … Die sechs Untersten werden mir über Mittag nachsitzen. Primus, Du wirst den Pedellen von dieser Verfügung in Kenntnis setzen.«
Und ich, Otto Leberecht Holzheimer, meldete unserem Pedell, die sechs Ultimi, darunter zwei der vorzüglichsten Griechen, seien wegen ungenügender Leistung mit der empfindlichen Strafe des Herrn Professors in aeternam rei memoriam gebrandmarkt worden!
Sehen Sie, geehrter Herr Redakteur, so geht's in der Welt! Der Geist siegte über das Fleisch, die deutsche Intelligenz über den griechischen Formelkram, der Germanismus über das Welsche, Bismarck über Benedetti, Schalk über das Philistertum, und Falk über die Jesuiten. Als deutscher Quartaner biete ich Ihnen, dem Gleichgesinnten, Gruß und Handschlag! Lassen Sie uns gemeinsam fortstreben im Dienste der echten, der geistesbefreienden Humanität!
Mit kollegialischem Gruß
Ihr
herzlich ergebener
Otto Leberecht Holzheimer.
pr. Adr.: Herrn Dr. Friedrich Leberecht Holzheimer,
Herzogl. Kreisphysikus und Sanitätsrat
zu Meppingen.



Es ist eigentümlich, wie schwer sich der Gymnasiast daran gewöhnt, das Privatleben seiner Lehrer unbefangen und parteilos ins Auge zu fassen und in dem Manne, der da berufen ist, von der Höhe seines Katheders den Äschylus zu erklären und Karzerstrafen zu verhängen, ohne störende Nebengedanken den Bürger und Staatsbürger zu würdigen. Alles, was der Lehrer im Kreise seiner Familie oder innerhalb der menschlichen Gesellschaft treibt, gewinnt für den Blick des Gymnasiasten eine absonderliche Beleuchtung, und zwar müssen wir zu unserem Bedauern konstatieren, daß diese Beleuchtung nur in Ausnahmefällen die einer rein menschlichen Sympathie ist. Vielmehr geht das Gymnasiastengemüt systematisch darauf aus, jeder Handlung des Gymnasialprofessors, und sei sie die indifferenteste und naturgemäßeste, eine komische Seite abzugewinnen und übermütige Glossen daran zu knüpfen.
Zu den ernstesten und heiligsten Familienereignissen gehört die Vermehrung des Hausstandes durch einen jungen Sprößling. Unter normalen Verhältnissen beeilen sich sofort die Verwandten und Freunde, das höchlich erfreute Elternpaar zu beglückwünschen, und ein Inserat im Tageblatt verkündet auch den entfernteren Gönnern und Gesinnungsgenossen, daß die liebe Frau Berta oder Josephine ihren Gatten mit einem kräftigen Jungen überrascht habe. Wenn der Gymnasiast wirklich ein ethisch tief angelegtes Geschöpf wäre, so müßte ein derartiges Vorkommnis in der Familie des Gymnasialprofessors auf die ganze Klasse einen erhebenden und läuternden Einfluß ausüben. Aber just das Gegenteil ist der Fall …
In Sekunda und Prima erfreuten wir uns eines Lehrers, der nur darum nicht die oben erwähnten Insertionskosten in jedem Semester dreimal zu tragen hatte, weil die Natur in diesem Punkte unüberwindliche Hindernisse aufgetürmt hat. Aber alljährlich einmal trat die beglückende Überraschung doch ein, und die ganze Klasse war dann in einer Weise demoralisiert, die mit dem Geist, wie er in einer Pflanzstätte des Schönen, Wahren und Guten herrschen soll, schroff kontrastierte.
Schon einige Wochen vor dem entscheidenden Tage raunte man sich auf allen Bänken das Geheimnis von Doktor Brömmels erneuten Hoffnungen zu. Sobald diese Tatsache für ausgemacht galt, beschäftigten wir uns während der Unterrichtsstunden Brömmels vornehmlich mit Epigrammen und Xenien, denen es oblag, unsere Entdeckung nach ihrer sittlichen, kulturgeschichtlichen und nationalökonomischen Seite zu kritisieren.
Eine hervorragende Rolle in diesen rhythmischen Kleinigkeiten spielte Niobe, als das Urbild eines überschwenglichen Mutterstolzes. Auch Danaos und andere mythische Gestalten woben sich zwanglos in unsere Distichen ein. Und da sich mir bei einer tieferen Würdigung der Sachlage die Erwägung aufdrängte, wie es Herrn Brömmel dereinst wohl gelingen möchte, seine zahlreichen Töchter glücklich und vorteilhaft zu verheiraten, so schuf ich, die Ereignisse antizipierend, eine Ballade, die mit den Versen anhub:
Im weiteren Verlauf der Dichtung schob ich nun dem unglücklichen Lehrer eine endlose Reihe von Machinationen unter, von denen keine zum erwünschten Ziele führt. Da ergreift ihn die helle Verzweiflung. Die Hände zum Zeus erhoben, bricht er in die klagenden Worte aus:
Da läßt Zeus seine Donner rollen, und eine vernichtende Stimme ruft dem erschrockenen Bittsteller zu:
Der Leser wird schon bei der Lektüre dieser wenigen Proben die Überzeugung gewinnen, daß unsere Lieblosigkeit einen wahrhaft beängstigenden Höhegrad erreicht hatte. Was war indes meine Ballade gegen die Xenien Wilhelm Rumpfs oder die Vierzeiler Emanuel Boxers? Eines dieser Quatrains lautete z. B.:
Ein anderes:
Ein drittes griff die Sache noch ironischer und beißender an. Es lautete:
Oder in knapperer Form:
Ja, selbst ethnographische Streiflichter blitzten aus unseren geistsprühenden Epigrammen:
Unter solchen und ähnlichen Perfidien verstrich Woche um Woche, und nun ging es ungefähr, wie ich nachstehend verzeichne.
Es war etwa in der Nachmittagsstunde zwischen zwei und drei. Doktor Brömmel erging sich gerade in einer ausführlichen Darlegung der griechischen Literaturverhältnisse seit dem Tode des Euripides … Plötzlich vernahm man an der Tür des Schulsaales ein schüchternes Pochen.
»Herr Professor, es klopft!«
Über die Züge Brömmels flog ein eigentümliches Leuchten.
»So, es klopft?« sagte er mit unsicherer Stimme. »Sehen Sie einmal nach, Boxer, wer da ist.«
Boxer ging, um zu öffnen. Im Rahmen der Pforte ward das ernste Haupt des Pedells sichtbar.
»Ah, Sie sind es, Quaddler«, sagte der Professor, nur mit Mühe eine gewisse Erregung bewältigend. »Was wollen Sie?«
»Herr Professor, Ihr Mädchen ist draußen, Sie möchten doch rasch mal nach Haus kommen.«
Durch die versammelte Sekunda ging ein leises, fast unhörbares Murmeln. Boxer, der sich wieder auf seinen Platz zurückzog, streckte uns bedeutsam die Zunge heraus und zog die Brauen in die Höhe, als wollte er sagen: »Jamjam adest!« Professor Brömmel aber beauftragte den Primus, einstweilen ein Kapitel aus Xenophons Memorabilien übersetzen zu lassen, griff hastig nach Stock und Hut und eilte ins Freie.
Sofort bemächtigten wir uns des Pedells.
»Was ist denn los, Herr Quaddler?« riefen wir, eine naive Unkenntnis heuchelnd. »Die Frau Professorin ist doch nicht krank geworden?«
Quaddler schüttelte unwillig das Haupt.
»Ach, die Herren Sekundaner müssen immer ihre Possen machen«, sagte er ärgerlich. »Sie werden wohl sehr gut wissen, was geschehen ist.«
»Aber wir haben keine Ahnung, bester Herr Quaddler!« riefen wir im Chor.
»Ach, gehen Sie weg, ich kenne das. Seit zwanzig Jahren bin ich Pedell, und die Herren Sekundaner haben es noch jedesmal so gemacht.«
»Das ist wohl bis jetzt in jedem Semester passiert?« fragte Boxer.
»Herr Boxer,« sagte Quaddler sehr ernst, »ich muß mir gütigst erlauben, zu vermerken, daß ich unmöglich zugeben kann, wo es sich um den Respekt handelt, und wofern Sie immer so Narrenspossen im Kopfe haben!«
»Aber ich frage ja nur, – ereifern Sie sich doch nicht! Also es ist wirklich was Kleines?«
Quaddler wurde jetzt ungemütlich.
»Wenn Sie meinen, Sie können hier Ihren Spott mit mir treiben, so muß ich mir ergebenst zu vermerken erlauben, daß Sie gütigst im Irrtum sind. Wenn der Herr Professor zurückkommen, werde ich vermelden, was vorgefallen ist.«
»Was? Er droht?« rief jetzt eine Stimme von den hinteren Bänken.
»'naus! 'naus!« donnerte eine zweite.
Quaddler richtete sich hoch auf.
»'naus, sagen Sie? 'naus? Wissen Sie was, wenn Sie mir so kommen und 'naus sagen, dann gehe ich.«
Und hiermit machte er kehrt und verschwand im Korridor.
Jetzt brach ein unendlicher Jubel los. Einer von uns bestieg den Katheder und machte seine Mitschüler in einer kurzen Ansprache auf das Wichtige und Erhebende des Momentes aufmerksam. Am Schluß dieser Rede betonte er die Notwendigkeit, dem gefeierten Lehrer durch eine möglichst glänzende und einstimmige Demonstration die Teilnahme der Sekunda an dem freudigen Ereignis recht unmittelbar auszudrücken. Nach längeren Debatten ward der Beschluß gefaßt, Herrn Brömmel des anderen Tages bei seinem Erscheinen im Lehrzimmer ein großes Bukett und eine ad hoc zu verfertigende lateinische Ode zu überreichen. Da wir nichts Besseres zu tun hatten, so gingen unsere berufensten Lateiner sofort ans Werk, das projektierte Festgedicht in seinen Umrissen zu Papier zu bringen. Sechs oder sieben Entwürfe gelangten zur Verlesung. Es fand sich da eine reiche Auswahl der wunderbarsten und überraschendsten Wendungen. Eine dieser Hymnen begann mit den Worten:
eine Strophe, deren Schlußwendung nicht der Grazie entbehrt. Ich selbst hatte eine tiefempfundene Ode verfaßt, die mit dem Ausrufe begann:
Sie wurde jedoch von der Majorität meiner Kameraden als zu karzergefährlich abgelehnt.
Des anderen Tages mit dem Glockenschlag neun trat Doktor Brömmel nicht ohne eine gewisse Befangenheit in das Schulzimmer. Sofort erhob sich der Primus von Obersekunda und streckte die Rechte wie zum Eidschwur nach der Decke. Auf dieses verabredete Signal brach die ganze Klasse in ein stürmisches Hoch aus: Hoch! und abermals Hoch! und zum drittenmal Hoch! Doktor Brömmel wußte nicht, ob er danken oder eine Untersuchung einleiten sollte. Ehe er sich jedoch über dieses Dilemma entschieden hatte, trat unser bester Redner aus den Bänken, schritt, in der Linken das riesige Bukett, in der Rechten die auf sauberes Velinpapier geschriebene Ode haltend, nach dem Katheder hin und begann seine Deklamation. Das Festgedicht war so eingerichtet, daß nach jeder achtzeiligen Strophe der Chor einfallen mußte, was denn auch jedesmal bestens besorgt wurde. Herr Doktor Brömmel schwankte während der ganzen Zeremonie fortwährend zwischen den verschiedenartigsten Stimmungen hin und her. Einmal biß er sich so entschieden auf die Lippe und legte die geballte Faust auf die Kathederfläche, daß wir unbedingt überzeugt waren, er würde die ganze Klasse wegen Komplotts beim Lehrerkollegium anzeigen; dann aber, unseren heiligen Ernst wahrnehmend, lächelte er still vor sich hin und gedachte an Berta, die ja in der Tat, die ja wirklich, die ja genau so, wie es in dem Festgedicht hieß, sein Haus mit Freude und Segen erfüllt hatte. Im stillen aber mochte er Gott danken, daß der ganze Umfang seines Glückes den Schülern zurzeit noch verborgen geblieben war. Hätten wir gewußt, daß sich das oben mitgeteilte Quatrain Boxers verwirklichen sollte, hätten wir geahnt, daß die Welt um zwei junge Brömmels reicher geworden war: wir würden ohne Zweifel zwei Redner ins Feld gesandt, zwei Oden gedichtet und zwei Buketts überreicht haben, eine Huldigung, deren unverkennbare Komik die Reserve, mit welcher Doktor Brömmel uns jetzt anhörte, unmöglich gemacht hätte.
Nachdem unser Spruchvermelder seine Aufgabe erledigt hatte, sagte Doktor Brömmel mit gemessener Freundlichkeit: »Ich danke Ihnen. Wir wollen uns durch diesen Zwischenfall indessen nicht weiter stören lassen und unsere Arbeit da wieder aufnehmen, wo wir sie unterbrochen haben.«
Es dauerte zwei Tage, bis wir erfuhren, daß die Sonne des Brömmelschen Hauses in das Zeichen der Zwillinge getreten war. Jetzt aber kannte die Flut der Epigramme, Distichen und Quatrains keine Grenzen mehr. Boxer verfertigte allein an zweihundert Vierzeiler, und da wir seine Aperçus in hohem Grade originell fanden, so beschlossen wir, dieselben auf gemeinschaftliche Kosten drucken zu lassen. Gedacht, getan. Jeder von uns bekam zwei Exemplare der köstlichen Sammlung: die übrigen zerschnitten wir in kleine Streifen, und zwar so, daß jedesmal ein Quatrain durch diese Teilung isoliert wurde, und verstreuten die eigentümlichen Bonbonzettel kurz vor dem Beginne der nächsten Brömmelschen Lehrstunde im Schulzimmer und insbesondere auf dem Katheder.
Brömmel erschien wie gewöhnlich mit einer gewissen Schüchternheit. Der Soldat mag noch so oft den Donner der Schlachten gehört haben: beim Beginn des Gefechts verspürt er immer ein gewisses Unbehagen, das er erst nach und nach im Laufe des Treffens bemeistern lernt.
Auf dem Katheder angelangt, bemerkte Brömmel zu seiner größten Überraschung, daß man seinen Ehrenplatz heute in höchst eigentümlicher Weise dekoriert hatte. Er runzelte die Stirn und wollte sich eben erkundigen, »wer sich einen so witzlosen Streich erlaubt habe«, als sein Blick auf dem Namen Brömmel haften blieb, der sich in großen Buchstaben aus dem typographischen Karree einer sauber ziselierten Strophe hervorhob. Der Schulmann sah näher zu und vermochte nur mit Mühe einen Ausruf des Entsetzens zu unterdrücken.
»Sehr gut, sehr gut!« stöhnte er nach einer Weile, heftig die Nüstern blähend. »Und wer ist der saubere Kamerad, der sich dieser wohlfeilen Späße erfrecht? Er möge sich nennen, der Feigling, damit ich ihm zeigen kann, was einem solchen ehrlosen Streiche gebührt!«
In den Räumen der Sekunda herrschte lautlose Stille.
»Nun, will sich der wohl melden, der mir diese schmutzigen Wische da auf den Katheder gelegt hat? Ich frage nicht zum dritten Male!«
Über den Subsellien brütete eine unheimliche Grabesruhe. In der Tat hatten wir keine Veranlassung, der Aufforderung des Herrn Professors nachzukommen, da er uns so energisch versicherte, zum drittenmal würde er nicht fragen.
»So!« rief Brömmel nach einer längeren Pause, furchtbar die Augen rollend; »der will sich also nicht melden? Gut! Sehr gut! So werde ich die ganze Klasse über Mittag hier behalten!«
Jetzt erhob sich auf den hinteren Bänken ein Brummen des Unwillens, dem sich bald ein sehr dezidiertes Scharren mit den Stiefelabsätzen zugesellte.
»Was? Brummen wollen Sie? Scharren wollen Sie? Kindsköpfe, die Sie sind! Ich werde Ihnen einmal einen Quartaner herauf holen, der soll Ihnen sagen, was Lebensart ist!«
Gelächter auf allen Bänken.
Jetzt riß Herrn Brömmel die Geduld. Er eilte mit großen Schritten auf Boxer zu, den er in dem begründeten Verdacht hatte, einer der Haupträdelsführer bei jedem Skandal zu sein, und rief mit Donnerstimme:
»Sie sind mir für diesen himmelschreienden Unfug verantwortlich! Entweder Sie machen mir den Schuldigen ausfindig, oder ich sperre Sie vier Tage auf den Karzer.«
»Meinen Sie mich?« lächelte Boxer mit der Unschuld eines vierzehnjährigen Mädchens.
»Ja, Sie! Ich sehe Ihnen an, daß Sie die ganze Geschichte angestiftet haben! Kein Wort mehr!«
»Aber, Herr Doktor, ich versichere Sie, daß ich keine Ahnung habe, um was es sich eigentlich handelt. Gebrummt habe ich diesmal nicht, und wegen Nichtbrummens zu brummen fällt mir gar nicht ein.«
»Lassen Sie Ihre schlechten Witze, sonst werden Sie Ihre Lage nur noch verschlimmern! Wollen Sie mir kurz und bündig gestehen, was Sie von der Sache wissen?«
»Von welcher Sache, Herr Doktor? Gebrummt habe ich nicht, denn ich sitze viel zu weit vorn, und gescharrt habe ich auch nicht,[31] denn ich habe heut' Stiefel an, die mir so eng sind, daß ich keinen Fuß rühren kann. Also wovon soll ich wissen?«
»Mensch, Sie verstellen sich in einer Weise, die geradezu empörend ist. Ich frage Sie, was wissen Sie über den Autor der schamlosen Pasquille, die man mir dort auf den Katheder gelegt hat?«
»Erlauben Sie einmal«, sagte Boxer, nach dem Katheder eilend. – Er las mit halblauter Stimme:
»Behalten Sie diese Dummheiten für sich, und gehen Sie auf Ihren Platz zurück!« schrie Brömmel mit steigender Erbitterung.
Boxer raffte die Zettel, die auf dem Katheder lagen, zusammen und steckte sie in die Brusttasche.
»Wenn Sie mir drei Tage Zeit lassen,« sagte er harmlos, »so wird es mir nicht schwer halten, den Urheber zu ermitteln. Ich gehe einfach bei allen Druckereien der Stadt herum und erkundige mich, in welcher Offizin diese Zettel gedruckt worden sind. Das ist das einfachste und sicherste Mittel.«
»Das werden Sie bleiben lassen«, versetzte Brömmel energisch. »Wollen Sie Ihren Impertinenzen die Krone aufsetzen und diese Sudeleien womöglich noch ins Tageblatt befördern? Geben Sie her!«
Boxer nahm jetzt die Stellung ein, die Lessing auf seinem berühmten Gemälde dem Johann Huß zuerteilt hat.
»Herr Professor,« sagte er, »das ist eine schreiende Ungerechtigkeit! Sie bedrohen mich mit einer mehrtägigen Karzerstrafe, falls ich Ihnen den Schuldigen nicht namhaft mache, und dabei suchen Sie mir die Mittel zu entziehen, die allein geeignet sind, mir die gewünschte Entdeckung zu ermöglichen. Herr Professor, Sie werden entschuldigen, wenn ich mich damit nicht beruhigen kann. Ganz ergebenst bitte ich um die Erlaubnis, sofort zum Herrn Direktor gehen zu dürfen. Ich werde ihm die ganze Angelegenheit vortragen und diese Zettel zur Verfügung stellen. Der Herr Direktor mag dann selbst entscheiden, ob ich dafür verantwortlich bin, wenn andere etwas von Zwillingen schreiben. Außerdem habe ich niemals gehört, daß Zwillinge ein Schimpfwort wäre.«
Brömmel sah jetzt sehr wohl ein, daß er sich in eine Sackgasse verrannt hatte. Er wäre lieber gestorben, ehe er zugegeben hätte, daß der Direktor diese schnöden Machwerke der mißratenen Sekundaner zu Gesicht bekäme. Was konnte es frommen, wenn die offizielle Folge einer solchen Wendung der Dinge wirklich für Boxer und Genossen verhängnisvoll ward? Privatim hätte der Direktor sich doch köstlich amüsiert und nicht verfehlt, im Klub und auf den öffentlichen Bierkellern, die er mit Vorliebe frequentierte, das Ereignis zum besten zu geben, ganz abgesehen davon, daß Brömmel sich dem Direktor gegenüber selbst unter vier Augen nicht kompromittieren wollte. Der Zwist wurde also beigelegt, Boxers Unschuld in ihrem vollen Umfange anerkannt und von einer weiteren Untersuchung Abstand genommen, weil, wie Doktor Brömmel sich ausdrückte, die ganze Sache eigentlich zu erbärmlich war, um ein Wort darüber zu verlieren.
»Ich bitte mir übrigens aus,« fügte er hinzu, als er wieder auf dem Katheder Platz nahm, »daß Sie die Wische da unverzüglich vernichten. Sekunda stellt sich durch solche Lächerlichkeiten ein testimonium paupertatis aus, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als Ihre Zeit mit solchen unlauteren Reimereien zu vertrödeln? Schämen Sie sich in Ihre Seelen hinein! Wenn Sie so fortfahren, so werden Sie über kurz oder lang moralisch zugrunde gehen, – denken Sie an mich! Ohne echten sittlichen Ernst ist eine gedeihliche Entwickelung des Menschen nicht denkbar, und wenn Sie noch so glänzende Fortschritte in den Wissenschaften machen, was ich nicht gerade behaupten kann, so würden Sie doch niemals zu wahrhaften Männern heranreifen, falls der frivole Geist, wie er seit einiger Zeit in dieser Klasse herrscht, einen dauernden Einfluß behaupten sollte. Wahrlich, es ist weit gekommen, wenn nicht einmal mehr das Privatleben des Lehrers vor den Ungezogenheiten einer charakterlosen Schuljugend sicher ist. Aber das kommt von dem oberflächlichen und leichtfertigen Lebenswandel, dem sich die meisten jungen Leute von heutzutage leider schon sehr, sehr früh zu ergeben pflegen! Es ist ein wahres Unheil, wenn sich in der Stadt, wo die Gymnasien ihr Zelt aufgeschlagen haben, gleichzeitig eine Universität befindet. Verlassen Sie sich darauf, ich werde Ihnen auf die Finger sehen! Erfahre ich jemals wieder,[33] daß einer von Ihnen an Zechgelagen teilgenommen hat, so lasse ich keine Milderungsgründe gelten: ich trage unbedingt auf Relegation an. Es sind Leute unter Ihnen, die gar nicht wissen, was sie sich und der bürgerlichen Gesellschaft als Mitglieder eines öffentlichen Erziehungsinstitutes schuldig sind. Das muß anders werden. Boxer, an Sie wende ich mich speziell. Sie sind mir wiederholt als derjenige bezeichnet worden, der bei allen nichtsnutzigen Streichen das große Wort führt. Ich rate Ihnen in aller Freundschaft, bessern Sie sich, sonst nimmt es kein gutes Ende mit Ihnen. Wahrlich, Ihr vortrefflicher Herr Vater hat es nicht um Sie verdient, daß Sie in dieser Weise seinem Namen Unehre machen.«
Boxer erhob sich mit der Miene eines tödlich Beleidigten.
»Herr Professor,« stammelte er mit gut gekünstelter Aufregung, »das hat mir noch niemand gesagt. Und was meinen Vater betrifft, so hat er erst gestern in meiner Gegenwart geäußert, ich sei der Stolz der Familie. Ich kann das durch Zeugen erhärten, und in der Tat wüßte ich auch nicht, inwiefern ich ihm die mindeste Unehre machte. Ich habe bis jetzt noch immer die besten Aufsätze geschrieben, und meine Zensuren lauten, bis aufs Betragen, stets günstig.«
»Setzen Sie sich! Ich weiß besser, was Ihr Herr Vater über Sie denkt, und sollte er wirklich im Zweifel sein, wie es um seinen Sohn bestellt ist, so werde ich ihm bei nächster Gelegenheit einmal gründlich die Augen öffnen.«
Boxer setzte sich, und der Unterricht nahm seinen Anfang.
Als aber Doktor Brömmel den Lehrsaal verlassen hatte, sanken sich die Sekundaner gegenseitig in die Arme und jauchzten vor Wonne und Seligkeit.
»Ach,« klang es von Mund zu Mund, »der Himmel gebe, daß die Brömmelina bald wieder Zwillinge bekommt!«

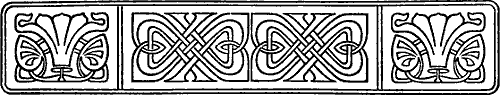

Si omnes mundi homines,
Quae amant, iis non carerent,
Praeclara vitae esset spes,
Nam qui timores nos terrerent?
Perpetuo vellem bibere,
Sed saccus mi repletus raro!
O Deus, pater optume,
Quor fato utor tam amaro?
Quor gulam mi tam aridam,
Tam vini cupidam dedisti,
Si, quibus flammas opprimam,
Pecunias dare omisisti?
Ad ultimum me rediges:
Haud justum mi parasti sortem!
Mehercle! Quae mi cunque des, –
Aut dabis aes, aut dabis mortem!

… Am 24. Februar 18**

Womit soll ich zunächst anfangen? – Es klingt eigentümlich, aber es ist nichtsdestoweniger wahr: jeder Anfang hat für mich etwas Peinliches. Bei meinen deutschen Aufsätzen hocke ich oft stundenlang und kaue an der Feder, ohne zu wissen, wie ich dem Dinge beikommen soll. Gewöhnlich helfe ich mir dann dadurch, daß ich mich nach einem geeigneten Zitat umsehe und dasselbe als Motto oben rechts in die Ecke schreibe. Hieran läßt sich dann gewöhnlich in ungezwungener Weise anknüpfen, indem man etwa fortfährt wie nachstehend:
»Der große Dichter, dem wir diese Worte entlehnen, hat ohne Zweifel dabei die hochwichtige Frage im Auge gehabt, deren Behandlung mir heute von Amts wegen obliegt.«
Es ist mir bis jetzt noch stets gelungen, den erforderlichen Nachweis zu liefern, zumal wenn das Zitat von Schiller war, dessen Aussprüche das Angenehme haben, daß sie für alle Verhältnisse des Lebens gleich brauchbar sind. Ich will also dieser meiner angestammten Gewohnheit auch heute nicht untreu werden und mein Tagebuch mit den herrlichen Worten aus Schillers Glocke einleiten:
Dies ist nämlich die Ansicht meines Mitschülers Leopold Hutzler, der in der Nähe des Fensters sitzt und durchaus nicht leiden kann,[36] wenn man auch nur ein kleines Quadratchen öffnet, um frische Luft hereinzulassen. Wie zu Eingang notiert, ist es noch Februar, und die Witterung läßt manches zu wünschen übrig. Wir besitzen nun einen Lehrer, der zum Schlagfluß neigt und vor Kongestionen fast umkommt, wenn alles geschlossen ist. Kaum tritt er ins Zimmer, so ruft er mit seiner dröhnenden Baßstimme: »Schwarz, machen Sie mal 's Fenster auf!«, und Schwarz tut, wie geheißen. Bis zum 20. Februar ging die Sache auch ihren stillen, friedlichen Gang. An diesem Tage aber gelangten die exercitia pro loco zur Verteilung, und Hutzler, der ein Feind aller Zugluft ist, kam in die Nähe des Fensters zu sitzen …
Doktor Perner ließ wie gewöhnlich oben die Klappe öffnen und wollte eben seinen Vortrag beginnen, als der stramme Hutzler sich von seinem Platze erhob und mit aufgestelltem Rockkragen und frostschauernder Stimme in die geflügelten Worte ausbrach:
»Herr Doktor, es zieht so!«
Doktor Perner wird nun jedesmal nervös, wenn jemand behauptet, es ziehe. Er sagt, das sei Einbildung, und wenn die Bewegung der atmosphärischen Luft die Gesundheit schädige, so könne kein Mensch mehr über die Straße gehen, ohne eine Rippenfellentzündung oder die Diphtheritis zu bekommen.
»So, es zieht Ihnen?« erwiderte er in wegwerfendem Tone. »Wie alt sind Sie eigentlich?«
»Im nächsten Januar werde ich siebzehn!« entgegnete Hutzler mit Würde.
»Und demungeachtet zieht es Ihnen? – Nun, dann ist es die höchste Zeit, daß Sie endlich einmal dieses Vorurteil ablegen. Setzen Sie sich, das Fenster bleibt auf!«
Hutzler zog den Rockkragen noch höher, setzte sich nicht und sagte mit männlicher Festigkeit:
»Herr Doktor, der Arzt hat es mir dringend verboten, mich der Zugluft auch nur auf wenige Minuten auszusetzen. Ich bitte um die Erlaubnis, meinen Platz wechseln zu dürfen!«
»Meinetwegen«, sagte der Doktor Perner mit einem geringschätzigen Achselzucken. – »Hanau, wechseln Sie einmal mit dem Hutzler den Platz!«
»Herr Doktor,« sagte Hanau, »ich bin erst gestern wiedergekommen und neige sehr zum Katarrh. Es wäre vielleicht doch besser, wenn wir das Fenster zumachten.«
»Seien Sie still! Gildemeister, setzen Sie sich dort an das Fenster!«
Gildemeister hustete dumpf, und es klang wie ein Bierfaß.
»Wenn Sie erlauben,« sagte er mit heiserer Stimme, »so möchte auch ich hier auf meinem Platze bleiben. Ich habe jetzt schon acht Senfpflaster verbraucht, um meinen Luftröhrenkatarrh los zu werden, und bin immer noch nicht damit zustande gekommen.«
»Gut,« sagte Doktor Perner jetzt stirnrunzelnd, »so bleiben Sie, wo Sie sind. Wenn es dem Hutzler zieht, so mag er seinen Paletot umhängen.«
»Wenn ich meinen Paletot umhänge, so wird mir's zu warm, und dann erkälte ich mich erst recht.«
»Meinetwegen erkälten Sie sich sechsmal.«
»Nun, Sie werden ja sehen, was Sie anrichten, Herr Doktor«, sagte Hutzler gekränkt. – »Ich merke jetzt schon einen eigentümlichen Kitzel im Halse, und so fängt es bei mir jedesmal an.«
Mit diesen Worten begann er zu hüsteln.
Ich muß nun an dieser Stelle bemerken, daß Hutzler einer unserer gesundesten Schüler ist. Wie oft hat der Direktor Samuel Heinzerling ihm die vernichtenden Worte zugerufen: »Schwächläch! Sä, schwächläch? Non, hären Sä änmal, Hutzler, äch wollte, jäder Mänsch onter der Sonne wäre so schwächläch wä Sä! Faul sänd Sä, aber nächt schwächläch!« Es handelt sich bei der ganzen Opposition Hutzlers lediglich um das, was man eine parlamentarische Unterbrechung nennt. Er will in die Monotonie der Lehrstunden eine gewisse Frische und Abwechslung bringen. Aus diesem Gesichtspunkte wird uns auch die Weigerung der beiden erwähnten Mitschüler begreiflich.
Der Lehrer begann nun den Unterricht, und Hutzler, das Haupt trotzig in die Hand gestützt, bereitete sich zur Fortsetzung seiner planvoll erwogenen Störung vor.
Als es ein Viertel schlug, hustete er dreimal tief auf und stöhnte dann, als ob sich ihm die Luftröhre krampfhaft zusammenschnüre. Fünf Minuten später hatte sein Husten einen so dröhnenden Charakter[38] angenommen, daß es Herrn Doktor Perner unmöglich war, den Unterricht fortzusetzen.
Er hielt einen Augenblick inne.
»Sind Sie nun bald fertig?« rief er, die Augen rollend, während er das Buch heftig wider die Platte des Katheders stieß.
Hutzler hustete noch lauter, und so natürlich, daß ich noch heute nicht begreife, wie er diese gewaltigen Erschütterungen seines Kehlkopfes zuwege bringen konnte, ohne ernstlich Schaden zu nehmen.
»Hutzler!« schrie Doktor Perner außer sich.
Jetzt trat in dem trefflich erkünstelten Anfalle eine Pause ein. Hutzler erhob sich.
»Herr Doktor, darf ich nun vielleicht das Fenster da zumachen?«
»Das Fenster bleibt auf! Sie sollten sich schämen, auf so pöbelhafte Weise etwas erzwingen zu wollen, was ich Ihnen grundsätzlich verweigern muß.«
Kaum hatten diese Worte Hutzlers Trommelfell erreicht, als er sofort wieder zu husten begann, und zwar so krachend und klirrend, daß ich jeden Augenblick meinte, die Brust müsse ihm zerspringen.
»Ich lasse Sie sofort nach dem Karzer führen!« rief Doktor Perner, außer sich vor Zorn. »Wenn Sie so empfindlich sind gegen jede erbärmliche Kleinigkeit, so wickeln Sie sich in Watte! Ich meinesteils dulde nicht, daß man in meinen Lehrstunden solche Komödien aufführt.«
»Komödien?« hustete Hutzler. »Wenn ich erkältet bin, werde ich doch wohl noch husten dürfen? … Hätten Sie beizeiten das Fenster geschlossen …«
»Sie sind einer der frechsten Gesellen, die mir noch jemals vorgekommen. Gehen Sie nach Hause und ziehen Sie sich wärmer an! Ich bin es müde, mich fortwährend mit Ihnen herumzuzanken!«
»Recht gern«, hustete Hutzler. »Hätte ich gewußt, daß es hier so ziehen würde, so wäre ich von Anfang an in einem wärmeren Kostüm erschienen.«
Hutzler wohnt nur drei Schritte vom Gymnasium entfernt. Er ging, und Doktor Perner setzte seinen Vortrag fort. Es dauerte ungefähr zehn Minuten. Dann erschien der treffliche Leopold wieder in der Tür, und mit einem Male herrschte in Sekunda ein Leben,[39] dessen reizende, überschwängliche Ausgelassenheit sich nicht in Worte kleiden läßt. Zuerst erscholl ein dreisalviges Gelächter; dann ein dumpfes Geheul, wie es die Rothäute bei ihren Angriffen auf die Weißen auszustoßen pflegen; dann ein Klatschen, Pfeifen, Scharren, Trappeln und Rütteln, daß mir selbst, der ich doch an das Schlimmste gewöhnt bin, fast Hören und Sehen verging. Hanau und ich hoben in der allgemeinen Verwirrung unseren Tisch ungefähr drei Zoll hoch über den Boden und ließen ihn dann mit aller Wucht aufdonnern, so daß der Staub wie Opferrauch nach der Decke stieg.
Es war dies nur eine verdiente Huldigung an die Adresse unseres liebenswürdigen Kameraden Hutzler.
Ahnst Du, o Genius meines Tagebuches, wie Hutzler im Schulzimmer erschien? Hinten auf den Rücken und vorn vor den Bauch hatte er sich vermittelst roter Schnüre zwei Federkissen gebunden. An den Füßen trug er die großen Reisepelzstiefel seines Vaters; zwei Müffe, die seinen beiden Schwestern angehörten, dienten ihm als Pulswärmer, und um den Hals trug er in unzähligen Windungen einen halbzölligen Hanfstrick, wie ihn die Packer beim Aufwinden der Warenballen benutzen.
Doktor Perner stand wie versteinert, während Hutzler sich ganz gelassen anschickte, seinen Platz einzunehmen.
»Halt!« schrie der Professor. »Keinen Schritt weiter! Denken Sie etwa, Sie befinden sich hier in einer Bierkneipe?«
»Gewiß nicht, Herr Doktor!« entgegnete Hutzler ehrerbietig. »So viel ich weiß, befinde ich mich in Sekunda.«
»Schweigen Sie! Ihr Zynismus übersteigt alle Begriffe. Sofort entledigen Sie sich dieses Unrats und verfügen sich nach dem Karzer!«
»Welchen Unrates, Herr Professor?«
Doktor Perner war außer sich, er trat auf den Schüler zu und faßte ihn an dem Strick, der um seinen Hals lag.
»Hier, dieses nichtswürdigen Tandes!« schrie er, daß uns allen die Ohren gellten.
»Ach so,« sagte Hutzler, »es ist ja wahr, da wollte ich Sie noch ganz ergebenst um Entschuldigung bitten. Meine beiden[40] wollenen Halstücher sind in der Wäsche, und Mutter wollte mir das ihrige nicht hergeben. Da meinte der Vater, so ein Strick sei auch nicht zu verachten, und es käme ja nicht darauf an, wie es aussehe, wenn es nur warm hielte. Aber wenn Sie meinen, es wäre unziemlich, so bin ich gern bereit, ihn wieder abzulegen.«
Mit diesen Worten begann er, das halbzöllige Seil von seinem Halse loszuwickeln.
In immer größeren Kreisen fegte der hanfgeflochtene Radius um Hutzlers Kopf, und jetzt fehlte nicht viel, und die Spitze hätte den Professor ernstlich in seiner Integrität verletzt. Ich gebrauche hier Integrität als Euphemismus, da es mir nicht wohl ansteht, diejenigen Teile des Doktor Perner namhaft zu machen, die von dem wuchtigen Strick Hutzlers zunächst bedroht wurden.
»Mensch!« rief Doktor Perner wutschnaubend, indem er das Ende des Strickes ergriff und daran zerrte. »Das sollen Sie mir büßen!«
Hutzler bemühte sich, die Augen zu verdrehen und zwischen den Lippen die Zunge sichtbar werden zu lassen.
»Herr Doktor!« stöhnte er mit verlöschender Stimme, nach rechts und links mit den Armen in die Luft greifend. »Ich ersticke! Ich ersticke!«
Doktor Perner ließ los. Hutzler reckte seinen Hals und begann, ihn vollends auszuwickeln.
»Nun, was zögern Sie noch?« rief der Lehrer, indem er mit der rechten Hand nach der Tür deutete. »Losgeschnallt! sage ich, und dann hinauf! Vor nächstem Montag kommen Sie mir nicht wieder herunter!«
»Also weil ich mich Ihrer ausdrücklichen Anordnung entsprechend etwas wärmer gekleidet habe, belegen Sie mich mit Karzerstrafe?« sagte Hutzler, gleich darauf in einen erneuten Hustenanfall ausbrechend. »Erlauben Sie, Herr Doktor, ist der Karzer geheizt?«
»Der Pedell wird das Nötige besorgen«, entgegnete Doktor Perner. »Schwarz, bestellen Sie einmal, daß Nummer fünf geheizt wird. Und jetzt bringen Sie sich unverzüglich in eine anständige Verfassung. Diese schamlosen Wülste hier dulde ich nicht!«
»Aber, Herr Doktor, es sind ja zwei Kopfkissen! Meine Mutter hält so viel auf ihr Weißzeug, die würde sich schön wundern, wenn sie erführe …«
»Kein Wort mehr, oder ich vergesse mich!«
Hutzler schwieg und begann, seine Kissen loszuschnallen. Mit einemmal stieß er einen Schrei des Entsetzens aus. Die Naht war geplatzt, und eine Flut von Federn ergoß sich in das Schulzimmer.
Wir andern eilten sofort hinzu, um die kostbaren Daunen aufzulesen, und bald wirbelte es rings wie Schneeflocken.
Doktor Perner machte vergebliche Anstrengungen, die Ordnung wiederherzustellen. Gelles Geheul derjenigen, die in dem Tumult umgestoßen wurden und auf den Boden zu liegen kamen, mischte sich unter die Wehklagen Hutzlers, der sich nicht genug tun konnte in elegischen Ausrufen und Seufzern.
»Ach, was wird meine Mutter sagen! Das kommt davon, daß ich das so aufschnallen mußte. Hätte ich die Kissen ruhig anbehalten, dann wären sie nicht entzwei gegangen. Ach, und jetzt zieht es wieder, und die Federn kommen mir in den Hals. Herr Doktor, erlauben Sie mir, nach Hause zu gehen. Ich fühle mich sehr, sehr unwohl!«
»Gehen Sie!« rief Doktor Perner in ohnmächtigem Zorn.
Hutzler ließ sich die Sache nicht zweimal sagen. Hastig raffte er seine Kissen zusammen, ergriff den Strick an einem Ende und schritt majestätisch zur Tür hinaus, sein improvisiertes Halstuch wie eine Schlange hinter sich herziehend. Wir übrigen vergnügten uns den Rest der Stunde hindurch damit, daß wir die Flaumfedern, die rings durch das Zimmer wirbelten, geschickt in die Höhe bliesen, wodurch ein ununterbrochenes Schneegestöber entstand, das mir viel Spaß machte. Doktor Perner ließ in das Tagebuch einschreiben, es habe dem Hutzler in kindischer Weise gezogen; auch sei derselbe mit einem Strick um den Hals im Lehrzimmer erschienen und habe sich die frechsten Störungen erlaubt. Der Eintrag schloß mit dem Vermerk einer zweitägigen Karzerstrafe. Hutzler war indes klug genug, die nächsten acht Tage wegen Unwohlseins zu fehlen. Erst am folgenden Sonnabend kam er wieder, und[42] am Dienstag darauf fragte ihn Doktor Perner, ob er die Strafe abgesessen habe.
»Ich?« sagte Hutzler erstaunt.
»Ja, Sie! Antworten Sie mir!«
»Aber, Herr Doktor, Sie haben mir die zwei Tage ja geschenkt!« entgegnete Hutzler, tief beleidigt.
»So? Davon weiß ich kein Wort!«
»Doch, Herr Doktor!« wagte ich jetzt schüchtern zu bemerken.
»Ja, Herr Doktor!« riefen zwei, drei Stimmen aus dem Hintergrunde. »Am vorigen Sonnabend haben Sie gesagt: Nun, für diesmal will ich es Ihnen noch erlassen, aber in Zukunft geht es Ihnen schlecht, das gebe ich Ihnen schriftlich!«
Doktor Perner begann bei dieser bestimmten Formulierung unserer Lüge stutzig zu werden. Vielleicht auch schien es ihm das geratenste, mit Hutzler Frieden zu schließen. Daher sagte er geringschätzig:
»Nun, es mag gut sein. Wenn ich es denn einmal gesagt habe, so will ich nicht weiter darauf bestehen. Aber das sage ich Ihnen: kommt mir wieder einmal etwas Ähnliches vor, so ist es alle mit uns. Überhaupt konstatiere ich seit einiger Zeit das Überhandnehmen eines Geistes, der den Zwecken dieser Anstalt schnurstracks zuwiderläuft. Es herrscht hier statt des wissenschaftlichen Ernstes eine läppische Puerilität, die mich anwidert. Ich bin auch einmal jung gewesen und habe mich meines Lebens gefreut, aber ich würde noch jetzt schamrot werden, wenn ich mir jemals eine so kindische Haltung hätte vorwerfen müssen, wie sie Ihnen zur zweiten Natur geworden ist. Bessern Sie sich, ich rate es Ihnen im guten. Ostern steht vor der Tür, und die Versetzungen sind noch lange nicht entschieden. Es könnte manchem passieren, daß er sich grimmig verrechnete. Zum Aufrücken in eine höhere Klasse ist nicht nur eine gewisse Summe von Kenntnissen erforderlich, sondern vor allen Dingen ein würdiges Betragen. Die Primaner werden sich bedanken, ihren Lehrsaal mit einer Gesellschaft von Kindsköpfen teilen zu sollen, wie sie hier auf den Bänken von Obersekunda sitzen. Was lachen Sie, Hutzler? Weinen sollten Sie und in sich gehen, ehe die verderblichen Wege, auf denen Sie sich befinden,[43] vollends zum Abgrund geführt haben. Ein Mensch von Ihren Gaben! Es ist himmelschreiend!«
Hutzler erhob sich.
»Herr Doktor, ich habe nur ein freundliches Gesicht gemacht«, versetzte er mit unerschütterlicher Ruhe.
»Machen Sie Ihre freundlichen Gesichter, wenn Sie zu Hause sind! Hier ist Haltung und Ernst erforderlich, und Sie hätten am allerwenigsten Ursache, ihrem Übermut freien Lauf zu lassen.«
Hiermit schloß das Hutzlersche Intermezzo.

Am 5. Mai 18**
… Von mir selber zu reden, verbietet mir eigentlich die mir innewohnende Bescheidenheit. Indes neulich habe ich unserem Religionslehrer einen so köstlichen Streich gespielt, daß ich nicht umhin kann, diese wohlgelungene »Störung« hier aufzuzeichnen. Und eine »Störung« war es in des Wortes tiefgehendster Bedeutung, insofern sie nämlich nicht allein den regelmäßigen Verlauf des Lektionsplanes, sondern mehr noch das gesamte seelische Gleichgewicht unseres trefflichen Lehrers »störte«. Aber ich konnte ihm nicht helfen. Einmal hat er's durchaus nicht um mich verdient, daß ich den Regungen des Mitleids Audienz gebe, da er mir in der Religionsstunde schon dreimal »wegen hartnäckigen Widersprechens« Ordnungsstrafen erteilte. Und dann hätte ich Nerven besitzen müssen von der Dicke und der Dauerhaftigkeit jenes Strickes, den Hutzler im Februar dieses Jahres um seinen Hals wickelte, wenn ich die qualvolle Monotonie, die sich in der religiösen Gesinnung des Herrn Pastors geltend machte, länger hätte ertragen sollen.
Der Herr Pastor …! Wir nennen ihn so, weil er in früheren Zeiten eine Predigerstelle an einem benachbarten Dorfe versah. Er ist indes schon seit geraumer Zeit an unserem Gymnasium in bester Form angestellt und gibt in allen Klassen Glaubenslehre und Kirchengeschichte. Ich unterlasse es, hier auf seine persönliche Beschreibung einzugehen, da es mir doch nicht möglich wäre, seinen[45] wohlwollenden Gesichtszügen und dem sanften Behagen, das um seine schmalen, blutlosen Lippen spielt, stilistisch gerecht zu werden.
Der Herr Pastor ist nämlich ein sehr frommer Mann, was ich ihm durchaus nicht verüble, denn wenn jemand Pastor ist, so versteht es sich von selbst, daß er gewisse Gesinnungen hegt. Wohl aber verüble ich dem Herrn Pastor im höchsten Grade, daß er seiner Frömmigkeit seit so und so viel Jahren in sämtlichen Klassen stets denselben Ausdruck verleiht und so zum Beispiel an jedem Morgen, den Gott werden läßt, aus dem Klassengebetbuch dasselbe Gebet abliest. Wir alle kennen es längst auswendig: aber der Herr Pastor scheint nun einmal die Überzeugung zu hegen, dieses Gebet sei besonders wirksam und gottwohlgefällig. Es beginnt mit den Worten:
»So treten wir denn wiederum vereint vor die Stufen Deines Thrones, o Allmächtiger, und flehen zu Dir mit kindlichem Herzen um die Gnade Deines Beistandes …«
Es ist mehr als zwei Seiten lang und enthält unter anderm die sehr richtige Bemerkung:
»Schritt für Schritt wandeln wir dem Ende zu und sind ihm jeden Morgen näher gebracht.«
Es hat mir nun fast den Anschein, als ob der Herr Pastor geglaubt habe, durch die fortwährende Betonung dieser unleugbaren Tatsache das immer näher rückende Ende weiter hinausrücken zu können. Denn nur so vermag ich mir zu erklären, wie er immer und immer wieder dieselben Phrasen zum besten gab, ohne zu bedenken, daß jedes unverkünstelte Menschengehirn bei solchem Geklapper aus dem Leim gehen muß. Er scheint eine ganz eigen organisierte Natur zu besitzen. Wir bekamen das trostlose Gebet doch nur jeden Dienstag und Freitag zu hören: er aber trug es seit Menschengedenken auch Montags, Mittwochs, Donnerstags und Sonnabends vor (in Prima und Tertia nämlich), ohne daß es ihm bis jetzt irgend geschadet hätte.
Nun, es heißt schon in Goethes Faust: »Die Kirche hat einen guten Magen«. Da ich aber in keiner Beziehung zur Kirche gehöre und mich überhaupt von der sogenannten kirchlichen Richtung prinzipiell fern halte – mein Vater ist Freimaurer –, so erscheint[46] es begreiflich, daß ich infolge dieser ununterbrochenen Gebetsidentität nahezu krank wurde und eine wahre Wut gegen den wiederkäuenden Lehrer faßte.
Da kam mir ein köstlicher Gedanke, den ich um so bereitwilliger durchführte, als ich mir sagen mußte, das Faktum werde, ganz abgesehen von der Befriedigung meiner Gebetwünsche, auch einen reizvollen Zwischenfall absetzen, wie ein lebensfroher Gymnasiast ihn stets brauchen kann. So zögerte ich denn nicht länger und »vollendete das Werk dieser Woche«. (Ein schönes Zitat! Es ist dem Schlußgebet entnommen, das wir jeden Sonnabend um zwölf mit anhören müssen.)
Das Klassengebetbuch liegt in der Regel auf dem Katheder, damit es dem Lehrer gleich zur Hand sei, sobald er das Bedürfnis fühlt, sich mit Gott zu unterhalten. Wie Möros in der Schillerschen Ballade, schlich ich mich eines Morgens in aller Frühe – ich war eigens eine halbe Stunde vor Beginn der Lehrstunde erschienen, um der erste zu sein – zum Katheder, öffnete das Buch mit dem schwarzen, unheimlichen Einband, der so oft in den Händen meines Peinigers geruht hatte, und suchte mit fiebernder Hast nach dem verhängnisvollen Kapitel.
»Aha!« sagte ich mit diabolischer Wollust, als ich den Gegenstand meines Hasses entdeckt hatte, – »da steht es:
›So treten wir denn wiederum vereint vor die Stufen Deines Thrones, o Allmächtiger, und flehen zu Dir mit kindlichem Herzen um die Gnade Deines Beistandes …‹
Du sollst keinen mehr kränken!« Und mit keckem Griffe riß ich die beiden Blätter, auf denen das Leibgebet des Herrn Pastors verzeichnet stand, aus dem Buche, zerpflückte sie in hundert mikroskopische Stückchen und trug sie kaltblütig, als ob nichts geschehen wäre, nach dem Hofe, wo ich sie dem Spiel der Frühlingswinde überantwortete.
In dem beseligenden Gefühle, ein gutes Werk vollbracht zu haben, setzte ich mich auf meinen Platz und wartete der Dinge, die da kommen sollten.
Es schlug sieben. Die Tür öffnete sich, und herein wandelte wuchtigen Schrittes unser gottwohlgefälliger Religionslehrer. Er setzte sich auf den Kathederstuhl, schneuzte sich zweimal und legte[47] dann sein Gesicht in jene frommen Gebetsfalten, die ich so oft mit Schrecken an ihm bemerkt hatte. Das war immer die Introduktion; eine halbe Minute später ging's los: »So treten wir denn wiederum vereint vor die Stufen Deines Thrones, o Allmächtiger …«
Der Herr Pastor erhob sich und ergriff mit einem verschleierten Blick gen oben das Gebetbuch. Auch die Schüler standen ehrerbietig von ihren Plätzen auf und falteten schweigend die Hände.
Lautlose Stille.
Der Herr Pastor schlug das Gebetbuch auf und spitzte die Lippen. Merkwürdigerweise war das so oft vorgetragene Gebet heute nicht auf den ersten Griff zu finden.
Der Herr Pastor blätterte. Und blätterte wiederum. Und blätterte abermals.
Es war ganz unbegreiflich!
Er beschaute das Buch von außen, als wolle er sich überzeugen, ob es noch das alte, stille, traute Gebetbuch von ehedem sei, mit dessen Hilfe er so manches Mal vereint vor die Stufen des Thrones getreten war.
In der Tat, der Einband hatte sich nicht im geringsten verändert.
Nun suchte der Herr Pastor, immer befremdlicher dreinschauend, im Register.
Richtig, da stand es, Seite 50!
Der Herr Pastor suchte demgemäß Seite 50, aber siehe da! der schöne Spruch: Suchet, so werdet Ihr finden, wurde diesmal zuschanden! … Jetzt erst ging dem unglücklichen Lehrer ein Licht auf. Er stieß einen unartikulierten Ton der Entrüstung aus und sagte dann mit einer Stimme, die an die Posaune des Jüngsten Gerichts gemahnte:
»Da hat mir ein miserabler Junge die Blätter herausgerissen, auf denen unser Morgengebet stand! Ich will nicht untersuchen, wer sich diesen sakrilegischen Akt erlaubt hat: ich überlasse den Betreffenden dem Gefühl seiner eigenen Schande. Aber traurig ist es doch, daß so etwas in einer Klasse von gesitteten jungen Leuten vorkommen kann! Pfui!«
Ich mußte mir auf die Lippen beißen, um nicht in helles Gelächter auszuplatzen. Der Herr Pastor bemerkte es.
»Was lachen Sie?« sagte er mit einem vernichtenden Blick auf mein unschuldiges Gesicht. »Gehen Sie hinaus: Sie sind in dieser Stimmung nicht würdig, der Schulandacht beizuwohnen.«
»Aber Herr Pastor« … sagte ich demütig.
»Sie verlassen das Zimmer!« wiederholte er schneidig. »Wenn Sie bei einem solchen Anlaß überhaupt lachen können, so läßt das tief blicken.«
Ich verließ also das Zimmer, stand aber nahe genug an der Tür, um zu hören, daß der Herr Pastor noch eine längere Rede hielt. Hierauf öffnete er wieder das Gebetbuch und las ein anderes Kapitel vor, das halb so lang war, als die »Stufen des Thrones«, und schon um seiner Neuheit willen die gebührende Aufmerksamkeit fand.
»Amen!« sagte der Herr Pfarrer wuchtig und salbungsvoll, und gleich darauf fügte er hinzu: »Sie können den Heppenheimer jetzt wieder hereinholen.«
War das nicht ein köstlicher Streich? Aber nicht genug! Das Gerücht von dem herausgerissenen Gebet verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch alle Klassen, und ehe der folgende Morgen graute, waren die »Stufen des Thrones« aus sämtlichen Gebetbüchern entfernt! So ging dem Herrn Pastor denn ein für allemal die Möglichkeit verloren, seiner langjährigen Leidenschaft fürder zu frönen!
Er verhängte jetzt eine umfassende Untersuchung, die jedoch ohne Resultat blieb. Wenn ich der Eventualität einer Karzerstrafe so gleichmütig gegenüberstünde, wie Schwarz oder Rumpf, die beide einen unbeschreiblichen Stoizismus besitzen, so würde ich dem Herrn Pastor ohne weiteres entgegentreten und ihm zurufen: »Ja, Verehrtester, c'est moi qui l'ai fait! Und wissen Sie, warum ich's getan habe? Weil es ein Sprüchlein gibt, das da lautet: So Ihr betet, sollt Ihr nicht plappern wie die Heiden, die da meinen, sie würden erhöret, wenn sie viele Worte machen! Weil ferner sich der Betende in sein stilles Kämmerlein einschließen soll! Und weil schließlich geschrieben steht, daß der Buchstabe tot macht, um wieviel mehr ein ellenlanges Geleier, das aus mehreren tausend Buchstaben besteht!«
Da ich heute gerade bei der Persönlichkeit des Herrn Pastors bin, so will ich noch die Geschichte von den Bescherungen meines[49] Freundes Boxer notieren. Die Sache ist zwar sehr einfach, aber sie hat mich königlich amüsiert.
Vor einiger Zeit nämlich, es mögen jetzt vielleicht acht oder zehn Wochen her sein, hatten wir es eingeführt, dem Herrn Pastor jedesmal morgens bei dem Beginn der Lehrstunde eine Bescherung auf den Katheder zu setzen. Mein Freund Boxer war in dieser Beziehung der Haupt-Entrepreneur und ging dabei ebenso malerisch als humoristisch zu Werke. Der Herr Pastor entdeckte beim Eintritt in das Lehrzimmer folgende Gegenstände in zierlicher Gruppierung auf der Platte seines Lehrpultes: in der Mitte eine große, halb zerbrochene Blumenscherbe, mit zwei alten Schreibärmeln behangen, wie eine Totenurne; oben darauf eine Schneelawine (es war damals noch Winter und hatte tüchtig geschneit), recht fest geknetet und von der Form eines menschlichen Kopfes. Die Augen hatten wir aus gekautem, blauem Papier gefertigt; desgleichen die Nase; den Mund stellte ein hereingedrücktes Bleistiftchen dar. Unser Mitschüler Schwarz hatte seine brandrote Mütze hergeben müssen, auf daß sie diesem Schneekopfe zur Bedeckung diene. Rechts und links prangten zwei stattliche Haufen frischgeschlagener Chausseesteine und ein Paar alte Stiefel, die Boxer sich von dem Hausknecht im »Goldenen Pfau« hatte schenken lassen. Die Lücken unseres künstlichen Aufbaues waren mit Äpfeln und Eierschalen, rohen Kartoffeln, Besenreisern und ähnlichen Gegenständen dergestalt ausgefüllt, daß man eine Barrikade en miniature vor sich zu sehen glaubte, wie denn Boxer überhaupt viel Talent zum Kommunismus verrät. Der Herr Pastor näherte sich dieser Bescherung jedesmal mit einem Blick, als könne das Ding explodieren, bestieg den Katheder und legte dann seinen Arm links auf die Platte des Pultes. Mit einem einzigen, gewaltigen Ruck fegte er die Barrikade herunter, daß wir jedesmal Angst hatten, der Wandschrank, der rechts vom Katheder steht, möge durch den Anprall so mannigfacher Objekte zertrümmert werden.
Die Klasse aber brach in ein diabolisches Jauchzen aus, und die Vordersten liefen herzu, um die Brocken der Schneelawine aus dem Fenster zu werfen, und besonders um die alten Stiefel in Sicherheit zu bringen, die bei jeder Bescherung aufs neue verwendet wurden.
Der Herr Pastor beobachtete bei solchen Vorgängen stets das Prinzip des unbedingten Ignorierens. Kein Wort kam über seine Lippen: er strafte uns mit stiller Verachtung.
Zuweilen fiel ihm das recht schwer, denn einmal hatten wir ihm einen alten, zerrissenen Familienschirm an die Lehrtafel genagelt, dessen Fischbeindrähte dergestalt über den Kathedersessel hinausragten, daß es nur bei einer eigentümlichen Haltung des Kopfes möglich war, ihnen auszuweichen. Der Herr Pastor ertrug diese Tortur mit einer bewundernswerten Geduld etwa fünf Minuten hindurch; dann sagte er dem Katheder Valet und tat, als ob er nur zur Abwechslung einmal einen anderen Standpunkt einnehme, während er bisher niemals seinen gewöhnlichen Platz hinter dem Pult verlassen hatte.
Endlich aber zerriß auch diesem Gerechten der Faden der Geduld. Boxer hatte ihm nämlich, des ewigen Hinabwerfens müde, einen großen Eimer voll Wasser auf die Platte gestellt, dessen Fall eine wahre Sündflut herbeigeführt haben würde.
Der Herr Pastor kam, beschaute sich das Ding mit rollenden Blicken, blähte die Nüstern, stieg wieder vom Katheder herunter, schritt zornig im Zimmer auf und ab, bestieg den Katheder von neuem und sagte endlich mit Donnerstimme:
»Boxer, schaffen Sie das augenblicklich hinweg!«
Ich bewunderte hier den Instinkt des scheinbar so stillen Mannes, der sofort wußte, wo er den Feind seiner Ruhe zu suchen hatte.
Boxer erhob sich.
»Ich?« sagte er indigniert. »Weshalb denn gerade ich?«
»Tun Sie, was ich Ihnen sage! Augenblicklich schaffen Sie mir das Ding da fort!«
»Wenn ich den Eimer dahin gesetzt hätte,« entgegnete Boxer, »mit Vergnügen! Aber so sehe ich in der Tat nicht ein …«
»Augenblicklich!« wiederholte der Herr Pastor, indem er den Arm ausstreckte und die Spitze seines Zeigefingers auf den Boden richtete.
»Gut!« sagte Boxer, »ich bin Schüler und muß gehorchen. Aber ich will mich doch einmal bei dem Herrn Direktor erkundigen, ob ich Ihnen die Eimer ausleeren muß.«
Mit diesen Worten trat er aus den Bänken heraus und schritt langsam und würdevoll dem Katheder zu. Stirnrunzelnd ergriff er das in diesen Räumen sehr ungewöhnliche Gefäß und wußte es so einzurichten, daß er beim Herabtreten vom Katheder stolperte und langwegs ins Zimmer fiel.
Ein Hallo sondergleichen durchbrauste die Räume Sekundas. Ich versichere bei allen Göttern, es hat ganz über alle Maßen schön geklatscht, und das Wasser floß bis in den fernsten Winkel des Saales. Die Verwirrung wurde noch dadurch gesteigert, daß einige von uns riefen, sie könnten es in einem so feuchten Zimmer nicht aushalten, sie hätten sich neulich erst erkältet, als der Pedell so unsinnig aufgewaschen, und sie bäten um ihre Entlassung. Vier oder fünf wurden in der Tat beurlaubt; dann aber wandte sich der Herr Pastor zu Boxer und sagte:
»Boxer, ich mache Sie von jetzt an für alles verantwortlich, was in diesen Räumen geschieht. Ist morgen wieder etwas auf die Kathederplatte gestellt, so werden Sie die Folgen zu tragen haben!«
Boxer trocknete sich inzwischen die Beinkleider und erwiderte in vorwurfsvollem Tone:
»Also wenn der Schwarz ein Paar alte Stiefel auf den Katheder legt, dann bin ich dafür verantwortlich?«
»Was?« rief Schwarz, »ich hätte ein Paar alte Stiefel auf den Katheder gelegt? Herr Pastor, das muß ich mir doch sehr von dem Boxer verbitten.«
»Ich sage ja nur: wenn«, erwiderte Boxer.
»Still,« gebot der Herr Pastor; »was ich gesagt habe, dabei bleibt es! Und nun rufen Sie den Pedell, daß er hier aufwischt!«
Die Situation Boxers war offenbar eine kritische. Gerade für den folgenden Tag hatten wir uns so etwas Hübsches ausgedacht! Wir wollten dem Herrn Pastor nämlich zwei Eimer auf den Katheder stellen, und Schwarz hatte zu diesem Behufe bereits seiner Tante, bei der er zur Miete wohnte, einen gestohlen. Und nun sollte unser guter Freund Boxer für alle diese Streiche verantwortlich gemacht und vielleicht mit einer mehrtägigen Karzerstrafe belegt werden! Es war nicht zu verlangen, daß wir unser[52] reizendes Amüsement aufgaben; aber ebensowenig durften wir Boxer zumuten, um unseres Gaudiums willen die Räume des Karzers zu beziehen.
Wir überlegten hin und her, ohne zu einem Resultat zu gelangen.
Plötzlich sagte Boxer: »Laßt mich nur machen!«
Am folgenden Tage arrangierten wir die Bescherung, wie verabredet. Boxer war der emsigste, und in der Tat, es war keine kleine Arbeit, denn wir mußten die Eimer glasweise füllen, weil der Pedell sonst Lunte gemerkt hätte. Einer von uns stand Wache, um das Herannahen des Herrn Pastors rechtzeitig anzukündigen.
»Er kommt!« rief es jählings aus dem Munde unseres Warners.
Sofort ergriff Boxer seine Mütze, nahm einen möglichst starken Stoß Bücher unter den Arm und verließ das Lehrzimmer, um sich auf dem Korridor hinter einen der größten Schränke zu stellen.
Zwei Minuten später erschien der Lehrer, und unmittelbar hinter ihm her tappte keuchend und atemlos unser trefflicher Freund Boxer, die Bescherung auf dem Katheder genau ebenso verblüfft anstarrend, wie der Herr Pastor.
– »Boxer! Wo ist der Boxer?« zürnte der entrüstete Schulmann.
»Hier!« rief es hinter ihm. »Entschuldigen Sie, daß ich mich heute verspätet habe.«
Der Herr Pastor biß sich ärgerlich auf die Lippe. Der Tatsache gegenüber, daß Boxer fast mit ihm zugleich ins Zimmer getreten war, konnte er seine Drohung von gestern nicht wohl verwirklichen.
»Heute brauche ich die Eimer wohl nicht auszuleeren?« fragte Boxer triumphierend.
»Schwarz,« sagte der Lehrer, »rufen Sie einmal den Pedell.«
Der Pedell erschien.
»Quaddler,« begann der Herr Pastor in ernstem Tone, »nehmen Sie einmal diese Gefäße da hinweg. Ich mache Sie von jetzt ab dafür verantwortlich, daß solche Ungehörigkeiten sich nicht wiederholen. Stellen Sie sich an den Brunnen, damit kein Wasser geschöpft werden kann, oder lassen Sie Ihre Frau Wache halten. Wozu sind Sie verheiratet?«
»Entschuldigen Sie gütigst,« stammelte Quaddler in höchster Verwirrung, »aber meine Frau war gerade damit beschäftigt, sich anzukleiden, und da mußte ich Kaffee brennen.«
»Brennen Sie Ihren Kaffee von sieben bis acht! Kommen Sie vorher Ihren Pedellpflichten nach! Was ist das für eine Art! Die Eimer da können doch nur von Ihnen herrühren! Warum geben Sie nicht besser auf Ihre Küchengerätschaften acht?«
Quaddler näherte sich dem Katheder.
»Ich bitte um Verzeihung«, sagte er. »Das sind allerdings sozusagen zwei Eimer, aber zwischen Eimer und Eimer ist ergebenst ein Unterschied. Meine Eimer sind ganz anders. Und wenn die Herren Sekundaner hinter meinem Rücken solche Sachen da mitbringen …«
»Seien Sie still und machen Sie, daß Sie so schnell wie möglich hinauskommen. Die Eimer können Sie behalten, denn wenn dieselben auch nicht Ihrer Küche entstammen, so bezweifle ich doch, daß die wahren Besitzer sich melden werden.«
Und Quaddler nahm die Eimer und verschwand in den Gängen des Schulgebäudes. Der Herr Pastor irrte sich indes, wenn er glaubte, über fremdes Eigentum so ohne weiteres verfügen zu dürfen. Die Tante meines Freundes Schwarz machte bei der Polizei die Anzeige, es sei ihr am Nachmittage des Dreizehnten ein Eimer gestohlen worden. Die Behörden stellten umfassende Recherchen an; Quaddler mußte zu wiederholten Malen auf das Gericht, und selbst der Herr Pastor ward eidlich vernommen. Schwarz brauchte nicht zu schwören, denn er ist erst fünfzehn Jahre alt, und so lief die Sache höchst günstig ab. Fortes fortuna juvat.

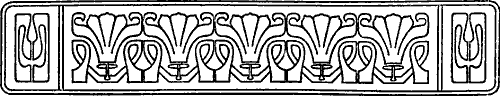

Zu den reinsten Genüssen meiner Schuljahre zähle ich den Unterricht des originellen Mathematiklehrers Doktor Veit, der uns von Quarta bis Obersekunda den Pfad zur Vollendung führte. Man verbindet gewöhnlich mit dem Begriffe des Mathematikers die Vorstellung eines regelrecht konstruierten Behälters öder, lebloser Formeln: nur im äußersten Winkel dieses Behälters lauert die Individualität eines menschlich fühlenden Wesens. Unser lieber, trefflicher Veit war die verkörperte Widerlegung dieser einseitigen Theorie. Kein Zug seiner charaktervollen Erscheinung erinnerte an die Schablone. Seine innere und äußere Physiognomie entfernte sich himmelweit von jenen typischen Schreckbildern, die alles auf Gleichungen zurückführen, die selbst in der Liebe von positiven und negativen Größen phantasieren und die Erkorene mit dem Parallelogramm der Kräfte an die hochklopfende Brust ziehen. Doktor Veit war vielmehr ein erquickliches Original, in derber Holzschnittmanier ausgearbeitet, aber nirgends geometrisch korrekt. In seinen Lehrstunden herrschte durchaus nicht der Ton der reinen Mathematik. Sein Vortrag war reich an subjektiven Streiflichtern, an reizvollen Impromptus, an ergötzlichen Zwischenfällen …
Erst in Sekunda lernten wir diesen Mann nach dem ganzen Umfange seiner Vorzüge schätzen.
Wenn es elf schlug, und der Xenophon-Interpret, »froh der bestandenen Gefahr,« von hinnen geeilt war, dann erschien in der Tür eine mittelgroße Gestalt mit rötlich angestrahltem Gesicht, den Hut ein wenig im Nacken, um die Lippen ein freundliches Lächeln.[55] Rasch warf er die Kopfbedeckung auf den Tisch neben dem Eingang und schritt beweglich nach dem Katheder, ohne nach pädagogischer Würde zu haschen, ohne in professorenhafter Manier den Rock zuzuknöpfen, ohne an der Brille zu rücken. Mit prüfendem Blick musterte er die lebhaft plaudernde Versammlung und nahm dann halb wie im Traum den Schwamm, der neben der Kreide lag, um ihn mit Wasser zu sättigen. Allerlei groteske Figuren beschreibend, wischte er die große Schultafel ab; dann kehrte er sein freundliches Antlitz von neuem dem schwatzhaften Publikum zu, trommelte mit den Fingern auf die Holzfläche des Katheders und nickte still vor sich hin …
Das währte so drei, vier Minuten. Plötzlich schien er sich zu besinnen, weshalb er hierher gekommen. Mit der Faust auf die Fläche des Lehrpultes schlagend wie ein Tambour, der die Kolonne zum Sturme führt, rief er mit Donnerstimme:
»Allez! vite! vite! vite! wacker! wacker! wacker! Boxer, komme Se mal raus an die Tawel!«
Diese Wendung kehrte in ähnlicher Form als Einleitung zu jeder Lehrstunde wieder. Doktor Veit vermochte sich nämlich gewisser dialektischer Eigentümlichkeiten nie zu entschlagen, namentlich in erregter Stimmung; wenn er im Eifer des Dienstes erglühte, wenn der Zorn ihm die Nerven schüttelte, stets verfiel er dem Banne der Mundart, und seine Mundart war nicht die gefeilteste. In grammatikalischer wie in lexikographischer Hinsicht borgte er bei dem Volke. So ergoß sich ein Hauch echter Urwüchsigkeit und reinen, gediegenen Menschentums über die exklusive Klassizität unseres Gymnasialkatheders.
Boxer stand auf und trat an die »Tawel«, die rechts vom Katheder auf den Holzzapfen der Staffelei ruhte …
»Ich bitt' mer jetzt aus, daß Ihr Ruh' halt't!« rief Doktor Veit kategorisch den hinteren Bänken zu. »Na, Boxer! Allez! vite! vite! Hier ist die Kreide! Schreibe Se emal folgende Gleichung!«
Boxer schrieb und begann hierauf zu Nutz und Frommen der Klasse die Auflösung.
»Halt' mer emal die Gäul' an!« unterbrach ihn Doktor Veit mit der naiv-herzlichen Frische des Volkes. »Möricke, habe Sie das verstande?«
»Jawohl, Herr Professor.«
»So rekapituliere Sie's!«
Möricke versuchte, die mathematischen Wege seines Freundes Boxer nachzuwandeln; bald aber geriet er ins Stolpern.
»Ui! ui, ui! …« rief Doktor Veit abwehrend. »Sie lerne auch Ihr Lebdag nix, Möricke! – Boxer, erkläre Sie's noch emal!«
Boxer begann von neuem und führte die Aufgabe siegreich zum Schlusse.
»'s war gut. Gehn Se auf Ihren Platz. Wenn der Hutzler halb so viel wüßt' wie der Boxer, so wüßt' er zehnmal so viel wie der Möricke.«
»Oh!« erwiderte Möricke, »ich hatte mich bloß versehen. Die Tafel blinkt so, und da hatte ich das x für ein a gehalten!«
»So? Ist's wahr, Hutzler, blinkt die Tawel?«
»Jawohl, Herr Professor. Ich seh' hier so gut wie gar nichts.«
»Knebel, rücke Se mal die Tawel so, daß der Hutzler und der Möricke was sieht!«
Knebel, Heppenheimer und zwei oder drei ihrer Mitschüler sprangen auf, um die Tafel zurecht zu rücken.
»Sie steht zu steil«, rief Hutzler pathetisch.
Heppenheimer beeilte sich, die Hinterbeine des Gerüstes nach hinten zu schieben.
»So blinkt's noch mehr!« rief der tückische Hutzler.
»Allez! vite! vite!« mahnte unser guter Professor. »Zeit ist Geld, sagt der Engländer!«
Heppenheimer rückte und rückte. Mit einemmal kam der Aufbau ins Rutschen. Das Zugreifen der Sekundaner bezweckte nur scheinbar die Rettung. Im nächsten Augenblicke stürzte alles über den Haufen.
Lautes Gelächter. Das Antlitz des Lehrers nahm jählings ein violettrotes Kolorit an. Heppenheimer, der den ganzen Frevel veranlaßt, rieb sich heuchlerisch ächzend die Kniescheibe.
»Für so Posse bedank' ich mich!« zürnte Herr Veit, heftig den Schwamm zerknetend. »Ihr müßt net meine, daß Ihr hier en Hanswurscht vor Euch habt!«
»Die Dielen hier sind so glitschig«, versetzte Knebel.
»Selbst glitschig! Lausbube seid Ihr, die bei jeder Gelegeheit ihre Späß treibe. Jetzt rasch emal die Geschichte da wieder aufgestellt! Und das sag' ich Euch, passiert so etwas wieder, so komm' ich Euch über die Köpp'!«
Bei dieser unparlamentarischen Phrase erhob sich auf den hinteren Bänken ein Gebrumme der Mißbilligung.
Doktor Veit verließ den Katheder.
»Wer hat hier gebrummt? – Was? Er will sich geheim halte? Ich kenn' mein' Pappenheimer, sagt Schiller. Das ist gewiß wieder der miserable Kleemüller gewese!«
Kleemüller fuhr empor, als habe ihn eine Natter gestochen.
»Ich bin's nicht gewesen!«
»Sie sind's gewese, und jetzt halte Sie 's Maul!«
»Ich verteidige nur meine Rechte«, erwiderte Kleemüller.
»So? Na, dann komme Se mal raus an die Tawel!«
»Weshalb?«
»Dummes Geschwätz! Sie solle die nächst' Aufgab' löse. Na, steht die Tawel nun fest? Allez! vite! vite! vite!«
Kleemüller trat heraus und begann zu rechnen.
»Sie mache das viel zu umständlich. Das Verfahre läßt sich wesentlich abkürze. Wisse Sie davon nix?«
»Nein.«
»Sehe Se wohl, daß ich Recht hab'? Sie habe gebrummt; sonst wüßte Se, was hier zu tun ist. Jetzt mache Se, daß Se so schnell wie möglich auf Ihren Platz komme, sonst verzehrt Sie 's Gewirrer!«
Gewirrer! So sprach Doktor Veit in der Tat, wenn er eine gewisse Stufe der Indignation überschritten hatte. Im normalen Zustande sprach er: Gewitter.
Das Antlitz des ehrlichen Mathematikers gewann jetzt wieder den alltäglichen Ausdruck. Die Überzeugung, daß er Kleemüllers Sündenschuld unwiderleglich erhärtet habe, gab ihm die seelische Ruhe zurück. Er fuhr mit dem Schwamm triumphierend über die Tafel und rief dann in freudigster Klangfarbe:
»Aufgepaßt!«
Nun begann er in seltsam geschraubtem Hochdeutsch eine wissenschaftliche Erörterung, die er durch praktische Exempel treffend[58] erläuterte. Ab und zu unterbrach er seine Darlegung mit dialektischen Ausrufen:
»Wann jetzt das Geraschpel an dem Tintefaß net bald aufhört, dann fahr' ich hinein!«
Oder:
»Möricke, Sie hocke wieder da wie e betrunke Kaninche und schlafe mit offene Auge!«
Oder:
»Knebel, sage Se doch dem Pedell, er soll sein Küch' zumache. Mer riecht wieder im ganze Haus, was gekocht wird.«
Gegen Ende der Stunde ward Doktor Veit in der Regel ein wenig heiser. Er litt nämlich an einer leichten Entzündlichkeit der Mandeln, war jedoch im übrigen der kräftigste und gesündeste Mensch unter der Sonne. Wenn sich dieses Gefühl bei ihm regte, so holte er tief Atem, legte die Hand vor den Kehlkopf und schüttelte bedenklich das Haupt. Dann murmelte er halblaut:
»Ja, ja, die Flöt' hat bald ausgepfiffe!«
Oder:
»Lang werde mir's net mehr mitmache: übers Jahr um die Zeit sind die Quetsche gegesse.«
Endlich erscholl die Pedellglocke.
War es Sonnabend, so hatte der Lehrer die Verpflichtung, mit der Klasse ein Schlußgebet anzustimmen. Für Doktor Veit, den ausgesprochenen Materialisten, eine schreckliche Aufgabe! Seufzend holte er das schwarze, unheilverkündende Buch hervor und suchte sich unter den zweihundertundfünfzig Gebeten das kürzeste aus.
»Da, Knebel, lese Sie's vor! Allez! vite! vite!«
Und Knebel begann zu lesen:
»Vollendet ist das Werk dieser Woche. Du, Herr, hast es vollenden helfen! …«
Doktor Veit, der mit gefalteten Händen auf dem Katheder stand und auf den Schwamm blickte, wechselte während der Lektüre mindestens achtmal sein Standbein und atmete erst wieder auf, wie Knebel das Amen flüsterte. Jetzt drängte die Klasse stürmisch dem Ausgange zu.
»Halb so wild!« rief Doktor Veit, seinen Hut ergreifend. »Festina lente, sagt der Lateiner!«
Und somit schritt er behaglich der Treppe zu.
Im Erdgeschoß begegnete er dem Pedell.
»Höre Se mal, Quaddler, ich hab's Ihne schon sage lasse: Wenn Sie wieder Kraut koche, dann mache Se gefälligst die Küch' zu. Es riecht hier so schon net grad' nach Ambra und Roseöl.«
»Aber erlauben Sie gütigst, die Tür war fest verschlossen, und der Geruch muß sozusagen durchs offene Fenster gestiegen sein. Insofern es übrigens auch ein ganz vortreffliches Kraut war.«
»Mache Se mer die Gäul' net scheu, Quaddler! Sie wisse nun, was ich gesagt hab'. Richte Sie sich danach. Und was ich noch weiter bemerke wollt': Lasse Sie doch drobe ans Tawelgestell e paar Hake mache, daß die Geschicht net alle Naselang auseinannerrutscht.«
»Schön, Herr Professor. Inwiefern soll ich die Haken denn machen lassen?«
»Ich werd' Ihne das später erörtern! Jetzt hab' ich kein' Zeit!«
Er räusperte sich.
»Ach ja,« stöhnte er vor sich hin, »ewig is mer geplagt! Das nimmt kein gut' End'! Heut' übers Jahr wirft mer mit meine Knoche die Birn' ab.«
»Ganz gehormster Diener, Herr Professor.«
Und nun begab sich unser trefflicher Mathematiklehrer ins Gasthaus »Zur Sonne«, wo er einen kolossalen Appetit entwickelte. Die Empfindlichkeit seiner Mandeln ließ nach, und den Zahnstocher zwischen den Lippen, wagte er die schöne Versicherung: »Es is immer noch kein schlecht Lebe auf der Welt. – Schorsch, bringe Se mer noch e Flasch Niersteiner!«

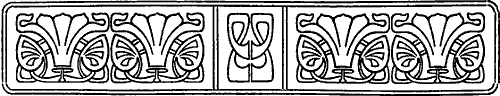

Das beglückende Lenzgefühl, das der Mai durch alle Adern gießt, wird mir durch eine unauslöschliche Erinnerung zu einem wahren Rausch der Wonne gesteigert. Ich denke nämlich, wenn die Fluren und Wälder sich neu begrünen, an die Jahre zurück, da ich dies erquickende Schauspiel durch den steifen, weißgestrichenen Rahmen eines großen Schulfensters beobachten mußte und dazu verurteilt war, die entzückendsten Stunden des Frühlings vor dem Katheder höchst würdiger und höchst gelehrter Männer zu verbringen. Aus den benachbarten Gärten klang das Konzert der Vögel herüber in die dumpfigen Schulräume, aber die ernsten Männer mit den großen Rundbrillen hatten kein Ohr für diesen melodischen Zauber: sie redeten von Sprachgebräuchen, Anakoluthen, Konjunktionen, Schreibfehlern und Anachronismen, – ebenso wirr und zusammenhanglos, wie ich diese verschiedenen Gesichtspunkte ihrer pädagogischen Tätigkeit hier aneinander reihe. Anstatt die Lebensweisheit von den grünen Blättern der Natur abzulesen, mußten wir uns mit dem herumschlagen, was auf den gedruckten stand; sei es nun, daß ein Chorgesang des Sophokles oder eine schwungvolle Rede Ciceros, sei es, daß eine Gleichung aus der analytischen Geometrie, oder daß eine Frage aus der Kirchengeschichte unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.
Ich seufzte dann oft heimlich über die Tyrannei der modernen Zivilisation und warf über den Rand meiner Bücher und Hefte hinaus sehnsuchtsvolle Blicke nach den lauschigen Baumwipfeln, die so wonniglich im linden Westwinde rauschten.
Drüben auf dem tannbewachsenen Hügel, etwa eine halbe Stunde vom Städtchen entfernt, lag die Liebigshöhe, so genannt nach dem großen Chemiker, dem die dankbare Bürgerschaft kein beredteres Denkmal ihrer Hochachtung zu stiften wußte, als daß sie einen Bierkeller – das Schätzbarste, was eine germanische Bürgerschaft besitzt – nach seinem Namen taufte. Dort hatten wir verfassungswidrigen Primaner mehr als einmal »eine Orgie gefeiert«, – wie der Direktor sich ausdrückte, wenn er unsere Zechgelage entdeckte und uns mit mehrtägiger Karzerstrafe belegte. Auch war die Liebigshöhe ein beliebter Sammelplatz für solche Insassen der Stadt, die sich einer zahlreichen Familie erfreuten; denn es war nirgends so billig, wie hier im Schatten der Tannen, ganz abgesehen davon, daß außer Bier, Kaffee und Kuchen nichts verabreicht wurde. Zu den Töchtern dieser Familien gehörte auch Jenny, die blonde, schlanke, blauäugige Jenny, an die ich bereits in Unterprima eine Reihe hervorragender Liebeslieder gestaltete, während ich sie in Oberprima zur Heldin eines fünfaktigen Trauerspiels erkor …
Wenn ich so von meinem Platz aus das zierliche Gehöft mit dem braunroten Dach und den blinkenden Fenstern aus der blauen Ferne herüberlächeln sah, so zogen all diese Bilder in bunter, beglückender Reihe durch mein Gemüt, und ich begann immer lauter zu seufzen und immer schwerer den Zwang zu empfinden, der mich an diese harten Subsellien fesselte …
Mit einemmal wurde ich durch die dröhnende Anrede des Direktors oder eines seiner ebenso pflichttreuen Kollegen daran erinnert, daß ich noch Sklave war und nicht das Recht hatte, meine Phantasien während der hochwichtigen Erklärung eines griechischen Tragikers über Berg und Tal wandern zu lassen.
»Sä sänd wäder änmal nächt bei der Sache!« klang es von den Lippen des erzürnten Philologen Doktor Samuel Heinzerling, desselben, der später mit meinem unvergeßlichen Freunde Wilhelm Rumpf das denkwürdige Rencontre in den Räumen des Karzers hatte. Die Worte trafen mich stets wie ein Blitz aus heiterem Himmel, denn ich war in der Tat durchaus nicht bei der Sache und mußte es stillschweigend über mich ergehen lassen, wenn Heppenheimer mich auf den Wink des Autokraten als »onaufmerksam« ins »Tagebooch« einschrieb.
Wie oft habe ich, noch ehe es halb schlug, die Uhr in die Hand genommen und auf dem Rand meiner Virgilausgabe Buch geführt über jede verstrichene Minute! Das gelangweilte Herz glaubte durch diese Kontrolle den Gang dieser trägen Zeit zu beflügeln; aber es war unglaublich, wie bleischwer trotz aller Machinationen die Augenblicke dahinzogen. Ein Triumphgeschrei klang durch die Seele, wenn man mit großen lateinischen Lettern »drei Viertel« notieren durfte. War man von dem Aufzeichnen dieser einzelnen Zeitstadien ermüdet, so erging man sich wohl auch in Epigrammen, deren schweres, molossisches Versmaß die Stimmung des niedergedrückten Gemüts versinnlichte. Der Kern ihrer Wehklagen ließ sich in den Ausruf zusammenfassen: »Will's denn heute wieder einmal gar nicht ›ganz‹ werden!« Ganz! Das war das erlösende Wort! Ganz! Was lag nicht alles in diesen vier Buchstaben, zumal wenn sie sich auf den Schluß der letzten Stunde, also auf vier Uhr nachmittags, bezogen. Und wenn nun gar Quaddler, unser ehrlicher Pedell, sich um ein paar Minuten verrechnet hatte und zu früh klingelte, – wie jauchzten wir da empor beim Gedröhne seines heiseren Metalls! War es doch das Signal der Freiheit, das er uns gab, und »die Freiheit schmeckt süß«, selbst in Prima.
Der geneigte Leser hat vielleicht ein paar Söhne auf dem Gymnasium und fängt an, diese Skizzensammlung für die Verbreiterin unsittlicher Ideen zu halten; aber ich kann ihm nicht helfen. Wenn er sich selber des Jubels nicht mehr erinnert, der ihm bei der Kunde von dem Schluß der Gymnasialexerzitien durch alle Fibern zuckte, so ist dies ein individuelles Unglück: ich meinesteils trage das Bild jener Zeit mit unverblaßten Farben im Busen und fühle fast stündlich ein gewisses Behagen, daß ich nicht mehr verpflichtet bin, nachmittags um zwei meine Bücher zusammenzuschnüren und nach der alten Spelunke zu traben, die mir die herrlichsten, sonnigsten Maitage gestohlen hat.
Worin besteht denn die Glückseligkeit des jungen Studenten anders, als in dem Bewußtsein, daß er aufgehört hat, dem Bann des Gymnasiallebens anzugehören?
Ich finde hierüber bei Hermann Grimm, dem geistvollen Novellisten, eine sehr bezeichnende Stelle.
»Ich war achtzehn Jahre alt«, schreibt dieser feine Beobachter menschlicher Verhältnisse, »und eben erst Student geworden. Das ist ein Übergang im Leben, wie wenige. Man ist mit einem Schlage aus einem ungewissen Wesen ohne Bedeutung zu einem Manne mit Titel, Rang und gegründeten Ansprüchen umgeschaffen. Man hat Geld zu seiner Verfügung, kann arbeiten, was und wie man will, und darf den Genuß des Lebens von den Bäumen pflücken, wo die Früchte am lockendsten aus dem Laube leuchten. So griff ich das Leben an: ohne kopfhängerische, einsiedlerhafte Neigung war ich ein vergnügter Student und wußte nur vom Hörensagen, daß es eine Zukunft gebe; die Vergangenheit war mir ein unbekanntes Land geworden, zu dessen Ufern die Erinnerung niemals zurückkehrte. Was konnte ich Größeres verlangen? Ein Palast, um darin zu studieren, berühmte Gelehrte, die uns »meine Herren« anredeten, die mit wunderbarer Höflichkeit Kenntnisse und Eifer bei uns voraussetzten, eine große Stadt, in der es sich frei und unbehelligt lebte, freie Abende, Nächte (wenn wir wollten), Theater – für einen Studenten gibt es keinen unerfüllten Wunsch.«
Aus diesen Zeilen spricht ganz dasselbe Gefühl, dem ich in den oben stehenden Worten Ausdruck verliehen habe. Im Winter läßt man sich die Sache zur Not noch gefallen. Man begeistert sich für Antigone, obgleich der Umstand, daß man die Tragödie des unsterblichen Meisters in minimalen Bruchteilen zu sich nimmt, sehr geeignet ist, dieser Begeisterung Abbruch zu tun. Man übt sich im lateinischen Stil, denn man kann einmal Reichstagsabgeordneter werden und in die Lage kommen, das »timeo Danaos« oder das »nil humanibus arduum est« zitieren zu wollen. Man fertigt deutsche Aufsätze nach klassischen Vorbildern, denn eine gewisse Leichtigkeit im Ausdruck ist allezeit nütze, sei es nun, daß man sich auf die Schriftstellerei wirft, was bei den Gymnasiasten von heutzutage die Regel ist, oder daß man als Hotelbesitzer lange Rechnungen verfertigt, die unter Umständen mehr einbringen als die Schöpfungen der Novellistik. Alles das geht im Winter, denn Schnee und Regen sind keines Menschen Freund, und im Feld und auf der Heide ist wenig zu suchen, wenn der Nord durch die kahlen Zweige der Buchen fegt. Aber im Frühling,[64] sobald die ersten Lerchen ins Blaue steigen, ändert sich diese Sachlage. Dann wird der Zwang, auf die Vorträge eines Doktor Samuel Heinzerling zu lauschen, zur qualvollsten Sklaverei, und die Sehnsucht nach den Umarmungen der Mutter Natur macht jeden wissenschaftlichen Ernst zuschanden.
Das Bewußtsein, daß ich einst in diesen Ketten geschmachtet habe und jetzt frei bin, frei wie der Vogel in der Luft, dieses süße Gefühl des Nicht-Gymnasiastentums bildet jetzt eine der vornehmsten Würzen meines Frühlingsgenusses.
Aber die Medaille hat ihre Rückseite. Nicht selten rächt sich die Vergangenheit für den stillen, triumphierenden Hohn, mit dem ich ihrer gedenke, – und nachts in den entsetzlichsten Traumgesichtern kehrt sie mir zurück und schreckt mich mit der Maske der Gegenwart. Ich sehe mich trotz meines Doktordiploms, das bereits vor acht Jahren lügnerischerweise behauptet hat, ich sei ein vir perdoctus, und trotz des würdevollen Bartwuchses, den ich mir im Laufe der letzten zwei Lustra anzueignen wußte, von meinen ehemaligen Schulkameraden umringt in dem Saale der Prima, und vor mir steht die fragwürdige Gestalt des Doktor Samuel Heinzerling oder eines seiner gestrengen Kollegen. Das Verhängnis drückt mir einen lateinischen Klassiker in die Hand und verlangt von mir, ich solle exempli gratia das erste Kapitel der Rede Ciceros pro Roscio Amerino ins Griechische übersetzen. Ich überfliege den lateinischen Text mit fiebernden Blicken und gewahre sofort, daß mir für einige der notwendigsten Ausdrücke die griechischen Vokabeln fehlen. Mein Nachbar, ein fleißiger und gewissenhafter Schüler, der in den Tagen meiner wirklichen Primanerschaft stets aufs pünktlichste präpariert war, scheint diesmal ausnahmsweise faul gewesen zu sein, wie ich. Ich gebe ihm alle erdenklichen Signale mit dem Ellbogen, mit den Füßen, mit den Knien; ich raune ihm zu: »Mensch, Du bist des Todes, wenn Du mir nicht Dein Wörterbuch vorschiebst!« Aber er rührt sich nicht.
»Non,« klingt die Stimme meines Peinigers, »wollen Sä non bald anfangen? Sä scheinen mär wäder änmal nächt gehöräg vorbereitet.«
Ich lege die Hand aufs Herz.
»Aber, Herr Direktor,« stammle ich treuherzig, »ich kann Sie aufs bestimmteste versichern …«
Ich hoffe durch diese bestimmte Versicherung nur Zeit zu gewinnen, aber Samuel Heinzerling unterbricht mich.
»Sein Sä mer ställ«, sagt er in wegwerfendem Tone; »äch weiß zor Genöge, was äch von Ähren bestimmten Versächerongen zo halten habe. Öbersätzen Sä jetzt das Kapätel ins Grächäsche, oder gäben Sä zo, daß Sä nächt nach Geböhr präparärt sänd!«
Mit einem verzweifelten Entschluß beginne ich:
»Credo ego vos judices mirari … Ὑμᾶς μὲν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, θαυμάζειν ἐγῷμαι …«
»Goot«, sagt Samuel Heinzerling; »non weiter!«
Da haben wir's! Das nächste Wort, summi, ist zwar ein ganz gewöhnliches, und ich weiß genau, daß ich die entsprechende griechische Vokabel mindestens hundertmal angewandt habe; jetzt aber, im entscheidenden Augenblicke vor den Schranken Doktor Samuel Heinzerlings, bin ich mit aller Kraft nicht imstande, die fluchwürdigen paar Silben aus meinem Gedächtnis heraufzubeschwören.
»Summi …,« sage ich, »ja, summi, das heißt … es kommt darauf an, wie man das hier auffaßt; nämlich insofern … summus kann verschiedenerlei bedeuten. Wenn wir z. B. sagen, summus mons, so ist das etwas anderes, als wenn wir sagen, summa cum laude …«
»Bleiben Sä bei der Sache; öbersätzen Sä sommä mit dem änzägen bezeichnenden grächäschen Wort ond lassen Sä alle Omschweife!«
»Also,« stammle ich, während mir der helle Angstschweiß auf die Stirne tritt, »summi … Credo ego vos judices mirari, quid sit, quod cum tot summi …«
»Das Lateinäsche können wär ons sälbst lesen. Sä scheinen mer nächt recht zo wässen, was sommä auf Grächäsch heißt.«
»O gewiß, Herr Direktor; es fragt sich nur, ob wir das Wort hier figürlich auffassen, oder ob wir seine eigentliche Bedeutung …« (mit gedämpfter Stimme zum Nachbarn:) »Du, summi, Himmelkreuzdonnerwetter, lege mir doch Dein Heft hin!«
Mein Nachbar rührt sich nicht.
»Was haben Sä da eben zom Schwälble gesagt? Er soll's Ähnen wohl einflöstern? Korz ond böndig, wässen Sä, wä Sä sommä zu öbersätzen haben oder nächt?«
»Summi … natürlich … ich nehme das hier bildlich von den geistigen Eigenschaften.«
Der Direktor schüttelt unwillig mit dem Kopf und sucht mit der rechten Hand in der Westentasche nach dem Bleistift, um mir die Note »ongenögend« anzumalen.
Der Angstschweiß rinnt mir jetzt bereits literweise von der Stirn. Aber noch gebe ich meine Sache nicht verloren. Ich entsinne mich, daß griechisch καλὸς κἀγαθός eine hervorragende sittliche Eigenschaft bedeutet, und versuche ganz glatt weg, dieses summi auf die angedeutete Weise zu übertragen.
»Sä sänd wäder änmal faul gewesen«, ruft jetzt Heinzerling in schnarrendem Tone.
»Καλὸς κἀγαθός,« hauchte ich noch mit der letzten Kraft meines Mundes, »κἀγαθός, das heißt, ich wollte mir die ganz ergebene Bemerkung erlauben, ich war gestern unwohl, und wir hatten Besuch, und mein Onkel war da, und dann hatte ich noch gestern die Korrektur meiner neuen Novellen zu lesen, die dieses Jahr erscheinen, und die ich Ihnen nicht dringend genug empfehlen kann.«
»Was? Novellen wollen Sä schreiben ond wässen nächt änmal, wie sommä auf Grächäsch heißt? Wässen Sä was, Sä täten auch besser, Sä öbten säch ärst noch ein wenäg in den Elementen der Scholbäldong, ehe Sä säch daran machten, einem denkenden Volke geistige Nahrong onterbreiten zo wollen. Wenn mer än Mänsch sagt, er schreibt Novellen, so wärft das ein sehr schlechtes Lächt auf seinen Läbenswandel, ond korz ond got, Sä gehn mer sechs Stonden auf den Karzer. Schreiben Sä änmal ein, Heppenheimer: ›Doktor Ernst Eckstein wägen ongenögender Vorbereitong ond vorsätzlichen Novellenschreibens mit sechs Stonden Karzer bestraft‹. Knöpke, holen Sä einmal den Pedellen.«
Jetzt wird mir die Sache zu bunt.
»Was, Herr Direktor? Sie wollen sich hier über meinen schriftstellerischen Beruf ereifern? Sie wollen mir Verhaltungsmaßregeln erteilen in Angelegenheiten, von denen Sie nicht das[67] geringste verstehen? Das übersteigt denn doch alles, was mir bis jetzt in meiner Praxis vorgekommen ist! Augenblicklich verlassen Sie das Zimmer! Augenblicklich, sage ich, oder Sie sollen mich von einer Seite kennen lernen, die Ihnen schwerlich gefallen wird.«
»Mänsch, was onterstehn Sä säch? Heppenheimer, schreiben Sä änmal ins Tagebooch: ›Wägen empörenden Benehmens …‹«
Ich trete aus den Bänken heraus, kreuze die Arme vor der Brust und schreite auf den Direktor los.
»Samuel,« sage ich, »es ist genug des grausamen Spiels. Ich habe längst mein Maturitätsexamen gemacht und eine Doktorprüfung bestanden, die mich zur Forderung einer anständigen Behandlung berechtigt. Lassen Sie sich Ihren Cicero pro Roscio Amerino einpökeln und das summi und alle übrigen lateinischen Superlative übersetzen, von wem Sie Lust haben; ich danke dafür! Leben Sie wohl und grüßen Sie mir Ihre Frau Gemahlin!«
Und hiermit ergreife ich meinen Zylinder, der sich zwischen den Mützen meiner Schulkameraden ganz eigentümlich ausnimmt, packe meine Bücher unter den Arm und schreite hochaufgerichtet der Tür zu.
»Heppenheimer!« ertönt die Stimme Samuels. »Rofen Sä schnell den Pedellen! Sechs Tage Karzer! Zwölf Tage Karzer! Augenbläckläch wärd er hänaufgeföhrt.«
Ich aber renne im Sturmschritt die Treppe hinab, stoße den Pedell, der mir entgegenkommt, über den Haufen und bin zwei Minuten später im Freien. Sowie mich Gottes allgütige Sonne bescheint, wache ich auf. Die Nachbarsleute versichern regelmäßig, ich hätte in den Nächten, die mir derartige Träume senden, furchtbar gestöhnt, und die Witwe Wendelsheim, die ein sehr gutes Herz hat, rekommandiert mir jetzt bereits zum fünfundzwanzigsten Male ihr unfehlbares Mittel gegen Alpdrücken.
Noch peinlicher gestalten sich diese Verhältnisse, wenn mich der Geschichtslehrer ins Gebet nimmt. In den Sprachen habe ich mich immer noch so leidlich zurecht gefunden, aber die Historie war meine schwache Seite. So erinnere ich mich, daß ich in Sekunda[68] aufgefordert wurde, eine kurze Darstellung der Hussitenkriege zu liefern. Leider war mir der Gegenstand, über den meine oratorische Leistung sich erstrecken sollte, so unbekannt, wie Herrn Gambetta die Geheimnisse der Strategie; aber in einer dunklen Vorahnung der Tatsache, daß der Diktator von Tours dereinst auch ohne diese Kenntnisse das militärische Szepter ergreifen würde, beschloß ich, kühn ins Feuer zu gehen und ein »Essay« zu liefern, das mich »herausbeißen« sollte. Der Umstand, auf den sich meine Hoffnung begründete, war die umfassende Kenntnis des berühmten Studentenliedes:
Ein Volksdichter, so kalkulierte ich, wird von der historischen Wahrheit nur wenig abgewichen sein, und so bedarf es denn nur einer glücklichen Paraphrase dieses rührenden Gesanges, um die mir gestellte Aufgabe zu lösen.
Ich begann.
»Es war zur Zeit der Hussitenkriege. Die Verhältnisse hatten sich damals so eigentümlich gestaltet, daß nach langem Hin- und Herüberlegen und vielen vergeblichen Bemühungen, den Frieden aufrecht zu erhalten, demungeachtet der Krieg losbrach. So geht es eben in der Geschichte der Völker! Ganz ähnlich lagen die Dinge beispielsweise vor Ausbruch des Ersten punischen Krieges. Überall walten hier die gleichen Prinzipien: und so gilt denn diese Wahrheit auch von dem bedeutsamen und hochwichtigen Krieg, den ich jetzt zu behandeln gedenke. Da dieser Krieg oder diese Kriege von den Anhängern des Professors Huß geführt wurden, so nannte man sie, um sie mit anderen nicht zu verwechseln, die Hussitenkriege. Ich übergehe hier einiges minder Wichtige und komme zu dem entscheidenden Moment, wo die Hussiten sich aufmachten und zunächst die Richtung nach Jena einschlugen. Nach einem flüchtigen Abstecher in der Richtung von Camburg langten sie vor dem feindlichen Städtchen Naumburg an, das neben anderen hervorragenden Eigentümlichkeiten eine große Wiese besaß, die man mit Rücksicht auf die daselbst nistenden Vögel, oder vielleicht auch wegen eines daselbst häufig stattfindenden Vogelschießens, die Vogelwiese nannte. Die[69] Frage ist noch unentschieden, welche der beiden Versionen die richtigere sei. Es gibt Geschichtsforscher, welche sich unter Aufwendung eines großen Scharfsinnes für die erstere Auffassung entscheiden. Ebenso anerkannte Autoritäten neigen indes der entgegengesetzten Ansicht zu, und so will ich denn, da mir die Quellen in diesem Augenblicke nicht zur Hand sind, die Frage nicht weiter erörtern. Auf dieser ganzen Vogelwiese sah man nichts als Schwerter und Lanzen.«
Ich vermied das Wort »Spieße«, da der Reim mich verraten hätte. Von innerem Wohlgefühl über meine Schlauheit erfüllt, bemerkte ich nicht, daß der Lehrer immer vergnüglicher dreinschaute, – oder wenn ich sein Lächeln wahrnahm, so hielt ich es für einen Ausdruck der Zufriedenheit, der mich ermutigen sollte, kühnlich fortzufahren.
Das ging denn auch so eine Weile ohne ernstliche Schwierigkeit; als ich aber bei der Schilderung der Teuerung anlangte und das historische Faktum zum besten gab, daß ein einziges Lot Kaffee an sechszehn Pfennige gekostet habe, da brach ein wahrer Sturm des Beifalls los, und mit peinvollem Erröten mußte ich einsehen, daß ich das Lächeln auf den wohlwollenden Zügen des Professors gänzlich mißdeutet hatte.
»Schweig' und setz' Dich«, sagte der Lehrer mit Würde; »ich will nicht so grausam sein, Dich zu massakrieren.«
Ich war froh, daß die Komödie vorüber war, denn besonders behaglich hatte ich mich bei dieser Interpretation deutscher Volkslyrik doch nicht gefühlt, und besser, in den Abgrund geschleudert zu werden, als in peinvoller Schwebe über der Tiefe zu hangen.
Auch diese geschichtlichen Lektionen reproduziert mir der Traum oft in erschreckender Weise, und ich fühle ganz deutlich, wie sich mir das Fatum in Gestalt eines bleiernen Druckes auf die Gurgel legt, wenn der Professor mich auffordert:
»Geben Sie uns nun einmal eine kurze Darstellung der Situation Europas nach Beendigung der Völkerwanderung.«
Mit allen zehn Fingern wühle ich mir im Gehirn herum, aber die Situation will nicht klar werden, und nur das dunkle Bewußtsein, daß es damals in Europa sehr wüst und unordentlich[70] ausgesehen, tröstet mich über die wüste Unordnung in dem eigenen Schädel. Dann plötzlich suche ich mir dadurch zu helfen, daß ich Nasenbluten bekomme oder mich in der Wade vom Krampf ziehen lasse, ein Mittel, das ich allen verlegenen Primanern aufs wärmste empfehlen kann. Nur im Traum will es nicht verfangen.
»Das kennt man«, sagte der Lehrer geringschätzig. »Ich bin auch einmal Primaner gewesen, aber mich hat niemals der Krampf gezogen. Erzählen Sie nur ruhig weiter, oder machen Sie sich auf drei Tage Karzer gefaßt!«
Die Tage Karzer regnen nur so, wenn ich träume. Ich habe freilich auch im Wachen gar manche schöne Stunde unter dem Dachfirst des Gymnasialgebäudes geschmachtet, aber der Traum treibt es doch noch verschwenderischer als die Wirklichkeit. Zudem sehe ich im Traum gar kein Mittel ab, die Verbüßung der verhängten Strafe zu hintertreiben, während ich tatsächlich dies mit einer Meisterschaft verstand, vor der ich noch jetzt eine gewisse Hochachtung empfinde. Es traf sich nicht selten, daß ich während einer einzigen Woche von drei Lehrern zugleich mit sechs Stunden Karzer belegt wurde. Ich meldete mich dann eines schönen Tages bei dem Pedell und sagte: »Herr Quaddler, ich habe auch noch die sechs Stunden Karzer abzusitzen, die der Herr Doktor mir verordnet hat«. Der brave Pedell glaubte sich bei dieser Bezeichnung »der Herr Doktor« beruhigen zu dürfen, und ich klomm die Treppe hinan. Ein paar Tage später kam der erste der drei Lehrer und erkundigte sich, ob der Verurteilte sich gemeldet habe. Quaddler bejahte. Dann erschien der zweite. Quaddler bejahte abermals. Und beim dritten bejahte Herr Quaddler zum drittenmal. Der Gedanke, daß ein Schüler dreimal in einer einzigen Woche von drei verschiedenen Lehrern der Freiheit beraubt werden könne, war ihm so unfaßlich, daß seine arme Seele ihn gar nicht in Berechnung zog. Er hielt die Erkundigungen der Lehrer einfach für Beweise eines besonderen Interesses, das sie an meiner Persönlichkeit nahmen, und so erledigte ich denn nicht selten drei und vier Strafen auf einmal, – eine stenographische Methode des Absitzens, die ihre unleugbaren Vorteile hat. Nur im Traume will sich dies oft bewährte Mittel nicht anwenden lassen: Quaddler, der in Wirklichkeit[71] einer der gutmütigsten Menschen unter der Sonne war, kontrolliert hier auf einmal mit der Bosheit eines Inquisitionsrichters, und selbst seine Tochter, die sanfte, rosige Anny, denunziert mich bei Samuel Heinzerling wegen unterschlagener Bußestunden.
So rächt sich das Einst an dem Jetzt, weil das Jetzt seine Befriedigung darüber ausdrückt, daß es von den Ketten des Einst befreit ist. Alles gleicht sich im Leben aus. Wer bei Tage mit dem Hut in der Hand an der Kirchentür sitzt und um Almosen fleht, der besteigt nachts im süßen Delirium der Träume vielleicht den Thron Frankreichs oder den Stuhl Petri, und wem das Schicksal die Krone aufs Haupt gedrückt hat, der beschäftigt sich, wenn Morpheus ihn eingewiegt hat, vielleicht mit dem Verkauf alter Zahnstocher oder mit dem Waschen gebrauchter Whistkarten.
Es gab nur ein Mittel, um sich beim Herannahen des Lenzes den Druck der Gymnasialfesseln weniger fühlbar zu machen: die Wonne der Ungezogenheit. Ihr Weisen, Frommen und Gerechten, ich sehe schon wieder im Geiste, wie ihr die Stirn runzelt. Aber ihr wißt nicht, daß die Ungezogenheit den eigentlichen Lebenskern, ja, die einzige und echte Poesie des Gymnasiallebens ausmacht. Nimm einer deutschen Nähterin ihren Sonntagnachmittag, und du knickst ihr die Blüte des Daseins; nimm einem Gymnasiasten das Privilegium der Ungezogenheit, und du bohrst ihm den Dolch der Verzweiflung ins Herz. Ich weiß ein Lied davon zu singen! Ein volles Jahr hindurch habe ich mich, von einem düsteren Vorurteil irre geführt, mit eigener Hand dieses köstlichen Privilegiums entkleidet – und gelitten, wie ein Prometheus am Felsen. Ich will dem geneigten Leser zum Schluß auseinandersetzen, wie dies zusammenhing.
Als ich in die Quarta des städtischen Gymnasiums eintrat, war ich ein frommes Kind von zwölf Jahren, das an nichts Böses dachte und sein Dasein gestaltete, wie die Götter es fügten, – ohne Besorgnis vor dem Stirnrunzeln der Lehrer, ohne Rücksicht auf Lob und Strafe. Die Folge dieser kindlichen Unbefangenheit war, daß ich mir eine Reihe empfindlicher Mißtrauensvota zuzog und am Schluß des Jahres eine im Punkte des Betragens sehr bedenklich nuancierte Zensur mit nach Hause brachte, während drei oder vier meiner Kameraden »wegen Fleißes und guten Betragens«[72] ein Prämium erhielten. Dieses Prämium, das den andern zugefallen und mir vom Schicksal vorenthalten worden war, bildete während der folgenden Osterferien in meinem elterlichen Hause das tägliche Tischgespräch. Man sah es wie eine Kränkung der Familienehre an, daß ich leer ausgegangen sei, und ließ mich dies so schmerzhaft empfinden, daß ich den heroischen Entschluß faßte, im nächsten Jahre meinen Aufenthalt in Tertia dazu zu benutzen, eine solche amtliche Bestätigung meines »Fleißes und guten Betragens« im Schweiße meines Angesichts zu verdienen.
Dieses Jahr in Tertia war das unglücklichste meines Lebens.
Ein Kapitel aus Curtius langweilte mich; ich verspürte das unwiderstehliche Gelüste, mit meinem Nachbar über irgend einen erheiternden Gegenstand zu plaudern; aber das Prämium trat wie ein Gespenst zwischen mich und diesen beglückenden Plan, und das Wort erstarb mir auf den Lippen.
Ich machte einen nachmittäglichen Spaziergang. Die Zunge klebte mir am Gaumen, und ich fühlte den Drang, in die nächste Kneipe einzukehren und auf das Wohl Samuel Heinzerlings ein Glas Bier zu trinken. Sofort erinnerte ich mich des Paragraphen der Gymnasialstatuten, der besagt, daß den Schülern dieser Pflanzstätte des Wahren, Schönen und Guten der Genuß geistiger Getränke ein für allemal untersagt ist, – und ich ließ den verlockenden Kelch seufzend vorübergehen.
Die Kommilitonen führten irgend einen köstlichen Streich aus; meine ganze Seele rang nach aktiver Beteiligung, aber ich wußte, daß es mit dem Prämium aus war, wenn ich mich auch nur eines einzigen Vergehens schuldig machte, und so erstickte ich meine Sehnsucht und blieb, was zu sein ich mir vorgenommen: ein braver Schüler.
Das Osterfest des folgenden Jahres kam heran. Ich erhielt mein Prämium in Gestalt eines Kiepertschen Atlas, und vorn in zierlich lithographierten Zügen stand die wunderbare Tatsache zu lesen, daß ich ein Jahr hindurch die volle Zufriedenheit meiner sämtlichen Lehrer erworben hatte.
Mit diesem Kleinod im Arm eilte ich nach Hause; aber schon unterwegs legte ich den feierlichen Schwur ab: niemals und unter[73] keiner Bedingung wieder nach einem Prämium zu streben, sondern meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und mich ohne Rückhalt dem Kultus der beglückenden Göttin Ungezogenheit zu widmen. Ich habe den Schwur redlich gehalten; auch meine Eltern haben sich später mit dem Ausbleiben der Prämien zu versöhnen gewußt. Sie mochten so etwas wie eine dämmernde Ahnung von dem haben, was in mir vorging, und da ich ja nun überhaupt einmal gezeigt hatte, daß es mir, wenn es absolut sein mußte, wohl möglich war, ein ganzes Jahr hindurch die Qualen der Artigkeit zu ertragen, so fiel es ihnen leichter, auf die Beweise einer fortgesetzten guten Aufführung zu verzichten.
Ich aber betrachte noch jetzt das Jahr in Tertia als einen Fehler in meinem Lebensplan, und hundertmal hab' ich mir zugerufen: annum perdidi! Nein, ihr Gestrengen, die Ungezogenheit ist das eigentliche Element des Gymnasialschülers, und so wenig der Fisch im Extrait double de violette existieren kann, so wenig ist es dem Alumnen einer modernen Bildungsanstalt möglich, die Luft eines Nonnenpensionats einzuatmen. Für die Töchter gebildeter Stände mag die »Gezogenheit« ihre Vorteile haben. Den jungen Leuten, die sich im Laufe der Dezennien zu Bürgern einer freien Nation entwickeln und das Material liefern sollen zu dem großen mitteleuropäischen Kulturstaat, den deutschen Knaben und Jünglingen lasse man das Privilegium der Flegeljahre und die süßen Träume der Jugendeselei, denn nur so können sie gedeihen.



So oft der Sterbliche in den Schatz seiner Gymnasialerinnerungen zurückgreifen mag, stets wird er finden, daß die Reichhaltigkeit und Fülle dieser Reminiszenzen unerschöpflich ist. Stets wird er ein neues Bild, eine neue Situation entdecken, an die er vielleicht seit Jahren nicht mehr zurückgedacht hat. Und wenn er das alles unter dem entsprechenden Gesichtswinkel zu betrachten weiß, so stellt sich ihm hier eine Welt im kleinen, eine vorgreifende Gestaltung all seiner späteren Erlebnisse dar, die sich zu dem Treiben der großen und wirklichen Welt etwa verhalten mag, wie das Puppenspiel der kleinen Mädchen zu den Freuden des Mutterglücks.
Es ist dies schon mit Rücksicht auf den beträchtlichen Zeitraum, den der heranreifende Mensch in den Mauern des Gymnasiums zu verbringen hat, mehr als erklärlich. Da die Länge der Zeit nicht füglich allein nach der Summe von Erdumdrehungen, die zwischen zwei bestimmten Terminen stattfinden, berechnet werden darf, sondern vielmehr nach der Summe von Eindrücken, die das Gemüt und der Intellekt empfangen, so darf man kühnlich behaupten: wir verbringen die Hälfte unseres Lebens unter der Botmäßigkeit der Gymnasialtyrannen. Schopenhauer hat in seiner Abhandlung über den Unterschied der Lebensalter sehr treffend nachgewiesen, daß der Mensch etwa mit dem zwanzigsten Jahre die subjektive Hälfte seiner Existenz hinter sich hat. Die Jahre der Kindheit sind ungleich inhaltsreicher und daher subjektiv ungleich länger als die des Mannes- und Greisenalters. Dem jugendlichen Geist ist fast jede Erscheinung der Außenwelt neu, – und daher in einem gewissen Sinne epochemachend.[75] Der Greis hat sich dagegen längst eine intellektuelle Blasiertheit angeeignet: es bedarf somit schon außerordentlicher Ereignisse, um ihn ernstlich zu influieren. Die Tage fliehen ihm dahin wie im Sturme; das Kommen und Gehen der Jahreszeiten, das dem Kinde als eine Umgestaltung des ganzen Daseins erscheint, macht ihm den Eindruck regelmäßiger Vibrationen; und die Wunschlosigkeit seiner Seele entkleidet die Dinge jenes Kolorits, das sie dem Kinde so wichtig und interessant macht. Kurz, die acht oder neun Jahre, die wir auf den Subsellien unserer Schulen versitzen, wiegen reichlich die vierzig oder fünfzig auf, die das Schicksal uns nachher noch vorbehalten hat, und die Erlebnisse der Gymnasialzeit bilden somit den größten Teil unserer Persönlichkeit. Es kommt noch hinzu, daß die Erinnerung jene frühesten Eindrücke weit lebhafter und frischer reproduziert als alles, was das Leben später hinzufügt. Selbst gedächtnisschwache Greise, die nach einer Viertelstunde vergessen haben, was unter ihren Augen vorgegangen ist, bewahren in der Regel die Bilder ihrer Kindheit in den lebhaftesten Farben, – zu einer Zeit also, wo das Gehirn längst aufgehört hat, neue Begebnisse mit einiger Zuverlässigkeit aufzuspeichern.
Den eigentlichen Reiz der Gymnasialerinnerungen kann nur derjenige begreifen, der selbst ein Gymnasium besucht hat, – daher ihr Zauber denn in der Regel von Frauen nur in sehr fragmentarischer Weise gewürdigt und nicht selten absolut mißverstanden wird. Ich erinnere mich, daß eine meiner zahlreichen, im übrigen höchst achtbaren und liebenswerten Großtanten bei dem Bericht einiger Gymnasialstreiche, die ich zum besten gab, in ein so bedenkliches Stadium sittlicher Entrüstung geriet, daß ich an mir selbst irre ward und mich fragte, ob ich denn in der Tat jenes ruchlose Geschöpf sei, das die treffliche Matrone im Sinn hatte, wenn sie von einem unverzeihlichen Mangel an Pietät und Gesittung redete. Aber bald fand ich Trost in dem Gedanken, daß es dem Blinden nicht vergönnt ist, über die Farben zu urteilen, und mein schwankendes Selbstgefühl gewann das Gleichgewicht wieder. In der Tat, aus der Ferne läßt sich die Situation des Gymnasiasten durchaus nicht begreifen. Er steht dem »Herrn Professor« oder dem »Herrn Doktor« in jeder Beziehung anders gegenüber, als z. B. der Privatschüler dem Privatlehrer[76] oder der Hausschüler dem Hauslehrer. Es wird keinem vernünftigen Menschen beifallen, in den Flegeleien, die eine der letztgenannten Spezies in Szene setzen könnte, etwas Witziges oder Amüsantes zu erblicken. Zum wahren Wesen einer humoristischen Schülerungezogenheit gehört als erste Bedingung der Hintergrund eines öffentlichen Schulsaales und die gleichzeitige ideale Beteiligung von dreißig bis fünfzig gleichgesinnten Seelen. Nur hier ist ein eigentlicher »Streich«, eine originelle Täuschung des Lehrers, eine graziös-perfide Störung möglich, denn die beträchtliche Ausdehnung des Terrains und die große Anzahl der Mitschüler eröffnet die Wahrscheinlichkeit, daß der Urheber dieser Unarten geheim bleibe oder doch erst nach langen, erheiternden Zwischenfällen entdeckt werde. Der ungezogene Privatschüler gleicht dem brutalen Raubmörder, der den arglosen Wanderer überfällt und mit Kugel oder Stahl zu Boden streckt, ein Akt, dem jegliche Pointe fehlt, weil eben nichts dazu gehört, als eine freche Stirn und eine Geringschätzung der Guillotine. Der verschlagene Brigantenhäuptling dagegen, der sein Opfer mit hundert Netzen umgarnt und ihm unter Beibehaltung aller äußeren Formen der Höflichkeit die Freiheit raubt, um erst nach erhaltenem Lösegeld das Sequester wieder aufzuheben, der geniale Spitzbube des Märchens, der seinem Oheim das Bettuch unter dem Leibe wegstahl und den Pfarrer samt dem Küster aus dem Predigerhaus entwandte, um das würdige Paar, in einen Sack eingeschnürt, neben die Schinken des Rauchfangs zu hängen: ein solcher Virtuos des Verbrechens, ein solcher Paganini der Gaunerei hat Anspruch auf unsere ästhetischen Sympathien. Und wie dieser humoristische Frevler zum Raubmörder, so verhält sich der ungezogene Gymnasialschüler zu den obenerwähnten Kategorien und zu allen übrigen Nicht-Gymnasiasten.
Im Grunde sind die Missetaten der Sekundaner und Primaner so harmlos! Ich kenne eine Reihe höchst achtbarer und wissenschaftlich durchbildeter Lehrer, die gar nicht mehr existieren könnten, wenn ihre Schüler nicht ab und zu die gewitterschwüle Luft des Schulsaales durch eine erfrischende Ungezogenheit reinigten. Die »goldenen Rücksichtslosigkeiten« Theodor Storms bewähren sich auch hier: Nichts ist langweiliger, als ein Saal voll wohlgesinnter,[77] braver Schüler, die ein braver, wohlgesinnter Lehrer in den Elementen des Wissens unterrichtet; und kein Lehrer wird von jener gemütstieferen Sorte von Schülern, die wir mit dem Gesamtnamen der Ungezogenheitsfähigen bezeichnen wollen, minder geliebt und geachtet als der stirnumrunzelte Schultyrann, der jede Bewegung nach rechts oder links wie ein Verbrechen ahndet und in Krämpfe verfällt, wenn Müller bei seinem Nachbar Stipelius sotto voce anfragt, wieviel Uhr es sei. Proh pudor! Ist denn die Schule ein Zuchthaus? Verblendeter Autokrat! Wenn Du wüßtest, welche Flüche Dir im stillen nachgesandt werden, sobald Du mit Deinen langen Beinen durch die Tür geschritten bist! Wenn Du die Nasen sähest, die Stipelius Dir dreht, sobald Du den Kopf wendest, und wenn Du die Verse gelesen hättest, die Holzmeier neulich auf Deine liebende Gattin dichtete! Alles, was Dich und Deine Familie angeht, ist ein Gegenstand des ausgelassensten Spottes für Deine sämtlichen zweiundfünfzig gepeinigten Schüler, und die noms de guerre, mit denen Dich ihre geheime Rachsucht belegt, sind Legion.
Wie anders ergeht es dem liberalen Denker, der sich daran erinnert, daß auch er vor so und so viel Dezennien auf diesen Bänken saß und ab und zu unter dem Tische Sechsundsechzig spielte! Ich hatte mich während der letzten vier Jahre meiner gymnasialischen Laufbahn eines so seltenen Mannes zu erfreuen, und ich wüßte nicht, daß derselbe auch nur ein einziges Mal in eine komische Situation geraten wäre. Solange ein Schüler nicht ernstlich störte oder kein allzu eklatantes Ärgernis gab, so lange ignorierte dieser Weltweise selbst die schwersten Verstöße gegen die Gymnasialordnung: war die Grenze, die seine Nachsicht gezogen hatte, überschritten, so verhängte er mit einer freundlichen Gelassenheit die zermalmendsten Strafen und fuhr dann ohne weiteres im Unterricht fort. Es lag beinahe etwas Wohlwollendes in seiner Stimme, wenn er plötzlich vom Buche aufsah und, über die Brille hinweglugend, irgend einem verblüfften Rebellen zurief: »Boxer, Sie haben drei Tage Karzer!« Keine Spur von Erbitterung malte sich dabei auf seinen philosophischen Zügen. Wer die Sprache nicht verstanden und bloß nach dem Klang der Worte geurteilt hätte, der wäre befugt gewesen, eine Phrase zu vermuten, wie »Bitte, schließen Sie doch das Fenster«, oder »Ich glaube, es zieht da hinten«.
Boxer, dem diese unerwartete Anrede öfters begegnete, versuchte niemals zu replizieren, denn er wußte, daß Sträuben und Schweifwedeln hier gleich vergeblich waren. Schweigend starrte er vor sich hin und faßte, von bitterer Reue ergriffen, den lobenswerten Entschluß, in Zukunft seine Karten etwas tiefer zu halten.
Dieser erfahrene Stoiker – ich meine den Professor – war überhaupt in vielen Beziehungen ein Original. Der nachstehende Vorfall erscheint in diesem Sinne charakteristisch:
Ein gewisser Credner wurde zum Übersetzen aufgefordert und lieferte eine höchst ungenügende Leistung.
»Warum sind Sie nicht präpariert?« fragte der Professor, über die Brille schielend.
»Weil ich faul gewesen bin, Herr Professor«, entgegnete Credner mit einer gewissen Frische.
»Heppenheimer,« sagte der Herr Professor, »schreiben Sie mal ins Tagebuch: ›Credner wegen Aufrichtigkeit belobt.‹«
Nach diesem Credner kam die Reihe an meinen lorbeergekrönten Freund Wilhelm Rumpf. Er fiel durch wie sein Vorgänger.
»Auch Sie scheinen nichts gearbeitet zu haben«, sprach der Professor wohlwollend. »Warum bereiten Sie sich nicht gründlicher vor?«
»Weil ich faul gewesen bin, Herr Professor«, entgegnete Wilhelm Rumpf, die Blicke zu Boden senkend.
»Heppenheimer, schreiben Sie einmal ein: ›Rumpf wegen Plagiats mit zwei Tagen Karzer bestraft.‹«
Und Rumpf mußte auf den Karzer, da half ihm kein Gott. Die Prima aber fand den Ausspruch ihres Weltweisen so trefflich und wohlbegründet, daß sie in einen nicht zu beschreibenden Jubel ausbrach.
Ganz den Gegensatz zu diesem platonischen Urbild eines Gymnasiallehrers bildete ein unglücklicher Choleriker, der uns in Sekunda den Virgil erklärte. Seine Haltung wechselte zwischen vulkanischen Wutausbrüchen und ohnmächtiger Schwäche. Während seiner Lehrstunden herrschte ein Lärm, wie er seitdem nur noch im deutschen Reichstag erhört worden ist. Wir lachten, schrien, sangen, husteten, scharrten mit den Füßen und klatschten mit den Händen, daß man sein eigenes Wort nicht verstand; und wenn Doktor Hähnle sich endlich zu der[79] sittlichen Tat eines Entschlusses aufraffte und Ruhe gebot, so erscholl ein Hohngebrüll, daß die Fenster klirrten. Vom Standpunkte der reinen Moral hat ein solcher Unfug allerdings etwas Beklemmendes; aber die Schuld liegt einzig auf der Seite des Lehrers. Wenn fünfzig ungezogene Jungen die Gelegenheit haben, straflos zu tumultuieren, so werden sie unter allen Umständen diese Gelegenheit ausnutzen, – mit derselben mathematischen Notwendigkeit, mit der die Biene ihre Wachszellen formt und der Dichter seine poetischen Schöpfungen webt. Wo der Strom die Dämme einreißt, da verdienen nicht die Wogen unseren Groll, sondern die nachlässigen Deichverwalter, denen es oblag, den Anprall in den gehörigen Schranken zu halten. Waren es doch dieselben Sekundaner, die später in Prima von dem eben geschilderten Weltweisen wie spielend gebändigt wurden.
Die Attentate, die wir auf die Person dieses nie genug zu beweinenden Doktor Hähnle ausübten, waren nach Form und Inhalt zahllos wie der Sand am Meere. Scherz, Ironie und tiefere Bedeutung mischten sich hier in grotesker Buntscheckigkeit mit List und Rache. Von den zärtlichsten Neckereien bis zu den gröblichsten Unbilden baute unsere ruchlose Phantasie Staffel um Staffel, und wenn Doktor Hähnle nicht schließlich unter unseren sakrilegischen Krallen seinen Geist auskrähte, so geschah dies nur deshalb, weil er noch rechtzeitig pensioniert wurde.
Wenn die ersten Kirschen reiften, so erstanden wir eines jener zierlichen Sträußchen, wie die Marktweiber sie, auf blankgeschabte Hölzer gesteckt, zum Verkauf bieten. Diese köstliche Gabe der jungen Natur wurde Herrn Doktor Hähnle beim Beginn der Lehrstunden als Zeichen der allgemeinen Liebe und Verehrung überreicht.
Obgleich sich das Ereignis, das ich schildern will, bereits seit einem Dezennium alljährlich wiederholte, so verfehlte der also gefeierte Lehrer doch niemals, in den verbindlichsten Worten seinen Dank auszusprechen und das Sträußchen auf dem Tisch neben der Tür in Depositum zu geben.
Nun begann die Komödie.
»Herr Doktor, darf ich einmal hinausgehen?«
»Gehen Sie!«
Der Schüler ging und zog im Vorbeigehen mit geschicktem Griffe von einer der zierlich zusammengebundenen Kirschen dergestalt das Fleisch ab, daß der Kern am Stiel sitzen blieb. Die Beute ostensibel zum Munde führend, verschwand er im Korridor.
»Herr Doktor, darf ich einmal hinausgehen?«
»Gehen Sie!«
Abermalige Abstreifung des Kirschenfleisches und Zurücklassung des entblößten Kernes.
Das Sträußchen enthielt ungefähr zwölf bis fünfzehn Kirschen. Zwölf bis fünfzehn Schüler baten demgemäß um die Erlaubnis, »hinausgehen« zu dürfen.
Unter mannigfachen Störungen und Impertinenzen verstrich die Stunde. Doktor Hähnle gewahrte sofort, welches Los man ihm bereitet hatte, und machte Anstalten, ohne weiteres an den Resten des Festgeschenkes vorüber zu wandeln. Aber das ging nicht so.
»Herr Doktor, Ihr Sträußchen!« rief eine Stimme aus dem Hintergrunde.
»Vergessen Sie doch Ihr Sträußchen nicht!« klang das Echo.
»Ja, wo ist denn dem Herrn Doktor sein Sträußchen?«
Ein vierter ergriff das Sträußchen mit den zwölf bis fünfzehn Stielen, an denen die Kerne elegisch herabbaumelten, und trat vor, um es dem verwirrten Lehrer mit Grazie zu präsentieren.
Und nun erscholl ein Jubelgeheul durch die heiligen Hallen der Sekunda, das an die stolze Hyperbel gemahnte, mit welcher Homer das Wehgebrüll des verwundeten Ares zu versinnlichen sucht. Doktor Hähnle aber wies die schnöden Überbleibsel des Sträußchens mit Verachtung zurück und eilte, von einem wahren Gelächter der Hölle verfolgt, ins Freie.
Ein andermal brachten wir eine Auswahl musikalischer Instrumente mit, etwa eine Mundharmonika, ein Blechtrompetchen und eine Maultrommel. An solchen Tagen herrschte in den Räumen der Sekunda eine ungewohnte Stille. Gewitterschwül lagerte es über den Bänken, und Doktor Hähnle konstatierte zu seiner eigenen bänglichen Überraschung, daß er fünf Minuten lang ohne Unterbrechung dozieren konnte. Da mit einemmal erhob sich in den fernsten Winkeln des[81] Saales ein sanft anschwellender Triller, der unter der atemlosen Stille der Versammlung in ein Motiv aus Flotows Martha überging und plötzlich mit einem grellen Mißton abbrach.
Donnernder, rasender Applaus.
Doktor Hähnle stand wie versteinert.
Abermals herrschte ein brütendes Schweigen, und jetzt ertönte in melodischer Abdämpfung das unheimliche Schnurren der Maultrommel, die dasselbe Motiv aus der Flotowschen Oper, nur etwas neckischer nuanciert, wiederholte.
Applaus wie vorhin. Doktor Hähnle wurde dunkelrot im Gesicht. Mit der geballten Faust schlug er aufs Lehrpult.
»Still einmal«, rief er mit bebender Stimme. »Der miserable Mensch, der das getan hat, soll sich noch einmal hören lassen; ich will ihm dann zeigen, was einer so beispiellosen Roheit gebührt!«
Und wiederum schwieg die ganze Klasse wie ein Mann.
Eine halbe Minute ungefähr ließ das gewünschte Dakapo auf sich warten; dann begann wieder jene erste Sirenenstimme mit dem verführerisch lieblichen Triller, und das Motiv aus Martha folgte in tadelloser Reinheit.
»So!« schrie Doktor Hähnle unter dem überschwenglichen Jauchzen der Schülerschaft. – »Jetzt soll der miserable Mensch seine Frechheit noch einmal wagen!«
Die Versammlung begrüßte diese seltsame Wendung des Hähnleschen Zornes mit gebührender Aufmerksamkeit. Hähnle trat nunmehr vom Katheder herab, um von der Seite her in die Reihen der Schüler zu blicken. Indes schon Uhland singt:
Die Artisten auf den hinteren Bänken, die Hähnle jetzt als zunächst verdächtig ins Auge faßte, ließen ihre Instrumente nach vorn wandern, und mit einemmal erscholl das schöne Volkslied
aus der entgegengesetzten Richtung.
Jetzt schritt Hähnle zur Untersuchung. Er begann beim Primus.
»Wo haben Sie's gehört?«
»Da hinten am Ofen.«
»Wo haben Sie's gehört?«
»Da vorn am Fenster.«
»Wo haben Sie's gehört?«
»Mir kam's vor, als sei's draußen.«
»Wo haben Sie's gehört?«
»Ich? Ich habe gar nichts gehört.«
»Wo haben Sie's gehört?«
»Dort am Katheder.«
Diese kühne Bemerkung wurde durch Beifall auf allen Bänken belohnt.
Nachdem Doktor Hähnle so eine halbe Stunde lang herumgefragt und die widersprechendsten Auskünfte vernommen hatte, ging er ans Werk, die einzelnen Schüler zu visitieren.
»Treten Sie mal hier heraus«, sprach er zum Primus.
Er befühlte dem lächelnden Schüler nun sämtliche Taschen, wobei dieser nicht verfehlte, Au! zu schreien oder allerlei unnennbare Töne auszustoßen, die er mit der Bemerkung entschuldigte: Ach, Herr Doktor, ich bin so kitzlich!
Die Visitation blieb natürlich erfolglos, denn die Maultrommel war längst bei den noch nicht visitierten Schülern in sicheren Gewahrsam gebracht.
So untersuchte Doktor Hähnle nun den zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten seiner mißratenen Sekundaner, ohne das mindeste zu entdecken.
Mit einemmal faßte er einen verwegenen Entschluß. Er griff sich plötzlich einen Schüler aus den mittleren Bänken heraus und befahl ihm, schnell einmal herzukommen. Zufällig hatte der Instinkt des gequälten Lehrers diesmal das Rechte getroffen; aber es half ihm nur wenig. Der Schüler, weit entfernt, der Aufforderung Hähnles so ohne weiteres Folge zu leisten, stellte sich vielmehr schwerhörig, gab die musikalischen Instrumente mit aller Vorsicht an den Vordermann ab und fragte dann mit rührender Naivität:
»Meinen Sie mich, Herr Doktor?«
»Ja, Sie!« rief der fiebernde Hähnle. »Machen Sie nur keine Umstände! Kommen Sie augenblicklich heraus!«
»Ach so«, sagte der Schüler; »ich dachte, Sie meinten den Heinemann. Ja, wenn Sie denn wirklich der Ansicht sind, ich könnte mir diese Störung erlaubt haben, so bin ich ja mit Vergnügen bereit, herauszukommen; aber Sie dürfen mir nicht in die rechte Seite kommen, Herr Doktor, da bin ich gestern geschröpft worden.«
Doktor Hähnle ließ sich zwar in der Regel sehr viel gefallen, wie der geneigte Leser aus der vorstehenden Schilderung bereits entnommen haben dürfte; aber zuweilen nahm er an Bemerkungen Anstoß, bei denen dies keiner vermutet hätte.
So irritierte ihn jetzt die Versicherung Kleemüllers, daß er in der rechten Seite geschröpft sei.
»Denken Sie vielleicht, Sie können hier Ihre Possen treiben?« rief er mit Donnerstimme. »Ich gebe Ihnen drei Stunden Karzer!«
»Weshalb?« fragte Kleemüller ruhig.
»Weshalb? Ich will Sie lehren, mir mit solchen Dummheiten zu kommen!«
Kleemüller nahm eine sehr ernste Haltung an.
»Herr Doktor,« begann er, jedes Wort nachdrücklich betonend, »wenn ich sage, ich bin in der rechten Seite geschröpft, so bin ich geschröpft, und ich weiß nicht, was Sie an dieser Tatsache auszusetzen haben.«
»Sie gehen mir jetzt sechs Stunden auf den Karzer, und überdem werde ich den Herrn Direktor von dem Vorgefallenen in Kenntnis setzen.«
»So,« entgegnete Kleemüller, »also bei Ihnen darf man nicht einmal in der rechten Seite geschröpft sein? Nun, da bin ich doch neugierig, ob der Herr Direktor Ihre Auffassung teilt!«
»Kein Wort mehr!« rief Doktor Hähnle. »Entweder Sie bringen mir ein ärztliches Zeugnis, daß Sie wirklich geschröpft sind, oder Sie gehen auf den Karzer!«
»Gut«, sagte Kleemüller. »Ich werde Ihnen ein ärztliches Zeugnis bringen. Muß ich es auch polizeilich beglaubigen lassen?«
»Kommen Sie jetzt nur mal heraus! Sie haben vorhin gepfiffen!«
»Ich? Aber Herr Doktor, wenn man in der rechten Seite geschröpft ist, vergeht einem das Pfeifen von selbst! Ich möchte mal sehen, wenn Sie in der rechten Seite geschröpft wären …«
Nach diesen und ähnlichen Albernheiten begann nun bei Kleemüller die Untersuchung nach demselben Schema, das Hähnle vorher bei den Schülern der ersten Bank angewandt hatte, und mit demselben Erfolg. Da mit einemmal erscholl die Klingel des Pedells. Hähnle ergriff seinen Hut und war froh, die Untersuchung und die Lehrstunde hinter sich zu haben.
Am folgenden Tage brachte Kleemüller sein Schröpfzeugnis, und so war auch dieser Punkt zur Zufriedenheit beider Teile erledigt.
Eine besonders hervorragende Rolle in unserem Verkehr mit Doktor Hähnle spielten die Unglücksfälle.
Ich erkläre mich deutlicher.
Kleemüller, der überhaupt in körperlichen Leiden exzellierte, hatte sich den Fuß verstaucht und kam, auf einen Knüppel gestützt, der während eines nicht allzu strengen Winters ausgereicht haben würde, eine bescheidene Familie mit Brennmaterial zu versorgen, in das Zimmer gewankt. Im Begriff, sich auf seinen Platz zu begeben, fiel er langwegs zu Boden, die eigens zu diesem Zweck in reicher Auswahl mitgebrachten Bücher nach allen Richtungen hin verstreuend und mit dem Knüppel so auf die Dielen donnernd, daß der Staub in gigantischen Wolken aufwirbelte. Gleichzeitig mit diesen Staubwolken stieg Kleemüllers Klagegeschrei zum Himmel. Der leidende Philoktet des Sophokles kann nicht entsetzlicher geheult und gewinselt haben wie der gefallene Kleemüller. Die Töne aller Urwaldsbestien vermischten sich in dieser phonetischen Kraftleistung, und die entzückte Sekunda brüllte den Chor.
Doktor Hähnle wartete stirnrunzelnd, bis Kleemüller sich wieder erhoben hatte. Die Brust des unglücklichen Philologen arbeitete in wilder Bewegung. Plötzlich streckte er den rechten Arm aus, richtete die Spitze des Zeigefingers auf denjenigen seiner Schüler, der mit der Führung des Klassendiariums beauftragt war, und sprach die vernichtenden Worte:
»Heppenheimer, schreiben Sie mal ins Tagebuch: ›Kleemüller erschien mit einem Stocke bewaffnet im Lehrzimmer und ließ denselben mit aller Wucht auf die Dielen aufpoltern!‹ So, das haben Sie sich nun selbst zuzuschreiben! Denken Sie, ich bin gesonnen, mir[85] Ihre fortgesetzten Impertinenzen so ohne weiteres gefallen zu lassen? Nun machen Sie, daß Sie auf Ihren Platz kommen!«
»Aber Herr Doktor,« wimmerte Kleemüller, »man wird doch noch per Zufall einmal hinfallen können!«
»Man wird gar nichts!« entgegnete Hähnle zermalmend, und Kleemüller setzte sich langsam auf seinen Platz.
Der beklagenswerte Lehrer trug sich von diesem Moment an wochenlang mit dem Bewußtsein, ein Exempel statuiert zu haben.
Ein »Unglücksfall« von höchst folgenschwerer Bedeutung war das unerwartete Erscheinen einer Wespe.
Kleemüller, der sehr nervös war, und einige gleichgesinnte Kollegen gebärdeten sich dann jedesmal wie Pensionsdämchen beim Anblick einer Ratte, und die übrigen, von christlichem Mitgefühl übermannt, improvisierten eine Jagd der ausgelassensten Art. Man warf Rosts deutsch-griechisches Wörterbuch nach dem Eindringling, ohne sich darum zu kümmern, daß der dickleibige Quartband ganz in der Nähe des Katheders niederfiel … Man operierte mit Kappen und Taschentüchern und griff in der Hitze des Gefechts sogar nach dem Hut des Lehrers, ohne die Einsprache des geängstigten Eigentümers zu beachten. Solche Jagden nahmen in der Regel eine volle Viertelstunde in Anspruch. Wenn sie zu Ende waren, machte Hähnle seiner Erbitterung dadurch Luft, daß er sich, wie bei dem »Unglücksfall« mit dem Knüppel, an Heppenheimer wandte und im Diarium die Tatsache konstatieren ließ: eine Wespe sei während der Lehrstunde durch das Schulzimmer geflogen und von verschiedenen Schülern unter Herbeiführung mehrfacher Störungen verfolgt worden.
Hiermit hatte er seinem pädagogischen Gewissen in jeder Beziehung Genüge getan. Dieses Tagebuch spielte überhaupt in dem Leben Doktor Hähnles eine denkwürdige Rolle. Er befahl all seine Wege und was sein Herz kränkte der treuen Vaterpflege dieses Institutes, ohne daß es uns jemals klar geworden wäre, was seine Eintragungen füglich bezweckten.
Eines Tages warf einer meiner Freunde in demselben Moment, da Doktor Hähnle die Blicke in sein Notizbuch heftete, um eine kritische Note einzuschreiben, mit geschickter Fingerelastik eine Knallerbse[86] in die Luft, die in der Nähe des Katheders niederfiel und den unglücklichen Schulmann nicht wenig erschreckte.
Sofort wußte er, wo er seine Seele zu erleichtern hatte.
»Heppenheimer,« schrie er, noch bleich vor Schreck und Aufregung, »schreiben Sie mal ins Tagebuch: ›Eine Knallerbse fiel in der Nähe des Katheders nieder und zerplatzte.‹«
In der folgenden Stunde ereignete sich die überraschende Explosion aufs neue. Doktor Hähnle verschmähte nicht, der Wiederholung seines Schreckens durch folgende Tagebuchnotiz Ausdruck zu verleihen:
»Abermals fiel eine Knallerbse in der Nähe des Katheders nieder und zerplatzte.«
Dieses »Abermals« entlockte der jugendlichen Versammlung, die ein sehr lebhaftes Gefühl für unfreiwillige Komik besaß, ein wieherndes Gelächter, das Herrn Doktor Hähnle bei einiger Fähigkeit des Urteils hätte belehren müssen, wie wenig diese amtlichen Bestätigungen seiner eigenen Schande geeignet waren, den erstorbenen Respekt im Busen der Schuljugend neu zu beleben.
Was war die Folge dieses »Abermals«?
Wir wären keine Vollblut-Sekundaner gewesen, wenn wir nicht den Versuch gemacht hätten, ob Doktor Hähnle nicht auch zum drittenmal auf den Leim gehen würde. Leider schlug dieser Versuch infolge des Umstandes fehl, daß die Freude an dem Zerspringen der kleinen Orsinibomben bereits zu beträchtliche Dimensionen angenommen hatte. Ehe noch Doktor Hähnle seinem Heppenheimer zurufen konnte: »Zum drittenmal …«, – hatte sich bereits das vierte, fünfte und sechste Mal an den verschiedensten Punkten des Schulzimmers ereignet, und während der verzweifelte Pädagoge nach den hinteren Bänken rannte, um die verborgenen Angreifer zu entdecken, sandten ihm die Schüler der vorderen Bänke einen ganzen Hagel dieser Wurfgeschosse in den Rücken, so daß er nach einigen krampfhaften Wendungen die Arme schlaff am Körper herabsinken ließ, als wollte er sagen: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen! Nie wieder habe ich eine so klägliche Szene erlebt, wie dieses innerliche Zusammenbrechen des knallerbsenüberwältigten Virgil-Interpreten. In diesem Moment ergriff uns[87] etwas wie Mitleid. Wir erkannten, daß Doktor Hähnle eigentlich für die normale Ungezogenheit eines Sekundaners zu schmächtig war: dieser Mann gehörte nach Sexta.
Der beweinenswerte Lehrer schien selbst etwas von der Wahrheit dieser Erwägung zu fühlen: das Bewußtsein, es müsse etwas geschehen, riß ihn mit einemmal aus seiner Erstarrung empor. Er warf sich in Positur, hob die Faust und schrie mit geller Stimme:
»Ihr miserablen Buben! Ich habe mich nie vor Männern gefürchtet, meint Ihr, ich fürchtete mich vor Euch?«
Ungeheure Heiterkeit war die Antwort auf diese verunglückte Apostrophe.
Mit einemmal nahm Hähnle die Haltung eines Mannes an, der mit sich und seinen Entschlüssen im reinen ist. Er wandelte majestätischen Schrittes nach dem Tisch, wo sein Hut lag, stülpte die Kopfbedeckung mit einer energischen Handbewegung über das Haupt und faltete dann die Arme vor der Brust.
»So,« sagte er, »nun mag Euch Stunde halten, wer will! Ich gehe jetzt zum Herrn Direktor.«
Die ganze Klasse wälzte sich fast vor Vergnügen. Doktor Hähnle aber warf uns noch einen Blick der grenzenlosesten Verachtung zu und eilte dann hinaus, die Tür heftig ins Schloß werfend.
Sofort herrschte in den Räumen der Sekunda eine ganz erträgliche Ruhe. Einer von uns stand auf und eilte dem Verschwundenen nach.
Doktor Hähnle hatte seinen furchtbaren Entschluß in der Tat verwirklicht; er war zum Direktor gegangen, hatte gemeldet, daß die Sekunda in offener Rebellion begriffen sei, und die Zusage einer exemplarischen Ahndung erhalten.
Das Verhängnis sollte nicht lange auf sich warten lassen. Die nächsten acht Tage waren fast ausschließlich einer umfassenden Untersuchung gewidmet, an der sich das ganze Lehrerkollegium beteiligte. Im Anfang blieben die Bemühungen unserer Inquisitoren absolut fruchtlos. Die Sekundaner bezeugten einstimmig, daß im ganzen nur zwei Knallerbsen zur Explosion gelangt seien, und daß der Täter in einem gewissen Heinsius gesucht werden müsse, der zwei Tage nach dem bedeutsamen Ereignis das Gymnasium für[88] immer verlassen hatte, um nach Amerika überzusiedeln. Schon gewann es den Anschein, als würde unsere Effronterie, verbunden mit der Leichtgläubigkeit unserer Lehrer, diesmal den Sieg davontragen: aber siehe da, es fand sich ein braver, gesitteter Schüler, der den Verräter spielte. Ich und fünf andere der hervorragendsten Frevler wurden von diesem verkappten Mouchard bei der Direktion angezeigt – ein Zwischenfall, der dem Gange der Untersuchung eine wesentlich neue Richtung gab.
Der Reihe nach in das Zimmer des Direktors beschieden, verharrten wir zunächst bei unserer Aussage, daß Heinsius die Knallerbsen geschleudert habe; ungünstige Konstellationen zwangen uns indes nach kurzer Frist ein »reumütiges« Geständnis ab.
Samuel Heinzerling nahm alles mit hochwichtiger Amtsmiene zu Protokoll. Über die Art und Weise, wie wir beim Schleudern der Knallerbsen zu Werke gegangen seien, hatte ich mit dem ernsten Gymnasialfürsten eine anderthalbstündige Unterredung. Er wollte absolut nicht glauben, daß es möglich sei, diese Schleuderung lediglich mit den Fingern zu bewerkstelligen, und fügte seinen hierauf bezüglichen Zweifeln jedesmal die Bemerkung hinzu, daß fortgesetztes Leugnen »onsere Lage nor verschlämmern könne«. Erst als ich mich erbot, den Herrn Direktor durch den Augenschein zu belehren, wie vollkommen es möglich sei, durch eine kräftige Bewegung des Handgelenkes die erforderliche Wurfgeschwindigkeit zu erreichen, gab sich der Skeptiker mit der Bemerkung: »Non, wär wollen das dahingestellt sein lassen«, zufrieden.
Das Endresultat dieses unvergeßlichen Abenteuers war für sämtliche Teilnehmer in hohem Grade verhängnisvoll. Zwei von uns wurden relegiert, wir übrigen erhielten Karzerstrafen bis zu zehn Tagen, und Doktor Hähnle ward von dem Unterricht in Sekunda »auf sein Ansuchen« entbunden. Ein Vierteljahr später las man in dem großherzoglichen Regierungsblatt, daß Doktor Ephraim Hähnle in Anerkennung seiner langjährigen Dienste pensioniert worden sei.
Wer erkennt nicht den tieferen Sinn, der in dieser knabenhaften Rebellion gegen einen unfähigen Pädagogen liegt? Ein ohnmächtiger Lehrer ist gerade dem mutwilligsten und ausgelassensten[89] Schüler a priori ein Greuel, denn die Schwäche scheint seine Unarten in einer Weise herauszufordern, die seinen Stolz beleidigt. Es ist kein Verdienst, da Exzesse zu begehen, wo die Straflosigkeit so gut wie gewiß erscheint; auch soll der Exzeß nicht die Regel sein, weil er sonst viel von seinem eigentlichen Reiz einbüßt. Doktor Hähnle ward gestürzt wie eine unfähige Regierung, und jede Regierung, der die Revolution über den Kopf wächst, erleidet genau das, was ihr gebührt.
In Prima benahmen wir uns schon aus eigenem Antrieb gesetzter, ganz abgesehen davon, daß sich unter den Lehrern der Prima kein Hähnle befand. Die originellste Figur war hier ohne Zweifel der Direktor Samuel Heinzerling, ein jovialer, den Regungen des Humors nicht unzugänglicher Mann, der sich einer allgemeinen Beliebtheit erfreute. Wir nannten ihn Pater und sagten ihm am Schlusse unserer lateinischen Aufsätze alle erdenklichen Schmeicheleien, die der »rector gymnasii illustrissimus, justissimus, dilectissimus«, wie er in solchen Hymnen gewöhnlich qualifiziert wurde, ganz beifällig aufnahm und mit einem »Valde placet« am Rande der Arbeit belohnte.
Nur eine schwache Seite hatte dieser vortreffliche Pädagoge: er litt nämlich an dem Vorurteil, ein gerechter und vollkommener Primaner müsse des Morgens präzis mit dem Glockenschlage auf seinem Platze sein. Nun ist es eine erfahrungsgemäße Tatsache, daß die Freuden des Morgenschlummers um so entschiedener gewürdigt werden, je mehr sich der Mensch innerlich und äußerlich entwickelt; und ich insbesondere war bereits in Unterprima ein unversöhnlicher Gegner des altklassischen Wahlspruches: Aurora musis amica.
Noch jetzt empfinde ich, wenn ich mich vorübergehend in meiner Vaterstadt aufhalte und des Morgens um drei Viertel auf sieben den Schall des kleinen bimmelnden Glöckchens vernehme, das die Munizipalität eigens für die Bedürfnisse der Schulen auf dem Stadtkirchturme angebracht hat, ein dunkles, beklemmendes Unbehagen, das mir im Anfang durchaus rätselhaft erscheint, bis ich mir darüber klar werde, daß es die Erinnerung an meine Primanerzeit ist, die mir diese Gefühle im Busen zeitigt.
Es war doch eine peinliche Situation …! Man lag, von den köstlichen Armen eines jugendkräftigen Schlafes umfangen, sorg- und ahnungslos auf der Matratze und träumte von Hulda, der schwarzäugigen Schauspielerin, die des Tags zuvor im Linkerschen Saale so unvergleichlich die Anna-Liese gespielt hatte, oder von Pauline, der blonden Tochter des Stadtpredigers: da mit einemmal erscholl die klappernde Monotonie dieses verwünschten metallenen Weckers, und die duftigen Phantasiebilder zerflossen in Rauch vor dem unbarmherzigen Tageslichte der Wirklichkeit. Im Traume vielleicht ein König, ein Gott, sah man sich jetzt wieder zum Sklaven der Stunde herabgewürdigt; der Zwang des Müssens trat in qualvoller Zudringlichkeit an uns heran und legte uns die eisernen Hände aufs Herz, so daß es tief gedemütigt in sich zusammenschauerte.
Es begann nun jener stets von neuem auszufechtende Kampf zwischen der Neigung und der Pflicht. Man dehnte und streckte sich, als wolle man die Freuden der zwei, drei Stunden, die man unter anderen Umständen noch verträumt und verdämmert hätte, gleichsam im Extrakt genießen. Man legte sich »noch für zehn Minuten« auf die andere Seite, um schon nach Ablauf von dreißig Sekunden emporzufahren und nach der Zeit zu sehen. Man beneidete seinen älteren Bruder, der Student war und jeden Morgen bis elf Uhr in den Federn blieb. Man fluchte der irrationellen Einrichtung des Stundenplans, der die Klufenbrecherschen Auseinandersetzungen über Mathematik recht gut auf eine passendere Zeit hätte verlegen können, und schwur sich, sobald man das Gymnasium hinter sich habe, das Versäumte mit aller Macht nachzuholen.
Unterdessen verstrich eine Viertelstunde, und von neuem hob der entsetzliche Klöppel auf dem Stadtkirchturme zu wimmern an. Jetzt sprang man mit gleichen Füßen aus dem Bett und kleidete sich mit einer Geschwindigkeit an, die uns seitdem zum Mythus geworden ist. Nach Verlauf von fünf Minuten war man im Freien: den Kaffee hatte man wie ein hastiges Stehseidel hinunter gestürzt, und die Semmel pflegte man sich ohnehin zum behaglichen Verbrauch während der Lehrstunden aufzusparen.
So schnell man jedoch hier zu operieren wußte, die verlorene Viertelstunde konnte nicht wieder eingebracht werden, und so kam[91] man denn regelmäßig um zehn, ja selbst fünfzehn und zwanzig Minuten zu spät.
Unser Direktor fand dieses Zuspätkommen empörend. Er hatte, um dem immer bedrohlicher um sich greifenden Mißbrauche energisch zu steuern, die Anordnung getroffen, daß jeder, der ohne genügende Entschuldigung den Beginn der Lehrstunden versäume, mit dem Vermerk »zu spät gekommen« notiert würde, und daß jeder, der innerhalb einer Woche zweimal notiert worden sei, einen Tag lang in den Räumen des Karzers über die Pflichten des Primaners nachzudenken habe.
Da ich auch ohne diesen Extrazuschuß oft genug meiner Freiheit beraubt wurde, so strengte ich alle Kräfte an, um der peinvollen Eventualität einer doppelten Notierung vorzubeugen, und zu diesem Zweck bedurfte ich einer Reihe genügender Entschuldigungen, deren Beitreibung meinen ganzen Scharfsinn in Anspruch nahm.
Zum Glück war der Direktor keine skeptische Natur. Er ließ selbst das Unwahrscheinliche, wenn es mit einer gewissen Keckheit vorgetragen wurde, unbeanstandet passieren. Ich hatte mir im Laufe der Semester eine solche Virtuosität der Erfindung angeeignet, daß ich am Schluß meiner Gymnasiallaufbahn nahe daran war, ein »Leichtfaßliches Entschuldigungshandbuch für Gymnasiasten und Realschüler« zusammenzustellen, das ohne Zweifel ein ebenso dankbares als zahlreiches Publikum gefunden hätte. Ich will an dieser Stelle einige der wirksamsten Entschuldigungen planlos aneinander reihen, um so dem dulce doch wenigstens einen Gran von utile beizumischen. Vielleicht sieht sich ein deutscher Verleger bei der Lektüre dieser Zeilen veranlaßt, mich zur Ausarbeitung des damals projektierten Werkes nachträglich aufzufordern. Gefällige Anträge erbitte ich direkt unter meiner Adresse.
Einer der wichtigsten Faktoren im Gebiete der Gymnasialentschuldigungen ist der Onkel. Ein Gymnasiast kann sich gar nicht genug Onkels halten. Ein Onkel ist in jeder Beziehung verwendbar namentlich aber für das Zuspätkommen:
»Ich mußte meinen Onkel an den Bahnhof begleiten.«
»Mein Onkel hatte einen Schlaganfall.«
»Mein Onkel feiert heute seinen fünfundsechzigsten Geburtstag.«
»Mein Onkel aus Havelberg ist angekommen.«
NB. Ist der Onkel aus Havelberg einigermaßen mit dem Gymnasialdirektor bekannt, so fügt man hinzu:
»Er läßt auch schönstens grüßen, und wenn sein Aufenthalt nicht gar zu kurz wäre, würde er sich die Ehre geben.«
Bei Samuel Heinzerling waren diese Onkel-Entschuldigungen stets von augenblicklicher Wirkung.
»Non, es äst goot«, sagte er befriedigt lächelnd. Nur wenn ich in der Zerstreutheit die frohe Botschaft von der Ankunft meines Onkels aus Havelberg an zwei aufeinander folgenden Tagen zum besten gab, wagte er die überraschte Bemerkung:
»Schon wäder? Ähr Onkel scheint aber auch recht väl zo reisen!«
Ich erkannte sofort meinen Irrtum, sagte jedoch so unbefangen als möglich:
»O ja, Gott sei Dank, er ist noch recht rüstig.«
Es versteht sich von selbst, daß unter Umständen auch Tanten in gleicher Richtung verbraucht werden können. Hier empfiehlt es sich, von Zeit zu Zeit eine Kindtaufe zu erfinden oder aber, falls man die Anwendung unvermählter Tanten vorzieht, hysterische Krämpfe in Ansatz zu bringen.
Wenn ich die verwandtschaftlichen Beziehungen hinlänglich in Kontribution gesetzt hatte, griff ich in das Kapitel gewisser häuslicher Vorkommnisse und beantwortete die Frage des Direktors: »Warum kommen Sie zu spät?« mit der schlagenden Bemerkung:
»Mein Waschwasser war gefroren.«
Oder:
»Unsere Köchin hat sich verschlafen.«
Oder:
»Meine Uhr ging falsch.«
Alle diese Entgegnungen fand der Direktor vollkommen »genügend« – ich hätte denn die Unvorsichtigkeit begehen müssen, die Mär von dem gefrorenen Waschwasser in den Hundstagen vorzubringen.
In Oberprima, wo ich die ersten Spuren eines sprossenden Bartes zu verzeichnen hatte, behauptete ich sogar einmal, mein Barbier habe sich verspätet.
»So?« fragte der Direktor. »Non, äch dächte, in Ährem Alter brauchte man säch noch nächt rasären zo lassen! Wä äch so alt war, dachte äch nämals an dergleichen Allotria. Öbrigens, Sä haben ja noch Ähren ganzen Anflug von Bart äm Gesächt stehen. Wo haben Sä säch denn rasären lassen?«
»Herr Direktor, das ist es ja gerade. Ich habe mich eben nicht rasieren lassen, und deswegen steht der Bart noch. Heute war mein Rasiertag. Jedesmal den fünfzehnten lasse ich mich rasieren.«
»Non, es mag goot sein! Sagen Sä Ährem Barbär, er soll in Zokonft zeitiger kommen: wär können här nächt auf ähn warten.«
Und hiermit nahm ich freudestrahlend meinen Platz ein.
Als weitere Entschuldigungen führe ich nur noch kurz die nachstehenden an:
»Ich fiel, zerriß mir die Beinkleider und mußte wieder umkehren.« – »Ich ward beim Vorübergehen an einem Hause der Kreuzstraße mit einer eigentümlichen Flüssigkeit begossen etc.« – »Ich bekam eine Ohnmacht.« – »Auf dem Sandwege war die Passage durch drei ineinander gefahrene Wagen versperrt. Ich mußte daher den Umweg über die neue Kurstraße und den Kommandantenplatz nehmen.« – »Ich wurde irrtümlich verhaftet.« – »Ich habe mir den Fuß verstaucht.« – »Es war Glatteis.«
Bei dieser letzten Phrase wird sich der Lehrer naturgemäß wundern, daß er von einer so unverkennbaren Naturerscheinung nichts gemerkt habe.
»So?« wird er fragen. »War Glatteis?«
Die Mitschüler ermangeln nicht, diese Frage unbedingt zu bejahen.
»Das heißt,« fügt nun der zu spät gekommene Schüler hinzu, »nur an einzelnen Stellen. Sie sind vielleicht über den Hohlweg und am Rathaus vorübergegangen; dort ist die Temperatur in der Regel um einige Grad höher als in den feuchteren Gegenden an der Seltersgasse und dem Waldtore.«
Während der Monate Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März und April wird der Lehrer kaum Anstand nehmen, diese klimatologische Bemerkung als letztes Wort gelten zu lassen.
Unser trefflicher, unvergeßlicher Direktor hatte es sich selbst zuzuschreiben, wenn seine Schüler auf diese Weise Fortschritte im Gebiete der Unwahrheit machten. Warum haftete er mit so eigensinniger Starrköpfigkeit an dem Prinzip des einzuhaltenden Glockenschlages? Gern hätten wir uns auf das Kompromiß des akademischen Viertels eingelassen; aber da sich die Gymnasialregierung absolut weigerte, uns auch nur auf dem achten Teile des Weges entgegenzukommen, so sahen wir uns genötigt, unsere Zuflucht zu dem Mittel eines intellektuellen Schleichhandels zu nehmen, der höheren Ortes ohne Zweifel in seinem wahren Wesen erkannt, dennoch aus Opportunitätsgründen respektiert wurde.





Die Art und Weise, wie die Schüler der oberen Gymnasialklassen von den Schulgesetzen in abstracto und ihren einzelnen Lehrern in concreto behandelt werden, hat, streng genommen, etwas Naives, denn sie basiert auf Voraussetzungen, die eine merkwürdige Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse bekunden. Es waltet hier teils der himmelschreiendste Irrtum, teils der unbegreiflichste Optimismus vor. Die ernsten Männer, die in ihrer Eigenschaft als Oberstudienräte die Zusammenstellung jener Gesetzesparagraphen beaufsichtigt haben, verstanden sehr viel von der theoretischen Pflicht, aber sehr wenig von dem praktischen Leben. Das moderne Gymnasialgesetz verwechselt den Begriff einer öffentlichen Lehranstalt, die nur zu gewissen Stunden besucht wird, mit dem eines Pensionats, das die Schüler sozusagen mit Leib und Seele aufnimmt und nicht allein ihren Unterricht, sondern ihre moralische und gesellschaftliche Erziehung leitet. Es ist lächerlich, die Befugnisse des Gymnasiums in der angedeuteten Richtung zu erweitern, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil seine Mittel nicht zur Durchführung ausreichen. Wo die Kontrolle fehlt, da ist alles Befehlen und Verbieten ein zweischneidiges Schwert. Anstatt sich also damit zu begnügen, den Gymnasiasten während der Lehrstunden im Zaume zu halten, ihm gelegentlich die christlichen Tugenden einzuprägen und die Norm aufzustellen: Sobald du irgendwie einen öffentlichen Skandal erregst, gleichviel durch welche Handlung, so wanderst du auf den Karzer, – anstatt sich dieser klugen Reserve zu befleißigen, mischt sich das Gymnasium in Dinge, die nicht nur[97] über seine vernunftgemäßen Befugnisse, sondern in der Regel sogar über die Möglichkeit einer Beaufsichtigung weit hinausgehen.
So erklärt die Gymnasialordnung das Besuchen von Wirtshäusern für unmoralisch und ahndet die Zuwiderhandlung mit mehr oder minder beträchtlichen Freiheitsstrafen. Was man bei diesem Verbot beabsichtigt, liegt klar zutage: nicht den Wirtshausbesuch an sich, sondern den daraus erwachsenden Mißbrauch wolle man hintertreiben. Naiv und idealistisch wie sie sind, glauben die Oberstudienräte diesen Zweck durch ein Radikalverbot zu erreichen; aber sie haben nur eins erreicht: der anständige Gebrauch eines an sich harmlosen Instituts ward zum Verbrechen gestempelt, ohne daß der unanständige Gebrauch, der Mißbrauch, ernstlich verringert würde. In der Tat läßt sich nicht absehen, warum es für den achtzehnjährigen Primaner eine Sünde sein soll, gelegentlich ein Glas Bier zu trinken, während der Kommis schon in früheren Jahren das gleiche leistet, ohne darum die Achtung seiner Mitbürger einzubüßen. Weit richtiger und wirkungsvoller würde es sein, wenn das Gymnasium den allgemeinen Grundsatz aufstellte: »Benehmt Euch anständig!« – ohne weiter auf die Details einzugehen. In jedem einzelnen Falle würde dann das freie Ermessen des Lehrers darüber entscheiden, ob dieses erste und vornehmste Gebot des Gymnasiasten befolgt oder verletzt worden wäre. Ein solcher Appell an das Taktgefühl der jungen Leute bei theoretischer Anerkennung ihrer unbedingten Selbständigkeit müßte auch moralisch von ungleich günstigeren Erfolgen sein, als die alberne und demütigende Methode, die jetzt noch vielfach im Schwunge ist.
Der Bierparagraph war auch mir in den Tagen meiner Gymnasiastenschaft ein fortwährender Grund des Verdrusses und der Erbitterung. Wenn ich so an heißen Juliabenden bei den Hecken des Lohseschen Felsenkellers vorüber kam und den Direktor Samuel Heinzerling erblickte, wie er im Kreise seiner zahlreichen Familie ein Seidel nach dem andern hinter die schwarze Krawatte goß, so war mir zu Mut wie einem Pariser Vorstadtbewohner, der im zerlumpten Kittel durch das Bois de Boulogne schlendert und die prunkvollen Equipagen des Quartier Saint Germain vorbeieilen sieht. Warum schwelgte dieser graue Epikuräer im vollen, während[98] ich, ein Kind der Entbehrung, fernab an der Böschung stand und meine Sehnsucht bändigen mußte? Wäre ich jetzt kühnlich auf die Plattform gewandert, hätte ich unbekümmert um Samuel und seine Töchter Ismene, Winfriede, Laura und Vitriaria vor einem der braun gestrichenen Tische Platz genommen und einen Schnitt bestellt, so war mein Schicksal besiegelt. Am andern Morgen hätte der strenge Autokrat mich in folgender Weise apostrophiert:
»Eckstein! Sä waren mer gestern wäder mal auf dem Felsenkeller! Sä haben dä Ongeböhrlichkeit Ähres Benehmens so weit geträben, daß Sä sogar, ohngeachtet Sä mäch bemerkt haben, einen Schnätt bestellten. Sä gehen mer zwei Tage auf den Karzer! Knebel, schreiben Sä änmal äns Tagebooch: Eckstein, weil er än einem öffentlichen Bärlokal einen Schnätt bestellte, mit zwei Tagen Karzer bestraft. Heppenheimer, rofen Sä den Pedellen!«
Das sieht fast wie ein tableau chargé aus, aber es ist eine Photographie, streng nach der Natur. Samuel Heinzerling hatte nur selten das Glück, einen Schüler wegen »Wärtshausbesochs« abzufassen, denn wir kannten die Lokale, die er zu frequentieren pflegte, und vermieden sie: aber wenn er einen ertappte, so übte der rector illustrissimus in der oben geschilderten Weise Justiz, und die Form seines »Eintrags« im »Tagebooch« variierte nur wenig. Niemals ist es erhört worden, daß er einem kneipenden Schüler die Strafe erlassen hätte; es war, als fürchte er, der Durst seiner Primaner könnte die Befriedigung seines eigenen Durstes in Frage stellen, wie er denn in der Tat stets in den Herbstmonaten, wenn das sogenannte Salvatorbier ausgetrunken und durch eine geringere, später gebraute Sorte ersetzt war, düsterer und grämlicher dreinschaute als in der eigentlichen Saison.
Trotz dieser exklusiven Richtung unseres Direktors zechten wir schon in Sekunda ganz wacker. Wir hatten eine Stammkneipe, deren Inhaber, von der Ungehörigkeit der Gymnasialgesetze im tiefsten Innern durchdrungen, alles anstrebte, um uns das Joch unserer Schülerschaft nach Möglichkeit zu erleichtern. Leider bot sein Lokal nicht unbedingte Sicherheit, da sich mitunter auch ein Lehrer in diese traulichen Räume verirrte. Der alte Lorenz wußte uns in solchen Fällen rechtzeitig von der drohenden Gefahr zu[99] verständigen. Es war hergebracht, daß wir vor dem Eintreten an den Schalter klopften. Lorenz zog dann die Klappe weg und grinste. Dieses Grinsen bedeutete so viel als: die Luft ist rein. War Lorenz nicht am Faß tätig, so versah einer von seinen Söhnen das Amt des Schenkwirts interimistisch, und diese Söhne bewerkstelligten jenes orientierende Grinsen weit unzuverlässiger als der Vater; daher es sich denn hin und wieder ereignete, daß wir unseren Peinigern ahnungslos in die offenen Arme liefen.
Eines Nachmittags – es war im August des Jahres 18** – hatte uns Samuel Heinzerling durch eine furchtbare Auseinandersetzung über das Wesen des lateinischen Konjunktivs gemartert und am Schlusse seiner Rede ein neues Thema für den lateinischen Aufsatz gegeben: »Quaeritur utrum Alexander dignus fuerit cognomine Magni necne.« Am Schlusse der Lehrstunde verspürte ich einen unwiderstehlichen Durst, und mein Freund Wilhelm Rumpf teilte diese Empfindungen, so daß er meinen Vorschlag, in der Schenke des alten Lorenz ein Seidel zu schlürfen, ohne weiteres genehmigte. Arm in Arm schritten wir über den Ludwigsplatz. Vor der Engelhardtschen Buchhandlung begegnete uns Wilhelm Rumpfs angeheirateter Onkel, ein liebenswürdiger alter Herr, der gern seinen Spaß mit uns trieb und auch heut nicht umhin konnte, uns mit einer scherzhaften Phrase dingfest zu machen. Wir kannten zwar die humoristischen Redensarten des Onkels seit lange auswendig; aber die selbstgefällige Freude, mit der er sie immer und immer wieder vortrug, verfehlte nie ihre Wirkung. Besonders tiefsinnig schien ihm der anachronistische Scherz von den Kanonen des Hannibal, und er besaß ein bewundernswürdiges Talent, von jedem beliebigen Gesprächsthema auf dieses Bonmot abzulenken. – Als er uns nach längerer Kauserie wieder freigab, hatte unser Durst gewaltige Dimensionen angenommen, und im Geschwindschritt eilten wir der Stätte zu, wo wir so oft gegen die Paragraphen des Gymnasialgesetzes gefrevelt hatten.
Wir klopften an den Schalter. Der alte Lorenz war diesmal wieder »dienstlich verhindert«, und sein ältester Sohn Fritz stand vor dem Schenktische.
Der Bursche warf uns einen beruhigenden Blick zu, und so schritten wir denn ahnungslos ins Lokal und suchten mit jener[100] prüfenden Unsicherheit, die jedem Neueintretenden eigen ist, nach einem Tische, um uns niederzulassen.
Da – wer beschreibt unser Erstaunen, unsere Verwirrung, als wir in der entferntesten Ecke des langen, bandartigen Kneipzimmers die nur allzu wohlbekannte Gestalt Samuel Heinzerlings wahrnahmen! Der Vortrag über den lateinischen Konjunktiv schien nicht allein uns durstig gemacht zu haben, denn das Seidel, das der Direktor vor sich stehen hatte, war bis auf einen traurigen Rest ausgeschlürft. Samuels Angesicht glühte in dunkler Röte. Ich schwankte, ob ich dies Echauffement der Glut des Augusttages oder dem Zorn über unser vermessenes Eintreten zuschreiben sollte: beide Umstände mochten in gleicher Weise mitgewirkt haben. Ich ergab mich schon stillschweigend in mein Schicksal. Die zwei Tage Karzer dünkten mir ebenso unvermeidlich, wie dem Delinquenten, der unter dem Fallbeil liegt, die Enthauptung. Auch Samuel Heinzerling schien von der Notwendigkeit dieser Lösung durchdrungen, denn jetzt spielte um seine Lippen ein halb verdrießliches, halb siegesgewisses Lächeln, und mit grimmigem Finger rückte er an der großen rundglasigen Brille.
Aber wir hatten die Rechnung ohne Wilhelm Rumpf gemacht. Ehe ich noch ahnte, was er vor hatte, faßt er mich am Arm, und sagte mit einer Stimme, in der die Fülle der höchsten seelischen Genugtuung widerklang:
»Komm, da sitzt ja der Herr Direktor! So habe ich mich doch nicht getäuscht.«
Samuel Heinzerling starrte uns an, als habe die Vermessenheit Rumpfs ihn versteinert.
»Wälhelm« aber schritt kühn auf ihn zu, zog die Mütze und verneigte sich mit einem artig gelispelten: »Guten Tag, Herr Direktor, verzeihen Sie gütigst, wenn wir Sie stören!«
»Rompf, was onterstehn Sä sich?«
»Entschuldigen Sie gütigst«, stammelte Rumpf mit verbindlichem Lächeln.
»Was haben Sä här zo sochen? Äch kann mer schon denken, was för Nächtsnotzigkeiten Sä wäder auf'm Korn haben!«
»Ich habe Sie auf dem Korn, Herr Direktor. Ich wollte mir nur die ganz ergebene Frage erlauben, ob wir den Aufsatz: »Quaeritur[101] utrum Alexander dignus fuerit cognomine Magni necne« auch in Dialogform behandeln dürfen. Mein Freund da behauptet, nein; ich aber bin in der Ansicht, daß diese Form sich ganz besonders für ein derartiges Thema eignet, denn, sagen Sie selbst, Herr Direktor: wenn man so die Tugenden und die Laster Alexanders des Großen gegeneinander abwägen will, so ergibt es sich ganz natürlich, daß man jede dieser verschiedenen Auffassungen eine Person substituiert. Hat nicht z. B. Lessing in seinem Gespräche über Freimaurerei …«
»Schon goot!« unterbrach ihn Samuel Heinzerling.
»Wir dürfen's also in Dialogform behandeln?« fuhr Wilhelm Rumpf fort. »Ich wollte mich doch gleich vergewissern. Wir sahen Sie da eben hereintreten, und da ich die Absicht habe, noch heute Abend an die Disposition zu gehen …«
»Rompf, Sä sänd ein Schelm; aber es läßt säch nächt leugnen, Sä haben säch got herausgebässen. Än Zokonft warten Sä mer höbsch draußen, bäs äch wäder hänaus komme. So lange hat Ähre Däsposätion wohl Zeit. Kennen Sä nächt dä Vorschräft des Gämnasialgesetzes, daß es den Schölern onserer Anstalt verboten äst, öffentläche Lokale zo besochen?«
»Entschuldigen Sie, Herr Direktor,« sagte Rumpf im Tone eines Gekränkten, »es ist den Schülern verboten, die Lokale allein zu besuchen; wenn sie aber wissen, daß sie innerhalb dieser Lokale einen Lehrer oder gar den Direktor der Anstalt treffen, so scheint es mir den Gesetzen des Gymnasiums durchaus nicht zuwider zu laufen, wenn man in der Absicht einer wissenschaftlichen Anfrage …«
»Schwätzen Sä säch den Hals nächt noch trockener, als er schon äst! Äch wäderhole Ähnen, Sä haben säch got herausgebässen, ond non wäll äch Ähnen erlauben, daß Sä mät Anstand än Glas Bär tränken. Hören Sä? Aber nor ein Glas: von där däalogischen Form wollen wär än däsem Falle absehen.«
»Herr Direktor sind zu gütig, aber ich versichere Sie, wir dachten durchaus nicht …«
»Frätz!« unterbrach ihn Samuel Heinzerling, »brängen Sä mal drei Seidel! So, ond non lassen Sä säch's got schmecken. Wahrhaftig Rompf, wenn Sä änmal später än den Verhältnissen des[102] börgerlichen Lebens so väl Geistesgegenwart an den Tag legen, wä jetzt bei Ähren leider nor zo oft wäderholten Lompenstreichen, so werden Sä ein beröhmter Mann werden.«
Wir nahmen Platz und ließen uns das unter so gefährlichen Umständen erworbene Bier trefflich munden. Nach Verlauf von zehn Minuten erhob sich unser jovial-liebenswürdiger Direktor vom Sitze, was für uns natürlich das Signal war, ein gleiches zu tun. Draußen vor dem Tore trennten wir uns. Nach zehn Schritten machte Heinzerling Kehrt.
»Non, Rompf. Sä haben ja noch keine Antwort wägen der däalogischen Behandlung? Es scheint, daß Ähre Däsposätion doch nächt so große Eile hat, wä Sä vorgeben?«
»Qui tacet, consentire videtur«, sagte Rumpf mit unerschütterlicher Gelassenheit. »Sie haben meine Frage unbeantwortet gelassen, also schließe ich daraus, daß Sie meine Ansicht billigen. Die Grundzüge des Aufsatzes habe ich mir bereits beim Bier überlegt.«
»Nochmals, Sä sänd ein Schelm,« lachte Samuel, indem er den breitkrempigen Hut in die Stirne zog. »Aber nähmen Sä säch än acht! Äch för mein Teil habe Sänn för Humor, und lasse mer ab ond zo selbst eine kleine Dommheit gefallen, wenn sä mät Grazie ond attischem Salz gewörzt ist. Äch känne jedoch Leute, dä för dä Reize der Komäk ongleich weniger empfänglich sänd! Da könnten Sä mät Ähren olämpischen Konstgräffen sehr öbel anlaufen! Danken Sä Gott, daß äch här gesässen habe: wäre äch zom Beispiel mein Schwägersohn, der Ordänarius von Obersekunda gewäsen, so hätten Sä kein Bär, sondern Cachot gekrägt! Märken Sä säch das!«
Und mit würdevoller Gelassenheit schritt er den heimischen Laren zu.



Das zierlich broschierte Heft der Gymnasialgesetze, das jedem neu aufgenommenen Schüler persönlich vom Herrn Direktor überreicht und ans Herz gelegt wurde, enthielt auch einen Paragraphen über das Tabakrauchen. Die Oberstudienräte bezeichneten dieses moderne Kulturlaster als »überaus schädlich für die Gesundheit und obendrein in hohem Grade kostspielig«, daher denn jeder Schüler der »Pflanzstätte« verpflichtet sei, ein Gelübde der Enthaltsamkeit abzulegen.
Die Wirkungen dieses Paragraphen waren der Art, daß ich der kompetenten Behörde, falls es ihr um die Förderung der Jugend ernstlich zu tun ist, den Vorschlag mache, künftighin folgende Ukase unter die Gesetzessammlung mit aufzunehmen:
»Die in hohem Grade zeitraubenden und gesundheitswidrigen Privatstudien sind jedem Schüler des Gymnasiums bei Relegation untersagt.«
»Das schweigsame Verhalten während der Lehrstunden zeugt von Stumpfsinn und wird daher dringlich verbeten.«
»Fortgesetzte Nüchternheit schädigt die Elastizität der Seele, wie schon der uralte christlich-germanische Wahlspruch beweist: ›Wer niemals einen Rausch gehabt …‹ Daher sich denn jeder Schüler mindestens dreimal wöchentlich im Zustande eines schönen, augenrollenden Wahnsinns befinden muß.«
Und so weiter.
Nach den bisherigen Erfahrungen würde man auf diesem Weg wahre Musterbilder von fleißigen, aufmerksamen und nüchternen Schülern erziehen.
Kein Kenner der einschlägigen Verhältnisse wird mir bestreiten, daß es nur das Verbot ist, was den Quartaner an die Regaliakiste und in die Kneipe führt. Ich weiß mich sehr wohl zu erinnern, daß ich ein stark gebrautes Lagerbier mit einer wahren Überwindung trank, denn es schmeckte mir heillos bitter, und eine Tasse gezuckerter Milch wäre mir hundertmal lieber gewesen: aber ich erblickte im Bier das Kriterium der Männlichkeit, und so bezwang ich mein Widerstreben und sündigte ohne jeden Genuß. Hätte man uns damals täglich drei Seidel als Pensum diktiert, ich hätte mich lieber einsperren lassen, als daß ich mich diesem Zwange in Demut gefügt hätte.
Noch entschiedener und allgemeiner gilt dies vom Rauchen. Mit wahrer Todesverachtung qualmten wir in Tertia unsere Zigarren – nur weil es verboten war! Keinem von uns wäre es im Traum beigefallen, eine so unerfreuliche Summe von Beschwerden und Üblichkeiten durchzumachen, wenn wir nicht aus jenem Gymnasial-Paragraphen die Überzeugung geschöpft hätten, es müsse dem Rauchen doch irgend ein verborgener Zauber innewohnen, der sich durch fortgesetztes Studium entdecken ließe. Das Rauchen der Gymnasiasten würde auf ganz bescheidene Dimensionen beschränkt werden, sobald jener verhängnisvolle Paragraph hinwegfiele. Man gebe die Sünde frei, – und sie hört auf, zu verlocken.
Die Epoche, in der ich am meisten gegen das Tabaksverbot frevelte, war mein Biennium in Quarta und Tertia. Wir hatten da unser sechs eine Art Tabakskollegium gegründet, das seine Sitzungen unter freiem Himmel abhielt. Durch den Wiesengrund am östlichen Ende der Stadt strömte ein Bach, von Erlen und anderem Dickicht umsäumt. Selten nur verirrte sich eines Menschen Fuß an dieses trauliche Ufer – und hier saßen wir geschart und ließen in feierlichem Ernste den Qualm unserer Zigarren zum Firmament aufsteigen. Mein Vater hatte damals von einem bösen Schuldner zweitausend Zigarren an Zahlungs Statt empfangen, die der Versicherung dieses Spekulanten zufolge unter Brüdern hundert Taler wert sein sollten, in Wirklichkeit aber ein so niederträchtiges Kraut waren, daß mein Vater sie schon auf den bloßen Geruch hin beiseite stellte. Da mir um jene Zeit jede, auch die beste Zigarre ganz abscheulich schmeckte, so waren mir diese Zahlungsobjekte trotz[105] ihrer Verwerflichkeit äußerst willkommen. Vor Beginn unseres Tabakskollegiums füllte ich mir die Taschen und regalierte dann meine Genossen mit echten Havannas. Schwarz, der sich viel auf seine Kennerschaft zugute tat, wehte sich wiederholt mit den Fingern den Rauch in die Nase und sagte bedeutsam: »Ja, die Zigarre ist gut!« – »Ein feines Blatt«, fügte Knebel hinzu. Und nun rauchten wir mit wütender Vehemenz – etwa dreimal so schnell als ein erwachsener Durchschnittsraucher. – Knebel ward immer blässer und blässer, aber er lächelte in stoischem Gleichmut und wiederholte nur zuweilen mit halb verlöschender Stimme: »Wirklich, ein sehr feines Blatt! Aber schwer!« – Noch zwei Minuten, und der Ärmste ließ die Zigarre sinken, beugte sich über das Wasser und erbrach sich so heftig, daß ihm der Angstschweiß in großen Perlen auf die fiebernde Stirn trat.
Trotz unseres kollegialischen Mitleids war uns diese Katastrophe äußerst willkommen, denn sie bot uns die Möglichkeit, ohne ein Geständnis der eigenen Schwäche die Zigarren zu beseitigen und dem stöhnenden Knebel beizuspringen. Einer von uns trat weiter oberhalb an den Bach und tauchte sein Taschentuch in die rieselnde Flut, um Knebel die Schläfe zu kühlen. Ein zweiter und ein dritter faßten den Dulder bei den Armen; ein vierter klopfte ihm beschwichtigend auf den Rücken. Die Zigarrenstummel flogen ins Wasser; Knebel erholte sich, und stolz im Selbstgefühle einer männlichen Tat begab man sich auf den Heimweg.
Unterwegs blies man sich verschiedene Male den Atem ins Gesicht und fragte:
»Du, riecht man's?«
»Noch ziemlich …«
Dann wurde Gras gekaut oder ein Apfel verzehrt, denn auch die Eltern durften von unseren Orgien nichts wissen. Noch stundenlang trugen wir die Empfindung einer gewissen Üblichkeit mit uns herum. Ja, zuweilen, wenn Schwarz ein paar wirklich schwere Zigarren mitgebracht hatte, waren wir förmlich berauscht, und alles, was um uns vorging, machte uns den Eindruck eines beklemmenden Traumes …
Und doch ertrugen wir diese Leiden mit Genugtuung, – denn die herbe Frucht war verboten!
Auch die Furcht, »abgefaßt« zu werden, steigerte unser Mißgefühl. In Quarta und Tertia bebt man wie ein scheues Mädchen vor dem Gedanken, wegen irgend einer Freveltat »eingesponnen« zu werden. Bei mir persönlich kam noch hinzu, daß ich während des Jahres in Tertia um ein Prämium kandidierte; eine »Abfassung« wegen Rauchens hätte aber dieses Prämium im Keime erstickt.
Mit welcher Ängstlichkeit hielten wir selbst an dem verborgenen Strande des Wiesenbachs Umschau, ob nicht irgend ein bedrohlicher Wanderer nahe! Einmal überraschte uns der felder- und wälderdurchstreifende Registrator Bieler so jählings, daß wir gerade noch Zeit hatten, den Brand unserer Zigarren in die weiche Erde zu drücken. Der alte Herr schien nicht wenig befremdet, hier am einsamen Quell eine Reihe von Knaben zu finden, die sich nicht einmal Blumen zum Kranze wanden, sondern in sichtlicher Verlegenheit aufsprangen und die Mützen zogen.
»Was macht Ihr denn hier?« fragte er argwöhnisch.
»Wir krebsen«, gab Schwarz mit großer Schlagfertigkeit zur Antwort.
»So, gibt's hier Krebse? Und was brennt denn da drüben?«
»Ach da«, sagte Schwarz … »Wir haben vorhin ein kleines Pulvermännchen gemacht, und da glimmt das Papier noch.«
Der Registrator entfernte sich, ohne sich über die Glaubhaftigkeit dieser Bemerkung zu äußern. Tagelang schwebten wir in heilloser Angst, er möge uns denunzieren; denn der Quartaner lebt der Meinung, die ganze Welt sei gegen ihn verschworen, und die Bürgerschaft kenne kein höheres Interesse, als ihn anzuzeigen.
So ging die Sache in Quarta und Tertia. In Sekunda wurden wir bereits frecher. Des Abends nach Sonnenuntergang bummelten wir häufig mit brennender Zigarre durch die Stadt. Anfangs gebrauchten wir die Vorsicht, das glühende Ende mit der Hand zu bedecken; später ward auch diese Reserve kühn über Bord geworfen. So begab es sich denn nicht selten, daß ein Sekundaner wegen Tabakrauchens mit Strafe belegt wurde. Wenn ich meinesteils diesem Schicksal entging, so lag das nur daran, daß ich in Sekunda über die Freude am Rauchen so ziemlich hinaus war und nicht den vierten Teil so oft »blotzte«, als in Quarta und Tertia.[107] Auch hatte ich, wenn ich extra muros gegen die Gymnasialgesetze sündigte, allzeit Glück.
Ein einziges Mal wurde ich als Sekundaner wegen öffentlichen Rauchens denunziert, aber nicht bei den Gymnasiallehrern, sondern bei dem Stadtprediger, der uns den Konfirmanden-Unterricht erteilte.
Dieser Mann, der sehr ehrwürdige Kirchenrat Doktor Philipp Jakob Engel, war in jeder Beziehung ein Original. Er hatte sich unter dem schwarzen Talar ein frisches, fröhliches Herz bewahrt. Nichts lag ihm ferner als Puritanertum und einseitiger Zelotismus. In der Weise des großen Doktor Martinus Luther genoß er sein Leben, – zum mindesten was Wein und Gesang betraf. Im Punkte des Weibes war er allerdings vom Schicksal mißhandelt, denn er hatte sich, vom Rausch der Minne verlockt, eine Wirtstochter aus Bromskirchen zur Gattin erkoren, die ihm das Dasein mehr mit Dornen als mit Rosen durchflocht. Er suchte dann in der feierlichen Stille des Wirtshauses Trost für die Leiden seiner Häuslichkeit. »Der Wind bläst heute wieder von Bromskirchen«, pflegte er den Stammgästen zuzurufen, und dann wußte man, daß der Kirchenrat nicht vor ein Uhr nachts den Heimweg antreten würde.
Doktor Engel leitete also den Konfirmanden-Unterricht, und zwar abwechselnd in dem einen Jahre den der Knaben und in dem anderen den der Mädchen. Ich hatte glücklicherweise ihn zum Seelsorger! Wer es irgend einrichten konnte, sparte sich für das Jahr Engels auf, denn das Joch dieses Gerechten war sanft und schmerzlos. Der Unterricht fand von elf bis zwölf statt. Kurz vor halb erschien der Herr Kirchenrat langsamen Schrittes im Lehrsaale, wandelte wohl noch fünf Minuten lang, in Gedanken verloren, auf und ab und begann dann mit einer kurzen Wendung, deren feierliches Phlegma gegen sein sonstiges Feuer wunderbar kontrastierte, die Gesangbuchverse zu überhören. Human wie er war, nahm er nie den geringsten Anstoß daran, daß man diese Gesangbuchverse einfach ablas. Nachdem die Aufgabe zur beiderseitigen Befriedigung erledigt war, schritt er an das Abfragen der Katechismussprüche, die wir ebenfalls ganz unverfroren vom Blatte wegstahlen.
»Nun, und was denkst Du Dir bei diesem Spruche?« forschte er dann wohl gelegentlich.
Der Schüler gab eine Antwort, die mit einem langsamen »Ganz gut!« belohnt wurde, wenn sie nur einigermaßen verdaulich war. Im andern Falle meinte der Kirchenrat, das lasse sich wohl hören, sei aber doch nicht so ganz richtig – und nun lieferte er mit salbungsvollem Behagen die korrekte Erklärung. Fünf Minuten vor drei Viertel sah er zum erstenmal auf die Uhr, zwei Minuten später zum zweitenmal. Um drei Viertel aber stemmte er die rundlichen Finger auf die Tischplatte und murmelte durch die Zähne:
»So, ich habe jetzt noch ein Amtsgeschäft, und da wollen wir's denn für heute gut sein lassen. Für das nächste Mal lernt Ihr mir den folgenden Vers und die folgenden Sprüche.«
Und hiermit verließ er das Lehrzimmer.
Was das für Amtsgeschäfte waren, die so regelmäßig um drei Viertel auf zwölf wiederkehrten, das habe ich nie in Erfahrung gebracht.
Bei diesem Kirchenrat, dessen echt christliche Milde aus der vorstehenden Schilderung zur Genüge erhellen wird, hatten mich einige der sogenannten Stadtschüler, auf die wir Gymnasiasten mit Verachtung herabsahen, wegen öffentlichen Rauchens angezeigt.
Als ich den Saal betrat, riefen sie mir triumphierend entgegen:
»Heute wird er Dich vornehmen!«
So recht behaglich war mir bei dieser Eröffnung, trotz Engels bekannter Nachsichtigkeit, nicht zumute. Doch beherrschte ich mich und gewärtigte mit stoischer Ruhe der Dinge, die da kommen sollten.
Der Kirchenrat erschien, wie üblich, kurz vor halb. Sein Antlitz hatte diesmal etwas ungewöhnlich Ernstes und Feierliches. Ja, ich glaubte einen Zug von Schmerz zu entdecken, der elegisch um die herabgezogenen Lippen spielte. So mußte der biblische Vater dreinschauen, wenn er des verlorenen Sohnes gedachte …
Gebeugten Hauptes schritt der Kirchenrat einige Male auf und ab. Dann blieb er stehen und rief mich beim Namen.
»Komm einmal heraus«, sagte er mit einer Stimme, die mir ein tiefes seelisches Weh zu atmen schien.
Die Stadtschüler rieben sich schmunzelnd die Hände.
Nicht ohne Verlegenheit trat ich zu dem Kirchenrate heran, der mich ein wenig abseits führte und mir dann mit gedämpfter Stimme ins Ohr raunte:
»Eh' ich's vergesse, sag' doch Deinem Herrn Vater, ich könnte morgen abend nicht zum L'Hombre-Kranz kommen.«
Frohe Enttäuschung!
»So,« fuhr er nun mit energisch dröhnender Stimme fort, »nun geh' auf Deinen Platz und vergiß nicht, was ich Dir gesagt habe!«
Es war der nachsichtigen und liebevollen Natur dieses Priesters unmöglich, irgend jemanden zu verletzen. So ignorierte er denn vollständig die schnöde Anzeige meiner Gegner und genügte nur in dieser wahrhaft klassischen Weise dem Dekorum.
In Prima wichen unsere Lehrer insoweit von dem Wortlaute des Gymnasialgesetzes ab, als sie ein Auge zudrückten, wenn die Schüler innerhalb ihrer vier Pfähle zur Zigarre oder zur Pfeife griffen. Nur das Rauchen auf der Straße war hier verboten. Aber gerade deshalb ward es mit Vorliebe kultiviert. Wäre es dem Gymnasiasten wirklich nur um das Kraut zu tun, so hätten wir unserem Rauchgelüste bei einer so milden Praxis hinlänglich fröhnen können: aber jetzt hatten die Zigarren im Hause ihren wesentlichen Reiz verloren. Die Sehnsucht des Primaners galt der öffentlich gerauchten Straßenzigarre. Einige von uns trieben die Sache so weit, daß sie vor dem Beginn der Lehrstunden in dem Schulsaale rauchten, was hin und wieder zu gräßlichen Untersuchungen führte, ohne daß jemals der Täter entdeckt worden wäre.
Als wir schließlich Studenten wurden, und der letzte Zwang wegfiel, da hingen sehr viele unserer Matadore das Rauchen überhaupt an den Nagel; wie denn zum Beispiel mein früherer Mitschüler, der Geheime Medizinalrat Dr. Schwarz in Hamburg, noch bis auf den heutigen Tag ein abgesagter Feind der Zigarre ist. Wenn ihm diese Zeilen hier zu Gesicht kommen, widmet er vielleicht meinen abscheulichen Tertianer-Glimmstengeln ein dankbares Lächeln der Erinnerung; denn ihnen schuldet er die erkleckliche Summe, die er jetzt infolge seines Nichtrauchens alljährlich zurücklegen oder für die Vervollständigung seiner humoristischen Bibliothek aufwenden kann.



Ich war vierzehn Jahre alt und erst vor kurzem Sekundaner geworden, als mich plötzlich, wie ein Flammenstrahl aus heiterm Himmel, der Drang nach poetischer Selbstbespiegelung ergriff. Ich erinnere mich noch des Tags und der Stunde … Der Herbstwind strich klagend durch die halbentblätterten Zweige der großen Platanen. Ein feiner Regen stäubte wider die Scheiben, so recht öde und trostlos, als ob die kranke Natur sich matt und erschöpft in den Schlaf weine. Drunten im Hofe sah es möglichst unwirtlich aus. Die versumpften Wege mit ihren großen, gelblichen Pfützen, das bräunliche Laub, das der Wind von Zeit zu Zeit aufwirbelte, das nasse Holzwerk des Spaliers und die triefende Hütte des Jagdhundes, der sein Sommerquartier längst verlassen, um im Hause gegen die Unbilden der Witterung Schutz zu suchen – dies alles machte einen unsagbar traurigen Eindruck. Drüben von der Landstraße her, wo die drei vereinsamten Pappeln wie lange Gespenster in den Dunst hineinragten, tönte das heisere Krächzen der Dohlen: sonst war alles wie ausgestorben …
Am Fenster stehend sah ich dem Hereinsinken der Dämmerung zu. Ein schmaler, blaßgelber Streifen am Horizont bezeichnete mir den Untergang des Tagesgestirns, das seit mehr als einer Woche nicht zum Vorschein gekommen war. Eh' ich's ahnte, war ringsum bleigraue Nacht geworden. Tief atmend trat ich ins Zimmer zurück. Im Ofen brannte ein lustiges Feuer. Auf meinem Arbeitstische glänzte die Lampe, die man in der Zwischenzeit unbemerkt hereingebracht hatte, und auf dem Teppich vor dem Sofa lag mit allen[111] Symptomen der Befriedigung und des Wohlbehagens der treue vierfüßige Begleiter meiner sommerlichen Ausflüge. Ein wunderbares Gefühl von Traulichkeit überkam mich. So schnell als möglich ließ ich den Vorhang herab. Dann setzte ich mich an den Tisch und schrieb mein erstes Gedicht. Seltsamerweise besang ich in diesen kühn gegliederten Versen den Zauber einer mondhellen Sommernacht. Ich pries das »unendliche Gewimmel der Sterne« und die Ulmen, die »sanft versilbert« ihre Häupter ins Blaue erheben! Und doch war das Ganze keineswegs etwas Angekünsteltes und Gemachtes, sondern ein wirklicher Herzenserguß, ein Erlebnis, das mit zwingender Macht nach Gestaltung rang. Ich brauche kaum hinzuzufügen, daß drei oder vier Strophen mit »wenn« begannen, daß eine wahrhaft großartige Summe von schmückenden Beiwörtern verbraucht wurde, und daß ich solche Verse, wo mir der Reim nicht augenblicklich zur Hand war, einfach ungereimt ließ. Dergleichen findet sich in jedem Erstlingsgedichte und wird erst später als Frevel empfunden. Damals glaubte ich etwas wahrhaft Schönes und Imposantes geschaffen zu haben, denn die Fülle meiner subjektiven Stimmung war mir identisch mit dem Geleisteten. Wie viele, sonst sehr achtbare Leute, die nicht vierzehn Jahre alt sind und nicht in Sekunda sitzen, verfallen in einen ähnlichen Irrtum! Was man dem Sekundaner verzeiht, das macht den Erwachsenen einfach lächerlich. Aller Dilettantismus beruht auf dieser Verwechslung. Der Dilettant trägt ganz wie der Dichter eine Welt voll Poesie in der Seele: aber während der schöpferische Poet seine Empfindungen dergestalt in dem Medium der Sprache zu verkörpern weiß, daß der Hörer und Leser das Gesamtbild nachschafft, gelingt dem Dilettanten nur ein trauriges Stammeln. Fehlt ihm nun der kritische Blick für die Kluft, die sein Empfundenes von seinem Gestalteten trennt – und dies ist die Regel –, so ist der Dichterling fertig. Der Sekundaner, der sich auf dieser Stufe befindet, hat die Möglichkeit einer Entwicklung für sich: denn selbst das größte Talent beginnt stümpernd. Der fertige Mensch aber erfährt mit Recht die strengste Beurteilung, denn in der Sphäre der Kunst gibt es keine christliche Milde, wie in der Sphäre der Ethik.
Das war also mein erstes Gedicht, – wenigstens das erste, dessen Genesis mir klar vor der Seele steht. Nun folgten rasch aufeinander die entsetzlichsten Balladen im altdänischen Stile, die furchtbarsten Sonette und die traurigsten Elegien. Ich kaufte mir ein schönes Album mit Goldschnitt, in das ich meine »Schöpfungen«, chronologisch geordnet, eintrug. Bald aber wurde mir dieses Kopieren zu umständlich. Ich dichtete gleich frisch drauf los in den Prachtband hinein, wobei es denn wesentlich darauf ankam, keiner Korrektur zu benötigen. Vom Anlegen der Feile war ich überhaupt damals kein Freund. Ich hatte so viel Stoff zu verarbeiten, daß ich immer wieder nach Neuem drängte. Es ist unglaublich, was ich alles in den Bereich meiner rhythmischen Betrachtungen zog. Sonnenaufgänge, die ich niemals gesehen hatte; die Leiden eines Negerknaben, der am Strande des Quorra von den Weißen geraubt wird; der nächtliche Reiter, der seinen Bruder erstochen und nun am zerbröckelnden Turme Wacht halten muß; die Freude über den bevorstehenden Semesterschluß; Glaube, Liebe und Hoffnung; der Gymnasialkarzer; die Vergänglichkeit alles Irdischen, und die Freuden einer nächtlichen Kahnfahrt: – dies alles war mir gleichmäßig untertan. Ich schrieb eine Ode »An unsern Hund« und einen Hymnus auf das griechische Übersetzungsbuch von Mehlhorn. Ich philosophierte über die Unsterblichkeit der Seele und über den niederträchtigen Nationalcharakter der Punier.
Das währte so ein halbes Jahr. Dann kam ein neues Motiv hinzu: das »Ewig-Weibliche«. Die schwarzen Locken und flammenden Augen brausten jetzt nur so durch meine Verse, und an Purpurwangen und Rosenlippen war kein fühlbarer Mangel.
Bis dahin hatte ich meine poetischen Regungen durch unverbrüchliches Schweigen gedeckt. Namentlich in der Schule, wo der Begriff des Verses jenseits aller Erfahrung zu liegen schien, war mir niemals eine verräterische Silbe über die Lippen geglitten. Ich hatte die dunkle Empfindung, als treibe ich etwas Verbotenes. Sobald ich das Wort »Gedicht« aussprechen hörte, erinnerte ich mich eines Vorfalles aus meiner Quintanerzeit. Der Lehrer gab uns damals zwei verschiedene Aufsatzthemata. Zuerst las er uns eine Gellertsche Fabel vor, die wir in Prosa nacherzählen sollten, –[113] und dann eine Anekdote in Prosa. Ich fragte nun in aller Harmlosigkeit: »Die sollen wir wohl in Verse bringen?« Eine geringschätzige Zurechtweisung war die Antwort, und einige meiner hochweisen Herren Mitschüler lachten aus vollem Halse. Von diesem Moment an hatte ich das Gefühl, als sei alles Rhythmische unziemlich, und so war ich denn äußerst zurückhaltend. Nur einem einzigen Freunde teilte ich ab und zu etwas mit. Und da dieselbe Elisabeth, deren Rosenwangen ich poetisch verherrlichte, auch ihm als Ideal alles weiblichen Liebreizes erschien, so beschlossen wir gemeinsam, einige dieser Lieder sauber abzuschreiben und dem Gegenstande unserer Neigung auf dem Wege der Stadtpost zu übermitteln.
Als wir den Brief eben gesiegelt hatten, trat mein Vater ins Zimmer. Wir gaben uns alle erdenkliche Mühe, recht gleichgültig dreinzuschauen, – aber vergebens. Nach einigem Hin- und Herfragen sahen wir uns schmählich entlarvt. So kam denn nicht nur unsere phantastische Verliebtheit zutage, – nein, auch das Geheimniß, daß ich dichtete, wurde ans Licht gezogen. Tiefe Beschämung. Nach langem Widerstreben lieferte ich mein Album aus. Es war mir zumute, wie einem Mädchen, das beim Baden von Männern überrascht wird.
Indes die Sache lief noch verhältnismäßig befriedigend ab. Ich wurde dringlich ermahnt, über diesen rhythmischen Versuchen meine Schularbeiten nicht zu vernachlässigen: im übrigen möge ich nur fortfahren. Dergleichen sei jedenfalls besser, als das sonst so fleißig geübte Einwerfen von Fenstern oder Niederreißen der Zaunpfähle.
Während meines ganzen Aufenthaltes in Sekunda beobachtete ich die strengste Reserve. Das Terrain war hier für poetische Anwandlungen äußerst ungünstig. Kaum, daß ich ab und zu die Keckheit hatte, einen deutschen Aufsatz mit der Wendung zu schließen: »Denn, wie der Dichter sagt …« und dann eine Strophe eigener Schöpfung einzuschmuggeln, in der Voraussetzung, der Lehrer werde den Kunstgriff nicht merken. Noch kürzlich ist mir einer dieser Aufsätze in die Hände gefallen. Der Lehrer hätte, um sich täuschen zu lassen, geradezu ein Dummkopf sein müssen, denn die Verse waren echt knabenhaft; aber großmütig ließ er die Vermessenheit hingehen, ohne mich durch die Frage: »Wer ist denn eigentlich[114] der Dichter, dem Sie diese Strophe entlehnen?« in Verlegenheit zu setzen.
Erst in Prima hatten wir offizielle Gelegenheit, unsere lyrischen Talente vor der Korona der Mitschüler zu betätigen. Unser Horaz-Interpret, ein feingebildeter Mann, der sich namentlich in literarischen Dingen durch ein reges Interesse auszeichnete, forderte uns jedesmal, wenn eine Ode genügend erklärt und verstanden war, zur freiwilligen Leistung einer metrischen Übertragung auf. Natürlich gab nur eine kleine Minorität diesem Ansinnen Folge; aber mit welchem Stolzgefühl schwellte es die Brust, wenn man über diese wenigen Mitbewerber den Sieg davon trug!
Der poetisch beanlagte Primaner steht zumeist unter dem Einflusse Platens, dessen Formkorrektheit ihm naturgemäß imponiert. Erst später entwickelt sich die Vorliebe für Heine und Goethe. Während meines ersten Semesters in Prima waren es besonders die kunstvoll-fremdartigen Ghaselen, die mich zur Nacheiferung entflammten. Keine Dichtungsform schien mir so geeignet, die heterogensten Dinge ohne weitere Kompositionsschwierigkeiten zusammenzuleimen, als dieses orientalische Reimgeplänkel. Ohne zu ahnen, daß wir ganz im Sinne Heinrich Heines (dessen Reisebilder uns damals noch unbekannt waren) die Ghaselform nach ihrer bedenklichen Seite hin persiflierten, wählten wir die sonderbarsten Ausklänge. Sie waren das Primitive, Ursprüngliche: die Gedanken und Verse wurden erst nachträglich wie Arabesken herumgeschlungen. So dichteten wir Ghaselen aus Braun-Dur, die also begannen:
Oder wir wählten als Refrain eine ganze Phrase, wie: »Doch der Schickung Groll verbeut's«, und intonierten nun folgendes Carmen:
Und nun folgte in schwungvoller Darlegung, was das glutbeschwingte Herz alles möchte … Es sähe gern … die Bächlein fließen … die Blumen sprießen … den Jäger die Rehlein schießen usw. Aber überall tritt ihm das Fatum entgegen; überall dröhnt es mit Donnerstimme: »Doch der Schickung Groll verbeut's!«
Solche Herzensergüsse waren vollständig ernst gemeint: aber, wie gesagt, Heinrich Heine hätte sie getrost in seinen »Reisebildern« verwerten können.
Nach und nach mochte die Form der Ghaselen uns selbst ein wenig kurios vorkommen. Wir benutzten sie jetzt zu komischen Extravaganzen, zu Klageliedern über unsere Primanerleiden, zu Hymnen auf die Eigentümlichkeiten der Professoren. Eines dieser Gedichte besitze ich noch: ich schrieb es während der Sophokles-Repetition, als Samuel Heinzerling eine etwas gar zu theoretische Auseinandersetzung über das Glykoneische Versmaß lieferte. Das Poem lautete:
Unsere Lehrer.
Gleichzeitig mit diesen und ähnlichen Scherzen, unter denen die Hyperbeln auf die Füße des Herrn Doktor Hellwig und die Epigramme auf die zahlreichen Kinder des Herrn Doktor Brömmel eine hervorragende Rolle spielten, ward auch das sentimentale Genre redlicher Begeisterung kultiviert. Es entstanden glühende Liebeslieder, die mit ängstlicher Scheu im Pulte verwahrt blieben,[116] denn jeder fremde Blick wäre ja eine schnöde Entweihung gewesen … Und dann entschloß man sich gleichwohl, wenigstens eines der »herrlichen Lieder« hinauszusenden in die kalte, lieblose Welt …
Niemand hat diesen epochemachenden Schritt im Leben eines lyrisch produzierenden Primaners so reizend geschildert, wie Paul Heyse in seiner »Lottka«.
Der Erzähler hat ein wehmuttrunkenes Lied gedichtet; sein Freund, ein achtzehnjähriger Musiker, setzt die »seufzenden Strophen in Musik, mit einer Klavierbegleitung, die das nahe Hereinbrechen des Weltgerichts über dem Haupte des wankelmütigen Mädchens« andeuten sollte.
»Damals«, so heißt es wörtlich, »erschien die »Dresdener Abendzeitung« unter der Redaktion eines, wie ich glaube, seitdem verschollenen Herrn Robert Schmieder, der Gedichte der Aufnahme würdigte, über die mein kritisches Selbstbewußtsein nur die Achseln zucken konnte. An ihn schickten wir unsern Liebling, natürlich anonym, in der festen Überzeugung, schon in der nächsten Nummer Text und Komposition erscheinen zu sehen, mit der Bitte an die unbekannten Einsender, die Abendzeitung auch fernerhin mit so willkommenen Früchten ihres Talentes zu erfreuen. In süßer Beklommenheit, trotz unseres Inkognitos, betraten wir die Konditoreien, in denen Journale gehalten wurden, und forschten errötend nach unserm Erstling. Woche auf Woche verging, ohne daß sich unsere Erwartung erfüllte. Ich selbst hatte endlich, zumal nachdem wir noch einmal geschrieben und die Zurücksendung in ziemlich vornehmem Tone verlangt hatten, ohne einer Antwort gewürdigt zu werden, alle Hoffnung aufgegeben und war über diesen ersten Mißerfolg so beschämt und gekränkt, daß ich zunächst in einem längeren Gedichte der undankbaren Mitwelt den Handschuh hinwarf und auf die gerechtere Nachwelt pränumerierte, dann aber jede Andeutung des fehlgeschlagenen Unternehmens vermied und von Bastel (der ehrliche Name meines Freundes war Sebastian) verlangte, er solle auch die Melodie nicht mehr summen, die mir sogleich die ganze leidige Geschichte wieder ins Gedächtnis rief.«
Wer hätte nicht, in gleicher Lage, diese wechselvollen Stimmungen ausgekostet? Hier nimmt das Schicksal zum erstenmal den[117] Lyriker in die Schule, und gar mancher kommt über diese verunglückte Probe niemals hinaus. Ist der Betroffene in der Tat ohne dichterische Begabung, so darf er eine möglichst baldige Zerstörung seiner Illusionen als ein Glück betrachten. Aber gleichviel, es schmerzt. Sah man nicht bereits im Geiste einen prachtvoll gebundenen Oktavband, der in jedem Jahr eine Neuauflage erlebte und neben Geibel und Rückert in den Büchersammlungen aller Frauen und Mädchen heimisch wurde? Und nun dieses herbe Mißgeschick! Was wir für ein literarisches Ereignis hielten, ist an der kalten Seele des Redakteurs spurlos vorübergegangen! Er hat sich vielleicht an dem Weh unseres blutenden Herzens die Pfeife angezündet!
Wie glorreich aber berührt im andern Falle die krönende Hand des Erfolges! Wenn wirklich nach so und so viel Wochen das Gedicht, A. O. oder B. O. unterzeichnet, im Feuilleton des Anzeigers erscheint, – wie steigt dem glückseligen Primaner die Glut ins Angesicht, und mit welch' unsäglichen Gefühlen des Stolzes nimmt er überall, wo es möglich ist, das Blatt zur Hand, um die prächtigen Strophen zwanzig-, dreißig- und vierzigmal wieder zu lesen! Er kann gar nicht begreifen, daß da drüben der Herr, der beim Biere sitzt, zuerst den Leitartikel, die Börsen-Kurse und das Vermischte liest; er meint, jedes Auge müßte sich von dem Gedichte magisch gebannt fühlen, und von Mund zu Munde müßte die Frage lodern: »Wer ist der Verfasser dieses herrlichen Liedes? Das ist ja etwas ganz Eminentes! Das müssen wir herausbringen!« In jedem Zirkel, den unser anonymer Autor betritt, erwartet er, daß man ihn mit den Worten überfalle: »Haben Sie's denn auch schon gelesen? ›Die Klage der Sehnsucht!‹ Wunderbar! Wunderbar! Meine beiden Schwestern haben sich's in ihr Album geschrieben. Meine Tante kann's bereits auswendig, und mein Schwager, der Kapellmeister, wird das Prachtstück in Musik setzen!«
Nichts von alledem ereignet sich. Die Herren in der Bierstube, die so eifrig die Börsenkurse und die Leitartikel studieren, würdigen das phänomenale Gedicht keines Blickes, und in den Familienkreisen und Teegesellschaften geht die Unterhaltung ihren einförmigen[118] Gang. Auch hier beginnt die Laufbahn des Poeten mit Enttäuschung.
Dergleichen läßt sich zur Not noch ertragen. Man richtet sich empor an dem Beispiele so vieler großer Männer, die auch erst nach langen Kämpfen Anerkennung gefunden haben. Man setzt seine ganze Hoffnung auf das nächste Gedicht, das bereits an die Redaktion unterwegs ist usw.
Weit mehr Stoizismus gehört jedoch zum Überstehen der folgenden Szene:
Der Primaner ist in das belebteste Bierhaus geschlichen, weil ihm bekannt ist, daß dort zwei Exemplare der durch ihn mit unsterblichem Ruhme gekrönten Zeitung gehalten werden.
Ahnungsvoll und von süßem Grauen durchbebt, schlürft er sein schäumendes Glas.
Da sitzt der Stadtrichter, ein alter, redseliger Herr … Unter dem Plaudern wirft er auch einen Blick auf das anonyme Gedicht.
»Der druckt aber doch auch allen möglichen Schund«, sagt er mit wegwerfender Gebärde.
Und nun beginnt eine boshafte Besprechung, die von den Umsitzenden aus vollem Halse belacht wird.
Der unglückliche Primaner bedarf seiner ganzen moralischen Kraft, um sich nicht zu verraten. Von diesem Augenblicke an wirft er auf den Stadtrichter, der sonst ein ganz ehrlicher Mann ist, einen unversöhnlichen Haß. Die »wohlfeilen Späße« des alten Herrn sind ein »trauriges Zeichen der Zeit«. »Dieser armselige Böotier, der die Schönheit nicht sehen und würdigen kann, weil ihm der Aktenstaub die Augen umwirbelt! Und die Laffen, die seinen abgeschmackten Bemerkungen Beifall gejauchzt haben!« Ihre Persönlichkeit prägt sich für alle Zeiten unserm Gedächtnis ein … Nach Jahren noch, wenn wir ihnen begegnen, denken wir in einer Anwandlung von Bitterkeit und Geringschätzung: »Aha, das ist ja auch einer von jenen Vandalen, die sich an meinem Kleinod vergingen!«
Erst später, wenn man die literarischen Kinderschuhe ausgetreten und einen freieren Blick erlangt hat, erst als Mann[119] erkennt man, daß jenes Gedicht in der Tat sehr mangelhaft war. Und wenn auch der Stadtrichter keine Ursache hatte, sich über diese Mangelhaftigkeit zu mokieren (er würde dasselbe Gedicht, wenn er es in den Werken eines Klassikers gefunden hätte, pflichtschuldigst bewundert haben), so dürfen wir ihm doch aus hundert Gründen seine Unart verzeihen … Und in der Tat, wir verzeihen ihm, zumal wir in Erfahrung gebracht haben, daß der Stadtrichter zu den eifrigsten Lesern unserer Essays und Novellen gehört.

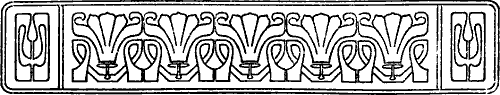

Die oberen Gymnasialklassen sind der eigentliche Schauplatz für die platonische Liebe. Die Primanerliebe ist sogar sprichwörtlich geworden, und in akademisch gebildeten Kreisen gehört es zum vornehmen Ton, über dieses erste Aufflackern des erotischen Prinzips geringschätzig zu lächeln. Man vergißt eben im rastlos wiederkehrenden Kampf des Lebens, was man zu einer Zeit fühlte, da sich Herz und Geist erst für diesen Kampf vorbereiteten. Wie kalt und verständig schrieb der herangereifte Goethe über Lili, die den jungen Goethe so magisch gefesselt, so unwiderstehlich hingerissen und bezaubert hatte! Der Mensch wird nüchterner und erblickt dann die Vergangenheit durch die Brille seiner philiströsen Alltagsstimmung.
Unter Primanerliebe versteht man gemeinhin eine jugendliche Dummheit, die in schauderhaften Sonetten und tausendfach wiederholten Fensterpromenaden gipfelt, eine Landpartie als Perihel des Entzückens und die Abreise der Geliebten in das Pensionat als schrecklichste Katastrophe kennt, häufige Einschnitzungen in die Subsellien hervorruft und beim Abgang nach der Universität in Bier, Paukereien und wohlgewachsenen Schenkmädeln ertränkt wird. Dergleichen mag sich ereignen; aber wenn der Verlauf der normalen Primanerliebe in der Tat mit dem Vorgeschilderten buchstäblich übereinstimmt, so folgt daraus lange nicht, daß eine unwichtige Lächerlichkeit vorliegt.
Was ist überhaupt eine Kleinigkeit? Was ist geringfügig? Nur die engherzigste Arroganz kann hier den Maßstab der eigenen Subjektivität anlegen. Was mir sehr geringfügig und wertlos erscheint, ist einem anderen vielleicht das halbe Leben. Das Kind,[121] dem seine Puppe ins Wasser fällt, ist nicht etwa zum Schein, sondern ernstlich und im tiefsten Grunde seines Herzens unglücklich; der Knabe, der zu Anfang des neuen Semesters nicht versetzt wird, fühlt nicht etwa einen Miniaturschmerz, sondern sein ganzes Ich ist unter Umständen so sehr von der Qual seines verletzten Ehrgefühls durchdrungen, daß ihm jede Hoffnung zu Grabe geht; daher es denn keineswegs unerhört ist, daß Schulknaben sich aus solchen »geringfügigen« Anlässen den Tod gegeben. Nirgends ist der Begriff der Größe und der Kleinheit so relativ als in dem, was unser Gemüt angeht. Jede Sorge, jede Neigung, jede Leidenschaft wird einen gesellschaftlich oder philosophisch höher Stehenden finden, der sie von seinem Standpunkt aus belächeln darf. Der Professor, der außer sich gerät, weil ihm ein Exemplar seiner mit so heißer Liebe gepflegten Schmetterlingssammlung ruiniert wurde, kommt dem ernsten Forscher in gewissem Sinne komisch vor; der Dandy, den der plötzliche Verlust seines Handschuhknopfs in Erregung bringt, scheint dem Denker geradezu unbegreiflich; die Hausfrau, die über einen häßlichen Fleck in ihren frisch gescheuerten Dielen in Tränen ausbricht, erweckt vielleicht unseren Hohn: und doch liegt in allen diesen Fällen ein wirklicher Schmerz vor. Würde nicht etwa ein Heros, ein Gott, der unser ganzes Tun und Treiben aus der Vogelperspektive betrachtete, selbst die ernstesten Obliegenheiten unseres Staatslebens komisch finden? Die ganze irdische Geschäftigkeit mit ihrem anspruchsvollen Eifer unterscheidet sich von dem krabbelnden Treiben der Milben, die das Mikroskop in einem Stückchen Käserinde entdeckt, durch kein wesentliches Kriterium. Hier wie dort finden wir ein mühsames Hasten im Interesse der Ernährung und Fortpflanzung; hier wie dort lauert im Hintergrunde der Tod, der die ganze Komödie hinwegfegt. Daß wir dem Treiben der Menschen eine höhere Wichtigkeit beilegen als dem der Milben, kommt nur daher, weil wir zufällig Menschen sind. Wären wir Milben, so schwärmten wir vielleicht für die großen Fragen des Milbentums.
Es wäre eine blöde Verkennung der Tatsachen, wenn wir leugnen wollten, daß die sogenannte Primanerliebe nicht selten die einzige wahre Liebe ist, die ein menschliches Herz auf Erden zu fühlen bekommt. Alphonse Karr sagt einmal sehr bezeichnend: »Wenn die[122] Mädchen wüßten, welch' einen Schatz von Liebe das Herz eines solchen jungen Menschen, der zum erstenmal liebt, in sich birgt! Wenn sie ein Verständnis hätten für diese Hingebung, diese Vergötterung! Wenn sie ahnten, daß sie für einen solchen Jüngling das Leben mit all seiner Wonne, das Paradies mit all seinem geheimnisvollen Zauber darstellen …! Aber in ihrer törichten Geringschätzung für diesen Jüngling, in ihrer noch törichteren Bevorzugung blasierter und verkommener Geschöpfe lassen sie sich diese erste Liebe von Grisetten oder Kammermädchen hinwegschnappen!«
Wenn die Primanerliebe selten zu einem praktischen Resultat führt, so liegt dies vorzugsweise in der Natur unserer sozialen Verhältnisse. Auch sind es wiederum nur diese sozialen Verhältnisse, die der Primanerliebe in den Augen des wohlbestallten Bürgers eine so überaus komische Färbung verleihen. Ein achtzehnjähriger Fischerbursche auf Capri, der seine fünfzehnjährige Teresina liebt und sie nach zwei Jahren eines mehr oder minder romantischen Brautstandes zum Altare führt, erscheint uns poetisch: ein achtzehnjähriger Primaner im gleichen Fall erregt beinahe unsere Mißbilligung. Und doch waltet hier wie dort das gleiche Naturgesetz ob. Die Komik, die einem verliebten Primaner innewohnt, erwächst nur aus dem Umstand, daß der Weg von dem Abiturientenexamen bis zur Würde eines vom Staat besoldeten Kreisrichters ein sehr langer und unerquicklicher ist. Leider kümmert sich Eros um solche Äußerlichkeiten nicht; am wenigsten aber hat er Respekt vor den Gymnasialgesetzen. Es gibt Lehrer, die kindisch genug sind, jede Regung der Liebe, die vor Beendigung des Gymnasialkursus eintritt, als eine strafbare Neigung für Allotria zu betrachten; ja, ich erinnere mich, daß einer dieser kurzsichtigen Pedanten mit Karzerstrafen vorging, weil ein jugendlicher Leander keine nur irgend denkbare Gelegenheit versäumte, an gewissen Fenstern vorüber zu wandeln. Dieser Versuch, das Sonnenlicht mit der Nachtmütze zu fangen, berührte mich schon damals so kläglich, daß ich mit dem unverständigen Cato fast Mitleid empfand. Was sind drei Tage Karzer gegen einen freundlichen Blick aus geliebten Augen?
Ich verwahre mich hier gegen ein Mißverständnis! Nicht im Traume fällt es mir ein, jede erotische Bummelei des deutschen[123] Primaners für eine Haupt- und Staatsaktion des Herzens zu halten; ich erhärte nur, daß solche ernstlichen und tiefen Empfindungen ungleich häufiger sind, als die Schulweisheit selbst der liberalsten Pädagogen sich träumen läßt. Man darf sich hier nicht durch die Außenseite beirren lassen. Die glühende, das ganze Wesen durchleuchtende Liebe tritt in diesem ersten Jugendalter oft ganz in derselben kindischen Gewandung auf, wie die müßige Tändelei. Die Fensterpromenade ist keineswegs nur der Zeitvertreib des koketten Flaneurs: auch der echte, im tiefsten Grund der Seele entflammte Romeo wählt dieses Mittel, – und nur die Musik oder die Dichtkunst vermöchte zu schildern, was er dabei empfindet. Die Mutter des jungen Mädchens, die meist nach langer Blindheit dahinter kommt, daß dieses ewige Vorüberziehen ihrem Töchterchen gilt, zankt (nicht ohne eine stille Befriedigung ihrer geschmeichelten Eitelkeit) über die »dummen Jungen«, die etwas Besseres tun könnten, als so ihre Zeit zu vertrödeln: aber sie ahnt nicht, daß hier eine reinere und gewaltigere Leidenschaft vorliegt, als die halb aus Wohlgefallen, halb aus Berechnung zusammengesetzte, bürgerlich abgestempelte Salonliebe, die nach einer Reihe hochachtbarer Begegnungen zu einer Erklärung und schließlich zu einer respektablen Ehe führt. Diese Verkennung ist um so weniger begreiflich, als die Menschen doch alle einmal jung und mehr oder minder in dem gleichen Falle gewesen sind.
Wenn wir auf der einen Seite nicht leugnen können, daß die äußeren Allüren der Primanerliebe nicht selten den Eindruck einer naiven Ungelenkigkeit, ja einer kindischen Fadheit machen, – alles natürlich vom Standpunkte des gesetzten Familienvaters, – so dürfen wir auf der anderen Seite nicht verhehlen, daß es gerade die herrschende Sitte mit ihren verknöcherten Regeln ist, die den Primaner so lange in dem Zustande der gesellschaftlichen Unreife und Torheit erhält. In gewissem Sinne ist das Alter von sechzehn bis achtzehn Jahren das unglücklichste des ganzen Lebens.
»Ich war«, so schildert Paul Heyse den Zustand des Halbwüchsigen, »ein lang aufgeschossener, blasser junger Mensch, in jenem verlegenen Alter, wo man den Knabenschuhen sich entwachsen fühlt und noch sehr unsicher in die Fußstapfen der Männer zu treten[124] versucht. Mit einer tollkühnen Phantasie und einem blöden Herzen, zwischen trotzigem Selbstgefühl und mädchenhafter Empfindlichkeit hin und her geschaukelt, zupft man grübelnd an allen Schleiern, die die Geheimnisse des Menschenlebens sterblichen Augen verdecken, weiß heute das letzte Wort über die letzten Dinge, gesteht sich morgen, daß man noch im ABC stecke, und gebärdet sich überhaupt so unbehaglich widerspruchsvoll, daß man sich selbst unerträglich werden würde, wenn man nicht von Leidens-, das heißt Altersgenossen umgeben wäre, die es nicht besser machen und doch auch darum nicht aus der Haut fahren.«
Es ist vornehmlich der deutsche Jüngling, der dies Mißbehagen auskostet, und zwar zunächst und in erster Linie aus dem betrübenden Grunde, weil ihm die Gesellschaft absolut keine Stellung anweist. Der Verkehr eines sechzehnjährigen jungen Menschen mit den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft und insbesondere mit den gleichalterigen und älteren Mädchen entbehrt jeder vernünftigen Basis und Norm. Er mag der geistreichste und geweckteste Kopf sein: die Damen rechnen ihn nicht für voll, und die Herren erst recht nicht. Ja, vielfach deutet man seine Anwesenheit im Salon als Zudringlichkeit. In Deutschland ist es eine Sünde, nicht vollständig erwachsen zu sein. In Frankreich, in England ist das anders. Ich habe in Paris hundertmal den ungezwungenen, graziösen und doch keineswegs allzu vertraulichen Ton bewundert, in welchem selbst Knaben von vierzehn und fünfzehn Jahren mit älteren Leuten verkehren. Da waltet nicht eine Spur von Befangenheit ob, da herrscht nicht jene blöde Verschämtheit, die nicht weiß, wo sie mit den langen Beinen und Armen hin soll. Wohl aber hat sich gerade infolge dieser Freiheit und Leichtigkeit eine bescheidene Reserve ausgebildet, die sehr wohltätig mit der vorlauten Keckheit kontrastiert, die als anderes und nur zu begreifliches Extrem den halbwüchsigen Deutschen charakterisiert. Wo soll ein deutscher Jüngling eigentlich seine gesellschaftliche Schule durchmachen? Bis zu einem gewissen Alter verbietet man ihm – entweder direkt, oder indirekt durch die unfreundliche, verletzende Behandlung – den Zutritt in die Gesellschaft. Dann mit einemmal werden ihm die Pforten geöffnet, und nun verlangt man die Manieren eines Gentleman. Aber dergleichen erlernt sich[125] nicht über Nacht. Ich erblicke in der Liebenswürdigkeit, mit der die Franzosen ihre jungen Leute behandeln, ein Hauptmoment ihrer geselligen Überlegenheit. Der gebildete Franzose hat sich von jung auf jene gefälligen Manieren angewöhnt; sie sind ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Der Deutsche dagegen soll sie seinem fast fertigen Menschen nachträglich aufkleben. Daher braucht man denn später nur ein wenig zu kratzen, um die Politur wegzubröckeln und den ungeleckten Bären hervorschimmern zu sehen.
Ich habe meine Jugend in einer kleinen Stadt verlebt, die ungleich beträchtlichere Chancen für die Geselligkeit bot, als etwa Leipzig oder Berlin; aber ich wüßte mich nicht zu erinnern, daß ich in irgend einem Kreise unseres Gemeinwesens einem vernünftigen und natürlichen Verkehr zwischen den Schülern und Schülerinnen begegnet wäre. Schon als Quintaner spielten wir stets nur »unter uns«. Wenn sich ab und zu eine »Emanzipierte« in unsere Gesellschaft wagte, so wurde sie von ihren Freundinnen bedenklich schief angesehen, denn die Mütter behaupteten, so etwas schicke sich nicht. Später, als das Spielen aufhörte, erstarb auch dieser letzte Rest von Beziehung, und es war fast ein Zufall, wenn irgendwo einmal eine Begegnung statthatte. Die Folge dieser eigentümlichen Klausur war natürlich ein vollendeter Mangel an savoir vivre. Beide Teile kamen bei einem solchen zufälligen Rencontre nicht aus der Befangenheit heraus, und das Resultat war eine gründliche Verstimmung. Man fuhr, wie Paul Heyse sagt, nur deswegen nicht aus der Haut, weil so und so viele Leidensgefährten gleichfalls drin stecken blieben.
Was bleibt also einem Primaner, der in solchen Verhältnissen aufgewachsen ist, übrig, als schließlich seine Zuflucht zu Fensterpromenaden und ähnlichen Albernheiten zu nehmen? Er wäre vielleicht der verständigste Mensch von der Welt, er würde vielleicht mit verdoppeltem Fleiß arbeiten, wenn er nur ab und zu einmal Gelegenheit hätte, die knospende Göttin, die er verehrt, zu sehen und zu sprechen: so aber vertrödelt er seine Zeit, um das mühsam und flüchtig zu erhaschen, was die Gesellschaft ihm – der Himmel mag wissen aus welchem Grunde! – für die Regel vorenthält.
Übrigens zeigt sich das Aufkeimen unverstandener Liebesempfindungen, wie jedermann weiß, schon im frühesten Knabenalter.[126] Nur sind sich diese Regungen ihres Zieles so völlig unbewußt, daß hier Kombinationen möglich sind, die späterhin bei einer voll entwickelten Liebe zu schmerzlichen Katastrophen führen. Noch in Untersekunda liebte ich mit meinem besten Freunde gemeinsam eine und dieselbe Adorata. Arm in Arm zogen wir an ihrem Fenster vorbei, ohne daß sich jemals ein Gefühl von Eifersucht in uns geregt hätte. Auch raubte uns diese ätherische Huldigung weder den Appetit noch den Schlaf. Das Ganze war in der Tat eine Kinderei, ein erstes, harmloses Vibrieren der Seele, und als uns schließlich der Vater des gefeierten Mädchens ohne Verständnis für unsere Ritterlichkeit bei dem Ordinarius der Klasse verdächtigte, so überwog unsere Entrüstung, und wir beschlossen ohne jeden Herzenskampf, die Tochter eines so barbarischen Vaters mit Verachtung zu strafen. Ganz derselbe Freund hatte später in Prima eine Leidenschaft, die ihn auf Jahre hinaus tief unglücklich machte und schließlich seinen Tod herbeiführte.
Es gilt hier also, zu unterscheiden und nicht vornehm ablehnend die ernstesten Dinge, die ein Menschenherz zu bewegen imstande sind, mit dem Leichten und Nichtigen über einen Kamm zu scheren. Das herrlichste Mittel, die Leidenschaften zu lenken, ist ihr Verständnis.



Es war in Sekunda. Die letzte der nachmittäglichen Unterrichtsstunden neigte sich ihrem Ende zu. Da erhob sich mein Freund Wilhelm Rumpf aus Gamsweiler – derselbe, der später als neugebackener Primaner jenes denkwürdige Rencontre mit dem Direktor Heinzerling zu bestehen hatte – und bat den Lehrer in der hergebrachten Weise um die Erlaubnis, »mal hinausgehen zu dürfen«.
Es fiel mir auf, daß Wilhelm, als ihm die Bitte gewährt wurde, ganz gegen seine Gewohnheit nach der Mütze griff; – bald aber sollte ich den Grund dieser Maßregel erfahren … Denn als Doktor Brömmel die lateinischen Stilübungen glücklich beendet hatte und sich verabschieden wollte, fand er die Tür des Schulzimmers von außen verschlossen. Wilhelm Rumpf hatte, gleichsam als Vorstudie für sein künftiges Attentat auf Samuel Heinzerling, ganz sachte den Schlüssel herumgedreht und war dann, im Hochgefühl einer bedeutsamen Tat, schmunzelnd von dannen gewandelt.
In den Räumen Sekundas herrschte infolge dieser unerwarteten Einkerkerung großer Tumult. Alles drängte sich eifrig heran und versuchte zu öffnen. Die Schwächeren wurden in dem Gedränge zu Boden geworfen, die Kecken und Rücksichtslosen teilten Püffe und Stöße aus, und der Lehrer selbst geriet in Gefahr, von dem brandenden Ozean der erregten Schuljugend mit fortgerissen zu werden. Nur mühsam und mit Aufbietung aller Körper- und Geisteskräfte gelang es ihm, die Ordnung so weit wieder herzustellen, daß er zum Worte kam. Zerstreut, wie er war, hielt er uns folgende Ansprache:
»Vor allen Dingen bitt' ich mir Ruhe aus! Ruhe, sage ich, oder es geschieht ein Unglück! Boxer, der ganze Unfug scheint mir wieder von Ihnen auszugehen! Ich rate Ihnen freundschaftlichst, treten Sie etwas gelinder auf!«
Boxer versuchte zu remonstrieren.
»Gehn Sie auf Ihren Platz«, rief Brömmel mit Donnerstimme. »Ich will mal sehen, ob ich den Urheber solcher Streiche nicht ausfindig mache! Hutzler, Sie sollen sich setzen! Es ist unerhört, was man in dieser Klasse erleben muß! Kurz und bündig: Wer hat die Tür da zugeschlossen? Der Betreffende möge sich melden!«
»Aber Herr Doktor,« versetzte Hutzler im Ton einer milden Zurechtweisung, »der Schlüssel steckt ja von außen.«
Allgemeines Gelächter.
»Das ist wahr,« brummte der Lehrer, »daran dachte ich nicht. Nun, es ist wahrlich nicht Ihr Verdienst, wenn Sie diesmal wider Erwarten unschuldig sind. Jedenfalls ist der Täter ein ganz erbärmlicher Junge, den ich exemplarisch bestrafen werde.«
»Herr Professor,« begann Kleemüller, »das hat ganz bestimmt einer von den nichtsnutzigen Primanern getan!«
»Unsinn! die Primaner sind ernste, gesittete Leute! Ich wollte, Ihr hättet halb so viel Anstand und Ehrgefühl!«
»Dann war's einer aus Tertia!« rief Gildemeister.
»Das ist hier zunächst indifferent. Vorläufig müssen wir zusehen, daß wir hinaus kommen. Heppenheimer, gehn Sie mal hinunter und rufen Sie den Pedellen!«
Wir unterdrückten nur mühsam eine diabolische Heiterkeit. Heppenheimer erhob sich und schritt mit komischer Grandezza der Tür zu.
Jetzt erst erkannte Brömmel, wie seltsam er sich geirrt hatte.
»Ja, so«, rief er in wachsendem Unwillen. »Wahrhaftig, man wird ganz irre in dieser Umgebung. Setzen Sie sich, ich werde selbst gehen!«
Eine Salve des tollsten Gelächters belohnte dieses neue Capriccio.
»Ich will sagen,« verbesserte Brömmel stirnrunzelnd, »wir müssen schleunigst den Pedellen zitieren … Boxer, gehn Sie ans Fenster und rufen Sie!«
»Recht gern, Herr Professor«, erwiderte Boxer zuvorkommend.
Er öffnete einen Flügel:
»Herr Quaddler! Herr Gymnasialpedell! Herr Karzerverwalter! Herr Leberecht Gottlieb Quaddler! Sie möchten doch gleich mal heraufkommen! Hören Sie nicht? Quaddler! Der Herr Professor ruft!«
»Lassen Sie Ihre Glossen«, zürnte der Lehrer, heftig aufstampfend. »Rufen Sie einfach: Herr Quaddler! und damit basta!«
»Herr Quaddler! und damit basta!« schrie Boxer aus vollem Halse.
»Ich komme ja schon«, erklang die Stimme des ehrlichen Hausverwalters, der eben mit einer Ladung von Kienspänen aus dem Holzstalle trat. »Was wollen Sie denn von mir?«
»Herr Quaddler! Sie sollen gleich mal herauf kommen! Hören Sie, Herr Quaddler? Der Herr Professor ruft! Wir sind eingeschlossen, Herr Quaddler! Eilen Sie sich, Herr Quaddler, sonst wird der Kaffee kalt! Hören Sie, Herr Quaddler?«
»Lassen Sie Ihr verdammtes ›Herr Quaddler‹!« rief Brömmel entrüstet.
»Aber der Mann heißt doch so! Ich soll nicht Herr Gymnasialpedell sagen, ich soll nicht Herr Karzerverwalter sagen …«
»Sie sollen das Maul halten!« schrie der Professor außer sich.
»Auch gut«, versetzte Boxer demütig.
Nach zwei Minuten ertönten auf dem Korridor Schritte. Gleich darauf pochte es schüchtern ans Türgetäfel.
»Herein!« rief der Professor zerstreut.
Quaddler drückte zur größten Erheiterung von zweiundfünfzig übermütigen Sekundanern auf die Türklinke.
»Sie müssen den Schlüssel herumdrehen«, sagte Brömmel verdrießlich. »Irgend ein frecher Wicht hat uns hier eingeschlossen.«
»Was?« fragte Quaddler.
»Den Schlüssel sollen Sie umdrehen!« schrie der cholerische Pädagoge. »Sie scheinen heute wieder infam schwerhörig!«
»Schwerhörig? Gewiß nicht, Herr Professor, aber da drüben in der Prima, wo von vier bis fünf Englisch ist, wird ergebenst so laut gelacht, daß man sein eigenes Wort nicht versteht.«
»Enthalten Sie sich aller Bemerkungen und schließen Sie auf!«
»Ja, Herr Professor, verzeihen Sie gütigst, wenn ich mir ganz ergebenst erlauben darf zu vermerken, so wird das mit dem besten Willen nicht möglich sein, weil der Schlüssel nicht steckt.«
»Was? Auch das noch? Es ist empörend!«
»Warten Sie mal, Herr Professor,« begann jetzt Boxer, indem er mit der rechten Hand seine Tasche durchsuchte, »ich habe da meinen Hausschlüssel bei mir, vielleicht paßt der …«
»Was? Ihren Hausschlüssel? Mit welchem Recht tragen Sie einen Hausschlüssel bei sich? Wissen Sie nicht, daß Sie Punkt neun Uhr in Ihrer Wohnung zu sein haben?«
»Gewiß, Herr Professor! Aber man kann sich doch einmal wider Willen verspäten. Wenn man zum Beispiel einen Onkel an die Bahn zu begleiten hat …!«
»Ihre Onkels können bei Tag reisen. Dieser Hausschlüssel wirft ein sehr bedenkliches Licht auf Ihre Gewohnheiten.«
»Das ist wohl zu schroff geurteilt! Aber darf ich einmal die Probe machen? Ich wette, er schließt!«
»Meinetwegen, versuchen Sie's!«
Boxer begann nun sehr geräuschvoll zu operieren. Natürlich erfolglos.
»Herr Professor!« rief Hutzler nach einer Weile. »Ich muß schleunigst hinaus! Ich fühle mich unwohl.«
»So? Was fehlt Ihnen denn?«
»Wir hatten Gurkensalat zum Rindfleisch, – und jedesmal, wenn ich Gurkensalat esse …«
»Gedulden Sie sich! Ich kann um Ihretwillen die Tür nicht eintreten lassen!«
»So erlauben Sie mir, daß ich durchs Fenster …«
»Ich glaube, Sie sind verrückt!«
»Keineswegs, Herr Professor! Ich klettere einfach am Rohr der Dachtraufe hinab.«
»Und brechen den Hals!«
»Nun, da wär' auch nichts weiter verloren! Sie haben mir ja so manchmal gesagt …«
»Sparen Sie Ihre Worte! Sie bleiben hier, bis geöffnet ist! Quaddler! sorgen Sie jetzt dafür, daß dieser Unfug ein Ende nimmt!«
»Erlauben der Herr Professor … Soll ich sozusagen den Schlosser holen?«
»Natürlich! Mit Ihren Fingern werden Sie bei der Sache nichts ausrichten!«
»Schön, Herr Professor. Welchen Schlosser soll ich denn holen?«
»Das ist mir gleichgültig.«
»Vielleicht den Kreiling?«
»Himmelkreuzdonnerwetter, holen Sie, wen Sie wollen!«
»So will ich den Kreiling holen. Der Burkhardt wohnt zwar bedeutend näher …«
»Selbstverständlich holen Sie dann den Burkhardt.«
»Belieben der Herr Professor ganz ergebenst vermerken zu wollen, der Schmelzer wohnt aber noch näher!«
Doktor Brömmel schlug mit der geballten Faust auf die Kathederfläche.
»Sie sind ein Schafskopf! Augenblicklich machen Sie, daß Sie fortkommen!«
»O, Herr Professor … Ich gehe ja schon«, sagte Quaddler beleidigt.
Und hiermit tappte er langsam über den Korridor und die Stiege hinunter.
Doktor Brömmel setzte sich, kreuzte nach Art Walthers von der Vogelweide ein Bein mit dem andern und heuchelte eine wahrhaft stoische Ruhe.
»Ich werde die Frist benutzen, um Ihnen ein kurzes lateinisches Exerzitium zu diktieren. Rüsten Sie sich zum Schreiben!«
»Was?« rief Boxer pathetisch. »Das steht nicht im Schulprogramm!«
»Wenn Sie sich noch ein einziges freches Wort erlauben, so schick' ich Sie nach dem Karzer!«
Boxer erhob sich.
»Frech zu sein ist meine Gewohnheit nicht; aber in aller Bescheidenheit …«
»Sie lernen mir zur Strafe den ersten Gesang der Odyssee auswendig. Ich will Sie lehren, meine pädagogischen Maßnahmen Ihrer unreifen Kritik zu unterwerfen! – Still jetzt dahinten! Ich beginne mit dem Diktat!«
Er legte die Arme gleichmütig vor die Brust und hub an, wie nachstehend:
»Gönne die Reichtümer den Reichen und ziehe die Tugend den Reichtümern vor!«
»Wie?« fragte Knebel. »Was soll man vorziehen?«
»… Und ziehe die Tugend den Reichtümern vor«, wiederholte Brömmel mit eisiger Kälte.
Die Federn kritzelten hastig übers Papier.
»Wenn ich die Lehren der Weisheit verschmähe und noch im reiferen Alter wie ein Kind nach den Zerstreuungen des Augenblicks hasche, so bin ich albern … Das letzte Wort geben Sie mit ineptio, ineptire.«
»So bin ich was?« fragte Knebel.
»Albern sind Sie,« versetzte Brömmel, – »im höchsten Grade.«
»Gehört das mit ins Diktat?«
»Ja, Sie können sich's mit ins Diktat setzen! Heppenheimer, warum schreiben Sie nicht?«
»Ich bin fertig.«
»So? Zeigen Sie einmal her!«
Mit siegesgewissem Lächeln reichte Heppenheimer sein Blatt hin.
»Was ist das für eine erbärmliche Schmiererei?«
»Das ist Stenographie.«
»So? Stenographie? Auch wieder so ein Mittel, um den Lehrer zu hintergehen! Ich muß Ihnen sagen, daß ich von solchen Geheimschriften absolut kein Freund bin. In meinen Stunden wird so geschrieben, daß es jedermann lesen kann!«
»Das kann jedermann lesen, – vorausgesetzt natürlich, daß er's gelernt hat. Auch die gewöhnlichste Schrift ist nur dem leserlich, der sie versteht.«
»Lassen Sie Ihr Geschwätz, und schreiben Sie weiter!«
Noch drei oder vier Sätze brachten wir so zu Papier. Dann fingen wir an, die denkwürdigen Phrasen ins Lateinische zu übertragen.
»Boxer, warum schreiben Sie nicht?«
»Ich habe Kopfweh! Sechs Stunden Gymnasium sind mir gerade genug.«
»Sie lernen mir jetzt auch den zweiten Gesang der Odyssee auswendig!«
»Damit sich mein Kopfweh noch steigert? Damit ich schließlich eine Gehirnentzündung bekomme?«
»Kein Wort mehr, oder ich weise Ihnen die Tür!«
Die Klasse begann wieder zu lachen. Auch Boxer konnte nicht umhin, sich trotz seines Kopfwehs aufrichtig zu beteiligen.
»Was? Sie wollen mir hier Gesichter schneiden? Augenblicklich gehn Sie hinaus!«
»Gern, Herr Professor, sobald der Quaddler mit dem Schmelzer gekommen ist.«
»Ja so … Der Mensch bleibt in der Tat über alle Begriffe lang'! Heppenheimer, sehen Sie mal nach … Das heißt … Ich will sagen … Es ist gut! Halten Sie sich an die Arbeit!«
So verstrich eine Viertelstunde. Da knarrte es auf den Dielen des Korridors.
»Herr Professor, der Schmelzer war nicht zu Hause, und damit Sie nicht so lang warten müssen und denken, ich bin etwa nachlässig im Dienst, so wollte ich mir erlauben, Ihnen dies kurz zu melden. Ich gehe jetzt gütigst zum Burkhardt.«
»Sie sind der bornierteste Mensch, der mir je vorgekommen!« wetterte Brömmel in heller Verzweiflung. »Denken Sie, ich habe Lust, hier bis morgen früh Quarantäne zu halten?«
»Aber der Herr Professor werden so frei sein … insofern Sie mir doch gesagt und vermeldet haben, und der Schmelzer doch ganz in der Nähe wohnt …«
Brömmel verließ den Katheder und stürmte in ohnmächtigem Zorn nach der Tür. Mit geballter Faust schlug er wider die Bretter.
»Danken Sie Ihrem Schöpfer, daß die Tür uns trennt«, ächzte er, kaum noch der Sprache mächtig.
»Gott verzeih' mir die Sünde, der Herr Professor sind ja furchtbar erregt! Da will ich mich doch recht beeilen, damit ich ja zur pünktlichen Zeit wieder da bin!«
Und fort war er, ehe Brömmel etwas erwidern konnte.
Wilhelm Rumpf hatte sich bis dahin abseits im Hofe herumgetrieben und die Situation auskundschaftet. Er benutzte den[134] günstigen Moment, um unbemerkt den Schlüssel wieder ins Schloß zu stecken.
Brömmel saß inzwischen, von heftigen Gemütsbewegungen hin und her geschüttelt, auf dem Lehrstuhl. Sein ganzer Habitus verriet, daß er alle moralische Kraft aufwenden mußte, um nicht in schäumende Wut auszubrechen. Mit den Fingern der rechten Hand trommelte er in heftigem Dreivierteltakt auf die Kathederfläche. Ab und zu nickte er verzweiflungsvoll lächelnd vor sich hin, als wollte er sagen: »Sehr gut, wirklich, ganz ausgezeichnet! So etwas kann auch nur in Sekunda passieren!« Dann warf er wieder den Kopf in den Nacken und zuckte die Achseln. »Die ganze Sache«, so ließ sich diese Geste interpretieren, »ist mir zu erbärmlich, um mich darüber zu ärgern. Dumme Jungens seid Ihr allesamt, den Quaddler mit eingerechnet! Wenn ich doch endlich einmal dieses Gymnasium mit seinen fatalen Auftritten los wäre! – Aber die Professur an der Hochschule will noch immer nicht kommen, trotz meiner epochemachenden Studie über das griechische Medium! Das wahre Verdienst wird niemals erkannt! Fluch über dies Zeitalter!«
Endlich, endlich erschien Quaddler mit dem sehnsuchtsvoll erwarteten Burkhardt.
Der Schlossermeister war im höchsten Grad ungehalten.
»Sie denken, ich kann um jede Lumperei abkommen«, sagte er noch im Treppenbau. »Es ist jetzt verdammt schlimme Zeit: die Gesellen sind fort, und der Lehrbub versteht nichts. Um ein Schloß aufzumachen, läuft man nicht so ohne weiteres drei Meilen weit. Die paar Kreuzer machen die Suppe nicht fett!«
»Aber erlauben Sie gütigst,« erwiderte Quaddler, »das gehört doch sozusagen in Ihr Geschäft, und wo die Pflicht Ihres Amtes …«
»Ach was,« versetzte Burkhardt, »ich habe kein Amt, und der Teufel soll's holen, wenn ich alle Naselang aus der Werkstatt geholt werde! Das nächste Mal setz' ich Ihnen zwei Gulden auf Rechnung. Ich danke dafür, den halben Nachmittag zu vertrödeln, wenn die Leute einmal einen Schlüssel verlegen.«
So traten sie vor die Tür.
»Aber was wollen Sie denn eigentlich?« schrie Burkhardt, den armen Quaddler wütend am Arme schüttelnd. »Da steckt ja der[135] Schlüssel! Himmelschockmillionendonnerwetter, denken Sie vielleicht, Sie können mich hier, wie ein böser Bube, zum Narren halten?«
»Ja, aber bester Herr Burkhardt, das geht nicht mit rechten Dingen zu! Vorhin stak der Schlüssel nicht, das kann ich beeidigen.«
»So? Können Sie das beeidigen? Na, mir sollen Sie wieder kommen mit Schlösseraufmachen! Einen alten Hund werde ich tun, aber nicht wieder mit Ihnen herlaufen, Sie alter, versoffener Pfannenschmied!«
Der Schlossermeister eilte fluchend die Treppe hinab. Quaddler aber stand wort- und regungslos da, eine männliche Niobe.
»Nun, wird's bald?« rief Doktor Brömmel, an der Türklinke rüttelnd.
Der Pedell seufzte. Dann drehte er in völlig geknickter Stimmung den Schlüssel um.
»Hören Sie,« begann Doktor Brömmel in strafendem Tone, »ich glaube, Sie selbst haben in Ihrer bodenlosen Zerstreutheit den Schlüssel da abgezogen! Ich hasse nichts mehr als die Zerstreutheit. Wiederholt sich dergleichen, so werde ich dafür sorgen, daß Ihnen von höchster Stelle aus ein Verweis erteilt wird.«
»Herr Professor, so wahr ich hoffe, dereinstens selig zu werden …«
»Das kann jeder sagen.«
»Das finde ich auch«, meinte Boxer. »Wie die Dinge liegen, kann nur Herr Quaddler die Tat verübt haben.«
»Da hören Sie's«, eiferte Brömmel.
»Aber ich will augenblicklich des Todes sterben …«
»Schweigen Sie! Nur von außen kann der Schlüssel herumgedreht worden sein, und Sie allein sind draußen gewesen. Ihr hartnäckiges Leugnen ist geradezu abgeschmackt. Ich werde dem Herrn Direktor nunmehr sofortige Anzeige machen.«
Wilhelm Rumpf, der diese Verhandlungen aus einer Ecke des Korridors mit anhörte, verspürte bei den strengen Worten des Professors etwas wie Mitleid. So trat er denn plötzlich ins Schulzimmer und rief atemlos:
»Ach, Herr Doktor, ich bin rein außer mir! Wie ich vorhin das Zimmer verließ, war ich so in Gedanken, daß mir ein Unglück[136] passierte. Ich glaubte, ich wäre daheim. Denn wissen Sie, Herr Professor, Sie sprechen gerade so, wie mein Hauswirt … Ich weiß selbst nicht, wie es gekommen ist … In der Zerstreutheit zog ich den Schlüssel ab …«
»Knebel, schreiben Sie mal ins Tagebuch: ›Rumpf wegen groben Unfugs mit einem Tage Karzer bestraft‹. Wenn Sie wieder ein Märchen aushecken, so lügen Sie weniger ungeschickt!«
»Ein Märchen?« rief Wilhelm im höchsten Pathos. »Ich rede die Wahrheit! Wer sich schuldig fühlt, der bleibt im Verborgenen! Ich aber trete kühn vor Sie hin, um den Quaddler vom Verdacht zu befreien …«
»Ach ja, Herr Rumpf,« murmelte Quaddler gerührt, »das ist wirklich recht schön von Ihnen! Ich hab's ja immer gesagt, der Rumpf ist gar so kein übler Schüler nicht.«
»Es bleibt dabei«, sagte Brömmel, den Hut aufsetzend. »Wenn Sie wirklich so über alle Begriffe zerstreut sind, wie Sie behaupten, so geben Sie künftighin besser acht! Ich kann die Zerstreutheit nicht leiden! Und Sie, Quaddler, werden von jetzt ab den Schlüssel inwendig stecken lassen. Wenn uns dann jemand einschließt, können wir wenigstens öffnen, ohne den Schlosser zu rufen. Adieu!«
»Seien Sie ruhig, Herr Rumpf,« flüsterte Quaddler beschwichtigend, »ich will Ihnen die zwölf Kreuzer Pedellengebühren für den Tag Karzer nicht anrechnen!«



Noch in Tertia hatte das Wort Karzer für unsere Ohren etwas Dämonisch-Furchtbares. Wir glaubten synonyme Anklänge an »Schafott« oder »Bagno« herauszuhören. Die wenigsten von uns hatten die geheimnisvollen Räume, die der Pedell Quaddler mit seinen riesigen Schlüsseln verwahrte, auch nur zu Gesicht bekommen, denn die Karzerstrafen gehörten in Tertia zu den größten Seltenheiten. Man züchtigte unsere kleinen Vergehen einfach durch sogenanntes Nachsitzen, d. h. man sperrte uns nach Schluß der Unterrichtsstunden in ein Schulzimmer. Diese Methode ward bei leichteren Vergehen auch in Sekunda noch angewendet. Nur Prima besaß das Privilegium der ausschließlichen Karzerverbüßung; daher denn in Sekunda diejenigen Schüler, welche »hinauf« unter die Botmäßigkeit des Pedells wandelten, mitleidig auf die bloßen Nachsitzer herablächelten.
In Sekunda nämlich ging mit den stillen Tertianern eine eigentümliche Wandlung vor. Das System der Doppelklassen übte hier seine antipädagogische Wirkung. Wenn die Oberstudienräte alles aufböten, um die Schüler zu demoralisieren, so könnten sie keine praktischere Einrichtung treffen, als diese zweijährige Dienstzeit. Sexta, Quinta, Quarta und Tertia waren auf einen Kursus von nur einem Jahre berechnet; in Sekunda aber rückten jedesmal zu Ostern die Tertianer als Untersekundaner ein, während die bisherigen Untersekundaner zu Obersekundanern emporstiegen. Der Unterricht fand gemeinsam in demselben Raume statt. In litteris ward durch diese Verschmelzung manches gewonnen: schon der Umstand, daß man auf diese Weise dem Wetteifer der Jüngeren mit den Älteren[138] ein weites Feld eröffnete, darf nicht unterschätzt werden. In moribus aber verhielt sich die Sache umgekehrt. Es gab keine schroffere Kluft, als die zwischen dem respektvollen Tertianer und dem kecken, krawallsüchtigen Schüler Sekundas. Mit Staunen und Neid sah der zum Untersekundaner avancierte Tertianer die edle Ungebundenheit seiner neuen Mitschüler, und schon nach wenigen Tagen regte sich der Nachahmungstrieb. Derselbe Wetteifer, der auf dem Gebiete der Wissenschaft Gutes erzielte, lieferte auf dem des Betragens die unbequemsten Resultate. Man beobachtete, daß die Phrase: »Sie gehn mir einen Tag auf den Karzer!«, die in Tertia von geradezu niederschmetternder Wirkung gewesen wäre, hier fast ohne Einfluß auf das seelische Gleichgewicht der betroffenen Märtyrer blieb. Man konstatierte, daß diese Obersekundaner absolut aufgehört hatten, an die Furchtbarkeit des diabolischen Schrecknisses zu glauben. Und so verschwand denn auch bei uns Jüngeren rasch die letzte Spur jener Karzer-Religiosität, die uns in Tertia so magisch gebannt hatte. Der Mensch, der die physikalischen Gesetze des Gewitters kennen lernt, hört auf, vor dem Jupiter tonans zu bangen; die Vertrautheit, welche der Astronom mit den Problemen der Verfinsterungen bekundet, tötet die heilige Scheu vor dem Schwinden des Sonnenballs. So verloren auch wir den geheimen Schauder, nachdem wir die Erfahrung gemacht hatten, daß sterbliche Menschen, wie wir, ganz behaglich mit diesem Orkus verkehrten und ohne Herzenskrämpfe den Nachen Charon-Quaddlers bestiegen.
Es war gerade vier Wochen nach Antritt meiner Sekundanerschaft, als ich zum erstenmal für sechs Stunden »unter das Dach« verbannt wurde. Ich hatte, wegen einer kleinen Störung von »vier bis fünf« im Arrest behalten, diese Zeit der Knechtung dazu benutzt, in Gemeinschaft mit zwei Leidensgefährten sämtliche Kleiderhaken des Schulzimmers um ihre Achse zu drehen, ein Prozeß, der mit einer radikalen Zerstörung identisch war. Noch begreife ich nicht, wie unsere Naivität hoffen mochte, die Tat werde unbestraft bleiben. Denn Quaddler, der gewissenhafteste Pedell seines Jahrhunderts, hatte uns sorgfältig eingeriegelt, so daß also die Unmöglichkeit, einen unbekannten Quidam für die Zerstörung des Gymnasialeigentums verantwortlich zu machen, jeder logischen Natur[139] einleuchten mußte. Nur eine Persönlichkeit existierte, der wir unseren Frevel aufbürden konnten: Quaddler selbst, der jedesmal nach Entlassung der Arreststräflinge das Lokal reinigte. Dieser höchst unwahrscheinliche Ausweg mochte unserem Zerstörungstrieb hinreichend bedünken. Kurz und gut, wir hatten die verbrecherische Abdrehung ohne jede Besorgnis vor den möglichen Folgen bewerkstelligt, und mit siegesgewissem Lächeln zogen wir, als die Stunde unserer Haft zu Ende war, an dem öffnenden Quaddler vorüber ins Freie. Der brave Pedell entdeckte natürlich sofort, was seine Schutzbefohlenen gesündigt; und ehe er des folgenden Tages zum drittenmal geläutet hatte, waren wir angezeigt. Mit blödem Zynismus wagten wir, unser Vergehen in Abrede zu stellen. Aber Quaddler stand zu fest in der Hochachtung seiner Gebieter, als daß man sein Zeugnis bezweifelt hätte. So räumten wir denn endlich ein, was nicht länger zu leugnen war, und ernteten als Lohn die beregte sechsstündige Karzerstrafe.
Es war doch ein eigentümliches Gefühl, als man so die enge Treppe hinaufwandelte und zum erstenmal die kahlen, weiß gestrichenen Eingänge der Zellen erblickte!
Quaddler war bei solchen Anlässen stets von ausgezeichneter Höflichkeit.
»Wollen die Herren Sekundaner nur hereinspazieren«, sagte er mit einer chevaleresken Handbewegung; »und dann möchte ich mir gütigst erlauben, daß Sie ja nicht zu viel klingeln, indem von wegen der Störung, weil nämlich die Herren Lehrer, insofern sie den Unterricht erteilen, bei fortwährendem Geklingel nicht fortsetzen können.«
Er hatte seine guten Gründe, der ehrliche Quaddler, warum er die Karzer-Delinquenten stets so höflich apostrophierte. Von jeder Stunde, die wir verbüßen mußten, erhielt er einen Kreuzer süddeutscher Währung, und ich versichere feierlichst, er stand sich nicht übel bei diesem Zuschuß! Mit edler Pflichttreue brachte er jeden Verstoß gegen die Gymnasialgesetze zur Anzeige, und ehe ein Frevler gezüchtigt war, kannte seine moralische Entrüstung keine Grenzen. Sobald aber der Mund des Lehrers die Strafe diktiert hatte, sobald war das sittliche Bewußtsein im Busen Quaddlers befriedigt, und er kehrte die volle Schönheit seiner Humanität[140] heraus. Ja, er empfand etwas wie Liebe für seine Sträflinge; nur mußte man sich völlig der Hausordnung fügen, denn in diesem Punkte war er Pedant.
Er öffnete also und ließ uns eintreten in die Hallen der stummen Verbannung. Wohl gemerkt: jeden einzelnen in ein besonderes Lokal; denn gerade durch das System der Einzelhaft unterschied sich der Karzer von dem milderen Arrest.
Die Türen fielen krachend ins Schloß, die Schlüssel drehten sich um – fast so geschwind wie jene unglückseligen Kleiderhaken –, Quaddler tappte wuchtigen Trittes nach der Türe der Vorflur, schloß auch diese und eilte die Treppe hinunter.
Da saßen wir denn zum erstenmal auf dem Karzer! Das Krachen des Schlüsselumdrehens war das Totenlied unserer Freiheit gewesen.
Verglichen mit dem Arrest, durfte der Karzer für eine weit entschiedenere Absperrung von der bürgerlichen Gesellschaft gelten. Während jener Stunde, die wir zur Abdrehung der Kleiderhaken benutzt hatten, war, wie manchesmal, eine Erholungspause mit behaglichem Fensterschauen verbracht worden. Hier, wo sich das einzige Fenster hoch an der Decke befand, war diese Zerstreuung um so weniger zu erreichen, als das Fenster durch ein starkes Gitter vor unseren Zudringlichkeiten geschützt war. Auch die sonstige Einrichtung unserer Zelle erschien minder behaglich als die Räume Sekundas. Ein kleines, weiß getünchtes Stübchen, dessen einziges Ameublement in einer Pritsche, einem Tisch und einem Stuhle bestand! Und die Pritsche war hart, und der Stuhl war noch härter! Auf dem Tische nahmen sich die wenigen Bücher, die wir mitgebracht hatten, schrecklich verödet aus, und der kleine, schwarze Ofen in der Ecke schien vor Melancholie verrosten zu müssen …
Eine Weile übte dieser erste Eindruck auf unsere Lebensgeister seine abdämpfende Wirkung aus; nach und nach jedoch erwachten wir zum frohen Bewußtsein, daß sechs Stunden keine Ewigkeit sind, und das erste Symptom dieser neu sich regenden Elastizität war ein Ruf an die Adresse des Nachbars.
»Du, Knebel, hier ist's äußerst gemütlich! Wie ist's bei Dir?«
»Famos«, antwortete Knebel.
Jetzt vernahm ich auch die undeutliche Stimme des dritten Dulders, dessen Zelle von der meinen durch die Knebels getrennt war. Es gewährte mir eine besondere Genugtuung, mit diesem fernen Freunde durch das Medium Knebels zu korrespondieren.
»Du, Knebel!«
»Was?«
»Frag' mal den Scholz, was er treibt.«
Alsbald telegraphierte Knebel weiter:
»Du, Scholz, was treibst Du eigentlich?«
Ein dumpfer Klang war die Antwort, und alsbald gab mir Knebel zurück:
»Nichts.«
»Ganz mein Fall«, sagte ich freudig erregt.
Pause.
»Du, Knebel!«
»Was?«
»Ich klingle jetzt!«
»Gut!«
Und nun zog ich die Klingel.
Es dauerte einige Minuten; dann klirrte die Tür der Vorflur, und Quaddler erschien vor den Zellen.
»Wer hat geklingelt?« fragte er unwillig.
»Ich, Herr Quaddler, ich«, rief ich, an die Tür pochend.
»Ich bin ja kaum zehn Minuten drunten«, gab Quaddler zur Antwort. »Was wünschen Sie?«
»Ach, Herr Quaddler, mir ist auf einmal so schlecht geworden. Bitte, lassen Sie mich gleich mal hinaus.«
Quaddler brummte etwas in den Bart und drehte den Schlüssel um.
»Ich sag' Ihnen, Herr Quaddler, ich hab' ein solches Leibweh bekommen! Ich kann den Geruch der Tünche nicht recht vertragen. Sie täten wirklich besser, wenn Sie die Karzerzellen tapezieren ließen.«
»Das wäre gütigst zu kostspielig«, versetzte Quaddler ärgerlich. »Machen Sie jetzt nur mal, daß sie fertig werden und wieder hineinkommen. Ich habe dringende Geschäfte.«
»Ja, Herr Quaddler, das ist alles ganz gut, aber ich kann doch unmöglich …«
»Ach, die Herren Sekundaner haben allzeit eine Ausrede …«
Ich blickte mich jetzt auf der Vorflur um und sagte dann wohlwollend:
»Die Schränke da gehören wohl Ihnen? Sehr schöne Schränke, wirklich ganz ausgezeichnete Schränke. Es sind wohl Kleiderschränke?«
»Sozusagen teilweise«, erwiderte Quaddler sichtlich geschmeichelt. »Aber machen Sie jetzt nur rasch. Ich habe sehr wenig Zeit …«
Ich trat an einen der Schränke heran und befühlte ihn.
»Echtes Eichenholz«, sagte ich mit Kennermiene. »Wirklich, Herr Quaddler, ich beneide Sie. Wo haben Sie die Schränke eigentlich her?«
»Erlauben Sie gütigst, die Pflicht meines Amtes … Ich kann mit dem besten Willen nicht zugeben … Wollen Sie jetzt … oder wollen Sie nicht …?«
»Aber ich werde doch einmal Ihre Schränke betrachten dürfen …«
»Wenn Sie heute abend Ihre Strafe verbüßt haben, will ich mir gütigst erlauben, Ihnen die Schränke in allen Einzelheiten zu zeigen. Aber jetzt, inwofern Sie wirklich die Absicht haben …«
»Es ist hier draußen viel bessere Luft als drinnen«, sagte ich, auf ein anderes Thema ablenkend.
»O, da drinnen ist ganz gute Luft; und wenn die Herren Sekundaner die Haken abreißen, so ist die Luft längst schön genug, und ich muß jetzt in allem Ernste bitten, sich gefälligst beeilen zu wollen. Da schlägt's schon ein Viertel …«
»Ein Viertel! Wahrhaftig! Man soll's gar nicht sagen, wie doch die Zeit vergeht! Überhaupt, wenn man bedenkt … Wissen Sie noch, Herr Quaddler, wie ich in Quarta saß … Ich meine, das wäre erst gestern gewesen!«
»Wie Sie in Quarta saßen, hatten Sie gütigst viel weniger tolle Streiche im Kopfe, und wenn Sie ergebenst meinen, Sie könnten mich hier zum Narren halten, so werde ich dem Herrn Professor mitteilen, daß Sie immer sagen, Sie hätten Leibweh und könnten die Tünche nicht vertragen, und nachher von Quarta sprechen und doch nicht hineingehen.«
Mit diesen Worten trat er an die Tür der Zelle.
»Wollen Sie jetzt, oder wollen Sie nicht?«
»Es ist wirklich merkwürdig, Herr Quaddler,« sagte ich, tief Atem holend, »die kühle Luft hier draußen hat mich auf wunderbare Weise gestärkt. Es ist mir gar nicht mehr übel, und wenn Sie erlauben, verfüge ich mich wieder in meine Zelle.«
»Sie werden ja sehen, was Sie sich anrichten.«
»Aber zum Donnerwetter, wenn sich mein Leibweh doch gebessert hat! Soll ich denn nur, um Ihnen einen Gefallen zu tun …«
»Was? Donnerwetter wollen Sie sagen? Ei, zum Donnerwetter, das laß ich mir nicht gefallen. Wofür halten Sie mich? Marsch in die Zelle!«
»Quaddler, Quaddler, werden Sie nicht unangenehm.«
»Ach, ich bin's müde, mich von Ihnen hänseln zu lassen!« Und krach! flog die Tür zu, und brummend schlich der ehrliche Schließer von dannen.
Abermals ein kurzes Zwiegespräch mit dem trefflichen Knebel.
»In zehn Minuten ist die Reihe zu schellen an mir«, rief er jauchzend. »Der Quaddler soll doch wissen, wofür er das schwere Karzergeld einheimst.«
Ich benutzte die Frist bis zur nächsten Quaddler-Episode, um mich im Innern meiner Zelle etwas gründlicher umzusehen.
Wenn ich die Mauern meines Verließes vorhin »weiß getüncht« nannte, so war dies insofern inkorrekt, als die ursprüngliche Reinheit des Kolorits längst einem Zustande schwarz gesprenkelter Unsauberkeit Platz gemacht hatte. Da existierte kaum ein Fleckchen, wo nicht ein Tintenklex, eine Inschrift oder eine groteske Zeichnung prangte, so daß einzelne Partien der Wandfläche den Eindruck einer fast regelmäßigen Marmorierung hervorriefen.
Ich trat näher herzu: Hunderte von Vorgängern hatten hier eine beredte Erinnerung an durchlittene Stunden zurückgelassen … Ich bekenne, daß mich dieser augenscheinliche Beweis von dem socios habuisse malorum äußerst behaglich anmutete. Und dabei ersah ich aus den meisten dieser Ergüsse, daß die Schmerzen des Karzers keineswegs den guten Humor schädigten: eine Wahrnehmung, die sofort in meinem eigenen Busen verwandte Regungen weckte.
Da stand z. B. in großen lateinischen Lettern, fast unmittelbar an der Decke:
Und gleich daneben von derselben Hand:
Ein Ungenannter verstieg sich zu folgendem Stoßseufzer:
Darunter in schöner Frakturschrift:
Und hiervon links:
Illi robur et aes triplex circa pectus erat, qui primus fragilem discipulum carceri commisit.
Ein gewisser Ittmann, künftiger Philologe von Fach, hatte einen Vers des Tyrtäus in den Kalk eingekratzt und dann die Vertiefungen mit Rotstift bemalt, so daß da fast in der Weise einer pompejanischen Mauerinschrift zu lesen war:
Zu deutsch:
Auf der entgegengesetzten Wand las ich die schwungvollen Verse:
Ganz ähnlich hatte sich mein Mitschüler Schwarz vernehmen lassen, der ausnahmsweise bereits in Tertia »unter das Dach« geschafft worden war. Er schrieb:
O Fanny, himmlisches Mädchen, wenn Du, Engelgleiche, mich lieben wolltest, ich ließe mich gern Zeit meines Lebens hier einsperren.
Dein treuer Seelsorger
G. Schwarz.
In kecken Lettern prangte unmittelbar darunter folgender Passus:
Wilhelm Rumpf, weil er dem Dr. Klufenbrecher Kirschkerne unter den Stuhl gelegt hat, mit acht Stunden Karzer bestraft. Gott, wie wenig!
Ein Jüngling namens Fresenius ließ sich also vernehmen:
E. P. aus L. schrieb das Nachstehende:
Wie, schnöder Quaddler, Du weigerst Dich, zu öffnen, wenn ich klingele? Wahrlich, ich klingele nicht aus Übermut, sondern aus Not … Nun, ich spreche mit einer leichten Variation des Horaz:
Aquam memento rebus in arduis servare.
Das waren so die pikantesten und witzigsten Scherze dieser Wandliteratur. Andere Aufzeichnungen entbehren der Pointe, wie z. B. die echt sekundanerhafte Lobrede auf des Pedells liebreizendes Töchterlein:
Anny Quaddler est virgo venustissima, dulcissima, placentissima. Basia ei dare velim quam plurima. Pedes habet elegantissimos, genua rotundissima et cetera.
Natürlich fehlten auch die gröberen Lästerungen, Zynismen und Cochonnerien nicht. Es hat von jeher eine stark verbreitete Sorte von Schülern gegeben, die den Mangel an Esprit und Humor durch einen scharf ausgeprägten Kultus der Zwei- und Eindeutigkeiten zu ersetzen suchen, geistlose Zotenjäger, die in jedem Kleiderhaken einen Phallus erblicken, ohne imstande zu sein, ihre Sottise in ein erträgliches Epigramm zu kleiden. Auch diese Dunkelmänner hatten reichlich zur Beklecksung der Karzerwände beigetragen; aber es fehlte ihren Skripturen auch jene bescheidene Dosis von Salz, die man einem christlich-germanischen Sekundaner zumuten darf.
Ich wurde aus meinen Betrachtungen durch Knebels Geklingel jählings emporgeschreckt. Drei Minuten später ertönten auf dem Korridor wieder die Schritte Quaddlers. Knebel begann ein entsetzliches Ächzen und Stöhnen.
»Ach, Herr Quaddler, ach, um Himmels willen, was ist mir so schlecht! Machen Sie schnell auf! Ich muß mich fürchterlich übergeben! Schnell, schnell! Ach du lieber Gott, ist mir schlecht!«
»Herr Knebel,« begann Quaddler mit einer Stimme, aus der man sein olympisches Stirnrunzeln hervorlas, »ich sage Ihnen, ohne Scherz, wenn Sie mir so kommen, so werden Sie sich ergebenst täuschen.«
Knebel stieß einige ganz entsetzliche Würgtöne aus und bat dann von neuem in kläglichster Melodie um Öffnung der Zelle.
Wütend stieß Quaddler die Tür auf.
»Gott sei Dank! Das war gerade zur rechten Zeit. Ach, Herr Quaddler, was ist mir so schlecht! Lassen Sie mich nur ein Viertelstündchen hinaus.«
»Das geht nicht«, versetzte der Pedell, durch die Naturwahrheit, mit welcher Knebel seine merkwürdige Rolle spielte, stutzig gemacht.
»So holen Sie mir rasch etwas frisches Wasser«, stöhnte der Heuchler, von neuem glucksend und gröhlend. »Ach, wenn das meine Mutter wüßte! Ach Gott, wie ist mir so schlecht!«
»Gut, das Wasser sollen Sie haben. Aber das sag' ich Ihnen, treiben Sie mir nicht die Sache zu weit, und ulken Sie mich nicht alle Augenblicke herauf. Ich bin nicht zu Ihrer Bedienung da, das müssen Sie sich nicht einbilden.«
Mit diesen Worten entfernte er sich. Die Zelle Knebels hatte er offen gelassen; der Verschluß des Korridors genügte ja! Knebel aber hatte nichts Eiligeres zu tun, als mir und unserem Kameraden Scholz das Verließ zu öffnen und so auf der geweihten Domäne Quaddlers eine Dreimännerversammlung höchst revolutionärer Art ins Leben zu rufen. Unsere Verabredungen waren in Kürze getroffen. Scholz versteckte sich hinter einem der Schränke, nachdem wir vorher seine Zelle sorgfältig verschlossen hatten. Ich selbst begab mich in mein Gefängnis zurück und wartete, bis Knebel seine Übelkeitsangelegenheiten geordnet hatte. Dann, um der Möglichkeit einer Visitation bei Scholz vorzubeugen, klopfte ich und bat mir ebenfalls ein Glas frisches Wasser aus, wobei ich durch allerlei gekünstelte Phrasen die Ungeduld Quaddlers so sehr steigerte, daß er schwur, er werde nicht mehr heraufkommen, und wenn wir die Klingel abrissen.
Weiter wünschten wir nichts.
Nachdem Quaddler verschwunden war, trat Scholz aus seinem Versteck heraus, drehte die Schlüssel unserer beiden Zellen um, und siegesfroh sanken wir uns an die brüderlich klopfenden Herzen. Ein brillanter Skat (Scholz trug immer die Karten bei sich) vereinigte uns für den Rest unserer Strafzeit in fröhlicher Ungezwungenheit. Einmal noch hatten wir, nachdem wir alle nötigen Vorbereitungen getroffen, den Pedell herauf zitiert; unsere dauernde Ruhe hätte seinen Verdacht erregt. Im übrigen blieben wir unbehelligt. Und so endete denn unser erstes Karzererlebnis in jeder Hinsicht befriedigend.
Mein zweiter Aufenthalt in »Quaddlers Dachkammern« steht mir nicht minder klar im Gedächtnisse wie mein Debüt. Späterhin haben die Eindrücke sich verwischt. Die »halben« und die »ganzen« Tage wiederholten sich zu massenhaft, als daß jede einzelne Perle dieses Rosenkranzes in meiner Erinnerung aufgezeichnet sein könnte. Damals aber war meine Seele in Karzerangelegenheiten so jungfräulich, daß selbst das geringste Ereignis eine unauslöschliche Spur zurückließ.
Es war drei Wochen seit jener ersten sechsstündigen Skathaft. Ich hatte diesmal einen vollen Tag zu verbüßen, und zwar in Gemeinschaft mit Wilhelm Rumpf, der Krone und dem Spiegel aller deutschen Gymnasialschüler. Die Ursache unserer Schicksale war nicht die gleiche. Rumpf hatte sich einer tätlichen Mißhandlung des zart organisierten Salonschülers Heinrich von Sternberg erfrecht, ich aber war, so seltsam es klingen mag, ein Opfer meines früh entwickelten Patriotismus geworden.
Zur Zeit meiner Sekundanerschaft florierte nämlich die Tätigkeit des Nationalvereins. Unser damaliger Geschichtslehrer, übrigens einer von den wenigen Pädagogen, die es verstanden, ihren Schülern wirkliches Interesse einzuflößen, benutzte eine Vorlesung über die französische Revolution, um den Nationalverein und seine Bestrebungen mit den terroristischen Klubs von Paris zu vergleichen. Teils aus Frömmig-, teils aus Zeitvertreib – wie die berühmte Dame des[148] deutschen Volksliedes –, ich will sagen, halb aus Liberalismus, halb aus Freude am Stören und Widersprechen, stand ich auf und erklärte dem »großdeutsch« gesinnten Lehrer feierlich, es sei mir leider unmöglich, seine politischen Anschauungen zu teilen. Der Ordinarius von Sekunda zähle ja persönlich zu den Mitgliedern des Nationalvereins, ohne daß man behaupten könne, derselbe habe Ähnlichkeit mit Robespierre oder Marat. Das war nun freilich eine für den Lehrer sehr unangenehme Gegenrede, denn die Tatsache von der Mitgliedschaft des Ordinarius ließ sich nicht abstreiten. Der Herr Professor mochte überdies der berechtigten Ansicht huldigen, meine Opposition habe etwas von der prinzipiellen Feindseligkeit der »Unversöhnlichen«. Er schritt zur Gewalt und verbannte mich wegen frecher Störung für zwölf Stunden ins Gymnasialgefängnis.
Man hatte diesmal mit diabolischer Tücke den Sonntag für die Verbüßung der Haft festgesetzt, eine Maßregel, die unser Schicksal bedeutend erschwerte.
Schon um drei Viertel auf sieben mußte ich mich den Armen des Schlummers entreißen, der uns Schülern doch gerade den Sonntagsmorgen so lieb und wert vor allen übrigen machte! Nicht ohne eine gewisse Verstimmung wanderte ich durch die stillen Gassen, deren geschlossene Läden mich höhnisch angrinsten, als wollten sie sagen: Ei, schon so frühe? Wir beginnen unser Tagewerk noch lange nicht! Wohin denn mit deinen Büchern und deiner Schulmappe? So viel wir wissen, gibt es doch heute keine Lektionen …?
Nun, sprach ich zu mir selbst, ich werde den Tag schon herumbringen; und stolzen Hauptes wanderte ich an den schloßverhangenen Buden vorüber. Goethe hat es gesagt: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister! … Ich werde dem Schicksal beweisen, daß die Freiheit selbst in dem Kerker wohnt!
Am Brandplatze begegnete mir der alte Registrator Bieler, ein bekannter Frühaufsteher, der seinen Spaziergang machte. Als ich ihn grüßte, bemerkte ich, daß über seine Lippen ein halb sarkastisches, halb mitleidiges Lächeln glitt. Auch nickte er so ganz eigentümlich still vor sich hin … Die verwünschten Bücher! Die niederträchtige Schreibmappe! Ich fühlte, ich war erkannt. Mit dem feierlichen[149] Ernst eines alten Römers gelobte ich mir, in Zukunft meine Bücher stets am Tage zuvor bei Quaddler zu deponieren.
Und nun betrat ich das Gymnasialgebäude.
Wie öde, wie leblos dehnten sich diese Mauern! Hier, wo sonst das lauteste, regste Treiben herrschte, wo das Gelächter chronisch und das Gebrüll permanent war, hier thronte jetzt die dumpfe Majestät einer Grabesstille, die mir kalt auf die Seele fiel! Nichts ist trauriger als der Kontrast zwischen dem belebten und dem unbelebten Raum! Ein Schauspielhaus sieht nach beendigter Vorstellung weit trübseliger, ja in gewissem Sinne erschütternder aus, als die ödeste Heide … Nun, das Gymnasium ist ja auch eine Art Schauspielhaus, nur daß die Komödianten hier gleichzeitig das Publikum abgeben.
Langsam ging's die Wendeltreppe hinauf nach den Regionen des Dachstuhls … Rumpf war noch nicht da. Einsam verhallten unsere Tritte durch den weiten, schläfrigen Raum. Ich sprach keine Silbe. Mit einer Art von wollüstigem Grausen sog ich die Elegie dieser trübseligen Morgenstunde in mein Gemüt ein.
So war ich denn in die Zelle gelangt. Fünf Minuten später kam Wilhelm Rumpf, – ebenfalls sehr stumm und geräuschlos. Die Tür fiel hinter ihm zu: wir waren allein, – durch das gemeinsame Schicksal verbunden und doch getrennt durch die kalkbeworfene, inschriftenübersäte Wand.
Rumpf war der erste, der das feierliche Schweigen zu brechen wagte.
»Prosit!« rief er mit gewohntem Zynismus.
Der warme Klang dieser Stimme gab mir die volle Elastizität des Geistes wieder.
Ich antwortete, und so entspann sich ein brüderliches Gespräch, das endlich mit dem Bemerken abgebrochen wurde, man wolle zunächst etwas arbeiten, da ja der Tag lang und das dolce far niente gerade in diesen Räumen am wenigsten dolce sei.
Ich setzte mich an den Tisch und durchmusterte meine Papiere und Bücher.
Homer! Aufs Geratewohl schlug ich auf und las. Die frische Seeluft, die mir aus den Rhythmen des hellenischen Sängers entgegenwehte, paßte so wenig zu meiner Situation, daß ich nach kurzer[150] Frist das Buch zuklappte und hinauf nach dem spärlichen Stück blauen Himmels sah, das in wolkenloser Klarheit durch die vergitterte Luke herein glänzte. In der Tat, es gab keinen schrofferen Gegensatz, als zwischen jenem ungebundenen Abenteurer Odysseus, der mit den lieben Genossen die weintraubenfarbige Salzflut befuhr, und mir, dem gefesselten Sekundaner, der in den Karzerräumen eines deutschen Provinzgymnasiums für den Nationalverein büßte!
Meine Stimmung war jetzt, infolge der verschiedenen Wandlungen, die sie erlitten hatte, nachgerade bis zu dem Punkte gediehen, wo der deutsche Gymnasiast sich in Versen ergeht. Überhaupt war der Karzer für mich stets ein poetisch fruchtbarer Boden. Hier entstand mehr als ein Gedicht, das später mit geringen Veränderungen im Druck erschien, hier wurde gar mancher Ton angeschlagen, dem man nicht anmerkte, daß er dem Territorium Quaddlers entstammte. Auch die Primanerliebe fand die glücklichsten Momente ihrer lyrischen Gestaltungskraft auf dem prosaischen Karzer! Es klingt wunderbar, aber es ist so …
Ich setzte mich also wieder behaglich zurecht, breitete einen Bogen Papier vor mich hin und ergriff die Feder.
Was schrieb ich?
Ein Klagelied um »die sonnigen Tage von einst«!
Es ist eine sonderbare Erscheinung, die unter anderen auch Paul Heyse in der Novelle »Lottka« zum Ausdruck gebracht hat, daß die Jugend, die eigentlich noch kaum von einer Vergangenheit reden kann, mit Vorliebe ihren begrabenen Träumen, ihren zertrümmerten Hoffnungen nachweint. So singt der achtzehnjährige Paul in der tränenreichen Melodie des »long, long ago«:
Späterhin erscheint uns dergleichen fast unbegreiflich; aber wenn man mitten darin steckt, so kommt man sich mit seiner ganzen wehmuterfüllten Individualität so heilig und ernst vor, daß man jeden Zweifel mit Entrüstung von der Hand weisen würde.
»Die sonnigen Tage von einst« erleichterten mir das Herz, und in bester Laune benutzte ich die Rückseite des Blattes zur Abfassung eines Karzerhymnus, der in dröhnenden Rhythmen die Nichtswürdigkeit[151] dieser Anstalt vom Standpunkte der reinen Moral zu beleuchten suchte.
Mit einemmal ertönten die Kirchenglocken. Eine erneute Erinnerung an den Zustand der Unfreiheit! Sonst hatte uns jeder Sonntag, dafern wir die Stunde nicht ruchlos verschlafen, beim Vormittagsgottesdienst am Hause des Herrn gesehen. Ich sage »am« Hause des Herrn, denn wir standen davor, mit dem sehr weltlichen Zwecke, die schönen Töchter des Landes einwandeln zu sehen. Die Lehrer, insbesondere die Religionslehrer, hatten uns zwar vielfach Vorlesungen im Sinne der berühmten Londoner Anti-young-men-before-the-church-standing-association gehalten und uns schließlich gesagt, wenn wir denn absolut nicht von dieser Unsitte ablassen könnten, so möchten wir doch wenigstens nach stattgehabter Revue auch das Innere des Tempels besuchen; aber diese Mahnungen blieben fruchtlos. Wir überschritten nur selten die Schwelle. Nicht als ob wir schon damals sämtlich überzeugungsfeste Anhänger von Schopenhauer oder David Strauß gewesen, nicht als ob wir jeder Sympathie für die Kirche entbehrt hätten, nein, es war ein anderer Umstand, der uns zurückhielt: der Eifer nämlich, mit dem die Lehrer sich jeden, der beim Gottesdienste erschien, ins Notizbuch vermerkten. Nur eine ganz verschwindende Minorität strenggläubiger oder augendienerischer Alumnen frequentierte die Kirche trotz dieser unglückseligen Methode. Die Quartalzensur brachte dann unter den »Besonderen Bemerkungen« das herrliche Lob: »NB. Besuchte fleißig die Kirche …«
Jetzt tönten die Glocken durch die klare, friedliche Morgenluft. Ich glaube, wenn's mir in diesem Augenblicke freigestanden hätte, ich würde meine Zelle nicht nur mit dem Platz vor der Kirche, sondern auch mit der Emporbühne im Innern vertauscht haben, selbst auf die Gefahr hin, als kirchenfleißig notiert zu werden.
Rumpf schien von ähnlichen Gefühlen durchflutet. Denn mit einemmal rief er mir sonderbar gähnend zu:
»Du, es ist doch verflucht langweilig!«
»Es geht«, antwortete ich mit gut erkünstelter Überlegenheit. Es ging aber nur sehr mangelhaft!
Wilhelm Rumpf griff nun zu dem niemals versagenden, ewig vollgültigen Universalmittel des Klingelns. Quaddler erschien. Es entspann sich ein Dialog, nach dessen Beendigung der Pedell wieder verschwand, ohne daß sich unsere Situation im wesentlichen gebessert hätte. Der ehrliche Schuldiener mußte von unserer neulichen Skatpartie Wind bekommen haben, denn er weigerte sich hartnäckig, uns Wasser zu holen, solange Rumpf sich auf dem Vorflur befand. Deprimiert hörten wir seine nägelbeschlagenen Absätze treppabwärts poltern. Für diesmal schien aus unserer Partie Piquet, auf die wir so zuverlässig gerechnet hatten, nichts werden zu sollen.
Da fiel mein Blick auf das Fenster. Die Vergitterung war nicht in die Mauer eingelassen. Sie bestand vielmehr aus einer Art Rost, die man mit Schrauben an das Holzwerk befestigt hatte. Ein köstlicher Gedanke zuckte durch mein Gehirn. Wenn es uns gelang, diese Schrauben zu lösen, so konnten wir die Kommunikation, die auf normalem Wege durch die Türen unmöglich war, über das Dach bewerkstelligen. Die Neigung der schiefergedeckten Fläche war eine sehr mäßige – eine Gefahr also nicht vorhanden. Und überdies, was fragt ein deutscher Sekundaner nach der Gefahr, sobald es gilt, einen lustigen Streich auszuführen …!
Ich teilte meine Idee dem schandtatbereiten Freunde mit, der sie alsbald feurig ergriff.
Ans Werk also!
Ich rückte den Tisch gerade unter die Dachluke, stellte den Stuhl in die Mitte der geräumigen Platte und stieg dann langsam hinauf. Der improvisierte Bau war hoch genug, um das Gitterwerk in den Bereich meiner Hände zu bringen. Ich überzeugte mich, daß der eiserne Rost sich an der einen Seite wie ein Deckel in Scharnieren bewegte, während die andere Seite mit vier großen Schrauben an der Rampe des Fensters haftete. Wenn man diese vier Schrauben herauszog, so mußte das Gitter ganz nach Art einer Lukenklappe heruntersinken und die Fensteröffnung frei geben. Die Einrichtung hatte überdies den Vorteil, daß man die Spuren dieser rechtswidrigen Eröffnung wieder austilgen konnte. Eine einzige Schraube, nur zur Not eingedrückt, reichte aus, um das Gitter in der Schwebe zu halten, – ein Umstand, der nicht unterschätzt werden durfte. Der[153] Pedell stattete uns nämlich, so ungern er auf unser Klingeln erschien, mitunter Besuche aus dem Stegreif ab.
Da ich keinen Schraubenzieher besaß, so öffnete ich mein Taschenmesser, das mir in Gymnasialangelegenheiten stets ein unentbehrlicher Diener gewesen. Ich könnte über dies Taschenmesser eine lange Serie höchst stimmungsvoller Geschichten schreiben. Parenthetisch erwähne ich hier nur das Nachstehende: Es existierten innerhalb des Gymnasialgebäudes wenige Subsellien, in die ich nicht eine Anzahl sehr korrekt gemeißelter Inschriften eingraviert hätte. Nun gab es zwar einen Gesetzesparagraphen, der da besagte: »Es ist den Schülern dieser Anstalt aufs strengste verboten, in die Bänke, Tische, Stühle und sonstige Gerätschaften des Inventars Namen einzuschneiden.« Aber niemals hat zwischen der Praxis und der Theorie eine so unausgefüllte Kluft gegähnt, wie hier! Die Subsellien unseres Gymnasiums waren geradezu Musterkarten aller erdenklichen Schriftarten, von dem unbehilflichen Stümpern des Anfängers bis zur technisch vollendeten Leistung des Virtuosen. Da winkten in schöner Antiqua unzählige Josephinen, Mathilden, Henrietten und Wilhelminen; da prangten in prickelnder Perlschrift zierliche Disticha und geistvolle Quatrains; ja selbst Häuser, Bäume und ähnliche Gegenstände waren in ihren Umrissen dargestellt. Hutzler hat späterhin auf einem Tische der Prima einen großen Kanal gebaut, der in mehrfachen Windungen von dem einen Ende zum anderen lief und, wenn man den Tisch durch untergeschobene Bücher in eine schräge Lage versetzte, vollkommen geeignet war, einen Tintenstrom en miniature von der Quelle bis zur Mündung fließen zu lassen. Niemals, solange man denkt, ist ein Schüler wegen Einschnitzungen bestraft worden, obgleich der Pedell mit großem Eifer auf die Missetäter fahndete. Wir schnitten nämlich, um die Möglichkeit, aus dem Inhalt des Eingeschnittenen auf den Täter zu schließen, ein für allemal in der Wurzel zu ersticken, nicht selten die Namen solcher Schüler ein, denen man dergleichen wegen der musterhaften Korrektheit ihres Lebenswandels nicht zutrauen konnte. Ja, Boxer gravierte einmal in majestätischen Lettern: Samuel Heinzerling! Nachdem wir diesen Präzedenzfall geschaffen, durften wir getrost unsere eigenen Namen verewigen, denn nun war die Entschuldigung gestattet: alius fecit!
Der Leser könnte nun fragen, ob denn ein Schluß von dem Platz auf den Täter nicht viel korrekter gewesen wäre. Jawohl! So leicht faßt man uns nicht! Alle acht Tage wurden infolge der exercitia pro loco die Plätze gewechselt. Wenn jemand also einen besonders auffallenden Einschnitt verbrochen hatte, so machte er die Spuren seiner Tätigkeit für die nächsten acht Tage unkenntlich. Das geschah auf folgende Weise: In erster Linie ward die helle Schnittfläche mit Tinte behandelt, so daß sich der Einschnitt durch nichts von den übrigen, ebenfalls schwarz und alt aussehenden, unterschied. Dann füllte man die Vertiefungen dergestalt mit festgeknetetem Brot aus, daß die Fläche wiederhergestellt war. Hierüber legte man abermals eine Lage von Tinte. Da die ganze Tischfläche schwarz und überdies ziemlich rauh und zerklüftet war, so hätte man jeden Quadratzoll genau untersuchen müssen, um die betreffende Stelle zu finden. Nach vierzehn Tagen, wenn der Täter längst an einem andern Platze saß, hob er vor dem Beginn der Lehrstunde die jetzt dürr gewordene Brotfüllung heraus, und wie mit einem Zauberschlage stand die ganze Inschrift in ihrer vollen Glorie auf der verwandelten Fläche. Wurde Quaddler jetzt wirklich durch diese Novität befremdet, so war man jeder Verantwortung überhoben; der Schüler aber, der neu auf den verfänglichen Platz versetzt worden war, erklärte auf eine etwaige Interpellation sittlich entrüstet: »Aber ich sitze ja hier erst seit gestern, und um das einzuschneiden, braucht man doch mindestens acht Tage!« Der Lehrer ließ dann die Sache aus Opportunitätsgründen »auf sich beruhen«.
Dieses bedeutsame Messer also, das hornumschiente, wie Homer sagen würde, zog ich aus der Tasche und begann meine Operation. Die Schrauben saßen verzweifelt fest, – aber nach Verlauf einer halben Stunde und mit Aufopferung einer Klinge gelang es mir doch, mein Problem zu bewältigen. Das Gitter senkte sich geräuschlos. Ich faßte rechts und links den Lukenrand und schwang mich empor.
Ein wunderbarer Anblick belohnte mich. Da unten tief lag der große, stille, einsame Platz. Gegenüber das gewaltige Zeughaus, dessen graurötliches Gemäuer fast an die Ruinen des Heidelberger Schlosses gemahnte. Nach rechts die Stadt mit ihren zahllosen Giebeln und Dächern, nach links der herrliche Wiesengrund mit den[155] freundlichen Landhäusern; und fern am Himmelsrande die bewaldeten Höhen, deren letzte Kuppen bläulich hinüber schimmerten.
Da drüben, an dem großen Fabrikgebäude vorüber, erkannte ich auch das Haus des Professors, dem ich meine Gefangenschaft zu verdanken hatte.
Schnöder Tyrann, dachte ich bei mir selbst, wie schwer hast du dich betrogen! Du wähnst mich im öden Dunkel der Zelle, und ich halte hier Musterung über die Herrlichkeiten des Landes! Ha, wie frei und köstlich mir diese Morgenluft die Schläfe umspielt! Stolz blicke ich von meiner Höhe herab auf die Kleinheit und Gemeinheit des Lebens! Was kriecht und krabbelt da unten? Ich glaube, der Registrator Bieler, der von seinem Morgenspaziergange zurückkehrt! Wie kläglich! Wie pygmäenhaft! Jetzt hebt er den Kopf … Ich ducke mich schleunigst … Aber es droht keine Gefahr; der Herr Registrator hat nur drüben nach der großen Uhr des Zollhauses geblickt.
»Salve!« tönt es mir plötzlich ans Ohr. Wahrhaftig, da ist er, Wilhelm Rumpf aus Gamsweiler, mein Leidens- und jetzt mein Freudensgefährte. Wenn wir uns weit überbeugen und die Arme ausstrecken, so können wir uns beinahe die Hände reichen.
»Ist's nicht famos hier oben in der freien, reinen, blauenden Himmelsluft?«
»Bene dixisti«, gibt Wilhelm mit der Würde eines echten Ciceronianers zurück.
Und nun beginnt ein Stündchen der entzückendsten Umschau. Wir preisen uns gegenseitig die Reize der Landschaft; wir glossieren die Personen, die da drunten vorüber schreiten.
Da kommt ein zierliches Dienstmädchen …
Das ist das Lieschen von Wilhelm Rumpfs angeheiratetem Onkel. Wunderbar, wie hier vom Rahmen des Karzerfensters aus alles an Interesse gewinnt! Freilich, der Platz da unten liegt am Ende der Stadt, und die Menschen, die vorüber wandeln, sind zu zählen.
»Ah, ich weiß, was sie will«, sagt Rumpf mit verständnisinnigem Lächeln. »Der Onkel schickt sie zum Registrator Bieler, um[156] für heute abend den Whistkranz abzubestellen. Die Tante ist unwohl. Weißt Du, carissime, die verrät uns nicht.«
Und mit verwegener Donnerstimme ruft er:
»Lieschen! Lieschen!«
Sie dreht sich um. Wilhelm Rumpf aus Gamsweiler möchte sich totlachen.
»Nimm Dich in acht«, warne ich im Ton einer Cassandra. »Der Quaddler hat Ohren wie ein Luchs. Auch muß Fräulein Anny jeden Augenblick aus der Kirche kommen.«
»Ah was! Bis der hier herauf tappt, sind wir längst wieder drunten – Lieschen!«
Dasselbe Spiel wiederholt sich. Endlich beim dritten Male sieht das Mädchen herauf. Wie vom Donner gerührt, bleibt sie stehen.
»Fort, fort!« winkt der Tollkühne, und Lieschen begreift. Noch mehrmals zurückblickend, wandelt sie ihrer Wege.
Da kommen zwei junge Damen, biegen aber gleich wieder rechts ab.
»Das ist Fräulein Elsner und ihr Besuch aus Schleswig«, erläutert Wilhelm Rumpf mit Kennermiene.
»Gott bewahre, es ist die kleine Waldow und ihre Cousine Griesinger …«
»Lehr' Du mich die Mädchen kennen. Ich sage Dir, ich täusche mich nicht … Aber sieh mal dort … Kennst Du den?«
»Weiß Gott! Der Quaddler! Er kommt aus der Kirche! Rasch hinunter … Jetzt hat er sein Pflichtbewußtsein gestärkt und wird uns einen Besuch abstatten.«
Im Nu tauchen wir in die Luke. Zwei Minuten später ist das Gitter angeschraubt, der Stuhl vom Tisch gehoben und alles in Ordnung gebracht.
Unsere Ahnung betrügt uns nicht. Es währt nur kurze Zeit, da klirren draußen die Schlüssel, Quaddler schreitet über den Vorflur und begrüßt zunächst meinen Freund.
»Es ist auch recht schön von Ihnen, Herr Rumpf,« sagte er wohlwollend, »daß Sie nicht so viel geklingelt haben. Ich hab's schon von meiner Tochter gehört, es wäre alles recht stille gewesen.«
»Ah so,« erwidert Rumpf, »ich denke, Ihre Fräulein Tochter war in der Kirche …«
»Nein, heute mußte sie ergebenst zu Hause bleiben. Heute war mein Tag.«
»So, wer hat denn gepredigt?«
»Der Herr Kirchenrat.«
»Ist's möglich? Das Kirchenrätchen?«
»Herr Rumpf, ich muß Sie bitten, was den Respekt betrifft …«
»Tun Sie doch ums Himmels willen nicht so zimperlich! Alle Welt weiß doch …«
»Alle Welt weiß, daß Ihnen sozusagen nichts heilig ist, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich will noch mal hinübergehen, und dann muß ich gütigst einen wichtigen Brief schreiben.«
Sprach's, empfahl sich und erschien dann bei mir.
»Sagen Sie mal, Herr Quaddler,« hub ich an, nachdem wir die ersten Phrasen der Begrüßung gewechselt hatten, »wer waren denn eigentlich die zwei jungen Damen, die Ihnen da vorhin am Steueramte begegnet sind?«
Quaddler starrte mich an, als ob er ein Gespenst sähe.
»Wie? Was? Woher wissen Sie denn …?«
Jetzt erst erkannte ich, daß ich in meiner Zerstreutheit eine Bêtise verbrochen. Jeder andere Pedell würde den Unfug gemerkt haben; nur Quaddler war mit einiger Effronterie zu beschwichtigen.
»Sehr einfach, Herr Quaddler! Sehen Sie, Herr Quaddler, ich habe hier einen Taschenkamm, an dem ist hinten ein sympathetischer Spiegel. Wenn ich den nun so gegen das Fenster halte und mit dem einen Auge durch die Finger blinzle …«
»Zeigen Sie mal her«, sagte Quaddler erstaunt und bemühte sich, durch die Finger zu blinzeln.
»Ja, Sie halten das Ding falsch! So müssen Sie's halten!«
Ich stellte mich in Positur.
»Sehen Sie, ganz deutlich … Eben geht der Herr Registrator Bieler vorüber … Sehen Sie …«
Quaddler beeilte sich, meinem Beispiel zu folgen.
»Sozusagen nicht die Spur sehe ich«, rief er nach einer Weile.
»Sie sind wohl kurzsichtig?«
»Im Gegenteil, weitsichtig.«
»Nun wohl, der Spiegel da ist nur für Kurzsichtige berechnet.«
»Das ist aber merkwürdig!«
»Sehr merkwürdig, Herr Quaddler!«
Der Pedell schüttelte den Kopf, als ob er der Sache nicht recht traute. Dann schaute er empor nach dem Gitter. Da war nichts Verdächtiges zu bemerken! Es mußte doch wohl in der Ordnung sein mit dem Spiegel …
»Wirklich, sozusagen ein sehr merkwürdiger Spiegel«, wiederholte er nachdenklich. »Nun, ich glaube, es wäre übrigens besser, wenn Sie lieber gütigst etwas arbeiten wollten!«
»Arbeiten? Am Tage des Herrn?«
»Warum nicht? Da Sie ja doch heute sozusagen keinen richtigen Sonntag haben, und die Arbeit übrigens nicht schändet …«
»Nun, ich werde mir's überlegen. Gehen Sie nur jetzt getrost an Ihren wichtigen Brief!«
Der Pedell empfahl sich.
Fünf Minuten später saßen wir wieder auf dem Rande der Luke und erfreuten uns der herrlichen Aussicht.
Nachdem wir unsere Gemüter an diesen Wonnen gesättigt, erwachte die Begier nach einer konkreten Zerstreuung.
»Wart', ich komme hinüber«, sagte Rumpf mit einem prüfenden Blick auf das Terrain.
Vorsichtig zog er erst das rechte, dann das linke Bein über den Fensterrand. Dann ergriff er einen jener Haken, an denen die Schieferdecker beim Ausbessern des Daches ihre Leitern festhängen, und gab sich einen kräftigen Schwung. Ich ergriff seine Linke, und das große Werk war vollbracht.
Wir arrangierten nun im Innern der Zelle eine Piquetpartie, die uns etwa eine Stunde hindurch auf das kostbarste amüsierte.
Da mit einemmal, welch ein unverhofftes Geräusch … Quaddler mußte dem sympathetischen Spiegel doch nicht so recht geglaubt haben, denn er war ganz leise die Treppe hinauf geschlichen und öffnete jetzt den Korridor mit diabolischer Vorsicht.
Wir rührten uns nicht. Es war für Rumpf augenscheinlich zu spät, um in seine Zelle zurückzukehren.
Quaddler trat an meine Tür und pochte.
»Was treiben Sie jetzt?« sagte er mißtrauisch.
Ich rückte ostensibel mit dem Stuhle, erwiderte das Klopfen und sagte:
»Gerade war ich dabei, das berühmte Carmen des Horaz: »Odi profanum vulgus et arceo« ins Deutsche zu übersetzen.«
»Das ist recht von Ihnen«, erwiderte Quaddler.
Und nun klopfte er an die Zelle Wilhelm Rumpfs.
»Was machen Sie denn, Herr Rumpf?«
Keine Antwort.
»Herr Rumpf! Ich frage Sie, womit Sie beschäftigt sind?«
Grabesstille.
Jetzt drehte Quaddler den Schlüssel um. Welch ein Anblick bot sich seinen entsetzten Blicken! Das Gitter erbrochen, der Sträfling verschwunden, – hinaus aufs Dach und von da vielleicht vermittelst der traditionellen Leine, von welcher Herr Quaddler erst jüngst in einem spannenden Lieferungsroman gelesen, hinab auf den festen Grund der Erde! Wer weiß, vielleicht hatte Rumpf genau die Absicht, wie jener italienische Grafensohn, unter die kleinasiatischen Seeräuber zu gehen …! Und doch … Es war nicht zu begreifen …!
»Herr Rumpf! Herr Rumpf!« schrie Quaddler verzweifelnd, »wo sind Sie?«
Alles stille.
»Da muß ich doch gleich einmal in seine Wohnung gehen und nachsehen, ob er daheim ist.«
Und mit rasender Eile stürmte er die Treppe hinab.
Sofort stieg Rumpf auf dem Wege über das Dach in seine Zelle zurück. Die Gitter wurden ganz regelrecht mit allen vier Schrauben befestigt, und als ob nichts geschehen sei, vertieften wir uns in unsere Bücher. Die Messer aber verbargen wir der Vorsorge halber in unseren Stiefeln.
So verstrich eine halbe Stunde. Da ertönten Stimmen … Quaddler hatte sich richtig bei den Wirtsleuten, wo Wilhelm Rumpf zur Miete wohnte, erkundigt, und da man hier um den Verschwundenen nicht wußte, so war der biedere Pedell in seiner Verzweiflung zu[160] dem angeheirateten Onkel gerannt, um diesen von dem Vorfall in Kenntnis zu setzen.
»Da, sehen Sie, geehrter Herr Rat,« sagte Quaddler bebend, indem er den Schlüssel umdrehte, »fort ist er!«
»Ei, guten Tag, lieber Onkel!« rief Wilhelm Rumpf mit rührender Naivität; »das ist aber schön, daß Du mich hier 'mal besuchst.«
Quaddler und der Herr Rat standen wie angewurzelt. Mehrere Minuten lang war keiner von ihnen fähig, ein Wort über die Lippen zu bringen.
»Aber das werde ich dem Herrn Direktor vermelden«, stammelte endlich Quaddler.
»Was denn?« versetzte Rumpf harmlos.
»Daß Sie da oben hinausgeschlüpft sind, und wenn man dann meint, Sie wären fort, dann kommen Sie wieder.«
»Sie sind närrisch«, antwortete Rumpf. »Bin ich vielleicht eine Ratte? Da, sehen Sie her, der Zwischenraum da ist kaum eine Hand breit.«
»Ja, ja, Sie haben das Gitter abgeschraubt, ich hab's wohl gesehen, und dann sind Sie aufs Dach entschlüpft.«
»Herr Quaddler ich verbitte mir das! Womit soll ich das Gitter denn abschrauben?«
»Nun, Sie werden wohl irgend ein Instrument bei sich haben.«
»Lieber Onkel, Du bist Zeuge. Ich belange den Quaddler wegen Verleumdung. Jetzt aber stelle ich die kategorische Forderung, daß ich augenblicklich untersucht werde.«
»Gut, das soll geschehen«, erwiderte Quaddler. »Ich werde das Meißelchen schon finden, mit dem Sie die Sache gemacht haben.«
»Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich keinen Meißel besitze, noch jemals besessen habe. Untersuchen Sie nur meine sämtlichen Taschen. Sie haben wahrscheinlich nach der Kirche die Lotz'sche Bierstube besucht …«
Die Visitation blieb natürlich fruchtlos.
»Ja, Herr Quaddler,« sagte Rumpfs Onkel, »ich begreife in der Tat nicht, was Sie eigentlich wollen. Das Gitter da ist doch ganz fest, und mit den Fingern kann man's nicht abschrauben …«
Rumpf wandte sich verständnisinnig zu diesem gewichtigen Fürsprecher und murmelte:
»Ich sag's ja, er war bei Lotz. Gestehen Sie's offen Quaddler!«
»Bei Lotz …, das steht sozusagen richtig, aber ich habe nur zwei Glas Bier getrunken, und was ich gesehen habe, das hab' ich gesehen, und das laß ich mir nicht ausreden, und wenn Sie's gütigst erlauben, werd' ich's dem Herrn Direktor vermelden.«
»Zwei Glas Bier!« schrie Wilhelm Rumpf. »Und ein Mann, der sich solchen Ausschweifungen überläßt, will uns moralische Vorlesungen halten …? Wissen Sie was? Besoffen sind Sie gewesen, und da haben Sie in Ihrem Taumel eine Halluzination gehabt. Ich bin hier nicht von der Stelle gewichen und habe gearbeitet, während Sie den heiligen Sonntag durch ein Zechgelage entweihten. Ich werde dem Herrn Direktor schon das Nötige zu vermerken wissen, wenn Sie mich anschwärzen wollen. Soll ich noch dafür aufkommen, wenn Sie sich in aller Frühe einen Rausch antrinken? Pfui, und abermals pfui! Sie wollen Pedell sein? Sie wollen eine Tochter erziehen? Sie sollten sich schämen! Ein Mann von beinahe fünfzig Jahren und solche Extravaganzen …! Siehst Du, Onkel, so hat man nun seine Not auf der Welt: wenn der Pedell sich bekneipt, soll der Sekundaner die Suppe ausessen!«
»In vollem Ernste, Herr Quaddler,« begann jetzt der Onkel, »ich fange an zu glauben, daß Sie sich in eigentümlicher Weise getäuscht haben. Darf ich Ihnen einen freundschaftlichen Rat erteilen, so lassen Sie die Sache auf sich beruhen. Der Herr Direktor gibt etwas auf mein Urteil, und ich werde ohne Bedenken die Aussagen meines Neffen bestätigen. Oder haben Sie sich vielleicht gar in der Zelle geirrt? Nicht wahr, daneben sitzt ja noch einer?«
»Nein, nein!« erwiderte Quaddler, »es war hier diese Zelle, und ich will nicht selig werden …«
»Sie sind hartnäckig«, sagte der Onkel; »Scherz beiseite, ich werde die nächste Gelegenheit ergreifen, mit dem Herrn Direktor zu sprechen.«
»Da möchte ich Sie doch ganz ergebenst bitten, wenn Sie das tun wollen, die Güte zu haben, es lieber nicht zu tun. Eher will ich noch annehmen, ich hätte mich getäuscht; obgleich ich mich ganz[162] gewiß, das heißt, ich will sagen, bitte, sprechen Sie nicht mit dem Herrn Direktor!«
»Sobald Sie mich wegen Ihrer verrückten Halluzination anzeigen,« sagte Rumpf pathetisch, »sobald wird mein Onkel das Seinige tun, um Ihre Intrigen zu hintertreiben! Das versteht sich von selbst! Nicht wahr, Onkel?«
Der Onkel nickte.
»Ich sage gar nichts mehr«, erwiderte Quaddler kleinlaut; »was man heutzutage alles erlebt …! Nichts für ungut, Herr Rat, daß ich Sie hierher bemüht habe. Nehmen Sie's denn meinetwegen auf Rechnung meiner Kollation, wie der Herr Rumpf sagt, aber ich versichere Sie, wie gesagt, ich sage gar nichts mehr.«
Und hiermit war die Sache erledigt.
Den Rest des Tages verbrachten wir jeder still in seinen vier Wänden. Wir mochten doch nicht ein zweites Mal auf Quaddlers Halluzinationsfähigkeit spekulieren.



Es schlug zwei. Der Direktor des städtischen Gymnasiums, Dr. Samuel Heinzerling, wandelte mit der ihm eigenen Würde in den Schulhof und erklomm langsam die Stiege.
Auf der Treppe begegnete ihm der Pedell, der eben geläutet hatte und sich nun in seine Privatgemächer verfügen wollte, wo es allerlei häusliche Arbeiten zu erledigen gab.
»Äst nächts vorgefallen, Quaddler?« fragte der Direktor, – den devoten Gruß des Vasallen durch ein souveränes Kopfnicken erwidernd.
»Nein, Herr Direktor.«
»Hat der Herr Bibläothäkar noch nächt öber die bewußten Bände resolvärt?«
»Nein, Herr Direktor.«
»Goot, so gähen Sä noch heute hinöber und erkondigen Sä säch, wä säch diese Angelägenheit verhält … Noch eins. Der Prämaner Rompf fehlt seit einigen Tagen. Verfögen Sä säch doch einmal in seine Wohnung und öberzeugen Sä säch, ob er wärklich krank ist! Ich zweifle fast …«
»Entschuldigen Sie, Herr Direktor, der Rumpf ist wieder da; ich sah ihn vorhin über den Hof kommen.«
»Non, om so bässer.«
Der geneigte Leser verzeihe die eigentümliche Orthographie, mit der wir die geflügelten Worte des Gymnasialherrschers zu Papier bringen. Herr Dr. Samuel Heinzerling sprach allerdings nicht ganz so abnorm, als unsere Schreibweise vermuten lassen könnte:[164] allein das deutsche Lautsystem gibt uns kein Mittel an die Hand, die spezifisch Heinzerlingsche Klangfarbe genauer zu versinnlichen. Ich, der bescheidene Erzähler, habe selber hundertmal den Vorträgen des Herrn Direktors in stummer Andacht gelauscht und den Heinzerlingschen Vokalismus sozusagen zu meinem Lieblingsstudium erhoben. Solange unser armseliges Alphabet nicht eigene Zeichen für Zwitterlaute zwischen i und e, zwischen u und o usw. besitzt, so lange wird der Historiograph, der sich mit Herrn Dr. Samuel Heinzerling beschäftigt, die von uns vorgeschlagene Rechtschreibung adoptieren müssen.
Der Herr Direktor sagte also: »Non, om so bässer!« und schritt über den langen Korridor den Pforten seiner Prima zu.
Samuel war heute ungewöhnlich früh gekommen. In der Regel hielt er an der Theorie des akademischen Viertels fest. Diesmal hatte ihn ein häuslicher Zwist, über den wir aus begreiflicher Delikatesse den Schleier der Verschwiegenheit breiten, schon vor der Zeit aus dem behaglichen Sorgenstuhle getrieben, in welchem er seinen nachmittäglichen Kaffee zu schlürfen pflegte. Nur so erklärt es sich, daß die Primaner noch nicht daran gedacht hatten, nach Art der Gemsen ihre übliche Wache auszustellen.
Der Herr Direktor vernahm bereits auf dem Korridor einen Heidenlärm. Vierzig dröhnende Kehlen schrien »Bravo!« und »Dakapo!«
Samuel runzelte die Stirn.
Jetzt verstummte das Chorgebrüll, und eine klare, schneidige Stimme begann in komischem Pathos:
»Non, wär wollen äß för diesmal goot sein lassen. Sä haben säch wäder einmal nächt gehärig vorbereitet, Heppenheimer! Äch bän sähr onzofräden mät Ähnen! Sätzen Sä säch!«
Donnernder Applaus.
Der Direktor stand wie versteinert.
Bei den Göttern Griechenlands, – das war er selbst, wie er leibte und lebte …! Ein wenig karikiert, – aber doch so täuschend ähnlich, daß nur ein Kenner den Unterschied herauszufühlen vermochte! Eine solche Blasphemie war denn doch – dem Sprichwort zum Trotze – noch nicht dagewesen! Ein Schüler[165] erfrechte sich, ihn, den souveränen Beherrscher aller Gymnasialangelegenheiten, ihn, den Verfasser der »Lateinischen Grammatik für den Schulgebrauch, mit besonderer Rücksicht auf die oberen Klassen«, ihn, den renommierten Pädagogen, Ästhetiker und Kantianer, von der geweihten Höhe seines eigenen Katheders aus lächerlich zu machen! Proh pudor! Honos sit auribus! Das war ein Streich, wie er nur in der Seele des Erzspitzbuben Wilhelm Rumpf zur Reife gelangen konnte!
»Wollen Sä einmal etwas nähmen, Möricke«, fuhr die Stimme des pflichtvergessenen Schülers fort … »Was, Sä send onwohl? Gott, wenn mer jonge Leute in Ährem Alter sagen, sä send onwohl, so macht das einen sähr öblen Eindruck. Knäbel, schreiben Sä einmal äns Tagebooch: ›Möricke, zom Öbersätzen aufgefordert, war onwohl …‹«
Jetzt vermochte der Direktor seine Entrüstung nicht länger zu bemeistern.
Mit einem energischen Ruck öffnete er die Tür, und trat unter die erschrockenen Zöglinge, wie der Leu unter die Gazellenherde.
Er hatte sich nicht getäuscht.
Es war in der Tat Wilhelm Rumpf, der größte Taugenichts der Klasse, der sich so frevelhaft an der Majestät vergangen hatte. Erst seit vier Wochen zählte dieser Mensch zu Samuel Heinzerlings Schülern, und schon gebührte ihm vor allen Bengeln, vom Primus bis zum Ultimus, die Krone! Mit hochgezogenen Vatermördern, auf der Nase eine große, papierene Brille, in der Linken ein Buch, in der Rechten das traditionelle Bleistiftchen haltend, – so stand er auf dem Katheder und wollte eben eine neue Gotteslästerung ausstoßen, als der tiefbeleidigte Direktor auf der Schwelle erschien.
»Rompf!« sagte Samuel mit Fassung, – »Rompf! Sä gähen mer zwei Tage än den Karzer. Knäbel, schreiben Sä einmal äns Tagebooch: ›Rompf, wegen kändischen, onwördigen Benähmens mät zwei Tagen Karzer bestraft.‹ – Heppenheimer, rofen Sä den Pedellen!«
»Aber Herr Direktor …!« stammelte Rumpf, indem er die Papierbrille in die Tasche steckte und auf seinen Platz zuschritt.
»Keine Wäderrede!«
»Aber ich wollte ja nur … ich dachte …«
»Seien Sä ställ, sag' äch Ähnen!«
»Aber erlauben Sie gütigst …«
»Knäbel, schreiben Sä ein: ›Rompf wägen wädersetzlichen Betragens mät einem weiteren Tage Karzer belägt.‹ – Äch bän's möde, mich äwig mät Ähnen heromzoschlagen. Schämen sollten Sä säch in den Grond Ährer Sääle hänein! Pfoi, und abermals pfoi!«
»Audiatur et altera pars, Herr Direktor. Haben Sie uns diese Lehre nicht stets ans Herz gelegt …?«
»Goot! Sä sollen nächt sagen, daß äch meinen Pränzäpien ontreu wärde. Was haben Sä zo Ährer Entscholdigong anzoföhren?«
»Ich kann nur versichern, Herr Direktor, daß ich durchaus nichts Unziemliches beabsichtigte. Ich gedachte mich lediglich ein wenig in der Mimik zu üben.«
»Öben Sä Ähren lateinischen Stäl und Ähre grächische Grammatäk!«
»Das tu' ich, Herr Direktor. Aber neben der Wissenschaft hat doch auch die Kunst ihre Berechtigung.«
»Das habe äch nä in meinem Läben geleugnet. Wollen Sä ätwa Ähre Albernheiten för Konst ausgäben? Jädenfalls äst däse Konst sähr brotlos.«
»O, bitte, Herr Direktor!«
»Seien Sä ställ. Wänn Sä so fortfahren, so wärden Sä öber korz oder lang Schäffbroch leiden. Knipcke, sehn Sä einmal nach, wo der Heppenheimer mit dem Pedellen bleibt.«
»Ach, für diesmal, Herr Direktor«, flüsterte Rumpf in schmeichlerischem Tone, – »für diesmal könnten Sie mir die Strafe noch erlassen.«
»Nächts da! Sä gähn än den Karzer. Doch wär wollen ons dorch däsen Zwäschenfall än onsrer Arbeit nächt stären lassen. Hutzler, repetären Sä einmal …«
»Herr Direktor, ich war beim Vorübersetzen nicht zugegen. Hier ist mein Zeugnis.«
»So! Sä waren wäder einmal krank. Wässen Sä, Hutzler, Sä sänd auch öfter krank als gesond …«
»Leider, Herr Direktor. Meine schwächliche Konstitution …«
»Schwächläch? Sä, schwächläch? Non, hären Sä einmal, Hutzler, äch wollte, jäder Mänsch unter der Sonne wäre so schwächläch wä Sä! Faul sänd Sä, aber nächt schwächläch …«
»Faul? Aber ich kann doch nicht während eines Fieberanfalls …«
»Äch känne das! Sä wärden wäder einmal zo väl Bär getronken haben. Repetären Sä einmal, Gildemeister.«
»Fehlt!« riefen sechs Stimmen zugleich.
Samuel schüttelte mißmutig das Haupt.
»Weiß keiner, warom der Gildemeister fehlt?«
»Er hat Katarrh!« antwortete einer der sechse.
»Katarrh! Wä äch so alt war, hatte äch nämals Katarrh. Aber wo bleibt denn der Knipcke und der Heppenheimer? Schwarz, gehn Sä einmal hinaus, kommen Sä aber gleich wäder!«
Schwarz ging, und kam nach zehn Minuten mit dem Pedell und den beiden Kommilitonen zurück.
»Herr Quaddler war mit Tapezieren beschäftigt«, sagte Heppenheimer in achtungsvollem Tone; »er mußte sich erst ein wenig umkleiden.«
»So! und dazo brauchen Sä eine halbe Stonde? Quaddler, äch fände, Sä wärden nachlässig äm Dänste!«
»Sie entschuldigen ganz gehorsamst, Herr Direktor, aber die Herren sind erst vor zwei Minuten an meine Tür gekommen.«
»Oh!« riefen die drei Primaner wie aus einem Munde.
»Non, äch wäll das nächt weiter ontersochen! Här, nähmen Sä einmal da den Rompf ond föhren Sä ähn auf den Karzer. Rompf, Sä wärden säch anständig betragen und nächt alle Augenbläcke nach dem Pedellen rofen, wä das vor acht Tagen geschehn ist. Quaddler, Sä lassen säch durch nächts bestämmen, den Rompf auf den Vorflur zo lassen! Wenn ähm wäder schlächt wärd, so mag er das Fänster öffnen. Am bästen äst's, Sä sätzen ähm alles Nötige hänein in die Zälle, und lassen die Töre ein för allemal verschlossen. Freitag abend kömmt er wäder herunter.«
»Schön, Herr Direktor.«
»Das Ässen können Sä säch dorch einen Ährer Freunde besorgen lassen. Verstanden?«
Rumpf nickte.
»So! und non fort mät Ähnen!«
»Es ist also wirklich Ihr Ernst, Herr Direktor, mich für eine künstlerische Leistung …«
Samuel Heinzerling lachte mit männlich-pädagogischer Würde.
»Sä sänd ein drolliger Kauz, trotz aller Ährer Ongezogenheiten. Aber helfen kann äch Ähnen nächt. Solange Sä mär nächt dartun, was Ähre angäbliche könstlerische Leistung notzt und frommt, – ganz abgesehen von Ährer onziemlichen Tendenz, – so lange wärden Sä säch ins Onabänderliche fögen mössen. Machen Sä jetzt, daß Sä hänauf kommen!«
Wilhelm Rumpf biß die Lippen aufeinander, machte kehrt und verschwand mit Quaddler in der Dämmerung des Korridors.
»Was haben Sie eigentlich verbrochen, Herr Rumpf?« fragte der Pedell, als sie die Treppe hinanschritten.
»Nichts.«
»Aber verzeihen Sie gütigst, Sie müssen doch was gemacht haben?«
»Ich habe nur das getan, was der Direktor beständig tut.«
»Woso?«
»Nun, geben Sie einmal wohl acht: Sähen Sä, mein läber Quaddler, der Rompf ist ein Taugenächts und verdänt eine exemplarische Zächtigong.«
»Herr Gott meines Lebens!« stammelte der Pedell, beide Hände über dem Kopf zusammenschlagend. »Nein, wer mir gesagt hätte, daß so etwas möglich sei … Aber das ist ja ordentlich graulich, Herr Rumpf! Weiß der ewige Himmel, wenn ich Sie nicht mit meinen eigenen Augen vor mir sähe, ich würde schwören, des gestrengen Herrn Direktors persönliche Stimme gehört zu haben! Tausend noch 'mal, das muß ich sagen! Sie können's noch weit bringen in der Welt! Wissen Sie, da war ich einmal drüben bei Lotz in der Bierstube, da war auch so ein Zauberkünstler, der machte Ihnen alles nach, was Sie wollten, Vogelgezwitscher und Pferdewiehern, Hundegebell und Hochzeitspredigten. Aber so wie Sie hat er mich doch nicht aus Rand und Band gebracht!«
»Glaub's, glaub's, läber Quaddler!« versetzte Rumpf, immer noch den Direktor imitierend.
»Und das haben Sie in seiner Gegenwart aufgeführt? Nein, hören Sie einmal, nichts für ungut Herr Rumpf, aber alles am rechten Ort. So was geziemt sich nicht, und der Herr Direktor haben alle Ursache, im höchsten Grade ungehalten zu sein.«
»Meinen Sä?«
»Ich muß Sie recht schön bitten, Ihr Spiel jetzt sein zu lassen. Es verträgt sich nicht mit dem Ernst meines Amtes. Wollen Sie gefälligst hier hereinspazieren!«
»Mät Vergnögen …!«
»Herr Rumpf, ich werde dem Herrn Direktor sagen, Sie hätten noch nicht genug an der Ihnen diktierten Strafe …«
»Was gäht Sä meine Strafe an, Sä alter, närrischer Quaddler!«
»Was mich Ihre Strafe angeht? Nichts! Aber es geht mich viel, sehr viel an, ob Sie fortfahren, den Herrn Direktor in respektwidriger Weise zu verspotten.«
»Ich kann machen, was äch will.«
»Das können Sie nicht.«
»Doch, Quaddler. Äch kann sprechen, wä mär's paßt, und wäm's nächt gefällt, der dröckt säch oder hält säch die Ohren zo.«
»Nun, warten Sie!«
»Worauf?«
»Ich werde dem Herrn Direktor Bericht erstatten.«
»Sagen Sie einen schönen Gruß von mir.«
»Sie werden sich wundern.«
Quaddler drehte den Schüssel um und tappte langsam die Treppe hinunter.
Im Saale der Prima ward inzwischen eifrig Sophokles interpretiert. Heppenheimer verdeutschte gerade zum größten Jubel der übermütigen Sippe das Wehgeschrei des unglücklichen Philoktetes:
»Ai, ai, ai, ai …«
Der Direktor Samuel Heinzerling fiel ihm in die Rede.
»Sagen Sä ›Au, au, au, au‹. Das ›Ai‹ als Interjektion des Schmerzes äst sprachwädrig.«
»Ich dachte, ›Au‹ sei bloß bei körperlichen Schmerzen gebräuchlich«, bemerkte Heppenheimer.
»Non, dänken Sä välleicht, Philoktet habe bloß geistig gelätten? Sä scheinen mer den Gang der Tragödie ohne sonderliche Aufmerksamkeit verfolgt zu haben.«
»Herr Direktor, es klopft!« sagte Knebel.
»Sähn Sä einmal nach, Knipcke!«
Knipcke eilte, zu öffnen.
»Was? Sä, Quaddler? Warom stören Sä ons schon wäder? Fassen Sä säch korz!«
»Ich wollte mir gütigst erlauben, ergebenst zu vermerken, der Primaner Rumpf spricht noch immer so, wie von wegen weshalb Sie ihn bestraft haben.«
»Was? Er sätzt die Komödie fort? Non, äch wärde die erforderlichen Maßregeln zu ergreifen wässen! Knäbel, schreiben Sä einmal ein, – oder nein, lassen Sä's läber! Es äst goot, Quaddler. Heppenheimer, fahren Sä fort. Also: ›Au, au, au, au,‹ nächt: ›Ai, ai, ai, ai‹. Das Folgende können Sä etwa mät: ›Ach, ihr äwigen Götter!‹ oder mät ›Allmächtiger Hämmel!‹ wädergeben!«
Heppenheimer erledigte sein Pensum zu des Direktors leidlicher »Zofrädenheit«. Nach ihm übersetzte Schwarz »ongenögend«. Dann erscholl Quaddlers Klingel. Der Verfasser der lateinischen Grammatik für den Schulgebrauch erklärte den Unterricht für geschlossen. In der Tür erschien Doktor Klufenbrecher, der Mathematiklehrer, der die Prima von drei bis vier über die Geheimnisse der analytischen Geometrie zu unterhalten hatte. Samuel Heinzerling reichte dem »geschätzten Herrn Kollegen« herablassend, aber nicht ohne ein gewisses humanes Wohlwollen, die grübchenreiche Rechte und verfügte sich dann nach dem Direktorialzimmer, wo er sich nachdenklich auf seinem Amts- und Dienstsessel niederließ.
Quaddler ging inzwischen ans Werk, die freie Stunde gehörig auszunutzen. Rüstig stülpte er den Pinsel in den Kleistertopf und bestrich eine Tapetenbreite nach der anderen mit duftender Klebematerie.
Wilhelm Rumpf aber saß gähnend auf der Pritsche und versicherte im Selbstgespräch, er sei das Gymnasium mit seinen unmotivierten Freiheitsbeschränkungen bis über die Ohren müde.
Herr Samuel Heinzerling kraute sich jetzt in den Locken, rückte die große Brille mit den runden Gläsern zurecht und schüttelte zwei-, drei-, viermal das pädagogische Haupt.
»Ein mäserabler Jonge, dieser Rompf!« murmelte er vor sich hin … »Aber äch glaube fast, auf dem Weg der Güte äst mähr bei ihm auszurichten, als mit Gewalt und Strenge. Äch wäll ähm einmal ärnst-nachdrocksamst ins Gewässen räden! Schade ohm ähn! Er gehört zo meinen begabtesten Schölern!«
Er klingelte.
Nach drei Minuten erschien Anny, Quaddlers sechzehnjährige Tochter. Sie war augenscheinlich im Begriff, einen Ausgang zu machen; dafür sprach das kokette Federhütchen, das sich anmutig auf ihren dunklen Locken wiegte, und das bunte Schaltuch, das ihre vollen Schultern umfing.
»Sie befehlen, Herr Direktor?« fragte sie mit einer graziösen Verbeugung.
»Wo ist Ihr Vater?« flüsterte Samuel mit einer für seine Verhältnisse außerordentlich reinen Aussprache des »i«.
»Er kleistert. Haben Sie etwas zu besorgen, Herr Direktor?«
»So, er kleistert. Na, dann wäll äch ähn nächt stören in seiner Kleisterei. Es äst nächts Besonderes, Anny. Der Karzerschlössel stäckt ja?«
»Ich werde einmal gleich fragen, Herr Direktor.«
Wie ein Reh eilte das Mädchen die Treppe hinunter. Nach wenigen Sekunden war sie wieder zur Stelle.
»Jawohl, Herr Direktor, die Schlüssel stecken, sowohl der zum Vorflur, wie der zur Zelle. Befehlen Sie sonst etwas?«
»Nein, äch danke.«
Anny verabschiedete sich. Lächelnd blickte Samuel ihr nach.
»Ein reizendes Känd!« murmelte er vor sich hin. »Ich gäbe väl darom, wenn meine Winfriede nur halb so väl savoir vävre besäße – von Ismenen ganz zo geschweigen. Däser Quaddler äst ein paganus, ein homo incultus, und dessenohngeachtet verstäht er es, eine Charitin groß zo zähen, während äch, der feingebäldete Kenner des klassischen Altertoms, äch, der homo, coi näl homani alienom äst, nächt ämstande bän, eine meines Bäldongsgrades wördige Nachkommenschaft zo erzielen.«
Er strich sich einigemal über das glattrasierte Kinn, nahm dann seinen Hut vom Tisch und klomm die Stiege zum Karzer hinan.
Wilhelm Rumpf war höchlich überrascht, als sich schon nach so kurzer Gefangenschaft die Tür in den Angeln drehte. Sein Staunen erreichte jedoch den Zenitpunkt, als er in dem unerwarteten Besucher den Direktor Samuel Heinzerling erkannte.
»Non, Rompf?« sagte der ehrenfeste Pädagoge.
»Was wünschen Sie, Herr Direktor?« entgegnete der Schüler im Tone einer resoluten Verstocktheit.
»Äch wollte mäch einmal erkondigen, ob Sä in säch gähn und einsähn, daß solche Puerilitäten der Aufgabe des Gymnasiums und dem in däsen Mauern herrschenden Geiste vollständig zowäder laufen …«
»Ich bin mir nicht bewußt …«
»Was, Rompf? Sä wollen säch noch auf die Hänterbeine stellen? Sähn Sä einmal, was wörden Sä wohl sagen, wenn Sä an meiner Stelle wären? Wörden Sä nächt däsen onartigen, öbermötigen Wälhelm Rompf aus Gamsweiler noch ganz anders bei den Ohren nähmen? Hä?«
»Herr Direktor …«
»Das sänd doch Kändereien, wä man sä einem anständigen jongen Mann aus gooter Famälie nächt zotraut! Wässen Sä was? Beim nächsten dommen Streich wärde äch Sä relegären!«
»Relegieren …?«
»Ja, Rompf! Relegären! Drom gähn Sä än säch und lassen Sä dä Ongezogenheiten, die Ähnen wahrhaftig keine Ehre machen … Äch wäderhole Ähnen: sätzen Sä säch einmal an meine Stelle! …«
Wilhelm Rumpf ließ das Haupt nachdenklich auf die Brust sinken. Er fühlte, daß die angedrohte Relegation nur noch eine Frage der Zeit sei. Mit einemmal zuckte ein diabolischer Gedanke durch sein Gehirn.
»Wenn ich denn einmal fortgejagt werden soll,« sprach er zu sich selbst, »so mag es denn auch mit Eklat geschehen!«
Er lächelte, wie der verbrecherische Held eines Sensationsromanes nach gelungener Missetat zu lächeln pflegt, und sagte im Tone einer beginnenden Zerknirschung:
»Sie meinen, Herr Direktor, ich solle mich an Ihre Stelle versetzen …?«
»Ja, Rompf, das meine äch.«
»Gut, wenn Sie's denn nicht anders haben wollen, so wünsche ich viel Vergnügen!«
Und damit sprang er zur Tür hinaus, drehte den Schlüssel um und überließ den armen Direktor seinem unverhofften Schicksale.
»Rompf! Was fällt Ähnen ein! Äch relegäre Sä noch heute! Wollen Sä augenbläckläch öffnen! Augenbläckläch, sage äch!«
»Äch gäbe Ähnen härmät zwei Stonden Karzer«, antwortete Rumpf mit Würde. »Sä haben sälbst gesagt, äch solle mäch an Ähre Stelle versätzen.«
»Rompf! Es geschäht ein Onglöck! Ein Onglöck, sage äch! Öffnen Sä! Äch befähle es Ähnen!«
»Sä haben nächts mähr zo befählen! Äch bän gägenwärtäg där Därektor! Sä sänd der Prämaner Rompf! Seien Sä ställ! Äch dolde keine Wäderräde!«
»Läber Rompf! Äch wäll's Ähnen för däsmal noch verzeihen. Bitte, machen Sä höbsch auf. Sä sollen mät einer gelinden Strafe dorchkommen. Sä sollen nächt relegärt werden. Ich verspreche es Ähnen! Hären Sä?«
Der »läbe Rompf« hörte nicht. Er hatte sich leise über den Vorflur geschlichen und eilte jetzt die Treppe hinab, um siegreich zu entweichen.
Als er an der Tür des Pedells vorüber kam, packte ihn eine prickelnde Idee.
Er legte das Auge ans Schlüsselloch. Quaddler stand just auf der Leiter, den Rücken nach der Pforte gekehrt, und mühte sich, einen schwer bekleisterten Tapetenstreifen an die Wand zu kleben. Wilhelm Rumpf klinkte ein wenig auf und rief mit dem schönsten Heinzerlingschen Akzent, der ihm zu Gebote stand, ins Zimmer:
»Äch gehe jetzt, Quaddler. Beobachten Sä mär den Rompf. Der Mänsch beträgt säch wä onsännäg. Er erfrächt säch noch ämmer, seine ämpärtänenten Spälereien zu treiben. Bleiben Sä jetzt nor rohig auf Ährer Leiter. Äch wollte Ähnen nor noch sagen, daß Sä ähm onter keiner Bedängong öffnen! Der Borsche wäre[174] ämstande, Sä öber den Haufen zo rännen und – mär nächts, där nächts – dorchzogehn! Hären Sä, Quaddler?«
»Wie Sie befehlen, Herr Direktor. Entschuldigen Sie nur gütigst, daß ich hier oben …«
»Sä sollen rohig bleiben, wo Sä sänd, ond Ähre Kleisterei erst fertig machen. Adiö!«
»Ganz gehorsamster Diener, Herr Direktor.«
Wilhelm Rumpf stieg nunmehr die Treppe wieder hinan und betrat die Regionen des Karzers.
Samuel Heinzerling tobte fürchterlich. Jetzt schien er auch die Klingel zu entdecken, denn in demselben Augenblicke, da Rumpf sich hinter einen gewaltigen Kleiderschrank der Pedellfamilie barg, erscholl ein wütendes Geläute, gell und schrill, wie das Kreischen empörter Wald- und Wasserteufel.
»Zo Hölfe!« stöhnte der Schulmann, – »zo Hölfe! Quaddler, äch bränge Sä von Amt ond Brot, wänn Sä nächt augenbläckläch herauf kommen! Zo Hölfe! Foier! Foier! Mord! Gewalttat! Zo Hölfe!«
Der Pedell, durch das unausgesetzte Geklingel an seinen Beruf gemahnt, verließ seine Privatbeschäftigung und erschien auf dem Vorflur des Gefängnisses. Der heimtückische Primaner schmiegte sich fester in sein Versteck. Samuel Heinzerling hatte sich erschöpft auf die Pritsche gesetzt. Sein Busen keuchte; seine Nasenflügel arbeiteten im Tempo eines rüstigen Blasebalgs.
»Herr Rumpf«, sagte Quaddler, indem er wie warnend wider die Tür der Zelle pochte, »es wird alles notiert!«
»Gott sei Dank, Quaddler, daß Sä da sänd! Öffnen Sä mär! Däser mäserable Kärl sperrt mäch här ein … Es äst hämmelschreiend!«
»Ich sage Ihnen, Herr Rumpf, die Späße werden Ihnen schlecht bekommen! Und daß Sie den Herrn Direktor einen miserablen Kerl nennen, das werd' ich mir besonders vermerken!«
»Aber Quaddler, sänd Sä denn verröckt?« eiferte Samuel im Tone der höchsten Entrüstung. »Zom Henker, äch sage Ähnen ja, daß der Rompf, der elende Gesälle, mäch här eingespärrt hat, als äch ähn besochen und ähm äns Gewässen räden wollte! Machen Sä jätzt keine Omstände. Öffnen Sä!«
»Sie müssen mich für sehr dumm halten, Herr Rumpf. Der Herr Direktor hat eben noch mit mir gesprochen und mir strengstens anbefohlen, Sie unter keiner Bedingung heraus zu lassen. Und nun betragen Sie sich anständig und lassen Sie das Klingeln, sonst häng' ich die Schelle ab.«
»Quaddler, äch bränge Sä äns Zochthaus wägen wäderrechtlicher Freiheitsberaubung.«
»Hören Sie einmal, wissen Sie, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, so ist das ewige Nachahmen des Herrn Direktors recht kindisch, nehmen Sie mir's nicht übel. Es ist wahr, der Herr Direktor sprechen ein wenig durch die Nase, aber so ein dummes Geklöne, wie Sie's da zusammenquatschen, so machen's der Herr Direktor noch lange nicht. Und nun sag' ich Ihnen zum letztenmal, verhalten Sie sich ruhig, und benehmen Sie sich, wie es sich geziemt …«
»Aber äch wäderhole Ähnen auf Ähre ond Sälägkeit, der schändläche, näderträchtäge Borsche hat den Schlössel hänter mär heromgedreht, ähe äch noch woßte, was er vor hatte! Quaddler! Mänsch! Äsel! Sä mössen mäch doch erkännen! Tun Sä doch Ähre Ohren auf!«
»Was? Esel nennen Sie mich? Mensch nennen Sie mich? Ei, wissen Sie was, da fragt sich's doch noch sehr, wer von uns beiden der größte Mensch und der größte Esel ist. So was lebt nicht. Nennt so ein grüner Junge einen alten, ehrlichen Mann einen Esel! Selbst Esel! … Verstehen Sie mich? Aber warten Sie nur!«
»Ein Äsel sänd Sä ond ein Ochse dazo!« stöhnte Heinzerling verzweifelnd. »Sä wollen also nächt öffnen?«
»Ich denke nicht daran.«
»Goot! Sehr goot!« ächzte der Schulmann mit verlöschender Stimme. »Sehr goot! Äch bleibe also äm Karzer! Hären Sä, Quaddler? Äch bleibe äm Karzer!«
»Es soll mich freuen, wenn Sie zur Vernunft kommen. Aber nun lassen Sie mich ungeschoren. Ich habe mehr zu tun, als Ihre Possen mit anzuhören!«
»Quaddler!« rief Samuel wieder heftiger. »Äch sitze rohig Stonde för Stonde ab! Verstähen Sä? Stonde för Stonde! Wä[176] ein ongezogener Jonge erdolde äch däse empörende Schmach! Hären Sä, Quaddler?«
»Ich gehe jetzt. Arbeiten Sie was.«
»Heiliger Hämmel, mär schwändelt der Verstand! Bän äch denn wärklich toll geworden! Mänsch, so gocken Sä doch wänägstens einmal dorchs Schlösselloch! Dann wärden Sä ja sehen …«
»Jawohl, damit Sie mir in die Augen blasen, wie neulich! Das fehlte mir noch! …«
»Non denn, so gehn Sä zom Teufel. Mät der Dommheit kämpfen Götter sälbst vergäbens! Aber komm' äch Ähnen heraus! komm äch Ähnen heraus! Äch gäb's Ähnen schriftlich: Sä sänd zom längsten Pädäll gewäsen!«
Quaddler tappte ärgerlich die Stiege hinunter. Dieser Rumpf war wirklich ein Ausbund von Impertinenz! Esel hatte er ihn genannt: Donner und Doria! Seit Frau Kathinka Quaddler das Zeitliche gesegnet, war dergleichen nicht vorgekommen …!
Ja, ja, die Herren Primaner!
Samuel Heinzerling maß inzwischen mit großen Schritten die Zelle. Seine ganze Erscheinung gemahnte an den afrikanischen Löwen, den menschliche Gewinnsucht in den Käfig gebannt, ohne die stolze, urwüchsige Kraft seiner edlen Natur brechen zu können. Die Hände auf dem Rücken, das Haupt mit der grauen Mähne wehmütig auf die rechte Schulter geneigt, die Lippen fest aufeinander gepreßt, – so wandelte er auf und nieder, auf und nieder, – die düstersten, menschenfeindlichsten Gedanken im Gemüte wälzend.
Plötzlich spielte ein breites Vollmondslächeln über seine Züge.
»Es äst ond bleibt doch komäsch!« murmelte er vor sich hin. »Wahrhaftig! Wenn äch nächt so onmättelbar bei der Geschächte beteiligt wäre, äch könnte sä amösant fänden …«
Er blieb stehen …
»Gereicht mär däse Öberlistung eigentlich zur Schande? Pröfe däch, Samoel! Hat nächt ein bekannter Könäg dem Diebe, der ihm eine Uhr stehlen wollte, eigenhändig die Leiter gehalten? Äst nächt selbst Först Bäsmarck von boshafter Hand ränkevollerweise eingerägelt worden? Hondert andrer Fälle nächt zo gedänken! Ond doch begägnet die Wältgeschächte besagtem König mät Hochachtong.[177] Ond doch gilt Först Bäsmarck nach wä vor för den bedeutendsten Däplomaten Europas! Nein, nein, Samoel! Deine Wörde als Scholmann, als Börger, als gebäldeter Denker leidet nächt äm gerängsten onter däser peinlichen Sätoation! Berohäge Däch, Samoel …«
Er setzte seine Promenade in befriedigter Stimmung fort. Bald aber unterbrach er sich von neuem.
»Aber meine Prämaner!« stammelte er erbleichend. »Wenn meine Prämaner erfahren, daß äch auf dem Karzer gesässen habe! Onerträglächer Gedanke! Meine Autorätät wäre ein för allemal dahän! Ond sä wärden es erfahren! Sä mössen es erfahren! Äch bän ein för allemal däskredätärt! O ähr Götter, warom habt ähr mär das getan!«
»Herr Direktor,« flüsterte jetzt eine wohlbekannte Stimme an der Zellentür … »Sie sind noch lange nicht diskreditiert! Ihre Autorität steht noch in vollem Flore …«
»Rompf!« stammelte Samuel. – »Schändlicher, gottvergeßner Mänsch! Öffnen Sä! Augenbläcklich! Betrachten Sä säch als moraläsch geohrfeigt! Sähen Sä säch för dreifach relegärt an!«
»Herr Direktor, ich komme, um Sie zu retten! Beleidigen Sie mich nicht!«
»Zo rätten? Welche Onverschämtheit! Aufmachen sollen Sä, oder …«
»Wollen Sie mich ruhig anhören, Herr Direktor? Ich versichere Sie, alles wird sich ausgleichen.«
Samuel überlegte.
»Goot«, sagte er endlich. »Äch wäll mäch herablassen … Räden Sä …«
»Sehen Sie, ich wollte Ihnen nur zeigen, daß meine Kunst doch nicht so ganz ohne praktische Bedeutung ist … Verzeihen Sie, wenn ich dabei scheinbar die vorzügliche Hochachtung und Verehrung verletzen mußte, die ich Ihnen aus vollstem Herzen zu zollen mir freudig bewußt bin.«
»Sä sänd ein Schelm, Rompf!«
»Herr Direktor … Wie wär's, wenn Sie mir die Karzerstrafe erließen, die Drohung betreffs der Relegation zurücknähmen und[178] mir erlaubten, über alles Vorgefallene das strengste Stillschweigen zu beobachten …?«
»Das gäht nächt! … Ähre Strafe mössen Sä absitzen …«
»So? Na, dann leben Sie wohl, Herr Direktor. Klingeln Sie nicht zu viel!«
»Rompf! Hären Sä doch! Äch wäll Ähnen was sagen … Rompf!«
»Bitte …!«
»Sä sänd in välen Bezähungen ein ongewöhnlächer Mänsch, Rompf … ond da wäll äch einmal eine Ausnahme machen … Öffnen Sä nor!«
»Erlassen Sie mir die Karzerstrafe?«
»Ja.«
»Werden Sie mich relegieren?«
»Nein, än Teufels Namen.«
»Geben Sie mir Ihr väterliches Wort, Herr Direktor!«
»Rompf, was onterstähn Sä säch …«
»Ihr väterliches Wort, Herr Direktor!«
»Goot! Sä haben's!«
»Jupiter Ultor ist Zeuge.«
»Was?«
»Ich rufe die Götter zu Zeugen an.«
»Machen Sä auf!«
»Gleich, Herr Direktor. Sie tragen mir's aber auch ganz gewiß nicht nach?«
»Nein, nein, nein! Wärden Sä mäch non bald heraus lassen?«
»Sie erteilen mir volle Absolution?«
»Ja, onter der Bedängung, daß Sä nämandem erzählen, wä schwär Sä säch vergangen haben. Ich habe Ähnen ja gesagt, äch halte Sä för einen ongewöhnlächen Mänschen, Rompf …«
»Ich danke Ihnen für die gute Meinung. Mein Ehrenwort: so lange Sie Direktor des städtischen Gymnasiums und Ordinarius der Prima sein werden, soll keine verräterische Silbe über meine Lippen gleiten!«
Und damit drehte er den Schlüssel um und öffnete …
Wie der Uhlandsche König aus dem Turme, so stieg Samuel Heinzerling an die freie Himmelsluft. Tief holte er Atem. Dann[179] strich er sich mit der Rechten über die Stirn, als ob er sich besinne …
»Rompf,« sagte er, »äch verstehe Spaß … Aber … nächt wahr, Sä tun mer den Gefallen, mäch nächt wäder mimisch zo kopären? Sä … Sä machen dä Geschächte zo ähnläch!«
»Ihr Wunsch ist mir Befehl!«
»Goot!! Ond non machen Sä, daß Sä hänonter kommen. Es äst noch nächt drei Värtel. Sä können noch am Onterrächt teilnehmen!«
»Aber würde man nicht stutzen, Herr Direktor? Jedermann weiß, daß Sie mir drei Tage Karzer diktiert haben …!«
»Goot! Äch gähe mät Ähnen.«
So eilten sie selbander die Treppe hinab.
»Quaddler!« rief der Direktor ins Erdgeschoß.
Der Pedell erschien an der untersten Windung und fragte dienstbeflissen, was der Gebieter zu verlangen geruhe.
»Äch habe dem Rompf aus verschädnen Grönden dä drei Tage geschenkt«, sagte Samuel.
»Ah …! Drum sind der Herr Direktor noch einmal zurückgekommen … Hm … Ja, aber was ich sagen wollte, der Herr Rumpf war gar nicht ruhig in seiner Zelle. Nichts für ungut, Herr Direktor, aber er hat geschimpft wie ein Rohrspatz …«
»Lassen Sä's goot sein, Quaddler. Äch wäll däsmal aus ganz besonderen Motäven Gnade för Recht ergehen lassen. Sä können den Karzerschlössel abzähen!«
Quaddler schüttelte befremdet das Haupt.
»So!« sagte Samuel. »Ond non kommen Sä mät nach der Präma, Rompf!«
Sie wandelten über den Korridor dem Schulsaale zu. Der Direktor klopfte.
»Entscholdigen Sä, Herr Kollege,« flüsterte er eintretend im weichsten Moll, dessen sein würdevolles Organ fähig war … »äch bränge da den Rompf wäder. Knebel! … Sä erlauben doch, läber Herr Klufenbrecher …? Knebel! Schreiben Sä äns Tagebooch: ›Man sah säch bewogen, dem Rompf än Anbetracht seines aufrächtäg reuägen Benähmens dä än der vorägen Stonde däktärte Karzerstrafe[180] zo erlassen.‹ … So! Ond non wäll äch nächt weiter stören, verehrter Herr Kollege … Haben Sä's, Knebel? … ›däktärte Karzerstrafe zo erlassen …‹«
»Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Direktor?« fragte der höfliche Mathematiker.
»Äch danke verbändlichst, äch habe för heute genog gesässen … Rompf, äch erwarte, daß Sä das Gelöbnis der Bässerung in jäder Hänsächt erföllen. Adieu, Herr Kollege.«
Sprach's und verschwand in den labyrinthischen Gängen des Schulgebäudes. – –
– – Wilhelm Rumpf hielt sein Versprechen aufs gewissenhafteste.
Er kopierte von jetzt ab nur noch die übrigen Lehrer: Samuel Heinzerlings geweihte Persönlichkeit war ihm heilig und unverletzlich.
Auch bewahrte er das unverbrüchlichste Stillschweigen, bis der Direktor im Herbste desselbigen Jahres auf wiederholtes Ansuchen in den Ruhestand versetzt wurde.
Erst dann erfuhr die jauchzende Prima den Hergang jener unerwarteten Versöhnung.
Rumpfs »aufrächtäge Reue« war für die lachlustige Bevölkerung des Städtchens eine Quelle unendlicher Heiterkeit. Unter denen, die sich am meisten über die Farce amüsierten, befand sich der joviale Direktor Samuel Heinzerling, der treffliche Autor der lateinischen Schulgrammatik.
Möge es ihm vergönnt sein, noch recht oft beim schäumenden Glase zu erzählen, wie er den gottlosen Schelm »Wälhälm Rompf« auf dem Karzer besuchte … »Rompf« seinerseits wird jenes schöne Rencontre im Gebiete Quaddlers nie vergessen, und sollte er so alt werden wie Grillparzer.



Die sympathische Teilnahme, die sich mein unvergeßlicher Lehrer Dr. Samuel Heinzerling im deutschen Vaterlande zu erwerben wußte, hat mich veranlaßt, die Papiere meiner Schuljahre aufs neue zu durchblättern und nach Zügen zu forschen, die das erhabene Bild des trefflichen Schulmannes vervollständigen und vertiefen könnten. Werden doch neuerdings Charaktere, die sich nicht annähernd der Popularität Samuel Heinzerlings rühmen können, – most popular nannte ihn erst kürzlich die Londoner »Public Opinion«, – werden doch literarische Größen, um die sich keine Seele mehr kümmert, in ausführlichen Biographien erörtert und bis auf die Eigentümlichkeiten ihrer Fleischerrechnungen und Einladungskarten seziert: weshalb sollte nicht ein Mann von der Bedeutung Samuel Heinzerlings die gleiche Pietät von seinem Geschichtschreiber beanspruchen dürfen?
Es fällt mir da ein Heft in die Hände, auf dessen Titelseite in großen Lettern die Worte prangen: »Geographie. Nachgeschrieben in den Lehrstunden des Herrn Direktor Samuel Heinzerling. Dienstags und Donnerstags von zwei bis drei. Sommersemester.«
Was ich dem Leser im nachstehenden mitzuteilen gedenke, ist seinem wesentlichen Inhalte nach diesem Hefte entlehnt. Nur hin und wieder hat die Erinnerung einige Linien ergänzt.
Es war gegen Ende Mai. Samuel Heinzerling hatte uns eine Schilderung der politischen und sozialen Verhältnisse von Paris geliefert. Der eigentliche Geographie-Unterricht wurde bereits in den unteren Klassen erledigt: in Prima gab man unseren Kenntnissen nur die letzte Retouche. Samuel Heinzerling legte daher einen[182] besonderen Wert auf das Kolorit. Er wünschte, uns das großstädtische Leben und Treiben, die tausendfältig sich kreuzenden Tendenzen einer rastlos jagenden Bevölkerung, die Schwierigkeiten und Wirrnisse eines so ungeheuren Gemeinwesens und ganz besonders den Kontrast zwischen der ruhigen Beschaulichkeit einer deutschen Kleinstadt und dem fiebernden Chaos der modernen Babel »plastäsch vor dä Sääle zo föhren«.
Beim Beginn der Lehrstunde, von der ich berichten will, trat er mit würdevoller Langsamkeit in das Schulzimmer, – noch würdevoller und langsamer als gewöhnlich. Auf dem Katheder angelangt, zog er einen Stoß vergilbter Blätter aus der Tasche, breitete sie sorgfältig vor sich aus und begann dann mit einer gewissen jungfräulichen Verlegenheit:
»Zor Vervollständägong des Bäldes, das äch än der vorägen Stonde vor Ähren Bläcken entrollt habe, wäll äch Ähnen heute einige charakterästäsche Stellen aus meinem Paräser Tagebooch vorlesen, das äch vor nonmehr säbzehn Jahren während eines fönfwöchentlächen Aufenthaltes än der französäschen Hauptstadt verfaßt habe. Däse ansprochslosen Notäzen werden Ähnen besser, als eine theoretäsche Schälderung däs vermöchte, dä Wahrheit meiner neuläch erörterten Behauptong klar machen: daß nämläch ein Monäzäpiom von allzo beträchtlächer Ausdehnong dä Exästenz des Ändävädooms än jeder Hänsicht erschwert. Äch wäderhole Ähnen: Dezentraläsation moß dä Parole jedes vernonftgemäß organäsärten Staatswesens sein. Däse sogenannten Weltstädte sänd aus keinem Gesächtsponkt zo rechtfertägen!«
»Aber, Herr Direktor,« begann Wilhelm Rumpf, als Samuel innehielt, »das alte Rom zur Zeit des Augustus war doch auch eine Weltstadt.«
»Sätzen Sä säch«, erwiderte Heinzerling mißmütig. »Das alte Rom war der Mättelponkt der damals bekannten Erde, hatte also logäscherweise das Anrecht auf eine gewässe räumläche Ausdehnong. Heutzotage aber steht der Omfang däser Großstädte mät dem ährer Staaten än gar keinem Verhältnäs. Öbrägens, äch halte mer aus, daß Sä mäch jetzt nächt bei jeder Sälbe onterbrechen; zomal es säch fögen könnte, daß meine Aufzeichnongen hän ond wäder einen[183] etwas persönlichen Charakter annähmen. Dä Sobjektävätät äst aus solchen Reisenotäzen mät dem besten Wällen nächt ämmer hänaus zo schaffen. Sollte also etwas Derartäges mät onterlaufen, so erwarte äch von Ährem Anstandsgeföhl, daß Sä mäch nächt mät onnötägen Fragen behellägen. Äch bränge Ähnen dorch dä Mätteilong däser Aufzeichnongen ohnehän ein gewässes Opfer: aber der Pädagoge äst mächtäger än mer als der Prävatmann. Rompf, wenn Sä lachen wollen, so gehn Sä mer vor dä Töre! Verstehen Sä mäch? Ond non ställ! Äch begänne!«
Seit Wochen hatte in der Prima keine so feierliche Ruhe geherrscht, wie nach dieser Erklärung unseres allverehrten Direktors. Was konnte uns wünschenswerter erscheinen, als die Ankündigung subjektiver Streiflichter auf das Privatleben einer uns so teuren und hochinteressanten Persönlichkeit?
»Meine Notäzen«, hub Samuel mit der ganzen Fülle seines wohlklingenden Organes an, »bestehen aus losen Zätteln, dä dem Datom nach aneinander gereiht sänd. Äch habe das Wächtigste här zosammengestellt ond begönne non ohne weitere Einleitong mät der Lektöre. Äch bemerke nor noch, daß äch mäch damals aus rein wässenschaftlächen Grönden zo jener ämmerhän beschwärlächen Reise entschlossen hatte.
Nochmals, äch begänne:
›Paräs, am drätten Mai. Bereits seit värzehn Tagen befände äch mäch än der Hauptstadt der Gallier. Äch habe mäch schon so zämläch än den öffentlächen Bäbläotheken orientärt ond freue mäch von Herzen öber dä Fölle des vorhandenen Materäals. Nor eine einzäge Handschräft, deren Exästenz Waldhober mär doch so zoverlässig behauptete, habe äch bäs jetzt noch nächt auftreiben können. – Gedold!‹«
»Herr Direktor,« warf hier Möricke ein, »wer ist denn der Waldhuber?«
»Ohne Zweifel ein Pariser Bibliothekar«, fügte Schwarz hinzu.
»Onsänn! Waldhober! Wer wärd Waldhober sein! Der beröhmte Archäologe, gegenwärtäg än Göttängen! Sä scheinen mer auch öber den Stand der modernen Wässenschaft sehr schlecht onterrächtet.«
»Wer kann all die Professoren so auswendig kennen«, versetzte Möricke.
»Sei'n Sä mer ställ! Sä können öberhaupt nächt väl auswendig. Äch fahre än der Lektöre fort:
›Paräs, am värten Mai. Gestern abend beim Diner – dorchaus nächt onsere deutsche Hauptmahlzeit, sondern välmehr der römäschen coena entsprechend – machte mäch Doktor Mouchard vom Collège de France aufmerksam, wä sehr es meinen Zwecken entsprechen wörde, wenn äch mäch dem Großherzoglich badäschen Gesandten, Herrn von Prättwätz, vorstellen wollte. Doktor Mouchard schälderte mer besagten Herrn von Prättwätz als einen Mann von wahrhaft klassäscher Bäldong, der änsbesondere ein hohes Änteresse för das Stodiom der Altertömer bekonde. Er könne meine Ontersochongen öber dä grächäschen Haartrachten wesentläch fördern, zomal er eine reichhaltäge Prävatbäbläothek ond verschädene wertvolle Manoskräpte besitze; daronter ein alexandränäsches Palämpsest von höchster Bedeutong. Doktor Mouchard fögte hänzo, Herr von Prättwätz sei ein dorchaus menschenfreundlächer, ädler Charakter, frei von Dönkel ond Öbermot, – kein Sklave der Hybris, dä äns Verderben föhrt. So habe äch denn än der Tat den Entschloß gefaßt, morgen fröh elf Ohr den trefflächen Staatsmann än seiner Wohnung, rue de Berlin Nommer neun, aufzosochen ond ähm meine wässenschaftlächen Absächten des näheren vorzotragen.
Am fönften Mai, abends. Heute fröh um neun Ohr sochte äch meinen schwarzen Frack hervor, börstete ähn sorgfältäg ab, setzte meinen Zäländer auf, kaufte mer ein Paar Handschohe von gelblächer Farbe ond nahm eines der vor meinem Hotel stehenden Zweigespanne, dä, beiläufäg bemerkt, äm onbedeckten Zostande eine gewässe Ähnlächkeit mät den Wagen des Homer aufweisen.
Äch habe non von jeher än den Oblägenheiten des alltäglächen Lebens einen gewässen Hang zom Onglöck bekondet. Meine Gattän wärd mer bezeugen, daß äch, Eier essend, stets dä verdorbenen aus der Schössel hervorlange, von dem Verwechseln des Sandfasses mät dem Täntenfasse ganz zo geschweigen. Auch dä zahlreichen Verwondongen, dä äch mer dorch Gabeln, Scheren, Törpfosten ond ähnläche Änstromente zozähe, kann äch nor als das Resoltat einer[185] latenten Neigong zom Mäßgeschäcke betrachten. Wenn mer non dergleichen schon daheim än dem trauten Kreise meiner Famälie passärt, om wäväl mehr bän äch den Dämonen des Zofalls ausgesetzt än einer Weltstadt, dä alle Sänne des Menschen än Ansproch nämmt ond ähn fast der Fähägkeit einer rohägen Öberlegong beraubt?
Äch war kaum än das Vehäkolom eingestägen, als äch, von dem Wonsche besäält, mäch betreffs des augenbläcklächen Zeitstandes zo onterrächten, nach meiner Ohr greifen wollte ond däselbe trotz aller Anstrengong nächt zo fänden vermochte. Äch berohägte mäch anfängläch bei dem Gedanken, sä sei ohne Zweifel äm Hotel auf dem Kamäne lägen gebläben. Als äch jedoch beim Aussteigen den Kotscher bezahlen wollte ond zo däsem Endzwecke nach dem kleinen Geld sochte, das äch gewöhnläch än der rechten Westentasche verwahre, da bemerkte äch zo meiner Verwonderong, daß öch öberhaupt keine Weste anhatte.
Verte! räf äch dem Kotscher zo. In meinem Hotel angelangt, fand äch dä Weste wohlbehalten am Schlössel des Kleiderschrankes, wo äch sä sorgfältäg aufgehängt hatte. För heute war es zo spät, da der badäsche Gesandte om zwölf Ohr zo fröhstöcken pflegt. Äch warf mäch daher wäder än meine Alltags- oder Stodärkleider ond gäng vergnögläch zor Bäbläothek. Morgen äst ja auch noch ein Tag. Öbrägens war dä heutäge Ausbeute auf der Bäbläothek so ergäbäg, daß äch dä kleine Enttäuschong gern än den Kauf nehme.‹«
»Herr Direktor!« rief Möricke, als Heinzerling einen neuen Zettel hervorsuchte.
»Non?«
»Hätten Sie denn nicht einfach Ihren Frack zuknöpfen können? Dann hätte man ja gar nicht gesehen, daß Sie die Weste nicht anhatten.«
»Goot! Sehr goot! Däse Bemerkong zeigt, daß Sä meine Mätteilongen einer denkenden Betrachtong onterzähen! Knebel! Schreiben Sä mal äns Tagebooch: ›Möricke wegen Aufmerksamkeit belobt.‹ … Haben Sä's, Knebel …? ›Wegen Aufmerksamkeit belobt.‹ … Was non dä Sache selber betrifft, so moß äch Ähnen bemerken, daß dä Verwärklächong Ährer an säch ja recht glöcklächen Idee aus dem zwängenden Gronde onmöglich war, weil der Frack[186] noch aus der Zeit meines Staatsexamens herröhrte. Äch konnte denselben mät dem besten Wällen nächt zoknöpfen, denn als Kandädat war äch wesentläch schlanker. Doch wär wollen ons dorch däsen Zwäschenfall än onserer Lektöre nächt stören lassen. Äch fahre da fort, wo äch aufgehört habe.
›Am sechsten Mai. Mät dem französäschen Idiom gäng es mär gestern abend recht schlecht. Der Kellner wollte mäch absolot nächt verstehen; ond da er weder än der lateinäschen noch än der grächäschen Sprache dä erforderlächen Kenntnässe besaß, so bläb mer nächts öbrig, als meine Wönsche zo Papär zo brängen. Er las meine Sätze denn auch mät Leichtägkeit ab. Wahrlich, nämals hätte äch äm Traume gedacht, daß dä gewöhnläche französäsche Konversationssprache einem Manne von klassäscher Bäldong so schwer fallen könnte. Dä nasale Aussprache gewässer Sälben hat för mein Organ etwas Wäderstrebendes‹ … Hotzler, was lachen Sä?«
Der Schüler erhob sich.
»Ich … ich wollte nur …«
»Was wollten Sä?«
»Ich kann nicht begreifen, daß gerade Ihnen die nasale Aussprache Schwierigkeiten bereitet.«
»Wäso? Was wollen Sä damät sagen? Hören Sä mal, Hotzler, äch glaube, Sä brängen här nächt den gehörägen Ernst mät, wie er zor Sache erforderläch äst. Knebel, schreiben Sä mal äns Tagebooch: ›Hotzler wegen kändäschen, läppäschen Benehmens getadelt.‹ Zor Strafe lese äch Ähnen jetzt däse lehrreichen Bemerkongen öber dä französäsche Aussprache nächt weiter vor! Das haben Sä säch non selber zozoschreiben! Rompf, lassen Sä das Gewackel ond röcken Sä weiter nach rechts! Sä hocken dem Gäldemeister ja auf dem Leib wä eine Klette. Ond non kein Wort mehr!
›Paräs, am säbenten Mai. Gestern om halb elf Ohr gräff äch abermals zo Frack ond Zäländer, vergewässerte mäch zweimal, ob dä Weste an Ort ond Stelle sei, ond bestäg dann das Zweigespann Nommer 1313. Dä ominöse Zahl beröhrte mäch eigentömläch. Ein alter Römer wörde än gleicher Lage omgekehrt sein. Äch aber habe mäch stets von den Anwandlongen eines dorch nächts zo motävärenden Aberglaubens ferne gehalten. Äch erwähne den[187] Omstand nor, weil der Eindrock, den er än mer hervorräf, för meine Stämmong charakterästäsch äst. Ebenso befremdete mäch än der Richelieu-Straße dä altklassäsche Änschrift eines Weinkellers: »Cave Richelieu«, eine Warnong, dä – fast an das beröhmte »Cave canem!« anklängend – einen alten Römer ebenfalls zor Vorsächt ermahnt hätte …‹«
Samuel Heinzerling hielt einen Augenblick inne.
»Herr Direktor,« rief Wilhelm Rumpf, die Pause benutzend, »darf ich mir in Beziehung auf diesen letzten Passus eine Frage erlauben?«
»Goot, fragen Sä!«
»So viel ich mich erinnere, heißt französisch la cave: der Keller, so daß also jene Inschrift ziemlich zwanglos mit »Richelieukeller« übersetzt werden könnte, eine Konjektur, die um so größere Wahrscheinlichkeit hat, als besagte Inschrift wirklich auf einem Keller zu lesen stand.«
»Goot! Sehr goot!« versetzte Samuel Heinzerling, die rundglasige Brille zurecht rückend. »Ähre Häpothese verrät eine röhmläche Schlagfertägkeit. Äch wäll sogar zogeben, daß Sä onter Omständen möglächerweise tatsächlich recht haben: mer jedoch, als dem klassäschen Phälologen ond Altertomsforscher, lag das Lateinäsche ongleich näher …
Äch fahre än der Lektöre fort:
›Trotz däser Omina woßte äch goten Motes zo bleiben. Mein Kotscher peitschte drauflos, als hätte er noch heute wä Helios dä Ronde om den Erdball zo machen. Nämals bän äch von Pferden auf so schnelle Weise befördert worden. Meine schon fröher ausgesprochene Häpothese einer Verwandtschaft des grächäschen ἵππος mät dem althochdeutschen hupfan (Phölologäsche Jahrböcher IV, S. 306) scheint mer jetzt evädenter als je. Leider sollte äch däse wässenschaftläche Erkenntnis mät einem persönlächen Onfall bezahlen: denn als wär so äm besten Sausen dahän rollten, ereignete säch plötzlich eine Erschötterong. Äch schrä auf ond gewahrte das Zweigespann än einer Lage, dä mer das Schäcksal des onglöcklächen Bellerophon äns Gedächtnäs zoröckräf. Noch lehnte freiläch das geschädägte Fohrwerk an einem großen, zweirädrägen Gemösekarren; aber äch war onglöcklächerweise wäder das Rad däses Lastwagens angedröckt[188] worden, was eine starke Besodelong mät Teer ond anderen klebrägen Stoffen zur Folge hatte. Än däsem Zostande konnte äch natörläch meinen Besoch beim Großherzogläch badäschen Gesandten nächt ausföhren. So bezahlte äch denn den Kotscher ond gäng än etwas deprämärter Stämmong nach Hause.
Das sänd dä Folgen der Zentraläsation, sagte äch, als äch nach einer Stonde wäder auf meinem Sofa saß ond ein Gläschen Borgonder schlörfte.
Meinen Frack ond meine Weste habe äch dem Hausknecht zom Reinägen gegeben. So werde äch denn vor öbermorgen den badäschen Gesandten nächt sprechen können; doch äch habe ja Zeit. Ohnehän moß äch heute onter allen Omständen Luitgardens Bräf beantworten. Sä könnte sonst glauben, äch wäre veronglöckt.‹«
»Wessen Brief?« fragte hier Wilhelm Rumpf.
»Non, das äst onwesentläch.«
»Luitgard, das ist wohl die Frau Direktorin?« fragte Möricke.
»Lassen Sä Ähre unnötägen Fragen! Äch habe keine Lost, Ähnen här meine Famälienverhältnisse auseinander zo setzen. Hören Sä weiter:
Also … ›sä könnte sonst glauben, äch wäre veronglöckt. Ond än der Tat, stand äch nächt heute bereits mät einem Fooße in Charons Nachen? Non, äch habe mer geschworen: kein Zweigespann mehr! Äch lese da eben än meinem Reisehandbooch, das ein sonst onbekannter Schräftsteller, namens Karl Bädeker, verfaßt hat, dä Omnäbosse seien bei weitem bälläger ond bequemer. Dä sogenannte Impériale – das Verdeck – scheint mer än der Tat ein äußerst gönstäger Platz, da man von dort einen freien Ombläck genäßt. Öbermorgen also mät erneuten Kräften ans Werk!
Meine Stodien liegen heute so zämläch brach. Dä Erschötterong än der Droschke hat mäch so verwärrt, daß äch keinen vernönftägen Gedanken zo fassen ämstande bän. Äch benotze daher, wä bereits oben bemerkt, däsen Änterämszostand zo einem Bräfe an meine Gattän.
Noch eines wäll äch erwähnen. Es äst mer vorhän aufgefallen, daß der Hausknecht eine korze Tonpfeife rauchte. Es scheint däs ein täf eingeworzelter französäscher Nationalgebrauch,[189] während än Deutschland dä lange Pfeife vorherrscht. Obgleich nächt moderner Koltorhästoräker von Fach, pflege äch doch dä Länder ond ähre Sätten aufmerksam zo beobachten. Den Välgewandten nennt mäch Luitgarde oft scherzweise – ond än gewässem Sänne hat sä onstreitäg recht. Besser freiläch wörde sä sagen: der Välseitäge.
Doktor Mouchard war vor einer Stonde bei mer ond fragte mäch, wä mer der badäsche Gesandte gefallen habe. Äch erzählte ähm das erlättene Mäßgeschäck: der Mensch lachte mer laut äns Gesächt. Däse Franzosen sänd eine herzlose, egoästäsche Nation.
Mein Kollege Träuble, der Ordänarios von Quarta, wörde säch än gleichem Falle ganz anders benommen haben.
Am neunten Mai. Gestern om halb elf verläß äch mein Hotel, om den Omnäbos der Länie Clichy-Odéon abzupassen, der, wä der Hausknecht versächert, dächt an der rue de Berlin vorbei fährt. Der Omnäbos kam, ond da äch än der Gymnastäk zwar kein Koryphäe, aber ämmerhän ein ganz leidlächer Dälettant bän, so gelang es mär ohne Schwärägkeiten, dä treppenartäge Leiter, oder besser, dä leiterartäge Treppe, zor sogenannten Impériale hänan zo klämmen. Dä Höhe, än der äch mäch non befand, hatte zwar äm ersten Augenbläck etwas Beonrohigendes; bald ändes öberzeugte äch mäch von der Solädätät des Eisengeländers, – ond dä völläge Sorglosägkeit der öbrägen Passagäre trog dazo bei, mein Onbehagen völläg zo tälgen. So genoß äch denn än onbeschränktem Maße dä großartäge Aussächt auf das Treiben der Weltstadt. Än Betrachtongen der mannächfachsten Art versonken, hatte äch anfängläch nächt bemerkt, daß der Omnäbos, sobald ein Herr absteigen wollte, nächt anhält. Däse Röcksächt gält bloß för das zarte Geschlecht. Jetzt aber ward äch auf däsen Omstand aufmerksam, da mein Nachbar, ein Jöngläng aus dem Handwerkerstande, den Platz an meiner Seite verläß ond ohne dä gerängste Bangägkeit an dem rasch dahänrollenden Omnäbos hänonter kletterte. Zwei Sekonden später stand er wohlbehalten auf dem Trottoir ond gäng än das nächste Haus, als wäre nächts vorgefallen …
Mer ward mät jedem Augenbläck schwöler zomote. Das Hänanklämmen, zomal wenn der Omnäbos stand, läß säch ohne[190] Möhe bewerkstellägen; aber hänonter, ond noch dazo röckwärts? Nonquam retrorsom! Das war von jeher mein Wahlsproch, – ond non sollte äch onter so wäderwärtägen Verhältnässen dem Grondsatze meiner Jogend ontreu werden? Ändes, was war zo machen? Dä Straße, än dä wär jetzt einfohren, war dä rue de Clichy … Äch sprach also: fortes fortona jovat ond gäng färmo constantäque anämo ans Werk. Zo Anfang schänen dä Götter mer gönstäg. Dä Treppe ward än korzer Zeit glöcklich zoröckgelegt, ond wohlbehalten langte äch auf der breiten Onterstäge an, von der äch nor herabsprängen moßte, om sägreich geborgen zo sein.
Mein Kollege Salzmann, der Physiker, hat mer oft auseinander gesetzt, daß onsere klassäsche Bäldung eine einseitäge, ädealästäsche sei ond zor Ergänzong einer realästäschen Hälfte – der Natorwässenschaften – bedörfe. Äch habe Salzmann oft einen Materialästen genannt ond ähn aus Plato ond der »Krätäk der reinen Vernonft« zo wäderlegen gesocht. Jetzt ändes erkenne äch, daß er nächt völlig äm Onrecht war. Hätte äch än meiner einseitägen, ädealästäschen Rächtong nächt öbersehen, daß ein Körper, der säch än Bewegong befändet, vermöge des Gesetzes der Trägheit än däser Bewegong verharrt, auch wenn dä causa movens zo wärken aufhört, – äch erännere mäch däses Lehrsatzes aus meiner Gymnasialzeit, – so wäre äch nächt beim Absprängen von der Omnäbosstäge langwegs än den Kot gefallen.
Mein Alexander moß onter allen Omständen gröndlächen Onterrächt än den Realien erhalten. Es äst dä Pflächt der Eltern, ähre Känder vor den Öbeln, dä sä selber aus Onkenntnäs erdoldet haben, vorsächtäg zo bewahren.
Äch habe mer beim Storz von der Omnäbosstäge dä rechte Kännlade verletzt ond sätze daher mät verbondenem Antlätz än meinem Hotel. Mein Zostand verbätet mer jedes öffentläche Erscheinen. Da äch also heute nächt zum Diner komme, wärd Doktor Mouchard mäch ohne Zweifel morgen zor Rede stellen, ob äch välleicht beim badäschen Gesandten diniert habe. Äch wörde unbedängt Ja sagen, wenn äch nor äm Besätze einer zoverlässägen Personalbeschreibong wäre! Das sänd wäder dä Folgen der Zentraläsation! Wenn däses Volk nächt so rennte ond jagte, sondern säch Zeit[191] nähme, dä Fahrgäste absteigen zo lassen, so hätte äch heute zoverlässig meinen Plan zor Ausföhrong gebracht!
Eines steht ändes fest: keine Macht der Welt brängt mäch wäder auf eine Impériale. –
Es klopft, – sollte es Mouchard sein?‹«
Boxer und Möricke waren bei den letzten Worten hastig nach der Tür gestürzt.
»Was fällt Ähnen ein?« rief Samuel Heinzerling im Tone des höchstens Erstaunens.
»Ich wollte mal nachsehen«, erwiderte Boxer; »Sie sagten doch eben: ›es klopft.‹«
»Onsänn! Äch habe vorgelesen – ganz deutlich ond onverkennbar: ›Es klopft – sollte es Mouchard sein?‹«
»Ach so,« erwiderte Boxer, »das Letzte habe ich nicht gehört.«
»Ich auch nicht, Herr Direktor«, fügte Möricke ehrerbietig hinzu.
»Sä hören öberhaupt nächts, Möricke; setzen Sä säch!«
Und von neuem hub die wohlklingende Stimme des trefflichen Schulmannes zu lesen an:
»›Den zehnten Mai. Es war nächt Doktor Mouchard, sondern der Hausknecht. Der wackere Mensch kam, om meine beschmotzten Kleider zo holen. Äch werde ähm bei meiner Abreise ein töchtäges Tränkgeld geben mössen, denn er hat än der Tat väl Arbeit mät meinem schwarzen Kostöm.
Gestern abend hatte äch eine brällante Idee. Sä bestand darän, das nächste Mal einen Platz äm Ännern des Fohrwerks zo nehmen ond dä Gelegenheit abzopassen, sobald eine Dame den Kondokteur anhalten heißt. Äch kann wohl sagen, daß däse Lösong mer als ein Träomph menschlächer Berechnong erschien. Meine Befrädägong erreichte den Höhegrad, als auch dä Schmerzen än meiner Kännlade fast gänzlich nachläßen ond eine Kreuzbandsendong aus Grönängen eintraf, eine Beilage des Grönänger Wochenboten, woran Luitgarde dä folgende Stelle mät Rotstäft angesträchen hatte.
Vermäschtes. Onser trefflächer Archäologe, dä Zärde onserer Vaterstadt, der Gymnasialdärektor Samoel Heinzerläng, befändet säch seit einigen Wochen än der französäschen Hauptstadt, wo seine Ontersochongen öber dä Haartrachten des Altertoms einen gedeihlächen[192] Fortgang nehmen. Aus sächerer Quelle können wär hänzofögen, daß Herr Baron von Prättwätz, der Großherzogläch badäsche Gesandte, onseren Heinzerläng mät seinem ganzen Einflosse onterstötzt ond ähm sogar seine reichhaltäge Prävatbäbläothek zor Verfögong gestellt hat.
Träuble, Träuble! räf äch aus, als äch däse schmeichelhafte Anerkennong meiner bescheidenen Bestrebongen nächt ohne Erröten gelesen hatte. Wer sonst auch sollte öber däse Details, dä äch nor Luitgarden geschräben hatte, so genau onterrächtet sein, wenn nächt er, der langjähräge Freund meines Hauses? Dä Nachrächt von dem götägen Entgegenkommen des Großherzogläch badäschen Gesandten war freiläch ein wenig verfröht, ändes: Rom äst nächt an einem Tage erbaut worden, ond korz ond goot, dä Notäz des Grönänger Wochenboten versetzte mäch än dä rosägste Stämmong …
Am zwölften Mai. Gestern warf äch mäch zom värten Male än Gala, om endläch meinem prädestänärten Gönner den längst zogedachten Besoch abzostatten. Der Omnäbos kam, ond äch, flänk wä der Wänd, hänein ond Platz genommen.
Es war doch ein ganz anderes Geföhl här onten äm Schoße der behaglächen Sächerheit, als da oben auf der schwankenden Höhe der Impériale. Horaz sagt mät Recht, der Blätz schlage am läbsten än hohe Törme ond öbermötäge Fächten ein, während er das ställe, bescheidene Kraut am Boden verschone …
Äch hatte äm Omnibos ein sehr schön gekleidetes weibläches Wesen zor Nachbarän. Dä Dame trog einen halb dorchsächtägen schwarzen Schleier, der etwa bäs än dä Gegend des Mundes reichte. Vermotläch äst dä Sätte däser halben Maskärong dorch dä Phönizier aus dem Orient nach Marsilia, dem heutägen Marseille, gebracht ond von da aus nach dem Norden verpflanzt worden.
Während der Fahrt war äch bestrebt, meine topographäschen Kenntnässe zo erweitern. Der Omnäbos schän ändes heute eine andere Roote einzoschlagen. Dä Gegend war mer wenägstens vollständäg neu.
Non, om so besser, sagte äch zo mer selbst. Äch bereichere so nor meine Anschauongen.
Dä Physiognomä der Straßen, dorch dä wär kamen, worde von Minote zo Minote seltsamer. Äch gewahrte zahlreiche Blusenmänner, zom Teil mät Äxten bewaffnet. Aus Wein- ond Branntweinschenken tönte mer verworrenes Geschrei entgegen. Deutläch glaubte äch dä Klänge der Marseillaise zo hören. Äch gestehe, daß äch däse Symptome höchst bedenkläch fand. Onrohig rotschte äch auf meinem Sätze hän ond her. Dazo kam der verdächtäge Omstand, daß der Omnäbos leerer ond leerer ward. Rätselhafte Erscheinong! Hatte välleicht der Kondokteur äm Komplott mät dem Kotscher dä Absächt, mäch än eine menschenleere Gegend zo fahren ond mäch dort zo berauben? Paräs stand än däser Hänsächt von jeher än öblem Rofe. Än Grönängen freiläch wäll äch mäch om Mätternacht getrost vor das Tor wagen, – aber Paräs äst nächt Grönängen. Mein Herz begann lebhafter zo schlagen; – ond als jetzt auch der letzte Passagär ausstäg, da rächtete äch än der Tat ein ställes Stoßgebet zom Hämmel ond befahl Luitgarden, Alexander, Ismenen, Winfrieden ond Vitriaria der Försorge des Allmächtägen. Was konnte dä nächste Mänote brängen? Womät hatte äch das verdänt? Äch dorchmosterte mät einem raschen Bläck mein vergangenes Leben ond fand leider, daß äch välfach gefehlt hatte. Eine ernstläche Reue öberkam mäch, ond zerknärscht gelobte äch mer Besserong, wenn äch nor däsmal noch aus den Armen des Verrates errettet wörde … Da hält der Omnäbos an … Fänster bläckend trat der Kondokteur auf mäch zo ond räf: »Descendez s'il vous plaît!«
Tödläch erschrocken leistete äch seinem Befehl Folge. Wenäge Sekonden später ändes hatte säch alles befrädägend aufgeklärt. Dä ganze Lösong der rätselhaften Erscheinongen lag än dem Omstande, daß äch än den Omnäbos einer falschen Länie eingestägen war, ond mäch non an der Endstation einer Vorstadt befand, dä von der Wohnong des badäschen Gesandten reichläch anderthalb Stonden entfernt lag. Was bläb mer öbrig, als mät demselben Wagen wäder nach Haus zo fahren ond Gott zo danken, daß mer wenägstens nächts Schlämmeres begegnet war. Morgen werde äch besser aufpassen: endläch moß man doch eine gewässe Paräser Routäne erlangen.
Am dreizehnten Mai. Gestern stand äch wäder gegen halb elf Ohr an der Omnäbosstation. Aller gooten Dänge sänd drei, mormelte äch vor mäch hän. Äch bän gewohnt, öfters etwas vor mäch hänzomormeln, ein Gebrauch des Monologs, den äch mer aus den Komödien des Plautus angeeignet habe. Äch halte ähn för ein vortreffliches Mättel, säch mät dem eigenen Äch gehöräg äns Klare zo setzen. Vär, fönf Omnäbosse kamen voröber; sä waren sämtlich bäs auf den letzten Platz öberföllt. Da kam mer plötzläch der Gedanke, mäch aller Fohrwerke zo entschlagen ond einfach zo Fooße zo gehen. Eine herrläche Idee! räf äch aus. Än der Tat, wenn äch zo Fooße gäng, so war äch gegen alle bäsher erlättenen Onbälden ein för allemal geschötzt. Onbegreifläch, daß mer däse Wahrheit nächt fröher einleuchtete! Wäväl Zeit, wäväl Geld, wäväl goote Laune hätte äch sparen können!
Röstäg eilte äch förbaß, seelenvergnögt, daß äch endläch das rächtäge Auskonftsmättel gefonden hatte.
Leider worde äch erst zo spät gewahr, daß dä Zeit för eine Omnäbosfahrt zwar reichläch zogemessen, aber för den Fooßgänger doch etwas zo knapp gegräffen war. Als äch än dä rue de Berlin einbog, schlog es halb eins, ond da äch woßte, daß der Baron om zwölf Ohr dejenärt, so besah äch mer das Haus einstweilen von außen.
Morgen werde äch zeitäger aufbrechen, mormelte äch, als äch den Röckweg antrat.
Heute fröh erhäält äch von Alexandern einen recht netten lateinäschen Bräf, an dem äch nor einäge Germanäsmen zo rögen hatte. Äch habe ähn schleunägst korrägärt ond, nach Beifögong zweier Dankeszeilen än grächäscher Sprache, zoröckgesandt.
Das Wetter hat säch zom Argen gewendet: ύεῖ μὲν ό Ζεύς, wä der hellenäsche Lyräker sängt, ond auf den Straßen waltet des Kotes erdröckende Fölle. Beim Anbläck des grauen Gewölks habe äch eine Elegä än altklassäscher Form zo Papär gebracht, dä äch här beiföge …‹«
Samuel Heinzerling unterbrach sich und rückte die Brille zurecht.
»Ach, Herr Direktor«, rief die Prima wie aus einem Munde, als der Verfasser der Lateinischen Grammatik für den Schulgebrauch[195] Miene machte, die Elegie zu überschlagen. »Ach, lesen Sie uns doch vor! Lassen Sie doch ja nichts aus, Herr Direktor! Gerade die Verse interessieren uns! Bitte, die Elegie!«
»Non goot, Sä sollen sä hören«, versetzte Samuel, augenscheinlich geschmeichelt. »Das Gedächt betätelt säch: ›Regenwetter‹ …
»Bravo!« rief Wilhelm Rumpf, als Samuel Heinzerling geendet hatte.
»Enthalten Sä säch jeder Krätäk«, sagte der Schulmann ein wenig ungnädig.
»Aber, Herr Direktor, ich werde doch meinen Empfindungen noch Ausdruck verleihen dürfen …«
»Verschäben Sä den Ausdrock Ährer Empfändongen bäs zom Schlosse der Lehrstonde!«
»Wirklich, ganz ausgezeichnet!« sagte jetzt Hutzler halblaut zu seinem Nachbar.
»Hotzler, Sä gehn mer hänaus! Äch bän Ähre Dommheiten möde. Wä können Sä säch ein Orteil erlauben, Sä, der Sä nächt einmal ämstande sänd, einen Daktylos von einem Trochäos zo onterscheiden.«
»O, Herr Direktor …«
»Knebel, schreiben Sä mal äns Tagebooch: ›Hotzler, zom zweiten Male wegen läppäschen Benehmens getadelt.‹ Hotzler, äch wäderhole Ähnen, Sä gehn mer hänaus!«
Hutzler verließ das Lehrzimmer. Der Direktor fuhr fort:
»›Am säbzehnten Mai. Äch bän so erbättert, daß äch nor archäologäsche Jamben zo Papär brängen möchte! Däffäcele äst satäram non scräbere!
Am Värzehnten däses Monats machte äch mäch schon gegen neun Ohr auf … Nächt ohne eine gewässe Ängstlächkeit betrat äch[196] dä Straße: ein fönfmaläges Mäßlängen äst wenäg geeignet, onser Vertrauen zo stärken.
Äch schrätt dorch dä Straße Vivienne nach dem Börsenplatze ond bog dann än dä Richelieustraße ein, wo äch mäch sehr vorsächtäg weiter bewegte. Schon hatte äch etwa dä Hälfte der Straße zoröckgelegt, als äch plötzläch einen Menschen bemerkte, der mät einer langen, speerartägen Stange drohende Gesten ausföhrte ond dabei so onzweideutäg seine Bläcke auf mäch heftete, daß äch kein Ödäpos zo sein brauchte, om zo erraten, wem däse Feindselägkeit gelten sollte.
Hatte der Mensch wärkläch Absächten auf mein Eigentom ond mein Leben? Offenbar gehörte er dem Arbeiterstande an, – ond was man von den Paräser Arbeitern zo halten hat, das weiß heutzotage ein jeder. Das Schäcksal der onglöcklächen Könägin Maräe Antoinette stand mät einem Male än forchtbarer Klarheit vor meiner Sääle …
Ond doch, wä war es denkbar, daß ein Mensch am hellen Tage auf dä geachtete Persönlächkeit eines deutschen Gymnasialdärektors frevelhafterweise ein Attentat wagen dorfte? Wämmelte es nächt rängs von Menschen? Freiläch bemerkte äch, daß jedermann dem Borschen mit der speerartägen Stange ängstläch auswäch. Er moßte also gefährläch sein … Ändessen, was konnte er mer anhaben? Auf offener Straße, fast onter den Augen zweier Poläzästen ond einer bewaffneten Schäldwache? Än dä Mätte der Straße auszobägen, schän mer gefährläch, der zahlreichen Fohrwerke halber: also köhn drauf los! Mot, Samoel! räf äch mer zo. Sollte der Mensch da än der Tat einen Frevel beabsächtägen, so werden dä Männer des Gesetzes alsbald dä Pläne eines wahnwätzägen Barräkadenmannes zo vereiteln wässen. Äch schrätt mannhaft vorwärts. Der Mensch mät dem Speer schwenkte ond gestäkolärte ämmer verdächtäger. Dabei stäß er seltsame Töne aus, dä wä ein fremdländäsches Krägsgebröll klangen. Sollte äch omkehren?
Äch räf mer eben ein neues Mot, Samoel! zo, als plötzläch von oben eine Flössägkeit öber mäch herklatschte, dä meinen Frack alsbald mät einer weißen, kalkartägen Kroste öberzog. Allmähläch[197] gäng mär ein Lächt auf, ond auch Doktor Mouchard hat es mer nachträgläch bestätägt. Das Haus, vor dem der Mann mät der Stange auf- ond abläf, worde jost fräsch getöncht. Äch hatte den ehrsamen Arbeiter schmähläch verkannt!
George, der Hausknecht, äst seit ehevorgestern mät der Reinägong meines Frackes beschäftägt, hat jedoch bäs zor Stonde nor onbefrädägende Resoltate erzält. Dä Beinkleider hatten nor wenäg gelätten, was leicht zo erklären äst, da der verhängnäsvolle Goß von oben auf mäch hereinbrauste.
Äm ganzen darf äch mer Glöck wönschen, daß äch auf däse Weise eine lehrreiche Erfahrong gemacht habe. Äch weiß jetzt, was es bedeutet, än Paräs auf dem Trottoir zo wandeln. Wenn non anstatt däser flössägen Masse ein Balken, ein Stein oder sonst etwas Wochtäges herabgestörzt wäre, wä däs bei dem fortwährenden Ausbessern ond Ombauen, das här zo herrschen scheint, dorchaus äm Bereiche der Möglächkeit lägt? Ond Luitgarde, Alexander, Winfriede, Ismene ond Vitriaria? Entsetzläch! Nein, es war nor ein Wänk der götägen Götter, ond äch söndäge gröbläch, wenn äch öber däsen kleinen Zwäschenfall morre. George, der Hausknecht, äst ja geschäckt; auch hat er än der letzten Zeit väl Öbong bekommen.
Meinen Besoch beim Großherzogläch badäschen Gesandten habe äch nonmehr auf Donnerstag den neunzehnten Mai festgesetzt. Äch freue mäch onendläch, eine Bekanntschaft zo machen, von der mer Mouchard so väl Gootes geweissagt hat.
Mouchard hat säch däsmal edler benommen als das letzte Mal. Äch schätze än ähm einen töchtägen Vertreter der Wässenschaft ond einen läbreichen Freund …
Am zwanzägsten Mai. Non bän äch's denn doch möde, mäch äwäg mät däsen Paräsern heromzoschlagen. Daß mär so etwas passären moßte! Es äst wahr, mein schwarzer Frack säht nächt mehr zom elegantesten aus, ond mein Zäländer äst seit lange des ersten Glanzes beraubt: wä es aber mögläch war, mäch ongeachtet däser kleinen Änkorrektheiten meiner Toilette för den belgäschen Klavärlehrer Haentjens zo halten, der wegen verschädener Betrögereien steckbräfläch verfolgt wärd, das äst ond bleibt mer ein Rätsel! Non, äch habe den Ärrtom der Paräser Poläzästen teuer bezahlen mössen.[198] Volle zwölf Stonden verbrachte äch auf der Wache, bäs äch ämstande war, meine Ädentätät zo erhärten. Doktor Mouchard hat mär än däser Bezähong sehr anerkennenswerte Dänste geleistet. Onerhört! sage äch. Einen deutschen Gymnasialdärektor mät einem belgäschen Klavärlehrer zo verwechseln, ond noch dazo mät einem Betröger! Äch rofe dä Götter zo Zeugen an, ob äch jemals dem Eigentom meiner Mätmenschen auch nor än Gedanken zo nahe getreten bän! Man sollte denken, däse honestas mößte säch auch än meinen Gesächtszögen hänlängläch ausprägen. Onerhört! sage äch. Bäs elf Ohr abends hab' äch auf der sogenannten Violine verbracht, teilweise onter schweren Verbrechern, äch, Samoel Heinzerläng, Därektor des städtäschen Gymnasioms zo Grönängen. Wer mer das vor acht Tagen geweissagt hätte! Aber äch werde Genogtoong fordern, – koste es, was es wolle! Das sänd dä Fröchte jener räsägen Konglomerate, dä man Weltstädte nennt! Än Grönängen wäre dergleichen onmögläch gewesen. Notabene, könftäghän werde äch stets meinen Paß bei mer tragen.
Den Besoch bei dem Großherzogläch badäschen Gesandten habe äch natörläch auf öbermorgen vertagt …
Am einondzwanzägsten Mai. Endläch bän äch ans Ziel gelangt, wenägstens topographäsch geredet. Äch erreichte wohlbehalten das Hotel än der rue de Berlin ond zog, äm Geföhl eines onendlächen Wohlbehagens, dä gesandtschaftläche Klängel. Leider moßte äch von dem Däner dä Meldong entgegennehmen, der Baron von Prättwätz sei am Tage zovor auf sechs Wochen nach Baden-Baden verreist.
Äch war nächt wenäg verstämmt. So väle Aufregongen, so väle Verloste an Zeit ond Geld, so väle Verdräßlächkeiten, – ond non alles omsonst! Äch legte mer das Gelöbde ab, nä wäder än einer fremden Großstadt Besoche zo machen. Dergleichen föhrt zo nächts Gootem. Äch bän einmal das Opfer der Zentraläsation geworden ond habe keine Lost, däse onglöckseläge Rolle weiter zo spälen. Der wässenschaftläche Ernst eines deutschen Gelehrten äst onvereinbar mät dem frävolen ond oberflächlächen Treiben solcher modernen Riesenstädte. Sänd wär dorch dä Omstände verorteilt, ons zeitweiläg ännerhalb däser gefährlächen Weichbilde aufzohalten, so gezämt ons dä onbedängte Reserve!‹«
Samuel Heinzerling faltete seine Zettel zusammen.
»So,« sagte er, indem er das Päckchen in die Brusttasche schob, »Sä werden aus dem Mätgeteilten zor Genöge ersehen haben, was äch beweisen wollte: daß dä Zerteilong än väle abgesonderte Staaten ein Segen för dä deutsche Nation äst. Äch wönsche non, daß Sä mer för das nächste Mal däse Frage än einem korzen Aufsatze theoretäsch ond praktäsch erörtern. – Der Hotzler kann jetzt wäder hereinkommen.«
In diesem Augenblicke erscholl die Klingel. Würdevollen Schrittes und im Bewußtsein, die Keime einer segensreichen Weltanschauung gelegt zu haben, verließ der Verfasser der Lateinischen Grammatik für den Schulgebrauch, mit besonderer Berücksichtigung der oberen Klassen, das Lehrzimmer.
»Ich habe mir alles stenographiert«, rief Heppenheimer, die Mappe schwenkend.
»Et ego«, versetzte ich freudestrahlend. »Morgen muß uns der Rumpf die Geschichte vorlesen.«
Die schändlichen Stenographen! Ohne die teuflische Kunst Gabelsbergers wäre dem wackeren Schulmann der Schmerz erspart worden, den infandus dolor seiner Pariser Leiden in diesen Blättern so buchstäblich renoviert zu sehen. Er hatte kein Glück mit seinen Besuchen, der treffliche Heinzerling, weder mit dem Besuch im Karzer, noch mit dem Besuch beim Großherzoglich badischen Gesandten in der rue de Berlin.


Aech werd' ähn Där nämmer vergessen,
Den schnöden Prämaner-Träomph,
Daß äch auf dem Karzer gesessen,
Do extravagärender Rompf!
Äch bätt' euch, bei allen Prophäten,
Wer nähme dä Sache nächt kromm?
Äch wollt' äns Gewässen ähm räden, –
Da dräht er den Schlössel mer om!
Äch schälle … Was notzt mär das Schällen?
Bornärt äst der Quaddler ond stompf.
Der dömmste von allen Pedellen
Meint faktäsch, äch wäre der Rompf!
Doch bläb äch gelassen ond monter,
Bäs Rompf als Befreier erschän:
So kam äch denn wäder heronter
Und habe dem Schlängel verzähn!
Ond mag es ons Lehrer betröben,
Äch wag' das geflögelte Wort:
Als Schöler säch mimisch zo öben,
Äst doch nächt so völläg absord!


Beim Bär – beim Bär,
War nä mein Bosen schwär!
Vergässen äst des Dolders Not,
Der schnöden Präma Öbermot …
Der Gäldemeister stärt mäch nächt,
Der Hotzler schäkanärt mäch nächt:
Manch Seidel schlörf' äch leer.
Beim Bär – beim Bär
War nä mein Bosen schwär!
Äm Grond – äm Grond
Äst's Bär mer nächt gesond!
Zom Schlagfloß hab' äch stäts geneigt,
Ond bayräsch Bär erhätzt so leicht.
Es geht äns Blot, es nämmt dä Roh, –
Der väle Ärger kömmt dazo,
Dä Präma treibt's zo bont!
Äm Grond – äm Grond
Äst's Bär mer nächt gesond!
Was toot's? Was toot's?
Das Bär äst doch was Goot's!
Ond ob's das Läben mer verkörzt, –
[202]Mäch dönkt, wer störzen soll, der störzt!
Zom Hömmel häb' äch köhn den Bläck:
Där, Zeus, vertrau' äch mein Geschäck,
Än Deinen Händen roht's!
Was toot's? Was toot's?
Das Bär äst doch was Goot's!
Das Bär – das Bär,
Das bleibt non mein Pläsär!
Der Zechtäsch äst mein Heilägtom,
Dä Kneipe Mekka mer ond Rom;
Ond wenn dä Hand das Glas omspannt,
Föhlt säch dä Sääle gottverwandt:
Fromm wärd sä mehr ond mehr …
Das Bär – das Bär,
Das äst non mein Pläsär!
Wä domm – wä domm,
Das Zämmer fällt ja om!
Dä Wände taumeln kromm ond schäf,
Jetzt sänd sä hoch, jetzt sänd sä täf …
Ond jetzt … aha, äch märk' es wohl,
Jetzt röcken Geister mer am Stohl …
Herr Wärt, äch dolde stomm!
Wä domm – wä domm,
Das Zämmer fällt ja om!
Das Bär – das Bär
War ongewöhnläch schwär!
Sont certi … nein … Wä sagt Horaz?
Wä? Was? Der Gäldemeister tat's?
Ja, Luitgard! … ja, äch hab' genog …
Der Knebel … schreibt's äns Tagebooch …
Ja, ja … schon beim Homär …
Das Bär – das Bär
War ongewöhnläch schwär!
(Ab unter den Tisch.)



Wenn das Maturitätsexamen dem Gymnasiasten ernst und bedeutsam erscheint, so raubt ihm die Klassenprüfung den Gleichmut nur in Ausnahmefällen. Es gibt allerdings eine Sorte von ganz besonders ehrgeizigen oder ganz besonders unwissenden Schülern, die auch der Klassenprüfung mit einer gewissen Bänglichkeit entgegenwandeln: aber sie bilden die Minorität. Für mich und meine nächsten Freunde war dieses ein- oder zweimal im Jahre wiederkehrende Examen allezeit ein Gaudium, und je zahlreicher sich das Publikum versammelte, um so vergnüglicher pflegten wir dreinzuschauen.
Das Klassenexamen ist die Farce des Gymnasiallebens. In corona civium liebt es kein Lehrer, seine Schüler als unwissend bloßzustellen. Denn der Vorwurf dieser Unwissenheit träfe in erster Linie ihn selbst. Daher wir denn regelmäßig über solche Materien examiniert wurden, die während der letzten Wochen bis zum Überdruß zerkaut und verdaut waren.
Wir erschienen beim Beginn des Examens sehr pünktlich, – in unsern besten Kleidern, – und getragen von jener Feiertagsstimmung, die aus dem Bewußtsein der bevorstehenden Ferien erwächst. So nahmen wir auf den Subsellien im großen Saale Platz, an dessen Eingang der Pedell Quaddler in schwarzem Frack und weißer Halsbinde Posto gefaßt hatte. Nach und nach erschienen die Lehrer, stets in schmunzelndem Zwiegespräch, sich wiederholt Herr Kollege nennend und eine ähnliche Befriedigung zur Schau tragend wie die Schüler. Zuletzt nahte würdevollen Schrittes der Direktor Samuel Heinzerling, ganz Wohlwollen, ganz Frühling[204] und Sonnenschein. Ehrfurchtsvoll traten die übrigen Pädagogen nach rechts und links auseinander, um ihren Herrn und Meister hindurchzulassen. Mit vollendeter Humanität teilte Samuel seine kollegialischen Grüße aus: die Schüler aber mußten sich bei seinem Erscheinen von ihren Sitzen erheben, eine Höflichkeitsbezeigung, für die Samuel stets durch heftiges Abwinken dankte.
Der Religionslehrer bestieg nunmehr den Katheder, faltete die Hände und sprach:
»Lasset uns beten!«
Abermals stand die Klasse auf wie ein Mann, und Samuel Heinzerling blickte wohlgefällig auf diese Kolonnen, die ihn und den Herrn der Heerscharen durch eine so ehrfurchtsvolle Behandlung auszeichneten.
Der Religionslehrer sprach sein Gebet und bat den Allmächtigen, er möge unsern Eingang und unsern Ausgang segnen. Hierauf begann das Examen.
Eine halbe Stunde verstrich, ohne daß uns das Publikum irgend einen Vertreter gesandt hätte. Da endlich knarrte die Tür. Aller Augen wandten sich nach der Schwelle: es erschien der Superintendent Samson, der sich in ganz ungewöhnlichem Maße für die geistige Entwicklung der Jugend interessierte. Verbindlich lächelnd drückte er einem Lehrer nach dem andern die Hand, – aber ganz sachte und insgeheim, um ja nicht zu stören. Dann folgte er mit reger Aufmerksamkeit den Peripetien der Prüfung, öfters mit dem Kopfe nickend und stets so schlau dreinschauend, als ob er wirklich imstande sei, die gestellten Fragen korrekt zu beantworten.
Nach dem Superintendenten erschien der erste Stadtprediger, und dann füllten sich die Hallen so allgemach, bis um elf Uhr der Höhepunkt eintrat.
Ein beträchtliches Kontingent zu diesen Vormittagsbesuchern lieferten die Gymnasiasten selbst, und zwar wohnten die Schüler der unteren Klassen mit Vorliebe den Prüfungen der oberen bei, so daß die Sextaner niemals so zahlreich vertreten waren, als wenn die Prima examiniert wurde.
Des Nachmittags bot der Saal einen weit pittoreskeren Anblick, denn jetzt erschienen auch die Mütter und Schwestern der Examinanden.[205] Der Anblick farbenprächtiger Roben und wallender Hutbänder war in diesen Räumen etwas so Ungewohntes, daß wir bei dem Erscheinen der ersten Dame jedesmal in einen Zustand herzklopfender Aufregung gerieten, zumal wenn die Dame jung und hübsch war. Das Rauschen ihres Gewandes tönte uns lieblicher als Musik, und die kleinen, zierlichen Halbstiefelchen klappten so ganz anders auf den Dielen des Saales als die kolossalen Gehwerkzeuge Doktor Hellwigs.
Samuel Heinzerling war bei diesen Anlässen von einer musterhaften Galanterie. Jeder Zoll seines Wesens atmete Wohlwollen und Ritterlichkeit, wenn er die gnädige Frau oder das verehrte Fräulein nach dem Stuhle geleitete. Nur die Backfische im Alter von 13 bis 15 Jahren behandelte er etwas kühler, denn er wußte, daß gerade diese Sorte seinen Schülern am gefährlichsten war.
Gegen vier Uhr nachmittags hatte sich der Damenflor, der unsere Prüfung schmückte, am reichsten entfaltet. Gar mancher von uns erblickte da auf bescheidenem Rohrstuhle den »Stern seines Lebens«, die »Rose, vom Himmelstau gebadet«, den »Engel, zu gut für diese lieblos rauhe Welt«. Besonders zart organisierte Schüler kamen aus dem Erröten gar nicht heraus; die Mädchen aber steckten die Köpfe zusammen, – und was sie insgeheim miteinander schwatzten, betraf gewiß nicht die Sprachgebräuche des Xenophon.
Während der Nachmittagsprüfung waren wir selbstverständlich weit weniger aufmerksam als des Vormittags. Die Lehrer wußten sehr wohl, daß sie diese rückgängige Bewegung unseres Interesses dem Einflusse des Ewig-Weiblichen zuschreiben mußten. Daher sie denn jetzt vorzugsweise solche Schüler examinierten, die ihnen als erotisch unempfänglich bekannt waren. Es ist wunderbar, wie fein der Instinkt der Lehrer hier das Richtige trifft. In jeder Klasse sind immer drei, vier, fünf exemplarische Jünglinge vorhanden, die ein so stark entwickeltes Pflichtgefühl oder ein so schwach entwickeltes Herz besitzen, daß ihnen die Regeln über den griechischen Optativ ungleich wichtiger sind als der Anblick eines schönen Mädchengesichts. Diese Unempfänglichen werden in so heiklen Fällen besonders aufs Korn genommen, wenn es gilt, rasch eine Querfrage zu beantworten u. dergl. m. Zu einem längeren, wissenschaftlichen Verhör[206] eignet sich unter Umständen auch der verliebte Schüler, – wofern er nämlich auf dem Gebiete, das der Lehrer gewählt hat, sehr sattelfest ist. Es wird ihm alsdann ein besonderes Vergnügen bereiten, in den Augen seiner Angebeteten zu brillieren. Den Horaz übersetzend, schleudert er wohlgezielte Pfeile nach ihrem Herzen. Er beschwört die Lydia, sie möge den Sybaris nicht vor Liebessehnsucht vergehen lassen, und meint dabei sich und Volckmanns blonde Therese. Er verdeutscht die Ode: Quem tu, Melpomene, semel, – und denkt dabei schüchtern an seine eigenen poetischen Versuche, mit denen er die Auserkorene durch Vermittlung seiner Schwester oder auf dem Wege einer anonymen Postsendung heimgesucht. Nickt dann der Superintendent mit beifällig schmunzelnder Miene, so ist der Gymnasiast stolz auf seinen errungenen Triumph, und zerstreut lächelnd folgt er der Aufforderung des Lehrers, sich wieder zu setzen.
Das Klassenexamen ist die einzige Gelegenheit, wo die Primanerliebe innerhalb der vier Wände des Gymnasiums etwas freier aufatmet. Die Klassenprüfung ist ihr Sonnenblick. Hier kann der Lehrer gegen ihre verstohlene Betätigung nichts einwenden. Noch entsinne ich mich des jauchzenden Entzückens, mit dem mir einer meiner Freunde, Paul Schuster, am Schluß des Examens um den Hals fiel, weil diese wenigen Nachmittagsstunden das wieder aufgebaut hatten, was ihm während des Semesters durch die Ungunst der Verhältnisse zerstört worden war.
Paul Schuster liebte eine reizende Blondine, namens Elisabeth. Er besang sie in hundert Liebesliedern. Seine Schwester hatte ihm zugeredet, und so kopierte er das schönste dieser Gedichte auf goldgerändertes Briefpapier, schrieb, von hundert seligen Ahnungen erfüllt, seinen Namen darunter, und barg es in einer zierlichen Enveloppe, auf deren Siegelstelle eine Taube mit dem biblischen Ölzweig prangte. Dann setzte er als Adresse die Worte darauf: »Meiner himmlischen Elisabeth«, und ließ der Holden das Billett durch seine Schwester mit in die Schule bringen. Am Abend erhielt er die Nachricht, das Gedicht habe einen ungeheuren Eindruck gemacht. Elisabeth sei von dem Zauber der wogenden Rhythmen geradezu hingerissen; nur meine sie, der Dichter habe doch hin und wieder gar zu schmeichelhaft übertrieben.
Drei Tage später glaubte Paul Schuster zu bemerken, daß der Direktor Samuel Heinzerling während der Interpretation der Antigone ihm verschiedene Male einen strafenden Blick zuschleuderte. Das Schicksal sollte ihn über die Ursache jenes eigentümlichen Mienenspiels nicht lange in Zweifel lassen. Nach Beendigung der Lehrstunde entbot ihn Samuel auf sein Zimmer. Verwirrt leistete er dieser Aufforderung Folge. Wer schildert seine Empfindungen, als er auf dem Tische des Gymnasialtyrannen sein Billet-doux an Elisabeth wahrnimmt.
»Schoster,« begann der Direktor, »Professor Gönther föhrt Klage, Sä belästägen seine Tochter.«
Paul Schuster glaubte bei diesen Worten Samuels in den Boden versinken zu müssen. Ein jäher Krampf schnürte ihm die Kehle zusammen.
»Herr Direktor,« stammelte er, »wenn Professor Günther dergleichen behauptet, so spricht er die Unwahrheit …«
»Wä, Schoster?« fragte Heinzerling mit schneidiger Stimme, »Sä wollen noch leugnen? Sätzen Sä säch dort einmal auf den Stohl!«
»Aber, Herr Direktor …«
»Sätzen Sä säch! Also Sä haben dä Dreistägkeit, den Herrn Professor Gönther der Onwahrheit zo bezächtägen! Goot! Sehr goot! Ond was sagen Sä zo däsem Zettel, den dä Frau Professor än der Scholtasche ähres Töchterchens gefonden hat? Wollen Sä etwa än Abrede stellen, daß Sä däsen Wäsch da geschräben haben?«
»Nein, Herr Direktor!«
»Non goot! Äch ontersage Ähnen härmät ein för allemal, däse onzämlächen Scherze zo wäderholen.«
Er nahm das Blatt zwischen die Finger und rückte die Brille zurecht.
»Es äst wärklich stark, Schoster!
Begreifen Sä nächt, daß es geradezo onverantwortlich äst, einem wohlerzogenen Kände solche Albernheiten än den Kopf zo[208] setzen? Äch dächte, Sä gäben säch vorläufäg noch ein wenig mät Ährem Sophokles ab.
Sehnsocht, Sehnsocht! Sehnen Sä säch nach einem ordentlächen Matorätätsexamen, ond vertrödeln Sä Ähre Zeit nächt mät solchen Abgeschmacktheiten. Wenn säch der Mensch erst einmal solche Alloträa än den Kopf gesetzt hat, dann geht sein wässenschaftlächer Sänn öber Nacht zo Grabe. Merken Sä säch das!«
Paul war außer sich.
»Herr Direktor,« stöhnte er verzweifelt, »ich glaube bis jetzt noch keine Veranlassung gegeben zu haben …«
»Das habe äch auch nächt behauptet. Aber dä bästen Schöler werden äm Handomdrehen leichtsännäg, wenn sä anfangen, säch mät solch kändäschem Tand abzogeben. Äch habe Sä non gewarnt.«
Der Direktor entließ ihn. Paul Schuster hielt nur mit Mühe die Tränen zurück. Er kam sich so erbärmlich, so namenlos lächerlich vor, daß er zu jedem Entschluß unfähig war. Zu Hause angelangt, überlegte er. Nach mehrstündigem Hin- und Hersinnen kam er zu dem Resultat, daß ihm nichts anderes übrig bleibe, als Elisabeths Vater persönlich aufzusuchen. Trotzig erhobenen Hauptes machte er sich auf den Weg. Er ward nicht vorgelassen. Was tun? Eine halbe Minute lang schwankte er, ob er sich nicht mit Gewalt den Weg in das friedliche Studierzimmer bahnen und im Tone eines beleidigten Theaterhelden Rechenschaft fordern sollte für die zwiefach kränkende Unbill. Bald aber gewann die vernünftige Erwägung die Oberhand. Der eben noch so heroische Primaner zog ab. Wie ein verschmähter Freier schlich er gesenkten Blickes nach Hause, warf sich mit geballten Fäusten langwegs auf das Sofa und heulte.
So war das poesiereiche Verhältnis zu Elisabeth meuchlings zertrümmert worden. Allerhand kleine Mißverständnisse hatten dazu beigetragen, den Sturz der Ideale zu vervollständigen.
Und nun kam die Klassenprüfung. Elisabeth erschien reizender als je. Sie nahm in der vordersten Reihe Platz. Zwei Stunden lang kreuzten sich die Blicke der beiden Liebenden, und dieser stumme[209] Depeschenwechsel reichte aus, beiden die Gewißheit zu geben, daß sie »einander noch angehörten«. Am Schluß des Examens erntete Schuster ein Lächeln, das ihm den letzten Zweifel benahm … Glücklicher Schuster!
Ich wiederhole es: Das Klassenexamen ist der Lichtblick der scheuen Primanerliebe!
Doch kehren wir aus dem Speziellen ins Allgemeine zurück, und erzählen wir den weiteren Normalverlauf der Semesterprüfung.
Am Abend des dritten Tages bestieg Samuel Heinzerling den Katheder und verkündete die Prämien und die Versetzungen. Ein feierlicher Moment! Der Direktor wußte denn auch der Bedeutsamkeit des Augenblicks in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Seine Stimme klang fast wie die Posaune des Jüngsten Gerichts, wenn er begann:
»Von Onterpräma nach Oberpräma röcken auf:«
Und nun folgte die Liste. Die nicht erwähnten Schüler waren zu ewiger Verdammnis – ich will sagen, zum Sitzenbleiben für ein weiteres Semester verurteilt.
Dann fuhr der Direktor fort:
»Prämien erhalten än däser Klasse:«
Und nun folgte das kurze Verzeichnis der wenigen Auserwählten. Dieses Verzeichnis schrumpfte, je höher man in der Reihe der Klassen hinaufstieg, immer mehr zusammen. In Prima gab es nur ganz ausnahmsweise Prämien:
»Dä Prämaner taugen alle nächt väl«, so pflegte Samuel privatim diese Maßnahme zu motivieren.
Zu Ostern fand am Schlusse der Prüfungen zuweilen ein sogenannter Aktus statt, bei dem das schöne Geschlecht noch zahlreicher vertreten war als beim Examen. Gedichte, deutsche und lateinische Reden, Gesänge und sonstige musikalische Vorträge waren der Gegenstand dieser nachmittäglichen Feier, an der sich nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer aktiv beteiligten. So entsinne ich mich eines trefflichen Vortrags, den Samuel Heinzerling über die Wirkung der echten Humanität hielt. Doktor Brömmel, der Zwillingsvater, sprach wiederholt über die Bevölkerungsverhältnisse der europäischen Staaten; er wies darauf hin, daß Deutschland das rivalisierende Frankreich immer mehr zu überflügeln verspreche,[210] eine Wahrheit, die von Emanuel Boxer mit der malitiösen Bemerkung begleitet wurde: »Daran ist niemand schuld, als Doktor Brömmel!« Der »Herr Pastor« ließ sich über das griechische Schisma vernehmen, ein Thema, von welchem Boxer behauptete, daß es die anwesenden Damen nur zur Hälfte verstehen würden. Doktor Perner endlich gab Bilder aus der neueren Literaturgeschichte. Leider waren meine Gymnasialhumoresken damals noch nicht geschrieben, sonst würde er sie ohne Zweifel mit Enthusiasmus erwähnt haben.
Gegen sechs Uhr trat man den Heimweg an. Jedermann befand sich in einer rosigen Stimmung. Nur die Sitzengebliebenen ließen elegisch die Köpfe hängen und gelobten sich, im neuen Semester Rache zu üben für die erlittene Kränkung.
»Das habe ich dem Doktor Perner zu danken«, sagte der eine.
»Mich hat der Brömmel ins Verderben geritten! Für das nächste Jahr wünsche ich ihm Drillinge!«



Gegen Schluß des Semesters tritt in der Stimmung des deutschen Gymnasiasten eine seltsame Wandlung ein. Bis dahin hat er die Knechtschaft des Stundenzwanges mit jener edlen Resignation hingenommen, die der Weise einem unabwendbaren Übel entgegenbringt. Jetzt mit einemmal ergreift ihn ein selbstbewußter, beinahe trotziger Frohsinn. Noch leistet er den Befehlen des Lehrers Folge, aber sein Gesichtsausdruck steht mit dieser äußeren Unterwürfigkeit in schroffem Gegensatze. Auf der lächelnden Lippe schwebt ein unausgesprochenes Wort, das, ins Verständliche übertragen, ungefähr also lautet: »Ich gehorche! Ich stehe unter deiner Botmäßigkeit! Aber der Tag der Befreiung naht auf Sturmesflügeln! Wenn er erscheint, dann wehe dem Grundgesetz deiner Herrschaft!« Strafen, die sonst eine niederschmetternde Wirkung ausgeübt hätten, werden jetzt gleichgültig, ja fast mit offenem Hohn ertragen: der Skorpion des Absolutismus hat seinen Stachel verloren.
Wer in der Völker- und Staatengeschichte einigermaßen bewandert ist, der wird sich erinnern, daß ähnliche Stimmungen von jeher den Verschwörer am Vorabend der Entscheidung beseelt haben. Genau so dachte und fühlte der Neger, der unter Toussaints Führung die Fesseln seiner langjährigen Sklaverei sprengen sollte. Hätten die Plantagenbesitzer von St. Domingo ein deutsches Gymnasium besucht, sie wären niemals von den schwarzen Bataillonen überrumpelt worden. Der deutsche Gymnasiallehrer weiß nur zu genau, was jener Stimmungswechsel bedeutet. Er weiß, daß es[212] die Perspektive auf die Ferien ist, die seiner Klasse so rebellisch die Adern schwellt.
Ferien! Das Wort hat für einen deutschen Gymnasiasten etwas Zauberisches! Schon viele Wochen im voraus wird bis auf den Tag und die Stunde berechnet, wie lange man noch auf den harten Subsellien zu schmachten hat. Die Phantasie eilt der Wirklichkeit in rauschendem Fluge voraus und bevölkert die Zukunft mit den beglückendsten Lichtstrahlen. Man entwirft Pläne; man gelobt sich, die anderthalb Monate diesmal so recht gründlich und nach allen Richtungen hin auszukosten. Man überläßt sich einer poesievollen Zerstreutheit, die sich von Woche zu Woche steigert und zuletzt in die vollendete Träumerei ausartet.
Mir und meinem vielgenannten Freund Wilhelm Rumpf war diese gesteigerte Spannung so unerträglich, daß wir den Freitag und den Sonnabend vor dem Beginn der Ferien jedesmal schwänzten. Zur gewohnten Stunde ergriffen wir unsere Schreibmappen und traten ins Freie. In dem kleinen Tempel der städtischen Promenade, der zu dieser Frist völlig verwaist stand, gaben wir uns ein Rendezvous und beratschlagten, was den Tag über zu beginnen sei. Wenn wir einen Entschluß gefaßt hatten, stellten wir unsere Uhren mit ängstlicher Genauigkeit nach der großen Turmuhr der Stadtkirche und verloren uns dann, halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen, seitwärts in die Felder. Ganz besonders entzückend waren diese illegitimen Ausflüge am Schluß des Sommersemesters. Eine prächtige Landschaft, die noch im reichsten Festgewand strahlte, ein tiefblaues Himmelsgewölbe, und auf allen Hügeln und Hängen ein überschwenglicher Segen des köstlichen Obstes, – was brauchten wir mehr, um glücklich zu sein? Die Freude über den wolkenlosen Septembertag paarte sich mit dem Triumphgefühl über die gelungene Entweichung. Jauchzend strichen wir durch die einsamen Nußgärten und füllten uns, dem siebenten Gebote zum Trotz, die Taschen. Gegen zehn nahmen wir in der nächsten ländlichen Schenke einen Imbiß, dessen Mangelhaftigkeit durch den Glanz unserer Gemütsverfassung ersetzt wurde. Eine Stunde später rüsteten wir uns zum Heimweg. Es galt, rechtzeitig in der Behausung einzutreffen, denn die Sache sollte den Anschein haben, als kämen wir direkt aus dem Gymnasium.
Auf diese Weise verbrachten wir den Freitag und den Sonnabend. Wie Leander die Hero, so besuchten wir die Göttin der Freiheit unter dem Deckmantel des Geheimnisses … Für kurze Zeit hat dieser verstohlene Umgang einen unendlichen Reiz: auf die Dauer aber sehnt man sich nach dem festen Besitz. So hatten wir denn beim Läuten der Sonntagsglocken gerade genug an dem heimlichen Raube, und wonnetrunken begrüßten wir unser rechtliches Eigentum, – die Ferien!
Wer vermöchte zu schildern, was ein deutscher Gymnasiast beim Beginn der Ferien empfindet! Sechs lange Wochen! Eine Ewigkeit! Freudig blitzenden Auges und stolz erhobenen Hauptes wandelt man umher, als ob man die ganze Welt besäße! Und zwar ist dieses Entzücken um so aufrichtiger und vollständiger, je weiter abwärts wir uns von der Prima entfernen, – vielleicht nur aus dem Grunde, weil die Empfindung von der Länge der Zeit mit der fortschreitenden Entwicklung des Menschen zusammenschrumpft. Dem Quartaner und Tertianer sind diese sechs Wochen in der Tat ein unbegrenzter Spielraum: das jugendliche Gemüt überläßt sich der Illusion, die Frist könne kein Ende nehmen. Der Primaner dagegen hat sich zu oft schon diese sechs Wochen »von rückwärts betrachtet«; die Erfahrung hat seinen Idealismus auf ein minder grandioses Maß reduziert; er weiß die Summe der Genüsse, die ihn erwarten, bereits annähernd abzuschätzen.
In einem Punkte verwerten die Schüler aller Klassen das Privilegium der Ferien gleichmäßig: im freien Genusse des Morgenschlummers. Das Recht, ohne Rücksicht auf eine bestimmte Stunde in den hellen Tag hineinschlafen zu können, gießt über das ganze Wesen des deutschen Gymnasiasten einen Schimmer der rosigsten Verklärung. Wenn er nachts erwacht und sich, behaglich aufatmend, nach der anderen Seite wendet, so ist das Bewußtsein, am folgenden Morgen den sonst so verhängnisvollen Schlag der Glocke überhören zu dürfen, allein ausreichend, um die Ferien mit dem Gewand eines zauberischen Liebreizes zu umkleiden!
So dämmert der Tag heran. Draußen, in den Zimmern und auf dem Korridor ist schon alles geschäftig: der glückliche Gymnasiast[214] rührt sich nicht. Selbst wenn er längst nicht mehr schlafen kann, hält er noch die Augen geschlossen, bis die Mutter oder die Schwester ihn, weniger aus Gründen der Moral, als mit Rücksicht auf die gestörte Hausordnung, weckt. Nun kleidet der Triumphator sich an, langsam, mit souveräner Verachtung der Zeit, – denn er hat ihrer ja mehr, als er braucht! Nach eingenommenem Frühstück verläßt er das Haus: das ist ein unumstößliches Axiom der Ferienpraxis. Je nach der Verschiedenheit seines Alters und seines Temperaments verbringt er den Vormittag verschieden. Er streift durch Feld und Wald, er schlendert Arm in Arm mit seinem Intimus durch die Gassen, er besucht verstohlenerweise ein Bierhaus und wagt selbst eine Partie Billard. Der Quartaner und Tertianer gibt sich mit seinen Altersgenossen in besonders günstig gelegenen Höfen der Nachbarschaft ein Rendezvous, um zu spielen; er plant tolle Streiche und verabredet Ausflüge in die weitere Umgebung. Vor Mittagszeit aber betritt keiner, weder der Schüler von Quarta, noch der Oberprimaner, die elterliche Wohnung.
Nach Tische treibt sich der Feriengymnasiast zum Leidwesen seiner Angehörigen in störender Weise auf den Kanapees und Sesseln herum; trällert ein Lied, worüber seine ältere Schwester nervös wird; neckt seine jüngeren Brüder; nimmt eine illustrierte Zeitschrift zur Hand, trotz der wiederholten Versicherung des Vaters, das sei keine Lektüre für ihn; fragt, ob nicht bald Kaffee getrunken werde; stemmt seine Stiefel wider die polierten Tischfüße, legt sich ins Fenster oder verklebt seiner Mutter das Schlüsselloch des Nähtischchens mit Wachs. Die Aufforderung, er möge etwas arbeiten, beantwortet er mit einem wohlwollenden Lächeln.
»Erst will ich mich ausruhen«, sagt er, behaglich die Arme reckend.
Wenn man das so mit ansieht, man sollte meinen, der Ärmste habe Monate lang Dienste in einer Tretmühle geleistet.
Der Nachmittag wird, je nach der Jahreszeit, zu Ausflügen in die umliegenden Bierdörfer, zu Fensterpromenaden, zu Skatpartien, zu Kahnfahrten und dergleichen benutzt, und der Abend bringt oft nur eine Fortsetzung des Nachmittags.
Dieses lustige, ungebundene Leben erfährt eine gelinde Trübung durch den Hinblick auf die Ferienarbeiten, die in einigen Gymnasien nicht ganz ohne Belang sind.
Ich meinesteils habe meine Pensa stets schon in der ersten Woche begonnen und so unter der Hand ohne ernstliche Schädigung meines Wohlgefühles erledigt. Die meisten Schüler warten jedoch bis zuletzt und verderben sich den Schluß der Ferien von Grund aus. Es leuchtet ein, daß die von mir befolgte Methode gerade vom Standpunkt des Epikuräers aus die einzig richtige ist, – auch richtiger als das andere Extrem, während der ersten Tage alles auf einmal zu absolvieren.
Unter den Ferienarbeiten, mit denen man uns die Flügel ein wenig zu binden hoffte, nahm der deutsche Aufsatz einen hervorragenden Rang ein. Und zwar gab man uns zu wiederholten Malen das Thema: »Wie verbrachte ich meine Ferien?« Diesen Aufsatz schrieb ich stets in der ersten Woche, denn die historische Wahrheit gehörte von je zu den geringsten Verdiensten solcher Arbeiten. Ganz faule und versumpfte Kameraden, die niemals aus eigenem Antrieb ein Buch in die Hand nahmen, gaben sich in dem Ferienaufsatz den Anschein, als hätten sie umfassende Privatstudien im Xenophon und im Curtius geleistet. Die Lehrer nahmen das merkwürdigerweise stets so beifällig hin, daß ich als Obersekundaner den Entschluß faßte, dieses lügnerische Selbstlob einmal auf die Spitze zu treiben. Da war denn in meinem Aufsatz etwa folgender Passus zu lesen:
»Ich erhob mich des Morgens zwischen vier und fünf, nahm in aller Eile den Kaffee ein und verfertigte alsdann bis gegen 10 Uhr lateinische Stilübungen. Hierauf machte ich einen halbstündigen Spaziergang, um sofort wieder an meine Arbeit zurückzukehren. Ich las Corneille, Racine, Molière und Chateaubriand, bis ich zu Tische gerufen wurde, was in der Regel so gegen ein Uhr statthatte. Die Stunden von zwei bis fünf widmete ich dem Griechischen, der Geschichte und der Geographie. Hierauf unternahm ich in Begleitung meines Vaters einen Spaziergang, von dem wir meistens so gegen halb sieben Uhr zurückkehrten. Um sieben Uhr wurde zu Nacht gespeist, und nun arbeitete ich von acht bis elf[216] Mathematik, Physik und Kirchengeschichte. Oft auch habe ich die Mitternacht an meinem stillen Pulte herangewacht, denn ich hatte mir nun einmal fest vorgenommen, eine gewisse Summe von Lernstoff zu bewältigen. Sagt doch schon ein alter Klassiker: ›Wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben.‹ Meine Mußestunden benutzte ich dann zur Lektüre von Goethe, Schiller, Klopstock, Wieland, Herder, Lessing, Platen, Rückert und Roderich Benedix; auch übersetzte ich viele Oden des Horaz metrisch ins Deutsche. Des Sonntags besuchte ich von neun bis elf die Kirche, hielt mich jedoch, um nicht aufzufallen, meist abseits, weshalb mich die Herren Lehrer ohne Zweifel nur selten wahrnahmen. Einmal war ich zwei Tage lang in Frankfurt, und diese in jeder Hinsicht belehrende Reise will ich hier zum Gegenstand einer ausführlichen Schilderung machen.«
Ich wurde um dieses Aufsatzes willen »wegen Unfugs« mit sechs Stunden Karzer bestraft und dazu beauftragt, dasselbe Thema noch einmal, und zwar in jeder Hinsicht wahrheitsgemäß, zu behandeln.
Drei Tage später also reichte ich dem Lehrer eine neue, von der ersten wesentlich differierende Arbeit ein, die folgenden Passus enthielt:
»Des Morgens schlief ich bis neun, mitunter sogar bis zehn Uhr. Denn, sagte ich bei mir selbst, wozu sollst du dich plagen, wenn du's gut haben kannst? Gearbeitet habe ich nur sehr wenig. Ich erledigte zwar zur Not meine Pensa: im übrigen aber verspürte ich einen seltsamen Abscheu gegen jede Tätigkeit. Man lebt nur einmal auf der Welt, pflegte mein Großonkel Schmidthenner zu sagen. So hielt ich es denn für zweckmäßig, mir die kurze Freiheit recht zunutze zu machen. Fast täglich bestand ich mit Wilhelm Rumpf einen Ringkampf, wobei immer derjenige siegte, der den Untergriff hatte. Solche Übungen sind in jeder Beziehung praktisch. Ich merkte dies bei dem Zwist mit dem Gänsehirten von Wieseck. Der Mann wollte uns ausschimpfen, weil Rumpfs kleiner Pudel ihm die Gänse gejagt hatte. Wir zerbläuten ihn jämmerlich. Hieraus erhellt, daß der Jüngling sich nicht früh genug in körperlichen Exerzitien ergehen kann. Wie sagt schon Horaz? usw. usw.«
In diesem Stile ging es zwölf Seiten lang. Am Schluß meiner tückischen Abhandlung hatte ich die zwölf Stunden Karzer, die ich diesmal eroberte, so vollständig verdient, daß ich mich noch jetzt über die Nachsicht des sonst so leicht erregbaren Lehrers wundere.
»Wie verbrachte ich meine Ferien?«
In der Tat ein trostloses Thema für einen deutschen Gymnasialschüler, der weder lügen, noch seine Lehrer beleidigen will!



Das Wort Examen hat für den Gymnasialschüler je nach Umständen eine sehr verschiedenartige Klangfarbe. Ernst und gewichtig tönt es an sein Ohr, wenn es die Abiturientenprüfung bezeichnet; leicht und harmlos dagegen, wenn es jene Komödie bedeutet, die sich alljährlich ein- oder zweimal vor dem Beginn der Ferien wiederholt, mit dem angeblichen Zweck, das Publikum über die intellektuellen und ethischen Fortschritte der künftigen Staatsbürger zu unterrichten.
Das Abiturienten- oder Maturitätsexamen ist, streng genommen, nur eine Form, da die Lehrer in den meisten Fällen vorher wissen, wer da bestehen und wer durchfallen wird. Es wäre auch sonderbar, wenn die paar Stunden oder Tage des Examens genauere Auskunft über den Bildungsgrad eines Schülers ermöglichen sollten, als die Monate und Jahre des regen persönlichen Verkehrs in der Klasse. Gleichwohl betritt der Abiturient mit einem seltsamen Zagen den Prüfungssaal, nicht ahnend, daß sein Schicksal schon vor der ersten Frage so gut wie entschieden ist. Der Schüler, der sich während seiner ganzen gymnasiastischen Laufbahn durch die lebhafte Betätigung eines wissenschaftlichen Sinnes ausgezeichnet und den Beweis geliefert hat, daß er wirkliche Kenntnisse besitzt, wird selbst dann nicht durchfallen, wenn er in einer Spezialität unglücklicherweise alle Fragen schuldig bleibt; viel eher ist der umgekehrte Fall denkbar, daß ein Ignorant, der sich nur oberflächlich »eingepaukt« hat, durch eine glückliche Konstellation entschlüpfe. Es liegt also nicht der geringste Grund zur Aufregung vor;[219] aber die Tradition und der Instinkt wirken hier mächtiger als die reine Vernunft.
In dem Gymnasium meiner Vaterstadt Gröningen hatten die Abiturienten erst ein dreitägiges schriftliches Examen und dann ein mündliches von etwa sechs Stunden zu leisten. Das schriftliche war entschieden die Hauptsache. Es bestand aus drei Extemporal-Aufsätzen, einem deutschen, einem französischen und einem lateinischen. Die strengste Klausur sonderte uns während dieser Arbeiten von der Außenwelt ab. Vor Schluß seines Aufsatzes durfte keiner den Saal und die dazu gehörigen Räumlichkeiten verlassen. Gegen Mittag lieferte uns der Pedell etwas kalte Küche; den Angehörigen der Schüler war es nicht gestattet, sich bei dieser Proviantlieferung zu beteiligen, da es früher mehrfach vorgekommen war, daß man in Buttersemmeln, Würsten u. dergl. die nötigen literarischen Hilfsmittel zur Bewältigung der Themata eingeschmuggelt hatte. Trotz dieser peinlichen Vorsicht gelang es fast regelmäßig, etwas Verwendbares über die Schwelle zu paschen. Bei dem Schließen oder Öffnen des Fensters warf man einen Zettel in den Hof, der das Thema bezeichnete. Treue Freunde, die unten lauerten, beschafften sofort, was sie an früheren Bearbeitungen desselben Vorwurfs etc. etc. auftreiben konnten, und legten es im rechten Moment auf eine gewisse verschwiegene Lokalität, deren Besuch man uns doch nicht völlig verbieten konnte. Zuweilen gelang es auch, schon Tags zuvor das Thema ausfindig zu machen, sei es, daß ein Familienmitglied des Examinators die Sache verriet, sei es, daß wir listigerweise das Notizbuch des Lehrers durchforschten und so die nötigen Anhaltspunkte eroberten.
Einmal hatte der Direktor Samuel Heinzerling in Erfahrung gebracht, der Abiturient Ittmann sei am Abend vor dem Beginn der Prüfung auf wunderbare Weise in den Besitz des Themas gelangt und werde des Tags darauf eine Reihe von Manuskripten und Drucksachen mitbringen, und zwar, um der Möglichkeit einer Visitation auszuweichen, in seinen Stiefelschäften. Gott weiß, wer hier den Judas gespielt hatte: genug, Samuel Heinzerling war bis ins einzelne unterrichtet und beschloß, dem p. p. Ittmann auf eine möglichst humorvolle Weise zu Leibe zu gehen.
Es war die ganze Zeit über abscheuliche Witterung gewesen. Auch am Tage des lateinischen Aufsatzes herrschte ein großer Schmutz in den Straßen. Hierauf gründete Samuel seinen Plan.
Als Ittmann im Saale erschien, trat der Direktor freundlich lächelnd auf ihn zu und reichte dem überraschten Schüler die Hand.
»Kommen Sä, läber Ättmann,« sagte er schmunzelnd, »äch weiß, Sä neigen sehr stark zor Erkältong …«
Hiermit führte er den Erstaunten nach dem Ofen, wo ein Stiefelzieher und zwei Pantoffel standen.
»So, läber Ättmann, äch habe Ähnen da ein paar Pantoffel besorgt, damit Sä säch ja nächt verderben. Zähen Sä Ähre Stäfel höbsch aus. Äch bän öberzeugt, Sä haben säch nasse Föße geholt.«
»Sie sind zu gütig, Herr Direktor,« stammelte Ittmann, »aber ich habe wirklich ganz trockene Füße. Ich danke recht sehr.«
»Es wärd doch besser sein, wenn Sä dä Schohe dort anzähn. Sä sänd mär än der letzten Zeit wäderholt onwohl gewesen …«
»Das ist ganz vorüber, Herr Direktor. Ich fühle mich jetzt vollständig frisch.«
»Eben, weil Sä säch fräsch föhlen, sollen Sä säch nächt wäder erkälten. Machen Sä jetzt keine Omstände; äch meine es goot mät Ähnen!«
»Ohne Zweifel, Herr Direktor. Ich verspüre aber nicht den geringsten Anflug von Nässe. Lassen Sie lieber den Schierlitz die Pantoffel da anziehen: der hat einen viel weiteren Weg als ich.«
»Nein, nein! Der Schärlätz äst eine roboste Nator! Sä allein haben mär den verflossenen Wänter fortwährend öber Katarrh geklagt. Jetzt machen Sä mäch nächt ongedoldäg, ond entledägen Sä säch so rasch wä möglich Ährer Stäfel! Äch befähle es Ähnen!«
Ittmann war der Verzweiflung nahe. Seine angeborene Geistesgegenwart half ihm jedoch auch diesmal über die Klippe hinweg.
»Nun denn, Herr Direktor,« sagte er mit einer artigen Verbeugung, »so nehme ich dankbar an.«
Mit diesen Worten ergriff er die Pantoffel und den Stiefelzieher und eilte der Tür zu.
»Wo wollen Sä hän?« rief Samuel Heinzerling.
»Herr Direktor, Sie werden mir zutrauen, daß ich so viel Lebensart besitze, um meine Stiefel nicht in Ihrer Gegenwart auszuziehen. Ich verfüge mich da neben ins Konferenzzimmer.«
Samuel Heinzerling trat auf ihn zu, klopfte ihm auf die Schulter und flüsterte mit einem halbunterdrückten Lächeln:
»Wässen Sä was? Gehn Sä läber nach Hause ond wechseln Sä zo Haus Ähre Stäfel! Sä haben säch öbrägens goot herausgehauen, wärkläch, sehr goot! Das moß Ähnen der Neid lassen.«
»Aber, Herr Direktor, ich versichere Sie …«
»Machen Sä, daß Sä fortkommen ond versächern Sä mäch läber nächts. Äch denke, Sä wässen am besten, wo der Schoh Sä dröckt. Aber äch sage Ähnen, auf dem Fooß stehen wär nächt mäteinander, wenn das Examen anfängt! Sä sänd mär ein onreeller Kamerad! Verstehn Sä mäch?«
»Herr Direktor,« versetzte Ittmann mit einem Blick auf seine Stiefel, »ich habe heute morgen schon so viel eingesteckt, daß ich auch diesen Vorwurf einstecken und Sie um dauernde Nachsicht ersuchen will.«
Samuel Heinzerling lachte.
Ittmann aber eilte nach Hause und erschien diesmal ohne die Eselsbrücken. Sei es nun, daß das Erlebnis mit Samuel Heinzerling seinem Geiste eine besondere Elastizität verlieh, sei es, daß der Direktor ein hervorragendes Wohlwollen entwickelte, kurz, der Schüler erhielt die Note eins.
Der lateinische Aufsatz, den ich zur Bekundung meiner Reife verabfolgen mußte, betraf den Kaiser Tiberius.
Ich habe nun bereits in meiner Skizzensammlung »Aus Sekunda und Prima« hervorgehoben, daß die Weltgeschichte von je meine schwache Seite gewesen. Von Tiberius insbesondere wußte ich nur sehr wenig Positives, – etwa, daß er des Kaiser Augustus Nachfolger gewesen; daß er sich durch Grausamkeit und Willkür ausgezeichnet; daß er einen Günstling, namens Sejanus, besessen und schließlich von Macro mit einem Kissen erstickt worden sei. Nun[222] verstand ich es zwar, solche geringfügige Anhaltspunkte möglichst ausgiebig zu verwerten: aber das Gold meines Wissens wollte diesmal, noch so breit geschlagen, nicht ausreichen, um den gewaltigen Raum eines Abiturientenaufsatzes zu bedecken.
Hier half ich mir nun auf folgende sinnreiche Weise, die ich jedem Primaner unter gleichen Verhältnissen auf das wärmste empfehlen möchte. Ich hatte zufällig wenige Tage zuvor eine interessante Monographie über den Kaiser Augustus gelesen, deren Einzelheiten mir noch ziemlich treu im Gedächtnis hafteten. So begann ich denn meinen Aufsatz wie folgt:
»Nach dem Tode des Cäsar Octavianus Augustus bestieg der tückische, menschenfeindliche Tiberius den Kaiserthron. Es gelang ihm schon nach kurzer Frist, sich in allen Teilen des Reichs gründlich verhaßt zu machen, denn er bildete durchweg den schroffsten Gegensatz zu dem wohlwollenden, gerechten, kunst- und literaturfreundlichen Augustus. Dieser Kontrast mußte die Antipathie der Römer noch beschleunigen und vertiefen. Augustus hatte das und das getan, diese und jene Einrichtung getroffen, so und so die Verhältnisse des römischen Volkes geregelt; von alledem finden wir bei Tiberius keine Spur. Augustus und seine Freunde Messala, Pollio und Mäcenas waren Kenner der griechischen Dichter, deren Werke man in öffentlichen Bibliotheken sammelte; in der Umgebung des Tiberius dagegen finden wir weder einen Mäcenas noch einen Messala noch einen Pollio. Augustus war auch äußerlich eine sehr angenehme Erscheinung. Ein heiterer Friede ruhte auf seinem Antlitz. Er machte den Eindruck eines biederen, würdevollen und geistig bedeutenden Alten. Ganz anders Tiberius, von welchem uns dergleichen nirgends berichtet wird.«
Auf diese Weise gab ich eine sehr detaillierte Geschichte des Augustus und fügte nur von Zeit zu Zeit die Bemerkung hinzu, das sei bei Tiberius anders gewesen.
Nachdem ich so mein Wissen erschöpft hatte, schloß ich wie folgt:
»Leider ist die Zeit bereits zu sehr vorgerückt, als daß es mir noch möglich wäre, auf die übrigens allbekannten Einzelheiten der so verhängnisvollen Regierung des Tiberius näher einzugehen. Erwähnen will ich noch, daß er, wie fast alle Tyrannen, auf[223] unnatürliche Weise endete. Ja, es gibt eine Nemesis der Weltgeschichte, deren furchtbares Walten nur der Tor leugnen wird! Est modus in rebus, sunt certi denique fines!«
Und dann sprach ich noch den üblichen Wunsch aus:
»Spero fore, ut, quae hodie conscripsi, rectori gymnasii doctissimo, illustrissimo, justissimo mire placeant.«
Meine Hoffnung ging in Erfüllung. Die umfassenden Kenntnisse, die ich im Punkte des Augustus entwickelt hatte, reichten aus, um meine tiberianische Unwissenheit zu bemänteln.
Minder glücklich war ein Abiturient namens Glaser, der einen deutschen Aufsatz über die Völkerwanderung zu schreiben hatte und, wie Sokrates, nur eins wußte: daß er nichts wußte.
Er begann sein Thema wie folgt:
»Indem ich an die heutige Aufgabe heran trete, erinnere ich mich der alten Vorschrift, daß der wahre Philosoph niemals über einen Gegenstand reden darf, ohne ihn des näheren definiert zu haben.
Was heißt Völkerwanderung? Augenscheinlich bedeutet dieser Ausdruck eine Wanderung von Völkern. Fragen wir nun zunächst: Was ist ein Volk? so liegt es klar zutage, daß sich dieser Begriff nicht so in aller Kürze fixieren läßt. Wir müssen daher etwas weiter ausholen. Schon in den ältesten Zeiten …«
Und nun folgte eine graziös stilisierte Musterkarte historischer Data, wie sie in dem Kopfe des pfiffigen Schülers nach und nach hängen geblieben war. Die Ägypter, die Assyrer und Meder spielten hier eine bedeutsame Rolle. Ein längerer Abschnitt war dem auserwählten Volk Gottes gewidmet, dem Volk par excellence. Dann sprach Theophil Glaser von den Volksrechten, von den verschiedenen Staatsformen usw. usw.
Die Hälfte des Aufsatzes war hiermit zurückgelegt. Der Schüler fuhr fort:
»Wir kommen nun zu dem zweiten Teile unserer Definition: Was ist eine Wanderung?« Ein Problem, das er in ähnlicher Weise löste, wie das des Volkes.
Als er endlich den Begriff der Völkerwanderung glücklich zusammengesetzt hatte, war die gegebene Frist abgelaufen, und hastig warf er die heuchlerische Phrase auf das Papier:
»Zu meinem größten Bedauern muß ich hier schließen, denn ich höre das heisere Metall des Pedellen.«
Theophil Glaser bestand zwar im deutschen Aufsatze »cum laude«, in der Geschichte aber fiel er trotz seiner glänzenden Definitionen unwiderruflich durch.
Die Lehrer wollten nicht glauben, daß nur Quaddler daran schuld war, wenn Glasers Abhandlung des versöhnenden Schlusses entbehrte.

Druck: J. Neumann, Neudamm.

Für jede Familienbibliothek,
besonders aber für die Hausfrau auf dem Lande.
Sofiensruh.
Wie ich mir das Landleben dachte,
und wie ich es fand.
Von S. Jansen.
Zweite, kürzlich neu erschienene Auflage.
Preis fein geheftet 4 Mk., hochelegant gebunden 5 Mk.
Ein prächtiges, rein aus dem Leben geschöpftes Werk von eigenartiger, frischer, humorvoller Darstellung, dessen erste Auflage in noch nicht sieben Monaten vergriffen gewesen ist. Die Verfasserin, Stadtfrau und in der größten norddeutschen Handelsstadt angesessen, kauft sich in der Nähe ihrer Heimat ein kleines Landgut, welches sie selbst mit größtem Verständnis bewirtschaftet. Ihre wenigen Freuden und die große Zahl der Sorgen schildert uns die Dichterin nun in einer Form, wie sie lebenswahrer und doch zum Gemüte sprechender nicht gedacht werden kann. Wir haben hier eine seltene Perle moderner Erzählerkunst vor uns und ein Buch, das ein vorzügliches Festgeschenk, namentlich für unsere Hausfrauen, genannt zu werden vollauf verdient.
Die Kritik hat sich über »Sofiensruh« durchweg ungemein anerkennend geäußert. Wir geben folgende Kritikauszüge wieder:
Der Tag in Berlin. »Ein sehr amüsantes Buch – und ein sehr nachdenkliches Buch, nachdenklich im Sinne Fontanes, als etwas, über das man viel nachdenkt. Ich habe viel dabei gelacht und doch viel dabei gelernt. Mark Twainisch fängt es an, mit grotesken Zirkusplätzen, und geht dann doch in den schönen niederdeutschen, etwas schwermütigen Humor über, den wir an Klaus Groth und Fritz Reuter so sehr lieben. Und das schönste daran ist, daß alles, was in dem Buche steht, so gar nicht erfunden und bloß ausgedacht ist, sondern in jeder Zeile den unverkennbaren Stempel der erlebtesten Wahrheit trägt. … Städter und Agrarier sollten diese meistens grotesk lustigen und doch so bitterernsten Schilderungen und Erlebnisse genau studieren, die ersteren, um zu begreifen, unter welchen unerhörten Schwierigkeiten der Landwirt heute der Natur und seinem Helferpersonal sein Leben abzuringen hat, die letzteren, um endlich darüber klar zu werden, daß ohne eine gründliche, an die Wurzel gehende Umgestaltung des ländlichen Arbeitsverhältnisses über lang oder kurz jede größere Wirtschaft zugrunde gehen muß. … In Zolas furchtbarem »La Terre« sind die Tatsachen eigentlich nicht viel krasser; sie sind eben nur durch ein bittereres Temperament gesehen. … Wie gesagt: ein nachdenkliches Buch! Ein sehr nachdenkliches Buch! Und wird keiner kommen dürfen und sagen, ein »Hetzer« habe es geschrieben.
Dr. Franz Oppenheimer.«
Das Daheim in Leipzig. »… Es ist ein heiteres und erfreuendes und zugleich ein trauriges und betrübendes Buch. Es ist heiter und erfreuend, weil wir in ihm eine prächtige deutsche Frau kennen lernen, voll Mutterwitz, gesundem Verstande, Tatkraft und zähem Wollen, die überdies noch über eine sehr ungewöhnliche Gabe der Schilderung und der Charakterisierung verfügt. … Unser Buch ist gerade in seinen Einzelschilderungen auch kulturgeschichtlich von großem Wert, es zeigt uns aber vor allem, unter wie unsagbar schwierigen Verhältnissen heute vielfach die Landwirtschaft in Deutschland betrieben wird.
Th. H. Pantenius.«
Gartenlaube in Leipzig. »… Der Titel »Tagebuch« ist im allgemeinen nicht gerade vertrauenserweckend; es verbirgt sich gemeinhin zu viel Eitelkeit und Selbstbespiegelung, zu viel Absicht und Verlogenheit dahinter. Hier aber ist Wahrheit von Anfang bis zu Ende, ist Erdgeruch und Eigenart, ein Stück Leben, das sich in aller Schlichtheit des Empfindens, ohne jede Pose, offenbart … Und welch goldiger Humor verklärt nicht all die großen und kleinen Fehlschläge, welche Herzensgüte und Vornehmheit der Gesinnung offenbart sich nicht darin, wie diese Frau sich zu den Menschen, zum Leben stellt! Wahrlich, »ein Frauenbuch«, auf das die Geschlechtsgenossinnen der Autorin nicht stolz genug sein können, dessen Lektüre mehr als ein Zeitvertreib, ein gute Unterhaltung ist! … Möge das schöne Buch vielen zu einem Freund und Wegweiser werden.«
Für jede Familien- und Hausbibliothek empfohlen:
Entwickelungsgeschichte der Natur. Von Wilhelm Bölsche. Zwei Bände, 1646 Seiten, 785 Abbildungen, 16 Tafeln in Schwarz- und Farbendruck. Preis in Leinen fein gebunden 18 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 22 Mk.
Die Physik. Von H. Maser, Professor Dr. P. Richert und Dipl. Ing. A. Kühns. Zwei Bände, 1745 Seiten, 1183 Abbildungen, 10 Tafeln in Farbendruck. Preis in Leinen fein gebunden 18 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 22 Mk.
Die Chemie. Von Dr. Max Vogtherr. Ein Band, 847 Seiten, 421 Abbildungen, 5 Tafeln in Farbendruck. Preis in Leinen fein gebunden 9 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 11 Mk.
Das Mineralreich. Von Professor Dr. Georg Zürich. Ein Band, 754 Seiten, 521 Abbildungen, 8 Tafeln und Beilagen in Schwarz-Farbendruck. Preis in Leinen fein gebunden 9 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 11 Mk.
Das Pflanzenreich. Von Professor Dr. K. Schumann und Professor Dr. E. Gilg. Ein Band, 858 Seiten, 480 Abbildungen, 6 Tafeln in Farbendruck. Preis in Leinen fein gebunden 9 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 11 Mk.
Das Tierreich. Von Professor Dr. L. Heck, Professor Paul Matschie, Bruno Dürigen, Dr. Ludwig Staby, E. Krieghoff, Professor Dr. v. Martens. Zwei Bände, 2222 Seiten, 1455 Abbildungen, 12 Tafeln in Schwarz- und Farbendruck. Preis in Leinen fein gebunden 18 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 22 Mk.
Länder- und Völkerkunde. Von Dr. F. W. Paul Lehmann. Zwei Bände, 1646 Seiten, 1024 Abbildungen, 11 Tafeln in Farbendruck. Preis in Leinen fein gebunden 18 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 22 Mk.
Weltgeschichte. Von M. Reymond. Zwei Bände, 1672 Seiten, 841 Abbildungen, 16 Bildertafeln und 10 bunte, historische Karten. Preis in Leinen fein gebunden 18 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 22 Mk.
Kunstgeschichte. Von Professor Dr. Max Schmid. Nebst einem kurzen Abriß der Geschichte der Musik und Oper, herausgegeben von Dr. Clarence Sherwood. Ein Band, 842 Seiten, 411 Abbildungen, 10 Tafeln in Schwarz- und Farbendruck. Preis in Leinen fein gebunden 9 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 11 Mk.
Geschichte der Weltlitteratur und des Theaters aller Zeiten und Völker. Von Julius Hart. Zwei Bände, 1886 Seiten, 825 Abbildungen, 16 Tafeln in Schwarz- und Farbendruck. Preis in Leinen fein gebunden 18 Mk. In Halbleder hochfein gebunden 22 Mk.
Gesamtregister bearbeitet von der Verlagsbuchhandlung. Ein Band von etwa 300 Seiten. Das Gesamtregister wird jedem Abnehmer des Gesamtwerkes, also dem Käufer aller sechzehn Textbände, kostenlos geliefert; sonst wird es abgegeben: in feinen Leinenband gebunden, zum Preise von 6 Mk., in hochfeinen Halblederband gebunden zum Preise von 8 Mk.
Alle Werke zeichnen sich neben anerkannt vorzüglichem Text durch ungemein billigen Preis, reichen, prächtigen Bilderschmuck und geschmackvolle Einbände aus. Es sind Bücher, welche zu den ersten Schätzen unserer Literatur gehören; auf jedem Weihnachtstische werden sie überall Freude und Bewunderung hervorrufen.
Reich illustrierte Probehefte aller Werke werden umsonst
und postfrei geliefert.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

Für Kriegsveteranen, Volksbibliotheken und zu
Prämienzwecken.
Aus großer Zeit.
Bilder
aus dem Kriegsleben eines pommerschen Jägers.
Von
Paul Lehmann-Schiller.
Mit erläuternden Abbildungen.
Preis hochelegant gebunden 5 Mk.
Die Literatur über Kriegserinnerungen ist nicht gering, aber auch der Interessentenkreis für solche Werke ist ein großer. Unter den vielen Büchern dieses Genres nimmt obengenanntes, das erst im Jahre 1903 erschienen ist, nicht den letzten Platz ein. Die Kritik nennt es mit Recht ein prächtiges, rein aus dem Leben geschöpftes Buch für jung und alt! Sein Verfasser ist heute Direktor des Schiller-Gymnasiums zu Stettin. Nach Ausbruch des Krieges 1870 machte er sofort das Abiturientenexamen und trat als Einjährig-Freiwilliger bei den Greifswalder, pommerschen, zweiten Jägern ein. Nach der Schlacht von Sedan zur Belagerung von Metz ins Feld geschickt, machte Lehmann diese, die Belagerung von Paris (Champigny) und die Jagd auf Bourbaki durch das südöstliche Frankreich mit. – Wir lesen das humorvolle Tagebuch eines jungen Idealisten, dreißig Jahre später durchgearbeitet und in seinem Stoff gesichtet von dem gereiften Manne, mithin ein Werk, dessen Lektüre mehr bietet, wie die meiste stoffverwandte Literatur, und sich dem alten Feldzugssoldaten, wie dem Freunde deutscher Geschichte zum Genuß gestaltet. Auch kulturgeschichtlich, sowohl für deutsche, wie namentlich für französische Verhältnisse, bietet das Buch viel. Besonders aber werden die meist hochdeutsch, aber vielfach auch in echt vorpommerschem Platt gegebenen Schilderungen durch ihren frischen und humordurchwehten Ton seinem Besitzer genußreiche Lesestunden bereiten.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

Schönstes Buch für die wirklich reifere Jugend,
besonders für zukünftige Forstleute, Jäger und Landwirte.
Das Jägerhaus
am Rhein.
Jugenderinnerungen eines alten Weidmannes.
Dem jägerischen Nachwuchse erzählt von
Oberländer.
Mit 104 Originalabbildungen von Jagdmaler C. Schulze.
Preis hochelegant gebunden 8 Mk.
Das Jägerhaus am Rhein will den Sinn für echt weidmännisches Fühlen und Denken, sowie für die Liebe zur Natur schon in der Brust des Knaben wecken, aus dem später einmal ein tüchtiger und weidgerechter Jäger werden soll. Die Lehren geschehen an der Hand einer prächtigen und überall in edelstem Sinne unterweisenden Schilderung von Oberländers eigenen Jägerlehrjahren und dabei nicht etwa im trockenen Schulmeisterton, sondern in einer so glücklichen und anziehenden Form, daß das Buch nicht allein eine hervorragende Bildungsschrift für die reifere Jugend genannt werden kann, sondern auch dem erfahrenen Weidmanne, der sich bei Oberländers Schilderungen vielfach in seine eigene Jugend zurückversetzt sieht, das größte Interesse abgewinnen muß. Jedem Jüngling, dem das erste Gewehr soeben anvertraut wurde, oder der es demnächst führen soll, müßte mit diesem Das Jägerhaus am Rhein in die Hand gegeben werden; die Lehren Oberländers werden so unendlich viel Gutes schaffen. Das reich und wunderhübsch illustrierte Buch ist mithin besonders als Festgeschenk für die wirklich reifere Jugend geeignet und namentlich für den in der Jagd-, Forst- oder auch in der Landwirtschaftslehre stehenden zukünftigen Jäger.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

Schönstes Geschenkwerk für die Jugend, besonders für Jäger-, Forstmanns- und Landkinder im Alter von acht bis vierzehn Jahren.
Aus der
Waldheimat.
Deutsche Wald- und Jägermärchen
für jung und alt.
Erzählt von
Ernst Ritter von Dombrowski
und reich illustriert von Hans Rudolf Schulze-Berlin.
Preis hochelegant gebunden 4 Mk.
Niemals wird sie ausgesungen, die Poesie des deutschen Waldes; unerschöpflich in ihrer Schönheit quillt sie als ein Born der Dichtung, der Sage und des Märchens aus der Phantasie unserer deutschen Dichter. Zu ihnen gesellt sich als neuester der altbekannte Jagdschriftsteller Ernst von Dombrowski und bietet uns, gleich einem taufrischen Strauß Laub- und Nadelzweige aus deutschem Walde, zwölf herrliche, sinnige und so tief empfundene Märchen für unsere Weidmannskinder, wie sie nur ein Dichter zu schreiben versteht, der in Wald und Weidwerk zum gereiften Manne wurde. Deshalb eignet sich »Aus der Waldheimat« auch wie kein anderes Märchenbuch für das deutsche Jägerkind, und überall, wo einem solchen ein Geschenk gemacht werden soll, wird das hier angekündigte Buch die trefflichsten Dienste tun. Wie bei keiner anderen Lektüre werden unsere Kinder durch diese Dichtung in die Schönheiten und den ewig jugendlichen Reiz unserer Wälder sowie in die Poesie des deutschen Weidwerkes eingeführt und ihre Sinne erfüllen sich unbewußt mit jener Gedankenwelt, die noch den Schatz und das Heiligtum des gereiften Mannes, ja, des Greises im grünen deutschen Walde bilden.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Der Schmutztitel wurde entfernt.
Offensichtlich fehlerhafte Zeichensetzung wurde stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen:
S. 36: daß → das
Er sagt, das sei Einbildung
S. 65 mirami → mirari
Credo ego vos judices mirari
S. 65: summas → summus
Wenn wir z. B. sagen, summus mons
S. 99: Konjuktivs → Konjunktivs
Wesen des lateinischen Konjunktivs gemartert
S. 100: Deliquenten → Delinquenten
wie dem Delinquenten, der unter dem Fallbeil liegt
S. 101: jeder diese → jede dieser
daß man jede dieser verschiedenen Auffassungen
S. 140: bebesonderes → besonderes
jeden einzelnen in ein besonderes Lokal
S. 140: Sympton → Symptom
erste Symptom dieser neu sich regenden Elastizität
S. 155: Leben → Lebens
auf die Kleinheit und Gemeinheit des Lebens
S. 159: areco → arceo
Odi profanum vulgus et arceo
S. 163: gefügelten → geflügelten
die geflügelten Worte des Gymnasialherrschers
S. 205: Ihnen → ihnen
daß ihnen die Regeln über den griechischen Optativ
S. 212: anderhalb → anderthalb
die anderthalb Monate diesmal so recht gründlich
End of Project Gutenberg's Gesammelte Schulhumoresken, by Ernst Eckstein
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GESAMMELTE SCHULHUMORESKEN ***
***** This file should be named 52083-h.htm or 52083-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/2/0/8/52083/
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.