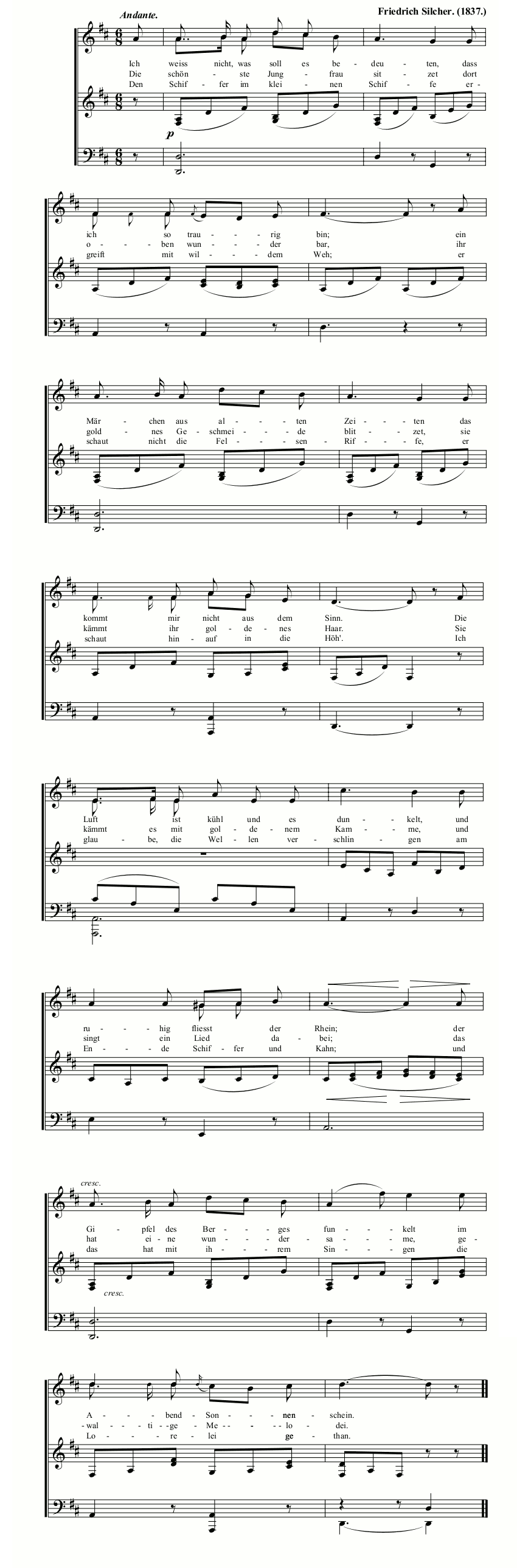The Project Gutenberg EBook of Studien und Plaudereien im Vaterland, by
Sigmon M. Stern and Menco Stern
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Studien und Plaudereien im Vaterland
SECOND SERIES
Author: Sigmon M. Stern
Menco Stern
Release Date: April 8, 2011 [EBook #35797]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK STUDIEN UND PLAUDEREIN ***
Produced by La Monte H.P. Yarroll, Thorsten Kontowski and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Studien und Plaudereien
Im Vaterland
second series
by
Sigmon M. Stern,
Author "Studien und Plaudereien," First Series, and
Director of Stern's School of Languages, New York.
AND
MENCO STERN.
THIRD EDITION.

NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY
F.W. CHRISTERN
Boston: Carl Schœnhof
copyright, 1881,
BY
SIGMON M. STERN.
TO
OUR FRIENDS AND PUPILS
WHO HAVE INSPIRED AND ENCOURAGED US IN OUR WORK
THIS BOOK IS DEDICATED.
PREFACE.
How times have changed!
Formerly it was thought that a nation existed only for the sake
of its ruler; to-day the belief is that the man at the head of a
people is only a first servant.
The schoolmaster of olden time was the ruler of the school;
to-day every good teacher considers himself in the service of the
students intrusted to his care, and concedes that each of them
possesses individuality and has rights that he must respect; he
deems it his duty to consider above all things the true interest of
those under his charge, and consequently will carefully prepare
their way, so as to make it as easy and pleasant as possible, and
assist them in attaining their ends with the least loss of strength
and time.
It is because of such ideas as those just mentioned that our
best teachers have been moved to consider the methods and textbooks
in common use, and the mode of improving upon them. The result is
that great improvements have been made in all branches of
study.
In order to study a language years ago, the student went
directly to the works of the best writers, but found that learning
in this way was impracticable: those great authors had written for
such as knew their language and understood it well—not for
those who were to study it for the first time; hence, teachers came
to write textbooks containing rules of grammar in connection with
sentences to illustrate such rules, and afterward used and applied
extracts from the writings of standard authors.
This was a step forward and a better way, because of its greater
system; but, though the method proved useful, it was not found
easier or more agreeable than the old one.
Famous men have studied and learned languages in both of these
ways; but they were men who, on account of their great abilities,
would have acquired the knowledge in any other way: many less
gifted have also learned languages in these ways; but with what
sacrifice of time and strength; what labors they had to endure, and
how many of them have had to give up the study!
Must these hardships necessarily be connected with the study of
languages? Is there no way to reach the same or even better
results, with less difficulty;—are there no means to open
education to a still greater circle, indeed to open it to all, to
make a common road smooth, easy and agreeable?
The cordial reception given by educators of the best class to my
"Studien und Plaudereien," (first series), has led me, in
connection with my brother Mr. Menco Stern, to write a second
series "Studien und Plaudereien" (im Vaterland).
I earnestly hope this second series may prove as practically
useful as the first.
In response to the many inquiries I have received concerning the
method of conducting my classes, I will say that
1) I prepare every lesson with the utmost care, taking "Studien
und Plaudereien" as basis and guide, at the same time endeavoring
to make them as interesting as possible.
2) I have arranged all the important rules of the German grammar
so as to teach them from the very first in a certain number of
lessons, orally, and give the students a printed German grammar
afterward, to review and to perfect their grammatical knowledge; they are thus
made to understand, value and even enjoy the study of grammar.
3) In teaching, I make my students understand, speak, read and
write, but do not exercise any one faculty or function at the
expense of any other.
4) My teaching is always full of life and animation; we do not
confine ourselves to books; all there is in this world worth being
thought of or spoken about, all that is great, good and beautiful,
we draw into the circle of our studies.
5) We speak only German in our German classes.
I wish to repeat here what I have said on many other occasions,
that the progress made of late years in teaching of languages is
due to a great extent to the powerful impulse given by Prof.
Gottlieb Heness, through his valuable observations upon linguistic
study, and more especially through his ingenious and admirable rule
of teaching a language in its own words, that is: German in German
and French in French, and further by showing us clearly how to
apply the rules of teaching languages as given principally by
Pestalozzi and Diesterweg.
Now a few words about "Studien und Plaudereien" (im Vaterland),
second series.
This book will serve a double purpose:—it will be used by
the teacher as a basis and guide for instruction, as well as a
reader for his students of the second grade, "Studien und
Plaudereien," first series, having been used for the first
grade.
The present new orthography has been adopted according to
"Regeln und Wörterverzeichnis für deutsche
Rechtschreibung zum Gebrauche in den preussischen Schulen.
Herausgegeben im Auftrage des Königlichen Ministeriums der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten."
A list of those substantives which have not been divided in the
text, will be found on pages 379 and 380.
The few rules of grammar in the third section I have given in
the present form, because they have served me best so arranged.
Every teacher may, however, vary them according to his own pleasure
and will be right in doing so.
The few rules of elocution in the eighth section which I have
selected to be printed, may and should be enlarged orally by the
teacher.
The notes will not be found necessary for pupils having
teachers, who surely will give them full and exact explanations and
derivations of words they do not understand. The plan of this book
permits me to give only in the shortest possible way the meaning of
some of the new words used in this particular connection. Those
students, however, who desire to have the full value of the new
words, I refer to Sander's Wörterbuch.—To those who use
this book as a means of instruction without a teacher, I recommend
also, as I do to my own pupils, any good German grammar they can
obtain.
SIGMON M. STERN.
Stern's School of Languages,
New York, August 31st, 1881.
Inhalt.
Sektion I.
Seite 1
Wiedersehen. — Neuigkeiten. — Louis spricht
über Dr. Albert.
— Frau Dr.
Stellen's Brief. — Vom Rhein. — Ihre
Familie. — Anna's Brief. — Der deutsche Verein. —
Ein Ritt. — Der Frühling. — Reineke Fuchs: Der
Löwe hält Hof. Des Wolfes Klage. Des Panthers Klage. Der
Dachs, ein Advokat. Eine Verteidigung. Hennings Unglück. Des
Königs Mitleid. Sein Beschluß. Braun geht zu Reineke.
Sein Empfang. Reineke und Braun. Des Bären Unglück.
Rückkehr. Hinze geht zu Reineke. Wie es Hinzen erging.
Grimbart als Bote. Reineke und Grimbart reisen zusammen. Reineke's
Furcht und Reue. Reineke kommt zum König. Wie sich Reineke
verteidigt. Reineke wird zum Tode verurteilt. Reineke unter dem
Galgen. Reineken's List. Er wird gerettet. Bei Weib und Kindern.
— Ein Kompliment für Louis.
Sektion II.
Seite 32
Neue Bekanntschaften. — Das alte und das neue
Deutschland. — Barbarossa. — Der Mann von Blut und
Eisen. — Deutschlands Größe. — Die alten
deutschen Kaiser. — Friedrich, Burg-Graf von Nürnberg,
und die faule Grete. — Kaiser Wilhelm. — Deutschlands
Größen erscheinen in Paaren. — Das Land der
Zukunft. — Die alte und die neue Welt. —
Kultur-Völker. —
Das Vater-Land. — Fiesko, Washington und
Napoleon. — Schiller, ein Prophet. — Bismarck, als er
jung war. — Noch mehr von Bismarck. — Noch etwas von
Bismarck.
Sektion III.
Seite 62
Martha Parks eine Schülerin. — Die sieben Raben.
— Die »Natürliche Methode«. —
Grammatikalische Winke: Gut und wohl. Ich wünsche, ich will,
ich möchte. — Louis' grammatische Fehler. —
Konjunktion »daß«. — »Ich bin«
und »ich habe«. — Das Verb. — »Ich
bin« und »ich werde«. — Der Artikel.
— Femininum,
neutrum, masculinum. — Die Gesellschaft trennt sich.
— Dr.
Alberts Bibliothek. — Seine besten Bücher. —
Das Reisen und das Lesen. — Wem wir danken sollen. — Ein
Plan zu einer Bibliothek. — Rückkehr. — Der
Sänger-Krieg auf der Wartburg. — Ende des
Wartburg-Krieges. — Die heilige Elisabeth. Braut und
Bräutigam. Die Hochzeit. Elisabeth als Land-Gräfin. Das
Rosen-Wunder. Trennung. Allein. Verlassen. Vertrieben. Arm. Das
Ende der Leiden. — Ein Geheimnis. — Das Signal. —
Ein Ritter-Mahl. — Die Speise-Karte. — Bei Tafel.
— Engländer, Franzosen, Deutsche und Amerikaner bei
Tische. — Fritz Beckmann. — Die Gabel. — Ein
Rätsel. — Noch eins. — Toast und
Anstoßen.
Sektion IV.
Seite 114
Ein Morgen im Blumen-Hause: Die Rose. Das
Vergiß-mein-nicht. Die Narzisse. Die Myrthe. Der Jasmin.
Epheu. — Ein interessanter Abend: Frau Meister spricht. Das
echte Weib. — Die Nibelungen: Worms — Krimhilde. Xanten
— Siegfried. Siegfried kommt nach Worms. Die Insel Island.
Brunhilde. Gunther und Siegfried gehen auf Brunhildens Burg.
Brunhilde wird besiegt und kommt nach Worms. Zwei Hochzeiten. Zehn
glückliche Jahre in Xanten. Besuch in Worms:
Ritter-Kämpfe und Kirch-Gang. Hagen. Die Jagd. — Das
Weib in der alten
Zeit, in der Ritter-Zeit und in der modernen Zeit. —
Goethes[P-1]
Iphigenie. — Rätsel.
Sektion V.
Seite 180
Annas Brief: Heimweh. Sonnen-Aufgang in Nürnberg.
Albrecht Dürer. Hans Sachs. Adam Kraft. Frankfurt am Main. Der
Palmen-Garten. Ein Sonnen-Untergang. Goethes Geburts-Haus. Weimar
und die Fürsten-Gruft. Deutsche Eisen-Bahnen. Deutsche Felder.
Eine Kirmes. Bauern-Tanz. Der Nacht-Wächter.
Spinn-Stuben-Lieder. — Münchhausen auf der Jagd. —
Münchhausen in Rußland. — Eine Entdeckung. —
Aus Schillers Leben: Im Eltern-Hause. Der Herzog Karl von
Württemberg[P-2].
Schiller in der Schule. Goethe. Lavater. Schillers erstes Drama.
Seine Flucht. »Fiesko.« »Kabale und Liebe.« Seine
Not. Körner. Schiller ist Professor der Geschichte.
Goethe[P-3] und
Schiller werden Freunde. Blüte-Zeit der modernen deutschen
Literatur[P-4] in
Weimar. Auf der Höhe des Ruhmes. »Wilhelm Tell.«
— Pfänder-Spiel: Thorwaldsen, Napoleon
I., Raphael, Voltaire,
Columbus, Alexander von Humboldt.
Sektion VI.
Seite 225
Falten auf der Stirne. — Auf der Jagd. — Das
Unendliche und Erhabene in der Natur. — Das graue Auge, das
braune, das blaue und das schwarze. — Eine Begegnung nach
Mitternacht. — Eine Geschichte. — Ein schweres
Unternehmen. — Herder. — Parabeln. — Kalif.
— Storch. — »Die Teilung der Erde.«
Sektion VII.
Seite 257
Eine Überraschung. — Die Vorlesung: Turm von Babel.
Die Mutter-Sprache. Eine traurige Periode in der deutschen Kultur
und Sprache. — Lessing: Seine Bedeutung für die deutsche
Sprache, für die deutsche Litteratur und für die Kunst:
Laokoon.
Winckelmann. Lessings Entdeckung und ihre Bedeutung. — Musik.
— »Wenn die Schwalben heimwärts
ziehn.«
Sektion VIII.
Seite 280[P-5]
Land-Partie: Die Grotte. — Enthüllung. —
Ackerbau. — Aussprache: Form der Lippen. — Vokale.
— Das lange und das kurze »a«. — Das lange
und das kurze »e«, »i«, »o«,
»u«, u.s.w. — über das Trennen der Silben.
— Betonung im Satze. — Ton auf zusammengesetzten
Wörtern:
a)
Verben mit Präpositionen.
b) Zwei Substantive. — Konsonanten:
»g«, »r«, »s«,
»st«,[P-6]
»v«, »w«, »z«. —
über das »ch«. — Trennung der Wörter.
— Eine Komödie. — Beifall. — Auf
Wiedersehen.
Anhang.
Seite 305

Studien und Plaudereien.
I.
Herr Meister: Willkommen!
Willkommen! Louis und Otto! Wie ich mich freue, Sie wieder zu
sehen! Recht herzlich willkommen! Und wie groß Sie geworden
sind! Waren Sie immer recht wohl?
Otto: Ich danke Ihnen, Herr
Meister; wir sind wohl und glücklich, und ich freue mich, auch
Sie so kräftig zu finden.
Herr Meister: Ja, ja; ich bin
recht kräftig; — das macht die Arbeit, meine Freunde.
— Die Arbeit, die wir lieben, stärkt uns, nicht wahr? —
Aber kommen Sie; nehmen Sie Platz. — So. —
Erzählen Sie mir. Wir haben uns lange nicht gesehen. —
Aber, Louis, was ist denn das? Ich höre ja kein Wort von
Ihnen!
Otto: Bruder Louis
fürchtet sich.
Herr Meister: Fürchtet
sich?
Otto: Ja, —
fürchtet sich, deutsch zu sprechen.
Herr Meister: Aha, — ich
verstehe. Freund Louis denkt: Nun habe ich so lange kein Deutsch
gesprochen und
gelesen, und alles ist vergessen. Wie? — denkt Louis nicht
so?
Louis: Ja, Herr Meister.
Herr Meister: Bravo, Louis,
bravo! Das war ein Anfang. Sprechen Sie zu.
Louis: Aber — ich kann
nicht.
Herr Meister: Nur Muth, mein
Freund! Sie haben so viel gelernt, — und alles so gut,
daß Sie es in vielen Jahren nicht vergessen werden. Sie
schütteln den Kopf, — Sie glauben es nicht? So tat auch
ich einmal, da ich fremde Sprachen studierte. Das aber weiß
ich nun: Eine Sprache, gut studiert, wird in uns ein lebender
Organismus und faßt tiefe Wurzeln,
wie ein Baum in Mutter Erde. — Im Stillen wächst er; der Stamm wird stark,
er grünt; und eines schönen Morgens steht er da in
Blüten. Ganz so ist es mit einer Sprache.
Louis: So?
Otto: Ihre Worte machen Louis
glücklich; nicht wahr, mein Bruder?
Louis: Ja, — ich habe
wieder Mut. Ich muß wieder lernen und schnell und
perfekt lernen; denn — Wissen Sie nicht, Herr Meister,
daß Bruder Albert hier ist?
Herr Meister: Wirklich?
Louis: Ja, er ist letzten
Donnerstag angekommen.
Herr Meister: Nun, das freut
mich. Ihre Eltern sind wohl recht glücklich?
Louis: Ja, — und wir
alle. Otto, Schwester Martha und ich.
Herr Meister: Das will ich
glauben. Auch wir halten hier einen lieben Gast. — Wollen Sie
einen Augenblick
entschuldigen? — Ich will nur jene Thüre öffnen.
— Meine Damen, haben Sie doch die Güte, hereinzukommen
in mein Studier-Zimmer.
Otto: Ah — Fräulein
Bella!
Louis: Guten Tag,
Fräulein Martha und Fräulein Bella! Wie befinden Sie
sich, meine Damen?
Martha Meister: Meine Herren,
ich wünsche Ihnen guten Tag!
Bella: Ach — ich bin so
froh, Sie wieder zu sehen, Herr Otto und Herr Louis!
Otto: Ich wußte nicht,
daß Sie hier waren, Fräulein Bella. Das ist ein
unerwartetes Glück,
Sie hier zu finden.
Herr Meister: Fräulein
Bella, ich habe eine Neuigkeit für
Sie. Raten Sie einmal, — was mag das sein?
Bella: Herr Louis hat wieder
ein neues Pferd.
Louis: O nein, Fräulein
Bella, das ist es nicht.
Herr Meister: Ich wußte,
daß Sie es nicht erraten würden. Herr
Albert Parks, der junge Doktor, ist wieder hier.
Martha Meister: Wirklich?
Bella: Das ist schön!
Louis: O Fräulein Martha,
Sie müssen meinen Bruder Albert sehen. — Er ist ein
Doktor — o ja, — und versteht alles, glaube ich. Kisten
und Kasten voll Bücher hat er mitgebracht, Instrumente und
Rapiere. Sie sollten einmal sehen, wie er fechten kann. Das hat er auf
der deutschen Universität gelernt; und heute Morgen hat er
mich gelehrt, das Rapier zu führen; sehen Sie — so
—. O, er kann gut fechten und er ist so stark, nicht wahr,
Otto? —
Otto: Ja wohl.
Bella: Hat er auch einen
Bart?
Louis: O ja, sehen Sie,
hier.
Otto: Einen Schnurrbart,
Louis.
Louis: Ja, einen Schnurrbart
hat er; einen langen Schnurrbart.
Martha Meister: Ich weiß
sehr viel von Ihrem Herrn Bruder.
Louis: Wie so, mein
Fräulein?
Martha Meister: Durch
Fräulein Bella.
Louis: Wo haben Sie meinen
Bruder denn gesehen, Fräulein Bella?
Bella: Ich habe ihn noch nicht
gesehen, aber meine Freundin, Frau Dr. Stellen aus Cöln, hat mir von ihm
geschrieben. Auch Anna hat geschrieben.
Louis: Wirklich? Hat Anna
geschrieben? Auch an mich?
Bella: An Sie? Das können
Sie doch wohl nicht gut erwarten, Sie böser Mensch! In dieser
langen Zeit
haben Sie uns ganz vergessen. O, ich weiß alles. Ihre Pferde
haben Sie dressiert, sie tanzen gelehrt und recht graziös zu
gehen im spanischen Schritt; oder Sie waren in Ihrem Boote auf dem
Wasser. Aber haben Sie auch nur einmal an Ihre alten Freunde
gedacht?
Louis: Ich weiß es wohl:
Otto hat Ihnen geschrieben, was ich getan habe; — was ich
gedacht habe, konnte er Ihnen natürlich nicht schreiben. Aber
glauben Sie nur: Ich habe oft an Sie gedacht und habe oft den
Augenblick herbeigewünscht, wann ich Sie wiedersehen
sollte.
Bella: An mich gedacht, aber
nicht an mich geschrieben.
Otto: Fräulein Bella, Sie
sind zu hart gegen meinen Bruder.
Martha Meister: Ja, Bella, Du
bist recht grausam.
Sieh' einmal, wie traurig Louis ist!
Bella: Soll ich ihm vergeben,
dem leichten Herrn Louis? Was sagen Sie, Herr Meister? — Ja?
— Nun, ich reiche Ihnen meine Hand und verzeihe Ihnen dieses Mal.
Louis: Sie sind so gut.
Bella: Nun wollen Sie auch den
Brief hören; — ist es nicht so? — Ja, ja. —
Nun gut! Hören Sie zu, ich lese zuerst Frau Dr. Stellen's Brief:
»Meine lieben Freunde in Amerika!
Euch allen wünsche ich Gesundheit und ein
Leben, so glücklich, wie wir es hier führen. Euer letztes
Schreiben hat
mir viel Freude gemacht und ich schreibe heute deutsch, weil Ihr es
wünscht. Wir hatten vor kurzem einen Besuch.
Herr Doktor Albert Parks, ein Bruder Eurer Freunde Otto und Louis,
war bei uns. Anna war, — wie Ihr Euch leicht denken
könnt, — sehr glücklich, einen Amerikaner zu sehen
und englisch zu sprechen. Mit uns spricht Anna nur deutsch. Der
Herr Doktor hörte es und rief: »Ist es möglich? So
kurze Zeit haben Sie deutsch studiert und verstehen so viel und
sprechen so gut! Da muß ich mich schämen! Denn ich habe
mehr Zeit gebraucht. Ich kann Sie
versichern, ich kenne Landsleute hier, die ein Jahr und
länger in Berlin und in Leipzig waren und weniger sprechen und
verstehen als Sie.«
Ja, ja! Der Herr Doktor ist ein liebenswürdiger Mann. —
Nachmittags waren wir auf dem Rhein; und wie der junge Doktor da
stand, vorne am Schiff, hoch auf dem Deck, voll jugendlicher Kraft; und wie der Wind
seine Locken
und seinen Mantel bewegte, da kam er mir vor wie ein Kapitän,
der im Sturm mit sicherer Hand das Schiff regiert und festen Auges den Männern
gebietet. Er sah unsern Rhein: Auf
grünlichen Fluten
gleiten wir dahin; links und rechts erhebt sich die
Erde. Darauf schattige Bäume und freundliche Häuser.
Darüber hinaus ragen die
Türme, und über diesen die Berge; — und über
allem — der weite Himmel; und herunter strahlt die Sonne, warm und mild.
Das Auge sieht hinauf zu diesem Himmel. Welch' ein
süßes Blau! Das Auge sieht hin zu den weißen
Wolken,
die dahin fliegen leicht und rein und in tausend verschiedenen,
phantastischen Formen. — Und wieder herab senkt sich das Auge
zur Flut, die so kühl und klar dahin wallet und so friedlich. Nichts trübt, so weit das Auge
reicht, die klare Flut; nichts stört den Frieden der spiegelglatten Fläche. Die Sonne taucht ihre
Strahlen in die Fluten, und es blinkt in
den wunderbarsten Farben. — Und die
würzig Luft sauge ich
ein und fühle mich erquickt. — Ich schließe die
Augen. Ich will nichts mehr sehen; hören nur will ich das
Säuseln des Windes, das Rauschen des Wassers. O, welche Musik!
Ich vergesse die Erde, vergesse alles um mich und höre —
und höre — — — den Ton einer Glocke.
»Zu Tisch, meine Damen und Herren,« ruft der
Stewart.
Schnellen Schrittes eile ich hinab
zur reichen Tafel, wo Freunde warten. Das
Beste der Erde bietet man mir zur Speise und einen Wein von unserm Rhein zum
Trinken, der ist, wie der Nektar der Götter — und
ich labe mich. Aufblickend sehe ich
zur Rechten und zur Linken freundliche Dörfer und grünende Felder
und blühende Gärten, Berge mit Weinlaub bedeckt. Graue Burgen stehen
auf Felsen und erzählen von
alten Rittern und ihren Taten. — Und die mächtigen
Felsen, die stolz und hoch da stehen,
sprechen von alten Zeiten, da wilde Elemente darin brausten, als wollten sie alles mit sich
reißen; aber sie, die Felsen, waren da und hatten sich
dagegen gestemmt mit fester
Brust.
Unter allen Felsen aber raget einer hervor. Stolz erhebt er das Haupt; denn gezwungen hat er bis heute die Wogen des
großen Stromes, die zu ihm kommen und dann ihren Weg
verlassen und gehen, wie er ihnen vorschreibt. Alles hält er
in respektvoller Ferne — und wehe dem Boote, das ihm
übermütig zu
nahe kommt!
Frohes Lachen und melodisches Singen tönet herab vom Deck
des Dampfers. Neben mir links und neben mir rechts sitzen
glückliche Menschen, die sich mit mir freuen, und in allen
Augen könnt Ihr eines nur sehen: die
Zufriedenheit.
Himmel und Erde, Wasser und Luft, Tiere und Menschen sind hier
in Harmonie. Ist mein Brief zu lang geworden? Ich fürchte
fast. Das Beste habe ich aber vergessen! Ich muß doch
über unsere kleine Tochter schreiben. Jeden Tag wird sie
größer und klüger und schöner und sie ist so
lieb und so süß, daß wir keinen Namen finden
können, gut genug für sie. Mein Gemahl nennt sie immer:
»Du kleiner, süßer Engel,« und wenn ich sie
so rufe, hört sie. Mein einziges Gebet ist früh und
spät, daß der liebe Gott sie uns erhalten möge. Nun
will ich aber meinen Brief beenden. Herzliche Grüße von
meinem Gatten und mir an Euch und alle Freunde, und viele, viele
Grüße an das schöne Land Amerika.
Eure treue Freundin
Clara Stellen.«
Louis: Dieser Brief ist aber
poetisch, mein Fräulein!
Bella: Hören Sie nur
weiter, jetzt kommt noch ein kleiner Brief von Anna:
»Teure Schwester und teure Freundinnen! Wenige Worte
will ich heute an Euch schreiben. Es ist bald acht Uhr und wir
gehen in das Konzert. Ich wünsche nur, Ihr könntet alles
hören und sehen, wie ich. Tausend Küsse und tausend
Grüße von Eurer Anna.
Nachschrift: Schreibet mir bald, bitte! bitte!«
Louis: Ich will wieder Deutsch studieren, — ich
will!
Otto: Aber, Louis, was ist dir
denn? So sprich doch nicht so laut!
Louis: Ach, Herr Meister,
warum können wir denn nicht studieren, wie früher? Das
war ja so schön!
Martha Meister: Lieber Papa,
könnten wir nicht einen deutschen Verein
bilden? Was meinst du, Papa?
Herr Meister: Wohl, meine
Tochter. Ich lege alles in deine Hände. Mache den Plan;
ordne, was nötig[I-1] ist,
ganz, wie du meinst. Ich bin mit allem zufrieden, was du tust.
Louis: Ich auch, Fräulein
Martha.
Bella: Das war ein guter
Gedanke von Dir, Martha. Ich wurde immer traurig, wenn ich an den
langen Winter dachte. — Anna nicht bei mir, — und ich
so allein. — Nun aber beginnt die Sonne mir wieder zu
scheinen. —
Martha Meister: Wer zur
deutschen Gesellschaft gehören will, rufe:
»Ich!«
Louis: Ich!
Bella: Und ich!
Otto: Ich!
Herr Meister: Und ich!
Martha Meister: Und ich!
— So wären wir fünf; und unsere teure Mama wird
auch kommen; ich werde sie bitten, — — —
Bella: Und Gretchen auch.
Martha Meister: Gewiß,
Gretchen kommt. Aber, — wo ist Schwester Gretchen?
Bella: Sie ist da, — in
ihrem Zimmer. Pst! Hören Sie! Sie liest ihrer Mutter vor!
Hören Sie:
Bella: Sie deklamiert
schön, nicht wahr, Otto?
Otto: Sehr schön, in der
Tat. — Ich glaube, das war ein Gedicht von Friedrich von
Bodenstedt.
Bella: Gretchen kommt auch,
das weiß ich. Aber wie ist es mit Ihrem Bruder, dem Herrn
Doktor? Wollen Sie nicht mit ihm darüber sprechen?
Louis: O, Albert kommt, wenn
ich ihn darum bitte; und der kann die
Gesellschaft unterhalten. — O, der weiß
Geschichten. Hören Sie nur! Gestern, vor Abend, sah er meine
Pferde, und mein Nero ist, wie Sie wissen, mein bestes Pferd.
— Albert, sagte ich, Albert, was denkst Du über meinen
Nero? — Hat Feuer, nicht wahr? — Ja, ja, den kann
Niemand reiten, außer mir. So? sagt Albert und lächelt
und nimmt mir die Zügel aus der Hand. Ich wollte ihn
warnen; aber denkt nur, — er sitzt schon auf. Nero bäumt sich, schlägt aus;
— aber mein Bruder drückt die Sporen fest in die
Seiten, lenkt es und fliegt in wildem Galopp dahin.
Nimm Dich in Acht, rufe ich ihm nach;
nimm dich in Acht! Aber lächelnd winkt er mir mit seiner
Rechten, reitet meinen Nero nach rechts und nach links, ganz wie
ich selbst. Dann steigt er ruhig ab und sagt zu mir, der ich
verwundert dastehe: Ja, ja, mein Lieber; man muß die Tiere verstehen und
studieren, so gut wie die Menschen.
Und hast Du die Tiere denn auch studiert? frage ich ihn, —
und er nimmt mich am Arme und sagt: Komm mit mir dorthin, in jenen
Busch; da können wir ruhen. Da will ich Dir etwas
erzählen, das wird dir gefallen. — Wir taten so und
Albert begann:
Du weißt, mein lieber Louis, der Löwe ist König
unter den Tieren, und es war im Monat Mai, es grünten die
Felder, die Wiesen und Wälder, und überall in
Bäumen, Büschen und Hecken war Leben. Da gab Nobel, der
König, ein Fest. Alle waren gekommen von weiter Ferne:
Isegrimm, der Wolf, Braun, der Bär, auch die anderen alle, und
die Vögel, groß und klein. Einer war nicht da: Reineke
Fuchs.
Und Isegrimm trat vor den Thron des Königs und sprach also:
Wir alle haben dein Wort, o König, gehört und sind
gekommen; es fehlet allein Reineke Fuchs. Niemals tut er deinen
Willen. Mich hat der Böse übel behandelt, mein
Weib hat er verhöhnt, und meine Kinder hat
er geblendet mit bitterem
Wasser. Da sind die armen Kindlein vor dir, o König, und
fordern
Recht.
Und Hündchen Wackerlos sprang vor den König und begann
zu klagen; es sprach in feinen
Worten; es sprach nur französisch. Und die Katze kam da auch
mit neuen Klagen, und dann kam der Panther und sprach also:
Was Katze und Hund da sagen, will wenig bedeuten. Aber höret
mich an; ich habe zu sprechen wider Reineke Fuchs. Da ich
harmlos den Weg wanderte durch den Wald, hörte ich ein Weinen
und Wimmern links im Gebüsch. Verwundert trete ich zur
Seite und sehe: Reineke hält Lampe, den Hasen, an den Ohren
und zauset ihn
fürchterlich; und wäre ich nicht gekommen, — Lampe
wäre nun tot. Solches aber ist doch nicht recht in diesen
Tagen des Friedens.
Reineke's Neffe aber, der Dachs, trat vor den König,
gedankenvoll und lächelnd; denn er war ein Advokat, sehr
gelehrt und schlau, und begann seine Rede
also:
Mein König, es ist ein altes Sprichwort: »Ein Feind
wird niemals Gutes von dir sagen.« Kein Wunder also,
daß diese Herren Schlechtes reden wollen von Reineke, meinem
teuern Onkel. Er selbst ist nicht hier; sonst würden sie
wahrlich solches nicht wagen. Aber wer ist es, der hier
auftritt zu klagen. Isegrimm, der Wolf? Hat der ein Recht dazu? Er,
der so übel gehandelt an Reineke? — Ich bitte, o
König, höret, was ich jetzt sage:
Einmal war Freundschaft zwischen dem Wolfe und dem Fuchse; alle
Beute wollten sie teilen nach
Recht. Da kam eines Tages der Wolf und war sehr hungrig, —
und hungrig ist er ja immer — zu meinem Oheim und
verlangte zu essen. Ah, sagte freundlich mein Oheim, hier habe ich
nichts. Aber da weiß ich ein fettes Schwein; das hängt nicht weit von
hier beim Bauern; wenn ihr warten wollt vor dem Hause, so will ich
es durch's Fenster werfen, aber gebt mir auch die Hälfte.
Gewiß, sagte der Wolf, und beide gingen. Mein Oheim tat, wie
er gesprochen, und warf die fette Beute hinunter durch das Fenster;
doch, da er selbst zu essen verlangte, lachte der Wolf — es
war dieser Wolf, — und sagte hämisch: Hier, mein Freund,
wünsche guten Appetit — und gab meinem Oheim das breite
Stück Holz, woran das Schwein gehangen hatte. So teilt der
Wolf. — Aber das ist noch nicht alles.
Ein anderes Mal hatte er wieder großes Verlangen nach
Fischen. Da kam er zum Fuchse. Und gut, — wie Reineke ist,
— sprach er: Auf jener Straße kommt heute Nachmittag
ein Mann von dem Strome; der bringt Fische in dem Wagen. Da
können wir essen, — und beide gingen zusammen.
Der Fuchs aber legte sich auf die Straße und lag ganz
still, als wäre er tot. Der Fuhrmann kam und sah den
toten Fuchs und freute sich nicht wenig. Er nahm ihn, warf ihn auf
den Wagen und fuhr die Straße entlang. Mein Oheim aber, der
Fuchs, warf die Fische vom Wagen herab auf die Straße. Es
folgte der Wolf und fraß. Endlich sprang der Fuchs vom
Wagen, ging zum Wolfe und wollte auch von den Fischen essen. Da
sagte der Wolf: Nehmet, Reineke, nehmet; hier ist für euch,
— und gab ihm von den Fischen — die Gräten. — So handelt der Wolf. — Soll ich noch mehr von ihm sagen?
Nichts Gutes, o König, würdest du hören. —
Und wegen des Hasen! Es ist wahrlich zum Lachen, wie falsch der
Panther gesehn hat. Wohl hatte mein Oheim den Hasen beim Ohre. Der
Hase ist ja meines Oheims Schüler. Er war zu ihm gekommen und
wollte lernen, die Psalmen zu singen. Nun aber hat der Hase kein
feines Gehör und kann die Töne nicht lernen. Da verlor mein Oheim die
Geduld und zauste den Hasen an den Ohren. — Aber das ist doch
wohl das Recht des Lehrers! — Wo soll denn Ordnung sein, wenn
nicht der Lehrer das Recht hat, die Ohren des Schülers zu
zausen?
Nein, das muß ich hier sagen, hier vor dem König,
daß mein Oheim ein frommes, gutes Leben führt und betet
und fastet und seit Wochen kein Fleisch ißt, sondern
Gras und Kräuter.
Laßt ihn kommen, o König, vor euch selbst und sehet, ob
es nicht also sei.
Reineke's Neffe hatte gesprochen, und der König hatte
gehört. — Da kam Henning daher, der Hahn; — und
hinter ihm trug man eine Henne ohne Kopf und Hals. Er selbst war
traurig und er begann zu sprechen vor Nobel, dem König:
Höret mich an, o König! — Vor wenigen Tagen noch
lebte ich still und glücklich inmitten meiner Familie. Da kam
der Fuchs daher, als Mönch gekleidet. Die
Hände gefaltet, mit den Lippen betend, blickte er
aufwärts zum Himmel und sagte zu mir: Wisse, Freund Henning, der
König hat befohlen, daß alle Tiere im Walde und auf dem
Felde in Frieden leben und nicht wieder streiten oder einander töten in
böser Feindschaft. Du siehst, ich selbst bin nun ein
Mönch geworden und nichts hast du von mir zu fürchten,
auch nicht deine Söhne und deine Töchter. So sprach der
Fuchs und zeigte einen Brief mit großen Siegeln vom
König. Mit Freude hörte ich alles und sagte es den
anderen. Die sprangen hinaus vom sichern Hofe in das Feld, das Beste zu
suchen in Busch und Wald. Doch kurz war das Glück, und traurig
das Ende.
Der falsche Fuchs hatte sich hinter einer dichten Hecke versteckt und sprang hervor und
mordete fürchterlich. Von allen meinen stolzen Söhnen und
lieblichen Töchtern ist niemand geblieben. Die letzte hat er
heute erwürgt, sie, die
Unglückliche, die letzte meines Stammes. Also sprach Herr
Henning und weinte bitterlich.
Nobel schüttelte unmutig
sein königliches Haupt und sprach: Guter Henning, mit Trauer
höre ich das Unglück, welches dich befallen hat. Mit
allen Ehren wollen wir deine Tochter zu Grabe bestatten. Ich selber will dem Sarge folgen.
Einen Marmorstein lasse ich auf ihr Grab
setzen, und darauf soll man diese Worte lesen: »Hier ruht in
Frieden: Kratzefuß, Hennings Tochter, die beste der Hennen.
Legte viele Eier in's Nest und verstand gut zu scharren. Ach! hier liegt sie, durch Reinekens Mord den
Ihren genommen.« — Euch aber, ihr Herren, die hier
versammelt sind, bitte ich: Beratet, wie fördern wir Recht und Frieden im
Lande? — so kam man denn
überein, daß Braun, der Bär, auf Reinekens
Schloß Malepartus gehen und ihn auffordern sollte im Namen des Königs,
vor dessen Thron zu erscheinen, auf daß der König die
Klage höre und Recht spreche und ihn strafe, wenn er ihn schuldig befände.
Und Braun ging und wanderte durch eine lange Heide und kam
zuletzt nach Malepartus. Da hatte Reineke eine stattliche Burg gebaut,
fest und stark gegen Feinde, mit vielen heimlichen Gängen, durch
die er entschlüpfen könnte,
wenn es nötig wäre. In den weiten und schönen Hallen
aber lebte Reineke mit seiner Gemahlin und den beiden Söhnchen
und sie aßen und tranken vom Besten und waren sorglos.
Da hörte er die rauhe Stimme des Bären, der also rief:
Du sollst zum Könige kommen, Reineke, daß der König
die Klage höre und Antwort gebe und Recht spreche; und
daß er dich strafe, wenn er dich schuldig befindet. —
So du aber nicht kommst, wird er dich hängen lassen.
Der Fuchs hörte die Worte des Bären und sprach
lächelnd zu sich selbst: Diesen rohen Gesellen will ich heimsenden, daß er noch
lange an Reineke denke. — Und alsbald ging er hinaus vor das
breite Thor und sprach mit freundlicher
Stimme zu Braun, dem Bären: Guten Tag, mein teuerster Oheim! Welche
Ehre für mich, daß ihr selbst mich besuchet! Aber, was
sehe ich? Wie seid ihr so erhitzt
und voll Staub! —
Konnte der König niemand anders senden? — Mußtet
ihr gerade diese beschwerliche
Reise machen? — Seid ihr hungrig? — Was giebt man euch
doch! Ihr wisset, wir leben hier ärmlich und haben wenig Gutes.
— Honig können wir euch geben. Doch, ich weiß
wohl, ihr esset niemals Honig.
Honig? rief der Bär erfreut. — Nichts
ist mir lieber, als Honig. O, gebet mir Honig!
Ist es wirklich wahr, sprach der Fuchs mit falscher Freude,
esset ihr Honig so gern? Ei, davon kann ich euch geben. —
Wisset, nicht weit von hier wohnt Rüsteviel, der Bauer; der
hat Honig, — mehr, als ihr je gesehen.
So laß uns gehen, schrie der glückliche Bär und
trabte voran, so schnell, wie er konnte.
Sie kamen auf Rüsteviels Hof. Das aber wußte der
schlaue Fuchs, daß Rüsteviel auf seinem Hofe einen Baum
spalten wollte und einen Keil
hineingetrieben hatte. — An dem einen Ende war der Baum offen
und in dem andern Ende steckte der Keil. — Den hungrigen
Bären führte der Fuchs hierher und sagte gar freundlich
zu ihm: Hier, teurer Oheim, möget ihr Honig essen. —
Doch esset nicht zu viel! Das rate ich euch, — er ist gar
süß.
Mit beiden Vorderfüßen zugleich sprang der Bär in die Spalte. Den
Kopf steckte er bis über die Ohren hinein, nach Honig
suchend.
Reineke aber war an dem andern Ende, zog mit aller Kraft an dem Keile;
und es gelang ihm
nach vieler Mühe,
den Keil zu entfernen. —
Zusammen klappte der Baum, und Braun war gefangen.
Er schrie vor Schmerzen laut auf, bat den Fuchs um Hilfe. Der
Fuchs aber lief und lachte und rief aus der Ferne: Wünsche
guten Appetit, Herr Braun, guten Appetit!
Rüsteviel aber, geweckt durch das Geschrei des Bären, sprang aus dem Bette
und nahm seine Axt und eilte auf den Hof. Da sah er den Bären
und weckte alle Nachbarn.
Sie kamen eilends herbei; die
Männer mit Stöcken und die Frauen mit Besen und alle schlugen auf
den gefangenen Bären.
In der Verzweiflung
aber reißt er sich los, läßt beide Klauen stecken
von den Vorderfüßen und vom Gesichte die Haut. Laut schreiend vor
Schmerz, rannte er unter die Bauern. Sie alle fliehen, die Weiber
zumal; und eine von ihnen, eine Köchin, fiel in das Wasser des
Baches. Das war des Bären Glück; denn, als man zum Bache
rannte wegen der Köchin, konnte der Bär entkommen. — Sein Elend aber war so groß, daß er sich
ins Wasser stürzte, um zu sterben, denn zu groß waren
die Schmerzen. — Aber er schwamm den Bach hinunter und kam nach vielen
Tagen zurück an den Hof des Königs.
Als Nobel, der König, ihn sah, rief er entsetzt: Großer
Gott! Bist du das, Braun? Kaum kenn' ich dich wieder! Wer hat das
getan?
Und als der König die Geschichte gehört hatte, sagte
er zu den Herren um ihn: Ihr alle habt den unglücklichen Braun
gehört. Höret nun auch meinen Willen: Ich bestimme,
daß Hinze, der Kater, jetzt gehe zu Reineke. Du bist ein
höflicher Mann, Hinze, und verstehst, in feinen Worten zu
sprechen. Zu Reineke gehe und kehre bald wieder mit ihm.
Traurig ging der Kater, Reineke fürchtend. Und als er nach
Malepartus kam, trat Reineke zu ihm heraus und sprach: Ah, sieh'
einmal, Hinze! Kommst du zu mir? Das freut mich. Mit dir? Ja, mit
dir will ich gehen; denn du bist ein feiner Mann; aber ich möchte
[I-4]
nicht gehen mit dem rohen Bären; — auch hatte ich Furcht
vor ihm. — Mit dir gehe ich gerne. Was aber kann ich dir
geben zum Essen? Ach ja, — Ich habe Honig, süß und
gut, möchtest du wohl davon speisen?
Nein, sagte Hinze, ich mache mir nicht viel aus Honig; wenn du
mir aber eine Maus geben wolltest, würde ich dir danken.
Issest du Mäuse so gern?
rief verwundert der Fuchs. Mäuse kann ich dir geben in
großer Menge in meines Nachbarn Scheune.
Laß uns dahin gehen.
Und sie kamen in die Scheune des Nachbarn, des Predigers.
An der Seite der Scheune aber hatte Reineke gestern ein
Loch gegraben und hatte dadurch des Predigers beste
Henne gestohlen. — Erzürnt darüber, hatte
Martin, des Predigers Söhnchen, eine Schlinge gelegt an die
innere Seite der Öffnung.
Alles das wußte der Schlaue und sprach mit falscher
Freundlichkeit: Hinze, höret nur die Mäuse, wie sie
pfeifen! So viele sind darin; man könnte sie nicht in zwei
Wagen von dannen fahren. Hier ist das Loch, springt nur hinein!
Hinze aber fürchtete sich und fragte ängstlich: Meint
ihr, Reineke, daß es sicher wäre, hinein zu gehn?
—
Sicher, ganz sicher, mein lieber Hinze; spring nur zu.
Während du mausest,
will ich hier wachen für dich.
Und der Kater glaubte dem Falschen, sprang durch die
Öffnung — und schrie, schrie jämmerlich! —
denn er fühlte die Schlinge um den Hals, und sie preßte
ihn arg.
Martinchen hörte das Schreien und jubelnd kam er gelaufen
und rief: Ah, so hab' ich endlich den Dieb gefangen, der uns die
Hühner stiehlt; und dann mißhandelte er den armen Hinze.
Reineke freute sich dessen und glaubte, der Kater wäre nun
tot. — Aber er war noch entsprungen; blutig und einäugig zwar, — doch
hatte er das Leben behalten.
Jammernd kam er zurück zum Könige und klagte sein
Leid.
Des Königs Herz entbrannte in gewaltigem
Zorne, und er sprach mit Donner-Stimme: Ich sehe, dieser
Reineke ist ein Frevler
und verdient den
Tod.
Aber Grimbart, der Dachs, kam wieder und sprach: Wollt ihr
Reineke verdammen, bevor ihr ihn gesehen oder gehört? —
Lasset mich zu ihm gehen und, wahrlich, ich werde ihn bringen.
Und Nobel, der König, sprach: Thue nach deinem Worte.
Grimbart, der Dachs, machte sich nun auf den Weg und kam mit
vieler Mühe zu seines Oheims Burg. Da klopfte er an die Pforte
und rief mit lauter Stimme: Öffnet, Reineke; denn Grimbart ist
es, Euer Neffe. Öffnet! Ich habe mit Euch zu reden.
Und Reineke öffnete willig die Thüre und führte
den Neffen in das Innere der Burg zu seinem Weibe und seinen zwei
Söhnen. Beide waren noch jung und sahen dem Vater sehr
ähnlich, und der eine besonders
war schlau.
Reineke aber sagte zu Grimbart: Ich weiß, warum du zu mir
kommst.
Und denkst du nicht selbst, fragte wohlwollend der Neffe,
daß es nun Zeit wäre, des Königs Willen zu tun und
vor ihn zu kommen?
Wohl, versetzte Reineke. Heute
bist du mein Gast. Ruhe von deiner beschwerlichen Reise; morgen aber
gehe ich mit dir zum König.
Dann speisten sie alle zusammen; und dem Dachse gefiel es sehr
gut in Reinekens Haus; denn Reineke war liebevoll mit seinem Weibe
und zärtlich mit den Kindern. Und
als es Nacht war, gingen alle zu Bette.
Am nächsten Morgen früh nahm Reineke Abschied und sagte zu seinem Weibe: Achte wohl auf die Kinder; lasse keines aus dem
Hause; — denn ich muß fort in Geschäften zum
König und hoffe, recht bald wieder bei euch zu sein. Ihr aber,
meine lieben Kinder, seid recht artig und höret auf eure
Mutter. Dann bringe ich euch etwas Gutes mit von dem Könige;
und dann ging er mit dem Neffen.
Auf dem Wege aber begann Reineke ernstlich zu denken und sprach
zu seinem Neffen: Weißt du, Grimbart, daß ich beginne,
des Königs gerechten Zorn zu
fürchten? — Denn ich bin schuldig, und vieles ist wahr,
was die Feinde sagen von mir. Ich habe den plumpen Bären
mißhandelt, des Königs Boten, und auch Hinze, den
Kater. Ich habe dieses getan und noch viel mehr, was schlecht
ist.
Ist es also? fragte traurig Grimbart. Dann bekenne mir offen deine Sünden und
gelobe Besserung.
Und Reineke tat also. Dann sprach er: Nun ist mir das Herz viel
leichter, und freier gehe ich zum Könige.
Es geschah aber, so oft sie an einen Bauernhof kamen, daß Reineke die Hühner
haschen wollte. —
Und er hätte sie wahrlich getötet, wäre nicht
Grimbart gewesen, der ihn immer warnte, sagend: Oheim, ich dachte,
du wolltest dich bessern?
Ja, so ist es, rief dann der Fuchs. Ja, ja! Ich bin doch ein
arger Sünder.
Endlich kamen sie an des Königs Hof; und schnell wurde es
bekannt: Reineke, der Fuchs, ist angekommen.
Er aber ging leicht und frei durch die Straßen daher, als
wäre er selber des Königs Sohn; grüßte,
lächelte freundlich, und niemand sah die Furcht in seinem
Herzen.
Dann trat er zum König. Majestätisch saß er auf
seinem Throne, von den Großen und Nobeln umringt. Die meisten
von diesen waren bittere Feinde des Fuchses. — Dieser aber
begann also zu reden:
Groß seid ihr, o König, und gerecht. Ihr höret
alle, die Schuldigen und auch die Unschuldigen. Ihr könnt tun
mit uns nach eurem Willen; denn unser Leben ist in eurer Hand. Nun
aber wisset, o König, daß viele hier am Hofe sind, die
mich hassen, weil ich euch treu bin.
Schweig, rief der König! Du schwätzest zu viel und ehrtest
nicht die Boten, die ich dir sandte.
O König, da ist wahrlich niemand, der des Königs Wort
höher hält, als ich, dein treuester Diener. Was aber kann
ich dafür, wenn der Bär von den Bauern mißhandelt wird? Gefräßig ist
der Bär, und ich habe ihn ernstlich gewarnt; er aber wollte
nicht hören; — und so war es auch mit Hinze, dem
Kater.
Und so sprach Reineke immer. Wie viele der Feinde auch kamen und
gegen ihn auftraten, — er
wählte die Worte so wohl, er sprach so frei, daß man
glauben mußte, er wäre ganz schuldlos und jene
wären die Schuldigen.
Zuletzt aber kamen ehrbare Männer, wohlbekannt; und ihr
Wort galt viel — gegen diese konnte Reineke nicht
sprechen, und der König fällte das Urteil:
Reineke Fuchs soll sterben. Bindet ihn und führet ihn hinaus
zu dem Galgen.
Als Reinekens Freunde dieses hörten, waren alle von Herzen
betrübt und verließen
unwillig den Hof des Königs. Nobel aber sah es nicht gern,
daß so viele edle Männer seinen Hof verließen.
Reineke aber hatte nur wenig Mut; und als er gebunden unter dem
Galgen stand, dachte er: Wenn der König mir nur noch einmal
erlauben wollte zu sprechen, so hätte ich noch Hoffnung, mein
Leben zu erhalten.
Und er drehte sich nun zu dem Volke, das gekommen war, sein Ende
zu sehen. Und er sprach zum König, der finster
da saß neben seiner Gemahlin. Auf diese besonders blickte der
Schlaue, denn er kannte ihr weiches Herz, und
sprach:
Nur noch einmal, o König, gebet mir das Wort, bevor ich
diese schöne Erde verlasse. Meine Sünden will ich offen
bekennen, daß alle es hören zur
Warnung.
Als die Königin diese kläglichen Worte vernahm, sah
sie mit bittenden Augen den König an, und dieser sagte: Wohlan
denn, so sprich!
Da wurde Reinekens Seele viel leichter und er begann:
Vor euch allen hier bekenne ich es offen: Ich habe viel und
schwer gesündigt im Leben. Jung hatte ich begonnen zu stehlen
und zu rauben unter den Hühnern und Gänsen und
Lämmern und Ziegen. Aber da ich später ein Freund des
Wolfes wurde und er mich lehrte, so wurde ich viel schlimmer. Wenn
wir zusammen ausgingen auf Raub und Mord, nahm er immer das
Größte für sich und oft alles; und ich hätte
hungern müssen, wenn ich nicht einen Schatz für mich
vergraben hätte.
Einen Schatz? unterbrach ihn der König. Sprachst du von
einem Schatz?
Ich sprach von einem Schatz. So viel rotes, scheinendes Gold
saht ihr nie zuvor. In vielen Wagen kann man es nicht bringen. Und
Edelsteine und Ringe und Ketten so
schön, wie sie die Königin wohl noch nie gesehen. Aber
was nützt
mir nun alles, da ich den Tod vor Augen sehe? — Mit dem
Schatze aber war es so: —
Mein Vater war, wie ihr alle wohl wisset, sehr schlau. —
Auf einer langen Reise hatte er den Schatz des Königs Emmrich
entdeckt. Aber er hatte wenig Freude daran, denn er hielt ihn
vergraben am heimlichen Orte. So aber habe ich selbst ihn
gefunden. Einst, in einer stürmischen Nacht, — der Regen
fiel in Strömen, der Donner rollte und Blitz auf Blitz zuckte,
— da sah ich meinen Vater spät aus seinem Hause kommen
und scheu sich umsehen nach allen Seiten. — Mich aber hatte
er nicht gesehen; denn ich war versteckt. Ich wunderte
mich, ihn so spät und in solchem Wetter ausgehen zu sehen und
folgte ihm.
Der Weg war lang; bergauf und bergab. — Endlich machte
mein Vater Halt, sah sich noch einmal um; und da er niemand
bemerkte, scharrte er eine Öffnung in die Erde mit den Pfoten
und starrte lange hinein und freute sich sehr.
Da war ich sehr neugierig. Doch lag ich stille und rührte mich nicht. Lange
nachdem mein Vater wieder fort war, ging ich zum Baume und tat,
wie mein Vater zuvor. — O, Herrlicheres hatte ich niemals
gesehen an Reichtum! — Dieselbe Nacht und die folgenden
arbeitete ich schwer, das Gold zu entfernen.
Und wohl hatte ich daran getan, — das fand ich
später; denn ich rettete so euer Leben, o König.
Du lügst! schrie der König.
Wie könnte ich, sagte der Fuchs, wie könnte ich jetzt
lügen vor meinem Tode? Was würde es mir helfen? —
und dabei richtete der Arge die Augen zum Himmel.
Die Königin aber war ängstlich geworden, als sie das
hörte vom Leben ihres Königlichen Gemahls, und sie sagte
zum König: O, lasset ihn hierher kommen, daß wir näheres
hören und euch vielleicht vor Unglück bewahren.
Dessen freute sich der Fuchs von Herzen und auf den Wink des
Königs trat er herab vom Galgen und gerade
vor den König und die Königin und sprach weiter also:
Ja, ich folgte nun öfters dem Vater und sah ihn
einmal in eine geheime Versammlung gehen. Da waren Isegrimm, der
Wolf, Braun, der Bär, und viele andere Herren, die ich nicht
kannte. Sie alle sprachen sehr leise und mit vieler Mühe
verstand ich dieses: Eine Revolution wollten sie machen und den
Bären wollten sie zum Könige haben. Nach allen Landen
sandten sie Boten, Truppen zu sammeln; mit
dem Gelde meines Vaters wollte man sie bezahlen und er sollte der
erste Minister im Staate werden. —
Ich aber freute mich um meines guten Königs willen,
daß ich den Schatz entfernt hatte, denn die Soldaten wollten
den Gold im Voraus haben und wollten nicht kommen ohne
das Geld.
So konnten sie den bösen Plan in jener Zeit nicht ausführen. Ich aber habe den
Schatz noch heute und will ihn gern in eure Hände, mein
König, legen, daß ihr sehet, daß ihr an mir einen
treuen Diener hattet.
Die Königin, dieses hörend, war sehr gerührt. Sie
sah auf zu ihrem Gemahl, und dieser sagte mit ernstem Auge: Es
scheint, du sprichst jetzt die Wahrheit; ich glaube dir. Bindet
Braun, den Bären, und Isegrimm, den Wolf, und führt sie in das Gefängnis. Reineke
aber, den
Fuchs, machet frei; denn ich erkenne ihn als meinen treuesten
Diener.
Darüber freuten sich viele; und viele waren gar
traurig.
Isegrimm aber sagte zu Braun: Sieh', dieses Mal hat er wieder
gewonnen, der Falsche.
Der König aber rief Reineke zu sich und fragte ihn leise:
Wo, sagtest du, wäre der Schatz vergraben?
Und so antwortete Reineke: Höret, ich bitte, o König,
genau die Worte, die ich jetzt spreche, so daß ihr und eure
Gemahlin den Platz nicht vermisset, wo Gold und Juwelen begraben
liegen.
In Flandern ist eine Wüste. Dort ist ein Brunnen,
Krekelborn heißt er. An dem Brunnen gehet vorbei. Dann kommt
ihr an einen Busch. Auch an dem Busche gehet vorbei. Dann aber
kommt ihr an einen einsamen Ort. Weder
Menschen noch Tiere leben daselbst, nur die Eule allein haust[I-5] hier. Da
stehen zwei Birken. Da bleibet stehen;
denn ihr habt den rechten Ort gefunden. Unter den Wurzeln der
Bäume findet ihr, was euch erfreut. Ich selbst wollte mit euch
gehen. Doch, wißt ihr wohl, der Papst hat mich in den
Bann getan. Nun aber habe ich im Herzen
gelobt, nach Rom zu gehen als Pilger. Ich will
nun ein besseres Leben beginnen. Doch hier ist der Hase. Der kennt
den Platz. Wenn ihr befehlet, so rufe ich ihn.
Und der König sprach: Thue so. Und der Fuchs rief den
Hasen.
Zu Reineke selbst aber sagte der König: So gehe nach Rom
und komme befreit vom Banne zurück.
Reineke jauchzte von Herzen; denn
er war frei, seine Feinde aber lagen in Ketten.
Nach Rom ging er aber nicht, sondern eilte nach Malepartus und
preßte Weib und Kinder freudig ans Herz.
Herr Meister: Bravo, mein
Freund! Bravo!
Martha Meister: Das
erzählten Sie sehr gut, Herr Louis.
Bella: Das war sehr
schön, nicht wahr, Otto?
Otto: Ja, Louis; ich freue
mich auch über Dich. Du solltest Goethes[I-6]
Reineke Fuchs lesen. Da findest Du noch mehr.
Louis: So? — Ist es von
Goethe?[I-7]
Otto: Gewiß, Bruder.
Louis: Von Goethe[I-8]. —
Hm, — Goethe[I-9]
gefällt mir.
Bella: Mir gefällt er
auch.
Herr Meister: Wirklich?
Bella: Ich bin ganz erstaunt
über Louis.
Louis: Aber warum denn?
Bella: Sie sprechen ja ein
prachtvolles
Deutsch!
Louis: O, Fräulein Bella;
ist das Ihr Ernst?
Bella: Ja, ganz
gewiß.
Louis: Das freut mich
sehr.
Otto: Siehst Du, Louis? Herr
Meister hat Recht.
Louis: Ja, das ist wahr! Ihre
Hand, Herr Meister. Fräulein Bella, wollen Sie das auch an
Anna nach Cöln schreiben?
Bella: Das will ich sicherlich
tun, und wollen Sie auch oft zu uns kommen, ja?
Louis: Ja wohl, mein
Fräulein.
Bella: Und Ihren Bruder
mitbringen?
Louis: Ja, aber — Otto,
da habe ich ganz vergessen, daß Albert auf mich wartet. Wir
müssen nun gehen. Meine Damen, auf Wiedersehen! Adieu, Herr
Meister!
Martha Meister: Kommen Sie
recht bald wieder, meine Herren. Sie sind immer angenehm.
Otto: Danke Ihnen. Adieu,
Fräulein Bella.
Bella: Auf Wiedersehen!
Herr Meister: Adieu!

II.
Martha: Darf ich Papa? — Störe ich nicht?
Herr Meister: Komm', meine
Tochter, setze Dich!
Martha: Hast Du heute viel
geschrieben, Pa....?
Gretchen: Sie kommen!
Bella: — — sie
kommen!
Martha: Aber — wie Ihr
stürmt! Sie kommen! Sie kommen!
Wer kommt?
Bella: Jetzt sind sie auf der
Treppe;
jetzt — jetzt klopfen sie an.
Herr Meister: Herein!
Louis: Hier ist mein Bruder
Albert, der Doktor!
Otto: Erlauben Sie mir, Herr
Meister, Ihnen meinen Bruder vorzustellen: Herr Doktor Albert. —
Herr Meister, unser verehrter Freund! — Fräulein
Gretchen und Fräulein Martha, Herrn Meisters Töchter.
— Unsere Freundin, Fräulein Bella!
Dr. Albert: Meine Herrschaften, ich bringe Ihnen Grüße aus
Deutschland; — so oft und so viel hat man mir von Ihnen
erzählt, daß Sie mir wie alte Bekannte erscheinen.
Martha: So dürfen wir
hoffen, daß Sie bald wieder heimisch bei uns werden?
Dr. Albert: Heimisch fühle ich mich
schon jetzt, mein Fräulein. — Martha, Schwesterchen,
willst Du nicht bei mir sitzen?
Martha Parks: Ach ja!
Gretchen: Bist Du froh,
daß Dein Bruder wieder bei Dir ist?
Martha Parks: O ja!
Bella: Herr Doktor, hatten Sie
eine gute Fahrt?
Dr. Albert: Ja, mein Fräulein ... Das
war eine prachtvolle Reise! Wir hatten klares Wetter, guten Wind,
aber auch ein wenig Sturm; und dann und wann einen herrlichen
Sonnen-Untergang; — vom Sonnen-Aufgang kann ich Ihnen wenig
sagen.
Bella: Ah, Reisen ist doch
schön!
Dr. Albert: Das ist es, mein
Fräulein.
Herr Meister: Und hat es Ihnen
gut gefallen in meinem Deutschland, Herr Doktor?
Dr. Albert: Sehr gut, mein Herr.
Glückliche Jahre habe ich dort verlebt. Deutschland ist mir
teuer geworden.
Martha Meister: Wie lange ist
es jetzt, Papa, daß Du nicht in Deutschland gewesen bist?
Herr Meister: Viele Jahre sind
verflossen, meine
Tochter, seitdem ich mein Vaterland zum letzten Male gesehen
habe.
Dr. Albert: Dann, mein Herr, sollten Sie
einmal gehen und es wieder sehen. — Das alte Deutschland, das
Sie einst verließen, werden Sie nicht
mehr finden;
— ein neues ist erstanden. Schön
war Deutschland ja immer und schön ist es noch heute. Aber zur
Schönheit ist nun auch die Macht gekommen, die Macht, welche
Barbarossa den deutschen Landen einst gewünscht.
Herr Meister: So lese ich, und
so sagt man mir. Doch scheint es mir selbst wie ein Wunder!
Dr. Albert: Das glaube ich Ihnen gerne,
mein Herr. Sie denken noch immer an die schöne Sage, die
Deutschland einst gedichtet hatte in seinem Unglück und in
seiner Hoffnung: Tief unter der Kyffhäuser-Burg sitzt Kaiser
Barbarossa. — Er sitzt sorgenvoll und schlummernd vor
einem Marmortische, den Kopf gestützt mit seiner Hand.
— Sein Bart wallt nieder
bis zur Erde und schlingt sich um den Tisch. — So sitzt er
schlummernd hundert Jahre. — Dann erhebt er traurig das Haupt
und spricht zum Zwerg: Fliegen
die Raben noch um den Berg? — Und der Zwerg geht und kommt
zurück und spricht: Die Raben fliegen noch um den Berg!
— Dann seufzt[II-1] der Kaiser
und schlummert wieder ein und schlummert noch hundert Jahre.
—
Aber heute, mein Herr, sitzet der Kaiser nicht mehr am
Marmortische; — er ist erwacht und emporgestiegen aus dem unterirdischen Schlosse.
Ich sah ihn selbst, den alten Kaiser mit schneeweißem
Haare; ich sah das Reich, das nun
wirklich einig und mächtig ist durch einen Mann — durch Bismarck.
Herr Meister: Ja, ja, so
ist's!
Dr. Albert: Ja, Herr Meister, das einige
Deutschland ist sein Werk. — Welch' ein Genius ist dieser
Bismarck! — Ich halte ihn für einen der
größten Männer, die jemals lebten; — denn
enorm ist es, was er vollbracht hat und staunenswert ist es, wie er's getan!
Mitten unter Feinden steht er, — gigantisch an Körper
und groß an Geist. — Die Herren der Länder
ringsum sind bereit zum Vernichten, sie
lauern nur auf den rechten Moment. — Und
die, für welche er kämpft, stehen mürrisch zu Seite, geben keine
hilfreiche Hand, nicht einen freundlichen Blick, rufen kein liebes
Wort. — Finster schauen sie ihn an und zeigen Haß, da
er Liebe bringt.
Bittend steht er unter ihnen, reicht ihnen einen Oliven-Zweig
und sagt: Meine Herren, diesen Zweig habe ich im Auslande
gebrochen, Ihnen denselben zu reichen als Zeichen des Friedens und
der Freundschaft, auf daß wir gemeinschaftlich das große Werk
beginnen und beenden.
Aber sie wollen nicht auf ihn hören und lassen ihn stehen.
Unverstanden und verkannt muß er den steilen Weg aufwärts klimmen, ganz allein
planend und übermenschlich schaffend. Wie groß, wie wahrhaft
groß er da unter den Menschen erscheint. — Im Herzen
aber hatte er Gott, der ihn kennt, und vor sich seinen König,
der ihm traut; er selbst aber glaubte an den Sieg des Guten und in
diesem Glauben fühlte er sich stark und groß. Fest und
sicher und schnell geht er vorwärts und unternahm jene gewaltige Operation — nun, Sie kennen
sie ja.
Herr Meister: Ja, ja, wir
kennen sie! Aus jenem Deutschland, das einst zerstückt und bald den Nachbarn
zugefallen wäre als willkommene Beute; aus dem Deutschland,
das kraftlos und ein Spott der Welt geworden war,
aus diesem unglücklichen Deutschland hat er ein einiges Reich
geschaffen, das wieder stark ist, wie ehemals; den Deutschen gab er wieder ein
großes Vaterland und pflanzte in sie
einen höhern Sinn.
Dr. Albert: Und das konnte Bismarck nur
tun, weil er groß ist. — Weil er selbst groß ist
und gut, zieht er Tausende mit sich auf eine bessere Höhe.
Aber, mein Herr, ich sage noch mehr: Deutschland ist ein
deutsches Land geworden zuerst durch Bismarck. — Er hat
vollendet, was Arminius einst begonnen hatte: — Das Werk der
Einheit und Freiheit. — Aber dieses Werk hatte geruht viele
hundert Jahre, hatte geruht im ganzen Mittelalter, denn was war das
Deutschland des Mittelalters, das sich so gern
das heilige römische Reich nannte? — Es war kein
deutsches Land mit deutschem Geiste, —
es war eine schwache Nachahmung des alten römischen Reiches,
nichts mehr.
Aber solche wunderbare Macht besaß einst Rom, daß
noch der große Kaiser Karl und alle Kaiser nach ihm nichts
Höheres kannten, als den Titel »Kaiser von
Rom.«
Wie der liebliche Schmetterling in die glänzende
Flamme und ins
Verderben flattert, so zogen die
deutschen Kaiser zu ihrem eignen Unglück nach Rom. Mancher
starke Mann fand den Tod in Roms Gefilden.
Während England durch die schirmenden Wogen des deutschen
Oceans geschützt war und frei und
groß und stark wurde, — und während Frankreich
lieblich und eins wurde, richteten die deutschen Kaiser ihre Augen
auf fremde Länder, auf Böhmen, Italien, Sicilien,
Spanien. — Darum hatten Deutschlands Söhne fremde Kriege
zu kämpfen auf ihrem eignen Boden.
Deutschlands blühende Fluren
wurden zerstampft von den Hufen der Kriegsrosse; und Deutschlands Dörfer
und Städte wurden niedergebrannt von wilden,
fremdländischen Horden, und die Wohlfahrt
wurde vernichtet.
Das Unglück war groß. — Da erbarmte sich Gott des geliebten Landes und
sandte ihm die Männer vom Hause Hohenzollern.
Herr Meister: Es sind
Männer voll Kraft und Tugend, die
von Hohenzollern.
Dr. Albert: So ist es, mein Herr. Klug und
stark waren die meisten von ihnen — und sie erkannten ihre
Mission. — Mit Energie, mit Kraft und gutem Willen zog der
erste Hohenzoller, Burggraf Friedrich von Nürnberg,
in Brandenburg ein.
Wie die Raubvögel aus
ihren Nestern aufflattern, so verschwanden die Raubritter aus
den Burgen, als sie den Donner seiner ersten Kanone
hörten.
Sie raubten und plünderten nicht mehr und
störten nicht mehr friedliche Leute bei ihrer Arbeit. Eine
neue Ära begann, und in jener unfruchtbaren, sandigen Fläche
im Norden Deutschlands, wo jener erste Friedrich klein begonnen
hatte, da erhebt sich heute eine Stadt mit einer Million
fleißiger Einwohner, ein Centrum für Kunst und Wissenschaft, — das Haupt des
deutschen Reiches, — Berlin.
Was jener Burg-Graf einst begonnen, was der große
Kurfürst und Friedrich der Große fortgesetzt hatten, das
hat Kaiser Wilhelm vollendet — durch Bismarck.
Martha Meister: Ich denke es
mir so schön, Kaiser Wilhelm und Bismarck, — den
ehrwürdigen Monarchen und den mächtigen Denker und
Schöpfer zu sehen.
Gretchen: Und ich denke: Es
ist merkwürdig, daß Deutschlands Größen immer
in Paaren erscheinen; in Wissenschaft und Politik, in Poesie und
Musik. — Goethe[II-2] und
Schiller; Alexander und Wilhelm von Humboldt; Haydn und Mozart;
Jakob und Wilhelm Grimm; Kaiser Wilhelm und Bismarck.
Bella: Du hast ganz Recht,
Gretchen; es ist wirklich wahr.
Dr. Albert: Deutschland hat Glück
darin; und da es unter den Ländern Europas wieder begonnen hat
mit neuer Jugend, so will ich ihm aus vollem Herzen eine
glückliche Zukunft
wünschen.
Bella: Herr Doktor, Sie sind
wohl ganz ein Deutscher geworden?
Martha Parks: Was? —
Albert, bist Du nicht mehr Amerikaner?
Dr. Albert: Ha, ha! — Sehen Sie doch,
Herr Meister, das ist Eifersucht! —
Habe ich Deutschland zu viel gepriesen? —
Was sehen Sie mich alle so an, als wäre ich ein Verräter? — Welchem Lande
ich angehöre mit meinem Herzen? — Sie können es
wissen; ich bin furchtlos und offen.
Alle: Nun?
Dr. Albert: Dem Lande gehöre ich an,
das am größten ist und am schönsten unter allen
Ländern der Erde; das die größten, mächtigsten
Ströme hat und Seen; — dessen Berge sich himmelhoch
türmen; das die fruchtbarsten Äcker, die fruchtbarsten
Bäume, die goldreichsten Minen hat und Menschen, wie sie
besser und größer auf Erden nicht sind und niemals
waren; — dem Lande, das die Unglücklichen empfängt
aus allen Teilen der Erde Gottes und mit freundlichem Auge sie
anschaut und mit gütiger Hand ihnen winkt und dann
fröhlich zuruft: Kommet alle und seid willkommen und genießet die Freiheit; —
wir wollen mit Euch teilen dieses Land und alles, was Gott uns
selbst gegeben hat; So ihr lebet und seid, wie wir selbst, und
werden wollet, wie wir: freie, gute Menschen; — das ist mein
Land; dem gehöre ich an.
Alle: Das ist Amerika!
Dr. Albert: Da ist mein Vaterland!
Louis: Hurrah!
Dr. Albert: Wo das Sternenbanner weht!
Louis: Hurrah! Hurrah!
Dr. Albert: Unser Amerika ist heute schon
das Land der Freiheit; und bald wird es das Land der Kunst und
Wissenschaft, — die Heimat alles Guten sein.
Louis: Ist das Dein Ernst,
Albert?
Dr. Albert: Würde ich so sagen, wenn
es nicht mein Ernst wäre?
Wo ist ein Land auf der weiten Erde, das besser zum
Größten geeignet wäre, als
Amerika?
Sieh' einmal hinüber in den Kontinent, den wir den
Kontinent der Kultur zu nennen pflegen! Wirf nur einmal einen Blick nach
Europa!
Viele Völker, mit verschiedenen Sitten,
verschiedenen Charakteren, verschiedenen Sprachen haben sich
geteilt in die Länder; — und jedes Land hat seine
eigenen Interessen und ist darum der natürliche Feind des
Nachbarn.
Und nun sieh' Dich um in unserm Lande, das größer
ist, als alle Länder Europas zusammen; — das sich
streckt zwischen zwei großen Meeren.
Vom Atlantischen Ocean bis zum Stillen Ocean wohnt nur ein Volk,
das nur eine Sprache spricht, das nur ein Interesse hat, —
den Wunsch, die Bürger des Landes zu beglücken! —
Kannst Du ein anderes Land der Erde nennen, das geeigneter ist,
eine Heimat des Guten und Schönen zu sein?
Auch Länder werden alt, mein lieber Louis, so gut, wie die
Menschen, und eben so gut, wie ein Mensch dem andern seinen
Reichtum vererbt und seine Kenntnisse, so muß
ein Land dem andern, — so muß Europa uns seine besten
Errungenschaften überlassen.
Otto: Damit werden aber die
Europäer nicht zufrieden sein, Albert!
Dr. Albert: Das, mein Lieber, wird die
Sache nicht ändern. Die Völker haben
selbst keinen Willen in der Geschichte; — sie folgen der Leitung
eines höheren, weisen Willens.
Hast Du nie das Werk eines Gärtners beobachtet? — In seinem Treibhause erzieht der Gärtner den
Samen und die zarten
Pflänzchen. — Aber diese pflanzt er später in den
großen Garten, wo sie kräftiger werden und
nützlicher, wo sie Früchte tragen.
Europa ist das Treibhaus Amerikas. — Alles, was Europa
gesäet und gezogen zu allen Zeiten, das wird nun nach Amerika
verpflanzt zum Heile aller.
Es ist Plan in der Geschichte. — Die Geschichte ist
philosophisch; — aber man muß sie auch mit einem
philosophischen Auge studieren.
Alles, was Ägypter, Griechen, Römer und Juden getan,
taten sie für uns. — Diese Völker sind untergegangen, wir
leben.
Die Griechen verehrten die Schönheit. Aber was ist die
Schönheit allein ohne die Wahrheit? —
Die ewigen
Wahrheiten aber des alten Testamentes, — die Existenz eines
unsichtbaren Gottes
wurde von den Juden gelehrt, und dann endlich war die Zeit
gekommen, — und es erschien den Menschen der Heiland, ein
Erlöser vom Übel, ein Verkünder der unendlichen Liebe. — Und viele
Völker hatten es gehört mit Staunen. — Neues Leben
war überall erstanden. — Die Lehre des
Christentums wurde überall verbreitet, die Lehre der ewigen
Liebe.
Jahrhunderte vergingen. — Da zogen
Tausende und Tausende zum heiligen Grabe und opferten den Tribut der Dankbarkeit.
Und sie kamen zurück aus dem Morgenlande nach Europa. —
Da genügte ihnen Europa nicht mehr.
— Und die Völker waren nun reif; — und es war nun
Zeit, der Menschheit das Schönste zu geben.
Und Gott gab der Menschheit das Schönste an jenem Morgen,
da die Sonne vor Columbus' Augen auf ein goldenes Eiland schien;
als die wilden Matrosen mit Thränen in den Augen riefen: Land!
Land!
Martha Parks: Unser Land!
Otto: Ja, Martha, unser Land!
Das Land der Zukunft.
Dr. Albert: Glaubst du nun an die Mission
Amerikas, Freund Louis?
Louis: Ich muß wohl!
Dr. Albert: Und weißt du auch, wer
mich zuerst das gelehrt hat? — Ein Mann, der es selbst nicht
einmal
wußte, der es aber fühlte, — der Komponist
Rubinstein.
Ich hörte »Der Turm von Babel,« kurz bevor ich
Deutschland verließ. — Der Herr hatte den Turm
zerstört und die Sprachen der Menschen verwirrt. — Da
ziehen die verschiedenen Nationen nach den verschiedenen Erdteilen: Die Semiten nach
Asien, die Hamiten nach Afrika, die Jafetiten nach Europa.
Auf ihrem Marsche singen sie Lieder. — Die Semiten singen
eine ernste, tiefe, melancholische Melodie; — die Hamiten
singen ein Lied, wobei man an nichts anderes denken kann, als an
den Trab der Kamele in Ägypten, — die Jafetiten aber
sangen eine wunderbar süße, schöne Melodie. —
Und nachdem die drei Märsche verklungen waren, da fuhr mir
urplötzlich der Gedanke durch den Kopf: Nun
sollte ein vierter Zug kommen und singen: Hail Columbia! —
Martha Meister: Oftmals habe
ich daran gedacht: Was Columbus wohl fühlte, da er zum ersten
Male den Fuß auf diesen Boden setzte?
Dr. Albert: Ich glaube, mein Fräulein,
ich hatte von einem solchen Gefühl vor wenigen Tagen eine
Ahnung, da ich selbst an's Land kam. Die Erde
hätte ich küssen mögen. — Der Himmel erschien
mir viel höher, als anderswo, und die Luft viel
kräftiger, und die Menschen viel lebendiger, energischer;
— sie gingen einher, wie anderswo die Könige tun, und sprechen und
blicken frei und tragen den Kopf so stolz.
O, rief ich einmal über das andere Mal aus: Das ist ein
großes, großes Land, — mein Vaterland — ah,
lächeln Sie nicht! — Es könnte Ihnen gehen, wie
mir: Ich stand mit Freunden in Neapel am Hafen, und, da es Sonntag war,
so hatten die Schiffe geflaggt. — Da kam ein Herr daher, und
jeder konnte es sehen, daß er ein Amerikaner war. — Er
erblickte am Maste unser Sternenbanner und nahm den Hut
von dem Kopfe und beugte sich ehrfurchtsvoll. Alle lächelten, ich
mit, — heute thäte ich's nicht. Hören Sie auch
dieses:
Es war meine erste Seefahrt, — meine Reise nach
Deutschland. — Viele Tage hatten wir nichts gesehen, als
Himmel und Wasser, und wir verlangten alle nach Land.
Morgen vielleicht, hatte der Kapitän abends bei Tische
gesagt, — morgen vielleicht sehen wir Land. —
Süße Hoffnung! — Sie ließ mich keine Ruhe
finden in der Nacht, und frühe am Morgen war ich bereits auf
dem Verdecke.
Sie sind frühe auf, junger Mann, — sprach einer der
Offiziere zu mir.
Bin ich der erste? fragte ich.
Von den Passagieren — ja.
Kein Land in Sicht? fragte ich wieder.
Noch nicht, mein Herr. Sehen Sie dort, wie die Sonne herauf aus
dem Wasser steigt? — Ah, — sehen Sie jenen Streifen am fernen
Horizont? — Das ist Irland!
Und ich stürmte die Treppe hinab und rief in die
Kajüte: Land! Land!
In wenigen Minuten war es belebt auf dem Verdecke; — und
alle fragten durch einander: Wo ist das Land? — und sahen mit
müden Augen über das Meer und sagten: Ich kann nichts
sehen! — und andere riefen: o ja, wirklich, da ist es! Sehen
Sie nicht, dort? Land! Land!
Da hörte ich hinter mir ein Schluchzen; ich drehte mich um. Eine Frau
stand da. — Sie betete und Thränen rollten ihr die
Wangen herab, — es waren Freudenthränen.
O, Irland! Altes, teures Irland, sehe ich dich wieder? —
und dann sprach sie lauter:
Seht doch, wie schön es ist! Wie lieblich die Sonne seine
grünen Berge bescheint! — Armes, altes Irland! Viel
Gutes hat es getan für England in der alten Zeit der
Römer. — Aber England hat heut alles vergessen und ist
undankbar.
Manche lächelten, als sie dieses hörten. Ich vermochte es nicht.
Jahre waren vergangen, und ich hatte die Frau vergessen. —
Und wieder war ich zur See und segelte heimwärts; — und
kürzer und kürzer wurde der Raum, der mich trennte von meinem Vaterlande.
Da gedachte ich wieder der Frau und ihrer Liebe zu ihrem Vaterlande;
— und als ich den ersten Streifen amerikanischen Landes sah,
als ich den herrlichen Hafen von New York sah, da fühlte ich
tief, wie jene Frau: — es war die Liebe zum Vaterlande:
Ich soll das Glück in meiner Heimat
finden,
Hier, wo der Knabe fröhlich aufgeblüht,
Wo tausend Freudespuren mich umgeben,
Wo alle Quellen mir und Bäume leben —
Ach, wohl hab' ich es stets geliebt. Ich fühlte:
Es fehlte mir zu jedem Glück der Erde.
Martha Meister: Herr Doktor,
Sie denken in vielen Dingen, wie Papa.
Dr. Albert: Das ist mir lieb, von Ihnen,
mein Fräulein, zu hören.
Gretchen: Ja, das ist auch
wahr, Martha. — Papa äußerte
kürzlich ähnliche Gedanken, als wir
über Fiesko sprachen.
Otto: Fiesko von Schiller?
Gretchen: Ja wohl, Herr Otto.
— Ach, Papa, sprich ein paar Worte über Fiesko. —
Die jungen Herren hören so etwas gerne; — und wir auch,
nicht wahr, Martha?
Martha Meister: Bitte, lieber
Papa.
Herr Meister: Mit
Vergnügen, meine Freunde:
Genua war einst eine Republik und Andreas Doria war Doge.
Er war gerecht gegen alle; daher
liebte man ihn. — Aber anders war es mit seinem Neffen. — Er
war tyrannisch und man begann ihn zu fürchten.
Aber im Stillen war bereits eine Verschwörung gegen
Doria und sein Haus entstanden; und das Haupt der Verschwörung
war Graf Fiesko.
In der Nacht vor dem Ausbruche der Verschwörung aber konnte
Fiesko keinen Schlaf finden; — und unruhig ging er auf dem
Balkon seines Palastes auf und ab, mit sich redend:
Da liegt es vor mir, Genua, die Königin des Meeres, vom
Monde beschienen. — Sein Schicksal liegt in
meiner Hand. — Noch kann ich's wenden, wie
ich will. Genua eine Republik oder Monarchie; Republikaner Fiesko
oder König Fiesko.
Und die beiden Engel, der böse und der gute, ringen
gewaltig in ihm.
Der gute Engel siegte — einen Moment nur; dann aber ward
der böse Engel Herr.
Mehr, meine Freunde, will ich nicht erzählen vom Drama.
— Aber das genügt für Sie, eine wunderbare Gabe
dieses großen Poeten zu erkennen.
Mit seinem Seherblick schaute
er wie ein Prophet in die Zukunft und schilderte Jahre voraus, was später in
Wirklichkeit
kam:
In zwei Republiken waren zwei Helden,:
Washington und Napoleon. — An beide Helden traten die beiden
Engel heran: der böse und der gute. In Napoleon siegte der
böse Engel, in Washington der gute.
Napoleon machte sich zum Monarchen und wurde zum Tyrannen.
— Washington aber rief: Freiheit für alle! Unter freien
Bürgern will ich der erste sein, nichts mehr!
Wo finden Sie die Größe eines Washington wieder? Ist
es nicht groß, eine Krone zu verschmähen und einen
Thron?
Otto: Ja, wahrlich, das ist
es. — Napoleon muß ich bewundern und achten;
Bismarck muß ich bewundern und achten; — aber unsern
Washington muß ich bewundern, verehren und lieben.
Martha Parks: Ja, das thue ich
auch, Otto!
Dr. Albert: Und daran thust Du auch ganz
recht, mein Schwesterchen.
Otto: In Europa denkt und
dichtet man viel über die Freiheit; wir aber denken und
dichten und halten die Freiheit.
Bella: Aber Schiller ist doch
wohl ein großer Poet, nicht wahr? —
Dr. Albert: Ja, mein Fräulein, der
Sänger der Freiheit.
Bella: Sein Drama
»Wilhelm Tell« ist sehr schön. Ich habe es zweimal
gelesen.
Otto: Und haben Sie »Die
Räuber« auch gelesen?
Bella: Die Räuber?
— Nein.
Dr. Albert: Das ist ein Stück für
Dich, Louis.
Louis: Ich möchte es
hören, Albert.
Dr. Albert: Otto, Du hast es gelesen.
Willst Du es
nicht erzählen? — Das heißt, wenn es den
Herrschaften angenehm ist.
Herr Meister: O, sicherlich.
Wir hören mit Vergnügen zu. Beginnen
Sie, Otto.
Der alte Graf von Moor hatte zwei Söhne, Karl und Franz von
Moor. Am meisten liebte er Karl, den ältesten, und ihm
gedachte er auch seinen ganzen Reichtum zu geben, —
Schloß und Land und alles. Daher kam es, daß der
jüngere neidisch wurde und lange hin und her dachte,
wie er alles aus den Händen des Bruders an sich reißen könnte, und so ging
er eines Tages mit einem Briefe, welchen er selbst geschrieben
hatte, zum Vater und begann: Mein Vater, ich habe wieder einen
Brief erhalten aus Leipzig, ein Freund schreibt mir über Karl,
es ist gar Übles; wollt ihr es hören?
Und der alte Vater sprach: Über meinen geliebten Sohn
schreibt er? Lies es; was es auch sei, ich will es hören.
Nun las Franz dem unglücklichen Vater vor, was er
Schlechtes ersonnen hatte. Des Vaters
Auge füllte sich mit Thränen, und einmal nach dem andern
rief er aus: O mein Sohn, warum kommst du nicht zurück zu mir
an mein väterliches Herz und wirst wie ehemals ein guter, braver Mensch. Schreibe ihm
das, Franz, schreibe es ihm.
Karl von Moor studierte auf der Universität zu Leipzig.
Eines Tages, da er in seinem liebsten Buche, in Plutarch, gelesen und voll
Begeisterung ausgerufen hatte: Ja, das
waren Männer und große Zeiten! da sprach Spiegelberg,
ein Kamerad, zu ihm: Was hindert uns denn, Großes zu tun?
Komm, Moor, laß uns Räuber werden! — Karl aber
sprach: Findest du Freude an dem Galgen, Mensch, so gehe nur.
Mehrere Studenten kamen jetzt lärmend und singend zu ihm,
und einer von ihnen brachte für Karl von Moor einen Brief. Wie
aber waren alle erstaunt, da sie sahen, daß Karl den Brief,
den er mit Freude empfangen und geöffnet hatte, voll Zorn zur
Erde warf und dann selbst hinaus zur Thüre rannte. Man
fürchtete Unglück und nahm den Brief vom Boden und las
das Folgende:
»Unglücklicher Bruder! Der Vater sagt, daß ich
dir schreibe, er fluche dir und
enterbe dich und befehle
dir, niemals wieder vor sein Angesicht zu kommen, denn er mag den Sohn
nicht sehen, der seinem Namen und seiner Familie Schande bringt.
Dein trauriger
Bruder Franz.«
Bald kam Karl zurück. Er trat in ihre Mitte und sprach dann
mit lauter Stimme: Freunde, Kameraden, was für eine Welt ist
das, in der wir leben, das Gute und das Große ist nirgends
mehr, nur das Schlechte und das Gemeine ist überall. Seht: ich
hatte einen Vater, den ich liebte und der mir teuer war, und noch
vor wenigen Tagen schrieb ich ihm und bat ihn, mir mein Unrecht zu
vergeben; ah, ich hatte ihn gebeten mit Worten, die einen Stein
erweicht hätten, — aber des Vaters Herz blieb hart. Seht,
Freunde, so ist mein eigner Vater, so und noch schlimmer sind die
Menschen alle in diesen Tagen. Die Menschheit ist zu tief gesunken,
wir wollen sie heben und das Schlechte und die
Tyrannei wollen wir vernichten. Wer von euch steht mir bei? wer von
euch hat den Mut, Tod und Untergang zu schwören aller
Tyrannei?
Wir alle stehn dir bei und schwören! riefen sie.
Wohlan, so laßt uns Räuber werden!
Und alle schrien: So laßt uns Räuber werden, und Karl
von Moor sei Hauptmann!
Franz aber verfolgte seinen teuflischen Plan. Ein Mann, den er
selbst geschickt hatte, kam eines Tages zum alten
Grafen Moor und sagte, daß er ein Kamerad seines Sohnes Karl
gewesen sei und daß er nun komme, um dem Vater seines Sohnes
Tod mitzuteilen. Der alte Vater hörte und
glaubte es und wurde so unglücklich und so krank, daß
man sein nahes Ende befürchtete. Seine Nichte Amalie war bei
ihm und trauerte mit ihm; denn sie liebte Karl und sie las laut aus
der Bibel die Geschichte Jakobs und Josephs vor, und als sie an
Jakobs Worte kam: Mein graues Haupt wird mit Kummer in die Grube fahren
— da fiel der unglückliche Mann wie leblos zurück
und Amalie[II-3] schrie auf:
Er stirbt, er stirbt! und alle dachten der Graf von Moor sei tot
und jetzt wäre Franz Herr im Schlosse.
Karl von Moor befand sich jetzt an der
Spitze einer großen Räuber-Bande in den
böhmischen Wäldern. Er war zum Schrecken aller Tyrannen, aller Reichen und
aller großen Herren geworden, welche Übles taten,
— den Armen, den Schwachen und den Bedrückten aber gab und half
er. Eine neue Ordnung der Dinge wollte er schaffen und allen Menschen wollte er gleiche
Rechte geben. Seine Ideen erfüllten seine Leute mit
Begeisterung, und sie kämpften so mutig, daß sie immer
siegten gegen des Königs Soldaten.
Es war am Abend nach einer solchen Schlacht, als Karl von Moor allein im Walde
unter den Bäumen ruhte, daß er recht traurig wurde, da
er über sein Leben nachdachte. Er hatte Glück verbreiten wollen
— und bis heute hatte er es nur vernichtet. Städte hatte
er durch Feuer zerstört, Saaten und Felder hatte er in den
Schlachten zerstampft und dann — o, wie das Wimmern und
Klagen der Witwen und Waisen in
seinen Ohren ertönte! Ah, zu spät mußte er lernen,
daß er einst zu schnell gehandelt hatte; zu spät
mußte er sehen, daß es nicht eines Menschen Werk sei,
für alle zu sorgen, daß Gott allein in seiner
Allweisheit, in seiner Allmacht und in seiner Allgüte dieses
vermag. O, wie wünschte er seine
Jugend-Jahre zurück; o, wie wünschte er sein Leben noch
einmal beginnen zu können, — aber es war zu spät.
— Er wurde unterbrochen in seinen Gedanken, denn die
Räuber führten einen Jüngling zu ihm. Karl
betrachtete ihn lange, dann sprach er: Freund, mir scheint,
daß ihr nobel seid. Ihr gefallt mir, darum sage ich euch:
Haltet euch fern von uns, kehrt zurück zu den Menschen, da eure
Hände noch rein sind vom Blute.
Der Jüngling aber sprach: Ich bin ein böhmischer
Edelmann und hatte reiche Ländereien und schöne
Schlösser und, um mein Glück voll zu machen, ein
Mädchen, das mich liebte, und in wenigen Tagen sollte sie mein
Weib sein. Da ließ mich der Fürst des Landes in das
Gefängnis werfen — ich hatte kein Unrecht begangen — und endlich, da man mich nach
Monaten wieder frei machte, fand ich meine Braut nicht mehr. Der
Fürst hatte ihr gedroht, daß ich sterben müsse,
wenn sie nicht sein werden wolle; und sie, die Unglückliche,
hatte sich selbst geopfert, um mein Leben zu retten. Auch meine
Güter hat man mir geraubt. Nun sagt, Herr Graf von Moor, was
bleibt mir, als der Kampf um mein Recht? Laßt mich bei euch,
einen Unglücklichen bei den Unglücklichen, denn auch ihr
seid nicht glücklich, wie ich sehe. Und Moor sprach: Du magst
bleiben.
Durch diese Erzählung aber war in Moor wieder der Wunsch
erwacht, seine Heimat und seine Geliebte zu sehen, und er befahl:
Auf, auf nach Franken!
Franz hatte nun alles erreicht, er hatte Reichtum und Herrschaft
— aber er war unglücklich, denn ihm fehlte die Ruhe im
Innern. Mit bösen Gedanken hatte er begonnen und zu bösen
Taten war er gekommen und tiefer und tiefer war er gesunken, so
daß die Menschen ihn haßten und fürchteten, gleich
wie er sie. Ein fremder Graf war in das Schloß gekommen.
Niemand kannte
ihn, aber Franz von Moor fürchtete ihn mehr als einen andern
Menschen. Amalie aber mußte immer an Karl denken, sie
wußte nicht warum; und da sie in dem Garten saß und zu
ihrer Laute das Lied sang, welches
Karl einst so liebte, hörte sie vom andern Ende des Gartens
dieselben Worte und dieselbe Melodie. Sie wußte nun, wer der
fremde Graf war.
Es war Nacht geworden, und Karl von Moor war wieder
zurückgegangen in den Wald. Da sah er beim Mondenschein
einen Mann an einen alten Turm gehen und er hörte auch
Töne aus dem Innern des Turmes. — In diesem Umstande vermutete[II-4] er
ein Geheimnis. — Leise trat Moor hinzu,
packte den Mann und sprach: Wer bist du und was thust du hier?
Erbarmen, rief jener,
Erbarmen, ich bringe Brot für einen Unglücklichen, der
hier im Turme hungert. Mit seinem Schwerte öffnete Karl die
Thüre, und aus der Tiefe des Turmes kam langsam und scheu, die
Hände ringend und Erbarmen, Erbarmen! rufend, eine Figur. War
es ein lebender Mensch, war es ein Skelett? Karl von Moor erkannte
in dem alten Manne mit den langen, schneeweißen Haaren seinen
eignen Vater!
Jetzt verstand Karl alles, sein Feind war auch seines Vaters
Feind, des Vaters Unglück und sein eignes kam von einem
allein. Und er rief seine Räuber und sprach:
Freunde, noch eins tut für mich, und dann will ich nichts
mehr von euch bitten: Bringet hierher vor mich Franz von Moor!
Diese Nacht aber war wieder eine der schrecklichsten gewesen,
wie sie Franz von Moor so oft erlebt hatte: er konnte nicht
schlafen, denn er mußte an seine Sünden denken, und wenn
er endlich eingeschlafen war, so hatte er die fürchterlichsten
Träume, und so groß war seine Angst, daß er nicht allein sein wollte,
daß seine Diener an seinem Bette wachen mußten. Nach
langer Zeit zum ersten Male sandte er wieder in dieser Nacht zum
Pastor; nach langer Zeit zum ersten Mal wollte er wieder beten und
er begann:
Höre mich beten, Gott im Himmel, es ist das erste Mal, soll
auch gewiß nimmer geschehen. Erhöre mich, Gott im
Himmel! — Franz hatte das Beten verlernt, und seine Angst und
seine Verzweiflung war endlos. Als die Räuber in das
Schloß stürmten, fanden sie Franz leblos auf der Erde
— er erwachte nie mehr.
Amalie hatte überall im Garten ihren Geliebten gesucht. Er
war geflohen, sie folgte ihm in den Wald, sie sah
ihn und das waren nach langer, langer Zeit die ersten und letzten
Momente des Glückes.
Louis: Und wie war das
Ende?
Otto: Das möchte ich Dir
nicht sagen.
Louis: Aber das ist recht
schlecht von Dir, Otto!
Dr. Albert: Dafür werde ich Dir ein
Lied vorsingen aus den »Räubern«. —
Fräulein Martha Meister, wollen Sie mich nicht begleiten?
Martha Meister: Sehr gerne,
Herr Doktor.
Dr. Albert (singt):
Ein freies Leben führen wir,
Ein Leben voller Wonne;
Der Wald ist unser Nachtquartier,
Bei Sturm und Wind hantieren wir;
Der Mond ist unsre Sonne.
Louis: Das gefällt mir,
Albert. Nun erzähle mir noch ein wenig von Bismarck.
Dr. Albert: Auf der Universität in
Berlin studierte ein junger Schwede. Dieser erhielt eines Tages
einen Brief von seinem Onkel. Der Onkel schrieb: Mein lieber Neffe!
— Deine Cousine, meine Tochter, reist nach Ems in's Bad. In
Berlin möchte sie einige Tage rasten und zugleich Berlin
sehen. Willst du nicht die Güte haben, deine Cousine an der
Post abzuholen und ihr Berlin
zu zeigen u.s.w.
Die junge Dame kam an. Da stand der junge Mann mit einer Rose im
Knopfloch.
Er
begleitete sie in das Hotel.
Am nächsten Morgen kam er mit einer feinen Equipage und
zeigte der Dame Berlin und so tat er am zweiten und am dritten
Tage.
Die Dame war glücklich über ihren galanten und
aufmerksamen Vetter.
Am vierten Morgen begleitete er sie zurück zum Postwagen. Und die Dame
saß schon, da sagte der junge Mann:
Cousine, ich kann Sie nicht abreisen lassen, ohne Ihnen ein
Geständnis zu machen.
Die junge Dame errötete und schlug die Augen nieder.
Ich muß Ihnen sagen, sprach der junge Mann weiter,
daß ich — nicht ihr Cousin bin. Ihr Cousin ist mein
Freund. Er hatte keine Zeit mit Ihnen zu gehen, weil er ein Examen
zu machen hat; darum bat er mich, es zu tun.
Aber, mein Gott, wer sind Sie denn? rief die Dame.
Der junge Mann gab ihr seine Karte. Der Postillon bließ
seine Trompete, der Postwagen rollte fort, und die junge
Dame las auf der Karte — Otto von Bismarck.
Seitdem waren Jahre verflossen. — Aus dem jungen Bismarck
wurde der alte, weltberühmte Bismarck, der in der Wilhelmsstraße in Berlin
wohnt.
Da hielt eines Tages eine Equipage vor Bismarcks Palast, und
eine alte, elegante Dame stieg aus, sandte ihre Karte zu dem
mächtigen Kanzler des deutschen Reiches und bald stand sie vor
ihm und sprach:
Als Eure Excellenz mich zuletzt sahen, war ich noch jung. Eure
Excellenz sind seitdem groß und berühmt geworden und haben mich
sicherlich vergessen. Ich hatte einst die Ehre, an ihrem Arme
Berlin zu besichtigen.
Ah, rief Bismarck, ich erinnere mich dessen
sehr wohl und bin Ihnen, Madame, zu großem
Danke verpflichtet. Mein Leben war immer so voll Arbeit,
daß ich nur einmal das Museum in Berlin sehen konnte, und das
war mit Ihnen zu jener Zeit. — Aber nun erlauben Sie mir, Sie
einzuführen in meine Familie. —
Glückliche Stunden folgten darauf.
Martha Meister: Was mir an
Bismarck so wohl gefällt, das ist ein Dreifaches: Seine warme
Liebe zur Familie, zur Religion und zur Natur.
Dr. Albert: Da haben Sie auch ganz Recht,
mein Fräulein. — Ah, ich sehe, Louis ist noch nicht
zufrieden.
Bismarck war Offizier geworden und mit seinen Kameraden stand er
einst vor einem Wasser. Da hörten sie: Hilfe! Hilfe! aus dem
Wasser. — Zuerst von allen sprang Bismarck in die Tiefe,
tauchte unter und rettete mit Not das Leben seines Dieners.
Dafür gab ihm der König eine Rettungs-Medaille, und
das war Bismarcks erster Orden.
Und einst war Bismarck in Wien auf einem Diner der Diplomaten.
— Ah, wie da alles glitzerte und glänzte von Orden und
Sternen in Gold und Silber — und Bismarck hatte nichts, als
jene Rettungs-Medaille.
Bismarck vis-à-vis saß ein gewaltiger Politiker Österreichs, dessen
Brust nicht breit genug war für alle Orden, die er hatte.
Ei, Herr von Bismarck, was für einen Orden haben Sie denn
da? fragte er sarkastisch.
Das ist eine Rettungs-Medaille, sagte Bismarck
gleichgültig; — es ist meine Gewohnheit, zuweilen einem Menschen das Leben
zu retten.
Jahre vergingen, und auch Bismarck wurde groß; auch Bismarck erhielt
Orden, mehr, als er tragen konnte, und er war schon viel
größer, als der sarkastische Diplomat von
Österreich.
Und wieder war er mit ihm auf einem Diner, und saß ihm
gegenüber. Und wieder glitzerte des andern Brust von den
vielen Sternen und wieder hatte Bismarck nichts als die
Rettungs-Medaille; alle andern hatte er zu Hause gelassen.
Ei, sagte dieses Mal Bismarck, — ei, Excellenz, welche
Orden haben Sie denn da?
Und die Excellenz zählte die Orden an den Fingern; —
sie hatte nicht Finger genug!
Oh, sagte Bismarck, alle diese Orden habe ich auch. Aber haben
Sie auch eine Rettungs-Medaille?
Die Excellenz errötete und antwortete nicht.
Louis: Siehst Du, Albert, das
ist das beste, was ich von Bismarck gehört habe; sage mir
doch, Albert, wie war Bismarck in der Schule?
Dr. Albert: Ich glaube, gut und fleißig.
Louis: So? — Hm.
Dr. Albert: Besonders gern studierte er Geschichte.
Louis: Dann will ich auch
Geschichte studieren. Erzähle mir noch eine; dann will
ich dich nicht mehr bemühen, Albert.
Dr. Albert: Als Bismarck noch ein junger
Diplomat war, mußte er einst dem Minister-Präsidenten
von Österreich einen Besuch machen.
Es war ein sehr heißer Sommertag. Der Herr Minister-Präsident
saß vor einem offenen Fenster in den Hemd-ärmeln und
rauchte seine Cigarre.
Er ließ Bismarck lange in der Halle stehen, ohne Notiz von
ihm zu nehmen. — Bismarck hustete; — aber der
Herr Minister-Präsident wollte den jungen Mann immer noch
nicht hören.
Da zog Bismarck seinen Rock ebenfalls aus, stellte einen Stuhl neben den
des Minister-Präsidenten, nahm auch eine Cigarre aus der
Tasche und sprach: Herr Minister-Präsident, darf ich Sie um
etwas Feuer bitten? —
Der Minister-Präsident war starr vor Erstaunen.
Er warf seine Cigarre aus dem Fenster; Bismarck auch. Er stand
auf; Bismarck auch. Er zog seinen Rock an; Bismarck auch —
und nun begann die Audienz.
Louis: Diese Anekdote ist noch
besser, Albert!
Dr. Albert: So, Schwesterchen Martha, nun
wollen wir gehen.
Herr Meister: Wenn Sie noch
einen Augenblick verzögern wollten, so
möchte ich Ihnen etwas erzählen, was mir soeben einfiel bei Ihrer
letzten Anekdote.
Der Baron von Rothschild saß auch einmal in seinem
Arbeits-Zimmer, als ein Herr hereintrat. — Vertieft in seine
Kalkulation, sagte der Baron zu dem Fremden:
Nehmen Sie einen Stuhl, bitte!
Aber ich bin der Graf von....
So? — Dann nehmen Sie zwei!
Louis: Das war eine gute
Antwort, Herr Meister. — Nun müssen wir gehen.
Dr. Albert: Meine Herrschaften, es war mir
sehr angenehm!
Martha Meister: Mama wird
bedauern, verhindert gewesen zu sein.
Dr. Albert: Empfehlen Sie mich Ihrer Frau
Mama.
Martha Meister: Danke. —
Adieu, Martha; komm bald wieder zu uns.
Otto: Adieu, meine Damen! Herr
Meister, Adieu!
Louis: Nun, Fräulein
Bella, sind Sie zufrieden mit mir?
Bella: Ja, Sie sind ein Mann
von Wort.
Louis: Adieu, meine
Herrschaften!
Alle: Adieu!

III.
Martha Parks: Das ist ein
schönes Märchen! Aber das Ende, Albert?
Dr. Albert: Es ist zu Ende. Hat es Dir
gefallen, Martha?
Martha Parks: Sehr gut,
Albert.
Dr. Albert: Das war eine liebe, gute
Schwester, nicht wahr, Martha?
Martha Parks: Glaubst Du,
Albert, daß es heute solche Schwestern giebt?
Dr. Albert: O ja. — Schwestern sind
heute so gut, wie früher. — Nun aber
möchte ich von Dir das Märchen hören. Willst Du es
erzählen?
Martha Parks: O ja, das will
ich: Da war eine Mutter, die hatte sieben Söhne und eine
Tochter. — Wenn die Knaben gespielt hatten im Garten oder im
Walde, dann kamen sie immer hungrig nach Hause; — und eines
Tages standen sie wieder um ihre Mutter, welche ein Brot in der
einen Hand hatte und ein Messer in der andern.
Gieb mir zuerst, Mutter! — Gieb mir zuerst! — riefen
die Knaben wild durch einander. —
Wenn ihr doch alle Raben wäret! sagte unwillig die Mutter.
— Da waren die Knaben plötzlich verschwunden, und über dem Hause
flatterten sieben Raben hin und her und kreischten: Rab! Rab! Rab!
O, meine Brüder! rief da die Schwester, — und die
arme Mutter weinte und jammerte. Aber das half nun nichts mehr. Die
Raben flogen
in den Wald.
Die Mutter hatte nun keine frohe Stunde mehr. Sie weinte Tag und
Nacht — und starb bald vor großem Schmerz, und da war
das Mädchen ganz allein.
Tag für Tag aber ging sie in den Wald, sah nach allen
Bäumen, sah nach allen Raben und rief ihre Brüder mit
Namen, — aber sie kamen nicht. Und wenn sie dann oftmals ohne
alle Hoffnung war, dann setzte sie sich auf einen Baumstamm, bedeckte ihr Gesicht
mit ihren weißen Händchen und weinte bitterlich.
So saß sie auch eines Tages da; und ihr Jammer war so groß, daß sie
dachte, ihr Herz müsse brechen. Da hörte sie eine Stimme:
Stille deine Thränen, gutes Mädchen! Wenn du sieben Jahre
schweigen, — nicht ein Wort sprechen und
sieben Hemden,
spinnen willst, so sollst du deine Brüder wieder finden.
— Das Mädchen sah auf; — und vor ihr stand ein
Zwerg mit langem Silberbarte; der winkte ihr
freundlich zu und — verschwand.
Das Mädchen aber merkte seine Worte. Sie blieb im Walde,
wohnte in einem hohlen Baume, sprach kein Wort und spann Flachs
für die Hemden. — So waren sechs Jahre vergangen, aber das siebente Jahr
war noch nicht zu Ende.
Da kam einmal ein Prinz in den Wald. Er sah das liebliche
Mädchen und dachte zuerst, sie wäre ein wirklicher Engel.
— Er sprach mit ihr; sie aber antwortete nicht; sie
schüttelte nur mit dem Kopfe.
Armes Kind, sagte der Prinz zu seinen Dienern, — sie ist
stumm; aber sie ist schön.
Keine Prinzessin der Welt kann schöner sein; — und nahm
sie mit sich in seinen Palast.
Der Prinz aber hatte eine Schwester, die war hart und grausam.
— Was willst du mit dem fremden Mädchen? fragte sie
ihren Bruder. — Ich werde sie mir zur Gemahlin nehmen,
antwortete der Prinz. — Diese Hexe deine
Gemahlin? rief die Prinzessin. — Ja, sie ist eine Hexe! Sie
kann wohl sprechen; aber sie darf nicht und sie will nicht! —
Sage das nicht, Schwester, sprach der Prinz; — sie ist gut,
aber sie ist stumm. Armes Mädchen!
Die Prinzessin aber sprach zu allen Leuten, daß alle mit
ihr dachten und sprachen: Ja, sie ist eine Hexe, und sie muß
verbrannt werden; — und ein Scheiterhaufen wurde errichtet und sie
wurde dahin geführt.
Der Prinz küßte sie tausendmal und wollte sie nicht
lassen. Er weinte, daß alle mitweinen mußten, die es
hörten. Auch sie weinte und blickte hinauf zum Himmel; aber
sie sprach kein Wort.
So ging sie und trug die sieben Hemden unter dem Arme und kam an den Scheiterhaufen und mußte
hinauf steigen. — Und da sie oben stand, wollte man das Feuer
anzünden, — und betend sah
sie hinauf zum Himmel, — — da kamen sieben Raben und
flogen und flogen um den Holzhaufen; denn in diesem Augenblicke
waren die sieben Jahre zu Ende.
Sie warf einem jeden von den Raben ein Hemd zu, und da standen
vor ihr sieben schöne Ritter.
Schwester! Treue, liebe Schwester! riefen alle. — Da sind
sie wieder, meine Brüder! rief sie. O, meine Brüder!
Alle erstaunten. Das Feuer wurde nicht angezündet. —
Sie erzählte ihre Geschichte, und der Prinz stieg auf den
Scheiterhaufen. Engel! o mein Engel! rief er, — und trug sie
hinunter und führte sie in seinen Palast; und bald war sie
sein Weib.
Albert, höre einmal! Was war das?
Dr. Albert: Bravo, — Bravo?
Martha Parks: Wer ruft da
Bravo? — Ich werde die Thüre öffnen. — Herr
Meister!
Herr Meister: Verzeihung,
meine kleine Freundin! Vergebung, Herr Doktor! Gegen unsern Willen
sind wir Lauscher geworden.
Martha Meister: Nicht
Lauscher, Papa, — Zuhörer, — Bewunderer. —
Ein kleines Auditorium für Martha.
Martha Parks: So habt Ihr
alles gehört?
Gretchen: Das meiste, liebe
Martha. — Herr Otto wollte uns einführen, aber wir
wollten Dich nicht unterbrechen. — Wie schön Du das
erzählt hast!
Martha Parks: Das kommt, weil
ich dieses Märchen so liebe.
Bella: Ist dieses Ihre
Bibliothek, Herr Doktor?
Dr. Albert: Hier ist meine Bibliothek,
Fräulein, und Schwester Marthas Schule. Nicht wahr?
Martha Parks: Und Du bist mein
Lehrer. O, ist das nicht komisch? Albert ist ein Lehrer!
Dr. Albert: Wissen Sie, meine Herrschaften,
es macht mir unendliche Freude, meine kleine Schwester zu lehren.
Sie ist so intelligent, und dabei ist diese Art zu lehren so
höchst interessant für mich selbst.
Louis: Ja, ich habe Albert
gesagt, daß er es machen sollte wie Sie, Herr Meister. Das
ist die beste Methode in der Welt!
Herr Meister: Gemach, mein Freund Louis. Jeder Weg ist
gut, wenn er uns zum Ziele führt, und der
Weg, den wir gewählt haben, ist gewiß
einer der angenehmsten. Was meinen Sie, Herr Otto?
Otto: Sicherlich, angenehm,
interessant — und vor allem gediegen; und auch Bruder
Albert meint, das Halbe, das Einseitige und das Oberflächliche wäre
unmöglich in Ihrer Methode.
Dr. Albert: Das sehe ich am Resultate.
— Allein über einen Punkt habe ich nun schon viel
gedacht und bin jetzt noch nicht im Klaren?
Herr Meister: Und das
wäre, Herr Doktor?
Dr. Albert: Die Grammatik.
Herr Meister: Ah, — das
dachte ich!
Dr. Albert: Wie haben Sie selbst es mit der
Grammatik gehalten?
Herr Meister: In der folgenden
Weise: Wenn meine Freunde Fehler im Sprechen oder
Schreiben gemacht haben, so habe ich sie verbessert.
Dr. Albert: So sagte mir Louis. Allein ich
sollte denken, das würde nicht genügen.
Herr Meister: Bei manchen
Schülern genügt es, bei anderen nicht.
Dr. Albert: So machen Sie einen Unterschied bei den Schülern, wie
ich sehe?
Herr Meister: In der Tat, das
thue ich. — Bei Kindern schlage ich den Weg ein, den die
Mütter einschlagen bei
ihren Lieblingen und den die Natur selbst sie gelehrt. — Wenn
das Kind fehlerhaft spricht, so
sagt die Mutter: Nicht so, mein Kind. Das war nicht recht. So
mußt du sprechen. — Das genügt meistens für
Kinder. Oft kann man bei ihnen keinen andern Weg einschlagen.
— Und warum sollte man den Kindern mehr sagen, als das? Sie
haben ja Zeit genug, haben nichts zu versäumen.
Anders aber ist es bei älteren Personen, die denken und
immer nach dem Warum? fragen. Bei diesen und besonders bei solchen,
welche die Grammatik ihrer Muttersprache studiert hatten,
gehe ich ebenfalls den Weg, von dem ich sagte, daß die Natur ihn
vorgeschrieben habe; — allein ich füge noch
etwas Neues hinzu: Ich gebe ihnen auch die Regeln der
Grammatik, nachdem ich die Fehler verbessert habe, und so dringen
sie auch ein in den Geist der Sprache.
Doch habe ich mich stets gehütet, darin zu viel zu tun,
und niemals habe ich meine Schüler ermüdet mit Regeln der Grammatik.
Stets war es Vergnügen für beide Teile, für
Schüler und Lehrer.
Auch bin ich nicht immer denselben Weg gegangen; oft tat ich es
so und oft anders, je nach dem Alter, je nach der
Individualität des Studierenden; — und darin liegt die
hohe Schönheit und die Größe dieses Systems: Es ist
ein System der Freiheit, der wahren Freiheit, — das nur
entstehen konnte in einem freien Lande. Jeder Lehrer kann darin
seine Individualität geben, um so das Höchste und Beste
zu erreichen.
Otto: Sehr wahr!
Herr Meister: Worüber ich
aber noch täglich erstaunen muß, ist eine Beobachtung, die ich neulich gemacht habe:
Daß nur wenig Grammatik, daß nur wenige Regeln
genügen, um recht zu sprechen und recht zu schreiben. —
Dazu freilich ist es
nötig, daß der Lehrer klar denkt und sieht.
Ich habe meinen Freunden hier gewisse, kurze Regeln gegeben,
— und, Sie sehen, sie sprechen korrekt.
Dr. Albert: Das ist wahr. — Und
welche Regeln halten Sie für die notwendigsten?
Herr Meister: Ah, —
für die notwendigsten! Mein lieber Herr Doktor, ich will Ihnen
einige von solchen Sätzen geben, die meinen Freunden gute
Dienste geleistet haben.
— Aber nehmen Sie die Sätze für nichts mehr, als
für was ich sie ausgebe: Praktische Winke, die unendlich viel
Gutes tun. Sie mißverstehen mich nicht, nicht wahr? —
Ich gebe sie Ihnen nicht als Regeln.
Meine Freunde haben sich gewöhnt, ihre Gedanken sofort mit
deutschen Worten auszudrücken.
Dr. Albert: Und das erkenne ich als den
größten Vorteil Ihrer Methode.
Herr Meister: Ganz recht.
— Dennoch kommt es vor, daß sie englische Idiome und
Konstruktionen gebrauchen.
Dr. Albert: Das ist ganz
natürlich.
Herr Meister: Ja. — Zum
Beispiel: Unsere Freunde würden nie im Englischen sagen:
"My brother Louis
rides good"; das wäre nicht grammatikalisch; — sie
würden sagen: "My brother Louis rides well;" denn "good" ist ein Adjektiv im
Englischen, "well" aber wird als Adverb gebraucht. So kam es denn,
daß Herr Otto auch im Deutschen sagte »Mein Bruder
Louis reitet wohl«. Im Deutschen aber ist das nicht recht.
— »Wohl« wird sehr oft gebraucht als Synonym von
»nicht krank«. — Z.B. »Wie geht es Ihnen?
— Danke, ich bin wohl«. Wir gebrauchen es auch oft in
dieser
Verbindung: »Bringen Sie mir gefälligst ein Glas
Wasser!« »Sehr wohl, mein Herr«, — wie das
Englische "all
right", "very well" und so weiter. "My brother Louis rides well" würde
im Deutschen sein: »Mein Bruder Louis reitet gut«; denn
»gut« ist im Deutschen Adjektiv und Adverb. Also nicht:
"He speaks well"
»Er spricht wohl«, sondern: »Er spricht
gut«.
Otto: Den Fehler habe ich sehr
oft gemacht, nicht wahr, Herr Meister?
Herr Meister: O ja, recht oft.
Aber bin ich jemals müde geworden, Sie zu verbessern?
Otto: Nein, wahrlich nicht.
Sie hatten Ausdauer wie unser U.S.
Grant.
Bella: Beharrlichkeit
führt zum Ziele.
Herr Meister: Und hier z.B.
ist unsere liebe Freundin Bella. — Sie würde im
Englischen sagen: "I
wish to write a letter"; — und so sprach sie dann auch
im Deutschen: »Ich wünsche einen Brief zu
schreiben«; — aber wir sprechen im Deutschen
gewöhnlich nicht so: "I wish to buy essence of the white rose", »Ich
wünsche, Essenz der weißen Rose zu kaufen«; das
ist nicht recht, meine Freundin, nicht wahr? Heute aber wissen wir
es besser.
Bella: Heute sage ich:
»Ich will einen Brief schreiben«, »Ich will
Essenz der weißen Rose kaufen«, oder noch besser:
»Ich möchte Essenz der weißen Rose
kaufen.«
Herr Meister: Ganz recht.
Louis: Du mußt nicht
denken, mein lieber Doktor, daß ich ohne Fehler bin. O, ich
kann auch Fehler machen, so gut wie Fräulein Bella.
Bella: Und das kann ich
bezeugen.
Louis: Und ich kann Dir auch
einige aufzählen, denn ich kenne meine Fehler auswendig.
— Sieh' einmal hierher, Albert. In unserer englischen Sprache
sagt man z.B. "To-day
we are here. To-morrow we shall go to Mr. Meister's house".
Und so habe ich auch im Deutschen gesprochen: »Heute wir sind
hier. Morgen wir werden gehen in Herrn Meisters Haus.« Dieses
Deutsch ist nicht gut, Albert. Nicht wahr? Das ist schlechtes
Deutsch. "To-day" ist hier ein Adverb. Das Adverb muß im
Deutschen beim Verb stehen oder auch beim Auxiliar, wenn ein
solches vorhanden ist. Du mußt also
sprechen: »Heute sind wir hier. Morgen werden wir in Herrn
Meisters Haus gehen«. »Heute« muß bei
»sind« stehen und »morgen« bei
»werden«. Du mußt nicht das Adverb von dem Verb
oder dem Auxiliar trennen. Hast Du mich
verstanden, Albert?
Dr. Albert: Sehr gut, Louis.
Louis: Nun, dann höre
weiter: Im Englischen sagen wir z.B. "I have written this page". »I shall go to the
concert". Wenn Du nun nicht den Unterschied zwischen der
deutschen und englischen Konstruktion studiert hättest, so
würdest Du im Deutschen sagen: »Ich habe geschrieben
diese Seite«, »Ich werde gehen in das Konzert«.
— Aber ist das recht, Albert?
Dr. Albert: Nein.
Louis: Du mußt sagen:
»Ich habe diese Seite geschrieben«; denn im Deutschen
mußt Du das Auxiliar von dem Verb trennen, wenn es geht.
— Ist das klar?
Dr. Albert: O, sehr klar! Ich muß
nicht sagen: »Ich werde gehen in das Konzert«, sondern:
»Ich werde in das Konzert gehen«.
Louis: O, Du bist ein
vorzüglicher Schüler.
Ich will Dir noch mehr sagen: "I am glad that you are here", »Ich bin
froh, daß du bist hier«. Dieses Deutsch ist nicht gut.
— Ich habe hier zwei Sätze, und der erste Satz ist:
»Ich bin froh«. Dieser Satz ist recht. Der zweite Satz
beginnt nach dem Komma mit dem Worte »daß«, und
dieser Satz ist falsch; — denn ein jeder Satz, welcher mit
der Konjunktion »daß« beginnt, hat das Verb am
Ende oder auch das Auxiliar, wenn ein solches vorhanden ist.
— Also muß ich sagen: »daß du hier
bist« und nicht »daß du bist hier«. Noch
andere Konjunktionen gehen wie »daß«, doch nicht
alle, und es wird gut sein, wenn Du an diese Worte denkst:
»Konjunktion am Beginne, Verb oder Auxiliar am Ende.«
"I hear that he will
come", »Ich höre, daß er kommen wird«
und nicht: »Ich höre, daß er wird kommen«.
"He says that he has
done his work", »Er sagt, daß er seine Arbeit
getan hat« und nicht: »Er sagt, daß er hat getan
seine Arbeit«. Du siehst auch hier, daß in den
Sätzen, die mit Konjunktionen beginnen, das Verb oder das
Auxiliar am Ende steht.
Dr. Albert: Ja, ja. Das sehe ich. O, wie
sehr ich Dir danke!
Louis: O, bitte, bitte! Wenn
Grammatik Dir so sehr gefällt, dann werde ich Dir noch mehr
geben. Vielleicht würdest Du sagen für: "I am going" »Ich
bin gehend«, "I
am writing a letter" »Ich bin schreibend einend
Brief«. Das wäre aber kein gutes Deutsch. — Wo wir
im Englischen ein Partizip des Präsens sagen, sagt man im
Deutschen das Präsens: »Ich gehe«, »Ich
schreibe einen Brief«. "He is talking" = »Er spricht«;
nicht: »Er ist sprechend«. — "He was walking" nicht: »Er
war gehend«, sondern, [III-1]»Er
ist gegangen«. — "He was working"= »Er hat
gearbeitet« u.s.w.
Dr. Albert: Sehr gut, Louis. Du verstehst
Grammatik.
Louis: Nicht wahr?
Dr. Albert: Aber Du sagtest mir, Du
hättest keine Grammatik studiert.
Louis: Nun ja, ich meinte,
nicht so, wie Du.
Herr Meister: Aber Louis, Sie
hätten noch sprechen sollen über: »Ich bin, du
bist, Sie sind, er ist, sie ist, es ist; Wir sind, ihr seid, Sie
sind, sie sind« &c.; und über: »Ich habe, du
hast, Sie haben, er hat, sie hat, es hat; Wir haben, ihr habt, Sie
haben, sie haben« &c.
Louis: Das kann ich noch tun,
Herr Meister, wenn Sie erlauben. Ich war nicht bei Dir in Berlin,
Albert, als Du Deutsch studiert hast, aber ich weiß doch, Du
hast immer
gesagt für "He
has gone" »Er hat gegangen«, für "He has run" »Er hat
gelaufen«. Wir haben das hier immer so gesagt und ich am
meisten; nicht wahr, Otto? Aber es war nicht recht. Es sollte
heißen für "He has gone" »Er ist gegangen«; für
"I have run"
»Ich bin gelaufen«. Ich habe lange Zeit gebraucht, um
das zu begreifen; und noch längere Zeit, um es
zu sprechen, bis endlich Herr Meister so zu mir sprach: Louis,
hören Sie einmal: »Ich gehe«, »ich
schwimme«, »ich renne«, »ich reite«,
»ich fahre«, »ich stehe auf«, — das
sind Wörter, die eine Bewegung, andeuten, nicht wahr? — eine Bewegung des
Subjektes von einem Platze zum andern oder von einer Position in
eine andere. — Nun gut. Solche Wörter aber stehen im
Perfectum oder Plusquamperfectum nicht mit dem Auxiliar
»haben«, sondern mit dem Auxiliar »sein«.
Also nicht: Perfectum »Ich habe nach Hause gegangen«,
Plusquamperfectum »Ich hatte nach Hause gegangen«;
sondern Perf. »Ich bin nach Hause gegangen«, Plusq.
»Ich war nach Hause gegangen«, und nicht: Perf.
»Ich habe schnell gelaufen«, Plusq. »Ich hatte
schnell gelaufen«, sondern Perf. »Ich bin schnell
gelaufen«, Plusq. »Ich war schnell gelaufen«. Im
Englischen haben wir für das Perfectum im Activum stets das
eine Auxiliar "I
have" &c. — Im[III-2] Deutschen aber
haben wir zwei: »Ich habe« zc. und »ich
bin« zc. Also: Alle Wörter im Deutschen, die eine
Bewegung des Subjektes angeben von einer Stelle zur andern oder aus
einer Stellung in die andere, stehen mit dem Auxiliar
»sein«; z.B.: Präs. Ich schwimme &c.;
Imperf. Ich schwamm &c.; Perf. Ich bin geschwommen, du bist
geschwommen, Sie sind geschwommen, er ist geschwommen, sie ist
geschwommen, es ist geschwommen, wir sind geschwommen, Ihr seid
geschwommen, Sie sind geschwommen, sie sind geschwommen; Plusq. Ich
war geschwommen, du warst geschwommen, Sie waren geschwommen, er
war geschwommen, sie war geschwommen, es war geschwommen, wir waren
geschwommen, Ihr waret geschwommen, Sie waren geschwommen, sie
waren geschwommen.
So auch: Präs. Ich reise &c.; Imperf. Ich reiste
&c.; Perf. Ich bin gereist &c.; Plusq. Ich war
gereist &c. — Präs. Ich reite &c.;
Imperf. Ich ritt &c.; Perf. Ich bin geritten &c.;
Plusq. Ich war geritten &c. — Präs. Ich fahre
&c.; Imperf. Ich fuhr &c.; Perf. Ich bin gefahren
&c.; Plusq. Ich war gefahren &c. — Präs.
Ich falle &c.; Imperf. Ich fiel &c.; Perf. Ich bin gefallen
&c.; Plusq. Ich war gefallen &c.
Dr. Albert: Das verstehe ich sehr gut, mein
lieber Louis. Nun danke ich Dir.
Louis: Bitte, bitte.
Dr. Albert: Das Verb oder, wie wir es in
Berlin nannten, das Zeitwort, hat mir im Deutschen nie
viel Mühe gemacht.
Bella: Auch mir nicht. —
Da giebt es nicht so viele unregelmäßigen Zeitwörter wie im
Französischen.
Otto: Das deutsche Verb ist so
leicht, wie das englische, meine ich.
Dr. Albert: Ganz gewiß; und dazu hat
das Englische das Verb leichter, als eine andere Sprache, die ich
kenne. Denken Sie nicht auch so, Herr Meister?
Herr Meister: Ich stimme Ihnen bei.
Bella: Herr Meister, Sie
hatten mir das deutsche Verb so klar gemacht, daß ich es in
wenigen Minuten für immer verstanden habe.
Otto: Ich wünsche, Herr
Meister, Sie würden meinem Bruder Ihre Methode
erklären.
Herr Meister: Mit
Vergnügen. Ich habe das Folgende für das Beste befunden,
andere mögen anders verfahren. Meine Freunde
haben von Anfang an das Präsens, das Imperfectum und das
Perfectum aller Zeitwörter gelernt. Sie wissen »ich
schreibe, ich schrieb, ich habe geschrieben«; »ich
höre, ich hörte, ich habe gehört«. Sie wissen
auch »ich höre« ist ein regelmäßiges
Verb; denn »höre« behält »ö«
in allen Zeiten: Präsens, Imperfectum &c.; — auch wissen
Sie »ich schreibe« ist ein unregelmäßiges
Zeitwort, weil es nicht denselben Vokal behält in allen
Zeiten; — im Präsens hat es »ei« (schreibe);
im Imperfectum »ie« (schrieb) und auch im Perfectum
(geschrieben).
Nun wollen wir das Verb »ich höre« betrachten.
Präsens: ich höre. Ich werde ein »n« an das
Wort »höre« hängen, dann ist es
»hören«. Das ist der Infinitiv. Dieser Infinitiv
aber wird auch als Substantiv gebraucht z.B.: »Das Hören
wird mir schwer«.
Otto: Ist das nicht dasselbe
wie das englische Particip Präsentis "hearing, walking, writing" u.s.w.?
Herr Meister: Ganz recht.
— Im Deutschen können wir von jedem Worte auf diese
Weise ein Substantiv bilden. Und alle diese Substantive haben den
Artikel »das« z.B. »das Sprechen wird mir
leicht«, [III-3]»das Reiten ist heute angenehm« u.s.w.
Dr. Albert: Das ist ein sehr guter Wink
für den Studierenden und erleichtert ihm vieles.
Herr Meister: Nicht wahr? Aber
weiter! »Ich höre«. Ich komme zurück zum
Präsens, bilde daraus den Infinitiv »hören«
und aus diesem Infinitiv[III-4] bilde
ich wieder das Futurum, indem ich damit verbinde das Auxiliar
»ich werde, du wirst, Sie werden, er wird, sie wird, es wird,
wir werden, Ihr werdet, Sie werden, sie werden«. »Ich
werde hören« ist also das Futurum. Meistens können
wir von diesem Infinitiv auch den Imperativ bilden, aber nicht
immer.
Das Activum wollen wir nun verlassen und ein wenig über das
Passivum sprechen. »Ich höre, ich hörte, ich habe
gehört«. Wir nehmen »gehört« vom
Perfectum und verbinden es mit dem Auxiliar »ich werde, ich
wurde, ich bin geworden«, so finden wir das Passivum. Also
Präs. Ich werde gehört &c.; Imperf. Ich wurde
gehört &c.; Perf. Ich bin gehört worden &c.
Mehr als ich soeben gesagt, gab ich meinen Freunden nicht
für den Anfang; — das andere gab ich ihnen nach und
nach, und alles wurde ihnen leicht.
Dr. Albert: Das ist sehr klar, in der Tat;
und ich möchte wohl eine kleine Probe mit
meiner kleinen, klugen Schwester Martha machen. Sie hat das Verb im
Deutschen noch nicht studiert.
Martha Parks: Ich habe alles
verstanden, Albert, was Herr Meister gesagt hat. Frage nur zu!
Dr. Albert: Nun, wir wollen einmal sehen.
Ich gebe Dir das Wort »ich fange, ich fing, ich habe
gefangen«.
Martha Parks: »Ich
fange« ist Präsens; »Fangen« ist Infinitiv;
»das Fangen« ist Substantiv; »ich werde
fangen« ist Futurum. Ist das recht?
Louis: Recht, Schwester
Martha. Weiter! Das Passiv!
Martha Parks: Das Passiv ist:
»Ich werde gefangen« — Präsens; »Ich
wurde gefangen« — Imperfectum; »Ich[III-5] bin
gefangen worden« — Perfectum; »Ich werde gefangen
werden« — Futurum.
Dr. Albert: Das hast Du gut gemacht,
Martha.
Martha Meister: Ihre Schwester
ist sehr intelligent, Herr Doktor.
Otto: Erinnern Sie sich, Herr
Meister, wie viele Mühe Sie einmal mit uns hatten, als Sie das
Passiv erklärten?
Herr Meister: Es geht vielen
so, wie es Ihnen erging. — Und oft höre ich von
Amerikanern, die wirklich gut Deutsch sprechen und die Grammatik
gut studiert haben, Ausdrücke wie »Othello ist heute im
Theater
gespielt«, anstatt »Othello wird heute im Theater
gespielt«. Sie sagen »Othello war gestern Abend im
Theater gespielt« anstatt »Othello wurde gestern im
Theater gespielt«. Das kommt aber daher: Im Englischen
gebrauchen wir "I am,
thou art, he is, she is, it is, we are, you are, they are" mit
dem Adjectiv, mit dem Substantiv und mit dem Verb z.B. "He was good", »He was an
American", »He was caught". Im Deutschen aber sagen wir
»Er war gut«, »Er war ein Amerikaner«,
»Er wurde gefangen«. Im Deutschen sagen wir »ich
bin, du bist, Sie sind, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr
seid, sie sind« mit dem Adjektiv und mit dem Substantiv. Mit
dem Verbum aber gebrauchen wir »ich werde, du wirst, Sie
werden, er wird, sie wird, es wird, wir werden, Ihr werdet, Sie
werden, sie werden«.
Dr. Albert: Auch das, Herr Meister, ist
sehr klar. Nun aber sagen Sie mir: Was tun Sie, daß Ihre
Schüler den Artikel lernen?
Herr Meister: Nichts. —
Da ist nichts zu tun, Herr Doktor. Den Artikel müssen wir der
Zeit überlassen. — Die Zeit ist mächtig. Sie tut es
für uns; — langsam zwar, aber sicher. — Sprechen
unsere Freunde hier den Artikel nicht korrekt?
Dr. Albert: Ganz korrekt.
Herr Meister: Nun wohl, die
Zeit allein hat es getan.
Gretchen: Ist Ihnen der
Artikel auch recht schwer geworden, Herr Doktor?
Dr. Albert: Ja wohl, mein Fräulein.
Oft habe ich mich gefragt: Werde ich den Artikel wohl jemals
lernen?
Gretchen: Aber Sie sprechen
den Artikel so perfekt wie ein Deutscher.
Dr. Albert: Ja, mein Fräulein —
heute!
Herr Meister: Ihnen ging es
mit dem Artikel, wie mir einst mit der Aussprache. Oft war ich in der
größten Verzweiflung und rief: Wann, o wann werde
ich die Aussprache des Englischen inne haben! —
Ich habe sie heute. — Zeit und Geduld! — Zwar habe ich
meinen Freunden einige Regeln gegeben über den Artikel; so
z.B. sagte ich oft ....
Louis: »e« am
Ende, »die« am Beginne.
Herr Meister: Ganz recht,
Louis. Das heißt: Wenn ein Wort »e« am Ende hat,
so hat es meistens den Artikel »die«, z.B.:
»Rose«, »die Rose«; »Flamme«,
»die Flamme«; »Schule«, »die
Schule«. — Auch alle Wörter, die am Ende
»heit«, »keit«, »ung«,
»schaft« &c. haben, haben den Artikel
»die«; z.B.: »die Schönheit«,
»die Fröhlichkeit«, »die Wohnung«,
»die Freundschaft«.[III-6] — Wörter mit
»chen« und »lein« am Ende, haben immer
»das«; z.B.: »das Bäumchen«,
»das Röslein«. Auch Wörter, welche von
Adjektiven kommen, haben »das«; z.B.:
»schön«, »das Schöne«;
»groß«, »das Große«;
»grün«, »das Grüne«. Ferner
Wörter, die von Verben kommen und die Form des Infinitivs
behalten; z.B.: »schreiben«, »das
Schreiben«; »lesen«, »das Lesen«.
Nun wohl; das sind einzelne, gute Winke über den Artikel;
aber sie helfen nicht sehr viel. In Deutschland verstehen kleine
Kinder eben so korrekt zu sprechen, wie hier bei uns die kleinen
Kinder die rechte Aussprache haben; das heißt: wenn sie
dieselbe korrekt hören. Aber, aber, — wir vergessen,
daß uns Herr Louis nicht eingeladen hat, heute über
Grammatik zu sprechen.
Dr. Albert: Ganz recht, Herr Meister. Ich
danke Ihnen, daß Sie mich daran erinnern. — Es kam
durch mich; und ich bitte um Entschuldigung, Louis, daß Du
durch mich gehindert bist, Dein Programm auszuführen.
Louis: Bitte, Albert, das tut
nichts. Wenn wir von jetzt an unsere Zeit ökonomisch
gebrauchen, so können wir sehr gut unsern Plan
ausführen.
Darf ich Sie bitten, meine Herrschaften, mir zu folgen? Ich
bitte um Ihren Arm, Fräulein Gretchen.
Martha Parks: Ich werde mit
Ihnen gehen, Herr Meister.
Herr Meister: Es wird mir ein
großes Vergnügen sein, mein Fräulein.
Otto: Darf ich um die Ehre
bitten, Fräulein Bella?
Dr. Albert: Fräulein Martha, Sie
können wohl erraten, wohin Bruder Louis uns zuerst führen
wird.
Martha Meister: Zu Nero?
Dr. Albert: Ganz recht.
Martha Meister: Ich dachte es.
Ich sah seinem Auge die größte Ungeduld an.
Dr. Albert: Vielleicht ziehen Sie
es vor, mein Fräulein, hier zu bleiben und meine
Bibliothek zu besichtigen. — Der größere Teil
meiner Bücher ist allerdings noch in Kisten verpackt. Was Sie
hier sehen, nenne ich meine Reise-Bibliothek; dieselbe enthält
solche Werke, die ich stets gerne bei mir habe.
Hier sind die spanischen Werke.
Martha Meister: Calderon:
La vida es
sueño. — Cervantes: Don Quixote.
Dr. Albert: Dieses hier sind die
italienischen.
Martha Meister: Dante:
Divina Comedia.
— Torquato Tasso: Gerusalemme liberata. — Ariosto: Orlando Furioso.
Dr. Albert: Und nun kommen wir zu den
französischen.
Martha Meister: Corneille:
Le Cid. —
Racine: Athalie.
— Molière: Tartuffe.
Dr. Albert: Die deutschen stehen hier.
Martha Meister: Goethe[III-7]:
Wilhelm Meister, Faust. — Schiller: Wilhelm Tell. —
Heine: Buch der Lieder.
Dr. Albert: Von den englischen halte ich
nur ein Werk bei mir.
Martha Meister: Und das
ist?
Dr. Albert: Sehen Sie hier?
Martha Meister: Shakespeare.
— Aber warum, Herr Doktor, halten Sie aus unserer kostbaren
Litteratur, die doch wahrlich so reich ist, nur ein Werk?
Dr. Albert: Wenn ich Shakespeare habe,
brauche ich kein anderes Buch mehr. — Sehen Sie hier? —
Das ist alles, was ich bei mir habe in der griechischen
Sprache.
Martha Meister: Homer's
»Ilias«.
Dr. Albert: Geben Sie mir Homer und
Shakespeare und ich will es schon eine Weile aushalten, allein auf einer Insel. — Hier stehen einzelne Werke der
lateinischen Sprache.
Martha Meister: Virgil's
»Aeneis«.
Dr. Albert: Und die »Oden« von
Horaz.
Martha Meister: Es muß
herrlich sein, diese Werke in den Original-Sprachen lesen zu
können, wie Sie es tun.
Dr. Albert: Das ist es allerdings; und ich
denke, Jeder sollte sich bemühen, dasselbe
zu tun. Glauben Sie mir, mein Fräulein: Das Reisen ist das
vorzüglichste Mittel, die
Menschen zu veredeln. Mit offnen Ohren
und Augen zu reisen, mit den Menschen fremder Länder sprechen
und arbeiten, — die Sitten fremder Völker beobachten und
vergleichen, — das, mein Fräulein, mehrt unsere
Kenntnisse und formt unsern Charakter —
Nächst dem Reisen aber ist das Lesen wohl das beste Mittel
zur Bildung. Oder wissen Sie etwas Anderes, mein Fräulein,
welches interessanter ist und belehrender, als das Reisen und das
Lesen?
Martha Meister: Nein,
gewiß nicht. Aber eins sollten wir nie vergessen, Herr Doktor, —
die Dankbarkeit und die Bewunderung für diejenigen
Männer, welche uns die Mittel geben, uns zu veredeln. Wir
sollten über die Geschöpfe niemals den
Schöpfer vergessen.
Täglich danken wir ja dem himmlischen Schöpfer
für die himmlischen Gaben; — warum sollten wir nicht
auch den irdischen Schöpfern danken für die irdischen
Gaben?
Die idealen Werke eines Shakespeare sollten uns immer an den
hohen Genius erinnern, der sie geschaffen, und andere Werke, wie
Eisenbahnen
und Telegraphen, sollten uns an die Dankbarkeit erinnern, die wir
den praktischen Männern, den Männern der Wissenschaft,
schulden.
Dr. Albert: Und sagen Sie auch das noch,
mein Fräulein. — Wenn wir mit Menschen fremder Nationen
in ihrer Muttersprache reden, so sollen
wir in Dankbarkeit der Männer gedenken, die uns den
angenehmsten und kürzesten Weg gezeigt haben, das zu
erreichen. — Und darum bewundere ich Ihren Vater, mein
Fräulein. — Seine Methode ist für die Sprachen, was
die Eisenbahn für
das Reisen ist: sie macht den Weg kürzer und angenehmer.
Martha Meister: Ich danke
Ihnen. — Wissen Sie, Herr Doktor, daß ich noch keine
Bibliothek gesehen habe, die so schön gebaut und eingerichtet war, wie die Ihrige?
Dr. Albert: Es macht mich glücklich,
daß meine
Bibliothek Ihren vollen Beifall
hat, besonders, weil sie ganz mein Werk ist, das heißt, nach
meinem Plane gebaut wurde.
Martha Meister: Aber ich
dachte, dieser Teil Ihres Hauses wäre erst vor einem Monate
beendet worden und vor Ihrer Rückkehr.
Dr. Albert: So ist es. Ich werde Ihnen das
erklären: Vor etwa einem Jahre schrieb mein Vater nach Berlin
unter anderm: .... »und nun habe ich Dir auch zu schreiben,
daß wir, sobald das Wetter besser wird, die Seite unseres
Hauses niederreißen werden, die nach dem Garten zu liegt, um
sie schöner und größer aufzubauen.
Du hast auf Deiner Reise durch Europa gewiß schöne
Privat-Bibliotheken gesehen; — und ich würde Dir dankbar
sein, wenn Du mir helfen wolltest. Du könntest mir
nämlich den Plan zu einer Bibliothek schicken, die nicht zu
groß und auch nicht zu klein ist.
Du weißt, ich liebe den Komfort; und finde ich dann etwas
in Deinem Plane, was ich gebrauchen kann, so werde ich es
gewiß nehmen u.s.w., u.s.w.«
Darauf antwortete ich meinem Vater: Wenn ich eine Bibliothek
bauen dürfte nach meinem Willen, dann müßte sie
lang sein, wie ein Saal; denn ich selbst gehe gern während der
Arbeit auf und ab; — dazu aber brauche ich Raum; — und
ich höre dann gerne meinen eigenen Schritt;
— daher wäre es am besten, wenn der Fußboden mit weißen
Marmor-Platten bedeckt würde. — Die Halle dürfte
nur ein Stockwerk hoch
sein, denn ich
höre nicht gern den Tritt von Anderen über
mir, wenn ich denke.
Die Decke sei gewölbt und von Glas, um das
Licht von oben fallen zu lassen. — Das Ende der Halle, dem
Eingange gegenüber, sei ein Halbrund; auch hier sei die Decke
gewölbt, — aber nicht von Glas, — blau gemalt mit
goldenen Sternen.
Rechts und links an beiden Seiten seien Fenster von buntem Glas.
— Auch eine Nische würde ich haben zu meiner Rechten;
— dahin würde ich eine Marmor-Statue, z.B. eine Kopie
der Venus von Medici stellen, zu meiner Linken sollte der Stahlstich einer
Madonna von Raphael sein.
Durch einen Vorhang von schwerem Damast würde ich dann
diese Rotunde trennen von dem Haupt-Teile der Halle. — Eine
Doppel-Thüre aber würde ich haben am anderen Ende der
Rotunde, dem Vorhang gegenüber. — Diese Thüre
müßte in ein kleines Blumen-Haus führen, das
gefüllt wäre mit tropischen Gewächsen; von hier aus
könnte man dann in den Garten gehen.
In der Rotunde selbst sei ein Tisch zum Schreiben und ein
Pult, um auch stehend studieren zu können.
So wären also drei Abteilungen da, wenn man den Vorhang
vorziehen und die Thüre nach dem Blumen-Haus schließen
wollte; — nämlich: Die Haupt-Halle der Bibliothek, dann
die Rotunde und zuletzt das Blumen-Haus.
In der Halle aber würde ich weite und bequeme Stühle haben zum
Empfang von Gästen und Freunden.
Ein großer Leuchter, in der Mitte
hängend, müßte das Ganze mit Gas beleuchten,
während in der Rotunde nur ein Arm-Leuchter mit Öl sein
dürfte.
In einem großen Kamin könnte man durch große
Holz-Scheite
Wärme durch den ganzen Raum verbreiten.
Im Blumen-Hause aber würde ich einen Spring-Brunnen
haben; denn wie Musik so gerne höre ich das Plätschern
und Rauschen des Wassers.
So etwa schrieb ich, nicht ahnend, was mein Vater wollte.
— Ich hatte den Plan völlig vergessen; denn in keinem
der folgenden Briefe erwähnte mein Vater meinen Plan.
— Das war eine völlige Verschwörung gegen mich,
denn auch meine Mutter und meine Geschwister
schwiegen
darüber.
Martha Meister: Und ich sehe,
alles ist genau so gebaut, wie Sie es gewünscht.
Dr. Albert: Genau so, mein
Fräulein.
Martha Meister: Ich hätte
Ihre überraschung sehen
mögen!
Dr. Albert: Meine Überraschung, meine
Freude, meine Dankbarkeit über dieses alles und über den
feinen Takt meiner Teuern war groß.
Martha Meister: Sie
müssen sehr glücklich sein, Herr Doktor!
Dr. Albert: Glücklich? Ja, das bin
ich. — Aber das höchste Glück, — das, —
mein Fräulein — ah, die Herrschaften kommen
zurück.
Bella: Martha, warum bist Du
nicht mit uns gegangen? O, wie viel Schönes haben wir gesehen;
und nun, Herr Doktor, wollen Sie mir eine Bitte erfüllen?
Dr. Albert: Mit Vergnügen, mein
Fräulein; aber erst müssen Sie mir sagen, was ich tun
soll.
Bella: Nein, mein Herr Doktor.
Erst müssen Sie mir versprechen, es zu tun; — es ist gar
nicht schwer für Sie.
Dr. Albert: Nun wohl; ich verspreche Ihnen,
zu tun, was Sie wünschen.
Bella: Ihre Schwester Martha
hat mir draußen gesagt, daß Sie ihr so vieles
erzählt haben über Thüringen. Bitte, lieber Herr
Doktor, erzählen Sie uns auch etwas. — Ich habe heute
noch gar nichts Schönes gehört. Ich weiß nicht, was
ich denken soll von Otto und von Louis. Wo ist denn Louis jetzt?
Sie sind heute nicht so offen, wie sonst. Einer sieht den andern an
und dann lächeln sie; und so oft ich sie frage: Aber was ist
denn? — so sagen sie beide: O nichts, gar nichts. — Ich
bin ganz böse mit Ihnen, Otto.
Otto: O, das tut mir aber
leid.
Dr. Albert: Also von Thüringen soll
ich Ihnen erzählen. Setzen wir uns.
Herr Meister: Ich meine, der
Sängerkrieg auf der Wartburg
hätte großes Interesse für uns alle, Herr
Doktor.
Dr. Albert: Sehr wohl.
Bella: Entschuldigen Sie, Herr
Doktor. Ist das dieselbe Wartburg, über welche Sie einmal an
Louis geschrieben haben? —
Dr. Albert: Es ist dieselbe, mein
Fräulein. Das Schönste, was Sie sehen können in
dieser alten Burg, das ist der Saal.
Vor mehr als sechshundert Jahren, im Jahre 1207, waren hier
sechs der größten Sänger und Poeten Deutschlands
versammelt, um vor dem Landgrafen und der Landgräfin, vor den Rittern
und den schönen Ritterfrauen und Fräulein um
den höchsten Preis zu ringen durch ihre Kunst in Poesie und
Gesang.
Mit den schönsten Worten, mit den lieblichsten Tönen,
mit der höchsten Begeisterung sang einer nach dem andern zum
Preise der Religion, der Frauen und der Fürsten.
Heinrich von Ofterdingen, der geschickteste von allen, sang aber allein
gegen die übrigen fünf; er pries den Herzog Leopold von
Österreich; — und die fünf anderen: Heinrich der
tugendsame Schreiber, Walther von der Vogelweide, Reinmar der Alte,
Bitterolf und Wolfram von Eschenbach lobten den Landgrafen.
Und da sie alle vollendet hatten, wußte man nicht, welcher
Partei man den Preis zukommen lassen sollte, ob den fünf
Sängern, ob Heinrich von Ofterdingen.
Man konnte zu
keiner Entscheidung kommen, und die Erbitterung war so
groß geworden, daß man zuletzt beschloß, das Loos
sollte entscheiden, wer Sieger sei; der Besiegte aber sollte sterben, und
dieses Loos traf Heinrich von Ofterdingen; und als die erbitterten
Sänger ihn ergreifen wollten, floh er aus ihrer Mitte zum Ende
der Halle zur Landgräfin und fiel ihr zu
Füßen und bat um ihren Schutz.
Und er hatte nicht umsonst gefleht.
— Sie sah seine angstvollen Augen und hörte seine
klagenden Worte und hatte Erbarmen mit seinem jungen Leben. —
Sie breitete die Falten ihres weiten Mantels über ihn zum
Zeichen, daß sie ihn schütze, daß niemand ihn
berühren, niemand ihn beschädigen dürfte.
Und man einigte
sich, daß man nach einem Jahre den Kampf wieder beginnen
und entscheiden
wollte.
Nach einem Jahre waren sie alle wieder versammelt. Heinrich von
Ofterdingen war in diesem Jahre bei dem großen Meister
Klingesor im Ungarnlande
gewesen. Der Meister selbst war mit ihm gekommen.
Der Kampf des Gesanges aber endete heute fröhlicher, als im
Jahre zuvor, und der Preis wurde zuerkannt — dem Sänger Wolfram von
Eschenbach.
Nun ging man zur Tafel, und edle Knappen und schöne
Mägdelein brachten die besten Speisen in silbernen Schalen und
den feurigsten Wein in goldenen Bechern.
Heute waren alle freudig. Da stand der Meister Klingesor aus dem
Ungarlande auf und alle hörten mit großer Ehrfurcht die Worte,
welche er sprach: In dieser Stunde wird dem Könige vom
Ungarlande eine Tochter geboren; und sie wird einst in das
schöne Thüringen kommen und Herrin sein in diesen Hallen. Heil der
Tochter meines Herrn! Heil ihr, die man nennen wird Elisabeth.
— So endete der Sängerkrieg auf der
Wartburg, — und Fräulein Bella, ich hoffe, daß
meine Erzählung Ihnen gefallen hat.
Bella: Sehr gut. Ich danke
Ihnen sehr, Herr Doktor.
Gretchen: Das ist die heilige
Elisabeth; weißt Du das, Bella?
Bella: Ich habe es bis jetzt
nicht gewußt.
Martha Meister: Die heilige
Elisabeth war meine Heldin; und als ich in Deinem Alter war,
Martha, habe ich immer von ihr gelesen. Nicht wahr, Papa?
Herr Meister: Ich erinnere
mich dessen sehr genau, meine Tochter.
Martha Parks: War sie wirklich
so gut, daß man ihr den Namen die heilige Elisabeth gegeben
hat?
Martha Meister: Sie war sehr
gut.
Martha Parks: Aber was hat sie
denn getan?
Martha Meister: Das will ich
Dir wohl sagen:
Vier Jahre war Elisabeth alt, — da empfing ihr Vater, der
König von Ungarn, eines Tages die Boten des Landgrafen von
Thüringen; — sie baten um die Hand seiner Tochter
für den Sohn des Landgrafen.
Der König von Ungarn hörte dieses gerne, denn er
wußte, daß das Thüringer-Land reich und schön
war und seine Landgrafen edel.
In einem goldenen Wagen verließ Elisabeth das Ungarnland,
begleitet von ihrer Amme, von vielen
edlen Jungfrauen und Rittern; und da sie nach Thüringen vor
die Wartburg kamen, wurden sie mit großer Freude
empfangen.
Der junge Prinz öffnete selbst die Thüre zum Wagen und
hob seine Braut aus der silbernen Wiege, in welcher sie lag, und
alle erstaunten über ihre große Schönheit und
über die große Anzahl der Wagen, die ihr folgten,
gefüllt mit Gold und anderen kostbaren Dingen.
Der Prinz und die Prinzessin aber liebten sich und waren wie
Bruder und Schwester und spielten mit einander; denn beide waren
noch jung; der Prinz war erst zehn und die Prinzessin nur vier
Jahre alt.
Und da Elisabeth älter und größer wurde,
vermißte sie nie die Kirche; und sie betete immer zu Gott,
daß er sie gut machen möchte, und daß sie den
Menschen gutes tun könnte.
Den Armen gab sie, so viel sie nur konnte, und die Kranken
besuchte sie und tat ihnen viel Gutes und sie war gegen alle
Menschen so freundlich, besonders aber mit den Traurigen.
Die Landgräfin aber, des Prinzen
Mutter, war darüber oft hart mit ihr, denn sie sagte, sie
wäre eine Prinzessin und würde einst die Gemahlin ihres
Sohnes werden, und es wäre nicht recht, sich so gemein zu
machen. — Und einst sagte die Landgräfin sogar: Wir
wollen sie zurückschicken nach Ungarn!
Da aber zeigte der junge Prinz auf einen großen Berg und sprach: Siehst
du den Berg vor uns? Wäre er auch vom feinsten Golde, so
wollte ich doch eher ihn vermissen, als meine Elisabeth. Ich habe
nichts lieber auf dieser Welt, als sie.
Da Elisabeth fünfzehn Jahre alt war, wurde eine große
Hochzeit gefeiert. Es war ein schönes,
glückliches Paar. — Sie war schön und liebreich und
fromm; und er war reich an allen Tugenden eines Ritters.
Nach wenigen Jahren wurde er nun selbst Landgraf im Thüringer-Lande.
Darüber aber war niemand glücklicher, als Elisabeth. Denn
nun konnte sie Gutes[III-8]
tun[III-9], soviel sie
wollte, und niemand konnte sie mehr hindern.
Häufiger, als früher, ging
sie nun zu den Unglücklichen, und wenn sie die Hütten verlassen hatte, war es den
Armen, als wäre ihnen ein Engel erschienen, so reich waren
ihre Gaben, so beglückend ihre Worte und so freundlich war ihr
Auge; und überall im Lande sprach man von der Landgräfin Elisabeth und
überall hatte sie Freunde.
Aber da waren auch einige, die böses von ihr sprachen zu
ihrem Gemahl, dem Landgrafen. — Es war
Hungers-Not im Lande, und das Brot war wenig und teuer; und sie
sagten, es wäre wahrlich nicht recht, daß die Landgräfin so oft zu den
Armen gehe und so reichlich Brot verschenke.
Der Landgraf aber
wollte nicht hören auf ihre Worte und sagte nichts zu seiner
Gemahlin.
Aber einmal war er aus der Wartburg geritten; und da er wieder auf dem Wege
heimwärts war, sah er aus dem Wald-Pfade die Landgräfin
kommen, welcher eine Dienerin folgte. — Und der Landgraf dachte: Unter dem
weiten Mantel trägt sie wieder Brot für die Armen, und
wir selbst haben doch so wenig in dieser teuern Zeit, — und
er rief ihr zu: Laß doch sehen, was du unter dem Mantel
trägst! — O, rief sie,
stotternd vor Angst, — o — es sind — Rosen!
In dieser Jahres-Zeit Rosen, Elisabeth? — Unmöglich!
— Komm', laß doch sehen! — Und da sie zitternd
ihren Mantel zurückschlug, war sie selbst erstaunt, denn
wahrlich — es waren Rosen.
Und der Landgraf und
Elisabeth lebten manche Jahre glücklich zusammen und hatten
schöne und gute Kinder. Da kam er eines Tages ernst nach Hause
und sprach: Elisabeth, ich habe einst gelobt nach dem Grabe des
Heilands zu wallfahren mit meinen Mannen, und nun ist die Zeit gekommen, daß
ich mein Wort erfülle.
Mußt du, sprach sie mit wehmütigem Herzen, so gehe.
Aber da sie allein war, mußte sie bitterlich weinen; und da
der Tag des Abschiedes kam, konnte sie nicht von ihm lassen; und
viele Meilen wanderte sie mit ihm, auf seinen Arm
gestützt.
Da endlich sprach er zu ihr: Nun, mein teures, liebes Weib,
gehe zurück zur Burg.
So schwer war es ihr noch niemals geworden, zu tun, was ihr
Gemahl ihr gebot und ihr Weh war so tief,
daß die härtesten Ritter mit ihr weinten.
Sie kam zur Burg zurück. Es war ein harter Tag für
sie. — Aber ein Tag folgte, der noch härter war; das war
der Tag, da man ihr die traurige Botschaft brachte, daß ihr
Gemahl im Kampfe gefallen war.
Da war das Licht der Sonne ihr nicht mehr golden; und der zarten
Blümchen Schönheit sah sie nicht mehr und hörte
nicht mehr auf den lieblichen Sang der Vögel, und die
Landschaft und die ganze Welt schien ihr schwarz. Da war keine
Freude mehr für sie auf dieser Erde.
Und der Bruder ihres Gemahls kam auf die Burg und machte sich
zum Herrn des Landes und vertrieb die Witwe seines Bruders.
Es war finstere Mitternacht, da er sie hinausstieß vor das
Burg-Thor. Der Regen fiel in Strömen; aus schwarzen Wolken
zuckte der Blitz; der Donner rollte fürchterlich durch die
Berge und greulich heulte der Sturm.
Elisabeth ging den schmalen Pfad den Berg hinab. Auf schwachem
Arme trug sie das jüngste Kind, an der linken Hand führte
sie das zweite, und ihr ältestes Söhnlein mußte die
Fackel tragen, um den schlüpfrigen Weg zu
beleuchten.
Und zuletzt kam sie an den Fuß des Berges und nach
Eisenach. In der Stadt, wo sie einst Gaben gespendet, mußte
sie nun selbst um milde Gaben bitten; doch niemand wollte der
Unglücklichen ein Obdach
gewähren; und still ertrug sie
die Not um ihres Heilands willen, der so viel mehr gelitten hatte für die
Menschheit; — und sie ertrug alles mit Geduld, bis sich der
Landgraf ihrer wieder erbarmte und sie zurückrief; aber sie
wollte nicht mehr zurück in die Burg.
Deutschlands großer Kaiser, Friedrich II., flehte sie an, daß sie
seine Gemahlin würde; — aber ihr Herz gehörte dem
einen, der nicht mehr bei ihr war; ihm wollte sie treu bleiben.
Eines nur hatte sie erbeten für sich: Das Gnaden-Brot bis
an ihr Ende, und da gab man ihr die Stadt Marburg. Hier lebte sie
im Kloster als Nonne, überall Segen
verbreitend bis eines Tages ihr Wunsch erfüllt war.
Ihr Geist war zu ihm hinüber gegangen in jene selige
Welt.
Vierundzwanzig Jahre war sie alt, da lag sie im Sarge, wie ein
Engel zu schauen.
Der Kaiser selbst und die Edelsten des Reiches trugen den
Sarg zu
Grabe.
Wie damals, so spricht man noch heute im Thüringer-Lande
von der heiligen Elisabeth.
Martha Parks: Ich höre
Dir so gerne zu, Martha; Du auch, Albert?
Dr. Albert: Ja, Schwester, mir geht es wie
Dir.
Herr Meister: Es ist schade,
daß Louis es nicht gehört hat. Er hat großes
Interesse für solche Erzählungen.
Bella: Ja, das ist auch wahr;
wo ist Louis? Ist er noch nicht zurück? — Sie
lächeln, Herr Doktor! — Ah — da ist ein Komplott im Werke gegen
uns. — Gretchen, merke, was ich Dir sage, und der Herr Doktor
weiß auch darum. Was ist es, Herr Doktor? Sagen Sie es mir,
ich bitte. Sie sind immer so gut.
Dr. Albert: Mein verehrtes Fräulein,
ich danke Ihnen für Ihre gute Meinung, und ich versichere Sie,
daß ich mich bemühen werde, mir dieselbe zu erhalten.
Aber ich bitte Sie, mich für einige Momente zu entschuldigen,
da ich Ihnen von Tannhäuser erzählen möchte; und
wenn ich das jetzt nicht thue, dann werde ich es vergessen.
Gretchen: Ist das derselbe
Tannhäuser, der in Richard Wagners Oper vorkommt?
Dr. Albert: Es ist derselbe. Wenn Sie auf
der Wartburg stehen und hinaus sehen in die Landschaft, dann sehen
Sie den Venus-Berg, als den schönsten unter allen anderen. In
diesem Berge ist die Frau Venus, die schönste Frau auf Erden,
und Tannhäuser, der tapfere Ritter, wohnte im schönen,
weiten Palaste bei ihr. Was sein Herz begehrte, wurde ihm erfüllt; und dennoch
war er nicht glücklich, und sprach zu Frau Venus:
Hohe Frau, nun laßt mich gehen! Ich will nach Rom zum
Papste und ihn bitten, daß er meine vielen Sünden mir
vergebe.
Sie bat ihn: Bleibet hier, mein Ritter, bleibet bei mir. Hier
ist es wahrlich schön, tausendmal schöner, als unter den
Menschen da oben. Tannhäuser schüttelte traurig sein
Haupt und sagte: Ich kann nicht, ich kann nicht, beste Frau. Und sie kniete
nieder vor ihm und blickte ihn an mit ihren schönen Augen und
flehte.
Nein, o nein, sagte er; ich kann nicht.
Sie hing sich an seinen Hals und weinte. Da riß er sich
los und eilte hinaus; — und im Pilger-Kleide und mit dem
Stabe in der Hand, wanderte er barfuß und barhaupt manchen
Tag und kam nach Rom.
An demselben Tage aber war eine große Prozession; und
Tannhäuser, der Ritter, fiel auf die Kniee vor dem Papste und
rief:
Vergebet mir, o Vater, meine vielen Sünden!
Und es sprach der Papst: Dein Blick ist scheu, mein Sohn, und
deine Wangen sind so hohl, sag an: Was hast du böses
getan?
Und der Ritter sagte: O Vater, vergebt mir; ich wohnte im Berge
bei Frau Venus.
Der Papst aber sprach darauf: Wohntest du da? — Wahrlich,
so wie dieser Stab in meiner Hand nie
blühen kann, so kann ich dir solche Sünde nicht vergeben;
— du bist verdammt hier und im Jenseits.
Und Tannhäuser ging traurig und mit gesenktem Kopfe aus der
heiligen Stadt.
Am nächsten Tage aber brachte man den Stab vor den Papst.
Zu seinem großen Erstaunen sah er Blüten am trocknen
Holze.
Eilig sandte der Papst Männer aus, den Ritter zu suchen;
aber keiner konnte ihn finden, denn er war schon wieder zurück
gegangen zum Berge.
Da stand Frau Venus wartend. Freudig rief sie aus, ihn mit
offnen Armen empfangend: Mein Ritter, mein Ritter! ich wußte,
ihr kämet zurück!
Martha Parks: Nun Albert,
weiter!
Dr. Albert: Mehr, meine kleine Martha
—
Bella: O, Herr Doktor; was ist
das?
Otto: Das ist
Trompeten-Schall.
Herr Meister: Gretchen,
höre! Ist das nicht wirklich ein Signal der Ritter?
Gretchen: Wirklich, Papa.
Martha Parks: O Albert, kommt
jetzt der Tannhäuser?
Louis: Nein, aber sein
Page.
Bella: Das ist Louis! Das ist
Louis im Ritter-Harnisch.
Gretchen: Ich glaube, Bella,
jetzt wird Dir alles klar werden.
Louis: Ludwig, der Page,
bittet die hohen Herrschaften, Ritter sowie Ritter-Damen, zur Tafel
zu kommen. — Ritter Meister wird das Burg-Fräulein
Martha Parks zu Tische führen; der Ritter Albert das
Ritter-Fräulein Martha Meister; Ritter Otto das
Ritter-Fräulein Bella, und der Page Ludwig selbst des edlen
Ritters Meister schöne Tochter Margaretha; und folgende
Speisen werden sie laben:
1) Eine gute Fleischbrühe.
2) Reis.
3) Fische, Aal und Salat.
4) Wilder Schweinskopf mit saurer
Sauce.
5) Ochsen-Fleisch, nach anglo-sächsischer
Weise mit Pickeln.
6) Schinken vom jungen Schwein, in Burgunder-Wein
gekocht.
7) Allerlei Geflügel.
8) Braten von Wildbret mit sauern
Kirschen.
9) Kuchen: Turmkuchen und Baumkuchen.
10) Nürnberger Pfeffer- und Honigkuchen in der Form von
Frauen und Rittern.
11) Waffeln und Eisen-Kuchen.
12) Und Wein, viel Wein.
Dr. Albert: Halt, Page, blase noch nicht
zum Marsche! Ich sehe, die Herrschaften stehen verwundert und
neugierig.
Bella: O nein, Herr Doktor;
wir sind nicht neugierig, wir sind niemals neugierig. Nicht wahr,
Gretchen?
Gretchen: O nein, niemals!
Dr. Albert: Aber Sie möchten wohl
gerne wissen, was alles dieses zu bedeuten habe; nun, ich werde es
Ihnen sagen. — Sie wissen ja, Louis studiert jetzt deutsche
Geschichte — und bei den Rittern hat er begonnen.
Otto: Und bei einem sehr
praktischen Teile, glaube ich.
Dr. Albert: Beim Essen und Trinken! Nun
sind unsere Eltern nach dem Westen gereist, und Louis spielt den
Herrn der Burg, wie er sagt.
Otto: Das bedauert aber keiner
mehr, als der Koch.
Martha Meister: Unser armer
Koch!
Dr. Albert: Der ist in Verzweiflung und
meint, solch' ein Mahl habe er noch nie zubereitet, und er habe doch schon manchen
Tag gekocht.
Gretchen: Das will ich gerne
glauben.
Dr. Albert: Aber Louis hat seinen Willen
und — sein Ritter-Mahl.
Louis: Und die Herrschaften
werden ein feines Mahl haben.
Martha Meister: Jedenfalls ein
originelles.
Dr. Albert: Und nun in den Speise-Saal.
Vorwärts! — Page, blase zum Marsch!
Louis: Sehr wohl. —
Dr. Albert: Setzen wir uns zur Tafel.
Martha Meister: Aber hier ist
es wirklich, wie in einem Ritter-Saale: Helme, Panzer, Schilde,
Lanzen. Gehört das alles dem Ritter Louis?
Bella: Du mußt nicht
Ritter sagen, Martha. Louis ist noch kein Ritter; er ist noch
Page.
Martha Meister: In meinen
Augen ist er bereits ein Ritter.
Louis: Ich danke Ihnen, mein
Fräulein; und ich werde für Sie kämpfen gegen
Drachen und wilde Tiere und böse Feinde; und werde Ihr Leben
verteidigen mit meinem Blute.
Martha Meister: Und ich werde
Sie bewundern.
Louis: Alles, was Sie hier
sehen an Waffen, hat mein Bruder für mich in Europa gesammelt. Das ist eine kostbare
Sammlung: Gefällt sie Ihnen, Herr
Meister?
Gretchen: Und wie schön
diese Tafel geordnet und mit Blumen geschmückt ist!
Otto: Das ist Schwester
Marthas Werk.
Bella: Du hast auch davon
gewußt, Martha; — o, Du kleine Heuchlerin!
Martha Parks: Siehst Du nun,
Louis, daß ich schweigen kann?
Louis: O ja, das hast Du von
mir gelernt, Martha.
Dr. Albert: Louis, Deine Suppe wird
kalt!
Louis: Hm, hm; ich spreche
wieder zu viel. Nicht wahr?
Bella: Ich meine, Herr Doktor,
es sei ganz schön, bei Tische zu sprechen. Die Franzosen
wissen gewiß sehr gut, wie man speisen
soll, und sie sprechen sehr viel, wenn Sie essen.
Martha Meister: Die Franzosen
plaudern mir zu viel bei Tische. — Ich halte es mit den
Engländern; die sind ernst bei Tafel und beginnen mit Gebet;
und so machen wir es auch zu Hause. — Was denken Sie, Herr
Doktor?
Dr. Albert: Ich halte es mit den Deutschen.
Viele von ihnen beginnen das Mahl mit Gebet und plaudern
während des Essens ganz angenehm. Bruder Otto aber macht es, wie der
Engländer: Er speist, er hört und bedient seine Dame.
Otto: Nicht so, Albert; ich
speise weder wie ein Engländer, noch wie ein Deutscher, noch
wie ein Franzose; sondern wie ein wahrer Amerikaner; das
heißt: Ich nehme das Beste von allen, und bin ich, wie jetzt,
im Kreise guter Freunde und an der Seite einer Dame, wie
Fräulein Bella, und habe ich vor mir gute Speisen und feine
Weine und höre ich eine leichte und angenehme Unterhaltung,
— dann befinde ich mich recht komfortabel, recht
behaglich.
Herr Meister: Sie erinnern
mich an den großen deutschen Schauspieler Beckmann.
Fritz Beckmann war einer der besten Schauspieler in Berlin und
war sehr witzig und sehr komisch. — Wegen seines guten Humors
hatte er viele Freunde.
Einer von ihnen war Herr Hagen. Eines Abends gab Herr Hagen eine
große Gesellschaft. Bei Tische hatte Herr Beckmann seinen
Sitz zwischen den beiden Töchtern des Hauses: Anna Hagen und
Carolina Hagen.
Herr Beckmann sprach lange Zeit kein Wort, sondern lächelte
immer. Darüber wunderte man sich, und Fräulein Carolina
fragte ihn: Warum so still, heute Abend, Herr Beckmann? Sind Sie
nicht wohl?
O nein, mein Fräulein. Mir ist sehr wohl zu Mut in der
Tat. Denn zwischen A. Hagen und C. Hagen sitze ich mit B. Hagen
(Behagen = Komfort).
Louis: Bravo, Herr Meister,
bravo!
Bella: Aber, Louis, ich habe
keine Gabel.
Martha Parks: Ich auch nicht,
der Diener hat die Gabeln vergessen.
Louis: O nein, liebe Martha,
das hat der Diener nicht. Aber Ritter und Ritter-Fräulein
haben keine Gabeln zum Essen nötig.
Bella: So? Aber womit haben
sie denn das Fleisch gegessen? Nicht mit den bloßen Fingern,
will ich hoffen.
Louis: Nein, mein
Fräulein; nicht mit den bloßen Fingern, sondern mit
kleinen Hölzern, so wie diese sind, die neben Ihren Tellern
liegen.
Gretchen: Ja, ich habe mich im
Stillen über diese Hölzchen gewundert.
Martha Meister: Aber damit,
Herr Louis, können wir nicht essen.
Louis: Aber die
Ritter-Fräulein konnten es früher. Gabeln kamen erst vor
drei hundert Jahren aus Italien nach Deutschland, und erst
später, im Jahre 1608, brachte Thomas Congate die ersten
Gabeln nach England. — Und in einem französischen
Kloster zankten sich die Mönche über die Einführung
der Gabel. Die älteren Mönche hielten den Gebrauch der
Gabel für sündhaft, während die
jüngern die Gabeln für erlaubt hielten.
Gretchen: O, wie gelehrt Sie
sind, Herr Louis!
Martha Meister: Sie studieren
wohl recht viel, Herr Louis?
Louis: Hm, ja.
Bella: Das muß ich aber
auch an Anna nach Cöln[III-10]
schreiben.
Louis: Ja, tun Sie das. So.
— Jetzt sollen Sie auch moderne Gabeln haben. Johann, bring'
Gabeln!
Gretchen: Ich möchte
Ihnen ein Rätsel geben. Wer ist der größte
Tyrann?
Bella: Louis?
Gretchen: O nein, Bella!
Martha Parks: Napoleon?
Gretchen: Nein.
Otto: Cäsar?
Gretchen: Nein!
Dr. Albert: Wallenstein?
Gretchen: Nein!
Herr Meister: Nero?
Gretchen: Nein!
Louis: Aber wer denn,
Fräulein Gretchen?
Gretchen: Der Magen.
Martha Parks: Der Magen?
Louis: Das innere Organ hier
im Centrum meines Körpers?
Gretchen: Ganz recht; —
denn der Magen herrscht mit bitterer
Strenge über alle Menschen zu Wasser und zu Lande.
Dr. Albert: Und zu Wasser tyrannisiert er
oft fürchterlich.
Gretchen: Und er herrschte zu
allen Zeiten.
Louis: Das ist wahr.
Gretchen: Und nimmt keine
Kultur an und ist gegen Damen ebenso grausam, wie gegen
Männer; und alle erkennen seine Herrschaft an.
Otto: Sie haben recht,
Fräulein, der Magen ist der größte Tyrann.
Martha Parks: Ich will Euch
auch ein Rätsel geben; soll ich?
Dr. Albert: Nun, Schwesterchen, laß
hören!
Martha Parks: Welcher Ring ist
nicht rund?
Louis: Aber alle Ringe sind
rund!
Martha Parks: O, ich
wußte, daß niemand es raten würde.
Otto: Nun, Martha?
Martha Parks: Der He —
ring.
Alle: Bravo, Martha,
bravo!
Louis: Das war wirklich gut,
teuerstes Schwesterchen. — Johann, bring' Champagner: —
Albert, kennst Du Papas Anekdote? Einmal sagte Papa im Hotel zum
Kellner: Bringen Sie mir eine Flasche Wein! Oui. — Sie sprechen
französisch? — Yes. — Auch englisch? — Ja.
Otto: Meine Herrschaften, hier
kommt der Champagner. Das erste Glas sei für den Burg-Herrn!
Meine Damen und meine Herren! Louis, der Amerikaner und Deutsche,
der Gesellschafter und Historiker, der Page und Burg-Herr, —
Louis, der alles ist und alles kann — Louis soll leben
— hoch! hoch! hoch!
Dr. Albert: Komm', Louis, stoß' an.
Laß' die Gläser klingen. — Ah, das gab einen guten
Ton!
Herr Meister: Ich stoße
mit Ihnen an, Louis. Auf Ihr Wohl!
Louis: Auf Ihr Wohl, Herr
Meister! und Fräulein Martha, Sie haben kein Glas?
Martha Meister: Ich trinke
niemals Wein.
Otto: Prosit, Bruder
Louis!
Louis: Prosit, Bruder Otto,
und auf Ihr Wohl, Fräulein Bella!
Bella: Wohl bekomm's, Herr Louis!
Louis: Deine Gesundheit,
liebes Schwesterchen!
Martha Parks: Gesundheit,
Bruder Louis!
Louis: Fräulein Gretchen,
jetzt habe ich die Runde gemacht und nun bleibe ich wieder bei
Ihnen und stoße mit Ihnen noch einmal an.
Gretchen: Otto will sprechen!
hören Sie, Louis!
Otto: Meine Herrschaften! Wir
trinken Kaffee und Thee aus den Tassen und stoßen nicht an;
wir trinken Wasser aus unseren Gläsern und stoßen
niemals an; aber trinken wir Wein, dann stoßen wir an.
— Warum tun wir das beim Wein allein? Warum?
Herr Meister: Ich habe niemals
darüber nachgedacht, Herr Otto.
Otto: Nun wohl. Man
erzählt sich:
Einmal saß ein Weiser mit seinen Schülern beim Weine.
— Meister, sagte ein Jünger, wenn wir mit dir trinken,
dann sind unsere fünf Sinne angenehm beschäftigt. An unserm
ganzen Körper fühlen wir den Effekt des Weines; unsere
Zunge schmeckt den Wein, unsere Nase riecht ihn und das Auge sieht
ihn mit Wohlgefallen;
unser Ohr aber hört die hohen Worte der Weisheit, die du
sprichst in der Begeisterung durch den Wein. —
Und wieder einmal saßen die Jünger zusammen beim
Weine; aber der Meister war nicht bei ihnen. — Da sagte
derselbe Schüler: Ach, heute genießen nur vier Sinne den
Wein; denn wir hören nicht die weisen Worte unseres
Meisters.
So laßt uns denn, rief da ein anderer Schüler, die
Gläser zusammen stoßen und rufen: Heil unserm Meister!
— Sie taten so; sie hörten das Klingen der Gläser;
und von diesem Tage an stoßen die Menschen an, wenn sie Wein
trinken, und denken des Freundes oder der Freunde.
Herr Meister: Das ist eine
feine Erklärung.
Bella: Und eine
philosophische.
Dr. Albert: Jetzt will ich Ihnen noch eine
Anekdote erzählen; dann ist die Tafel aufgehoben und wir begeben uns in das
Musik-Zimmer.
In einem Hotel in Jena saß einst ein alter Herr in einer
Ecke am Tische und trank Wein. — Der Wein aber war dem Herrn
zu stark, und er mischte ihn darum mit Wasser.
In demselben Hotel, in einer andern Ecke, saßen drei
Studenten am Tische. Auch sie tranken Wein; aber sie mischten ihn nicht mit Wasser;
und sie lachten über den alten Mann, der seinen Wein
verdünnte.
Endlich stand ein Student auf, trat vor den alten Mann und
sprach: Herr, wissen Sie auch, daß Sie eine große
Sünde begehen, die edle Gottes-Gabe, den Wein,
mit Wasser zu verdünnen? Sprachs und setzte sich. Der alte
Mann aber stand auf und sprach:
Wasser allein macht stumm,
Das beweisen im Wasser die Fische.
Wein allein macht dumm,
Das beweisen die Herren am Tische.
Und da ich nun keines von beiden will sein,
So vermische mit Wasser ich meinen Wein.
Sprach's und ging hinaus. Die Studenten aber waren mäuschenstill; denn sie
wußten jetzt, wer dieser alte Herr war. Es war —
Goethe[III-11].
Otto: Das war gut.
Dr. Albert: Wenn Sie belieben, meine Damen, so gehen wir in das
Musik-Zimmer. Gesegnete Mahlzeit!
Alle: Gesegnete Mahlzeit!
Martha Meister: Der Herr
Doktor ist wohl so freundlich und singt uns eins von seinen
Studenten-Liedern vor.
Dr. Albert: Mit Vergnügen, mein
Fräulein. Wollen Sie die Güte haben, mich zu
begleiten.
Dr. Albert (singt):
Krambambuli, das ist der Titel
Des Tranks, der sich bei uns
bewährt;
Es ist ein ganz probates Mittel,
Wenn uns was Böses widerfährt.
Des Abends spät, des Morgens früh
Trink ich mein Glas Krambambuli.
Krambimbambambuli, Krambambuli!
Bin ich im Wirtshaus
abgestiegen,
Gleich einem großen Kavalier,
Dann laß' ich Brot und Braten liegen
Und greife nach dem Pfropfenzieh'r.
Dann bläst der Schwager Tantranti
Zu einem Glas Krambambuli.
Krambimbambambuli, Krambambuli!
Braust mir's im Kopf, reißt
mich's im Magen,
Hab' ich zum Essen keine Lust;
Wenn mich die bösen Schnupfen plagen,
Hab' ich Katarrh auf meiner Brust:
Was kümmern mich
die Medici?
Ich trink' mein Glas Krambambuli.
Krambimbambambuli, Krambambuli!
Wär' ich zum großen Herrn geboren,
Wie Kaiser Maximilian,
Wär' mir ein Orden auserkoren,
Ich hängte die Devise dran:
"Toujours
fidèle et sans souci,
C'est
l'ordre du Krambambuli!"
Krambimbambambuli, Krambambuli!
Ist mir mein Wechsel ausgeblieben,
Hat mich das Spiel labét
gemacht,
Hat mir mein Mädchen abgeschrieben,
Ein'n Trauerbrief die Post
gebracht:
Dann trink' ich aus Melancholie
Ein volles Glas Krambambuli.
Krambimbambambuli, Krambambuli!
Und hat der Bursch kein
Geld im Beutel,
So pumpt er die Philister
an
Und denkt: »Es ist doch alles eitel,
Vom Burschen bis zum Bettelmann!«
Denn das ist die Philosophie
Im Geiste des Krambambuli.
Krambimbambambuli, Krambambuli!
Soll ich für Ehr' und Freiheit fechten,
Für Burschenwohl den Schläger ziehn,
Gleich blinkt der Stahl in meiner
Rechten,
Ein Freund wird mir zur Seite stehn;
Zu ihm sprech' ich: »Mon cher ami,
Zuvor ein Glas Krambambuli!«
Krambimbambambuli, Krambambuli!
Alle: Bravo, bravo!
Louis: Das gefällt mir,
das muß ich auch lernen.
Bella: Sagen Sie, Herr Doktor,
waren Sie auch einmal im Carcer?
Dr. Albert: Darüber, mein liebes
Fräulein, darüber müssen Sie mich nicht fragen; denn
diese Frage möchte ich Ihnen nicht beantworten. Aber wenn Sie
mich fragen, wie das Innere eines Carcers ist, — das will ich
Ihnen wohl sagen.
Gretchen: Da ist es wohl recht
finster und schaurig; so habe ich es mir immer gedacht.
Dr. Albert: Im Gegenteil, mein
Fräulein. Der deutsche Student lebt leicht und frei und froh,
für ihn giebt es nichts Schauriges; doch, vielleicht das
Examen am Ende, — sonst ist alles heiter,
— auch seine Gefängnisse; auch darin macht er sich das
Leben froh, empfängt Besuche und tut oft, was er will.
Ich habe einen Carcer gesehen, der wirklich schön war.
Jeder Student, der in demselben gesessen hatte, hat etwas zur
Verschönerung beigetragen. Viele
haben Bilder an die Wände gemalt, und einige dieser Bilder
waren recht schön.
Ich erinnere mich eines Bildes: Es ist ein Vulkan. Darauf sitzt
ein Student und raucht und bläst aus seiner langen Pfeife
furchtbaren Rauch. Der Professor aber, durch den er in den Carcer
gekommen war, rennt davon aus Furcht.
Louis: Das gefällt mir
auch.
Otto: Soweit, meine Damen,
sind wir unserm Programm treu geblieben. Sollen wir es auch
ferner?
Alle: O, gewiß.
Otto: Nun wohl; dann bitte
ich, von jetzt an mir zu folgen. Unsere Wagen sind angespannt, um uns an
meine Yacht zu bringen. Wir werden dann eine Fahrt in die Bai
unternehmen.
Martha Parks: Ja, und Musik
haben wir auch.
Bella: O, ist das nicht
herrlich, Gretchen? — Aber —
Gretchen: Aber was ist Dir
denn, Bella? Du wirst ja so scheu?
Bella: O nichts, nichts. Ich
dachte gerade an einen Traum, den ich einmal gehabt habe.
Louis: O, heute giebt es
keinen Sturm und keine großen Fische mit hundert Köpfen.
Ich erinnere mich Ihres Traumes sehr gut.
Otto: Nein, Fräulein
Bella. Ich verspreche es Ihnen. Wir haben eine herrliche Fahrt bei
Vollmond, und ich bin der Kapitän.
Louis: Vorwärts denn,
meine Herrschaften. Vorwärts! Zur See! Zum Vergnügen!

IV.
Gretchen: So frühe heute
in Deinem Blumen-Hause, Schwester? — Guten Morgen. Wenn ich
Dich ansehe, muß ich an die schönen Worte denken:
Du bist wie eine Blume,
So hold, so schön, so rein.
Ich schau' Dich an, und Wehmut
Schleicht mir in's Herz hinein.
Du bist traurig, Martha? — Du hast wirklich Fieber. Bist
Du nicht wohl?
Martha Meister: Habe keine
Besorgnisse um mich, liebes Gretchen. Ich habe letzte Nacht wenig
oder gar nicht schlafen können, — sonst ist es
nichts.
Gretchen: Du hast nicht
schlafen können? Dann bist Du krank, Martha.
Martha: Nein, Schwester. Ich
versichere Dich, mir ist wohl; wirklich, sehr wohl; ich bin sogar
glücklich.
Gretchen: So? Und davon wird
man bleich? Das, Schwester, ist
ganz neu für mich.
Martha: Weißt Du,
Gretchen, ich habe in der letzten Nacht sehr viel denken
müssen.
Gretchen: Ach, das böse
Denken und Sorgen! Das ist recht häßlich! Das macht alt,
bringt Falten in das Gesicht und macht die Haare grau.
Martha: Aber, Schwester, kann
die Erde es hindern, daß die Gräser sprossen? Kann die Pflanze es hindern,
daß die Knospen kommen? — Nun, so wenig können wir
das Denken verhindern. Gedanken kommen von selbst.
Gretchen: Ist das so mit Dir?
— Ich glaube, mit mir ist es anders.
Martha: Denkst Du nicht auch,
Gretchen, daß es recht traurig ist, wenn ein großer
Mensch nicht den rechten Platz gefunden hat in der Welt und in
einem kleinen Zirkel schaffen muß ohne Freude?
Gretchen: Ja, das ist recht
unglücklich für ihn. Dann ist er wie der Fichten-Baum,
von welchem der Dichter singt:
Ein Fichten-Baum steht einsam
Im Norden auf kahler
Höh'.
Ihn schläfert; mit
weißer Decke
Umhüllen ihn Eis und
Schnee.
Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgen-Land
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsen-Wand.
Martha: Gretchen, ich will Dir
ein Geheimnis sagen.
Gretchen: Und ich soll es
niemandem wieder sagen, nicht wahr?
Martha: Nein, niemandem. — Ich glaube,
der Herr Doktor Albert ist nicht glücklich. Er ist Doktor der
Medizin, und der Beruf des Arztes paßt nicht
für ihn.
Gretchen: Aber, liebe Martha,
wie weißt Du das?
Martha: Ich weiß es
nicht; aber ich fühle es.
Gretchen: Und Du meinst
wirklich, der Herr Doktor sei ein großer Mann?
Martha: Ich meine, daß
er alles das besitzt, was ihn zu einem großen Mann
machen könnte, wenn er den rechten Platz fände. Denke,
Gretchen, an das, was ich Dir heute Morgen sagte.
Da kommt auch unsere liebe Mama. Guten Morgen, Mama! Wie hast Du
geschlafen?
Frau Meister: Gut, meine
Tochter; ich danke Dir. Aber Du bist heute Morgen sehr früh
bei Deinen Blumen; und ohne Frühstück. Das ist nicht
recht, Kind.
Bella: Nein, Martha, das ist
gar nicht recht von Dir. Guten Morgen! Guten Morgen!
Gretchen: Das ist schön,
daß Du so früh kommst.
Bella: Ich wünsche, Frau
Meister, Sie wären gestern bei uns gewesen! Louis' Ritter-Mahl
war wirklich sehr komisch; und die Fahrt gestern Abend, — war
das nicht herrlich, Gretchen?
Frau Meister: Soeben war der
Diener der Herren Parks hier, um nach Eurem Befinden zu fragen.
Auch brachte er einen Korb mit Früchten.
Gretchen: Wie aufmerksam!
Bella: Als ich im Hause nach
Euch fragte, sah ich den Korb. Solche Äpfel habe ich noch nie
gesehen, so rot, so glänzend, so rund; Weintrauben,
Orangen, Pfirsiche, — denkt nur, in dieser Jahreszeit
Pfirsiche, — und ich glaube, auch Ananas.
Frau Meister: Ich ließ
den Herren meinen herzlichsten Dank sagen für ihre Güte
und Aufmerksamkeit und auch, daß ich mich noch mehr zu den
Früchten freuen würde, wenn die Geber heute Abend zu uns
kommen wollten, um sie mit uns zu speisen.
Bella: »Denn es ist der
Anblick der Geber so schön, wie die Gaben.«
Martha: Ich finde, daß
Ihr beide, Bella und Gretchen, heute Morgen sehr poetisch seid.
Bella: Nicht wahr? Ich habe
soeben »Hermann und Dorothea« gelesen, — das ist
ein herrliches Gedicht.
Martha: Willst Du heute bei
uns bleiben, Bella? Du könntest mit Schwester Gretchen
plaudern. Wenn Mama und ich heute Vormittag ausgehen, werde ich diesen
Strauß Deiner Mama bringen und ihr sagen, daß Du heute
bei uns bleiben möchtest. Ist es Dir recht?
Bella: Das ist mir sehr lieb,
Martha. Für wen hast Du alle diese Blumen gepflückt?
Martha: Diesen Strauß gebe ich Dir, meine liebe
Mama, und diesen stelle ich meinem Papa auf den Schreib-Tisch. Er
ist gewohnt, jeden Morgen frische Blumen dort zu finden, — und diese
Blumen kommen in das Hospital für die armen Kranken.
Frau Meister: Die Blumen
kommen ihnen immer wie eine Himmels-Gabe. — Ich glaube, meine
Tochter, es wird bald Zeit, daß wir gehen. Ihr aber bleibt
ruhig hier; es ist hier schön.
Martha: Adieu, Gretchen;
adieu, Bella. Auf kurze Zeit nur.
Frau Meister: Adieu, meine
Lieben!
Bella: Ihr habt aber ein
schönes Blumen-Haus, Gretchen.
Gretchen: Papa hat es für
Martha gebaut. Sie liebt die Blumen.
Bella: Wer liebt nicht die
Blumen? — Vorgestern Abend saß ich bei meiner guten
Mama. Sie blickte tiefsinnig auf einen herrlichen Strauß,
der vor ihr stand. Ich aber las ihr vor aus den Psalmen: »Die
Himmel erzählen die Ehre Gottes« — ja, unterbrach
mich Mama, — und die Blumen erzählen von der Liebe
Gottes.
Gretchen: Ja, ja. Deine Mama
liebt Blumen und Vögel und Musik und Poesie. Ihr geht es wie
mir. Jede Blume ist für mich ein poetischer Gedanke der Natur.
Begreifst Du das wohl? Viele Blumen haben auch einen Charakter wie
die Menschen; das ist ganz gewiß wahr, Bella. An manchen kann
man die Freude
sehen, an anderen wieder die Schwermut oder die Liebe, auch den Haß
und den Stolz oder die Bescheidenheit.
Bella: Sieh' nur diese
schöne Rose! Meinst Du nicht auch, daß die Rose die
schönste sei unter allen Blumen?
Gretchen: Ja. Aber weißt
Du auch, warum sie es ist?
Bella: Nein. Warum,
Gretchen?
Gretchen: Weil die Rose von
einer Frau stammt.
Bella: Von einer Frau? Ha, ha,
ha! Die Rose von einer Frau, o Gretchen!
Gretchen: Nun, höre
einmal zu: Es ist schon lange her, da war in Corinth eine Nymphe
und ihr Name war Rotanda; und sie war die Herrin von Corinth und
war so schön, daß die stärksten und besten jungen
Männer zu ihr kamen und um ihre Hand baten.
Sie aber hatte stets gesagt: »Wer meine Liebe gewinnen
will, muß um sie kämpfen«; und sie floh in den
Tempel der Diana. Ihre Bewunderer folgten und öffneten die
Thüre des Tempels mit Gewalt, — und da stand Rotanda mit
dem Schilde in ihrer Linken und dem Schwerte in ihrer Rechten; ihr
Gesicht war gerötet, ihre Augen flammten in feurigem Mut.
Ah, wie schön! rief das Volk der Griechen; ah, wie
schön! Sie sei die Göttin dieses Tempels! Und das Volk
nahm die Statue der Göttin Diana und warf sie hinaus vor den
Tempel.
Apoll aber, Diana's Bruder, war erzürnt über solchen
Frevel; mit zornigen Augen sah er hinab auf
Rotanda. Da wurde sie starr; ihre Füße
wurden fest in der Erde wie Wurzeln, ihre Arme wurden wie Zweige
eines Baumes, ihre Haare wurden wie Blätter und
Blüten.
Rotanda war verwandelt worden in einen Rosen-Busch mit Dornen;
ihre Bewunderer aber waren Schmetterlinge geworden; und diese
fliegen noch heute zur Rose und lieben sie und küssen sie.
Bella: So ist die Rose
entstanden? Das habe ich nicht gewußt. Aber nun weiß
ich, warum die Rose so schön und lieblich ist. Ich danke Dir
vielmals, liebes Gretchen.
Gretchen: Ich will Dir ein
schönes Gedicht von Heine sagen, oder kennst Du es schon? Es
lautet so:
Der Schmetterling ist in die Rose verliebt,
umflattert sie tausend
mal.
Ihn selber aber, goldig zart,
Umflattert der liebende Sonnen-Strahl.
Jedoch in wen ist die Rose verliebt,
Das wüßt' ich gar zu gern.
Ist es die singende Nachtigall?
Ist es der schweigende Abend-Stern?
Ich weiß nicht, in wen die Rose
verliebt.
Ich aber lieb' euch all':
Rose, Schmetterling, Sonnen-Strahl,
Abend-Stern und Nachtigall.
Und nun nimm dieses.
Bella: Aber was denn,
Gretchen?
Gretchen: Dieses
Rosen-Blatt.
Bella: Dieses eine Blatt nur?
Du scherzest!
Gretchen: Nimm es, Bella, nimm
es.
Bella: Aber warum denn?
Gretchen: Wenn ich Dir ein
Rosen-Blatt gebe, so bedeutet das so viel, als würde ich zu
Dir sagen: Liebe Bella, komm recht oft zu mir, so oft Du willst; Du
kommst mir nie zu viel.
Bella: Ist das die
Blumen-Sprache?
Gretchen: Ja; kennst Du jene
Sage nicht?
Bella: Ach, Gretchen, ich
weiß gar nichts, und Du weißt so viel. Du mußt
mich alles das lehren; willst Du, Gretchen?
Gretchen: Gerne, Bella, gerne.
— Da war einmal eine Akademie und darin waren zwanzig
gelehrte Männer. Ihr Prinzip aber war: Viel hören, viel
denken und wenig sprechen, und niemals waren mehr als zwanzig
Männer in der Akademie.
Da kam einmal ein gelehrter Doktor aus dem Orient und
wünschte, in die Akademie aufgenommen zu werden.
Der Präsident der Akademie wollte nicht gerne nein sagen
und aufnehmen konnte man ihn auch nicht gut. — Was war zu
tun?
Man nahm ein Glas, füllte es mit Wasser, so daß kein
Tropfen mehr hineinging, und stellte es vor den gelehrten Mann aus
dem Orient.
Er verstand das Symbol und traurig stand er auf und wollte
gehen. Da sah er auf der Erde ein Rosen-Blatt liegen. Ein Gedanke
kam ihm; er nahm das Blatt, legte es auf das volle Glas Wasser, und
siehe, kein Tropfen floß über.
Die Akademiker sahen, applaudierten und nahmen ihn auf in ihre
Akademie. So, jetzt weißt Du auch, was ein Rosen-Blatt
bedeutet, nicht wahr?
Bella: Ja, und ich will es mir
merken. Und nun sage mir auch, woher der Name:
»Vergiß-mein-nicht« kommt, bitte.
Gretchen: Ein Paar ging einmal
an der Donau spazieren; es war am Abend ihrer Hochzeit; sie sahen
in das Wasser.
Sieh' da, sieh! — Da schwimmt ein Strauß! rief die
Braut, ach, die schönen kleinen Blumen! Sie müssen
ertrinken, und ich liebe
diese blauen Blümchen über alles.
Warte, sprach er und war bereits in den Strom gesprungen; aber
das Wasser der Donau war sehr wild und riß ihn hinab in die
Tiefe; — noch einmal kam er herauf, — die Blumen hielt
er fest in der Hand und mit seiner letzten Kraft warf er sie in die
Höhe zu ihr, die er liebte, und rief: Vergiß-mein-nicht!
dann versank er und ward nie mehr gesehen.
Bella: Eine Blumen-Fabel
weiß ich auch, die mir Dein Papa einmal erzählt hat. Es
war einmal ein Schäfer namens Narziß, der trieb
seine Schafe an
den Bach. Er blickte in das klare Wasser und sah zum ersten Male
sein Bild. Er bewunderte es, blieb lange Zeit da stehen und konnte
sein Auge nicht von dem schönen Bilde wenden. Zeus aber
zürnte über diese Eitelkeit und verwandelte den Schäfer in
eine Blume — Narzisse, und seitdem steht sie traurig an den
Bächen mit gesenktem Haupte.
Gretchen: Komm' hierher,
Bella, an die Fontaine; hier ist eine Narzisse.
Bella: Dieses ist die erste,
die ich sehe. — Kannst Du mir sagen, Gretchen, warum wir
einen Braut-Kranz von Orangen-Blüten tragen, wenn wir Hochzeit
machen?
Gretchen: Das weiß ich
nicht, Bella.
Bella: In Deutschland
trägt die Braut keinen Kranz von
Orangen-Blüten.
Gretchen: So? Wie weißt
Du das?
Bella: Anna hat es mir
geschrieben.
Gretchen: Aber was hat man
dort anstatt der Orangen-Blüten?
Bella: Einen Zweig von der
Myrthe.
Gretchen: So? — In
Toscano ist es noch anders. Da tragen die Bräute einen
Strauß von Jasmin in der Hand, und ich will Dir auch sagen,
warum.
Jasmin war früher sehr selten in Europa. Schiffer hatten
diese Pflanze zuerst von Indien mitgebracht, und der Herzog von
Toscana hatte sie allein in seinem großen Garten und wollte
sie auch allein behalten und befahl seinem Gärtner,
keine Jasmin-Blumen zu vergeben.
Aber der Gärtner liebte ein Mädchen und brachte ihr an
ihrem Geburts-Tage einen großen, schönen Strauß;
darin war auch ein Zweig von Jasmin. Die Braut freute sich
darüber ganz besonders und pflanzte diesen Zweig in ihren
Garten.
Die Zeit verging, und der Gärtner hatte sein Mädchen
noch nicht heiraten können; denn ihre Mutter sagte: Der
Gärtner ist nicht reich genug.
Da verkaufte das Mädchen ihre Jasmin-Blumen, — bekam
dafür viel Geld und gab alles ihrem Bräutigam. Nun waren
sie reich und machten Hochzeit.
Bella: Und darum trägt
noch heute jede Braut in Toscana Jasmin an ihrem
Hochzeits-Tage?
Gretchen: Zum Andenken an das
kluge und treue Mädchen.
Bella: Weißt Du,
Gretchen, das gefällt mir, und wenn wir Hochzeit machen, Du
und Martha und ich, dann wollen wir auch Jasmin tragen. Sollen
wir?
Gretchen: Wir wollen mit
Martha darüber sprechen. Diese Pflanze —
Bella: Das ist Epheu.
Gretchen: Epheu bedeutet Treue
und Freundschaft. Das Epheu umschlingt den Baum liebevoll, will ihn
schützen, nicht wahr? Und wenn
der Baum alt wird und wenn man ihn fällt — das Epheu
bleibt ihm treu und grünt weiter.
Bella: Und ich gebe Dir ein
Epheu-Blatt.
Gretchen: Und ich nehme es an
und wir bleiben treue Freundinnen.
Bella: Ewig treue Freundinnen!
O, mir ist so wohl. Die Welt, die ganze Welt möchte ich jetzt
küssen!
Gretchen: Und ich möchte
in einem fort singen:
La, la, la,
La, la, la,
Tra, la, la, la.
Komm', Bella, in's Haus!
Frau Meister: Aber ich
bedauere sehr, daß ich Ihrem Herrn Bruder nicht ebenfalls
danken kann.
Bella: Ach, warum haben Sie
den Herrn Doktor nicht mitgebracht?
Otto: Mein Bruder ging nach
Mittag aus, um einige Fabriken zu besichtigen, sowie gegen Abend
die Druckereien unserer größten
Zeitungen. Er ist noch nicht zurück und ich vermute, daß
er noch in dem untern Teile der Stadt ist.
Martha Meister: Ich hoffe, Ihr
Herr Bruder ist wohl.
Otto: Danke, Fräulein; er
ist ganz wohl.
Louis: Das glaube ich nicht,
Otto. Gestern Nacht, da Du schon lange schliefst, hörte ich
ihn in seinem Zimmer, das über dem meinigen ist, auf und
abgehen, lange Zeit, so daß ich auch nicht einschlafen
konnte, obgleich ich sehr müde war. Und als ich heute Morgen
in Albert's Zimmer kam, saß er schlafend auf dem Stuhle,
und die Lampe
brannte noch; er war nicht zu Bette gewesen. Vor sich aber hatte er
Pläne von Maschinen, von Gebäuden und Kalkulationen, von
denen ich nichts verstand.
Aber, Albert, sagte ich zu ihm, gehört denn dieses auch zu
Deinem Studium? —
Er lächelte und antwortete nichts. Ich weiß wirklich
nicht, was ich von ihm denken soll. Mir kommt er vor, als sei er
seit gestern nicht mehr derselbe Mensch.
Otto: Das ist Deine Einbildung, Louis;
Einbildung, nichts mehr.
Gretchen: Schon lange habe ich
gewünscht, einmal zu sehen, wie unsere Zeitungen hergestellt werden; aber Papa hatte niemals
Zeit, und allein kann eine Dame nicht gehen. Die Herren haben es
darin viel besser, sie können gehen, wohin sie wollen, und
können tun, was sie wollen.
Bella: Ja, die Herren haben es
in allem besser.
Martha: Mama lächelt,
Mama glaubt es nicht.
Frau Meister: Nein, ich glaube
es nicht. Ich kannte einmal eine junge Dame, reizend und klug wie
Ihr; die sprach wie Ihr und — handelte darnach.
Bella: Und — Frau
Meister?
Frau Meister: Und als sie
ihren Irrtum einsah, war es zu spät.
Gretchen: Du sprichst aber
heute sehr mysteriös, liebe Mama. Entweder ist da etwas, was
ernst ist oder interessant.
Frau Meister: Oder beides.
Gretchen: Bitte, liebe Mama,
würdest Du nicht die Güte haben, uns mehr davon zu
erzählen?
Bella: O, tun Sie es, Frau
Meister, ich bitte reizend.
Frau Meister: Ich werde Euern
Wunsch erfüllen, um so lieber, da es sogar meine Pflicht ist.
Nur bitte ich um Eure Geduld und auch um die Ihrige, meine Herren,
wenn ich mehr Zeit gebrauchen werde, als Sie jetzt denken.
Martha: Wir wollen uns
näher zu Mama setzen; rücken Sie näher, Herr Otto
und Herr Louis.
Frau Meister: Es war im Sommer
18 .... Staub und Hitze hatten viele Leute aus der
geräuschvollen Stadt auf das Land getrieben; auch unsere
Familie hatte ihren Landsitz bezogen. Hohe, grüne Berge
ringsum, schattiger Wald, ein lustig rinnender Bach, ein
fischreicher See, und, soweit das Auge reichen konnte, eine
herrliche Landschaft, ein weites, geräumiges Sommerhaus mit
einem schönen Garten — das alles hatten wir, und das war
genug, uns glücklich zu machen.
Vater und Mutter waren in diesem Sommer besonders
glücklich; denn Martha, ihre älteste Tochter, lebte nun
nach ihrem Wunsche und war heiterer geworden, als sie sonst war.
Sie war nicht mehr so oft allein, sondern ging in Gesellschaften
und nahm oft teil an den Spaziergängen und Ausflügen.
Sie war sonst immer gut, war gehorsam und liebevoll gegen die
Eltern, sorgsam für ihre jungen Geschwister und freundlich
gegen alle, so daß man von allen, die sie kannten, nur eines
hörte: Sie ist schön und lieb, wie ein Engel; wie schade,
daß sie selbst nicht ganz glücklich ist!
Und alle dachten und fragten oft: Was mag es wohl sein,
daß sie so traurig ist, daß sie oft so melancholisch
aus ihren schönen, großen Augen sieht?
Alles dieses war aber in jenem Sommer ganz anders. Martha war
heiter, so heiter, wie alle anderen jungen Leute der
Gesellschaft.
Unter den jungen Herren aber waren zwei besonders interessant;
es waren zwei Deutsche. Sie hatten ihre Studien beendet auf einer
deutschen Universität, hatten eine Reise um die Welt
unternommen, hatten sogar Afrika durchreist, waren in
Palästina, in Ägypten, auch in China und Indien gewesen
und waren nun hier, um Amerika zu sehen und zu studieren.
Sie brachten Briefe und Empfehlungen von guten Freunden unseres
Vaters und waren gerne in unserer Familie gesehen, und auch sie
versuchten, uns angenehm und nützlich zu sein.
Wir hörten besonders gern, wenn sie von ihren Reisen
erzählten; denn sie erzählten interessant und sie selbst
waren es.
Der eine von ihnen war etwas schwärmerisch, viele
sagten: poetisch, wie wir es oft sehen bei Deutschen; und Martha hörte ihm
immer aufmerksam zu, wenn er seine Ideen über das Leben,
über Länder und Menschen aussprach.
Besonders aber bewunderte er die Frauen dieses Landes und oft
hörten wir ihn sagen: Durch viele Länder der Erde bin ich
gereist; aber unter den Frauen aller Nationen sah ich keine, die so
schön waren oder klüger oder edler, als die Frauen dieses
Landes.
Wir alle hörten das gerne; denn wir wußten, es war
sein Ernst.
Wenn wir ausgingen, so folgte Schwester Martha stets seiner
Einladung und ging an seinem Arme. — Schöne Tage
vergingen so, und waren wir abends müde vom Vergnügen des
Tages, so wünschten wir doch den nächsten Morgen herbei
mit seinen neuen Freuden.
An einem Tage waren wir nach einem nahen Walde gegangen.
Schattige Kühle wehte uns entgegen und Wohlgeruch; wir
hörten das Lispeln der hohen Bäume
und das Konzert der kleinen Sänger. Auf dem grünen
Teppich gingen wir fröhlich dahin, pflückten hier und da
ein Blatt oder eine Beere und hatten bald die Welt außerhalb
des Waldes vergessen.
Auch mit Martha war es so. Sie war froh heute, ganz froh; ja,
sie war noch heiterer als sonst und
sang und sprang mit uns bald hierher, bald dorthin.
Dann lagerten wir uns auf einem
freien Platze und hielten unser Mahl, hörten Anekdoten,
Geschichten und Rätsel. Wir beendeten das Mahl, erhoben uns, gingen in den Wald, suchten Gräser und
Blumen, und so kam es, daß wir uns bald zerstreut
hatten.
Ich war mit einer Freundin gegangen; wir hatten seltene Pflanzen
gefunden; als wir müde waren, setzten wir uns nieder und lasen
aus einem Buche.
Wenige Minuten saßen wir, da hörten wir ein Lachen.
Da kommt Martha auch, sagte ich zu meiner Freundin; und richtig!
— da kam sie und rannte wie ein Reh; hinter ihr her kam aber
ihr Begleiter, der deutsche Herr; er wollte sie haschen, aber er konnte es nicht.
Sie sind schneller, als ich, rief er. Sie säumte eine Minute; er wollte sie
fassen; aber schnell war sie wieder entwischt und er hielt nur ein Band in seiner
Hand. — Sachte, mein Freund, sachte;
so schnell fängt man mich nicht, rief sie und lachte in solch'
herzlichem Tone.
Er folgte ihr nach. — Ah, sehen Sie? Sie können mich
nicht fangen!
Aber ich muß, sagte er.
Wenn ich will, sagte sie; nun wohl, hier will ich halten; ich
werde mich auf diese Schaukel setzen; sie hängt so schön
zwischen diesen großen mächtigen Bäumen.
Schaukeln Sie mich, Herr Doktor, — und sie saß
schon, und er schwang sie, daß sie hoch hinauf flog. Es war
ein herrliches Bild, wie sie in den Lüften schwebte.
So, das ist genug, rief sie endlich, — sehen Sie? Dort ist
eine Quelle, eine Heilquelle, und das Wasser darin ist weit und
breit berühmt; so sprechend, sprang
sie zur Erde und beide gingen zur Quelle.
Was sie sprachen, konnte ich nicht hören; ich sah nur, wie
sie dort standen, und wie er dann kniete, — und ich glaubte
damals, um Wasser zu schöpfen.
Der Tag endete so froh, wie er begonnen.
Der nächste Tag war ein Samstag. Es war trübe, und der Regen fiel in
Strömen herab. Ich saß am Fenster und sah die dicken
Tropfen am Fenster-Glase herunterfließen. Ich sah auf die
Straße und lachte, wenn dann und wann ein Mann schnell
vorüber rannte. Sonst war alles öde, — auch in
unserm Hause. — Martha sah ich den ganzen Tag nicht einmal;
sie wäre ein wenig unwohl, ließ sie sagen, und
hätte keinen Appetit.
Sonntag kam, die Sonne schien wieder ein wenig. Die Glocke
läutete zur Kirche. Da sah ich Schwester Martha wieder zum
ersten Male; sie war nicht mehr dieselbe.
Bist Du wieder wohl, liebe Martha, rief ich ängstlich?
Danke, Schwester, ich bin wohl, antwortete sie und lächelte
ernst. Ihr Lächeln war so eigentümlich, und in
ihrer Stimme lag ein fremder Ton.
Wir gingen zur Kirche. So inniglich sang heute Martha, so
inniglich betete sie heute! Thränen rollten aus ihren Augen,
und sie hörte aufmerksam auf die Predigt des Geistliche.
Ich erinnere mich der Predigt noch heute. Der Text war: Lucas
18, Vers 29 u. 30.
»Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage Euch, es ist
niemand, der ein Haus verläßt oder Eltern oder
Brüder oder Weib oder Kinder, um des Reiches Gottes willen,
der es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und in
der zukünftigen Welt das ewige Leben.«
Von diesem Tage an wurde Martha stiller, als sie je zuvor
gewesen war. — Sie blieb freundlich und liebevoll gegen alle.
Sie selbst aber glich einem Engel, der still
im Hause waltete.
Doch der Vater schüttelte ernst den Kopf, und die Mutter
war traurig, und die Freunde gingen nachdenkend vom Hause.
Und da war einer, der litt besonders.
So verging der Rest des Sommers, und als der rauhe Wind durch
die Bäume fuhr und die Blätter herabwehte, zogen wir
wieder zur Stadt, — und bald kam ein Fest, — ein Fest
der Freude für Martha, nicht für uns. Martha stand im
langen Gewande vor dem Prediger, der sie dem Konvente unserer
episkopalischen Kirche weihte.
Vaters Haar war weiß geworden. Oft, sehr oft, hörte
ich ihn im Schlafe sprechen: O mein Kind, mein Kind!
Und war sie glücklich geworden?
Oft kam ich zu ihr in's Kloster. Mir wurde stets so wohl, wenn
ich sie sah, und so ging es allen Menschen, wenn sie zur guten,
schönen Schwester Martha kamen. — Wenn Schwester Martha
an das Bett der Kranken trat, so fühlten sie Erleichterung, und berührte sie
die Kranken mit der Hand, so schwanden die Schmerzen.
Sie selbst aber war am liebsten unter den Kindern und bei den
älteren Mädchen in der Schule des Konvents und hier wurde
sie am meisten geliebt, so vom ganzen, warmen, jungen Herzen der
Mädchen.
Als ich sie wieder einmal in der Schule sah unter den
fröhlichen Mädchen, sprach ich zu ihr: Du bist doch recht
glücklich!
Glücklich, sagte sie langsam, — ach ja, ich bin's.
— Ich sah sie verwundert an und zweifelte zum ersten
Male an ihrer Zufriedenheit.
So waren wieder einige Jahre vergangen, und große Trauer
herrschte im Konvent, besonders in der Schule,
denn die gute, schöne Schwester Martha war krank, bedenklich krank, hatte der Arzt gesagt.
Ich war viel bei ihr; sie wünschte es; zuletzt kam ich
nicht mehr von ihrem Bette hinweg.
Da eines Tages, spät am Nachmittage, faßte sie wieder
meine Hand und sagte: Teure, höre mir zu; ich habe mit Dir zu
sprechen.
Ich rückte näher, so daß ich ihre schwache
Stimme besser hören konnte; ihre Hand ruhte in der meinen, und
sie sah mir in die Augen so tief, so innig und so liebevoll, und
ihre Stimme klang so mild.
Schwester, sagte sie, geh' und öffne jenes Fenster. —
Ich ging und tat es und kam zurück und sagte:
Du siehst so wohl aus, beste Schwester, bald wirst Du wieder
ganz gesund sein.
Sehr bald; — siehst Du die Sonne dort, meine Liebe?
— Bald wird sie sinken hinter jenem Berge und dann scheint
sie mir niemals mehr.
O, sprich nicht so; nein, o nein! sagte ich.
Weine nicht, sprach sie dann mit freundlicher Stimme, weine
nicht; sei glücklich mit mir; denn jetzt bin ich wirklich
glücklich, endlich einmal nach langen, langen Jahren.
O, Gott; warst Du es denn nicht immer?
Ich war es nicht. Höre meine Worte; es werden meine letzten
sein.
Meine teure, liebe Schwester, sagte ich.
Sie begann:
Denkst Du noch jenes Sommer-Tages, da wir einen Ausflug machten
in den Wald? Da war es, daß mich ein edler Mann gebeten
hatte, sein Weib zu werden; und bevor ich noch Antwort gab, ja oder
nein sagen konnte, kam die Gesellschaft zu uns. Wir gingen nach
Hause und in dieser Nacht kämpfte ich einen schweren Kampf mit
mir selbst:
Soll ich sein Weib werden? Soll ich an das Haus gebunden sein?
Soll ich die vielen, kleinen Dienste tun, — ich, die ich das
Größte, Edelste tun wollte? — Was kann das Weib
großes tun im Hause? — Der Mann tut das Große
außer dem Hause, — soll es nicht auch das Weib
können? — Und wahrlich, ich fühlte Kraft genug in
mir.
So dachte ich und traf meine Entscheidung. — Du kennst sie.
— Ich kam hierher mit hohen Ideen, mit großen
Plänen, — ach, sie waren so schön! — Aber es
waren die Pläne eines Mädchens.
So viel Unglück hatte ich in der Welt gesehen und so viel
Übel, und ich glaubte, das Übel schneller beseitigen, das Gute schneller befördern
zu können. — Es waren Gedanken eines unerfahrenen
Mädchens.
Da ich in die Hütten der Armen kam und an die Betten der
Kranken, da linderte ich viel
Unglück; — aber das Unglück beseitigen,
gänzlich beseitigen, wie ich es einst geträumt hatte,
— das konnte ich nicht; und alle Menschen glücklich, gut
und nützlich zu machen, — das war unmöglich.
Aber eins habe ich gesehen und gelernt, daß die Familien
glücklich, daß die Väter froh und fleißig,
daß die Kinder gesund und wohlerzogen waren, wo eine Mutter
war, — eine weise, gute Mutter.
Aber das Unglück war im Hause, und der Vater war
unfreundlich und mutlos zu seinem Berufe, und die Kinder waren
unzufrieden und zänkisch, wo die Mutter-Liebe
fehlte, wo das freundliche Wort fehlte und der freundliche Blick
und der Komfort im Hause; — ich meine nicht den Komfort, der
teuer zu erkaufen ist mit Geld, sondern den Komfort, den der Blick,
der Ton, den das liebende Herz der Mutter giebt.
Alles, meine Schwester, alles, glaube es mir, — das
Glück des Mannes, das Glück der Kinder, das Glück
der Familie,
das Glück des Landes liegt in den Händen der Frauen und
nicht so viel in den Händen der Männer; denn diese sind
willig und folgen den Frauen; und wohl dem Lande, das gute Frauen
und gute Mütter hat!
Und siehe, Schwester; ein Glück habe ich aus meinen
Händen gegeben. Wie oft habe ich die Mutter beneidet, wenn ich sah,
wie sie ihr Kind küßte, wie sie ihr Kind liebend an die
Brust drückte.
Da wurde es mir klar, daß ich geirrt hatte; ich hatte
gefehlt, da ich das Beste gewollt.
Wohl versuchte ich gut zu machen, soviel ich konnte; darum
lehrte ich die jungen Mädchen, und manches gute Samen-Korn
habe ich gesäet.
Die gute Schwester weinte, und ich wollte sie trösten und sagte: Hast Du nicht
dadurch viel Gutes gegründet?
Ja, sagte sie, das habe ich allerdings, und mein Trost ist auch,
das Du glücklich bist, teure Schwester; und nun versprich mir
hier, daß Du auch ferner ein wahres, gutes Weib sein willst
Deinem Gatten, wie Du es bis heute warst; daß Du eine treue
Mutter sein willst Deinen Kindern, daß sie Dich so lieben wie
eine Freundin, so daß Deine Töchter Dir alles, alles
vertrauen; daß sie nichts und niemals etwas geheim halten vor
Dir. Lehre sie, daß das Haus ein Heiligtum sei und das Weib
die Hüterin; denn der Mann geht in die Welt und sieht so viel
des Bösen und wird oft so verwirrt; sage es ihnen doch,
daß es des Weibes Pflicht ist, ihn zu läutern vom Schlechten und ihn zu
erheben vom Gemeinen und ihn zu stärken zum Guten.
Lehre sie ihr Haus angenehm machen, daß jeder es gern
betrete.
Lehre sie, daß des Weibes Mission hoch und heilig ist.
— Meine Stimme wird schwach, — und nun versprich mir,
Deinen Töchtern einst meine Geschichte zu erzählen; und
nun laß' — sieh', wie die Sonne schon sinkt, —
laß' uns beten. —
Ich sank neben ihrem Bette auf die Kniee und wir beteten; ich
hörte ihr Amen und dann einen leichten Seufzer; ich sah auf zu
ihr, ihr Auge war geschlossen, sie
schlief. —
Wochen waren vergangen, — da legte ich Blumen auf ihr
Grab. Ohnmächtig hatte man mich von ihrem Bette nach meinem
Hause getragen; ich verfiel in eine schwere Krankheit. Im Fieber
sprach ich allein von ihr, meiner teuern, seligen Schwester. Ich habe
mich bemüht, ihre letzten Worte zu erfüllen. — Nun
habe ich Euch auch ihre Lebens-Geschichte erzählt; und ob es
mir wohl geglückt ist, Euch, liebe Kinder, eine Mutter zu
werden, wie sie es gewollt?
Martha: O Mama, teuerste,
liebste Mama!
Gretchen: Wie kannst Du nur so
fragen, Mama?
Frau Meister: Mein Gatte,
meine Freunde können die Antwort geben.
Bella: Verzeihung, Frau
Meister. Aber was ist aus dem jungen deutschen Herrn geworden?
Frau Meister: Das kann ich in
wenigen Worten sagen.
Eines Morgens kam sein Freund zu mir. Er war bleich und
war kaum im Stande, zu sprechen.
— Sehen Sie hier, mein Fräulein. Lesen Sie, sagte er mit
bebender Stimme; und ich las:
»Teurer Wilhelm! Lange waren wir treue Freunde, und kein
Tag fand uns getrennt. Vergieb mir, wenn ich dich heute verlassen
habe; denn ich muß fort, fort in die weite Welt und muß
allein sein mit mir. Ich muß versuchen, ob ich nicht dieses
Herz stillen kann, denn mir ist gar weh. — O, sie hätte
so glücklich werden können, — und sie ist es jetzt
nicht; glaube mir. Ich aber will kämpfen wie ein Mann. Arbeit
wird mich heilen; in Taten werde ich Vergessenheit suchen und
finden. Und hörst du einstmals meinen Namen nennen und
hörst du, daß ich großes getan, dann wisse, es war
ihr Bild, das mir vorschwebte, ihr Bild, das mich begeistert
hat.
Lebe wohl, ich bleibe ewig
Dein treuer Freund
Gustav von Halsen.«
Seitdem haben wir nie mehr von ihm gehört.
Louis: Aber der andere? Der
Freund, Frau Meister, der Ihnen den Brief brachte?
Frau Meister: Sitzt jetzt in
jenem Zimmer, sehen Sie, dort.
Gretchen: Was? Jetzt? Bei
Papa?
Frau Meister: Nein, —
Papa ist es selbst.
Martha: Papa?
Gretchen: Oh!
Bella: Herr Meister? —
Herr Wilhelm Meister?
Frau Meister: So ist es. Wie
das kam, erzähle ich Ihnen ein anderes Mal.
Otto: Herr Meister ist jetzt
wohl sehr beschäftigt?
Frau Meister: Mein Gemahl ist
in seinem Studier-Zimmer am Schreib-Tische, und dann stören
wir ihn niemals gerne; darum müssen Sie auch gütigst
entschuldigen, daß wir ihn nicht gerufen haben.
Otto: Gewiß, Madam.
Gretchen: Denkst Du nicht,
Mama, daß Martha jetzt zu ihm gehen könnte? Papa wird
sich gewiß freuen, wenn er hört, daß die Herren
hier sind.
Frau Meister: Willst Du gehen,
Martha?
Martha: Gerne, teure Mama.
— Entschuldigen Sie mich auf wenige Momente.
Otto: Bitte, mein
Fräulein.
Louis: Geht Fräulein
Martha jetzt zu Herrn Meister?
Gretchen: Ja wohl, Herr
Louis.
Louis: O, das ist gut!
Bella: Frau Meister, o, ich
hätte Ihre gute Schwester gern einmal sehen mögen. Haben
Sie kein Bild von
ihr?
Frau Meister: O doch, Bella.
Siehst Du jenes Bild an der Wand?
Bella: Ja.
Frau Meister: Nun, das ist ihr
Bild.
Bella: Ihr Bild ist es?
Otto: Ich dachte, es wäre
Marthas Bild; Ihrer Tochter Bild.
Louis: Und ich dachte immer,
es wäre Gretchens Bild.
Bella: Ja, das habe ich auch
gedacht.
Frau Meister: Und Sie
könnten recht haben, denn die Ähnlichkeit ist groß;
im Ausdrucke des Gesichtes ist Gretchen ihr ähnlich; in Figur
und Haltung gleicht unsere Martha ihr. Als dieses Bild gemalt
wurde, war meine Schwester siebenzehn Jahre alt; nur eine Kopie
existiert von diesem Bilde. Wo diese aber ist, weiß ich nicht.
Ah, — da kommt meine Tochter wieder und bringt ihren Papa am
Arme. Das ist schön, daß Du kommst, Wilhelm. Du bist
nicht böse, daß wir Dich gestört haben, nicht
wahr?
Herr Meister: Nein, nein; ich
danke Euch allen, denn ich freue mich, meine Freunde
begrüßen zu können. Guten Abend, Fräulein
Bella! Guten Abend, meine Herren!
Martha: Denken Sie nur, wie
liebenswürdig Papa war: er gab mir dieses Manuskript, einen
Teil dessen, was er heute geschrieben hat; und er hat mir erlaubt,
es Ihnen vorzulesen.
Gretchen: Das ist eine
große Ehre für Sie, Herr Louis. Papa tut das sonst
nie.
Louis: Herr Meister
weiß, daß ich das zu würdigen verstehe. Nicht wahr,
Herr Meister?
Herr Meister: So ist es,
Louis, gewiß.
Gretchen: Ich bin wirklich
neugierig zu wissen, wie es geworden ist, Papa.
Otto: Worüber schreiben
Sie jetzt, Herr Meister?
Herr Meister: Über die
alte deutsche Litteratur.
Martha: Dieser Teil in meiner
Hand ist einiges aus dem Nibelungen-Liede.
Otto: Soll ich Ihnen die Lampe
näher bringen?
Martha: Danke; ich kann sehr
gut sehen.
Louis: Hier, mein
Fräulein, nehmen Sie diesen Fuß-Schemel. Das ist
bequemer für Sie, nicht wahr?
Martha: Danke. — Soll
ich beginnen, Mama?
Frau Meister: Wir sind
bereit.
Martha: Das
Nibelungen-Lied.
Worms war die Hauptstadt des Königreiches Burgund. Hier
lebte die Königin Ute mit ihren Söhnen Gunther, Gernot
und Gieselher. Viele große Ritter waren an ihrem Hofe: Ortewein von Metz, Hagen von Tronje und sein
Bruder Dankwart und Volker von Alzei, der Spielmann. Aber die
Zierde des Hofes und die Zierde des ganzen
Landes war Krimhilde, der Königin Tochter.
O Mutter, sprach einst Krimhilde zur Königin, o Mutter, ich
hatte einen bösen Traum: Zwei Aare töteten meinen Falken, und ich hatte diesen Falken so lieb.
Armes Kind, erwiderte die Mutter, der Falke ist ein Ritter, den
du lieben und — verlieren wirst.
Lieben? — sprach Krimhilde, — nie will ich einen
Mann lieben, denn Liebe bringt Leid.
Aber auch Freude, sagte die Mutter, wenn es ein edler und
tapferer Ritter ist; und ich hoffe, daß ein solcher einst
dich, mein Kind, beglücken soll.
Xanten war die Hauptstadt der Niederlande
am Unter-Rhein. Da lebte der König Sigismund mit Siegelinde,
seinem königlichen Weibe, und mit Siegfried, seinem Sohne.
Vater, sprach eines Tages Siegfried, — Vater, ich ziehe
nach Burgund; ich will Krimhilde mir zum Weibe gewinnen.
Wenn du das willst, sprach der König, dann gehe. Aber
wisse, Gunther hat manchen starken Mann. Besonders merke dir
Hagen.
Ich will in Freundschaft um Krimhildens Hand bitten; aber was
ich im Guten nicht gewinne, das kann ich auch erobern mit meiner starken Hand.
So gehe, sprach der König; doch Siegelinde weinte, als der
Sohn sie verließ.
Und nach sechs Tagen kam er nach Worms mit zwölf starken
Rittern. Aber König Gunther kannte Siegfried nicht und er
ließ Hagen rufen; denn dieser kannte alle Länder und
ihre Herren.
Da Hagen an das Fenster ging und hinunter in den Schloßhof und auf die
fremden Ritter sah, sprach er: Ich habe diese Ritter niemals
gesehen; aber ich denke, der erste ist Siegfried von den Niederlanden. — Ja,
derselbe ist es und kein anderer. Er hat einst die starken
Riesen, die Nibelungen,
bekämpft und ihnen den größten Schatz der Erde
abgenommen, den Nibelungen-Schatz; und vom Zwerge Alberich gewann
er die Tarnkappe,
die ihn unsichtbar macht, und den Lindwurm hat er auch getödtet
und sich dann gebadet in des Drachen-Blut[IV-1],
so daß er unverwundbar ist. Er ist ein gewaltiger Ritter, und
wir müssen ihn freundlich empfangen.
Und Gunther und seine Brüder und Hagen und alle Ritter
gingen hinab, Siegfried zu begrüßen.
Nun begannen frohe Tage; Ritter-Spiele wurden gefeiert, und
Siegfried siegte immer. Wenn aber die Frauen fragten: Wer ist jener
Held, der so schön gewachsen ist und der so reiches Gewand
trägt? — dann hörten sie die Antwort: Das ist
Siegfried, der Held von den Niederlanden.
Ein Jahr war er nun in Worms gewesen und noch hatte er sie nicht
gesehen, die er zu gewinnen kam; denn Krimhilde war stets nach
feiner Frauen-Sitte in ihren Zimmern.
Sie aber hatte ihn doch gesehen; denn wenn die Kampf-Spiele auf
dem Hofe waren, stand sie hinter ihrem Fenster, sah hinab auf den
schönen, tapfern Siegfried und begann erst, ihn zu bewundern,
und dann, ihn zu lieben.
In dieser Zeit war Lüdeger der König von Sachsen und
sein Bruder Lüdegast König von Dänemark. Diese
beiden erklärten den Burgundern den Krieg.
Da sprach Siegfried zu Gunther: Bleibe du hier bei den Frauen
und beschütze sie, und laß mich gehen mit Hagen und mit
deinen Brüdern, zu streiten für deine Ehre und für dein
Gut.
Und so geschah es auch. Siegfried
besiegte beide Könige und nahm beide gefangen. Gernot sandte
einen Boten nach Worms mit der Sieges-Botschaft.
Aber niemand in Worms hatte in größerer Furcht und
Angst gelebt, als Krimhilde. Heimlich ließ sie den Boten zu
sich kommen und sprach: O, sage schnell, was du bringst; und ist es
gute Botschaft, dann gebe ich dir Gold.
Wir haben gesiegt, sagte der Bote; und der Mann, der den Sieg
errungen, heißt Siegfried; alle waren
tapfer, deine Brüder und Hagen und die anderen; aber das
meiste und das beste hat der Held vom Nieder-Rhein getan und die
beiden Könige hat er auch gefangen und er bringt sie
hierher.
Da wurde Krimhilden's Antlitz rosenrot, und sie ließ den
Boten, reichlich beschenkt, von sich gehen.
Nun stand sie am Fenster und sah die Straße hinab, so weit
ihr Auge reichte, ob sie noch nicht kämen. Endlich kamen sie.
Als die Hufe der Pferde den Boden stampften, da klopfte ihr das
Herz in der Brust und da sah sie endlich auch ihn wieder, der so
schön und hoch vor allen war.
Sechs Wochen wurden die Verwundeten gepflegt am Hofe zu Worms;
sechs Wochen lang zogen die Ritter hinaus, sich zu üben in den Kampf-Spielen; sechs
Wochen lang bereiteten die Frauen den Schmuck und die Kleider, die
sie tragen wollten während des Sieges-Festes.
Und am ersten Tage des Sieges-Festes war ein großes
Gedränge auf dem Fest-Platze am Rhein; denn Ute kam heute mit
ihrer Tochter Krimhilde. Hundert Ritter und hundert Mädchen
begleiteten sie.
Da sah Siegfried sie zum ersten Male. Wie der lichte Mond vor
den Sternen schien sie ihm, und Glück und Schmerz wechselten
in seinem Herzen.
Da wurde er zur Königin Ute gerufen, damit ihre Tochter ihm
Willkommen biete. Und als er vor der Holden stand, da wuchs ihm der
Mut. Sie aber errötete tief und sagte:
Willkommen, Herr Siegfried, edler Ritter! Und als er sich
verbeugte, begegneten ihre Blicke einander, — doch nur
verstohlen sahen sie sich an.
Bald darauf gingen alle zur Kirche, und Krimhilde und Siegfried
gingen Hand in Hand; und als sie zusammen aus der Kirche kamen,
sagte Krimhilde: O, wie danke ich euch, edler Ritter, für die
Dienste, die ihr meinen Brüdern erwiesen!
Ich will ihnen noch länger dienen und will ihnen dienen bis
an meines Lebens Ende, wenn ich damit nur eure Liebe gewinnen
könnte!
Das Sieges-Fest dauerte noch zwölf Tage, und Siegfried sah
nun jeden Tag Krimhilde. Dann wollte er zurückkehren nach Xanten. —
Jung Gieselher aber bat ihn zu bleiben, und so blieb er.
Auf der Insel Island lebte Brunhilde, die Königin. Weit und
breit sprach man von ihrer Schönheit und von ihrer Kraft. Sie
konnte Speere werfen, Steine schleudern und springen, besser, als mancher
Ritter; — und nur einem solchen Ritter wollte sie Herz und
Hand schenken, der sie in diesen drei Dingen überbieten
konnte. Viele der tapfersten Ritter waren schon gekommen und
— gefallen.
Siegfried kannte Brunhilde, und endlich hörte auch Gunther
von ihr und sagte: Ich gehe an die See zu Brunhilde.
Thue es nicht, sprach Siegfried, du könntest die Reise mit
Leib und Leben bezahlen.
Aber Gunther sprach: Kein Weib ist so stark, daß ich sie
nicht leicht überwinden
könnte.
Du kennst Brunhilde nicht, sprach Siegfried; und ich rate dir
nochmals: Geh' nicht nach Island!
Ich gehe, sprach Gunther, und koste es mein Leben; und du magst
mit mir gehen; mit deiner Hülfe besiege ich sie
gewiß.
Sie gingen: Gunther und Siegfried, Hagen und viele andere
tapfere Ritter. Am Fenster standen die Frauen und weinten.
Siegfried stieß vom Lande ab und lenkte das Schiff.
Am zwölften Morgen ihrer Reise sahen sie ein Land mit Burgen und
Palästen. Da sprach Gunther: Nie habe ich solche Burgen
gesehen. Der Herr dieses Landes muß gar mächtig
sein.
Brunhilde ist die Herrin dieses Landes, erwiderte Siegfried, und
diese Burg vor uns ist Brunhildens Wohnsitz, die Isenburg.
Sie landeten und bestiegen die Pferde. Siegfried hielt Gunthers
Steig-Bügel, damit
Brunhilde glauben sollte, Siegfried sei Gunthers Vasall. So hatten
sie es verabredet, als sie
noch im Schiffe waren.
Gunther und Siegfried waren weiß gekleidet und saßen
auf weißen Pferden; alle anderen waren schwarz gekleidet und
saßen auf schwarzen Pferden. So ritten sie auf die Burg zu.
Diese war aus grünem Marmor gebaut, hatte sechs und achtzig
Türme und umfaßte drei Paläste.
Brunhilde war glücklich, als sie Siegfried sah; sie eilte
ihm entgegen und rief:
Willkommen, Siegfried, in meinem Land; ich möchte wohl
hören, warum du kommst.
Besten Dank für diesen Gruß, sprach Siegfried; doch,
ihr solltet Gunther grüßen; er ist König am Rhein
und er ist mein Herr. Er — dein Herr? sprach Brunhilde;
— und was will er von mir?
Ich kam um deiner Schönheit willen, sprach Gunther, und
deine Liebe will ich gewinnen.
So laßt uns gleich den Kampf beginnen, sprach Brunhilde,
und legte ihren goldenen Panzer an.
Siegfried aber ging zum Schiffe, setzte die Tarn-Kappe auf und
kam zurück — ungesehen.
Man zog einen großen Kreis. In diesem Kreise sollte der
Kampf stattfinden. — Da stand Brunhilde; ihre Rüstung
glitzerte von Gold und von Edel-Gestein, doch mehr als alles
glänzte ihre Schönheit.
Da brachten vier Diener Brunhildens Schild; der war groß
und dick und schwer; und Hagen sprach zum König:
Wie nun, König Gunther? es geht an Leben und Leib!
— Das ist ein teuflisches Weib!
Dann brachten vier Ritter ihren Speer; der wog hundert
Pfund.
O, wär' ich zu Hause! dachte Gunther.
Da brachten zwölf Ritter einen Stein, rund und breit; und
Hagen rief laut:
Des Teufels Braut in der Hölle sollte sie sein, aber nicht
meines Königs.
Siegfried aber, unsichtbar durch seine Tarn-Kappe, trat an
Gunther hinan, berührte ihn und sprach leise:
Fürchte nichts, Gunther; ich helfe dir; gieb mir den
Schild; mache du selbst nur die Geberden und Bewegungen, während ich gegen
sie kämpfe.
Jetzt wickelte Brunhilde den Ärmel auf, und ihr
schneeweißer Arm wurde sichtbar. Sie ergriff den Speer und schwang
ihn mit Macht durch die Luft und warf ihn nach ihres Gegners Schild. Das Feuer sprang vom Stahle.
Siegfried strauchelte und
fiel; schnell
aber stand er wieder und faßte den Speer und warf ihn
zurück auf Brunhildens Schild, daß die Funken flogen und
Brunhilde zu Boden sank. Dank euch, König Gunther, rief sie,
sprang auf, nahm den Stein, schleuderte ihn hoch in die Luft und
sprang selbst darüber hinweg. Doch Siegfried nahm den Stein
und warf ihn noch höher, nahm Gunther in den Arm und sprang
noch höher und weiter.
Brunhilde staunte über solche Kraft und war bitter, denn
sie war besiegt zum ersten Mal, besiegt von Gunther, — so
glaubte sie nämlich.
Ja, wenn es Siegfried gewesen wäre, dachte sie, wie froh
wäre ich dann! Wie gerne hätte sie ihm den Sieg gegönnt. Aber da sie nun Gunther
folgen sollte, sagte sie: Nein, ich kann noch nicht, ich muß
erst meine Freunde sehen.
Und sie schickte Boten nach allen Seiten, daß die Ritter
ihres Landes kämen.
Das bedeutet nichts Gutes, sprach Hagen; die Königin will
uns nicht folgen; den Krieg will sie mit uns. Warum läßt
sie sonst diese Ritter kommen?
Da kann ich helfen, sprach Siegfried; ich gehe und komme bald
zurück mit tausend starken Helden.
Bleib nicht zu lange, sprach Gunther; und Siegfried zog ab.
In einem Schifflein zog er durch das Meer; und das Schifflein
flog wie der Wind. Aber den Schiffer konnte niemand sehen;
Siegfried segelte in seiner Tarn-Kappe. — Nach einem Tage und einer
Nacht kam er in das Nibelungen-Land.
Dort stand eine einsame Burg auf einem hohen Berge. Dahin lenkte Siegfried seine
Schritte und klopfte dort an eine Thür. Innen schlief ein
Riese; der bewachte die Thüre, und neben ihm lagen seine
Waffen.
Wer pocht? rief der Riese.
Ein Ritter! antwortete Siegfried. Öffne!
Der Riese stand auf, zog seine Rüstung an, hob
den Helm auf seinen Kopf, öffnete die Thür und schlug mit
einer Eisen-Stange nach Siegfried.
Dieser zog sein Schwert und schlug so gewaltig auf den Riesen,
daß es durch den ganzen Berg schallte und daß auch der
Zwerg Alberich erwachte.
Er rüstete sich und lief an die Thüre und kam in dem
Augenblicke, als Siegfried den Riesen band.
Nun begann Siegfried mit Alberich zu kämpfen; er zupfte ihn an dem langen Barte, und der Zwerg
schrie laut vor Schmerz. — Siegfried band den Zwerg, sowie er
den Riesen gebunden hatte.
Wer bist du? rief der Zwerg.
Dein Herr! rief Siegfried. Treuloser Bösewicht, kennst du
mich nicht besser? Vor Jahren war ich hier und habe den Berg
erobert und dich und alle Nibelungen.
Wahrlich, du bist Siegfried! rief der Zwerg. Und nachdem
Siegfried ihn losgebunden hatte, lief er zurück in den Berg,
wo die Nibelungen auf ihren Betten lagen, und er rief:
Auf, ihr Helden! Eilt zu Siegfried, Euerm Herrn! — und
im Nu standen tausend Nibelungen
wohlgerüstet da. Alberich führte sie hinaus zu
Siegfried.
Siegfried zog mit ihnen ab und kam am nächsten Tage
zurück zu seinen Freunden auf der Isenburg. Brunhilde sah die
Riesen und erklärte, sie wäre bereit,
mit Gunther zu gehen.
Bald waren alle wieder auf dem Schiffe und auf der Fahrt nach
Worms.
Es war eine freudige Fahrt; mit Tanz und Gesang und Spiel
verkürzten sie die Zeit. Neun
Tage waren sie gefahren und sie näherten sich Burgund. Gunther
bat Siegfried, nach Worms voraus zu reiten, sein Glück und
seine Ankunft zu verkünden.
Wie glücklich war Siegfried, als er diesen Auftrag hörte. Seine Ungeduld, seine
Sehnsucht wuchsen, je näher er Worms kam,
wo Krimhilde ihn sehnsuchtsvoll erwartete.
Mit vierundzwanzig Rittern ritt er auf Worms zu. Aber bald
hörte er aus dem Schlosse lautes Klagen und Weinen, denn die
Frauen hatten ihn ohne Gunther kommen sehen.
Als aber Siegfried im Schlosse stand, inmitten der Frauen, als
er ihnen erzählte, daß Gunther ihm folge mit seiner
Braut Brunhilde, — da verwandelte sich das Weinen in Freude
und in Jubel, und Krimhilde rief:
O, edler Ritter, dürfte ich euch nur mein Gold geben,
als Boten-Lohn!
Aber wie könnte ich euch solches nur anbieten?
Und hätte ich dreißig Länder, erwiderte
Siegfried, so wäre ich nicht zu stolz, aus eurer Hand das
kleinste Geschenk anzunehmen.
Da ließ Krimhilde vier und zwanzig goldene Spangen mit Edel-Steinen bringen und gab sie
Siegfried. Dieser aber verteilte sie wieder unter Krimhildens
Mädchen.
Nun laßt uns an den Strom gehen, sprach Siegfried, die
Freunde zu empfangen.
Und bald bewegte sich ein langer Zug zum Rhein. Und da die Sonne
schien, glitzerte alles von Gold und Juwelen. Hoch zu Rosse aber saßen
viele Burgunder-Frauen im feinsten Schmucke, und tapfere Ritter
führten die Pferde der Edel-Frauen; Ortewein begleitete die
Königin Ute, Siegfried aber führte Krimhildens Pferd am
Zügel.
So kamen sie an den Rhein, und bald landeten die Schiffe.
An Gunthers Hand stieg Brunhilde aus dem Schiffe, und ihnen
folgten viele Frauen und tapfere Ritter.
Krimhilde eilte auf Brunhilde zu und hieß sie willkommen
mit Kuß und Umarmung.
Da sprach wohl mancher Ritter: Nie habe ich zwei Frauen von
solcher Schönheit zusammen gesehen.
Doch die Kenner sagten: Krimhilde ist die schönere. —
Bald darauf bewegte sich der Zug jubelnd zum Palaste des
Königs.
Gunther hatte versprochen, dem tapfern Siegfried seine Schwester
Krimhilde zum Weibe zu geben für seine Hülfe im Kampfe;
und bevor sie sich niedersetzten zum Hochzeits-Mahle, erinnerte
Siegfried König Gunther an sein Versprechen.
Was ich geschworen, will ich halten, sprach Gunther und
ließ Krimhilde kommen.
Und als sie vor ihm stand in einem Ring von Helden, und als er
mit ihr von einem Ritter sprach, den er für sie gewählt, da errötete sie
und ihr Herz klopfte gewaltig, denn sie ahnte, daß der Bruder
von Siegfried sprach; und da sagte sie leise und
verschämt:
Bruder, ich gehorche. Da küßte Siegfried vor allen
Rittern seine schöne Braut.
Bald saßen sie bei Tische. Doch Brunhilde schien nicht
glücklich zu sein! Warum biß sie die Lippen zusammen? Warum
blickten die Augen bald trübe, bald zornig?
Ihr gegenüber saß Siegfried
und neben ihm Krimhilde, die liebliche Krimhilde! Und
Thränen der Eifersucht, der bitteren, wilden Eifersucht
stürzten aus Brunhildens
Augen.
Warum weinst du? sprach Gunther zärtlich und besorgt.
Auch du solltest weinen, antwortete schnell Brunhilde, über
das Unglück deiner königlichen Schwester, die du
erniedrigt und an einen Vasallen vergeben hast.
Später wirst du alles erfahren, sprach Gunther darauf.
Nach der Tafel begannen die Kampf-Spiele. Brunhilde sah die
Schilde, die Schwerter, die Lanzen, und die alte Kampf-Lust
erwachte wieder in ihr. Und als des Abends Brunhilde ganz allein
war mit Gunther, kam er in große Not: sie nahm ihren
Gürtel, band Gunthers Hände und Füße,
trug ihn zu einem
Nagel und hängte ihn an die Wand im Zimmer.
Sein Bitten half nichts, er mußte hängen bleiben bis
an den lichten Morgen. Da hatte sie Mitleid mit ihm und band ihn wieder los.
Gunther kam zu Siegfried und klagte sein Leid.
Da sprach Siegfried: Laß mich wieder mit ihr kämpfen;
mir soll sie nicht widerstehen; in meiner Tarn-Kappe werde ich sie
besiegen.
Und wenn du sie töten würdest, es wäre mir nicht
leid; denn sie ist ein schreckliches Weib.
Noch einmal zog Siegfried seine Tarn-Kappe an, noch einmal
besiegte er Brunhilde, nahm ihr Ring und Gürtel ab und ging.
Ring und Gürtel aber schenkte er seiner holden Krimhilde.
Hätte er es nicht getan, es wäre weiser und besser
gewesen.
Noch vierzehn Tage dauerte das Hochzeits-Fest; länger
konnte Siegfried nicht bleiben; nach Hause mußte er nun
ziehen, wo ihn sein Vater schmerzlich erwartete, und wo seine
Mutter täglich weinte um den Sohn, den sie verloren
glaubte.
Wie herzlich küßten die glücklichen Eltern
Krimhilde, ihres geliebten Sohnes Weib, als sie ankam. Wie
viele
Freuden-Thränen weinten sie, als ihr glücklicher
Helden-Sohn vor ihnen stand!
Sigismund ließ seinen Sohn zum König krönen;
denn er selbst wollte nun ruhen.
Zehn Jahre lang genossen Siegfried und Krimhilde das reinste
Glück und sie hatten auch einen Sohn; den nannten sie
Gunther.
Auch König Gunther hatte einen Sohn, den hatte er Siegfried
genannt; der war seine einzige Freude; denn in Brunhildens Herz
herrschten Eifersucht und Haß, und oft fragte sie: Warum
kommt Siegfried nie an unsern Hof?
Er wohnt zu fern von hier, war Gunthers gewöhnliche
Antwort.
Aber ist Siegfried nicht dein Vasall, und muß der Vasall
nicht tun, was sein Herr ihm befiehlt? fragte dann Brunhilde.
Dann lachte Gunther und antwortete nicht. Aber sie wollte
Siegfried wieder sehen; er mußte kommen, und darum sagte sie
eines Tages gar freundlich:
Ach Gunther, wie sehne ich mich
nach deiner Schwester! Wie oft denke ich an die glücklichen
Tage, da ich dich gewann, und da Krimhilde sich mit Siegfried
vermählte. O, laß
sie kommen! Laß sie recht bald kommen! — zur
nächsten Sonnen-Wende!
Und Gunther war schwach genug, ihr zu glauben und zu gehorchen. Dreißig
Ritter schickte er ab. Diese kamen in drei Wochen nach Norwegen, wo Siegfried
und Krimhilde gerade wohnten.
Krimhilde lag auf dem Ruhe-Bette. Da kamen ihre Mädchen in
das Zimmer und brachten die freudige Botschaft: Fremde Ritter sind
gekommen und sie sehen aus wie Burgunder!
Der starke Siegfried hörte Gunthers Einladung und
antwortete, daß er in zwölf Tagen kommen wollte mit
seinem Vater Sigismund und mit Krimhilde.
Die Boten kehrten zurück und
meldeten, was sie gehört.
Ist Krimhilde noch so schön? war Brunhildens erste
Frage.
Sie wird kommen, und du wirst sie sehen, antworteten die Boten,
und sie zeigten auch die kostbaren Geschenke, die sie von Siegfried
erhalten hatten.
Da sprach Hagen: Siegfried könnte sein ganzes Leben lang
geben und würde immer noch reich sein, denn er besitzt den
Nibelungen-Schatz. Ich selber möchte den wohl besitzen!
Nun machte man große Vorbereitungen in Worms zum Empfange
der Gäste. Gunther ging zu Brunhilde und sprach: Wie einst
meine Schwester dich empfing, als du in dieses Land kamst, so will
ich, daß du nun Krimhilde empfängst.
Das thue ich gerne, erwiderte sie.
Sie kommen morgen, sprach Gunther, geh' und bereite dich
nun.
Brunhilde kam den Gästen entgegen in großer Pracht. Die Königinnen
küßten einander. Nie zuvor hatte man in Worms Feste
gesehen, wie sie nun gefeiert wurden. Von allen Teilen des
Burgunder-Landes kamen die Ritter gezogen. Zehn Tage lang
ertönte in der Stadt der festliche Klang der Glocken und
dazwischen in den Kampf-Spielen das Schlagen der Schwerter, das
Stoßen der Lanzen. Selbst die Königin Brunhilde schien
ihren Kummer zu vergessen im Geräusch und in der Freude des
Festes.
Doch das Unglück kam schnell.
Am elften Tage waren die beiden Königinnen zusammen und
sahen dem Kampf-Spiele zu. Da sprach Krimhilde, voll Freude und
Stolz auf Siegfried sehend:
Sieh' nur, Schwester, sieh' auf Siegfried! Habe ich nicht einen
Mann, der wohl verdiente Herr zu sein über alle
Länder?
Bist du allein auf der Welt mit deinem Siegfried? erwiderte
Brunhilde gereizt.
Harmlos sprach Krimhilde weiter: Aber so sieh' doch nur,
Brunhilde, wie schön und stattlich er ist!
Mag sein, sagte Brunhilde; und er ist doch nur Gunthers
Vasall.
Nicht Vasall, liebe Schwester, Gunthers Genosse ist er und ein König wie Gunther,
sprach Krimhilde noch immer harmlos.
Nein, er ist Gunthers Vasall! rief Brunhilde. Das hat er mir selber gesagt, als
er mit deinem Bruder nach Island kam.
Glaubst du, daß der stolze König von Burgund seine
Schwester einem Vasallen giebt? Drum, liebe Schwester, lasse den
Streit und wisse: er ist kein Vasall.
Den Streit laß' ich nicht! rief Brunhilde. Siegfried ist
ein Vasall, und von heute an wird er mir besser dienen, als
bisher!
Das wird er nicht, rief Krimhilde, denn Siegfried ist ein
König, und er ist werter, als mein Bruder Gunther!
Du überhebst dich! schrie
Brunhilde. Erweist man dir so große Ehren wie
mir?
Nein; weil ich bescheidener bin, als du, sprach jetzt Krimhilde.
Aber du sollst heute noch sehen, daß ich vor dir in die
Kirche gehen kann.
Und sie stand auf, ging zu ihren Mädchen und befahl ihnen,
ihr die schönsten und reichsten Kleider anzulegen. Dann ging
sie mit ihnen zur Kirche. Alle wunderten sich, daß die beiden
Königinnen nicht, wie sonst, zusammen
zur Kirche gingen. Vor der Kirche aber stand Brunhilde und
erwartete Krimhilde.
Halt! rief sie, als Krimhilde nahte. Geh' nicht in die Kirche
vor mir, der Königin.
Sieh', stolze Brunhilde, sprach jetzt Krimhilde, wenn du
schweigen könntest, das wäre dir besser, dann
müßtest du nicht die bittere Wahrheit hören. Und
nun will ich es dir auch sagen: Es war nicht Gunther, der mit dir
kämpfte,
es war mein Gemahl, der dich zweimal besiegte! Und damit du
wissest, ich spreche die Wahrheit, so schaue! Erkennst du diesen
Ring und diesen Gürtel als dein? Im Kampfe hat Siegfried dir
beide genommen, und mir gab er sie dann zum Geschenke. Brunhilde
war starr vor Schrecken und sie konnte nicht hindern, daß
Krimhilde vor ihr eintrat in die Kirche.
Da war Musik und Gesang in der Kirche; aber eine saß da
und hörte nichts davon, — es war Brunhilde.
Und da sie wieder in ihrem Palaste war, fand sie noch keine
Ruhe, und sammelte ihre treuesten Ritter und bat unter
Thränen: O verschafft mir Rache, Rache an Siegfried!
Doch diese schwiegen, denn wer konnte mit Siegfried
kämpfen? Da sprach Hagen: Meine Königin, warum weinet
ihr?
O Hagen, rief die Königin, ich bin beschimpft! Siegfried hat mich
beschimpft!
So soll er sterben; und können wir ihn nicht töten mit
Kraft, so tun wir es mit List!
Nein, sprach da jung Gieselher, das darf nimmermehr
geschehen.
Nein, sprach auch Gunther, sein Blut darf nicht fließen,
so vieles habe ich Siegfried zu danken.
Zuletzt aber willigte er ein in Hagens teuflischen Plan.
Zwei und dreißig Boten ritten ein in Worms und brachten
eine neue Kriegs-Erklärung von den Sachsen-Königen
Lüdeger
und Lüdegast. Doch dieses alles war nur Schein und die Boten waren nicht Sachsen, sondern
es waren Burgunder, gekleidet wie Sachsen, und man wollte Siegfried
töten auf dem Kriegs-Zuge.
Als Siegfried auch von dem Kriege gehört hatte, bot er
Gunther seine Hülfe an und ging und rüstete seine
Nibelungen.
Hagen aber ging zu Krimhilde, um Abschied von ihr zu nehmen, wie
er sagte; in Wahrheit aber wollte er von ihr ein Geheimnis
erfahren.
Hagen, sprach Krimhilde, euch vertraue ich meine Sorge. Ihr seid
ein alter Freund, ich weiß es. O, vergeltet es nicht an mir und hasset mich
nicht für das, was ich eurer Königin getan.
Euch hassen, Königin Krimhilde? Wie könnte ich das!
Und Siegfried? — Wahrlich, keinen in der Welt liebe ich mehr,
als euern tapfern Siegfried. Ich will ihm dienen, wo ich kann.
O, dank euch, edler Hagen, sprach Krimhilde. Seht, jetzt geht er
wieder in den Krieg gegen die Sachsen, darum fürchte ich, es
könnte ihm ein Leid geschehen.
Was braucht ihr zu fürchten? sagte Hagen listig. Siegfried
kann im Kriege nicht fallen. Ist er nicht unverwundbar?
Ach ja, erwiederte ängstlich Krimhilde, — als er den
Lind-Drachen tötete, da badete er im heißen Blute, und
seine Haut wurde hart wie Horn.
Und was fürchtest du nun? fragte Hagen.
Aber ein Linden-Blatt fiel auf seine linke Schulter; dahin drang
kein Blut, und hier ist er leicht zu verwunden. Darum fürchte
ich.
Da sprach der Falsche froh: Es ist wahrlich gut, daß ihr
mir das sagtet. Nähet ein kleines Kreuz auf sein Gewand, genau
über jene Stelle, damit ich ihn
beschützen kann.
Das will ich, sagte Krimhilde froh. — Dank, edler Freund!
Tausend Dank!
Hagen ging. Er wußte genug. Der Kriegs-Zug war nun nicht
mehr nötig und anstatt des Krieges veranstaltete man eine Jagd.
O, geh'[IV-2]
nicht zur Jagd, sprach Krimhilde, als Siegfried von ihr Abschied
nahm. O geh' nicht; ich fürchte, du möchtest nimmer
wiederkehren.
Ich komme bald zu dir zurück; — und was könnte
mir geschehen! Bin ich denn nicht unter Freunden?
O geh' nicht, bat sie, denn ein Traum hat mich gewarnt. Zwei
wilde Schweine verfolgten dich über eine Heide, und alle
Blumen waren rot von Blut. —
Es ist ein Traum, sprach er, nur ein Traum. Und sie sprach
weiter: Dann stürzten zwei Berge zusammen, und du warst
darunter begraben.
Er lächelte, küßte sie und ging; Krimhilde aber
war sehr traurig.
Sie hatten schon den ganzen Tag gejagt; da sprach ein Knecht zu Siegfried. Herr,
hört ihr das Horn blasen? Wir müssen zum Abend-Brot
eilen.
Geh' nur, sprach Siegfried; ich aber will erst den Bären
fangen, den ich dort sehe. Er sprang vom Pferde, verfolgte den
Bären, fing ihn und band ihn fest an seinen Sattel und ritt
zurück zur Gesellschaft. Hier band er den Bären los;
dieser lief in das Zelt und warf alles um. Die Burgunder flohen
erschrocken davon. Siegfried aber folgte dem Bären,
tötete ihn und kehrte zurück.
Da saßen die Helden auf dem grünen Rasen und speisten, was die
Diener brachten. Da sprach Siegfried:
Ich sehe hier genug zum Essen; doch warum bringen die Diener
keinen Wein?
Hagen ist schuld daran, sprach König Gunther; er will uns
verdursten lassen.
Ich hatte geglaubt, wir würden im Spessart jagen; darum sandte ich dorthin den
Wein, sprach Hagen.
Und einer der Ritter sagte: Warum essen wir nicht näher
beim Rhein? Dort ist wenigstens Wasser genug.
Wasser ist auch hier, sprach Hagen, eine Quelle voll guten
Wassers; lasset uns zur Quelle gehen.
Oder besser noch, rief Siegfried, wir wollen dahin um die Wette
laufen.
Siegfried lief in seiner vollen Rüstung; Gunther und Hagen
aber hatten die ihrige abgelegt, und als sie an den Brunnen kamen,
stand Siegfried da und wartete und ließ Gunther zuerst
trinken.
Während dessen aber
legte er selbst seine Rüstung ab; dann stieg auch er hinab, um
zu trinken.
Da entfernte Hagen schnell Siegfried's Waffen, und als Siegfried
sich bückte, spähte jener nach dem Kreuze auf der
Schulter, nahm den Speer und warf ihn mit aller Kraft bis tief in
die Brust.
Siegfried schrie laut auf, und der starke Hagen floh vor dem
verwundeten Siegfried.
Dieser sprang auf; der Speer ragte weit hervor aus der Schulter;
er suchte seine Waffen, aber fand nur den Schild. Den warf der
todwunde Mann auf Hagen, daß er zu Boden fiel; aber Siegfried
war bleich geworden und sank auf den grünen Rasen.
Die Burgunder standen um den sterbenden Helden und weinten.
Warum weint ihr? sprach Hagen. Freuet euch, jetzt sind wir aller
Sorgen frei; ich habe ihn mit gutem Bedachte erschlagen![IV-3]
O Gunther, sprach Siegfried, sorget für mein Weib, sie....
Mehr konnte er nicht sprechen. Der tapfere Held hatte geendet und
alle Blumen ringsum waren rot vom Blute.
Nun legten sie Siegfrieds Leiche auf
einen Schild und trugen ihn nach Worms. Es war spät in der
Nacht, als sie ankamen, und Hagen ließ Siegfrieds Leiche vor
Krimhildens Thüre legen.
Am Morgen ganz früh da läuteten die Glocken zur
Kirche, und Krimhilde weckte ihre Dienerin, daß sie mit
ihr zur Kirche
ginge. Ach, Königin, rief das Mädchen, hier liegt ein
toter Ritter!
Mein Siegfried! schrie da Krimhilde und fiel ohnmächtig neben die
Leiche, und sie erwachte wieder und rief: Siegfried! Siegfried! und
brach dann in lauten Jammer aus, und mit ihr klagten der alte
Sigismund und alle ihre Freunde.
Siegfrieds Ritter kamen, den Tod ihres Herrn zu rächen.
Doch Krimhilde sprach: Vergießet kein
Blut, Gott selbst wird uns rächen.
Ein Sarg wurde geschmiedet von Gold und von Silber; Siegfried
wurde hineingelegt und in die Kirche getragen. Krimhilde folgte und
auch Gunther, seine Brüder und Hagen.
Als die Brüder den großen Jammer der Schwester sahen,
da erfaßte Reue ihr Herz.
Schwester, sprachen sie, wir haben ihn nicht getötet; die
Schächer haben es getan.
O, ich kenne die Schächer! rief Krimhilde, — kommt
her und berühret die Leiche!
Alle taten so; und als Hagen kam, da begann die Wunde zu
fließen.
O, ich wußte es, ich wußte es! — er ist der
Mörder! schrie Krimhilde.
Tröste dich, Schwester, sprach da jung Giselher, ich will
dir ersetzen mit meiner Liebe,
was Siegfried dir gewesen.
Siegfried ersetzen? rief sie und fiel nieder neben die Leiche; und drei Tage
und drei Nächte blieb sie da; und Tag und Nacht kamen auch die
Armen, zu singen und zu beten, und Krimhilde ließ Geld
verteilen an alle, welche kamen.
Am vierten Tage wurde der Sarg geschlossen und zu Grabe
getragen.
Der Zudrang des Volkes war groß und das Schluchzen tönte lauter, als das
Läuten der Glocken und das Singen der Priester.
Noch einmal muß ich ihn sehen, schrie plötzlich
Krimhilde, — o, noch einmal!
Man mußte den Sarg wieder erbrechen. Da umschlang sie den schönen
Kopf des Toten und küßte ihn und weinte und wollte ihn
nicht lassen. Man riß sie zuletzt mit Gewalt vom
Sarge und brachte sie in die Burg. Hier lag sie besinnungslos bis
zum nächsten Tage.
Der alte König Sigismund brach auf; Krimhilde aber wollte
nicht wieder nach Xanten; nahe bei Siegfrieds Grab baute sie
für sich eine Wohnung; und mit vollen Händen teilte sie
Gold vom Nibelungen-Schatze unter die Armen. Das war ihre einzige
Freude.
Herr Meister: Mehr dachte ich
für heute nicht zu geben, — und ich fürchte schon,
daß dieses zu viel war.
Bella: O nein, Herr Meister.
Jetzt bin ich erst begierig nach dem, was nun folgt; denn es kann
doch so nicht enden!
Herr Meister: Nein. Dieses war
noch nicht die Hälfte. Es folgt nun ein sehr poetischer und
interessanter Teil, worin wir besonders viel hören über
den bösen Hagen und auch über Krimhilde. Sie wird
König Etzel's Gattin und so weiter, und so weiter. Alles
dieses ein anderes Mal, nicht heute.
Louis: Wie schade! Ich
hätte Ihnen die ganze Nacht zuhören mögen,
Fräulein Martha.
Martha Meister: Das ist ja ein
großes Kompliment für Vaters Erzählung; ich danke
Ihnen in seinem Namen und in meinem eignen.
Bella: Aber was für eine
Frau diese Brunhilde war! Das wär'[IV-4] eine Frau für Louis!
Louis: So? Wünschen Sie
mir wirklich solch' ein Weib? O, Bella, Bella! — Die Damen
sind heute zu grausam mit mir. — Denken Sie nur, Martha,
meine eigne Schwester sagte mir vor Abend: Louis, Du bist doch
eigentlich gar nichts. Du bist weder ein Mann, noch ein Kind; und
kleine Knaben sind so unmanierlich, weißt Du? so roh. —
Nun bitte ich Sie, beste Frau Meister, sagen Sie mir doch, sehe ich
aus wie ein kleiner, roher, häßlicher, unmanierlicher
Junge? Sehen Sie einmal, ich bin beinahe so groß, wie Herr
Meister.
Frau Meister: Ihr
müßt nicht lachen, Ihr jungen Damen. — Louis, Sie
sind ein ganzer Mann.
Louis: Ich danke Ihnen, Frau
Meister!
Gretchen: Ha, ha, ha! Sie
amüsieren mich sehr, Herr Louis. Ha, ha, ha!
Otto: Darf ich Dir einen Rat
geben, Louis?
Louis: Nun, Bruder Otto?
Otto: Widersprich nie den Damen.
Louis: Hm — Ja, Du
hältst es immer mit ihnen.
Otto: Und darum geht es mir
auch immer so gut.
Bella: Das ist recht! Respekt
soll man haben, Respekt vor uns!
Herr Meister: Haben Sie es
gehört, mein guter Freund Louis? Wir müssen uns fügen
in unser Schicksal; wir kämpfen umsonst dagegen an. Eine neue Zeit ist
gekommen. Die früher Herren waren, sie werden nun Sklaven und
die Sklavinnen werden zu Herrinnen.
Bella: Die Frauen —
Sklavinnen? Das ist wohl nur Phantasie, Herr Meister!
Herr Meister: Keine Phantasie,
mein Fräulein, sondern Wirklichkeit.
Gretchen: Aber, Papa, war denn
das Weib eine Sklavin bei Griechen oder Römern?
Herr Meister: Nein, mein Kind,
sie war nicht Sklavin, aber sie war die erste Dienerin des Mannes.
Was schön und was wahr ist, das haben uns wohl die Völker
des Altertums gelehrt; aber das Weib zu ehren,
— nicht. Es war erst ein christlicher Dichter, welcher sang:
»Ehret die Frauen, sie flechten und weben himmlische Rosen
ins irdische Leben.«
Gretchen: Willst Du damit
sagen, Papa, daß erst mit dem Christentume eine bessere Zeit
für die Frauen begonnen hat?
Herr Meister: Ganz recht, das
will ich. Es war ein Weib, das Jesus Christus geboren hatte, und
darum verehrte man Maria. Und später, als das Christentum sich
mehr und mehr ausbreitete, waren es christliche Ritter und
christliche Minne-Sänger, welche die Frauen verehrten, wie es
nie ein Volk des Altertums getan hatte. Ich kenne keinen Dichter
des Altertums, der so schön von den Frauen gesungen hat, wie
Walter von der Vogelweide:
[IV-5]»Durhsüeßet
und geblüemet sint die reinen frouwen:
eß wart nie niht sô wünneclîches an ze
schouwen
in lüften noch ûf erden noch in allen grüenen
ouwen.
Liljen unde rôsen bluomen, swâ die liuhten
in meien touwen dur daß gras, und kleiner vogele sanc,
daß ist gein solher wünnebernden fröide
kranc,
swâ man siht schœne frouwen. daß kan trüeben
muot
erfiuhten,
Und leschet alleß trûren an der selben stunt,
sô lieblîch lache in liebe ir süeßer
rôter munt
und strâle ûß spilnden ougen schieße in
mannes herzen
grunt.«
Bella: Das ist freilich sehr
schön und sehr schmeichelhaft für
uns. Aber, Herr Meister, haben im Mittel-Alter alle Menschen
die Frauen so geehrt, oder waren es nur die Minne-Sänger, die
so von uns dachten?
Herr Meister: Es waren
allerdings nur die Ritter und die Minne-Sänger, also die
feineren Klassen der Gesellschaft, die den Wert der Frauen
erkannten. Vergoldet nicht die Sonne zuerst die Spitzen der Berge, bevor ihr herrlicher
Schein auch hinab in das Tal[IV-6] dringt?
— Auch für die Frauen der unteren Klassen begann bald
die Erlösung — durch
Dr. Martin
Luther.
Bella: O, Herr Meister, ich
sehe schon, Sie wollen uns zeigen, daß das Heil für die
Frauen aus Deutschland kommt, wie so vieles andere, was die
Menschen beglückt hat.
Herr Meister: Nein, mein
Fräulein, daran habe ich allerdings nicht gedacht. Aber ich
wollte Ihnen zeigen, daß das Heil der Frauen immer aus dem
Norden kam.
Gretchen: Papa, hat denn auch
die Befreiung der Frauen etwas mit der Geographie zu tun?
Herr Meister: Sehr viel, mein
Kind. Ist nicht das Weib im Norden, sagen wir z.B. in Deutschland
oder in England, geachteter, als im Süden: in Griechenland, in
Italien, in der Türkei? Und ist das nicht ganz
natürlich?
Im Süden ist die Natur freundlich mit dem Menschen und
giebt ihm alles, wie eine gütige Mutter. Dort ist die Sonne
warm, die Luft mild, und der Erdboden ist reich. Die Natur giebt
dem Manne im Süden mit leichter Mühe Nahrung und Schutz, darum bedarf der Mann im Süden
des Weibes und des Hauses nicht so sehr, wie der Mann im
Norden.
Aber wie war es früher im Norden. Der Mann kam abends aus
dem Walde, und die Kälte des Winters war strenge. Er hatte
gejagt oder die Bäume des Forstes gefällt; und nun war er
hungrig und müde.
So erreichte er sein Heim. Da aber stand sein Weib an der
Thüre und erwartete ihn mit liebendem Blicke, mit offenem
Arme. Sie nimmt ihm die Waffen ab, sie führt ihn zum Herde an
das erwärmende Feuer und dann zum reichlichen Mahle, das sie
bereitet.
Dem Manne wird wohl, er fühlt sich glücklich und er
weiß, daß er dieses seinem treuen Weibe zu danken hat;
er erkennt den Wert ihrer Wohltat — und ehrt und liebt das
Weib.
Was die Natur im Norden dem Manne versagt hat, das giebt ihm reichlich das
Weib.
Wundern Sie sich nun, daß die rohen Germanen das Weib
höher schätzten, als die kultivierten
Römer? Wundern Sie sich nun, daß die Minne-Sänger,
diese Dichter des Nordens, im Weibe das Symbol alles Guten und
Schönen sahen, während die Troubadours, diese Dichter des
Südens, im Weibe nur die Geliebte des Mannes erblickten? Und
wundern Sie sich nun, Bella, daß auch ein Germane in der
neuen Zeit uns das höchste Ideal eines Weibes gegeben hat?
Gretchen: Und von welchem
Manne sprichst Du, Papa?
Herr Meister: Von Goethe[IV-7].
Frau Meister: Ich dachte
es.
Martha: Goethe[IV-8], Papa?
Goethe[IV-9], meinst
Du?
Herr Meister: Ja, liebe
Martha; und denkst Du nicht, mein liebes Weibchen, daß unsere
Töchter Goethes[IV-10]
»Iphigenie« oft und recht oft, und gut und recht gut
studieren sollten?
Frau Meister: Gewiß,
Wilhelm, ich denke wie Du; und ich denke auch, daß alle
jungen Damen dasselbe tun sollten. Es würde uns allen sehr
lieb sein, wenn Du jetzt ein wenig über dieses wundervolle
Werk erzählen wolltest.
Herr Meister: Wenn Du es
wünschest, gerne. Sie haben von Tantalus gelesen, meine
Freunde, nicht wahr? — Nun wohl. — Tantalus war der
Sohn des Zeus und der Pluto und wohnte in seiner Burg am Berge
Sipylus.
Unter allen Königen war er der stärkste und reichste;
denn er hatte so viele Länder, daß man sie in drei Tagen
nicht durchwandern konnte, und darin hatte er viele Herden von
Schafen und Rindern.
Bei den Menschen war er überall beliebt und bei den
Göttern so sehr, daß sie ihn oft einluden, im Olymp an
ihrer Tafel mit ihnen zu speisen, und ihn oft um seine Meinung
fragten; denn sie kannten seine Weisheit.
Daher wurde Tantalus sehr stolz und dachte von sich sehr hoch
und mehr, als recht war; denn was ich bin, so dachte er, bin ich
durch mich selbst, durch meine eigene Kraft, durch meine eigenen
Taten; und am Ende sind die ewigen Götter nicht mehr, als ich
bin, vielleicht nicht einmal so viel. — So sprach er und
verübte eine abscheuliche Tat, um die Allwissenheit der Götter zu
prüfen.
Dann aber waren die Götter erzürnt und stürzten
ihn von der
göttlichen Tafel tief hinab in die Unterwelt und straften ihn
fürchterlich.
Und auch die Nachkommen dieses Tantalus waren stark, klug,
nobel, aber oft auch stolz und übermütig. Aus dieser
Familie stammte Agamemnon.
Er war Feldherr der Griechen, als sie nach Troja
zogen, und seine Tochter Iphigenie war der Göttin Diana
geopfert worden. So dachten die Griechen, Agamemnon und
Klytemnestra, seine Gattin.
Diana aber, die Göttin, hatte Mitleid mit der herrlichen
Iphigenie gehabt und hatte sie in einer Wolke auf die Insel Tauris
gebracht.
Hier weilte sie in einem Tempel als die
Priesterin der Göttin Diana zum Heile vieler Menschen. Denn
der König Thoas, ein ernster, roher Mann, wurde freundlicher,
da er die schöne, milde Jungfrau sah; er folgte ihrem Worte
und wurde milder gegen seine Diener und gegen sein Volk. Alles war
besser geworden in dem Lande von dem Tage an, da Iphigenie darin
weilte.
Wenn früher Männer aus fremden Ländern nach
Tauris gekommen waren, so wurden sie getötet; nun aber war man
gut gegen sie und sandte sie in die Heimat zurück.
Iphigenie aber ward nicht froh im fremden Lande und unter
fremden Menschen und sie sehnte sich zurück in die teure
Heimat, zu ihrem Vater, zu ihrer Mutter, zu ihrer Schwester, zu
ihrem Bruder Orest, der noch klein war, da sie ihn verlassen hatte.
Und oft stand sie am Meere, sah weit hinaus und grüßte die
Meeres-Wellen, die vielleicht hinzogen nach ihrer lieben
Heimat.
An einem Tage aber war der König zum Tempel gekommen, um
Iphigenie zu seiner Gattin zu nehmen; denn er war weib- und
kinderlos geworden.
Sie aber sagte zu ihm: Ich ehre dich, o König, wie einen
zweiten Vater, wie einen Freund; doch dein Weib vermag ich nicht zu
werden, denn meine Heimat ist es, nach der ich mich sehne.
Der König aber war über solche Worte unzufrieden und
sprach: Wohlan, es sei also: Kommt ein Glied aus
deiner Familie, dich heimzuführen, so magst du gehen; wo
nicht, so werde mein Weib. — Doch wahrlich, es beginnen von
diesem Tage an wieder die alten Sitten meines Volkes!
Und der König ging in seinem Zorne und gebot: Man
höre nicht mehr auf das Wort jener Priesterin. Man opfere, wie
früher, alle Fremden, die diese Insel betreten, und man
beginne sofort mit den zweien, die man vor kurzem an der Küste
gefunden.
Der eine dieser Gefangenen aber kam durch den Hain. Er war ein Grieche, und nach vielen Jahren
zum ersten Male hörte Iphigenie wieder die Laute ihrer
geliebten Mutter-Sprache. Und sie hörte auch, daß Troja
gefallen, daß ihr Vater heimgekommen und durch die Hand
seiner eigenen Gattin ermordet sei; denn sie hatte es nicht
vergessen können, daß er Iphigenie hatte töten
lassen; —
und Iphigenie hörte mehr; sie hörte, daß Orest, ihr
Bruder, wieder die eigene Mutter getötet hätte, um den
Vater zu rächen.
Ach, Unglück über Unglück war gekommen über
ihr Haus, und nun sollte sie das Schrecklichste tun: Sie selbst
sollte ihren Bruder opfern; denn Orest, ihr Bruder, stand nun vor
ihr; er war der zweite der Gefangenen; er selbst hatte ihr jene
fürchterliche Kunde aus der Heimat
gebracht.
Wie groß ihre Freude war, den Bruder zu sehen, den
heißgeliebten, den lang vermißten, so groß war
auch ihr Schmerz über alles, was sie gehört und über
das Übel, das den Bruder befallen hatte; — denn er fiel
oft in den fürchterlichster
Wahnsinn durch den Gedanken an seine unmenschliche Tat.
Aber Iphigenie wollte ihm Hülfe bringen; ja, sie
mußte den beiden folgen; denn ihr Bruder war mit seinem
Freunde Pylades gekommen, das Götterbild der Diana aus dem
Tempel zu entführen.
Iphigenie wollte ihnen helfen und mit ihnen entfliehen. Sie
konnte ihre Freiheit wieder gewinnen, sie konnte die Heimat und
Elektra, ihre teure Schwester, wieder sehen und bei dem geliebten
Bruder leben.
Das alles wollte und konnte sie nun erreichen. Wie
glücklich sie war!
Doch ach! — durfte sie es tun? War Thoas, der König,
nicht ihr väterlicher Freund, ihr Wohlthäter? —
Undankbar wollte sie nimmer sein! Niemals wollte sie unrecht tun, niemals, selbst
dann nicht, wenn sie die Heimat nie wieder sehen sollte, —
die Heimat, die ihr so teuer war; lügen wollte sie nicht,
selbst wenn der Bruder unglücklich werden sollte.
Sie glaubte an das Gute, Edle in den Menschen, und so ging sie
zu Thoas, dem König, und sagte ihm den Plan, offenbarte ihm alles und bat ihn, sie zu
retten, sie und den Bruder und dessen Freund; sie bat ihn, eine
Tat zu tun, so groß und so edel, wie diese.
Lange zauderte der König.
Es ward ihm schwer, sich von ihr, dem geliebten Weibe, zu trennen;
es ward ihm schwer, die beiden Griechen, seine Feinde, ungehindert
ziehen zu lassen.
Aber das Wort Iphigeniens und ihr Wesen
waren so mächtig, daß der König hörte und die
große Tat[IV-11] vollbrachte. — Sie schied
von ihm in Freundschaft; ihr Bruder ward geheilt vom Wahnsinn und
war wieder froh.
So wirkt ein Weib. Kultur, milde Sitten, Wohlfahrt und
Glück bringt sie dem Lande; sie macht glücklich, edel und
groß alle, die in ihrer Nähe sind; dem Kranken und allen
Unglücklichen bringt sie Heilung und neue Lust zum Leben.
So groß ist die göttliche Kraft des Weibes. Sie wirkt
gutes durch den Ton ihrer Stimme, durch den Blick ihres Auges,
durch ihr ganzes Wesen; aber dann nur kann sie es vollbringen, wenn
ihr Herz rein, wenn ihre Seele groß, wenn sie ist, was sie
sein soll: Eine
Priesterin im Hause und eine Förderin des Guten und
Schönen auf Erden.
Martha: Papa!
Herr Meister: Meine
Tochter!
Martha: Von heute an will ich
Goethe[IV-12] lieben
um seiner »Iphigenie« willen.
Herr Meister: Das thue nur,
meine Tochter, Du thust recht. — Aber Mama, wir bedürfen
nun auch des Materiellen. Wo sind die schönen Früchte,
die uns die Herren Parks so freundlich gesandt haben?
Frau Meister: Martha wird so
gut sein, sie uns zu reichen.
Herr Meister: Aber, Herr Otto,
wie geht es Ihrem Herrn Bruder, dem Doktor?
Otto: Er sagte mir, daß
er vielleicht noch kommen würde, wenn auch spät.
Gretchen: Louis, können
Sie gut Rätsel
lösen?
Louis: O ja.
Gretchen: Nun, was ist
das?
Erst weiß wie Schnee,
Dann grün wie Klee,
Dann rot wie Blut,
So schmeckt es gut.
Louis: Das ist etwas zum
Essen, nicht wahr?
Gretchen: Ja, aber was?
Louis: Das weiß ich
nicht.
Bella: Eine Kirsche.
Gretchen: Richtig!
Bella: Aber was ist das?
Ein Kopf und ein Bein
Ist alles, was mein.
Der Kopf hat eine Mütze
Das Bein hat eine Spitze.
Was ist das?
Martha: Ich weiß es,
Bella.
Bella: Nicht sagen, Martha,
nicht sagen! Nun, Herr Otto?
Otto: Ist es eine
Stecknadel?
Bella: Ja, eine Stecknadel.
— Wollen Sie auch ein Rätsel geben, Otto?
Otto: Was ist das?
Ein jeder hat's;
Im Grabe ruht's;
Der Herr befiehlt's,
Der Kutscher tut's.
Louis: Das ist schwer; das
errate ich niemals.
Otto: Nun, meine Herrschaften?
Erraten Sie!
Bella: Ja, wenn wir nur
könnten! Ich glaube, Frau Meister weiß es. Sagen Sie es.
Was ist es?
Frau Meister: Herr Otto, ist
es ein Wort mit drei Silben?
Otto: Ganz recht.
Frau Meister: »Vorfahren«?
Otto: Erraten! Erraten!
Louis: Was? — Ich
verstehe es noch nicht.
Otto: Vorfahren, Louis. Denke
nur nach.
Louis: O ja; jetzt habe ich
es, jetzt habe ich es. Das ist sehr gut, Otto. Woher hast Du Deine
Rätsel? Ich will auch Rätsel studieren. — Nun, das
ist merkwürdig! Hören Sie nicht wirklich auch einen Wagen
vorfahren? Er hält — das ist unser Wagen, Otto. Albert
kommt, — ja, das ist sein Schritt.
Frau Meister: Das ist mir sehr
angenehm. — Herein!
Dr. Albert: Ich wünsche Ihnen einen
guten Abend, meine Damen und meine Herren, und bitte um Verzeihung,
daß ich Sie störe in Ihrer Unterhaltung. Es ist so
reizend hier, daß ich es sehr bedauere, nicht verweilen zu
können. Zwei Schul-Freunde, welche ich in der unteren Stadt
getroffen habe, warten
auf der Straße in unserm Wagen; und so muß ich Euch
bitten, Otto und Louis, aufzubrechen, so leid es mir auch tut. Seid
Ihr bereit?
Otto und Louis: Wir sind
bereit.
Bella: Es ist wirklich schade,
daß Sie nicht ein wenig bleiben können, Herr Doktor.
Dr. Albert: Niemand bedauert das mehr, als
ich selbst; — und so wünsche ich Ihnen allen: Gute
Nacht!
Alle: Gute Nacht!
Otto: Gute Nacht, meine
Herrschaften!
Louis: Gute Nacht, meine
Damen! Gute Nacht, Herr Meister!
Frau Meister: Wollt Ihr mich
entschuldigen, wenn auch ich nun gehe?
Alle: Gewiß.
Martha: Mama, kann ich Dich
auf Dein Zimmer begleiten? Ich möchte mit Dir sprechen.
Frau Meister: Gewiß,
meine Tochter. Komm! — Gute Nacht, Bella!
Bella: Schlafen Sie wohl, Frau
Meister!
Martha: Wollt Ihr mich
entschuldigen, Bella und Gretchen? Ich bin bald wieder bei
Euch.
Gretchen: Gewiß. Wir
bleiben bei Papa und plaudern.

V.
Martha: Aber, — das ist
ja englisch, und ich dachte, Anna schriebe deutsche Briefe!
Bella: Das tut sie auch,
Martha — siehst Du, hier beginnt der deutsche Teil, und so
hübsch schreibt sie, ich habe ihn schon zwei mal ganz alleine
für mich gelesen und ich möchte ihn wieder und wieder
hören. Ach, bitte, süßes Gretchen, lies ihn doch
einmal laut vor, ich weiß, Martha, es wird Dir viel
Vergnügen machen, alles zu hören, was meine liebe, gute
Schwester Anna schreibt. Willst Du, Gretchen, ja?
Gretchen: Gewiß, Bella,
gerne; wo soll ich beginnen?
Bella: Hier, siehst Du?
Gretchen: Also ....
Entschuldige mich, teure Bella, daß ich meinen Brief auf
englisch begonnen habe; ich schreibe jetzt so gerne englisch und
höre es so gerne. Wenn ich auf der Straße gehe und
höre hinter mir englisch sprechen, dann beginnt mein Herz so
laut zu pochen, und ich muß mich umsehen und möchte
jeden umarmen, aus dessen Munde ich den trauten Ton der englischen
Sprache vernehme, — ich habe
Heimweh.
Ach, Schwester, das Heimweh ist eine traurige Krankheit! Das
Herz tut einem so weh, daß man glaubt, es müsse brechen,
und die Menschen scheinen uns alle so kalt, so herzlos zu sein, und
man möchte immer allein sein und immer weinen. — Auch
fürchtet man immer, man würde Vater und Mutter und
Schwester und Freunde niemals wiedersehen, und allerlei traurige
Gedanken kommen; — aber warum habt Ihr mich auch so lieb,
daß ich immer an Euch denken muß! — Des Nachts
träume ich oft, ich sei wieder bei Euch daheim, und alles
wäre wieder wie früher; dann ist alles so schön, und
ich bin so glücklich. Aber wenn ich dann aufwache, und die
fremden Wände sehe, dann muß ich
weinen.
Ich habe heute einen neuen Hut; unsere liebe, teure Freundin hat
ihn selbst angefertigt: Blaues
Band und eine große weiße Feder aus Paris; ich sehe
immer in den Spiegel und freue mich und denke: Was würde wohl
Bella von meinem Hute sagen? — Ich bekomme auch ein neues
Kleid von blauer Seide; blaue Seide, weißt Du, habe ich so
gern.
Was hier nun weiter folgt, liebe Bella, habe ich zusammen mit
Frau Dr. Stellen
geschrieben; und Du mußt erraten, welche Teile von meiner
Freundin und welche von mir kommen. Ob das wohl schwer zu erraten
ist?
(Aus meinem Tage-Buche. Seite 37.)
3 Uhr 35 Minuten morgens.
Das war eine lange, lange Fahrt! Ich bin froh, daß unser
Hotel so nahe beim Bahnhofe ist. Mein Zimmer ist freundlich und
bereits hell vom Lichte des kommenden Tages; ich öffne das
Fenster und trinke die frische, wohlthätige Morgen-Luft. Ein
langer Streifen, rot wie köstliches Gold, zieht sich am fernen
Horizont entlang, und prächtiger und immer prächtiger
wird der Farben-Glanz, bis sie selbst erscheint — die Sonne
in ihrer vollen, majestätischen Schönheit. —
Gewiß, so schön mag sie gewesen sein am ersten Tage der
Schöpfung.
Ihr Anblick macht mich wieder frisch, und ich vergesse auf
einige Minuten, wie müde ich bin.
Vor mir liegt die Stadt noch schlafend. Wie lieblich sie
aussieht, beschienen vom Morgen-Rot! Solche Häuser habe ich
niemals gesehen; sie erinnern an eine Zeit, die längst
dahingeschwunden. Die Dächer sind alt und spitz und
haben viele Türmchen. Eine alte Burg steht oben auf dem Berge,
und ringsum liegt die Stadt. Zwei Türme von großer
Schönheit stehen am Thore vor mir. Von der nahen Kirche
kündet gerade die Glocke die vierte Stunde an. Männer
kommen; ihre Schritte schallen laut durch die stille Straße;
die Männer gehen zur Arbeit, und ich gehe zur Ruhe. Was soll
ich Dir wünschen: Gute Nacht oder Guten Morgen?
(Zwei Tage später.)
»Lebe wohl, du alte, gute Stadt; einst warst du schön
und stolz; — Ruinen und Erinnerungen sind dir geblieben,
— doch auch diese sind noch schön! Ich will oft an dich
denken. Lebe wohl, du gute, alte Stadt! Ich muß
weiter!«
Weißt Du, liebe Bella, in welcher Stadt ich das
geschrieben habe? — Ein großer Maler lebte hier; er war
der größte Maler Deutschlands und lebte gleichzeitig mit
Raphael. — Raphael hat ihm persönlich einmal geschrieben
und ihm aus Hochachtung ein selbst gemaltes Bild gesandt. Das Haus,
in dem er wohnte, steht noch; es ist groß und wohlerhalten.
Der Künstler hatte eine schöne
Frau, aber diese war sehr böse gegen den armen D.... —
Halt! Fast hätte ich den Namen genannt! Kennst Du, Bella, die
Stadt noch nicht?
Viele alte Kirchen sind dort, und eine derselben ist besonders
schön. Ihr Portal ist wunderbar. Wenn Du in die Kirche
trittst, so findest Du Kunstwerke von jenem Maler und
auch das Sakraments-Häuschen von Adam Krafft.
Nicht weit von dieser Kirche findest Du auch das Denkmal eines Schuhmachers. Ja, Bella, eines
Schuhmachers. Aber das Denkmal hat man ihm gesetzt für seine
Verse.
H... S.... war ein Schuh-Macher und Poet dazu.
Und auf dem Markte steht ein Brunnen von seltener
Schönheit. Oh, Du weißt nun, ich spreche von der Stadt
Nürnberg, von Albrecht Dürer und von Hans Sachs.
(Aus dem Tage-Buche. Seite 82.)
Im Palmengarten.
»Hier ist es herrlich! — ist es im Paradiese wohl
schöner gewesen? — So viele Menschen sind hier und alle
scheinen einander zu kennen; die Herren grüßen so
höflich und schwingen die
Hüte so hoch, und die Damen verbeugen sich graziös und
lächeln so freundlich; hier sind gewiß alle recht
glücklich. Lachend und plaudernd promeniert man unter den
Klängen der heiteren Musik auf breiten, sandigen Gängen
zwischen Feldern der lieblichsten und kostbarsten Blumen. —
Wie hier die Zeit doch so schnell vergeht! Schon sinket die Sonne
und scheidend
erglänzt sie in einem Meere der lieblichsten und
süßesten Farben, mich dünkt, ich hätte sie nie
zuvor so herrlich gesehen. — Noch einen letzten Blick wirft
sie auf alles —; das Scheiden tut ihr recht leid, denn die
Erde ist heute so schön. Die endlosen Felder von Weizen und
Korn gleichen dem Meere, wenn linde Winde es leise im Sommer am
Abend erregen; die Hügel sind mit dem lieblichen
Grüne des Weines bedeckt, und an den Bäumen schimmern im
reichlichen Laube die goldgelben
Früchte.
Die Schatten werden tiefer, und die Nacht sinkt herab. In den
Lüften summen die Käfer, und Feuer-Würmchen
leuchten aus
dem Grase hervor. Lieder klingen aus der Ferne von Burschen und
Mädeln, die freudig vom Felde kehren zu den heimischen
Hütten.«
—
Bin ich nicht eine gute, sentimentale Deutsche geworden? Ach, Du
würdest es auch werden, meine teuerste Bella, wenn Du hier
wärest, denn die Natur ist hier ganz anders.
Ein Sonnen-Untergang hier ist mild und freundlich, bei Euch ist
er brillant; einem Sonnen-Untergang in Deutschland muß man
mit Freude zusehen, einen solchen in Amerika bewundern. Ich sehe,
wie Du über mich lachst, aber das mußt Du nicht tun.
Nun, liebe Bella, hast Du erraten, wo ich jetzt bin? Ein wenig
leichter will ich es Dir machen: Es ist eine große Stadt, und
ein großer Poet wurde dort geboren, dessen Mutter einst sehr
schön war. Ich habe auch das Haus gesehen und das Stübchen unter dem Dache, wo er
geträumt und gedichtet hat. Noch jetzt befinden sich in einem
der Zimmer folgende Worte von seiner Hand:
Kennst Du den Poeten, und weißt Du den Namen der Stadt?
— Frankfurt am Main und Goethe[V-1].
(Aus dem Tagebuche. Seite 117.)
»Ehrfurchtsvoll betritt mein Fuß
diesen Pfad, der aufwärts führt zwischen
grünenden Hecken. Zur Rechten und zur Linken ruhen die Müden der Erde
unter Blumen; aber vor mir, oben, steht von Marmor ein Tempel. Da
bleibe ich stehen, und heilige, erhabene Scheu bewegt meine Seele;
denn hier ruhen drei Fürsten: Der eine gebot, und Sterbliche hörten
auf sein Wort; die zwei andern aber herrschten im Reiche des
Geistes, sie waren Könige im Lande der Poesie. —
Vereint, wie sie waren im Leben, sind sie es nun im Tode. Ihr Geist
aber wirkt noch heute und wird wirken, so lange das Gute und
Schöne noch[V-2] Wert hat auf
Erden.«
Weißt Du, teure Bella, in welcher Stadt wir waren? Die
beiden größten unter den Poeten des modernen
Deutschlands lebten hier. Ich war in ihren Häusern und ich
glaube, daß die Deutschen einstmals diese Stadt so hoch preisen werden,
wie die Griechen es taten mit Athen, und solltest Du den Namen
»Weimar« nennen, so hast Du auch die Stadt erraten.
(Aus meinem Tagebuche. Seite 166.)
»Wie gut man in deutschen Eisen-Bahnen schreiben kann! Ich
glaube, sie fahren so langsam, um den Fremden das Land zu zeigen.
Das ganze Land erscheint mir wie ein großer Park, wohl
gepflegt und in schöner Ordnung
gehalten. Wiese und Feld und Wald und Flur wechseln ab; und
überall, auf den Bergen wie in den Thälern, erblickt man
Städte und Dörfer. Das sieht prächtig aus. Wie lachende Augen,
so glänzen aus den weißen, reinlichen Häusern die
klaren Fenster, und aus der Mitte der Dörfer heben sich von
den Kirchen, himmelwärts deutend,
die schlanken Türme.
Der Zug hält — eine Station!«
Hier, liebe Bella, habe ich Dir vieles zu sagen. Also, der Zug
hatte gehalten, — da hörten wir vom nahen Dorfe Musik
und Jubel, und wir fragten einen von den Bauern,
welche neugierig bei dem Zuge standen und uns eben so anstaunten,
wie wir sie: Was bedeutet denn der Jubel im Dorfe? — Heute
haben wir Kirmes, sagte der eine. Kirmes? fragte ich. Was ist
Kirmes, Herr Doktor?.. Und Dr. Stellen antwortete: Kirmes ist der Bauern
größtes Fest in dem Jahre. Da giebt es Wett-Rennen zu
Pferde und dann Tanz, und wer weiß, was sonst noch mehr.
— Weißt Du was, Frauchen? Wir
könnten hier eigentlich bleiben und mit Fräulein Anna
einmal Kirmes feiern.
War das nicht schön vom Herrn Doktor? Und bald fuhren wir
in einem Bauern-Wagen hinein in das reinliche Dorf. Ich sah immer
von einer Seite auf die andere und konnte mich nicht genug wundern
über die niedlichen Häuser.
Wir waren in einer andern Welt, in einer ältern Welt.
Unter der Linde in der Mitte des Dorfes, auf einem runden,
freien Platze, da ging es lustig her. Da unter
dem freien Himmel tanzten die Burschen und die Mädel; und wie
sie hüpften und wie sie sprangen und wie sie jauchzten vor Freude!
— Doch alles ging in Ordnung zu. O, so komisch sahen die
Burschen aus in ihren bunten Westen und in ihren langen, schwarzen
Röcken; auf ihren Köpfen standen die hohen, altmodischen,
seidenen Hüte. Jeder Bursche hatte an dem Hute einen
Strauß von bunten Blumen und ein langes seidenes Band. Blumen
und Band hatte der Schatz ihm gegeben, und
Rock und Hut waren vom Großvater geerbt, denn auch der
Großvater hatte mit der Großmutter die Kirmes so
getanzt.
Als der Tanz beginnen sollte, winkte der Bursche mit der Hand
und zu ihm kam sein Schatz. O, liebe Bella, ich wünsche, Du
hättest gesehen, wie sie tanzten, seine Wange ruhte an der ihren und beider Augen drehten
sich zum Himmel vor Wonne. O,
es war zu komisch — aber wir durften nicht lachen, denn den
Leuten war es Ernst.
Und, liebe Bella, — aber das mußt Du niemandem
wieder sagen — ich selbst habe zwei mal mitgetanzt; und wenn
ich an Frau Dr. Stellen vorüber kam, und wenn sie sah, wie ich meinen
»Schatz« so innig fest hielt und die Augen auf nach
oben wandte, dann lachte sie mir laut und herzlich zu. Das war
köstlicher Spaß!
Als die Bauern hörten, daß wir aus Amerika
kämen, traten viele zu uns und fragten, ob wir den Bruder
nicht gesehen hätten oder die Schwester, oder ihren Onkel,
oder ihre Tante; sie wären doch auch in Amerika. Auch fragten
sie uns, ob wir Eisen-Bahnen hätten und ob es wahr wäre, daß man
in Amerika alle Tage Fleisch essen könnte und Butter auf dem
Brote; und zuletzt fragten sie, in welchem Monate die Kirmes bei
uns in Amerika gefeiert würde.
Die Leute sind noch sehr naiv, nicht wahr? — Aber sie sind
gut. Es sind treue, brave Menschen, und zufrieden mit ihrem Loose
und voll Poesie und Musik.
Wir blieben über Nacht in dem Dorfe, schlafen aber konnte
ich nicht, denn kaum hatte die Dorf-Uhr langsam und phlegmatisch
zehn geschlagen, da ertönte ein mächtiges Horn, und ein
Mann mit einem großen Hunde und einem langen Spieße ging durch die
Straßen und sang, so laut er nur vermochte:
»Hört ihr Herren und laßt euch
sagen:
Die Glocke hat zehn geschlagen.
Nehmt in acht
das Feuer und Licht,
Daß niemandem Schade geschicht.«
Und jede Stunde machte der Mann die Runde und jede Stunde
ließ er an allen Ecken seinen Gesang ertönen, bis die
Uhr drei schlug. Da sang er folgendes:
»Hört ihr Herren und laßt euch
sagen:
Die Glocke hat drei geschlagen!
Der Tag vertreibet die finstere Nacht,
Ihr lieben Christen, seid munter und wach
Man weiß ja nicht, wenn der liebe Gott kommt
Und uns in seiner Gnade wegnimmt.
Drum wachet alle Stund' und lobet Gott den
Herrn.«
Dann war es still im Dorfe und ermüdet schlief ich endlich
ein und schlief recht lange und erwachte, als die Sonne hoch am
Himmel stand. — Weißt Du, liebe Schwester, was
Spinn-Stuben-Lieder sind?
Dieselben Bauern-Mädchen, die so froh und lustig sind, wenn
die Kirmes kommt, sind ernst und fleißig zu allen anderen
Zeiten des Jahres; und im Winter am Abend kommen oft viele zusammen
in einem Hause und jede bringt ihr Spinn-Rad mit. Da sitzen sie im
Kreise und spinnen und erzählen Märchen und singen
— Lieder, das sind Spinn-Stuben-Lieder.
Als wir aus dem Dorfe fahren wollten, sah ich zwei Kinder, es
waren zwei Knaben. So schön habe ich noch niemals Knaben
gesehen; der eine von ihnen war zwei und der andere drei Jahre alt.
Ah, Bella, Bella, welche Augen! Welche Locken-Köpfe! Jetzt
weiß ich, daß Raphael seine Cherubim-Köpfe auf
Erden gesehen hat. — Ich werde sie niemals vergessen.
Nun aber, Schwester, will ich kein Wort mehr schreiben und nur
sagen: Lebe wohl und grüße alle Freunde tausendmal von
mir. Vergiß auch nicht, Louis zu grüßen von
Deiner
Dich ewig liebenden Schwester
Anna.
Nachschrift: Und vergiß auch nicht, meinem lieben, kleinen
Kanarien-Vogel ordentlich Hanf-Samen zu geben, und küsse ihn
für mich und sage, daß ich recht oft an ihn denke und
daß er brav sein soll in seinem kleinen Hause.
Bella: Solch' einen Brief kann
ich nicht schreiben! Hier, Martha, sind die Lieder. Willst Du
einige singen? — Du bist nun müde, Gretchen, nicht
wahr?
Gretchen: Das ist ein langer
Brief.
Martha: Ich werde mit diesem
Liede anfangen:
1.
Ein Sträußchen am Hute,
Den Stab in der Hand,
Zieht rastlos der Wandrer
Von Lande zu Land.
Er sieht so manch' Städtchen,
Sieht manch' schönen Ort, —
Doch fort muß er wieder,
Muß weiter fort.
Da sieht er am Wege
Ein Häuschen steh'n,
Das war ja umgeben
Von Blumen so schön.
da tut's ihm gefallen[V-3],
Da sehnt er sich hin, —
Doch fort muß er wieder,
Muß weiter ziehn.
Ein freundliches Mädchen
Das redet ihn an:
Ein herzlich Willkommen,
Du Wanders-Mann!
Sie blickt ihm in's Auge,
Sie reicht ihm die Hand —
Doch fort muß er wieder
In ein anderes Land.
2.
Mein Schatz ist nicht hier,
Ist über die Höh'.
Ich darf nicht dran denken,
Sonst tut's Herz mir so weh!
Gretchen: Das ist ganz
niedlich, Martha. Was ist das andere?
3.
Martha:
Blau blüht ein Blümelein,
Das heißt »Vergiß-nicht-mein«.
Dies Blümchen leg' an's Herz
Und denke mein.
Blau ist der Treue Schein,
Blau ist das Auge dein.
Das Blümlein pfleg' auch du,
Wo du auch weilst.
Der über Sternen thront,
Der deine Liebe lohnt,
Der sieht herab auf dich,
Denkst du an mich.
Louis: Bravo, bravissimo! Da capo!
Martha Parks: Guten Tag,
Martha! Guten Tag, Gretchen und Bella! Ha, ha, ha!
Bella: Ach — bin ich
erschrocken!
Gretchen: Und ich, und sieh
einmal Martha an.
Louis: Ich bitte Sie tausend
mal um Vergebung; das wollte ich nicht, ich wollte Sie wirklich
nicht erschrecken!
Martha Parks: Nein, das
wollten wir nicht; so böse sind wir nicht; nicht so, Louis?
— Wir klopften, einmal, zweimal; und da hörten wir
niemanden »Herein« rufen, und da nahm Louis mich bei
der Hand —
Louis: Und da sind wir. Sie
sind wohl recht böse auf mich, nicht wahr? Aber ich bin froh,
daß ich gekommen bin; denn vor der Thüre hätte ich
das wunderschöne Lied nicht hören können.
Martha Parks: Wie schön
Ihr singen könnt!
Bella: Das war ein Lied von
Anna; sie hat es mir aus Köln geschickt mit vielen
Grüßen an alle Freunde und einem besondern Gruße
an Louis.
Louis: So? Nun, das freut mich
recht sehr; auch einen Gruß an mich; ich danke Ihnen,
Fräulein Bella, und geht es Ihrer Schwester Anna gut in
Deutschland?
Bella: O ja; sie schrieb mir
einen langen Brief. Sie können ihn lesen, wenn Sie wollen.
Nehmen Sie ihn nur mit nach Hause; Sie werden lange Zeit dazu
gebrauchen, und ich glaube, er wird Sie interessieren.
Louis: Sie sind sehr
gütig, mein Fräulein.
Martha Meister: Wir haben Sie
ja so lange nicht gesehen, Herr Louis!
Gretchen: Und Ihre Herren
Brüder auch nicht!
Bella: Sie sind doch alle
wohl?
Louis: O ja; danke, meine
Damen, recht wohl.
Martha Parks: Meine
Brüder gehen immer auf die ..... die ....., was ist es, Louis?
Wohin geht Ihr?
Louis: Auf die Jagd.
Martha Parks: Ja, auf die Jagd
und lassen mich alleine, und ich bin dann traurig. Das ist gar
nicht schön von ihnen, nicht wahr?
Louis: Nun werden wir nicht
mehr so oft gehen, liebe Schwester.
Gretchen: Schießen Ihre
Herren Brüder so gut, wie Sie?
Louis: O ja; oft besser.
Albert nimmt einen Silber-Dollar aus der Westen-Tasche und wirft
ihn mit der linken Hand in die Luft; mit der rechten Hand
schießt er dann sein Pistol ab und trifft den Dollar. —
Sagen Sie, Fräulein Bella, haben Sie schon Münchhausens
Jagd-Abenteuer gelesen? Nein? Nun, meine Damen, dann will ich Ihnen
etwas erzählen, das Ihnen gefallen soll.
Der Baron von Münchhausen war einmal auf der Jagd. Da kam
ein Hirsch durch
den Wald gerannt. Schnell nahm der Baron die Flinte von der
Schulter. Aber — o weh! — er hatte keine Kugel mehr. Da
nahm er vom
Boden einen Kirschen-Stein auf, steckte ihn in die Flinte,
zielte,
drückte ab und traf das
Tier mitten auf den Kopf zwischen das schöne Geweih. Der Hirsch fiel, stand
aber im nächsten Momente wieder auf den Beinen und war auf und
davon gerannt.
Ein Jahr später kam Baron von Münchhausen wieder in
den Wald und sah wieder denselben Hirsch und auf dem Kopfe zwischen
dem Geweihe war ein großer Baum mit reifen Kirschen. Dieser
Baum war aus dem Kirschen-Stein gewachsen. Dieses Mal aber hatte Herr v.
Münchhausen Kugeln; er schoß und der Hirsch fiel tot zu
Boden. Da hatte der Baron einen feinen Braten und Kirschen zum
Dessert. War das nicht schön, meine Damen?
Gretchen: O, das war
reizend!
Louis: Das ist alles noch
nichts. Das Beste kommt noch; hören Sie nur:
Einmal war der Baron nach Rußland geritten auf seinem
Pferde; der Winter war sehr streng und es schneite sehr stark. An
einem Tage war er schon lange geritten und daher müde
geworden, aber er sah kein Haus, und es schneite, als ob alles vom Himmel
herunter wollte. Zuletzt konnte er nicht weiter; er war zu sehr
ermüdet, und es war schon lange Nacht. Da band er sein Pferd
an einen Pfahl, hüllte sich in seinen Mantel,
legte sich auf den Schnee und schlief ein.
Am nächsten Morgen, als er wieder erwachte, war er sehr
verwundert; denn rings umher sah er Grab-Steine, und er hatte sie doch nicht am
Abend gesehen! Er war aus einem Kirch-Hofe. Wo aber war denn sein
Pferd? — Er hörte es über
sich wiehern; und als er aufblickte, sah er es hängen an
der Spitze des Kirch-Turmes.
Nun war alles klar: Gestern hatte es so viel geschneit,
daß der Schnee bis über die Häuser und bis
über die Turm-Spitze gekommen war, und was er für einen
Pfahl angesehen hatte, das war das obere Ende des Kirch-Turmes.
Nach Mitternacht war dann der Schnee geschmolzen; der Baron selbst
war allmählich herabgesunken, bis
er zuletzt auf dem Kirch-Hofe ruhte. Das Pferd aber hing nun noch
oben. Da nahm er sein Pistol, zielte und schoß mitten durch
den Halfter. Das Pferd kam herunter, der Baron setzte sich darauf
und ritt fröhlich weiter.
Bella: Ist das alles wahr, was
Sie da sagen, Herr Louis?
Louis: O ja, mein
Fräulein, das ist alles wahr, denn der Baron von
Münchhausen hat es selbst erzählt.
Gretchen: Aber, Herr Louis,
ich muß Sie wieder fragen: Warum kommen denn Ihre Herren
Brüder nicht mehr?
Louis: Bruder Otto ist noch zu
müde von der Jagd und ruht sich aus, und Bruder Albert geht
oft wie träumend umher, es muß wohl etwas Ernstes sein,
über das er sinnt; aber ich mag ihn nicht mehr fragen. Einmal
habe ich es getan, und da sah er mich so wunderlich an, — ich
wußte nicht, was ich von ihm denken sollte.
Martha Parks: Ich weiß,
was er tut; Louis, soll ich es sagen? Aber Ihr dürft es
niemandem wieder erzählen — hört Ihr,
niemandem.
Bella: O nein, wir wollen es
niemandem sagen. Was ist es, Martha? Sprich nur.
Martha Parks: Er macht
Gedichte.
Bella: Gedichte?
Martha Parks: Ja, ganz
gewiß. Ich kam einmal zu ihm und da sah ich es. Schnell legte
er alles zur Seite, und so habe ich nur die Überschrift
gelesen, sie lautete: »An Martha«. Ha, sagte ich, Du
willst mich überraschen, lieber Albert, nicht wahr? und da
lachte er laut und lange und küßte und koste mich und
wollte gar nicht enden.
Gretchen: Wirklich?
Bella: So?
Louis: Hm, hm!
Martha Parks: Aber was ist
denn, Ihr wundert Euch ja alle so sehr?
Bella: Hast Du.........
Martha Meister: Hast Du schon
von Schiller gehört, Martha?
Martha Parks: Von
Schiller?
Bella: Ich würde Dir
recht herzlich danken, wenn Du uns heute von ihm erzählen
wolltest. Du hast mir schon vor langer Zeit versprochen, einmal von
diesem großen deutschen Dichter zu sprechen.
Martha Meister: Gerne, gerne
will ich heute Deinen Wunsch erfüllen, das heißt, wenn es
Euch allen angenehm ist.
Alle: O, wir bitten darum.
Martha Meister: Gut, dann will
ich beginnen.
Schillers Vater war ein ernster Mann. Er war Offizier in einem
würtembergischen Regimente. Und als er aus dem Lager
kam und zum ersten Male an der Wiege seines Sohnes stand, betete er
inniglich:
O, gütiger Gott, laß diesen meinen neugebornen Sohn
gut werden und groß, und laß ihn alles das erreichen,
was ich mir einst selbst gewünscht habe, aber nicht mehr
erreichen konnte.
Die Mutter war mild und fromm und lieb, wie es eine Mutter nur
sein konnte mit ihrem einzigen Sohne. Und wenn der Vater oft zu
strenge gewesen war, so kam Friedrich zur Mutter und vergaß
seinen kindlichen Kummer; und wenn die Mutter
ihm eine Freude machen wollte, so erzählte sie ihm die
Geschichten aus der Bibel. Dann lauschte er mit seinen beiden
Schwestern.
Zuletzt sagte der kleine Friedrich: Ich will ein Prediger
werden. Das war auch der Mutter lieb, und oft mußte sie
lachen, wenn sie ihren Friedrich sah, wie er auf dem Stuhle stand
und seinen Schwestern und Freunden eine Predigt hielt.
Einige Jahre später kam er zu einem Pastor und studierte
fleißig, und seine Liebe zu diesem guten Manne war so
groß, daß er fest
entschlossen war, auch ein Prediger zu werden, wie jener. Aber
es sollte anders kommen.
In jener Zeit hatte der Herzog von Würtemberg ein Institut
errichtet für die Söhne seiner Offiziere, und da er nur
die besten Knaben für diese Anstalt
wählen wollte, so kam er auch in Schillers Haus.
Frau Schiller aber mochte ihren Sohn nicht in jene Anstalt
geben, denn er konnte dort keine Theologie studieren; und dann
wollte sie gerne ihren einzigen, geliebten Sohn bei sich behalten.
Aber der Herzog wollte und mußte seinen Willen haben. Dreimal
war er gekommen, bis zuletzt Friedrich Schiller vom Eltern-Hause in
die Anstalt kam, die später den Namen
»Karls-Schule« erhielt.
Bella: An Frau Schillers
Stelle würde ich den Sohn nicht in jene Anstalt gegeben
haben.
Martha: Ah, meine liebe Bella,
Du kennst den Herzog nicht. Er war ein arger Tyrann, wie die
meisten Fürsten in jener Zeit — und das war eine
böse, böse Zeit. Jeder Fürst, und war er noch so
klein, wollte leben und herrschen, wie Ludwig XIV. von Frankreich es getan hatte.
Sie bauten Paläste, Theater und Opern-Häuser, hielten
Sänger und Ballett-Tänzer, hatten die großartigsten
Parks und Gärten und dazu Luxus aller Art; aber das Geld zu
diesen Herrlichkeiten nahmen sie von ihren Unterthanen.
Die armen Menschen mußten schwer arbeiten wie Sklaven,
damit ihre Herren schwelgen konnten;
und als sie nichts mehr hatten und ihnen alles genommen war, da
ergriff man ihre Person; von dem Vater und von
der Mutter nahm
man die Söhne; mit Gewalt riß man sie von ihren Herzen, sah
nicht auf ihren Schmerz, hörte nicht auf ihre Klagen; —
und die Söhne verkaufte man dann an England, und England
schickte sie nach Amerika, — dort sollten sie kämpfen
gegen Freiheit und Recht.
So trieben es in jener
Zeit die meisten Fürsten, und auch der Herzog Karl. Als er
älter war, wurde er freilich anders, und als er seinen
fünfzigsten Geburts-Tag feierte, schrieb er ein langes
Register seiner Sünden und versprach, sich zu bessern, und
ließ dieses in allen Kirchen seines Landes vorlesen.
Diese Besserung aber und auch die Errichtung der Karls-Schule
war das Werk seiner Gemahlin. Diese Herzogin war aber zuvor eines
andern Mannes Frau gewesen; der Herzog hatte sie jedoch mit Gewalt
zu sich genommen.
Louis: Und der Mann, was tat
denn der?
Martha Meister: Nichts, Louis;
er konnte nichts tun. Karl war ein arger Tyrann
— und auch in der Schule. Ihr könnt euch wohl denken,
daß es Schiller niemals recht gefiel, schon deshalb nicht,
weil er kein Prediger werden konnte und Medizin studieren
mußte.
Die Schule war berühmt geworden, und oft kamen hohe Herren
von allen Teilen Deutschlands, um sie zu besehen. Einmal war auch
der junge Herzog Karl August von Weimar mit seinem Freunde Goethe[V-4] gekommen.
Wie Schiller den jungen Poeten anstaunte! O, rief er aus, wie jung er ist, und
doch schon so berühmt! Und ich, ich habe noch nichts getan,
und wer weiß, ob ich wohl jemals etwas Großes tun
werde!
Da standen sie zum ersten Male zusammen und sie gingen von
einander und wußten nicht, daß sie einst die beiden
großen Poeten Deutschlands und die besten Freunde werden
sollten.
Ein anderes Mal kam Lavater nach der Karls-Schule. Lavater war
damals berühmt; nicht allein, weil er ein geistreicher Mann
und ein sehr frommer Prediger war, sondern auch deshalb, weil er
ein Werk geschrieben hatte über Physiognomie.
In der Karls-Schule führte man ihm die Schüler vor,
daß er sie sehe und ein Urteil abgebe über ihren
Charakter und ihre Fähigkeiten. Nachdem er schon
viele gesehen und beurteilt hatte, kam auch ein langer, hagerer
Mensch. Lavater befühlte seinen Kopf, sah ihm scharf in die
Augen, musterte ihn von oben bis unten und rief voll
Entsetzen: O, o, das wird ein großer Spitzbube werden! —
Schiller war es; dieses Mal hatte sich der gute Lavater arg
getäuscht.
Nachdem Schiller genügend studiert hatte, wollte er auch
sein Examen machen in der Medizin und schrieb seine Arbeit. Die
Professoren prüften sie und fanden sie gut; — doch
meinten sie: Schiller denke nicht immer so wie sie; er habe zu
viele eigene Ideen und allzu viel Feuer.
Wohl, sagte der Herzog, so soll Schiller noch ein Jahr bei uns
bleiben, wir wollen ihm das Feuer erst legen. — Und Schiller
mußte noch ein Jahr länger in dieser Anstalt bleiben,
die er haßte.
In diesem Jahre schrieb Schiller sein erstes Drama, aber die
Professoren und der Herzog durften es nicht wissen. Nachts im
Geheimen mußte er schreiben, und da er zuletzt sein Werk
beendet hatte und es seinen Freunden fern im finstern Walde vorlas,
da war ihr Enthusiasmus unbeschreiblich, — solche Gedanken in
deutscher Sprache hatten sie nie zuvor weder gelesen noch
gehört.
Bald hatte Schiller auch sein Examen gemacht und war Arzt
geworden in einem Regimente, das in Stuttgart stand. Nun ließ
er sein Drama drucken, und es ging in die Welt und entflammte alle
Herzen. Überall, überall, wo man deutsch verstand, las
man »Die Räuber,« in den besten Theatern spielte
man dieses Stück und Schiller war mit einem Male berühmt
geworden.
Der Herzog selbst war stolz darauf, denn Schiller war ja aus
seiner Schule hervorgegangen; und doch wollte er ihn verhindern,
ferner Poesie zu schreiben. »Bücher über Medizin
mag der Schiller schreiben, keine Poesie,« — so etwa
schrieb der Tyrann an den Poeten.
Louis: Es ist ein Glück
für diesen Herzog Karl, daß ich nicht zu seiner Zeit
gelebt habe. Schiller hat doch Poesie geschrieben, nicht wahr?
Martha Meister: Gewiß,
aber das ist eine lange Geschichte, und ich fürchte, es wird Ihnen zu
viel, Herr Louis.
Louis: O nein, mein
Fräulein. Sie wissen sehr wohl, wie gespannt ich nun bin. Bitte, seien Sie so gut
und erzählen Sie weiter.
Martha Meister: Zur selben
Zeit lebten auch in Stuttgart die Herren Wolzogen; sie waren
Schul-Kameraden und Freunde von Schiller, und ihre Mutter nahm
großes Interesse an dem jungen Poeten und gehörte zu
denen, die ihn bewunderten, und sie hätte gar zu gerne einmal
»Die Räuber« im Theater zu Mannheim
gehört.
Schiller reiste dahin mit ihr und einer andern Freundin; aber da
er heimlich, ohne des Herzogs Wissen, Stuttgart verlassen hatte, so
hatte er die Damen gebeten, mit niemandem darüber zu reden.
Das versprachen denn auch die Damen sehr schnell.
Und sie kamen zurück und hatten »Die
Räuber« gesehen und dazu die Begeisterung der Menschen;
— und sie konnten nicht schweigen, es war ihnen
unmöglich! — Und nur einer Freundin erzählten sie
es; aber sie sagten zu ihr, daß sie es niemandem weiter
erzähle. Und die Freundin hatte auch eine Freundin und diese
wieder eine andere; und eine Freundin erzählte es der andern,
aber hatte immer zu derselben gesagt: »Ja nicht weiter
erzählen« — und so war es endlich doch zu des
Herzogs Ohren gekommen.
Der Herzog war ergrimmt, daß
Schiller, ein Offizier des Regiments, es gewagt
hatte, ohne seine Erlaubnis die Garnison zu verlassen, und er
gab ihm daher einige Wochen Arrest. Schiller aber hatte
beschlossen, frei, für immer frei zu werden.
Bald darauf wurde wieder des Herzogs Geburts-Tag gefeiert, und
die Gäste waren von weit und breit gekommen; und da war
großes Gedränge; Gäste zu Wagen
und zu Pferde kamen und gingen.
In derselben Nacht fuhr langsam ein Wagen zum Thore hinaus,
darin saßen zwei Männer, tief in ihre Mäntel
gehüllt. Die Nacht war finster, kein Stern stand am Himmel,
und die Beiden im Wagen saßen lautlos da. Nur einmal, als der
Wagen die Soldaten am Thore passierte, atmeten sie laut und frei,
und dann fuhr der Wagen schnell, und zuweilen konnte man einen
Seufzer und die Worte hören: Meine arme, arme Mutter!
Früh am nächsten Morgen hielt der Wagen in Mannheim,
und ein schlanker, hoher Mensch sprang herab, — es war
Schiller, der den Händen des Tyrannen entflohen war; er war in
einem andern Lande, — er war frei. An seine Schwester schrieb
er damals so:
»6. November 1782.
Teuerste Schwester!
Gestern Abend erhielt ich deinen lieben Brief und ich eile, dich
aus deinen und unserer besten Eltern Besorgnissen über mein
Schicksal zu reißen.
Daß meine völlige Trennung von Vaterland und Familie nunmehr
entschieden ist, würde mir sehr schmerzhaft sein, wenn ich sie
nicht erwartet und selbst befördert hätte, wenn ich
sie nicht als die notwendigste Führung des Himmels betrachten
müßte, welche mich in meinem Vaterlande nicht glücklich
machen wollte. Auch der Himmel ist es, dem wir die Zukunft
anvertrauen, von dem ihr und ich, gottlob nur
allein, abhängig seid; und Ihm übergebe ich euch,
meine Teuern; Er erhalte euch fest und stark, meine Schicksale
erleben und mein Glück mit der Zeit mit mir teilen zu
können. Losgerissen aus euren Armen, weiß ich keine
bessere, keine zuverlässigere
Niederlage meines teuersten Schatzes, als Gott. Von Seinen
Händen will ich euch wieder empfangen und — das sei die
letzte Thräne, die hier fällt!..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... Noch einmal, meine innig geliebte Schwester,
vertraue auf Gott, der auch der Gott deines fernen Bruders ist, dem
dreihundert Meilen eine Spanne breit
sind, wenn Er uns wieder zusammen gebracht haben will.
Grüße unsern besten, allerteuersten Vater und unsere
herzlich geliebte, gute Mutter, meine liebe, redliche Louise und
unsere kleine gute Nanette. Wenn mein Segen Kraft hat, so wird Gott
mit euch sein. Ein inneres, starkes Gefühl spricht laut in
meinem Herzen: Ich sehe euch wieder. — Vertraue auf Gott! Es
wird kein Haar von uns allen auf die Erde fallen.
Ich werde zu weich, Schwester, und schließe. Wenn
du die Wolzogen
sprichst, so mache ihr tausend Empfehlungen ....... Ich kann nicht
weiter schreiben. Du schreibst mir, wie bisher, über
Mannheim.
Ewig dein treuer, zärtlicher Bruder
Friedrich Schiller.«
So schrieb er an seine älteste Schwester, und Ihr werdet
wohl gemerkt haben, daß er in Mannheim nicht mehr war. Die
Verfolgung des Herzogs fürchtend, war er bald weiter
geflüchtet, wohin aber, das wußten nur wenige.
Schiller war verschwunden, sein Name wurde nun lange nicht mehr
gehört; — aber auf einem Land-Gute der Frau von Wolzogen
sah man jetzt zuweilen einen schlanken Mann durch Feld und Wald
gehen, langsam, mit gesenktem Haupte, oft wie träumend. Und
wenn die Leute ihn so sahen, so meinten die einen, er müsse
viel denken; andere meinten, er müsse wohl große Sorgen
haben — alle aber zogen voll Achtung den Hut vor ihm ab.
Es war Schiller. Hier lebte er und hier dichtete er
»Fiesko«. Doch bald durfte er wieder nach Mannheim
zurückkehren, und da vollendete er sein drittes Drama,
»Kabale und Liebe« — und auch dieses Drama
gefiel.
Schiller hätte nun glücklich leben können, denn
er war frei und wurde berühmt; aber er war arm. Das machte ihm
jetzt besonders viel Sorge; denn als er »Die
Räuber« hatte drucken lassen, hatte ein Freund, ein
Offizier, das
Geld für ihn geborgt; und da Schiller das Geld noch nicht
zurückzahlen konnte und der Freund selbst kein Geld hatte, den
Wechsel
zu bezahlen, so mußte er in das Gefängnis wandern, der
Freiheit und der Ehre beraubt — durch Schiller; und dieser
konnte an keine Hülfe denken für den treuen Freund.
Schiller war in Verzweiflung und murrte gegen die Göttin
der Poesie, die ihm bis heute nur Kummer und Leiden gebracht hatte.
Wahrlich, er wollte die Ungetreue verlassen, wollte sich ganz dem
Studium der Medizin hingeben und niemals, niemals wollte er wieder
dichten.
Aber es sollte nicht so kommen.
Zu dieser Zeit kam von Leipzig ein Brief an Schiller. Zwei
Herren und ihre Bräute hatten ihm gemeinschaftlich geschrieben, sie
wollten dem Dichter der Räuber den Tribut ihres Dankes
darbringen; die Damen hatten auch eine Hand-Arbeit an Schiller
gesandt mit der Bitte, sie anzunehmen als Zeichen ihrer
großen Bewunderung.
Das ist von Gott, dachte Schiller, und schrieb zurück und
erzählte seine traurige Lage und bat um Hilfe für seinen
gefangenen Freund, und bald erhielt er eine Summe, welche
groß genug war, den Freund zu befreien; Schiller selbst aber
folgte der Einladung, nach Leipzig zu kommen und wohnte jetzt bei
seinem guten und reichen Freunde Körner.
Louis: Nobler Körner!
Martha Meister: Ja, nobler
Körner! Er zerstreute die finsteren Wolken,
die über dem Haupte des Dichters schwebten, und brachte ihm
bessere Tage. Manche lehrreiche und manche frohe Stunde verlebten
sie da.
Und einmal, da sie so recht freudig zusammen gewesen waren,
hatte Schiller im Vollgefühl seines Glückes seine Ode
»An die Freude« gedichtet.
Gretchen: »Freude,
schöner Götter-Funken«?
Martha Meister: Dasselbe.
Beethoven faßte durch dieses Gedicht die Idee zu seiner
großen, wunderbaren Symphonie, der neunten.
Gretchen: Und endete sie mit
den Worten des Dichters.
Martha Meister: So ist es,
Schwester.
Bella: Und was war Schillers
nächstes Drama?
Martha Meister: »Don
Carlos«.
Gretchen: Verzeihe, Schwester,
wenn ich nochmals unterbreche. Es dürfte für Bella von
Interesse sein zu hören, daß die Musen den edlen
Körner reichlich belohnten für das, was er an ihrem
Liebling, Schiller, getan hatte.
Bella: Wie meinst Du das,
Gretchen?
Gretchen: Körners Sohn,
Theodor Körner, ist besonders von den Musen geliebt worden.
Theodor Körner ist ein deutscher Dichter von Gottes Gnaden. Er
war wie sein und seines Vaters Freund ein Dichter der Freiheit. Das
deutsche Volk ehrt ihn hoch und gedenkt seiner mit besonderer
Liebe. Mit der Leier sang und mit dem Schwerte kämpfte Theodor
Körner für sein Vaterland; und da
er einst in einer Schlacht schwer verwundet wurde und im Walde lag
und vermeinte, er müsse hilflos sterben, da
schrieb er mit der letzten Kraft die folgenden Verse:
Abschied vom Leben.
(Als ich schwer verwundet und hilflos in einem Holze lag und zu
sterben meinte. Nachts 17.-18. Juni 1813.)
Die Wunde brennt — die bleichen Lippen
beben.
Ich fühl's an meines Herzens matterm Schlage:
Hier steh' ich an den Marken meiner Tage
—
Gott, wie du willst, dir hab' ich mich ergeben.
Viel gold'ne Bilder sah ich um mich schweben;
Das schöne Traum-Bild wird zur Toten-Klage.
Mut! Mut! — Was ich treu im Herzen trage,
Das muß ja doch dort ewig mit mir leben!
Und was ich hier als Heiligtum erkannte,
Wofür ich rasch und jugendlich entbrannte, —
Ob ich's nun Freiheit, ob ich's Liebe nannte:
Als lichten Seraph seh' ich's vor mir
stehen;
Und wie die Sinne langsam mir vergehen,
Trägt mich ein Hauch zu
morgenroten Höhen. —
Aber seine Todes-Stunde war noch nicht gekommen; Leute hatten
ihn gefunden und erhielten ihn am Leben.
Martha Meister: Laß uns
einmal sein »Gebet während der Schlacht« singen,
Gretchen, das ist groß.
Vater, ich rufe dich:
Brüllend umwölkt mich der Dampf der Geschütze,
Sprühend umzucken mich rasselnde Blitze.
Lenker der Schlachten, ich rufe dich!
Vater du, führe mich!
Vater du, führe
mich!
Führ' mich zum Siege, führ' mich zum Tode;
Herr, ich erkenne deine Gebote.
Herr, wie du willst, so führe mich,
Gott, ich erkenne dich!
Gott, ich erkenne
dich!
So im herbstlichen Rauschen der Blätter
Als im Schlachten-Donnerwetter,
Urquell der Gnade, erkenn' ich dich.
Vater du, segne mich!
Vater du, segne mich!
In deine Hand befehl' ich mein Leben,
Du kannst es nehmen, du hast es gegeben;
Zum Leben, zum Sterben segne mich.
Vater, ich preise dich!
Vater, ich preise
dich!
Es ist ja kein Kampf um die Güter der Erde, —
Das Heiligste schützen wir mit dem Schwerte.
D'rum fallend und siegend preis' ich dich!
Gott, dir ergeb' ich mich!
Gott, dir ergeb' ich
mich!
Wenn mich die Donner des Todes begrüßen,
Wenn meine Adern geöffnet fließen,
Dir, mein Gott, dir ergeb' ich mich!
Vater, ich rufe dich!
Gretchen: So, Schwester, nun
werde ich Dich nicht mehr stören.
Louis: Wie ist es unserm
Schiller weiter ergangen, Fräulein Martha?
Martha Meister: Er war
Professor geworden an der Universität zu Jena, und seine
Vorlesungen über Geschichte waren so beliebt, daß
Studenten von vielen anderen Universitäten kamen, um ihn zu
hören. Und das war auch gar nicht zu verwundern; denn Schiller
gab seine Vorlesungen ganz anders und viel besser als die anderen
Professoren der Geschichte und wie er schon Großes geleistet hatte in der deutschen Poesie, so
tat er es jetzt in der Geschichte.
Auch in seiner Familie war er glücklich. Er hatte ein
treues, liebes Weib und viele Freunde; — doch den teuersten
von allen sollte er später finden.
Da waren eines Abends zu einer gelehrten Gesellschaft viele
Professoren gekommen, unter diesen auch Goethe[V-5]. Als die
Sitzung zu Ende war, begleitete er Schiller. Sie sprachen lebhaft
zusammen und gewiß über etwas, was von hohem Interesse
für beide war. Denn Goethe[V-6] war sehr
erstaunt, als er mit einem Male vor Schillers[V-7] Wohnung
stand; aber er
ging mit Schiller hinein, und dort sprachen sie weiter, und es war
schon spät, als sie sich trennten.
In dieser Nacht geschah es, daß Goethe[V-8] und
Schiller Freunde wurden für das ganze Leben.
Goethe[V-9] wohnte
in Weimar, und bald zog nun auch Schiller dahin, um ganz der Poesie
zu leben; und hier erstanden in der Freundschaft dieser beiden
großen Männer diejenigen Werke, welche Deutschland zu
seinen besten zählt. Hier schrieb Schiller das große
Drama »Wallenstein«, auch »Maria Stuart«
und »Die Braut von Messina«, sowie »Die Jungfrau
von Orleans« und dann die wunderschönen Balladen.
Als Schiller im Jahre 1798 nach langer Zeit wieder einmal nach
Leipzig gekommen war, spielte man dem Dichter zu Ehren im Theater
»Die Jungfrau von Orleans«.
Auch der Poet war gegenwärtig, und als das Drama beendet
war und er das Theater verlassen und auf die Straße treten
wollte, hatten sich viele tausend Menschen vor dem Hause
aufgestellt. In tiefster Ehrfurcht trennte sich die Menge und ließ den Poeten durch die Mitte
gehen, und auf beiden Seiten beugten sich alle mit
entblößtem Haupte vor ihm. Die Mütter hatten ihre
Kinder gebracht und in die Höhe gehoben und ihnen
zugeflüstert: Seht, seht, das ist er! — War das nicht
ein herrlicher Triumph für den Dichter?
Einst hatte er in jungen Jahren von Dichter-Ruhm und von Unsterblichkeit
geträumt und in seinen reiferen Jahren sah er Ruhm und Unsterblichkeit, und die Bewunderung von
Mit- und Nachwelt waren ihm reichlich zu teil, aber im Ringen des
Geistes war die Hülle zerbrechlich geworden.
Der Poet war schwach und krank und sein Ende sah er eilends
nahen. Ach, so vieles hätte er noch gerne sagen mögen von
dem, was ihm die große edle Seele füllte, und da schrieb
er sein letztes, sein lieblichstes von allen seinen Werken
»Wilhelm Tell«.
Gretchen: Ja, ja, Martha, da
hast Du recht, »Wilhelm Tell« ist ein Juwel in
Schillers Werken.
Martha Meister: Mir ist es das
liebste von allen seinen Dramen, und ich glaube, dem deutschen
Volke ebenfalls. »Wilhelm Tell« ist Schillers
Testament, und wie sein erstes, so ist sein letztes Drama —
ein Sang der Freiheit.
»Bewahret euch die Freiheit; sie ist teurer, als alles,
was ihr besitzet!« — rief er dem deutschen Volke zu.
Mit seinem Propheten-Auge hatte er die nahenden trüben Zeiten
gesehen und er kannte bereits den Tyrannen, der das Volk zu
bedrücken kam, und darum wollte er vor seinem Tode seiner
Nation noch zeigen, was ein edles Volk tun sollte, wenn man ihm
sein Bestes, die Freiheit, rauben will.
Ob er recht gesehen hatte?
Im Jahre 1808 — Schiller weilte nicht mehr unter den
Sterblichen — als Napoleons Hand schwer auf Europa und vornehmlich auf Deutschland lastete, da spielte man im Theater zu Berlin
»Wilhelm Tell«, Schillers Drama. Von Anfang an folgte
man mit Spannung, bis zuletzt der Enthusiasmus schwoll und alle so
gewaltig packte, daß das ganze Publikum sich von den Sitzen
erhob und, sich selbst vergessend, mit den Schauspielern rief:
»Wir wollen sein ein einig Volk von
Brüdern,
In keiner Not uns trennen und Gefahr.
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,
Eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.
Wir wollen trauen auf den höchsten Gott
Und uns nicht fürchten vor der Macht der
Menschen.«
Und den Deutschen kam wieder Mut und Kraft und Freiheit.
Gretchen: Ja, Napoleon hat
dieses Drama gefürchtet, denn es hatte eine Macht, bedeutender als Vogt.
Martha Meister: Das ist wahr.
— Aber wie schön, Gretchen, ist die Sprache in
»Wilhelm Tell«, nicht wahr? Es ist etwas Wunderbares in
dieser Sprache, ein Etwas, das ich in keinem andern Drama von
Schiller und auch bei keinem andern deutschen Poeten wiederfinde,
— ich meine, es sei der Geist des Poeten, der noch ruht
zwischen den Silben und Wörtern. Ich bitte Dich, liebe
Schwester, sage doch einmal jene Stelle, in welcher Melchthal das
Unglück seines Vaters beklagt.
Gretchen: Also, der junge
Melchthal war von Hause entflohen vor dem tyrannischen Vogte und hatte
Schutz gefunden beim edlen Walther Fürst. Stauffacher, der
Patriot, kommt zu diesem, bespricht mit ihm des Landes Unglück
und erzählt auch von der Grausamkeit des Vogtes, wie nämlich
dieser den alten Melchthal geblendet habe, weil er nicht sagen wollte
oder konnte, wohin sein Sohn sich geflüchtet hätte. Alles
dieses hatte der junge Melchthal im nächsten Zimmer
gehört; er stürzt hervor, und in
seinem großen Seelen-Schmerze ruft er aus:
»O, eine edle Himmels-Gabe ist
Das Licht des Auges — alle Wesen
leben
Vom Lichte, jedes glückliche Geschöpf —
Die Pflanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte.
Und er muß sitzen, fühlend, in der Nacht,
Im ewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr
Der Matten
warmes Grün, der Blumen Schmelz,
Die roten Firnen kann
er nicht mehr schauen —
Sterben ist nichts, — doch leben und nicht sehen,
Das ist ein Unglück. — Warum seht ihr mich
So jammernd an? Ich hab' zwei frische Augen
Und kann dem blinden Vater keines geben,
Nicht einen Schimmer von dem Meer des Lichts,
Das glanzvoll, blendend mir in's Auge dringt.«
So spricht der junge Melchthal und er schwört dem Wüterich Rache und spricht zu
den beiden Männern, Walther Fürst und Stauffacher,
daß sie an's Freiheits-Werk gehen mit ihm. Und sie machen
einen Plan, und
dann ruft der junge Melchthal diese Worte:
— »Blinder, alter Vater,
Du kannst den Tag der Freiheit nicht mehr schauen;
Du sollst ihn hören. — Wenn von Alp zu Alp
Die Feuerzeichen flammend sich
erheben,
Die festen Schlösser der Tyrannen fallen,
In deine Hütte soll der Schweizer wallen,
Zu deinem Ohr die Freuden-Kunde tragen,
Und hell in deiner Nacht soll es dir tagen.«
Bella: O, Gretchen, ist das
herrlich!
Louis: Und wie schön, wie
schön Sie das lesen, liebes Fräulein. Sehen Sie, meiner
Schwester Martha kommen die Thränen aus den Augen.
Martha Parks: Ja, und Dir
auch, Louis.
Martha Meister: Mit
Thränen dürft Ihr aber nicht aus unserm Hause gehen;
bleibet noch ein wenig hier, wir wollen — ja, was wollen wir
doch gleich tun? Bella, Gretchen, sprechet!
Bella: Laßt uns
Pfänder spielen.
Gretchen: O ja; »Zwanzig
Fragen«.
Martha Meister: Ich
möchte Euch einen Vorschlag machen. Als Du, liebe Schwester,
Annas Brief vorgelesen hattest, kam mir die Idee, wie interessant
es sein müßte, wenn wir Rätsel gäben, wie Anna
es getan hat in ihrem Briefe. Entschuldigt mich einen Moment, und
dann werde ich Euch zeigen, was ich meine; ich will nur jenen
Kasten mit
Photographien holen. So, ich habe hier diese Bilder gewählt.
Ich gebe Ihnen eins, Herr Louis, und auch Dir eins, Martha. Aber du
mußt es niemandem zeigen, Martha; halte es fest an Dich
— so, das ist recht.
Martha Parks: Kann ich es
nicht einmal Louis zeigen?
Martha Meister: Nein,
niemandem, Martha; wir wollen ja gerade
raten, welche Persönlichkeit Du in der Hand hast. —
Hier, Bella, nimm dieses, und dieses ist für Dich, Gretchen;
— und nun möchte ich Euch zeigen, wie ich es meine:
Ich habe in meiner Hand das Bild eines Mannes; er ist alt, aber
sehr freundlich und schön. Weißes Haar wallt in Locken
von seinem Kopfe, der schön geformt ist. Seine Stirne ist hoch
und geistreich, seine
Augen blicken mild, — ich vermute, sie sind blau, doch
gewiß weiß ich es nicht, — und sein Mund ist so
freundlich; der alte Herr scheint so gütig, ich möchte
ihn küssen. Ihr könnt noch nicht wissen, wer es ist;
— ich will euch noch ein wenig mehr sagen. Er ist kein
Amerikaner, — er ist sehr berühmt, und er hat viele
Jahre außerhalb seines Vaterlandes gelebt.
Bella: Ist es ein
Deutscher?
Martha Meister: Nein.
Martha Parks: Ein
Engländer?
Martha Meister: Nein.
Louis: Ein Franzose?
Martha Meister: Nein.
Gretchen: Ein Spanier?
Martha Meister: Nein.
Bella: Kein Franzose, kein
Engländer, kein Deutscher, kein Amerikaner, kein Spanier. Ist
er ein Italiener?
Martha Meister: Nein.
Louis: Dann ist es kein
Europäer; es ist ein Chinese.
Martha Meister: O nein, Louis;
er hat keinen Zopf — es
ist ein Europäer.
Martha Parks: Ist es ein
Däne?
Martha Meister: Richtig, ein
Däne.
Gretchen: Ein Däne?
— Schön, berühmt und alt? Hat lange im Auslande
gelebt? Wer mag das sein?
Bella: Ach, Martha, Du machst
es auch zu schwer.
Louis: Was hat er denn
Berühmtes getan?
Martha Meister: Raten Sie
doch, Herr Louis!
Louis: War er ein Soldat?
Martha Meister: Nein.
Bella: Ein Kaufmann?
Martha Meister: Nein.
Gretchen: Dann war er ein
Künstler.
Martha Meister: Das war
er.
Martha Parks: Ein Musiker?
Martha Meister: Nein.
Bella: Ein Maler?
Martha Meister: Nein.
Bella: Nun, dann kann ich es
nicht erraten.
Martha Meister: Nun, Gretchen,
sinne nach; Du mußt es finden.
Gretchen: Kenne ich ihn?
Martha Meister: O ja; wir
haben ein Werk von ihm.
Gretchen: Er ist kein Poet?
— nein; ich glaube, ich habe es. Ist er ein Bild-Hauer —
ja? Wir haben eine Statue von ihm, nicht wahr? — Lebte er
lange in Rom?
Martha Meister: Ja, ja;
— nur weiter.
Gretchen: Ist es
Thorwaldsen?
Martha Meister: Ja,
Thorwaldsen ist es. — Hier ist sein Bild.
Bella: O, wie schön er
ist.
Louis: Das hätte ich
niemals geraten.
Martha Meister: Nun, Herr
Louis, wissen Sie, was ich meine; nun können Sie beginnen.
Louis: Sehr wohl: — Ich
halte hier in meiner Hand das Bild eines Mannes, welcher sitzt; er
ist nicht sehr groß, aber er hat große Stiefel an. Er ist auch ein berühmter Mann;
er blickt sehr finster aus seinen Augen und ist ein Franzose und
ist auf einer fernen Insel gestorben.
Bella: Das ist Napoleon.
Louis: O Bella, warum raten
Sie es so schnell? Sie sind zu klug.
Martha Meister: Sie machen es
uns zu leicht, Herr Louis.
Bella: Jetzt können Sie
es bei mir auch so machen, Herr Louis. Ich habe ein
wunderschönes Bild, es ist reizend. Es ist ein Mann; er ist
jung, und seine schöne, geschickte Hand stützt den Kopf,
auf dem eine Kappe sitzt, so eine Art Barett, wissen Sie; darunter
hervor quellen die prachtvollsten Locken, und die Augen, — o,
die Augen, Louis, sollten Sie sehen!
Louis: Das ist gar kein
Mensch, das muß ein Engel sein.
Bella: Nein, Louis; bleiben
wir ruhig auf der Erde.
Martha Meister: Was ist er?
Ist er ein Bildhauer?
Bella: Nein.
Martha Meister: Ist er ein
Künstler?
Bella: Ja.
Gretchen: Ein Italiener?
Bella: Ja. — Geh' nicht
zu schnell Gretchen.
Louis: Ist er ein Musiker?
Bella: Nein.
Louis: Ein Maler?
Bella: Ja.
Louis: Ist es Raphael?
Bella: Ja, nun sind wir quitt,
Louis; nicht wahr?
Louis: Und nun kommen Sie,
Fräulein Gretchen.
Gretchen: Mir hat man keines
schönen Mannes Bild gegeben. Er ist häßlich, sehr
häßlich; dafür war er aber um so geistreicher; und
trotz seiner Häßlichkeit hat ihn einmal eine Marquise im
Theater vor einem großen Publikum im Namen des Publikums umarmen und
küssen müssen.
Bella: So, das wird ja recht
interessant.
Gretchen: Ja; er trägt
eine Perücke.
Martha Parks: Washington?
Gretchen: Nein, Martha, nicht
Washington. Er war kein Amerikaner, er war kein Republikaner, aber
er hat eine Republik befördert und einen großen
König hatte er zum Freunde.
Martha Meister: Das sind
Widersprüche.
Gretchen: Und doch ist alles
in Ordnung.
Martha Meister: War es ein
Franzose?
Gretchen: Ja.
Martha Meister: Und war er
sehr geizig?
Gretchen: Ganz recht.
Martha Meister: Und hat er am
Ende sehr viel Wohlthätiges getan mit seinem Gelde?
Gretchen: Ja, ja; nun sag' es
nur, Du hast es schon erraten.
Martha Meister: War es
Voltaire?
Gretchen: Voltaire.
Martha Parks: Nun will ich es
Euch aber nicht schwer machen, denn es ist von selbst schon schwer
genug.
Martha Meister: So, Du machst
uns wirklich angst, Martha.
Martha Parks: Durch diesen
Mann kam eine Revolution über die ganze Erde.
Louis: Oho!
Martha Parks: Ja, ja, Louis;
so sagte meine Gouvernante.
Louis: O, dann ist es wahr,
Schwester; und weiter?
Martha Parks: Und er hat einen
Hut auf.
Louis: So?
Martha Parks: Ich bin noch
nicht zu Ende. Der Hut ist nicht wie Dein Hut, Louis; auch nicht
wie Alberts oder Papas Hut.
Louis: Dann hat er am Ende
einen Damen-Hut auf.
Martha Parks: O nein;
Männer tragen solche Hüte, aber nicht auf dem Lande.
Louis: Nicht auf dem Lande;
hm, hm, — und war er ein Amerikaner?
Martha Parks: Ein Amerikaner,
— ja — nein, er war nicht in Amerika geboren.
Louis: Ist er in Europa
geboren worden?
Martha Parks: O ja.
Bella: In Deutschland?
Martha Parks: Nein, Bella,
nicht in Deutschland, auch nicht in England und nicht in Frankreich
und nicht in Spanien und nicht in Dänemark.
Martha Meister: Vielleicht in
Holland?
Martha Parks: Nein,
Martha.
Gretchen: In Italien?
Martha Parks: Ja, in Italien
ist er geboren worden — nun, ich will Euch ein klein wenig
helfen, — ich sehe, es wird Euch wirklich schwer. Die
Menschen waren sehr böse gegen ihn und haben ihm gar nicht
gedankt für das Gute, was er getan hat für sie, und
zuletzt hat man ihn in ein Gefängnis geworfen, und er ist
begraben worden mit seinen Ketten.
Louis: Wer mag das nur
sein?
Martha Parks: O, Louis! Das
weißt Du nicht? Columbus ist es, Columbus!
Louis: O, meine Damen, das
hätten wir auch wissen können.
Martha Parks: So, nun kommst
Du, Martha.
Martha Meister: Aber ich habe
ja schon — weißt Du nicht?
Martha Parks: Ja, aber damit
hast Du es uns nur gezeigt.
Louis: Bitte, mein
Fräulein.
Martha Meister: Nun wohl. Den
Mann, dessen Bild Sie mir gaben, Herr Louis, müssen wir alle
verehren wegen seiner großen Gelehrsamkeit;
der Wissenschaft hat er sein ganzes Leben geopfert und sein
großes Vermögen, und vielleicht hat nie
ein Mann vor ihm gelebt, der so gelehrt gewesen ist wie er. Er ist
sehr alt geworden; er kommt aus einer edlen Familie und sein
Bruder, der ebenfalls sehr gelehrt war, hat auch viele Bücher
geschrieben; die größten Männer Deutschlands und
viele Fürsten waren seine Freunde. Kennt Ihr jetzt den
Mann?
Bella: Noch nicht; war er
selbst ein Deutscher?
Martha Meister: Ja.
Gretchen: War es Alexander von
Humboldt?
Martha Meister: Erraten,
Schwester, erraten!
Louis: So, meine Damen; nun
müssen wir aber doch wohl gehen; — es wird uns zu
spät, nicht wahr, Martha?
Martha Parks: Wir müssen
nun gehen und müssen sehen, wie es unserm Bruder Otto
geht.
Martha Meister:
Grüßen Sie ihn von mir.
Gretchen: Und von mir.
Bella: Auch von mir,
bitte.
Martha Parks: Adieu! Wir haben
immer so viel Vergnügen bei Euch.
Gretchen: Das freut uns. Kommt
recht bald wieder.
Bella: Und bringt die Herren
Brüder mit!
Martha Parks: Danke.
Louis: Adieu!

VI.
Bella: Herr Doktor, sagen Sie
mir, sind Sie unglücklich?
Gretchen: Aber — welche
Frage, Bella!
Dr. Albert: Verzeihen Sie dieses
Lächeln, mein liebes Fräulein, aber Ihre Frage ist
wirklich überraschend für mich — und dabei sind Sie
so originell und sehen mich so ängstlich, so neugierig an mit
Ihren großen, schönen Augen! — Was auf Erden,
beste Freundin, bringt Sie auf solche Gedanken?
Bella: Ich — ich
—
Louis: Ich war es, nicht wahr,
Fräulein Bella? Ich erzählte Ihnen, daß Bruder
Albert seit kurzem immer sehr ernst sei und immer Falten auf der
Stirne habe — etwa so — siehst Du, Albert, ganz wie ich
jetzt, so siehst Du gewöhnlich aus.
Dr. Albert: Aha — ich verstehe. Die
Herrschaften waren so gütig, meine Persönlichkeit zum
Gegenstande ihrer Betrachtungen zu
machen. Für diese Ehre schulde ich Ihnen großen Dank, in
der Tat; allein da werde ich in Zukunft wohl recht vorsichtig vor
Ihnen sein müssen. Also Falten haben Sie auf meiner Stirne
entdeckt,
wirkliche Falten und daher die wohlgemeinte Frage meiner Freundin:
»Herr Doktor, sind Sie unglücklich?« Aber bedeuten
Falten denn immer Unglück? Oftmals sind sie Zeichen der Sorge
oder des Schmerzes und auch der Reue; oft aber deuten sie auf
ernstliches Denken und sind wie die dunklen Schatten, welche hier
und da auf grünen, sonnigen Bergen ruhen. Der Landmann sieht sie häufig
mit Freude, denn gerade diese Schatten kommen von den Wolken,
welche über den Bergen und auf ihren Gipfeln schweben und seinen durstigen Saaten
den warmen, befruchtenden Regen verheißen. — Nun
möchten Sie wohl gar zu gerne wissen, meine Freundin, was die
Falten auf dieser Stirne bedeuten? Denken Sie ja nicht allzu viel
nach, meine Freundin, sonst — sonst —
Bella: Bekomme ich auch solche
Falten, nicht wahr?
Dr. Albert: Und das wäre doch schade,
Bruder Otto, meinst Du nicht so?
Gretchen: Sie zeigen soeben,
Herr Doktor, daß Sie selbst sehr gerne beobachten.
Dr. Albert: O gewiß, mein
Fräulein, das thue ich, denn alles in der Welt hat Interesse
für mich: Menschen und Pflanzen, Tiere und Steine, alles,
alles. Die Betrachtung der Natur zumal
gewährt mir hohen Genuß. Geht es Ihnen nicht auch
so, Fräulein Martha?
Martha Meister: Auch ich finde
viel Freude im Beschauen der Natur; allein wie wenig Gelegenheit
findet man dazu in einer großen Stadt.
Bella: Das meine ich auch. Ich
lese und höre so viel von dem Schönen, von den Wundern der
Welt; aber hier bin ich jahraus,
jahrein inmitten einer ungeheuern Masse von Backsteinen. Ich
möchte wohl auch einmal etwas in der Welt beschauen.
Dr. Albert: Wirklich? Dann gehen Sie doch
einmal mit mir, wenn ich durch die Wälder streife.
Bella: O, das wäre
herrlich, Herr Doktor! — Nein, nein, es geht doch wohl nicht,
denn Sie bleiben ja immer so lange fort. Was Sie da wohl tun, wenn
Sie Tag und Nacht von Hause bleiben? — Ei, das möchte
ich gar zu gerne erfahren, mein lieber Herr Doktor — aber das
sind wohl auch Geheimnisse, nicht wahr?
Dr. Albert: Durchaus nicht, mein
Fräulein. Ich weile gern in der großen Stadt, denn
gerade dieses Lärmen und Treiben ist es, wodurch auch in mir
die Lust zum Schaffen erweckt wird.
Allein, wenn nach langem Studieren und Schreiben und Denken mein
Auge ermattet und die Hand mir erlahmt und mein Ohr des nimmer
endenden Geräusches müde wird, wenn mein Geist seine
Frische verliert und den Mut und den Enthusiasmus, — dann
schließe ich schnell mein Buch und mein Zimmer, dann ergreife
ich die Flinte und eile hinaus in die weite, weite Welt und steige
hinauf auf die Berge.
Oftmals geschah es dann wohl, daß ich lange nach
Mitternacht noch lauernd im Gebüsche stand. Aus den schlanken
Tannen
kam dann das Reh mit dem Jungen arglos und langsam hervor und so
lieblich war es im silbernen Lichte des Mondes anzuschauen,
daß ich, auf die Flinte gestützt, ruhig blieb und mich so
lange erfreute am Anblick, bis sie beide in graziöser Schnelle
weiter dahin eilten.
Öfters aber schaute ich auf zum dunkelblauen Himmels-Zelte,
zu den Sternen ohne Zahl, und unaussprechliches Staunen
erfaßte mich über die unbeschreibliche Pracht. Wessen
Seele müßte nicht heiligste Ehrfurcht empfinden vor
solch' erhabenem Anblicke? Sind nicht viele jener Sterne tausend
und tausendmal größer als der Erdball? Welcher Verstand könnte
die Unendlichkeit des Welten-Raumes erfassen, in dem alle diese Sterne ihre eigenen
Bahnen mit unglaublicher Schnelle
durcheilen! Der Mensch kann nur staunen. — Ein Nichts
erscheint er sich selbst, ein Atom im Weltall; er beugt in
Demut sein Haupt vor dem Schöpfer und versinkt in die
tiefste Anbetung. In seinem Innern aber erhebt sich
dann wohl jauchzend die Stimme: Der allgewaltige Schöpfer
dieser wunderbaren, großen, unendlichen Welt ist ja auch dein
liebender Vater; er wachet und waltet über alle Wesen mit
Vater-Güte und dem Menschen gab er die Einsicht, daß er dieses verstehe, und er
gab ihm ein Herz, daß er es fühle. Dann hebt sich die
Brust, und neues Leben durchrinnt mich wieder. Neue Gedanken und
neue Pläne zu großen und guten Taten beginnen in mir zu
keimen; elastisch springe ich auf aus meinem
Verstecke und dringe vorwärts.
überall um mich in den Büschen regt es sich, denn der Tag
bricht neu an. Ich klimme aufwärts, bis ich den Gipfel des
Berges erreiche, ah — von neuem eine unbeschreibliche
Überraschung! Vor mir liegt der Ocean, endlos, endlos; ich
erhebe meine Hände beim Anblick desselben, mein Herz
strömt über von Glück, aus den Augen brechen
Thränen der Freude, und meine Lippen murmeln — Worte des
Psalmisten: »Preise den Herrn, meine Seele, die Welt ist
seiner Herrlichkeit voll, die Majestät des Herrn ist
groß und mächtig. — O, wie sind deine Werke
wunderbar — alles hast du mit Weisheit geschaffen — die
Erde ist voll deiner Güter. — Dem Herrn sei Lob und Ehr'
in Ewigkeit.«
Martha Parks: O Albert, wie Du
sprechen kannst. Ich könnte Dir immer zuhören.
Martha Meister: Herr Doktor,
Sie sprechen mir wie aus der Seele.
Dr. Albert: Das will ich wohl glauben, mein
Fräulein; ich sah in Ihre Augen und da las ich wie in einem
Buche.
Otto: Geht es Dir auch so wie
mir, Albert? Wenn ich mit Personen rede, welche mir ganz und gar
sympathisch sind, dann entstehen auf einmal in mir Gedanken, die
ich nie zuvor gehegt. Welch' wunderbare
Macht doch das menschliche Auge besitzt!
Martha Meister: Gleichen hierin nicht
manche Augen der Sonne, deren Strahlen Leben erzeugen, wenn sie auf
fruchtbaren Boden fallen?
Otto: Mein Fräulein, Ihr
Vergleich gefällt mir.
Martha Parks: Otto, welche
Augen hältst Du für die schönsten, die blauen oder
die braunen?
Otto: Schwesterchen,
möchtest Du wohl anstatt meiner Ansicht die schönen Worte
eines Poeten hören?
Martha Parks: Ach ja, bitte,
Otto.
Otto: In Mirza Schaffy's
Liedern heißt es so:
»Ein graues Auge —
Ein schlaues Auge.
Auf schelmische Launen
Deuten die braunen;
Des Auges Bläue
Bedeutet Treue,
Doch eines schwarzen Aug's Gefunkel
Ist stets, wie Gottes Wege, dunkel!«
Bella: Das ist ganz reizend.
Was meinst Du dazu, Martha?
Martha Parks: Es ist ein
allerliebstes Gedicht. Laß doch mal sehen, Bella, was
für Augen hast denn Du? O, Du hast braune Augen, Du hast
schelmische Augen, Bella. Wißt Ihr aber auch, wer die
schönsten Augen hat? Ich weiß es. — Ein Freund
meines Bruders Albert. Er wohnt in Deutschland und bald kommt er zu
uns. Albert hat mir viel von ihm erzählt; er hat große,
blaue Augen, sagt Albert, und bald sind sie melancholisch und bald
traurig, und dann wieder mutig, — nicht wahr, Albert, hast Du
mir nicht so gesagt?
Dr. Albert: Ja, ja, Du kleine Schwätzerin!
Martha Parks: Ach, sollte ich
nicht davon sprechen, Albert? Das habe ich nicht gewußt. Aber
das schadet
nicht, Albert, unsere Freundinnen dürfen alles wissen, Martha
und Gretchen und Bella, nicht wahr?
Bella: Aber warum wollen Sie
uns nicht auch von ihm erzählen, Herr Doktor? Sie sind unser
Freund und Ihre Freunde sind auch die unsern, und wir müssen
sie kennen. Ist es nicht, wie ich sage? Gretchen, sprich Du!
Gretchen: Gewiß, Herr
Doktor, Ihre Freunde finden bei uns stets einen herzlichen
Empfang.
Dr. Albert: Dafür danke ich Ihnen,
meine Freundinnen, und erlauben Sie mir zu sagen, daß ich auf
Ihre Freundschaft sehr stolz bin.
Bella: Und wir auf die
Ihrige.
Martha Meister: Wir bitten
Sie, Herr Doktor, Ihren Freund nach seiner Ankunft bei uns
einzuführen.
Dr. Albert: Ich bin Ihnen außerordentlich verbunden, allein ich dürfte kaum in die
Lage kommen, von Ihrer gütigen Erlaubnis Gebrauch zu
machen.
Gretchen: Aber weshalb denn
nicht, Herr Doktor?
Dr. Albert: Mein Freund geht selten in
Gesellschaft, niemals aber dann, wenn Damen gegenwärtig
sind.
Gretchen: Was Sie sagen!
Martha Meister: Aber Ihr
Freund fürchtet sich doch nicht vor Damen?
Dr. Albert: Nein, das nicht; aber wie ich
sagte, meine Damen, es ist wirklich so.
Bella: Damenscheu! — O
das ist wirklich interessant. Herr Doktor, wir lassen Sie heute
nicht gehen, wenn Sie uns nicht viel, wenn Sie nicht alles, was Sie
wissen, von Ihrem Freunde erzählen. Fangen Sie schnell an,
bitte, bitte, lieber Herr Doktor, ich werde Ihnen dafür auch
ewig dankbar sein.
Louis: Albert, solchen Bitten
kannst Du nicht widerstehen, das weiß ich.
Dr. Albert: Wenn ich Ihnen willfahre, Fräulein Bella, so geschieht
es sicher gegen den Willen meines Freundes.
Bella: Er wird Ihnen vergeben;
wir alle werden für Sie um Verzeihung bitten.
Dr. Albert: Wohl, dann will ich's
wagen!
Ehe ich vor mehreren Jahren nach Deutschland reiste, hatte ich
oft gehört, daß unsere Eisenbahnen viel besser
wären, als diejenigen in Europa; und als ich nun nach meiner
Ankunft in Deutschland abends spät in Hamburg in den Eisenbahn-Zug
einstieg, um nach Hannover zu fahren, fand ich es wirklich so. Da
war ich zum ersten Mal in einem Coupé[VI-1]. Die
Sitze an sich waren allerdings sehr bequem, allein das Coupé
war recht eng, und man hatte weder genügend Luft
noch Licht und gar keine Freiheit der Bewegung. Man kann nicht, wie
bei uns, von einem Wagen zum andern gehen, man hat nicht einmal
Verbindung mit den Coupés[VI-2] desselben Wagens. Ich fühlte
mich beengt. Wie unangenehm, dachte ich, muß es doch sein,
wenn man in solch' kleinem Raume mit Reisenden zusammentrifft,
welche uns nicht behagen, oder wie gefährlich könnte es
werden, wenn man nachts allein mit unredlich Menschen reisen müßte.
Dabei fahren die deutschen Eisenbahnen bei weitem nicht so
schnell, wie die unsrigen.
Mehrere Stunden mochte ich wohl gefahren sein, als der Schaffner rief: »Aussteigen! Dieser Zug bleibt hier liegen, der nächste Zug nach
Hannover kommt in einer Stunde.« — Ich stieg aus und
ging in den Wartesaal. Es war eine Stunde nach
Mitternacht und es war kühl. In dem hohen Zimmer, das vom
Tabacks-Rauche schwarz gefärbt und darum düster war,
brannte ein kleines Licht; ich war sehr müde und schlief bald
auf einem Stuhle. Ein heftiges Schütteln
erweckte mich; ein Mann hatte mich an beiden Schultern gefaßt
und schrie mit Donner-Stimme mir ins Ohr: »Einsteigen nach
Hannover.« Es war zwei Uhr. — Murrend über die
rauhe Störung und noch halb schlafend, ergriff ich hastig mein
Gepäck und eilte hinaus. Kaum erreichte ich meine
Coupé, so brauste der Zug schon weiter. Ich sah mich um,
— war ich allein? ha — in der einen Ecke saß ein
Mann mit einem großen breiten Hute und blickte mich
schrecklich an, so daß ich unwillkürlich nach
meiner Pistolen-Tasche griff. Ebenso schnell war der Kerl in der Ecke aufgesprungen, hielt mir einen
Revolver entgegen und schrie: Was wollen Sie? — Was wollen
Sie? rief ich. — Ich will nichts, wohl aber Sie. — O,
ich will auch nichts. — Warum griffen Sie nach Ihrem Pistol?
— Weil Sie nach dem Ihrigen griffen und mich anstarren,
lüstern wie ein Räuber.
Ich — ein Räuber! rief er und lachte dabei so
herzlich, daß ich nun völlig munter
wurde und mich wahrhaft schämte. Betrachten Sie mich
ordentlich, guter Freund; sehe ich aus wie ein Räuber, sagte
er und dabei nahm er seinen Hut vom Kopfe und zeigte ein
sonnenverbranntes Gesicht. Die Züge desselben waren
regelmäßig. Die Stirne war hoch und der Kopf höchst
charakteristisch; wahrhaft schön aber waren die großen
Augen. Ich bat ihn, mir meinen Irrtum zu vergeben. Bitte sehr,
bitte, mein Herr, sagte er in melodischer, freundlicher Stimme; Sie
sind ein Fremder, wie ich an Ihrer Sprache höre und tun sehr
wohl daran, vorsichtig zu sein. — Wir reichten einander die
Hände, setzten uns nieder und hatten bald die interessanteste
Unterhaltung in englischer Sprache. Er sprach das Englische so rein
und so fließend, daß es mir selber nicht klar wurde,
welches von beiden Ländern seine Heimat wäre, ob England
oder ob Deutschland. Er erzählte gerne und gut von seinen
großen Reisen, er sagte mir, daß er gerade jetzt von
einer Reise um die Welt nach dem Eltern-Hause in Berlin
zurückkehre, und ich bemerkte ihm dann auch, daß ich
selbst nach Berlin reisen wollte, um dort zu studieren. Ich
erzählte ihm von meiner Familie und von meinen Absichten, und
da die Sonne herauf kam, waren wir beide erstaunt, daß die
Nacht so schnell vergangen war. Dieses war meine erste Nacht auf
deutschem Boden, und dieses war meine erste Begegnung mit meinem
Freunde.
Gretchen: Und ist das derselbe
Freund, welchen Sie jetzt hier erwarten?
Dr. Albert: Derselbe, mein
Fräulein.
Martha Parks: Armer Mensch! Er
ist gar nicht glücklich, nicht wahr, Albert?
Bella: Aber was ist denn Ihrem
Freunde Böses widerfahren, Herr Doktor?
Dr. Albert: Das ist eine traurige
Geschichte. Sie sollen sie hören, vielleicht werden Sie dann
weniger, als andere, seine Zurückhaltung mißdeuten.
Mein Freund ist kein geborner Deutscher. Sein Vater hatte in der
Jugend Deutschland verlassen und war nach vielen Reisen zuletzt in
Indien geblieben. Er gründete ein bedeutendes Handels-Haus,
und seine Schiffe brachten die Schätze des Landes in alle
Teile der Welt. Man hielt ihn für den reichsten unter den
dortigen Handels-Herren. Seine Gattin war eine Engländerin,
und da er im Osten seinem einzigen Sohne nicht die erwünschte
Erziehung geben konnte, so kehrte er mit
seiner Familie nach der Heimat zurück, wo er in Berlin sich
einen fürstlichen Palast erbaute. Sein Sohn hatte dann das
Gymnasium mit gutem Erfolge absolviert und war gerade zur
Universität gegangen, als der Krieg zwischen Deutschland und
Frankreich ausbrach. Deutschlands Jugend eilte mit Begeisterung zu
den Waffen, und auch mein Freund Heinrich stand nicht zurück.
In den Schlachten war er der erste und hatte sich durch Tapferkeit
und Mut derartig vor anderen hervorgetan, daß man ihn nicht
allein mit
dem eisernen Kreuze schmückte,
sondern ihn auch zum Range eines Offiziers beförderte. Bei
allen seinen Kameraden war er beliebt, und alle freuten sich
über seine Auszeichnung. Er
selbst war stets der fröhlichste von allen, voll Lebenslust und
Witz, nie ermüdet und voll Vertrauen auf sein gutes
Glück. Dies machte ihn zu kühn. In der Schlacht bei Gravelotte
war er unter den Mutigsten der erste; vorwärts drang er, immer
vorwärts, von Position zu Position; und er führte seine
Kompagnie im Sturm-Schritte voran und schwang hoch und
siegestrunken die erbeutete Fahne, da sank er, von einer Kugel
getroffen, bewußtlos zu Boden.
Als er wieder zum Bewußtsein gekommen war, sah er sich
verwundert um. Er war in einem fremden Zimmer auf einem bequemen
Lager. Kameraden hatten ihn nach dem nahen
Schlosse eines französischen Nobelmannes gebracht, und die
Tochter des Hauses pflegte ihn unter Aufsicht des Arztes. Seine
Verwundung war schwer; man zweifelte an seiner Errettung, er selbst aber
sprach lebhaft in seinen Fieber-Phantasien von den Augen eines
Engels, die schützend über ihm wachten. Und wirklich
schien es so; denn was die Ärzte kaum zu hoffen gewagt hatten,
das geschah — er genas. Und als
er nach vielen Wochen endlich wieder zum ersten Male am Arme seiner
treuen Pflegerin einen Gang in den Garten machen konnte, da war er
wirklich zu neuem Leben erstanden. Glücklicher war er nie
zuvor in seinem Leben gewesen und dankbar blickte er auf zu ihr
— zu seiner Retterin. Sie verstand seinen stummen Blick. Kein Wort wurde
gesprochen, nur die Vögel in den Büschen sangen lieblich.
Ah, wie herrlich erschien beiden die Welt. — Schnell schritt
seine Genesung nun vorwärts und nicht lange nachher erhielt er
die Weisung, in seine Heimat
zurückzukehren. Zuvor jedoch hatte er beim Herrn des Schlosses
um die Hand der Tochter gebeten, und das war mit ihrer Erlaubnis
geschehen. Allein des Vaters höfliche, aber entschiedene Worte
lauteten so:
»Mein Herr, Sie haben gegen mein Vaterland das
Schwert geführt. Zu meinem größten Bedauern
muß ich es aussprechen, daß dieser unglückliche
Umstand eine nähere Verbindung mit meiner Familie
unmöglich macht.« —
Mein Freund reiste nach seiner Heimat. Unaussprechlich war die
Freude seiner Eltern über ihren geretteten Sohn. Ah —
sie wußten nur von der einen Wunde, welche nun geheilt war,
die andere, die schmerzlichere, die vom Pfeile Amors, konnten sie
nicht sehen. — Gerne gaben sie ihrem Sohne die Erlaubnis, auf
Reisen zu gehen. Unter fremdem Himmel, unter fremden Menschen
hoffte er das Vergangene vergessen zu können. Sein
Kämpfen war vergebens, — da eilte er endlich nach
vielen, vielen Monden zurück in die
Heimat derjenigen, um deren willen er so litt. Er erreichte die
Stadt. Vom Turme läuteten die Glocken, und viele Menschen
gingen zur Kirche. Auch er trat ein, noch zeitig
genug, um die letzten Segens-Worte zu hören, welche der Priester über
ein neu vermähltes Paar aussprach; und
dann verließ das Braut-Paar die Kirche. Der Bräutigam
war ein Offizier der französischen Armee und mit
triumphierendem Blicke führte er an seinem Arme die
schöne Braut. Aus ihren Augen aber rollten große
Thränen. Waren es Freuden-Thränen? Dem Braut-Paare aber
folgte ernsten Schrittes ihr Vater. Es war jener Nobelmann und er
hatte nun seinen Willen durchgesetzt. Von diesem Tage an wurde mein
Freund ernst und schweigsam. Er begann ein Leben voll rastloser
Thätigkeit, machte eine Reise um die Welt, beobachtete die
Menschen aller Länder, kam zurück, studierte weiter in
Berlin und drang tief in alle Gebiete des Wissens ein. Er besitzt
alles, was viele andere Menschen zufrieden und glücklich
machen würde, allein er selbst ist es nicht. Wie oft habe ich
ihn getröstet und ermuntert, wie oft ihm Vorwürfe gemacht; dann
aber pflegte er zu sagen: Mein Lieber, ich habe lange und schwer
gerungen, diese Schwäche zu überwinden, bis heute ist es
mir nicht gelungen, ihrer Herr zu werden, und Gott allein
weiß, ob ich dieses jemals erreichen werde. Mein Leben ist
wie eine Landschaft zur Nacht-Zeit; auf Bergen und Hügeln und
Flüssen und Seen und Fluren ruht das matte
Licht des Mondes — wie ganz anders wäre doch alles im
heitern Sonnenscheine. Es ist der
Sonnen-Schein, der auch meinem Leben fehlt.
Bella: Und dieser Freund,
sagten Sie, kommt jetzt zu uns hierher, Herr Doktor?
Dr. Albert: Ja, mein Fräulein, er
folgt meinem Wunsche und seines Vaters Rat. Der Vater selbst war
auch einmal in seiner Jugend hier gewesen.
Gretchen: Und glauben Sie
nicht, Herr Doktor, daß er bei uns wieder froher werden
dürfte?
Dr. Albert: Ah, mein liebes Fräulein,
wenn das möglich wäre!
Gretchen: Und warum sollte es
unmöglich sein, trauen Sie uns so wenig zu?
Dr. Albert: Nein, es ist nicht
Mißtrauen gegen Sie, allein nach meinen Erfahrungen
muß ich jene Möglichkeit bezweifeln.
Bella: O, Herr Doktor, wir
können vieles, wenn wir wollen, und Gretchen kann alles, wenn
sie will. Nicht wahr, Martha?
Martha Meister: Ja, ja —
und wir alle würden ihr helfen, wir würden hören auf
jedes ihrer Worte, wir würden achten auf jeden ihrer Winke;
was meinst Du dazu, Gretchen?
Dr. Albert: Die Damen sind in der Tat zu
gütig, allein, allein — ich fürchte, Sie mühen
sich vergebens.
Gretchen: Wie wäre es,
Herr Doktor, wenn wir Ihren scheuen Freund, der sich von den
Freuden der Welt zurückzieht, dahin brächten, daß
er selbst uns, den Damen, den Vorschlag zu einem Picknick
machte?
Dr. Albert: Dann will ich Sie als meine
Meisterin anerkennen; aber, mein Fräulein, können Sie
zaubern oder Wunder tun?
Gretchen: Zuweilen. —
Wollen Sie Ihren Freund bei uns einführen?
Dr. Albert: Das wird sehr schwierig sein,
aber ich werde es versuchen.
Gretchen: Und wollt Ihr mir in
allem auf's genaueste folgen?
Alle: Wir wollen in allem
auf's genaueste folgen.
Gretchen: Und versprechen,
keinem Menschen ein Wort vom Komplott zu erzählen?
Alle: Wir versprechen, keinem
Menschen ein Wort vom Komplott zu erzählen.
Gretchen: Wie feierlich das
klang. — Wohlan, so gehen wir frisch an's Werk. Sie sollen
schon sehen, Herr Doktor, wie wir triumphieren werden.
Dr. Albert: Ihre Mühe wird
größer sein, als Sie denken.
Gretchen: Der Preis ist des
Ringens wert.
Bella: Wissen Sie, Herr
Doktor, daß ich mich fürchte vor diesem Freunde.
Dr. Albert: Dazu haben Sie keine Ursache,
bestes Fräulein, er ist der liebenswürdigste, treueste
Mensch von der Welt.
Bella: Mißverstehen Sie
mich nicht, Herr Doktor, ich fürchte nicht ihn, sondern seine
große Gelehrsamkeit — ach, ich weiß so wenig, so
wenig.
Dr. Albert: Darum haben Sie ja keine Sorgen
— außerdem wird Otto Ihnen zur Seite stehen. Nicht
wahr, Bruder Otto?
Bella: Was studieren Sie denn
jetzt, Herr Otto?
Otto: Herders Werke. Den
»Cid« und die »Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit« habe ich beendet. Das erste
würde auch Ihnen, mein Fräulein, sehr gut gefallen. Heute
Morgen las ich einige Parabeln, welche mir großes
Vergnügen bereitet haben.
Bella: Würden Sie so
gütig sein, Herr Otto, uns einige dieser Parabeln zu
erzählen?
Otto: Recht gerne, mein
Fräulein.
Unmittelbar nach
Erschaffung des Weltalls war der Mond eben so groß und so
brillant wie die Sonne. Damit aber war der Mond nicht zufrieden und
sprach: Warum komme ich nicht vor der Sonne, warum muß ich
ihr folgen? Und der Mond grämte sich und wurde dadurch
bleich und klein. — Sein Glanz aber war in den Welten-Raum
gegangen, und dadurch waren die Sterne entstanden. Mit Schrecken
gewahrte der Mond seine Veränderung und er betete. Da sandte
Gott einen Engel, der sprach also zum Monde: Schuf nicht der allweise Gott
dich so groß und so schön wie die Sonne? Kam dein
Unglück nicht durch deine eigene Schuld? Und nun mußt du
so bleiben für ewige Zeiten. Doch mildere deinen Schmerz,
guter Mond, denn wenn die Menschen nach des Tages Last ermüdet
sind, so wenden sie sich mit Freude von der Sonne Glut zu deinem sanfteren Licht,
und die Unglücklichen werden zu dir aufblicken und bei dir
Trost suchen und finden, denn du selbst warst ja unglücklich
und verstehst sie und fühlst mit ihnen.
Und so ist es noch heute.
Bella: Meinen besten Dank,
Herr Otto; — nun aber sagen Sie mir auch, warum ist das Wort
»Mond« ein Masculinum? Sie sagten immer »der
Mond«.
Otto: Das weiß ich
wirklich nicht, Fräulein Bella; weißt Du es, Albert?
Dr. Albert: Darüber habe ich noch
niemals nachgedacht.
Bella: Soll ich es Ihnen
sagen? Nun, der Mond muß ja ein Masculinum sein — denn
er geht nachts alleine aus. Nicht lachen, meine Freunde, still
sein; Otto, noch eine Parabel, ich bitte schön.
Otto: Einmal waren die
Menschen recht schlecht auf Erden, da sandte Gott ein großes
Wasser — die Sündflut, und alle Menschen
kamen um, nur Noah nicht und seine Familie; sie
wohnten in der Arche. Und als sie eine lange Zeit darin verbracht
hatten, sandte Noah einen Raben aus, damit er sehe, ob die Wasser
von der Erde verschwunden seien.
Bella: Entschuldigen Sie mich,
Herr Otto, war es nicht eine Taube, welche er
ausschickte?[VI-3]
Otto: Später sandte er
eine Taube, denn der Rabe war nicht wieder gekommen; er hatte
nämlich auf Erden so viel Leichnam gefunden, daß er
Noah, seinen Wohlthäter, vergaß. Aber die Strafe kam
bald über den Undankbaren. Auf der Erde waren noch so viele
schlechte Dünste, und davon wurde der Rabe,
welcher früher weiß war wie Schnee, ganz schwarz. Und so
ist er noch heute; und wenn der Rabe seine Jungen sieht, so schaudert er vor der Häßlichkeit
und wird hart gegen sie. Und noch heute sagen wir von Eltern,
welche grausam gegen ihre Kinder sind, »seht die
Raben-Eltern«.
Und nun werde ich Ihnen noch eine Parabel erzählen, das
soll aber meine letzte sein:
Als Alexander der Große in Afrika war, kam er auch in ein
Land, in dem die Leute so reich waren, daß sie ihm in
silbernen Schalen goldene Früchte entgegenbrachten. Er aber
sprach: Ich bin des Silbers und des Goldes wegen nicht in euer Land
gekommen, eure Sitten will ich kennen lernen. Und da führte
man ihn auf den Markt-Platz. Der König des Landes saß
gerade auf seinem Throne, um Recht zu sprechen, und vor ihm standen
zwei Männer. Da sprach der eine derselben: Von diesem Manne
hier habe ich einen Sack mit Spreu
gekauft und als ich den Sack öffnete, fand ich diesen
großen Klumpen
Gold in demselben — nun aber will dieser Mann ihn nicht
zurücknehmen. Nein, sagte der andere, ich will ihn nicht
zurücknehmen, denn es wäre nicht recht; ich verkaufte ihm
den Sack mit allem, was darin wäre.
Der König hatte beide gehört. Dann sann er eine Weile
und sprach zu dem einen: Hast du nicht einen Sohn? Ja, mein
König. — Und jener hat, wie ich weiß, eine
Tochter. Wohlan, da ihr beide rechtschaffene Männer seid, so
verheiratet euere Kinder und gebet ihnen das Gold. — Beide
Männer gingen befriedigt von dannen, Alexander aber war sehr verwundert.
Als der König das sah, fragte er: Sage mir, fremder
König, war mein Urteil nicht gerecht? Wie würde man denn
in deinem Lande gehandelt haben?
In meinem Lande, erwiderte Alexander, würde der Richter
beide enthauptet und das Gold für sich selbst
genommen haben. — O, o! rief da der König, und
läßt Gott die Sonne in jenem Lande scheinen? — Ja
—. Und läßt er regnen? — Ja —. Wohl,
versetzte der König, so ist es der unschuldigen Kinder und der dummen Tiere
wegen. — So, Fräulein Bella, jetzt bin ich zu Ende.
—
Bella: Dank, besten Dank, Herr
Otto. — Wie gefallen Ihnen diese Parabeln, Herr Louis?
Louis: Sehr gut, mein
Fräulein.
Martha Parks: Du bist aber
heute sehr ruhig, Louis!
Martha Meister: Auch ich habe
mich im Stillen darüber gewundert.
Louis: Ich beginne jetzt
ebenfalls, ernst zu werden.
Dr. Albert: Oho, Bruder Louis, wozu denn
das?
Louis: Ich bereite mich vor
auf die Ankunft Deines Freundes.
Dr. Albert: Ei! Wie machst Du denn das?
Louis: Ich studiere deutsche
Philosophie. —
Dr. Albert: Du — — Philosophie?
—
Martha Parks: Das ist wohl
sehr schwer, Louis, nicht wahr?
Louis: Sehr schwer, Schwester.
— Das Schwierigste habe ich heute studiert; gerade bevor ich
hierher kam, da las ich dieses:
In Bagdad war einmal ein weiser und guter Kalif. Am besten aber
war er immer, wenn er nach Mittag sein Schläfchen gehalten hatte,
seine Tasse Mokka trank und seine lange Pfeife rauchte. Darum kam
auch sein Großvezier immer um diese Zeit zu ihm; und als
derselbe eines Nachmittags mit ernstem Gesichte eintrat, fragte ihn
der Kalif: Großvezier, warum hast du denn heute Falten auf
der Stirn? O, sagte der Vezier, als ich soeben in den Palast gehen
wollte, sah ich vor der Pforte einen Krämer mit den schönsten
Sachen stehen; zu gerne hätte ich manches für meine
Gemahlin gekauft — allein mir fehlt es an Geld. — Gehe
und bringe ihn herauf zu mir. — Der Großvezier ging und
bald stand der Krämer vor dem Kalifen, der für sich
selbst und den Vezier ein Paar schöner Pistolen kaufte und
für dessen Gemahlin die feinsten Kämme von Elfenbein und die
kostbarsten Ringe und Armbänder. Gerade
wollte der Krämer seinen Kasten schließen, da bemerkte
der Kalif in der einen Ecke noch ein Kästchen und fragte den
Krämer, was er darin zu verkaufen habe. Ei, sagte der
Krämer geheimnisvoll,
in diesem Kästchen ist ein wunderbares Pulver, ich habe es von
einem andern Kaufmann erhalten, der es nebst einer Schrift selbst
auf der Straße zu Mekka gefunden hat. Aber da ist niemand,
welcher die Schrift lesen kann, denn es ist die einer
ausländischen Sprache; ich will euch beides, Pulver nebst Schrift, zu den
gekauften Waren überlassen. Und er gab beides dem Kalifen und
ging. Dieser sah in die Schrift und wunderte sich, denn dieselbe
war völlig verschieden von der arabischen, und er wurde sehr
begierig zu wissen, was die Schrift enthalte. Da sagte der Vezier:
Am Ende der Stadt, nicht weit von der Moschee, wohnt ein Mann
namens Selim, die Leute nennen ihn den gelehrten Selim, denn er
versteht alle Sprachen der Welt und gewiß auch diese; wenn
ihr befehlt, so gehe ich und rufe ihn. Thue das, sprach der Kalif;
und der Vezier ging und kam bald mit dem Gelehrten zurück. Der
Kalif sagte zu ihm: Die Leute nennen dich den gelehrten Selim,
zeige mir nun, daß du den Titel verdienst. Kannst du diese
Schrift mir lesen, so werde ich dich reichlich belohnen; kannst du
es nicht, so lasse ich dir fünf und zwanzig auf die Sohlen
geben. Selim nahm die Schrift in die Hand und sagte dann nach einer
Weile: Wahrlich, das ist Lateinisch und heißt im Arabischen
so: Mensch, der du dieses hörest, preise Allah. So du von
diesem Pulver nimmst und schnupfest und dich dreimal nach Osten
beugest und das Wort mutabor sprichst, kannst du dich verwandeln in die Form
eines jeden Tieres, das du siehst, und kannst auch dessen Sprache
verstehen; doch mußt du dich hüten zu
lachen, sonst wirst du das Wort vergessen, das notwendig ist,
um wieder Mensch zu werden. — Als der Kalif dieses
hörte, beschenkte er den Gelehrten reichlich, gebot ihm tiefes
Schweigen und hieß ihn gehen.
Am nächsten Morgen früh war der Kalif mit seinem
Vezier in dem großen Garten des Palastes, aber da sie kein
Tier sahen, so gingen sie weiter und kamen in das Feld an einen
Teich. Da machten sie Halt, denn
aus dem Wasser kam soeben ein Storch und bald flog ein anderer zu
ihm aus der Luft, und sie hoben die langen Schnäbel und sahen sich an und
bald machte der eine und dann wieder der andere klapp, klapp.
— Die beiden dort führen sicherlich eine Unterhaltung,
sagte der Kalif, ich möchte wohl hören, was sie zu
sprechen haben, gieb mir doch von dem Pulver. Der Vezier nahm die
Schachtel mit dem Pulver
aus der Tasche. Nimm du zuerst, Vezier, ich will doch sehen, wie
die Sache wird. Der Vezier nahm darauf von dem Pulver, schnupfte
es, sagte mutabor und bückte sich drei Mal gegen Osten, und
da wurde seine Nase so lang wie der Schnabel eines Storches, sein
Bart und seine Haare wurden zu Federn, seine Arme wurden zu
Flügeln und seine Beine lang und dürr wie Storch-Beine. Verwundert
rief da der Kalif: Vezier, ihr seid wahrhaftig ein ganzer Storch,
wie drollig ihr ausseht, nein, so etwas sah ich im Leben noch
nicht. Nun gebet mir schnell von dem Pulver. Und der Kalif nahm
auch von dem Pulver, sagte auch das Wort mutabor, bückte sich ebenfalls
dreimal gegen Osten und siehe, auch er war nun ein Storch. Beide
horchten und verstanden die folgende Unterhaltung. Der erste
Storch, welcher aus dem Teiche gestiegen war, hatte zum andern zu
sprechen begonnen: Guten Morgen, Fräulein Nichte! — Guten Morgen,
Frau Tante. — Haben Sie gut geschlafen? — Danke, so,
so. — Wollen Sie heute Morgen Frühstück mit
mir nehmen? — Ach nein, ich danke, habe gar keinen Appetit,
meine Mama hat heute Abend große Gesellschaft, da soll ich
vor den Gästen Solo tanzen und da kam ich soeben hierher, um
noch ein wenig zu üben. Entschuldigen Sie
gütigst, Frau Tante. — Darauf ging der Storch
gravitätisch auf- und abwärts, drehte sich links und
drehte sich rechts und bewegte die Flügel hin und her. Das
alles war aber so außerordentlich komisch, daß der
Kalif laut zu lachen begann und Kalif und Vezier lachten so lange,
bis der letztere endlich sagte: O,[VI-4] o, nun aber kann ich wirklich
nicht mehr. Die Störche hatten sich verwundert umgeschaut und
waren erschreckt davon geflogen.
Plötzlich aber sagte der Kalif: Vezier, wir sollten ja
nicht lachen — Vezier, welches ist doch das Wort? Mu—mu— machte
der Vezier, mehr konnte er nicht hervorbringen und auch der Kalif
hatte das Wort vergessen. Sie bückten sich wohl tausendmal
gegen Osten — aber das half nichts, sie blieben
Störche.
Das aber war doch recht traurig, denn als Storch wollte der
Kalif nicht zurück gehen in die Stadt; und sie sannen hin und
her, was wohl am besten zu tun sei. Da kamen sie zuletzt auf die
Idee, nach Mekka zu fliegen zum Grabe des Propheten; dort wollten
sie um Hülfe bitten. — Sofort begannen beide zu fliegen,
und als sie hoch in den Lüften über Bagdad schwebten,
gewahrten sie
auf den Straßen der Stadt ein großes Gedränge der
Menschen. Viele waren zu Pferde, und ihnen voraus ritt ein junger
Mann auf weißem Rosse mit prächtigen Waffen und
Kleidern.
Ah — sagte der Kalif zu seinem Vezier, das ist Mansor, der
Sohn meines Feindes; er zieht jetzt ein in mein Schloß als
Kalif. Ich verstehe nun alles, ich weiß nun zu wohl, wer
jener Kaufmann war, der mir das Pulver brachte, — es war sein
Vater, der Zauberer. Welch' ein
Komplott! Vorwärts, Vezier, komme hinweg aus dieser Stadt,
vorwärts nach Mekka! Und so schnell flog er, daß der
Vezier kaum folgen konnte. Zuletzt — es war schon Abend
geworden — sagte der Vezier: Ich kann nun wahrlich nicht
mehr; ich sehe dort in der Ferne eine Ruine, laßt uns
daselbst über Nacht verweilen.
Als sie an das alte Gemäuer gekommen waren, wollte
der Kalif hinein gehen, der Vezier aber hielt ihn am Flügel
zurück und sagte: Ihr werdet doch nicht hinein gehen, wer
weiß, was darin ist. Der Kalif aber war furchtlos und schritt
voran; ängstlich folgte der Vezier. Erst kamen sie durch einen
langen dunkeln Gang und dann in einen andern, der
war sehr eng. Kaum hatten sie die Mitte erreicht, so vernahmen sie
ganz deutlich vom andern Ende ein leises Wimmern. Sie hielten an
und zitternd flüsterte der Vezier: Ich flehe, laßt uns
zurück; hier sind Gespenster. Der Kalif
aber ging weiter und so auch der Vezier. Am Ende des Ganges war ein
kleines Zimmer, nur wenig Licht fiel durch die engen Spalten der Mauer. Hier war
das Wimmern deutlich zu hören, es kam aus einer Ecke. Beide
sahen dahin — zwei große schwarze Augen glänzten
dort — der Vezier schauderte. Der Kalif aber sah — es
war eine Eule.
Höchst merkwürdig, die Eule konnte sprechen: Ihr
Störche seid mir ein gutes Zeichen, darum seid mir willkommen!
— Wer bist du? fragte der Kalif. — Ich bin die
Prinzessin von Indien. — Ein böser Zauberer war zu
meinem Vater gekommen und wollte mich zum Weibe haben für
seinen Sohn. Darüber wurde mein Vater sehr zornig und
ließ ihn aus dem Palaste treiben. Aber als Sklave verkleidet
kam er wieder, und als ich eines Tages im Garten spazieren ging und
um einen Becher frischen Wassers bat, brachte er es mir. Allein er
hatte ein Pulver in das Wasser getan, und da ich es trank, wurde
ich in eine Eule verwandelt. Der böse Mann brachte mich dann
hierher und sagte zu mir: Hier mußt du ewig weilen, es sei
denn, daß du Jemanden fändest, der dich zum Weibe nehmen
wollte. Die Eule schwieg, und nun erzählte der Kalif seine
Geschichte. Als er zu Ende war, sagte die Eule wieder: Ich kenne
ihn sehr wohl, diesen Zauberer, denn es ist derselbe, welcher mich
hier gefangen hält. Wenn ihr mich erlösen wolltet,
könnte ich euch wohl helfen. Da nahm der Kalif den Vezier bei
dem einen Flügel, führte ihn zur Seite und begann leise
mit ihm zu reden: Vezier, ihr müßt zur Eule gehen und
sie bitten, daß sie eure Gemahlin werde, denn ihr habt
gehört, daß sie nur auf diese Weise erlöst werden kann und uns helfen will.
— Nein, o nein, sagte der Vezier, das geht nicht an —
eine Eule zur Frau! — o! — außerdem habe ich ja
schon eine zu Hause; was würde die mit mir tun, wenn ich eine
andere Frau nach Hause brächte, — es ist viel besser,
ihr heiratet sie selbst, denn ihr habt ja doch noch kein Weib.
— Dem Kalifen war es nicht lieb — aber was konnte er
tun? Er wollte doch kein Storch bleiben! Er ging daher zurück
zur Eule, verbeugte sich tief und sprach: Schöne Prinzessin,
ich, der Kalif von Bagdad, komme zu euch und bitte um eure Hand,
gewährt sie mir und werdet mein Weib. — Und
beschämt schlug sie die Augen nieder, kam zögernd aus der Ecke hervor und
sagte leise: Ja; und dann fiel der Kalif nieder vor ihr auf die
Kniee. Die Eule war sehr glücklich und sie lächelte
lieblich und sprach: Jeden Monat kommen die Zauberer des Landes
einmal in diesem alten Schlosse zusammen und halten ein
großes Mahl und erzählen dann, was sie getan haben. Auch
heute Abend kommen sie hierher; vielleicht vernehmen wir dann das
Wort von dem bösen, bösen Manne. Folgt mir, ihr Herren
Störche, ich führe euch jetzt zum Platze. Sie schritt
voran, die beiden Störche folgten. Es ging durch viele
Thüren und Zimmer und schmale Gänge. Zuletzt blieb sie
vor einer Pforte stehen. Durch eine Spalte konnte man in eine große Halle
sehen, in welcher viele Lichter brannten. An einer langen Tafel
saßen viele alte Männer mit langen, grauen Bärten,
vor sich hatten sie hohe Becher
mit Wein stehen und sie tranken viel, — am andern Ende saß derselbe
Alte, welcher ihnen das Pulver mit dem Manuskripte gegeben hatte.
Die drei warteten lange und lauschten und sie hörten alles,
was gesprochen wurde. Da stand zuletzt jener alte Krämer auf
und erzählte laut lachend, wie er den Kalifen in einen Storch
verwandelt habe. Alle fragten ihn darauf: Welches Wort hast du ihm
denn gegeben? Mutabor, sagte er. Als der Kalif dieses hörte,
sprang er schnell zurück, aus der Ruine. Die Sonne erschien
gerade am östlichen Himmel, da bückte er sich dreimal und
sprach mit lauter Stimme: Mutabor, und so tat auch der Großvezier, und
wirklich! sie wurden wieder zu Menschen.
Kalif und Vezier umarmten sich lange und herzlich vor
großer Freude, und als sie sich endlich von einander los
machten, sahen sie bei sich stehen eine holde Jungfrau, so schön sie noch keine gesehen
hatten. Ich bin die Prinzessin von Indien, sagte sie. — Meine
geliebte Braut, rief der Kalif; und alle kamen wieder nach Bagdad,
und das Volk war glücklich, daß sein Kalif wieder da
war.
So, nun bin ich zu Ende. — Nun, geliebtes Schwesterchen,
wie gefällt Dir diese Philosophie?
Martha Parks: Das ist sehr
schön, lieber Bruder Louis. Hast Du dieses alles selbst
gedacht, als Du so ruhig hier saßest?
Louis: O nein, Martha, das
habe ich nicht, ich habe es in einem Buche aus Alberts Bibliothek
gelesen.
Dr. Albert: »Märchen von
Hauff« — nicht wahr, Louis?
Louis: Ganz recht,
»Märchen von Hauff«, das ist der Titel des Buches.
Es sind noch viele andere schöne Geschichten darin, die
sollten Sie lesen, Fräulein Bella.
Bella: Das möchte ich
wohl, aber da sind so viele kleine Silben im Deutschen, die machen
das Lesen für mich so schwierig.
Dr. Albert: Ich weiß schon, mein
Fräulein, was Sie meinen. Nun, wenn Sie mir erlauben, so werde
ich Ihnen in
Kürze vielleicht einige Aufklärung darüber
geben können. — Was wollen Sie sagen, mein
Fräulein?
Gretchen: Ich möchte
Ihnen mitteilen, daß ich Ursache
habe, mit den Herren Parks sehr böse zu sein.
Dr. Albert: Mit mir, mein
Fräulein?
Otto: Mit mir?
Louis: Mit mir?
Gretchen: Mit allen drei
Herren!
Louis: Aber warum denn?
Dr. Albert: Was haben wir denn verbrochen?
Gretchen: Verbrochen? Sehr
viel, meine Herren. Keiner von Ihnen erzeigte mir heute nur so viel Ehre, sehen Sie,
nicht so viel.
Bella: Aber Gretchen, ich habe
nichts bemerken können.
Martha Meister: Ich verstehe
Schwester Gretchen schon, ha, ha!
Gretchen: Sehen Sie einmal,
meine Herren! Zuerst sprach der Herr Doktor und er sprach nur mit
Schwester Martha, wenigstens sah er nur sie an; dann Herr Otto und
er sprach zu niemandem mehr, als zu meiner Freundin Bella, und
jetzt sprach Herr Louis zu seiner Schwester Martha ganz allein.
— Niemand erzählt mir etwas, o ich fühle mich sehr
zurückgesetzt, meine Herren!
Louis: Fräulein Gretchen,
Sie müssen warten, bis meines Bruders Freund kommt. Wenn Sie
ihn zum Reden bringen, so erzählt er Ihnen auch Geschichten.
Nicht wahr, Albert?
Dr. Albert: Ja, ja, mein Fräulein, das
tut er, und er erzählt viel, viel besser als ich!
Martha Parks: Das geht wohl
nicht, besser als Du, Albert?
Dr. Albert: Nun gut, Ihr werdet schon
sehen. Gewöhnlich spricht er sehr
kurz; aber wenn wir ihn nur einmal zum Sprechen bringen
können. Halt! Da fällt mir gerade noch zur rechten Zeit
ein, daß ich unserer lieben Freundin Bella noch eine Antwort
schulde auf ihre Frage: »Sind Sie unglücklich, Herr
Doktor?« — Nein, mein Fräulein, ich bin es nicht;
ein Teil meines Glückes aber wird Ihnen klar werden, wenn ich
Ihnen das folgende Gedicht von Schiller deklamiere:
Die Teilung der Erde.
»Nehmt hin die Welt!« rief Zeus von
seinen Höhen
Den Menschen zu; »nehmt, sie soll euer sein.
Euch schenk'
ich sie zum Erb' und ew'gen Lehen;
Doch teilt euch brüderlich darein.«
Da eilt, was Hände hat, sich
einzurichten,
Es regte sich geschäftig jung und alt:
Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten,
Der Junker pirschte[VI-5]; durch
den Wald.
Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen,
Der Abt wählt sich den edlen
Firnewein,
Der König sperrt
die Brücken und die Straßen
Und spricht: »Der Zehente ist mein.«
Ganz spät, nachdem die Teilung längst
geschehen,
Naht der Poet, er kam aus weiter Fern';
Ach, da war überall nichts mehr zu sehen,
Und alles hatte seinen Herrn.
»Weh mir! so soll denn ich allein von
allen
Vergessen sein, ich, dein getreuster Sohn?«
So ließ er laut der Klage Ruf erschallen,
Und warf sich hin vor Jovis Thron.
»Wenn du im Land der Träume dich
verweilet,«
Versetzt der Gott, »so hadre
nicht mit mir.
Wo warst du denn, als man die Welt geteilet?«
»Ich war,« sprach der Poet, »bei
dir.«
»Mein Auge hing an deinem Angesichte,
An deines Himmels Harmonie mein Ohr;
Verzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte
Berauscht, das Irdische
verlor!«
»Was tun?« spricht Zeus, —
»die Welt ist weggegeben,
Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein;
Willst du in meinem Himmel mit mir leben,
So oft du kommst, er soll dir offen
sein.«
Martha Meister: Aber Sie
dürfen über den Himmel auch die Erde nicht vergessen,
Herr Doktor.
Dr. Albert: Nein, mein verehrtes
Fräulein, das werde ich nicht. Ich will Ihr mahnendes Wort wohl merken. Und nun
müssen wir aufbrechen — nicht wahr, Schwester?
Martha Parks: Wenn Du
mußt, Albert. — Otto und Louis, nehmt Abschied.
Bella: Sie sind plötzlich
zu eilig, Herr Doktor!
Dr. Albert: Gute Nacht, meine Damen,
träumen Sie süß. Gute Nacht.
Alle: Gute Nacht.

VII.
Martha Meister: Wie schön
von Ihnen, Louis, daß Sie kommen!
Martha Parks: Ach, wir sind so
geeilt.
Bella: Du glaubst kaum, liebe
Martha, wie gespannt wir sind.
Gretchen: Was für
Nachrichten bringen Sie uns heute, Herr Louis?
Louis: Gute, meine Damen, sehr
gute, ich ....
Bella: Wie warm Ihnen ist,
Louis; Gretchen, Martha, — schnell die Fächer zur Hand — so —
das ist schön, Louis, nicht wahr?
Louis: O, ich bin beneidenswert!
Gretchen: Jetzt ist Ihnen
kühler, nicht wahr? Nun, Louis, was wollten Sie sagen?
Louis: Ach so — sie sind
fast immer allein in der Bibliothek bei verschlossener Thüre;
was sie verhandeln,
möchte ich wohl wissen, aber ich weiß es nicht und kann
Ihnen nichts davon verraten. Heute Mittag bei Tisch aber begann
Albert so wie zufällig: Heinrich, ich möchte Dich heute
Nachmittag in eine befreundete Familie einführen — ich
— ich weiß, was Du sagen willst, — nein,
nein, mein
Freund, keine Entschuldigung heute, ich habe dort eine kleine
Vorlesung über Lessing zu geben und es liegt mir viel daran, den
Damen zu gefallen, und Du weißt zu gut, daß ich viel
besser sprechen kann, wenn ich Dich vor mir habe; liebster
Heinrich, bringe mir das Opfer, willst Du? — »Hm, ich
begleite Dich,« — war alles, was er darauf erwiderte.
Er spricht sehr wenig und immer kurz, aber jedes seiner Worte hat
Wert. Otto meint, daß seine Ideen hoch und edel seien.
Martha Parks: Und ich glaube
wie Otto. Ich sitze gerne bei dem stillen Freunde meines Bruders,
und er sieht mich immer so freundlich an, und ich sehe ihn wieder
an; wir sprechen kein Wort — wir sehen einander bloß
an.
Martha Meister: Nicht wahr,
Gretchen, es ist nun Zeit, Mama und Papa zu rufen? Entschuldigt
mich, bitte, in wenigen Minuten bin ich wieder bei Euch.
Bella: Bitte, Martha, gehe
nur. — Gretchen! Gretchen! — ich glaube, man
klopft.
Gretchen: Ich habe nichts
gehört, Bella.
Louis: Es war der Wind.
Bella: Aber jetzt — ganz
sicherlich, es klopft; Gretchen, ich habe es wirklich gehört;
o, wie ich zittere!
Martha Parks: Ja, ich habe es
auch gehört.
Gretchen: Herein!
Dr. Albert: Guten Tag, mein wertes
Fräulein; Fräulein Bella, guten Tag! Sieh, sieh,
Schwesterchen ist schon hier mit Bruder Louis — nun, das ist
ja gut.
Erlauben Sie mir, meine Damen, Ihnen meinen liebsten Freund
vorzustellen: Herr von Halsen, Fräulein Gretchen Meister und
unsere liebe Freundin Bella ....
Gretchen: Da kommen die Eltern
auch und Schwester Martha.
Dr. Albert: Meine Herrschaften, ich bin
glücklich, Sie so wohl zu sehen. Ich habe mir heute die
Freiheit genommen, meinen lieben Freund aus Deutschland bei Ihnen
einzuführen: Herr Heinrich von Hal... — Heinrich, was
ist Dir? — was starrst Du jenes Bild so an?
Herr von Halsen: Hm, hm,
meines Vaters Bild hier, — hm, — wer ist der
Haus-Herr?
Herr Meister: Ich habe die
Ehre, mich Ihnen selbst als solchen vorzustellen —
mein ....
Herr von Halsen: Sind Sie Herr
Meister, Herr Wilhelm Meister?
Herr Meister: Ganz recht, mein
Herr.
Herr von Halsen: Hatten Sie
nicht einen Jugend-Freund Gustav von Halsen? ....
Herr Meister: Ja, ja, mein
Herr, — Sie wissen von ihm? .... ich flehe, sprechen Sie, lebt
er?
Herr von Halsen: Er lebt und
er ist wohl, und ich selbst — bin sein Sohn.
Herr Meister: Er lebt —
Dank, dank dir, guter Gott! — und Sie — sein Sohn!
Willkommen mir, willkommen in meinem Hause, Sohn meines Freundes. O
sieh' doch hier, teures Weib, meines — unsers Freundes Gustav Sohn. Ach,
Kinder, Ihr — Ihr wißt von all' dem nichts; es ist eine
alte, traurige Geschichte!
Frau Meister: Sie wissen
alles, ich sprach davon vor kurzem — vergeben Sie mir, Herr
von Halsen, wenn ich erst jetzt Ihnen Willkommen, aus ganzem Herzen
Willkommen entgegenrufe. Als ich eintrat durch jene Thüre und
Sie erblickte, war ich sprachlos; ich konnte mich nicht fassen,
denn eine längst vergangene Zeit stand mit einem Male wieder
vor mir. Sie sind das Ebenbild Ihres Vaters.
Herr Meister: Ja, ja —
wo waren meine Augen nur!
Herr von Halsen: Mein
verehrtester Herr, ich habe Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin einige
Worte vom Vater zu sagen und Papiere zu überbringen. Albert,
willst Du mich für einige Momente entschuldigen?
Dr. Albert: Gewiß!
Herr Meister: Treten Sie
ein!
Herr von Halsen: Hm, hm,
— seltsam, — schnell gefunden — fast unglaublich
—!
Frau Meister: Entschuldigt
uns, bitte, — nur wenige Minuten!
Bella: O, Gretchen,
Martha!
Martha Meister: Das ist
wahrhaft wunderbar!
Gretchen: Wahrhaft
wunderbar!
Dr. Albert: Was bedeutet denn dieses
alles?
Otto: Ach, ich sehe, Albert,
Du weißt nichts von der Geschichte seines Vaters. Wenn ich
nicht irre, Albert, so hört man jetzt in jenem Zimmer das
Finale einer sehr interessanten Geschichte, deren ersten Teil Frau
Meister uns neulich erzählt hat. Hast Du ihm denn niemals
Herrn Meisters Namen genannt?
Dr. Albert: Wie durfte ich denn?
Fräulein Gretchen hatte es mir ja verboten, und in der kurzen Zeit seines
Hierseins hatten wir gar vieles zu besprechen. Er erwähnte
zwar einmal, daß er später einen alten Freund seines
Vaters aufsuchen müsse, einen Namen nannte auch er mir nicht.
— Merkwürdig, wie sich das nun
schickt!
Louis: Nein, — ich
weiß nicht, was ich sagen soll; das ist gerade wie ein
Roman.
Bella: O, wie glücklich
ich bin, daß ich auch einmal einen Roman mit erlebt habe! Ich
habe es immer gewünscht, — nun weiß ich doch auch,
wie es ist.
Otto: Nun, Fräulein, wie
denn?
Bella: Nun ja — so
— o, ich weiß selber nicht wie, — so — so
seltsam!
Dr. Albert: Das Leben, beste Freundin, ist
voll von Romantik, glauben Sie mir.
Gretchen: Wie klein in diesem
Momente der Kreis der Menschen erscheint, — denken Sie nur:
Ihr Freund — meines Vaters alten Freundes Sohn!
Martha Meister: Weißt
Du, Gretchen, das ist Dir eine gute Vorbedeutung.
Bella: Ja, Gretchen, das ist
wahr.
Martha Meister: Ihre
Vorlesung, Herr Doktor, dürfen Sie aber nicht aussetzen!
Dr. Albert: Ganz recht, mein Fräulein,
darf ich nicht aussetzen.
Louis: Er könnte sonst
etwas von unserm Plane merken, nicht wahr?
Gretchen: Laßt uns denn
Platz nehmen. Bitte, Herr Doktor, beginnen Sie, sobald man
eintritt. — Die Thüre öffnet sich schon —
Martha, sieh' nur Mama an, wie glücklich sie ist, und Papa
— er hält den Herrn von Halsen am Arme, als wollte er
nie wieder von ihm lassen. — Hier, Mama, bitte, nimm Platz
— dürfte ich Sie bitten, Herr von Halsen, hier; Papa,
hier ....
Herr Meister: Aber Kinder, so
feierlich — was soll denn das?
Martha: Still, lieber Papa,
Mama weiß alles und wird es Dir später
erklären.
Dr. Albert: Meine Damen und meine Herren!
Wenn ich oft in meinen Studien-Jahren gegen Kolonnen von Vokabeln
mühsam gekämpft und gegen Scharen von Konjugationen und Deklinationen
hart gestritten hatte und nicht selten ermattet zusammengebrochen
war, dann mag ich wohl öfters in der Verzweiflung ausgerufen
haben: O, warum haben unsere Väter jemals begonnen, den Turm
von Babel zu bauen?!
Die Jahre sind nun geschwunden, und nur noch in sanfter Wehmut
gedenke ich jener Leiden. Als Sieger bin ich hervorgegangen, und Großmut ist
wieder eingezogen in mein Herz. Dann und wann sogar habe ich meine
süßen Träumereien und — wer weiß, wer
weiß, sage ich dann, ob nicht der allwaltende Vater seine Kinder
so weit von einander entfernt und nach allen Enden der Erde
zerstreut hat, auf daß sie sich nach langer Zeit des
Wiederfindens erfreuen mögen! Ja, wenn ich sehe, wie die
Menschen bis heute sich die Kraft des Dampfes und der
Elektricität dienstbar gemacht haben, wie sie die Ferne in die
Nähe rücken und die Zeit
überbrücken — dann erscheint es mir fast, als ob
jener Tag wirklich nicht mehr ferne wäre, da alle Brüder
des großen Menschen-Geschlechts nach langer Trennung sich
wieder verstehen lernen wie ehemals, als sie eine Sprache redeten.
Die Fähigkeiten der Menschen
werden so groß, die Methoden des Studiums werden so
vollkommen sein, daß man ungemein schnell und leicht die
Sprachen der Welt erlernen kann. Hat man doch heute den Anfang
bereits gemacht.
Louis: Bravo, bravo! —
applaudieren Sie doch, Herr Meister!
Dr. Albert: Diese ideale, glückliche
Zeit liegt noch in weiter Ferne; darum sorgen Sie noch nicht, meine
Freunde, welche von den zahlreichen Sprachen Sie wählen werden
zu stetem, häuslichem Gebrauche. Zwar könnte ich schon
heute sagen, auf welche derselben Ihre Wahl fallen würde als
auf die schönste, leichteste, beste. Soll ich sie nennen, die
Sprache Ihrer Wahl? —
Die Mutter-Sprache wird es sein. — Denn die Töne, in
welcher die Mutter zuerst uns die süßen Laute der Liebe
zugehaucht hat, sind
in unser Innerstes eingepflanzt, und das Schönste, was wir
sagen wollen, und das Teuerste und das Heiligste — wir sagen
es am besten in diesen Lauten. Darum ist die Mutter-Sprache uns
allen heilig und lieb, darum verehrt eine edle Nation die
Mutter-Sprache, und darum hängt das Volk so fest an ihr. Denn
es fühlt, es ist die Mutter-Sprache sein geistiger Boden, ohne
welchen es so wenig gedeihen kann, wie der
vollgewachsene Baum, den man in fremde Erde gepflanzt hat. —
Es wäre ein Unglück für ein Volk, wenn es seine
Mutter-Sprache verlieren müßte. Und wissen Sie, meine
Freunde, daß dem deutschen Volke dieses Unglück
einstmals gedroht hat?
Das deutsche Volk war von der Höhe seines politischen
Glückes tief hinabgestürzt in das Unglück des
dreißigjährigen Krieges, und auf den Sonnen-Glanz seiner
Dichtkunst im 13. Jahrhundert war
schwarze Finsternis gefolgt.
Poesie und Kunst und Litteratur waren nirgends sichtbar, und als
einziger Trost erklangen ihm in dieser langen Nacht die
göttlichen Töne der Musik von Händel und Bach.
Die höheren Zirkel der deutschen Nation blickten verlangend
und suchend umher und fanden Befriedigung in den schönen
Schriften der großen Poeten Frankreichs, das Volk aber blieb
konservativ und hielt fest an der Sprache der Mutter, an der Sprache, welche
Luther ihnen in der Bibel gegeben hatte.
Da kam Gotthold Ephraim Lessing und hob die deutsche Sprache und
gab ihr Halt und festen Grund und Form und flößte ihr
Stärke ein und zierte sie mit Schönheit. Und dann schritt
er zu Deutschlands Musen-Tempel, öffnete mit fester Hand die
Pforten, die langverschlossenen, und zündete die Fackel an und schwang sie hoch und leuchtend,
bis die Morgenröte kam und das volle
Tageslicht
wieder einströmte in die herrlichen Räume und auf den
Altar, vor welchem zwei der Priester sich vereint die Hände
reichten — Schiller und Goethe[VII-1]. Auf
den Altar aber hatte Lessing eine dreifache Weihe
gebracht: »Emilia Galotti«, »Nathan der
Weise« und »Minna von Barnhelm«. Wahrlich, das
deutsche Volk schätzt sie hoch, diese Gaben: dieses perfekte
Trauerspiel, dieses große Schauspiel und dieses schöne
Lustspiel.
Ah, meine Freunde, verstehen Sie nun, warum Deutschland seinem
Lessing hohe Verehrung schuldet und zollt?
Und was ihm das deutsche Volk schuldet für Sprache und
Litteratur — Dank und Verehrung, — das schulden ihm die
Gebildeten der gesamten Welt für das, was er auch
für sie getan durch seinen »Laokoon«, denn
»Laokoon« ist nicht das Werk einer Nation, sondern das
Gemeingut aller insgesamt.
Sie haben mich gebeten, meine verehrten Freunde, mit Ihnen auch
über Lessings »Laokoon« zu sprechen. Ich erfülle mit
großem Vergnügen Ihren Wunsch, muß mich jedoch
wegen der Kürze der mir zugemessenen Zeit auf ein geringes beschränken.
Durch seinen »Laokoon« rief Lessing eine solche
Veränderung in den Ideen über Dichtkunst, Malerei und
Bildhauerei hervor, wie einst
Newton auf einem andern Gebiete.
Sagte ich zuviel, meine Freunde? nein, ich glaube nicht.
Bevor ich jedoch über dieses Thema weiter spreche,
muß ich Sie bekannt machen mit einem der vorzüglichsten Männer
seiner Zeit, mit Johann Winckelmann. Aus dem Teile eines Briefes,
der von ihm selbst an einen Freund geschrieben sein soll,
können Sie einiges aus seinem Leben hören:
»Du verlangst meine Lebensgeschichte zu wissen,
und diese ist sehr kurz, weil ich dieselbe nach dem Genuß abmesse. M. Plautius,
Consul, und welcher über die Illyrier triumphiert hatte,
ließ an sein Grabmal, welches sich
unweit Tivoli erhalten hat, unter allen seinen angeführten
Taten setzen: "Vixit
ann. IX." Ich würde sagen: »Ich habe bis in das
achte Jahr gelebt;« dies ist die Zeit
meines Aufenthalts in Rom und in andern Städten von
Italien. Hier habe ich meine Jugend, die ich teils in der Wildheit,
teils in Arbeit und Kummer verloren, zurückzurufen gesucht und
ich sterbe wenigstens zufriedener; denn ich habe alles, was ich
wünschte, erlangt, ja mehr, als ich denken, hoffen und verdienen konnte.
— Ich schätze mich für einen von
den seltnen Menschen in der Welt, welche völlig zufrieden sind
und nichts zu verlangen übrig haben. Suche einen andern,
welcher dieses von Herzen sagen kann!
Meine vorige Lebens-Geschichte nehme ich kurz
zusammen. In Seehausen war ich achthalb Jahre als Konrektor an der
dasigen Schule. Bibliothekarius des Herrn Grafen von Bünau bin
ich ebenso lange gewesen und ein Jahr lebte ich in Dresden vor
meiner Reise. — Meine größte Arbeit ist bisher die
»Geschichte der Kunst des Altertums, sonderlich der Bildhauerei« gewesen.
— Ferner ist ein italienisches Werk unter dem Titel:
»Erklärung schwerer Punkte in der Mythologie, den
Gebräuchen und der alten Geschichte, alles aus unbekannter
Denkungsart des Altertums«;
— dieses Werk in Folio lasse ich auf eigne Kosten in Rom
drucken. — Beiläufig arbeite ich an einer
Allegorie für Künstler.
Dieses ist das Leben und die Wunder Johann Winckelmanns, zu
Stendal in der Altmark, zu Anfang des 1718. Jahres geboren. —
Ich wünsche dir, daß du zu der Zufriedenheit gelangen
mögest, die ich hier genieße und genossen habe, und bin
beständig
Dein treuer Freund und Bruder
Winckelmann.«
Lessing auch las die Werke dieses Mannes, der es verstand wie
kein anderer zuvor, die Wunder der Schönheit in den
Bild-Werken der Alten vor den Augen einer erstaunten Mitwelt zu enthüllen, und Lessing kam an
die Beschreibung der herrlichen Gruppe, der Laokoon-Gruppe.
Sie alle, meine Freunde, kennen die Geschichte des trojanischen
Krieges, nicht wahr? Sie wissen, daß trotz der glorreichen
Taten tapferer Helden dennoch im zehnten Jahre die Mauern der
Stadt fest da standen und daß dann die Griechen ein Pferd von
Holz erbauten, so groß, daß man einen Teil der Mauer
hätte niederreißen müssen, um es in die Stadt zu
führen, und daß die Griechen dann ihre Schiffe bestiegen
um heimwärts zu segeln — zum Schein. — Sie
erinnern sich auch, daß dann die Trojaner aus den Thoren
stürzten in die lang entbehrten Felder und das Pferd sahen und
staunten und fragten: Was bedeutet denn das? und daß sie
jenem falschen, lügenhaften Griechen glaubten, der ihnen
sagte, daß die Griechen auf dem Meere verderben müßten, wenn sie dieses
Pferd, ein Opfer der Götter, in ihre Stadt brächten, und
wie sie auch gewarnt wurden von Laokoon, dem Priester, doch
abzustehen von ihrem Vorhaben. Dann waren die Schlangen gekommen
aus dem Meere und hatten den Priester samt seinen beiden
Söhnen umschlungen.
Dieser Moment nun ist es, den ein alter griechischer Meister
erfaßt und in Marmor
ausgeführt hat und zwar mit solcher Meisterschaft, daß
Winckelmann nicht Worte des Lobes genug finden kann für die
Erhabenheit des Werkes und die Weisheit des Meisters, der in jedem
Zuge die höchste Schönheit zum Ausdruck gebracht hat
—
überall, überall; und der nicht wie der römische
Dichter Virgil gehandelt habe, welcher Laokoon in seinem Gedichte
vor Schmerz laut schreien und also doch den Mund weit und
unschön öffnen ließe.
Lessing las die mißbilligende Kritik
über Virgil, nahm den Poeten zur Hand und las die Verse, deren
Übersetzung nach Schiller so lautet:
»Jetzt aber stellt sich den entsetzten
Blicken
Ein unerwartet, schrecklich Schauspiel dar.
Es stand, den Opferfarren zu
zerstücken,
Laokoon am festlichen Altar.
Da kam (mir bebt die Zung', es auszudrücken)
Von Tenedos ein gräßlich Schlangenpaar,
Den Schweif gerollt in fürchterlichem Bogen,
Dahergeschwommen auf den stillen Wogen.
Die Brüste steigen aus dem Wellenbade,
Hoch aus dem Wasser steigt der Kämme blut'ge Glut
Und nachgeschleift in ungeheurem Rade
Netzt sich der lange Rücken in der Flut,
Laut rauschend schäumt es unter ihrem Pfade,
Im blut'gen Auge flammt des Hungers Wut,
Am Rachen wetzen zischend sich die Zungen,
So kommen sie ans Land gesprungen.
Der bloße Anblick bleicht schon alle
Wangen,
Und auseinander flieht die furchtentseelte Schar;
Der pfeilgerade Schuß der Schlangen
Erwählt sich nur den Priester am Altar.
Der Knaben
zitternd Paar sieht man sie schnell umwinden,
Den ersten Hunger stillt der Söhne Blut;
Der Unglückseligen Gebeine schwinden
Dahin von ihres Bisses Wut.
Zum Beistand schwingt der Vater sein Geschoß;
Doch in dem Augenblick ergreifen
Die Ungeheu'r ihn selbst, er steht bewegungslos,
Geklemmt von ihres Leibes Reifen;
Zwei Ringe sieht man sie um seinen Hals und noch
Zwei andre schnell um Brust und Hüfte stricken,
Und furchtbar überragen sie ihn doch
Mit ihren hohen Hälsen und Genicken.
Der Knoten furchtbares Gewinde
Gewaltsam zu zerreißen, strengt
Der Arme Kraft sich an; des Geifers Schaum besprengt
Und schwarzes Gift die priesterliche Binde.
Des Schmerzens Höllenqual durchdringt
Der Wolken Schooß mit berstendem Geheule,
So brüllt der Stier, wenn er, gefehlt vom Beile
Und blutend, dem Altar entspringt.«
Nochmals las Lessing die Verse des Poeten und nochmals sah er
auf die Gruppe des Bildhauers, — da war
nirgends etwas zu
tadeln: beide, Bildhauer und
Dichter, hatten das Schöne in bester Weise geschaffen —
nur auf verschiedenem Wege — und Lessing stutzte, staunte,
sann — und machte die große Entdeckung für die
Kunst, daß Dichter und Maler und Bildhauer nach demselben Ziele streben — die
Schönheit zu schaffen, daß sie aber oft verschiedene
Wege einschlagen
müssen, dieses Ziel zu erreichen.
Vielleicht, meine Freude, mögen Sie im ersten Momente
enttäuscht oder nicht im
Stande sein, die hohe Bedeutung dieser Entdeckung vollständig
zu begreifen, oder Sie mögen sich wundern und fragen: Hat man
dieses nicht immer erkannt? — oder Sie mögen auch sagen:
Was liegt daran, auf welche Art Dichter, Maler und Bildhauer
schaffen!
Ah, meine Verehrtesten, wie sehr ich wünsche, daß Sie
mich begleiten könnten
nach dem Raume, welcher den kostbarsten Schatz unter allen
Bild-Werken enthält! Wenn wir eintreten, sehen wir an den
Wänden entlang Männer und Frauen sitzen, welche vor uns
in derselben Absicht wie wir gekommen sind. Eine heilige,
glückliche Freude leuchtet aus ihren Augen; auf ihrem
Angesichte ruht scheue Ehrfurcht, und sie falten die Hände
und bewegen die Lippen betend — auch wir tun wie sie; und
zwei Mädchen, welche lachend und leicht nach uns gekommen
waren, wurden ebenfalls still und senkten bescheiden und fromm das
Haupt, und alle gehen gehoben zu heiliger Höhe als bessere
Wesen von dannen, denn sie sahen die Madonna von Raphael.
So, meine Freunde, wirkt ein Genius durch sein Werk. Er macht
die Menschen glücklicher und besser. So wirkt auch der Bildner
des Apoll von Belvedere, so auch der Schöpfer des Domes zu
Cöln.
Sie waren von Gott und andern Menschen besonders begnadet, und
was ihnen in
Fülle zuströmte, müssen andere durch
mühsames Ringen erstreben, durch schweres Studium, durch
ernstes Suchen der Regeln, die zum rechten Wege führen.
Winckelmann sagt: »Die Quelle und der Ursprung in der Kunst
ist die Natur selbst.«
Und zu diesem Wege führte uns Lessing in seinem Werke
»Laokoon,« aus welchem ich Ihnen zum Schlusse das Wort
Lessings anführen möchte, daß wir als unserm
Meister folgen müssen dem unsterblichen, ewig schönen
Homer.
Martha Parks: Bravo, Albert,
bravo! und nun applaudieret alle — lauter — so —
das ist recht.
Dr. Albert: Ich danke Ihnen, meine Freunde;
Ihre Güte macht mich glücklich.
Herr von Halsen: Sehr gut,
Albert, sehr gut!
Herr Meister: Meinen besten
Dank, mein lieber Herr Doktor.
Frau Meister: Sie haben mir
einen großen Genuß bereitet, verehrter Herr Doktor.
Martha Meister: Und
gewiß, Herr Doktor, auch mir.
Gretchen: Sowie mir; eines nur
muß ich bedauern.
Dr. Albert: Und das wäre, mein
Fräulein?
Gretchen: Daß ein Mann
wie Lessing nicht auch über die Kunst aller Künste,
über die Musik, seine Gedanken geäußert hat.
Dr. Albert: Das ist in der Tat zu
bedauern, aber wie wäre es, mein Fräulein, wenn Sie uns
Ihre Ideen
über Musik mitteilen wollten? Die Ansichten einer solch'
ergebenen Dienerin der Kunst würden
für uns alle lehrreich und angenehm sein.
Gretchen: Ah, mein Herr,
das wage ich nicht; wie
dürfte ich mich unterstehen, vor einer Versammlung gelehrter
Herren, wie sie hier ist, zu sprechen!
Louis: O mein Fräulein,
wir werden Nachsicht üben.
Gretchen: Nun, dann will ich
beginnen. Die Musik liebe ich von ganzer Seele treu und innig und
in der Tat versäume ich wohl kaum ein gutes
Konzert. Und doch geschah es nicht selten, daß ich eine
gewisse Unzufriedenheit am meisten gerade dann verspürte, nachdem ich die
höchste Freude an den schönsten Werken der unsterblichen
Meister genossen hatte.
Können Sie sich das wohl denken oder erklären? —
Mir ging es da, wie es so manchem kleinen Knaben geht, wenn der
Vater ihm ein Spiel-Zeug von der Reise brachte. Eine Weile freut er
sich — dann aber geht er still in eine Ecke und fragt sich:
Was mag wohl im Innern sein?
Und wenn ich nach einem großen Konzerte wieder alleine war
mit mir selbst und die herrlichsten Passagen mir noch im Ohre
klangen und ich mich noch labte am Strome der
Töne, dann drängte sich mir oft die Frage auf:
Was — was ist Musik? Woher hat
ein Beethoven diese süßen Melodien, diese wunderbaren
Harmonien? — Aus der Natur? — In der Natur höre
ich wohl einzelne Melodien, wie im Gesange der Vögel, doch
niemals solche, wie unsere größten Komponisten sie uns
geben, niemals Harmonien. Wie denn? ist überhaupt das, was
unsere Komponisten formten, etwas Natürliches, etwas, was wahr
ist und bestehen kann, oder ist es etwas Künstliches, etwas,
was Menschen zusammengefügt haben und das vergehen muß
wie Menschen-Werk? — Nein, nein — mein Glaube an die
Musik war zu mächtig, und doch — ich hätte so gerne
die Zweifel aus mir entfernt.
Es wollte mir lange nicht
gelingen; so viel ich auch denken und fragen und in
Büchern suchen mochte, — vergebens war mein
Bemühen.
Aber wir werden oftmals beschenkt, da wir es am wenigsten
erwarten, und doppelt groß ist dann unsere Freude. Und so
ging es auch mir. Ich fand eine Antwort in einer späteren Zeit
und an einem entfernten Orte. Wollen sie die Antwort hören?
Sie befriedigt mich selbst sehr wohl, doch bin ich nicht kühn
genug zu glauben, daß sie auch Ihnen genügen wird.
Ich stand vor dem erhabensten Schau-Spiel der Natur, das ich bis
heute gesehen habe, — ich stand am Niagara-Fall.
Wie lange ich da weilte, ich weiß es nicht mehr —
aber immer mußte ich denken: O, wie schön, wie
schön ist doch die Erde, auf welcher wir leben. Solche
große Pracht, solch' endlose Herrlichkeit wurde doch zu viel
für meine Augen, und ich bedeckte sie mit meinen Händen,
da — war es möglich? — o, göttliches Wunder
— ich
hörte in der Natur ein Konzert, so gewaltig, so schön und
erhaben, wie ich noch keines gehört hatte, und das Rätsel
der Musik war mir gelöst.
Töne und Melodien und Harmonien sind überall,
überall in der Natur; überall, wo Leben ist, da entsteht
auch der Ton; wo der Ton uns sympathisch erquillt, wo Melodie und
die Harmonie, da geht das Werk der Natur glücklich von
statten; und instinktiv weilen wir hier und hier weilt alles
Lebende gerne.
Töne kommen vom Leben, sind Beweise des Lebens und darum
wirken sie gleiches und erwecken auch Leben. Daher die Macht der
Musik über alles Lebende, daher die Anziehungs-Kraft der Musik auf alles,
was Leben hat. Farbe und Form wirken auf das Auge der
Geschöpfe, Ton und Musik auf das Ohr.
Der Dichter erhebt sich über die Menschen, übersieht
ihre Taten, erforscht ihre
Gedanken und Gefühle und, indem er in seinen Dichtungen die
Handlungen von Menschen wahrhaft gruppiert, wirkt er wieder auf
Menschen durch deren Herzen und Verstand.
Der Maler erhebt sich gleichsam über die Erde und
führt eine Scene auf seinem Gemälde derartig aus,
daß auch andere Menschen die Schönheit der Erde leichter
zu erkennen vermögen. Der Maler wirkt durch das Auge.
Dem Komponisten aber verlieh Gott in seiner Gnade die Gabe,
daß er sich im Geiste über das Irdische zu den
Himmels-Sphären schwingen und jene Harmonien vernehmen
kann, welche
aus den unendlichen Räumen zusammenströmen und das
glückliche Zusammen-Wirken alles Bestehenden im Welten-Alle
verkünden. O, wer wie sie jene Musik der Sphären
vernehmen könnte!
Beethoven und Mozart und Gluck und Haydn und Händel und
Mendelssohn und Bach und Weber und die anderen alle — sie
hörten dieselbe und gaben uns andern in ihren Werken nur ein
schwaches Echo, auf daß wir uns daran laben und vom
Höheren lernen und an das Höhere glauben.
Daher kommt es, daß die Macht der Musik so allgewaltig
ist, weil sie aus den Höhen stammt,
und daher kommt es auch, daß ein Beethoven, der sich erhoben
hatte über allen irdischen Glanz, sich selbst vor einem Kaiser
nicht beugte, da selbst ein Goethe, der erste Poet seiner Zeit,
sich ehrfurchtsvoll bückte, als beide, Komponist und Poet,
zusammen dem Fürsten begegneten. Darum geschah es auch,
daß an einem Tage während des Wiener Kongresses die
versammelten Kaiser und Könige und Fürstinnen sich
sämtlich von ihren Sitzen erhoben und sich beugten vor dem
Meister; er hatte ihnen durch seine Kompositionen eine Ahnung gegeben von jenen Höhen, Höhen,
in denen er selbst geweilt, und er hatte die Großen der Erde
erfüllt mit Ehrfurcht vor dem Höchsten, dessen
bescheidener Diener er selbst nur war.
Eben diese hohe Macht ist es, welche auch aus Händel
sprach, als er zu einem Kurfürsten von Sachsen sagte:
»Königliche Hoheit, ich haben meinen
»Messias« nicht geschrieben, um Euch zu unterhalten, sondern um
Euch zu bessern.«
Und es ist nur ein Abglanz des Schönen, das Mozart selbst
vernommen und das wir wiederfinden in seinen Werken und in seinem
Leben.
Ich will nun meine Bemerkung schließen mit den Worten
Schillers, meines Lieblings-Dichters:
»Wer kann des Sängers Zauber lösen,
Wer seinen Tönen widerstehen?
Wie mit dem Stab des Götter-Boten
Beherrscht er das bewegte Herz. —
— Da beugt sich jede Erden-Größe
Dem Fremdling aus der andern Welt —
— So rafft von jeder eitlen Bürde,
Wenn des Gesanges Ruf erschallt,
Der Mensch sich auf zur Geister-Würde
Und tritt in heilige Gewalt.«
Meine Herrschaften, ich habe nichts mehr zu sagen; bitte, seien
Sie nicht zu streng mit mir.
Frau Meister: O, meine liebe,
liebe Tochter!
Herr von Halsen:
Vorzüglich! — Eine Philosophin!
Dr. Albert: Fräulein Gretchen, Madame,
Herr Meister, haben Sie meines Freundes Urteil gehört? Wer ihn
kennt, weiß wie viel diese wenigen Worte bei ihm zu bedeuten
haben.
Martha Meister: O, wie
glücklich hast Du mich gemacht, Gretchen!
Bella: Und wie stolz ich auf
Dich bin!
Herr Meister: Bravo, mein
Kind, sehr brav. Komm, nun sing uns auch ein Lied vor. Du bist doch
nicht zu müde?
Gretchen: O nein, mein lieber
Papa. Martha, Du begleitest mich doch, nicht wahr?
Martha Meister: Gewiß,
gewiß; was wählest Du?
Dr. Albert: Singen Sie: »Wenn die
Schwalben heimwärts ziehn«; mein Freund hört es
gerne.
Gretchen (singt):
Wenn die Schwalben heimwärts ziehn,
Wenn die Rosen nicht mehr blühn,
Wenn der Nachtigall Gesang
Mit der Nachtigall verklang,
Fragt das Herz
In bangem Schmerz:
Ob ich dich auch wiederseh'?
Scheiden, ach Scheiden tut weh!
Wenn die Schwäne südlich ziehn,
Dorthin, wo Citronen blühn,
Wenn das Abendrot
versinkt,
Durch die grünen Wälder blinkt,
Fragt das Herz
In bangem Schmerz:
Ob ich dich auch wiederseh';
Scheiden, ach Scheiden tut weh!
Herr von Halsen: Albert!
Dr. Albert: Sehr wohl, Heinrich, sogleich!
Meine Herrschaften, wir haben nun die Ehre, uns bestens zu
empfehlen.
Martha Meister: Müssen
Sie so frühe gehen?
Frau Meister: Sie eilen, meine
Herren; nun, wir dürfen Sie nicht hindern, aber unsere anderen
Freunde bleiben noch hier, nicht wahr?
Martha Parks: Ja, ja, wir
bleiben noch hier, Frau Meister.
Louis: Und haben noch viel
Vergnügen.
Herr Meister: Also morgen zur
bestimmten Zeit!
Herr von Halsen: Zur
bestimmten Zeit. Ich empfehle mich.
Alle: Auf Wiedersehen, auf
Wiedersehen!

VIII.
Dr. Albert: Dank, mein Fräulein. Dank
für dieses eine Wort ....
Martha Meister: Sehen Sie,
Herr Doktor, welche Scene!
Dr. Albert: Das ist herrlich! — Hier
vor uns der klare, liebliche See und dort in bläulich Ferne die
kräftigen Rücken der Berge, die höher und höher
hinter einander sich türmen. O, mein Fräulein, daß
Sie die Freude dieses Augenblickes fühlen könnten wie
ich!
Martha Meister: Ich fühle
sie, Herr Doktor; o — hören Sie — Gesang.
Dr. Albert: Das ist Bruder Louis[VIII-1] Stimme — er kommt.
Wie hübsch das Echo dazu schallt.
Louis (singt):
»Im Wald und auf der Heide
Da such' ich meine Freude,
Ich bin ein Jägers-Mann,
Ich bin ein Jägers-Mann.
Halli halloh, halli halloh,
Ich bin ein Jägers-Mann.«
Oho — Ihr seid schon hier? Ich dachte, ich wäre der
erste. — Albert, Albert, wo warst Du nur? Bestes
Fräulein, warum waren Sie nicht bei uns? So herzlich haben wir
lange nicht gelacht. Dieser Heinrich von Halsen, o, das ist
der lustigste Mensch von der
Welt!
Dr. Albert: Sagte ich es nicht:
»Kennt ihn nur erst!« — Aber so, wie seit wenigen
Tagen, habe ich ihn selbst niemals zuvor gesehen. Ein neues Leben
ist über ihn gekommen; das haben wir allein der kleinen
Zauberin, Ihrer Schwester Gretchen, zu danken. Mit vollem Herzen
brachte ich ihr daher gestern in Gegenwart aller meinen Tribut
dar.
Martha Meister: Und wie
glücklich Sie meine teure Schwester und mich selbst machten
durch die feine Manier, mit der Sie es taten. Sie ....
Louis: Da kommen sie —
hierher alle, alle hierher! Herr Meister und Frau Meister, Herr von
Halsen und Fräulein Gretchen, Otto und Fräulein Bella und
Schwesterchen Martha, — hierher, hierher!
Herr Meister: Hier ist die
Grotte; nun sagt mir einmal, wie gefällt sie Euch?
Frau Meister: Wie schön,
wie schön sie ist!
Otto: Wissen Sie auch, meine
Herrschaften, daß dieses ein Lager-Platz der Indianer
war?
Bella: Wirklich?
Otto: Diesen See nannten sie
den »Fischreichen.«
Martha Parks: Indianer? Hu
— wenn sie mit einem Male hinter jenem Felsen hervorsprängen
— mir grauset es!
Louis: Laß sie nur
kommen, Schwester, laß sie nur — ich bin bei Dir
— ha, wie ich wünsche, die Rot-Häute zu sehen!
Dr. Albert: Louis, hast Du wirklich so
großes Verlangen, die Indianer zu sehen!
Louis: Ein unbeschreiblich
großes Verlangen!
Dr. Albert: Gut, so komme mit mir.
Louis: Was —? Mit
Dir?
Dr. Albert: Mit mir und meinem Freunde
Heinrich nach dem Westen.
Bella:
Louis:
Martha Parks:
Otto: Du — Ihr —
geht nach dem Westen?
Dr. Albert: O stille, Freunde —
Ordnung! Ich habe jetzt mit Euch zu sprechen. Aber erst nehmet
Platz. So — seid Ihr alle bequem? Nun, dann werde ich
meine Enthüllungen mit
dem heutigen Briefe unseres teuren Vaters beginnen; ich werde nur
einen Teil und zwar in deutscher Übersetzung lesen:
»— Dein letztes Schreiben wurde mir von der lieben
Mutter überreicht, als ich von meiner langen und mühsamen
Reise zu ihr und zu den lieben Verwandten zurückkehrte. Die Mama war
betrübt wegen Deines Entschlusses und sie bedauerte die Jahre,
welche Du im Studium der Medizin verbracht habest und welche nun
nutzlos
geworden seien. Aber sie ist wieder beruhigt, völlig beruhigt,
da sie sieht, wie ich selbst mich über Dich freue, ja, mein
Sohn, mich freue von ganzem Herzen. — Es war Dein Wunsch vor
Jahren, den Beruf eines Arztes zu wählen, und ich wollte
Deinem Lebens-Glücke nicht hindernd entgegentreten,
unterdrückte meine eignen Neigungen in dieser
Sache und ließ Dich gewähren.
Mir selbst aber war von meinem seligen Vater, dem lieben
ehrwürdigen Greise, dessen Du Dich
vielleicht noch erinnerst aus frühen Kinder-Jahren, —
ich sage, mir war von ihm eine solch' hohe Verehrung für den
Ackerbau eingeflößt
worden, daß ich es stets als ein hohes Ziel meines Lebens
betrachtete, Land-Wirtschaft zu betreiben,
Land-Wirtschaft in großartigem Stile.
Meine Jahre sind mir in anderer Beschäftigung
verflossen, und erst vor wenigen Wochen konnte ich an die
Ausführung meines Lieblings-Planes ernstlich denken. Ich
reiste nach dem fernen, fernen Westen — und bin jetzt
zurückgekehrt. Große, endlose Strecken Landes habe ich
durch Ankauf zu meinem Eigenthum gemacht. Der jungfräuliche
Boden ist fruchtbar und eben, und nur in einem Teile erheben sich
Hügel und Berge, die mit den besten Holz-Arten bedeckt sind.
Die Seen und die Ströme sind reich an Fischen und auch tief
und im Stande, große Schiffe zu tragen. Eben dachte ich
darüber nach, mich mit fähigen Männern in Verbindung zu setzen, die mir beistehen
sollten, diesen neuen Teil unseres Landes für die Kultur zu
gewinnen — da kam Dein Brief, mein Sohn, mir wie eine Himmelssendung und brachte mir
Deinen und Deines Freundes Entschluß. Und da dachte ich denn,
daß Deine und Deines Freundes Energie und Intelligenz und
meine eigene, verbunden mit den Erfahrungen eines bewegten Lebens,
dazu unsere Mittel und unser guter Wille genügen sollten, um
vorwärts zu kommen in unserm großen Werke. Meinst Du
nicht auch so? Ich werde nun wieder zurückeilen zu Euch, um
dann mündlich ....« &c. &c.
Louis: So wirst Du ein Farmer,
Doktor Albert Parks?
Dr. Albert: Ein Farmer werde ich, ganz
recht; ein Farmer, welcher Strecken Landes der Wildnis
entreißt und sie fruchtbar macht und gesund und schön
für die Menschen zum Bewohnen; ein Fabrikant, der Fabriken
errichtet und die Produkte, welche die Fläche und das Innere
der Erde erzeugt, verwendet und Tausenden
von Familien Arbeit, reichliche Nahrung und Komfort verschafft; — ein Kaufmann, welcher die
Erzeugnisse des
Landes auf fremden Markt versendet und gegen andere fremde Produkte
eintauscht — das, das wird meine und meines Freundes
Aufgabe für die kommenden Jahre
sein.
In der freien Gottes-Natur und auch da, wo das Geräusch der
Maschinen am betäubendsten und die
Regsamkeit der Menschen am lebhaftesten ist — da, da bin ich
am liebsten, da befinde ich mich am wohlsten und da schaffe ich am
meisten und am besten. So dachte mein Groß-Vater, so denkt auch mein Vater,
so denkt mein Freund und so denke auch ich. Den heiligen,
stillwirkenden Beruf des Arztes aber sollen Männer üben
mit stillem, sinnigem Wesen. — Jetzt, meine
Freunde, versteht Ihr mich, will ich hoffen; jetzt wißt Ihr,
warum ich nachts so viel über Pläne von Bauten und
Maschinen studierte und so viel kalkuliert habe; jetzt wißt
Ihr, warum mein Freund Heinrich herüber zu uns gekommen ist,
und jetzt wißt Ihr auch meine sorgenvollen Blicke zu deuten
— ach, konnte ich wissen, daß alles, alles so gut, so
wunderbar gut kommen würde? Ja, alles hat sich zum besten
gewandt; ist es nicht so, Heinrich?
Herr von Halsen: So ist es,
Albert, in der Tat, nur eine ist hier, die da weint, unsere liebe
kleine Martha. Sage mir, Martha, warum weinest Du?
Frau Meister:
Gretchen:
Martha:
Bella:
| } |
Warum weinest Du, Martha? |
Martha Parks: Nun geht Albert
wieder fort von uns!
Dr. Albert: Liebe, süße, gute
Schwester, noch gehe ich ja nicht, und wenn ich auch gehe, ich
komme gewiß bald wieder.
Herr von Halsen: Komm zu mir,
liebe Martha, komm, Du wirst bald wieder froh werden — ein
klein wenig Geduld nur — — meine Herrschaften, ich habe
die Ehre, Ihnen hier zwei junge Autoren vorzustellen, die Herren Otto und Louis
Parks. Sie werden uns mit einem neuen Lustspiel erfreuen, es ist ihr erstes
Lustspiel. Um uns Vergnügen zu bereiten, haben sie sich, wie
ich selbst bezeugen kann, viel Mühe gegeben, und ich bitte Sie
in ihrem Namen um Nachsicht und um die Erlaubnis, es vorlesen zu
dürfen.
Frau Meister: Welch' freudige
Überraschung!
Herr Meister: Eine
Komödie in der Tat?
Herr von Halsen: Zuvor aber
muß ich den beiden Herren meinem
Versprechen gemäß einiges mitteilen über die
Aussprache des Deutschen.
Ich hatte das Glück, bei meinem Studium der deutschen
Sprache Herren als Lehrer zu haben, welche besonders großen
Wert auf eine reine, vollkommene Aussprache legten. Fürchten
Sie nicht, meine Damen, daß ich zu lange sprechen werde; von
den vielen, vielen Regeln werde ich für diesen Moment nur
einige der wichtigsten wählen.
Vor allem sprechen Sie mit den Lippen — gebrauchen Sie die
Lippen viel und zwar so, daß die äußeren Ränder sich berühren; doch
immer sei die Form des Mundes schön.
Im Deutschen haben wir zwei Arten von »a«.
Denken Sie einmal, Sie wären im Theater und Sie wären
etwas zu frühe gekommen. Die Lichter sind klein und es ist
noch recht dunkel; mit einem Mal wird das Haus voll erleuchtet und
von der Gallerie tönt wie aus einem Munde ein
überraschendes »a——h!«
Das ist genau das deutsche lange »a«, das
»a« mit dem Hauch, mit der Aspiration.
Das zweite »a« aber ist das »a«, das Sie
beim Lachen hervorbringen: ha ha, ha ha ha. Dieses ist das kurze
»a«, es entsteht durch den Druck, durch Pression.
Gehaucht wird das »a« (lang) vor einem Konsonanten, hervorgepreßt (kurz) aber
vor zwei[VIII-2] Konsonanten.
»A« ist gehaucht in »sage«,
»habe«, »male«, »Knabe«,
»Vater«; denn »a« ist vor einem Konsonanten.
»A« wird hervorgepreßt in »halte«,
»lasse«, »danke«, »kalt«,
»Satz«; denn »a« ist vor zwei Konsonanten.
So haben wir auch zwei »e«, ein gehauchtes und ein
gepreßtes; gehaucht vor einem, aber
gepreßt vor zwei Konsonanten. So
haben wir zwei »i«, zwei »o«, zwei
»u«, zwei »ä«, zwei
»ö«, zwei »ü«.
Das deutsche »au« gleicht dem englischen "ou" in "mouse", "house". Das
deutsche »äu« und »eu« dem englischen
"oy" in
"boy", "annoy".
Das deutsche, »ei« dem englischen "i" in "idle", "fine".
Wollen Sie das deutsche »ü« oder
»ö« aussprechen, so formen Sie die Lippen so, als
wollten Sie pfeifen; und gebrauchen Sie die Oberlippe mehr, so
entsteht das »ü« und lautet wie «u» im
Französischen «rue»; gebrauchen Sie die Unterlippe mehr,
so entsteht das »ö« und lautet wie das
französische "eu" in "amateur" — aber bei dem »ü« ist
die Öffnung des Mundes noch kleiner, als beim
»ö«; »ä« lautet ähnlich dem
Tone, den das Lämmchen hervorbringt in
»bl——ä«.
Hüten Sie sich, das deutsche »u« zu sprechen
wie Sie es tun im englischen Worte "use" das ist nicht deutsch und klingt
unschön. Sprechen Sie das »u« wie "oo"[VIII-3] in "moon".
Im Deutschen trennen wir Silben nicht wie im Englischen. Im
Englischen sagen Sie "Jan—uary", im Deutschen sagen wir
»Ja—nuar«; im Englischen sagen wir "min-ute" im Deutschen
sagen wir »Mi—nu—te«.
Im Deutschen beginnen wir die Silben mit Konsonanten, wo immer
es tunlich[VIII-4] ist.
Also, »sa—ge«, nicht »sag—e«;
wir sprechen »ma—len«, aber nicht
»mal—en«; »hö—ren«, nicht
»hör—en« und »schrei—ben«,
nicht »schreib—en«.[VIII-5]
Der Accent bei »sage« ist auf »sa«,
nicht auf »ge«; in »malen« auf
»ma« und nicht auf »len«; sprechen Sie
[VIII-6]»sa'ge, ma'len, hö'ren,
schrei'ben«.
Sprechen Sie in diesen Wörtern die erste Silbe recht
energisch und schön aus und dehnen Sie die letzte nicht
lang.
Im Englischen ist man oft geneigt, im Satze, das Pronomen
besonders zu betonen; im Deutschen zieht
man das Verbum vor, z.B. "I understand you"; aber »Ich verste'he Sie.«
Ein Wort, welches zusammengesetzt ist aus einer Präposition
und einem Verbum, hat den Accent auf der Präposition:
vor'sprechen, ab'schreiben, auf'stehen,
unter'gehen, aus'arbeiten, bei'stehen,
mit'sprechen, nach'sehen &c. &c.
Wörter, zusammengesetzt aus zwei Substantiven, haben den
Accent auf dem ersten Worte, z.B. Haus'-Thüre, Sprach'-Lehre,
Winter'-Hut, Herzens'-Freude.
Viele von den Konsonanten werden im Deutschen ausgesprochen, wie
im Englischen.
Das »g« ist wie das "g" in "go", und das »g« sollte stets so
ausgesprochen werden, ob am Anfang oder am Ende. Nur in seltenen
Fällen und nur da, wo der Wohlklang (die Euphonie) es
verlangt, sollte es ein wenig sanfter gesprochen werden, doch
niemals am Anfang. — Man hüte sich vor den Extremen!
In einem Teile Deutschlands spricht man das »r« mit
dem Gaumen, wie die Franzosen es tun; in einem andern bringt man
das »r« mit der Zunge hervor, wie man es tut in der
englischen Sprache, — und so ist es am besten.
Das deutsche »s« sei sanft wie das englische
"s" — denn
so ist es am schönsten; ein »ss«, (doppeltes
»s«) sei stark.
»St« wird von vielen Deutschen wie s und t
gesprochen, ganz wie das englische "st" in "stone", "star", "strong", "string".
Von vielen aber wird es gesprochen wie »scht«; also
nicht »S—t—ein« sondern
»Schtein«; nicht »S—t—ern«
sondern »Schtern«; nicht
»s—t—ark« sondern
»schtark«.
In den besten Theatern Deutschlands gilt die letzte
Aussprachs-Weise; die größten und besten Gesangs-Lehrer
Deutschlands lassen nur »Schtern«,
»Schtock«, »schtark«, niemals
»S—t« aussprechen beim Singen.
»V« ist wie »F« und »F« wie
»V«.
»W« kommt dem englischen "v" ziemlich nahe — und ich bitte
Sie, sprechen Sie doch das deutsche »w« niemals wie das
englische "w".
»Z« ist »ts«; also »zanken«
wie »tsanken«, »Zahlen« wie
»Tsahlen«, »Zorn« wie
»Tsorn«.
Jetzt kommt das »ch« — das ist leicht. —
Kennen Sie den eigentümlichen Ton, den die Gans hervorbringt?
— sehen Sie, so — nun, das ist das deutsche
»ch« bei dem Vokale »e«, wie in
»recht«; bei dem Vokale »i«, wie in
»ich«, [VIII-7] (ja nicht isch!!!); bei
»ä«, wie in »Mächte«; bei
»ö«, wie in »möchte«; bei
»ü«, wie in »Bücher«,
»züchte«; bei »ei«, wie in
»reich«, »leicht«; bei »eu«,
wie in »Leuchte« und in »euch«.
»Ch« wird mit dem Gaumen hervorgebracht (Guttural)
bei den Vokalen »a«, »o«, »u«
und »au« — in »ach«,
»Nacht«, »hoch«, »mochte«,
»suche«, »Bruch« und
»Rauch«.
Sprechen Sie besonders die Anfangs-Konsonanten aller Silben
energisch und schön aus.
Bitte, beachten Sie stets das Gesetz der Schönheit! Der
Mensch mit einem Gefühle für das Schöne wird auch
seine Sprache, die höchste eigne Errungenschaft des
Menschen-Geistes, schön sprechen. Und dann wollen Sie vor
allem bedenken, daß die deutsche Sprache auf demselben Boden
entsprossen ist, auf welchem die göttliche Musik Beethovens
erstand. Und nun kommt noch eine, meine letzte Regel. Sprechen Sie
das Deutsche recht langsam, leicht und elegant und ziehen Sie die
Worte nicht
zusammen, sonst könnte es Ihnen ergehen wie jener
Sängerin, da sie den »Erlkönig« von Goethe
öffentlich vortrug; sie kam an die
Stelle:
»Dem Vater grauset's; er reitet
geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind
—«
und sang: »Er hält in den Armen
da—sächzende Kind.« Lautes Lachen erfolgte, denn
alle hatten verstanden »Er hält in den Armen das 16te
Kind.« Ich bin zu Ende — Otto, Sie haben das Wort.
Otto: Die folgenden Personen
werden in dieser Komödie vor Ihnen erscheinen: Luise und
Ottilie, Rudolf und Arthur, etwas später dann ein Sergeant von
der Polizei mit Polizisten, auch der Herr Baron von Sellen mit
seiner Gemahlin Elisabeth, und dann viele andere Personen,
Gäste eines großen Hotels, in dessen Empfangs-Zimmer sich das Ganze
abspielt.
Luise ist die junge Gemahlin Rudolfs; gestern hatten sie
Hochzeit gehalten und waren dann am Nachmittage abgereist und am
Abend im Hotel angekommen. Am folgenden Morgen dann trafen, wie
vorher brieflich bestimmt war, sich die befreundeten Paare. Luise
und Ottilie treffen zuerst und allein zusammen, und später so
auch die Herren.
Die erste Scene beginnt also mit der freudigen Begegnung zwischen Luise und Ottilie. —
Willst Du zu lesen beginnen, Louis?
Louis: Sehr wohl, ich
beginne:
Erste Scene.
Luise — Ottilie.
Luise: Ach —
Ottilie!
Ottilie: Aber, Luise!
Luise: Ottilie, — ich
bin unglücklich!
Ottilie: Wie du mich
erschrickst — du unglücklich? beste, liebste, Luise,
— unglücklich am Tage nach der Hochzeit — nein,
nein es kann, es darf nicht sein; — aber so weine doch nicht
in einem fort. Was ist dir denn, so sprich, so sprich doch nur, ich
bitte dich, liebe Luise!
Luise: Es begann nach meiner
Trauung.
Alles war so schön gegangen und da ich vom Altare trete, um an
Rudolfs Arm zurückzukehren und die Menschen erblicke, welche
da Kopf an Kopf in der Kirche stehen, da kommt eine — eine
Verwirrung über
mich und — o — Ottilie — ich — verlor
meinen Trauring.
Ottilie: Das ist schlimm!
Luise: O, es ist ein
entsetzliches Unglück. Als ich nach Hause kam, merkte ich es
erst. — Nur meine Mutter weiß es und unser alter treuer
Diener. Überall haben sie gesucht, jeden Stein haben sie
umgedreht — umsonst — er ist fort und niemals finde ich
ihn wieder, niemals, niemals!
Ottilie: Und Rudolf?
Luise: Er weiß noch
nichts. Als wir nachmittags abreisen wollten und bereits im Wagen
saßen, bemerke ich gerade noch, daß mir mein neuester und
gerade mein schönster Hut fehlte, du weißt ja —
der dir so besonders gefiel. Ich bitte Rudolf, in das Haus zu eilen
und ihn mir zu bringen. Er geht — und bleibt entsetzlich
lange aus. Endlich, da ich vor Ungeduld beinahe vergehe, kommt er
wieder — denke dir, kommt wieder ohne meinen Hut und lacht so
laut und so fürchterlich, daß er kein Wort zu sprechen
vermag, lacht konvulsivisch; und je mehr ich bitte, je mehr ich
weine, desto lauter lacht er. Das ist der Anfang unserer Reise
— er in der einen Ecke und lacht, daß ich meine, er
habe den Verstand verloren, und ich in der andern Ecke und weine,
daß mir schier das Herz vergehen will. Endlich
kommen wir hier an im Hotel. Da eile ich in mein Zimmer und
schließe mich ein ganz allein und durchweine die Nacht.
Ottilie: Und Rudolf?
Luise: Ist der herzloseste,
leichtsinnigste Mensch von der Welt, aber ich habe ihn auch vor
meiner Thüre klopfen lassen — zur Strafe klopfen lassen,
bis er müde wurde.
Ottilie: Luise, Luise, ich
fürchte, du begehst einen großen Irrtum!
Luise: So, meinst du? Ich
dachte es auch heute Morgen, und öffnete deshalb die Thür
und hoffte, er würde wieder kommen; und richtig, ich höre
Schritte nahen — das waren seine Tritte — warte, dachte
ich, ich will es dir nicht zu leicht machen, und setze mich
ans Fenster und
drehe der Thüre den Rücken zu. Richtig, er tritt ein, und
ich bleibe eine Weile stille sitzen und schaue zum Fenster hinaus,
jeden Moment denkend, er müsse nun kommen, mich in seine Arme
zu fassen — aber er bleibt still. Ich drehe mich um und sehe
— denke dir meinen Schrecken — einen fremden Herrn auf
meinem Sopha ausgestreckt. Als er mich sieht, ist er ebenso
erschreckt wie ich selbst und stammelt in Verwirrung ein paar
Worte: Pardon — Irrtum —, giebt mir in Hast seine Karte
und ist im Nu — mit den Schuhen in der Hand und dem Rocke auf
dem Arme — zur Thüre hinaus, und das alles ging so
schnell wie der Blitz und so komisch, daß ich trotz meines
Elendes nun
auch laut, laut lachen mußte.
Ottilie: Nein — das
muß ich sagen — der zweite Tag deines ehelichen Lebens
fängt komisch genug an. Laß mich die Karte sehen.
Luise: Hier — hier ist
sie.
Ottilie: Hm. — Friedrich
Baron von Sellen; sieh', sieh'. Weißt du, Freundin, das geht
so nicht mit dir und Rudolf — ihr müßt euch wieder
vereinigen und zwar heute Morgen noch. Ich habe eine gute Idee. Wir
schreiben ihm ein Billet — und — nun, du sollst sehen,
er wird schon kommen.
Luise: O ja, er muß zu
mir kommen; er war allein schuld, o, der häßliche
Mensch!
Ottilie: Komm, komm nur auf
mein Zimmer!
[Beide ab.]
Zweite Scene.
Rudolf —[VIII-8]
Arthur.
Rudolf: Sage, was du willst,
Arthur — es hilft nichts, gar nichts. Es ist das Beste, man
nimmt das Leben leicht. Ich habe es versucht, war ernst — was
war die Folge? Konnte während der ganzen Nacht kein Auge
schließen. In der unbehaglichsten Stimmung verlasse ich endlich heute früh
mein Zimmer, um im Freien Trost, Zerstreuung zu suchen, und nehme
gerade, als ich dort auf der Brücke stehe, meine beste
Trösterin, meine Cigarre, aus der Tasche, mache Feuer und
stecke in Gedanken — das Feuer statt der Cigarre in den Mund.
Nicht allein, daß ich vor Schmerz laut aufschreien mochte,
— von den Fenstern des Hotels muß ich noch das laute
Gelächter dazu vernehmen. Mein Gesicht muß im Momente
wohl recht komisch gewesen sein, ich hätte gerne selber
mitgelacht, wenn es nur nicht meiner Zunge begegnet wäre.
ärgerlich eile ich zurück
zum Hotel, will auf mein Zimmer gehen, öffne die Thüre
und — denke dir mein freudiges Erstaunen: wahrhaftig —,
da sitzt sie am Fenster und sieht auf die Berge hinaus. Aha, denke
ich, sie hört mich nicht, ich will sie überraschen
— und leise, ganz leise von hinten komme ich näher,
näher, und schnell lege ich meine Hände auf ihre Augen.
Na — die Überraschung! Wie von einer Viper gestochen,
springt sie auf vom Stuhle und schreit Feuer! Mörder! —
Himmel, jetzt erst sehe ich, daß es gar nicht meine Frau,
— daß es eine alte Dame in einer kolossalen Nacht-Haube ist. Ich sehe mich um
— das war ja gar nicht mein Zimmer — ich will ihr
erklären, sie läßt mir keine Zeit und schreit in
einem fort: Feuer! Räuber! Mörder! — Ich höre
die Leute auf dem Korridor rennen und denke das Beste sei
fortzueilen. Ich thue also und komme glücklich eine Treppe
höher wieder in mein eignes Zimmer.
So begann der zweite Tag dieser allerliebsten
Hochzeits-Reise.
Arthur: Und was ist aus deiner
jungen Frau geworden?
Rudolf: Ach, frage mich nicht
— das ist eine ganz fatale Geschichte!
Arthur: Also — in dem
Punkte scheinst du doch ernst zu werden.
Rudolf: Nun, denkst du
vielleicht, es sei ein Spaß, eine Frau zu haben und doch
keine zu haben, oder stundenlang vor der Thüre seiner
Angetrauten vergebens zu stehen und auf
alles Klopfen, Bitten, Beschwören, Drohen keine andere Antwort
zu hören, als Seufzen und Schluchzen und Weinen? — O,
laß mich nicht mehr daran denken, es macht mich rasend.
Arthur: Still, Rudolf —
was willst du von mir, ich habe dir ja kein Leid zugefügt.
Rudolf: Du? — nein, das
ist wahr.
Arthur: Ich kann es nicht
begreifen: du der liebenswürdigste Mensch, einen Streit mit
deiner Frau — und noch dazu am Hochzeits-Tage. Warum, Mensch,
konntest du nicht warten bis später?
Rudolf: Als ob ich einen
Willen gehabt hätte! Der abscheuliche Putz, die Hüte,
sind daran schuld.
Arthur: Die Hüte?
Rudolf: Ja, der Hut und deine
Schwester!
Arthur: Oho, — nun gar
meine Schwester!
Rudolf: Höre mich an.
Alles war glücklich überstanden: Trauung und Gratulation
und Küssen und Hände-Schütteln, Vorstellung und
Empfangen und Weinen und Abschied-Nehmen &c. &c. und
glücklich sitze ich schon im Wagen neben meiner himmlischen
Luise und juble im Herzen — da fällt es ihr
mit einem Male ein, daß sie noch den einen Hut haben
muß. Ich muß wieder aussteigen und in's Haus
zurückeilen. Kaum trete ich ein, so erblickt mich mein Cousin
und Wehmut im Auge umschlingt er mich mit beiden Armen und seufzt:
Bruder, noch eine Flasche Champagner, — noch eine — und
zieht mich fort mit sich, ob ich will oder nicht. Da kommt deine
Schwester Antonie. Und nun zieht sie mich am andern Arm fort, fort
in den Tanz-Saal und sagt: »Ich muß erst meinen Tanz
haben, Rudolf; eher kommen Sie mir nicht fort.« Verblüfft steht da mein
enttäuschter Cousin und hält die Champagner-Flasche in
der Hand; er weiß nicht, was er allein damit tun soll, und
schlüpft sie mir schnell in die
hintere Tasche meines Frackes. Beim Tanzen geht der Kork los,
explodiert — dem General vom Bombenfeld an die Nase. Er schreit laut auf vor
Schmerz, der Champagner spritzt nach tausend Seiten auf alle; alles
flieht entsetzt auseinander, und ich entrinne glücklich, komme
zurück in den Wagen und rufe dem Kutscher zu: Vorwärts,
vorwärts — und flugs gehts dahin. Ich aber
falle in die Ecke und beginne zu lachen und lache
übermenschlich, und nähmest du mir das Leben, ich konnte
mich nicht halten. Luise fragt nach ihrem Hute; ich kann nicht
antworten. Sie beginnt zu weinen und je mehr sie weint, desto mehr
muß ich lachen und an die Champagner-Scene denken. Als ich
endlich zu mir komme und alles erklären will, sitzt sie in der
Ecke und weint und will kein Wort von mir hören, dem
herzlosesten Menschen auf der ganzen Gottes-Erde. Wir kommen hier
an in dem Hotel — sie eilt in ihr Zimmer, schließt sich
ein und mich aus — nun, du weißt ja den Rest dieser
herrlichen Hochzeits-Reise.
Arthur: Rudolf, wirklich, ich
bedaure dein Unglück.
Rudolf: Siehst du, Arthur, das
freut mich von dir; da ist doch eine Menschen-Seele, die mein
Unglück mit mir fühlen kann.
Arthur: Ich will mit meiner
Frau sprechen; Ottilie und Luise sind Freundinnen. Verlaß
dich darauf, meine Ottilie bringt alles wieder in Ordnung. Ich will
jetzt zu ihr gehen.
Rudolf: Ich werde hier warten
auf dich.
Arthur: Sehr wohl. (Ab.)
Dritte Scene.
Rudolf erst allein, dann Sergeant.
Rudolf: (Am
Fenster stehend, sieht hinaus auf die Berge und singt für sich
halblaut.)
Nimm das Leben leicht,
Nimm das Leben leicht;
Nimm es leicht,
Nimm es leicht!
Tra—la—ra'—la—ra.
Tra—la'—la.
La—l la'—la
La—la'.
(Ein Sergeant der Polizei nähert sich
ihm.)
Sergeant: Ich bedauere, Sie
stören zu müssen in Ihrem guten Humor!
Rudolf: Und Sie
wünschen?
Sergeant: Ich wünsche
nichts — ich befehle.
Rudolf: Oho —
Sergeant: — befehle
Ihnen, mir zu folgen.
Rudolf: Dazu verspüre ich durchaus keine
Lust.
Sergeant: Das glaube ich.
Leute von Ihrer Sorte folgen mir niemals gern.
Rudolf: Mann, wissen Sie wohl,
mit wem Sie reden?
Sergeant: Ja, mit einem von
der Bande, die —
Rudolf: Bande?
Sergeant: — welche nun
lange genug unsere Stadt unsicher gemacht hat.
Rudolf: Aber wissen Sie denn
nicht, daß ich ....
Sergeant: Wir wissen alles;
wir wissen, daß Sie heute Morgen bei einer Dame eingebrochen
sind, sie berauben, sie morden, und wer weiß, was sonst noch
wollten; also —
Rudolf: Wa — was —
heute Morgen — Dame — so — aber, mein lieber
Sergeant, das war ein Mißverständnis — eine
Zerstreuung — ich versichere —
Sergeant: Versichern Sie das
später lieber dem Richter — jetzt folgen Sie mir.
Rudolf: Aber ich sage Ihnen
doch, daß ich Ihnen nicht folgen werde, nicht folgen kann.
Ich — ich bin auf meiner Hochzeits-Reise — und eher
—
Sergeant: Still, Freund!
(er pfeift, worauf mehrere Polizisten
eintreten) — ergreifet ihn!
Rudolf: Was? mich? Wagt es
— ich bin auf meiner Hochzeits-Reise — (während des Tumults, der entsteht, indem die
Polizisten Rudolf ergreifen und fesseln, kommen Kellner und
Gäste von allen Seiten und zuletzt auch Luise. Als sie Rudolf
gebunden unter den Polizisten erblickt, schreit sie laut auf, eilt
auf ihn zu und umklammert ihn.)
Luise: Rudolf —! Was ist
hier geschehen?
Rudolf: Aus Verzweiflung,
daß —
Luise: Ein neues Unglück?
— O, alles kommt durch mich, durch meine Schuld — es
ist meine Schuld, meine Schuld alleine; (sie
wendet sich flehend zu den Leuten) o, helfet mir, ihr guten
Leute! (sie erblickt den Baron von Sellen, der
mit seiner
Gattin am Arme erscheint.) O, Herr Baron, helfen Sie meinem
Gatten, er ist unschuldig!
Baron von Sellen: Ist jener da
Ihr Gatte, der heute Morgen bei meiner Frau eingebroch... —
höre mal, meine liebe Elisabeth, — jetzt aber, glaube
ich, hast du einen Mißgriff gemacht: das ist ja
der Gemahl dieses jungen, allerliebsten Weibchens, das ich heute
Morgen so erschreckt habe durch — meinen Einbruch. Herr
Sergeant, meine Gattin nimmt ihre Klage zurück; nicht wahr,
Elisabeth?
Frau Baronin von Sellen: Ja,
sonst möchte jene junge Frau mir meinen Gatten verhaften
lassen — es war nur ein Irrtum, Herr Sergeant.
Arthur (erscheint mit Ottilie in Eile): Eine Depesche an
Rudolf!
Rudolf: Luise, öffne sie
doch schnell für mich.
Luise (liest
laut): »Liebe Luise! Ring ist gefunden, sende ihn dir
mit deinem Hute.
Antonie.«
Rudolf: Hurrah, der Hut kommt
nach.
Luise: Und mein Ring ist
gefunden, Ottilie! mein Ring, mein Ring!
Rudolf: Aber, Kinder, nun
bindet mich doch los, ich muß doch meine Frau umarmen! So
—
(singend):
Nimm das Le'ben leicht,
Nimm das Le'ben leicht;
Nimm es lei'cht, —
Nimm es
lei'cht!
Tra—la—ra'—la—ra—
Tra—la'—la
Tra—l'la'—la
La—la'.
Nun aber, Luischen, beginnen wir unsere Hochzeits-Reise!
Die Gäste alle: Viel
Vergnügen und Glück auf den Weg!
Alle: Bravo, bravo!
Dr. Albert: Otto und Louis, meine
Brüder, reicht mir Eure Hände. Ich gratuliere Euch und
auch mir selbst. —
Alle: Und wir alle gratulieren
herzlich.
Herr Meister: Das ist
vorzüglich, vorzüglich, — ah!
Bella: Und ich überreiche
Ihnen, Herr Otto, einen Lorbeer-Kranz.
Martha Parks: Und ich Dir,
mein lieber Bruder Louis!
Otto: Meine teuren Freunde.
Obwohl wir, Bruder Louis und ich, uns Mühe gegeben haben,
dieses kleine Spiel recht gut zu machen, so wissen wir doch,
daß wir diese enthusiastische Aufnahme Ihrer Freundschaft
schulden. Wir fühlen es und wissen es wohl zu schätzen
und danken Ihnen mit unserm ganzen Herzen. Und ich bin sicher, wir handeln ganz
auch im Sinne der Damen, wenn wir diese Kränze, unsern ersten
Lorbeer, mit dem Manuskripte der Komödie vereint, unserm Herrn
Meister überreichen als ein Zeichen unserer Freundschaft, als
ein Zeichen unserer Dankbarkeit und als ein Zeichen unserer hohen
Achtung. Wir bitten Sie, Herr Meister, nehmen Sie beides von uns
an.
Herr Meister: Meine Freunde,
das Herz ist mir tief gerührt, und mein Auge strömt
über von Thränen der Freude. Sie machen mich
glücklich, meine Freunde, und ich nehme, was Sie mir reichen,
als teures Andenken an die frohen Stunden, die wir zusammen verlebt
haben, und als ein Zeichen der Hoffnung für die
glückliche Zeit, welche wir noch vor uns haben. —
Frau Meister: Und sie wird
kommen, mir sagt es das Herz.
Herr Meister: Dem durfte ich
immer trauen und ihm traue ich auch jetzt. Gewiß, teure
Freunde, noch andere glückliche Tage werden folgen, und wenn
wir auch scheiden müssen, laßt uns immer denken an die
Worte des Sängers:
Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Daß man vom Liebsten, was man hat,
Muß scheiden;
Wiewohl doch nichts im Lauf der Welt
Dem Herzen ach, so sauer fällt
Als Scheiden, als Scheiden!
Nur mußt
du mich auch recht verstehn,
Ja recht verstehn,
Wenn Menschen aus einander gehn,
So sagen sie: Auf Wiedersehn,
Ja, Wiedersehn!
Alle: Auf Wiedersehn, auf
Wiedersehn!

Der
Hand-Schuh.
Vor seinem Löwen-Garten
Das Kampf-Spiel zu erwarten,
Saß König Franz,
Und um ihn die Großen der Krone,
Und rings auf hohem Balkone
Die Damen in schönem Kranz.
Und wie er winkt mit dem Finger,
Auf tut sich der weite Zwinger,
Und hinein mit bedächtigem Schritt
Ein Löwe tritt
Und sieht sich stumm
Rings um,
Mit langem Gähnen,
Und schüttelt die Mähnen
Und streckt die Glieder
Und legt sich nieder.
Und der König winkt wieder,
Da öffnet sich behend
Ein zweites Thor,
Daraus rennt
Mit wildem Sprunge
Ein Tiger hervor.
Wie der den Löwen erschaut,
Brüllt er laut,
Schlägt
mit dem Schweif
Einen furchtbaren Reif
Und recket die Zunge,
Und im Kreise scheu
Umgeht er den Leu,
Grimmig schnurrend,
Drauf streckt er sich murrend
Zur Seite nieder.
Und der König winkt wieder,
Da speit das doppelt geöffnete Haus
Zwei Leoparden auf einmal aus,
Die stürzen mit mutiger Kampf-Begier
Auf das Tiger-Tier;
Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen
Und der Leu mit Gebrüll
Richtet sich auf, da wird's still;
Und herum im Kreis,
Von Mord-Sucht heiß,
Lagern sich die greulichen Katzen.
Da fällt von des Altans Rand
Ein Hand-Schuh von schöner Hand
Zwischen den Tiger und den Leun
Mitten hinein.
Und zu Ritter Delorges, spottender
Weis'
Wendet sich Fräulein Kunigund:
»Herr Ritter, ist eure Lieb' so heiß,
Wie ihr mir's schwört zu jeder Stund,
Ei, so hebt mir den Hand-Schuh auf!«
Und der Ritter, in schnellem
Lauf,
Steigt hinab in den furchtbar'n Zwinger
Mit festem
Schritte,
Und aus der Ungeheuer Mitte
Nimmt er den Hand-Schuh mit keckem Finger.
Und mit Erstaunen und mit Grauen
Sehen's die Ritter und die Edel-Frauen,
Und gelassen bringt er den Hand-Schuh zurück.
Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde,
Aber mit zärtlichem Liebes-Blick —
Er verheißt ihm sein nahes Glück —
Empfängt ihn Fräulein Kunigunde.
Und er wirft ihr den Hand-Schuh in's Gesicht:
»Den Dank, Dame, begehr ich nicht!«
Und verläßt sie zur selben Stunde.
Die Bürgschaft.
(Damon und Phinthias.)
Zu Dionys, dem Tyrannen,
schlich
Damon, den Dolch im Gewande;
Ihn schlugen die Häscher in Bande,
»Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!«
Entgegnet ihm finster der Wüterich. —
»Die Stadt vom Tyrannen befreien!«
»Das sollst du am Kreuze bereuen.«
»Ich bin,« spricht jener,
»zu sterben bereit
Und bitte nicht um mein Leben;
Doch willst du mir Gnade geben,
Ich flehe dich um drei Tage Zeit,
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit;
Ich lasse den Freund dir als Bürgen:
Ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen.«
Da lächelt der König mit
arger List
Und spricht nach kurzem Bedenken:
»Drei Tage will ich dir schenken;
Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist,
Eh' du zurück mir gegeben bist,
So muß er statt deiner erblassen,
Doch dir ist die Strafe erlassen.«
Und er kommt zum Freunde: »Der
König gebeut,
Daß ich am Kreuz mit dem Leben
Bezahle das frevelnde Streben;
Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit,
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit;
So bleib' du dem König zum Pfande,
Bis ich komme zu lösen die Bande.«
Und schweigend umarmt ihn der treue
Freund
Und liefert sich aus dem Tyrannen;
Der andere ziehet von dannen.
Und ehe das dritte Morgen-Rot scheint,
Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint,
Eilt heim mit sorgender Seele,
Damit er die Frist nicht verfehle.
Da gießt unendlicher Regen
herab,
Von den Bergen stürzen die Quellen,
Und die Bäche, die Ströme schwellen,
Und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab,
Da reißet die Brücke der Strudel
hinab,[G-1]
Und donnernd sprengen die Wogen
Des Gewölbes krachenden Bogen.
Und trostlos irrt er an Ufers
Rand;
Wie weit er auch spähet und blicket
Und die Stimme, die rufende, schicket,
Da
stößet kein Nachen vom sichern Strand,
Der ihn setze an das gewünschte Land,
Kein Schiffer lenket die Fähre,
Und der wilde Strom wird zum Meere.
Da sinkt er ans Ufer und weint und
fleht,
Die Hände zum Zeus erhoben:
»O hemme des Stromes Toben!
Es eilen die Stunden, im Mittag steht
Die Sonne, und wenn sie niedergeht,
Und ich kann die Stadt nicht erreichen,
So muß der Freund mir erbleichen.«
Doch wachsend erneut sich des Stromes
Wut,
Und Welle auf Welle zerrinnet,
Und Stunde an Stunde entrinnet.
Da treibet die Angst ihn, da faßt er sich Mut
Und wirft sich hinein in die brausende Flut
Und teilt mit gewaltigen Armen
Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.
Und gewinnt das Ufer und eilet
fort
Und danket dem rettenden Gotte;
Da stürzet die raubende Rotte
Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort,
Den Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord
Und hemmet des Wanderers Eile
Mit drohend geschwungener Keule.
»Was wollt ihr?« ruft er,
vor Schrecken bleich,
»Ich habe nichts, als mein Leben,
Das muß ich dem Könige geben!«
Und entreißet die Keule dem nächsten gleich;
»Um des Freundes willen erbarmet euch!«
Und drei, mit gewaltigen Streichen,
Erlegt er, die andern entweichen.
Und die Sonne versendet glühenden
Brand,
Und von der unendlichen Mühe
Ermattet, sinken die Kniee.
»O, hast du mich gnädig aus Räubers-Hand,
Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land,
Und soll hier verschmachtend verderben,
Und der Freund mir, der liebende, sterben!«
Und horch! da sprudelt es
silberhell,
Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen,
Und stille hält er, zu lauschen;
Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig, schnell,
Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell,
Und freudig bückt er sich nieder
Und erfrischet die brennenden Glieder.
Und die Sonne blinkt durch der Zweige
Grün
Und malt auf den glänzenden Matten
Der Bäume gigantische Schatten;
Und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehn,
Will eilenden Laufes vorüber fliehn,
Da hört er die Worte sie sagen:
»Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen.«
Und die Angst beflügelt den
eilenden Fuß,
Ihn jagen der Sorge Qualen,
Da schimmern in Abend-Rots Strahlen
Von ferne die Zinnen von Syrakus,
Und entgegen kommt ihm Philostratus,
Des Hauses redlicher Hüter,
Der erkennet entsetzt den Gebieter:
»Zurück! du rettest den
Freund nicht mehr,
So rette das eigene Leben!
Den Tod erleidet er eben.
Von Stunde zu
Stunde gewartet' er
Mit hoffender Seele der Wiederkehr,
Ihn konnte den mutigen Glauben
Der Hohn des Tyrannen nicht rauben.« —
»Und ist es zu spät, und
kann ich ihm nicht,
Ein Retter, willkommen erscheinen,
So soll mich der Tod ihm vereinen.
Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht,
Daß der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht,
Er schlachte der Opfer zweie
Und glaube an Liebe und Treue!«[G-2]
Und die Sonne geht unter, da steht er
am Thor
Und sieht das Kreuz schon erhöhet,
Das die Menge gaffend umstehet;
An dem Seile schon zieht man den Freund empor,
Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor:
»Mich, Henker!« ruft er, »erwürget!
Da bin ich, für den er gebürget!«
Und Erstaunen ergreifet das Volk
umher,
In den Armen liegen sich beide
Und weinen vor Schmerzen und Freude.
Da sieht man kein Auge thränenleer,
Und zum Könige bringt man die Wunder-Mär';
Der fühlt ein menschliches Rühren,
Läßt schnell vor den Thron sie führen.
Und blicket sie lange verwundert
an.
Drauf spricht er: »Es ist euch gelungen,
Ihr habt das Herz mir bezwungen;
Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn;
So nehmet auch mich zum Genossen an!
Ich sei, gewährt mir die Bitte,
In eurem Bunde der dritte.«
Ritter
Toggenburg.
»Ritter, treue
Schwester-Liebe
Widmet euch dies Herz;
Fordert keine andre Liebe,
Denn es macht mir Schmerz.
Ruhig mag ich euch erscheinen,
Ruhig gehen sehn.
Eurer Augen stilles Weinen
Kann ich nicht verstehn.«
Und er hört's mit stummem
Harme,
Reißt sich blutend los,
Preßt sie heftig in die Arme,
Schwingt sich auf sein Roß,
Schickt zu seinen Mannen allen
In dem Lande Schweiz;
Nach dem heil'gen Grab sie wallen,
Auf der Brust das Kreuz.
Große Taten dort geschehen
Durch der Helden Arm;
Ihres Helmes Büsche wehen
In der Feinde Schwarm;
Und des Toggenburgers Name
Schreckt den Muselmann;
Doch das Herz von seinem Grame
Nicht genesen kann.
Und ein Jahr hat er's getragen,
Trägt's nicht länger mehr;
Ruhe kann er nicht erjagen
Und verläßt das Heer;
Sieht ein
Schiff an Joppe's Strande,
Das die Segel bläht,
Schiffet heim zum teuren Lande,
Wo ihr Atem weht.
Und an ihres Schlosses Pforte
Klopft der Pilger an;
Ach, und mit dem Donnerworte
Wird sie aufgetan:
»Die ihr suchet, trägt den Schleier,
Ist des Himmels Braut,
Gestern war des Tages Feier,
Der sie Gott getraut.«
Da verlässet er auf immer
Seiner Väter Schloß,
Seine Waffen sieht er nimmer,
Noch sein treues Roß,
Von der Toggenburg hernieder
Steigt er unbekannt,
Denn es deckt die edeln Glieder
Härenes Gewand.
Und erbaut sich eine Hütte
Jener Gegend nah,
Wo das Kloster aus der Mitte
Düstrer Linden sah;
Harrend von des Morgens Lichte
Bis zu Abends Schein,
Stille Hoffnung im Gesichte,
Saß er da allein.
Blickte nach dem Kloster
drüben,
Blickte stundenlang
Nach dem Fenster seiner Lieben,
Bis das Fenster klang,
Bis die
Liebliche sich zeigte,
Bis das teure Bild
Sich in's Tal[G-3] herunter
neigte,
Ruhig, engelmild.
Und dann legt' er froh sich
nieder,
Schlief getröstet ein,
Still sich freuend, wenn es wieder
Morgen würde sein.
Und so saß er viele Tage,
Saß viel Jahre lang,
Harrend ohne Schmerz und Klage,
Bis das Fenster klang.[G-4]
Bis die Liebliche sich zeigte,
Bis das teure Bild
Sich in's Tal[G-5] herunter
neigte.
Ruhig, engelmild.
Und so saß er, eine Leiche,
Eines Morgens da;
Nach dem Fenster noch das bleiche
Stille Antlitz sah.
Der Alpenjäger.
Willst du nicht das Lämmlein
hüten?
Lämmlein ist so fromm und sanft,
Nährt sich von des Grases Blüten,
Spielend an des Baches Ranft.
»Mutter, Mutter, laß mich gehen,
Jagen nach des Berges Höhen!«
Willst du nicht die Herde locken
Mit des Hornes munterm Klang?
Lieblich tönt der Schall der Glocken
In des Waldes Lust-Gesang.
»Mutter, Mutter, laß mich gehen,
Schweifen auf den wilden Höhen!«
Willst du nicht der Blümlein
warten,
Die im Beete freundlich stehn?
Draußen ladet dich kein Garten;
Wild ist's auf den wilden Höhn!
»Laß die Blümlein, laß sie
blühen!
Mutter, Mutter, laß mich ziehen!«
Und der Knabe ging zu jagen,
Und es treibt und reißt ihn fort,
Rastlos fort mit blindem Wagen
An des Berges finstern Ort;
Vor ihm her mit Windes-Schnelle
Flieht die zitternde Gazelle.
Auf der Felsen nackten Rippen
Klettert sie mit leichtem Schwung,
Durch den Riß gespaltner Klippen
Trägt sie der gewagte Sprung;
Aber hinter ihr verwogen
Folgt er mit dem Todes-Bogen.
Jetzo auf den schroffen Zinken
Hängt sie, auf dem höchsten Grat,
Wo die Felsen jäh versinken
Und verschwunden ist der Pfad.
Unter sich die steile Höhe,
Hinter sich des Feindes Nähe.
Mit des Jammers stummen Blicken
Fleht sie zu dem harten Mann,
Fleht umsonst, denn loszudrücken
Legt er schon den Bogen an;
Plötzlich aus der Felsen-Spalte
Tritt der Geist, der Berges-Alte.
Und mit seinen
Götter-Händen
Schützt er das gequälte Tier
»Mußt du Tod und Jammer senden,«
Ruft er, »bis herauf zu mir?
Raum für alle hat die Erde;
Was verfolgst du meine Herde?«
Gefunden.
Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen
Das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt es brechen,
Da sagt es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Ich grub's mit allen
Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus.
Und pflanzt' es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.
Erl-König.
Wer reitet so spät durch Nacht und
Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein
Gesicht? —
Siehst, Vater, du den Erl-König nicht?
Den Erlen-König mit Kron' und Schweif? —
Mein Sohn, es ist ein Nebel-Streif. —
»Du liebes Kind, komm, geh mit
mir!
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir;
Manch' bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch' gülden Gewand.«
Mein Vater, mein Vater, und hörest
du nicht,
Was Erlen-König mir leise verspricht? —
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind.
—
»Willst, feiner Knabe, du mit mir
gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reih'n
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.«
Mein Vater, mein Vater, und siehst du
nicht dort
Erl-Königs Töchter am düstern Ort? —
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau;
Es scheinen die alten Weiden so grau. —
»Ich liebe dich, mich reizt deine
schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.« —
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erl-König hat mir ein Leid's getan! —
Dem Vater grauset's, er reitet
geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Müh' und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.
Der Fischer.
Das Wasser rauscht', das Wasser
schwoll,
Ein Fischer saß daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Teilt sich die Flut empor;
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.
Sie sang zu ihm, sie sprach zu
ihm:
Was lockst du meine Brut
Mit Menschen-Witz und Menschen-List
Hinauf in Todes-Glut?
Ach
wüßtest du, wie's Fischlein ist
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund.
Labt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schöner her?
Lockt dich der tiefe Himmel nicht,
Das feuchtverklärte Blau?
Lockt dich dein eigen Angesicht
Nicht her in ew'gen Tau.
Das Wasser rauscht', das Wasser
schwoll,
Netzt' ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll,
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn geschehn:
Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Und ward nicht mehr gesehn.
Die wandelnde Glocke.
Es war ein Kind, das wollte nie
Zur Kirche sich bequemen,
Und Sonntags fand es stets ein Wie,
Den Weg ins Feld zu nehmen.
Die Mutter sprach: die Glocke
tönt,
Und so ist dir's befohlen,
Und hast du dich nicht hingewöhnt,
Sie kommt und wird dich holen.
Das Kind, es denkt: die Glocke
hängt
Da droben auf dem Stuhle.
Schon hat's den Weg in's Feld gelenkt,
Als lief' es aus der Schule.
Die Glocke Glocke tönt nicht
mehr,
Die Mutter hat gefackelt.
Doch welch ein Schrecken hinterher!
Die Glocke kommt gewackelt.
Sie wackelt schnell, man glaubt es
kaum;
Das arme Kind im Schrecken,
Es läuft, es kommt, als wie im Traum;
Die Glocke wird es decken.
Doch nimmt es richtig seinen
Husch,
Und mit gewandter Schnelle
Eilt es durch Anger, Feld und Busch
Zur Kirche, zur Kapelle.
Und jeden Sonn- und Feier-Tag
Gedenkt es an den Schaden,
Läßt durch den ersten Glocken-Schlag,
Nicht in Person sich laden.
Der Kaiser und der Abt.
Ich will euch erzählen ein
Märchen, gar schnurrig:
Es war 'mal ein Kaiser; der Kaiser war kurrig.
Auch war 'mal ein Abt, ein gar stattlicher Herr;
Nur schade! sein Schäfer war klüger, als er.
Dem Kaiser ward's sauer in Hitz' und in
Kälte:
Oft schlief er bepanzert im Krieges-Gezelte;
Oft hatt' er kaum Wasser zu Schwarz-Brot und Wurst;
Und öfter noch litt er gar Hunger und Durst.
Das Pfäfflein, das wußte
sich besser zu hegen,
Und weidlich am Tisch und im Bette zu pflegen;
Wie Vollmond glänzte sein feistes Gesicht.
Drei Männer umspannten den Schmerbauch ihm nicht.
Drob suchte der Kaiser am
Pfäfflein oft Hader
Einst ritt er, mit reisigem Krieges-Geschwader,
In brennender Hitze des Sommers vorbei.
Das Pfäfflein spazierte vor seiner Abtei.
»Ha,« dachte der Kaiser,
»zur glücklichen Stunde!«
Und grüßte das Pfäfflein mit höhnischem
Munde;
»Knecht Gottes, wie geht's dir? Mir däucht wohl ganz
recht,
Das Beten und Fasten bekommen nicht schlecht.
Doch däucht mir daneben, euch
plage viel Weile.
Ihr dankt mir's wohl, wenn ich euch Arbeit erteile.
Man rühmet, ihr wäret der pfiffigste Mann,
Ihr höret das Gräschen fast wachsen, sagt man.
So geb' ich denn euern zwei
tüchtigen Backen
Zur Kurzweil drei artige Nüsse zu knacken.
Drei Monden von nun an bestimm' ich zur Zeit.
Dann will ich auf diese drei Fragen Bescheid.
Zum ersten: Wann hoch ich im
fürstlichen Rate,
Zu Throne mich zeige im Kaiser-Ornate,
Dann sollt ihr mir sagen, ein treuer Wardein,
Wie viel ich wohl wert bis zum Heller mag sein?
Zum zweiten sollt ihr mir berechnen und
sagen:
Wie bald ich zu Rosse die Welt mag umjagen?
Um keine Minute zu wenig und viel!
Ich weiß, der Bescheid darauf ist euch nur Spiel.
Zum dritten noch sollst du, o Preis der
Prälaten,
Auf's Härchen mir meine Gedanken erraten.
Die will ich dann treulich bekennen; allein
Es soll auch kein Titelchen Wahres dran sein.
Und könnt ihr mir diese drei
Fragen nicht lösen,
So seid ihr die längste Zeit Abt hier gewesen;
So lass' ich euch führen zu Esel durch's Land,
Verkehrt, statt des Zaumes den Schwanz in der Hand.«
—
Drauf trabte der Kaiser mit Lachen von
hinnen.
Das Pfäfflein zerriß und zerspliß sich mit
Sinnen.
Kein armer Verbrecher fühlt mehr Schwulität,
Der vor hochnotpeinlichem Hals-Gericht steht.
Er schickte nach ein, zwei, drei, vier
Un'vers'täten,
Er fragte bei ein, zwei, drei, vier Fakultäten,
Er zahlte Gebühren und Sporteln vollauf;
Doch löste kein Doktor die Fragen ihm auf.
Schnell wuchsen, bei herzlichem Zagen
und Pochen,
Die Stunden zu Tage, die Tagen zu Wochen,
Die Wochen zu Monden, schon kam der Termin!
Ihm ward's vor den Augen bald gelb und bald grün.
Nun sucht' er, ein bleicher
hohlwangiger Werther,
In Wäldern und Feldern die einsamsten Örter,
Da traf ihn, auf selten betretener Bahn,
Hans Bendix, sein Schäfer, am Felsen-Hang an.
»Herr Abt,« sprach Hans
Bendix, »was mögt ihr euch grämen?
Ihr schwindet ja wahrlich dahin, wie ein Schemen.
Maria und Joseph! wie hotzelt ihr ein!
Mein Sixchen! es muß euch was angetan sein.«
»Ach, guter Hans Bendix, so
muß sich's wohl schicken.
Der Kaiser will gern mir am Zeuge was flicken,
Und hat mir drei Nüss' auf die Zähne gepackt,
Die schwerlich Beelzebub selber wohl knackt.
Zum ersten: Wann hoch er, im
fürstlichen Rate,
Zu Throne sich zeiget im Kaiser-Ornate,
Dann soll ich ihm sagen, ein treuer Wardein,
Wie viel er wohl wert bis zum Heller mag sein?
Zum zweiten soll ich ihm berechnen und
sagen:
Wie bald er zu Rosse die Welt mag umjagen?
Und keine Minute zu wenig und viel!
Er meint, der Bescheid darauf wäre nur Spiel.
Zum dritten, ich ärmster von allen
Prälaten,
Soll ich ihm gar seine Gedanken erraten;
Die will er mir treulich bekennen; allein
Es soll auch kein Titelchen Wahres dran sein.
Und kann ich ihm diese drei Fragen
nicht lösen,
So bin ich die längste Zeit Abt hier gewesen;
So läßt er mich führen zu Esel durch's Land,
Verkehrt, statt des Zaumes den Schwanz in der Hand.«
—
»Nichts weiter?« erwidert
Hans Bendix mit Lachen,
»Herr, gebt euch zufrieden! das will ich schon machen.
Nur borgt mir eur Käppchen, eur Kreuzchen und Kleid;
So will ich schon geben den rechten Bescheid.
Versteh' ich gleich nichts von
lateinischen Brocken,
So weiß ich den Hund doch vom Ofen zu locken.
Was ihr euch, Gelehrte, für Geld nicht erwerbt,
Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt.«
Da sprang, wie ein Böcklein, der
Abt vor Behagen.
Mit Käppchen und Kreuzchen, mit Mantel und Kragen
Ward stattlich Hans Bendix zum Abte geschmückt,
Und hurtig zum Kaiser nach Hofe geschickt.
Hier thronte der Kaiser im
fürstlichen Rate,
Hoch prangt' er, mit Scepter und Kron', im Ornate:
»Nun sagt mir, Herr Abt, als ein treuer Wardein,
Wie viel ich itzt wert bis zum Heller mag sein?«
—
»Für dreißig
Reichsgulden ward Christus verschachert;
Drum gab' ich, so sehr Ihr auch pochet und prachert,
Für Euch keinen Deut mehr, als zwanzig und neun,
Denn einen müßt Ihr doch wohl minder wert sein.«
—
»Hum!« sagte der Kaiser,
»der Grund läßt sich hören,
Und mag den durchlauchtigen Stolz wohl bekehren.
Nie hätt' ich, bei meiner hochfürstlichen Ehr'!
Geglaubet, daß so spottwohlfeil ich wär'.
Nun aber sollst du mir berechnen und
sagen:
Wie bald ich zu Rosse die Welt mag umjagen?
Um keine Minute zu wenig und viel!
Ist dir der Bescheid darauf auch nur ein Spiel?«
—
»Herr, wenn mit der Sonn' Ihr
früh sattelt und reitet,
Und stets sie in einerlei Tempo begleitet,
So setz' ich mein Kreuz und mein Käppchen daran,
In zweimal zwölf Stunden ist alles getan.«
—
»Ha,« lachte der Kaiser,
»vortrefflicher Haber!
Ihr füttert die Pferde mit Wenn und
mit Aber.
Der Mann,[G-6]
der das Wenn und das Aber erdacht,[G-7]
Hat sicher aus Häckerling Gold schon gemacht.
Nun aber zum dritten, nun nimm dich
zusammen:
Sonst muß ich dich dennoch zum Esel verdammen.
Was denk' ich, das falsch ist? Das bringe heraus!
Nur bleib' mir mit Wenn und mit
Aber zu Haus!« —
»Ihr denket, ich sei der Herr Abt
von St. Gallen.« —
»Ganz recht! Und das kann von der Wahrheit nicht
fallen.« —
»Sein Diener, Herr Kaiser! Euch trüget euer Sinn:
Denn wißt, daß ich Bendix, sein Schäfer, nur
bin!« —
»Was Henker! Du bist nicht der
Abt von St. Gallen?«
Rief hurtig, als wär er vom Himmel gefallen,
Der Kaiser mit frohem Erstaunen darein;
»Wohlan denn, so sollst du von nun an es sein!
Ich will dich belehnen mit Ring und mit
Stabe.
Dein Vorfahr besteige den Esel und trabe!
Und lerne fortan erst quid Juris
verstehn!
Denn wenn man will ernten, so muß man auch sä'n.«
—
»Mit Gunsten, Herr Kaiser! Das
laßt nur hübsch bleiben!
Ich kann ja nicht lesen, noch rechnen und schreiben;
Auch weiß ich kein sterbendes Wörtchen Latein.
Was Hänschen versäumt, holt Hans nicht mehr ein.«
—
»Ach, guter Hans Bendix, das ist
ja recht schade!
Erbitte demnach dir ein' andere Gnade!
Sehr hat mich ergetzet dein lustiger Schwank;
Drum soll dich auch wieder ergetzen mein Dank.«
—
»Herr Kaiser, groß hab' ich
so eben nichts nötig;
Doch seid ihr im Ernst mir zu Gnaden erbötig,
So will ich mir bitten, zum ehrlichen Lohn,
Für meinen hochwürdigen Herren Pardon.«
—
»Ha bravo! Du trägst, wie
ich merke, Geselle,
Das Herz, wie den Kopf, auf der richtigen Stelle.
Drum sei der Pardon ihm in Gnaden gewährt,
Und obenein dir ein Panis-Brief beschert:«
»Wir lassen dem Abt von St.
Gallen entbieten:
Hans Bendix soll ihm nicht die Schafe mehr hüten.
Der Abt soll sein pflegen, nach unserm Gebot,
Umsonst, bis an seinen sanftseligen Tod.« —
Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute.
Klinge, kleines Frühlings-Lied,
Kling' hinaus in's Weite.
Kling' hinaus bis an das Haus,
Wo die Blumen sprießen.
Wenn du eine Rose schaust,
Sag', ich laß sie grüßen.
Das Gewitter.
Urahne, Groß-Mutter, Mutter und
Kind
In dumpfer Stube beisammen sind;
Es spielet das Kind, die Mutter sich schmückt.
Groß-Mutter spinnet, Urahne gebückt
Sitzt hinter dem Ofen im Pfühl —
Wie wehen die Lüfte so schwül!
Das Kind spricht: »Morgen ist's
Feier-Tag,
Wie will ich spielen im grünen Hag,
Wie will ich springen durch Tal[G-9] und
Höh'n,
Wie will ich pflücken viel Blumen schön!
Dem Anger, dem bin ich hold!« —
Hört ihr's, wie der Donner grollt?
Die Mutter spricht: »Morgen ist's
Feier-Tag,
Da halten wir alle fröhlich Gelag,
Ich selber, ich rüste mein Feier-Kleid;
Das Leben, es hat auch Lust nach Leid,
Dann scheint die Sonne wie Gold!« —
Hört ihr's, wie der Donner grollt?
Groß-Mutter spricht:
»Morgen ist's Feier-Tag,
Groß-Mutter hat keinen Feier-Tag,
Sie kochet das Mahl, sie spinnet das Kleid,
Das Leben ist Sorg' und viel Arbeit;
Wohl dem, der tat, was er sollt'!« —
Hört ihr's, wie der Donner grollt?
Urahne spricht: »Morgen ist
Feier-Tag,
Am liebsten morgen ich sterben mag;
Ich kann nicht singen und scherzen mehr,
Ich kann nicht sorgen und schaffen schwer,
Was thu' ich noch auf der Welt?« —
Seht ihr, wie der Blitz dort fällt?
Sie hören's nicht, sie sehen's
nicht,
Es flammet die Stube wie lauter Licht,
Urahne, Groß-Mutter, Mutter und Kind
Vom Strahl mit einander getroffen sind;
Vier Leben endet ein Schlag —
Und morgen ist's Feier-Tag.
Lieber Sterne ohne Strahlen,
Als Strahlen ohne Sterne —
Lieber Kerne ohne Schalen,
Als Schalen ohne Kerne —
Geld lieber ohne Taschen,
Als Taschen ohne Geld —
Wein lieber ohne Flaschen,
Als umgekehrt bestellt!
Krambambuli.
(Zur 3. Sektion.)
Geb. von Crescentius Koromandel, d.i. Hof-Rat Wittekind in Danzig. (1745.)
[Text]
[Listen]
[Finale]

Wenn die Schwalben heimwärts ziehn.
Abschied.
(Zur 7. Sektion.)
Carl Herloßsohn. (1842.)
[Text]
[Listen]
[Finale]

Es ist bestimmt in Gottes Rat.
(Zur 8. Sektion.)
Ernst von Feuchtersleben. (Vor 1826.)
[Text]
[Listen]
[Finale]

Noten.
Noten zur ersten Sektion. |
|
Seite |
| 1. |
kräftig; |
stark. |
|
stärkt; |
macht uns stark. |
| 2. |
Anfang, der; |
der Beginn. |
|
Mut,
der; |
die Courage. |
|
faßt tiefe
Wurzeln; |
die Sprache geht fest in uns ein, wie die unteren Enden des
Baumes in die Erde. |
|
wächst; |
er wird groß. |
|
wirklich? |
ist das so? |
| 3. |
Augenblick, der; |
der Moment. |
|
unerwartetes
Glück; |
ein Glück, das ich nicht erhoffen konnte, groß. |
|
Neuigkeit, die; |
etwas Neues. |
|
erraten; |
finden. |
| 4. |
fechten; |
kämpfen mit dem Schwerte. |
|
Schnurrbart, der; |
der Bart unter der Nase. |
| 5. |
grausam; |
Sie haben ein hartes Herz. |
|
verzeihe; |
vergebe. |
|
Gesundheit, die; |
Substantiv von gesund = wohl. |
| 6. |
Besuch, der; |
die Visite. |
|
gebraucht; |
haben müssen. |
|
versichern; |
sagen. |
|
Lands-Leute, die; |
Leute aus unserm Lande, aus Amerika. |
|
liebenswürdig; |
freundlich und gut. |
|
jugendliche Kraft, die; |
Kraft, wie sie junge Leute haben. |
|
Locken, die; |
die langen, schönen Haare seines Kopfes. |
|
regiert; |
kommandiert. |
|
gebietet; |
kommandiert. |
|
Fluten, die; |
das Wasser des Rheines. |
|
erhebt sich; |
das Land wird hoch auf beiden Seiten. |
|
ragen; |
die Türme reichen über die Häuser. |
|
strahlt; |
scheint. |
| 7. |
Wolken, die; |
das Wasser, das verdunstet und in die Atmosphäre steigt,
wo es sich wieder sammelt. |
|
verschiedenen; |
anderen, ungleichen. |
|
wallet; |
geht, fließt. |
|
friedlich; |
still. |
|
Frieden, der; |
die Ruhe, die Rast. |
|
Fläche, die; |
die obere Seite des Wassers war glatt, wie ein Spiegel, ein
Glas. |
|
blinkt; |
glitzert. |
|
Farben, die; |
das Wasser schien grün, gelb, blau, etc. |
|
würzig; |
süß. |
|
sauge; |
trinke. |
|
erquickt; |
erfrischt. |
|
schnellen Schrittes; |
schnell gehend. |
|
Tafel, die; |
der Tisch. |
|
bietet; |
offeriert. |
|
Speise, die; |
das Essen. |
|
ich labe mich; |
ich esse, trinke und bin froh. |
|
aufblickend; |
wenn ich vom Tische aufsehe. |
|
Dörfer, die; |
kleine Plätze auf dem Lande, wenige Häuser. |
|
Felsen, der; |
ein hoher, harter Stein. |
|
stolz; |
majestätisch. |
|
brausten; |
rauschten, lärmten. |
|
gestemmt; |
gestellt. |
| 8. |
Haupt, das; |
der Kopf. |
|
gezwungen; |
er war ihr Herr geworden. |
|
übermütig; |
sorglos und wild. |
| 9. |
Verein, der; |
der Klub. |
|
bilden; |
machen, beginnen. |
|
ordnen; |
arrangieren, tun. |
|
nötig; |
was sein muß. |
| 10. |
steigt; |
kommt. |
|
zerfließen; |
schmelzen, zu Wasser werden. |
|
sprießt; |
aus der Erde kommt. |
|
Tal[N-1], das; |
zwischen zwei Bergen ist das Tal[N-2]. |
|
Winter-Qual, die; |
alles das, was nicht angenehm ist im Winter. |
|
schallt; |
kommt ein Ton. |
|
Gletscher, der; |
Eis-Berg in den Alpen. |
|
leckt; |
wenn die Sonne auf die Gletscher scheint. |
|
Luft-Getön, das; |
das Singen der Vögel, etc. |
|
lind und lau; |
mild und warm. |
|
Au,
die; |
ein schöner Platz mit Gras bedeckt. |
| 11. |
unterhalten; |
gut sprechen, so daß alle sich freuen. |
|
Zügel, der; |
der Zügel ist von Leder, er ist im Munde des Pferdes und
in der Hand des Reiters. |
|
bäumt sich; |
stellt sich auf die Hinter-Füße. |
|
drückt; |
preßt. |
|
lenkt; |
leitet. |
|
nimm dich in Acht; |
sieh', daß du nicht fällst. |
| 12. |
übel behandelt; |
mir hat er böses getan. |
|
verhöhnt; |
insultiert. |
|
geblendet; |
blind gemacht. |
|
fordern Recht; |
wollen Recht haben. |
|
klagen; |
traurig sprechen. |
| 13. |
wider; |
gegen. |
|
will
wenig bedeuten; |
ist nichts. |
|
Wimmern, das; |
lautes Weinen. |
|
Gebüsch, das; |
der Busch, die Büsche. |
|
zauset; |
zieht Lampe bei den Ohren hin und her. |
|
schlau; |
klug, genial. |
|
wagen; |
tun. |
|
Beute, die; |
alles, was sie stehlen und rauben. |
|
Oheim, der; |
der Onkel. |
| 14. |
hämisch; |
ironisch. |
|
Fuhrmann, der; |
der Mann bei dem Wagen. |
|
fraß; |
aß.Ich esse, ich aß, ich habe gegessen. |
|
Gräten, die; |
Skelett des Fisches. |
|
handelt; |
tut. |
| 15. |
verlor; |
ich verliere, ich verlor, ich habe verloren. |
|
Gras und Kräuter; |
Pflanzen. |
|
gekleidet; |
bedeckt mit dem Mantel eines Mönches. |
| 16. |
streiten; |
kämpfen, zanken. |
|
Hof,
der; |
der Raum um ein Haus auf dem Lande. |
|
dichten; |
dicken. |
|
erwürgt; |
ermordet, getötet. |
|
unmutig; |
unzufrieden. |
|
bestatten; |
legen. |
|
scharren; |
graben, kratzen. |
| 17. |
fördern; |
Frieden machen, Recht machen. |
|
so kam man denn
überein; |
alle sagten. |
|
auffordern; |
ihm sagen sollten. |
|
strafen; |
ihm böses tun. |
|
stattlich; |
groß und schön. |
|
heimliche Gänge; |
Wege unter der Erde. |
|
entschlüpfen; |
fliehen. |
|
Geselle, der; |
der Kamerad. |
|
Thor,
das; |
die große Thür. |
| 18. |
erhitzt; |
heiß, sehr warm. |
|
Staub, der; |
feine Erde, Schmutz, wie im Sommer bei trockenem Wetter. |
|
beschwerliche; |
schwere. |
|
ärmlich; |
nicht reich und nicht gut. |
|
erfreut; |
froh. |
|
Keil,
der; |
ein Instrument, um den Baum zu spalten; an dem einen Ende
spitz, an dem andern stumpf; der Keil wird in den Baum getrieben
mit dem stumpfen Ende der Axt. |
|
gar; |
sehr. |
| 19. |
zugleich; |
zur selben Zeit. |
|
zog; |
ich ziehe, ich zog, ich habe gezogen. |
|
es gelang ihm; |
er konnte. |
|
Mühe, die; |
die Arbeit. |
|
entfernen; |
herausbringen. |
|
Geschrei, das; |
das Heulen. |
|
eilends; |
schnell. |
|
Besen, der; |
Instrument, mit dem man das Zimmer reinigt. |
|
Verzweiflung, die; |
die Desperation. |
|
Haut,
die; |
die Haut des Bären ist mit Haaren bedeckt. |
|
entkommen; |
rennen. |
|
Elend, das; |
das Unglück. |
| 20. |
entsetzt; |
voll Furcht, Schrecken und Trauer. |
|
issest; |
ich esse; du issest, etc. |
|
speisen; |
essen. |
| 21. |
Menge, die; |
viele. |
|
Scheune, die; |
der Land-Mann hat Stroh und[N-3] Heu in der
Scheune. |
|
erzürnt; |
böse. |
|
Prediger, der; |
der Pastor. |
|
Loch,
das; |
die Öffnung. |
|
mausest; |
Mäuse fängst. |
|
einäugig; |
mit einem Auge. |
| 22. |
entbrannte in gewaltigem
Zorne; |
wurde sehr böse. |
|
Frevler, der; |
böser, böser Charakter. |
|
verdient den Tod; |
soll sterben. |
|
ähnlich; |
waren wie der Vater. |
|
versetzte; |
antwortete. |
| 23. |
zärtlich; |
liebevoll. |
|
Abschied, der; |
sagte Adieu. |
|
achte; |
siehe gut. |
|
artig; |
gut. |
|
Zorn,
der; |
der böse Wille. |
|
Bote,
der; |
der Diener, den der König gesandt hatte. |
|
bekenne; |
sage. |
|
gelobe; |
versprich. |
| 24. |
haschen; |
schnappen, fangen. |
|
hassen; |
nicht lieben. |
|
schwätzest; |
sprichst. |
| 25. |
gefräßig; |
der Bär frißt (ißt) gerne zu viel. |
|
auftraten; |
sprachen. |
|
galt; |
war. |
|
fällte das Urteil; |
sprach das Recht. |
|
betrübt; |
traurig. |
|
finster; |
ernst. |
|
weiches; |
gutes. |
|
bekennen; |
sagen. |
| 26. |
Schatz, der; |
viele[N-4] Gold,
Diamanten, etc. |
|
Kette, die; |
die Taschen-Uhr hängt an einer Kette; Damen tragen goldene
Ketten um den Hals. |
|
nützt; |
wozu ist es mir gut? |
| 27. |
Ort,
der; |
der Platz. |
|
Blitz, der; |
der Blitz zuckt im zickzack vor dem Donner. |
|
versteckt; |
stand hinter einem Busche. |
|
starrte; |
sah. |
|
rührte; |
bewegte. |
|
Arge,
der; |
der Böse. |
| 28. |
gerade; |
direkt. |
|
öfters; |
oft. |
|
Versammlung, die; |
viele Personen zusammen. |
|
Truppen, die; |
die Soldaten. |
|
Sold[N-5], der; |
das Geld. |
|
voraus; |
zuvor. |
|
ausführen; |
realisieren. |
|
führt; |
bringt. |
|
Gefängnis, das; |
ein Haus in welchem man die Diebe und Mörder
festhält. |
| 29. |
Wüste, die; |
Sahara ist eine Wüste; Prairie, Heide. |
|
einsamen; |
stillen. |
|
haust; |
ist, wohnt. |
|
Birke, die; |
der Name eines Baumes. |
|
Bann,
der; |
hat mich verdammt. |
|
gelobt; |
gesagt. |
| 30. |
jauchzte; |
freute sich. |
|
prachtvolles; |
sehr schönes. |
Noten zur zweiten Sektion. |
| 32. |
Darf; |
kann ich kommen. |
|
störe; |
hindere. |
|
stürmt; |
wild, hastig kommt. |
|
Treppe, die; |
ist vor dem Hause; sie ist hoch und hat Stufen; man geht von
der Straße auf die Haus-Treppe in das Haus; siehe
»Studien und Plaudereien, I.« Seite 163. |
|
vorzustellen; |
zu introduzieren; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 159. |
|
Herrschaften, die; |
Damen u. Herren. |
|
Grüße; |
Der Gruß; das Kompliment, gute Wünsche. |
|
Bekannten, die; |
Personen, die ich kenne. |
|
heimisch; |
wie zu Hause. |
| 33. |
Fahrt, die; |
die Reise auf dem Schiffe zur See. |
|
verflossen; |
vergangen, vorüber. |
|
verließen; |
ich verlasse, ich verließ, ich habe verlassen. |
| 34. |
erstanden; |
gekommen. |
|
Sage,
die; |
die Legende; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 54. |
|
schlummernd; |
halb schlafend, halb wachend. |
|
gestützt; |
gehalten. |
|
wallt nieder; |
geht tief. |
|
Zwerg, der; |
ein sehr kleiner Mann. |
|
seufzt; |
er giebt einen traurigen Ton von sich. |
|
emporgestiegen; |
heraufgekommen. |
|
unterirdisch; |
unter der Erde. |
|
Reich, das; |
die Nation, das Land. |
| 35. |
vollbracht; |
getan, vollendet. Ich vollbringe, ich vollbrachte, ich habe
vollbracht. |
|
staunenswert; |
wunderbar. |
|
ringsum; |
auf allen Seiten. |
|
Vernichten, das; |
Töten, zu nichts machen. |
|
lauern; |
warten. |
|
mürrisch; |
unzufrieden. |
|
gemeinschaftlich; |
zusammen. |
|
verkannt; |
nicht recht erkannt. |
|
steilen; |
hohen. |
|
planend; |
Pläne machend. |
|
übermenschlich; |
mehr, als ein Mensch kann. |
|
schaffend; |
arbeitend. |
| 36. |
unternahm; |
begann. |
|
gewaltige; |
große. |
|
zerstückt; |
in Stücken, in kleinen Teilen. |
|
Spott, der; |
der Sarkasmus. |
|
ehemals; |
bevor. |
|
Geist, der; |
Intellekt. |
|
Nachahmung, die; |
die Imitation. |
|
Schmetterling, der; |
ein Insekt, farbig, das von Blume zu Blume fliegt. |
| 37. |
Verderben, das; |
der Tod. |
|
geschützt; |
sicher. |
|
Boden, der; |
der Grund, die Erde; u. siehe »Studien Plaudereien,
I.« Seite 202. |
|
Fluren, die; |
die Felder; siehe »Studien u. Plaudereien, I.« Seite 87. |
|
Kriegs-Rosse, die;[N-6] |
Das Kriegs-Roß; das Kriegs-Pferd. |
|
Horden, die; |
die Soldaten. |
|
erbarmte; |
half. |
|
Tugend, die; |
guter Charakter. |
|
Raub-Vogel, der; |
Raub-Vogel; wilder Vogel. |
| 38. |
plünderten; |
raubten. |
|
Wissenschaft,[N-7]
die; |
die Astronomie, Medizin, Philologie, etc., etc.,
sind Wissenschaften. |
|
Schöpfer, der; |
ein Mann, der großes beginnt und vollendet. |
|
Zukunft, die; |
die Zeit, welche kommt. |
| 39. |
Eifersucht, die; |
Othello hatte Eifersucht auf Cassio. |
|
gepriesen;[N-8] |
Ich preise, ich pries, ich habe gepriesen. |
|
Verräter, der; |
ein Mann, der seinem Vaterlande nicht treu ist. |
|
genießet; |
lebet glücklich in der Freiheit. |
| 40. |
Sternen-Banner, das; |
die Flagge mit den Sternen. |
|
geeignet; |
gemacht. |
|
pflegen; |
den wir oft den Kontinent der Kultur nennen. |
|
wirf einen Blick; |
sieh! |
|
Sitten, die; |
die Manieren. |
| 41. |
vererbt; |
giebt. |
|
Errungenschaften, die; |
alles, was Europa hat und weiß. |
|
Sache, die; |
alles dieses. |
|
Geschichte, die; |
die Historien. |
|
beobachtet; |
gesehen; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 189. |
|
Treibhaus; |
ein Haus von Glas im Garten für Blumen und junge
Pflanzen. |
|
Samen, der; |
das Saat-Korn. |
|
zarten; |
kleinen und feinen. |
|
tragen; |
bringen. |
|
Völker, die; |
die Nationen. |
|
verehrten; |
beteten zu der Schönheit und liebten dieselbe; siehe
»Studien und Plaudereien, I.« Seite 176. |
| 42. |
ewig; |
immer; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 148. |
|
unsichtbar; |
man kann Gott nicht sehen. |
|
Verkünder, der; |
der Lehrer. |
|
unendlich; |
ohne Ende. |
|
Lehre, die; |
das Dogma. |
|
zogen; |
gingen.Ich ziehe, ich zog, ich bin gezogen; siehe
»Studien u. Plaudereien, I.« Seite 140. |
|
opferten; |
brachten, gaben. |
|
genügte; |
war nicht mehr genug. |
| 43. |
verklungen; |
zu Ende. |
|
Gedanke, der; |
die Idee. |
|
Ahnung, die; |
eine Idee. |
| 44. |
Hafen, der; |
Landungs-Platz für Schiffe. |
|
erblickte; |
sah. |
|
ehrfurchtsvoll; |
mit Respekt. |
| 45. |
Schluchzen, das; |
ein lautes Weinen. |
|
vermochte; |
konnte. |
|
trennte; |
separierte. |
| 46. |
aufgeblüht; |
groß geworden. |
|
äußerte; |
sprach. |
|
kürzlich; |
vor nicht langer Zeit. |
|
ähnliche; |
solche. |
|
gerecht; |
er wollte das Recht. |
| 47. |
Verschwörung, die; |
die Rebellion. |
|
Schicksal, das; |
sein Glück und sein Unglück. |
|
wenden; |
tun. |
|
gewaltig; |
stark. |
|
Seher-Blick, der; |
mit dem Auge eines Propheten. |
|
schilderte; |
schrieb. |
|
Wirklichkeit, die; |
die Realität. |
|
Helden, die; |
Der Held; der Heroe. |
| 48. |
verschmähen; |
nicht haben wollen. |
|
achten; |
respektieren; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 115. |
| 49. |
angenehm; |
recht. |
|
Vergnügen, das; |
die Freude; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 187. |
|
neidisch; |
böse; wollte alles für sich, nichts für seinen
Bruder. |
|
reißen; |
bringen. |
|
ersonnen; |
gedacht. |
|
ehemals; |
zuvor. |
| 50. |
Begeisterung, die; |
der Enthusiasmus; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 194. |
|
fluche dir; |
verdamme dich. |
|
enterbe; |
du bist sein Sohn nicht mehr. |
|
Angesicht, das; |
das Gesicht. |
|
Schande, die; |
ein schlechter[N-9] Name. |
|
die einen Stein erweicht hätten= |
daß sogar ein harter Stein mit gefühlt hätte. |
| 51. |
heben; |
besser machen. |
|
Haupt-Mann, der; |
der Kapitän. |
|
geschickt; |
gesendet; siehe »Studien und Plaudereien,[N-10] I.« Seite 199. |
|
mitzuteilen; |
zu sagen; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 201. |
|
Kummer, der; |
die Trauer, die Sorge. |
|
Grube, die; |
das Grab. |
|
Befand sich jetzt an der
Spitze |
= war jetzt der erste. |
| 52. |
Schrecken, der; |
die Furcht. |
|
Schwachen, die; |
die nicht stark sind. |
|
Bedrückten, die; |
die Sklaven, die Armen. |
|
schaffen; |
machen. |
|
Schlacht, die; |
der Kampf; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 176. |
|
verbreiten; |
nach allen Seiten bringen. |
|
Waisen, die; |
die Kinder, die keinen Vater und keine Mutter mehr haben. |
|
vermag; |
kann. |
|
Jüngling, der; |
der junge Mann; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 186. |
| 53. |
begangen; |
getan. Ich begehe, ich beging, ich habe begangen. |
| 54. |
Laute, die; |
ein musikalisches Instrument. |
|
Umstand, der; |
das Faktum. |
|
vermutete; |
glaubte; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 219. |
|
Geheimnis, das; |
ein Etwas, das niemand wissen sollte. |
|
Erbarmen, das; |
die Güte, die Gnade. |
| 55. |
Angst, die; |
die Furcht, die Not. |
|
geflohen; |
ich fliehe, ich[N-11]
floh, ich bin geflohen. |
|
begleiten; |
die Noten spielen zum Singen. |
| 56. |
Wonne, die; |
die Freude. |
|
abzuholen; |
zu empfangen. |
|
er begleitete sie; |
er ging mit ihr. |
|
ohne Ihnen ein
Geständnis zu machen; |
ohne Ihnen eins zu sagen. |
| 57. |
errötete; |
wurde rot. |
|
schlug die Augen nieder; |
sah auf die Erde. |
|
verflossen; |
vergangen. |
|
berühmt; |
bekannt bei allen. |
|
besichtigen; |
sehen. |
|
ich erinnere mich dessen; |
ich denke noch daran. |
|
zu großem
Danke verpflichtet; |
ich muß Ihnen sehr danken. |
| 58. |
gewaltiger; |
großer. |
|
Gewohnheit, die; |
die Manier. |
| 59. |
fleißig; |
er studierte viel. |
|
besonders; |
vor allem; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 144. |
|
dann will
ich dich nicht mehr bemühen; |
dann will ich nichts mehr von dir bitten. |
| 60. |
hustete; |
er brachte den Ton: hm hm! hervor. |
|
ebenfalls; |
auch; siehe [N-12]»Studien und Plaudereien, I.« Seite 184. |
|
verzögern; |
hier bleiben, warten. |
|
was mir soeben einfiel; |
woran ich in diesem Momente dachte; siehe »Studien und
Plaudereien, I.« Seite
82. |
| 61. |
angenehm; |
ich bin glücklich, Sie kennen gelernt zu haben. |
|
bedauern; |
Mama wird traurig sein; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 180. |
|
empfehlen Sie mich; |
sprechen Sie freundlich, gut von mir bei, etc. |
Noten zur dritten Sektion. |
| 62. |
früher; |
in alten Zeiten. |
| 63. |
plötzlich; |
mit eins. |
|
verschwunden; |
nicht mehr da. |
|
kreischten; |
riefen. |
|
flogen; |
ich fliege, ich flog, ich bin geflogen; siehe »Studien
und Plaudereien, I.« Seite
221. |
|
Jammer, der; |
das Unglück, die Not. |
|
schweigen; |
still sein; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 116. |
|
Hemden, die; |
das[N-13] Hemd;
das Kleid von Leinen auf dem Körper. |
| 64. |
stumm; |
sie kann nicht sprechen. |
|
Hexe,
die; |
ein böses Weib; in »Macbeth« sind drei Hexen;
die Hexe von Endor. |
|
Scheiter-Haufen, der; |
viele Stücke Holz aufeinander, um Personen lebendig darauf
zu verbrennen. |
| 65. |
anzünden; |
machen. |
|
Lauscher, die; |
Hörer vor der Thür. |
| 66. |
Gemach; |
sagen Sie nicht zu viel. |
|
Ziel, das; |
das gute Ende. |
|
gewählt; |
genommen. |
|
gediegen; |
gründlich, perfekt, sehr gut. |
|
Oberflächliche, das; |
das Halbe; nicht perfekt. |
| 67. |
Weise, die; |
die Manier. |
|
Unterschied, der; |
die Differenz. |
|
einschlagen; |
gehen. |
|
fehlerhaft; |
nicht richtig. |
|
versäumen; |
vermissen. |
| 68. |
ich füge noch
etwas Neues hinzu; |
ich sage noch etwas Neues. |
|
so dringen sie ein; |
so lernen sie verstehen. |
|
gehütet; |
bewahrt. |
|
ermüdet; |
müde gemacht. |
|
Beobachtung, die; |
die Observation; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 189. |
|
freilich; |
natürlich. |
| 69. |
geleistet; |
getan. |
|
gewöhnt; |
haben gelernt. |
|
Vorteil, der; |
der Profit. |
|
auszudrücken; |
zu sprechen. |
| 70. |
Verbindung, die; |
die Konnexion. |
|
Ausdauer, die; |
die Geduld. |
|
Beharrlichkeit, die; |
Geduld mit Energie. |
| 71. |
bezeugen; |
ich kann sagen daß es so ist. |
|
vorhanden; |
da. |
|
trennen; |
separieren. |
| 72. |
vorzüglicher; |
sehr guter. |
| 74. |
begreifen; |
verstehen; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 194. |
|
Bewegung,[N-14]
die; |
siehe ebenda, Seite 75. |
|
andeuten; |
bedeuten, meinen. |
| 75. |
Stellung, die; |
die Position. |
|
Mühe, die; |
die Arbeit; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 134. |
| 76. |
Ich
stimme Ihnen bei; |
ich denke so, wie Sie; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 195. |
|
verfahren; |
tun. |
|
regelmäßig; |
regulär. |
| 78. |
Probe, die; |
das Experiment. |
| 80. |
Aussprache, die; |
die Pronunciation. |
|
Verzweiflung, die; |
die Desperation. |
|
inne haben; |
in mir haben, gut verstehen. |
| 81. |
auszuführen; |
alles zu tun, was auf dem Programme steht. |
| 82. |
ziehen Sie es vor; |
ist es Ihnen lieber. |
| 83. |
aushalten; |
leben können. |
|
Insel, die; |
ein Land von Wasser umringt. |
|
sich bemühen; |
ernstlich denken. |
|
vorzüglichste; |
beste. |
|
veredeln; |
nobel machen. |
| 84. |
Geschöpfe, die; |
die Kreaturen. |
|
schulden; |
geben müssen. |
|
eingerichtet; |
arrangiert. |
| 85. |
Beifall, der; |
der Applaus. |
|
Rückkehr, die; |
zurück kommen. |
|
Schritt, der; |
das Gehen. |
|
Stock-Werk, das; |
die Etage. |
| 86. |
Tritt, der; |
das Gehen. |
|
gewölbt; |
oben rund. |
|
Gewächse, die; |
die Pflanzen. |
|
Pult,
das; |
der Stand. |
| 87. |
Leuchter, der; |
die Lampe. |
|
Holz-Scheite, die; |
die Stücke Holz. |
|
Springbrunnen, der; |
die Fontäne. |
|
völlig; |
ganz. |
|
erwähnte; |
schrieb. |
|
Geschwister, die; |
die Brüder und die Schwestern. |
|
schwiegen; |
schrieben nichts. |
|
Überraschung, die; |
die unverhoffte Freude. |
| 89. |
geschickteste; |
der beste Sänger. |
|
pries; |
ich preise, ich pries, ich habe gepriesen. |
|
man konnte zu
keiner Entscheidung kommen; |
man konnte nicht sagen, wer der beste Sänger
wäre. |
| 90. |
ergreifen; |
nehmen und töten. |
|
floh; |
ich fliehe, ich floh, ich bin geflohen. |
|
Schutz, der; |
die Protektion. |
|
gefleht; |
gebeten. |
|
berühren; |
Hand an ihn legen. |
|
beschädigen; |
böses tun. |
|
man einigte sich; |
alle sagten. |
|
entscheiden; |
zu Ende bringen. |
|
zuerkannt; |
gegeben. |
|
Ehrfurcht, die; |
der Respekt. |
| 92. |
Amme,
die; |
die Wärterin, Dienerin. |
| 93. |
gefeiert; |
gehalten; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 199. |
|
Tugenden, die; |
er war recht und gut in seinem Tun und Denken. |
|
häufiger; |
öfters. |
|
Hütten, die; |
die kleinen Häuser der armen Leute. |
|
verschenke; |
gebe. |
| 94. |
Wald-Pfad, der; |
der schmale Weg im Walde. |
|
trägst; |
hast; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 115. |
|
Heiland, der; |
Jesus Christus. |
|
wallfahren; |
gehen. |
|
Mannen, die; |
die Soldaten. |
|
wehmütigem; |
traurigem. |
|
Weh,
das; |
das Unglück; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 150. |
| 95. |
vertrieb; |
sandte sie fort; ich vertreibe, ich vertrieb, ich habe
vertrieben. |
|
hinaus stieß; |
sandte mit Gewalt. |
|
Fackel, die; |
das Licht. |
|
Obdach, das; |
Platz zum Schlafen. |
|
gewähren; |
geben. |
| 96. |
erbarmte; |
wieder gut wurde. |
|
Segen, der; |
gutes. |
|
Sarg,
der; |
man legt die Toten in den Sarg und legt den Sarg in die Erde;
siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 201. |
| 97. |
begehrte; |
wünschte; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 175 |
| 98. |
Stab,
der; |
der Stock. |
|
Jenseits; |
in der anderen Welt. |
| 99. |
Fleisch-Brühe, die; |
die Suppe. |
| 100. |
Schinken, der; |
Fleisch vom Schweine. |
|
allerlei Geflügel; |
Hühner, Gänse, etc. |
|
Braten
von Wildbret; |
geröstetes Fleisch eines Tieres aus dem Walde. |
| 101. |
zubereitet; |
gemacht. |
|
verteidigen; |
werde für ihr Leben kämpfen. |
| 102. |
gesammelt; |
zusammen gebracht. |
|
Sammlung, die; |
die Kollektion. |
|
geschmückt; |
schön gemacht. |
|
Heuchlerin, die; |
Hippokrit (fem.). |
|
speisen; |
essen. |
| 103. |
Unterhaltung, die; |
die Konversation. |
|
Schauspieler, der;[N-15] |
Beckmann spielte im Theater; er war ein Schauspieler; auch
Garrick. |
| 104. |
sündhaft; |
unrecht. |
| 105. |
herrscht; |
ist Herr. |
| 106. |
Herrschaft, die; |
die Macht, die Kraft. |
| 107. |
wohl bekomm's! |
auf Ihr Wohl! |
|
Jünger, der; |
der Schüler. |
| 108. |
Wohlgefallen, das; |
die stille Freude. |
|
genießen; |
freuen sich. |
|
aufgehoben; |
zu Ende. |
|
wir begeben uns in; |
wir gehen in. |
| 109. |
begehen; |
tun. |
|
beweisen; |
zeigen. |
|
mäuschenstill; |
so still, wie eine Maus. |
|
belieben; |
wenn es Ihnen recht ist. |
| 110. |
der sich bei uns
bewährt; |
der gut ist für uns. |
|
widerfährt; |
zukommt. |
|
Wirts-Haus, das; |
das kleine Hotel. |
|
Pfropfen-Zieher, der; |
Instrument, mit welchem man den Kork aus der Flasche
zieht. |
|
Schwager, der; |
der Kutscher; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 136. |
|
Braust
mir's im Kopf; |
habe ich Kopf-Schmerzen. |
|
keine Lust; |
keinen Appetit. |
|
Schnupfen, der; |
die Erkältung. |
|
was kümmern mich
die Medici? |
ich frage keinen Doktor. |
|
auserkoren; |
gegeben. |
| 111. |
Wechsel ausgeblieben; |
wenn ich kein Geld mehr habe. |
|
Bursch, der; |
der Student. |
|
Beutel, der; |
die Geld-Börse. |
|
so pumpt er die Philister
an; |
dann borgt er Geld von den Philistern. |
|
eitel; |
nichts. |
|
Schläger, der; |
das Schwert, der Fecht-Degen. |
|
blinkt; |
glitzert. |
|
Stahl, der; |
das Schwert. |
| 112. |
heiter; |
froh. |
|
beigetragen; |
getan. |
| 113. |
angespannt; |
die Pferde sind vor dem Wagen. |
Noten zur vierten Sektion. |
| 114. |
hold; |
lieblich. |
|
Wehmut, die; |
die Traurigkeit. |
|
schleicht; |
kommt leise. |
|
bleich; |
weiß im Gesichte. |
| 115. |
sprossen; |
wachsen. |
|
einsam; |
allein. |
|
kahler etc.; |
leerer, harter, ohne Pflanzen. |
|
ihn schläfert; |
er ist müde. |
|
umhüllen; |
bedecken. |
|
Morgen-Land, das; |
der Orient. |
| 116. |
paßt nicht
für ihn; |
ist nicht der rechte für ihn. |
|
besitzt; |
hat; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 154. |
| 117. |
Vormittag, der; |
der Morgen. |
|
gepflückt; |
gebrochen. |
|
Strauß, der; |
das Bouquet; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 156. |
| 118. |
tiefsinnig; |
in tiefen Gedanken. |
|
unterbrach mich; |
sagte schnell. |
| 119. |
Schwermut, die; |
die Melancholie. |
|
Stolz, der; |
der Hochmut. |
|
Bescheidenheit, die; |
das Gegenteil von Stolz. |
|
stammt; |
kommt. |
| 120. |
erzürnt; |
böse. |
|
Frevel, der; |
das Unrecht. |
|
starr; |
steif. |
|
umflattert; |
fliegt um sie. |
| 121. |
du scherzest; |
das ist nicht dein Ernst. |
| 122. |
ertrinken; |
sterben im Wasser. |
| 123. |
Eitelkeit, die; |
zu große Selbstliebe, zu große
Selbstbewunderung. |
|
Kranz, der; |
der Ring, eine Krone von Blumen auf dem Kopfe; siehe
»Studien und Plaudereien, I.« Seite 178. |
|
befahl; |
ich befehle, ich befahl, ich habe befohlen. |
| 124. |
schützen; |
bewahren, bedecken. |
| 125. |
Druckereien, die; |
die Häuser, in welchen man Zeitungen, Bücher,
etc., druckt; siehe »Studien
und Plaudereien, I.« Seite
22. |
|
vermeinte; |
glaube; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 219. |
| 126. |
Einbildung, die; |
die Phantasie, die Imagination. |
|
hergestellt; |
gemacht. |
|
reizend; |
schön; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 215. |
|
handelte darnach; |
tat wie sie sprach. |
|
Irrtum, der; |
der Fehler. |
| 127. |
rücken; |
kommen. |
|
Spazier-Gänge, die; |
die Promenaden; siehe »Studien und Plaudereien, I.«
Seite 107 (spazieren gehen). |
|
Ausflüge, die; |
die Exkursionen. |
| 128. |
schwärmerisch; |
melancholisch. |
| 129. |
heiterer; |
froher. |
|
Lispeln, das; |
das Wispern. |
|
lagerten; |
setzten sich. |
|
erhoben uns; |
standen auf. |
| 130. |
zerstreut hatten; |
von einander gegangen waren. |
|
haschen; |
fangen; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 57. |
|
säumte; |
wartete. |
|
entwischt; |
weggerannt. |
|
sachte; |
langsam. |
|
Schaukel, die; |
Instrument zum Schwingen. |
|
berühmt; |
viel, sehr bekannt. |
| 131. |
trübe; |
dunkel. |
|
eigentümlich; |
seltsam, anders als früher. |
|
Geistliche, der; |
der Pastor. |
| 132. |
glich,
etc.; |
sie war wie ein, etc. |
|
waltete; |
sorgte. |
|
litt; |
ich leide, ich litt, ich habe gelitten. |
| 133. |
Erleichterung, die; |
die Besserung. |
|
schwanden; |
vergingen. |
|
zweifelte; |
glaubte nicht gewiß. |
|
herrschte; |
war. |
|
bedenklich; |
sehr. |
| 135. |
Entscheidung, die; |
die Resolution. |
|
beseitigen; |
entfernen. |
|
eines unerfahrenen
Mädchens; |
eines Mädchens, das die Welt nicht kennt. |
|
Beruf, der; |
das Geschäft, die Profession. |
|
linderte; |
milderte. |
|
zänkisch; |
zankliebend; siehe »Studien u. Plaudereien, I.« Seite 112. |
| 136. |
beneidet; |
gewünscht, zu sein wie sie. |
|
trösten; |
ich wollte ihr Mut zusprechen. |
| 137. |
läutern; |
reinigen. |
|
geschlossen; |
nicht offen. |
|
seligen; |
glücklich im Paradiese. |
| 138. |
war kaum im Stande, etc.; |
er konnte fast nicht sprechen. |
|
vorschwebte; |
das ich sah in meiner Phantasie. |
| 139. |
beschäftigt; |
hat wohl viel zu tun. |
|
Bild,
das; |
Gemälde in Öl oder Crajon oder eine Photographie,
etc. |
| 140. |
würdigen, etc.; |
daß ich den Wert dieser Ehre kenne. |
| 141. |
Fuß-Schemel, der; |
kleiner Stuhl für die Füße. |
|
Aar,
der; |
Adler, König der Vögel. |
|
Falke, der; |
Name eines Vogels. |
|
Hof,
der; |
in ihrem Palaste. |
|
Zierde, die; |
das Schönste. |
| 142. |
erobern; |
erkämpfen und nehmen. |
| 143. |
Riesen, die; |
große, starke Männer. |
| 144. |
streiten; |
kämpfen; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 173. |
|
Gut,
das; |
alles, was du hast. |
|
geschah; |
so wurde es getan. |
|
errungen; |
gewonnen. |
| 145. |
üben; |
Übungen zu machen. (Übungen=Exercitien.) |
|
Schmuck, der; |
Ohr-Ringe, Arm-Bänder, etc. |
|
erwiesen; |
getan. |
| 146. |
schleudern; |
werfen. |
|
überwinden; |
besiegen; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 121. |
| 147. |
Wohnsitz, der; |
der Palast. |
|
Steigbügel, der; |
er hängt an der Seite des Pferdes und dient zum
Aufsteigen. |
|
verabredet; |
zuvor gesagt. |
|
umfaßte; |
hatte. |
| 148. |
es geht an Leben und
Leib; |
du mußt sterben. |
|
wog; |
ich wiege, ich wog, ich habe gewogen;u. siehe »Studien
Plaudereien, I.« Seite 146. |
|
Geberden, die; |
die Gesten. |
|
ergriff; |
nahm. Ich ergreife, ich ergriff, ich habe ergriffen. |
|
schwang; |
ich schwinge, ich schwang, ich habe geschwungen. |
|
Gegner, der; |
der Feind. |
|
strauchelte; |
stand nicht fest. |
| 149. |
gegönnt; |
gewünscht. |
|
zog
ab; |
ging weg. |
| 150. |
dahin lenkte S. seine
Schritte; |
dahin ging S. |
|
pocht; |
klopft. |
|
hob; |
setzte. |
|
Eisen-Stange, die; |
ein langer Stock von Eisen. |
|
zupfte; |
zog. |
| 151. |
im
Nu; |
in einem Momente. |
|
erklärte; |
sprach. |
|
verkürzten; |
machten sie die Zeit kurz. |
|
Auftrag, der; |
die Bitte, der Wunsch. |
|
Sehnsucht, die; |
sein Verlangen, sein Wunsch, Krimhilde zu sehen. |
|
Jubel, der; |
die laute Freude. |
| 152. |
anbieten; |
offerieren. |
|
Spangen, die; |
die Arm-Bänder. |
|
zu Rosse; |
das Roß; das Pferd. |
|
begleitete; |
ging mit der Königin Ute. |
| 153. |
gewählt; |
den er für sie ausgesucht genommen. |
|
biß; |
ich beiße, ich biß, ich habe gebissen. |
|
trübe; |
traurig. |
|
gegenüber; |
auf der andern Seite des Tisches. |
|
neben; |
bei. |
|
stürzten; |
fielen schnell. |
|
erfahren; |
hören und verstehen. |
| 154. |
trug; |
ich trage, ich trug, ich habe getragen. |
|
Mitleid, das; |
Gefühl, Sympathie. |
|
Leid,
das; |
das Unglück; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 225 |
| 155. |
gewöhnliche
Antwort; |
die Antwort, welche er oft gab. |
|
sehne; |
verlange; wie gerne möchte ich Krimhilde sehen. |
|
vermählte; |
verheiratete; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 51. |
|
Sonnen-Wende, die; |
der Frühling. |
|
gehorchen; |
zu tun, was sie wünschte. |
| 156. |
kehrten; |
kamen. |
| 157. |
Pracht, die; |
Schönheit und Reichtum. |
|
verdiente; |
der es wert wäre. |
|
gereizt; |
etwas böse, pikiert. |
|
Genosse, der; |
der Kamerad. |
| 158. |
überhebst; |
du machst dich größer, als du bist. |
|
erweist; |
giebt. |
|
sonst; |
vor diesem Tage. |
| 159. |
verschafft mir; |
nehmt für mich. |
|
Rache, die; |
Böses für Böses. |
|
beschimpft; |
insultiert. |
|
List,
die; |
die Intrigue; die Schlauheit. |
| 160. |
Schein, der; |
die Lüge. |
|
vergeltet; |
tut mir kein Leid. |
|
geschehen; |
zukommen. |
| 161. |
Stelle, die; |
der Platz. |
|
veranstaltete; |
arrangierte. |
| 162. |
Rasen, der; |
ein Platz, der mit Gras bewachsen ist. |
|
Spessart, der; |
Namen der Berge. |
| 163. |
Während dessen; |
in der Zeit, da Gunther trank. |
|
Bedacht, der; |
die Absicht, Intention. |
|
erschlagen; |
gemordet. |
|
Leiche, die; |
der tote Körper. |
| 164. |
ohnmächtig; |
wie tot. |
|
Vergießet kein
Blut; |
tötet niemanden. |
|
Reue,
die; |
die Sorge. |
|
Schächer, der; |
der Räuber. |
|
ersetzen; |
wiedergeben. |
| 165. |
Schluchzen, das; |
das starke Weinen. |
|
erbrechen; |
öffnen. |
|
riß; |
ich reiße, ich riß, ich habe gerissen; siehe
»Studien und Plaudereien, I.« Seite 224
(hinweggerissen). |
| 167. |
Widersprich; |
sprich nie gegen. |
|
fügen; |
zufrieden sein. |
|
umsonst; |
ohne Erfolg, Succeß. |
|
Wirklichkeit, die; |
die Wahrheit. |
|
Altertum, das; |
die Zeit der alten Griechen, Römer, etc. |
| 168. |
schmeichelhaft für
uns; |
ein Kompliment für uns. |
|
Spitzen, die; |
die höchsten Enden, Punkte. |
| 169. |
Erlösung, die; |
die Befreiung, die bessere Zeit. |
|
Nahrung, die; |
Essen und Trinken. |
|
Schutz, der; |
die Protektion. |
|
bedarf; |
hat nötig, muß haben. |
| 170. |
versagt; |
nicht gegeben. |
|
schätzten; |
respektierten und liebten. |
| 171. |
Rinder; |
Ochsen und Kühe. |
|
abscheuliche; |
sehr böse. |
|
Allwissenheit, etc.; |
er wollte sehen, ob die Götter alles wissen. |
| 172. |
Nachkommen, die; |
die Kinder, Kindes-Kinder, etc. |
|
Feldherr, der; |
der General. |
|
weilte; |
wohnte. |
| 173. |
Glied, das; |
eine Person. |
|
gebot; |
sagte. |
|
Hain,
der; |
der kleine Wald. |
| 174. |
Kunde, die; |
die Neuigkeit. |
|
fürchterlichster
Wahnsinn; |
wildeste Phantasien, Dilirium. |
|
entführen; |
bringen. |
| 175. |
offenbarte; |
erzählte. |
|
zauderte; |
wartete. |
|
Wesen, das; |
der Charakter. |
|
vollbrachte; |
tat. |
|
schied; |
ging. |
| 176. |
Rätsel
lösen; |
die Antwort finden auf ein Rätsel. |
|
Klee, der; |
eine Pflanze. Damen suchen sie im Grase und sind
glücklich, wenn sie dieselbe finden mit vier
Blättern. |
| 177. |
Mütze, die; |
die Kappe. |
|
befiehlt's;[N-16]
|
ich befehle, du befiehlst, er befiehlt — es. |
| 178. |
Vorfahren, die; |
die Eltern, Großeltern, etc. |
|
getroffen; |
gesehen, gefunden. |
| 179. |
plaudern; |
sprechen. |
Noten zur fünften Sektion. |
| 180. |
vernehme; |
höre. |
|
Heimweh, das; |
Wunsch, Sehnsucht nach der Heimat. |
| 181. |
Wände; |
die Seiten des Zimmers; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 28. |
|
angefertigt; |
gemacht. |
| 182. |
Bahn-Hof, der; |
die Station. |
|
dahingeschwunden; |
vergangen. |
|
Dächer; |
das Dach=die Decke auf dem Hause. |
| 183. |
Künstler, der; |
der Artist. |
|
Denkmal, das; |
das Monument. |
|
höflich; |
galant. |
|
scheidend; |
indem die Sonne untergeht. |
|
erregen; |
bewegen. |
|
Hügel, der; |
ein kleiner Berg. |
|
Laub,
das; |
Blätter des Baumes. |
|
Käfer, der; |
ein Insekt. |
| 185. |
Stübchen, das; |
das kleine Zimmer. |
|
Dicht-Kunst, die; |
die Poesie. |
|
vernimmt; |
hört. |
|
ehrfurchtsvoll; |
mit Pietät. |
|
Pfad,
der; |
der schmale Weg. |
| 186. |
Sterbliche; |
der Sterbliche, der Mensch. |
|
einstmals; |
später. |
|
Fremden, die; |
Leute aus anderen Ländern. |
|
gepflegt; |
kultiviert. |
|
wechseln ab; |
kommen nach einander. |
| 187. |
deutend; |
zeigend. |
|
schlanken; |
hohen und dünnen. |
|
Bauer, der; |
der Land-Mann. |
|
da
ging es lustig her; |
da waren alle froh. |
| 188. |
jauchzten; |
laut lachten und sangen. |
|
Schatz, der; |
die Geliebte. |
|
Wange, die; |
die Seite des Gesichtes. |
|
Wonne, die; |
die große, stille Freude. |
|
Spaß, der; |
das Vergnügen. |
| 189. |
Spieß, der; |
die Lanze. |
|
Nehmt in acht; |
bewahret. |
|
daß
niemandem Schade geschieht; |
daß keinem ein Unglück zukommt. |
|
lobet; |
preiset. |
| 191. |
da
tut's ihm gefallen; |
da gefällt es ihm. |
| 192. |
denke mein; |
denke an mich. |
| 194. |
auf die Jagd; |
sie gehen in den Wald und schießen Tiere. |
|
Hirsch, der; |
ein Tier des Waldes, schön, elegant. |
| 195. |
zielte; |
er sah scharf nach dem Kopfe des Hirsches, um zu
schießen. |
|
drückte ab; |
schoß; ich schieße, ich schoß, ich habe
geschossen. |
|
Geweih, das; |
die Hörner des Hirsches. |
|
gewachsen; |
ich[N-17]
wachse, ich wuchs, ich bin gewachsen; siehe »Studien und
Plaudereien, I.« Seite
132. |
|
es schneite; |
der Schnee fiel. |
|
Pfahl, der; |
der Pfosten. |
| 196. |
er hörte etc. wiehern; |
er hörte die Stimme seines Pferdes. |
|
allmählich; |
nach und nach. |
| 198. |
aus dem Lager; |
aus dem Regimente im Felde. |
|
Kummer, der; |
die Sorge. |
|
daß er fest
entschlossen war; |
daß es sein fester Wille war. |
| 199. |
Anstalt, die; |
das Institut. |
|
Unterthanen, die; |
die Leute in ihrem Lande. |
|
schwelgen; |
in Luxus leben. |
|
ergriff; |
nahm. Ich ergreife, ich ergriff, ich habe ergriffen. |
| 200. |
trieben es; |
taten. |
|
riß; |
ich reiße, ich riß, ich habe gerissen. |
|
arger; |
böser. |
| 201. |
Fähigkeit, die; |
das Talent. |
|
musterte; |
betrachtete, sah ihn scharf an. |
|
Spitzbube, der; |
der Dieb. |
| 203. |
gespannt; |
wie sehr ich wünsche, das Nächste zu hören. |
|
ergrimmt; |
sehr böse. |
| 204. |
es gewagt hatte; |
sich das Recht genommen hatte. |
|
Gedränge, das; |
viele Menschen, die einander drängten, preßten. |
| 205. |
befördert; |
gewollt und gesucht. |
|
zuverlässigere; |
bessere.[N-18] |
|
Spanne, die; |
eine sehr kurze Strecke. |
| 207. |
Wechsel, der; |
das schriftliche Versprechen, das Geld zu zahlen. |
|
Bräute; |
die Braut; die Geliebte, die der Mann zum Weibe nehmen
wird. |
|
gemeinschaftlich; |
zusammen. |
|
zerstreute; |
entfernte. |
| 209. |
matterm; |
schwächerm; schwach, schwächer. |
|
an den Marken meiner
Tage; |
am Ende meines Lebens. |
|
entbrannte; |
begeistert war. |
|
lichten; |
schönen. |
|
Hauch, der; |
ein leichter Wind. |
| 211. |
geleistet; |
getan. |
|
Wohnung, die; |
das Haus. |
| 212. |
Menge, die; |
die vielen Menschen. |
|
Ruhm,
der; |
die Glorie. |
| 213. |
Hülle, die; |
der Körper. |
|
zerbrechlich; |
krank. |
| 214. |
vornehmlich; |
und mehr noch. |
|
lastete; |
lag. |
|
Knechtschaft, die; |
die Sklaverei. |
|
bedeutender; |
größer. |
| 215. |
Vogt,
der; |
der Statthalter, der Gouverneur. |
|
Grausamkeit, die; |
die Tyrannei. |
|
geblendet; |
blind gemacht. |
|
er stürzt hervor; |
kommt schnell aus dem Zimmer. |
|
Wesen, das; |
alles, was lebt. |
|
Geschöpf, das; |
die Kreatur. |
|
erquickt; |
erfreut. |
|
Matte, die; |
die Wiese; die Flur; siehe »Studien und Plaudereien,
I.« Seite 87. |
|
Schmelz, der; |
der Glanz, die Schönheit. |
|
Firn,
der; |
die höchsten Spitzen der Berge mit Schnee bedeckt, —
in den Alpen. |
|
Wüterich, der; |
der Tyrann. |
| 216. |
tagen; |
Tag werden. |
|
Pfänder; |
das Pfand; »Zwanzig Fragen« ist der Name eines
Pfänder-Spieles in der Gesellschaft. Wer nach 20 Fragen die
rechte Antwort nicht geben kann, muß ein Pfand geben. |
|
Vorschlag, der; |
die Proposition. |
| 217. |
gerade; |
just. |
|
geistreich; |
intellektuell. |
| 218. |
Zopf,
der; |
langes Haar in einen Strang geflochten; wie die Chinesen. |
|
Künstler, der; |
der Artist. |
| 219. |
Bild-Hauer, der; |
ein Künstler, der Monumente macht. |
|
Stiefel, die; |
Fuß-Bekleidung von Leder, — höher, als der
Schuh. |
| 221. |
das sind
Widersprüche; |
das eine sagt das Gegenteil vom andern. |
|
geizig; |
zu sparsam. |
| 223. |
Gelehrsamkeit, die; |
das große Wissen. |
|
Vermögen, das; |
sein Geld etc. |
Noten zur sechsten Sektion. |
| 225. |
gewöhnlich; |
die meiste Zeit. |
|
Gegenstand, der; |
das Thema. |
| 226. |
Gipfel, der; |
die Spitze eines Berges. |
|
verheißen; |
versprechen. |
|
zumal; |
vor allem. |
|
Genuß, der; |
die Freude. |
| 227. |
jahraus |
— jahrein; immer. |
|
ungeheuern; |
großen. |
|
streife; |
nach allen Seiten gehe. |
|
Lust,
die; |
die Freude und der Wunsch. |
|
Schaffen, das; |
das Arbeiten an großen Dingen. |
|
Tannen; |
die Tanne, der Tannen-Baum; siehe »Studien und
Plaudereien, I.« Seite
35. |
| 228. |
erfassen; |
verstehen. |
|
Bahnen; |
die Bahn, der Weg. |
|
in Demut; |
in dem Gefühle, daß er so klein sei. |
|
Anbetung, die; |
beten, das Gebet, die Anbetung; siehe »Studien und
Plaudereien, I.« Seite
145. |
|
Einsicht, die; |
Verstand. |
|
keimen; |
wachsen. |
|
Versteck, das; |
der Busch, hinter welchem ich versteckt war. |
| 229. |
gehegt; |
gehabt. |
|
gleichen etc.; |
sind nicht etc., wie die Sonne. |
| 230. |
schelmische Launen; |
humoristische Ideen und Taten. |
|
deuten; |
zeigen. |
|
Bläue, die; |
Substantiv von »blau.« |
|
Gefunkel, das; |
das Glitzern und Scheinen. |
|
Schwätzerin, die; |
das Mädchen, das zu viel spricht. |
| 231. |
außerordentlich; |
sehr. |
|
verbunden,[N-19]
|
dankbar. |
| 232. |
willfahre; |
Ihren Willen thue. |
|
so geschieht es; |
so thue ich es. |
|
eng; |
nicht weit. |
| 233. |
unredlich; |
böse. |
|
Schaffner, der; |
der Kondukteur. |
|
aussteigen; |
herauskommen. |
|
Zug,
der; |
die Reihe von Wagen. |
|
Warte-Saal, der; |
die Halle in der Station. |
|
heftiges; |
starkes. |
|
unwillkürlich; |
instinktiv. |
|
Kerl,
der; |
der Vagabund. |
|
lüstern; |
nach Blut verlangend. |
| 234. |
völlig; |
ganz. |
|
munter; |
wach; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 41. |
|
Züge, die; |
die Form und die Linien. |
|
Erziehung, die; |
Schulen etc. |
| 236. |
das eiserne Kreuz; |
ein berühmter deutscher Orden, eine Medaille. |
|
Auszeichnung, die; |
die Ehre. |
|
kühn; |
mutig; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 123. |
|
erbeutete; |
gewonnene, eroberte. |
|
Lager, das; |
das Bett. |
|
zweifelte; |
glaubte nicht. |
|
genas; |
wurde gesund; ich genese, ich genas, ich bin genesen. |
| 237. |
Weisung, die; |
der Befehl, die Ordre. |
|
Monden; |
Monaten. |
|
zeitig; |
früh. |
| 238. |
vermähltes; |
verheiratetes. |
|
Vorwürfe gemacht; |
habe ihm gesagt, wie unrecht er thäte. |
|
matte; |
schwache. |
| 239. |
nach meinen Erfahrungen; |
nach dem, was ich bis heute gehört und gesehen habe. |
|
zaubern; |
Wunder tun. |
|
Land-Partie[N-20], die; |
Gesellschaft auf dem Lande, Exkursion. |
| 241. |
unmittelbar; |
nicht lange, direkt. |
|
grämte sich; |
war sehr traurig. |
|
schuf; |
ich schaffe, ich schuf, ich habe geschaffen. |
|
Glut,
die; |
die Hitze; Substantiv von heiß. |
| 242. |
kamen um; |
starben. |
|
Dünste, die; |
der Dunst, schlechte Gase. |
| 243. |
schaudert; |
erschrickt. |
|
Spreu, die; |
Schalen von Korn, Weizen etc.,
welche beim Dreschen abfielen und keinen Wert hatten. |
|
Klumpen, der; |
das schwere Stück. |
|
rechtschaffen; |
Männer, die das Rechte denken und tun. |
| 244. |
enthauptet; |
hingerichtet, getötet. |
|
unschuldigen; |
guten. |
| 245. |
Schläfchen, das; |
ein kurzer Schlaf. |
|
Krämer, der; |
der Kaufmann. |
|
Kämme, |
Kamm. die; der Man ordnet die Haare mit dem Kamme. |
|
Elfenbein, das; |
Zahn des Elefanten. |
|
geheimnisvoll; |
leise. |
| 246. |
hüten etc.; |
du mußt nicht lachen. |
| 247. |
Teich, der; |
ein kleines, stilles Wasser. |
|
Schnäbel, die; |
der Schnabel, der lange Mund des Storches. |
|
Unterhaltung, die; |
die Konversation. |
|
Schachtel, die; |
der kleine Kasten. |
|
dürr; |
dünn. |
| 248. |
Frühstück,
das; |
das erste Essen am Morgen. |
|
üben; |
lernen zu tanzen. |
| 249. |
Zauberer, der; |
der Magiker. |
|
Gemäuer, das; |
die Mauer, der Wall. |
|
Gang,
der; |
der Korridor. |
|
Gespenster; |
das Gespenst; der Geist vom Toten. |
| 250. |
Eule,
die; |
ein Vogel der Nacht mit großen Augen. |
|
Spalte, die; |
die kleine Öffnung. |
|
Becher, der; |
Gefäß von Metall, zum Trinken; siehe »Studien
und Plaudereien, I.« Seite
124. |
|
erlösen; |
befreien. |
| 251. |
zögernd; |
langsam. |
| 252. |
Jungfrau, die; |
das Mädchen. |
| 253. |
in Kürze; |
bald. |
|
Aufklärung, die; |
die Erklärung. |
|
Ursache, die; |
ein Recht. |
|
verbrochen; |
böses getan; ich verbreche, ich verbrach, ich habe
verbrochen. |
|
erzeigte; |
gab. |
| 254. |
gewöhnlich; |
meistens, die meiste Zeit. |
|
Höhen, die; |
Olymp. |
| 255. |
Erbe,
das; |
der Besitz. |
|
geschäftig; |
fleißig, viel. |
|
Junker, der; |
der Edelmann. |
|
pirschte;[N-21] |
jagte. |
|
Speicher, der; |
das Waren-Haus. |
|
Abt,
der; |
der katholische Priester. |
|
Firnewein, der; |
der alte Wein. |
|
sperrt |
etc.;baut Zoll-Häuser auf
den Brücken und den Straßen. |
|
geschehen; |
getan war. |
|
hadre; |
zanke; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 112. |
|
berauscht; |
übervoll. |
| 256. |
mahnendes; |
warnendes. |
Noten zur siebenten Sektion. |
| 257. |
Fächer, der; |
ein Instrument in der Hand der Damen, um sich im Sommer zu
kühlen. |
|
beneidenswert; |
so glücklich, daß andere sich in meine Situation
wünschen. |
|
verhandeln; |
mit einander sprechen. |
|
verraten; |
sagen; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 180. |
| 258. |
es liegt mir viel daran; |
ich wünsche sehr. |
| 260. |
Ebenbild, das etc.; |
Ihre Figur, Größe, Form etc. ist wie die Ihres Vaters. |
| 261. |
verboten; |
gesagt, es nicht zu tun. |
|
wie sich das nun schickt; |
wie das nun kommt. |
|
Vorbedeutung, die; |
das Omen. |
| 262. |
aussetzen; |
auslassen. |
|
Scharen, die; |
die Schar, die Truppe. |
| 263. |
der
allwaltende Vater; |
Gott. |
|
rücken; |
bringen. |
|
Fähigkeiten, die; |
die Talente. |
| 264. |
zugehaucht; |
leise gesprochen. |
|
gedeihen; |
groß werden und glücklich sein. |
|
Dichtkunst, die; |
die Poesie. |
|
Finsternis, die; |
die Dunkelheit. |
| 265. |
flößte; |
gab. |
|
Fackel, die; |
das Licht. |
|
Weihe, die; |
das Opfer. |
|
zollt; |
giebt. |
|
Gebildeten, die; |
Leute, die gut sind in der Moral, in den Manieren und im
Wissen. |
|
gesamten; |
ganzen. |
| 266. |
zugemessenen; |
gegebenen. |
|
geringes; |
weniges. |
|
beschränken; |
ich kann nur sehr wenig sagen, weil ich nicht viel Zeit
habe. |
|
Gebiet, das; |
das Feld. |
|
vorzüglichsten; |
besten. |
|
Lebens-Geschichte, die; |
die Biographie. |
|
Genuß, der; |
die Freude. |
|
Grab-Mal, das; |
Monument auf dem Grabe. |
|
Aufenthalt, der etc.; |
so lange ich in Rom lebte. |
| 267. |
schätze; |
halte. |
|
beiläufig; |
jetzt. |
| 268. |
enthüllen; |
klar machen. |
|
entbehrten; |
vermißten. |
|
verderben; |
sterben. |
|
erfaßt; |
genommen; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 185. |
| 269. |
mißbilligende; |
scharfe. |
|
Schauspiel, das; |
die Scene. |
|
Opfer-Farren, der; |
der Stier auf dem Altar. |
|
zerstücken; |
in Stücke schneiden. |
|
Wellen-Bad, das; |
das Meer. |
|
Wut,
die; |
die Bosheit, der Zorn. |
|
Rachen, der; |
der weite Mund der Schlange. |
|
wetzen; |
scharf machen. |
|
furchtentseelt; |
halbtot vor Furcht. |
|
Schar, die; |
die vielen Menschen. |
| 270. |
Biß, der; |
Substantiv von beißen. |
|
Beistand, der; |
die Hilfe; siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 103. |
|
Geschoß, das; |
der Bogen mit dem Pfeil. |
|
geklemmt; |
gepreßt. |
|
Genicken; |
das Genick, der Nacken. |
|
Beil,
das; |
die kleine Axt. |
|
nirgends; |
an keinem Platze. |
|
tadeln; |
unschön zu finden. |
| 271. |
Ziel, das; |
das Resultat. |
|
einschlagen; |
gehen. |
|
begleiten; |
mit mir gehen. |
|
enttäuscht; |
verwundert und nicht zufrieden. |
| 272. |
in Fülle; |
viel. |
| 273. |
ergebenen; |
treuen. |
|
wage, etc.; |
ich habe nicht den Mut. |
|
versäume; |
vermisse. |
|
verspürte; |
fühlte. |
|
labte; |
erfreute. |
| 274. |
Zweifel, der; |
die Ungewißheit. |
|
es wollte mir nicht
gelingen; |
es ging nicht. |
| 275. |
Anziehungs-Kraft, die; |
die Attraktion. |
|
erforscht; |
sucht und findet. |
|
Irdische, das; |
die Erde und was daraus ist. |
| 276. |
stammt; |
kommt. |
|
Ahnung, die; |
das Vorgefühl. |
| 277. |
Zauber, der; |
die Magik. |
|
lösen; |
verstehen und erklären. |
|
rafft; |
steht auf. |
|
Würde, die; |
die Höhe. |
Noten zur achten Sektion. |
| 280. |
bläulich; |
blau. |
|
der lustige Mensch; |
ein Mensch voll glücklichem Humor. |
| 282. |
Rot-Häute, die; |
die Indianer. |
|
meine
Enthüllungen; |
das überraschende Neue, was ich zu erzählen
habe. |
|
Verwandten, die; |
siehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 37. |
| 283. |
Neigungen, die; |
meine eigenen Wünsche. |
|
gewähren; |
ließ dir deinen Willen.[N-22] |
|
Greis, der; |
ein alter Mann. |
|
eingeflößt; |
gegeben. |
|
Land-Wirtschaft, die; |
das Bearbeiten des Landes. |
|
Beschäftigung, die; |
die Arbeit. |
|
fähig; |
klug. |
| 284. |
erzeugt; |
produziert, giebt. |
|
verwendet; |
zu anderen Dingen braucht. |
|
Nahrung, die; |
Essen und Trinken. |
|
verschafft; |
giebt, bringt. |
|
Erzeugnisse, die; |
das Erzeugnis, das Produkt. |
|
Aufgabe, die; |
die Mission. |
|
am betäubendsten; |
am stärksten. |
| 285. |
Wesen, das; |
der Charakter. |
| 286. |
Lustspiel,
[N-23]
das; |
die Komödie. |
|
meinem
Versprechen gemäß; |
wie ich versprochen habe. |
|
Ränder, die; |
die äußeren Seiten. |
| 288. |
tunlich; |
möglich. |
|
betonen; |
Accent geben. |
| 291. |
vortrug; |
sang. |
|
Empfangs-Zimmer, das; |
der Salon. |
|
Begegnung, die; |
das Wiedersehen. |
| 292. |
Trauung, die; |
die Hochzeits-Ceremonie in der Kirche. |
|
Verwirrung, die; |
die Konfusion. |
| 293. |
schier; |
fast. |
|
Elend, das; |
das große Unglück. |
| 293. |
Stimmung, die; |
die Laune; stehe »Studien und Plaudereien, I.« Seite 50. |
|
ärgerlich; |
böse. |
| 296. |
Haube, die; |
die Kopf-Bedeckung; Kappe der Frauen im Hause. |
|
Spaß, der; |
ein Vergnügen. |
|
Angetraute, die; |
die Frau. |
|
rasend; |
wild. |
|
zugefügt; |
getan. |
| 297. |
juble; |
freue mich. |
|
verblüfft; |
verwundert. |
|
schlüpft; |
steckt. |
| 298. |
flugs; |
schnell. |
| 299. |
verspüre; |
fühle, habe. |
|
Mißgriff, der; |
der Fehler. |
Anmerkungen zur Transkription
Anmerkungen zum Inhalt
[P-1]"Goethes" war "Göthes"
[P-2]"Württemberg" war "Würtemberg"
[P-3]"Goethe" war "Göthe"
[P-4]"Literatur" war "Litteratur"
[P-5]"Seite 280" war "Sei te280"
Anmerkungen zur Sektion I
[I-1]"nötig" war
"nöthig"
[I-4]"möchte" war
"mochte"
[I-5]"haust" war
"hauset"
[I-6]"Goethes" war
"Göthe's"
[I-7]"Goethe" war
"Göthe"
[I-8]"Goethe" war
"Göthe"
[I-9]"Goethe" war
"Göthe"
Anmerkungen zur Sektion II
[II-4]"vermutete" war
"vermuthete"
Anmerkungen zur Sektion III
[III-3]"»das Reiten"
war "das »Reiten"
[III-8]"Gutes" war
"gutes" (klein geschrieben)
Anmerkungen zur Sektion IV
[IV-1]"Drachen-Blut"
war "Drachen Blut"
[IV-2]"geh'" war "geh"
(ohne Apostroph)
[IV-3]"erschlagen" war
"erschagen"
[IV-5]"»Durhsüeßet" war
"Durhsüeßet"
Anmerkungen zur Sektion V
[V-1]"Goethe" war
"Göthe"
[V-3]"tut's" war
"thut's"
[V-4]"Goethe" war
"Göthe"
[V-5]"Goethe" war
"Göthe"
[V-6]"Goethe" war
"Göthe"
[V-8]"Goethe" war
"Göthe"
[V-9]"Goethe" war
"Göthe"
Anmerkungen zur Sektion VI
[VI-5]"pirschte" war
"birschte"
Anmerkungen zur Sektion VII
Anmerkungen zur Sektion VIII
[VIII-3]Deutsche
Anführungszeichen durch Englische ersetzt
Anmerkungen zu den Gedichten
Liedtexte
[L-1]
Räuber-Lied.
(Zur 2. Sektion.) Friedrich von Schiller. (1780.)
Nicht zu schnell.
Nachbildung von »Gaudeamus igitur.« (Vor 1717.)
1. Ein frei - es Le - ben füh - ren wir, ein
Le - ben vol - ler Won - ne! Der
Wald ist un - ser Nacht - Quar - tier, bei
Sturm und Wind han - tie - ren wir; der
Mond ist uns - re Son - ne, der
Mond ist uns - re Son - ne.
[L-2]
Krambambuli.
(Zur 3. Sektion.) Ged. von
Crescentius Koromandel, d.i. Hof-Rat Wittekind in Danzig.
(1745.) Fröhlich. Volksweise des 18. Jahrh.
1. Kram - bam - bu - li, das ist der Ti - tel
des
Tranks, der sich bei uns be - währt;
er ist ein ganz pro - ba - tes Mit - tel,
wenn
uns was Bö - ses wi - der -
fährt.
Des A - bends spät, des Mor - gens
früh trink'
ich mein Glas Kram - bam - bu - li. Kram
-
bim - bam - bam - bu - li, Kram - bam - bu -
li!
2. Bin ich im Wirts - Haus ab - ge - stie - gen, gleich
ei - nem gro - ßen Ka - va - lier,
dann lass' ich Brot und Bra - ten lie - gen
und
grei - fe nach dem Propf - en - Zieh'r,
dann bläst der Schwa - ger Tan - tran - ti
zu
ei - nem Glas Kram - bam - bu - li. Kram
-
bim - bam - bam - bu - li, Kram - bam - bu -
li!
[L-3]
Blau blüht ein Blümelein.
Volks-Lied vom Thüringer Walde.
(Zur 5. Sektion.)
Moderato.
1. Ach, wie ist's mög - lich dann, daß ich dich
las - sen kann! hab' dich von Her - zen lieb,
das glau - be mir! Du hast das
Her - ze mein so ganz ge - nom - men ein,
daß ich kein' an - dre lieb', als dich al - lein.
2. Blau ist ein Blü - me - lein, das heißt Ver-
giß - nicht - mein: dies Blüm - lein leg' an's
Herz
und denk' an mich! Stirbt Blum' und
Hoff - nung gleich, wir sind an Lie - be reich;
denn die stirbt nie bei mir, das glau - be mir!
3. Wär' ich ein Vö - ge - lein, wollt' ich bald
bei dir sein, scheut' Falk und Ha - bicht nicht,
flög' schnell zu dir. Schöß' mich ein
Jä - ger tot, fiel' ich in dei - nen Schoß;
säh'st du mich trau - rig an, gern stürb' ich
dann!
[L-4]
Gebet während der Schlacht.
(Zur 5. Sektion.) Theodor
Körner. (1813.)
Langsam und mit Würde.
Friedrich Heinrich Himmel. (1813.)
1. Va - ter, ich ru - fe dich! Brül - lend um-
wölkt mich der Dampf der Ge - schü- tze,
sprü - hend um - zu - cken mich ras - seln - de
Bli - tze. Len - ker der Schlach - ten, ich
ru - fe dich! Va - ter du, füh - re
mich!
2. Va - ter du, füh - re mich! führ' mich zum
Sie - ge, führ' mich zum To - de:
Herr, ich er - ken - ne dei - ne Ge-
bo - te; Herr, wie du willst, so
füh - re mich! Gott, ich er - ken - ne
dich!
3. Gott, ich er - ken - ne dich! So im
herbst - li - chen Rau - schen der Blät - ter
als im Schlach - ten - Don - ner-
Wet - ter, Ur - quell der Gna - de, er-
kenn' ich dich! Va - ter du, seg - ne
mich!
[L-5]
Wenn die Schwalben heimwärts ziehn.
Abschied. (Zur 7.
Sektion.) Carl Herloßsohn.
(1842.)
Franz Abt. (1842.)
Andantino.
1. Wenn die
Schwal - ben heim - wärts ziehn, wenn die
Ro - sen nicht mehr blühn, wenn der
Nach - ti - gall Ge - sang mit der
Nach - ti - gall ver - klang, fragt das Herz in ban -
Schmerz, fragt das Herz in ban - gem Schmerz:
ob ich dich auch wie - der
seh'? Schei - den, ach Schei - den,
Schei - den tut weh! Schei - den, ach
Schei - den, Schei - den tut weh!
2. Wenn die
Schwä - ne süd - lich ziehn, dort - hin
wo Ci - tro - nen blühn, wenn das
A - bend - Rot ver - sinkt, durch die
grü - nen Wäl - der blinkt, fragt das Herz in ban -
gem
Schmerz, fragt das Herz in ban - gem Schmerz:
ob ich dich auch wie - der
seh'? Schei - den, ach Schei - den,
Schei - den tut weh! Schei - den, ach
Schei - den, Schei - den tut weh!
[L-6]
Jäger-Leben.
(Zur 8. Sektion.) Wilhelm
Bornemann. (1816).
Lebhaft. Volks-Weise
(1827.) Von Gehricke (?)
mf
1. Im Wald und auf der Hei - de, da
such' ich mei - ne Freu - de, ich bin ein
Jä - gers - Mann, ich bin ein Jä - gers-
Mann! Die For - sten treu zu pfle - gen, das
Wild - bret zu er - le - gen, mein'
Lust hab' ich da - ran, mein' Lust hab'
ich da - ran. |: Hal - li, hal - loh, hal-
li, hal - loh! mein' Lust hab' ich da - ran. :|
2. Im Wal - de hin - ge - streck - et, den
Tisch mit Moos mir deck - et, die freund - li-
che Na - tur; die freund - li - che Na-
tur; den treu - en Hund zur Sei - te, ich
mir das Mahl be - rei - te auf
Got - tes frei - er Flur, auf Got - tes
frei - er Flur. |: Hal - li, hal - loh, hal-
li, hal - loh! auf Got - tes frei - er Flur. :|
3. Und streich' ich durch die Wäl- der und
zieh' ich durch die Fel - der ein - sam den
gan - zen Tag; ein - sam den gan - zen
Tag; doch schwin - den mir die Stun - den gleich
flüch - ti - gen Se - kun - den, tracht'
ich dem Wil - de nach, tracht' ich dem
Wil - de nach. |: Hal - li, hal - loh, hal-
li, hal - loh! tracht' ich dem Wil - de nach. :|
4. Wenn sich die Son - ne nei - get, der
feuch - te Ne - bel stei - get, mein Tag - Werk
ist ge - than, mein Tag - Werk ist ge-
than, dann zieh' ich von der Hei - de zur
häus - lich - stil - len Freu - de, ein
fro - her Jä - gers - Mann, ein fro - her
Jä - gers - Mann! |: Hal - li, hal - loh, hal-
li, hal - loh! ein fro - her Jä - gers - Mann!
[L-7]
Lorelei.
(Zur 8. Sektion.)
Heinrich Heine. (1822.)
Friedrich Silcher. (1837.)
Andante.
1. Ich weiß nicht, was soll es be - deu - ten,
daß
ich so trau - rig bin; ein
Mär - chen aus al - ten Zei - ten das
kommt mir nicht aus dem Sinn. Die
Luft ist kühl und es dun - kelt, und
ru - hig fließt der Rhein; der
Gi - pfel des Ber - ges fun - kelt im
A - bend - Son - nen - schein.
2. Die schön - ste Jung - frau sit - zet dort
o - ben wun - der -[G-11] bar, ihr
gold - nes Ge - schmei - de blit - zet, sie
kämmt ihr gol - de - nes Haar. Sie
kämmt es mit gol - de - nem Kam - me, und
singt ein Lied da - bei; das
hat ei - ne wun - der - sa - me, ge-
wal - ti - ge Me - lo - dei.
3. Den Schif - fer im klei - nen Schif - fe er-
greift es mit wil - dem Weh; er
schaut nicht die Fel - sen - Rif - fe, er
schaut nur hin - auf in die Höh'. Ich
glau - be, die Wel - len ver - schlin - gen am
En - de Schif - fer und Kahn; und
das hat mit ih - rem Sin - gen die
Lo - re - lei ge - than.
[L-8]
Es ist bestimmt in Gottes Rat.
(Zur 8. Sektion.) Ernst
von Feuchtersleben. (Vor 1826.) Felix
Mendelssohn-Bartholdy. (1839.)
Poco sotenuto.
1. Es ist bestimmt in Got - tes Rat, daß
man vom Lieb - sten, was man hat, muß
schei - den. Wie-
wohl doch nichts im Lauf der Welt dem
Her - zen ach, so sau - er fällt, als
Schei - den, ja
Schei - den! :| 4. Nun mußt du mich auch
recht ver - stehn, ja
recht ver - stehn: wenn Men - schen aus - ein-
an - der gehn, so sa - gen sie: auf
Wie - der - sehn, auf Wie - der - sehn,
auf Wie - der - sehn!
Anmerkungen zu "Noten"
[N-5]Kommt nicht im Text
vor.
[N-7]"Wissenschaft" war
"Wissenschhaft"
[N-9]"schlechter" war
"schleter"
`
[N-16]"befielt's" war
"besielt's"
[N-18]"bessere." war
"bessere"
[N-19]"verbunden;" war
"verbunden,"
[N-20]Kommt nicht im Text
vor.
[N-21]"pirschte" war
"birschte"
End of the Project Gutenberg EBook of Studien und Plaudereien im Vaterland, by
Sigmon M. Stern and Menco Stern
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK STUDIEN UND PLAUDEREIN ***
***** This file should be named 35797-h.htm or 35797-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/3/5/7/9/35797/
Produced by La Monte H.P. Yarroll, Thorsten Kontowski and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.