
The Project Gutenberg EBook of Deutsche Charaktere und Begebenheiten, by Jakob Wassermann This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Deutsche Charaktere und Begebenheiten Author: Jakob Wassermann Release Date: April 26, 2006 [EBook #18258] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DEUTSCHE CHARAKTERE *** Produced by Markus Brenner and the Online Distributed Proofreading Team at http://dp.rastko.net
Mit elf Abbildungen.
Alle Rechte vorbehalten, besonders die der Übersetzung.
Erste bis vierte Auflage.
 |
| Hochzeitsfeier im Jahre 1548, |
| nach einem Bildteppich im Kunstgewerbemuseum zu Berlin. |
| Vorwort | 9 | |
| Szene zwischen Friedrich dem Großen und Ziethen | 23 | |
| nach Vehse | ||
| Böttiger | 25 | |
| nach Vehse und Schmieder, Geschichte der Alchimi | ||
| Moritz von Sachsen | 41 | |
| nach Vehse | ||
| Wallenstein | 65 | |
| nach Vehse | ||
| Leonhard Thurneyßer | 111 | |
| nach Vehse und Dr. Möhsen | ||
| Danckelmann | 125 | |
| nach Vehse | ||
| Kaiser Rudolf II. und sein Hof | 131 | |
| nach Vehse | ||
| Hochzeit Fräulein Reginens, Herrin von Tschernembel, mit Herrn Reichard Strein | 145 | |
| nach Hohenecks »Stände Östreichs ob der Ems« | ||
| Friedrich Wilhelm I. von Preußen | 149 | |
| nach Vehse | ||
| Joachim Nettelbeck | 192 | |
| nach seiner Autobiographie | ||
| Christian Holzwart | 223 | |
| nach dem Neuen Pitaval | ||
| Karl August von Weimar | 251 | |
| nach Vehse, Briefen Eckermanns Gesprächen mit Goethe | ||
Die folgende Zusammenstellung deutscher Schicksale und Ereignisse ist zum größten Teil bereits vor drei Jahren abgeschlossen gewesen, ich hatte aber die Veröffentlichung in dem Gefühl verschoben, daß ein solches Buch mehr als ein anderes von einem Bedürfnis gefordert werden müsse. Der gegenwärtige Krieg, den wir Deutsche als einen Nationalkrieg empfinden, macht es zur Pflicht, in der Erinnerung des Volkes die Bilder einiger seiner merkwürdigsten Männer wachzurufen. Es kam darauf an, das festzuhalten, was im allgemein Gültigen zugleich das begrenzteste Persönliche gibt; darum mußte ich den ursprünglichen Plan des Werkes verändern und diejenigen Lebensbeschreibungen, Erzählungen und Anekdoten entfernen, die mehr Romanhaftes und Interessantes hatten als Exemplarisches, mehr äußeren Bezug als inneren, mehr Oberfläche als Gehalt. Die Darstellung ist nicht die meine, sie ist zumeist wörtlich die der Historiker und der Quellen, die im Inhaltsverzeichnis namentlich angeführt werden; ich habe das Material übernommen, wie es sich bot, mit keinem andern Maßstab messend, als mit dem der fühl- und spürbaren Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, nur nach dem Gesichtspunkt ordnend, den ein natürlicher Überblick ergab. Den außerordentlichen Schicksalen, dient nur das Wort treu ihrem Verlauf, wohnt soviel Überzeugungskraft von selber inne, daß Stilkünste sie nur verschleiern und verzerren können, und wenn irgendwo, gilt hier der Feuerbachsche Ausspruch: Stil ist die Weglassung des Unwesentlichen. Es ist dieselbe Prozedur, die von der Geschichte, der Überlieferung in den meisten Fällen so gesetzmäßig und methodisch besorgt wird, wie von einem Strom, der alles trübe Gemengsel und unreinen Stoffe alsbald an die Ufer schwemmt oder auf den Grund sinken läßt.
Ich habe es auch unterlassen, zwischen den losen Stücken durch Ausdeutung oder Betrachtung künstliche Brücken herzustellen; das Gemeinsame liegt in ihrem Geist und Wesen, die scheinbare Willkür in der Wahl kann sich nur auf einen Zwang der Phantasie berufen, die Entscheidung gab allein ihre deutsche Herkunft und deutsche Beschaffenheit.
Unabweisbar drängt sich hier die Frage auf: Was ist ein deutscher Charakter, was ist ein deutsches Schicksal, was ist ein deutsches Ereignis?
Spreche ich vom Deutschen schlechthin, so postuliere ich eine Gestalt, die aus der Erfahrung gezogen und zur Idee gesteigert ist; als solche schließt sie eine Summe von Eigenschaften in sich, welche sowohl dem Wesen des Volkes als Ganzes zukommen, als auch dem uns überlieferten Bilde repräsentativer Männer entsprechen. Den Maßstab hierzu liefert mir das lebendige und fließende Element der Geschichte. Indem sie mir eine zergliederte, beseelte Nachricht über das Ereignis gibt, wie auch über die Personen, die in ihm eine Rolle gespielt haben, erlaubt sie mir zugleich, Ereignis und Figur zu deuten, in freier Betrachtung zu erweitern und zu verallgemeinern. Das Gesetz begreifen, das Schicksal fühlen, die auf dem von der Menschheit bisher beschrittenen Weg gewaltet haben, ist das einzige Mittel, die Wege ihrer Zukunft wenigstens flüchtig und ahnend zu erleuchten.
In diesem Sinne hat man vom deutschen Charakter zu reden und ihn als ein Umgrenztes und Unterscheidendes zu erklären. Es wäre nicht einmal notwendig, auf Stammeseigentümlichkeiten zu verweisen, auf ausgebildete und in jeder Landschaft anders geartete Merkmale der Sprache, auf die Landschaftsformen selbst, auf die wechselnden Lebensbedingungen, das größere oder geringere Maß von Freiheit, von Wohlfahrt, von Begünstigungen, die die Natur gewährt oder die durch vornehmliche Kraft, Tapferkeit, durch Fleiß oder Glück erworben wurden; man kann in einem so reichen, ja unendlich scheinenden Organismus, wie es eine Nation ist, eine unendliche Vielfalt und Variabilität der Lebenskristallisationen feststellen, und doch wird die Nation in ihrer Gesamtheit gegen eine andere, sei es auch benachbarte, sogar verwandte Nation ein völlig verschiedenes Lebens- und Wesensbild zeigen. Es eignet eben jeder Nation, genau wie jedem einzelnen, ihr besonderes Fundament, ihre besondere Willenskraft, ihre besonderen Ziele, und in der Zusammenfassung erleidet sie jenes Schicksal, zu dem ihr Charakter den Grund legt.
Der Deutsche ward nicht in einem Garten geboren, die Natur hat ihn nicht verschwenderisch beschenkt. Die Berichte aus der Vorzeit erzählen schon von dem rauhen Klima und der Kargheit des Landes, das seine Bewohner zu unermüdlicher Arbeit aufforderte und durch Überfluß nicht verwöhnte. Seitdem ist die Erde williger geworden, die Atmosphäre milder, aber die Fülle oder nur die unerwartete Gabe hat der Bauer nie erfahren, der Gärtner, der Obstzüchter nie; genau nach dem Maß seines Tuns ward ihm gelohnt.
Das Leben des Urvolks war gewiß dem Kindheitszustand aller andern Völker ähnlich; an den Grenzen finden die Feinde nur wenig natürliche Hindernisse; kriegerische Horden, von Osten und Westen her eindringend, zerstampfen die Saaten, verwüsten die Siedlungen; kann der Aufruf des Fürsten Bewaffnete genug erreichen und sammeln, so zieht er dem Bedroher entgegen und stellt ihn in freier Feldschlacht; ist er zu solchem Unternehmen zu schwach, so verschanzen sich die Mannen in ihren festen Plätzen. Immerhin mußte der Deutsche als Bewohner des Herzlands Europas mehr als andre drauf gefaßt sein, daß alles, was er baute und schuf, was er säte und sparte, was er liebte und schmückte, seine Bäume und sein Vieh, sein Heim und seine Kinder, sein Land und alle Werke darin, die Beute von schweifenden Eroberern wurde.
Aber da eine feste politische Grenze nicht vorhanden war, konnte jeder Nachbar jederzeit zum Gegner, der Freund von gestern zum Feind von morgen werden. Die Folge davon, eine immer größere Zerstückelung des Gebiets, eine beständige Lostrennung einzelner Teile, die sich dann zu selbstwilligen und der Gesamtheit trotzig entgegengesetzten Interessensphären entwickeln, trat gar bald ein und enthüllte sich als ein nationales Unglück. Um das Jahr 1200 war ganz Deutschland der Schauplatz aufreibender egoistischer Kämpfe und eines Faustrechts, das jeden Besitz und jede friedliche Arbeit gefährdete. Um ihren Handel zu schützen, auf welchem allein der Wohlstand, ja die Existenz des Bürgertums beruhte, mußten die Städte zu Mitteln greifen, die sie auch als wehrhafte Macht in Achtung setzten, und nach und nach wurde jede Stadt, auch die nicht reichsfreie, zu einer Art von Republik. Da entstand nun die schönste und eigentümlichste Blüte der Volkskraft, ein beständiges inneres Wachstum bis in die Zeit der Reformation. Die großen Schwurgesellschaften übernahmen den Schutz des Privatlebens und ersetzten so den Staat, alle einzelnen traten in Genossenschaften zusammen, und diese wieder standen durch Bünde gegeneinander.
Drohende Gefahr macht Wachsamkeit zur ersten Tugend. Ordnung muß die Vielzahl ersetzen, Zucht ist das Gebot, das die Freiheit fördert. Der Mann ist König in seinem Haus, Diener in brüderlichen Verbänden. Nur Arbeit verleiht Würde, nur Bewährung einen Vorrang, und ohne Hingebung an eine Sache wird der Geist für nichts geachtet. Wenn aber der Geist sich zur Sachlichkeit gesellt, entsteht die Idee, die das Individuum formt und das Gemeinwesen entwicklungsfähig macht. Welche Wege auch immer der Ritter, der Junker, der Gutsherr, der Bauer einschlug, die Zukunft der Nation lag in den Händen des Bürgers.
Fast jede Stadt hatte etwas trotzig Ernstes, ja Finsteres; ihre Häuser drängten sich wie Männer, die Achsel an Achsel stehen, so dicht zusammen, daß für ein Blumenbeet der Raum nicht blieb. Die spitzgiebeligen Dächer erschienen als Wahrzeichen der zur Höhe gedrängten Kraft, die engen Gassen gaben das Gefühl der Umschlossenheit, und alles Schmuckwerk wuchs gleichsam aus der Not: die Zierlichkeit massiver Gitter, die geschwungenen Steinquadern unerschütterlicher Brücken, die Feinheit und zarte Gliederung erhabener Dome, deren ursprünglich fremde Formen dem deutschen Leben und Wesen immer mehr zu eigen wurden.
Während alle andern abendländischen Völker verhältnismäßig früh zur Bildung eines staatlichen Organismus gelangten, war dies bei den Deutschen erst im Verlauf des neunzehnten Jahrhunderts der Fall. Deutsche Zerrissenheit war das Merkwort, mit dem sich der Deutsche selbst in die Unabänderlichkeit eines Weltzustandes ergab. Dies ist eine Tatsache, deren Grund zu erforschen sich wohl lohnt.
Nach allem, was wir von dem Volk der Germanen wissen, scheint es, als ob ihr religiöses Leben durch den Eintritt in das Christentum eine bedeutende Störung erlitten, als ob eine natürliche Entfaltung ihrer religiösen Anlage ein andres Ergebnis gehabt hätte als das durch die Geschichte hervorgebrachte. Darauf läßt namentlich die immer wieder zutage tretende Abneigung der Deutschen gegen den Klerus, gegen das Papsttum und seine unumschränkte Gewalt schließen. Der Papst strebte nach Weltherrschaft; ein Weltimperium zu schaffen war auch der tiefe Wille der Deutschen; ist es nicht denkbar, daß die eingeborne Macht dieser Idee dadurch gebrochen worden ist, daß die Kaisergeschlechter der Salier, Franken und Schwaben eine Art Kompromiß schlossen, indem sie eine römische Weltherrschaft auf deutschem Boden gründen, die Nation in ein römisches Kaisertum verwandeln wollten? Es war dies eine poetische Idee und nicht eine politische, und darin liegt das Verhängnis, darin der Irrtum, der Stillstand, die Unfruchtbarkeit. Der Zug über die Alpen: das romantische Abenteuer; Italien, die zweite Heimat, Provinz des Lichtes und der Schönheit, der holde Traum, die Lockung der Jahrhunderte.
Immer wieder setzen die Kräfte an diesem Punkte an, immer wieder brechen sie hier. Es lebte im Volk ein unbeirrbarer, bis ins Unbewußte gedrungener Glaube, daß es die Herrenrolle in Europa wieder übernehmen werde, die nach alten Überlieferungen die Ahnen der Vorzeit innegehabt; aber diese Überzeugung kam stets nur in den Leistungen und Werken einzelner zum Ausdruck und entbehrte dann auch nicht der Schwermut und Klage; das Staatswesen schien davon unberührt zu bleiben. Während die Reformation, diese deutscheste Bewegung in der deutschen Geschichte, die langersehnte geistige Befreiung schafft, findet der Staat im Kaiserhaus selbst einen Feind, der ihn beständig an Rom und an die Romanen verrät, und die Hoffnung der Freien und Befreiten wird durch den Dreißigjährigen Krieg, das größte Unglück, von welchem je ein Volk getroffen wurde, erstickt. Langsam sammeln sich die Kräfte wieder; es ist ein erhabenes Zeugnis für die der Nation innewohnende Tüchtigkeit und Kraft, daß sie kaum eines Jahrhunderts bedarf, um zu einer Blüte der Bildung und des geistigen Lebens zu gelangen, wie sie die Geschichte keines andern Volkes kennt, eine Blüte allerdings, die nach Gustav Freytags tiefem Wort die wundergleiche Schöpfung einer Seele ohne Leib ist.
Erst mit dem Heraufkommen des preußischen Staates kündigt sich eine neue und verheißungsvolle Periode des nationalen Lebens an. Ein neues Lebensgesetz wird von den einzelnen ergriffen und bindet sie. Gleichsam gereinigt in der Glut geistiger Erlebnisse, vor einen reinen Spiegel hingestellt durch das Genie der Dichter, das Beispiel großer Feldherrn, großer Fürsten und im wahren Sinn protestantischer Volksfreunde, erkennen die Führer, erkennt das Volk die Notwendigkeit politischer Sammlung und finden den Weg, das Ideal praktisch zu verwirklichen. Alte Instinkte trotziger Selbständigkeit werden niedergezwungen und dem Allgemeinen dienstbar gemacht, schädliches Fremdes wird ausgeschieden, nützlich und tüchtig Fremdes angeschmolzen.
 |
| Ziethen, |
| nach einem Stich von Townley. |
In preußischer Zucht und Schule wächst das neue Deutschland zur Erkenntnis und zur Erfüllung seiner Aufgabe heran. Dort vollzieht sich die Sonderung, die Wandlung, der Zusammenschluß. Ein König, dessen unerschütterliche Energie im Bewahren, Sammeln und Vorbereiten ihn zum Werkzeug des Schicksals und zum wahren Zimmermann der Fundamente macht, gibt aus scheinbar bürgerlicher Enge das ungeheure Wort von der Suveränität, die er als einen rocher de bronze statuiere, und ein Philosoph in ebenso scheinbarer bürgerlicher Enge formuliert den kategorischen Imperativ als Stützpunkt einer die ganze moderne Welt überwölbenden Moral- und Sittenlehre.
Friedrich der Große war dann der Gestalter, wenn auch nicht der Vollender, die Verkörperung wesentlicher politischer und organisatorischer Eigenschaften, mit denen die neue Zeit ihre Arbeit beginnen konnte. Vielleicht war ihm am Ende seiner unvergleichlichen Laufbahn noch nicht einmal bewußt, wie sehr er Bürger war, indem er König war. Und da seine Taten ihn zum Helden machten, schuf er eben dadurch, daß er König und Bürger zugleich war, einen neuen Begriff des Heroischen, der durch seine Einfachheit und Menschlichkeit vorbildlich wurde. In ihm hat das deutsche Gesicht seine krönende Gültigkeit erhalten und seinen beredtesten Ausdruck.
Das deutsche Gesicht! Es schwebt mir Christoph Ambergers Bildnis eines Augsburger Patriziers vor, und Holbeins Bildnis des Bürgermeisters Meyer, und Lukas Cranachs Bildnis eines alten Mannes; ich denke an Luthers Gesicht, an Keplers Gesicht, an Scharnhorsts und Nettelbecks Gesicht, an Sebastian Bachs und an Moltkes Gesicht; es sind immer dieselben Züge wie die von Brüdern und Gefährten in der Reihe der wechselnden Geschlechter.
Sie wissen den Tod, ohne ihn zu sehen, sie spüren ihn, ohne ihn zu fürchten. Wie der Tod innerstes Gefühl wird, ist in dem Dürerschen Porträt des Patriziers Oswald Grell über alle Beschreibung wahr ausgedrückt, neben einem Antlitz von feierlich ernster Versunkenheit ist eine Landschaft mit zarten Bäumen hingesetzt wie die Vision einer höheren Welt.
Was macht ihr Auge so schön, so merkwürdig? Ist es der traumvolle Blick, der dennoch im Lichte badet, die Güte ohne Weichheit, die Strenge ohne Härte? Oder das Wissen um menschliche Dinge, um die deutsche Not, die Menschennot? Es wohnt ein Horchen in ihm, wie durch Stimmen aus der Überwelt erzeugt, ein ungewisser Schimmer, der auf Vertrautheit mit den letzten Entscheidungen des Schicksals deutet. Im Schluß der Lippen liegt ein bewältigter Zorn, der sich bald in Trauer wenden mag, oder eine Stille, die die Resignation trotzig ablehnt; die Nase ersteht aus Gruben, die von Seelenleiden ausgehöhlt sind, und um die Schläfen zuckt es wie Nachgewitter von Leidenschaften, die gegen die Mitte der Stirne hin sich in einen See ruhiger und reiner Gedanken auflösen.
Dem Deutschen ward verliehen, die Dinge zu sehen und durch die Dinge hindurch sich in ein Verhältnis zu Gott zu begeben. Zwischen ihm und Gott steht das Ding; das Ding wird sein eigen oder Gott wird sein eigen, er wird Gottes oder auch des Dinges. Symbolisch groß sieht man deshalb auf der Dürerschen Melancholia eine Leiter, eine Sanduhr, einen Zirkel, einen Würfel, ein Winkelmaß und manche andere »Dinge«.
In vielen deutschen Märchen ist der schlummernde Königssohn, der Schläfer, Siebenschläfer, Scheinschläfer eine Figur wie aus Selbstanklage und dunkler Verheißung gewebt. Leicht versank der Deutsche in sich selbst, verlor sich, vergaß sich, verspielte sich, versäumte die Stunde, die Gelegenheit, die Tat. Kehrte er aber einmal sein Inwendiges nach außen, so war seine Tat so heftig, wie vorher der Traum von ihr glühend. Es mußte aber ein Unbedingtes sein, ein Höheres, gleichsam nicht mehr das Ding, sondern Gott, was ihn wandelte. Dann bot er sich zum Opfer an, und das Opfer war ihm selbstverständlich, die eigene Person stets der Preis, den er ohne Prahlerei, mit vollkommener Einfachheit des Gemütes einsetzte.
Niemand kann kleiner sein als der Deutsche, wenn ihn die Alltäglichkeit beherrscht, niemand platter und lichtloser; niemand aber auch größer, wenn das Unbedingte an ihn herantritt, das Pathos großer Ereignisse ihn hinaufreißt. In keiner Sprache gibt es ein Wort, das den Zustand unnützer und spielerischer Wehrhaftigkeit so in den Bereich des Komischen stellte wie das Wort Spießbürger; aber in keiner auch ein Wort, das höchste Tugend so karg und metallen ausdrückte, wie das Wort Held. Spießbürger und Held, das sind die Pole deutschen Lebens, und daß aus einem Spießbürger ein Held werden kann, hat der Deutsche in jeder Stunde der Gefahr bewiesen. Hierzu brauchte er nur den Glauben an die Gerechtigkeit der Sache; es durfte nur der Sache nichts Erschlichenes anhaften, nichts Künstliches, nichts Verfeinertes, nichts Advokatisches; sie mußte sozusagen rauh und urtümlich sein und ihn im Mittelpunkt des Herzens treffen, dann wurde sein Herz zum Mittelpunkt der Welt.
Seine Anteilnahme kann bis zur Unbequemlichkeit lärmen, doch seine Begeisterung ist fast immer von stiller Art. Romanischen Völkern eignet oft eine Begeisterung ohne Tiefe, eine müßige und eitle, der begleitenden Tat ermangelnde; deutsche Begeisterung ist wie Essenfeuer; Hammer und Amboß, Huf und Schwert sind nicht weit davon entfernt. Der still Begeisterte, mehr Erglühte als Entflammte, das ist der Mensch, der des Fanatismus nicht fähig ist, und die Zustände jenseit der Selbstbesinnung finden wir beim Deutschen mehr im Gebiet des Religiösen und rein Geistigen, der Mystik und des Prophetentums, als in dem der Politik und des gemeinen Lebens.
So ist auch das Exzentrische dem deutschen Wesen fremd; seine Anlage ist konzentrisch. Er ist gefaßt; er weiß um seine Grenzen, wennschon sein Verlangen stets nach dem Grenzenlosen geht. Er ist beschaulich, bleibt aber nicht im Bilde ruhen, sondern verirrt sich gern in die Labyrinthe der Spekulation. Alles muß für ihn Bezug haben, Verbindung, Folge, – insoweit es das Geistige betrifft; daher seine Schwerfälligkeit, seine Pedanterie, sein Respekt vor dem Wissen, sein Zuviel an Schulbildung, sein Mangel an Glätte, an Schmiegsamkeit und an Manier. Insoweit es aber das Gemüthafte betrifft, braucht er keinen Bezug und achtet keine Folge; da wird ihm die Welt zum einheitlichen Gebilde, das Schicksal ein gerechter Herr, und in seiner Seele ist die Menschheit.
Wichtig vor allem ist ihm die Scholle; erstes Gesetz, die Hantierung, die er gelernt, zur Vollkommenheit auszubilden; einem Herrn zu dienen Bedürfnis und Freude; einen großen Gedanken in seiner Brust zu hegen und zu wärmen beinahe Kultus. In den Zeiten seiner politischen Unreife übersah er, daß die Scholle nur ein winziger Teil des Ganzen ist und segensvoller gedeiht, wenn auf der Nachbarscholle nicht der beargwöhnte Gegner, sondern der mitwirkende Freund haust; bedachte er nicht, daß die Hantierung vom Allgemeinen aus- und zum Allgemeinen zurückgehen muß, damit ineinanderwachsende Kräfte durch Überlieferung erstarken und erblühen können und nicht das einzelne vereinzelt mit sich selber stirbt; mißkannte er, daß es keinen Herrn gibt, der nicht der Diener seiner Diener ist; versäumte es, sich zum Herren seiner Herren zu machen und so, im Geflecht von Ordnung und Herrschaft, von Bürgerpflichten und Herrenrechten, von Herrenpflichten und Bürgerrechten das glückliche Glied eines glücklichen Volkes zu werden.
Dies ist anders geworden. Es war ein Prozeß, so schwierig und langwierig, daß die Besten immer wieder an ihrer Hoffnung verzweifelten und das Blut edler Märtyrer vergeblich geopfert schien. Der Prozeß ist gewonnen. Das verflossene Jahrhundert hat die deutsche Nation wiedergeboren, sie aus romantischer Dämmerung an den lichten Tag der Geschichte geführt und ihr, in Pflicht und Liebe, in Neigung und Interesse das Reich der Realität geöffnet. »Der Realismus, welchen man rühmend oder zürnend die Signatur der Gegenwart nennt,« sagt Gustav Freytag, »ist in Kunst und Wissenschaft, im Glauben wie im Staate nichts als die erste Bildungsstufe einer aufsteigenden Generation, welche das Detail des gegenwärtigen Lebens nach allen Richtungen zu vergeistigen sucht, um dem Gemüt neuen Inhalt zu geben.«
Der Deutsche hat die ihm gemäße Art von Politik gefunden; ich möchte sie die Politik des unbeirrbaren Triebes nennen; die Politik der Entfaltung, der Erkenntnis und der Bestimmung. Sie kann der Winkelzüge, der veralteten Rezepte und geheimen Wege entraten, da sie auf den natürlichen Rechten des Geistes und Herzens ruht, nicht auf willkürlichen Machenschaften, sondern auf einer Notwendigkeit und einer welthistorischen Idee.
Der Siebenschläfer, aufgewacht ist er ja längst, hat sich auf diesem Planeten ein gewaltiges Haus gebaut. Gestern ist es unter Dach gebracht worden. Schon grüßen die Tannenreiser vom First.
Nach dem glücklich beendeten Siebenjährigen Krieg sah Friedrich unter seinen Tischgenossen vorzüglich gern den alten General Ziethen. Wenn gerade keine fürstlichen Personen zugegen waren, mußte Ziethen immer an der Seite des Königs sitzen. Einstmals hatte er ihn auch zum Mittagessen am Karfreitag eingeladen, aber Ziethen entschuldigte sich; er könne nicht erscheinen, weil er an diesem hohen Festtag immer zum heiligen Abendmahl gehe und dann lieber in seiner andächtigen Stimmung bleibe; er dürfe sich darin nicht unterbrechen und stören lassen. Als er das nächstemal zur königlichen Tafel in Sanssouci erschien und die Unterredung wie stets einen heiteren, fröhlichen und geistreichen Gang genommen hatte, wandte sich der König mit scherzender Miene an seinen Nachbar. »Nun, Ziethen,« sagte er, »wie ist Ihm das Abendmahl am Karfreitag bekommen? Hat Er den wahren Leib und das wahre Blut Christi auch ordentlich verdaut?« Ein lautes spöttisches Gelächter schallte durch den Saal der fröhlichen Gäste. Der alte Ziethen aber schüttelte sein graues Haupt, stand auf, und nachdem er sich vor seinem König tief gebeugt, antwortete er mit fester Stimme: »Eure Majestät wissen, daß ich im Kriege keine Gefahren fürchte und überall, wo es darauf ankam, für Sie und das Vaterland mein Leben gewagt habe. Diese Gesinnung beseelt mich auch heute noch, und wenn es nützt und Sie es befehlen, lege ich meinen Kopf gehorsam zu Ihren Füßen. Aber es gibt einen über uns, der ist mehr als Sie und ich und mehr als alle Menschen, das ist der Heiland und Erlöser der Welt, der für Sie gestorben und uns alle mit seinem Blut teuer erkauft hat. Diesen Heiligen lasse ich nicht antasten und verhöhnen, denn auf ihm beruht mein Glaube. Mit der Kraft dieses Glaubens hat Ihre brave Armee mutig gekämpft und gesiegt. Unterminieren Eure Majestät diesen Glauben, so unterminieren Sie die Staatswohlfahrt. Das ist gewißlich wahr. Halten zu Gnaden.«
Die Tafelgesellschaft war totenstill geworden. Der König war sichtbar ergriffen. Er erhob sich, reichte dem General die rechte Hand, legte die linke auf seine Schulter und sagte: »Glücklicher Ziethen! Möchte ich es auch glauben können! Ich habe allen Respekt vor Seinem Glauben. Bewahre Er ihn. Es soll nicht wieder geschehen.«
Kein Mensch hatte den Mut, ein Wort weiter zu reden. Auch der König fand zu einem andern Gespräch keinen schicklichen Übergang, er hob die Tafel auf und gab das Zeichen zur Entlassung. Dem General Ziethen befahl er: »Komme Er mit in mein Kabinett.«
Unter die große Zahl merkwürdiger Männer, die das achtzehnte Jahrhundert in Deutschland hervorbrachte, gehört auch Johann Friedrich von Böttiger, der zufällige Erfinder des Porzellans. Böttiger war ein geborener Sachse; er ward geboren zu Schleiz im Vogtlande, wo sein Vater bei der Münze angestellt war. Da seine Mutter sich zum zweitenmal mit dem magdeburgischen Stadtmajor und Ingenieur Tiemann verheiratete, erhielt er frühzeitig Unterricht in der Mathematik und in der Fortifikationskunst, zeigte aber eine auffallende Neigung zur Chemie. Schon mit zwölf Jahren kam er als Lehrling in die Zornsche Apotheke nach Berlin, wo er sich sofort aufs Goldlaborieren legte. Er wurde dabei durch den berühmten Johann Kunkel aufgemuntert, der im Zornschen Haus verkehrte und von dem jungen Menschen so bezaubert war, daß er überall seine Talente und Kenntnisse rühmte.
Um diese Zeit reiste ein großer Unbekannter durch Europa, der unter mancherlei Namen und vielfach verkleidet auftrat. Er schien kein anderes Ziel zu haben, als die Ehre der Alchimie zu retten, und verwendete darauf ungeheure Summen, wenn auch mit großer Vorsicht. Wenn die Transmutationen nach seinen Angaben versucht wurden und Aufsehen erregten, war er immer schon weit entfernt und durch Namenwechsel unerreichbar geworden. Er kehrte nicht leicht dahin zurück, wo er schon gewesen, oder doch in ganz veränderter Gestalt. Dieser Unbekannte, welcher Goldsamen ausstreute, bezeichnete sich, wenn man nach Pässen und dergleichen fragte, als einen griechischen Bettelmönch und nannte sich Laskaris; er wollte Archimandrit eines Klosters auf der Insel Mytilene sein und führte als solcher auch ein Beglaubigungsschreiben des Patriarchen von Konstantinopel mit sich. Da er das Griechische vollendet sprach und sich auch sonst keine Blöße gab, wurde seinen Angaben geglaubt, und man war sogar geneigt, ihn für einen Abkömmling der kaiserlichen Familie Laskaris zu halten. Er sammelte Almosen zur Loskaufung von Christen, die in türkische Gefangenschaft geraten waren, allein man wollte bemerkt haben, daß er weit mehr an die Armen verschenkte, als ihm die Kollekte eintrug, und demnach mochte es ihm mit seiner Mission wenig ernst sein. Die Nachrichten über ihn beruhen auf dem Zeugnis glaubhafter Personen, die ihn als einen Mann von gefälligem Betragen schildern, sehr unterrichtet und voll von Interessen, was eher auf einen gebildeten Abendländer, als auf einen morgenländischen Klosterbruder schließen läßt.
Als der geheimnisvolle Fremde im Jahre 1701 nach Berlin kam, erkundigte er sich bei dem Gastwirt, ob es in Berlin auch Alchimisten gebe. An dergleichen Narren sei kein Mangel, antwortete treuherzig der Wirt und nannte unter anderen den Apotheker Zorn. Der Fremde ging bald darauf in die Zornsche Offizin und fragte nach einem chemischen Medikament. Der Provisor befahl einem Gehilfen, den Laboranten zu rufen. Es erschien ein junger Mensch, der Lehrling Böttiger. Auf die Frage des Fremden, ob er dem Laboratorium vorstehe, weil man ihn den Laboranten nenne, erwiderte er gutmütig lachend, man tue dies zum Spaß, weil er in seinen Nebenstunden zuweilen chemische Experimente mache. Dem fremden Herrn gefiel der Jüngling, und zur Einleitung einer näheren Bekanntschaft trug er ihm auf, ein Antimoniumpräparat herzustellen und ihm dieses ins Gasthaus zu bringen.
Als Böttiger das bestellte Präparat brachte, plauderte der Fremde mit ihm. Böttiger wurde zutraulich und gestand, daß er den Basilius Valentinus besitze und unverdrossen nach ihm arbeite. Er wiederholte seine Besuche und gewann die Gunst des Fremden immer mehr. Als dieser endlich abreisen wollte und die Pferde schon warteten, ließ er Böttiger noch einmal rufen und eröffnete ihm, daß er selbst das große Geheimnis besitze, und schenkte ihm zwei Unzen von seiner Tinktur, mit der Anweisung, daß er noch einige Tage davon schweigen, dann aber die Wirkung der Tinktur zeigen möge, wenn er wolle, damit man in Berlin die Alchimisten nicht mehr Narren schelte.
Nach der Entfernung des Fremden säumte Böttiger nicht, sich von dem Wert des Geschenks zu überzeugen. Bald zeigte er den Gehilfen, die ihn bis dahin verspottet hatten, gutes Gold als Produkte seiner Kunst und sagte, er sei entschlossen, die Pharmazie aufzugeben, nach Halle zu gehen und Medizin zu studieren. In der Tat nahm er den Abschied von seinem Prinzipal und bezog eine Mietwohnung. Er verkehrte mit Alchimisten, vornehmlich mit einem Laboranten namens Siebert. Eines Tages wurde er von dem Apotheker Zorn zu Tisch gebeten. Er traf dort zwei Freunde, den Pfarrer Winkler von Magdeburg und den Pfarrer Borst von Malchow. Die beiden Geistlichen vereinigten sich, dem achtzehnjährigen Menschen vorzustellen, daß er zum sicheren Broterwerb zurückkehren und nicht einer eingebildeten Kunst nachhängen solle; das Unmögliche, sagten sie, könne er doch nicht möglich machen. Er aber erbot sich, das Unmögliche sogleich möglich zu machen, und forderte sie auf, Zuschauer zu sein. Die ganze Tischgesellschaft verfügte sich nun mit ihm in das Laboratorium.
Hier nahm Böttiger einen Tiegel und wollte Blei darin schmelzen, als aber die Gegner sein Blei verdächtig finden wollten, wählte er statt dessen Silbergeld von bekanntem Gehalt. Die preußischen Zweigroschenstücke waren damals fünflötig, und von diesen nahm er dreizehn Stück. Während sie zusammenschmolzen, brachte er eine silberne Büchse hervor, die den Stein der Weisen in Gestalt eines feuerroten Glases enthielt. Er löste davon einige Körnchen ab, streute sie auf das fließende Metall und verstärkte die Glut. Danach reichte er den Zweiflern das ausgegossene Metall dar, und staunend überzeugten sich diese, daß es zum reinsten Gold geworden war.
Dem Laboranten Siebert zeigte Böttiger eine größere Transmutation in andern Metallen. Siebert mußte acht Lot Quecksilber in einem Tiegel heiß machen; auf die Masse warf Böttiger soviel als ein Handkorn groß von einem braunroten Pulver, das er zuvor in Wachs impastiert hatte. Dadurch wurde das Quecksilber ganz und gar in Pulver verwandelt, dieses Pulver wickelte er in Blei und ließ es schmelzen. Nach einer Viertelstunde war alles Metall zu Gold geworden.
Diese und andere Proben, welche Böttiger neugierigen Bekannten zeigte, machten ihn bald zum Helden des Tages, und das um so mehr, als er nicht für gut fand, die Wahrheit zu gestehen, sondern sich selbst als Erfinder des Pulvers bewundern zu lassen. Die Erfahrenen nannten ihn Adeptus ineptus und prophezeiten ihm Unheil, welche Prophezeiung sich auch bald erfüllte. Die Stadtgespräche drangen in die königlichen Vorzimmer und bis zu König Friedrich I. selbst. Der König ließ nachfragen und fand es geboten, sich des jungen Adepten zu versichern. Schon war Befehl erteilt, ihn zu verhaften, als ein Bekannter ihn warnte. In der Nacht verließ er Berlin zu Fuß und eilte, Wittenberg zu erreichen. Während er über die Elbe gesetzt ward, sah er hinter sich ein preußisches Kommando, das man ihm nachgeschickt hatte. In Wittenberg wohnte seiner Mutter Bruder, der Professor Kirchmaier, der auch als alchimistischer Schriftsteller von sich reden gemacht hatte. Bei ihm wäre Böttiger geborgen gewesen, allein der preußische Hof reklamierte ihn in Dresden als preußischen Untertan. Der Grund hierzu blieb bei dem erregten Aufsehen kein Geheimnis; der sächsische Hof ward aufmerksam. Man verweigerte die Auslieferung, weil sich ergab, daß er in Sachsen geboren sei. König August II. ließ ihn nach Dresden bringen und freute sich, daß ihm ein so seltener Vogel zugeflogen war, denn die Nachrichten aus Berlin ließen ihn nicht daran zweifeln, daß Böttiger wirklich ein Adept sei.
Böttiger zeigte dem Statthalter Fürstenberg die Tinktur und ihre Wirkung. Er überließ ihm eine Probe seines Arkanums, auch ein Gläschen voll Merkur, und damit reiste Fürstenberg zum König nach Warschau. Fürstenberg mußte einen Eid leisten, daß er mit dem König nicht früher eine Probe machen würde, als bis er auf Ehre und Gewissen versprochen habe, Zeugen nicht zuzulassen, auch weder jetzt noch künftig jemandem das Geheimnis zu entdecken. Ferner hatte Böttiger es ihm eingeschärft, nicht ohne Gottesfurcht und Frömmigkeit ans Werk zu gehen, weil darauf unendlich viel ankomme.
Kaum war Fürstenberg beim König angelangt, als im Zimmer des Königs ein Hund die Schachtel umwarf, in der sich das Glas mit Merkur befand, so daß dieses zerbrach. Böttiger hatte versichert, der Merkur sei von ganz besonderer Beschaffenheit, er war also in Warschau nicht zu ersetzen. Nichtsdestoweniger nahmen am zweiten Weihnachtsfeiertag, in tiefer Nacht, in einem der innersten Zimmer des Schlosses und bei verriegelten Türen der König und Fürstenberg die Probe vor. Die beiden Tiegel, die Böttiger mitgegeben hatte, wurden mit Kreide bestrichen, in den größeren Tiegel die Tinktur mit Merkur, wie er in Warschau zu kaufen war, und Borax getan, der zweite Tiegel darauf gestürzt und die Masse anderthalb Stunden lang ins Glühfeuer gestellt. Das Resultat des Prozesses war nicht Gold, sondern ein so fester Körper, daß man die Tiegel zerschlagen mußte, um ihn zu gewinnen. Fürstenberg schrieb an Böttiger, daß der König selbst über zwei Stunden beim Feuer gesessen sei; an der gehörigen Frömmigkeit habe es bestimmt nicht gefehlt, da der König zwei Tage vorher das heilige Abendmahl genossen und er, der Fürst, seine Gedanken ebenfalls einzig auf Gott gerichtet habe; trotzdem sei das Experiment, dessen Gelingen Böttiger dem König so sicher vorgespiegelt habe, gänzlich mißlungen.
Im Januar 1702 kehrte Fürstenberg wieder nach Sachsen zurück. Er traf Böttiger, der in seinem Hause wie ein Gefangener behandelt wurde, höchst unzufrieden; der lebenslustige junge Mensch drohte sich zu ermorden, wenn man ihm nicht die Freiheit gebe. Fürstenberg ließ ihn deshalb auf die Festung Königstein bringen, doch hier wurde Böttiger noch viel wilder. Nach einem Bericht des Kommandanten schäumte er wie ein Pferd, brüllte wie ein Ochse, knirschte mit den Zähnen, rannte mit dem Kopf gegen die Mauer, arbeitete mit Händen und Füßen, kroch an den Wänden entlang und zitterte am ganzen Leibe. Zwei starke Soldaten konnten seiner nicht Herr werden; er hielt den Kommandanten für den Engel Gabriel, verzweifelte wegen der Sünde an dem heiligen Geist an seiner ewigen Seligkeit und trank dabei oft zwölf Kannen Bier täglich, ohne betrunken zu werden. Man konnte nicht klar sehen, ob alles dies auf Verstellung beruhte.
Nun kam aber der Befehl vom Statthalter, ihn nach Dresden zu schaffen, und Fürstenberg nahm ihn wieder in sein Haus. Hier war es, wo er mit dem berühmten Tschirnhausen bekannt wurde. Ehrenfried Walter von Tschirnhausen gehörte zu Fürstenbergs vertrautesten Freunden. Sooft er von seinem alten Stammgut Kieslingswalde nach Dresden kam, wohnte er beim Statthalter und arbeitete beim Fürsten in dessen Laboratorium. Er war einer der ausgezeichnetsten Naturverständigen seiner Zeit, durch ihn sind in Sachsen die Glashütten eingeführt worden. Er hatte zwölf Jahre lang ganz Europa bereist und war Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften. Wie Kunkel in Berlin, so nahm sich Tschirnhausen in Dresden Böttigers an, und dies verlieh Böttiger auf einmal wieder große Wichtigkeit, so daß man jahrelang Geduld mit ihm hatte und immer hoffte, er werde das große Werk leisten. Er selbst hoffte es.
 |
| Joh. Friedr. Böttiger, |
| nach einem Medaillon im Museum zu Gotha. |
Böttiger erhielt nun seine Einrichtung im königlichen Schloß. Er bewohnte zwei Zimmer mit der Aussicht auf den Hofgarten, den sogenannten Probiersaal und einige Gewölbe zum Laborieren, die große Opernstube als Billardzimmer und das Kirchstübchen des Gärtners zu seiner Andacht. Alle Räume waren neu möbliert worden. Er durfte in dem an seine Wohnung stoßenden Feigengarten spazieren gehen, und wenn er ausfahren wollte, stand ihm eine königliche Equipage zur Verfügung. Zu seiner Beaufsichtigung wurde der Sekretär Nemitz bestimmt, der dafür ein besonderes Zimmer im Schloß hatte, nach Belieben Gäste einladen konnte, aber bei Verlust seiner Freiheit für Böttiger verantwortlich war. Außer Tschirnhausen durfte niemand ohne seine Erlaubnis zu Böttiger gehen. Ein Baron Schenk war angewiesen, Böttiger in dessen freien Stunden Gesellschaft zu leisten, ihm die Zeit zu vertreiben und, wenn er es verlangte, im roten Zimmer mit ihm zu speisen. Es speisten auch viele andere Personen bei ihm, so der Bergrat Pabst von Ohain, der berühmte Metallurg, der geheime Kammerier Starke, ein Liebling des Königs, der seine Schatulle besorgte, und der Sekretär Malhieu; Tschirnhausen, der Böttiger so lieb gewonnen hatte, daß er sich mehr in Dresden als in Kieslingswalde aufhielt, war häufig sein Gast und brachte manchmal den Statthalter mit. Böttigers Deputat im Schlosse waren mittags und abends fünf Gerichte mit Wein und Bier. Das Tafelgerät war aus Silber. Er konnte Geld haben soviel er wollte, man hielt ihm sogar Mätressen wie einem vornehmen Kavalier.
Böttigers Umgang hatte, wenn er bei Laune war, ungemein viel Anziehendes. Er war ein jovialer Mensch mit der lebendigsten Unterhaltungsgabe, mit der er alle zu bezaubern wußte. Der Statthalter lebte mit ihm auf vertrautem Fuß, fuhr oft mit ihm nach Moritzburg auf die Jagd, die Böttiger leidenschaftlich liebte, und schrieb ihm die zärtlichsten Briefe. Auch der König, der sich mit Bezug auf Böttiger überschwenglichen Hoffnungen hingab, behandelte ihn in seinen Briefen mit großer Rücksicht. Er gratulierte ihm zum neuen Jahr, versichert ihm wiederholt, daß der Statthalter die Vollmacht habe, alles nach Böttigers Belieben einzurichten, und ihm niemand aufdringen dürfe, der von »widrigem Naturell« sei. In Briefen des Königs an andere wird er Monsieur Schrader genannt oder »die Person« oder »der Bewußte« oder »l’homme de Wittenberg«; Böttiger selbst unterzeichnete sich nur mit seinen beiden Vornamen oder mit Notus.
Anderthalb Jahre lang war Böttiger vor dem Mißtrauen des Königs durch den Hund geschützt, der in Warschau die Schachtel mit dem Merkurglas umgeworfen hatte und der Vorwand genug gab, zu sagen, der König und sein Minister seien bei dem Tingierversuch ohne Geschick verfahren. Während dieser anderthalb Jahre lebte Böttiger in Herrlichkeit und Freude. Sein Aufenthalt kostete dem König vierzigtausend Taler. Böttiger war bei den Leuten von gutem Ton allgemein beliebt. Man speiste gern bei ihm, denn er legte jedem Gast eine große, goldene Schaumünze von eigener Arbeit unter den Teller; dies bewog sogar die Damen, sich zahlreich bei ihm einzufinden. Man spielte auch gern mit ihm, weil er gern verlor.
Die hohe Ehre hatte seinen Kopf so gänzlich eingenommen, daß er kaum der Möglichkeit gedachte, sein Schatz könne erschöpft werden. Allenfalls erwartete er von einigen Winken, die Laskaris im Gespräch hatte fallen lassen, daß sie ihn auf den rechten Weg führen würden, wenn es Zeit sei, ihn zu suchen. Diese Zeit schob er leichtsinnig hinaus, bis endlich Bedürfnis und Verlegenheiten mahnten, an die Auffindung der Goldquelle mit Ernst zu denken. Da fand er sich aber in seiner Hoffnung bedroht. Was er auch probierte, alles schlug fehl, und er überzeugte sich, daß er sich die Sache zu leicht gedacht habe und weit vom Ziel entfernt sei. Die berechnende Politik seiner Gönner wähnte sich jetzt am Ziel. Böttigers sechs Bediente waren schon längst gewonnen und belauerten ihn Tag und Nacht. Was sie berichteten, gefiel nicht mehr. Man argwöhnte, daß er die Umstellung merke und absichtlich das Rechte verfehle, um seine Kunst für sich zu behalten. Da erfuhr man, daß er Vorbereitungen treffe, um heimlich nach Österreich zu entweichen, und nun wurde seine Wohnung, sogar sein Zimmer mit Wachen besetzt.
Indessen hatte Laskaris, der noch in Deutschland reiste, seinen jungen Freund nicht aus den Augen verloren, und der üble Ausgang, welchen Böttigers Angelegenheiten in Dresden zu nehmen drohten, machte ihm Sorge, da er sich vorwerfen mußte, den Jüngling in Versuchung geführt zu haben. Er entschloß sich daher, ihn zu befreien und große Opfer nicht zu scheuen. In solcher Absicht wagte er sich im Jahre 1703 zum zweitenmal nach Berlin. Er ließ einen jungen Arzt, den Doktor Pasch, zu sich kommen, der mit Böttiger vertrauten Umgang gehabt hatte und unternehmend genug zu sein schien. Diesem eröffnete er alle Schwierigkeiten, trug ihm auf, nach Dresden zu gehen, dem König Böttigers Unwissenheit zu erklären und ihm für dessen Freilassung die Summe von achtmalhunderttausend Dukaten zu bieten, die man in Holland oder in einer beliebig zu bestimmenden deutschen Reichsstadt erheben könne. Um den Sendboten von der Aufrichtigkeit seines Anerbietens zu überzeugen zeigte er ihm einen Vorrat von Tinktur, der über sechs Pfund wog. Er bewies ihm durch Versuche, daß mit dieser Masse ein Zentner Gold in lauter Tinktur verwandelt werden könne, die dann noch drei- bis viertausend Teile Metall in Gold zu veredeln vermöge. Er gab ihm eine Probe für den König mit und versprach, ihn ebenso reich wie Böttiger zu beschenken, wenn er sich seines Auftrages gut entledigte.
Doktor Pasch begab sich auf den Weg. Er war mit zwei Herren verwandt, die am Dresdner Hof großen Einfluß hatten. Durch ihre Vermittlung hoffte er leichter zum König zu gelangen und machte ihnen deshalb sein Anliegen bekannt. Sie urteilten aber, ein so hoher Preis werde den König eher bestimmen, den Verhafteten noch besser zu bewahren, weil es ja den Anschein habe, als lasse Böttiger selbst durch dritte Hand soviel für seine Freiheit bieten. Außerdem meinten sie auch, daß dem König an ein paar Millionen Talern nicht soviel gelegen sein könne als ihnen, und sie kamen überein, Böttiger in der Stille fortzuschaffen und den Preis mit Doktor Pasch zu teilen.
Auf ihre Veranstaltung bezog Pasch eine Wohnung dicht neben dem Hause, worin Böttiger bewacht wurde. Er konnte ihm aus dem Fenster zuwinken, wurde sogleich von ihm erkannt, fand Mittel, ihm Briefe zu schicken, erhielt auf demselben Weg die Antworten, gab ihm Kunde von der nahenden Hilfe und verabredete mit ihm den Plan der Flucht.
Böttigers Bediente ließen sich das Hin- und Hertragen der Briefe gut bezahlen, berichteten aber höheren Orts über den Briefwechsel und lieferten die folgenden Briefe aus. Nichtsdestoweniger gelang es Böttiger zu fliehen. Er kam bis nach Enns in Österreich, wurde aber dort aufgegriffen und nach Sachsen auf den Sonnenstein zurückgebracht. Doktor Pasch war dritthalb Jahre lang Gefangener auf der Feste Königstein. Nach vielen Bemühungen zeigte sich ein Soldat willig, ihm zur Flucht zu verhelfen. Beide ließen sich an einem Seil herab, welches aber nicht bis zum Boden reichte; der Soldat kam glücklich an, Pasch jedoch fiel auf einen Felsen und zerbrach das Brustbein. Sein Gefährte trug ihn bis zur böhmischen Grenze, und von da gelangte er auf Umwegen nach Berlin zurück. Den Adepten Laskaris sah er nicht wieder, und seine Klagen, wie er vergeblich Jugend und Gesundheit zugesetzt habe, wurden stadtkundig in Berlin. Der König ließ ihn vor sich kommen und hörte seine Erzählung an. Sein Körper blieb siech von jenem Fall; nach anderthalb Jahren starb er.
Auf dem Sonnenstein wurde Böttiger sehr streng bewacht. Im Januar 1704 kam der König August nach Sachsen und lernte Böttiger persönlich kennen. Er bestand darauf, daß der Bergrat Pabst zur Bereitung des großen Arkans bei Böttiger förmlich Unterricht nehme. Pabst, Tschirnhausen und der Statthalter beschworen nun feierlich sechsunddreißig Kontraktpunkte, die auch der König durch seinen schriftlichen Eid unverbrüchlich zu halten versprach. Böttiger machte zur Bedingung, daß von dem gewonnenen Golde »nichts zur Üppigkeit sündhaften Aktionibus, boshafter Verschwendung, unnötigen und unbilligen Kriegen verwendet werden dürfe; auch dürfe, wer das Arkan besitze, nie einem Herrn dienen, der öffentlichen und schändlichen Ehebruch treibe und unschuldiges Blut vergieße«.
Im September 1705 übergab Böttiger auf zwanzig Folioseiten einen Prozeß zum Universal; kurz darauf machte er einen Tingierversuch, welcher gelang, aber der Kämmerer Starke sagte, es wären verschiedene Umstände passiert, die »zu einem konzentrierten Betrug ziemlichen Soupson gegeben«. Wiederholt bat nun Böttiger um seine Freiheit und machte den König vor Christi Richterstuhl dafür verantwortlich. Der König ließ ihn aber nicht los; vom Sonnenstein wurde er auf die Albrechtsburg bei Meißen geschafft, dann kam er wieder auf den Königstein und im Herbst 1707 nach Dresden zurück.
Hier ließ er nun Materialien aller Art herbeischaffen und verfuhr nach der berühmten mephistischen Tafel, das heißt, er kochte alles durcheinander. Und so, ganz zufällig, erfand er eines Tages, es war das sechste Jahr seiner Haft, das braune Jaspisporzellan und später, als er schon etwas methodischer zu Werke ging, das weiße Porzellan. Nach Tschirnhausens Rat bildete er diese Erfindungen technisch aus, wobei er seiner enthusiastischen Natur gemäß so eifrig war, daß er mehrere Nächte in kein Bett kam. In einem Schreiben an den König gestand er endlich, daß er kein Adept sei.
Der König begnügte sich jedoch mit dem Porzellan, das ihm bei der damaligen Kostbarkeit des chinesischen Porzellans beinahe so lieb wie eine Goldfabrik war. Die Manufaktur wurde sofort im großen durch herbeigezogene holländische Steinbagger betrieben. Das auf der Albrechtsburg zu Meißen hergestellte Porzellan verdrängte bald das chinesische und japanische, für das der König August noch Millionen ausgegeben hatte, und wurde einer der begehrtesten Luxusartikel der eleganten Welt. Eine Menge Dinge, die bisher aus Marmor, Metall oder Holz gemacht waren, wurden jetzt aus Porzellan fabriziert, sogar Särge; die Witwe eines Oberstallmeisters wurde in einem Porzellansarg begraben, der aber beim Hinuntersenken in die Gruft zerbrach. Wahrscheinlich hatten neidische Tischler die Leichenträger bestochen. Die Hauptkunstwerke, die man in Meißen herstellte, waren die kleinen, aufs feinste und schönste bemalten Figuren, und wie der »zerbrochene Spiegel«, »das Blumenmädchen«, »die fünf Sinne« beweisen, brachte man es darin zu einer hohen Vollendung. Der Vertrieb der Fabrik stieg bis über zweimalhunderttausend Taler, und die Kosten betrugen nur die Hälfte; gegen achtzig Kommissionslager und Handelshäuser führten das Verkaufsgeschäft.
Des Fabrikgeheimnisses wegen mußte Böttiger noch eine Zeitlang Gefangener bleiben, doch zeigte sich der König sehr gnädig gegen ihn, besuchte ihn häufig auf der Bastei und schoß mit ihm nach der Scheibe. Er erhielt Zutritt zu den Privataudienzen, sooft er wünschte, und wiederholt befahl der König, ihn vor Ärgernis zu schützen. Er schenkte ihm einen Ring mit seinem Bildnis, einen jungen Bären und ein Paar Affen und gab ihm offenen Kredit bei dem Hofjuden Meyer. Sechs Jahre nach der Erfindung wurde ihm die Meißner Porzellanfabrik zur freien Disposition ohne alle Rechnungslegung überlassen. Er lebte in Dresden auf großem Fuß, hielt eine zahlreiche Dienerschaft und eine Menge Hunde. Ausschweifungen in der Liebe und im Trunk verkürzten sein Leben; er starb im März 1713, erst vierunddreißig Jahre alt.
Kurfürst Moritz war der Sohn Herzog Heinrichs des Frommen und am 21. März 1521 geboren. Er war ein kräftiger Mann, geschmeidigen Körperbaus; sein braunes Gesicht verkündete den Helden. Seine Augen waren so glänzend, daß sie funkelten und wie von Flammen sprühten; schaute er unversehens jemand an, so mußte dieser den Blick niederschlagen. Seltsam waren in seiner Erziehung die Elemente gemischt. Sein Vater, den die Untertanen wegen seiner Gutmütigkeit liebten, war bei aller Frömmigkeit ein Mann ganz eigenen Schlages. Er hatte einen sonderbaren Geschmack am Bunten und eine sonderbare Vorliebe für Kanonen. Er ließ anstößige Bilder auf die Kanonen malen, und Lukas Cranach mußte ihm dazu die Zeichnungen machen. Er kaufte alle schönen Gemälde für seine Kanonen, die er nur auftreiben konnte, und obgleich er das Geschütz nie brauchte, konnte man ihm doch keine größere Freude bereiten, als wenn man ihm sagte, Kaiser Karl habe von seinen Kanonen gesprochen. Vom Hof seines Vaters kam Moritz an den des Kurfürsten von Mainz und sah hier das üppig schwelgerische Treiben eines katholischen Kirchenfürsten. Und dann weilte er bei seinem Vetter Johann Friedrich von Sachsen, wo er die traurige Einförmigkeit eines protestantischen Hofes der damaligen Zeit kennen lernte. Johann Friedrich hatte große Schwächen, der kluge Moritz durchschaute sie, er faßte einen Widerwillen gegen den Vetter, er konnte ihn nicht leiden, den dicken Hoffart, wie er ihn zu nennen pflegte.
Noch ehe er zwanzig Jahre alt war, vermählte er sich mit Agnes, der Tochter Friedrichs des Großmütigen von Hessen. Sein Vater war über die verfrühte Ehe so unglücklich, daß der Kummer sein Leben verkürzte; er starb wenige Monate nach der Hochzeit, und Moritz folgte ihm in der Regierung. Trotz seiner Heiratsungeduld mußte aber seine Frau später über ihn klagen, daß er die Wildschweinsjagd ihrer Gesellschaft vorziehe.
Moritz bekannte sich zur evangelischen Lehre wie sein Vater, aber er trat nicht in den schmalkaldischen Bund, so oft ihn auch sein Vetter, der Kurfürst, und sein Schwiegervater, der Landgraf, darum mahnten. Er vermochte in der neuen Lehre nicht die Summe alles Heils zu sehen. Er weigerte sich, eine Verbindung gegen den Kaiser abzuschließen, im Gegenteil, er näherte sich dem Kaiser, je mehr sich die Bundesgenossen von ihm entfernten. Er wollte nicht der Trabant dieser Bundesgenossen sein, er fand seinen nächsten und unmittelbaren Vorteil beim Kaiser. Deshalb ließ er durch seinen Vertrauten Christoph Carlowitz mit Granvella unterhandeln und kam dann im Mai 1546 persönlich zum Kaiser nach Regensburg; hier trat er in den Dienst des Kaisers ein. Karl ernannte ihn nicht nur zum Exekutor, Konservator und Schirmer von Magdeburg und Halberstadt, nach deren Besitz Moritz schon lange getrachtet hatte, sondern er versprach ihm auch die Kur Sachsen. Der Tag von Mühlberg verschaffte ihm den Kurhut wirklich, und es schien ihn nicht zu beirren, daß durch diese Schlacht sein Vetter in das bitterste Unglück geriet. Luther hatte wohl recht gehabt, als er einmal bei der Tafel den Kurfürsten davor gewarnt hatte, in Moritz einen jungen Löwen aufzuziehen.
Ende April 1547 rückten das kaiserliche Heer und die Scharen Herzog Moritz’ gegen Mühlberg. Der Kaiser Karl war ritterlich anzusehen, er saß auf einem andalusischen Roß, das mit einer rotseidenen, goldbefransten Decke behangen war; er war ganz in blanken Waffen, sein Helm und Panzer vergoldet, mit dem roten burgundischen Feldzeichen geschmückt; in der Rechten hielt er eine Lanze. Die Gicht hatte ihn grau und müde gemacht, sein Gesicht war leichenblaß, die Glieder wie gelähmt, die Stimme so schwach, daß man sie kaum vernahm. Zu früh aber hatten die Protestanten ihn wie einen Verstorbenen betrachtet. Karl zitterte jedesmal, bevor er die Waffenrüstung anlegte, aber dann erfüllte ihn plötzlich der Mut. So war es auch am Tag von Mühlberg.
Die ersten, die das Ufer der Elbe erreichten, waren Moritz und Herzog Alba. Ein Bauer verriet ihnen, daß Johann Friedrich in der Stadtkirche zu Mühlberg den Sonntagsgottesdienst abwarte, daß er sein Fußvolk schon nach Wittenberg vorausgeschickt habe und nach der Predigt mit den Reitern folgen wolle. Die spanischen Hakenschützen erhielten sofort den Befehl, hinüber zu schwimmen; sie taten es, indem sie sich entkleideten und die Säbel zwischen die Zähne nahmen. So bemächtigten sie sich der Brücke, die die Kurfürstlichen vergebens anzuzünden versucht hatten, und die sie zerstörten. Der Kaiser hatte schon über den dichten Nebel geklagt, der über der ganzen Gegend lag, jetzt gegen Mittag erhob sich der Nebel langsam. Er erblickte die Elbe, die Sonne trat heraus, aber sie war rot wie glühendes Eisen und schien den ganzen Tag über still zu stehen. Als später der König von Frankreich den Herzog Alba fragte, ob sich denn wirklich bei dieser Schlacht die Geschichte Josuas erneuert habe, erwiderte dieser: »Sire, ich hatte zu viel auf Erden zu tun, um bemerken zu können, was am Himmel vorging.« Gegen alles Erwarten wurde dem Kaiser durch einen Müller namens Strauch, dem die Kurfürstlichen zwei Pferde weggeführt hatten, eine Furt gezeigt; Moritz, sein Landesherr, versprach ihm dafür hundert Kronen, zwei andere Pferde und einen Herrenhof. Die Furt war von festem Boden, sieben Pferde konnten nebeneinander gehen, das Wasser reichte den Reitern bis an die Sättel. Einige Kavaliere des Kaisers hatten große Furcht, wenn der Kaiser selbst nicht vorangeritten wäre, hätten sie nicht gewagt, sich einer solchen Gefahr auszusetzen. Am jenseitigen Ufer angelangt, schickte Moritz einen seiner Offiziere mit einem Trompeter an den Kurfürsten und ließ ihn auffordern, sich dem Kaiser zu ergeben. Johann Friedrich schlug es ab. Er glaubte nicht an den Ernst der Dinge. Er konnte nicht glauben, daß ein ganzes Heer die Elbe durchwaten könne; er vermutete ganz und gar nicht, daß der Kaiser selbst gegen ihn anziehe; er zog sich vorsichtig zurück, und seinem bedächtigen Sinn wurde die Situation erst klar, als die Angriffe der kaiserlichen Armada immer ungestümer wurden. Jetzt empfand er mit einemmal die große Verantwortlichkeit, daß er sich gegen den ihm von Gott gesetzten Herrn, gegen das allerhöchste Reichsoberhaupt vergangen habe. Auf freiem Felde fiel er vor seinen Leuten auf die Knie, hob die Augen und Hände empor und betete: »Ach Gott im Himmel! Bin ich mit meinem Vornehmen gegen die Majestät ungerecht, so strafe mich, aber nicht mein Volk.«
Er stellte sein kleines Heer in Schlachtordnung auf und bestieg einen schweren friesischen Hengst; er trug einen schwarzen Harnisch mit weißen Streifen und darunter noch ein Panzerhemd mit kleinen Ringen.
Es war vier Uhr nachmittags. Der Vortrab der Kaiserlichen rückte zur Hauptattacke zusammen; es waren die Reiter von Herzog Moritz, die Neapolitaner und die Husaren. Mit dem Ruf »Hispania« und »das Reich« brachen sie los. Die Kurfürstlichen feuerten. Aber von der anderen Seite her rückten die vollen Gewalthaufen des Kaisers an. Die Haltung ihres Kriegsfürsten hatte der kleinen sächsischen Armee wenig Zuversicht und heldenmütiges Vertrauen eingeflößt. Da nun die Gefahr sich deutlich offenbarte, rief er sie an, getreu bei ihm zu stehen, wie er getreu bei ihnen stehen werde. Trotzdem kam allgemeine Verwirrung über die Leute. Aber es traf noch etwas weit schlimmeres ein. Der Patrizier Imhof aus Nürnberg, der unter Karls Fahnen diente, erzählt: »Es ist seltsam zu vernehmen, wie des Kurfürsten Räte und große Hansen, so er bei sich gehabt, mit ihm umgegangen sind. Wie die Schlacht angegangen, hat der Kurfürst seinem Volke zugeschrien: ›er wolle auf diesen Tag Leib und Blut bei ihnen lassen, sie sollten auch ehrlich halten bei ihm.‹ Als nun das Treffen angegangen, haben seine Räte und großen Hansen, auf die er sich verlassen, zur Flucht geschrien, auch unter sein eigenes Volk gehauen und gestochen und die Ordnung seiner Haufen getrennt. Das habe ich zu Torgau von etlichen von Karl gehört, auch habe ich an der Walstatt gesehen, daß alles durch Verräterei zugegangen.«
Das Heer stob auseinander, die Ritter zuerst, und als das Fußvolk die Ritter fliehen sah, warf es Gewehre und Piken weg und suchte sein Heil gleichfalls in der Flucht. Die Ritter entkamen, aber das Schicksal des Fußvolks war schrecklich; obwohl es die Waffen weggeworfen hatte und um Pardon bat, ward es samt und sonders niedergehauen. Karl, von Gottes Gnaden römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches, zu Hispanien König, hatte ausdrücklichen Befehl erteilt, alles über die Klinge springen zu lassen. Damals lernte man im Herzen von Deutschland das Haus Hispanien-Habsburg mit seinen Husaren kennen.
Johann Friedrich, den seine Ritter verlassen hatten, sah sich plötzlich ganz allein im Wald, wo alles voller Leichen lag, von Husaren vorn und hinten umgeben. Der schwerbeleibte Herr mußte sich zur Wehr setzen, er tat es ritterlich. Ein Ungar hatte ihn in die linke Backe gehauen, das Blut rann ihm über das Gesicht auf den schwarz und weißen Harnisch herab. Dennoch wollte er sich diesen Husaren und auch den neapolitanischen Reitern, die ihn umdrängten, nicht ergeben. Endlich sprengte ein Herr vom Hofgesinde des Herzogs Moritz heran, Thilo von Trotha; dieser rief ihn auf deutsch an, Pardon zu nehmen. Johann Friedrich ergab sich an diesen Deutschen; er zog einen Ring unter seinem Panzerhandschuh hervor. Die Waffen des sächsischen Kurfürsten, Schwert und Dolch, fielen den Ungarn zur Beute zu.
Thilo von Trotha brachte den gefangenen Kurfürsten unter einer Bedeckung von neapolitanischen Reitern zum Herzog von Alba. Dieser erstattete dem Kaiser Meldung. Karl wollte den edlen Fang sogleich sehen, aber dreimal weigerte sich der sonst so pflichtbewußte Alba, denn aus politischen Gründen fürchtete er mit Recht, daß Karl in der ersten Hitze den Kurfürsten allzu ungnädig behandeln werde. Der Kaiser bestand aber auf seinem Willen. Er hielt in der Heide zu Pferd.
Als der noch aus seinen Wunden blutende Johann Friedrich des Kaisers ansichtig wurde, den er in seinen Absagebriefen als »Karl von Gent, der sich römischer Kaiser heißt« betitelt hatte, seufzte er tief und rief aus: »Miserere miserere mei domine, nos sumus jam hic!« Der Kaiser erkannte den friesischen Hengst wieder; es war derselbe, den Johann Friedrich vor drei Jahren auf dem Reichstag zu Speier geritten hatte. Von Alba unterstützt stieg der Kurfürst vom Pferd, wollte nach spanischer Sitte vor dem Kaiser aufs Knie fallen und zog auch wieder nach deutscher Sitte seinen Blechhandschuh aus, um als Kurfürst dem Kaiser die Hand zu reichen. Karl lehnte sowohl die spanische Devotions- als die deutsche Vertraulichkeitsbezeigung ab. Er war sehr finster; er wendete sich zur Seite. Endlich brach der Kurfürst das Stillschweigen mit der Titulatur, mit der ihm die Kurfürsten schrieben. Er sprach: »Großmächtigster, allergnädigster Kaiser.« Karl erwiderte: »Ja, ja, nun bin ich Euer gnädiger Kaiser; Ihr habt mich lange nicht so geheißen.« Der Kurfürst fuhr fort: »Ich bin auf diesen Tag Euer Gefangener und bitte um ein fürstlich Gefängnis. Kaiserliche Majestät wolle sich gegen mich als einen geborenen Fürsten halten.« Darauf sagte der Kaiser zornig: »Ja, wie Ihr verdient habt. Ich will mich so gegen Euch halten, wie Ihr Euch gegen mich gehalten habt. Führt ihn hin! Wir wissen uns wohl zu halten.«
 |
| Moritz von Sachsen, |
| nach einem Holzschnitt aus der Werkstatt Cranachs. |
Erst spät in der Nacht kam Herzog Moritz von der Verfolgung der Ritter und Reiter zurück, bei der ihm heller Mondschein geleuchtet hatte. Mehr als zwanzig Stunden hatte er an diesem Tag zu Pferde gesessen, war mehr als einmal dem Tod entgangen, und nun fand er den Stammvetter in Gefangenschaft. Die Kur Sachsen war auf seinem Haupte fest.
Karl zog nun vor Wittenberg und belagerte die Stadt. Die Bürger wollten sich bis auf den letzten Mann wehren, und Johann Friedrich weigerte sich, sie zur Übergabe aufzufordern. Da ließ der Kaiser durch ein spanisches Kriegsgericht das Todesurteil über ihn aussprechen, welches lautete, »daß bemeldeter Hans Friedrich, der Ächter, ihm zur Bestrafung und andern zum Exempel durch das Schwert vom Leben zum natürlichen Gericht fürgebracht und solch Urteil auf der im Feld aufgerichteten Walstatt vollzogen werden solle.«
Der Kurfürst, dem es im Glück so sehr an der nötigen Energie gemangelt hatte, bewies im Unglück den ganzen Heldenmut des Glaubens, der sein einfaches Gemüt durchdrang. Er vernahm das Todesurteil, als er eben mit seinem Leidensgenossen Franz von Grubenhagen beim Schachbrett saß. Er erwiderte gelassen: »Ich kann nicht glauben, daß der Kaiser also mit mir handeln werde, ist es aber bei der kaiserlichen Majestät gänzlich beschlossen, so begehre ich, man soll es mir fest zu wissen tun, damit ich bestellen kann, was meine Frau und meine Kinder angeht.«
Neun Tage lang ließ Karl seinen Gefangenen in der Todesfurcht schweben. Dem Kurfürsten von Brandenburg und dem Herzog von Cleve gelang es aber, das Unheil abzuwenden: die Wittenberger kapitulierten. Johann Friedrich blieb Gefangener des Kaisers so lange als es diesem gefallen würde; selbst nach Spanien sollte er ihn schicken dürfen. Zum Unterhalt für ihn und sein Haus wurde ein Teil von Thüringen mit einem Jahreseinkommen von fünfzigtausend Gulden bestimmt. Es war ein Artikel in der Kapitulation, demzufolge Johann Friedrich alles annehmen sollte, was das Konzil zu Trident oder die kaiserliche Machtvollkommenheit in Sachen der Religion beschließen werde; diesen Artikel anzunehmen weigerte sich der Kurfürst beharrlich; Karl strich ihn mit eigener Hand wieder aus.
Auf einer großen Wiese bei Blesern übertrug der Kaiser dem Herzog Moritz das Kurfürstentum, und Moritz legte darauf sein Heer als Besatzung in die Stadt Wittenberg. Das Volk nahm sie mit tiefem Herzeleid auf. Moritz ritt zornig gerade aufs Schloß und sah keinem Menschen ins Gesicht. Zu den Ratsmännern, die ihm die Aufwartung machten, sagte er: »Ihr seid eurem Fürsten, meinem Vetter, so getreu gewesen, das will ich euch ewig im guten gedenken.«
Von Wittenberg aus zog der Kaiser gegen den Landgrafen von Hessen. Der war schon längst kleinmütig geworden, und als er das Schicksal Johann Friedrichs erfuhr, begann er mit Karl zu unterhandeln. Der Kaiser forderte, daß er sich auf Gnade und Ungnade ergeben, hundertfünfzigtausend Goldgulden Buße zahlen, seine Festungen schleifen und seine Kanonen ausliefern solle. Dagegen wurde ihm schriftlich versichert, daß er Land und Leben behalten, auch mit »einigem« Gefängnis verschont werden würde. Die beiden Vermittler, Joachim von Brandenburg und Moritz von Sachsen, verbürgten sich in dieser Verschreibung mit ihrem Ehrenwort gegen den Landgrafen. Im Vertrauen auf die Kurfürsten nahm der Landgraf die Bedingungen an. Moritzens Gemahlin, die Tochter des Landgrafen, tat vor dem Kaiser einen Fußfall für ihren Vater. Der Kaiser war zu keiner andern Erklärung zu vermögen, als daß der Landgraf sich auf Gnade oder Ungnade zu ergeben habe. Nun kam der Landgraf nach Halle; er speiste mit den beiden Kurfürsten zu Abend; am andern Morgen nahmen die drei Herren ihr Frühstück bei Granvella, und hier unterzeichneten sie das verhängnisvolle Schriftstück, in welchem, ohne daß sie es merkten, der Ausdruck »einiges« Gefängnis verändert war in »ewiges« Gefängnis. Am Nachmittag fand die Abbitte vor dem Kaiser statt. Der Kaiser saß auf dem Thron unter einem vergoldeten Himmel, umgeben von seinen spanischen, italienischen, niederländischen und deutschen Großen. Der Landgraf Philipp kniete in schwarzsamtenem Kleid mit roter Binde kleinmütig und traurig auf dem Teppich vor dem Throne, und hinter ihm las sein getreuer Kanzler Tielemann von Günterode die Abbitte vor. Er las mit kläglichen Gebärden und in kläglichem Ton; auf dem Gesicht des Landgrafen zeigte sich ein Lächeln; es war vielleicht die unbewußte Hilfe seiner leichten Natur gegen das Gefühl der Schmach. Aber der gravitätische Kaiser hob langsam den Finger auf und sagte in seiner brabantischen Mundart: »Wart, ik wöll dir laken lehr.« Nachdem der Reichsvizekanzler die Antwort des Kaisers verlesen, Günterode sich dann höflich bedankt hatte, erwartete der Landgraf des Kaisers Wink, um sich zu erheben. Dieser Wink erfolgte nicht. Nun stand der Landgraf von selber auf und wollte dem Kaiser die Hand reichen. Die kaiserliche Majestät jedoch sah sauer und hielt ihre Hand zurück. Dafür ergriff Alba die Hand des Landgrafen und lud ihn und die andern Fürsten zum Nachtmahl bei sich ein. Alba hatte sein Losament im Schloß. Als die Tafel aufgehoben war, spielte der Landgraf Brett mit einem der sächsischen Räte, es war zehn Uhr vorüber; da kündigte ihm Alba auf einmal an, daß er sein Gefangener sei. Zugleich traten hundert spanische Arkebusiere in den Saal. Die beiden Kurfürsten, die sich für die Freiheit des Landgrafen verbürgt hatten, waren außer sich; Joachim von Brandenburg rief, das sei ein Bösewichtsstück, zog den Degen, um Alba den Schädel zu zerspalten, Moritz aber zeigte sich tief betroffen und blieb bei seinem Schwiegervater die ganze Nacht hindurch. Er versicherte ihm, daß da ein Mißverständnis vorliegen müsse, und er werde mit dem Kaiser sprechen. Dies geschah. Der Kaiser sagte, daß sich ihm der Landgraf auf Gnade und Ungnade ergeben habe; es sei weder Rede noch Schrift davon gewesen, daß man ihn mit »einiger« Gefangenschaft verschonen wolle, nur mit »ewiger« Gefangenschaft habe man ihn verschonen wollen. Und so fand sich auch die Fassung in der Notel, die die Kurfürsten am Morgen unterschrieben hatten, ohne sie näher zu besehen.
Diese spanische Arglist brachte eine große Wandlung in dem Herzen Moritzens hervor. Er sah jetzt wohl, daß der Kaiser Karl darauf ausging, Deutschland spanisch zu machen, aus dem von Schatzungen und fremdem Kriegsvolk erdrückten Reich alles Wasser auf eine Mühle zu leiten, und da erwachte in ihm der Deutsche. Ohne seinen kühn verborgenen und kühn ausgeführten Widerstand wäre die spätere freie Entwicklung Norddeutschlands unmöglich gewesen, und wenn heute nicht ganz Deutschland ein österreichisches Gesicht zeigt, so ist es vielleicht im letzten Grunde der Verwechslung jener Wörtchen »einig« und »ewig« zu danken.
Zunächst freilich mußte Moritz warten. Einerseits fürchtete er, der Kaiser könne seine Drohung wahr machen und den Landgrafen nach Spanien schicken. Anderseits mußte er gewärtigen, daß der allerdurchlauchtigste, großmächtigste und unüberwindlichste Kaiser, welchen Titel Karl jetzt mit einer furchtbaren Realität führte, dem Kurfürsten Johann Friedrich wieder die Freiheit schenke, wodurch im Lande selbst Hader und Krieg ausbrechen mußte. Er war jetzt in der Schlinge. Die Rache mußte aufgeschoben werden.
Er suchte von nun ab sein Heil in der Verstellung. Gerade weil er sich zumeist sehr offen und rücksichtslos auszusprechen pflegte, konnte niemand auf die Vermutung kommen, daß hinter dieser Derbheit eine Berechnung verborgen sei. Als auf dem Reichstag zu Augsburg sich ein protestantischer Fürst an den kaiserlichen Tisch setzen wollte, rief er: »Hier ist kein Platz für Ketzer.« Selbst der undurchdringliche Kaiser Karl konnte sich bisweilen verraten; er hatte sich in Regensburg durch ein Lächeln verraten, als ihm die Protestanten ihre Schrift gegen das Tridentiner Konzil überreichten. Moritz verriet sich niemals. Er pflegte zu sagen: »Wenn ich wüßte, daß mein eigenes Hemd, das mir zunächst am Leibe liegt, meine Gedanken kennte, ich würde es austun und verbrennen.« Kein Mensch in Deutschland, keiner von seinen Freunden und Vertrauten erfuhr etwas von dem, was er im Schilde führte. Er täuschte den Kaiser, der ihn einmal getäuscht hatte, so sicher und vollkommen, daß das Stück, das er vor dem spanischen Senjor aufführte, ohne Zweifel das größte Meisterstück war, das jemals ein Deutscher zustande gebracht hat.
Seiner gewöhnlichen Lebensweise nach mußte man glauben, daß nur das Vergnügen und die Lustbarkeiten Reiz für ihn hätten. In seinem Hoflager beschäftigte ihn unausgesetzt die Wildbahn im Dresdener Forst; er liebte Trinkgelage, Ritterspiele und die Freuden der Fastnacht; ebenso suchte er an fremden Höfen und auf Reichstagen das lustige Leben, und er machte Kundschaft mit schönen Frauen. So schildert ihn Sastrow während des Augsburger Reichstages: »Herzog Moritz hatte seine Kurzweil in der Herberge eines Doktor Haus. Der hatte eine erwachsene Tochter, eine schöne Metze, hieß Jungfrau Jakobina, mit der badete er und spielte täglich Pharao mit ihr und dem wilden Markgrafen Albrecht. Sie lachte fein lieblich und freundlich zu der Fürsten Scherzen und hielten also Haus, daß der Teufel sich drüber freuen mochte und viel Sagens in der ganzen Stadt davon war.« Die Befreiung seines Schwiegervaters schien ihm nicht besonders am Herzen zu liegen. Der Landgraf, der öfter geäußert hatte, Gefängnis fürchte er weit mehr als den Tod, wurde in Donauwörth, wohin er gebracht worden war, sehr hart behandelt. Seine spanische Wache lärmte Tag und Nacht in seinem Quartier; er beklagte sich bitter, daß sie ihn auch bei Nacht visitierten, ob er nicht durch einen Ritz oder durch ein Mäuseloch entwischt sei. Einmal schrieb er an Moritz: »Wenn Euer Liebden so fleißig wären in meinen Sachen als im Bankettieren, Gastladen und Spielen, wäre meine Sach lang besser.«
Kein Wunder, daß der Kaiser glaubte, der vermöge am meisten bei Moritz, der ihm bei seinen Vergnügen Vorschub leiste. Aber der bedächtige und weitschauende Karl durchschaute den bedächtigeren und viel weiter schauenden, scheinbar so uninteressierten und doch so interessanten Moritz mit nichten. Auch die Venezianer, die größten Diplomaten der damaligen Zeit, durchschauten ihn nicht. Der Gesandte Mocenigo sagt von ihm: »Moritz hat viel Mut, aber, wie man glaubt, nicht viel Urteil, und dazu ist er ein sehr leichter Herr. Von ihm hat Karl wenig zu fürchten.«
Und doch wurde Moritz der Verderber des Kaisers. Als er alles zu seinem großen Plan vorbereitet hatte, stürzte er wie ein Sturmwind über Karl her und vernichtete ihn im Wetter. Lange zuvor, ehe der Schlag ausgeführt wurde, hatte er sich mit dem nötigen Geld zu versehen gewußt. Bereits im Jahre 1547 hatte er die Kleinodien des Meißner Domkapitels einliefern lassen. Es waren darunter ausbündige Stücke: das silberne Bild des Bischofs Bruno, mit Edelsteinen geschmückt, in der einen Hand den Bischofsstab, in der andern ein Buch haltend, dreiundsiebzig Mark schwer; Donatis silbernes Bild, zweiundfünfzig Mark schwer; Briccii Haupt mit goldener Inful; dazu einhundertvierzig Kelche, alles zusammen im Wert von hundertfünfzigtausend Gulden. Wo diese Schätze hingekommen, wußte später niemand zu sagen, höchstwahrscheinlich hatte Moritz sie heimlich einschmelzen lassen. Außerdem hatte er nach und nach bedeutende Summen aufgenommen; nach seinem Tode hatte sein Bruder eine Schuldenlast von über zwei Millionen Gulden zu tilgen.
Im Sommer des Jahres 1550 finden sich die Spuren der ersten Annäherung an Frankreich, mit dessen Hilfe Moritz den Kaiser zu demütigen dachte. Im November darauf unternahm er, von Karl hierzu bestimmt, die Belagerung von Magdeburg. Im Frühjahr des nächsten Jahres hatte er Zusammenkünfte mit dem Bruder des Kurfürsten von Brandenburg und seinem Schwager Wilhelm von Hessen und mit dem Herzog von Mecklenburg. Einige Monate später verhandelte er mit Jean de Bresse, Bischof von Bayonne, und das Bündnis mit Frankreich kam zustande. Es ward als eine merkwürdige Vorbedeutung angesehen, daß ein Blitzstrahl durch das Zimmer fuhr, in welchem der Vertrag abgeschlossen wurde. Im Januar 1552 beschwor der König von Frankreich die Allianz mit Moritz und den Kurfürsten. In deren Namen beschwor den Eid der Markgraf Albrecht von Brandenburg-Kulmbach, der mit Schärtlin nach Chambord gegangen war. Der französische König erhielt die Aussicht auf die deutsche Kaiserkrone und unterdessen die drei Bistümer Metz, Toul und Verdun.
Moritz entließ die vor Magdeburg versammelte Armee nicht, er vermehrte sie im Gegenteil bis auf fünfundzwanzigtausend Mann. Er nahm Offiziere in Dienst, die im schmalkaldischen Krieg gegen den Kaiser gedient hatten. Er war so schlau, die Stärke seines anwachsenden Heeres dadurch zu verbergen, daß er es verteilte und die Quartiere in den Dörfern oftmals wechseln ließ. Wohl hatte der Kaiser seine Spione im Lager. Moritz aber hinterging alle. Der Kaiser besoldete zwei geheime Sekretäre am sächsischen Hof; Moritz wußte es, verstellte sich, zog sie zu allen Beratungen, rühmte immer seine Treue gegen den Kaiser, und so meldeten die bestochenen Leute lauter falsche Dinge.
Die Venezianer faßten Argwohn, und dieser Argwohn verstärkte sich. Karl erhielt Warnungsbriefe nach Innsbruck, und sein Bruder Ferdinand riet ihm, den Landgrafen freizulassen. Der Kaiser antwortete: »Es wäre seltsam, wenn Herzog Moritz alles vergessen sollte, was ich für ihn getan, wenngleich die rücksichtslose Verwendung von so vielen Rebellen in seinem Dienst mich auf einigen Verdacht bringt.« Die drei geistlichen Kurfürsten wollten, erschreckt durch die Gerüchte, das Konzil zu Trident plötzlich verlassen. Beruhigend schrieb ihnen der Kaiser: »Moritz hat mir solche Zusicherungen gemacht, daß ich mir nur Gutes von ihm verspreche, wenn es noch Glauben gibt im menschlichen Leben.« Seine ausgesprochene Überzeugung war: »Die tollen und vollen Deutschen besitzen kein Geschick zu derartigen Ränken.«
Im März 1552 verließ Moritz Dresden und ging nach Thüringen. Bei Erfurt und Mühlhausen stand seine Armee. Er zog mit großer Eile nach Augsburg, wo er am 1. April ankam und sich damit, nach seinem eigenen Ausdruck, »vor die Spelunke des Fuchses in Innsbruck setzte.« Er hatte sich unterdessen mit dem Heer seines Schwagers vereinigt.
Der Kaiser ließ sich trotzig vernehmen, daß er den Leib des Landgrafen in zwei Teile zerlegen und jeder der Parteien, die ihn zwingen wollten, einen Teil entgegenschicken werde. In Wirklichkeit war die Lage Karls verzweifelt. Er hatte weder Truppen noch Geld. Sein Bruder hatte ihm geschrieben, er brauche seine ganze Macht in Ungarn. Die geistlichen Kurfürsten und der Herzog von Bayern wichen seiner Forderung um Hilfe aus. Die Wechselhäuser in Italien und in den Niederlanden, sowie die Fugger in Augsburg wollten keine Darlehen mehr geben. Karl hatte allen Kredit verloren, denn er verfolgte die übelste Politik, die man gegen Handels- und Geldleute treiben kann, nämlich die der Unehrlichkeit. So erblickte er zum Beispiel die größte Sicherheit für die Treue der Genuesen darin, daß er beschloß, ihnen die Kapitalien, die er ihnen schuldig war, nie wieder zu bezahlen; denn, so sagte er sich, sie würden sich hüten, mit einem Fürsten zu brechen, der ihnen so viel Geld schuldig war.
Der Kaiser wollte von Innsbruck aus nach London entfliehen, aber der zweimal unternommene Versuch mißglückte. In einer Aprilnacht begab er sich im tiefsten Geheimnis auf den Weg, so schwach und von Gichtschmerzen geplagt er auch war. In seiner Begleitung befanden sich nur zwei Kammerherren, zwei Diener und sein getreuer Barbier Van der Fé. Sie ritten durch Wald und Gebirge und erreichten in der Frühe das Dorf Nassereit. Hier blieb der Kaiser bis Nachmittag, und dann ritten sie bis Paschelbach, eine Stunde von der Ehrenberger Klause. Van der Fé ward aufs Schloß geschickt, um den Befehlshaber um Kundschaft zu erfragen. Dieser berichtete, Moritz sei schon von Augsburg aufgebrochen und habe Füssen besetzt, der Weg über Kempten sei unsicher durch des Herzogs Reiter. Da entschloß sich Karl, wieder nach Innsbruck zurückzukehren. In demselben tiefen Geheimnis langte er an, kein Mensch erfuhr etwas von der Reise.
Beim zweitenmal verkleidete er sich als altes Weib. Der Plan war, in einem bedeckten Packwagen über Ehrwald und Hohenschwangau zu entkommen. Der alte Kammerdiener Karls mußte sich in dessen Bett legen, und in der Küche wurde gekocht, als ob der Kaiser noch im Schlosse wäre. Zwei kurze Tagereisen wurden zurückgelegt, der neugebahnte Fernpaß überstiegen, und im Dorfe Lermos stieg Karl aus, um eine Mahlzeit zu nehmen. Ein Mädchen, das einmal sein Bildnis gesehen, rief bei seinem Anblick: »Ei, wie sieht die alte Frau dem Kaiser so gleich.« Da erschrak Karl und kehrte abermals um.
Inzwischen war es dem König Ferdinand gelungen, Moritz zu einem Waffenstillstand zu überreden, damit man zu Passau eine Versammlung einberufen könne, die zu beraten habe, wie die Gebrechen der deutschen Nation abzustellen seien. Diesen Stillstand benutzte Karl, und es gelang ihm, einiges Geld und Truppen zu sammeln. Das Heer stand bei Reitti, unfern der Ehrenberger Klause. Moritz zog zu Felde, schlug die Kaiserlichen und eroberte die Festung. Nun lag der Weg zum Kaiser offen. Die verbündeten Fürsten entschlossen sich, den Fuchs in seiner Spelunke zu suchen – da trat eine unerwartete Hilfe für den Kaiser ein: Moritz mußte erst einen Aufstand unterdrücken, der unter einem Teil des Fußvolks ausgebrochen war; die Leute forderten für den Sturm auf das Ehrenberger Schloß die doppelte Löhnung. Die Sache stand so schlimm, daß Moritz in Lebensgefahr war; er mußte fliehen und sich verbergen. So erhielt der Kaiser Zeit, Innsbruck zu verlassen. Der Herr zweier Welten mußte in einer kalten Frühlingsnacht, bei strömendem Regen und von heftigen Schmerzen geplagt, in einer Sänfte fliehen; fliehen beim Schein brennender Windlichter, mit denen die Diener die Engpässe der Tiroleralpen erhellten. Alle Brücken wurden hinter ihm abgebrochen. Dem Kaiser folgte der Kurfürst Johann Friedrich mit seinem alten Freund, dem Maler Lukas Cranach. Zum erstenmal seit fünf Jahren sah der Kurfürst sich nicht mehr von seiner spanischen Garde umgeben; er stimmte auf seinem Wagen ein Lob- und Danklied an.
Der Kaiser wandte sich nach Villach in Kärnten und blieb dort bis in die Mitte des Sommers. Moritz zog am vierten Tage nach Karls Flucht in Innsbruck ein. Alles was den Spaniern, dem Kaiser und dem Kardinalbischof von Augsburg gehörte, überließ er seinen Landsknechten als gute Beute; sie stolzierten in den prächtigsten Gewändern herum, auf ihren Hüten glänzten portugiesische Goldstücke, und einer nannte den andern »Don«. Moritz’ Verbündeter, der König Heinrich von Frankreich, zog ins Elsaß und erließ Manifeste, in denen viel von deutscher Freiheit zu lesen war; auf einem sah man sogar einen Freiheitshut mit zwei Dolchen und das Wort »Libertas« an der Spitze. Vor allem nahm der Befreier Deutschlands Metz, Toul und Verdun weg.
Moritz machte sich nun auf den Weg nach Passau, wo er mit dem König Ferdinand, dem Herzog von Bayern und den Bischöfen von Passau, Salzburg und Eichstädt den welthistorischen Vertrag abschloß, der den Protestanten ihre Religionsfreiheit wieder sicherte. Nachdem der Friede abgeschlossen war, führte er sein Heer dem König Ferdinand zu Hilfe gegen die Türken, der Kaiser wandte sich gegen die Franzosen nach Westen, und die gefangenen Herren von Hessen und Sachsen kehrten in ihre Länder zurück. Karl entließ Johann Friedrich nicht ohne Zeichen der Achtung, sogar der Rührung. Alle protestantischen Städte, durch die er auf seinem Weg kam, empfingen ihn wie einen Heiligen und Märtyrer. In Koburg traf er seine Gemahlin; sie hatte in den fünf Jahren ihre Trauerkleider nicht abgelegt und fiel in Ohnmacht, als sie ihn wiedersah. Die Ratsherren in Amtstracht und schwarzen Mänteln gingen ihm entgegen, die Bürger in ihren Rüstungen und Feiertagsgewändern bildeten Spalier, auf den Märkten standen die Geistlichen und die jungen Männer auf der einen Seite, die eisgrauen Leute und die jungen Mädchen mit dem Rautenkranz im fliegenden Haar auf der anderen, und die Knaben sangen das Tedeum. Der Fürst schritt mit entblößtem Haupt hindurch, seine Rückkehr ihrem Gebet zuschreibend, und hinter ihm ging sein lieber Lukas Cranach.
Auch der Landgraf von Hessen kehrte aus den Niederlanden nach Kassel zurück. Er hatte Moritzens Vorhaben gegen den Kaiser durchaus nicht glauben wollen und geäußert: »Wie will ein Sperling den Geier angreifen?« Das Wunderliche geschah jetzt, daß man Moritz von allen Seiten zu mißtrauen anfing. Da er so viele getäuscht, wenn auch zum guten Zweck getäuscht, verdächtigte man sein Wesen ganz und gar. Wilhelm von Hessen nannte ihn in einem Wortwechsel einen Verräter. Als er nach den Passauer Tagen die Stadt Frankfurt am Main auffordern ließ, sich zu ergeben, wurde ihm geantwortet, er möge erst fromm werden und die Judasfarbe ablegen.
Als er aus dem Türkenkrieg zurückgekehrt war, hielt er zur Fastnacht in Dresden großes Rennen und Stechen, und dann mußte er in den Krieg gegen seinen ehemaligen Freund und Bundesgenossen, den wilden Markgrafen Albrecht. Dieser hatte die Friedenspakte nicht geachtet; es gefiel ihm, das alte Faustrecht noch ferner in Deutschland zu üben, und er war ein gefürchteter Mann, der seinen eigenen Weg ging. Er behauptete, der Passauer Vertrag tauge nichts, die Pfaffen müßten gedemütigt werden. Nebenbei suchte er auch die Pfeffersäcke zu rupfen, wie er die Kaufherren der Städte nannte. Er umgab sich mit ein paar Tausend Eisenfressern und zog im Namen des Evangeliums verheerend durch die fränkischen und sächsischen Lande.
Bei Sievershausen in der Lüneburgerheide traf Moritz seine plündernden Scharen. Es gab ein kurzes Gefecht; hoch zu Roß, die rote Feldbinde mit dem weißen Streifen um die Brust, kämpfte Moritz ritterlich. Eine silberne Kugel traf ihn von hinten, zerriß seinen Panzer und drang durch seinen ganzen Körper. Wilhelm von Grumbach, der fränkische Ritter, soll sein Mörder gewesen sein. In einem Zelte, das man neben einem Zaun aufgeschlagen hatte, empfing er die erbeuteten Fahnen und die Papiere des Markgrafen, die er eifrig durchspähte. Er diktierte sein Testament, und nach zwei Tagen starb er, zweiunddreißig Jahre alt. Sein letztes Wort war: »Gott wird kommen,« das übrige verstand man nicht.
Kaiser Karl V. liebte Moritz so sehr, daß er, als man ihm zu Brüssel die Todesnachricht mitteilte, in die Worte ausbrach: »O, Absalom, mein Sohn, mein Sohn!«
Der wilde Markgraf wurde in die Acht getan, scheinbar gegen den Willen des Kaisers. »Es ist alles dahin gerichtet, Deutschland eine Kappe zu schneiden,« schrieb der Herzog von Braunschweig, der bei Sievershausen seine zwei ältesten Söhne verloren hatte, an Philipp von Hessen, »der Kaiser will die Fürsten nur gegeneinander hetzen. Er hat zwar Albrecht als seiner Hetzhunde einen gebraucht, würde es aber gern sehen, wenn ihm ein Rad übers Bein ginge.«
Albrecht flüchtete nach Frankreich, kehrte später nach Deutschland zurück und starb elend in Pforzheim, erst fünfunddreißig Jahre alt.
So endete die Reformation, die als eine Angelegenheit des Volkes begonnen hatte, als ein Zusammenbruch der Fürsten.
Albrecht Wenzel Eusebius Baron von Waldstein oder Wallenstein entstammte einem alten böhmischen Geschlecht, dessen Name schon im zwölften Jahrhundert zu finden ist. Er war am 15. September 1583 geboren und kam zwei Monate zu früh auf die Welt. Seine Eltern waren Protestanten, und beide verlor er bald, den Vater, als er zehn, die Mutter, als er zwölf Jahre alt war. Sein Oheim, Albrecht Slavata, ließ ihn in der Schule der böhmischen Brüdergemeinde unterrichten, aber ein zweiter Oheim, Johann von Ricam, nahm ihn von dort weg und brachte ihn in das adelige Jesuitenkonvikt nach Olmütz, wo ihn Pater Pachta der katholischen Kirche zuführte.
Die im Volk verbreiteten Sagen über den hochfahrenden und trotzigen Sinn Wallensteins beschäftigten sich auch mit seiner Kindheit. So hieß es, es habe ihm einst auf der Schule zu Goldberg geträumt, daß Lehrer und Schüler, ja selbst die Bäume des Waldes sich vor ihm verneigt hätten, und als er diesen Traum erzählte, sei er lebhaft verspottet worden.
Von Olmütz aus ging er auf Reisen; er machte mit einem reichen jungen Edelmann aus Mähren die europäische Kavaliertur nach Holland, England, Frankreich und Italien. Ihr gelehrter Begleiter war der Mathematiker und Astrolog Verdungs, ein Franke; durch ihn und den Professor Argoli in Padua wurde Wallenstein in die geheimen Wissenschaften der Sterne und in die Kabbala eingeweiht. Nach seiner Rückkehr diente er dem Kaiser Rudolf gegen die Türken und dem König Ferdinand unter Dampierre gegen die Venezianer. In diesem Feldzug konnte er schon ein Dragonerregiment auf eigene Kosten stellen, denn er war durch die Heirat mit einer begüterten alten Witwe zu Vermögen gekommen. Lukrezia von Landeck hieß die Frau; um seine Neigung zu gewinnen hatte sie ihm einen Liebestrank eingegeben, der ihm fast den Tod gebracht hätte. Sie lebte nur wenige Monate an seiner Seite.
Nach der Kampagne gegen Venedig erhob ihn der Kaiser Mathias in den Freiherrenstand und ernannte ihn zum Obrist, Hofkriegsrat und Kämmerer. Beim Ausbruch der böhmischen Unruhen waren seine Fähigkeiten schon anerkannt; die Böhmen wollten ihn zu ihrem General machen. Er blieb aber dem Kaiser treu und flüchtete von Olmütz aus mit der Kriegskasse nach Wien. Im Jahre der Prager Schlacht erhielt er die Reichsgrafenwürde, und nach dem Nikolsburger Frieden schenkte ihm der Kaiser die an Schlesien und an die Lausitz grenzende Herrschaft Friedland, die aus neun Städten und siebenundfünfzig Dörfern und Schlössern bestand; seitdem hieß man ihn nur den »Friedländer«. Auch wurde er Fürst des Reiches. Sein Vermögen entsprach der fürstlichen Würde; er war allmählich durch den Ankauf konfiszierter Güter, die um einen Spottpreis zu haben waren, der reichste Grundherr Böhmens geworden. Er betrieb den Güterschacher im allergrößten Stil, denn er verkaufte auch wieder. Um dieses Freiwerden adeliger Besitztümer verständlich zu machen ist es notwendig, auf die Ursache hinzuweisen.
Als Ferdinand im Jahre 1619 seinem Vetter Mathias folgte, war er bereits einundvierzig Jahre alt, ein kleiner, korpulenter Herr von gesunder Leibesbeschaffenheit und gemäßigter Lebensführung. Der beherrschende Zug seines Wesens war die Frömmigkeit. Khevenhüller schildert ihn, wie er einmal während einer Jagd den Trägern des heiligen Sakraments begegnete, umkehrte und barhäuptig bis an das Lager des Sterbenden folgte. Was Philipp II. für Spanien gewesen, wollte er für Deutschland sein. »Besser eine Wüste, als ein Land voll Ketzer,« war sein Wahlspruch. Die Priester waren für ihn die Stimme Gottes, und jeden einzelnen verehrte er als überirdische Erscheinung. »Tritt mir ein Priester und ein Engel zugleich in den Weg,« so soll er sich einst geäußert haben, »so werde ich dem Priester zuerst meine Ehrfurcht erweisen.« Dies galt freilich nur für die spanisch-aristokratischen Geistlichen, die sich zu dem System der unbedingten Ketzerausrottung bekannten. Er hörte alle Tage zwei Messen in der kaiserlichen Kapelle, am Sonntag außerdem die Messe in der Kirche, eine deutsche und eine italienische Predigt und nachmittags die Vesper; während der Adventszeit versäumte er keine Frühmette, und an allen Prozessionen nahm er zu Fuße teil. Seine Gewissensräte, die Jesuiten Lamormain und Weingärtner, hatten sein ganzes Herz in der Hand und lenkten es, wie der Orden wollte. Er war stark durch seinen Starrsinn. Alles Unglück ertrug er mit der Geduld des Hasses, den er gegen die Ketzer empfand; all das selbstverschuldete, durch Mangel an Treu und Glauben herbeigeführte Unglück erschien ihm als eine vorübergehende Prüfung Gottes. Er war der unversöhnliche Feind der Protestanten in Deutschland und Böhmen; die Rache, die er an ihnen üben wollte, war der Mittelpunkt seiner Gedanken und Gefühle.
Nach des Kaisers Mathias Tode zog das böhmische Protestantenheer gegen Wien. Ferdinand befand sich in der Hofburg. Er war ohne Soldaten und ohne Geld. Er schien verloren. Seine Räte drängten ihn, nach Tirol zu fliehen, selbst die Jesuiten stimmten für Nachgiebigkeit. Ferdinand weigerte sich. Die Lage war furchtbar; Geschosse flogen in die kaiserlichen Fenster, Ferdinand mußte sein Wohnzimmer verlassen. Er betete gegen seinen Feind. Seine Bedrängnis nutzend, erschienen sechzehn protestantische Herren der österreichischen Stände vor ihm und forderten, er solle seine Einwilligung zu der Union mit den Böhmen geben. Ferdinand weigerte sich, die Schrift zu unterzeichnen. Da faßte Andreas Thonradtel den Kaiser bei den Wamsknöpfen und rief ihm zu: »Nandl, gib dich, du mußt unterschreiben.« In diesem Augenblick schmetterten Trompeten im Burghof; es waren die Dampierreschen Kürassiere, die durch das Wassertor in die Stadt gedrungen waren. Sie retteten den Kaiser. Furcht und böses Gewissen trieben die Herren von der protestantischen Adelskirche aus Wien. Der böhmische General hatte die Gelegenheit versäumt, und Ferdinand entschloß sich rasch und kühn, nach Frankfurt zu reisen und sich dort zum Kaiser krönen zu lassen. Aber gerade in dieser Zeit sprachen ihm die Böhmen in Prag die königliche Würde ab. Sie entsetzten ihn als einen Erbfeind der Gewissensfreiheit, als einen Sklaven Spaniens und der Jesuiten, und sie wählten an seiner Statt den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zum König, ein unglücklicher Schritt, der die Erbitterung aller drei Religionsparteien auf die Spitze trieb, denn Friedrich war Kalvinist, und nach Luthers Wort waren die Kalvinisten siebenmal ärger als die Päpstlichen.
Friedrich war ein schöner, stattlicher und galanter Mensch von dreiundzwanzig Jahren. Als er zu Amberg die Nachricht erhielt, daß er König geworden sei, war er betroffen und konnte keinen Beschluß fassen. Erst auf das dritte Schreiben der Böhmen reiste er nach Prag und war nun guten Mutes. Er verließ sich auf seinen mächtigen Schwiegervater, den König von England, er verließ sich auf die Hilfe der deutschen Städte, der Hugenotten in Frankreich und der Graubündtner, die ihm versprachen, den spanischen Armeen die Pässe zu sperren, und am meisten verließ er sich auf seine Jugend.
Doch war er von Anfang an ein verlorener Mann. Wohl stand er an der Spitze einer evangelischen Union, viel mächtiger aber war die Vereinigung der katholischen Fürsten, welchen aus Haß gegen die Kalvinisten auch der protestantische Kurfürst Johann von Sachsen sich gesellte, und als nun gar der König von Frankreich Gesandte an die Fürsten der Union schickte, um sie von Friedrich abzubringen, machten diese ihren Frieden mit der katholischen Liga, und von allen verlassen, sah Friedrich von allen Seiten her die Feinde gegen sich losstürmen. Er hatte es nicht verstanden, die böhmischen Herren zu gewinnen; er hatte es nicht verstanden, sich bei diesen Aristokraten in Respekt zu setzen, die einen König nur zum Schein haben wollten, und daß er ihnen ihre krummen Sachen gerade biege. Sie hatten nur ihre Feudalrechte, Freiheiten und Privilegien im Sinn, nannten den Kaiser einen blinden Hund, den Herzog Max die bayrische Sau und den Kurfürsten von Sachsen den meineidigen, trunkenen Klotz, und als Friedrich sie einmal um sieben Uhr früh zu einer Ratsversammlung bescheiden ließ, wurde ihm erklärt, zu solcher Tageszeit könnten sie nicht kommen, der Mensch müsse nach der Arbeit seine Ruhe haben.
In der Stadt herrschte die größte Unsicherheit. Jeden Tag wurden ein paar Menschen ermordet. Ehebruch und Hurerei wurden zur Plage. Die Ernstgesinnten fanden sich durch Friedrichs Vorliebe für französische Sprache, französische Sitten und Moden beleidigt. Man verspottete ihn, wenn er im rotsamtenen Pelz, mit weißem Hut und gelben Federn abends im Schlitten durch die Stadt fuhr. Aber am meisten verdarb er seine Sache dadurch, daß er die Bilderstürmerei zuließ. Allenthalben wurden die Altäre zerstört, die Kruzifixe zerschlagen, die Gräber der Schutzpatrone aufgerissen und beraubt, die Geräte weggeführt, die schönen Stoffe verbrannt und das geschnitzte Holzwerk zerhackt. Als das große steinerne Kruzifix auf der Moldaubrücke fallen sollte, entstand ein Aufruhr, und man mußte der Wache befehlen, jeden in den Fluß zu werfen, der die Statue anzutasten wage.
So standen die Dinge, als Max und Tilly heranzogen, die glühenden Katholiken, die vor Eifer brannten, die böhmische Hauptstadt den Klauen des Ketzers zu entreißen. Die Jahreszeit war vorgerückt, es fing an rauh und kalt zu werden. Der General Boucquoy war gegen rasche Maßregeln, aber Tilly rief jederzeit im Kriegsrat, wo er vor Ingrimm und Ungeduld stets etwas zu zerknittern oder zu zerreißen pflegte: »Prag, Prag.« Im Frühnebel des 8. November stand die ligistische Armee endlich vor Prag. Der Morgen war bitterkalt, der Boden festgefroren. Abermals wollte Boucquoy den entscheidenden Schlag nicht wagen. Da trat ein spanischer Karmelitermönch auf, riß ein von den Böhmen verstümmeltes Marienbild aus der Kutte und hielt es hoch empor. Herzog Max rief überlaut: »Heilige Maria!« und »heilige Maria« wurde das Feldgeschrei des Tages. Es war Mittag, und die Sonne trat aus den Nebeln. Das Vorrücken zur Schlacht geschah in Massenvierecken des Fußvolks, die Reiterei zog auf beiden Flügeln mit. Die böhmischen Kanonen schossen in die Vierecke, und die ungarischen Reiter machten einen Angriff. Boucquoy und Herzog Max, die sich im Rücken der Armee befanden, hielten die Fliehenden mit dem Degen in der Faust auf. Nun führte der Reiteroberst Pappenheim seine Kürassiere gegen die Ungarn. Ein junger polnischer Lancier erstach das Pferd des den Böhmen verbündeten Herzogs von Anhalt. Er stürzte und wurde gefangen. Dieser Zufall war entscheidend. Die Ungarn ergriffen die Flucht, ihre Flucht verwirrte die ganze böhmische Schlachtordnung, und die Neapolitaner erstürmten die Schanzen und nahmen die Batterien. Die Schlacht war nach einer Stunde zu Ende. Eine einzige Stunde hatte das Schicksal Böhmens, ja das Schicksal Deutschlands für Jahrhunderte entschieden.
Im königlichen Tiergarten hatte Pappenheim gegen eine auserwählte Schar von jungen Adeligen gekämpft. Mit zahllosen Hieb- und Stichwunden bedeckt, fiel er und lag die ganze kalte Novembernacht hindurch ohne Bewußtsein unter Leichen und Pferden. Am andern Morgen kam ein Kroat über ihn. Er biß ihn in den Finger, weil der schöne Ring, den er trug, sich nicht anders wollte abziehen lassen. Das herzhafte Zubeißen des wilden Mannes brachte Pappenheim wieder ins Leben. Er blickte den Kroaten finster an und fragte: »Kerl, was willst du?« Der Kroat erwiderte: »Du hast gute Kleider an, du mußt sterben.« Obgleich halbtot, versetzte ihm Pappenheim eine gewaltige Ohrfeige, versprach aber dann, ihn gut zu belohnen, wenn er ihn zu einem Wundarzt führe. Der Kroat willfahrte.
Am Morgen nach der Schreckensnacht stieg Friedrich, der Winterkönig, in den Reisewagen, ließ alles im Stich, Krone, Kleinodien, Archiv und geheime Kanzlei, und fuhr über Breslau und Berlin nach Holland.
Die Rache des Kaisers war glänzend. Er wartete; er wartete sieben Monate lang. Er wollte die böhmischen Landherren sorglos machen und die Vögel sicher ins Garn locken. Es gelang ihm nur zu gut. Max und Tilly hatten Amnestie verbürgt. Tilly gab den Rat, die Stände nicht zur Verzweiflung zu treiben; aber die Klugen, die den Kaiser lenkten, waren der Meinung, daß Leute, die ein schlechtes Gewissen haben, keine verzweifelten Schritte tun, sondern daß solche Leute es lieben, sich zu ducken.
Eines Tages wurden plötzlich achtundvierzig Häupter des Aufstandes verhaftet und auf den Hradschin gefangengesetzt. Noch hatte Ferdinand seine Bedenken, ob er mit den Rebellen auf spanische Art verfahren solle. Der Jesuit Lamormain machte dem Spintisieren ein Ende, indem er erklärte, er nehme alles auf sein Gewissen. Am andern Morgen war der Blutbote auf dem Wege nach Prag, um dem Statthalter die kaiserlichen Befehle zu überbringen.
Schlag vier Uhr früh ertönte der Knall einer Kartaune vom Hradschin. Die Gefangenen, von einer Reiterschwadron und zweihundert Musketieren begleitet, wurden in bedeckten Wagen zur Altstadt heruntergeführt. Der Richtplatz war unmittelbar vor dem Rathaus, gegenüber der Theinkirche, wo der goldene Hussitenkelch mit dem Schwerte stand. Das Schafott war mit rotem Tuch behangen; auf einer Bühne unter einem Baldachin saß der Statthalter und elf vom Kaiser verordnete Kommissarien. Es war ein regnerischer Junimorgen, aber zum Trost der Märtyrer spannte sich ein schöner Regenbogen über den Lorenzberg.
Der Scharfrichter köpfte innerhalb vier Stunden vierundzwanzig Personen, drei wurden gehenkt. Es waren lauter protestantische Köpfe bis auf den des Grafen Czernin, der Katholik war. Er mußte sterben, weil man den Schein retten wollte, daß das Blutgericht keine Religionsverfolgung, sondern eine abgedrungene politische Maßregel sei. Es waren meist ganz alte Leute, die exekutiert wurden; zehn von ihnen zählten zusammen über siebenhundert Jahre.
Der Kaiser tat noch ein übriges für die Opfer: er betete, während sie hingerichtet wurden. Er hatte zu diesem Zweck eine Wallfahrt nach Mariazell angetreten, lag vor dem Bild der Mutter Gottes auf den Knien und flehte, daß die Böhmen noch vor ihrem Tod in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche zurückgeführt werden möchten.
Elf Monate nach dem Bluttag ließ Ferdinand einen Generalpardon verkündigen. Wer sich schuldig fühlte, sollte sich selbst anklagen, um die kaiserliche Verzeihung zu erhalten. Die Vögel liefen ins Garn. Siebenhundertachtundzwanzig Herren vom Adel, Ritter und Barone, stellten sich freiwillig. Sofort wurden ihre Güter konfisziert. Teils ganz, teils halb, teils ein Drittel. Im kaiserlichen Kabinett fehlte es an Geld. Die konfiszierten Vermögen ergaben die Summe von dreiundvierzig Millionen Gulden, eine ungeheure Summe für jene Zeit. Sie erlaubte dem Kaiser, den Krieg fortzusetzen. Alle Güter kamen in andere Hände. Es wechselte der ganze Besitzstand. Hundertundfünfundachtzig adelige Geschlechter und viele Tausende von Bürgerfamilien verließen die Heimat und wanderten ins Ausland, und ganz Böhmen, ganz Mähren und ganz Österreich wurde mit Gewalt wieder katholisch gemacht.
Der Anteil Wallensteins an der Rebellenbeute betrug nahezu ein Drittel. Sein Reichtum spielte eine wichtige Rolle in den Ereignissen der Zeit. Denn als in Deutschland der Krieg erwachte, als der König von Dänemark sich mit Mansfeld und dem Herzog von Braunschweig verband, als Holland, England und Frankreich sich anschickten, den Protestanten gegen das Haus Habsburg Hilfe zu leisten, sah sich der Kaiser ohne genügende Mittel zur Ausrüstung und Besoldung eines großen Heeres. Da erbot sich Wallenstein, der unterdessen durch die Heirat mit der Gräfin Harrach, der Tochter eines Günstlings des Kaisers, höfische Beziehungen erlangt hatte, zum Helfer. Wallenstein wollte den Krieg in großem Stile führen. Der Kaiser befahl ihm, ein Heer von zwanzigtausend Mann zu werben. Dies schlug er aus. Ein Heer von vierzig- bis fünfzigtausend Mann wollte er stellen, denn ein solches Heer, meinte er, werde sich selbst zu ernähren wissen. Er erhielt darauf die Vollmacht für diese Zahl und zugleich den unbeschränkten Oberbefehl als Generalissimus des Kaisers. Wenige Monate vergingen, und die Armee war beisammen. Sein Name lockte; nicht bloß unbeschäftigte und hungrige Menschen traten unter seine Fahnen, sondern es kamen auch als Offiziere Männer von höchstem Rang. Das Hauptquartier des Heeres war in Eger.
Wallenstein war zum Kriegsfürsten geboren. Er trat im höchsten Prunk auf und imponierte durch seinen Luxus, durch ein glänzendes Gepränge, das jeden blendete, der ihm nahte. Er wußte die stärksten Leidenschaften der Menschen zu erregen und sie dadurch auf Tod und Leben sich dienstbar zu machen. Seine Belohnungen waren königlich, seine Tafel bot unerschöpfliche Genüsse. Unter der einzigen Bedingung der strengsten Disziplin ließ er alle Ausschweifungen seiner Soldaten hingehen. Sein Lager war das lustigste, das Soldaten haben konnten. Er duldete einen riesigen Train von Bedienten, Troßbuben, Fuhrknechten und Weibern, nur Pfaffen duldete er im Lager nicht. Freibeuter aller Konfessionen und jeden Standes zogen ihm zu. Sein scharfes Auge erkannte den Tüchtigen auf den ersten Blick; der gemeinste Mann vermochte die höchste Stellung zu erringen. Jede heroische Tat wurde durch Beförderung und Geschenke ausgezeichnet, aber der Feigling mußte sterben, und über den Ungehorsamen erging der Befehl, der als Kriegsgerichtsspruch galt: Laßt die Bestie hängen.
Er verachtete die Menschen. Sie waren ihm nur Werkzeuge zu seinen Zwecken. Als ihm einmal Gustav Adolf vor einer Schlacht den Antrag machen ließ, daß man im äußersten Fall einander Pardon geben möge, antwortete er: »Die Truppen sollen entweder kombattieren oder krepieren.«
Schon sein Äußeres flößte Ehrerbietung und Scheu ein: eine lange, hagere, stolze Gestalt, das Gesicht immer ernst, bleich oder gelb, die Stirn hoch und gebieterisch, das schwarze Haar kurz abgeschnitten und aufwärtsstehend, die Augen klein, schwarz und feurig-stechend, der Blick finster und voll Argwohn, Lippen und Kinn mit starkem Schnurr- und Knebelbart bedeckt. Seine gewöhnliche Tracht war ein Reiterrock von Elensleder, darüber ein weißes Wams, Mantel und Beinkleider von Scharlach, ein breiter, nach spanischer Art gekräuselter Halskragen, Korduansstiefel, die des Podagras wegen mit Pelz gefüttert waren, und eine lange, rote Feder auf dem Hut.
Mochte es im Lager noch so laut hergehen, in seiner Nähe mußte alles still sein, seine unmittelbare Umgebung mußte die tiefste Ruhe bewahren. Weder Wagengerassel noch Stimmen im Vorzimmer konnte er ertragen. Man sagt, er habe einen Kammerdiener aufknüpfen lassen, der ihn ohne Befehl geweckt, und einen Offizier heimlich umbringen lassen, weil er mit lautklirrenden Sporen vor ihn getreten sei. Er war immer in sich selbst versunken, in sich selbst webend und brütend, nur mit seinen Plänen und Entwürfen beschäftigt. Er forschte unermüdlich und war unablässig tätig, aber immer nur aus sich selbst heraus und fremde Einflüsse schroff abwehrend. Er konnte es nicht einmal leiden, daß man ihn anblickte, wenn er seine Befehle gab; wenn er durch die Gassen des Lagers hindurchschritt, mußten die Soldaten so tun, als bemerkten sie ihn nicht. Ein wunderliches Grauen überfiel die Leute, wenn seine hagere Gestalt gespenstergleich vorüberging. Es umgab ihn etwas Geheimnisvolles, Feierliches und Banges. Er schritt eingehüllt in diese Zauber, und sie bildeten einen Nimbus um ihn. Der Soldat glaubte steif und fest, daß der General mit dunklen Mächten im Bündnis stehe, daß ihm die Sterne Bescheid sagten, daß er keinen Hund bellen, keinen Hahn krähen hören könne, daß er hieb-, kugel- und stichfest sei, und vor allem, daß er die Fortuna an seine Fahnen gebannt habe. Die Fortuna, die seine Göttin war, wurde die Göttin des ganzen Heeres.
Wallenstein war ein Mann von heißestem Temperament, aber äußerlich war er immer kalt und ruhig. »Laßt fleißig münzen,« schreibt er einmal an seinen Hauptmann im Herzogtum Friedland, »auf daß ich nicht Ursach hab, solches zu ahnden, denn ich höre, daß man dem nicht nachkommt, wie ich es befohlen, welches mir wohl in die Nasen raucht. Ich bin nicht gewohnt, eine Sache oft zu befehlen.« Er war höchst wortkarg und sprach recht wenig, dann aber mit Nachdruck. Am wenigsten sprach er von sich selbst. Der glühendste Ehrgeiz flammte still und lautlos in seiner Brust; ihm opferte er kaltblütig alles. Er war ein Meister in der Verstellung; keiner wußte um seine Absichten, und dem Umstand, daß er in wichtigen Sachen niemals etwas Schriftliches von sich gab, verdankte er viele seiner Erfolge. Er war zweiundvierzig Jahre alt, als er den Oberbefehl übernahm.
Im Herbst 1625 zog Wallenstein gegen den König von Dänemark. Er überwinterte in Halberstadt, das er erobert hatte. Im Feldzug des folgenden Jahres schlug er den Grafen Mansfeld bei der Dessauerbrücke. Dann gewann er dem Kaiser Schlesien zurück, eroberte die dänischen Besitzungen und Mecklenburg, das sein Herzogtum wurde. Zum Dank dafür, und weil er dem Kaiser viel Geld vorstreckte, überließ ihm Ferdinand das Herzogtum Sagan und verkaufte ihm die Herrschaft Priebus für einen niedrigen Scheinpreis. Auch wurde er zum General des baltischen und ozeanischen Meeres ernannt. Österreich wollte nämlich eine Seemacht werden. Dazu schien alles auf dem besten Wege, Dänemark lag darnieder, die Hansastädte waren willens, dem Kaiser behilflich zu sein, nur die Festung Stralsund widerstand. Ein halbes Jahr lang belagerte Wallenstein diese Stadt; obwohl er schwor, daß er sie einnehmen werde, und wenn sie mit Ketten an den Himmel gebunden wäre, mußte er unverrichteter Dinge wieder abziehen. Dieser Mißerfolg untergrub sein Ansehen im Norden Deutschlands. Auch der Kaiser verlor den Glauben an seine Unüberwindlichkeit. Jetzt traten die Fürsten mit ihren Klagen über den beispiellosen Pomp des Emporkömmlings auf. Ein Notschrei erhob sich über die unerträglichen Brandschatzungen, mit denen der General die besiegten Länder heimgesucht. Bis dahin hatten alle, verblüfft von seinem fabelhaften Glück, geschwiegen, nun taten sich die Lippen auf und ergossen sich in Verwünschungen gegen den Tyrannen, der auf Kosten des allgemeinen Elends im Überfluß schwelgte. Während Tausende ringsumher den Hungertod starben, während sich viele Bürger und Bauern entleibten, um der Not zu entrinnen, lebte jeder Rittmeister der Wallensteinschen Soldateska wie ein Fürst, und in Schlesien, wo der Bruder den Bruder, die Eltern ihre Kinder anfielen, um sie aus Hunger zu schlachten, war der Übermut der Söldlinge am größten. Die Häuser wurden geplündert und demoliert, ganze Dörfer verbrannt, die Weiber geschändet, den Männern Nasen und Ohren abgeschnitten; Offiziere, die kurz zuvor bettelarm gewesen waren, besaßen drei- bis viermalhunderttausend Gulden an barem Geld.
Aber noch gehorchte ganz Deutschland dem Winke Wallensteins. Er stand wie ein Alleinherrscher da. Das Unbegreiflichste an dem unbegreiflichen Manne war, daß er die Rüstungen umso eifriger betrieb, je mehr die Feinde schwanden. Das Heer zählte erst fünfzigtausend, dann hunderttausend, schließlich hundertfünfzigtausend Mann. Diese furchtbare Armada des Kaisers erweckte bei allen Fürsten Eifersucht und Angst. Die Kurfürsten und der Papst, die Aristokraten des Reichs und die Jesuiten standen dagegen auf, aber die Seele aller Ratschläge wider den übermächtig werdenden Kaiser war der Kardinal Richelieu, der in einem Bericht an den Papst Urban VIII. unverblümt die Absetzung Wallensteins forderte.
 |
| Wallenstein, |
| nach einem Stich von Peter de Jode. |
Dieser Bericht, erfüllt von tiefster pfäffischer Schlauheit, sprach von Österreich als von einer »Bestia mit vielen Köpfen«, von denen die abgeschnittenen immer wieder nachwüchsen; Gewalt fruchte nichts, man müsse das Blatt umkehren und des Kaisers Frömmigkeit ausnutzen. Derart müsse man seine Gottesfurcht ausnutzen, daß man ihn hetze, die seit dem Passauer Vertrag eingezogenen Kirchengüter zurückzuverlangen; so werde er sich alle protestantischen Fürsten auf immer zu Feinden machen. Ferner müsse man seine Frömmigkeit dadurch ausnutzen, daß man wegen der üblen Führung des Kriegsvolks sein Gewissen rühre und sein Mitleid reize. Alsdann solle Frankreich ein großes Heer nach Deutschland schicken, Gewalt brauchen, wo Gewalt vonnöten und mit dem Versprechen von Religionsfreiheit nicht sparsam sein.
Der Papst war mit diesen Vorschlägen einverstanden, und der Kaiser wurde langsam umgarnt. Sein Beichtvater bedeutete ihm, daß der Passauer und der Augsburger Religionsfriede ungültig seien, weil sie ohne den Konsens des Papstes abgeschlossen waren. Darauf erließ der Kaiser das berüchtigte Restitutionsedikt, welches alles wieder katholisch machte, was seit siebenundsiebzig Jahren protestantisch geworden war, und sofort erfolgte die strengste Exekution. Obwohl die norddeutschen Protestanten erklärten, sie würden eher Gesetz und Sitte von sich werfen und Germanien wieder in die alte Waldwildnis verwandeln als zugeben, daß das Edikt vollzogen werde, wurden sie durch die kaiserlichen Heere dazu gezwungen. Fortwährend lagen die Truppen in allen Ländern der Protestanten, mit Ausnahme Kursachsens, das noch für zu mächtig erachtet wurde, und raubten sie aus. Jede Beschwerde wurde höhnisch abgewiesen, und es fiel das Wort: Der Kaiser will lieber, daß die Deutschen Bettler seien als Rebellen.
Indessen verfolgte Wallenstein schweigend seine Entwürfe. Es kam der Tag, wo er seine Gedanken offen aussprach: »Man braucht keine Fürsten und Kurfürsten mehr. Jetzo ist es Zeit, daß man ihnen das Gasthütel abzieht. In Deutschland soll nur der Kaiser allein Herr sein.« Diese Sprache klang der deutschen Fürstenaristokratie furchtbar in die Ohren. Wallensteins Plan war, sämtliche kleinen Reichsfürsten mit Arglist oder mit Gewalt zu vertreiben, ihren Nachlaß zu parzellieren und an die Offiziere seines Heeres zu verleihen. Zum Teil war dies schon geschehen. Das neue Kaiserreich sollte sich auf den Soldatenadel stützen.
Natürlich war der Kaiser nicht sehr geneigt, einen Mann zu entfernen, der ein solches Machtideal für ihn verwirklichen wollte. Auf dem Regensburger Fürstentag im Juni 1630 befand sich Ferdinand in einer verzweifelten Lage. Die Fürsten bedrängten ihn, das über jedes Maß angeschwollene Heer zu verringern und den unerträglichen Diktator, den Urheber des allgemeinen Elends, zu entlassen. Weigerte sich der Kaiser, so drohten sie, sich mit den Protestanten und mit Frankreich zu verbünden. Auf der andern Seite erbot sich Wallenstein, die Fürsten in Regensburg zu überrumpeln und unschädlich zu machen. Noch ganz andere Pläne schwebten vor seinem kühnen Geist, und er wartete nur, daß der Kaiser sie gutheiße. Er wollte für den Kaiser gegen den Papst ziehen. Rom sei schon seit hundert Jahren nicht geplündert worden, ließ er sich vernehmen, es müsse jetzt um vieles reicher sein. Er hatte gegen hunderttausend Mann seines Heeres nach dem südwestlichen Deutschland gezogen und wollte sich nicht nur gegen Frankreich und Italien, sondern auch gegen die katholischen Fürsten Deutschlands wenden. Er und seine Günstlinge drangen unaufhörlich in den Kaiser, daß er seine Einwilligung zu den militärischen Operationen geben möge. Aber der Kaiser gab nicht die Fürsten auf, wie Wallenstein es wollte, er gab Wallenstein auf, wie die Fürsten es wollten. Dem päpstlichen Nunzius Rocci gelang es, Ferdinand umzustimmen; es gelang ihm mit Hilfe des feinsten Diplomaten jener Zeit, des Kapuzinerpaters Joseph, eines Mannes, der, wie sein Begleiter Herr von Leon sagte, gar keine Seele hatte, sondern nur Untiefen, in die ein jeder geraten müsse, der mit ihm verhandelte. Der Kaiser unterzeichnete den Absetzungsbefehl des Friedländers und hieb sich damit gleichzeitig die rechte Hand vom Arm. In dem Augenblick, wo alles zu gewinnen war, gab er alles auf. Die kirchliche Politik hat nie einen größeren Triumph gefeiert.
Zwei alte Freunde Wallensteins, der Hofkanzler Werdenberg und der Hofkriegsrat Westenberg, wurden beauftragt, ihm den Absetzungsbefehl zu überbringen. Sie trafen ihn in seinem Hauptquartier in Memmingen, anscheinend tief in astrologischen Studien, in Wirklichkeit völlig beschäftigt mit dem Gedanken an die Überrumpelung der deutschen Fürsten. Er empfing und bewirtete die kaiserlichen Räte prächtig. Lange Zeit wurde von gleichgültigen Dingen gesprochen, die Herren trauten sich nicht mit der Sprache heraus. Da nahm Wallenstein einige Papiere vom Tisch und sagte: »Diese Dokumente enthalten des Kaisers und des Kurfürsten von Bayern Nativität. Aus ihnen könnt Ihr sehen, daß ich Euren Auftrag kenne. Die Sterne zeigen, daß der Spiritus des Kurfürsten den des Kaisers dominiert. Aus dieser Ursach messe ich dem Kaiser keine Schuld bei. Es tut mir weh, daß kaiserliche Majestät mit Abdankung der Truppen den edelsten Stein aus seiner Krone wegwirft, es tut mir weh, daß kaiserliche Majestät sich meiner so wenig angenommen hat, aber Gehorsam will ich leisten.«
Wallenstein zog sich nun nach Gitschin, der Hauptstadt seines Herzogtums Friedland, in die Einsamkeit zurück. Von seinem Heere wurden dreißig Regimenter abgedankt, der Rest vereinigte sich mit Tilly.
Es erhob sich aber jetzt für den gefährdeten Protestantismus ein Retter in der Person Gustav Adolfs von Schweden, der Schneemajestät, wie ihn die Herren in Wien nannten, die freilich noch nicht wußten, was für Hitze ihnen dieser Eiskönig machen würde. Bei den Protestanten hieß er wegen seines blonden Haares und Bartes der Goldkönig, auch den Löwen aus Mitternacht hießen sie ihn in ihrer gläubigen Hoffnung.
Gustav Adolf war von ungewöhnlich hohem Wuchs, starkem Knochenbau und großer Wohlbeleibtheit, so daß nur ein starkes Pferd ihn zu tragen vermochte. Seine graublauen Augen blickten unter der weiten Stirn mit freundlichem Ausdruck. Seine Haltung und sein Anstand waren echt fürstlich, seine ganze Erscheinung trug das Gepräge der Zuversicht und Offenheit, und seine wohltönende Stimme flößte Vertrauen ein. Er übte große Macht über die Gemüter, seine Zunge war beredt, und seine Unterhaltung voll Anmut und Leutseligkeit. Er liebte die Wissenschaften, sein Lieblingsbuch war das Buch vom Krieg und Frieden von Hugo Grotius, das er immer mit sich führte. Seit seiner Jugend hatte nur der Krieg für ihn Reiz, er war zum Helden und zum Herrscher geboren. Er war fromm und gottesfürchtig, aber er war auch klug; seine Diplomatie hielt gleichen Schritt mit seiner Heldenschaft. Seine Geschäftsleute wurden hoch bezahlt, ein Netz von schwedischen Gesandten und Spionen war über die europäischen Höfe verbreitet, und sein Kabinett war durch seine undurchdringliche Verschwiegenheit so ausgezeichnet, daß die französischen Gesandten beständig darüber klagten, nie hinter die eigentlichen Absichten der Schweden kommen zu können. Fremden Ministern und Offizieren ließ Gustav, wenn sie in sein Lager zu Unterhandlungen kamen, ihre Geheimnisse beim Wein entlocken, wozu meist ein schottischer Oberst verwendet wurde, der übermäßig viel vertragen konnte und dabei doch den Verstand bewahrte.
Mit bloß vierzehntausend Mann kam Gustav Adolf nach Deutschland; die kaiserliche Macht war wenigstens doppelt so stark. Aber er hatte viel Zulauf von Wallensteins entlassener Armada, und er verließ sich auf die Sympathie im Volke; in allen Städten, die er durchzog, blies man von den Türmen: nun kommt der Heiden Heiland. Er nahm Stettin ein, rief die Mecklenburger von Wallenstein ab und zum Gehorsam gegen die alten Herzöge zurück, erstürmte Frankfurt an der Oder, bemühte sich, freilich vergebens, ein Bündnis zwischen den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg zu erwirken, und sandte, da Magdeburg in großer Not war, einen der Obersten seiner vierzig deutschen Kompanien, Herrn Dietrich von Falkenberg, in die belagerte Stadt. Falkenberg, ein sehr tapferer Edelmann, verkleidete sich als Schiffer und schlich durch Pappenheims Scharen in die Stadt, wo er alsbald den Kommandantenposten übernahm. Pappenheim machte den Versuch, ihn durch das Anerbieten einer großen Summe zu bestechen, er aber erwiderte: »Braucht der Pappenheim einen Schelmen, so mag er ihn im eigenen Busen suchen.«
Aber die Stadt war nicht zu halten. Tilly war mit dreißigtausend Mann vor den Mauern angelangt und eroberte alle Außenwerke, doch hatte er erfahren, daß der Schwedenkönig in der Nähe stehe, und wollte deshalb die Belagerung aufheben. Nur Pappenheim bestand im Kriegsrat auf einer Bestürmung. Am folgenden Tag fiel die Stadt. Pappenheim wurde ihr Mordbrenner. Um die Feinde zu vertreiben hatte er einige Häuser in Brand stecken lassen, der Wind blies in die Flammen, die nun alles ergriffen. Zornig darüber, daß ihnen die Feuersbrunst die erhoffte Beute entzog, schlugen die kaiserlichen Truppen jeden tot, der ihnen in den Weg kam. Einige ligistische Offiziere, empört über das teuflische Wüten der Kroaten, Ungarn und Wallonen, traten vor Tilly und baten ihn, er möge dem Gemetzel Einhalt tun. Mit finsterem Gesicht antwortete ihnen Tilly: »Drei Stunden Plünderung ist Kriegsregel. Der Soldat will für Müh und Gefahr etwas haben.« Pappenheim schrieb nach München: »Magdeburgs Jungfrauschaft ist weg. Wir haben es mit stürmender Hand erobert, den Bischof habe ich gefangen, Falkenberg ist niedergehaut samt allen Bürgern, so in der Wehr gewesen. Was sich von den Menschen in die Keller oder Böden versteckt hatte, ist alles verbrannt. Ich halt, es seien über zwanzigtausend Menschen draufgegangen und ist gewiß seit der Zerstörung Jerusalems kein greulicheres Werk und Straf Gottes gesehen worden.« An den Kaiser nach Wien schrieb er: »Es ist mir und meinen rätlichen Spießgesellen bei dieser wunderbaren Viktori nichts abgegangen, als daß wir nit Eure kaiserliche Majestät und dero kaiserliches Frauenzimmer als Zuschauer gehabt.«
Das war die magdeburgische Hochzeit, wie die kaiserliche Soldateska es nannte. Der Dom war von den Flammen verschont geblieben, in ihm wurde Messe gelesen und das Tedeum gesungen.
Das Kriegsvolk aber sang:
Gustav Adolf hatte nichts zum Entsatz Magdeburgs wagen wollen; in einer Schutzschrift wälzte er die Schuld auf die beiden Kurfürsten. Endlich rückte er vor Berlin und forderte eine bestimmte Erklärung. Der Kurfürst Georg Wilhelm war sein Schwager, aber er war ganz in den Händen seines Ministers, des Grafen Schwarzenberg, und dieser stand im Solde der Jesuiten. Der Kurfürst wollte stille sitzen und bangte davor, Land und Leute zu verlieren, und er fürchtete die Übermacht des Kaisers. Gustav Adolf zwang ihn jedoch, in sein Lager zu kommen, die Allianz zu unterzeichnen, und besetzte dann Berlin und Spandau. Darauf zog er südwärts dem alten Tilly entgegen, und in jenen Herzfeldern Deutschlands, bei Leipzig, wo mehrmals die deutschen Geschicke ausgekämpft worden sind, sollte nun die Entscheidung fallen.
Tilly hatte sein Hauptquartier in einem abgelegenen Hause vor Leipzig, er merkte erst nachher, daß es des Totengräbers Haus gewesen. Er hatte seine Befehle in einem Zimmer ausgefertigt, in dem sich lauter Pyramiden von Totenschädeln und Gebeinen befanden. Eine düstere Ahnung ergriff ihn, selbst Pappenheim erbleichte.
Am Morgen des Schlachttages schickte Tilly den Pappenheimer mit zweitausend Kürassieren aus, damit er rekognosziere. Aber der hitzige Mann ließ sich in ein Gefecht ein, und um ihn zu retten mußte Tilly seine ganze Streitmacht entfalten. Seine Völker trugen weiße Bänder auf Helmen und Hüten und weiße Binden um den Arm; er selbst kommandierte in einem sonderbaren Kostüm, in einem grünseidenen Schlafrock; auf dem Kopf hatte er ein Barett mit bunten Federn, und er ritt seinen kleinen Schimmel.
Der Schwedenkönig entwickelte sein ganzes Kriegsgenie und zeigte die Überlegenheit seines leichten Fußvolks. Er machte gegen die andrängenden Kaiserlichen Front, wendete sich mit der Spitze seiner Kolonne gegen die Hügel, wo ihre Geschütze standen, und beschoß Tilly mit seinen eigenen Kanonen. Die Reiterei wurde aus dem Feld geschlagen, das Fußvolk floh, und nur fünf Wallonenregimenter schlugen sich mit ihrem alten Vater Tilly unter dem Schutze der Nacht in geschlossener Ordnung durch. Tilly starrte vor sich hin, die Augen voll von Tränen. Er hatte schon drei Streifschüsse. In Halle traf er den Pappenheimer, der wieder mit höchster Bravur gefochten und vierzehn Schweden teils niedergehauen, teils, weil ihm das Schwert zerbrochen war, wie ein Bär in seinen Armen erdrückt hatte. Die Schweden erbeuteten das ganze kaiserliche Lager, alles Geschütz und über hundert Fahnen.
Jetzt trat in Wien eine andere Stimmung ein; die Hofschranzen und Weiber, Jesuiten und Kapuziner vermaßen sich nicht mehr, das »neue Feinderl«, wie sie Gustav Adolf nannten, mit Ruten über die Ostsee hineinzupeitschen oder das Schneeköniglein zerrinnen zu sehen, wenn es sich dem Süden näherte. Der Sieg Gustav Adolfs war ein zermalmender Schlag für den Kaiser und die Katholiken. Der König Sigismund von Polen jammerte, er könne gar nicht begreifen, warum unser Herrgott lutherisch geworden sei. Angst und Bedrücktheit wuchsen, als der Schwede durch die »Pfaffengasse« ins Reich zog, Erfurt, Würzburg, Hanau und Frankfurt nahm, die Pfalz befreite, mit Bayern unterhandelte, Augsburg eroberte und mit suveräner Macht jeden Widerstand zerbrach.
Im Mai des Jahres 1632 hielt er seinen Einzug in München, und in seiner Begleitung befand sich der vertriebene Böhmenkönig. Das Pfingstfest feierte er in Augsburg; eine Chronik erzählt davon also: »Am heiligen Pfingsttag wohnte der König dem öffentlichen Gottesdienst nicht bei, sondern ließ sich von seinem Hofprediger Doktor Fabricius in seinem Kabinett predigen. Abends aber bei der Tafel bekam er jählingen Lust zu tanzen, dahero denn sogleich Anstalt gemacht worden, daß die Geschlechterstöchter in den Fuggerschen Häusern erschienen, mit welchen sich sowohl der König wie die anwesenden fürstlichen Personen etliche Stunden lang mit englischen und deutschen Tänzen erlustiget.« Gustav Adolf war ein großer Frauenfreund; er wollte eine schöne Augsburgerin küssen; sie hieß Jakobine Lauber und gefiel ihm sehr, aber sie wehrte sich und riß dem König die Halskrause ab.
In diese friedlichen Tage hinein fiel die Nachricht, daß Wallenstein gegen den König von Schweden heranziehe.
In stolzer Ruhe hatte Wallenstein in Gitschin und in Prag gelebt. Schon von Memmingen aus hatte er für sein neues Schloß Sorge getragen und an seinen Landeshauptmann geschrieben: »Seht, daß die zwei Kapellen, meine und meines Weibes, heuer fertig werden; laßt die Altäre darin machen, wie auch die fünf Altäre in der Kirche verfertigen, daß ich daselbst den Gottesdienst verrichten könne. So seht ebenmäßig, daß alle Zimmer fertig werden und mit schönen Bildern versehen, denn in diesem verlasse ich mich allein auf Euch. So werdet Ihr auch sehen, daß der Garten verfertigt wird und viel Fontanen daselbst gemacht. Die Loggia laßt geschwind mit Zwerchgewölben und lavor di stucco zieren. Sagt dem Baumeister, daß gleich in der Mitte auf dem Platz vor der Loggia muß eine mächtige Fontana sein, dahin alles Wasser laufen wird, alsdann aus derselben, daß sich das Wasser auf die rechte und linke Hand teilt, und die andern Fontanen laufen macht. Ich vermeine Mitte Oktober zu Gitschin zu sein und daselbst zu verbleiben; dahero seht, daß das Gebäu fertig und die Zimmer mit Damast, Sammet und goldenen Ledern ausgeputzt und möbliert werden. Laßt mir auch bittern Wermutmost anmachen, der dulce picante ist, auf daß ich ihn kann desto ehender haben. Laßt alle Ställe verfertigen wie auch den Tummelplatz und das Ballhaus.«
In Prag lebte Wallenstein mit königlichem Aufwand, aber für seine Person, wie im Lager, in der tiefsten Abgeschiedenheit. Für den Palast, den er auf der Kleinseite hatte bauen lassen, waren hundert Häuser niedergerissen worden, um Platz zu gewinnen. Alle Straßen, die die Zugänge bildeten, waren mit Ketten gesperrt. Sechs Portale führten zu dem Palast; im Schloßhof stand eine Leibwache von fünfzig aufs reichste gekleideten Hellebardieren. Sein Hofstaat zählte an tausend Personen. Graf Paul Liechtenstein stand als Oberhofmeister an der Spitze, ein Graf Harrach war Oberstkämmerer, ein Graf Hardegg Oberststallmeister. Vierundzwanzig Kammerherren bedienten des Friedländers Durchlaucht, trugen, wie die des Kaisers, die goldenen Schlüssel, und sechzig Edelknaben aus den vornehmsten Häusern waren um ihn, alle in hellblauen Samt mit Gold gekleidet. Auch lebten viele seiner ehemaligen Offiziere bei ihm, denen er Löhnung und freie Tafel gab. Jede Mahlzeit bestand aus hundert Schüsseln. In den Marmorställen fraßen über tausend Pferde aus marmornen Krippen, und wenn er reiste, geschah es nicht anders als in fünfzig vierspännigen Wagen. Im Festsaal des Prager Palastes hatte er sich als Triumphator malen lassen, von vier Sonnenrossen gezogen, einen Stern über dem lorbeerbekränzten Haupt. Die langen Zimmerreihen waren mit astrologischen und mythologischen Figuren geschmückt. Aus einem Rundgemach führte eine geheime Treppe in eine Badegrotte aus künstlichem Tropfstein. Aus dieser Grotte trat man in eine hohe Säulenhalle und von da in den Garten mit seinen Fontänen und fischreichen Kanälen.
Wallensteins Vermögen war für jene Zeit ungeheuer. Man hat seine Jahreseinkünfte auf sechs Millionen Gulden geschätzt; er zog sie teils aus den Kapitalien, die er in den Banken von Venedig und Amsterdam liegen hatte, teils aus den böhmischen und mährischen Gütern und dem Fürstentum Sagan. Unausgesetzt erließ er einsichtsvolle Verfügungen für seinen Besitz, suchte die Jesuiten durch große Stiftungen beim Guten zu erhalten und berief tüchtige Männer in seinen Dienst. Aber er verkehrte nur mit sehr wenigen Personen; es lebte der italienische Astrolog Seni bei ihm, mit dem er viele Nächte in eifrigen Studien verbrachte, und seine einzigen Vertrauten waren sein Schwager Adam Terzka und dessen Mutter, die ihm wegen ihrer hohen Klugheit ganz besonders wert war. Seine Gesundheit hatte durch die Kriegsstrapazen gelitten, er mußte mäßig leben, und da er vom Podagra geplagt wurde, konnte er nur auf einen indischen Rohrstock gestützt gehen.
Ununterbrochen hatte der Kaiserhof mit Wallenstein korrespondiert. Nach der furchtbaren Leipziger Schlacht mußte man daran denken, einen Mann wieder zu gewinnen, dessen Kredit bei der Soldateska ohnegleichen war, und so wurde Questenberg nach Prag geschickt, um mit Wallenstein wegen Wiederannahme des Kommandos zu verhandeln. Wallenstein lehnte ab. Darauf ging Prag fast ohne Schwertstreich verloren. Don Balthasar Maradas zog mit den Truppen ab, um sie in Sicherheit zu bringen, hatte aber zuvor Wallenstein um Rat fragen lassen; dieser hatte erwidert, er habe kein Kommando mehr, Maradas möge tun, was er wolle. Darauf verließ er Prag, zog nach Gitschin und schickte seine Frau und seinen Vetter Max nach Wien. Max ward nun vom Kaiser mit einem beweglichen Schreiben an Wallenstein zurückgeschickt; Ferdinand flehte, er möge ihn doch in der gegenwärtigen Not nicht im Stiche lassen. Das war es, was Wallenstein wollte. Er begab sich nun nach Znaim, um mit dem Kaiser weiter zu unterhandeln. Er bequemte sich, das Kommando wieder zu übernehmen, aber vorerst nur auf drei Monate. Man drang immer mehr in ihn, und so entschloß er sich endlich, den Oberbefehl ohne Zeitbestimmung zu übernehmen, aber »in absolutissima forma«. Weder der Kaiser noch sein Sohn sollten bei der Armee etwas zu schaffen haben; zwei Artikel des Vertrags gaben Wallenstein unbeschränkte Macht, die Güter rebellischer Reichsstände einzuziehen, und wen er für schuldig erachte, zu begnaden oder zu bestrafen. Ausdrücklich war bedungen, daß weder der Reichshofrat, noch das Kammergericht, noch der Kaiser selbst in solchen Dingen das geringste einreden dürfe. All das liefert den Beweis, daß Wallenstein mit ungebrochenem Willen auf sein altes Ziel losging. Als »ordinari recompens« verlangte er kaiserliche Assekuration auf ein österreichisches Erbland und als »extra ordinari recompens« die Oberlehensherrschaft in den eroberten Ländern.
Der Vertrag wurde in demselben Monat unterschrieben, in welchem Tilly am Lech gefallen war. Seine Bedingungen sind von so außerordentlicher Art, daß sie in der Weltgeschichte ohne Beispiel dastehen. Nur ein so phantastischer Mann wie Wallenstein konnte sich einbilden, daß er das Seil ohne Gefahr so straff spannen könne. Nur ein Charakter so voll Fatum konnte ohne Erbeben ein Schicksal auf sich nehmen, das jede Erwartung heuchlerisch erfüllt.
Wenige Monate vergingen, und Wallenstein hatte wieder ein neues Heer von zweihundertvierzehn Schwadronen Reiterei, hundertzwanzig Kompanien Fußvolk nebst vierundvierzig Kanonen. Sofort säuberte er Prag und Böhmen von den Sachsen und vereinte sich in Eger mit dem Herzog von Bayern, der ihn vordem gestürzt hatte und ihn jetzt als Kriegsherrn anerkennen mußte. Beide zogen gen Nürnberg, wo der Schwedenkönig sich verschanzt hatte. Wallenstein besetzte die Anhöhen des Altenbergs und verschanzte sich gleichfalls. Sein Plan war, keine Schlacht zu liefern; er wollte Gustav Adolf zeigen, daß er schlagen oder auch nicht schlagen könne, wie es ihm beliebe. Monatelang stand Wallenstein wie eingefroren. Ringsumher begannen Hunger und Elend zu wüten. Gustav Adolf mußte kämpfen oder weichen. Er versuchte einen Sturm auf Wallensteins Linien, der mißlang aber gänzlich. Von diesem Tag an verlor er seinen frohen Mut und erhielt ihn nicht wieder. Er ließ Wallenstein Friedensvorschläge machen, aber noch ehe die Antwort kam, gab er sein Lager auf. Er zog an Wallenstein vorbei, der unbeweglich blieb, zog an die Donau und dann, dem Hilferuf des Kurfürsten von Sachsen folgend, an die Saale. Auch Wallenstein setzte sich jetzt in Bewegung; er ließ sein Lager anzünden, das anderthalb Meilen im Umfang gehabt hatte. Sein Heer war ein wandernder Raubstaat. Überall wurden die Herden weggetrieben, die Obstbäume umgehauen und die Dörfer verbrannt.
Wieder in den Feldern bei Leipzig trafen sich die Heere. Wallenstein hatte an Pappenheim geschrieben: »Der Feind marschiert hereinwärts, der Herr lasse alles stehen und liegen und incaminiere sich herzu mit allem Volk und Stücken, auf daß Er sich morgen früh bei uns befinde.« Dieser Befehl ist noch im Wiener Archiv aufbewahrt; er ist getränkt mit dem Blute Pappenheims, der am Tag von Lützen fiel.
Wallenstein ließ am Schlachtmorgen die Generale und Obersten an seinen Wagen kommen, um die Befehle zu erteilen, dann erst bestieg er sein Schlachtroß, aber die Steigbügel mußten mit seidenen Tüchern umwunden werden, da ihm die Füße schmerzten. Auf dem ganzen Gefild lag dichter Nebel. Gustav Adolf hatte ebenfalls sein Leibroß bestiegen und redete einzeln zu vielen Leuten seines Heeres. Dann ließ er zum hellen Schall der Trompeten und Pauken: »Eine feste Burg ist unser Gott« und jenes andere, sein Lieblingslied, anstimmen: »Verzage nicht, du Häuflein klein, obgleich die Feinde willens sein, dich gänzlich zu zerstören«.
Die Schlacht begann. Nach dreistündiger Bemühung wurden mehrere der wallensteinschen Vierecke durch die schwedische Infanterie zersprengt. Da gewahrte der König die schwarzen Kürassiere Wallensteins mit dem in blanker Rüstung davor haltenden Oberst Piccolomini. Er befahl dem finnischen Reiterregiment, sie anzugreifen, erhielt aber die Nachricht, daß sein Fußvolk wieder zum Weichen gebracht worden sei. Sogleich eilte er an der Spitze des smaländischen Regiments zu Hilfe. Dem rasch Voransprengenden konnten nur wenige folgen. Auf einmal befand er sich mitten unter den schwarzen Reitern. Sein Pferd wird durch den Hals geschossen, ihm selbst zerschmettert ein Pistolenschuß den linken Arm. Seine ersten Worte waren: »Es ist nichts, folgt mir.« Aber die Wunde war so bedeutend, daß die Knochen aus dem Ärmel hervorstarrten. Er wandte sich, um aus dem Getümmel zu entkommen, im selben Augenblick erhielt er einen zweiten Pistolenschuß in den Rücken. Mit dem Seufzer: »Mein Gott, mein Gott,« sinkt er vom Pferd, bleibt aber im Steigbügel hängen, das Pferd schleift ihn mit sich fort. Seine Begleiter fallen oder fliehen, nur ein Page bleibt bei ihm. Er lebt noch, der Page will nicht sagen, daß es der König ist, er wird selbst auf den Tod verwundet. Der König wird seiner goldenen Halskette beraubt und entkleidet, er ruft endlich: »Ich bin der König von Schweden.« Die schwarzen Kürassiere wollen ihn fortschleppen. Da sprengt das Stenbocksche Regiment heran. Die Kürassiere fliehen; da sie den König nicht mitnehmen können, durchschießen sie ihm den Kopf und durchstechen ihm den Leib mit vielen Stichen. Er sinkt zur Erde, der Hufschlag der Rosse braust über den Leichnam dahin.
Der verwundete, blutbedeckte, reiterlose Schimmel des Königs verkündigte, an der schwedischen Front entlang jagend, das geschehene Unglück. Zuerst entmutigt, dann in ihrem Schmerz zur Rache angespornt, griffen die Schweden neuerdings an, und wäre jetzt nicht Pappenheim mit vier frischen Regimentern auf dem Walplatz erschienen, so hätte der heldenhafte Bernhard von Weimar schon um die dritte Nachmittagsstunde gesiegt. So begann die Schlacht von neuem, aber auch Pappenheim erlag vor der unwiderstehlichen Gewalt des jungen Bernhard. Das kaiserliche Heer ergriff die Flucht. Wallenstein schlug in Prag seine Winterquartiere auf und ließ viele Offiziere hinrichten, weil durch sie, wie er sich ausdrückte, die kaiserlichen Waffen unauslöschlichen Spott erlitten hätten. In Böhmen sollte sich sein dunkles Schicksal erfüllen; ihm war nicht der Heldentod auf dem Schlachtfeld beschieden.
Am anderen Morgen suchten die Schweden unter den zahllosen Leichen des Schlachtfeldes die edelste Leiche, die des Königs. Man fand sie, nackt ausgezogen, vor Blut und Hufschlägen kaum erkennbar, mit neun Wunden bedeckt, unfern des großen Steins, der jetzt noch der Schwedenstein heißt. An der Leiche schworen die Soldaten dem Herzog Bernhard, ihm zu folgen bis ans Ende der Welt.
Der unerwartete Tod Gustav Adolfs erregte ganz Europa. Der Kaiser ließ in allen Kirchen Dankgebete singen, als wenn er den glorreichsten Sieg erfochten hätte, und er weinte beim Anblick des blutigen Kollers mit den Schußöffnungen im linken Ärmel, das der König in der Schlacht getragen hatte. In Madrid wurden Freudenfeste veranstaltet und der Tod des Königs zum Ergötzen aller Gläubigen im Schauspiel dargestellt. Der Papst, der es im stillen recht gern gesehen hatte, daß dem Kaiser ein Bedränger aufgestanden war, ließ eine Messe lesen. Den vertriebenen Winterkönig rührte bei der Nachricht vor Schrecken der Schlag, und er starb, sechsunddreißig Jahre alt; er hinterließ dreizehn unmündige Kinder, mit denen Eleonora, sein Weib, fast dreißig Jahre lang ohne Heimat und oft ohne Geld umherirren mußte, verfolgt von mancher abenteuerlichen Liebe und von blutgierigem Haß.
Während der schwedische Kanzler Oxenstjerna, der nach dem Tode des Königs an die Spitze der Geschäfte trat, mit Sachsen und Brandenburg unterhandelte, während Herzog Bernhard Franken zurückeroberte und sich am Oberrhein festsetzte und der Feldmarschall Horn die in Deutschland zerstreuten kaiserlichen Truppen aus dem Felde schlug, blieb Wallenstein ruhig in seinem Winterquartier und vermehrte sein Heer. Erst Mitte Mai brach er auf, zog nach Schlesien, gewann es dem Kaiser wieder, schloß aber bald einen Waffenstillstand mit dem sächsischen General Armin, der in Schlesien kommandierte. Derselbe auffällige Waffenstillstand wurde einige Wochen später erneuert. Es war der Plan Wallensteins wie auch der beiden Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, eine dritte Macht im Reich herzustellen, eine Mittelmacht zwischen dem Kaiser und den Schweden. Es lief damals das Gerücht, daß alle Ausgewanderten ihre Güter zurückerhalten, die Jesuiten aus dem Reich verjagt werden und den Schweden ihre Kriegskosten ersetzt werden sollten; auch hieß es, daß Wallenstein in dem geheimen Vertrag mit Kursachsen für sich selbst die Krone von Böhmen ausbedungen habe. Gewiß ist, daß Wallenstein gleichzeitig mit Frankreich unterhandelte und zwar über die Krone Böhmen. Der Kardinal Richelieu, der in den deutschen Angelegenheiten festen Fuß gefaßt hatte, ließ ihm seinen Beistand, eine Million Livre jährlich und die Krone anbieten, wenn er vom Kaiser abfallen wolle. Aber der Botschafter Feuquières brach die Unterhandlungen ab, weil er der Ansicht war, Wallenstein wolle ihn nur hinters Licht führen und die Feinde des Kaisers gegeneinander hetzen. Auch mit den Schweden und mit dem Herzog Bernhard trat er ins Einvernehmen. Das Mißtrauen am Wiener Hof wurde zur Spannung, als er sich weigerte, dem Herzog von Bayern gegen Bernhard von Weimar zu Hilfe zu ziehen. Er führte das Heer aus Schlesien in die Winterquartiere und schickte von Pilsen aus ein Schreiben nach Wien, worin er seine Obristen ihr Gutachten abgeben ließ, daß ein Kriegszug in dieser Jahreszeit untunlich sei.
Seit Gustav Adolfs Tode war dem Kaiser der mit Wallenstein abgeschlossene Vertrag immer lästiger geworden. Er klagte laut, daß er gleichsam einen Mitkönig habe und keine freien Dispositionen mehr in seinem eigenen Lande. Das Wiener Kabinett brach den Verkehr mit Wallenstein ab, weil die Notwendigkeit drängte, dem Herzog Bernhard in Süddeutschland entgegenzutreten. Da Wallenstein sich weigerte, dies zu tun, wurde der Herzog von Feria aus Italien gerufen, und Johann Altringer, einer von den Generalen Wallensteins, erhielt den Befehl, sich mit dem Herzog zu vereinigen. Altringer schwankte erst, aber nach dem Tode Ferias ließ er sich vom Wiener Hof gewinnen. Voll Zorn zitierte ihn Wallenstein vor sich, Altringer verweigerte den Gehorsam. Nun beschloß Wallenstein, um nicht zum zweitenmal abgesetzt zu werden, den Oberbefehl freiwillig niederzulegen, wollte sich jedoch sicherstellen, daß die Zusagen erfüllt würden, die man ihm gemacht hatte. Deshalb versammelte er alle in Böhmen, Mähren und Schlesien stehenden Generale und Obristen in seinem Feldlager zu Pilsen. Dort gab ihnen der Feldmarschall Illo ein Bankett, bei dem die Herren schließlich so betrunken waren, daß sie Stühle und Bänke, Ofen und Fenster zerschlugen. Illo und Graf Terzka, die sich mit Wallenstein verabredet, stellten ihnen beweglich vor, daß der Oberfeldherr wegen der vom Wiener Hofe erfahrenen Unbill genötigt sei, das Kommando niederzulegen. Diese unerwartete Nachricht bestürzte die Offiziere nicht wenig. Sie alle hatten auf Wallensteins Wort und in der Hoffnung, von ihm entschädigt zu werden, ihre Regimenter auf eigene Rechnung angeworben und ihr Vermögen zugesetzt; wenn Wallenstein fiel, drohte ihnen der Ruin. Zu ihrer Sicherstellung wurde ihnen jetzt ein Revers vorgelegt, und darin wurde der Kaiser, obwohl er nicht genannt war, hart angeklagt. Nach der flehentlichen Bitte an Wallenstein verpflichteten sich die Generale und Obristen, mit Gut und Blut für ihren Feldherrn einzustehen, sich auf keinerlei Weise von ihm trennen zu lassen, seinen Vorteil nach Möglichkeit zu befördern und seine Feinde zu verfolgen.
Vierzig Generale und Obristen unterzeichneten das merkwürdige Schriftstück. Es befand sich aber in ihrer Mitte auch der Verräter Piccolomini, der an der Spitze der italienischen Partei stand, und diese Partei war mit den Jesuiten im Bunde, um den Friedländer zu stürzen. Wallenstein aber hegte ein unbedingtes Vertrauen gegen Piccolomini, denn er glaubte aus den Sternen gelesen zu haben, daß er sich auf ihn verlassen dürfe. Piccolomini berichtete den Inhalt des Reverses nach Wien und klagte Wallenstein einer gefährlichen Verschwörung an. Zudem teilte der Herzog von Savoyen den Inhalt der Verhandlungen mit, die Wallenstein mit dem französischen Hofe gepflogen hatte. Man beschuldigte Wallenstein der verwegensten Pläne. Es hieß, er habe geäußert: »Ich dulde Gott nicht, viel weniger werde ich Ferdinand dulden.« Der spanische Botschafter sagte: »Wozu zaudern? Ein Dolchstoß macht der Sache ein Ende.« Ferdinand sah sich gedrängt, nicht nur die zweite Absetzung Wallensteins auszusprechen, sondern auch den Mann, der ihm die Monarchie gerettet hatte, der äußersten Rache seiner Feinde preiszugeben. Niedriger Eigennutz war der stärkste Beweggrund der mit aller Hast herbeigeführten Katastrophe, denn als die Absetzung noch tiefes Geheimnis war, stritten sich die Herren mit Erbitterung und bis zum Zweikampf über die Teilung der Beute, der Güter, der Häuser, der Gärten, ja der Wagen und Pferde Wallensteins und riefen mit schamloser Stirne sogar den Hof selbst zum Schiedsrichter bei ihren Zwistigkeiten an.
Der Hof seinerseits verfuhr gegen den gefährlichen Gegner ungemein verschlagen. Er schickte einen Erlaß an die Befehlshaber der Wallensteinschen Armee, worin die Absetzung des Generalobristfeldhauptmanns vorsichtig angedeutet war, die Offiziere ihrer Verpflichtung entbunden wurden, ihnen für den Fehltritt bei dem Pilsner Bankett mit Ausnahme zweier Rädelsführer Verzeihung zugesichert und der Fortbestand des kaiserlichen Wohlwollens gelobt wurde. Aber wochenlang nach diesem Erlaß korrespondierte der Kaiser scheinbar ganz harmlos mit Wallenstein über amtliche Geschäfte, nannte ihn nach wie vor »hochgeborner lieber Oheim und Fürst« und versicherte ihn mit der gewöhnlichen Courtoisie seiner Huld und Gnade.
Unterdessen wurden die Generale und Obristen einzeln nacheinander und im Geheimen gewonnen. Die Italiener, Spanier und Wallonen waren bald willig, die Deutschen, Böhmen, Mährer und Schlesier waren dem Friedländer treu, und man traute ihnen in Wien trotz der gewährten Amnestie nicht. Nach einem Monat erging ein zweites kaiserliches Mandat, das schon eine deutlichere Sprache führte und nicht nur an die Befehlshaber, sondern auch an alle gemeinen Soldaten gerichtet war. Es sprach davon, daß ihnen männiglich wohl bekannt sein werde, wie er, der Kaiser, seinen gewesenen Feldhauptmann von Friedland mit allerhand Guttaten, Gnaden, Freiheiten, Hoheiten und Dignitäten, als nicht bald bei einem Menschen seines Standes gleich geschehe, begabt und geziert habe; welchergestalt aber derselbe aus boshaftem Gemüt und ohne Zweifel längst gefaßtem Vorsatz eine Konspiration wider ihn und sein Haus angesponnen und durch Verkleinerung der kaiserlichen Person und eigensinnige Ausdeutung seiner Macht in der kaiserlichen Armada zugetane Obristen verführt habe. Der Kaiser erklärt, er habe gewisse Nachrichten erlangt, daß Wallenstein ihn und sein Haus gänzlich auszurotten sich vernehmen lassen und sich äußersten Fleißes bemühet habe, solche meineidige Treulosigkeit und barbarische Tyrannei zu vollziehen, dergleichen nicht gehört, noch in scriptis zu finden sei.
Wallenstein erfuhr erst, woran er war, als Gallas, Altringer, Maradas, Piccolomini und Colloredo Ordonnanzen erließen, welche den Obristen untersagten, künftig noch Befehle von Wallenstein, Illo oder Terzka anzunehmen. Die Obristen erhielten die Weisung, gegen Prag zu ziehen, um sich der Hauptstadt des Landes zu versichern. Wallenstein ließ nun in Pilsen eine feierliche Erklärung ausstellen, daß der frühere Revers nicht das geringste gegen den Kaiser und die Religion bedeutet hätte. Er befahl seinen Truppen, ebenfalls nach Prag zu ziehen, schickte aber zwei Offiziere an den Kaiser mit einem Handschreiben, in welchem er sich erbot, sich nach Danzig oder Hamburg zu begeben; er wünsche nur seine ducadi, seine Herzogtümer, zu behalten.
Aber gerade jene ducadi wollte man sehr gerne in Wien, das wußte Wallenstein recht wohl. Er beschloß daher, sich in Verfassung zu setzen, auf alle Fälle, nur nicht auf den Fall, den er keineswegs voraussehen konnte, da er gegen alle Berechnung war. In seiner tiefen Not wandte er sich jetzt ernstlich an den Herzog Bernhard von Weimar und ließ ihn auffordern, nach Böhmen zu kommen. Herzog Bernhard traute nicht. Er rief aus: »Wer an Gott nicht glaubt, dem kann auch der Mensch nicht glauben.« Und doch drängte die Zeit. Wallenstein erfuhr den Abfall eines Generals nach dem andern. Altringer entschuldigte sich von Frauenberg aus mit Krankheit, Gallas kam nicht wieder, Diodati war heimlich durchgegangen, dreizehn Kuriere flogen nach Regensburg und zurück, endlich machte sich Herzog Bernhard langsam auf den Weg. Wallenstein hatte sich nach Prag begeben wollen, der Abfall der Generale hatte den Plan vereitelt; auch den Vorsatz, nach Zittau zu marschieren, mußte er aufgeben; der dritte Ort, den er wählte, um sich mit den Schweden in Verbindung zu setzen, war Eger.
Am 22. Februar 1634 morgens gegen zehn Uhr verließ er Pilsen und zog am 24. nachmittags zwischen vier und fünf Uhr in Eger ein. In seiner Begleitung befanden sich Illo und Terzka mit fünf Kompanien Kürassieren, fünf Kompanien vom altsächsischen Regiment zu Pferd, die unterwegs abfielen und nach Prag marschierten, und zweihundert Mann Fußvolk. Bevor er das erste Nachtquartier erreicht hatte, stieß Oberst Butler mit acht Kompanien Dragoner zu ihm.
Butler war ein Irländer von Geburt und Katholik. Er hatte von Pilsen aus nach seinem Quartier in Gladrup von Wallenstein den Befehl erhalten, mit seinem Regiment auf Prag zu rücken, – bei Todesstrafe. Schon diese Weisung, die Pässe zu verlassen, die aus Böhmen nach der Oberpfalz führen, hatte seinen Verdacht erregt; jetzt erhielt er die neue Weisung, Wallenstein nach Eger zu folgen, und er mußte mit seinen Dragonern der Sänfte des Feldherrn voranreiten. Er schrieb an Gallas und Piccolomini über seinen wachsenden Argwohn, daß er notgedrungen mit Wallenstein ziehe, daß er aber vielleicht aus besonderer Schickung Gottes zu diesem Weg gezwungen werde, um eine besondere heroische Tat zu verrichten. Auf dem letzten Marsch ließ Wallenstein Butler an seine Sänfte kommen und entschuldigte sich, daß er bisher nicht mehr für ihn getan habe; er versprach ihm zwei Regimenter und ein Geschenk von zweimalhunderttausend Talern. In Eger mußte Butler mit seinen Fahnen in der Stadt bleiben, während seinen Soldaten auf freiem Feld zu kampieren befohlen war. Wallenstein wohnte im Haus des Bürgermeisters Bachhälbel auf dem Markt, Terzka und Kinsky mit ihren Frauen im Hintertrakt desselben Hauses.
Der Kommandant von Eger war der Obristleutnant in Terzkas Regiment, Johann Gordon, ein Schotte und Kalvinist. An ihn und an den Oberstwachtmeister Walter Lesly, ebenfalls einen Schotten, wandte sich Butler. In der Nacht vom 24. auf den 25. Februar verschworen sich diese drei Männer in der Zitadelle bei gezückten Degen, Wallenstein sofort aus dem Weg zu räumen. Es ward ausgemacht, daß am folgenden Abend Gordon die Generale zu einem Faschingsschmaus auf die Burg laden solle; bei diesem Schmaus sei die Tat zu vollbringen. Alles drängte zur Eile, schon hatte Illo frohlockend die Kunde gegeben, daß am andern Tag die Schweden in Eger einrücken würden.
Am 25. Februar, es war ein Samstag, gab Graf Terzka den Offizieren ein Gastmahl. Darnach, um sechs Uhr abends, fuhr er mit Kinsky, Illo und dem Rittmeister Neumann in einer Kutsche zum Faschingsschmaus auf die Burg. Man setzte sich zur Tafel und speiste und zechte lustig. Nach dem Essen veranstalteten Gordon und Lesly, daß das Obertor der Stadt geöffnet und hundert Mann von Butlers irischen Dragonern und ebensoviele deutsche Soldaten in die Stadt gelassen wurden; mit ihnen verstärkte man die Wache auf der Burg, die nun abgesperrt wurde. Unterdessen war das Konfekt aufgetragen worden. Da erhielt Gordon ein fingiertes Schreiben, das angeblich von Kursachsen verfaßt und nun aufgefangen war. Es stand darin, daß der Kurfürst die Absicht Wallensteins, vom Kaiser abzufallen, nicht billige, und daß er gesonnen sei, Wallenstein dem Kaiser auszuliefern, wenn er ihn in seine Gewalt bekomme. Gordon reichte den Brief Illo hinüber; dieser las ihn und schüttelte den Kopf. Auch die andern lasen ihn, es erhob sich ein Streit; um freier reden zu können, wurde die Dienerschaft hinausgeschickt; sie wurde in ein abgelegenes Gemach zum Essen geführt und dort eingeschlossen. Nun war man mit den Schlachtopfern allein.
Kaum hatten sich die Diener entfernt, so traten aus den beiden Nebenzimmern des Speisesaals der italienische Obristwachtmeister Geraldino und die irischen Hauptleute Deveroux und Macdonald mit sechsunddreißig Dragonern. Deveroux rief laut: »Viva la casa d’Austria!« Und Deveroux: »Wer ist gut kaiserlich?« Butler, Gordon und Lesly antworteten schnell: »Vivat Ferdinandus! Vivat Ferdinandus!« Ergriffen ihre Degen und jeder einen Leuchter von der Tafel und traten auf die Seite. Die Irländer schritten auf den Tisch zu und warfen ihn über den Haufen. Kinsky wurde zuerst niedergestoßen, dann Illo nach kurzer Gegenwehr; Terzka, der glücklich seinen Degen erlangt hatte, stellte sich in eine Ecke und verteidigte sich mannhaft. Sein Wams von Elenshaut schützte ihn gegen mehrere Hiebe, so daß ihn die Dragoner für einen Gefrorenen hielten; endlich trafen ihn einige Dolchstöße im Gesicht, er fiel und wurde mit den Kolben der Musketen erschlagen. Rittmeister Neumann hatte sich verwundet ins Vorhaus geflüchtet und wurde draußen erstochen. Die Körper der Gemordeten gab man den Dragonern preis, die sie bis aufs Hemd auszogen.
Gordon ließ nun den Speisesaal schließen und blieb bei der Wache auf der Burg, Lesly begab sich auf die Hauptwache am Markt, und Butler besetzte Wallensteins Wohnung. Es war eine finstere, unfreundliche Nacht, der Wind heulte und ein feiner Regen klirrte an die Fenster. »Es ist,« heißt es in den Frankfurter Relationen, »sonderlich zu merken, daß selbige Nacht um neun Uhr ein erschreckliches Windsbrausen erstanden, welches bis gegen Mitternacht gewähret. Hat sich also gleichsam das Firmament über die grausamen Mordtaten entsetzet und einen Abscheu getragen.«
Deveroux unternahm mit zwölf Mann den Gang zum Herzog. Die Wache am Haus ließ ihn durch, weil sie glaubte, daß er eine Meldung zu machen habe. Im Vorzimmer begegnete er dem Kammerdiener Wallensteins, der seinem Herrn, welcher eben ein Bad genommen hatte und sich zu Bett begeben wollte, den Nachttrunk brachte, Bier auf goldener Schale; Deveroux ward von ihm bedeutet, keinen Lärm zu machen. Sein Astrolog Seni hatte Wallenstein eben verlassen; er soll ihn aus den Sternen gewarnt haben. Wallenstein hatte den Lärm gehört, den die Aufstellung der Soldaten auf dem Markt veranlaßt hatte; er hatte das Schreien der Gräfinnen Terzka und Kinsky im Hintergebäude gehört, denn beide hatten schon von der Ermordung ihrer Männer auf der Burg erfahren; er war ans Fenster getreten und hatte die Schildwache gefragt. Deveroux forderte vom Kammerdiener den Schlüssel zu Wallensteins Zimmer, und als der Diener sich weigerte, sprengte er die Tür mit dem lauten Ruf: »Rebell! Rebell!« und trat mit seinen Mordgesellen ein. Wallenstein stand im Nachtkleid an den Tisch gelehnt. »Du mußt sterben, Schelm!« rief ihm Deveroux zu. Wallenstein eilte ans Fenster, um Hilfe herbeizurufen, Deveroux folgte ihm mit der Partisane. Wallenstein breitete die Arme aus, und ohne einen Laut von sich zu geben empfing der große Mann den Todesstoß.
Sein Leichnam wurde in einen roten Fußteppich gewickelt und in Leslys Kutsche auf die Zitadelle gebracht. Da lag er mit den vier Leichnamen der andern Ermordeten den ganzen Sonntag über. Am Montag wurden alle nach Mies auf Illos Schloß gebracht und begraben. Bloß Neumann nicht; wegen seiner lästerlichen Reden beim letzten Bankett, daß er ehestens in der Herren von Österreich Blut seine Hände zu waschen verhoffe, wurde er unter dem Galgen eingescharrt.
Wallensteins Sarg war zu klein geraten, und damit er Platz habe, mußten ihm die Beine zerbrochen werden.
Schweigend ist er aus dem Leben geschieden; geheimnisvoll hatte er die Pläne und Entwürfe, die seine Seele nährten, in tiefster Brust eingeschlossen, und über seinem Leben und über seinem Tode liegt ein undurchsichtiger Schleier.
Die Güter der Ermordeten wurden sämtlich eingezogen; von den Besitzungen Wallensteins, die auf fünfzig Millionen Gulden geschätzt wurden, fiel das meiste dem Kaiser zu. Die abtrünnigen Generale wurden reich belohnt, die Mörder machten ihr Glück und wurden angesehene Leute, aber alle Anhänger Wallensteins wurden geächtet und vierundzwanzig Obristen und Hauptleute wurden in Pilsen hingerichtet.
Leonhard Thurneyßer, genannt zum Thurn, war ein Goldschmiedsohn aus Basel und 1530, im Jahr der Übergabe der Augsburger Konfession, geboren. Er sollte wie sein Vater Goldschmied werden, war aber nebenher bei Doktor Huber, dem er Kräuter sammeln und Arzneien zubereiten half und aus den Schriften des Paracelsus vorlesen mußte. Schon in seinem siebzehnten Lebensjahr verheiratete ihn sein Vater mit einer Witwe, die ihn mit ihrem Vormund betrog. Durch einen falschen Freund kam er in Händel mit Juden und verließ die Heimat im achtzehnten Jahr seines Alters. Er ging in die weite Welt, zuerst nach England, dann nach Frankreich, und wurde hier Soldat unter den wilden Truppen des Markgrafen Brandenburg-Kulmbach. In der Schlacht von Sievershausen, in der Moritz von Sachsen fiel, wurde Thurneyßer von Christoph von Karlowitz gefangengenommen. Er verließ nun den Kriegsdienst und verschaffte sich seinen Lebensunterhalt als Arbeiter in Bergwerken und Schmelzhütten, auch mit der Goldschmiedekunst und mit Wappen- und Steinzeichnen. Da seine Frau von ihm geschieden worden war, heiratete er im Jahre 1558 eine Goldschmiedstochter aus Konstanz und zog mit ihr nach Imst in Tirol, wo er eine Schmelz- und Schwefelhütte anlegte und Bergbau auf eigene Rechnung trieb. Zwei Jahre später nahm ihn der Erzherzog Ferdinand von Tirol, der Gemahl der schönen Philippine Welser, in Dienst und schickte ihn auf Reisen; er ging nach Schottland und den orkadischen Inseln, nach Spanien, Portugal und in die Berberei, nach Äthiopien, Ägypten, Syrien, Arabien und Palästina, wurde auf dem Berg Sinai, im Katharinenkloster vom Orden des heiligen Basilius, Ritter der heiligen Katharina und kehrte über Kandia, Griechenland und Italien nach Tirol zurück.
Durch seine Kenntnisse als Chemiker und Metallurg, als Botaniker und besonders als Arzt, wurde er der berühmteste Wundermann seiner Zeit. Er fing jetzt an, seine Schriften herauszugeben, zuerst das in deutschen Reimen abgefaßte Buch »Archidoxa«, darin der »wahre Lauf, Wirkung und Einfluß der Planeten auf den menschlichen Körper, auf alle Gewerbe und Hantierungen der Menschen und die verborgenen Mysterien der Alchimie« enthalten waren. Als Wunderdoktor lernte ihn der Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg im Jahre 1571 während der Huldigungsfeier zu Frankfurt an der Oder kennen. Thurneyßer besorgte hier die Publikation einer andern Schrift, die den Titel hatte: »Pison, von kalten, warmen, mineralischen und metallischen Wässern samt Vergleichung der Pflanzen«, und die dem Kurfürsten von Sachsen zugeeignet war. An einer Stelle heißt es: »Große und starke Personen sind von kalter Natur, haben eine böse, unreine Komplexion, stinken und schwitzen viel, und solcher Art ist auch Herr Christoph Sparre, der kurfürstliche Oberhofmeister in Berlin.« Oder: »Diejenigen, die von Person lang, schmal, dürr und kleine runde Köpfe haben, besitzen gar keine Geschicklichkeit und führen weibische Reden wie weiland Kaiser Rudolf von Habsburg.« Er war auch Anatom, und Kaiser Ferdinand hatte ihm im Jahre 1559 erlaubt, eine Frau zu sezieren, der zur Strafe die Adern geöffnet waren, daß sie sich totbluten solle.
 |
| Leonhard Thurneyßer, |
| nach einem 1583 erschienenen Holzschnitt. |
Das Vertrauen des Kurfürsten erwarb er sich gleich, denn er war ein Mann von stattlichem Ansehen; die den Schweizern eigene Manier von Ehrlichkeit, seine Welt- und Menschenkenntnis und sein lebhaftes Temperament nahmen für ihn ein. Er verstand es, die Schwächen großer Herren und ihre Neigungen auszuforschen und sich gegen diejenigen klug zu betragen, an deren Gunst ihm gelegen war. Die Kurfürstin war krank, Thurneyßer übernahm die Behandlung, und der Erfolg bewirkte, daß von Stund an sein Glück bei den brandenburgischen Herrschaften gemacht war. Sie nahmen ihn mit nach Berlin, der Kurfürst ließ auf seine Kosten Thurneyßers Frau und Kinder, die er seit drei Jahren nicht gesehen hatte, aus Konstanz nach seiner Hauptstadt bringen.
Thurneyßer hatte dem Kurfürsten Blätter aus dem »Pison« gezeigt, welche die Flüsse in der Mark und deren unerkannte Reichtümer betrafen. So hieß es unter anderm darin: »Das Wasser der Spree ist grünfarbig und lauter. Es führet in seinem Schlich Gold und eine schöne Glasur. Das Gold hält 23 Karat ½ Gramm.« Daß die Spree Gold führe, war bisher unerhört, blieb auch unerhört. Ebenso beschrieb Thurneyßer Orte in der Mark, wo man Rubine, Smaragde und Saphire finden könne. Bisher hatte man sie nicht gesucht und nicht gefunden, fand sie auch niemalen. Aber die glänzenden Verheißungen lockten bei Hof nicht wenig, den Mann festzuhalten, der so viele Hoffnungen erweckte. Alle Hofleute waren von ihm entzückt, und sogar das kurfürstliche Hoffrauenzimmer breitete seinen Ruhm im ganzen Lande aus. Er erhielt Briefe von einigen Fräulein und verheirateten Damen, die auf dem Lande lebten, worin sie ihn um Schminke baten, oder um Schönheitsöl, oder um Waschwasser, nebst Beschreibung des Gebrauchs. Sie schließen gemeiniglich mit dem Ersuchen, es niemand wissen zu lassen, noch andern davon zu geben.
Thurneyßer war ein Mann, der sich wohl darauf verstand, die gute Meinung zu nutzen, die man von ihm gefaßt hatte, um sich bedeutende Reichtümer zu erwerben. Er wußte sich in seinen Glücksumständen bis an das Ende seines Lebens zu erhalten, – wo er dann freilich um Geld und Ehre kam. Er hatte ein vortreffliches Gedächtnis und eine nicht zu ermüdende Wißbegierde. Nach dem Vorbild des Paracelsus hatte er die Natur unmittelbar aus ihren Werken studiert, und da er mit Aufmerksamkeit eine Menge von Gegenständen in nahen und weitentlegenen Ländern betrachtet hatte, war er auch zu einer tiefen Erkenntnis der Natur gelangt. Nicht so sehr wie Paracelsus war er gegen das Bücherlesen eingenommen; er hatte mehrere medizinische und historische Werke studiert. Mit dem Griechischen war er auf seinen Reisen bekannt geworden, auch mit einigen orientalischen Sprachen, so daß er später eine Schriftgießerei in ausländischen Lettern anlegen und sogar ein Onomastikon herausgeben konnte. Lateinisch lernte er noch in seinem sechsundvierzigsten Jahr bei dem berlinischen Propst Jakob Colerus. Er verstand sich auf die Kunst des Zeichnens und konnte die für seine anatomischen Handleitungen und sein Kräuterbuch beschäftigten Formschneider wohl anweisen. Er hatte eine Karte der Mark Brandenburg aufgenommen, wie man sie damals noch nicht besaß. Seine Kenntnisse in der Mathematik, Astronomie und Astrologie waren nicht unbedeutend, so daß er nicht nur die weit und breit berühmten Kalender veröffentlichte und sich mit dem Stellen der Nativität abgeben konnte, sondern er vermochte auch für die Jahre 1580 bis 1590 die ephemeriden und astronomischen Tabellen zu berechnen.
Der Kurfürst bestellte ihn zu seinem Leibmedikus, und sein stehendes Gehalt betrug 1352 Taler, eine für jene Zeit ansehnliche Summe. Daneben hatte er auf vier Pferde Futter, die Hofkleidung, die Hofdeputate und bei Reisen Vorspann. Kurfürst und Hof gaben ihm vielerlei Bestellungen von Einkäufen, die er zu Leipzig, zu Nürnberg und zu Venedig durch seine Schreiber und Bekanntschaften besorgen mußte. Der Kurfürst war ein Liebhaber von Silbergerät; die Goldschmiede hatten so viel für den Hof zu tun, daß Joachim Friedrich viel Silberzeug in Leipzig anfertigen ließ, und Thurneyßer hatte davon die Kommissionen. Besonders setzte die Kurprinzessin Katharina von Küstrin ein außerordentliches Vertrauen in Thurneyßer. Ihr Gemahl war Administrator von Magdeburg, sie selbst residierte in Halle. Sie ließ ein Laboratorium bauen und ersuchte Thurneyßer, zu ihr zu kommen. Der Kurfürst gab nur ungern seine Einwilligung, weil er Thurneyßer stets um sich haben wollte. Katharina brauchte den gewandten Schweizer in allen ihren Geschäften; wenn sie Geld nötig hatte, mußte er auf der Leipziger Messe in seinem Namen zwei, drei und mehrere tausend Taler für sie aufnehmen. Sie ließ durch ihn Kleinodien und Silberzeug kaufen und verkaufen und schickte ihm Leute zu, die er zu Laboranten und Provisoren bilden, in der Imitation von Rubinen und Smaragden und im Wappen- und Steinschneiden unterrichten sollte.
Bald nach seiner Ankunft in Berlin hatte ihm der Kurfürst eine geräumige Wohnung in dem ehemaligen Franziskanerkloster, dem grauen Kloster, gegeben, damit er Platz zu einer weitläufigen Haushaltung haben möge. Er richtete sich dort in großem Stile ein. Im Laboratorium wurden nach seinem silbernen Buch die Arkana präpariert, die geheimen Arzneien, die ihn zum reichen Mann machten: Goldpulver, Goldtropfen, Amethystenwasser, Saphir-, Rubinen-, Smaragden-, Perlen- und Korallentinktur, auch Bernsteinöl. Er hatte Mittel »wider die Vergicht, wider ein Rotgesicht, dasselbe zu erläutern und zu dealbieren.« Ein Lot spiritus vini kostete vier Taler, ein Lot Spiritus vini correcti sogar sechs Taler, ein Lot Rhabarberextrakt zwei Taler. Der Gräfin Lynar schickte er einmal einige Öle zum äußerlichen Gebrauch, die fünfunddreißig Taler kosteten, und schrieb ihr dazu: »Ihre Gnaden würde zum besonderen Vergnügen gereichen, diese kleinen Unkosten zu tragen, damit Sie nichts einnehmen dürften.« Er meinte, weil sie ja die Mittel nicht schlucken müsse.
Er hielt im grauen Kloster eine Art von kleiner Hofstatt, seine Haushaltung bestand aus mehr als zweihundert Personen, aus Dienern, Schreibern, Laboranten, Boten zum Verschicken und den Arbeitern in der weitläufigen Druckerei, die mit deutschen, lateinischen, griechischen, hebräischen, chaldäischen, syrischen, türkischen, persischen, arabischen, sogar mit abessinischen Typen versehen war, in der seine Schriften fortan gedruckt wurden, auch die Schriften von andern Gelehrten, zum Teil aus fernen Städten, jede mit der Aufschrift: gedruckt zu Berlin im grauen Kloster. Die Arbeiter und Bedienten waren fast alle verheiratet und wohnten mit Frauen und Kindern bei Thurneyßer. Der Aufwand zu ihrem Unterhalt war so groß, daß er monatlich einen Ochsen schlachten ließ. Er selbst ging stattlich, in schwarzsamtenen und seidenen Kleidern, was ein besonderes Zeichen der Pracht war, auch täglich mit seidenen Strümpfen. Noch kurz ehe Thurneyßer nach Berlin kam, hatte der Markgraf Johann zu Küstrin seinem geheimen Rat Barthold von Mandelsloh, der die seidenen Strümpfe aus Italien mitgebracht hatte und einst an einem Wochentag mit ihnen bei Hof erschien, zugerufen: »Barthold! Ich habe auch seidene Strümpfe, aber ich trage sie nur des Sonn- und Festtags.« Thurneyßer prangte nicht nur in seidenen Strümpfen und Kleidern, sondern er trug um den Hals auch goldene Gnadenketten mit daran hängenden Kur- und Fürstenbildnissen, goldnen Gnadenpfennigen und Kontrefaitmünzen. Wenn er ausging, begleiteten ihn zwei Edelknaben; 1580 verrichteten diesen Dienst zwei Vettern, Christoph und Hans Christoph von Tetzel aus dem alten, reichsadeligen Patriziergeschlecht der Tetzel von Kirchsittenbach und Vohra zu Nürnberg. Ihre Eltern wohnten in Denelohe, einem im fränkischen Altmühlkreis gelegenen Reichsrittersitz; 1582 dankte der Vater dem Doktor Thurneyßer dafür, daß er seine Kinder zu sich genommen; er sei überzeugt, daß sie im ganzen Kurfürstentum nirgends besser als bei ihm zur Ordnung und Tugend erzogen werden könnten. Oft speisten große Gesellschaften von den Vornehmsten des Hofes bei ihm, und wenn auswärtige Herren ankamen, sich seines Rats zu erholen, nahm er sie im grauen Kloster bei sich auf, wie den Fürsten Radziwill. Er war das Orakel von aller Welt. König Friedrich II. von Dänemark bat ihn, die einst von Heinrich dem Löwen verschütteten Salzbrunnen zu Adeslon zu untersuchen; König Stephan Bathory von Polen, den er zuweilen mit Antidoten oder Gegengiften versah, sprach ihn um Hilfe wegen der Bergwerke an; Graf Wilhelm der Weise von Hessen forderte von ihm eine Erklärung fremder Buchstaben auf einem in der Grafschaft Katzenellenbogen aufgefundenen Gipsstein. Der König von Schweden schickte ihm einen schönen Luchspelz. Die Schreiber breiteten seine Wunderkuren aus und brachten reiches Entgelt, seltene gemalte Bücher, Handschriften, Erzstufen, Versteinerungen und Kräuter mit. Sie erzählten auch, was an auswärtigen Höfen und in anderen Ländern vorfiel, und mit diesen Nachrichten wußte Thurneyßer sich bei seinem Herrn sehr beliebt zu machen.
Von seinen Kalendern setzte er ungeheure Auflagen ab. Bei den einzelnen Monatstagen pflegte er Buchstaben und verblümte Worte als Prognostika beizufügen, und im folgenden Jahr schickte er dann die Erklärungen, wenn die Begebenheiten richtig eingetroffen waren. Im Kalender auf 1579 steht beim 17. Dezember: schändliche Tat einer fürstlichen Person. 1580 lautete die Erklärung: auf diesen Tag hat Signora Bianca Capelli ihren Stiefsohn zu Florenz mit Gift vergeben, welcher am 18. Dezember gestorben.
Als Nativitätssteller begründete er seinen Ruf mit der Versicherung, er habe dem König Sigismund August von Polen ohne Aberglauben und Teufelskünste Jahr, Monat und Tag seines Todes prophezeit; sowie in einer fürstlichen oder gräflichen Familie in Deutschland ein Kind geboren war, wurde ihm die Geburtsstunde zugeschickt; manchmal kamen mehrere Boten an einem Tag. Nun suchte er den Stand der Planeten, forschte, in welchem Zeichen des Tierkreises sie gestanden, bemerkte die Aspekten gegeneinander und bestimmte daraus die Influenzen auf den Geborenen. Er beurteilte seine künftigen Schicksale, seine natürlichen Neigungen und Fähigkeiten, ob er glücklich, reich oder arm, zu Ehren gelangen werde oder nicht, heiraten werde oder nicht, Kinder bekommen werde oder nicht, was er für Krankheiten zu erwarten und in welchem Alter er sterben würde. Das alles interessierte damals die Leute ungemein, jedermann glaubte steif und fest daran, auf den Universitäten wurden Collegia über das Nativitätstellen gelesen, und Bischöfe und hohe Geistliche gaben sich damit ab.
Die Bestimmung der Nativität hatte keinen Zweck, wenn man nicht die Talismane trug, die Thurneyßer fabrizierte. Er versah die ganze Mark und die benachbarten Länder mit Talismanen. Selbst Andreas Osiando, der berühmte Streittheolog in Königsberg, trug zum Schutz wider den Aussatz eine Kette um den Hals. Als Thurneyßer, eine goldne Kette um den Hals, 1574 nach Königsberg reiste, um den blödsinnigen Herzog zu heilen, benutzte er bei seinen Kuren die Talismane. Es waren sogenannte große Jupiter-Talismane, Sigilla solis. Sie finden sich noch in den Münzkabinetten; Jupiter erscheint auf ihnen wie ein Württemberger Professor mit Bart und Pelzrock und einem großen Buch, aus dem er doziert; auf dem Revers befindet sich ein Apucus, ein heiliger Rechenpfennig, der die Summe 34 gibt, man mag die Zahl in den sechzehn Feldern der Länge nach oder der Breite nach oder in der Diagonale addieren. Die Sigilla solis waren oft sechs Dukaten schwer. Einer ist vierzehn Dukaten schwer. Er trägt die Namen Gottes und der zehn Fürsten der Engel und die hebräischen Worte, die der berühmte Abt Trieheim aus der Bibel und den Rabbinen entlehnt und Agrippa von Nettelsheim in seinem Werk De occulta philosophia erklärt hatte. Die Sigilla solis waren dazu bestimmt, die solarischen Krankheiten abzuwenden, wozu die des Gehirns zählten. Es gab auch Talismane mit dem Zeichen der andern Planeten, und diese verhüteten die astralischen Krankheiten. Ferner gab es Talismane aus sieben verschiedenen Metallen gemischt, in einem festgesetzten Verhältnis und mit Beobachtung der Konstellation: wann sie geschmolzen waren und wann der Stempel aufgeprägt war; diese hatten eine besondere verborgene Kraft, Menschen, in unglücklicher Stunde geboren, glücklich zu machen. Andere Talismane verschafften die Gunst großer Herren, beförderten zu Ehrenstellen, ließen Heiratshändel gelingen, und wenn Mars beim ersten Eintritt in das Zeichen des Skorpions darauf geprägt war, verliehen sie dem Soldaten Mut und Sieg. Thurneyßer verkaufte Talismane zum Besten des ganzen menschlichen Geschlechtes, vom Kaiser bis zum Bauer herunter. Das sollte die mit dem Zepter kreuzweis gelegte Sense andeuten, die sich auf den Münzen befinden. Er erzeugte auch sympathetische Ringe, die von der fallenden Sucht befreiten.
Durch alle diese Geldquellen wurde Thurneyßer sehr reich. Sein Schatz bestand aus zwölftausend Goldstücken, teils einfachen und doppelten Portugalesern, teils vierfachen Kronen, Rosenobeln, Engalotten und Dukaten. Er besaß über neun Zentner an Trinkgeschirren und einen silbernen vergoldeten Hirsch, der, nach der Sitte der Zeit mit Leuchtern ausgeziert, in seinem großen Saale hing. Seine Bibliothek soll ihresgleichen weit und breit nicht gehabt haben; sein Naturalienkabinett enthielt eine Sammlung von Pflanzensamen aus allen Teilen der Welt. Er hatte Präparate von getrockneten Teilen des menschlichen Körpers und von seltenen Tieren. Er hatte Skorpione in Baumöl, die der gemeine Mann für entsetzliche Zauberteufel ansah. Sein Garten beim Grauen Kloster war voll botanischer Kuriositäten, und ein Elentier, das ihm der Fürst Radziwill geschenkt hatte, schickte er nach seiner Vaterstadt Basel, um sich bei seinen Landsleuten in Respekt zu setzen. Die frommen Baseler hielten es aber auch für einen Zauberteufel, und ein altes Weib gab ihm einen Apfel mit zerbrochenen Nähnadeln zu fressen.
Thurneyßer zog eine Menge kunstverständige Ausländer nach Berlin und brachte auf jede Weise viel Geld in Umlauf. Eine Menge Schriftgießer, Stempelschneider, Kupferstecher, Illuminierer, Buchbinder, Kaufleute und Goldschmiede hatten beständig für ihn zu tun. Er war der erste, der die chemischen Arzneien einführte, deren kleine aber wirksame Dosen den verschleimten Ruppiner- und Bernauerbiermagen des brandenburgischen Adels annehmlicher dünkten, als die bisherigen kopiosen galenischen Arzneitränke. Er half den Alaun- und Salpetersiedereien auf, sowie den Glashütten. Aus der Grimnitzer Glashütte in der Uckermark hatte er einen gläsernen Vogelbauer, in dessen inwendigem Raum ein Vogel saß, während außen Fische schwammen. Dieser Vogel war dem gemeinen Mann gleichfalls ein Zaubervogel, da er scheinbar mitten im Wasser mit schwimmenden Fischen lustig herumsprang, als ob er in freier Luft lebte.
Vierzehn Jahre lang erhielt sich Thurneyßer in der unverminderten Gnade des Hofes. Der Kurfürst gab ihm das Zeugnis, »daß er sich nach seinen ihm von Gott verliehenen Gaben gegen ihn und dem Hause Brandenburg, auch vielen anderen hohen und niederen Standespersonen getreu, aufrichtig, nützlich und wohl erzeiget habe«. Im Jahre 1575 war Thurneyßers Frau gestorben, das Schweizerheimweh kam über ihn, der Kurfürst wollte ihn nicht ziehen lassen, nun reiste er wenigstens zu Besuch nach Basel und heiratete dort 1580 seine dritte Frau, eine Geschlechtertochter aus Basel, eine Herbrot. Sie war liederlich, er verstieß sie, und sie brachte ihn um Ehre und Vermögen. Es entspann sich ein skandalöser Prozeß, worin beide Teile Schriften gegeneinander veröffentlichten, und seine sämtlichen Habseligkeiten, die er nach Basel geschickt hatte, wurden mit Beschlag belegt und der Frau zugesprochen. Darauf entstand in der Mark eine große Hetze gegen ihn, er wurde als Zauberer, Atheist und Wucherer gebrandmarkt, ein Professor in Greifswalde predigte öffentlich gegen ihn, warnte die Gemeinden und erachtete ihn des Kirchenbanns für würdig. Er verließ Berlin, wurde katholisch, ging nach Rom und begab sich unter den Schutz des Papstes. Beim Kardinal Ferdinand von Medici, bei dem er speiste, verwandelte er einen eisernen Nagel in Gold. Nach der Tafel stellte der Kardinal darüber ein Zeugnis aus, das man lange Zeit nebst dem Nagel als große Merkwürdigkeit den Fremden in Florenz zeigte. Es fand sich aber später, daß das Wunder durch einen Betrug zustande gekommen war.
Thurneyßer lebte ein paar Monate dann in Belvedere, wanderte dann wieder nach Deutschland und starb endlich in ärmlichen Umständen in einem Kloster bei Köln, fünfundsechzig Jahre alt, genau an dem Tage, auf den er sich selbst das Horoskop gestellt hatte.
Der Kurfürst Friedrich von Brandenburg und spätere erste König von Preußen überließ sich am Anfang seiner Regierung völlig der Leitung Danckelmanns, seines ehemaligen Hofmeisters. Eberhard Danckelmann war 1643 geboren; er war ein Fremder, ein Westfale aus der damals noch nassau-oranischen Stadt Lingen, wo sein Vater, der berühmte gelehrte Sylvester, Landrichter war. Die Familie war bürgerlich, hatte aber die Tradition, daß einer ihrer Vorfahren einem deutschen Kaiser durch treue Wachsamkeit das Leben gerettet und dieser ihm mit den Worten: »Danke, Mann«, den Ritterschlag erteilt habe. Das Wappen, das dieser Tradition Wahrscheinlichkeit geben sollte, war ein Kranich.
Der junge Danckelmann war eine Art Wunderkind gewesen; er hatte in Utrecht studiert, hatte hier schon in seinem zwölften Jahr eine Disputation gehalten und dann die europäische Turnee durch England, Frankreich und Italien gemacht. Er war zwanzig Jahr alt, als ihn der Große Kurfürst auf einer Reise nach Holland kennen lernte und zum Lehrer des damals fünfjährigen Prinzen Friedrich Wilhelm annahm. Zwei Jahre später, 1665, wurde er Titularrat, 1669 Halberstädtischer, 1676 kurmärkischer Regierungsrat, und noch unter dem Großen Kurfürsten Kammer- und Lehnsrat. Zweimal vor Friedrichs Regierungsantritt rettete er dem Prinzen das Leben, 1680 bei dem angeblichen Vergiftungsversuch durch die Stiefmutter, und sieben Jahre darauf bei einem Stickfluß, wo er ihm gegen den Rat der Ärzte eine Ader schlagen ließ und ihn so wieder zum Bewußtsein brachte. Kurz nach seiner Thronbesteigung ernannte ihn Kurfürst Friedrich zum Regierungspräsidenten in Cleve, und am 2. Juli 1695, bei der Zusammenkunft der sieben Brüder Danckelmann, die alle hohe Ämter im Brandenburgischen bekleideten, bei offener Tafel zum Premierminister mit dem ersten Rang am Hofe. Friedrich setzte die Bestallung eigenhändig auf. Es heißt darin, daß Danckelmann ein vollständiges Exempel ungefärbter Treue, unablässiger Applikation in der Beförderung der Gloire des Kurfürsten und aller andern, dem Diener eines großen Herrn wohlanständigen Tugenden und Qualitäten sei. In demselben Jahre ließ ihn der Kurfürst mit seinen sechs Brüdern von Kaiser Leopold in den Reichsfreiherrenstand erheben, und der Kaiser gab ihnen zu dem bisher im Wappen geführten Kranich sieben mit einem Ring zusammengehaltene Zepter, »damit deren Posterität aus denen sieben Zeptern die Urheber dieser unserer ihnen erteilten Gnad und Würde als sieben Brüder, welche gleichsamb an einem Ring beisammen halten umbsomehr abnehmen und vermerken können«. So das Diplom; und es besagte auch, daß Eberhard Danckelmann den ihm angetragenen Grafenstand abgebeten habe, um mit seinen Brüdern im gleichen Stand zu bleiben. Der Kurfürst verlieh ihm noch die Erbpostmeisterwürde, die Hauptmannschaft zu Neufeld an der Dosse und ansehnliche Lehne und Güter.
Er leitete die Finanzen und alle Hauptgeschäfte. Man nannte ihn den Colbert der brandenburgischen Staaten. Er vermehrte die Jahreseinkünfte aus den Domänen um hundertfünfzigtausend Taler. Er regierte mit seinen sechs Brüdern, von denen er der mittelste war. Man nannte diese Regierung der sieben Brüder Danckelmann, die als rechtschaffene Männer im Volk beliebt waren, die Herrschaft der Plejaden oder des Siebengestirns. Der älteste Bruder war Resident im westfälischen Kreis. Der zweite außerordentlicher Gesandter beim König von England, der dritte Kammergerichts- und Konsistorialpräsident, der vierte Generalkriegskommissär, der fünfte Kanzler zu Halle und außerordentlicher Gesandter am kaiserlichen Hof und der sechste Kanzler zu Minden.
Danckelmann war ein tüchtiger und verdienstvoller, ein sehr selbstbewußter und gegen den alten Adel sehr stolzer Mann. Er war von tiefmelancholischem Temperament; man hat ihn niemals lachen gesehen. Sein Unglück schwebte dunkel vor seiner Seele, als er noch im höchsten Glücke war. Eines Tages gab er dem Hof zur Einweihung seines neuen Hauses ein Fest. Die Gesellschaft tanzte im großen Saal, Danckelmann befand sich mit dem Kurfürsten in seinem Arbeitskabinett. Mit dem Wohlgefallen eines Kenners betrachtete Friedrich einige Gemälde, die dort an den Wänden hingen. »Das sind schöne Bilder,« meinte der Kurfürst. »Ach,« erwiderte Danckelmann mit bitterem Lächeln, »die Bilder und was ich sonst noch Kostbares besitze, wird ja doch einst, bald vielleicht, das Eigentum von Eurer kurfürstlichen Gnaden sein, wenn meinen Feinden gelingt, wonach sie so eifrig trachten, mir die Liebe meines Herrn zu entfremden.« Da legte der Kurfürst die Hand auf die Bibel und antwortete, der Fall könne sich nie ereignen.
Der Fall ereignete sich aber doch, und zwar nicht ohne Danckelmanns Verschulden. Das Zeremoniell war in jenen Tagen, wo sich alles um die Hofherrlichkeit drehte, die Schlange, die die gescheitesten Köpfe verführte. Danckelmann bezeigte sich gegen seine altadeligen Kollegen hochfahrend, rauh und unfügsam. Er mochte freilich zu tun haben, sich in Positur gegen sie zu setzen. Er verlangte von sämtlichen Ministern der auswärtigen Höfe den ersten Besuch; selbst den regierenden Reichsgrafen wollte er nicht weichen. In die Kirche zu Königsberg, wo der ganze Hof versammelt war, kam er einst zu spät, die Predigt hatte schon begonnen. Sein Nachfolger, der spätere Premier Wartenberg und der Feldmarschall Barfuß sprachen miteinander; Danckelmann fuhr zwischen sie mit den Worten: »Meine Herren, warum heben Sie mir kein Platz auf?« Wartenberg erhob sich und sagte: »Hier ist Platz.« Kalt entgegnete Danckelmann: »Es ist Ihre Schuldigkeit, mir Platz zu machen.«
 |
| Eberhard Danckelmann, |
| nach einem Stich von G. P. Busch. |
Dergleichen gab böses Blut. Im Gefühl seiner Vorzüge nahm Danckelmann auch gegen den Kurfürsten einen feierlichen Ton an, der dem hohen Herrn natürlich zu hoch vorkommen mußte. Er verdarb es auch mit den Damen und brachte die ganze kurfürstliche Familie gegen sich auf. Sein Sturz erfolgte auf echt orientalische Weise. Im Vorgefühl seines Schicksals hatte er seinen Abschied erbeten. Der Kurfürst, der fünfunddreißig Jahre lang um ihn gewesen war, bewilligte den Abschied. Danckelmann blieb in Berlin; noch am Abend des 10. Dezember 1697 erschien er bei Hof, und der Kurfürst unterhielt sich mit ihm aufs freundlichste. In der Nacht darauf erschien der Gardeoberst von Tettau in Danckelmanns Haus in der alten Friedrichstraße, dem sogenannten Fürstenhaus. Er wurde arretiert, seine Effekten wurden versiegelt, und man brachte ihn nach Spandau, später nach Peitz. Erst zehn Jahre darauf wurde er nebst vielen andern Staatsgefangenen pardonniert; da er Preußen nicht verlassen durfte, begab er sich nach Kottbus, wo er eine halbe Freiheit genoß und zweitausend Taler Pension. Seine sämtlichen Güter wurden ohne Prozeß konfisziert; das Fürstenhaus, Marzahne, Zimmerbude, Groß- und Klein-Quittainen in Preußen, Biesenbruch in der Uckermark, Umelingen und Schönebeck in der Altmark und die Kohlenbergwerke bei Wettin. Die Familie hat die Güter niemals zurück erhalten. Während der ganzen Zeit seiner Gefangenschaft war nur seine Frau um ihn, die sich ausgebeten hatte, seine Haft teilen zu dürfen. Erst nach Friedrichs Tode erhielt der siebzigjährige Greis eine Ehrenerklärung: König Friedrich Wilhelm ging öffentlich mit ihm zur Kirche.
Rudolf, der älteste Sohn des zweiten Maximilian, war zu Wien geboren und wurde in Spanien erzogen. Seine Mutter war Maria, die Lieblingstochter Karls V., eine echte Spanierin, streng katholisch, sehr tugendhaft und sehr düster. Der Aufenthalt am Hofe des unheimlich kalten, ausschweifenden und grausamen Philipp und die furchtbaren Ereignisse unter dessen Regierung hinterließen nicht zu verwischende Spuren in Rudolfs Seele. Ehemals war er sanft, schüchtern und gerechtigkeitsliebend gewesen; als er im Alter von neunzehn Jahren nach Deutschland zurückkam, um die römische Königskrone aufs Haupt zu setzen, war er wild, finster und zu heftigen Zornanfällen geneigt. Mit vierundzwanzig Jahren wurde er Kaiser. Er schlug seine Hofstatt zu Prag auf.
Es war eine Drohung über ihm von den Ahnen her. Aber er hatte nicht die rührende Melancholie Johannas von Kastilien, auch nicht die durch die Eitelkeit aller irdischen Dinge niedergebeugte stille Größe Karls V., in ihm war eine Art von Versteinerung. Mit der Ungeduld eines bösen Kindes sprach er seinen Widerwillen gegen alle Regierungsgeschäfte aus, und dieser Widerwille endigte erst, wenn er merkte, daß ein anderer sich ihrer mit Liebe und tätigem Fleiß annahm; dann erwachte in ihm der Neid und eine verzehrende Eifersucht.
Er kam niemals ins Reich; er besuchte nie einen Reichstag seit jenem Regensburger, wozu ihn die Türkennot gedrängt hatte. Er kam auch niemals nach Wien. Er saß fest auf dem Hradschin; dort hatte er seine Zauber- und Wunderwerkstatt aufgeschlagen. Wenn die deutschen Fürsten ihm ihre Gesandten schickten, ließ er ihnen sagen: er sei eben mit andern Angelegenheiten trefflich molestieret. Ebenso warteten die Boten Ungarns und Österreichs jahrelang in Prag vergeblich und immer wieder vergeblich auf eine Audienz. Die Statthalter und Generale wurden ohne Verhaltungsbefehle gelassen; sie mochten sich helfen, wie sie konnten. Die Geheimkünste füllten seine ganze Welt aus.
Er hatte große Schätze, verbarg sie aber sorgfältig in seinen Truhen. Es kümmerte ihn nicht, wenn den Räten und Hofleuten kein Gehalt ausbezahlt wurde, wenn sogar in der kaiserlichen Hofhaltung sich Mangel einstellte. Der bayrische Resident schrieb einmal an seinen Herrn: »Heute hat das vornehmste Hofgesinde nichts zu essen gehabt, es war kein Geld vorhanden, um für die Küche einzukaufen.« Von alledem unberührt, überließ sich Rudolf seiner Leidenschaft für das Mysteriöse und seiner Sammelwut.
Er sammelte Naturalien, seltene Steine, ausländische Pflanzen und Tiere. Löwen, Leoparden und Adler verstand er so zahm zu machen, daß sie mit ihm im Zimmer herumgingen. Die Welser in Augsburg, die für die zwölf Tonnen Goldes, welche sie dem Kaiser Karl vorgestreckt, einen Küstenlandstrich in Südamerika erhalten hatten, ließen von dort her peruanische Kuriositäten für ihn kommen. Er sammelte römische und griechische Altertümer, die seine Agenten aufkaufen mußten, Münzen, Gemmen, Kameen und Statuen. So erwarb er zwei der größten Schätze der Antike, den Sarkophag mit der Amazonenschlacht und die Onyxtasse mit der Apotheose des Augustus, für die er fünfzehntausend Dukaten bezahlte. Seine Schatzkammer war weit und breit berühmt; sie blieb fast zweihundert Jahre lang im Stande, erst in der Zeit der josefinischen Aufklärung ging vieles verloren; die Statuen wurden für ein Spottgeld veräußert, ein herrlicher Torso wurde durch das Fenster in den Schloßgraben geworfen, die seltenen Münzen wurden nach dem Gewicht verkauft, und die Tizianische Leda figurierte in einem Inventar unter dem Titel: ein nacktes Weibsbild von einer bösen Gans gebissen.
Ein besonderes Wohlgefallen fand Rudolf an der Stempelschneidekunst. Die Siegel an seinen Diplomen, goldnen Bullen, Lehn- und Gnadenbriefen sind so fein und zierlich in vollendetstem gotischen Stil ausgeprägt, daß die Annahme berechtigt erscheint, er habe die größten Meister dieser Kunst in seinen Dienst gezogen.
Von seinen Hofleuten wurde Rudolf II. Salomon genannt. Er beherrschte sechs Sprachen, war bewandert in der Mechanik, Physik und Mathematik und besonders in der Astrologie, Magie und Alchimie. Er verkehrte schriftlich mit allen gelehrten Männern im heiligen römischen Reich, und manchen unscheinbaren Doktor erhob er in den Adelsstand, auch wenn es ein Lutheraner war. Aber hauptsächlich waren die sonderbaren Leute seine Leute. Es lebten an seinem Hof eine Menge Uhrmacher und Maler, eine Menge Astronomen, die ihm Horoskope stellen und Kalender machen mußten; er verkehrte mit Adepten aller Art, worunter sich viele Scharlatane, Glücksritter, Quacksalber und Marktschreier befanden; er verkehrte mit Magiern, Spiegeldeutern, Lebensverlängerern und Menschenmachern; sie mußten dem Kaiser aus kochendem Wasser weissagen, ihm ihre Phantasmagorien zeigen und allen Ernstes versuchen, Mumien zu beleben und in der Retorte Menschen zu erzeugen.
Der größte Magus an Rudolfs Hof war der Engländer John Dee. Er schloß dem Kaiser das Geisterreich auf. Er rühmte sich, zu jeder Zeit seinen Genius vor sich zu sehen, und wenn er seine Studien unterbreche, setze sich der Genius an seine Stelle hin und studiere weiter; wenn er dann zurückkehre, brauche er ihn nur auf die Achsel zu klopfen, so stünde der Genius auf und entferne sich wieder. Rudolf hielt Dee für einen gewaltigen Zauberer, Dee hielt den Kaiser ebenfalls für einen gewaltigen Zauberer, und so hatten beide große Furcht und großen Respekt voreinander. Ein anderer Wundermann war der Italiener Marco Bragadino. Eigentlich hieß er Mamugna und war ein Grieche. Zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts war er als Graf Mamugnano nach Italien gegangen, trat in den Kreisen der venezianischen Nobili mit größter Pracht auf und machte in den Palästen der Dandolo und der Contarini zum Erstaunen aller Gold. In Prag erschien er stets begleitet von zwei riesigen schwarzen Bullenbeißern, die er zur Beglaubigung seiner Macht über die Geister mit sich führte. Er behandelte das Gold wie Messing, verschenkte große Stücke und hielt stets auf eine reiche Tafel. Als er sich später nach Münster wandte, verlor er sein Leben am Galgen. Noch größeres Aufsehen als dieser Bragadino machte ein gewisser Hieronymo Scotto. Er war es, der dem Kölner Kurfürsten Gebhardt Truchseß durch die Bilder in einem Zauberspiegel die schöne Gräfin Agnes Mannsfeld verkuppelte, worüber der geistliche Herr Land und Leute einbüßte. In Koburg verführte der einschmeichelnde Glücksritter die Gattin des Herzogs, und die unglückliche Prinzessin schmachtete dafür zwanzig Jahre lang im Gefängnis.
Alle fahrenden Alchimisten waren Rudolf willkommen, er hatte täglich Zuspruch von ihnen und beschenkte sie reichlich, wenn sie interessante Versuche machen konnten. Man nannte ihn den deutschen Hermes trismegistos, und daß er wirklich ein Adept gewesen, schien nach seinem Tode klar, denn man fand unter seinem Nachlaß eine graue Tinktur, man fand vierundachtzig Zentner Gold und sechzig Zentner Silber, die in Ziegelsteinform gegossen waren.
Es lebten aber auch drei große Männer an Rudolfs Hof: Tycho de Brahe, Loncomontanos und der unsterbliche Kepler, der von Prag aus sein fundamentales Werk »nova astronomia de stella martis« in die Welt sandte. Er hielt sich zwölf Jahr lang an Rudolfs Hof auf und war seit dem Tode Brahes, der an der Tafel des letzten Rosenbergs in Krumau aus Etikettenangst starb, als römisch-kaiserlicher Majestät Mathematikus angestellt. Ein Jahrgehalt von fünfzehnhundert Gulden war ihm zugesichert; aber er erhielt es selten richtig ausbezahlt.
Vielleicht war die Zurückgezogenheit, in welcher der Kaiser auf seinem Zauberschloß lebte, schuld daran, daß sich starke Parteiungen an seinem Hof bildeten. Den mächtigsten Einfluß hatten die Italiener. Davon liefert die Geschichte des Feldmarschalls Rusworn einen Beweis; Graf Khevenhüller erzählt sie in seiner altertümlichen Manier, die ich zu mildern versuche:
 |
| Kaiser Rudolf II., |
| nach einem Stich von A. Wierx. |
»Dies Jahr sind zu Prag der Feldmarschall Rusworn und der Begliojoso so hart aneinandergekommen, daß sie sich mit Worten übel traktiert, was der Begliojoso von seinem Feldmarschall hat leiden müssen. Seines Unwillens hat sich ein von Mailand verbannter Kerl namens Furlan bedient; der Begliojoso hatte in seiner Heimat eines Rechtsgelehrten Weib verführt, deshalb waren zwölftausend Kronen auf seinen Kopf gesetzt, welche dieser Furlan zu gewinnen und dabei seiner Acht sich zu entledigen hoffte. Als nun Begliojoso einmal am Abend auf der Kleinseite spazieren ging, ist Furlan zu dem Feldmarschall gegangen, der beim Grafen Herberstein speiste und hat ihm vermeldet, der Begliojoso lauere ihm auf. Darauf hat der Rusworn um seine Leute und Pistolen geschickt und hat seinen Kämmerling und den Furlan ihm vorausgehen heißen. Als sie nun den Begliojoso angetroffen, hat dieser, der nichts Böses im Sinn geführt, freundlich zu Furlan gesprochen, der aber hat ihm mit der Pistole geantwortet und ihn durch den Arm geschossen. Darauf hat der Begliojoso mit der rechten Hand den Degen erwischt, mit großer Wut auf die zwei losgegangen und sie gegen den Feldmarschall getrieben; der hat gemeint, die Verräterei sei erwiesen, hat dem Begliojoso stark mit der Wehr zugesetzt und ihn fast auf den Tod verwundet. Indem hat Furlan den Begliojoso hinterwärts durch den Kopf geschossen, ist davongelaufen, aber später ertappt und gehenkt worden. Der Kaiser war zuerst übel zufrieden, daß man seinen Feldmarschall so traktiert, aber als Rusworns Widersacher den Kaiser anders informiert, wurde er verarrestiert und die Sentenz über ihn gesprochen. Der Kaiser hat ihm den Pardon gegeben, der ist aber aus Praktiken zurückgehalten und die Exekution vorgenommen worden. Der Feldmarschall hat sich trefflich wohl zum Sterben geschickt, hat ein gemaltes Kruzifix vor sich ausgebreitet und seines Endes unerschrocken gewartet. Der Kopf ist ihm gleich zu der Wunde Christi gefallen, und also hat dieser kühne tapfere Held, so in Ungarn wider den Türken ansehnliche Dienste geleistet, mit einem schmählichen Streich sein Leben enden müssen, aus Mißgunst etlicher, die ihn um das Glück beneidet und denen er im Wege gelegen. Der Kaiser hat seine Übereilung hoch beklagt. Weil aber die Majestät damals sich ganz versteckt gehalten und fast niemand gehört, wurde die Sache beschönt und verschwiegen.«
Gerade weil Rudolf so eingezogen lebte, bedurfte er der Zuträgereien; die Kammerdiener brachten sie ihm, und nach seiner argwöhnischen Gemütsart lieh er ihnen ein williges Ohr. Lakaien und Abenteurer waren es, die im Hradschin kommandierten. Die Stallknechte hatten einen großen Stand, weil der Marstall des Kaisers Lieblingsaufenthalt war. Viel Macht übten endlich die listigen Buhlerinnen aus, mit denen der Kaiser in immer wechselnder wilder Ehe lebte. Die Ursache, weshalb sich Rudolf nicht vermählte, war das Horoskop, das ihm Tycho de Brahe gestellt hatte. Es lautete, er dürfe nicht heiraten, denn es drohe ihm Gefahr vom eigenen Sohn. Zwei Heiratsprojekte lagen vor: mit einer mediceischen Prinzessin und mit der spanischen Infantin Isabella. Viele Jahre lang wurde darüber verhandelt, aber jeder Versuch, den Kaiser zur Ehe zu bewegen, schlug fehl. Um das Jahr 1600, als sich die Heiratsprojekte endgültig zerschlagen hatten, stieg Rudolfs Trübsinn aufs höchste. Gegen seinen jüngeren Bruder Mathias faßte er einen unaustilgbaren Widerwillen. Das Erscheinen des Halleyschen Kometen bestärkte ihn in der Furcht vor den Anschlägen seiner Verwandten, Anschläge, die der blutige Schwanzstern ihm recht handgreiflich in der Vorbedeutung anzuzeigen schien. Vergeblich suchte ihm Kepler seine Angst auszureden. Er war so mißtrauisch, daß er nicht nur den niedrigsten Verleumdern zugänglich war, sondern auch alle Personen, die zu ihm kamen, untersuchen ließ, ob sie heimlich Waffen bei sich führten. Selbst seine Geliebten mußten sich diesem Zwang unterwerfen. Aus Furcht verließ er das Schloß nicht mehr. Sein Schlafzimmer glich einer Festung. Oft sprang er aus dem Bett und ließ durch einen Schloßhauptmann alle Winkel der kaiserlichen Residenz mitten in der Nacht durchstöbern. Wenn er zur Messe ging, was nur an hohen Festtagen geschah, saß er in einem gedeckten und stark vergitterten Oratorium. Um ganz sicher beim Spazierengehen zu sein, ließ er lange und weite Gänge mit engen schrägen Fensterchen gleich Schießscharten bauen, durch die hindurch er nicht fürchten mußte, erschossen zu werden. Diese Gänge führten in seinen prächtigen Marstall; er hatte hier seine Zusammenkünfte mit den Frauen und besah sich gern seine Pferde, die er liebte, auf denen er aber niemals ritt.
Daniel L’Hermite schildert die Erscheinung des siebenundfünfzigjährigen Kaisers wie folgt: »Viel zu frühe sind ihm Haare und Bart grau geworden. Die Stirn ist majestätisch, der Mund nicht unangenehm, die Augen sind feurig, werden aber von starken Wimpern fast gänzlich beschattet. Seine Gestalt ist mehr gedrückt als aufgerichtet, von alters her ist diese gedrückte Leibesgestalt im Hause Österreich angeboren. Er trägt noch immer Kleider nach der alten Sitte, er hält auf diese alte Sitte und setzt ein Zeichen der Größe daran, nichts an ihr zu ändern; er trägt einen kurzen, mit Gold eingefaßten Mantel und über der gegürteten weißen Hose ein spanisches Wams.«
In Prag wußte man oft monatelang nicht, ob Rudolf noch lebe. Das Volk fürchtete, die Günstlinge verheimlichten seinen Tod, um seine Schätze an sich zu bringen. Einmal brach deshalb ein Aufstand aus, und da zeigte sich der Kaiser nach langen Bitten am Fenster des Hradschins, um den andrängenden Volkshaufen zu beruhigen. In dumpfem Brüten, und ohne einen Laut von sich zu geben, saß er oft viele Stunden hindurch und schaute den Malern und Uhrmachern zu, die in seinem Zimmer arbeiteten. Wurde er dabei angesprochen, so packte ihn der Jähzorn, und er warf, was er gerade erreichen konnte, ein Gefäß oder ein Werkzeug, dem Störer mit Schimpfworten an den Kopf. Bisweilen auch fuhr er aus seinem wehmütig stieren Sinnen ohne Grund empor und zerschlug alles um sich her.
Personen, die in Geschäften bei Hof erschienen, fanden es ungemein schwer, zum Kaiser zu gelangen. Entweder war er im Zimmer bei den Löwen, Leoparden und Adlern, die er selbst fütterte, oder bei Tycho de Brahe auf der Sternwarte, oder bei Dee und Bragadino, beschäftigt mit Schmelztiegeln, Wunderspiegeln, Traumtafeln und Geistererscheinungen, oder in den Gärten des Hradschins, wo Bäume, Gesträuche und Blumen aus fernen Weltgegenden blühten und Zaubergrotten und Wasserwerke sich befanden, aus denen Musik ertönte. Wer ihn sprechen wollte, mußte sich als Stallknecht verkleiden und ihn im Marstall erwarten. Aber auch hier war es gefährlich, sich dem seltsamen und gewalttätigen Herrn zu nähern. Eva, die Tochter des in Ungnade gefallenen Oberst-Burggrafen Lobkowitz, hatte sich durch Geld eine solche Audienz erkauft, um für ihren gefangenen Vater Freiheit und Leben zu erbitten. Ein ehrlicher Stallknecht warnte sie in letzter Stunde, indem er ihr eröffnete, daß sie zu schön sei, um solches zu wagen, der Kaiser scheue nicht vor Gewalt zurück. Sie verstand ihn und floh.
Rudolf ahnte nichts von der Not seiner Völker. Der sturmbewegten Zeit mußte dieser kranke Träumer auf dem Thron alles schuldig bleiben. Die Türkengefahr und der Aufstand des Siebenbürgerfürsten vereinigte sämtliche Erzherzoge des habsburgischen Hauses zu dem Beschluß, den Kaiser abzusetzen, und der Urheber dieser Maßregel war Clesel, der Bischof von Wien und Neustadt. Im Juni 1608 mußte Rudolf an seinen Bruder Mathias die Krone Ungarns und die Lande Österreich und Mähren gegen ein Jahrgeld gänzlich abtreten, und trotz seines leidenschaftlichen Widerstandes wurde er gezwungen, den berühmten Majestätsbrief auszustellen, durch den er den böhmischen Herren unbedingte Glaubensfreiheit sicherte. Nur das tiefe Zerwürfnis mit Mathias drängte ihm den Majestätsbrief ab, die Scharteke, wie Kaiser Ferdinand später die Urkunde verächtlich betitelte, als er sie nach der Schlacht am Weißen Berg verbrannte. Aber eines glaubte sich Rudolf dadurch gesichert zu haben: als böhmische Majestät in dem teuren Prag ruhig sterben zu können. Es war ein Irrtum. Er wurde in seinem Schloß so eng bewacht, daß ihm nicht einmal verstattet war, in den Garten zu gehen und Luft zu schöpfen. Einmal, als der römische Kaiser aus dem Tor treten wollte, schlug die Wache das Gewehr auf ihn an; da kehrte Rudolf in seine Gemächer zurück, öffnete das Fenster und rief mit erhobener Hand: »Du undankbares Prag! durch mich bist du erhöht worden, und nun stößt du deinen Wohltäter von dir. Die Rache Gottes soll dich verfolgen und der Fluch über dich und ganz Böhmenland kommen.«
Die Kurfürsten von Mainz und Sachsen verwandten sich für den Kaiser, indem sie betonten, daß er doch auch noch ein Mitglied des kurfürstlichen Kollegiums sei. Darauf entgegneten die Stände Böhmens höhnisch den Abgesandten: »Wir wollen euch den römischen Kaiser samt dem Kurfürsten von Böhmen zugleich in einem Sack zuschicken.«
In dieser Bedrängnis war es, wo Mathias seinem Bruder auch die böhmische Krone raubte. Erbittert darüber, daß die Böhmen Mathias gehuldigt hatten, schleuderte Rudolf, als er die Abdankungsurkunde unterzeichnet hatte, im Zorn seinen Hut auf die Erde, zerbiß die Feder und warf sie dann auf das Diplom, auf dem man noch heutigentags den Tintenfleck sieht. Ungeachtet seiner hoffnungslosen Lage glaubte der wunderliche Mann durch die Stiftung eines Ordens von Friedensrittern alles wieder ins Geleise bringen zu können, und Tag und Nacht arbeitete er an den Ordensketten.
Von seinen sämtlichen Kronen besaß er jetzt nur noch die römische Kaiserkrone. Aber schon lange verachteten ihn auch die deutschen Fürsten und schickten endlich eine Gesandtschaft, um ihn zu nötigen, zur Wahl eines anderen Kaisers seine Zustimmung zu geben. Er empfing die Gesandten unter einem Thronhimmel stehend; die linke Hand hatte er auf einen Tisch gestützt. Als sie ihr Verlangen vorbrachten, wurde ihm der Kopf heiß, seine Knie zitterten, und er mußte sich auf einen Sessel niederlassen. Später sagte er zum Herzog von Braunschweig, seinem vertrautesten Freund: »Die mir in meinem Ungemach keine Hilfe geleistet und zu meinem Dienst nicht einmal ein Roß haben satteln lassen, haben mir jetzt eine Art von Leichenpredigt gehalten. Ohne Zweifel sind sie mit unserm Herrgott in geheimem Rat gesessen und wissen vielleicht von daher, daß ich noch in diesem Jahr sterben werde, weil sie gar so stark auf einen Nachfolger im römischen Reich dringen.«
Erniedrigung, Verlust der Würden und alle damit verbundenen Leiden hatte Rudolf ertragen; der Tod seines schönen treuen alten Löwen und zweier Adler, die er täglich mit eigener Hand gefüttert hatte, brach ihm das Herz.
Sein Leichnam wurde in eine mit rotem Damast ausgeschlagene Bahre gelegt, über der sich ein gläserner Deckel befand; auf der Brust trug er ein Kreuz, an der linken Seite die Wehr und an der rechten das goldene Vlies. Rudolfs Minister wurden verhaftet und zur Folter verurteilt; sein Schatzmeister Roszky, den er vor andern geliebt, erhängte sich im Gefängnis mit der Schnur, an welcher er den Kammerschlüssel getragen. Man ließ daher seinen Leib vom Nachrichter vierteilen und auf dem Weißen Berg bestatten. Allein es hieß, daß er sich an derselben Stelle oftmals auf einem Bock oder Hirsch reitend zeigte, und so wurde der Körper wieder ausgegraben, wurde verbrannt und die Asche in die Moldau geworfen. Als dies geschehen war, verschwand plötzlich der Schloßhauptmann, und es entstand der Verdacht, daß er den Roszky im Gefängnis ermordet, ihn aufgehängt und ihm das aurum purificatum, das er aus des Kaisers Schatz zurückbehalten, geraubt habe.
Der Kaiser Rudolf hinterließ von seinen vielen Geliebten wahrscheinlich viele Kinder, von denen vier Söhne bekannt geworden sind, die sein wildes Blut erbten. Don Carlos d’Austria diente dem Kaiser Ferdinand im Dreißigjährigen Krieg, wurde aber in einer Vorstadt von Wien bei einem Auflauf um eine öffentliche Dirne, in den er sich mutwillig gemischt hatte, unerkannt erschlagen. Zwei andere führten ein anonymes Dasein, der vierte jedoch, Don Cesare d’Austria, hatte an einem Edelfräulein Gewalt geübt und sie dann aus dem Weg geräumt. Der Kaiser, sein Vater, ließ ihm in einem warmen Bade die Adern öffnen.
Als Herr Reichard Strein mit zweiundzwanzig Kutschen, in denen seine nächsten Befreundeten gesessen, beim Grafen Ortenburg angekommen war, ließ er durch diesen bei Herrn von Tschernembel um die Hand seiner Tochter Regina werben. Um größere Unkosten zu verhüten und auf seine ansehnlichen Befreundeten weisend, begehrte Herr Strein, daß nach schleuniger Begleichung des Zeitlichen und geschehener Zusage die Hochzeit sogleich vorgenommen werde, und obwohl der andere Teil Einwendungen gemacht, wurde dem Begehren schließlich doch willfahrt. Die Brautleute wurden am selben Tag christlich zusammengetan, und der Abend ward bei guter Traktation fröhlich verbracht. Am folgenden Morgen wurde die Hochzeitspredigt gehalten; dann fuhr Herr Strein mit Herrn Achaz von Lohsenstein und seiner Schwester, der Frau Jörgerin, nach Freydek, um Ordnung zur Heimführung zu geben.
Am Mittwoch den 27. September wurde zu früher Tageszeit der Brautwagen mit fünfzig Reitpferden nach Karlspach bei Melk begleitet, dort setzten sich die Herren in die Kutschen, das Frauenzimmer auf ihre Wägen und zogen in folgender Ordnung weiter: erstlich die Handrosse, dann die andern Pferde, deren Zahl sich ebenfalls auf fünfzig belief; dann die Kutschen mit den Dienern; dann die Herren selbst in ihren Kutschen; dann drei berittene Trompeter; dann drei Berittene von Adel in meißenischen Sammetröcken und weißen Kranichfedern auf den Hüten; dann drei Edelknaben mit weiß und schwarzen Federbüschen auf den überzogenen Sturmhauben; dann die reisigen Knechte mit goldgeschmückten Röcken; dann Herrn Streins Pferd; dann wieder drei Berittene von Adel mit schönen Wehrgehängen und zum Beschluß drei junge Freunde des Herrn Strein. Hierauf folgte der Brautwagen; er war mit schwarzem Leder überzogen und mit weißem Atlas ausgefüttert, und das Eisenwerk war versilbert; sechs gefärbte Rosse zogen ihn, an deren Lederzeug schwarzseidene Fransen hingen. Die Kutschen der Frauenzimmer waren mit braunem lündischen Tuch bekleidet; es waren etwa dreißig Kobelwägen. Herr Strein empfing seine Gäste in Freydek mit ordentlichem Schießen und anderen Ehrenbezeugungen um zwölf Uhr Mittag.
Als nun die Herren und Frauen in ihre Zimmer gegangen und sich abgetan, ist die Mahlzeit mittlerweile bereit und die Speisen aufgetragen worden. Ein Saal war zum Tanzen zugerichtet und in einer gleichgroßen Stube standen sieben gedeckte Tafeln. Die Mahlzeit ist so vertraulich und lieblich abgegangen, daß man weder Fluchen noch unziemliche Reden gehört. Es ist kein übermäßiger Trunk geschehen, fröhlich ist jedermann gewesen und hat sich den Wein wohlschmecken lassen. Als nun das Obst- und Beschauessen zum Teil aufgetragen war und die Herrentafel aufgehoben werden sollte, fingen unversehens die Stühle an zu sinken; zudem brach der Boden acht Klafter in der Länge und fünf in der Breite auseinander, und es entstand ein großes Getümmel. Die Restbäume waren gebrochen und die Ziegelpflaster des Bodens, die Tische, Stühle, Bänke, Schrägen, Messer, Teller und alles, was am Herrentisch gesessen, samt etlichen aufwartenden Personen stürzte dreiundeinhalb Klafter in die Tiefe.
Die Hochzeitsgäste meinten nichts weniger, als das Jüngste Gericht und die Auferstehung der Toten sei gekommen. Der vom Schutt aufwirbelnde Staub war so groß, daß ihn die Leute im Hof für Flammenrauch hielten. »Ist durch sonderliche Fügung und Barmherzigkeit Gottes,« so lautet der Bericht, »niemand am Leben verkürzt worden, außer einem, Kleinschopf genannt, Herrn Gabriel Streinz’ Diener, der ist im Saal gewesen und hat das Krachen gehört, und ist herausgegangen und etlichen andern solches gesagt und mit dem Vermelden wieder hineingegangen, er wolle sehen, wo es brechen will. Indem hat ihn der Fall ergriffen und erschlagen.« Einer vom Adel ist im Saal auf der Bank gelegen und hat geschlafen; dem ist nichts geschehen, ist auch nicht eher erwacht, als bis Herrn Wolf Ehrenreich Streinz’ Lakai auf ihn gefallen, den er deshalb, unvermerkt woher er käme, hat schlagen wollen. Herr Adam von Puchheim ist ohne Schaden auf die Füße heruntergefallen, ist alsbald den andern zu Hilfe gelaufen und hat zum ersten die Frau Braut Reginam hervorgezogen, welche außer einem schlechten Riß am Knie keinen Schaden empfangen. Ihr Gemahl ist an Kopf und Arm ein wenig gestreift worden, zwei Bäume sind überzwerch auf ihm gelegen, Kalk ist ihm in die Augen gekommen, und er hat nichts sehen können.
Die Liste der bei dieser Hochzeit gestürzten Personen der Herren, Frauen, Fräulein und Bedienten gibt die Zahl achtundzwanzig.
Friedrich Wilhelm wurde am 14. August 1688 als einziger Sohn Friedrichs des Ersten und der geistreichen, philosophisch begabten Charlotte von Hannover geboren, nur wenige Monate nach dem Tode seines Großvaters, des Großen Kurfürsten. Schon als Kind hatte er einen robusten Körperbau, ein äußerst widerspenstiges Naturell und zeigte zum Lernen keine Lust. Der muntere, fast unbändige Knabe war der Abgott seiner Mutter und seiner Großmutter. Die Kurfürstin Sophie ließ den geliebten Enkelsohn bereits in seinem fünften Jahre zu sich nach Hannover kommen, aber es war nicht möglich, ihn dort lange zu behalten, denn er vertrug sich ganz und gar nicht mit seinem Spielkameraden, dem Prinzen Georg, der später König von England wurde. Die Abneigung zwischen den beiden blieb eine dauernde; sie haßten einander bis zur Todesstunde, und Friedrich nannte Georg nicht anders als: mein Bruder, der Tanzmeister, während Georg seinerseits: mein Bruder, der Sergeant, sagte.
Die Personen, die mit dem Prinzen zu tun bekamen, hatten einen schlimmen Stand mit ihm. Zwei Guvernanten mußten ihn beaufsichtigen, und oft brachte er durch seine tollen Streiche die beiden Frauen zur Verzweiflung. Frühzeitig legte er einen Widerwillen gegen allen Pomp und Luxus an den Tag, und er warf einmal ein Schlafröckchen von Goldstoff, welches anzuziehen man ihn nötigen wollte, ins Kaminfeuer. Dagegen bestrich er sich das Gesicht mit Fett und ließ sich in der Sonne braten, um eine recht braune Soldatenfarbe zu bekommen.
Wie von dem großen Leibniz bestätigt wird, galt Friedrich Wilhelm als Knabe für sehr witzig. Auf einem Jahrmarkt in Charlottenburg spielte der zwölfjährige Prinz den Taschenspieler zum allgemeinen Ergötzen. Die Herzogin von Orleans schrieb: »Es ist mir immer bang, wenn ich Kinder so witzig vor dem rechten Alter sehe, denn es ist mir ein Zeichen, daß sie nicht lange leben. Darum ist mir auch bang für den kleinen Kurprinzen von Brandenburg.« Friedrich Wilhelm blieb aber ungeachtet seines Witzes beim Leben, und zwar bei recht gesundem Leben. Nur mit dem Lernen wollte es gar nicht vorwärts; wie er seinem prunkliebenden Vater eine entschiedene Abneigung gegen Prunk zeigte, so trotzig verhielt er sich gegen alle Versuche seiner Mutter, die einen gelehrten Mann, une belle âme, aus ihm machen wollte. In seinem siebenten Jahre war ihm der Graf Alexander Dohna als Erzieher gegeben worden, ein ehrenfester, gravitätischer, stolzer Mann. Seine Instruktion besagte, daß er alle Mühe aufzuwenden habe, um dem Prinzen das Lateinische beizubringen, »da solches nicht allein die goldene Bulle erfordere, sondern auch die nötigen Verhandlungen mit den benachbarten Puissancen.« Aber trotz aller Einreden Dohnas lernte die Königliche Hoheit gar wenig, obwohl ihr ein ganz außerordentliches Gedächtnis anerschaffen war. Noch schlimmer ging es mit den Künsten, er wollte weder das Klavier noch die Flöte spielen, die Musik war ihm geradezu unleidlich.
In schärfstem Gegensatz zu der Vorliebe seiner Eltern für das Französische trat alsbald sein ausgeprägtes Deutschtum hervor. Hierin bestärkte ihn sein erster Lehrer, der Ephorus Friedrich Cramer. Cramer war ein kenntnisreicher und gebildeter Mann, der einst die Schrift des Abbé Bouhours: Kann ein Deutscher Geist haben? mit einer grimmigen Gegenschrift beantwortet hatte. Cramers Einwirkung blieb fest in der Seele Friedrich Wilhelms, die, wie rasch sie sich auch nach Sympathien und Antipathien entschied, daran für immer und aufs zäheste festhielt. Der Nachfolger Cramers war ein Franzose namens Rebeur, ein Emigrant, den Graf Dohna aus der Schweiz hatte kommen lassen. Aber dieser Rebeur war ein trauriger Pedant; er plagte den Prinzen fortwährend damit, daß er ihn lateinische, französische und deutsche Aufsätze über das Alte Testament machen ließ, und die Folge war, daß Friedrich Wilhelm fortan einen unbezwinglichen Haß gegen das Alte Testament hegte; sein ganzes Leben lang konnte es bei ihm nicht wieder zu Ehren gebracht werden, ein so guter Christ er auch war.
Seine Mutter verzog ihn gänzlich, und eigentlich hat er ihr das später nie verziehen. Gerade aus dem Verhältnis zur Mutter entwickelte sich in ihm die Forderung eines unbedingten blinden Gehorsams, »sonder Räsonieren«, seine unphilosophische starre Rechtgläubigkeit nach eigenem Rezept und eigener Vorschrift und die harte Behandlung, die er seinem Sohn Friedrich angedeihen ließ.
Er nährte im stillen nur zwei Leidenschaften: die Soldatenliebhaberei und die Ökonomie in den Finanzen. Schon als Knabe errichtete er von seinem Taschengeld eine Kompanie adeliger Kadetten. Eine zweite Kompanie befehligte sein Vetter, der Herzog von Kurland, mit dem er sich auch sehr übel vertrug, die Mutter kam einmal dazu, wie er ihn wütend bei den Haaren herumschleppte. Seine Sparsamkeit zeigte sich frühzeitig; er war acht Jahre alt, als er sich ein Ausgabenbuch anlegte, das den Titel führte: Rechnung über meine Dukaten. Seine Mutter ängstigte sich, daß der Geiz ihn verhärten werde, und nicht weniger bekümmerte sie seine immer mehr zutage tretende Unhöflichkeit gegen die Frauen, die freilich in einer unbesiegbaren Befangenheit und Schüchternheit begründet war und auch in dem Umstand, daß die erste zarte Neigung seines Herzens, die zur Prinzessin Karoline von Ansbach, nicht erwidert wurde. Karoline heiratete später den englischen Georg.
In seinem sechzehnten Jahr erhielt der Prinz die Erlaubnis zu einer Reise nach den Niederlanden und nach England. Der Herzog von Marlborough hatte ihm bereits ein Schiff zur Überfahrt bestimmt, als er nach Berlin zurückgerufen wurde; seine Mutter war gestorben. Von nun an lebte er mit Vorliebe in Wusterhausen, dorthin zog er die Leibkompanie seines Regiments, die er fleißig exerzieren ließ und die seine höchste Freude war. Er machte den Feldzug am Rhein unter Marlborough und Prinz Eugen mit, und im Jahre 1706 vermählte er sich mit der Prinzessin Sophie Dorothea von Hannover, welche die Mutter des großen Friedrich wurde. Sie war eine große schlanke Frau mit blauen Augen und braunem Haar, gebildet und lebhaft, ehrgeizig und stolz.
Als Friedrich Wilhelm nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1713 zur Regierung gelangte, änderte er den ganzen Hofhaushalt völlig um. Wer seine Gunst erlangen wollte, mußte Sturmhaube und Küraß anlegen, alles war Offizier und Soldat, und zwei Männer gewannen alsbald ausschließlich sein Vertrauen, der Generalmajor von Grumbkow und der Fürst Leopold von Anhalt-Dessau. Alle wichtigen Geschäfte gingen durch Grumbkows Hände, und da er des Königs täglicher Gesellschafter war, wuchs sein Einfluß beständig. Er fügte sich in des Königs Launen, wußte dessen erste Hitze abzulenken und leitete ihn, soweit er sich überhaupt leiten ließ, anscheinend treuherzig, freimütig und bieder. Grumbkow war ein großer Feinschmecker und konnte ungeheuer viel Wein vertragen, so daß er den Ehrentitel Biberius erhielt. Für zwölftausend Taler Tafelgelder, die ihm ausgezahlt wurden, übernahm er die Bewirtung der fremden Prinzen und Gesandten. Während der König und der übrige Hof in der größten Sparsamkeit lebten, führte Grumbkow allein einen glänzenden Haushalt. Der König speiste selbst gern und oft bei ihm und pflegte zu sagen: »Wer besser essen will als bei mir, der muß zu Grumbkow gehen.« Grumbkows Verschwendungssucht brachte ihn aber in eine höchst bedenkliche Abhängigkeit von fremden Höfen; er stand erst im englischen und später im österreichischen Solde. Seine Hauptfeindin war die Königin Sophie, deren Lieblingsplan einer Heirat ihres Sohnes Friedrich mit der englischen Prinzessin Amalia er hintertrieb. Damals beleidigte er die Königin geradezu durch unziemliche Redensarten, und sie verfluchte ihn dafür. Sein Ehrgeiz vermaß sich immer höher, geflissentlich säte er Zwietracht zwischen dem König und der Königin, endlich erschöpfte er die Langmut seines Herrn und fiel in Ungnade. Als der König seinen Tod erfuhr, sagte er: »Nun werden die Leute doch endlich einsehen, daß der Grumbkow nicht alles macht. Hätte er vierzehn Tage länger gelebt, so hätte ich ihn verhaften lassen.«
Leopold von Anhalt-Dessau, den der Volksmund und die Geschichte den Alten Dessauer nennt, war ein Vetter des Königs und seit dem italienischen Feldzug eng mit ihm befreundet. Leopold verstand sich auf die Seele des Soldaten, und wenn er fluchte, war es dem gemeinen Mann wie bei einer Schmeichelei zumute. Er führte die großen Neuerungen in der preußischen Armee ein, die ihr später in den Schlachten Friedrichs des Großen die taktische Überlegenheit verschafften: den eisernen Ladestock und den Gleichschritt der Kolonnen.
Grumbkow und der Fürst von Dessau waren grimmige Feinde. Den ersten Streit zwischen ihnen gab es wegen eines merkwürdigen Projektes, das Leopold dem König kurz nach seinem Regierungsantritt vorschlug. Leopold hatte in seinem Fürstentum alle Güter aufgekauft, das Land bestand am Ende nur noch aus Domänen und war ganz sein Eigentum geworden. Er riet dem König, ein gleiches zu tun, und bewies ihm, daß Dessau jetzt verhältnismäßig doppelt soviel einbringe, als dem König seine Staaten. Grumbkow widersetzte sich dem Vorschlag lebhaft und malte die schädlichen Folgen aus, wenn der König seinen Adel vom Güterbesitz vertreibe und sich vom baren Geld entblöße. Dem Fürsten schleuderte er die Anklage entgegen, daß ja in seinem Lande nur noch Juden und Bettler zu finden seien. Leopold geriet darüber in solchen Zorn, daß er den Minister auf Pistolen forderte, und nur mit Mühe verglich sie der König durch sein Dazwischentreten. Von da an war es unmöglich, beide Männer in leidlichem Einvernehmen zu halten. Zehn Jahre später kam es wegen des Vorwurfs der englischen Bestechung abermals zu einem Streit und wieder zu einer Herausforderung. Grumbkow lehnte ab. Um sich zu rächen verlangte Grumbkow vom Fürsten das Patengeschenk von fünftausend Talern, das er einst einer seiner Töchter versprochen hatte, wenn sie sich verheiraten würde. Der Fall war da. Es kam zum Wortwechsel und zu Beschimpfungen. Der Fürst schickte Grumbkow ein Kartell. Grumbkow schützte religiöse Bedenken vor und sagte, die Duelle seien nach göttlichen und menschlichen Gesetzen verboten. Endlich kam es aber doch zum Zusammentreffen, und beide Teile begaben sich vor das Köpenicker Tor. Sobald der Fürst, in weiter Ferne noch, seinen Gegner erblickte, rief er ihm zu, er solle den Degen ziehen. Grumbkow näherte sich mit langsamen Schritten, übergab dem Fürsten seinen Degen und sagte, er bitte Seine Durchlaucht untertänigst, das Vorgefallene zu vergessen und ihm seine Gnade wieder zu schenken. Da warf ihm der Fürst einen verachtungsvollen Blick zu, kehrte ihm den Rücken, schwang sich auf sein Pferd und ritt wieder gegen die Stadt.
Jetzt trat der König ernstlicher als Vermittler auf; er begehrte, daß Leopold eine Bescheinigung unterschreiben solle, worin Grumbkow das Zeugnis eines Ehrenmanns ausgestellt war; weigere sich der Fürst, so werde er, Friedrich Wilhelm, alle Generale zu sich kommen lassen und erklären, daß, wer den Grumbkow nicht für einen braven Offizier halte, ein Erzhalunke sei. Es gab weitläufige Verhandlungen, mit Müh und Not war der Fürst zu einer Abbitte zu bewegen, und bald darauf verließ er den Hof von Berlin. Sein Regiment stand in Halle und in Magdeburg. In Halle kam es zu schweren Händeln zwischen ihm und den Studenten, die beim Rekrutenexerzieren im Frühjahr ein lärmendes Publikum bildeten und das linkische Wesen der Rekruten verhöhnten.
Das Kabinettsministerium Friedrich Wilhelms blieb in den Händen des seit der Verschaffung der Königswürde bewährten Heinrich Rüdiger von Ilgen. Der kluge Westfale, den schon der große Kurfürst nach seinem Verdienst erkannt, gehörte zu jenen Bürgerlichen, welchen die Monarchie ihre Größe verdankt. Ilgen war ein sehr bedeutender Mann. Er allein hielt dem hartgesottenen Mylord Raby stand, der am Berliner Hof den Meister spielen wollte, und entfernte ihn endlich, indem er die Gräfin Wartenberg entfernte. In der gefährlichen Periode nach dem Utrechter Frieden, wo der Wind der Politik beständig umsprang, lenkte er das preußische Staatsschiff mit höchster Geistesgegenwart, ungetrübtem freien Blick und bewußter Energie. Von Jugend auf an Arbeit gewöhnt, gründlich unterrichtet, dabei welterfahren klug und scharfsinnig, war er ein Meister in der Kunst der Verstellung, mit der allein man damals regieren konnte. Er war immer auf der Hut, er verstand es wie irgendeiner von seinen geschulten Gegnern der alten Kabinette, seine Absichten zu verbergen, sich zweideutig auszudrücken, mit glatten Worten sie hinzuhalten, sie zugleich auf weiten Wegen auszuforschen, durch die stärksten Versicherungen von der richtigen Fährte abzulenken und unter den heiligsten Beteuerungen doch zu hintergehen, so wie sie ihn hintergehen wollten. Er hatte sich vollkommen in der Gewalt und beherrschte mit stets gleichbleibender kalter Besonnenheit sein Temperament, seine Zunge, sein Gesicht, ja sogar seine Augen. Nichts verriet ihn und er erriet immer. Alle Staatsgeheimnisse verschloß er in sich selbst, arbeitete alles selbst, hatte keine einzige Kreatur, auch seine Verwandten begünstigte er nicht. Seine Gabe, die Menschen zu erforschen, brachte ihn bei Hofe in den Ruf, daß er die Zukunft vorhersagen könne. Der König, obwohl er ihn nicht liebte, wußte doch, was er an ihm besaß.
Trotz der diplomatischen Kunst seines Ministers war es dem König doch immer gegenwärtig, daß, um unter den Mächten Europas Bedeutsamkeit zu erlangen, alles auf Geld und Soldaten ankomme; das übrige fände sich hernach von selbst. Seine Staatswirtschaft unterschied sich durchaus von derjenigen aller anderen Reiche und Kronen; sein Muster war und blieb das Hauswesen eines wohlhabenden Gutsbesitzers. Seine Neigung für das Soldatenwesen schien ein Spiel, aber hinter diesem Spiel verbarg sich ein tiefer, zukunftahnender Ernst. Es gibt eine Mitteilung über eine merkwürdige Stelle in Friedrich Wilhelms Testament; sie stammt vom Ritter Zimmermann und lautet: Mein ganzes Leben hindurch fand ich mich genötigt, um dem Neid des österreichischen Hauses zu entgehen, zwei Leidenschaften auszuhängen, die ich nicht hatte; eine war ungereimter Geiz und die andere eine ausschweifende Neigung für große Soldaten. Nur wegen dieser so sehr in die Augen fallenden Schwachheiten vergönnte man mir das Einsammeln eines großen Schatzes und die Errichtung einer starken Armee. Beide sind nun da, und nun bedarf mein Nachfolger weiter keiner Maske.
Sobald er den Thron bestiegen hatte, begannen die Werbungen in einem vorher nicht dagewesenen Umfang. Im ganzen Land wurde eine förmliche Jagd auf Bürger und Bauern veranstaltet. Scharen junger Leute flüchteten vor dem Korporalstock der Werbewütriche, und es kam vor, daß die Werber in Kirchen eindrangen und sich der jungen Männer während des Gottesdienstes bemächtigten. Es fehlte dem König gegenüber nicht an Klagen und Vorstellungen. Einmal wurde ihm ein Brief in die Hände gespielt, auf dem zu lesen war: Wer einen Menschen stiehlet und verkauft, daß man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben. 2. Moses 21, 16. Wenn jemand funden wird, der aus seinen Brüdern eine Seele stiehlet aus den Kindern Israel und versetzt oder verkauft sie, solcher Dieb soll sterben. 5. Moses 24, 7. Aber das waren Zitate aus dem Alten Testament, und das Alte Testament war ja dem König verhaßt; auch konnte der Hofhistoriograph Coßmann aus dem 1. Buch Samuelis, Kapitel 8 klärlich erweisen, daß es göttliches Recht der Könige sei, Knechte und Mägde, Söhne und Esel wegzunehmen. Friedrich Wilhelm ereiferte sich sehr, wenn er vernahm, daß fremde Staaten Verbote gegen seine Werbungen erlassen hätten; er hielt es für Unrecht, wenn sie ihm lange Kerle verweigerten, da niemand sie so gut zu schätzen wisse als er.
Die langen Kerle, das war die berühmte Potsdamer Garde, riesengroße Leute, die er in seinen eigenen Staaten ausheben, aus allen Weltgegenden für ansehnlichen Sold und gutes Handgeld sich verschreiben, von befreundeten Fürsten sich schenken oder im Notfall durch seine Werber mit Gewalt entführen ließ. Er schrieb einmal an den Grafen Seckendorf: »Wenn ich kann von meinen beiden Vettern in Anspach und Bayreuth vierhundert oder sechshundert Mann als Rekruten kriegen, will ich für jeden nackenden Kerl dreißig Taler geben.« Im Lauf von zwanzig Jahren schickte er ungefähr zwanzig Millionen Werbetaler in die Fremde. Mit Pässen, die vom König unterzeichnet waren, machten die Werber in allen deutschen und in den benachbarten Ländern Jagd auf lange Kerle. Im Jülichschen passierte es einmal, daß ein Oberstleutnant bei einem sehr langen Tischlermeister einen Kasten bestellte, der so lang und so breit sein sollte, wie der Tischler selber war. Als der Oberstleutnant nach einigen Tagen wiederkam, um den Kasten abzuholen, erklärte er, der Kasten sei zu kurz. Der Tischler legte sich sofort selbst hinein, um zu beweisen, daß der Kasten die nötige Länge habe. Geschwind ließ der Oberstleutnant von seinen Leuten den mitgebrachten Deckel zumachen und den Kasten von seinen Rekruten davontragen. Als aber der Kasten vor dem Tor aufgemacht wurde, war der lange Tischlermeister erstickt. Der Oberstleutnant wurde zwar zum Tode verurteilt, der König begnadigte ihn aber zu lebenslänglicher Festung. Der österreichische Hof, der russische und der polnisch-sächsische kamen der Passion des Königs freundlich entgegen. Für hundert russische Potsdamer, die ihm der Zar Peter, dann die Kaiserinnen Katharina und Anna zukommen ließen, gab er ihnen als Gegengeschenk das berühmte Bernsteinkabinett, das sein Vater angelegt hatte, und später eine bestimmte Zahl ausgebildeter preußischer Unteroffiziere. Von August dem Starken erwarb er gegen eine Partie Porzellan die dafür so genannten Porzellanregimenter.
 |
| Friedrich Wilhelm I., |
| nach einem Stich von G. P. Busch. |
Der gewöhnliche Preis eines langen Kerls von fünf Fuß zehn Zoll rheinländischen Maßes war siebenhundert Taler; einer von sechs Fuß wurde mit tausend Talern bezahlt, und war er noch länger, so stieg der Preis noch höher. Einer der teuersten war der Irländer Kirkland; für diesen zahlte der preußische Gesandte in London neuntausend Taler. Für einen andern bekam der General Schmettau fünftausend Taler und eine Stiftsstelle für seine Schwester. Im Lande selbst ward alles aufgeboten, damit man sich der tauglichen Subjekte rechtzeitig versichern konnte. Kinder in der Wiege, die lang zu werden versprachen, bekamen eine rote Halsbinde und ihre Eltern das Handgeld. Es gab Dorfschulen, wo alle Knaben solche Binden trugen. Ein sonderbarer Versuch des Königs, recht lange Potsdamer mit recht langen Frauen zusammenzugeben, um von ihnen wieder recht lange Kinder zu erhalten und auf solche Art ein Geschlecht von Giganten aufzuziehen, mißglückte leider.
Das Infanterieregiment der blauen Grenadiere, das Königsregiment genannt, war das schönste in ganz Europa. Es bestand aus Leuten von allen Ecken und Enden der Welt, Deutschen, Holländern, Engländern, Schweden, Dänen, Russen, Walachen, Ungarn, Polen und Litauern. Franzosen waren grundsätzlich ausgeschlossen, aber wenn sie sechs Fuß maßen, konnte der König nicht widerstehen. Die »lieben blauen Kinder« waren seine größte Freude. Er ging mit ihnen um wie ein Kamerad und wie ein Vater; jeder Soldat hatte bei ihm freien Zutritt. Die größten hatte er malen lassen, und ihre Bilder hingen in den Gängen des Potsdamer Schlosses. Der Flügelmann Jonas mußte sogar in Stein gehauen werden, und zwar, befahl der König, so ähnlich wie möglich. Es war den lieben blauen Kindern gestattet, Bier- und Weinhäuser, Material- und Italienerläden zu halten und Gewerbe zu treiben. Einigen baute der König Häuser, andern schenkte er Geld und Grundstücke, verheiratete sie und hob ihre Kinder aus der Taufe.
Um eine solche durch Zwangswerbung entstandene Armee in Ordnung zu halten, bedurfte es der schärfsten Disziplin. Die Truppen wurden jährlich neu gekleidet, die Infanterie blau, die Kavallerie weiß, die Husaren rot. Alle trugen, wie der König selbst, den langen Zopf und Puder in den Haaren. Die Monturen waren so eng, daß die Leute oft nicht wagten, sich zu bewegen, aus Furcht, die Röcke könnten zerreißen. Einmal bemerkte der König vom Fenster des Schlosses aus einen Offizier, der einen zu langen Rock an hatte; er ließ ihn sogleich rufen und schnitt ihm eigenhändig mit der Schere das vorschriftswidrige Stück weg. Exerziert wurde unaufhörlich, und es war das größte Glück des Königs, wenn bei jedem Kommando in der ganzen Linie nur ein Griff zu sehen, beim Marschieren nur ein Tritt und beim Feuern der Rotten nur ein Schuß zu hören war. Der Ton im Heer war streng und rauh, die Strafen waren furchtbar. Wenn ein Soldat desertierte, mußten Bürger und Bauern die Sturmglocken läuten, und wer den Flüchtling wieder einbrachte, bekam zwölf Taler. Um dem allmählich überhand nehmenden Werbeunfug zu steuern, erließ der König im Jahre 1733 das berühmte Kantonreglement, das den Keim und Anfang des allgemeinen Wehrpflichtgesetzes darstellt. Alle Einwohner des Landes wurden als für die Waffen geboren erklärt; ausgenommen waren nur die kleinen, die Söhne des Adels und die Söhne derjenigen Bürger, die einen gewissen Reichtum nachzuweisen vermochten.
Zeit seines Lebens bezeugte Friedrich Wilhelm für Kaiser und Reich eine Ehrerbietung und Treue der Gesinnung, die man bei einem so mächtigen Herrn, welcher achtzigtausend Soldaten unter sich stehen hatte, nicht vermuten konnte. Er warb um die Gunst der kaiserlichen Minister, und einmal sagte er: »Ich würde mich begnügen, wenn ich des Kaisers Kammerpräsident wäre.«
Alles was nicht deutsch war, war ihm nicht zu Sinne, und sonderlich waren ihm die Franzosen ein Greuel »mit ihren Quinten und französischen Winden«. Um den Berlinern die französischen Moden zu verleiden, ließ er seinen Profosen französische Kleider tragen, grüne Röcke mit großmächtigen Aufschlägen, gelbe Westen und gelbe Strümpfe, dazu ungeheuer große Hüte wie Wetterdächer und Haarbeutel wie riesige Säcke. Auf dem Theater ließ er einmal ein Stück aufführen, das den Titel hatte: »Der anfangs hitzig und großsprechende, zuletzt aber mit Schlägen abgefertigte Marquis«. Ebenso verhaßt waren dem König »die hoffärtigen Leute über dem großen Wassergraben«, wie er die Engländer nannte. Als ihn zwei reformierte Prediger um die Erlaubnis baten, ihre Söhne nach England zu den Erzbischöfen von Canterbury und York schicken zu dürfen, schlug er es mit der Begründung ab, daß in England keine Orthodoxie in der Religion statuiert werde und es überhaupt ein Sündenland sei. »Der König,« schreibt Seckendorf 1726 an Prinz Eugen, »ist sehr gegen die englische Nation pikiert und souteniert nicht ohne Grund, daß selbige durch ihre Seemacht das Comercium von ganz Europa an sich nehmen wolle.« Im Jahre 1730 wurden zwischen Deutschland und England Verhandlungen zu einer Doppelheirat gepflogen; der Kronprinz Friedrich sollte die Tochter Georgs II. und der Prinz von Wales die Prinzessin Friederike angetraut bekommen. England forderte nur, daß der König den Minister Grumbkow als einen Verräter im Dienst und Solde Österreichs entferne, und der Gesandte Hotham erbot sich, diese Anklage aus aufgefangenen Briefen Grumbkows zu beweisen. Der Graf Seckendorf stellte aber dem König vor, daß England den treuen Minister nur deshalb entfernen wolle, um mehr Einfluß am preußischen Hof zu gewinnen; die aufgefangenen Briefschaften seien unterschoben und künstlich fabriziert. Als nun Hotham zur Audienz kam und die Zuversicht aussprach, daß der König den Verräter sofort entlassen werde, geriet Friedrich Wilhelm in solchen Zorn, daß er dem Gesandten Großbritanniens die Dokumente ins Gesicht warf und sogar den Fuß aufhob, als wollte er ihn mit einem Tritt bedienen. Der Gesandte machte Anstalten zu seiner Abreise, Friedrich Wilhelm erkannte seine Übereilung und ließ sich zweimal entschuldigen, aber kurz darauf wollte er seine Gemahlin, die englische Prinzessin, bei der Tafel nötigen, auf Englands Untergang zu trinken.
Mit Holland und Sachsen-Polen stand der König gut, aber seine größte Sympathie hatten doch die Russen. Er war sehr für die russische Allianz, und der Gedanke des nordischen Drei-Adlerbündnisses schwebte ihm immer vor der Seele. Der große Kurfürst war anderer Meinung gewesen und hatte tiefer gesehen, wie sein Wort beweist: Die Russen sind Bären, die man nicht loslassen muß, weil es schwer ist, sie wieder anzubinden.
Die Königin Sophie Dorothea verübelte es ihrem Gemahl sehr, daß er sich allerwegen für das Interesse des Kaisers einsetzte. Einmal sagte sie bei Tisch vor seinen Vertrauten und Offizieren zu ihm: »Ich will noch erleben, daß ich Euch Ungläubige will gläubig machen und dartun, wie Ihr seid betrogen worden.« Aber der König ließ sich nicht irre machen. Einst schrieb er an Seckendorf: »Meine Feinde mögen tun was sie wollen, so gehe ich nit ab vom Kaiser, oder der Kaiser muß mich mit Füßen wegstoßen, sonsten ich mit Treu und Blut sein bin und bis in mein Grab verbleibe.« Er war auch der Ansicht, die deutschen Fürsten müßten geradezu gezwungen werden, die pragmatische Sanktion anzuerkennen. »Weigern sie sich, oder wollen sie sich nit explizieren,« schrieb er, »so muß man die Laus und Motten nit im Pelz lassen wuchern, daß der ganze Pelz nit verdorben sei.« Im Jahre 1729 schon drohte der Krieg, und da schrieb der König an Seckendorf: »Ich wünsche, daß es losgehe und kann versichern, daß ich mit Gut und Blut beistehen werde, aber es muß alles reichskonstitutionsmäßig sein, und die Auswärtigen müssen attackieren, dann ohne Räsonieren drup! drup! Mit die größte Pläsier von der Welt, die stolzen Leute zur Räson bringen zu helfen, sie sollen sehen, daß das deutsche Blut nit verwüstet ist.« Aber als es fünf Jahre später zum Krieg zwischen Frankreich und Österreich kam, wollte er seine Truppen doch nicht marschieren lassen und sagte: »Ich gebe keinen Mann und kein Geld. Ich muß wissen woher und wohin.« Dann ließ er aber doch zehntausend Blauröcke ins Feld rücken. Der Kardinal Fleury schickte ihm eine künstlich gearbeitete goldene Birne, in welcher ein Wechsel auf fünf Millionen Pistolen lag, zahlbar, wenn der König sich für Frankreich erklären würde. Er wies das Anerbieten zurück. In der Folge wurde er aber vom Kaiser mit Undank belohnt, und als es zum Frieden kam, wurde Preußens Stimme nicht einmal gehört. Ein halbes Jahr später sagte er bei einer Unterredung in Potsdam, indem er auf seinen so lange mißhandelten Sohn Friedrich wies, die berühmten Worte: »Da steht einer, der mich rächen wird.« Noch zwei Jahre früher freilich hatte er dieses Genie so über die Achsel angesehen, daß er sich geäußert hatte: »Fritzchen ne sait rien du tout des affaires. Wenn du es nicht recht anfangen wirst und alles drunter und drüber gehen wird, so werde ich in meinem Grabe über dich lachen.«
Als der Kronprinz Friedrich sechs Jahre alt war, erhielt er zwei militärische Gouverneure von seinem Vater, und diesen ward eingeschärft, ihn in der Furcht Gottes zu erziehen, denn dies sei das einzige Mittel, so schreibt der König selbst in seiner Instruktion, die von menschlichen Gesetzen und Strafen befreite suveräne Macht in den Schranken der Gebühr zu erhalten. Man müsse ihn zum Guten antreiben und die Begierde zum Ruhm und zur Bravur in ihm erwecken, von Opern, Komödien und andern weltlichen Eitelkeiten abhalten und ihm so viel als möglich Ekel davor machen. Aber alles was zu lernen sei, solle ihm ohne Ekel und Verdruß beigebracht werden. »Sie müssen ihn nicht bei Leib und Leben verzärteln oder gar zu weichlich gewöhnen. Vor der Faulheit, als woraus Verschwendung entsteht, soll ihm der allergrößte Abscheu von der Welt gemacht werden. Er soll nie allein gelassen werden, weder bei Tag noch bei Nacht, einer der Gouverneure soll jederzeit bei ihm schlafen. Da sich bei herannahenden Jahren oftmals das Laster der Hurerei einzuschleichen pflegt, soll sowohl der Oberhofmeister als auch der Subgouverneur vor allen Dingen achthaben, daß solches verhütet werde, widrigenfalls sie mir mit ihren Köpfen davor haften sollen.« Und in einem späteren Reglement heißt es: »Am Sonntag morgen soll er um sieben Uhr aufstehen; und sobald er die Pantoffel an hat, soll er vor dem Bette auf die Knie niederfallen und zu Gott kurz beten, und zwar laut, daß alle, die im Zimmer sind, es hören können. Dann soll er sich hurtig anziehen und proper waschen, schwänzen und pudern; dann soll er frühstücken in sieben Minuten Zeit. Dann sollen alle seine Domestiken und Duhan hereinkommen, das große Gebet gehalten, auf die Knie, darauf Duhan ein Kapitel aus der Bibel lesen soll und ein oder ander gutes Lied singen soll, da es dreiviertel auf acht sein wird. Alsdann wieder alle Domestiken herausgehen sollen. Duhan soll alsdann mit Meinem Sohn das Evangelium vom Sonntag lesen, kurz explizieren und dabei allegieren, was zum wahren Christentum nötig ist, auch etwas von Katechismo noltenii repetieren, und soll dies geschehen bis neun Uhr; alsdann mit Meinem Sohn zu Mir herunter kommen soll und mit Mir in die Kirche gehen und essen; der Rest des Tages ist vor Ihn. Des Abends soll er um halb zehn Uhr von Mir guten Abend sagen, dann gleich nach der Kammer gehen, sich sehr geschwind ausziehen, die Hände waschen, dann soll Duhan ein Gebet auf den Knien halten, ein Lied singen, dabei wieder alle Seine Domestiken zugegen sein sollen, alsdann Mein Sohn gleich zu Bette gehen soll.« So war auch für die Wochentage die Stundeneinteilung aufs genaueste geregelt. Das Budget des Prinzen ward ungemein kärglich bemessen, und der König prüfte alle Rechnungen selbst.
Friedrich sollte nach dem Willen seines Vaters vor allem ein guter Soldat werden; aber sein feiner, rascher und feuriger Geist war durch das pedantische Leben, das er führen mußte, das unablässige Exerzieren, das Absperren von Musik und Büchern, zu denen ihn seine innerste Herzensneigung zog und die ihm der Vater beharrlich verwehrte, aufs tiefste bedrückt. Er lehnte sich auf gegen die Tyrannei, gab sich Ausschweifungen hin und warf sich mit aller Glut einer jugendlichen und unbefriedigten Seele der französischen Philosophie in die Arme. Der König, dem die Änderung im Wesen des Sohnes nicht entgehen konnte, behandelte ihn nur um so strenger. Die Königin hatte Friedrich heimlich Unterricht im Flötenspiel geben lassen; er hatte oft in versteckten Gewölben Konzerte veranstaltet oder seine musikalischen Freunde in den Wald bestellt; während sein Vater Schweine hetzte, wurden die Flöten und Geigen aus den Jagdtaschen gezogen und im Waldesdunkel konzertiert. Der König kannte diese Neigung und nannte seinen Sohn verächtlich den Querpfeifer und Poeten. Auf Friedrichs Bitten hatte die Königin den berühmten Flötenspieler Quanz nach Berlin kommen lassen; der König hatte Nachricht davon erhalten und den Prinzen überrascht; Quanz konnte zwar noch glücklich in einem Kamin versteckt werden, er erzählte später, daß ihm nie eine Pause so schwer zu halten gewesen sei, aber der König hatte im Zimmer des Prinzen brokatne Schlafröcke und französische Gedichtbücher gefunden. Die Schlafröcke ließ er verbrennen, die Bücher verkaufen. Wütend darüber, daß sein Sohn den Petitmaitre machte, schickte der König eines Morgens den Hofbarbier Sternemann zu Friedrich mit dem Befehl, ihm die schönen, langen, braunen Seitenlocken abzuschneiden und ihn vorschriftsmäßig einzuschwänzen. Als der gutmütige Mann den Prinzen weinen sah, legte er die Schere weg und band die Locken in den Zopf mit ein. Als Friedrich sich bei seiner Tafel statt der zweizinkigen Eisengabeln gegen den Befehl dreizinkige silberne anschaffen ließ, ward er geschlagen. Auch bei anderen Gelegenheiten wurde er von seinem Vater mißhandelt, und seine Lage erschien ihm plötzlich so unerträglich, daß er den Plan faßte, zu entfliehen. Aber der unvorsichtige Katte, der überall in Berlin mit der Freundschaft des Kronprinzen prahlte, hatte geschwatzt, und der König, den sein Sohn auf einer Rheinreise begleitete, ließ ihn in Wesel verhaften und fragte ihn, warum er habe desertieren wollen. »Weil Sie mich nicht wie Ihren Sohn, sondern wie einen niederträchtigen Sklaven behandelt haben,« antwortete Friedrich. »Ihr seid also nichts weiter als ein feiger Desertör ohne Ehre?« sagte der König. »Ich habe so viel Ehre wie Sie,« antwortete Friedrich, »und habe nur das getan, was Sie mir hundertmal gesagt haben, Sie würden es an meiner Stelle tun.« Der König zog den Degen und wollte in der Hitze den Sohn erstechen. Der Mut des Kommandanten von Wesel rettete Friedrich; er warf sich zwischen Vater und Sohn und rief dem König zu: »Sire, durchbohren Sie mich, aber schonen Sie Ihres Sohnes!«
Der neunzehnjährige Prinz ward aus der preußischen Armee gestoßen und auf die Festung Küstrin gebracht. Sein Gefängnis war sehr hart. Die Tür war mit zwei großen Vorlegeschlössern versperrt, sein Essen, aus der Garküche mittags für sechs Groschen und abends für vier Groschen, mußte ihm vorher entzweigeschnitten werden, Messer und Gabel waren verboten, ebenso Tinte und Feder, Bücher und Flöte. Niemand durfte sich länger als vier Minuten bei ihm aufhalten, und um acht Uhr abends hatte der wachthabende Offizier den Befehl, die Kerzen auszulöschen. Einmal erinnerte er den Prinzen daran, zu Bett zu gehen, und als dieser nicht darauf achtete, blies er die Lichter aus. Friedrich gab ihm eine Ohrfeige. Am andern Morgen erschoß sich der Offizier. Die beabsichtigte Desertion allein hätte nicht des Königs Zorn so erregen können, wie es der Fall war. Man hatte ihm hinterbracht, und hier hatte wahrscheinlich Grumbkow seine Hand im Spiele gehabt, daß Friedrich nach Österreich fliehen gewollt, um katholisch zu werden und sich mit Maria Theresia zu verheiraten. Katholisch werden, das war für den König der Schrecken und das Grauen. Grumbkow, der sich überzeugt hatte, daß die Königin und die Prinzessin Friederike die wichtigsten Papiere beiseite gebracht hatten, drängte den Prinzen zu Aussagen über einige Punkte. Friedrich antwortete mit stolzer Verachtung. Da hatte Grumbkow die Stirn, mit der Folter zu drohen. Friedrich erwiderte, ein Henker könne nur mit Vergnügen von seinem Henkerhandwerk reden, und er wolle sich nicht zu weiteren Geständnissen erniedrigen. Die Untersuchung ergab, daß er zur Flucht fünfzehntausend Taler geborgt hatte, auch wurde ihm ein Liebesverständnis mit der schönen Potsdamer Kantorstochter Doris Ritter zur Last gelegt. Der König befahl, das Mädchen auszupeitschen und nach Spandau ins Spinnhaus bringen zu lassen; der Vater verlor sein Amt. Das furchtbarste Schicksal aber hatte Katte. Er hatte mit der Flucht gezögert, weil ein Mädchen ihn hielt, war arretiert und vom Kriegsgericht zur Ausstoßung aus der Armee und zu lebenslänglicher Festung verurteilt worden. Der König verschärfte das Urteil auf die Todesstrafe. Am sechsten November früh sieben Uhr wurde der zweiundzwanzigjährige Mensch am Schlosse vorbei und auf den Wall geführt. Friedrich öffnete das Fenster und rief mit lauter Stimme: »Verzeih mir, lieber Katte.« Katte erwiderte: »Der Tod für einen solchen Prinzen ist süß.« Damit ging er mutig zum Richtplatz, wo sein Kopf fiel. Friedrich wurde ohnmächtig und blieb dann bis zum Abend regungslos am Fenster stehen, den Blick unverwandt auf die Richtstätte gerichtet. Wahrscheinlich begann mit diesem Tag seine völlige Umkehr und Verwandlung, zum Heil seines Volkes und der Welt. So ist, was grausam und dem einzelnen schwer zu tragen scheint, in einem höheren Sinne Notwendigkeit.
Der Areopag, vor welchem am Berliner Hofe die Angelegenheiten der innern und äußern Politik verhandelt wurden, war das Tabakskollegium. Die Tabaksstube war auf holländische Art wie eine Prachtküche mit einem hohen Gestell von blauen Tellern eingerichtet; jeden Abend gegen sechs Uhr kam das Tabakskollegium zusammen und blieb bis zehn Uhr und auch länger. Es gehörten dem Kollegium an: Grumbkow, der Alte Dessauer, der Graf Dönhoff, der Oberst von Derschau, die Generale von Gerstorf und von Sydow, Jean de Forcade, der Kommandant von Berlin, Peter von Blankensee, bei Hofe der Blitzpeter genannt, Kaspar Otto von Glasenapp, Christoph Adam von Flanz, der beste Rebhuhnschütze, Dubislav Gundomar von Natzmer, Heinrich Karl von der Marwitz, Friedrich Wilhelm von Rochow, Wilhelm Dietrich von Buddenbrock, Arnold Christoph von Waldow, Johann Christoph Friedrich von Haake und die von Fall zu Fall gebetenen Minister und Gesandten.
Um den Haupttisch saßen die Herren mit ihren breiten Ordensbändern und rauchten aus langen holländischen Pfeifen; vor jedem von ihnen stand ein weißer Krug mit Ducksteiner Bier und ein Glas. Die nicht wirklich rauchen konnten, wie der Alte Dessauer und der Graf Seckendorf, mußten wenigstens eine Pfeife in den Mund nehmen und kalt rauchen; Seckendorf war sogar so gefällig, sich durch fortwährendes Blasen mit den Lippen den Anschein eines geübten Rauchers zu geben. Es ergötzte den König höchlich, wenn fremde Prinzen, die als Gäste anwesend waren, betrunken gemacht werden konnten oder wenn ihnen das ungewohnte Tabakskraut Sterbensübelkeit verursachte. Er selbst rauchte passioniert, jeden Abend dreißig Pfeifen. Auf dem Tische lagen die Zeitungen, die Berliner, die Hamburger, die Leipziger, die Frankfurter, die Breslauer, die Wiener, auch holländische und französische. Ein Vorleser war bestellt, der sie vorlesen, und, was unverständlich war, erklären mußte. Dieser Vorleser hieß Jakob Paul Freiherr von Gundling.
Gundling war ein Franke, ein Pfarrerssohn aus Hersbruck bei Nürnberg. Er war durch Danckelmann nach Berlin gekommen und Professor an der Ritterakademie gewesen, der König erhob ihn auf Grumbkows Empfehlung zum Hofrat und Zeitungsreferenten beim Tabakskollegium; er erhielt freie Tafel bei Hof, Wohnung im Schlosse und mußte den König auf allen seinen Gängen begleiten, um ihm mit seiner Gelahrtheit und instruktiven Unterhaltung nahe zu sein. Er galt als ein wichtiger Mann, und der russische wie der kaiserliche Hof verschmähten es nicht, ihn durch Gnadenketten zu gewinnen. Um die Gelehrsamkeit, die er wirklich besaß, recht lächerlich zu machen, mußte er beim König den Hofnarren abgeben. Der König erhob ihn zu einer bereits abgeschafften Würde, der des Oberzeremonienmeisters, und schenkte ihm den Anzug des verabschiedeten Besser, den dieser beim Krönungsfest getragen hatte; es war ein roter, mit schwarzem Samt ausgeschlagener Leibrock mit großen französischen Aufschlägen und goldenen Knopflöchern, dazu eine große Staatsperücke mit langen Locken aus weißen Ziegenhaaren, ein großer Hut mit weißen Straußfedern, gelbe Beinkleider, seidene Strümpfe mit goldenen Zwickeln und Schuhe mit roten Absätzen. Der König machte ihn, und zwar an Stelle des großen Leibniz, zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften. Er gab ihm den Freiherrntitel und die Kammerherrnwürde.
In der Trunkenheit schnitt man ihm einst den Kammerherrnschlüssel ab. Der König drohte, ihn wie einen Soldaten zu behandeln, der sein Gewehr verloren hat. Nachdem Gundling acht Tage hindurch einen ellenlangen hölzernen Schlüssel zur Strafe auf der Brust hatte tragen müssen, ward ihm der verlorene wieder eingehändigt, und er ließ ihn nun von einem Schlosser mit starkem Draht an seinem Rockschoß befestigen. Alle Würden und Chargen, auch die des geheimen Oberappellationsrats, des Kriegs- und Hofkammerrats, des Hof- und Kammergerichtsrats, des Freiherrn und Historiographen erhielt Gundling nur, um ihn und die Ämter damit zu verspotten. Einmal machte Gundling den Vorschlag, Maulbeerbäume in der preußischen Monarchie anzupflanzen; da ernannte ihn der König zum geheimen Finanzrat mit der Weisung an den vorsitzenden Etatsminister, »man solle Gundling feierlich in das Kollegium introduzieren, ihn cum voto sessionis anstellen und ihm das Departement aller seidenen Würmer im ganzen Land übertragen«.
Dem armen Gundling ward oftmals so stark zugesetzt, daß er seiner nicht mächtig blieb. Man heftete ihm allerlei Figuren von Eseln, Kamelen und Ochsen an sein Staatskleid und malte ihm einen Schnurrbart. Man ließ ihn aus den Zeitungen die boshaftesten Artikel über seine eigene Person vorlesen, die der König eigens an die Redaktionen hatte schicken lassen. Man setzte einen Affen, der genau wie Gundling gekleidet und mit dem Kammerherrnschlüssel geschmückt war, an seine Seite; der König behauptete, der Affe sei Gundlings natürlicher Sohn, und er wurde gezwungen, das Tier vor dem ganzen Tabakskollegium zu umarmen. In Wusterhausen, wo auf dem Schloßplatz immer mehrere junge Bären herumliefen, legte man ihm einige Bären in sein Bett, die Vorderfüße der Bestien waren zwar verstümmelt, dennoch hätten sie ihn mit ihren Umarmungen beinahe totgedrückt, und er bekam den Bluthusten. Einmal im Winter taumelte er betrunken über die Wusterhausener Schloßbrücke; da packten ihn auf Befehl des Königs vier handfeste Grenadiere, und an Stricken ließen sie den schweren Mann solange in den gefrorenen Schloßgraben hinunter und wieder hinauf und wieder hinunter, bis er das Eis durchgestoßen hatte. Diese Szene mußte zur besonderen Ergötzlichkeit des Königs wiederholt und sogar gemalt werden. Einmal war Gundling zu Gaste geladen und ließ sich in einer Sänfte tragen. Plötzlich wich der Boden der Sänfte unter ihm, er schrie den Trägern zu, sie möchten halten, aber je lauter er rief, je schneller rannten die Träger und zwangen ihn so, nach Art des Pachter Feldkümmel mit ihnen zu laufen. Häufig fand Gundling, wenn er nachts nach Hause kam, sein Studierzimmer zugemauert; anstatt sich zur Ruhe legen zu können mußte er stundenlang die Türe suchen und endlich an der Treppe schlafen.
Eines Tages entfloh der schwergeplagte Mann zu seinem Bruder, dem Professor Nikolaus Hieronymus in Halle. Der König ließ ihn aber wieder holen und machte Miene, ihn als Desertör zu bestrafen. Da er aber eine ungewöhnliche Stille an ihm bemerkte, nahm er zu dem alten Köder der Eitelkeit seine Zuflucht: er erhob ihn in den Freiherrnstand, und zwar mit der Anciennität von sechzehn Ahnen väterlicher und mütterlicher Seite. Es dauerte aber nicht lange, und der König ließ wieder einen seiner derbsten Schwänke an ihm verüben. Auf seinen Befehl schrieb Faßmann, der Autor der damals beliebten »Gespräche im Reich der Toten« eine bösartige Satire auf Gundling, betitelt: »Der gelehrte Narr«, und erhielt den Auftrag, sie Gundling im Tabakskollegium zu überreichen. Gundling wurde hochrot vor Zorn und kam so in Harnisch, daß er eine der zum Pfeifenanbrennen mit glühendem Torf gefüllten Pfannen ergriff und sie Faßmann ins Gesicht schleuderte, wovon diesem die Brauen und Wimpern versengt wurden. Sofort setzte sich Faßmann vor den Augen Seiner Majestät in Avantage, entblößte Gundling die hinteren Kleider und bearbeitete ihn mit der heißen Pfanne dermaßen, daß er vier Wochen lang nicht sitzen konnte. Seitdem begegneten sich die beiden gelehrten Herrn im Tabakskollegium niemals, ohne daß es zum Faustkampf kam. Der König, die Generale, die Minister und die Gesandten sahen den Turnieren zu. Schließlich verlangte der König, die beiden Herren sollten ihren Ehrenhandel durch ein Duell zum Austrag bringen. Faßmann forderte Gundling auf Pistolen, Gundling mußte die Forderung annehmen, er mochte wollen oder nicht. Als die Kombattanten auf dem Schloßplatz erschienen, warf Gundling die Pistole weg, Faßmann schoß ihm die seinige, die nur mit Pulver geladen war, in die Perücke, welche zu brennen anfing; Gundling fiel vor Schreck auf die Erde, und ein ganzer Eimer kalten Wassers, den man über ihn schüttete, konnte ihm nicht die Gewißheit geben, daß er noch lebte.
Achtundfünfzig Jahre alt, beschloß Gundling sein Dasein. Bei der Sektion ergab sich, daß er im Magen ein großes Loch hatte; der Magen war vom vielen Trinken geborsten. Seit zehn Jahren war vom König ein mächtiges Weinfaß zu seiner letzten Ruhestätte bestimmt worden. In seinem besten Staatskleid angetan, ward er in dieses Faß gelegt und so in Bornstädt bei Potsdam trotz des Widerspruchs der Geistlichkeit wirklich begraben. Faßmann hielt dem preußischen Freiherrn mit der Anciennität von sechzehn Ahnen, dem preußischen Kammerherrn, Präsidenten, Finanzrat und Historiographen die Nach- und Trauerrede über seine Weinfaß-Ruhestätte.
In Potsdam gab der König im Winter einige Assembleen, in Berlin unterließ er dies aus Sparsamkeitsgründen, da mußten die Generale und Minister auf ihre Kosten Assembleen geben, aber bei den Diners, wo Friedrich Wilhelm ein freies Gespräch liebte, verbat er sich die Anwesenheit von Damen. Der Hauptgastgeber war Grumbkow. Ein wegen seiner Knauserei bekannter General, bei dem sich der König zu Gast geladen hatte, entschuldigte sich einst, daß er keine eigene Wirtschaft führe. Der König verwies ihn zum Gastwirt Nikolai, erschien dort mit großem Gefolge, und es wurde vortrefflich gegessen und getrunken. Beim Aufstehen rief der General den Wirt herein und fragte ihn, was das Gedeck koste. »Ohne den Wein einen Gulden die Person,« antwortete der Wirt. »Schön,« sagte der General, »hier ist ein Gulden für mich und einer für Seine Majestät; die andern Herrn, die ich nicht gebeten habe, bezahlen für sich.« Der König lachte und erwiderte, das sei ganz fein; er habe den Herrn zu prellen geglaubt, und nun sei er selber geprellt. Darauf bezahlte er die ganze Rechnung.
Später wurde die Einrichtung der Assembleen einem herumreisenden Komödianten übertragen, einem gewissen Karl von Eggenberg. Er war ein Sattlersohn aus dem Bernburgischen, war vom König von Dänemark geadelt worden und hatte Friedrich Wilhelm durch seine Körperkraft in Erstaunen gesetzt; man hieß ihn nur den starken Mann, und er konnte eine zwei Zentner schwere Kanone samt einem Tambur in die Höhe heben und solange halten, bis der Tambur ein Glas Wein ausgetrunken hatte. Er kam reich nach Berlin, baute ein Haus, stand beim König, dem er die Husarenpferde, dänische Hengste, besorgte, in großer Gunst, und er war es auch, der das Theater wieder einigermaßen emporbrachte. Vordem hatten nur Seiltänzer, Gaukler, Taschenspieler, Marktschreier und Marionettenspieler von Zeit zu Zeit die Erlaubnis erhalten, in Berlin Vorstellungen zu geben, auch einzelne herumziehende Schauspieler, nur durfte nichts Ärgerliches und Skandalöses auf der Bühne erscheinen. Eggenberg bekam nun den Titel eines Königlichen Hofkomödianten und durfte mit einer vom König besoldeten Truppe Aufführungen veranstalten, »nur keine gottlosen und dem Christentum nachteilige Dinge, sondern lauter innozente Sachen zum honetten Amüsement.« Sie spielten auf dem Stallplatz und auf der breiten Straße; Hauptperson war der Hanswurst; es wurde der Doktor Faust aufgeführt, wie er vom Teufel geholt, und Haman, wie er gehängt wird. Der »Premierplatz« kostete acht Groschen. Zuletzt wurde die Komödie auch in Halle erlaubt, aber die theologische Fakultät erhob wegen des Gaukel- und Teufelsspiels beim König Protest. Der König schrieb zurück, es würden auch in Utrecht und Leyden Schauspiele geduldet, und kein Mensch könne zweifeln, daß dies die beiden ersten Universitäten der Welt seien.
Sonst war Friedrich Wilhelm allen Volkslustbarkeiten abhold, er sah darin nur Üppigkeit. Das Scheibenschießen hob er auf, Tee- und Kaffeeschenken verschwanden, und wer nach neun Uhr abends sich in den Wirtshäusern betreffen ließ, wurde von den Patrouillen arretiert. Wenn der König nach der Friedrichstadt kam, flüchteten die Leute, machten Türen und Fenster zu, und die Straßen waren öde. Für die Künste hatte Friedrich Wilhelm keinen Sinn. Er malte zwar selbst, besonders in den späteren Jahren, wo ihn die Gicht plagte; gewöhnlich waren es Bauern, die er porträtierte, einmal malte er auch Gundling als Polichinell, aber die Bilder wurden nur von seinen Schmeichlern gelobt. Für die Musik hatte er wenig übrig; einmal ließ er Glockenspiele aus Holland kommen, die von den Türmen geistliche Lieder spielten. Ein paarmal in der Woche ließ er an Winterabenden Arien und Chöre aus heroischen Opern vorführen, etwa aus Händels Alessandro oder Siroe, und zwar auf Blasinstrumenten von den Hoboisten des Garderegiments. Bei diesen Konzerten standen die Musiker mit ihren Pulten und Lichtern am einen Ende des langen Saals, und der König saß ganz allein am andern. Zuweilen, nach einem guten Diner, schlief er auch bei der heroischen Musik ein. Den höchsten Spaß bereitete ihm ein von Kapellmeister Pepusch für sechs Fagotte komponiertes Konzert, betitelt: Porco primo, porco secondo usw. Er hielt sich den Bauch dabei vor Lachen. Auch der Kronprinz Friedrich wollte einmal dieses Konzert hören, und um den Komponisten zu verspotten lud er eine große Gesellschaft dazu ein. Pepusch wollte ausweichen, mußte sich aber dem Willen des Prinzen fügen. Er kam nicht mit sechs, sondern mit sieben Hoboisten, legte die Noten auf die Pulte und schaute ganz ernsthaft im Saal herum. Der Kronprinz trat auf ihn zu und fragte: »Herr Kapellmeister, sucht Er etwas?« Pepusch antwortete, es fehle ihm noch ein Pult. »Ich dachte,« versetzte Friedrich lächelnd, »es seien nur sechs Schweine in seiner Musik?« – »Ganz recht, königliche Hoheit,« gab Pepusch zurück, »aber es ist da noch ein Ferkelchen gekommen, flauto solo.« Und Friedrich, der Flötenspieler, war angeführt.
Was der große Kurfürst begonnen hatte, vollendete Friedrich Wilhelm mit der Niederbeugung des Adels; er setzte die Besteuerung durch. Als der Graf Alexander Dohna, Marschall der Stände Preußens, in seinem Bericht an den König die Phrase gebracht hatte: Tout les pays seront ruinés, schrieb Friedrich Wilhelm die denkwürdigen, unsterblich gewordenen Worte: »les pays seront ruinés? Nihil credo, aber das credo, daß die Junkers ihre Autorität wird ruiniert werden. Ich stabiliere die Suveränität wie einen rocher von Bronze.« Friedrich Wilhelms Herz neigte sich mehr zu den Bürgern als zu den Junkern. Wenn er einmal äußerte, daß er ein wahrer Republikaner sei, so verstand er eigentlich seine bürgerliche Gesinnung darunter. Er liebte es, mit dem Volke unmittelbar zu verkehren, und besuchte Gastmähler und Hochzeiten, auch richtete er sich in Berlin und Potsdam ganz einfach bürgerlich ein, wie ein guter deutscher Haushalter. Fleißige Handwerker und reinliche Hausfrauen belobte er sehr. Mit der Reinlichkeit konnte er auch an seinem ganzen Körper nicht genug tun; ferner war er äußerst wahrheitsliebend. In der Instruktion für die Räte seines Generaldirektoriums schrieb er: »Wir wollen die flatterien durchaus nicht haben, sondern man soll Uns allemal nur die reine Wahrheit sagen.« Aber er war ein sehr gewalttätiger Herr und König, im Zorne wild und furchtbar. Friedrich der Große und seine Schwester hatten ihm den Spitznamen le ragotin gegeben. Zuletzt war er so dick geworden, daß seine Weste fast vier Ellen weit war.
Er forderte unbedingten Gehorsam ohne Widerspruch. Die Universität Halle stellte einmal beweglich vor, daß ein Studiosus von einigen Soldaten des Abends auf der Straße angefallen und zum Tor hinausgeführt worden sei. Der Bescheid des Königs lautete: »Soll nicht räsonieren! Ist mein Untertan.«
Er wollte in seinem Lande nur gute Christen, fleißige Bürger und tapfere Soldaten haben. Voltaire nannte ihn den Vandalen; aber alle seine Strenge und Härte entschuldigte Friedrich Wilhelm mit der Pflicht, und öfters äußerte er: Ich bin nur der erste Diener des Staates; und den Staat regierte er nach seiner eigentümlichen Weise mit Gewalt, um ihn zu beglücken. Dabei war er gewissenhaft; einmal hatte er in Stettin einen Beamten durch den Henker prügeln lassen, kurz darauf stellte sich die Unschuld des Mannes heraus, da ließ er ihn an seiner Tafel speisen, um ihm eine öffentliche Genugtuung zu geben. Er glaubte, immer gerecht zu handeln, doch handelte er nur in dem gerecht, was er selbst für Recht erkannte. Er war religiös, aber nur in dem, was er bei sich selbst als Religion gelten ließ; es war eine Religion ganz nach eigenem Rezept. Bisweilen war er ernstlich gesonnen, abzudanken, weil er glaubte, seine Pflicht nicht gehörig erfüllen zu können. Er hielt sich in der genauen Bedeutung des Wortes für einen Knecht Gottes. So wenig er das Alte Testament achtete, seine Gesetze waren wie die des Alten Testaments. Aus königlicher Machtvollkommenheit kassierte und annullierte er die Urteile der Richter und verschärfte sie weit öfter als er sie milderte. Da galt kein Ansehen der Person. Ein Kriegs- und Domänenrat von Schlubhut in Königsberg hatte Gelder unterschlagen, die für die Salzburger Emigranten bestimmt gewesen waren, und das Gericht erkannte auf einige Jahre Festung. Der König wollte das Urteil nicht bestätigen, verschob den Spruch bis zu seiner Reise nach Königsberg, befahl den Kriegsrat vor sich und kündigte ihm an, daß er ihn hängen lassen werde. Schlubhut erwiderte frech, das sei nicht Manier, so mit einem preußischen Edelmann zu verfahren, er werde die fehlende Summe ersetzen. Der König geriet in den höchsten Zorn und schrie: »Ich will dein schelmisches Geld nicht haben.« Darauf ließ er einen Galgen vor dem Sessionszimmer der Kriegs- und Domänenkammer errichten und vor den Augen der versammelten Räte Schlubhut daran aufknüpfen.
Er haßte die Juristen und hätte sie gerne alle vertilgt, besonders die Advokaten. Auf dem Lande durfte kein Advokat wohnen, damit die Bauern nicht prozeßsüchtig würden. Als er an die Stände Preußens das Verbot erließ, sich aller Beschwerden und Mahnungen und der Hinweisung auf alte Verheißungen zu enthalten, wagten die Stände einzuwenden, Gott, der allmächtige Vater, gestatte doch auch, daß man ihm Beschwerden vortrage, und bleibe nichtsdestoweniger allmächtig, mithin werde es Seine Majestät ebenfalls nicht ungnädig deuten. Aber Seine Majestät kehrte sich daran nicht, und in seinen Kabinettsbefehlen hieß es gewöhnlich: Wir sind Herr und König und tun, was Wir wollen.
In Reden und Schriften war er ausbündig derb. Die Ehrentitel Hundsfott, Kujon, Halunke schwebten beständig auf seinen Lippen. Auf Eingaben, die ihm nicht behagten, malte er Eselsköpfe und -ohren an den Rand, und in den Resolutionen, die er ausgehen ließ, hieß es fortwährend: Wenn das und das nicht geschieht, so werde Ich es scharf ansehen, man wird den König zum Feinde haben, so wird Lärm werden, so wird der Donner dreinschlagen, eh man es sich vermutet. Wenn ein Minister zu spät in die Sitzungen kam, mußte er hundert Dukaten Strafe zahlen. »Die Herrn sollen arbeiten, wofür Wir sie bezahlen,« sagte der König. Einer seiner Kammerdiener sollte ihm einmal den Abendsegen vorlesen. Als die Worte kamen: Der Herr segne dich, glaubte der einfältige Mensch in seiner Unterwürfigkeit »der Herr segne Sie« lesen zu müssen. Da fuhr ihn der König an: »Hundsfott, lies, was dasteht, vor dem lieben Gott bin Ich genau so ein Hundsfott wie du.« Die Bedienten waren allerdings ihres Lebens nicht sicher; er hatte stets zwei mit Salz geladne Pistolen neben sich liegen, und wenn sie etwas versahen, feuerte er die Pistolen auf sie ab.
Seine Sparsamkeit war so pedantisch, daß er sich alle Küchenzettel vorlegen ließ und an den geringfügigsten Ausgaben mäkelte. Die Zettel mußten bis auf jede Zitrone und auf jede Mandel Eier spezifiziert sein, und einmal schrieb er darunter: Ein Taler zu viel. Auf die Eingaben um Geldbewilligung schrieb er zumeist: Non habeo pecunia, oder: point d’argent, oder: Narrenspossen, Narrenspossen! Sogar auf die Papierersparnis richtete er sein Augenmerk; auf den Rand eines Berichts des Kammerkollegiums schrieb er: Der Quark ist das schöne Papier nicht wert, sollen schlecht Papier nehmen, das ist Mir genug.
Bei alledem konnte er auch freigebig sein. Für den Hofstaat der Königin hatte er achtzigtausend Taler ausgesetzt, viel mehr, als die erste Königin gehabt. In ihrem Kabinett war sämtliches Gerät von Gold, Kron-, Wand- und Armleuchter, Geridone und Tafeln. Einmal schenkte er ihr zu Weihnachten eine goldene Brandrute für den Kamin, die sechzehnhundert Taler kostete.
Er war ein rastlos tätiger Mann, kein Hauch von Phlegma war in ihm. »Der König,« schreibt Seckendorf im Juni 1726, »kann allem menschlichen Ansehen nach unmöglich in die Länge die Art zu leben kontinuieren, ohne an Gemüt und Leib zu leiden, maßen der Herr vom frühen Morgen bis in die späte Nacht in kontinuierlichem mouvement ist, bei sehr früher Tagesstunde das Gemüt mit verschiedenen und differenten Materien, Resolutionen und Arbeiten angreifet, hernach den ganzen Tag mit Reiten, Fahren, Gehen und Stehen sich unglaublich fatigiert, mit starkem Essen und ziemlichem, doch nicht bis zur debauche kommenden starken Getränke sich erhitzet, wenig und dabei sehr unruhig schläft, folglich sein ohnedem vehementes Naturell dermaßen echauffiert, daß mit der Zeit üble Folgen daraus entstehen dürften.«
Es kam vor, daß Friedrich Wilhelm irgendeinen faulenzenden Berliner Eckensteher mit eigenen Händen durchprügelte. Ein andres Mal prügelte er einen verschlafenen Torschreiber, der die Bauern vor dem Tor warten ließ, mit den Worten: »Guten Morgen, Herr Torschreiber« aus dem Bette. Recht mißlich war es, ihm zu begegnen. Wer ihm auffiel, an den ritt er so nahe heran, daß der Kopf des Pferdes dem Manne an die Brust stieß, und dann begann das Verhör. Sah er einen französischen Prediger, so fragte er jedesmal, ob sie Molière gelesen hatten, um ihnen damit anzudeuten, daß er sie für Komödianten halte. Am schlechtesten erging es denen, die vor ihm die Flucht ergriffen; einmal verfolgte er einen Juden, der Reißaus genommen hatte, und als er ihn gestellt hatte, sagte der Jude, er habe sich gefürchtet. Da prügelte ihn der König mit seinem Stock und schrie dabei in einemfort: »Lieben sollt ihr mich, lieben und nicht fürchten.«
So orthodox Friedrich Wilhelm auch war, erklärte er sich doch mit allem Nachdruck für die Toleranz. Er duldete alle Religionsparteien, nur die Jesuiten waren ihm zuwider, »die Vögels, die dem Satan Raum geben und sein Reich vermehren wollen«. Schon im Anfang seiner Regierung erließ er ein Edikt, worin er den lutherischen und reformierten Religionsverwandten gebot, aller Schmähungen sich zu enthalten und friedlich miteinander zu verkehren. Den lebhaftesten Anteil nahm er an dem Schicksal der Salzburger Emigranten. Er schickte nicht nur Kommissäre zu den Salzburger Bauern, um sie einzuladen, sich in seinen Staaten niederzulassen, sondern griff auch, um den Erzbischof Firmian von weiterer Verfolgung abzuschrecken, zu Repressalien gegen die Katholiken im Bistum Halberstadt und drohte die Einkünfte der Klöster in Beschlag zu nehmen. Zwanzigtausend Salzburger fanden damals in Preußen Zuflucht; als der erste Zug eintraf, begrüßte ihn der König selbst am Leipziger Tor und hieß die armen Leute als seine lieben Landeskinder willkommen; von der Königin wurden sie in Monbijou bewirtet.
Um das Jahr 1727 verfiel Friedrich Wilhelm in eine tiefe religiöse Schwermut. Er sprach unaufhörlich davon, daß er die Krone niederlegen und sich in den Haag zurückziehen wollte, wo ihm aus der Erbschaft Wilhelms des Dritten das Lustschloß Honslardik zugefallen war. Es war August Hermann Franke, der einen solchen Einfluß auf das Gemüt des Königs gewonnen hatte. Die Markgräfin von Baireuth schreibt: »Dieser Geistliche machte die unschuldigsten Dinge zur Gewissenssache, er verwarf alle Vergnügungen als verdammlich, selbst die Musik und die Jagd, man sollte nur vom Worte Gottes sprechen, alles andre war verboten.« Grumbkow und Seckendorf legten dem König immer wieder die Hindernisse dar, die sich seiner Abdankung entgegensetzten, und wie er einen solchen Schritt später bereuen würde. Aber der König versank nur noch tiefer in seine Grübeleien, und man durfte in seiner Nähe nicht mehr lachen. Da nun alle Worte vergeblich waren, verfielen Grumbkow und Seckendorf auf ein anderes Mittel. Sie überredeten den König, dem sächsischen Hof einen Besuch abzustatten, der damals der glänzendste in Deutschland war. Politische Gründe bestimmten Friedrich Wilhelm, den Vorschlag anzunehmen. Sobald er nach Dresden kam, wurde er von Fest zu Fest fortgerissen, die Freuden der Tafel wurden nicht vergessen, der Ungarwein nicht gespart, und die Freundschaft der beiden Könige war die innigste. Eines Tages, als man weidlich geschmaust hatte, führte der König von Polen seinen Gastfreund im Domino auf eine Redute. Immerfort schwatzend, gingen sie von einem Zimmer in das andere, wobei die Hofleute und der Kronprinz Friedrich folgten. Endlich gelangten sie in einen schön verzierten Raum, und während Friedrich Wilhelm das prächtige Gerät bewunderte, sank eine Tapetenwand nieder, und ein seltsames Schauspiel bot sich den Blicken dar. Ein Mädchen von vollendeter Schönheit lag nachlässig auf einem Ruhebette, nackt wie sie Gott erschaffen, mit einem Körper wie die mediceische Venus. Das Kabinett, worin sie sich befand, war von so vielen Kerzen erhellt, daß sie das Tageslicht überstrahlten. Der König von Polen sowohl als Grumbkow glaubten, daß Friedrich Wilhelm einer solchen Verlockung nicht werde widerstehen können; allein es kam anders. Bei dem ersten Blick nahm Friedrich Wilhelm seinen Hut, hielt ihn dem Kronprinzen vor das Gesicht und befahl ihm, sich zu entfernen. Er selbst wandte sich zum König von Polen, sagte trocken: »Sie ist recht schön,« und ging fort. An Seckendorf schrieb er ein paar Tage später: »Ich gehe zu kommendem Mittwoche nach Hause, fatigieret von allen guten Tagen und Wohlleben; ist gewiß nit christlich leben hier, aber Gott ist Mein Zeuge, daß Ich kein Pläsier daran gefunden und noch so rein bin als Ich von Hause hergekommen und mit Gottes Hilfe beharren werde bis an Mein Ende.«
Schon im Winter 1735 hatte der König an der Wassersucht gelitten, und sein Leben war in großer Gefahr gewesen. In dem strengen Winter des Jahres 1740 erkrankte er von neuem. Er ließ den lutherischen Propst Roloff kommen, der ihn zum Tod vorbereiten sollte. Er verzieh allen seinen Feinden, schließlich sogar seinem Schwager, dem König von England, der ihm doch, wie er sagte, alles gebrannte Herzeleid angetan habe. Er bereute seine Sünden und zählte sie in Gegenwart vieler Umstehenden so ausführlich auf, daß Roloff ihn bitten mußte, es zu unterlassen. Worauf Roloff drang, war Sinnesänderung, dazu aber war der Herr lange nicht zu bewegen. Er führte auf, daß er die Geistlichkeit immer respektiert, Gottes Wort immer fleißig gehört habe und seiner Frau immer unverbrüchlich treu gewesen sei; er behauptete, immer recht gehandelt und alles zu Gottes Ehre getan zu haben. Roloff widersprach dem und erinnerte ihn an die Verschärfungen der Todesurteile, an die ungerechten Hinrichtungen, an das erzwungene Häuserbauen in Berlin, zur großen Bedrückung seiner Untertanen, und des Königs Verantwortung wollte er als vor Gott genügend nicht gelten lassen. Da sagte der König: »Er schont Meiner nicht. Er spricht als ein guter Geist und ein ehrlicher Mann mit Mir. Ich danke ihm dafür und erkenne nun, daß ich ein großer Sünder bin.« Im April 1740 konnte er noch nach seinem geliebten Potsdam fahren; er gab Anordnungen für sein Leichenbegängnis, bei dem das Leibregiment feuern sollte. Mitten in seinen Schmerzen ließ er sich das Lied vorsingen: Warum sollt ich mich doch grämen? Als die Stelle kam: Nackend werd auch ich hinziehen, unterbrach er die Sänger mit den Worten: »Nein, das ist erlogen, ich will in der Montur begraben sein.« Bescheiden stellte ihm der Feldprediger vor, daß es dort oben keine Soldaten gäbe; da rief der König: »Was? Sapperment! Wieso?« Und er schien nun sehr niedergeschlagen.
Am Sterbetage, den 31. Mai, nahm er Abschied von seiner Frau, seinen Söhnen, allen Ministern, Beamten und Offizieren. Er ließ sich ans Fenster rücken, von wo er den Marstall überblicken konnte, und befahl, daß man die Pferde herausführe, denn er wollte dem Fürsten von Dessau und dem General Haake noch ein Pferd schenken. Als ihm sein Leibarzt auf die Frage, wie lange er noch zu leben habe, antwortete, ungefähr eine halbe Stunde, forderte er einen Spiegel, schaute hinein und sagte lächelnd: »Ich bin recht verändert, ich werde beim Sterben ein garstiges Gesicht machen.« Später wiederholte er die Frage an den Arzt. Der Leibmedikus befühlte ihm den Puls, zuckte die Achseln und sagte: »Er steht still.« Da hob der König seinen Arm, schüttelte die Faust und rief: »Er soll nicht stillstehen.«
Friedrich Wilhelm starb im zweiundfünfzigsten Jahre seines Alters; er starb, wie Friedrich der Große an Voltaire schrieb, mit der Neugierde eines Naturforschers, der beobachten will, was im Augenblick des Hinscheidens geschieht, und mit dem Heldenmute eines großen Mannes. Er ward in Potsdam begraben. Bei der Leichenfeier wurden die von ihm selbst ausgewählten Lieder gesungen und beim Trauermahl zwei von ihm eigens dazu bestimmte Eimer alten Rheinweins ausgetrunken.
Als Sohn eines Brauers und Branntweinbrenners wurde Joachim Nettelbeck am 20. September 1738 zu Kolberg geboren. Seine Mutter war aus dem Geschlecht des Schiffers Blanken; seines Vaters Bruder war ebenfalls Schiffer. Seine größte Kinderfreude bestand darin, auf Schiffen herumzuspringen, und sobald er lallen konnte, war sein Sinn auf die Schifferei gestellt. Sein Hang war so groß, daß er aus jedem Span, aus jedem Stück Baumrinde, das ihm in die Hände fiel, kleine Schiffe schnitzelte, sie mit Segeln von Federn oder Papier ausrüstete und damit auf Rinnsteinen und Teichen oder auf der Persante hantierte. Kein größeres Vergnügen gab es für ihn, als wenn seines Onkels Schiff im Hafen lag; da hatte er zu Hause keine Ruhe und bat immerfort, man möchte ihn nach der Münde lassen.
Nicht geringere Liebe zeigte er zum Gartenwesen. Sein Großvater war ein großer Gartenfreund, nahm ihn oft in seinen Garten mit und schenkte ihm sogar ein Fleckchen Land. Da legte er Obstkerne, pflanzte, verpfropfte und okulierte.
 |
| Joachim Nettelbeck, |
| nach einer Zeichnung von Ludwig Heine. |
Er mochte etwa sechs Jahre alt sein, da entstand eine Hungersnot im Lande. Es kamen viele arme Leute nach Kolberg, um Korn zu holen, weil man Getreideschiffe im Hafen erwartete. Als endlich ein Schiff mit Roggen auf der Reede anlangte, stieß es gegen den Hafendamm und sank in den Grund. Um es wieder emporzuwinden wurden zwei Schiffe benutzt, deren eines von seinem Onkel geführt wurde, und der Knabe war beständig zugegen. Das Fahrzeug wurde gehoben, doch das Korn war durchnäßt; bald waren alle Straßen mit Laken und Schürzen überdeckt, auf denen das Getreide der Luft und Sonne ausgesetzt wurde. Endlich kam ein zweites Kornschiff, und es konnte der Not gesteuert werden.
Im nächsten Jahre schickte der Große Friedrich von Preußen eine Wagenladung mit Kartoffeln nach Kolberg. Diese Früchte waren aber damals noch völlig unbekannt, und die Bürger berieten hin und her, was wohl damit anzufangen sei. Sie warfen sie den Hunden vor, die sie beschnupperten und verschmähten. Was sollen uns die Dinger? hieß es; sie riechen nicht, sie schmecken nicht, und nicht einmal die Hunde mögen sie fressen. Man glaubte, sie wüchsen auf den Bäumen und man müsse sie herunterschütteln wie die Äpfel. Alles dieses ward auf dem Markte, vor seiner Eltern Tür, verhandelt. Erst als der König im andern Jahr eine zweite Sendung von einem Landreiter begleiten ließ, der des Kartoffelbaues kundig war, gewann die neue Frucht das Wohlwollen der Bürger.
Der Knabe war auch ein großer Liebhaber von Tauben, und er sparte sich von seinem Frühstücksgeld so viel ab, daß er sich ein paar Tauben kaufen konnte. Seine Spielereien hielten ihn vom Lernen und von der Schule ab, und erst die dringenden Ermahnungen seines Paten weckten seinen Ehrgeiz. In seinem achten Jahre schenkte ihm der Pate zu Weihnachten eine Anweisung zur Steuermannskunst, und bald ging sein Eifer für diese Sache soweit, daß er oft im Winter bei strenger Kälte des Nachts, wenn klarer Himmel war, heimlich auf den Wall ging und mit seinen Instrumenten die Entfernung der Sterne vom Horizont oder vom Zenit maß und danach die Polhöhe berechnete. Kam er des Morgens erfroren nach Hause, so verwunderte sich alles, erklärte ihn für einen überstudierten Narren, und der Vater schlug ihn.
Da ein Seemann sich auf die Kletterkunst gut verstehen mußte, übte er sich in Gemeinschaft mit dem Sohn des Glöckners im Balkenwerk der großen Kirche in dieser Fertigkeit. Sie krochen überall herum, und oft verirrten sie sich in der gewaltigen Verzimmerung dergestalt, daß einer vom andern nichts mehr wußte, und wenn sie wieder zusammenkamen, war des Erzählens kein Ende, wo sie gewesen waren und was sie gesehen hatten. In dem inwendigen Holzverband krochen sie auch bis zur Spitze des Turmes hinauf, bis sie sich in dem beengten Raum nicht mehr rühren konnten. Diese Gewandtheit und Ortskenntnis kam ihm viele Jahre später wohl zustatten, als ein Wetterstrahl im Turm gezündet hatte und das Feuer gelöscht werden mußte.
Als er elf Jahre alt war, nahm ihn sein Onkel als Kajütenwächter mit auf sein Schiff, und seine erste Fahrt ging nach Amsterdam. Dort sah er die großen Indienfahrer und verspürte eine unbezwingliche Sehnsucht, auf einem solchen Schiff zu dienen. Bei Nacht und Nebel floh er auf einer Jolle, betrat eines der Schiffe, das er sonderlich ins Auge gefaßt, und wurde nach vielen Verhandlungen als Seemannsjunge geheuert. Das Schiff war für den Sklavenhandel nach Guinea bestimmt. Einundzwanzig Monate später kam er nach Amsterdam zurück, schrieb an seine Eltern, die, froh erstaunt, ihn noch am Leben zu wissen, ihn nach Kolberg riefen; dort blieb er nun bis zu seinem vierzehnten Jahr. Länger vermochte er aber seinem Abenteuer- und Tätigkeitstrieb nicht zu widerstehen: er entfloh neuerdings und verdingte sich auf einem Schiff, das nach Surinam bestimmt war. Auf der Heimfahrt fiel der Steuermann über Bord und ertrank, und Nettelbeck wurde zum Untersteuermann gemacht.
Im Jahre 1756 nahm er Dienst bei seinem Oheim, der eine Schiffsladung mit Holz von Rügenwalde nach Lissabon zu bringen hatte. Sein jüngerer Bruder, ein Knabe von vierzehn Jahren, und des Oheims junger Sohn waren ebenfalls auf dem Schiffe bedienstet. Sie erlitten an der flandrischen Küste Schiffbruch und wurden von österreichischen Soldaten gerettet. Der Oheim hatte aber eine tödliche Verletzung erlitten und starb in einem Kloster, wohin man ihn in Eile transportiert hatte. Als Ketzer und Preußen verdächtigt und gemieden, mußten sich die drei jungen Burschen durch das feindliche Land schlagen, und erst nach schrecklichen Mühsalen gelangten sie wieder nach Kolberg. Kaum hatte sich Nettelbeck von der überstandenen schweren Zeit erholt, so brach der Krieg aus, und die Werber des Königs kamen in die Stadt, um alle jungen Leute zum Soldatenstand zu pressen. Es war eine wahre Hetzjagd, der Schrecken für alle Eltern jener Zeit und für alles junge Volk, das eine Flinte schleppen konnte und nicht mochte.
Die entschiedene Abneigung des Bürgers gegen den Soldatenstand hatte ihre Rechtfertigung in der unmenschlichen Art, womit die jungen Leute von den Unteroffizieren behandelt wurden; so sagt Nettelbeck selbst, und er fügt hinzu: unter den Fenstern der Eltern wurden sie von den rohen Menschen aufs Grausamste mißhandelt, und es war ein kläglicher Anblick, wenn bei solchen Auftritten die Mütter in Haufen daneben standen, weinten und schrien und von den rauhen Barbaren abgeführt wurden.
Nettelbeck ergriff die Flucht. Bei Nacht, in Sturm und Schneegestöber wanderte er zu einem Bauern, welcher ihm genannt worden war, und mußte sich im Stadtholz eines Rudels Wölfe erwehren. Endlich erreichte er die Freistatt, hielt sich zwölf Tage dort verborgen, aber er ertrug es nicht, untätig zu sitzen, und er begab sich wieder nach der Münde. Eines Nachts erweckte ihn ein Klopfen an den Fensterladen des Kämmerchens, wo er schlief, und die bekannte Stimme einer getreuen Frauensperson rief ihm zu: »Joachim, auf! auf aus den Federn! Die Soldaten sind wieder auf der Münde!« In der Bestürzung griff er nach einem Bund Kleider, stahl sich im Hemd auf die Straße und bemerkte, als er sich anziehen wollte, daß er Frauenkleider mitgenommen hatte. Er warf einen roten Friesrock über die Schultern, da wurde er von den Soldaten gestört, er rannte zum Hafen, sprang in ein Boot und ruderte hinaus. Jenseits ging er an Land, wanderte so gut als nackend in der bitterkalten Märznacht vor mehrere Türen, wurde jedesmal abgewiesen und flüchtete endlich in einen alten Schiffsrumpf, der im Sommer als Bierschank benutzt wurde. Er kletterte in das Rauchfangloch und duckte sich vor der Kälte in einen Winkel zusammen. Am Morgen suchte er sein verlassenes Boot wieder auf und ruderte sich zu einem Schiffe heran, das einem Königsberger Schiffer gehörte. Der Mann nahm ihn auf und hielt ihn lange bei sich verborgen. Zwei Wochen später fuhr er mit einem anderen Schiffer nach Danzig, und dort wurde er Steuermann auf einer kleinen Jacht, die eine Ladung Hanf nach Westschottland bringen sollte. Die Schiffahrt in den Gewässern der Hebriden war der Klippen und starken Strömungen wegen sehr gefährlich, das Schiff irrte lange herum, geriet im Kanal mit sieben englischen Kapern zusammen, und alle diese Schnapphähne, so nennt sie Nettelbeck, stiegen an Bord seines Schiffes und nahmen mit, was nicht niet- und nagelfest war, Kessel und Pfannen, Tauwerk und Segel, Karten und Kompaß. Die Aufregung und das beständige Elend machten Nettelbeck krank. Er mußte in Metemblick zurückbleiben und begab sich zu einem Kompaßmacher in die Lehre; was er von ihm lernte, war ihm in der Folge von großem Nutzen.
Bald darauf rief ihn sein Vater nach Kolberg zurück, und er war noch nicht vier Wochen in der Heimat, so begann die Belagerung Kolbergs durch die Russen. Durch die Entschlossenheit der Bürgerwehr blieben die feindlichen Anstrengungen fruchtlos, und nachdem die Russen eine Menge Pulver unnütz verschossen hatten, mußten sie wieder abziehen. Nettelbeck begab sich nach Amsterdam, traf dort mit seinem alten Kapitän Blanken zusammen und fuhr mit ihm neuerdings nach Surinam; von dort heimgekehrt, hielt es ihn wieder nicht lange, und er fuhr mit einem andern Schiff nach Sankt Eustaz. Als er dann in seine Vaterstadt zurückgekehrt war, wurde diese zum zweitenmal von den Russen belagert, aber der Notstand dauerte nur drei Wochen. Während der Zeit des Siebenjährigen Krieges blieb den preußischen Schiffern, wenn sie Erwerb finden wollten, kaum etwas anderes übrig, als unter der neutralen Danziger Flagge zu fahren. In solcher Weise ging Nettelbeck von Danzig nach Königsberg und von Königsberg mit einem Getreideschiff nach Amsterdam.
Es ist nicht erforderlich, alle diese Fahrten und die späteren im einzelnen zu verfolgen; diese Begegnungen mit Freund und Feind, dieses Hin und Her in allen Zonen der Erde, diese Kämpfe mit allen Gefahren und allen Elementen. Sie bilden ein Leben voll beständiger Unruhe und beständiger Tätigkeit. Die Kaufleute im fremden Land sind listig und verschlagen; ihrer Tücke Herr zu werden, gegen ihre Vorteilssucht nicht des eignen Vorteils verlustig zu gehen, verlangt viel Klugheit, ja beinahe Weisheit und unendliche Selbstverleugnung. Immer wieder Stürme, immer wieder Schiffbruch; kaum ist ein kümmerlicher Verdienst in Sicherheit gebracht, so geht er durch Wagnis oder Unglück wieder verloren. Bei einer Fahrt in der Nordsee wird der Kapitän wahnsinnig und trifft Verfügungen, die den Untergang des Schiffes herbeiführen müssen. Eines Morgens stürzt er vom Steuer in die See und ertrinkt. Nettelbeck nimmt ein Verzeichnis seiner Habseligkeiten auf, versiegelt die eingepackten Waren und wirft vor den Augen der Matrosen das hierzu gebrauchte Petschaft ins Meer. Zu seiner Verwunderung kann er nirgends die Gelder und Barschaften des verunglückten Schiffers finden, die Taschenuhr, die silbernen Schuh- und Knieschnallen, die goldenen und silbernen Galanteriewaren nicht, die er vordem bei ihm gesehen. Als er mit dem Schiff in den Hafen gelangt, taucht trotz eidlicher Erhärtung der Verdacht auf, daß er das Gut des Schiffers veruntreut habe. Lästerung und Verleumdung heftet sich an seine Fersen, und der Kummer, den er darüber empfindet, raubt ihm allen Mut. Erst viele Jahre später wurde das Eigentum des toten Schiffers zufällig in einem Verschlag der Kajüte entdeckt, die Witwe und die Verwandten leisteten Nettelbeck Abbitte, und die ihn geschmäht und bezichtigt hatten, erhoben ihn in den Himmel, aber man muß nicht eben Nettelbeck sein, um den von Zufalls Gnaden gereinigten Schild der Ehre mit bitterem Gefühle zu betrachten. Allmählich reifte er in der Schule des Lebens zur Resignation heran; doch seine Kraft, zu handeln, seine wunderbare Kraft, zu helfen, erlahmte dabei mitnichten. Während des großen Brandes in Königsberg rettete er auf einem Boote viele Menschen vor dem sicheren und schrecklichen Tod. Einige Zeit nachher geriet auf dem Pregel ein holländisches Schiff in Brand. Alle Menschen, so viel deren herbeigekommen, waren damit beschäftigt, Löcher in das Verdeck zu hauen, um von oben Wasser in den brennenden Raum zu gießen. Dadurch gewann aber das Feuer nur um so größeren Zug, und Nettelbeck, der ein so widersinniges Verfahren nicht gelassen mit anschauen konnte, schrie ihnen zu, sie arbeiteten sich ja zum Unglück, sie müßten das Schiff versenken. Es lief aber alles verwirrt durcheinander, und niemand wollte auf ihn hören. Da griff er einen von seinen Zimmerleuten auf, sprang mit ihm in das Boot, das zum brennenden Schiff gehörte, und zeigte ihm eine Planke dicht über dem Wasser, wo er ein Loch ins Schiff hauen sollte. Das lasse er wohl bleiben, war die Antwort des Mannes, da könne er schlimmen Lohn dafür haben. Nettelbeck riß ihm die Axt aus den Händen, schlug selber das Loch, eilte spornstreichs auf das Verdeck, wo sich Hunderte von Menschen drängten, und schrie: »Herunter vom Schiff, was nicht ersaufen will, in der Minute wird’s sinken.« Und das Schiff sank. Die holländischen Kaufleute aber verklagten ihn bei der Admiralität und forderten von ihm den vollen Ersatz des Schadens. Er wurde vor das Kollegium zitiert und sollte sich verantworten.
Seine Rede war die: »Tausend Augen haben es mit angesehen, wie das Schiff in hellem Feuer stand. Hätte das nur noch eine halbe Viertelstunde so gedauert, so nahm die Flamme dergestalt überhand, daß es kein Mensch auf dem Schiff aushalten konnte und es mitsamt der Ladung preisgegeben werden mußte. Und wie sollte es dann fehlen, daß nicht die Taue mit verbrannten, die es am Bollwerk hielten; daß die flammende Masse stromabwärts und unter die vielen andern Schiffe trieb und diese mit ins Verderben zog? Jetzt ist großes und gewisses Unglück mit um so geringerem Schaden abgewandt, als Schiff und Ladung wohl wieder zu bergen sein werden. Ich bin daher auch des guten Glaubens, daß ich in keiner Weise strafbar gehandelt, sondern nur meine Bürgerpflicht erfüllt habe.«
Die Sentenz lautete, daß der Schiffer Nettelbeck vollkommen recht und löblich gehandelt habe und das Kollegium sich vorbehalte, ihm seine Zufriedenheit und Dankbarkeit durch feierlichen Handschlag zu bezeugen. Der Kollegiumsdirektor stand von seinem Sitze auf, schüttelte ihm treuherzig die Hand, dankte ihm im Namen aller Schiffer und im Namen der Stadt und hieß ihn einen wackeren Mann. Kaufleute, Schiffer und Advokat sahen einander verlegen an, dann traten sie einer nach dem andern zu ihm und gaben ihm ebenfalls die Hand. Der Direktor fragte ihn zum Schluß, ob er nicht, wie er im vorigen Jahr mit dem Bording der Witwe Rollof getan, das versunkene Schiff aus dem Wasser zu heben versuchen wolle. Und Nettelbeck sagte zu. Die Hebung gelang unter großen Schwierigkeiten, und da er von den holländischen Kaufleuten außer dem Ersatz seiner Auslagen nichts annehmen wollte, machten sie ihm ein Geschenk von hundert preußischen Gulden samt zehn Pfund Kaffee und zwanzig Pfund Zucker. Er seinerseits schenkte davon fünfundzwanzig Gulden den Armen, damit sie auch einmal einen guten Tag haben sollten.
Es war das Sonderbare seines Geschicks, daß es ihn immer wieder zwang, gegen die Elemente in den Kampf zu treten und er dem Wasser wie dem Feuer gegenüber stets die gleiche streitbare Rolle spielt. Als er nach vielen und gefährlichen Reisen, nach vielen und ermüdenden Versuchen, da und dort seinen Lebensunterhalt zu erwerben, als beinahe Vierzigjähriger 1777 wieder in seiner Vaterstadt saß, schlug eines Tages im April der Blitz in den Kirchturm, und im Nu brannte der Turm lichterloh. Die helle Flamme spritzte bei der Wetterstange gleich einem feurigen Springbrunnen empor, aus den Schallöchern sprühten die Funken wie Schneeflocken und fielen bereits in die Domstraße hinüber. Nettelbeck, dies sehend, rannte nach der Kirche und die Turmtreppe hinan. Im Hinaufsteigen überdachte er, wie groß das Unglück werden müsse, da es wohl schwerlich jemand unternehmen werde, bis in die höchste Spitze zu klimmen, wo er in den finstern Winkeln nicht so bekannt sei wie er selbst, der sie in seiner frühen Jugend oft mit Lebensgefahr durchkrochen hatte. Er wußte, daß auf dem Glockenboden stets Wasser und Löscheimer bereitstanden, aber an einer Handspritze, die hauptsächlich nottat, mochte es fehlen. Er machte auf der Stelle kehrt, drängte sich an den vielen Menschen vorüber, die alle hinauf wollten, eilte ins nächste Haus, dann ins zweite und ins dritte, bis er endlich eine Spritze bekam. Jetzt wieder, die Angst und der Eifer gaben ihm Flügel, zum Turm hinauf. In der sogenannten Kunstpfeiferstube, dicht unter der Spitze, fand er mehrere Maurer und Zimmerleute mit ihren Meistern, aber keiner wußte, was zu tun sei. »Liebe Leute,« sprach er, unter sie tretend, »hier ist nichts zu beginnen, wir müssen höher hinauf.« – »Leicht gesagt, aber schwer getan,« antwortete einer, »wir haben es schon versucht, doch es geht nicht. Sobald wir die Falltür über uns haben, fällt ein Regen von Flammen und glühenden Kohlen herunter und setzt auch hier die Zimmerung in Brand.« Nettelbeck aber ließ sich die Falltür öffnen, stieg hindurch, gebot, daß man ihm einen Eimer und die Spritze reiche und die Falltür wieder schließe, denn das Feuer durfte von unten keinen Zug bekommen. Er mußte sich den Kopf mit Wasser aus dem Eimer anfeuchten, damit seine Haare nicht in Brand gerieten, und um die Hände frei zu bekommen, schnitt er vorn in seinen Rock ein Loch, durch das er die Spritze steckte. Den Bügel des Eimers nahm er in den Mund und zwischen die Zähne; so klomm er empor. Die Holzriegel im Innern des Turms mußten ihm als Leitersprossen dienen, allein wohin er griff, um sich emporzuhelfen, fand er alles voll glühender Kohlen, nur hatte er nicht Zeit, an den Schmerz zu denken. Endlich hatte er sich so hoch verstiegen, daß ihm in der engen Verzimmerung kein Raum blieb, sich noch weiter hinauf zu winden, und hier sah er den rechten Mittelpunkt des Feuers acht oder zehn Fuß über sich zischen und sprühen. Er klemmte den Wassereimer zwischen die Sparren fest, sog die Spritze daraus voll und richtete sie gegen den Feuerkern. Wasser, Feuer und Kohlen prasselten ihm ins Gesicht, aber das Feuer verminderte sich alsbald merklich. Nun war aber auch der Eimer geleert. Aus Leibeskräften schrie er nach Wasser; einer der Zimmermeister hob die Falltür und rief: »Wasser ist hier, aber wie bekommst du es hinauf?« Er sagte, sie sollten es ihm nur bis über den Glockenstuhl schaffen, da wolle er sichs schon selber langen. Jene wagten es, und er kletterte ihnen von Zeit zu Zeit entgegen, um die vollen Eimer in Empfang zu nehmen, von denen er dann auch so fleißigen Gebrauch machte, daß er endlich das Glück hatte, den Brand zu überwältigen und völlig zu löschen. Und es war hohe Zeit, mit jeder Minute wurde ihm übler: das zurückspritzende Wasser hatte ihn bis auf die Haut durchnäßt, und zugleich war eine unerträgliche Hitze im Turm. Er eilte hinunter, und in der schneidenden Luft bei den Schallöchern vergingen ihm die Sinne. Als er wieder zu sich kam, lag er auf dem Kirchhof, ihm zur Seite standen zwei Chirurgen, die ihm an beiden Armen die Adern geöffnet hatten, und eine Menge neugieriger Menschen schaute zu. Seine Hände waren überall verletzt, die Haare auf dem Kopf abgesengt, der Kopf selbst wund und voller Brandblasen; an diesen Stellen wuchsen die Haare nie wieder, und zwei Finger an der rechten Hand blieben ihm zeitlebens verkrüppelt.
Zehn Jahre lang befuhr er noch die Meere, von Danzig bis Lissabon, von Amsterdam bis Norwegen, von London bis Westindien; bald im eignen Interesse, das aber nie ein Gelingen bescherte, bald im Auftrag fremder Reeder. Seine Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit, soviel sie ihm auch Achtung und Sympathie erweckten, konnten ihm doch nicht zu großem Geld und Gut verhelfen. Und er war zu unruhig, zu leidenschaftlich und zu wenig kühler Rechner, um aus geringen Vorteilen mit der Zeit und viel Geduld bedeutende zu machen. Um das Jahr 1787 wurde er in Kolberg seßhaft, und seine Mitbürger erwiesen ihm die Ehre, ihn als Verwandten des Seglerhauses aufzunehmen, welches ein Kollegium war, vor dem alle Schiffahrtssachen in erster Instanz entschieden wurden. Auch ernannten sie ihn zum Schiffsvermesser, dessen Amt es war, die Tragkraft der Fahrzeuge zu berechnen, und wieviel Lasten sie laden und über See führen konnten. Es gab auch in Kolberg ein Kollegium, die Fünfzehnmänner geheißen, das die Gerechtsame der Bürgerschaft beim Magistrat zu vertreten hatte. In dieser Körperschaft waren große Mißstände bemerklich geworden; die Fünfzehnmänner hatten angefangen, ihr Ansehen mehr zu ihrem Privatnutzen als zum allgemeinen Besten geltend zu machen, und es war eine enge Verbrüderung daraus entstanden, die sich einander zu allerlei heimlichen Praktiken verhalf. Da waren Depositenkassen angegriffen, Scheinkäufe vorgenommen, Gemeingut widerrechtlich verschleudert und andere Greuel mehr begangen worden. Furchtlos trat Nettelbeck in den Sumpf und machte eine lange Reihe von Ungebührlichkeiten, Veruntreuungen und krummen Schlichen vor Gericht anhängig. Es kam darüber zu einem langen und verwickelten Prozeß, und keine Art von Ränken und Rabulistereien blieb gegen ihn unversucht. Beinahe vier Jahre lang schleppte sich der Rechtsstreit hin, und so wie er sich die Sache zu Herzen nahm, hatte er während der ganzen Zeit keine ruhige Stunde. Er gesteht, daß er oft mit Feuer und Schwert hätte dreinfahren mögen, wenn das heillose Gezücht immer ein neues Mäntelchen für seine aufgedeckte Bosheit zu erhaschen suchte. Endlich kam die unsaubere Geschichte doch zu einem leidlichen Schluß; das Kollegium wurde aufgelöst und durch ein anderes ersetzt, und man bewies ihm das Vertrauen, ihn in die Zahl der neuen Repräsentanten zu wählen.
Ergreifend sind die wenigen Seiten seiner von ihm selbst erzählten Lebensgeschichte, wo er von seinen häuslichen und ehelichen Verhältnissen erzählt und die Bemerkung macht, daß ihm als Ehemann und Vater sein besserer Glücksstern erst spät erschienen sei. Nur der Anschein war günstig, als er sich im Jahre 1762 in Königsberg zu heiraten entschloß. Er war ein flinker und lebenslustiger Bursche von vier- oder fünfundzwanzig Jahren, sein junges Weib war sechzehn, und solange er dort lebte und als Schiffer ab- und anfuhr, war die Ehe ganz glücklich. Von drei Kindern, die ihm die Frau gebar, blieb indessen nur ein Sohn am Leben, der ihn auf seinen letzten Seereisen als unzertrennlicher Gefährte begleitete. Nach siebenjähriger Ehe entdeckte er, daß ihn die Frau betrog; er verzieh ihr, aber sie zeigte sich unverbesserlich, da ließ er sich von ihr scheiden, und sie verkam im Elend. Der Sohn, den er sehr liebte, starb ihm in jungen Jahren, und er stand nun verlassen in der Welt und wußte nicht, für wen er sich’s noch sauer werden lassen sollte. Es fehlte am festen Kern im inneren Haushalt, und so wollte er es noch einmal mit der Ehe versuchen. Als Fünfzigjähriger warf er seine Augen auf eine Schifferswitwe in Stettin, die er als eine ordentliche und rechtliche Frau zu kennen glaubte. Die Verbindung kam zustande, aber nun erst gingen ihm die Augen auf. Die fromme Witwe hatte gern ihr Räuschchen und hielt es eifrig mit mancherlei andern Dingen, die den Ehefrieden stören mußten. An ein Zusammenhalten des ehrlich Erworbenen war länger nicht zu denken, vielmehr sah er den unvermeidlichen Untergang seines kleinen Wohlstands vor Augen, und was blieb ihm übrig, als eine abermalige Scheidung? Mit trüben Blicken schaute er in die Zukunft. Er gehörte keinem Menschen an, war nachgerade ein alter Mann geworden, und fühlte er gleich sein Herz noch frisch und seinen Geist lebendig, so wollten doch die stumpfgewordenen Knochen nicht mehr gut tun. Die paar Jahre, die noch übrig waren, dachte er wohl noch hinzustümpern, und wenn nur noch der Sarg ehrlich bezahlt werden konnte, mochte man ihn hintun, wo seine Väter schliefen. Jedoch das Geschick meinte es besser mit ihm. So klang- und trostlos sollte sein Leben nicht enden.
Das Jahr 1806 war herangekommen. Joachim Nettelbeck, dem feurigen Patrioten, der die alten Zeiten und des großen Friedrichs Taten noch im Sinn hatte, blutete gleich so vielen das Herz bei der Zeitung von den entsetzlichen Tagen bei Jena und Auerstädt und ihren Folgen. Er hätte kein Preuße und abtrünnig von König und Vaterland sein müssen, wenn ihm jetzt, wo alle Unglückswellen über sie zusammenschlugen, nicht so zu Sinn gewesen wäre, als müßte er Gut und Blut und die letzte Kraft seines Lebens für sie aufbieten. So lautet sein eigenes Geständnis; nicht mit Reden und Schreiben, dachte er, aber mit der Tat sei hier zu helfen; jeder auf seinem Posten, ohne sich erst lange, feig und klug, vor- und rückwärts umzusehen.
Als nun Magdeburg und Stettin gefallen waren und die ungestüme französische Windsbraut sich immer näher und drohender gegen die Weichsel heranzog, da ließ sich’s voraussehen, daß bald genug auch die Feste Kolberg an die Reihe kommen mochte, und wirklich erschien im November ein französischer Offizier als Parlamentär in der Stadt und forderte die Übergabe. Diese wurde zwar verweigert, allein mit allem, was zu einer rechtschaffenen Verteidigung gehörte, sah es trübselig aus. Wall und Graben waren verfallen, von Palisaden keine Spur. Nur drei Kanonen standen in einer Bastion auf Lafetten und dienten bloß zu Lärmschüssen, wenn Ausreißer von der Besatzung verfolgt werden sollten; alles übrige Geschütz lag am Boden, hoch von Gras überwachsen, und die dazu gehörigen Lafetten vermoderten in den Remisen. Die Besatzung war gering an Zahl, entmutigt durch die Unglücksbotschaften, und der Kommandant, Oberst von Loucadou, ein alter abgestumpfter Mann, der seit dem bayrischen Erbfolgekrieg den Ruf eines tüchtigen Offiziers genoß und dessen Geist so blind an altem Herkommen hing, daß er sich in der neuen Zeit und Welt nicht mehr zurechtfinden konnte. Während alles, was Militär hieß, den trägen Schlummer mit ihm zu teilen schien, fühlte sich die ganze Bürgerschaft von der lebhaftesten Unruhe und Besorgnis ergriffen, und Nettelbeck wurde als einer der ältesten Bürger ausgewählt, sich mit dem Kommandanten über die Maßregeln zur Verteidigung zu verständigen. Dem Obersten erschien dies anmaßend, und er wußte nicht oder wollte es nicht wissen, daß von ältester Zeit her die Bürger von Kolberg sich als die natürlichen und gesetzlich berufenen Verteidiger ihrer Wälle und Mauern betrachteten. Vormals hatte jeder seinen Bürgereid mit Ober- und Untergewehr geschworen, hatte geschworen, daß diese Armatur ihm eigen angehöre, geschworen, daß er die Festung verteidigen helfen wolle mit Gut und Blut. Die Bürgerschaft war in fünf Kompanien eingeteilt, mit einem Bürgermajor an der Spitze, und wo es im Ernst gegolten, hatte der Kommandant sie nach seiner Einsicht gebraucht und wesentlichen Nutzen von ihrem Dienst gezogen. Nettelbeck eröffnete dem Obersten, daß die Bürger mit Gott entschlossen seien, in diesen bedenklichen Zeitläuften mit dem Militär gleiche Last und Gefahr zu bestehen, daß sie sich in ein Bataillon mit vollständiger Rüstung organisieren wollten und bäten, sich vor ihm aufstellen zu dürfen, damit er Musterung halte und jedem seinen Posten anweise, sie würden ihre Schuldigkeit tun. Als die Bürgerschaft sich versammelt hatte, kam der alte Oberst und sagte: »Macht dem Spiel ein Ende, ihr guten Leutchen! Geht in Gottes Namen nach Hause. Was soll mir’s helfen, daß ich euch sehe?« Und da Nettelbeck neuerdings Vorstellungen machte und sich und seine Leute zu den nötigen Arbeiten anbot, erwiderte der Kommandant mit einem höhnischen Lachen: »Die Bürgerschaft und immer wieder die Bürgerschaft! Ich brauche die Bürgerschaft nicht.«
Eine solche Geringschätzung erregte Murren und Unwillen, aber Nettelbeck ließ sich nicht abhalten, zu tun, was ihm Pflicht schien. Er machte den Oberst darauf aufmerksam, welch gute Dienste in früheren Belagerungen eine Schanze auf dem hohen Berg, eine Viertelmeile außerhalb der Stadt, geleistet hatte, und er und seine Freunde seien bereit, die Schanze wiederherzustellen. Der Oberst antwortete, was außerhalb der Stadt geschähe, kümmere ihn nicht, die Festung innerhalb werde er schon zu verteidigen wissen. Und so baute Nettelbeck die Schanze, und es halfen ihm die Bürger, ihre Gesellen, ihre Lehrjungen und Dienstmägde; als die Arbeit noch immer zu langsam vonstatten ging, warb er Leute am Hafen und bezahlte sie aus seiner Tasche. Er sorgte für die Anschaffung von Lebensmittelvorräten und nahm bei Bäckern, Bauern und Branntweinbrennern ein Verzeichnis der Bestände auf. Er ging in die umliegenden Dörfer und sah nach, was an Korn und Schlachtvieh vorhanden war. Mit all seinen Papieren ging er nun zum Kommandanten, um ihn zu bewegen, daß er die Vorräte in die Stadt schaffen lasse. Der Oberst aber, als hätte die Pest an den Papieren geklebt, drückte sie ihm eilig wieder in die Hand und sagte, er brauche den Plunder nicht und damit Gott befohlen.
Der Oberst hatte auch eine alte Köchin, und die war jedesmal zugegen, wenn Nettelbeck kam, und gab ihren Senf mit drein. Auch dieses Mal schimpfte und maulte sie, bis Nettelbeck die Galle überlief und er dem unverschämten Weibsbild die Meinung sagte, wodurch er aber den Obersten nur noch mehr gegen sich in Zorn setzte.
Um den Magistrat und seine Anstalten stand es auch kläglich, der Untergang der Stadt schien nicht aufzuhalten, und so entschloß sich Nettelbeck, der winterlichen Jahreszeit zum Trotz, den König selbst in Königsberg oder in Memel aufzusuchen und ihm Kolbergs Lage und Not vorzustellen. Da traf aber der Kriegsrat Wissening von Treptow in Kolberg ein, ein Mann, der Kopf und Herz auf dem rechten Fleck hatte. Der machte sich gegen Nettelbeck erbötig, selber zum König zu gehen und sein möglichstes zu tun, um den Platz zu retten. Unter den von den Truppen Versprengten, die täglich in Kolberg Zuflucht suchten, befand sich auch der Leutnant von Schill; Nettelbeck gewann ihn bald zum Freund, und der junge Offizier erklärte sich bereit, in Kolberg zu bleiben, um bei der Verteidigung zu helfen. Er stimmte mit Nettelbeck darin überein, daß vor allem die Maikule, der Schlüssel zum Hafen, um jeden Preis festgehalten werden müsse, und doch war zur Verschanzung dieses entscheidenden Punktes bis jetzt noch keine Schaufel in Bewegung gesetzt worden. Es waren keine Hände da, um auch nur einige Erdaufwürfe zustande zu bringen, und Nettelbeck trieb unermüdlich in der Geldervorstadt und in allen umliegenden Ortschaften Tagelöhner und Häusler zusammen, versprach und zahlte guten Lohn und verwandte gegen vierhundert Taler aus seiner Tasche. Tag und Nacht arbeiteten etwa sechzig Menschen nach dem von Schill entworfenen Plan an den Befestigungen; weder der Kommandant noch sonst jemand fragte und kümmerte sich, was da geschafft wurde. Indessen war der Kriegsrat Wissening mit ausgedehnten Vollmachten vom König zurückgekehrt. Seine Hilfe brachte neues Leben in die Verwaltung; ganze Herden Schlachtvieh, lange Reihen Getreidewagen zogen zu den Toren ein, und Heu und Stroh im Überfluß füllte die Futtermagazine. In der Stadt wurde geschlachtet und eingesalzen und die Böden der Bürgerhäuser mit Korn beschüttet.
Um die Mitte März hatten die Franzosen die Umzingelung der Festung beendet. Die Schanze auf dem hohen Berg ging unter blutigen Kämpfen verloren, auch die Anhöhen der Altstadt waren besetzt. Es war nun dringend geboten, die Überschwemmung des Geländes rings um die Festung zu bewirken, eine Absicht, die auf den hartnäckigen Widerstand der Grundeigentümer stieß. Auch der Kommandant wollte nichts davon wissen, bei der darüber geführten Unterredung mischte sich wieder die Köchin in ihrer gewohnten Weise ein. Nettelbeck schob sie ohne viel Federlesens zur Türe hinaus, der Oberst geriet in Hitze, griff nach seinem Degen und würde ihn gegen Nettelbeck gezogen haben, wenn ihm nicht dessen Begleiter, der Hauptmann von Waldenfels, mit den Worten in den Arm gefallen wäre: »Beruhigen Sie sich, Nettelbeck hat recht getan.«
Die Franzosen schickten indessen einen Parlamentär, den der Oberst in aller Freundlichkeit empfing und mit dem er hinter verschlossener Tür verhandelte. Nettelbeck argwöhnte Verrat, und in der Fülle seines beklommenen Herzens schrieb er an den König: Wenn Euere Majestät uns nicht bald einen andern und braven Kommandanten zuschicken, sind wir unglücklich und verloren.
Die Belagerer schritten zum Angriff, die Geldervorstadt geriet in Gefahr, Loucadou erteilte den Befehl, sie niederzubrennen, aber Schill stellte ihm das Unnützliche und Übereilte dieser Maßregel mit solchem Gewicht vor, daß er nachzugeben gezwungen war; dadurch konnten Hunderte von Menschen die beweglichen Trümmer ihres Besitzes in Sicherheit bringen, und erst als dies geschehen war, fand die Zerstörung statt. Der Kommandant aber bezichtigte Schill der Insubordination und ließ ihn in Arrest setzen. Soldaten und Bürger vernahmen mit Unwillen, was ihrem Liebling geschehen war. Es entstand ein Gemurmel, ein Reden, Fragen und Durcheinanderlaufen, das mit jeder Minute lauter und stürmischer wurde. Man wollte Schill mit Gewalt befreien und den Kommandanten zur Rechenschaft ziehen. Nettelbeck, lebhaft bestürzt und das Unselige dieser Volksbewegung erkennend, warf sich unter die Menge, bat sie, Vernunft anzunehmen und vor allen Dingen Schills eigene Meinung zu hören. Dies ward angenommen, und Nettelbeck ging zu Schill. Als der vernahm, wie die Sachen standen, erschrak er heftig, und Nettelbeck an beiden Händen ergreifend, rief er: »Freund, ich bitte Sie um alles, stellen Sie die guten Menschen zufrieden. Aufruhr wäre das letzte und größte Unglück, das uns begegnen könnte. Sagen Sie ihnen, ich sei nicht arretiert, ich sei krank, sagen Sie, was Sie wollen, wenn sich nur die Leute zur Ruhe geben.« Nettelbeck begab sich wieder auf den Markt, hielt eine Ansprache, die Leute kamen zur Besinnung und gingen friedlich auseinander. Schills Arrest blieb ein leeres Wort, das stillschweigend zurückgenommen wurde.
Die feindlichen Granaten schlugen in die Stadt, und der Oberst befahl, daß die Dächer mit Dünger belegt und das Pflaster aufgerissen werden sollte, um die Geschosse unschädlicher zu machen. Nettelbeck äußerte Zweifel über das Förderliche dieses Befehls; da die Dächer eine Neigung von mehr als fünfundvierzig Grad besaßen, meinte er, der Dünger werde wohl nicht haften bleiben, auch würden die Bomben vor den so bedeckten Dächern nicht sonderlich viel Respekt zeigen; das Aufreißen des Pflasters sei aber bei den engen Gassen sogar gefährlich, weil dann bei entstandener Feuersgefahr weder Spritzen noch Wasserkufen einen Weg durch die Steinhaufen und den umgewühlten Boden finden würden. Während des Gesprächs fuhr in der Nähe eine Bombe nieder und zersprang. Der Oberst sah sich mit etwas verwirrten Blicken um und stotterte: »Meine Herren, wenn das so fort geht, so werden wir müssen doch noch zu Kreuze kriechen.« Mehr konnte er nicht hervorbringen. Nettelbeck, alle Selbstbeherrschung verlierend, fuhr auf und schrie: »Halt! Der erste, wer er auch sei, der das verdammte Wort wieder ausspricht, von zu Kreuze kriechen, stirbt des Todes von meiner Hand.« Dabei riß er den Degen aus der Scheide, sein Nebenmann faßte ihn von hinten und zog ihn von Loucadou zurück. »Arretieren,« knirschte der Oberst mit schäumendem Mund, »gleich arretieren! In Ketten und Banden.« Alles drängte sich um den Oberst zusammen; Nettelbecks Freunde schoben ihn zurück, und er ging, wenig zufrieden mit sich selbst und seinem Zorneifer, still nach Hause. Nachmittags berief der Kommandant den Landrat zu sich und teilte ihm mit, er werde Nettelbeck vor ein Kriegsgericht stellen und auf dem Glacis der Festung erschießen lassen. Der Landrat erschrak, machte eindringliche Vorstellungen, jedoch der Oberst beharrte auf seinem Sinn. Als die Bürger vernahmen, was im Werke war, geriet alles in die größte Bewegung, alles ergriff Nettelbecks Partei; der Haufen sammelte sich und ward mit jeder Minute größer, wälzte sich zu Loucadous Wohnung, umringte ihn, und die Wortführer bestürmten ihn so lange im guten und im bösen, bis sie seine Entrüstung einigermaßen milderten oder vielleicht ihn ahnen ließen, daß er kein so leichtes Spiel haben werde. »Gut, gut,« sagte er endlich, »so mag der alte Bursche diesmal laufen. Hüt er sich nur, daß ich ihn nicht wieder fasse.« Nettelbeck hatte von seinem Fenster aus den Auflauf des Volkes bemerkt, hatte aber kein Arg, daß es ihn so nahe angehen könne. Erst andern Tags erfuhr er, wie schlimm es auf ihn und sein Leben gemünzt gewesen.
Die Belagerung nahm ihren Fortgang, und Not und Elend stiegen von Woche zu Woche. Es war am 1. Juli, als die Franzosen endlich letzten Ernst zu machen schienen. In den Morgenstunden eröffneten sie ein furchtbares Bombardement auf die Stadt. Bald gab es nirgends ein Plätzchen mehr, wo die zagende Menge vor dem drohenden Verderben sich hätte bergen können. Überall zerschmetterte Gewölbe, einstürzende Böden, krachende Wände und aufwirbelnde Säulen von Dampf und Feuer; überall die Gassen wimmelnd von ratlos umherirrenden Flüchtlingen, die ihr Eigentum preisgegeben hatten und unter dem Gezisch der kreisenden Feuerbälle sich verfolgt sahen von Tod und Verstümmelung. Geschrei von Wehklagenden, Geschrei von Säuglingen und Kindern, Geschrei von Verirrten, die ihre Angehörigen verloren hatten, Geschrei der Menschen, die mit dem Löschen der Flammen beschäftigt waren, Lärm der Trommeln, Rasseln der Fuhrwerke, Geklirr der Waffen, es war herz- und ohrenzerreißend. Im Laufe des Tages erstürmten die Franzosen die Maikule, und mit dem Verlust dieses wichtigen Punktes war die Verteidigung gelähmt, und das Münderfort war nun zur Beschützung des Hafens nicht mehr ausreichend, was sich zeigte, als das englische Schiff, das den Belagerten zu Hilfe gekommen war, beim Vordringen der Franzosen die Ankertaue kappte, um wieder das offene Meer zu gewinnen.
Zu spät hatte der König Unterstützungsmannschaften geschickt, zu spät den unfähigen Kommandanten durch den Major von Gneisenau ersetzt; es schien, daß die Stadt nicht mehr zu retten war. Inmitten der ringsum drohenden Gefahr erzeugte sich allmählich eine Gleichgültigkeit bei vielen, die nichts mehr zu Herzen nahmen. War auch nicht der Mut, so war doch die Natur erschöpft; Anstrengung, Schlaflosigkeit, immerwährende Spannung des Gemüts und Sorgen für Weib und Kind und Eigentum fielen auf die meisten mit einem solchen Gewichte, daß sie sich in den Trümmern ihrer Wohnungen ein noch irgend erhaltenes Plätzchen ersahen, um den bis in den Tod ermatteten Gliedern einige Ruhe zu gönnen.
Da geschah es, daß eine Bombe, verderblicher als alle andern, in das Rathaus fuhr, und ein hell aufflackerndes Feuer war die Folge ihres Zerspringens. Als naher Nachbar sprang Nettelbeck hin, um schnelle Anstalten zur Brandlöschung zu betreiben, aber ringsum regte sich keine menschliche Seele. Er lief zu Bekannten, braven und wackeren Männern, um sie zur Hilfe aufzurufen, doch schlaftrunken und ohne Gefühl beachteten sie sein Bitten und Ermuntern ebensowenig, wie sein Toben und Schelten. In steigender Angst rannte er auf die Brandstätte zurück und packte jeden an, der ihm begegnete. Ein vierschrötiger Kerl, dem er einen gefüllten Löscheimer aufdrängte, nahm ihn und schlug das Gefäß mit seinem nicht eben sauberen Inhalt Nettelbeck geradezu um die Ohren, so daß er fast die Besinnung verlor und von Schmutz und Ruß bedeckt eine jämmerliche Figur machte. Ohne sich darum zu kümmern eilte er in das nächste Wachhaus auf dem Walle und stürmte wild in das halbdunkle Wachzimmer. Auf der hölzernen Pritsche regte sich eine Gestalt. »Bester Mann, zu Hilfe, das Rathaus steht in Flammen!« schrie Nettelbeck. Der Offizier erhob sich, schlug die Hände zusammen und rief aus: »Ach, du armer Nettelbeck!« Jetzt erst erkannte ihn Nettelbeck; es war Gneisenau. Nun wurde die Lärmtrommel gerührt, die Soldaten erschienen, Patrouillen durchzogen die Stadt, und die Löschanstalten kamen in Bewegung. Zu gleicher Zeit hatten die Gefangenen im Stockhaus die allgemeine Verwirrung benutzt, um auszubrechen, und hatten in den Häusern zu plündern begonnen; auch Nettelbecks Haus wurde von diesem Schicksal betroffen. Durch den tätigen Eifer des Militärs wurde die Rotte wieder eingefangen und unschädlich gemacht.
So besonnen, wo es zu handeln galt, so allgegenwärtig gleichsam, wo eine Gefahr nahte, und so beharrlich, wo nur die unabgespannte Kraft zum Ziele führen konnte, hatte sich der Kommandant Gneisenau immer und überall seit dem ersten Augenblick seines Auftretens erwiesen. Wochen hindurch war er so wenig in ein Bett als aus den Kleidern gekommen. Vater und Freund des Soldaten wie des Bürgers, hielt er beider Herzen durch den milden Ernst seines Wesens und durch teilnehmende Freundlichkeit gefesselt. Jeder seiner Anordnungen folgte das unbedingteste Zutrauen.
Der Morgen des 2. Juli brach an. Not und Elend, Jammergeschrei und Auftritte der blutigsten Art, einstürzende Gebäude und prasselnde Flammen, das war das einzige, was bei jedem Schritt den entsetzten Sinnen sich darstellte. Gneisenaus scharfes Auge hatte mitten im gräßlichsten Tumult erkannt, daß der Feind Vorbereitungen traf, sich von der Wolfsschanze aus über das Münderfort herzustürzen. Es war drei Uhr nachmittags. Gegenanstalten wurden getroffen, Befehle flogen, alles war in der lebendigsten Spannung, plötzlich schwieg das feindliche Geschütz auf allen Batterien. Auf das Krachen eines Donners wie am Tage des Weltgerichts folgte eine lange, öde Stille. Jeder Atem stockte, niemand begriff den schnellen Wechsel, das schauerliche Erstarren so gewaltiger losgelassener Kräfte. Da nahte ein feindlicher Parlamentär, neben ihm ein preußischer Offizier, und alsbald stürzte dieser mit den atemlos hervorgestoßenen Worten in den Kreis seiner Bekannten: »Friede! Kolberg ist gerettet.«
Als im Jahre 1809 der König von Memel nach Berlin zurückkehrte, hieß es zuerst, er werde seinen Weg über Kolberg nehmen; aber die Strenge der Jahreszeit gebot die kürzeste Richtung, und da es bekannt wurde, daß das königliche Paar einen Rasttag in Stargard machen wollte, schlug Nettelbeck den Kolbergern vor, eine Abordnung der Bürgerschaft dorthin zu senden. Alles war seiner Meinung, aber alles glaubte auch, daß es dafür zu spät sei, denn um rechtzeitig an Ort und Stelle zu kommen hätte man sich noch den nämlichen Abend auf den Weg machen müssen. »Und warum nicht schon in der nämlichen Stunde?« fragte Nettelbeck. »Ich bin dazu bereit, aber ich bedarf noch eines Gefährten. Wer begleitet mich?« Schweigen und Kopfschütteln ringsherum, und schon wollte der Alte im feurigen Unmut auflodern, als ihm der Kaufmann Gölckel die Hand reichte, sich ihm zum Gefährten erbot und in einer Stunde reisefertig zu sein versprach. Sie kamen nach Stargard so früh am Morgen, daß sie noch alles in Finsternis und Schlaf begraben fanden. An einem Haus stiegen sie ab, klopften an und verlangten Herberge. Die Antwort lautete, alles sei dicht besetzt und kein Unterkommen mehr möglich. »Aber liebe Leute, den alten Nettelbeck werdet ihr doch nicht auf der Straße stehen lassen!« »Nein, wahrhaftig nicht,« scholl eine weibliche Stimme dagegen, »tausendmal willkommen! Da muß sich schon ein Winkelchen finden.«
Im königlichen Quartier wurde Nettelbeck von einem General erkannt und in das Empfangszimmer geführt. Der große Raum war voll von Offizieren, Damen und Standespersonen. Alles blitzte von Ordenszeichen, und es gab eine feierliche Stille, als der König und die Königin eintraten.
Vor Nettelbeck und seinem Begleiter stehend, sagte der König gegen die glänzende Versammlung hin mit bewegter Stimme: »Wenn jeder so seine Pflicht getan hätte wie die Kolberger, dann wäre es uns nicht so unglücklich ergangen.«
Nach einiger Wechselrede brach aus des alten Nettelbecks Munde das glühende Wort: »Verflucht sei, wer seinem König und Vaterland nicht treu ist.« Und dann: »Wir hoffen, Eure Majestät werden uns nicht sinken lassen.« Der König antwortete und streckte Nettelbeck die Hand entgegen: »Nein, nicht sinken lassen, nicht sinken lasse ich euch.«
Diese Stunde war vielleicht die schönste in Nettelbecks Leben, und keine empfand er dankbarer als Lohn für alle Opfer und Mühen. Er begann nun seine Hantierung wieder und fand auch ein notdürftiges Auskommen. Doch fiel es ihm immer schwerer aufs Herz, daß er so abgesondert und verlassen dastand. Er war nun fünfundsiebzig Jahre alt und sorgte sich doch noch um die Zukunft. Zuerst lachend, dann in wohlgemeintem Ernst rieten ihm seine Freunde, es noch einmal mit dem Ehestand zu versuchen, und nach vielem Bedenken und Zögern folgte er ihrem Rat und heiratete eine uckermärkische Pfarrerstochter, an deren Seite er noch ein spätes Glück fand und die ihm sogar im nächsten Jahr eine Tochter schenkte.
Sein rastloser Geist konnte nicht ruhen. Am Abend seines Lebens beschäftigte ihn noch ein Projekt, das er schon Jahrzehnte zuvor gehegt, der Lieblingswunsch, Preußen auch jenseits der Weltmeere groß, geachtet und blühend zu sehen. Er verfaßte eine Denkschrift, worin er den Lenkern des Staats den Vorteil auseinandersetzte, der mit dem Erwerb von Kolonien verbunden war, ja, er machte sich trotz seiner sechsundsiebzig Jahre erbötig, das erste preußische Schiff, das solchem Zweck dienen würde, selbst zu führen. Aber wie leicht zu denken, erweckte sein Vorschlag zu jener Zeit keine ernstliche Beachtung.
Im Jahre 1824, sechsundachtzig Jahre alt, endete der wunderbare Mann sein reiches Leben.
Am 29. Dezember 1845, in der Morgenfrühe, kam ein Mann von der Sudenburg, einer Vorstadt Magdeburgs außerhalb der Ringmauern, und passierte in Eile durch das eben geöffnete Tor. Er war sonderbar anzusehen; ein Schlafrock hing über seinem Körper, er war ohne Stiefel, ohne Strümpfe, ohne Kopfbedeckung, und Haar und Bart waren von Flammen versengt. Seine Schritte waren ungleich und zeugten von großer Ermattung. Bei einem Hause an der Johanniskirche, wo der Wundarzt Koch wohnte, machte er endlich halt und zog hastig die Klingel. Die Straßen waren noch leer, die Leute schliefen noch, und erst auf sein wiederholtes Klingeln wurde ihm das Tor aufgemacht. Er taumelte in das Wohnzimmer und fiel ohnmächtig auf das Sofa nieder. Der Chirurgus Koch und seine Frau, die ihm beide erschrocken entgegengetreten waren, fragten gleichzeitig, was geschehen sei und von wo er in einem solchen Aufzug herkomme. Der Wundarzt nahm das Licht vom Tisch, beleuchtete ihn und sah, daß nicht nur sein sonst wohlgepflegter Bart verkohlt war, sondern daß auch seine Hände blutig waren. »Um Gottes willen, Holzwart, was ist geschehen?« fragte er entsetzt, doch der Mann stammelte nur verworrene Antworten, sprach von Flammen und daß seine Familie, die Frau und seine fünf Kinder wohl erstickt seien. Der Wundarzt schickte seinen Sohn und den Lehrer Zimmermann sofort nach der Sudenburg hinaus, und sie kamen mit der Unglücksbotschaft zurück, daß man dorten sechs Leichen aus dem Schutt des niedergebrannten Hauses geschafft habe. Es war auch schon eine amtliche Anzeige eingegangen, und die Kriminaldeputation fand sich bei dem Wundarzt Koch ein, um von Holzwart Auskunft über die furchtbare Katastrophe zu erhalten.
Sie trafen Holzwart krank und hinfällig durch den erlittenen Blutverlust, aber doch imstande, ihren Fragen Genüge zu leisten. Er erzählte, daß ihm in der Nacht ein Mensch in seinen Verkaufsladen eingetreten sei und ihm zwei Stiche in die Brust versetzt habe; er sei mit dem Menschen ins Ringen gekommen, habe ihn verfolgt, habe neue Stiche erhalten, sei dann umgekehrt und habe sein Haus in Flammen stehend gefunden. Er sei zurückgewichen und fast ohne Besinnung in die Stadt gelaufen, und da sei er vor dem Kochschen Hause angelangt.
Das alles klang weniger wie Lüge, als wie die unzusammenhängenden Reden eines Fiebernden. Die Kleidungsstücke, die Holzwart am Leibe hatte, waren nicht durchstochen, und die Schnitte am Hals sprachen eher für einen Selbstmordversuch als für Verwundungen von fremder Hand. Das Haus war nicht nieder-, sondern ausgebrannt; Türen und Fenster boten den Anblick einer gewaltsamen Zerstörung. Die verkohlten und verstümmelten Leichname der Frau, des Sohnes und der vier Töchter wurden in dem Zimmer neben dem Laden gefunden, und es erwies sich bald, daß an ihnen ein zwiefaches Verbrechen begangen worden war. Die Körper zeigten deutliche Spuren der Ermordung; ihr Blut färbte die Dielen der Zimmer, tränkte die Polster des Sofas, hing in schweren Tropfen noch ungetrocknet an den Stühlen, hatte die Geschenke des Christabends, die Spielereien der unschuldigen Kleinen überspritzt.
Sollte also der Vater dieser schönen, gesunden und wohlgeratenen Kinder ihr Mörder sein? Aus welchem Grund? Aus Haß? Aus Habsucht? Aus Not? Hätte er sie gehaßt, so wäre es ja leichter gewesen, sich von ihnen zu entfernen. Die Welt ist groß, und es hat schon mancher die ihm lästig gewordenen Familienbande abgeschüttelt, seine Kinder der Willkür des Geschicks preisgegeben und mit leichtsinnigem Mut in der Fremde Vergessenheit seiner Pflichten gesucht. Auch waren die Kinder schon über die Hilflosigkeit der ersten Jugend hinaus; die älteste Tochter war sechzehn, die zweite vierzehn, die dritte zehn, der Sohn neun Jahre, und nur das jüngste Kind, ein Mädchen im Alter von vier Jahren, stand in der ersten, ganz hilfsbedürftigen Jugend. Das Gerücht, daß die Kinder hätten erben sollen, erwies sich als falsch. Sie waren arm, hatten nie etwas besessen und auch keine Hoffnung auf Besitz. Daß sich die Familie in Not befand, war gewiß. Man wußte, daß Holzwarts Verhältnisse von Jahr zu Jahr zurückgegangen seien, ja daß er ein vollständig ruinierter Mann und sozusagen am Ende seiner Bahn angekommen war. Dies konnte aber keinen ausreichenden Anlaß bilden, fünf Kinder und eine Frau zu ermorden und zu verbrennen. Schon nach den ersten Tagen nannte man ihn Mörder und Mordbrenner, und daß er selbst tödlich verwundet im Gefängnisse lag und nach den Berichten der Ärzte einem Verhör noch nicht ausgesetzt werden durfte, glaubte niemand. Woher sollten ihm die Wunden gekommen sein? Sie hätten ihn in ein tragisches Licht gestellt, und man wollte von ihm nur als von einem verworfenen Mörder wissen. Was er gelitten und noch zu leiden hatte, darum kümmerte sich kein Mensch. Aber der Tag kam, wo viele in sich gingen.
Am Morgen des sechsten Tages begab sich der Untersuchungsrichter zu ihm ins Gefängnis. Der Arzt hatte seinen Zustand soweit gebessert gefunden, daß eine schonende Vernehmung möglich war. Doch lag er noch im Bette, sein Äußeres zeigte große Erschöpfung. Nachdem ihn der Richter mit einigen Fragen über sein körperliches Befinden hingeleitet hatte, erkundigte er sich, ob er sich zu erinnern vermöge, was für Aussagen er am Morgen seiner Verhaftung gemacht. Ohne Zögern bejahte Holzwart, fügte aber sogleich hinzu, daß man ihm noch einige Tage Zeit gönnen möge, dann würde er sich vollständig über die ganze Begebenheit aussprechen. Der Richter wendete ein, es wäre besser, wenn er sich sogleich ausspräche, namentlich wenn er etwas auf dem Herzen hätte, und machte ihm bemerklich, daß er in seinem Richter nicht den kalten Menschen suchen solle, der mit Nichtachtung auf den Gesunkenen herabblicke, sondern einen Teilnehmenden, der mit schmerzlichem Gefühl die Herzen der Verbrecher auszuforschen beflissen sei. Ganz ruhig richtete er daran die einfache Frage: »Haben Sie sich vergangen?« Holzwart richtete sich von seinem Lager auf, stützte sich auf den rechten Arm und sah den Richter stumm an. »Sind Sie schuldig?« setzte der Richter hastig hinzu. Holzwart legte sich zurück, sein Auge ruhte fest auf dem Gesicht des Richters, und eine tiefe Bewegung malte sich in seinen Mienen, als er antwortete: »Ja, ich bin schuldig.«
Mit dieser Erklärung mußte sich der Richter vorerst begnügen, wenn er das Leben des Gefangenen nicht in Gefahr bringen wollte, und erst nach mehreren Tagen schritt er zu einer eindringlicheren Forschung. Holzwart zeigte von der Stunde ab ein unbedingtes Vertrauen zu seinem Richter, und seine Aussagen stimmten so völlig mit allen Ermittlungen überein, daß man seine Wahrhaftigkeit nirgends in Zweifel ziehen konnte.
»Ja, ich bin schuldig,« sagte er mit festem und ruhigem Ton; »es ist aber mein Verbrechen nicht das Werk eines augenblicklichen Einfalls. Jahrelang hatte ich erfahren müssen, daß ein Unglücksstern über mir und meiner Familie war. Diese Überzeugung hat mich geleitet, als ich die Hand gegen die Meinen erhob. Kein andrer Grund als die Liebe hätte mich veranlassen können, eine so schreckliche Tat zu begehen. Die Liebe gab mir die Kraft, sie alle, die nach meiner Einsicht bald hilflos und erniedrigt dastehen würden, auf die schnellste und schmerzloseste Weise aus der Welt zu schaffen. Sie haben unbewußt und froh die letzten Minuten ihres Daseins herannahen sehen. Ich begann die Tat mit meiner Frau und endete sie mit meiner jüngsten Tochter.« Bei dieser Erklärung durchzuckte ein furchtbarer Krampf den unglücklichen Mann, er preßte die Augen zu und war unfähig, seine innerliche Erregung mit der Kraft zu bewältigen, die er bis dahin gezeigt hatte. Erst am nächsten Tage konnte man das Verhör fortsetzen.
»Ich bin an Entbehrungen gewöhnt,« sagte er, »aber zur Niedrigkeit bin ich nie hinabgesunken, habe mich nach meiner Denkungsweise immer fern von Gemeinem gehalten, und da es zuletzt mit mir so schlecht stand, daß nur Wohltaten und Almosen mir und meiner Familie das Dasein fristen konnten, sah ich keinen anderen Ausweg. Wenn mir auch nur der entfernteste Hoffnungsstrahl geleuchtet hätte, würde ich nicht die Kraft zu der Tat gefunden haben. Mit dem ersten Januar trat der Zeitpunkt ein, wo wir als Bettler vor der Welt dastanden; der Entschluß, den ich schon lange in mir trug, mußte also vor dem ersten Januar ausgeführt werden. Je näher mir die schauerliche Notwendigkeit trat, desto mutloser wurde ich, bis endlich beim Anblick des letzten Talers, den ich vor mir liegen sah, die Gewalt der Not entschied. Jetzt mußte ich.«
Dieser letzte Taler, von dem er sprach, war in dem Schutt der verbrannten Wohnung wirklich gefunden worden. Er war geschwärzt und als Münze kaum zu erkennen.
Der Richter wendete ein, daß er doch willens gewesen sei, nach Magdeburg zu ziehen und sogar schon ein Quartier für hundertdreißig Taler gemietet habe; wie das mit seinem Vorsatz, die Seinen durch Mord gegen Not zu schützen, zu vereinen sei. Er antwortete, dies sei nur zur Beruhigung seiner Frau geschehen; er habe nie geglaubt und nie die Absicht gehabt, das Quartier wirklich zu beziehen. »Meine Existenzmittel waren verbraucht, ich sollte bedeutende Zahlungen leisten, und es lagen nur noch drei Tage vor mir, der Sonntag, der Montag, und der Dienstag. Mein Entschluß schwankte schon seit dem Weihnachtsfeste; von einem Tag zum anderen schob ich die Ausführung hinaus. Ich hatte schon überlegt, ob ich nicht allein aus der Welt gehen sollte; mir war dann wohl nach dem fürchterlichen Kampf, aber ihnen? Ich sah sie in der Armut, der Gemeinheit und dem Laster verfallen. Nein, zusammen aus der Welt, zusammen in den Frieden. Am Sonntag erhob sich der Gedanke in mir in seiner ganzen Stärke. Um neun Uhr machte ich den Verkaufsladen zu. Meine Familie hielt sich gewöhnlich in dem Zimmer hinter dem Laden auf, ich hatte meine Wohnung daneben. Ich ging aus meiner Kammer durch den Laden und rief meine Frau. Sie folgte mir in mein Zimmer, und dort gab ich ihr einen Brief meines Bruders zu lesen. Sie saß mit dem Rücken gegen mich gewendet, ich ergriff die Axt, die ich mir bereitgestellt hatte, und schlug ihr den Schädel und die Schläfen ein. Sie war augenblicklich tot und hatte auch nicht die leiseste Ahnung ihres nahen Endes gehabt. Ich legte die Leiche auf mein Sofa, wo schon mein Bett gerichtet war, doch so, daß es den Kindern nicht auffallen konnte. Dann ging ich wieder hinüber und holte meine älteste Tochter. Unter dem Vorwand, daß ich ihr etwas diktieren müsse, was sie mir aus der Apotheke holen sollte, gebot ich ihr, sich auf denselben Stuhl zu setzen, auf dem ihre Mutter gesessen war. Ich diktierte ihr, ich weiß nicht ob Kremortartari oder sonst so etwas; in dem Augenblick, wo sie sich über den Tisch bückte, schlug ich ihr ebenfalls den Schädel ein. Sie endete wie ihre Mutter ohne ein Schmerzgefühl. Ich trug die Leiche über den Flur in die Küche, und zur Sicherheit schnitt ich mit meinem Rasiermesser die Halsmuskeln durch. Dann rief ich die zweite Tochter und tötete sie auf dieselbe Weise, auf demselben Stuhl, mit demselben Beil. Die übrigen drei Kinder erschlug ich in ihrer Schlafkammer, wo sie in ihren Betten lagen und schliefen. Allen schnitt ich die Kehle zur Vorsicht durch, damit sie auf keine Weise noch einen Lebensfunken in sich spüren und Schmerz empfinden sollten. Jetzt war das Werk vollbracht und mir war leicht. Nur ich fehlte noch, nur ich und alles war gut.«
Er erzählte nun, wie er die Betten angezündet, sich daneben hingesetzt und seinen Hals durchschnitten habe. Aber er starb nicht, er atmete weiter. Sein Arm erschien ihm plötzlich wie gelähmt und zurückgehalten. An Mut und Entschlossenheit habe es ihm nie gefehlt; hatte er bis dahin Kraft bewiesen, so mußte es ihm doch auch gelingen, sein eigenes Leben zu zerstören. Er versetzte sich noch zwei Stiche in die Brust; es war umsonst. Sein Blut floß, aber das Leben fühlte er nicht schwinden. Von diesem Moment trat ein Zustand bei ihm ein, über den er keine Rechenschaft geben konnte. Er wußte nicht, wie lange er bei den Leichen gewesen, der Qualm, der sich verbreitete, trieb ihn schließlich auf und hinaus. Es war ihm, als fliehe ihn der Tod, als müsse er den Tod verfolgen. Du stirbst nicht, rief es in ihm, du kannst nicht sterben. Er lief fort, weg- und steglos, irrte lange durch einen Garten und kam endlich an das Haus des Wundarztes Koch.
Der Richter fragte: »Was erwarten Sie denn nach einer solchen Tat?« Holzwart schaute mit einem heiteren Blick empor und antwortete ohne Zaudern: »Den Tod erwarte ich. Mit Freuden erwarte ich ihn, ich wollte ihn mir selbst geben, aber es ist mir leider nicht gelungen.«
Der Richter nennt Holzwart einen ungewöhnlichen Menschen, der sich meist gewählt ausdrückte und bisweilen sogar in ein gewisses Pathos verfiel. Er war groß und von stattlichem Körperbau. Sein Gesicht war voll Ruhe, sein Blick frei, sprechend und sanft.
Im Publikum erhoben sich Stimmen, die die Liebe zu den Seinigen in Zweifel stellten. Es wurde gesagt, er habe seine Kinder mit großer Strenge behandelt und barbarische Züchtigungen über sie verhängt. Bei näherer Beleuchtung verschwanden diese Anklagen. Was den Schein von Härte hatte, war Konsequenz gewesen, und es erwies sich auch, daß Holzwart von den Pflichten eines Vaters ganz andere Begriffe gehabt hatte als mancher ehrbare Bürger. Man erinnerte sich eines Aufsatzes, den er viele Jahre vorher in der Magdeburger Zeitung hatte drucken lassen und worin er die Unerläßlichkeit und heilsame Folge strenger Zucht betont hatte. Darüber waren alle Zeugen einig, daß es keine artigeren und besseren Kinder gegeben habe als Holzwarts Kinder, insbesondere das jüngste sei ein höchst anmutiges Geschöpf gewesen, der Liebling des Vaters, wurde gesagt. Dies erklärte auch die tiefe und mächtige Bewegung, die ihn durchzittert hatte, als er bekannte: »Das jüngste Kind war das letzte, das ich tötete.«
Der Fleischer Wothge, der Holzwart oft Beistand in seinem Geschäftsbetrieb gewesen ist, bekundete die bemerkenswerte Tatsache, daß Holzwart nicht fähig gewesen sei, ein Schwein zu schlachten. Wenn er dabei behilflich sein sollte, so bebte er vor innerer Aufregung und Beklemmung. »Er war überhaupt ein sonderbarer Mann,« äußerte sich dieser Zeuge; »ich kann mich darüber nicht so ausdrücken, wie ich möchte, aber es scheint mir, als hätte er sich Vorbilder nach Büchern zum Muster aufgestellt. Ich habe ihn von Abd-el-Kadr, von Faust, von Ibrahim Pascha mit Lebendigkeit und Begeisterung sprechen hören. Das waren seine Leute. Er meinte immer: Großartig sterben müsse der Mensch.«
Und weiter erzählte Wothge: »Im vergangenen Jahre, als das fürchterliche Gewitter über uns stand, schlachtete ich eines Abends um elf Uhr bei ihm. Mitten unter dem schauerlichen Donner sagte er zu mir: ›Ich wollte, alles wäre hin; was ich auch anfange, das Unglück ist immer hinter mir her.‹ Es war eine oftmals wiederholte Rede von ihm: ›Man muß nie müssen, sondern nur wollen. Aber alle im Staate müssen, nur einer will, das ist der König.‹ Ein andermal fragte er mich über Glaubenssachen, und als ich ihm entgegnete, ich glaubte das, was im Katechismus stehe, rief er: ›Dann sind Sie ein Tor!‹ und ging von mir fort. Er war übrigens ein sehr reeller Mann, wußte sich in Respekt zu setzen und führte immer durch, was er sich vorgenommen hatte. ›Bricht’s, so bricht’s‹, pflegte er zu sagen. Seine Lieblingsbeschäftigung war das Schachspielen. Drei Freunde aus Magdeburg haben ihn öfters besucht, bloß um mit ihm Schach zu spielen. Eines Tages kam er auf sein Elternhaus zu sprechen, und da erzählte er mir, daß zwischen ihm und seinem Vater oft wilde Szenen vorgekommen seien. Einmal bei einem Streit habe sein Vater ihm geflucht, und von diesem Augenblick an sei sein Glücksstern untergegangen.«
Holzwarts Bruder erklärte dessen Vermögensverfall aus unglücklichen Konjunkturen und bekräftigte, daß er mit redlichem Willen und unermüdlichem Eifer stets danach gestrebt habe, sich und seine Familie zu ernähren. Er sei niemals arbeitsscheu gewesen, sondern es habe immer den Anschein gehabt, als solle seine Tätigkeit vergeblich sein. Er schrieb ihm eine Anlage zum Tiefsinn zu, die er vom Vater ererbt hatte. Es sei ihm nicht möglich gewesen, sich an einen Menschen zutraulich anzuschließen. In Güte hätte man aber alles von ihm erlangen können; wenn er aber Widerstand gefunden, wo er im Recht zu sein geglaubt, oder wenn er sich verkannt gesehen, habe ihn der heftigste Zorn ergriffen.
»Er hatte einen streng rechtlichen Sinn und ein feines Gefühl,« äußerte sich weiterhin der Bruder bei einer Zeugenvernehmung. »Es lag ein Stolz in seinem Charakter, der es ihm unerträglich machte, die Hilfe anderer in Anspruch nehmen zu müssen. Ebenso unerträglich war ihm der Gedanke, seine Kinder, die er sehr liebte, nach seinem Tode dem Mitleid fremder Leute preisgegeben zu sehen. Außerdem hatte er die Idee gefaßt, daß seinen Sohn ein ebenso unglückliches Dasein erwarte, wie er selbst es geführt. Wie großmütig und redlich seine Denkungsart war, zeigte sein Benehmen, als er vor einigen Jahren in der Lotterie spielte. Bei der Klasseneinzahlung bot er in einer Anwandlung froher Laune und gewiß in der Überzeugung, daß er nichts gewinnen werde, seiner Schwägerin die Hälfte des Gewinnes an. Das Los kam in der letzten Ziehung mit einem Gewinn von tausend Talern heraus. Holzwart hielt sich seinem Versprechen gemäß für verpflichtet, der Schwägerin die Hälfte davon zu zahlen, obgleich sie kein Recht geltend machen und die Abmachung nur für Scherz angesehen werden konnte. Er blieb dabei, er müsse das Geld teilen, weil er es versprochen habe, und er bräche niemals sein Wort. Als ich ihm vor Jahresfrist aus einer Verlegenheit half, sagte er bewegt zu mir: »Glaube mir, es wird mir schwerer, dein Geld zu nehmen, als es dir vielleicht ist, es zu geben.«
Die Geschichte seines Lebens, die Holzwart vor dem Richter erzählte, trug das unverkennbare Gepräge der Wahrheit und folgt hier mit seinen eigenen Worten.
»Mein Vater hatte mich zum Seifensieder bestimmt, und da ich nun einmal nicht studieren sollte und durfte, war mir das recht. Mein Vater hatte mich so sehr an Gehorsam gewöhnt, daß es mir nicht eingefallen wäre, mich gegen seinen Befehl zu sträuben. Die Wahl des Meisters war nicht günstig für mich. Ich merkte bald, daß ich unter solcher Anleitung nichts vom Geschäft begreifen würde. Ich klagte es meinem Vater, daß mich der Lehrherr mehr zu Hausarbeiten als zum Seifensieden verwende, doch dies wurde nicht von ihm beachtet. Auch meine Mutter hörte nicht eher auf diese Klagen, als bis es zu spät war. Das Lehrgeld war weggeworfen, und nach dreijähriger Lehrzeit ging ich als Geselle aus diesem Geschäft nicht um ein Haar klüger, als ich hingekommen war. Ich trat die Wanderschaft an, fand natürlich wegen meiner Unbrauchbarkeit nirgends lange Arbeit, und um nicht in Not zu geraten, kehrte ich in die Heimat zurück. Fürs erste blieb ich im elterlichen Hause, wo man eine wünschenswerte Unterstützung an mir fand. Dann versuchte ich es noch einmal in Eisleben als Volontär in einem Seifensiedergeschäft, doch wurde dies meinen Eltern mit der Zeit zu kostspielig, ich gab die Seifensiederei für immer auf und blieb nun fünf Jahre in meines Vaters Geschäft. Ich lebte dort in drückenden, sehr unangenehmen Verhältnissen, die vornehmlich durch meines Vaters Schwäche, mit den Dienstmädchen allzu vertraulich umzugehen, herbeigeführt wurden. Mein Vater behandelte mich sehr nachlässig, was bei meinem ohnehin reizbaren Ehrgefühl eine bedeutende Wirkung auf mich ausübte. Im Hause meiner Eltern befand sich auch meine nachherige Frau; nicht eigentlich als Ladenmamsell, sondern mehr aus Gefälligkeit gegen meine Mutter, die die ganze Last des ausgebreiteten Schmälzergeschäfts allein zu tragen hatte. Ich gewann das Mädchen lieb und wünschte sie zu heiraten. Im Grunde meines Herzens trieb mich mehr die Unerträglichkeit meiner Lage als die Sehnsucht nach der Ehe zu dem Eifer, womit ich meine Eltern um Gründung eines Haushalts für mich anging. Lange sträubten sie sich gegen die Verbindung, endlich willigten sie ein und gaben mir hundert Taler Gold zur Errichtung eines Materialladens; meine Frau brachte mir ungefähr ebensoviel dazu, und mit diesem Kapital begann ich voller Hoffnung mein selbständiges Leben und meine Ehe. Die Kaufleute gewährten mir willig und gern Kredit, so sah ich trotz des geringen Vermögens einer günstigen Schicksalswendung entgegen.
Aber wenn früher meine Verhältnisse drückend waren, so verfolgte mich jetzt ein Unglück nach dem andern. Mit dem besten Willen ging ich an mein Geschäft, doch schon im ersten Jahre wurde meine Frau nach der Entbindung krank und blieb volle fünf Vierteljahre in ärztlicher Behandlung. Sie mußte teure Bäder nehmen, und die Rechnungen für den Doktor und den Apotheker beliefen sich auf hundertzweiunddreißig Taler. Ich mußte Schulden machen und erkannte bald die Unmöglichkeit, mich in der Neustadt zu halten. Ehe noch ein Konkursverfahren eingeleitet werden konnte, wurde ich mit Hilfe meiner Mutter den Gläubigern gerecht und gab das Geschäft auf. Ich übernahm nun auf den Vorschlag meiner Eltern den Laden im Bonteschen Haus auf dem Markt, worin neben einem Schenklokal ein Handel mit Schmälzerwaren betrieben wurde. Ich sah gleich, daß diese Art von Wirtschaft nichts für mich war; zu einer Schenkstube gehörte ein anderes Wesen als das meine. Die Fleischwaren bekam ich aus dem elterlichen Geschäft und verkaufte sie eigentlich auf Rechnung meines Vaters, wobei mir nur der kleine Gewinn zufiel, den ich in der Schenkstube machte. Steuern für das Gewerbe, sowie Ladenmiete mußte ich aber bezahlen. Dazu kam, daß bei dem Laden keine Wohnung war und ich die Wohnung für meine Familie apart halten mußte. Es brach zu jener Zeit die Cholera in Magdeburg aus und raffte sogleich einen der beliebtesten Gäste meines Lokals, den Goldschmied Schladen, hinweg, die übrigen Männer bekamen Furcht und mieden meine Schenkstube, sie stand verödet, und ich mußte neue Gäste anzuwerben suchen. Es schlug fehl, und nach abermals zwei Jahren mußte ich das Geschäft mit einer baren Einbuße von sechshundertsechzig Talern auflösen.
Viele haben den Verfall meines Hauswesens meiner Vorliebe für wissenschaftliche Beschäftigung zugeschrieben, aber damit hat man mir unrecht getan. Ich hatte allerdings großes Interesse an der Literatur, las gerne historische und naturwissenschaftliche Werke, begann auch zur damaligen Zeit ein Tagebuch, worin ich eigene Ideen und gute aufgefundene Gedanken verzeichnete, muß auch gestehen, daß ich nach der Erzählung von Alvensleben »Der Racheschwur« ein Drama zu arbeiten anfing; aber alles dies füllte nur meine Mußestunden aus, die von anderen Männern beim Kartenspiel und Biertrinken verbracht wurden.
Ich versank nun in große Not, und meine Mutter unterstützte mich ein wenig. Ich faßte den Plan, in die weite Welt zu gehen und zu versuchen, ob nicht irgendein Platz für mich zu finden sei, wo ich meinen Lebensunterhalt gewinnen konnte. Mein Blick richtete sich auf Prag, wo ein Bruder meiner Mutter, der Weißgerber Grosse, in guten Umständen lebte. Ich trennte mich von meiner Familie. Es war ein schmerzlicher Abschied, aber ich ging nicht eher von ihnen, als bis mir meine Mutter in Gegenwart meines Bruders das Versprechen geleistet hatte, mütterlich für sie zu sorgen. Man schlug mir vor, die französische Handschuhmacherei zu erlernen, und wirklich schien mir dies ein Erwerbszweig, der einträglich zu werden versprach. Mein Onkel in Prag gab das Lehrgeld her, und obwohl ich nicht mehr in den Jahren war, wo man als Lehrling in einen neuen Beruf tritt und mir die Sache sehr sauer wurde, stärkte mich doch der Gedanke an meine Familie soweit, daß ich meinen Vorsatz glücklich durchführte. Nach zehn Monaten war ich Gehilfe des Meisters, der sich redlich Mühe mit mir gegeben hatte. Wieder in der Heimat angelangt, setzte ich alles daran, ein Handschuhmachergeschäft zu gründen. Mit etwas Geldmitteln wäre es mir wohl gelungen, allein ich hatte kein Geld, mein Vater wollte mir keins geben, die Mutter gab mir fünfzig Taler. Davon mußte ich die Hälfte für Arbeitszeug verwenden, und es blieb mir nicht einmal soviel, wie zum Ledereinkauf notwendig war. Dennoch versuchte ich mein Heil und hielt mich wirklich einige Zeit. Aber schließlich ging es bergab, und mein Ruin war täglich zu erwarten. Da starb mein Vater, und ich trat jetzt in das elterliche Geschäft als Pächter ein. Anfangs machte ich gute Geschäfte, aber bald wurde der Verdienst geschmälert durch die vielen neuerrichteten Schmälzerläden. Es trat noch das Mißgeschick hinzu, daß die Schweine plötzlich sehr teuer wurden, und dies ist ein harter Schlag für den Schmälzer, da die Waren noch eine Zeitlang in den alten Preisen bleiben, also bei jedem Schlachten zugesetzt werden muß. Ich blieb mit der Miete an meine Mutter rückständig, der Magistrat erhöhte die Pacht des Ladens unter dem Rathaus von sechzig auf hundert Taler, und im dritten Jahre wurde ich bankrott. Ich übergab meiner Mutter ihr Eigentum wieder, sie verkaufte das Haus und ließ mir unter Anrechnung auf mein späteres Erbteil fünfhundert Taler zum Kauf eines kleinen Hauses in der Junkerstraße, wo ich von neuem eine Schmälzerei anlegte. Ich mußte viel Geld verbauen; es wäre aber doch gegangen, wenn nicht ein Gläubiger der zweiten Hypothek mir sein Kapital gekündigt und ich einen neuen hätte erhalten können. Ich mußte wieder verkaufen und habe großen Schaden erlitten.
Jetzt war ich vollkommen herunter. Meine Mutter konnte nicht mehr helfen, mein Bruder hatte ein Gut in Lendorf gekauft und bot mir eine Freistatt. Ich ging zu ihm, als Arbeitsmann im wahren Sinn des Wortes. Fünf Monate hielt ich es aus, da trieb mich die Sehnsucht nach den Meinigen wieder zurück. Meine Frau hatte sich mit dem Schmälzerladen im Rathaus, der uns noch verblieben war, kümmerlich durchgebracht. Ich versuchte nun in Magdeburg einen neuen Erwerb und erlernte das Oblatenbacken. Meine Mutter schoß mir fünfzig Taler vor, und ich begann dies Geschäft. Aber es war, als hätte das Schicksal nur darauf gewartet, bis ich wieder Hoffnung gefaßt hatte. Kaum hatte ich einigen Vorrat liegen, so kamen die neuen Blättchen mit der Namenchiffre auf, meine Oblaten blieben als altmodisch unverkauft, und ich war wieder fertig. Da ging ich mit meiner ganzen Familie nach Lendorf zurück, und wir blieben dort ungefähr ein Jahr. Um diese Zeit verkaufte mein Bruder das Gut, und meine Mutter starb. Jetzt hatte ich freilich ein Erbteil zu erwarten, mit dem sich etwas beschaffen ließ. Ich bekam tausend Taler. Mit diesem Gelde kaufte ich ein Gehöft in Gommern, wo Gastwirtschaft betrieben wurde. Während meines Aufenthaltes in Lendorf hatte ich mich als Landwirt tüchtig geübt und Lust zum Feldbau bekommen. Die Frequenz des Gasthofs war gering, das Feld bestand nur aus zehn Morgen Ackerland, ich sah, daß nicht viel zu gewinnen sei, und da ich nach einem Jahre vorteilhaft verkaufen konnte, entledigte ich mich der Wirtschaft früh genug, um keinen Schaden zu erleiden. Damals gewann ich auch tausend Taler in der Lotterie, von denen ich die Hälfte meiner Schwägerin gab. Ich wollte mir nun ein kleines Gütchen kaufen, dazu reichten die Mittel nicht. Obwohl ungern, entschloß ich mich endlich, wieder eine Schmälzerei zu errichten, und zwar in der Sudenburg.
Ich hatte tausend Taler im Besitz. Die Herstellung des Ladens und die Anschaffung der Utensilien kosteten hundertsechzig Taler. Verdient wurde wenig. Die Schweine waren in dem Jahre sehr wohlfeil. Der Bauer hatte kein Futter für das Vieh und mußte verkaufen. Ich glaubte richtig zu spekulieren, wenn ich Schweine kaufte und steckte zweihundert Taler in den Handel, um einen ordentlichen Wintervorrat zu haben. Ich hatte mich leider verrechnet. Alle Leute hatten selbst Schweine gekauft und geschlachtet. Man holte mir nichts ab. Das Geschäft geriet ganz und gar ins Stocken. Schinken und Schlackwürste bewahrte ich für den Sommer auf. Eine entsetzliche Hitze kam und verdarb mir die Vorräte. Im nächsten Jahre stiegen die Schweine zu einem ungeheuren Preis, aber unsre Ware blieb auf dem alten Fuß. Ich hatte jetzt nur noch hundertvierzig Taler. Die Einnahme war erbärmlich; der tägliche Erlös betrug oft nur fünfzehn Silbergroschen. Wir mußten vom Kapital leben. Beim Ablauf des Jahres war ich dem Viehhändler hundertsechzig Taler schuldig. Mein Bruder erbot sich, mir vierhundert Taler zu leihen, und einer von meinen Bekannten legte hundert Taler dazu. Von diesem Gelde lebte ich mit meiner Familie, nachdem ich den Viehhändler bezahlt hatte. Ich schlachtete immer weniger. Im Jahre 1845 war alles Geld rein aufgezehrt. Es nahte der Winter, und die Not wurde bedrohlich. Abermals mußte ich meinen armen Bruder um Hilfe ansprechen. Er sendete mir zwanzig Taler, und dann wieder zwanzig Taler, und gegen Weihnachten aus freien Stücken fünf Taler zu Geschenken für meine Kinder. Meine Schuld beim Viehhändler war wieder auf anderthalb hundert Taler gestiegen.
Jetzt trat der Gedanke immer unwiderstehlicher an mich heran, mich und meine Familie schmerzlos aus der Welt zu schaffen, wo unserer nur Elend wartete, ich hatte keine Aussicht, keine Hoffnung mehr. Es blieb nur das Verhungern übrig. Ich war außerstande, die Meinen vor dem Untergang zu retten. Diese Gedanken machten mich fast krank, aber ich verriet sie nicht, und sie kehrten wie im Kreise immer wieder auf den Punkt zurück: Du bist dem Bettelstab verfallen. Vorwürfe über mein Leben und meine Geschäftstätigkeit konnte ich mir nicht machen. Ich habe immer geglaubt, richtige Maßregeln zur Verbesserung meiner Lage ergriffen zu haben, aber meine Bemühungen sind stets fehlgeschlagen. Verlust über Verlust, was ich angriff, mißlang. Bei der Erinnerung an all dies Leiden wurde mein Entschluß fester, und mein Gemüt stählte sich. Die Notwendigkeit trieb mich zur Tat.«
Bei gebessertem Gesundheitszustand konnte Holzwart nach einiger Zeit in das Verhörzimmer geführt werden. Seine Erscheinung war jetzt die eines zufriedenen und ergebenen Mannes. Es schien, als betrachte er das ihm neugeschenkte Leben mit einem mitleidigen Lächeln, als wollte er fragen: wozu? Er wiederholte sein Geständnis, und es war ersichtlich, daß die Schilderung der Mordnacht ihm eine unaussprechliche Pein verursachte. Und wieder behauptete er feierlich, seine Tat sei das letzte Werk der Liebe gewesen. Auf den Einwand, weshalb er bei seiner ersten Vernehmung im Kochschen Hause nicht sogleich offen bekannt, sondern eine Lüge angegeben habe, erwiderte er, es sei diese Lüge die einzige in seinem ganzen Leben. Er habe nur den Fragen genügen, lästiges Zudringen abwehren wollen, weiter nichts. Daß er verhaftet und vor dem Gesetz verantwortlich gemacht werden könnte, daran hatte er nicht gedacht. Nach seiner Meinung war er niemand auf der Erde eine Auskunft zu geben verpflichtet, und seine Tat mußte vor Gott allein verantwortet werden.
Eine Tat, straf- und todeswürdig vom Standpunkte des Rechtes, verworfen und abscheulich von dem der Moral. Der fürchterliche Irrtum, eine Familie verloren zu glauben, wenn die Hilfsquellen der Existenz versiegen, beruhte hier auf Charakterfehlern nicht allein, sondern auf Gemütsanlagen, die mit tragischer Liebe Bande des Blutes als unauflöslich betrachten. Der Gedanke, daß die geliebten Menschen einzeln ihre Nahrung suchen sollten, überstieg die Geisteskraft des Vaters; bis dahin im Schoße der Familie vor dem Unheil geborgen, sollte er sie jetzt der Verführung und der Verderbnis preisgeben? Die älteste Tochter war schön, vorzeitig entwickelt, blühend in Gesundheit und reizend durch freundliches Betragen. »Sie würde ihre Käufer schon gefunden haben,« warf Holzwart einst im Gespräch mit bitterem Hohne hin, »aber ich habe ihre Unschuld bewahrt und gerettet.« Der Richter wandte ein, das Mädchen hätte ja bei seiner Schönheit eine günstige Wendung des Geschickes erleben können. Da antwortete Holzwart: »Die Möglichkeit lag ferne, denn sie war arm; jetzt ist ihr Schicksal gesicherter.«
Im Dezember des Jahres 1846 wurde Holzwart verurteilt, nach dem Richtplatze geschleift, um mit dem Rade von unten herauf vom Leben zum Tode gebracht zu werden. Mit derselben Fassung und Haltung, die er bisher gezeigt, vernahm er das Urteil. Als ihm mitgeteilt wurde, daß ihm das Rechtsmittel der Appellation zustehe, erwiderte er ohne Besinnen, er habe die Strafe erwartet und durchaus nichts dagegen einzuwenden; er wünsche in kürzester Frist zu seinem Ziele zu kommen und wolle auch nicht von seinem Rechte Gebrauch machen, des Königs Gnade um Milderung der Strafe anzurufen, um den Vollzug des Verdikts nicht zu verzögern. Bei dieser Erklärung blieb er, trotzdem sein Verteidiger ihn zu anderer Ansicht zu bringen suchte. Es blieb diesem nichts weiter übrig, als seinem Willen entgegen zu handeln und aus eigener Machtvollkommenheit sich an den König zu wenden. Damit verging Tag um Tag, Woche um Woche, und Holzwart erwartete vergeblich das Ende eines Lebens, das für ihn allen Wert und Reiz eingebüßt hatte. Er glaubte, durch seine Verzichtleistung auf jeden Einspruch alle Hindernisse am besten beseitigt zu haben, und es gewann den Anschein, als siege wieder sein altes böses Schicksal, das immer seine Hoffnungen durchkreuzt hatte. Durch die seltene Verzichtleistung wurde ein Bericht nach dem anderen nötig, eine Formalität nach der anderen; bis zum September zogen sich die Verhandlungen hin, bevor man endlich dem König das Todesurteil vorzulegen bereit war.
Während der Zeit saß Holzwart geduldig im Gefängnis und harrte auf seinen Tod. Man gestattete ihm zu lesen, zu schreiben und Schach zu spielen. Er verfertigte die Schachfiguren aus Brot und malte mit Tinte ein Schachbrett auf Pappe. Es gehörte zu seiner größten Freude, wenn der Aufseher Zeit gewann, mit ihm Schach zu spielen.
Unter den Aufzeichnungen, die er zu Papier brachte, fanden sich Gedichte wie dieses:
Dann Tagebuchblätter.
Am 10. März.
O könnt ich dem Zauber Worte geben, der wie ein Glück meinen Schlaf durchzieht. Nicht gaukelnd beschleicht mich der Träume Spiel – nein, göttlich beglückend – o, welche Wonne, wenn mein Bruder, wenn meine Kinder, die Mutter, die Eltern erscheinen. – Vor den Richterblicken der Welt mag es unverdient heißen, doch in Träumen liegt mein Glück. Mein liebstes Kind saß mir auf meinen Knien – so war es mir heute, ich saß mit ihr bei allen Meinen. Das Kind umschlang mich süß und dicht, die andern schmiegten sich an mich – von ferne sah die Mutter dieser Teuern auf uns und sprach: »Ach, daß du diese Tat hast tun können – wie schwer muß sie dir geworden sein!«
Im April.
Bedarf es denn vor jenem Weltenrichter des Eingeständnisses der Tat? Nein! Nein! Er wußt sie ja, er braucht nun nicht zu fragen, er sah sie, kennt sie also schon genug. Rechtfertgen soll ich sie? Es blieb den Meinen nur Schmach und Elend – damit rechtfertige ich mich in Ewigkeit. Verkündet nur bald, wenn alles vollbracht, dem Lebensmüden die ewige Nacht.
Im April.
Ich will nichts glauben, will nichts denken, was die Vernunft nicht faßt. Annehmen und feststellen nichts, was gegen die Natur verstößt. Und doch komme ich immer darauf zurück – es gibt noch ein Etwas, nach welchem der Blick der Sterblichen vergeblich forschend sich richtet.
Im August.
Fünf Monate nach dem verkündeten Spruche. Himmel, diese Umstände um einen einzigen Menschen. Ich weiß nicht, ob man bei einer Frage von Krieg und Frieden so viel Zeit gebraucht, und daran hängt das Leben von Tausenden!
Es gibt ein Etwas im großen Weltenraume, das unheilvoll sein Wesen treibt, und eine dunkle Ahnung sagt mir nur: es waltet gegen dich! Es waltet unsichtbar, es waltet stumm und grausig, dies dämonische Wesen des Geisterreichs.
Das Jahr ging zu Ende, ohne das vom König bestätigte Urteil zu bringen. Das Gerücht von der Freigeisterei des seltsamen Verbrechers drang in die höheren Kreise und füllte manches gläubige Herz mit Entsetzen. Die entschiedene Weigerung Holzwarts, den Geistlichen zu empfangen, seine ebenso entschiedene Ablehnung einer geistlichen Begleitung zum Richtplatz, und das finstere und verschlossene Wesen, das er zeigte, wenn der Gefangenenprediger bei ihm eintrat, verbreitete ein wahres Grauen vor ihm. Es wurden Versuche gemacht, ihn zu erleuchten, aber man stieß auf klare und festgegründete Überzeugungen statt auf bösen Willen und dumpfe Verstocktheit, die man vorausgesetzt, und dagegen war aller fromme Bekehrungseifer machtlos.
Das Jahr 1848 regte seine gewaltigen Schwingen. Die Unruhen wurden stürmisch. Im Februar unterzeichnete der König das Todesurteil, und endlich wurden Anstalten zur Hinrichtung getroffen. Es gab bei Magdeburg einen Anger, wo manches blutige Haupt gesunken, mancher menschliche Leib von den Rädern zerstampft worden war. Hier sollte auch für Holzwart das Schafott errichtet werden; die königliche Gnade hatte die Strafe des Räderns in die der Enthauptung verwandelt. Der Tag wurde anberaumt, eine Truppenabteilung war schon kommandiert. Noch wußte Holzwart nichts von den Veranstaltungen zu seinem nahen Ende, aber ihm ahnte etwas. Die Nachgiebigkeit des Wärters verriet ihm zuerst die Nähe seines Endes. Aber er fragte nicht, er zagte nicht; sein Auge blieb ruhig und sein Herz stark. Alles war bereit, der Scharfrichter bestellt, da brach der Volksaufstand los. Die Bande des Gesetzes waren gelöst, und die Behörde scheute sich, eine Hinrichtung vollziehen zu lassen. Der Termin wurde vertagt.
Vielleicht war dem Gefangenen doch manches Wort zu Ohren gedrungen, das ihm den Stand der Dinge verraten hatte, und wieder wie ehedem rief es in ihm: du stirbst nicht, kannst nicht sterben. Es bemächtigte sich seiner eine schmerzliche Unruhe; seine Geduld wich zuzeiten einer kurzen aber tiefen Erregung, und seine Papiere bezeugen es, daß ihm davor bangte, das Leben noch lange ertragen zu sollen.
Im Mai 1848.
Ein Mann, der edlen Trotz besitzt, sollte der voll ruhigen Gleichmuts nicht in Freude und Leid die Grenzen wissen? Welch ewiges Schwanken zwischen Leben und Tod, von heute zu morgen, von morgen noch weiter. Armer König, immer Schach! Immer Schach! Schach bis zum matt.
Im Juni.
Sie zögern. Und ich grüble. Was hält mich? Was möchte ich noch? Das Grab der Meinen sehen, die Erde küssen, wo die Schlummernden ruhen. Unbegreiflich, daß ich mich bis jetzt ließ vertrösten.
Es findet sich die amtliche Anzeige des Gefängnisinspektors an den Richter, daß Holzwart seit fünf Tagen die Speisen unangerührt lasse und auf alle Vorwürfe die Antwort erteilt habe, er werde sein Ziel zu erreichen wissen. Der Richter stellte ihn ernstlich zur Rede, und Holzwart scheint Reue empfunden zu haben, denn er schrieb am 4. Juli:
»Genug, genug! Ich will alles ertragen. Der Ernst in seinem Auge; das harte Wort: Wenn Sie sich der verdienten Strafe entziehen, muß ich Sie für einen Feigling halten! Ich beuge mich. Mein Leben sei ein tributpflichtiges Opfer.«
Er kehrte zu der geduldigen Gelassenheit zurück, nachdem er vergeblich den Kampf mit seinem Geschick gewagt hatte. Als im preußischen Staate die Ordnung wiederhergestellt war, wurde das Todesurteil Holzwarts in lebenswierige Zuchthausstrafe verwandelt. Es muß ihn ein ungeheurer Schrecken bei der Verkündigung dieses neuen Urteils erfaßt haben; eine mit flüchtiger Schrift gemachte Aufzeichnung, die letzte, die überhaupt vorhanden ist, lautet: Am Leben bleiben, solche Gnade! Gezüchtigt durch Zuchthaus für eine solche Tat! Es kann nicht sein, es darf nicht sein!
Seit der Gewißheit seines Schicksals sprach er überhaupt nicht mehr. Eine kalte Entschlossenheit lag auf seinem Gesicht, und die freundliche Ruhe seiner Mienen war düsterem Ernst gewichen. Im Zuchthaus fügte er sich streng der Ordnung und zeigte sich im Benehmen und im Fleiß exemplarisch. Daß er still und abgeschlossen seinen Weg verfolgte, schien jedermann natürlich. Man hatte nicht verfehlt, der Direktion des Zuchthauses die Selbstmordversuche Holzwarts selbst mitzuteilen, um sich bei den jetzt vermehrten Gründen zu solcher Tat der Verantwortung zu entheben. Die Furcht schien unnütz. Ein Monat nach dem andern verlief, ohne der gesteigerten Aufmerksamkeit den geringsten Verdacht zu geben. Um so unerwarteter wirkte die amtliche Nachricht von Halle:
Der von dem Königlichen Kreis- und Stadtgericht hier eingelieferte Christian Holzwart aus Magdeburg stürzte sich am Sonntag, den 28. Januar 1850 nachmittags um drei Uhr bei Ausgang aus der Kirche von der Verbindungsbrücke des Flügels B und blieb auf der Stelle tot liegen, indem er sich den Hirnschädel gespalten und fast alle Glieder zerschmettert hatte.
So war der unglückliche Mann zur ersehnten Ruhe gekommen. Mit welchen Gefühlen mag er die acht Monate im Zuchthaus in Gemeinschaft mit Menschen erlebt haben, die er als das Verächtlichste im weiten Weltenraum bezeichnet hat? Mit welchen Gefühlen mag er die Tiefe des Abgrunds ermessen haben, bevor er sich hinunterstürzte? Den Tod zu zwingen, das war vielleicht seine stärkste Regung.
Die siebzehnjährige Vormundschaft der Herzogin-Mutter Amalia bedeutet ein unvergängliches Ruhmesblatt in der deutschen Geschichte, denn unter ihr wurde Weimar der Sammelpunkt jener Genien, denen die Unsterblichkeit sicher ist und durch die der Hof von Weimar einen stillen, aber hohen Glanz erhielt, wie er von keinem andern deutschen Hof jemals ausgegangen ist.
Amalie von Braunschweig war, als sie die Regierung antrat, erst achtzehn Jahre alt; fünf Jahre des siebenjährigen Krieges fielen noch unter ihre Herrschaft. Die Männer, die sie im Hof- und Zivildienst vorfand, waren alle noch aus der alten Schule; desto neuer war ihre Persönlichkeit, und mit dieser setzte sie es durch, daß man sie ihre eigenen Wege gehen ließ. Die Erziehung, die sie ihrem Sohne, dem künftigen Herzog, gab, machte Epoche in der deutschen Prinzenerziehung; sie wagte es, ihn sich in voller Freiheit entwickeln zu lassen, ja sie berief sogar einen Poeten zu seinem Erzieher, den heitern Wieland, der damals Professor in Erfurt war und eben den goldenen Spiegel geschrieben hatte, einen Fürstenspiegel, der auf den jungen Kaiser Josef gerichtet war.
Ein ungenannter Turist des achtzehnten Jahrhunderts, der in Weimar zum Hofball geladen war, schildert die Herzogin wie folgt: »Sie ist klein von Statur, sieht wohl aus, hat eine spirituelle Physiognomie, eine braunschweigische Nase, schöne Hände und Füße, einen leichten und doch majestätischen Gang, spricht sehr schön, aber geschwind, und ihr ganzes Wesen ist angenehm. Es war auch ein Pharaotisch da, der geringste Einsatz war ein halber Gulden. Die Herzogin spielte sehr generös und verlor einige Louisdor; da sie aber gern tanzte, blieb sie nicht lange beim Spiel. Sie tanzte mit jeder Maske, die ihr entgegenkam, und ging nicht eher fort als bis um drei Uhr früh, da alles aus war.«
Gouverneur der Prinzen Karl August und Konstantin war der Graf von Schlitz-Görtz, ein ernster, gravitätischer und formenstrenger Herr, der mit Nachdruck auf Etikette hielt, aber doch im privaten Kreis allerlei Kurzweil zuließ. Friedrich der Große hatte ihn während des bayrischen Erbfolgekrieges zu einer diplomatischen Mission in München verwendet, später war er Gesandter beim Reichstag zu Regensburg, wo er das deutsche Reich begraben sah. Daß er ein Mann von Geist war, bezeugt der Umstand, daß er Wieland an die Herzogin empfahl. Wieland zog wieder Knebel als Erzieher des Prinzen Konstantin nach Weimar, und Knebel war es, der dem jungen Karl August Goethe zuführte. Goethe berief Herder, und Herder wurde der Magnet für Schiller.
Karl Ludwig von Knebel war ein gebürtiger Franke; er war Major unter Friedrich dem Großen und stand in Potsdam in Garnison. Interessant durch seine barocke Genialität, war er zugleich ein tiefer Hypochonder. Durch eine krankhafte Empfänglichkeit für unangenehme äußere Eindrücke war er von ihnen abhängig und durch sie gestört. Wieland war sein Intimus, Lucrez, den er ins Deutsche übersetzte, sein langjähriges Studium. Herder nannte ihn seinen lieben alten Mönch und den menschenfreundlichen Timon. Es war am 11. Februar 1774, als Knebel seinem Herzog den Verfasser des Götz und des Werther vorstellte. Auf die Einladung des Grafen Görtz kam Goethe in das rote Haus in Frankfurt, und in seiner jugendlichen Schönheit und Liebenswürdigkeit schien er dem Herzog wie geschaffen, der Genosse bei einem lustigen Genieleben zu werden, wie es ihm damals im Sinne stand. 1775 wurde Goethe förmlich nach Weimar eingeladen. Der in Karlsruhe zurückgebliebene Kammerjunker von Kalb hatte den Befehl, Goethe in einem von Straßburg erwarteten Staatswagen nach Weimar zu bringen. Der Wagen blieb lange aus, Goethes fürstenfeindlicher Vater hatte ihm schon mit dem spottenden Zuruf: »Nah bei Hof, nah bei der Höll« die Furcht in die Seele geworfen, er könne nur der Spielball einer fürstlichen Laune gewesen sein; er hatte bereits die Flucht angetreten und befand sich in Heidelberg, als er dort noch aufgehalten wurde. So hing es an einem Faden, daß Goethe nicht nach Weimar kam; noch in späten Jahren hat er sich des wahrhaft Dämonischen dieser Situation erinnert.
»Goethe ging wie ein Stern in Weimar auf, der sich eine Zeitlang in Wolken und Nebel verhüllte,« schreibt Knebel; »jeder hing an ihm, sonderlich die Damen. Er hatte noch die Werthersche Montierung an, und viele kleideten sich danach. Er hatte noch von dem Geist und Sitten des Romans an sich, und dieses zog an. Sonderlich den jungen Herzog, der sich dadurch in Geistesverwandtschaft seines Helden zu setzen glaubte. Manche Exzentrizitäten gingen zur selbigen Zeit vor, die ich nicht zu beschreiben Lust habe, die uns aber auswärts nicht in den besten Ruf setzten. Goethes Geist wußte ihnen indessen einen Schimmer von Genie zu geben.«
Die Gerüchte über die Zustände in Weimar mußten von recht schlimmer Art gewesen sein, da sogar Klopstock den auffallenden Schritt tat, sich als Mentor und Warner einzumischen. Goethe wies ihn mit Entschiedenheit zurück, und es kam zum Bruch zwischen beiden.
Einen besondern Hof neben dem des Herzogs, dem regierenden Hof, wie er hieß, bildete der sogenannte verwitwete Hof der Herzogin Amalie. Wieland nennt die Herzogin eines der liebenswürdigsten Gemische von Menschheit, Weiblichkeit und Fürstlichkeit; sie hatte nicht wenig Gefallen an dem Leben, das ihr Sohn mit Goethe führte, und nahm selbst daran teil. Schon als Regentin hatte sie wie ein halber Student gelebt; einmal war sie auf einem Heuwagen mit acht Personen von Tieffurt nach Tennstädt gefahren, es kam ein Gewitter mit einem heftigen Regenguß, und die Herzogin, die wie die andern Damen in ganz leichtem Kleide war, zog Wielands Oberrock an. Sie faßte alles mit Enthusiasmus an und auf. So lernte sie Griechisch, und zwar so gut, daß sie nach kurzer Zeit den Aristophanes in der Ursprache lesen konnte. Am begeistertsten trieb sie Musik, malte auch und schwärmte für Italien und die italienische Literatur, in der ihr Führer der Rat Jagemann war, ein aus Konstanz entflohener Mönch. Die theatralischen Feste Amalies wurden entweder in der Stadt abgehalten oder in den Sommersitzen der Herzogin, in Tieffurt oder in Ettersburg. Namentlich im Park von Ettersburg wurden vor dem vertrauten Kreise der Fürstin viele lustige Gelegenheitsstücke gegeben, so 1778 Goethes Jahrmarkt in Plundersweilen, und 1779, zur Feier von Karl Augusts Geburtstag, eine derbe Parodie der Wielandschen Alceste. Die Arie: »Weine nicht, du Abgott meines Lebens« wurde auf die lächerlichste Art mit dem Posthorn begleitet, und auf den Reim schnuppe ein unendlich langer Triller gesungen. Nach dem Stück folgte die sogenannte Kreuzerhöhungsgeschichte mit einem üblen Buch von Jacoby; Merck nagelte das Buch mit dem Einband an einen Baum, so daß die Blätter im Winde flatterten, Goethe stieg in den belaubten Wipfel und hielt von dort herab ein hochnotpeinliches Halsgericht über die Scharteke.
Neunzehn Jahre war Karl August alt, als er die berühmte Erklärung gab, die den in sein Konseil einberufenen Dichter betrifft. Sie lautet: »Einsichtsvolle wünschen mir Glück, diesen Mann zu besitzen. Sein Kopf, sein Genie ist bekannt. Einen Mann von Genie an einem andern Orte gebrauchen, als wo er selbst seine außerordentlichen Gaben gebrauchen kann, heißt ihn mißbrauchen. Was aber den Einwand betrifft, daß dadurch viele Leute sich für zurückgesetzt erachten würden, so kenne ich erstens niemand in meiner Dienerschaft, der meines Wissens auf dasselbe hoffte, und zweitens werde ich nie einen Platz, welcher in so genauer Verbindung mit mir, mit dem Wohl und Wehe meiner gesamten Untertanen steht, nach der Anciennität, sondern ich werde ihn immer nur nach Vertrauen geben. Das Urteil der Welt, welches vielleicht mißbilligt, daß ich den Doktor Goethe in mein wichtigstes Kollegium setzte, ohne daß er zuvor Amtmann, Professor, Kammerrat und Regierungsrat war, ändert gar nichts. Die Welt urteilt nach Vorurteilen. Ich aber sorge und arbeite wie jeder andere, nicht um des Ruhmes, um des Beifalls der Welt willen, sondern um mich vor Gott und meinem Gewissen rechtfertigen zu können.«
Er war eher klein als groß von Gestalt, aber in seiner Erscheinung lag von der Jugend bis in das späteste Alter etwas Selbständiges und Energisches in sehr ungebundener und freier, fast studentischer Form; man pflegte ihn auch den Studenten von Jena zu nennen. Dem Major Knebel gegenüber legte der vierundzwanzigjährige Fürst einmal folgendes Selbstbekenntnis ab: »Ich muß erstaunlich wehren, meinem Herzen und den Leidenschaften nicht die Zügel schießen zu lassen; es ist gar zu schwer, sich wieder in den unnatürlichen Zustand zu fügen, in dem unsereiner leben muß und an den man so langsam sich gewöhnt zu haben glaubt.«
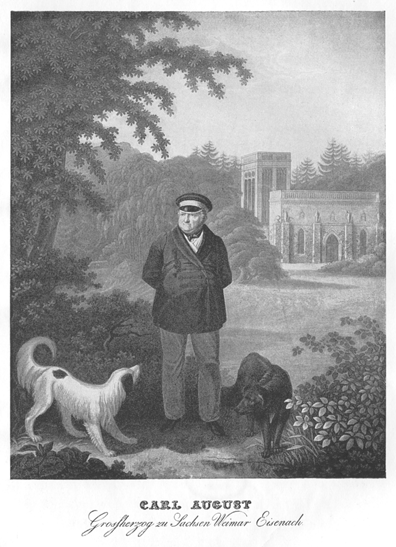 |
| Karl August von Weimar, |
| nach einem Steindruck von C. A. Schwerdgeburth; 1824. |
Merck, Goethes wunderbarer Freund, ließ sich, als alle Welt über die Streiche, die Karl August nach seiner Bekanntschaft mit Goethe machte, die Köpfe schüttelte, nicht beirren und vertrat nachdrücklich den Wert des seltenen Fürsten. Am 3. November 1777 schrieb er aus Darmstadt an den Buchhändler Nikolai in Berlin: »Ich hab Goethe neuerlich auf der Wartburg besucht, und wir haben zehn Tage zusammen wie die Kinder gelebt. Mich freuts, daß ich von Angesicht gesehen habe, was an seiner Situation ist. Das Beste von allem ist der Herzog, den die Esel zu einem schwachen Menschen gebrandmarkt haben und der ein eisenfester Charakter ist. Ich würde aus Liebe zu ihm eben das tun, was Goethe tut. Die Märchen kommen alle von Leuten, die ohngefähr so viel Auge haben, zu sehen, wie die Bedienten, die hinterm Stuhle stehen, von ihren Herrn und deren Gespräch beurteilen können. Dazu mischt sich die scheußliche Anekdotensucht unbedeutender, negligierter, intriganter Menschen, oder die Bosheit anderer, die noch mehr Vorteil haben, falsch zu sehen. Ich sage Ihnen aufrichtig, der Herzog ist einer der respektabelsten und gescheitesten Menschen, die ich gesehen habe.«
Wie Goethe, liebte es Karl August, sich nach den Aufregungen des Weltlebens in die Einsamkeit zu begeben. Er suchte dann die Borkenhütte im Park auf und konnte, während Goethe in seinem Gartenhaus am Stern weilte, mit dem Freund durch verabredete Zeichen eine telegraphische Konversation über das Tal der Ilm hinweg herstellen. Im Sommer 1780 schrieb er aus diesem Retiro an Knebel: »Es hat neun Uhr geschlagen, und ich sitze hier in meinem Kloster mit einem Licht am Fenster. Der Tag war außerordentlich schön, ich war so ganz in der Schöpfung, und so weit vom Erdentreiben. Der Mensch ist doch nicht zu der elenden Philisterei des Geschäftslebens bestimmt; es ist einem ja nicht größer zumute, als wenn man so die Sonne untergehen, die Sterne aufgehen, es kühl werden sieht und fühlt, und das alles so für sich, so wenig der Menschen halber; und doch genießen sie’s, und so hoch, daß sie glauben, es sei für sie. Ich will mich baden mit dem Abendstern und neu Leben schöpfen, der erste Augenblick darauf sei dein. Lebewohl solange.« Nach dem Bad in der Ilm fährt er fort: »Das Wasser war kalt, denn die Nacht lag schon in seinem Schoß. Als ich den ersten Schritt hineintat, war’s so rein, so nächtlich dunkel; über den Berg hinter Oberweimar kam der volle rote Mond. Es war so ganz still. Wedels Waldhörner hörte man nur von weitem, und die stille Ferne machte mich reinere Töne hören, als vielleicht die Luft erreichten.«
In den achtziger und neunziger Jahren hatte sich der Charakter des Herzogs zu seiner Reife ausgebildet; der junge Wein hatte sich geklärt, er stand jetzt goldrein im Pokale. »Täglich wächst der Herzog und ist mein bester Trost,« schrieb Goethe 1780 an Lavater. Aber in den Briefen an die Frau von Stein findet sich auch manches schärfere Urteil über Karl August, das freilich später immer wieder gemildert wurde. Einmal äußerte er sich: »Mich wundert nun gar nicht mehr, daß Fürsten meist so dumm, toll und albern sind, nicht leicht hat einer so gute Anlagen als der Herzog, nicht leicht hat einer so gute und verständige Menschen um sich und zu Freunden als er, und doch will’s nicht nach Proportion vom Flecke, und das Kind und der Fischschwanz gucken, eh man sich’s versieht, wieder hervor.« Vielleicht beirrte es Goethe und machte ihn ein wenig bitter, daß der Herzog häufig sehr mutwillige Neckerei mit seiner Beziehung zu Frau von Stein trieb. Einmal enthielt er ihm einen ihrer Briefe vor und schickte ihn dann durch einen Husaren in zehn übereinander gesiegelten Kuwerten mit folgenden Verszeilen:
Der Herzog hatte aber auch seine Herzensfreundin, und das war die Gräfin Werthern. Mit seiner Frau vertrug er sich schlecht. Die Herzogin Luise war eine formenstrenge Dame und hielt so stark auf Zeremoniell, daß es Mühe kostete, Goethe zur Spielpartie bei ihr einzuschmuggeln. Im September 1776, vor der Fahrt nach Ilmenau, schrieb Goethe an Charlotte von Stein: »Es ist mir lieb, daß wir wieder auf eine abenteuerliche Wirtschaft ausziehen, denn ich halt’s nicht aus. So viel Liebe, so viel Teilnahme, so viele treffliche Menschen, und so viel Herzensdruck.«
Die Herzogin war im höchsten Grade schwerblütig und schwerlebig, einsam in der Welt, ohne Freund, sogar Frau von Stein und Herder waren ihr zu leicht. Bei der Gräfin Werthern war der unruhige Herzog noch am ehesten festzuhalten. 1782 schreibt er an Knebel: »Auf Ostern besuche ich die Gräfin, welche doch die beste aller Gräfinnen ist, die ich kenne.« Um dieselbe Zeit schreibt Goethe: »Der Herzog ist vergnügt, doch macht ihn die Liebe nicht glücklich, sein armer Schatz ist gar zu übel dran, an den leidigsten Narren geschmiedet, krank und für dies Leben verloren. Sie sieht aus und ist wie eine schöne Seele, die aus den letzten Flammenspitzen eines nicht verdienten Fegefeuers scheidet und sich nach dem Himmel sehnend erhebt.« Der Graf Werthern war nämlich ein hocharistokratischer Sonderling, zuzeiten verschwenderisch, zuzeiten geizig wie ein Filz. Er hatte eine seltsame, spanisch zeremonielle Hausordnung eingeführt; kamen vornehme Gäste, so ließ er Bauernjungen, die als Neger geschwärzt und kostümiert waren, bei Tisch aufwarten. Die Gräfin war zwar eine kleine Dame, hatte aber die größten Manieren, und Goethe gestand, daß er alles, was er von Welt besaß, von ihr gelernt hatte.
Der Herzog gab sehr viel Geld für Jagd und Tafelfreuden aus, und oft finden sich unwillige Äußerungen Goethes über die Schmarotzer bei Hof und ihre Unersättlichkeit. In einem Brief an Knebel heißt es: »Selbst der Bauersmann, der der Erde das Notdürftige abfordert, hätte ein behaglich Auskommen, wenn er nur für sich schwitzte. Du weißt aber, wenn die Blattläuse auf den Rosen sitzen und sich hübsch dick und grün gesogen haben, dann kommen die Ameisen und saugen ihnen den filtrierten Saft aus den Leibern, und so geht’s weiter, und wir haben’s so weit gebracht, daß oben immer an einem Tage mehr verzehrt wird, als unten in einem beigebracht werden kann.«
So großmütig und freigebig der Herzog sein konnte, so fehlten ihm doch häufig die Mittel, um diejenigen, die der Hilfe würdig waren, in würdiger Weise von Not zu befreien; deshalb mußte auch Schiller am Hof zu Weimar ein gar trauriges und bedrücktes Leben führen. Es war nicht so viel Geld für ihn da wie für irgendeinen Kammerjunker, und wie Beethoven durch englisches, wurde Schiller schließlich durch dänisches Geld der schlimmsten Sorgen überhoben. Um Charlotte Lengefeld heiraten zu können mußte er sich um die Professur in Jena bewerben, die zweihundert Taler trug, aber Schiller war von so edler und vornehmer Art, daß er dem Herzog selbst für das Wenige, das er für ihn tat oder tun konnte, Dankbarkeit bewahrte. Karl Augusts Finanzen waren eben zeit seines Lebens in Unordnung. Fast unmöglich hielt es, ihn zu gewöhnen, daß er seine Ausgaben in das richtige Verhältnis zu seinen Einnahmen setzte. In späteren Jahren machte er alle seine Geschäfte mit Rothschild; wenn er in Geldverlegenheit war, ließ er seinen Wagen anspannen und fuhr nach Frankfurt.
Sonderbar waren in ihm die Eigenschaften gemischt, leichter Sinn und burschikose Laune, und dann wieder sittlicher Ernst und Tiefe des Gemüts. Von diesem Ernst und dieser Tiefe legt ein überaus herrlicher Brief Zeugnis ab, den er am 4. Oktober 1781 an Knebel schrieb. Als der Prinz Konstantin mit dem Mathematiker und Physiker Albrecht auf Reisen ging, war Knebel, der bisher der Erzieher des Prinzen gewesen war, pensioniert worden. Im Unmut darüber hatte er den Plan gefaßt, wieder in preußische Dienste zu treten; von diesem Entschluß brachte ihn der Herzog durch folgenden Brief ab.
»Sind denn die, die sich Deiner Freundschaft, Deines Umgangs freuen, so sklavisch, so sinnlicher Bedürfnisse voll, daß Du nur durch Graben, Hacken, Ausmisten und Aktenverschmieren ihnen nützen kannst? Ist denn das Rezeptakulum ihrer Seelen so gering, daß Du nirgends ein Plätzchen findest, wo Du irgend etwas von dem, was die Deine Schönes, Gutes und Großes, die innere Existenz der Edlen bessernd und veredelnd, gesammelt hat, ausfüllen kannst? Sind wir denn so hungrig, daß Du für unser Brot, so furchtsam und unstet, daß Du für unsere Sicherheit arbeiten mußt? Sind wir nicht mehrerer Freuden als der des Tisches und der der Ruhe fähig, können wir keinen Genuß finden, wenn Du, von dem Schmutz und dem Gestank des Weltgetriebes Reiner, Deine volle Zeit zur Schmückung des Geistes anwendend, uns, die wir nicht Zeit zum Sammeln haben, den Strauß von den Blumen des Lebens gebunden vorhältst? Sind unsre Klüfte so quellenlos, daß wir nicht eines schönen Brunnens brauchen, uns selbst unsrer Ausflüsse freuend, wenn sie schön in demselben aufgefaßt sind? Sind wir bloß zu Ambossen der Zeit und des Schicksals gut genug, und können wir nichts neben uns leiden als Klötze, die uns gleichen und nur von harter, anhaltender Masse sind? Ist’s denn ein so geringes Los, die Hebamme guter Gedanken und in der Mutter zusammengelegter Begriffe zu sein? Ist das Kind dieser Wohltäterin fast nicht ebenso sehr sein Dasein schuldig als der Mutter, die es gebar? Die Seelen der Menschen sind wie immer gepflügtes Land; ist’s erniedrigend, der vorsichtige Gärtner zu sein, der seine Zeit damit zubringt, aus fremden Landen Sämereien holen zu lassen, sie auszulesen und zu säen? Muß er nicht etwa daneben auch das Schmiedehandwerk treiben, um seine Existenz recht auszufüllen? Bist Du nun so im Bösen, so über Dich selbst erblindet, daß Du Dir einbilden könntest, Du habest uns nie dergleichen Nutzen verschafft, und achtest Du uns gering genug, daß Du glauben könntest, wir würden Dich so lieben wie wir tun, wärest Du uns hierin unnütz und überflüssig oder entbehrlich gewesen? Willst Du nun dieses schöne Geschäft, diese würdige Laufbahn aufgeben, alle eingewachsenen Bande ausreißen, gleich einem Anfänger eine neue Existenz ergreifen und Dich, Gott weiß wohin, unter Menschen, die Dich nichts mehr angehen und mit denen Du kein reines und Dir gewohntes Verhältnis hast, hinwerfen? Neuen Anteil ergreifen oder Dir machen, mehr Gute, mehr Böse kennen lernen, sehen, wie die Abscheulichkeiten so überall zu Hause, das Gute überall so befleckt ist? Und warum? Um etwa einigen Kanzlistenseelen aus dem Wege zu gehen, die Dir Deine Semmel, die Du mehr hast als sie, beneiden, weil Du nicht gleich ihnen Maultierhandwerk treibst? Und wohin willst Du Dich flüchten? Nimmst Du nicht überall Deine paar Semmeln mit, die Du mehr und leichter hast als andere? Sind nicht überall Knechte, die es entbehren und Dich darum beneiden werden? Wirst Du deren Neid besser aushalten? Dich, weil Du dort ein paar Monate fremd bist, von ihnen mehr geachtet halten, als Du es hier sein möchtest? Siehst Du etwas Erreichbares vor Dir, das Dir das, was Du entbehrst, ersetze? Ist dieses Erreichbare so gewiß? Schlägt’s fehl, kann es Deine Existenz dann ertragen, immer neue Zwecke zu machen, oft abgeschlagen zu werden und so herumzuirren? Willst Du also das Beständige für das Unbeständige hingeben? Laß uns die Sache nicht so feierlich nehmen und das Übel nicht für so unheilbar halten. Ist’s Deiner Natur gut, sich zu verändern, so reise. Warum sich immer ersäufen wollen, wenn’s mit einem schönen Bade getan ist?«
Es ging damals eine wohltätige Umwandlung mit dem Herzog vor; gleich Goethe gab er sich mehr und mehr dem Studium der Natur hin, um 1784 schrieb er an Knebel: »Die Naturwissenschaft ist so menschlich, so wahr, daß ich jedem Glück wünsche, der sich ihr auch nur etwas ergibt ... Sie beweist und lehrt so bündig, daß das Größte, das Geheimnisvollste, das Zauberhafteste so ordentlich, einfach, öffentlich, unmagisch zugeht; sie muß doch endlich die armen unwissenden Menschen von dem Durst nach dem Außerordentlichen heilen, da sie ihnen zeigt, daß das Außerordentliche so nahe, so deutlich, so unaußerordentlich, so bestimmt nahe ist.«
Das Jahr 1789 brachte auch für den Weimarer Hof Veränderungen mit sich, besonders im Hinblick auf sparsamere Wirtschaft. Herder schreibt an Knebel: »Der Hof ist wieder hier und die Tafel an demselben abgeschafft. Die Herren Mitesser bekommen Kostgeld, die Damen speisen mit dem fürstlichen Ehepaar auf des Herzogs Zimmer, und jedesmal wird ein Fremder dazu gebeten. Sie können denken, was die Hofdamen dazu sagen, und es ist unbegreiflich, daß sie nicht schon aus Furcht vor zukünftiger langen Weile zum voraus verschmachten.«
Über die französische Revolution äußerte sich der Herzog am 13. Januar 1793, eine Woche vor der Hinrichtung Ludwigs XVI., wie folgt: »Wer die Franzosen in der Nähe sieht, muß einen wahren Ekel für sie fassen; sie sind alle sehr unterrichtet, aber jede Spur eines moralischen Gefühls ist bei ihnen ausgelöscht ... Der Mensch war nie, die Zone, unter der er lebte, mag sein wie sie wolle, er war nie, sage ich, zur Treibhauspflanze bestimmt. Sobald er diese Kultur erhält, geht er zugrunde; auch beurteilt man die Franzosen falsch, wenn man glaubt, ihre Reife habe sie auf den jetzigen Punkt gebracht. Eines unterdrückte das andere im Reich, und nun unterdrücken die Unterdrücker selbst ihre alten Beherrscher, weil diese nachlässig und stupid waren. Nicht das mindeste Moralische liegt dabei zum Grunde, sondern man hat jetzt eine Art Moralität oder eine philosophische Zunft zum Werkzeug gebraucht.«
Die Abneigung Karl Augusts gegen die Franzosen hatte ihre Ursache darin, daß er sich ihnen gegenüber ganz und gar als Deutscher fühlte. Karoline von Wolzogen schrieb darüber einmal an Schiller: »Ich dankte auch dem Himmel beim Lesen des Mirabeau, daß alles, was mir lieb ist, nichts mit der Politik zu tun hat. An wie armseligen Fäden hängen diese Weltbegebenheiten! Es muß ein unsichtbares Gewebe das Menschengeschlecht umstricken und so zusammenhalten wie es hält; was diese Menschen dabei zu tun wähnen, kann nicht viel sein. So klein und eng sind sie, keine Spur eines bessern Wesens, das sich selbst an die allgemeine Glückseligkeit hingäbe, jeder denkt nur an einen bequemen Platz für sich, um darauf zuzusehen; sie haben nicht einmal die Energie, um herrschen zu wollen. Des Mirabeau Nationalstolz ist kindisch und ärgerlich, man könnte aus Depit deutsch sein wollen, wie der Tempelherr im Nathan Christ sein wollte, wenn man anders mit ihm zu tun hätte, glaub ich. Ich will dem Herzog von Weimar wohl darum, daß er Mirabeau übel begegnet hat.«
Im übrigen wurde das stille Weimar durch die großen Weltereignisse wenig berührt. Der Herzog, der zu Goethes Mißvergnügen eine wachsende Kriegslust an den Tag gelegt hatte, nahm 1794 an dem Feldzug in der Champagne teil; Goethe begleitete ihn, und wie man weiß, hat er dieses kriegerische Zwischenspiel wahr und meisterlich beschrieben. Es war in Karl August ein unstillbarer Drang, sich zu betätigen und auszuleben. So liebte er auch in seinen Herzensbeziehungen die Abwechslung. Als die Leidenschaft zur Gräfin Werthern vorüber war, wurde die reizende Sängerin und Schauspielerin Caroline Jagemann seine Favoritin. Für sie schrieb Goethe die Eugenie in der natürlichen Tochter. Sie war sehr schön und sehr ehrgeizig und stand den Werbungen Karl Augusts anfangs kühl gegenüber, denn eben ihres künstlerischen Ehrgeizes wegen hatte es nichts Verlockendes für sie, in einer kleinen Stadt und an einer kleinen Bühne die Mätresse eines Herzogs zu sein. Ihr Widerstreben steigerte die Leidenschaft Karl Augusts bis zur Verzweiflung. Endlich gab sie nach; sie blieb beim Theater, wurde aber zur Frau von Heygendorff erhoben. Es wird berichtet, daß sie noch in ihrem hohen Alter, als schon graue Locken das Gesicht umrahmten, von bezauberndem Reiz gewesen sei, besonders habe ihre Stimme etwas unvergleichlich Angenehmes gehabt. Frisch an Körper und Geist, war sie dem Herzog wie zugeschaffen, seinem innersten Bedürfnis entsprechend, selbst ihre Art sich auszudrücken war der seinen gemäß. Ihr Einfluß war groß und dauerte bis zum Tode des Herzogs. Ihre Hauptfeindin am Hof war die Gemahlin des Erbprinzen, die russische Großfürstin Marie, und es kam wohl vor, daß sie im Gefühl ihrer Überlegenheit diese der Zarentochter zu fühlen gab. Einmal hatte die Erbprinzessin bei einem Gang durch den Park ihre Freude an einer schönen Baumpartie ausgesprochen; als sie nach ein paar Tagen wieder vorüber kam, waren die schönen Bäume abgehauen. Frau von Heygendorff hatte den Herzog bestimmt, hierzu den Befehl zu geben. Weil Karl August fürchtete, daß seiner geliebten Freundin nach seinem Tod ein übles Schicksal widerfahren könnte, hatte er seinen Adjutanten unterwiesen, für den Fall, daß er außerhalb Weimars sterben sollte, den Kurier mit der Todesnachricht zuallererst zu Frau von Heygendorff zu schicken. Dieser Fall trat auch ein, und dem Befehl wurde buchstäblich Folge geleistet. Als die fürstliche Familie die Kunde von dem Tod des Herzogs bekam, hatte Frau von Heygendorff bereits ihren Wagen anspannen lassen und befand sich auf der Fahrt nach Mannheim, wo sie vordem, bei Iffland, ihre Ausbildung genossen hatte.
Karl August hatte auch für die Literatur der Ars amandi viel übrig und legte sich eine Bibliotheca erotica an, welche die seltensten Exemplare der Gattung enthielt. Er schenkte sie später seiner guten Freundin, der Gräfin Henckel, die sich sehr für das geheime Fach interessierte.
Die Verheiratung des Erbprinzen mit der Großfürstin veränderte alle Lebensverhältnisse in Weimar. »Sie können kaum einen Begriff haben von dem Glanz, der uns neuerlich umgibt,« schreibt Fräulein von Göchhausen im September 1804, »der Herzog ist mit drei russischen ganz von Juwelen strahlenden Orden geziert. Meine gute Fürstin strahlt nicht weniger ... Überhaupt reden wir jetzt von Gold, Silber und Edelsteinen wie sonst von Quarz, Gneis und Glimmer. Die wilden Völker, die noch mehr dergleichen bringen sollen, werden in diesen Tagen erwartet.« Die wilden Völker, das waren die Russen. Zwei Monate später schreibt das Fräulein: »Der Einzug war prächtig durch die unglaubliche Volksmenge, die in geordneten Wagen, zu Pferd und zu Fuß festlich entgegenwallten ... Es erschien alles ruhig und würdig, ich möchte es die frohe Teilnahme eines gebildeten Volks nennen. Am Montag kam die Großfürstin zum erstenmal ins Theater. Sie können sich den klatschenden Jubel kaum denken. Ein Vorspiel von Schiller wurde gegeben, hierauf folgte Mitridat. Diese Prinzessin ist ein Engel an Geist, Güte und Liebenswürdigkeit; auch habe ich noch nie in Weimar einen solchen Einklang aus allen Herzen über alle Zungen ergehen hören, als seit sie der Gegenstand aller Gespräche geworden. Sie tut wirklich Wunder; auch unser Vater Wieland ist begeistert und macht wieder Verse.«
Ein Jahr später kam der Kaiser Alexander nach Weimar zum Besuch seiner Schwester. Er wurde sehr gefeiert und bezauberte jedermann. Nach seiner Abreise schrieb Fräulein von Göchhausen an Böttiger: »Nächst dem Andenken im Herzen an den liebenswürdigen Kaiser hinterließ er auch blitzende Andenken in edlen Steinen. Sogar alle Hofdamen, worunter meine Wenigkeit sich auch befindet, erhielten reiche Geschenke an blitzenden Halsbändern, Kämmen und Gürtelschnallen. Der Kaiser, le comte du Nord, schickte Visitenkarten an die Damen vom ersten Rang und auch an Wieland. Künftigen Donnerstag kommt das erste preußische Regiment hier an; bald wird es wie in Wallensteins Lager hier aussehen. Unser Ländchen fühlt die schützende Nachbarschaft schwer. Die aufzubringenden Getreidelieferungen und die ins Land kommenden sechs- bis achttausend Mann lassen uns ängstliche Blicke in die Zukunft tun.«
Während der Einquartierung unterhielten sich einmal einige preußische Offiziere in einem Weinhaus über die Wohnungen, die sie gefunden hatten. Ein alter, dickbäuchiger Major sagte: »Ich stehe da bei einem gewissen Gothe oder Goethe, weiß der Teufel, wie der Kerl heißt.« Man machte ihn aufmerksam, es sei der berühmte Dichter Goethe, wo er stehe, da antwortete er: »Kann sein, ja ja, nu nu, das kann wohl sein, ich habe dem Kerl auf den Zahn gefühlt, und er scheint mir Mucken im Kopfe zu haben.«
Es kam nun die furchtbare Katastrophe der Schlacht von Jena und Auerstädt. Am 4. Oktober fuhren der König und die Königin von Preußen auf dem Wege nach Erfurt durch Weimar. Der Herzog befand sich bei dem preußischen Heere, das sein Oheim, der Herzog von Braunschweig, kommandierte. Die Herzogin-Mutter Amalie war nach Eutin geflohen, und in Weimar blieb nur die Herzogin Luise. Schon am Abend des Schlachttags trafen die gefürchteten Chasseurs ein, in der Nacht brach Feuer in der Nähe des Schlosses aus. Die Stadt wurde von den Franzosen drei Tage lang geplündert, manche Familie verlor Hab und Gut. Da sich Napoleon sehr ungehalten darüber zeigte, daß der Herzog von seiner Residenz abwesend und bei der preußischen Armee war, wurden zwei seiner treuesten Diener, der Oberforstmeister von Stein und der Leutnant von Seebach, abgeschickt, ihn zu suchen und zu eiliger Rückkehr aufzufordern. Ihr Unternehmen blieb ohne Erfolg, und in der Not verfiel man auf den jungen Regierungsrat Müller und betraute ihn mit der schwierigen Aufgabe, den Herzog vom Heeresdienst abzurufen und heimzuholen. Nach vielen Abenteuern und Irrfahrten traf Müller den Herzog in Berlin, aber Karl August war durchaus nicht geneigt, den gewünschten Fußfall vor dem Kaiser zu tun. Napoleon, obwohl höchst ungnädig gegen den Herzog gestimmt, ließ ihn doch nicht fallen und verwirklichte keine seiner Drohungen, denn er brauchte ihn zur Vermittlung beim Kaiser Alexander. Das kleine Land aber wurde durch die Kriegskontributionen in schwere Drangsale gestürzt, und nicht immer gelang es dem klugen und diplomatisch geschickten Friedrich von Müller, das größte Elend abzuwenden. Die Unnachgiebigkeit Karl Augusts, der es immer wieder verweigerte, vor Napoleon in Audienz zu erscheinen, trug auch nicht dazu bei, den Kaiser milder zu stimmen, wenngleich er der Herzogin Luise gegenüber eine große, vielleicht empfundene Hochschätzung an den Tag legte.
An den Festlichkeiten des Kongresses zu Erfurt nahm auch Weimar seinen Anteil. Napoleon hatte gewünscht, dem Kaiser Alexander das Schlachtfeld von Jena zu zeigen; dazu sollte eine große Jagd am Ettersberg und auf den Hügeln gegen Jena hin dienen. Friedrich von Müller berichtet darüber in seinen Memoiren:
»Am 6. Oktober war der Weg von Erfurt nach dem Ettersberg von früh an mit unzähligen Wagen, Reitern und Fußgängern bedeckt. Es war der schönste, klarste Herbsttag, kein Wölkchen am ganzen Himmel. In der Nacht vorher waren mehrere hundert Hirsche und Rehe aus dem Ettersburger Walde gegen einen großen freien Rasenplatz zusammengetrieben und umzäunt worden. In der Mitte dieses freien Platzes hatte man einen ungeheuren Jagdpavillon errichtet, 450 Schritte lang und 50 Schritte breit, mit drei Abteilungen, wovon die mittlere für die beiden Kaiser und für die Könige bestimmt war. Der Pavillon ruhte auf mit Blumen und Zweigen umschmückten Säulen. Dicht dabei sah man große, freistehende Balkone, von denen bequem das Ganze überschaut werden konnte. Ringsumher liefen Buden und Zelte mit Erfrischungen. An der Waldgrenze gruppierten sich um große Feuer zur Bereitung von warmen Speisen und Getränken eine Unzahl von Landleuten, die das Zusammentreiben des Wildes die ganze Nacht hindurch ermüdet hatte. Dazwischen ertönten muntere Jagdhörner und Gesänge. Die Monarchen, an der Landesgrenze von dem Herzog und der ganzen Jägerei zu Pferde empfangen, langten mit ihrem Gefolge unter dem Schalle der Jagdfanfaren gegen ein Uhr mittags an. Nun wurde in einzelnen Abteilungen das Wild aus dem umzäunten Walde heraus und so getrieben, daß es am großen Pavillon in Schußweite vorüber mußte. Napoleon ergötzte sich ungemein an diesem Schauspiel und schien überhaupt sehr vergnügt. Um vier Uhr endigte die Jagd; nicht der geringste Unfall hatte sie getrübt. Ich war in Erfurt zurückgeblieben und beauftragt, dem Kaiser Napoleon noch vor seiner Abfahrt aufzuwarten, worauf ich mich eiligst nach Weimar verfügen sollte. Es war fünf Uhr, als die Monarchen unter dem Geläute aller Glocken in Weimar einzogen. Wie Napoleon sich in die für ihn bereiteten Zimmer begab, war ich zufällig der erste, auf den seine Blicke im Vorzimmer trafen. Er ging sehr freundlich auf mich zu, tat mir mehrere Fragen, und ich mußte ihm einige umstehende, ihm noch nicht bekannte Personen vorstellen. Eine Stunde darauf ging es zur kaiserlichen Tafel. Unfern davon war in einer großen Galerie die Marschallstafel von mehr als hundertfünfzig Personen bereitet. Ich hatte dem Minister, Staatssekretär Maret und dem Marschall Soult die Honneurs zu machen, bei denen ich saß. Aber wir waren noch kaum bis zur Hälfte des Diners gekommen, als gemeldet wurde, daß die Monarchen im Begriff seien, sich von ihrer Tafel zu erheben. Nun strömte alles dahin. Napoleon liebte bekanntlich sehr rasch zu speisen, doch hatte er sich dabei lebhaft mit seiner Nachbarin, der Herzogin von Weimar unterhalten. Nach kurzer Pause fuhr man in das Theater, wohin der Wagen der beiden Kaiser von weimarischen Husaren eskortiert wurde. Vor dem Schlosse stand ein sechzig Fuß hoher Obelisk, geschmackvoll erleuchtet, auf dessen Spitze eine helle Flamme loderte. Das ganze Schloß und seine Umgebungen sowie alle Straßen bis zum Schauspielhause waren illuminiert, die innere Einrichtung und Verteilung der Sitze im Theater ganz wie die zu Erfurt. Die französischen Schauspieler führten, wie ich schon oben erwähnt, La mort de César von Voltaire auf. Unbeschreiblich war der Eindruck. Talma als Brutus übertraf sich selbst. Bei der Stelle am Schlusse des ersten Aktes, wo Cäsar dem Antonius, der ihn vor den Senatoren warnt, antwortet:
war es, als ob ein elektrischer Funke mächtig alle Zuschauer durchzuckte.
»Hatte die Aufführung des Trauerspiels La mort de César immerhin etwas seltsam Ominöses gehabt, so mußte es auf diejenigen, die diesen Abend miterlebt hatten, noch lange nachher einen erschütternden Eindruck machen, als sie erfuhren, wie wenig gefehlt hatte, daß diese Aufführung wirklich zum größten Trauerspiel der neueren Weltgeschichte geworden wäre. Es hatte sich nämlich eine kleine Anzahl verwegener preußischer Offiziere, das Unglück und den trostlosen Zustand ihres Vaterlandes tief empfindend und von glühendem Haß gegen dessen Unterdrücker erfüllt, verschworen, den Kaiser Napoleon bei seinem Heraustreten aus dem Theater zu erschießen. Sie hatten die Lokalität aufs genaueste erkundet, Voranstalten zu ihrer eiligen Flucht nach vollbrachter Tat getroffen und sich zum größten Teil in Weimar unbemerkt versammelt, als noch im letzten Moment einer der Mitverschworenen ausblieb. Sei es, daß dieser Umstand die übrigen abschreckte, oder daß sie Reue empfanden, genug, das Vorhaben unterblieb. Welche Verwirrung, welche Greuel das Gelingen so grausiger Tat unmittelbar und zunächst für Weimar nach sich gezogen hätte, ist kaum zu ermessen.«
Die Befreiung Deutschlands wäre durch einen Pistolenschuß erfolgt; die Hunderttausende von Opfern der nächsten Kriegsjahre hätten nicht geblutet, aber es hätte auch kein 1813, keine Erhebung des ganzen Volks gegeben, und so sehen wir wieder das Schicksal abseits von dem Willen der Menschen seinen ehernen Weg gehen.
Karl August trat mit den übrigen Fürsten des ernestinischen Hauses dem Rheinbund bei. 1815 besuchte er den Wiener Kongreß persönlich. Graf Nostiz notiert über ihn in seinem Tagebuch: »Der alte Herzog von Weimar lebt so burschikos fort, wie er es immer getrieben. Die Welt gefällt ihm, und er ist ihr immer durch Lebenslust verbunden, wenn auch die Jahre seine Beweglichkeit schwächen.«
Er trat als erster Großherzog zum deutschen Bund. 1825 feierte er sein fünfzigjähriges Regierungsjubiläum und seine goldene Hochzeit. Im Mai 1827 hatte sich seine Enkelin mit dem Prinzen Karl von Preußen verheiratet, im Frühjahr darauf reiste Karl August zum Besuche des jungen Paares nach Berlin, und auf der Rückreise starb er auf dem Gestüt zu Graditz bei Torgau am 14. Juli 1828, 71 Jahre alt. Er ward beigesetzt in der Fürstengruft auf dem Friedhof der Jakobskirche zu Weimar, wohin er wenige Monate früher Schillers sterbliche Reste hatte bringen lassen und wo vier Jahre später auch Goethe begraben wurde.
Die letzten Tage vor seinem Tode hatte er in fast beständiger Gesellschaft Alexanders von Humboldt verbracht, und Humboldt beschrieb diese Tage in einem Brief an den Kanzler Müller, der seinerseits wieder Goethe davon Mitteilung machte. In dem unvergleichlich schönen Gespräch, das Eckermann unterm 23. Oktober 1828 aufzeichnet, ist darüber eingehend zu lesen, und es möge, auch wegen des profunden und ewig gültigen Urteils, das Goethe über seinen Herzog fällt, zum Abschluß hier folgen.
»Es war nicht ohne höhere günstige Einwirkung,« sagt Goethe, »daß einer der größten Fürsten, die Deutschland je besessen, einen Mann wie Humboldt zum Zeugen seiner letzten Tage und Stunden hatte. Ich habe mir von seinem Brief eine Abschrift nehmen lassen und will Ihnen doch einiges daraus mitteilen.«
Goethe stand auf und ging zu seinem Pult, wo er den Brief nahm und sich wieder zu mir an den Tisch setzte. Er las eine Weile im stillen. Ich sah Tränen in seinen Augen. »Lesen Sie es für sich,« sagte er dann, indem er mir den Brief zureichte. Er stand auf und ging im Zimmer auf und ab, während ich las.
»Wer konnte mehr durch das schnelle Hinscheiden des Verewigten erschüttert werden,« schreibt Humboldt, »als ich, den er seit dreißig Jahren mit so wohlwollender Auszeichnung, ich darf sagen, mit so aufrichtiger Vorliebe behandelt hatte. Auch hier wollte er mich fast zu jeder Stunde um sich haben; und, als sei eine solche Luzidität wie bei den erhabenen schneebedeckten Alpen der Vorbote des scheidenden Lichtes, nie habe ich den großen, menschlichen Fürsten lebendiger, geistreicher, milder und an aller ferneren Entwicklung des Volkslebens teilnehmender gesehen als in den letzten Tagen, die wir ihn hier besaßen.
Ich sagte mehrmals zu meinen Freunden ahnungsvoll und beängstigt, daß diese Lebendigkeit, diese geheimnisvolle Klarheit des Geistes, bei so viel körperlicher Schwäche, mir ein schreckhaftes Phänomen sei. Er selbst oszillierte sichtbar zwischen Hoffnung der Genesung und Erwartung der großen Katastrophe.
Als ich ihn vierundzwanzig Stunden vor dieser sah, beim Frühstück, krank und ohne Neigung, etwas zu genießen, fragte er noch lebendig nach den von Schweden herübergekommenen Granitgeschieben baltischer Länder, nach Kometschweifen, welche sich unsrer Atmosphäre trübend einmischen könnten, nach der Ursache der großen Winterkälte an allen östlichen Küsten.
Als ich ihn zuletzt sah, drückte er mir zum Abschied die Hand mit den heiteren Worten: ›Sie glauben, Humboldt, Töplitz und alle warmen Quellen seien wie Wasser, die man künstlich erwärmt? Das ist nicht Küchenfeuer! Darüber streiten wir in Töplitz, wenn Sie mit dem Könige kommen. Sie sollen sehen, Ihr altes Küchenfeuer wird mich doch noch einmal zusammenhalten.‹ Sonderbar! Denn alles wird bedeutend bei so einem Manne.
In Potsdam saß ich mehrere Stunden allein mit ihm auf dem Kanapee; er trank und schlief abwechselnd, trank wieder, stand auf, um an seine Gemahlin zu schreiben, dann schlief er wieder. Er war heiter, aber sehr erschöpft. In den Intervallen bedrängte er mich mit den schwierigsten Fragen: über Physik, Astronomie, Meteorologie und Geognosie, über Durchsichtigkeit eines Kometenkerns, über Mondatmosphäre, über die farbigen Doppelsterne, über Einfluß der Sonnenflecke auf Temperatur, Erscheinen der organischen Formen in der Urwelt, innere Erdwärme. Er schlief mitten in seiner und meiner Rede ein, wurde oft unruhig und sagte dann, über seine scheinbare Unaufmerksamkeit milde und freundlich um Verzeihung bittend: ›Sie sehen, Humboldt, es ist aus mit mir!‹
Auf einmal ging er desultorisch in religiöse Gespräche über. Er klagte über den einreißenden Pietismus und den Zusammenhang dieser Schwärmerei mit politischen Tendenzen nach Absolutismus und Niederschlagen aller freieren Geistesregungen. ›Dazu sind es unwahre, Bursche,‹ rief er aus, ›die sich dadurch den Fürsten angenehm zu machen glauben, um Stellen und Bänder zu erhalten! – Mit der poetischen Vorliebe zum Mittelalter haben sie sich eingeschlichen.‹
Bald legte sich sein Zorn und er sagte, wie er jetzt viel Tröstliches in der christlichen Religion finde. ›Das ist eine menschenfreundliche Lehre,‹ sagte er, ›aber von Anfang an hat man sie verunstaltet. Die ersten Christen waren die Freigesinnten unter den Ultras.‹«
Ich gab Goethe über diesen herrlichen Brief meine innige Freude zu erkennen. »Sie sehen,« sagte Goethe, »was für ein bedeutender Mensch er war. Aber wie gut ist es von Humboldt, daß er diese wenigen letzten Züge aufgefaßt, die wirklich als Symbol gelten können, worin die ganze Natur des vorzüglichen Fürsten sich spiegelt. Ja, so war er! – Ich kann es am besten sagen, denn es kannte ihn im Grunde niemand so durch und durch wie ich selber. Ist es aber nicht ein Jammer, daß kein Unterschied ist und daß auch ein solcher Mensch so früh dahin muß! – Nur ein lumpiges Jahrhundert länger, und wie würde er an so hoher Stelle seine Zeit vorwärts gebracht haben! – Aber wissen Sie was? Die Welt soll nicht so rasch zum Ziele, als wir denken und wünschen. Immer sind die retardierenden Dämonen da, die überall dazwischen und überall entgegentreten, so daß es zwar im ganzen vorwärts geht, aber sehr langsam. Leben Sie nur fort und Sie werden schon finden, daß ich recht habe.«
Die Entwicklung der Menschheit scheint auf Jahrtausende angelegt, sagte ich.
»Wer weiß,« erwiderte Goethe, »– vielleicht auf Millionen! Aber laß die Menschheit dauern, so lange sie will, es wird ihr nie an Hindernissen fehlen, die ihr zu schaffen machen, und nie an allerlei Not, damit sie ihre Kräfte entwickle. Klüger und einsichtiger wird sie werden, aber besser, glücklicher und tatkräftiger nicht, oder doch nur auf Epochen. Ich sehe die Zeit kommen, wo Gott keine Freude mehr an ihr hat und er abermals alles zusammenschlagen muß zu einer verjüngten Schöpfung. Ich bin gewiß, es ist alles danach angelegt und es steht in der fernen Zukunft schon Zeit und Stunde fest, wann die Verjüngungsepoche eintritt. Aber bis dahin hat es sicher noch gute Weile, und wir können noch Jahrtausende und aber Jahrtausende auf dieser lieben, alten Fläche, wie sie ist, allerlei Spaß haben.«
Goethe war in besonders guter erhöhter Stimmung. Er ließ eine Flasche Wein kommen, wovon er sich und mir einschenkte. Unser Gespräch ging wieder auf den Großherzog Karl August zurück.
»Sie sehen,« sagte Goethe, »wie sein außerordentlicher Geist das ganze Reich der Natur umfaßte. Physik, Astronomie, Geognosie, Meteorologie, Pflanzen- und Tierformen der Umwelt und was sonst dazu gehört, er hatte für alles Sinn und für alles Interesse. Er war achtzehn Jahre alt, als ich nach Weimar kam; aber schon damals zeigten seine Keime und Knospen, was einst der Baum sein würde. Er schloß sich bald auf das innigste an mich an und nahm an allem, was ich trieb, gründlichen Anteil. Daß ich fast zehn Jahre älter war als er, kam unserm Verhältnis zugute. Er saß ganze Abende bei mir in tiefen Gesprächen über Gegenstände der Kunst und Natur und was sonst allerlei Gutes vorkam. Wir saßen oft tief in die Nacht hinein, und es war nicht selten, daß wir nebeneinander auf meinem Sofa einschliefen. Fünfzig Jahre haben wir es miteinander fort getrieben, und es wäre kein Wunder, wenn wir es endlich zu etwas gebracht hätten.«
Eine so gründliche Bildung, sagte ich, wie sie der Großherzog gehabt zu haben scheint, mag bei fürstlichen Personen selten vorkommen.
»Sehr selten,« erwiderte Goethe. »Es gibt zwar viele, die fähig sind, über alles sehr geschickt mitzureden; aber sie haben es nicht im Innern und krabbeln nur an den Oberflächen. Und es ist kein Wunder, wenn man die entsetzlichen Zerstreuungen und Zerstückelungen bedenkt, die das Hofleben mit sich führt und denen ein junger Fürst ausgesetzt ist. Von allem soll er Notiz nehmen. Er soll ein bißchen Das kennen und ein bißchen Das, und dann ein bißchen Das und wieder ein bißchen Das. Dabei kann sich aber nichts setzen und Wurzel schlagen, und es gehört der Fonds einer gewaltigen Natur dazu, um bei solchen Anforderungen nicht in Rauch aufzugehen. Der Großherzog war freilich ein geborener großer Mensch, womit alles gesagt und alles getan ist.«
Bei allen seinen höheren wissenschaftlichen und geistigen Richtungen, sagte ich, scheint er doch auch das Regieren verstanden zu haben.
»Es war ein Mensch aus dem Ganzen,« erwiderte Goethe, »und es kam bei ihm alles aus einer einzigen großen Quelle. Und wie das Ganze gut war, so war das Einzelne gut, er mochte tun und treiben, was er wollte. Übrigens kamen ihm zur Führung des Regiments besonders drei Dinge zustatten. Er hatte die Gabe, Geister und Charaktere zu unterscheiden und jeden an seinen Platz zu stellen. Das war sehr viel. Dann hatte er noch etwas, was ebensoviel war, wo nicht noch mehr: Er war beseelt von dem edelsten Wohlwollen, von der reinsten Menschenliebe und wollte mit ganzer Seele nur das Beste. Er dachte immer zuerst an das Glück des Landes und ganz zuletzt erst ein wenig an sich selber. Edlen Menschen entgegenzukommen, gute Zwecke befördern zu helfen war seine Hand immer bereit und offen. Es war in ihm viel Göttliches. Er hätte die ganze Menschheit beglücken mögen. Liebe aber erzeugt Liebe. Wer aber geliebt ist, hat leicht regieren.
Und drittens: Er war größer als seine Umgebung. Neben zehn Stimmen, die ihm über einen gewissen Fall zu Ohren kamen, vernahm er die elfte, bessere, in sich selber. Fremde Zuflüsterungen glitten an ihm ab, und er kam nicht leicht in den Fall, etwas Unfürstliches zu begehen, indem er das zweideutig gemachte Verdienst zurücksetzte und empfohlene Lumpe in Schutz nahm. Er sah überall selber, urteilte selber, und hatte in allen Fällen in sich selber die sicherste Basis. Dabei war er schweigsamer Natur, und seinen Worten folgte die Handlung.«
Wie leid tut es mir, sagte ich, daß ich nicht viel mehr von ihm gekannt habe als sein Äußeres; doch das hat sich mir tief eingeprägt. Ich sehe ihn noch immer auf seiner alten Droschke, im abgetragenen, grauen Mantel und Militärmütze und eine Zigarre rauchend, wie er auf die Jagd fuhr, seine Lieblingshunde nebenher. Ich habe ihn nie anders fahren sehen als auf dieser unansehnlichen alten Droschke. Auch nie anders als zweispännig. Ein Gepränge mit sechs Pferden und Röcke mit Ordenssternen scheint nicht sehr nach seinem Geschmack gewesen zu sein.
»Das ist,« erwiderte Goethe, »bei Fürsten überhaupt kaum mehr an der Zeit. Es kommt jetzt darauf an, was einer auf der Wage der Menschheit wiegt; alles übrige ist eitel. Ein Rock mit dem Stern und ein Wagen mit sechs Pferden imponiert nur noch allenfalls der rohesten Masse und kaum dieser. Übrigens hing die alte Droschke des Großherzogs kaum in Federn. Wer mit ihm fuhr, hatte verzweifelte Stöße auszuhalten. Aber das war ihm eben recht. Er liebte das Derbe und Unbequeme und war ein Feind aller Verweichlichung.«
Spuren davon, sagte ich, sieht man schon in Ihrem Gedicht Ilmenau, wo sie ihn nach dem Leben gezeichnet zu haben scheinen.
»Er war damals sehr jung,« erwiderte Goethe, »doch ging es mit uns freilich etwas toll her. Er war wie ein edler Wein, aber noch in gewaltiger Gärung. Er wußte mit seinen Kräften nicht wo hinaus, und wir waren oft sehr nahe am Halsbrechen. Auf Parforcepferden über Hecken, Gräben und durch Flüsse, und bergauf, bergein sich tagelang abarbeiten, und dann nachts unter freiem Himmel kampieren, etwa bei einem Feuer im Walde: das war nach seinem Sinne. Ein Herzogtum geerbt zu haben war ihm nichts, aber hätte er sich eines erringen, erjagen und erstürmen können, das wäre ihm etwas gewesen.
Das Ilmenauer Gedicht,« fuhr Goethe fort, »enthält als Episode eine Epoche, die im Jahre 1783, als ich es schrieb, bereits mehrere Jahre hinter uns lag, so daß ich mich selber darin als eine historische Figur zeichnen und mit meinem eigenen Ich früherer Jahre eine Unterhaltung führen konnte. Es ist darin, wie Sie wissen, eine nächtliche Szene vorgeführt, etwa nach einer solchen halsbrecherischen Jagd im Gebirge. Wir hatten uns am Fuße eines Felsens kleine Hütten gebaut und mit Tannenreisern gedeckt, um darin auf trockenem Boden zu übernachten. Vor den Hütten brannten mehrere Feuer, und wir kochten und brieten, was die Jagd gegeben hatte. Knebel, dem schon damals die Tabakspfeife nicht kalt wurde, saß dem Feuer zunächst und ergötzte die Gesellschaft mit allerlei trockenen Späßen, während die Weinflasche von Hand zu Hand ging. Seckendorf, der schlanke, mit den langen, feinen Gliedern, hatte sich behaglich am Stamm eines Baumes hingestreckt und summte allerlei Poetisches. Abseits, in einer ähnlichen, kleinen Hütte, lag der Herzog im tiefen Schlaf. Ich selber saß davor, bei glimmenden Kohlen, in allerlei schweren Gedanken, auch in Anwandlungen von Bedauern über mancherlei Unheil, das meine Schriften angerichtet. Knebel und Seckendorf erscheinen mir noch jetzt gar nicht schlecht gezeichnet, und auch der junge Fürst nicht, in diesem düstern Ungestüm seines zwanzigsten Jahres.
So war er ganz und gar. Es ist darin nicht der kleinste Zug übertrieben. Doch aus dieser Sturm- und Drangperiode hatte sich der Herzog bald zu wohltätiger Klarheit durchgearbeitet, so daß ich ihn zu seinem Geburtstage im Jahre 1783 an diese Gestalt seiner früheren Jahre sehr wohl erinnern mochte.
Ich leugne nicht, er hat mir anfänglich manche Not und Sorge gemacht. Doch seine tüchtige Natur reinigte sich bald und bildete sich bald zum besten, so daß es eine Freude wurde, mit ihm zu leben und zu wirken.«
Sie machten, bemerkte ich, in dieser ersten Zeit mit ihm eine einsame Reise durch die Schweiz.
»Er liebte überhaupt das Reisen,« erwiderte Goethe, »doch war es nicht sowohl, um sich zu amüsieren und zu zerstreuen, als um überall die Augen und Ohren offen zu haben und auf allerlei Gutes und Nützliches zu achten, das er in seinem Lande einführen könnte. Ackerbau, Viehzucht und Industrie sind ihm auf diese Weise unendlich viel schuldig geworden. Überhaupt waren seine Tendenzen nicht persönlich egoistisch, sondern rein produktiver Art, und zwar produktiv für das allgemeine Beste. Dadurch hat er sich denn auch einen Namen gemacht, der über dieses kleine Land weit hinausgeht.«
Sein sorgloses einfaches Äußere, sagte ich, schien anzudeuten, daß er den Ruhm nicht suche und daß er sich wenig aus ihm mache. Es schien, als sei er berühmt geworden ohne sein weiteres Zutun, bloß wegen seiner stillen Tüchtigkeit.
»Es ist damit ein eigenes Ding,« erwiderte Goethe. »Ein Holz brennt, weil es Stoff dazu in sich hat, und ein Mensch wird berühmt, weil der Stoff dazu in ihm vorhanden. Suchen läßt sich der Ruhm nicht, und alles Jagen danach ist eitel. Es kann sich wohl jemand durch kluges Benehmen und allerlei künstliche Mittel eine Art von Namen machen. Fehlt aber dabei das innere Juwel, so ist es eitel und hält nicht auf den andern Tag.
Ebenso ist es mit der Gunst des Volkes. Er suchte sie nicht und tat den Leuten keineswegs schön; aber das Volk liebte ihn, weil es fühlte, daß er ein Herz für sie habe.«
Die Juden von Zirndorf. Roman. Neubearbeitete Ausgabe. Vierte Auflage.
Die Geschichte der jungen Renate Fuchs. Roman. Dreizehnte Auflage.
Der Moloch. Roman. Neubearbeitete Ausgabe. Vierte Auflage.
Der niegeküßte Mund – Hilperich. Novellen.
Alexander in Babylon. Roman. Neubearbeitete Ausgabe. Fünfte Auflage.
Die Schwestern. Drei Novellen. Dritte Auflage.
Caspar Hauser oder die Trägheit des Herzens. Roman. Neue wohlfeile Ausgabe. Neunte Auflage.
Die Masken Erwin Reiners. Roman. Achte Auflage.
Der goldene Spiegel. Erzählungen in einem Rahmen. Achte Auflage.
Die ungleichen Schalen. Fünf einaktige Dramen.
Faustina. Ein Gespräch über die Liebe. Zweite Auflage.
Der Mann von vierzig Jahren. Roman. Zehnte Auflage.
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig
Anmerkungen zur Transkription: Dieses elektronische Buch wurde auf Grundlage der 1915 bei S. Fischer erschienenen Erstausgabe erstellt. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auflistung aller gegenüber dem Originaltext vorgenommenen Korrekturen.
p 039: die kleinen, aufs feinste und schönste gemalten Figuren -> bemalten
p 032: [Illustration] Joh. Friedr. Böttger -> Böttiger
p 113: [Illustration] Leonhard Thurneysser -> Thurneyßer
p 123: erhielt sich Turneyßer -> Thurneyßer
p 159: Wer einem Menschen stiehlet -> einen
p 160: Der Tischer legte sich -> Tischler
p 189: hielt ihm dem Kronprinzen -> ihn
p 195: Im Jahre 1656 -> 1756
p 207: sauer lassen werden sollte -> werden lassen
p 234: [Punkt ergänzt] wie er selbst es geführt.
p 274: [Punkt ergänzt] alle Zuschauer durchzuckte.
Die Originalschreibweise wurde prinzipiell beibehalten, insbesondere bei folgenden Wörtern:
Inful: Stirnbinde, Bischofsmütze
Gelahrtheit: veraltet/dichterisch: Gelehrtheit
Transcriber’s Note: This ebook has been prepared from the first print edition published in 1915 by S. Fischer. The table below lists all corrections applied to the original text.
p 039: die kleinen, aufs feinste und schönste gemalten Figuren -> bemalten
p 032: [Illustration] Joh. Friedr. Böttger -> Böttiger
p 113: [Illustration] Leonhard Thurneysser -> Thurneyßer
p 123: erhielt sich Turneyßer -> Thurneyßer
p 159: Wer einem Menschen stiehlet -> einen
p 160: Der Tischer legte sich -> Tischler
p 189: hielt ihm dem Kronprinzen -> ihn
p 195: Im Jahre 1656 -> 1756
p 207: sauer lassen werden sollte -> werden lassen
p 234: [added period] wie er selbst es geführt.
p 274: [added period] alle Zuschauer durchzuckte.
The original spelling has been maintained throughout the book.
End of the Project Gutenberg EBook of Deutsche Charaktere und Begebenheiten, by
Jakob Wassermann
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DEUTSCHE CHARAKTERE ***
***** This file should be named 18258-h.htm or 18258-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/1/8/2/5/18258/
Produced by Markus Brenner and the Online Distributed
Proofreading Team at http://dp.rastko.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.