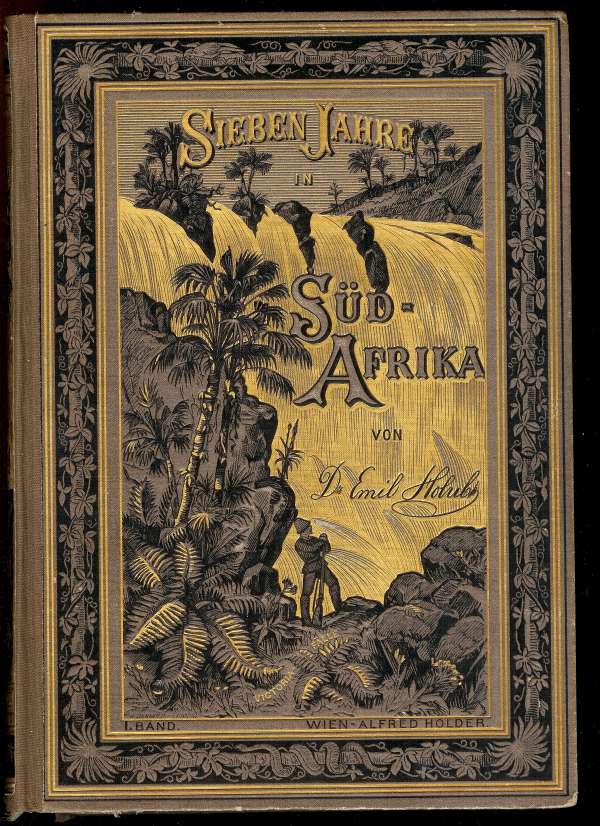
Project Gutenberg's Sieben Jahre in Süd-Afrika. Erster Band., by Emil Holub
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Sieben Jahre in Süd-Afrika. Erster Band.
Erlebnisse, Forschungen und Jagden auf meinen Reisen von
den Diamantenfeldern zum Zambesi (1872-1879).
Author: Emil Holub
Release Date: August 3, 2006 [EBook #15787]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SIEBEN JAHRE IN SÜD-AFRIKA. ***
Produced by Inka Weide and the Online Distributed
Proofreading Team. This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale
de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr.
[Anmerkung des Bearbeiters: Die folgende Ersetzung wurde für
diakritische Zeichen im Originaltext vorgenommen:
ng mit Breve: [)ng]]
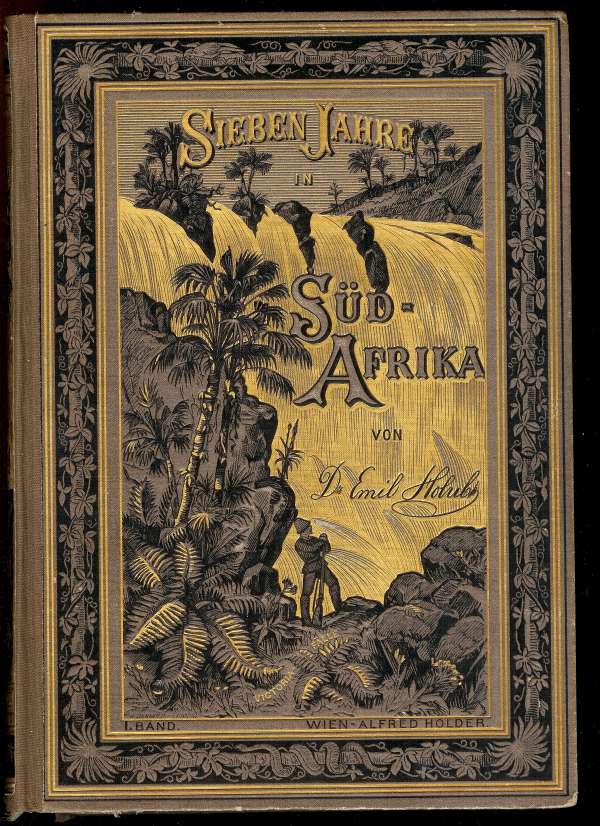
Erster Band.

[Emil Holub]
Sieben Jahre in Süd-Afrika.
Erlebnisse, Forschungen und Jagden auf meinen Reisen von den Diamantenfeldern zum Zambesi (1872-1879).
Von
Dr. Emil Holub.
Mit 235 Original-Holzschnitten und vier Karten.
Erster Band.
Wien, 1881.
Alfred Hölder,
k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler
Rothenthurmstraße 15.
Seiner
Apostolischen Majestät
dem Kaiser und Könige
Franz Josef I.
in tiefster Ehrfurcht gewidmet
vom
Verfasser.
Mein Scherflein zu dem großen Werke der Erschließung und Durchforschung Afrika's beitragen zu können, war mein seit früher Jugend gehegter und stets genährter Wunsch. Als ich während meiner Studienjahre bei der Lectüre der Reisewerke über den dunklen Erdtheil so selten den Namen österreichischer Reisenden begegnete, traten die Umrisse meines Reiseplanes immer schärfer hervor und als ich im Jahre 1872 an der Schwelle der Verwirklichung meines sehnlichsten Wunsches stand, war mein Entschluß gefaßt. Süd-Afrika war das Feld, auf dem ich der Wissenschaft und meinem Vaterlande ersprießliche Dienste zu leisten hoffen durfte.
Wie wechselvoll auch die Schicksale waren, welche mich während meines siebenjährigen Aufenthaltes in Süd-Afrika trafen, ich behielt unverwandt die mir selbstgestellte Aufgabe im Auge und was die beschränkte Kraft und die Mittel eines Einzelnen vermochten, habe ich zu leisten redlich mich bemüht. Dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen einer Reihe hochherziger Männer gelang es mir, manches Hinderniß glücklich zu besiegen, meine Sammlungen durch manches werthvolle Object zu vervollständigen.
Zum dritten Male aus dem Innern Süd-Afrika's in die Diamantenfelder zurückgekehrt, wurde ich wiederholt von meinen südafrikanischen Freunden um die Veröffentlichung meiner Reise-Erlebnisse ersucht. Da ich mich jedoch mit aller Kraft der Ausübung meiner ärztlichen Praxis zuwenden mußte, um die Mittel für meine Rückkehr nach Europa zu gewinnen, war es mir nicht möglich, die Bearbeitung meines Materials für das Erscheinen in Buchform in Angriff zu nehmen. Ich mußte mich vielmehr darauf beschränken, in mehreren südafrikanischen Zeitungen fragmentarische Mittheilungen über die bereisten Gegenden zu veröffentlichen.
Nach Europa zurückgekehrt, wurde ich schon in London um die Publication meiner Arbeiten angegangen und so war es meine Absicht—nachdem ich die Heimat wiedergesehen—meine Gesammt-Erfahrungen, sowohl die Reise-Erlebnisse als auch die wissenschaftlichen Resultate (letztere unter Beihilfe von Fachmännern) herauszugeben, wobei mir die Form des Werkes über die Novara-Reise als Richtschnur vorschwebte.
Um jedoch diesen Plan selbst in beschränkterem Umfange durchzuführen, hätte es eines mindestens dreijährigen Aufenthaltes in Europa bedurft, während ich mich aus mehrfachen Gründen veranlaßt sehe, noch im Laufe dieses Jahres nach Afrika zurückzukehren und meine Forschungen fortzusetzen. Dies bewog mich, den Wünschen zahlreicher Freunde nachzugeben, die wichtigeren Erlebnisse während meines siebenjährigen Aufenthaltes in Süd-Afrika in diesem Buche dem Leser vorzuführen und dabei nur hie und da wissenschaftliche Gebiete zu berühren, während die specielle Bearbeitung des in diese gehörigen reichen Materials im Vereine mit hervorragenden Fachmännern erfolgen soll.
Ich kann es nicht unterlassen, meinem geschätzten Verleger an dieser Stelle für die eben so reiche und würdige Ausstattung meines Buches und die dafür gebrachten Opfer meinen wärmsten Dank zu zollen. Auch halte ich es für meine Pflicht, meinem lieben Freunde Dr. Chavanne für seine Mitwirkung, sowie Herrn Ronniger für die meinem Werke gewidmete Sorgfalt auf das Herzlichste zu danken.
An den Wunsch, daß mein Werk dazu beitragen möge, das Interesse für die Erforschung und Erschließung des »schwarzen Continents« in Europa zu mehren, knüpfe ich die Hoffnung, daß es mir gegönnt sein werde, nach Jahren dem Leser weitere Schilderungen aus Süd-Afrika, wie auch Neues über diesen »Continent der Zukunft« zu bieten.
Wien, Pavillon des Amateurs, September 1880.
Emil Holub.
I. Auf der Fahrt nach dem Cap.—Die Capstadt.—Port Elizabeth
II. Meine Reise nach den Diamantenfeldern
Leben und Freuden in meiner ärztlichen Praxis.—Ein nächtlicher Ueberfall.—Dutoitspan und Kimberley.—Diggerverfahren.—Panorama der Kopje.—Morgenmarkt.—Meine erste Pavianjagd.—Vorbereitungen zur ersten Reise.
Meine erste Reise in das Innere von Süd-Afrika.
IV. Von Dutoitspan nach Lekatlong.
Meine Reisebegleiter.—Schwierigkeit der Beschaffung geeigneter Zugthiere.—Aufbruch aus den Diamantenfeldern.—Trostloser Zustand der Wege.—Südafrikanischer Vorspann.—Old de boers-Farm.—Bismarcks Retreat.—Der Vaal-River und sein Thal.—Ein Besuch in Korannadorfe bei Pniel.—Bauart der Korannahütten.—Sociale Zustände unter den Koranna's.—Vorschläge und Mittel zur Besserung derselben.—Freimaurerthum unter den Koranna's.—Ein gefährlicher Nachtmarsch zum Vaal-River.—Klipdrift.—Racenunterschiede zwischen Koranna's und Betschuana's.—Das Innere der Korannahütten.—Die River-Diggings am Vaal.—Die Fauna des Vaal-Thales.—Eine Krankenordination in Klipdrift.—Gong-Gong, Waldeks-Plant und der Fly-Dyamond.—Eine desolate Straße.—Die Holitzer Schlucht.—Die Cobra capella und ihre Gefährlichkeit.—Ringhalsschlangen.—Im Schlamme des Harts-River versunken.—Ankunft in Lekatlong.
V. Von Lekatlong nach Wonderfontein.
Batlapinenleben.—Webervögel und ihre Nester.—Zuckerrohr-Pflanzungen.—Spitzkopf.—Mitzima's Dorf.—Schlauheit der Batlapinen-Weiber.—Termitenbauten.—Reisende Batlapinen.—In Lebensgefahr.—Springbockfontein.—Transvaal-Emigranten.—Gassibone und seine Residenz.—Tauschhandel.—Wanderheuschrecken.—Ein seltsamer Labetrunk.—Am Vaal-River.—Wasser- und Land-Leguane.—Christiana, die westlichste Transvaal-Stadt.—Einfache Rechtspflege.—Landschaftlicher Contrast der beiden Vaalufer.—Bloemhof.—Ein gefährlicher Nachtmarsch bei Gewittersturm.—Waidmanns Eldorado.—Königskraniche.—Gnu und Bläßbock.—Romberg's Farm.—Von schwarzen Gnu's überrascht.—Hühnervögel.—Klerksdorp.—Potschefstroom.—Das Moi-Riverthal.—Geognostische Entdeckungen.—Wonderfontein und seine Grotten.
VI. u. VII. Rückreise nach Dutoitspan.
Wolmaran's Farm.—Ein junger Boer.—Tabakbau im Moi-Riverthale.—Ueppige Vegetation.—Optische Täuschung.—Transportkosten und Schwierigkeiten.—Gestörte Mahlzeit.—Ein Hinterhalt.—Farm Rennicke.—Eine Vogel-Colonie.—Gildenhuis.—Eine Löwenjagd an den Maqwasi-Höhen.—Gekränkte Hottentotten-Ehre.—Auswanderer nach den Leydenburger Goldfeldern.—Hallwater Farm und Saltpan. (Vermeintliche Ruinen von Monopotapa.)—Batlapinen-Gerichte.—Eine unliebsame Entdeckung.—Hebron.—Ostersonntag im Vaal-River.—Ankunft in Dutoitspan.
Zweite Reise in das Innere von Süd-Afrika.
Nach Musemanjana—Moschaneng—Molopolole—Schoschong—und Rückkehr über Linokana nach den Diamantenfeldern.
VIII. Von Dutoitspan nach Musemanjana.
Vorbereitungen und Ausrüstung zur Reise.—Meine diesmaligen Reisegefährten.—Aufbruch von Dutoitspan.—Klipdrift.—Platberg in Gefahr.—Diamantenfund.—Afrikanische Wegmauth.—Hebron.—Wassermangel.—Ein Grasbrand auf der Hochebene.—Hartebeest-Antilopen.—Ein theuerer Labetrunk.—Gassibone's Kraal.—Nigers Abenteuer mit einer Cobra.—Taung.—Ein holländischer Schmied.—Reverend Brown und die Missionsstation in Taung.—Maruma.—Monkey's Freuden und Leiden.—Eine dornenvolle Jagd.—Billige Diamanten.—Von Pavianen genarrt.—Unser Empfang in Musemanjana.
IX. Von Musemanjana nach Moschaneng.
Aufbruch nach Moschaneng.—Quaggaflats.—Hyänenjagd bei Mondschein.—Makalahari-Reiter.—Konana.—Barolongenstolz.—Acht Löwen.—Eine Begegnung mit Löwen am Setlagole.—Thierleben auf der Hochebene.—Gnujagd bei Nacht.—Boly verirrt sich.—Zebrajagd. Skeletthügel.—Eine abenteuerliche Gansjagd.—Südafrikanischer Frühling.—Am Ufer des Molapo.—Molema's Town.—Rev. Webb und die Mission daselbst.—Chef Molema.—Kranken-Ordination.—Siedelsperlinge.—Huß-Höhe.—Ankunft vor Moschaneng.—Hohe Gäste.
X. Von Moschaneng nach Molopolole.
König Montsua und das Christenthum.—Die Wesleyan-Mission in Moschaneng.—Besuch am Wagen.—Meine ärztliche Praxis in Moschaneng.—Merkwürdige Termitenbauten.—Ein Intermezzo bei unserer Abreise.—Das Banquaketse-Hochland.—Anzeichen tropischer Vegetation.—Hyänenhunde.—Pittoreske Landschaftsscenerien an den Naprstek-Höhen.—Beleuchtungseffecte auf der Hochebene.—Ruinen von Mosilili's Stadt.—Klippdachsjagd.—Grasbäume.—Ein Thari.—Molopolole.
XI. Von Molopolole nach Schoschong.
Malerische Lage der Stadt.—Rev. Price und Williams.—Die Kotla.—Ausflug in die Molopolole-Schlucht.—Ein Festtag für Molopolole.—Missionärs-Laufbahn in Süd-Afrika.—Empfang bei Seschele.—Die Bakwena's.—Geschichte des Bakwena-Reiches.—Königin Ma-sebele und Kronprinz Sebele.—Religiöse Vorstellung derselben.—Raka's, Linjaka's und Moloi.—Heilmethode und Heilmittel derselben.—Beschwörung Khama's.—Regenmacher.—Aufbruch von Molopolole.—Ein dornenvoller Marsch.—Eingeborne Postboten.—Wassernoth.—In Lebensgefahr.—Barwa's und Masarwa's.—Abergläubische Gebräuche dieses Sclavenstammes der Betschuana.—Ihre Jagdlist.—Neujahrsfeier in der Wildniß.—Im Bakwena-Lande verirrt.—Von Masarwa's gerettet.—Ein merkwürdiger Fund.—Begegnung mit Leoparden.—Ein besorgter Vater.—Einzug in Schoschong.
XII. Von Schoschong zurück nach den Central-Diggings.
Lage und Bedeutung Schoschongs.—Unser Empfang daselbst.—Rev. Mackenzie und die Mission der London Missionary Society.—Geschichte der Bamangwato's und ihres Reiches.—Sekhomo und Khama.—Sekhomo's Rath.—Sitten und Gebräuche der Betschuana (Schluß).—Die Circumcision und Boguera.—Die Kotla in Schoschong.—Die Breiprobe.—Aufbruch von Schoschong.—Das Fasanhuhn.—Khama's Salzsee.—Elephantenspuren.—Die Buffadder.—Die Dornfelder im Limpopothale.—Ein Löwe und die Hundemeute.—Ein seltener Anblick.—Zu Tode erkrankt.—Tschune-Tschune.—Die Dwarsberge und der Schweinfurth-Paß.—Brackfontein.—Eine sonderbare Elephantenjagd.—Linokana.—Rev. Jensen und die Hermannsburger Mission.—Die Baharutse und ihr Ackerbau.—Zeerust und der Marico-District.—Das Hooge Veldt.—Potschefstroom.—Die Elephantenjäger David Jakob und Viljeon.—Die Quarzitwälle am Klip-Port.—Trennung von meinen Gefährten.—Ankunft in Dutoitspan.
XIII. Dritter Aufenthalt in dem Diamantenfeldern
Uebersichtskarte von Dr. Holub's Reisen in Süd-Afrika.
| Seite | 12 | Zeile | 1 | von oben | lies | 16 statt 6. |
| " | 14 | " | 2 | " " | " | Salt-River statt Liesbeekfluß. |
| " | 18, 20, 21, und 28 | " | Bakensfluß statt Bakerfluß. | |||
| " | 48, | Zeile | 5 | von oben | " | Steinhäuschen statt Holzhäuschen. |
| " | 52, 56, und 73 | " | Jagersfontein statt Sagersfontein. | |||
| " | 69 | Zeile | 5 | von unten | " | flea statt flie. |
| " | 71 | " | 4 | " " | " | Botlaros statt Botlaris. |
| " | 74 | " | 16 | " " | " | Diggers statt Diggings. |
| " | 83 | " | 2 | " " | " | buyers statt keepers. |
| " | 89 und 92 | " | Krichofarm statt Krikofarm. | |||
| " | 113 | Zeile | 7 | von oben | " | Nomansland statt Normannsland. |
| " | 134 | " | 14 | " unten | " | 3 statt 83. |
| " | 136 | " | 14 | " oben | " | Alluvial Periode statt Kreideperiode. |
| " | 136 und 137 | Zeile | 2 | von unten | lies | Cobra statt Mamba |
| " | 138 | Zeile | 8 | von oben | lies | Cobra statt Mamba. |
| " | 139 | Zeile | 14 | von oben | lies | Cobra statt Mamba. |
| " | 142 | " | 12 und 17 | von oben | lies | Harts-River statt Vaal-River. |
| " | 144 | lies: | Im Schlamme des Harts-River statt Vaal-River. | |||
| " | 149 | Zeile | 1 | von unten | lies | Fingo's statt Betschuana's. |
| " | 141 | " | 5 | " oben | " | Kafirkorn statt Kaffee, Korn. |
| " | 151 | " | 2 | " unten | " | 12-25 Ctm. statt 12-15 Ctm. |
| " | 173 | " | 2 | " " | " | Schalenüberreste statt Schneckenüberreste. |
| " | 188 | " | 3 | " " | " | Waggonhoutbaumes statt Waggonboutbaumes. |
| " | 199 | " | 11 | " " | " | Bluebusches statt Bluebustes. |
| " | 200 | " | 3 | " " | " | Jadgspruit statt Sagospruit. |
| " | 231 | " | 3 | " oben | " | banje statt lantsch. |
| " | 235 | " | 13 | " unten | " | dreiseitig statt vierseitig. |
| " | 334 | " | 7 | " oben | " | (Tukans) statt (Zulies). |
| " | 460 | " | 6 | " " | " | unbedeutend statt ziemlich. |
| " | 465 | " | 7 | " " | " | ersteren statt letzteren. |
| " | 469 | " | 6 | " " | " | Banquaketse statt Bakwena. |
| " | 521 | " | 16 | " unten | " | Geologie statt Geschichte. |
| " | 521 | " | 4 | " " | " | 1/10 Gramm statt ½ Gramm. |
| " | 521 | " | 3 | " " | " | Tinctura Aconiti Napellus statt Aconiti a Napellus. |
| " | 523 | " | 13 | " " | " | dieser Reiche statt dieses Reiches. |
Auf der Fahrt nach dem Cap.—Die Capstadt.—Port Elizabeth.
Neues frisches Leben durchrieselt unser ganzes Sein, alle körperliche und geistige Lethargie ist mit einem Zauberschlage regster Beweglichkeit gewichen, wenn nach mehrwöchentlicher Seefahrt, von Southampton nach Süd-Afrika, und mag sie auch noch so glatt und angenehm verlaufen, der Capitän des Schiffes uns die frohe Botschaft von der Nähe des erwarteten Landes in wenigen trockenen Worten verkündet. Nicht ein, nein, zahllose Male stürmen wir aus dem comfortablen und luxuriös eingerichteten Salon der ersten Cajüte des imposanten Dampfers[1] auf das Deck, unsere Wangen sind geröthet, in unserem Auge scheint sich die Spannkraft des ganzen Nervensystems zu polarisiren, und mit fieberhafter Ungeduld spähen wir an den fernen Horizont, denn jeden Augenblick kann der Marsgast aus dem Mastkorbe das Erlösungswort »Land« auf das Deck herabrufen. Schon glauben wir den Gipfel eines hohen Berges über der Scheidelinie zwischen Ocean und dem unendlichen Luftmeere auftauchen zu sehen—doch nein—es ist die Mastspitze eines uns entgegen segelnden Fahrzeuges. Eine Täuschung, die durch die hochgespannte Erwartung doppelt bitter erscheint. Endlich ist es unläugbare Wahrheit, am südsüdöstlichen Horizonte zeichnet sich auf einer hellen, leichten Bank von Federwolken ein bläulicher, flacher Streifen ab, der von Minute zu Minute immer höher aus den Tiefen des Oceans aufsteigt. Es ist die Krone einer imposanten Felsenburg, jener steinerne Herold Afrika's der in der Entdeckungsgeschichte unseres Erdballs einen ewig denkwürdigen Wendepunkt bildet—der Tafelberg.
1 Die Ueberfahrtsdauer von Southampton über Madeira nach der Capstadt mit den Dampfern der beiden Concurrenz-Gesellschaften »Union Steam Ship Company« und »Donald Currie & Cie.« ist in den letzten Jahren bis auf 20 und 18 Tage abgekürzt worden.
Dieses Gefühl der Sehnsucht nach festem Boden, es steigert sich aber bis zur peinlichsten Ungeduld, wenn das Schiff auf seiner langen Fahrt mit all' den Launen und Tücken des Ocean's zu kämpfen hat; wenn der Neuling zur See, anstatt alle jene originellen, wunderbaren Phänomene des Meeres, die prächtige unvergleichliche Erscheinung des Sonnen-Auf- und Untergangs, das Spiel in der Färbung des Himmels und Wassers, das possirliche Treiben der Delphine und fliegenden Fische zu bewundern, einem Gefangenen gleich in der engen Cajüte Schutz vor Sturm und Wetter suchen muß; wenn an Stelle der scheidenden Sonne, welche den weiten Plan mit leuchtenden Bändern flüssigen Feuers durchsetzt—ein Bild, das sich dem für Natur-Erscheinungen empfindlichen Gemüthe mit unauslöschlichen Zügen einprägt—die Windsbraut, dunkle regengeschwängerte Wolkenmassen in rasender Eile dahinjagt, wenn das Meer, anstatt in leicht gekräuselten, kosenden Wellen am Bug des Schiffes sich brechend, sich in seinem ganzen majestätischen Zorne zeigt, im Kampfe mit dem Erbfeinde die Wogen aufthürmt zu mächtiger Höhe und diese donnernd zusammenbrechen, daß fast dem Sturme davor bangt, wenn das mächtige Fahrzeug in allen Spanten und Fugen ächzt und stöhnt.
So aber zeigte sich mir der Ocean: Von sechsunddreißig an Bord des »Briton« auf der Fahrt von Southampton über Madeira nach der Capstadt verlebten Tagen—26. Mai bis 1. Juli 1872—hatten wir mehr denn dreißig Tage stürmisches Wetter, volle vier Wochen litt ich an einer heftigen Dysenterie, welche meine Kräfte derart herabgebracht hatte, daß ich kaum mehr zu hoffen wagte, das Gestade Süd-Afrika's lebend zu erreichen. Bei einem solchen Körper- und dem damit verbundenen Seelenzustande werden es die geehrten Leser wohl leicht begreiflich finden, daß ich vor Begierde brannte, festen Boden unter mir zu fühlen, war doch dieser Boden mein heiß ersehntes Ziel, die Stätte, an der ich in jahrelanger Thätigkeit der Wissenschaft meine Kräfte zu widmen gedachte. Obwohl todtmüde, fühlte ich neue Kraft in meine Glieder dringen, als der Ruf »Land« in der zweiten Cajüte bekannt wurde, unverwandt prüfte ich den Horizont und wich nicht früher vom Platze, bis nicht der Tafelberg und seine beiden Genossen, der Löwenkopf zur Rechten und der Teufelsberg zur Linken, sowie die sich nach Süden dieser Gruppe anschließenden zwölf Apostel in ihrer ganzen Massenhaftigkeit mir vor Augen lagen.
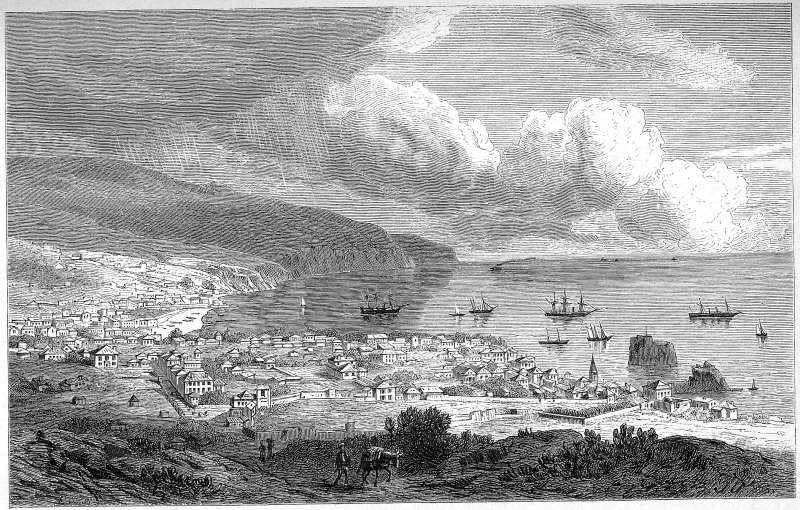
[Ansicht von Funchal.]
Bevor wir das Deck des »Briton« verlassen und den Fuß auf afrikanische Erde setzen, sei es mir gestattet, mit einigen Worten eines Erlebnisses an Bord desselben zu gedenken, das mir einen Vorgeschmack all' der Gefahren und Mühsale bot, die meiner auf meinen Reisen in Süd-Afrika harrten. Wir befanden uns am 20. Juni 1872 auf der Höhe von St. Helena, schon mehr als drei Wochen hindurch verfolgte uns ein so schlechtes Wetter, daß es schwer hielt, sich auf Verdeck zu erhalten. Durch die erwähnte Krankheit war ich sehr herabgekommen und je schwächer ich wurde, um so gedrückter schien mir die Atmosphäre in dem beengten Raum der zweiten Cajüte zu sein (meine Mittel erlaubten es mir nicht, einen Platz in der ersten Cajüte zu miethen). Als sich nun am genannten Morgen auffallende Athembeschwerden einstellten, nahm ich mir vor, mich mit Anwendung aller Kräfte (der Schiffsarzt lag am Delirium tremens darnieder und war mir somit ohne Nutzen) auf Verdeck zu schleppen, um die frische Luft einzuathmen. Mit unsäglicher Mühe erreichte ich das Vorderdeck (Vordercastell), mehrmals von dem Gischt der hoch aufschäumenden an den Bug des Schiffes unter Donnergetöse sich brechenden Wogen durchnäßt; die Erleichterung, welche die Luft der frischen Brise meiner Brust bot, war aber so verlockend, daß ich es nicht scheute, mich weiteren solchen Sturzbädern auszusetzen.
Nach wenigen Minuten sah ich jedoch ein, daß hier nicht meines Bleibens war; von einer überschlagenden Sturzwelle auf's Neue überrascht und ganz durchnäßt erhob ich mich und über den Bug in die aufgeregte See blickend, überlegte ich eben, ob es wohl nicht gerathener schien, in die Cajüte zurückzukehren; in diesem Momente begegnete mein Auge aber schon einer Riesenwoge, die sich mauerartig vor dem Schiffe aufthürmte. Bevor ich mich noch bergen hätte können, hatte sich das Schiff in die Woge gebohrt, und während der Schiffsrumpf bei dieser Sturzwelle bis in's Innerste erbebte, begruben die überstürzenden Wassermassen für einen Augenblick das ganze Vorderdeck; in diesem kritischen Momente griffen meine Finger instinctiv in den gitterartig durchbrochenen Boden des Vordercastells und suchten dort Halt zu gewinnen, allein wie ein Span von der Kraft des niederstürzenden Wassers gehoben, wurde ich über Bord geschleudert. Da ich jedoch im Falle an die untere Querstange anschlug, wurde die Wucht desselben geschwächt, und statt hinaus in's Meer geworfen zu werden, fiel ich senkrecht an der Schiffswand herunter; das Symbol der Hoffnung, der mächtige Schiffsanker, wurde meine Rettung. Ich blieb zwischen einem seiner Arme und der Schiffswand hängen und konnte von dem herbeieilenden Hochbootsmann aus meiner immer noch sehr gefährlichen Situation befreit werden.
Und nun zurück zum Tafelberge, der Hochwarte des Caplandes. Auf wenigen anderen Punkten des Küstenumfanges der einzelnen Continente ist die Bergform so bezeichnend für die Gestalt des ganzen Binnenlandes als hier. Am Fuße der drei zusammenhängenden Berge, des Tafel-, Teufel- und Löwenberges, dem Scheine nach an der gebogensten Stelle, einem der sichersten Plätzchen der Welt, gleichsam im Schutze dieser drei mächtigen Riesen lag mein erstes Reiseziel, breitet sich die Metropole Süd-Afrika's, die bevölkertste Stadt südlich des Zambesi, und die zweitbedeutendste Handelsstadt der englischen Colonien in Afrika aus. Obwohl ihr die Anmuth der Lage des sich an einer Berglehne terrassenförmig aufbauenden Hauptortes von Madeira, Funchal, den wir auf unserer Fahrt bewundern konnten, abgeht, bietet sie doch dem Fremden ein recht anziehendes Gesammtbild. Unwillkürlich bemächtigt sich des Fremdlings ein behagliches Gefühl der Sicherheit, wenn er, langsam dem Strande der Tafelbai folgend, sich der Capstadt nähert. Diese weißgetünchten, aus dem Grün der Straßenalleen und Gärten hervorgrüßenden Gebäude, hie und da von schlanken Thürmchen überragt, scheinen dem Fremdling Ruhe und Frieden nach den Stürmen des Meeres, ebenso wie nach jenen des Lebens zu bieten! Ein Ort des Friedens scheint es wie dazu erkoren. Allein wie so oft im Leben das dem Anscheine nach zweckmäßig Erscheinende sich oft bei näherer Untersuchung als das Gegentheil erweist, so ist auch dieser so geschützt erscheinende Ort, die Stadt wie die Bucht, zu manchen Jahreszeiten den heftigsten, rasch sich wiederholenden Stürmen ausgesetzt, welche die Stadt in eine Staubwolke hüllen; selbst bei ruhigem Wetter steigen durch den regen Verkehr aufgewirbelt dichte Staubmassen in die Höhe, daß man kaum auf hundert Schritte vor sich hinsehen kann, so daß alle halbwegs Vermögenden nur des Tags und ihrer Geschäfte halber sich in der Capstadt aufhalten, ihre Wohnungen jedoch außerhalb derselben in den am Fuße des Löwen- und Teufelsberges erbauten Ortschaften gewählt haben.
Dieser Uebelstand, an dem die Capstadt leidet, dürfte wohl noch geraume Zeit ihr anhaften bleiben, da einerseits eine Abhilfe gegen die aus der Simonsbai hereinbrechenden Südoststürme nicht durchführbar ist, andererseits aber die Pflasterung der Straßen der Capstadt bisher noch nicht versucht wurde. Gegen die Tücken des Oceans, von deren erbarmungsloser Herrschaft die am Strande der Tafelbai zerstreuten Wracktheile stumme Zeugen sind, hat man sich besonders in den letzten sieben Jahren unter der Verwaltung des Gouverneurs Sir Bartle Frère durch die Anlage großer Hafen- und Schutzbauten zu wahren gewußt.
Doch kehren wir zu meiner Ankunft zurück. Vorsichtig wurde unser Schiff in den damals (im Jahre 1872) noch ziemlich beengten Hafen mit Tauen hineinbugsirt. Am Ufer harrte eine dichte Menschenmenge, denn blos zweimal in einem Monate besuchte damals ein Postdampfer die Küste Süd-Afrika's—kein Wunder, daß ein von der am Fuße des Löwenkopfes erbauten Signalstation signalisirter Sendbote aus dem Mutterlande stets ein freudig erwartetes Ereigniß war (gegenwärtig gehen die Postdampfer wöchentlich nach der Colonie ab). Jene, die ihre Verwandten erwarteten, sowie Postbeamte mit einem Troß von Bedienten, um sofort die Post in Empfang zu nehmen, nebst einer großen Anzahl von Farbigen: Malayen, Hottentotten, Kaffern u.s.w., und zahlreiche Vertreter aus allen diesen Racen zusammengewürfelter Bastardtypen, die als Handlanger dem Ankommenden ihre Dienste anbieten, hatten sich am Hafendamme eingefunden und bildeten in ungezwungener Weise ein dichtes Spalier. Noch einige Minuten und der Dampfer hatte beigelegt; obwohl wir nur zwei Tage in Capstadt verbleiben sollten, um am dritten unsere Fahrt nach Port Elizabeth fortzusetzen, so eilte doch ein Jeder an's Land, um in dieser kurzen Zeit so gut als möglich die Capstadt kennen zu lernen. Der Hafen ist nach der Landseite von einer Mauer umgeben, innerhalb welcher ich in dunkelgraue Tuchkittel gehüllte und von bewaffneten Aufsehern überwachte Sträflinge die schweren Arbeiten, »hard labour«, zu denen sie verurtheilt waren, verrichten sah. Die schweren Ketten an den Füßen der meisten unter ihnen, schienen wohl unternommener Fluchtversuche wegen eine Verschärfung der Strafe zu sein.
Nach einigen hundert am Strande zurückgelegten Schritten stoßen wir am Eingange in die Capstadt auf den Fischmarkt, dessen Eigenart schon aus beträchtlicher Entfernung penetrante Dünste verrathen und die es wohl gerathen hätten, den Fischmarkt in größerer Entfernung vor der Stadt anzulegen. Eine artenreiche Zahl von Seefischen wird hier mit Ausnahme des Sonntags von den malayischen Fischern täglich aufgestapelt, von Hummern wahre Berge, deren ganze Masse auch stets willige Abnehmer finden. Wer sein Geruchsorgan gegen die Ausdünstung des Marktes unempfindlich zu machen wüßte, hätte hier ein dankbares Feld für Studien nach jeder, insbesondere aber ethnographischer Richtung. Die seit Decennien eingewanderten Malayen sind ihrer mitgebrachten Tracht und ihren Gebräuchen treu geblieben. Sie kamen als Fischer, Maurer, Schneider und sind es auch geblieben, selbst zu gediegenen Rosselenkern haben sie sich in der neuen Heimat gebildet. Mit rothen Tuchlappen, die älteren mit riesengroßen, kegelförmigen aus Stroh, Schilf und Bambusgeflecht erzeugten Hüten gegen die Sonnenstrahlen geschützt und meist in weitbauschige Leinenhosen und -Hemden gehüllt, sehen wir die dunkelbraunen Gestalten der Männer in ihren Booten mit dem Ausleeren ihrer Fangbeute in Körbchen eifrig beschäftigt. Der Gesichtstypus ist flach, wenig ansprechend, doch das Auge verräth die tropische Heimat, namentlich ist es bei den Frauen groß und schön. Die Frauen, den Männern behilflich und lachend bald in der eigenen, bald in der holländischen Sprache den Beutezug besprechend, tragen grellfarbige Kopftücher und ebenfalls bauschige weiße Hemden und eine große Zahl von Röcken, deren Umfang an die Crinolinen-Mode erinnert. Zwischen den eifrig beschäftigten Männern und Frauen tummelt sich ihre schwarzköpfige Nachkommenschaft; die Mädchen, niedlichen Puppen gleich, in weißes Linnen, die Knaben in kurzen Jäckchen und Hosen gekleidet. Kaum halb erwachsen, sind sie schon bemüht, in ihrer Weise und nach besten Kräften die Eltern zu unterstützen und größere Fische nach dem Markte zu schleifen.
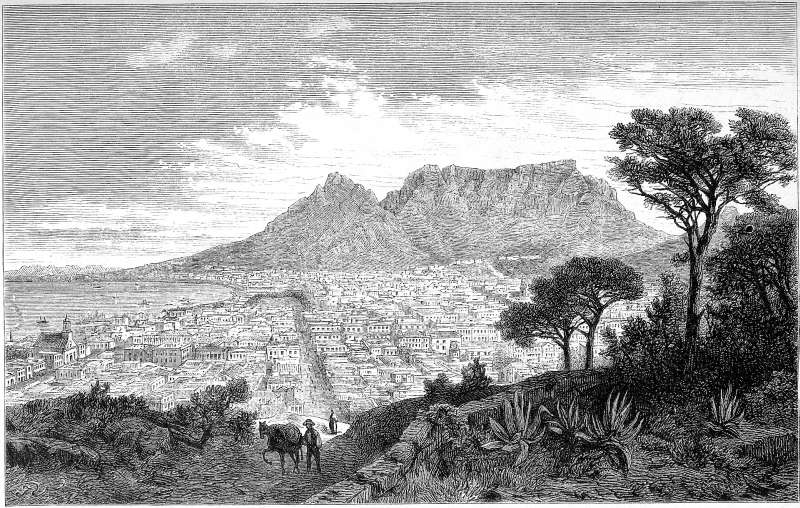
[Capstadt.]
Wir verlassen den Fischmarkt und begeben uns durch eine der vielen parallel die Stadt durchkreuzenden Straßen nach dem durch Pinien umsäumten Paradeplatz. Im Innern der Stadt werden wir weniger von der Bauart der Häuser, von denen noch viele den alten holländischen Styl zeigen, als vielmehr von dem Treiben in den Straßen gefesselt, in denen die Eingebornen, welche hier jedoch als Mischrace überwiegen, das meiste Interesse des Fremden erregen. Sie sind als Lastträger, als Kutscher und Diener an jeder Ecke, in jedem Geschäfte und Hause vertreten. Malayen, Kaffern und Mischlinge liegen friedlich an derselben Ecke und suchen, wo sich ihnen ein »Job« (eine Arbeit) darbietet, das Höchste herauszuschlagen. Hat sich im Verlaufe meines siebenjährigen Aufenthaltes Manches im Aeußern der Stadt zum Vortheil geändert und ist auch für die Hebung der allgemeinen Bildung viel gethan worden, diese Schichte der Bevölkerung ist sich gleich geblieben in ihrer Rohheit, gewonnen haben ihre Mitglieder nur an Verschmitztheit und Unverschämtheit in ihren Forderungen. Malayen und jene der Mischlinge, die durch Vermögensverhältnisse oder in Bildungsanstalten eine bessere Erziehung erwerben konnten, machen einigermaßen eine Ausnahme.
Die Mischlinge zeigen die mannigfachsten Nüancen der Hautfarbe, von einem leichten Stiche in's dunkle bis zu dunkelbraun; die schwarzen Gesichter gehören Kaffern und Eingebornen, die von der Ost- und Westküste und von St. Helena eingewandert sind.
Capstadt ist der Sitz der höchsten englischen Behörde für Süd-Afrika, des Commissioner for the Possessions and Dependencies in South Africa, des ihm zur Seite stehenden Ministeriums, sowie des aus dem Ober- und Unterhause bestehenden Parlaments, ferner der Sitz eines anglikanischen katholischen Bischofs, die Stadt zählt sechzehn Kirchen (Bethäuser mit eingerechnet) und unter den Bewohnern, deren Mehrzahl Farbige sind, finden sich Bekenner aller erdenklichen Confessionen. Unter den Weißen überwiegt das holländische Element über die übrigen Vertreter europäischer Nationen, deren Rechte durch Consuln gewahrt werden; es sind dies meist Kaufleute, welche die Consulargeschäfte nebenbei besorgen. Nur Frankreich und Portugal sind durch Consuls de carrière vertreten.
An der Spitze der jetzigen Regierung steht ein Mann, der sich das vollkommene Vertrauen der Colonisten erworben und zu den edelsten und einsichtsvollsten Gouverneuren gehört, die England je mit der Verwaltung seiner südafrikanischen Colonien betraut hatte. Viele der von Sir Bartle Frère eingeführten Neuerungen werden sich namentlich in der Zukunft ersprießlich erweisen.
Von den öffentlichen Gebäuden können wir namentlich die Stadthalle, die Kirchen, das Gouvernements-Gebäude, das Sailors Home, die Militärgebäude, die Eisenbahnstation erwähnen; vor Allem aber verdient das Museumsgebäude mit dem Monumente Sir Grey's und mit dem angrenzenden botanischen Garten, von den, die Stadt nach der Seeseite hin schützenden Befestigungen, namentlich das terrassenförmig angelegte, steinerne Castell, in dem der Chef der Militärbehörde der Capstadt residirt, und welches gegenwärtig dem Zulukönig Ketschwaio zum provisorischen Aufenthalte angewiesen worden ist, erwähnt zu werden.
Eine detaillirte Beschreibung der größten Stadt Süd-Afrika's würde zu weit führen und ich will mich nur auf einige wenige Objecte beschränken, und damit von der Metropole scheiden (siehe Anhang 1). Von den Bildungsanstalten der Hauptstadt ist namentlich das South African College zu nennen, an dem Männer vortragen, die bereits als Gelehrte europäischen Ruf erlangt haben. Von den wissenschaftlichen Gesellschaften nimmt die Philosophical Society den ersten Rang in Süd-Afrika ein. Sie hat Originalforschungen auf dem Gebiete aller Wissenschaften zum Zwecke. Der gegenwärtige Präsident der Gesellschaft ist der wohlbekannte Astronom Prof. Gill.
Und nun wollen wir einen Blick auf die Umgebung der Capstadt werfen, deren Scenerie, sowohl dem von der See als auch aus dem inneren Hochlande Kommenden den freundlichsten Eindruck macht und der Hauptstadt einen besonderen Reiz verleiht. Nähern wir uns der Stadt von der hohen See, so fallen uns schon aus großer Entfernung zahlreiche weiße Pünktchen auf, welche sich am Fuße des langgestreckten Löwenkopfes längs der See hinziehen, sie entpuppen sich in der Nähe als Villen, die aus den im prächtigsten Grün strotzenden Gärten hervorlugen und sich am Fuße der hier mit einem Grasteppich bedeckten Hügel, dort schroff abfallenden Felsenhöhe ungemein reizend und malerisch ausnehmen. Ein Tusculum der wohlhabenden Bewohner der Capstadt, besonders der Handelsherren, verbindet eine Pferdebahn, welche von 6 Uhr Morgens bis 10 Uhr Nachts in Betrieb gesetzt ist, diese Vorstadt mit der Metropole. Der von der Stadt entfernteste, nach der hohen See zu liegende Theil dieser Vorstadt wird Sea-Point, der näherliegende, mit ihr zusammenhängende Green-Point genannt. Da, wo sie sich vereinigen, finden sich die Friedhöfe, von denen jener der Europäer den stillen Cypressengärten Madeira's gleicht, während die höher am Bergabhange liegenden Friedhöfe der Eingebornen, namentlich die Begräbnißstelle der mohamedanischen Malayen mit ihren zahlreichen mit Inschriften versehenen Grabsteinen für den Ethnographen großes Interesse bieten. Neben den auf dunklen Schiefertafeln eingegrabenen Inschriften sind diese Gräber blos mit aus Papier geschnitzten und von Zeit zu Zeit erneuerten Blumen geschmückt.
Gewährt schon der Fuß des Löwenkopfes mit den schönen Villen einen reizenden Anblick, so gilt dies in erhöhtem Grade von dem untersten Hange des Teufelsberges. Hier reiht sich auf Meilen hin Dorf an Dorf, Garten an Garten, die einzelnen nett und sauber gehaltenen Gehöfte oft durch dichte Nadel- oder Eichengehölze von einander getrennt und überschattet. Von hundert zu hundert Schritt taucht hier immer ein neues anziehendes Bild auf, das zuweilen ausnehmend schön genannt werden kann, wie z.B. die über diesem Punkte sich erhebende Partie des Teufelsberges hier als eine interessante Felsenformation, dort als Gehölze oder blühende Erikawiesen den Hintergrund bildet. Eine über 100 Meilen landeinwärts führende Eisenbahn verbindet diese Vorstädte mit der Stadt. Züge gehen in der Regel stündlich ab. Ein besonderes Interesse bietet die dritte Station dar, sie führt der königlichen Sternwarte wegen, die etwas abseits gegen den Salt-River zu auf einer zu einem Lustgarten umgewandelten Sanddüne erbaut ist, den Namen »Observatory Road«. Unter der Leitung Prof. Gill's stehend, hat die Sternwarte durch Herschel junior's epochemachende Arbeiten Weltruf errungen. Auch der gegenwärtige Leiter und seine Gemahlin sind in den englischen Kreisen wohl bekannt, sie namentlich durch das von ihr veröffentlichte Werk: »Sechs Monate auf der Insel Ascension«, welche Zeit sie auf dieser öden vulkanischen Insel in Gemeinschaft mit ihrem Mann zubrachte, mit astronomischen, dem Durchgange des Mars gewidmeten Beobachtungen beschäftigt.
Der bedeutendste und anziehendste der drei die Capstadt so bezeichnenden und mit der Stadt selbst berühmt gewordenen Berge ist der schon mehrmals erwähnte 1082 Meter hohe Tafelberg (Table-mountain).
Mehr als ein Drittel der ganzen Höhe des Massivs nimmt der theils mit angebauten Wiesen, theils mit Gras, Buschwerk und mannigfaltigen Haidekräutern bewachsene Riesensockel ein, aus dem fast perpendiculär die mächtige, zerklüftete, doch oben vollkommen abgeflachte Kuppe aufsteigt. Stunden vergehen, bevor man auf die mit Felsenblöcken bedeckte Hochfläche, die dem Berge den Namen gab, gelangt, und oben angekommen, erheischt es die größte Vorsicht, um nicht irre zu gehen! Es ist daher angezeigt, sich der Führung eines Bewohners der Capstadt anzuvertrauen, an solchen bereitwilligen Führern fehlt es aber nicht, denn die Bewohner der meisten Städte Süd-Afrika's zeichnen sich durch ihre Freundlichkeit, ihre Gastfreundschaft und ihr biederes Entgegenkommen aus. Namentlich ist für jene, welche schöne Felsen-Scenerien bewundern wollen, das Besteigen des Tafelberges von hohem Interesse; allein der Genuß, den diese hie und da durch die natürlichen, oft so grotesken Felsenformen und eine reiche tropische Vegetation fesselnden und die Mühe des Besteigens so reichlich entlohnenden Bergeslehnen bieten, wird noch von der schönen Aussicht überboten, die den Besucher erwartet, wenn er müde von dem beschwerlichen Aufstieg an der flachen Kuppe angelangt, den Blick rund herum über den Horizont schweifen läßt. Vor uns dehnt sich scheinbar endlos nach Westen und Norden der Spiegel des Oceans aus, die tief in das Land einschneidende Tafelbai verräth uns jetzt noch das durch Jahrtausende thätige Bestreben des Meeres, den schmalen Felsenriegel, der die Tafelbai von der Kalk- und Simonsbai im Süden trennt, zu durchbrechen. In der Tafelbai selbst aber erblicken wir die flache, durch einen Leuchtthurm und Häusercomplexe gekennzeichnete Robbeninsel, auf der sich gegenwärtig ein Asyl für Irrsinnige und ein Staatsgefängniß für angesehene politische, den dunklen Racen angehörige Sträflinge befindet.
Unter uns der im farbenreichen Grün strotzende Fuß des Tafelberges und zwischen ihm und der Bai, in der zahllose, theils im sicheren Hafen, theils außerhalb auf der freien Rhede liegende Schiffe von regem Handel zeugen—die hellschimmernden Gebäude der Stadt, durch die sich kreuzenden geraden Straßen als ein Complex von Rechtecken hervortretend, deren Monotonie hie und da oasenförmig durch das Grün der Gärten und Alleen angenehm unterbrochen erscheint. Dort drüben am Abhange des Löwenberges die stillen Ruheorte der Malayen und der Farbigen überhaupt, weiter nach dem Green point-Leuchtthurm zu, die mit hohen Cypressen bewachsenen Friedhöfe der Bleichgesichter. Doch lassen wir das Bild des Vergehens und wenden wir unsere Blicke zur Rechten und zur Linken, wo sich die beiden Genossen des Tafelberges erheben. Da wo der Löwenkopf sein steiles Haupt erhebt, verbrüdert er sich mit einem der zwölf Apostel, die an ihrem steilen Fuße von den Wogen des Oceans bespült, stolz ihre zackigen spitzen Höhen in den blauen Aether erheben. Schweift der Blick zur Rechten und hat er sich an allen die Phantasie erregenden Formen, an den Felsenschluchten, Klüften, Felsenmauern, Terrassen und Riesenblöcken des Teufelsberges gesättigt, so blickt das Auge weiter hinaus auf eine mit Gebüschen, Wäldern und Haidekräutern bewachsene Ebene, auf grüne, glänzenden Teppichen gleichende Wiesen und angebaute Fluren, in denen sich Villen und Farmhäuser anmuthig bemerkbar machen, und die der Wohlhabenheit und Emsigkeit der Ansiedler das beste Zeugniß geben. So bietet die Umgebung der Metropole Süd-Afrika's, mögen wir sie von dem ehrwürdigen Haupte des Tafelberges, oder von den beiden anderen Höhen betrachten, mögen wir ihr von der See aus, von dem schaukelnden Boote unsere Aufmerksamkeit widmen, uns immer ein anziehendes, wechselndes Bild! Vom letzteren Standpunkte aus betrachtet, wird das Bild ungleich interessanter, indem eine scharf nach oben abgegrenzte Wolkenschichte in der Regel die obere Hälfte der beiden höheren Berge so verhüllt, daß das spitze Haupt des einen und das flache des andern über die Wolkenbank hinausragen und dadurch einen effectvollen Anblick gewähren.
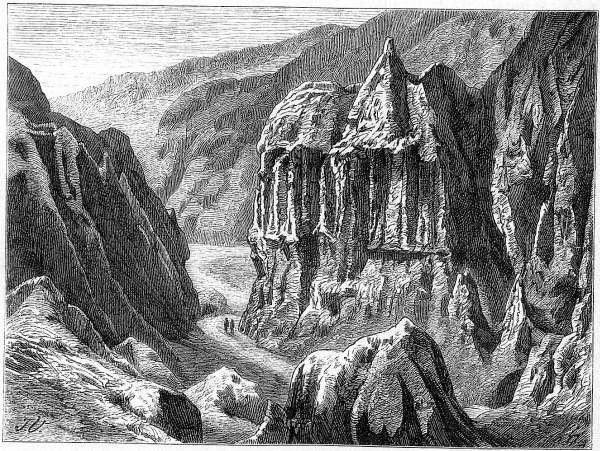
[Schlucht am Abhange des Tafelberges.]
Nach zweitägigem Aufenthalte in der Capstadt verließ der »Briton« die Tafelbai und wandte den Kurs um das Cap der Guten Hoffnung nach Osten, nach der Algoabai, um in der zweitgrößten Stadt der Colonie, dem wichtigsten Handelsorte Süd-Afrika's, woselbst die Mehrzahl seiner Passagiere an's Land zu gehen beabsichtigte, zu landen.
Die Fahrt längs der steilen bergigen Küste ist eine gefährliche und manches Schiff, selbst in jüngster Zeit, fand an den verborgenen Felsenriffen, welche die Küste säumen, sein Verderben.
»Ich versichere Sie,« äußerte sich einer der Stewarts[1] an Bord des »Briton«, »unter fünf Shillingen werden Sie nicht an das Land gelangen.«—Fünf Shillinge für eine Bootfahrt von etwa 1000 Schritt Länge? Unmöglich! So tönte es als Antwort in allen möglichen Sprachen zurück. Die Forderung schien unvergleichlich hoch. Eine halbe Stunde später und wir zögerten nicht, für dieselbe Leistung das Zweifache, d.h. zehn Shillinge zu geben, denn unter diesem Preise wollte keiner der Bootsleute einen Passagier an's Land bringen. Für mich war dieser an und für sich geringe Betrag eine harte Contribution, betrug ja mein ganzes Vermögen in diesem Momente nur 3½ £ St. und damit stand ich erst an der Schwelle des Landes, dessen Erforschung meine Aufgabe war!
1 Kellner.
Algoabai ist gleich den übrigen Buchten der Küste Süd-Afrika's eine weite, jedoch offene und deshalb den Stürmen ausgesetzte Bucht; die eine Seitenbucht der Simonsbai bildende Kalkbai ausgenommen, hat die ganze Südküste der Cap-Colonie keinen sicheren Hafen aufzuweisen, gewiß ein nicht zu unterschätzender Uebelstand, ein Hinderniß für die Entwicklung des Imports und Exports, denn abgesehen von der umständlichen und zeitraubenden Lösch-Manipulation der Ladung zwischen den zumeist in 500 bis 700 Schritten Entfernung von der Küste ankernden Schiffen und dieser, werden Fracht und Transport durch diesen Uebelstand ungewöhnlich vertheuert, andererseits nöthigten die Gefahren der offenen Rhede zu kostspieligen experimentalen Hafenbauten, deren Ausführung bedeutende Summen verschlingen, die sonst der Colonie zu Gute kommen würden.
Ein Gang entlang dem Strande der Algoabai, entrollt uns ein neues Bild des zürnenden Oceans, und beweist uns die Richtigkeit der zweiten Benennung des Cap der guten Hoffnung als Cap der Stürme. Hier aus der kahlen Düne, dort über den nackten zerrissenen Felsen, ragt ein Wrack empor, ob sein Rumpf auch eisengepanzert war, die Wuth des Sturmes und die Klippen des Strandes, sie kannten keinen Unterschied. Zerschellt liegt es neben dem einfachen Holzbaue an der öden, unwirthlichen Küste.
Jene—und weil meist zur Nachtszeit sich abspielend—um so furchtbareren trüben Episoden, wo wüthende Südoststürme schäumende Riesenwellen nach dem Ufer der Algoa-Bai schleuderten und ein Fahrzeug nach dem andern, oft bis neun in wenigen Stunden, an den Felsen zerschmetterten oder auf die Sandbänke warfen—sind in der Geschichte des neuen Hafenortes der zweitgrößten Stadt Süd-Afrika's ebenso wichtige und ereignißvolle als höchst traurige Gedächtnißtage geworden. Doch zurück zu meiner Ankunft im Weichbilde der Stadt![1]
Auf einem etwa 200 Fuß hohen, felsigen Abhange erbaut, dehnt sich Port Elizabeth über eine Fläche von zwei englischen Meilen Länge und ¼ bis 1 Meile Breite aus; entbehrt die Lage der circa 20.000 Einwohner zählenden Stadt auch landschaftlicher Schönheit, so ist ihre Bedeutung als Handelsstadt ein Ersatz hiefür, indem sie für ganz Süd-Afrika südlich des Zambesi die Rolle einer Handels-Metropole übernommen hat.
Namentlich wird die östliche Provinz der Cap-Colonie, der Oranje-Freistaat, die Diamantfelder, theilweise auch der Transvaal-Staat und das Innere Süd-Afrika's von diesem Hafenort aus versehen. Die Handelsinteressen werden von einer Gewerbekammer gewahrt, welche die bedeutendsten Kaufleute der Stadt zu ihren Mitgliedern zählt. Längs dem Abhange, an der 1½ englische Meilen langen Main-(Haupt-)straße von der sich wieder kleinere Straßen nach dem Meeresufer abzweigen und andere diesen unteren mit dem oberen Stadttheil auf der flachen Höhe verbinden—meist in eleganten und in großem Maßstabe aufgeführten Geschäftslocalen haben die bedeutendsten Handelshäuser Port Elizabeths ihre aus allen Welttheilen herrührenden Waaren aufgespeichert. Die Handelsherren selbst haben es sich oben am »Hill«, auf der Höhe, in luxuriös eingerichteten Wohnungen bequem gemacht, wo man eine Aug und Herz erfreuende Fernsicht auf's Meer und die frische Luft der Algoabai genießt. Hier haben sie in einem Clubhause eine elegante Ressource eingerichtet, wo sie sich namentlich an Mittwochen zu einem gemeinschaftlichen Diner einzufinden pflegen.
Ein kleiner schlammiger Fluß scheidet die Stadt in einen südlichen kleineren und einen größeren nördlichen Theil, ersterer wird meist von malayischen Fischern bewohnt. Nicht weit von dem Bakensfluß, am südlichen Ende der oberwähnten Mainstraße findet sich der Marktplatz, von dem prächtigsten Rathhause Süd-Afrika's an seiner südlichen Seite begrenzt. Sein Centrum ist von einer Granitpyramide geziert und man gelangt zu ihm unmittelbar von dem in's Meer auslaufenden Pier,[1] so daß er den Fremden, der sich durch die etwas monotone Ansicht der Stadt vom Meere aus, nicht viel verspricht, mit seinen schönen Gebäuden und den einer europäischen Großstadt ähnlichen, luxuriös ausgestatteten Verkaufslocalen auf das Angenehmste überrascht. Zwischen dem Meere und diesem Marktplatz, wie auch bis zur Mündung des Bakensflusses, ziehen sich riesige Speicher, in denen die Wolle zur Ausfuhr aufgestapelt und die eingeführten Güter, bevor sie in die Stadt gebracht werden, lagern.—Der Anblick der Stadt von der See aus wird in seiner Einfachheit einigermaßen durch die zahlreichen schönen Kirchen etwas gehoben. Oben am Hill findet sich auch ein sehr gut eingerichtetes Hospital und etwa eine halbe Meile davon landeinwärts, sowie unmittelbar unter den Höhen am nördlichen Ende der Stadt je ein botanischer Garten. In der Stadthalle finden wir eine sehr gute Bibliothek und ein leider vollkommen verwahrlostes Museum, auf das ich noch später zurückkommen werde.
1 Ich nenne Pier, die in's Meer auslaufenden, bei Hafenbauten errichteten Holzbrücken.
Nachdem ich gelandet, suchte ich ein Hotel auf, doch nicht mit der Unbefangenheit des wohlausgerüsteten Reisenden, denn meine Barschaft war, nachdem ich die zu entrichtende Waffensteuer (1 £ St. für meinen Gewehrlauf, zehn Shillinge für meinen Revolver) geleistet, bis auf zehn Shillinge zusammengeschmolzen und selbst diese dankte ich nur dem Umstande, daß die meinen Hinterlader enthaltende Kiste nicht mit auf dem »Briton« verschifft worden war. Ein deutscher Kaufmann, Hermann Michaelis, an den ich einen Empfehlungsbrief hatte, wies mich an den österreichischen Consul, Herrn Adler, und diesem Manne habe ich es zu danken, daß mir Port Elizabeth zu einem angenehmen Aufenthaltsorte wurde. Ich kann es nur herzlich wünschen, daß die Vertreter Oesterreich-Ungarns, auch in anderen Weltgegenden solch' regen Eifer für das Wohl der ihrem Schutze Empfohlenen an den Tag legen, in so energischer und unermüdlicher Weise die Interessen ihres Staates wahren möchten, als ich es in Port Elizabeth gefunden. Sowohl Herr Adler, der damalige Consul, als auch seine beiden Nachfolger, die Herren Allerberg und Mosenthal, der gegenwärtig Oesterreichs Interessen vertritt, bewiesen sich mir als solche.
Herr Adler führte mich bei den Honoratioren der Stadt ein und bald hatte ich die Freude und Genugtuung, einige Patienten meiner Obsorge anvertraut zu sehen. Um jedoch die freien Stunden wo möglichst zu benutzen, machte ich täglich Ausflüge in die Umgegend, die ich in Folgendem zu schildern versuchen will. Schon nach vierzehntägigem Aufenthalte in Port Elizabeth wurde mir von einem der Großhändler der Stadt der Antrag gestellt, mich gegen ein Jahreshonorar von 600 £ St. in der Stadt als Arzt niederzulassen. So ehrenvoll der Antrag für mich auch war, und so sehr seine Annahme mich von allen Lebenssorgen befreit hätte, ich konnte ihn aus noch näher anzuführenden Gründen nicht annehmen.
Zu meinen Ausflügen erkor ich mir einerseits das südliche Meeresufer, eine breite, theils mit dichtem tropischen Gebüsch bewachsene, theils meilenweit mit Sanddünen bedeckte Landzunge, die an ihrer äußersten Spitze ein Leuchthaus trägt (7 Meilen von Port Elizabeth entfernt), anderseits das nördliche Meeresufer nach der Mündung des Zwartkop-River zu, sowie auch das Thal des Baker-River, das mir viel des Interessanten darbot.—Zu diesen Gängen wählte ich mir in der Regel (nach beendeten ärztlichen Visiten) den Morgen und kehrte am Nachmittag heim. Mit allen Hilfsgeräthen eines Sammlers ausgerüstet, verließ ich dann das Hotel und eilte an den Wollspeichern vorüber nach der über den Bakensfluß führenden Brücke zu. Auch an diesen großen Wolllagerplätzen konnte ich nie vorübergehen, ohne nicht ein halbes Stündchen das Treiben an der sich zwischen dem Meer und den Gebäuden etwa 250 Schritt breit erstreckenden Düne zu verfolgen. Diese bietet dem Besucher einen, Port Elizabeth charakterisirenden und gewiß sehr anziehenden Anblick dar. Auf einer etwa 500 Schritt langen und 250 Schritt breiten, sandigen Fläche finden wir alle möglichen Schiffsartikel aufgestapelt. Da liegen an's Land gezogene Kähne und an ihnen gelehnt, schmauchen zahlreiche Theerjacken ihr Thonpfeifchen—so gemüthlich und phlegmatisch—für alle Welt vergessen, wie es die »getreuesten« ihres Schlages an den Ufern Alt-Englands zu thun pflegen! Förmliche Barrikaden von Fässern, Kisten, Eisendrahtrollen etc., riesige Anker und Ketten sowie verschiedene Schiffsreste sind über die Fläche zerstreut aufgethürmt. Ein reges Leben herrscht in diesem Labyrinthe von Kisten, Fässern und Rollen, ein stetes Auf- und Abladen, hier in die großen Waaren-Lagerhäuser, dort unmittelbar auf die großen, ochsenbespannten Capwägen, deren Bestimmungsort viele hundert englische Meilen landeinwärts liegt. Das Amt der Custom-Officers (Zollbeamten) ist denn auch hier kein leichtes, ihre Thätigkeit eine angestrengte.
Einen anziehenden Anblick bietet auf der Düne, das Landen der Kutter, welche die Waaren von den Schiffen bringen, das Ausladen derselben durch hunderte von schwarzen, nackten Hünengestalten. Die Seefahrzeuge, deren oft mehr denn 30 in der Bucht liegen (die Dampfschiffe etwa der Mündung des Baker-River gegenüber) können nicht bis zum Ufer gelangen, die riesigen Stein- und Pallissadenbrücken (Piers), die man in's Meer hinausgebaut, um das Anlegen der Schiffe zu ermöglichen, erweisen sich nutzlos, da sie einesteils nicht den hinreichenden Schutz bieten, theils zur Versandung führten, so daß noch immer jene überseeischen Fahrzeuge weit auf offener Rhede ankern müssen. Namentlich von der Höhe aus gesehen, bieten die Fahrzeuge wie sie sich auf der dunklen Fluth hin- und herwiegen, einen interessanten Anblick, oft kann man die mit vollen Segeln auslaufenden Segelschiffe, die großen oceanischen Dampfer aus- und einlaufen sehen, ein Anblick, der den Beobachter unwillkürlich mehr denn als Viertelstunden zu bannen vermag. Von den Schiffen werden die Waaren in unbeholfen aussehende, einmastige Kutter geladen und in den letzteren nach der sandigen Uferstelle, den Lagerhäusern gegenüber, gebracht. In einem »Nu« ist der Kutter von einem Schwarm Schwarzer umringt, die an ihm emporkletternd sich die Waaren reichen; es währt nicht lange und die Ladung ist gelöscht, d.h. in die Lagerhäuser getragen. Den geräuschvollen, allein so manch' Anziehendes darbietenden Ort verlassend, überschreiten wir die Bakerbrücke, um, die Ansiedlung der Malayen durchschreitend, das freie Meeresufer zu gewinnen. An der Mündung des genannten Flusses hatte man solch' einen Pier (Brücke) angelegt, was eine Versandung des vermeintlichen Hafens, den das kleine Flüßchen nicht auszuwaschen die Kraft und nöthige Strömung besaß, nach sich zog.
Das südliche Seeufer ist ein einziges bis zum Leuchthause reichendes terrassenförmig in die Tiefe absteigendes Felsenriff, hie und da mitunter durch Anbau verschiedener Seethierchen, namentlich Korallenthierchen incrustirt. Kürzere und längere Stellen sind mit Sand, doch blos am Ufer selbst, bedeckt, ohne daß der Sand tief in's Meer reichen würde, wie es nördlich von der Stadt gegen den Zwartkop-River der Fall ist. Was ich nun in der Ebbezeit in den künstlich von den Seethieren gebildeten Grotten an solchen auffischen, fangen und an vom Südoststurme ausgeworfenen Korallen und Algen habhaft werden konnte, das habe ich damals treu heimgeschlepppt. Auf meiner Rückreise aus dem Innern, während meines letzten Besuches der Stadt, konnte ich allerdings mit größerem Erfolge und im weiteren Umfange diese Sammlungen betreiben. Von meiner kleinen schwarzen Dienerin Bella und 4-5 gemieteten Schwarzen gefolgt, arbeitete ich mehrere Stunden hindurch an der Küste und kehrte mit reicher Beute zur Stadt zurück. Viel Vergnügen machte uns der Fang der Nautilus-Männchen, die in den Grotten zurückgeblieben waren. Mit einem aus Eisendraht verfertigten Haken stöberten wir in den noch mit Seewasser gefüllten Felsenlöchern umher; war einer jener Cephalopoden daselbst zurückgeblieben, so fuhr er sofort wild nach dem metallenen Eindringling, der es uns ermöglichte, ihn von dem Felsen, an dem er sich oft sehr fest geklammert, loszulösen. Fiel er dabei an eine trockene Stelle, so bewegte er sich rasch, indem er die Fangarme anzog, nach der Seeseite zu; fiel er auf loses Gestein, so hoben wir ihn in der Regel mit fünf bis zehn oft faustgroßen Steinen auf. Die größten dieser Thiere hatten eine Länge von 5 Zoll und bis 24 Zoll lange Fangarme; sie werden häufig von den Malayen aufgesucht und genossen, und sind unter dem Namen der Katfische bekannt. Oft trafen wir an einzelnen Stellen junge Männer und Frauen, welche mit Hämmern große Schnecken, Napfschnecken und Austern losschlugen, um selbe in der Stadt zu verkaufen, doch begegneten wir auch weißen Knaben, welche in, unseren Schmetterlingsnetzen ähnlichen Säckchen, kleine Palämons fingen, die in Port Elizabeth von Vielen als Delicatesse angesehen werden. Taucher und Möven beleben die seichteren Partien, erstere fliegen niedrig und spät auf, so daß mein Hund Spot mehrere erbeutete.
Ich erwähnte, daß dieses Ufer eine Art breite Landzunge bildet, welche etwa zur Hälfte eine einzige öde Sanddüne ist, während die andere Hälfte, meist an der Seite von Port Elizabeth und der Theil nach dem Leuchthause zu mit Ausnahme der äußersten Spitze, mit einer üppig wuchernden Vegetation bewachsen ist; und doch hat diese nur in dem Dünensande festen Fuß gefaßt, gewiß staunenswerth, um so mehr, als der Forscher auf dieser Strecke wenigstens 1000 Pflanzenarten finden dürfte. Vor Allen ist die fleischig-blättrige Mittagsblume in sehr vielen Arten vorhanden, deren eine hie und da mit schönen, citronenfarbigen, handgroßen Blüthen frisch aus dem dunklen Grün ihrer in Büscheln stehenden, fingerförmigen, dreikantigen Blätter hervorleuchtet. Einige Schritte vor uns, am Fuße eines dichten Gebüsches prangt eine zweite und dritte Art, die eine mit kleinen orangefarbenen, die zweite mit dunkelrothen Blüthen und während wir uns zu ihnen hinbeugen, überrascht das Auge aus einem niederen Binsendickicht zur Rechten ein dichtes Lager von einer dunkelblättrigen Art mit prachtvollen, Doppelthaler großen, hellrothen Blüthen. Wir haben uns noch nicht entschieden, welche wir zuerst in unsere Büchse aufnehmen sollen, als bei dem nächsten Tritte das Ausgleiten des Fußes zur Vorsicht mahnt, und als wir nach der Ursache unseres Falles forschen, finden wir, daß ihn ein zierliches Mittagsblümchen verschuldete, das theilweise von dem Rasen gedeckt, mit seinen weißen Blüthenscheiben friedlich da unten vegetirte. In der Betrachtung dieses Blüthenflors übersieht das Auge fast die Menge von Zwergbüschen, die vielen Binsen- und Euphorbia-Arten.
Der Entstehungsweise entsprechend, bildet diese sandige Unterlage für Meilen hin kleine, seichte, wiesenbedeckte Parallelthälchen und bebuschte Erhebungen, die letzteren etwa 30-50 Fuß über der Meeresfläche, die Thälchen 10-20 Fuß tief, 100-900 Schritte lang. Namentlich reich an Vegetation ist das westliche Ufer, d.h. jenes vom Leuchthaus nach Westen zu, an dem auch mehrere Farmhäuser liegen und unzählige Quellen zu dem hier eine einzige, zerrissene Felsenklippe bildenden Meeresufer hinabrieseln. Die Sümpfe sind hier mit zahlreichen, den Moorboden liebenden Gewächsen überwuchert, farbenprächtige Blumen und mehrere Schilfrohrarten säumen die offenen Tümpel ein; diese Sümpfe bedecken die Abhänge zum Meere, während die niedrigen, oben abgeflachten Höhen in seichten doch breiten Thälern hier mit unzähligen, oft kaum wahrnehmbaren, dort bis vier Fuß hohen buschartigen Erica-Arten überreich bedeckt sind; einem Botaniker geht das Herz über, wenn er so in diesen Schätzen nach Muße schwelgen kann. Diese Erica-Arten zeigen nicht allein mannigfache Blüthenformen, sondern auch alle möglichen Farben in den zarten Blüthen; weiß und grau meist die hohen strauchförmigen, gelblich bis ockerfärbig die kleineren, doch auch roth in allen Nüancen und violett bis zu noch dunkleren Tönen.
Der südwestliche Theil der Cap-Colonie ist durch seine Erica-Flora charakterisirt, die in einem jedoch nicht tief in's Land reichenden Gürtel den südlichsten Vegetations-Typus von Afrika bildet; die Umgegend von Capstadt und Port Elizabeth weisen die meisten Arten auf.—Außer den schon genannten findet der Forscher zu allen Jahreszeiten gewisse Liliaceen in der Blüthe, namentlich schönfarbige—feuer- und carminrothe—auch schlanke Schwertblumen sind ziemlich häufig anzutreffen, ihr schönes Roth mahnt an jenes der Aloëspecies, die wir so häufig an den Abhängen der Zuurberge etc. vorfinden. Von Cryptogamen sind namentlich Moose auf den überwucherten Dünen zu finden. Wenn man durch dieses Blumeneden schreitet, wähnt man, daß außer den Insecten und einigen wenigen Singvögeln kein lebendes Wesen diese Strecken bewohne. Und doch sind sie von so manchem Thiere bewohnt, von Thieren jedoch, die in den undurchsichtigen, wenn auch niederen Gebüschen vor den Menschen Schutz suchen, und nur Nachts sich aus denselben wagen. Es ist eine zierliche, kaum einen halben Meter Höhe erreichende Gazellenart, dann Hasen und Springhasen, graue Wildkatzen, Genettkatzen, Mäusehunde etc., die Nachts ihr Wesen in den Büschen und den wiesigen Niederungen treiben. Der Leuchtthurmwächter fängt so manche in Eisen, mit denen er seinen Miniaturgarten, den er sich in einem Thälchen angelegt, umgab.
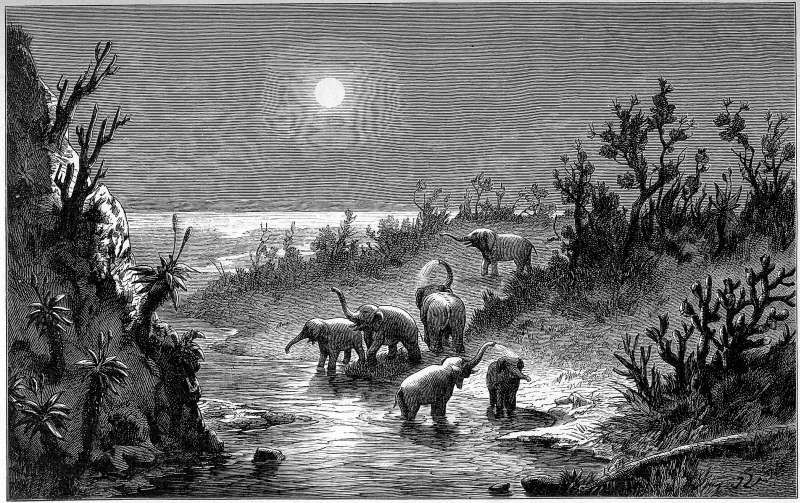
[Elephantengruppe, Nachts am Zondags-River.]
Ja, das Leben in diesem Leuchtthurme an der Sanddüne, von drei Seiten vom tobenden Meere umspült, zeigte mir eine der reinsten Idyllen, die ich je beobachtet. Doch ich muß befürchten, daß es mir hier an Raum gebricht, ihm eine längere Schilderung, die er verdienen würde, zu widmen. Der Wächter fühlt sich in seiner Oede vollkommen glücklich. Monatlich einmal geht er nach der Stadt, um seinen Gehalt zu beziehen, während wöchentlich ein zweirädriger Karren ihm seine Bedürfnisse von der Stadt zuführt. Er lebt mit seiner Familie und einem Gehilfen in einem steinernen Gebäude unter dem Leuchtthurm und hat jedes Schiff, das von der hohen See in die Algoabai einlaufen will, oder das die Bucht in sichtbarer Ferne passirt, nach der Stadt zu signalisiren. »Ich habe einen Tag den Dienst, den anderen mein Gehilfe, damit ich jedoch etwas im Gärtchen arbeiten kann, habe ich meiner Tochter telegraphiren gelernt, die mir nun im Dienste recht behilflich ist,« erklärte er mir. Ich kann es mir nicht versagen, hier eines Erlebnisses des Leuchtthurm-Castellans zu erwähnen, das er mir erzählte.
»Während einer stürmischen, dunklen Nacht verirrte sich der Capitän einer »Barke«, sah unser Licht für das von Port Elizabeth an (er hatte unzureichende Seekarten zu Gebote und war noch nicht in diesen Gewässern bekannt) und steuert auf uns los; als wir das Schiff erspäht hatten, sahen wir auch, daß dasselbe glücklich in einem durch Klippen gefährdeten Kanal Anker geworfen hatte. Ich telegraphirte nach Port Elizabeth, gegen den Morgen kam die »Tug« (Schleppdampfer), die es glücklich aus seiner unbequemen Lage herausbugsirte; etwa 20 Minuten nachher trat die Fluth ein, eine Verspätung um diese Zeit und das Schiff wäre rettungslos an den Felsen zerschellt worden.« Die Wachsamkeit des Wächters fand auch ihren Dank.
Lohnend waren meine Ausflüge an die Ufer der beschriebenen Landzunge während meines letzten Besuches von Port Elizabeth, ich erbeutete namentlich Seefische, Krabben, Cephalopoden, Würmer, Schnecken, Patellen, Seeraupen, Seehasen, Muscheln, Korallen, Schwämme etc., Algen und mehrere Arten Haifischeier.
Außer diesen Ausflügen nach dem südlichen Ufer der Bucht unternahm ich welche in entgegengesetzter Richtung nach dem nördlichen, gegen die Mündung des Zwartkop-Flusses. Das Ufer ist hier meist sandig, bis tief in's Meer hinein, noch die glücklichste Stelle, an der ein Schiff, wenn ihm der Südoststurm die Ankerketten bricht, stranden kann. Das Meer gab mir auf diesen Ausflügen namentlich interessante Muschelarten, an der Mündung des Flusses schwärmen Haifische und der Fluß selbst liefert dem Forscher zahlreiche Seefische, während seine Ufer, namentlich das linke, reichhaltige Petrefacten aus der Kreideperiode und im Alluvialboden Ueberreste von jetzt noch in der See lebenden muschelartigen Thieren und interessante schraubenförmige Gypsformationen zeigt. Hier finden wir (das Ufer ist flacher als das südliche) auch riesige Lagunen sich in's Land hinein erstrecken, die dem Ornithologen so manch' schönen Regenpfeifer, Strandläufer und Hammerkopf versprechen. Wir finden hier viele neue Species von Blumen, namentlich Aloë, Wucherblumen, Ranunculus und eine fleischige, nur hier anzutreffende Winde.
Ich kehrte gewöhnlich landeinwärts nach der Stadt zurück, die zwischen dem Fluß und der Stadt liegende Salzpfanne (kleiner salzhaltiger und zeitweilig im Jahre mit Wasser gefüllter, etwa 500 Schritt langer und 200 Schritt breiter See) berührend. Hier fand ich wieder neue Blumen, einige interessante Käfer und Schmetterlinge. Diese »Saltpan« liegt auf einer Grasebene, die nach Westen von dem Abhange, an dem die Stadt erbaut ist, begrenzt wird. Auch diese Ebene weist andere meist niedrige Pflanzen auf, ebenso der steinige Abhang, der überdieß in den Frühlingsmonaten August und September, an Schlangen, Eidechsen, Scorpionen, Spinnen und Insecten eine sehr reiche Ausbeute liefert; ich fing an diesem Abhange allein 34 Schlangen. Um diese Zeit (in den genannten Monaten) beginnt die Winterkälte nachzulassen, die Reptilien und Käfer verlassen ihre Löcher und Schlupfwinkel, die Morgen und Nächte sind jedoch noch so kalt, daß sie sich unter die größeren Steine zurückziehen. Hier liegen sie so ein bis zwei Wochen in einem halberstarrten Zustande, der es ermöglicht, die Thiere, ohne sie stark zu schädigen, zu bemeistern und der Spiritusflasche einzuverleiben.
Auch die landeinwärts unternommenen Ausflüge, welche mich gewöhnlich durch das Thal des Bakensflusses führten, ermangelten nicht ihres besonderen Reizes. Schroffe Felsenwände, riesige terrassenförmig sich aufthürmende Blöcke charakterisiren das Thal an seinem Unterlaufe, hochgrasige, blumenreiche Triften die Abhänge seiner mittleren Partien, Alles deutet darauf hin, daß wir uns in der Nähe des Meeres befinden, die über das Thal zerstreuten Niederlassungen und Gehöfte, die üppig wuchernde Vegetation von tropischen Büschen, Schlingpflanzen und Farren, die jede feuchte Stelle verräth und besonders an den Ruinen verlassener Wohngebäude lustig emporrankt. Einige hundert Schritte von der in einer Thalbucht erbauten Dampf-Wollwäscherei fand ich unter dem Gesteine ein Vipernpärchen eingerollt; da sie neben einander in einer wohl von einer großen Spinne herrührenden Vertiefung lagen, erfaßte ich mit der Zange zuerst die eine und beförderte sie rasch in meine mit den verschiedensten Kriech- und Kerbthieren zum größten Theile gefüllte Sammelflasche; ohne Schwierigkeit gelang es mir auch, das ahnungslos des Männchens beraubte Weibchen zu fangen, so daß das Pärchen nun wieder vereint war. Meine Excursion fortsetzend, hielt ich die Schlangen nach mehreren Minuten für hinreichend betäubt, um die Flasche öffnen zu können und um neue Funde rasch in Sicherheit zu bringen. Das offene Gefäß in der einen Hand, sammelte ich eifrig weiter, als mich plötzlich ein eigentümliches Rieseln an meiner Hand aufschreckte; ein Blick zeigte mir, was geschehen,—unwillkürlich ließ ich die Flasche mit ihrem ganzen Inhalt fallen, der Fluchtversuch der Schlangen mißlang jedoch, denn nachdem ich meine Fassung wieder erlangt, fing ich die Ausreißer wieder ein, diesmal mit aller Vorsicht die Flasche verschließend.
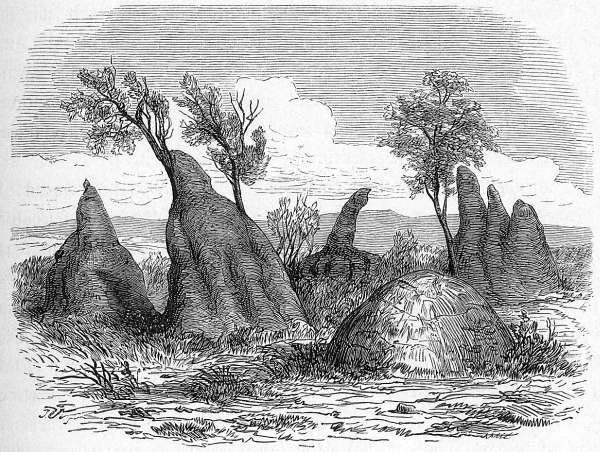
[Termitenhaufen.]
Eines Tages lud mich Herr Michaelis ein, mit ihm zu einem Freunde auf die Hochebene zu fahren, um »Bienen auszunehmen«; es war ein kleiner, etwa einen halben Tag in Anspruch nehmender Ausflug, der mir viel Freude machte. Wir fuhren in einem zweirädrigen gedeckten Karren hinauf auf den »Hill« und dann östlich auf die sich nach Nordost ausbreitende Ebene hinaus. Mit niedrigem Grase bewachsen ist dieses Hochplateau von Tausenden von meist halbkugelförmigen, einen Meter im Durchmesser haltenden und ½ bis 2/3 Meter hohen, rothbraunen Termitenhaufen bedeckt. Die noch bewohnten haben eine glatte, die verlassenen, deren es einige gab, eine rauhe, durchlöcherte Oberfläche. Ein Termitenbau wird nur dann verlassen, wenn seine Königin umkommt. Diese verlassenen waren eben die Stellen, wo meine Freunde nach dem Honig fahnden wollten. Während man in dem waldigen Innern Afrika's den Honigvogel als Führer zu den Nestern der wilden Bienen benützt, war es in unserem Falle in Port Elizabeth ein halbnackter, mit einer rothen, wollenen Zipfelmütze bedeckter Fingo, der, neben dem Karren einherlaufend, die verlassenen Termitenhaufen mit Kenneraugen prüfte. Es währte auch nicht lange, so winkte er uns zum Stillstande, er hatte gefunden, was wir suchten; aus einem der zahlreichen verlassenen Termitenhaufen sah man Bienen ein- und ausfliegen. Rasch war das Gefährt versorgt und bald hatten die Rauchwolken eines Feuerbrandes die Bienen in ihrem Baue betäubt. Nun ging's an's Wegräumen des Termitenbaues, in dessen früherer Höhle wir mehrere parallel zu einander befestigte Honigkuchen fanden, die theils von duftendem Honig, theils von junger Brut strotzten; ich konnte es mir nicht versagen, den ganzen Bau mit einigen Strichen in meinem Notizbuche zu verewigen. Die Zerstörung des Erdhaufens brachte auch zwei Scapsteeker (Schlangen) in meine Gewalt, die meiner stetig anwachsenden Sammlung einverleibt wurden. Mit solchen und ähnlichen Ausflügen waren vier Wochen meines Aufenthaltes in Port Elizabeth rasch verflossen, und nun hieß es, an den Aufbruch in das Innere denken.
Ich habe bereits im Vorhergehenden eines Antrags gedacht, der mir von Seite eines Großhändlers in Port Elizabeth gemacht wurde, so verlockend er war, ging ich darauf nicht ein, da mir einestheils von einem Kaufmanne aus Fauresmith im Oranje-Freistaat weit günstigere Verhältnisse in Aussicht gestellt waren, und andererseits mir Alles daran lag, dem Ziele näher zu kommen, und verläßliche Nachrichten über das Innere erlangen zu können, dazu aber war Fauresmith, mehr denn 60 geographische Meilen nördlich von Port Elizabeth gelegen, geeigneter als dieses selbst.
Herr Michaelis setzte mich nicht nur durch ein freundlich gewährtes Darlehen in den Stand, nach Fauresmith zu reisen, sondern erbot sich selbst, mich zu begleiten. Nur ungern schied ich von Port Elizabeth und allen während meines kurzen Aufenthaltes hier gewonnenen Freunden, deren herzliches Entgegenkommen ich nicht genug rühmen kann.
Meine Reise nach den Diamantenfeldern.
So verließ ich denn in den ersten Tagen des August 1872 Port Elizabeth, um über Grahamstown, Cradock, Colesberg und Philipolis, Fauresmith zu erreichen.
Von vier kleinen Pferden gezogen, legten wir die 86 englische Meilen betragende Strecke nach Grahamstown, der drittgrößten Stadt der Cap-Colonie, in einem zweirädrigen Karren in 11 Stunden zurück.
Diese Strecke ist in Bezug auf die Schönheit der Scenerie und der Vegetation gewiß die anziehendste. Heute gelangt man nach jenem Orte mittelst Bahn, auch diese führt durch reizende Partien, wenn ich ihnen auch jene, die man früher per Achse passirte, vorziehe. Der größte Theil des Weges führt längs den Abhängen der Zuur-Berge, welche bebuscht und bewaldet mit ihren Schluchten und Thälern, mit den eingeschlossenen Lagunen und den begrenzenden Bergwiesen, dem Künstler wie Naturliebhaber viel des interessantesten Stoffes bieten. Ich möchte sagen, daß wir auf dieser Strecke den mannigfachen Typen größerer Landstriche aller Welttheile begegnen. Weite Ebenen, zum Theil mit hohem Grase bedeckt, erinnern uns lebhaft an eine Pußta, nur daß die bekannten, unbeholfenen Ziehbrunnen fehlen; kurzbegraste Flächen rufen uns ein Bild der Steppe in's Gedächtniß, während einige wenige mit spärlichem Graswuchs bewachsene Sandflächen an die Wüste mahnen. Mancher hochbegraste Abhang gewährt mit den hunderten ihn bedeckenden riesigen und armleuchterartig geformten Euphorbien ein fesselndes Bild, doch den anziehendsten Anblick bieten die bebuschten und mit Niederwald bedeckten Partien.
Die Gebüsche stehen bald gruppenweise, auf Wiesenpartien dichte Knäuel bildend, ein Vegetationsbild, das namentlich weiter im Innern Süd-Afrika's ganze Landstriche charakterisirt; doch bei weitem der größte Theil der Strecke Port Elizabeth-Grahamstown ist von einem sozusagen undurchdringlichen Gebüsche bedeckt, das theils von eigentlichen Büschen, theils von Zwergbäumchen gebildet wird. Manche derselben scheinen wahre Riesen an Alter zu sein, während andere wieder von gewissen Insectenarten befallen, in kurzer Zeit absterben und unaufhaltsam der Fäulniß unterliegen.
Oft führte uns der Weg an Abhängen vorüber, deren weißberindete Bäumchen mit Schüssel- und Baumflechten über und über bedeckt, einen eigenthümlichen Anblick darboten und an niederschlagreiche Gegenden mahnten; besonderen Reiz und eine anmuthende Erinnerung an die Wälder des Nordens gewährte das massenhafte Auftreten einer Bartflechte (Usnea), welche mit ihren grau-grünen, fußlangen und dichten Zotten, einer Draperie gleich, die Queräste der Bäume schmückt und ihnen einen ehrwürdigen Anblick verleiht. An anderen Stellen wieder überschaut das Auge auf Meilen hin mit Zwergbüschen bedeckte Abhänge, aus denen uns sofort mehrere Arten der rothblüthigen Aloë, riesige baumartige, zahlreiche strauchartige und krautartige Wolfsmilcharten, mit ihren wundervollen, meist cactusförmig gebildeten Formen auffallen und das Herz eines Botanikers hoch entzücken. Zahlreiche Solanum-(Nachtschatten-)Species, bald niedrig, bald strauchartig an den Bäumchen emporrankend, mit gelben, weißen, violetten und blauen Blüthen beladen, gestalten mit anderen üppigwuchernden Schlinggewächsen einzelne, durch hochstämmigere Bäumchen ausgezeichnete Partien zu einem förmlich undurchdringlichen Dickicht, während vor Allem die Menge von Gras und Binsen, Erica- und Ranunculusarten unser Staunen erregt.

[Euphorbiaceen-Bäume.]
Den kaleidoskopartig wechselnden Landschaftsbildern entspricht auch die Vegetation; kahle, niedrige, oder aber mit Hochgras bestandene Flächen, Busch- und Miniaturhaine, marschige Stellen, Sümpfe, Bergabhänge und Ebenen zeigen uns immer wieder neue Liliaceen, Papilionaceen und Mimosen.
Hie und da finden wir eine Farm in der Mitte einiger Acker bebauten Landes, an der Wegseite ein aus galvanisirtem Eisen oder aus Backsteinen erbautes Hotel; Hotel heißt es immer, ob es den Namen eines solchen verdient oder blos aus zwei Zimmern und einem Krämerladen besteht.
Nicht minder artenreich als die Flora ist die Fauna auf dieser Strecke. Wir finden hier ein mannigfaltigeres Thierleben, als selbst im ganzen Raume der nächsten zehn Breitengrade nach Norden, also gegen das Innere Süd-Afrika's. Auf den kahleren, grasarmen Ebenen tummeln sich Scharrthierchen und Erdeichhörnchen; beide Thiere leben in gemeinschaftlichen Bauen, und solche Stellen sind dann etwas erhaben und zeigen bis zwanzig Ein- und Ausgangslöcher, so breit, daß man bequem eine Faust einführen könnte. Wo die Erdeichhörnchen hausen, da finden sich auch zahlreiche große Spitzmäuse vor. (Die Gewohnheiten dieser Thiere will ich hier nicht beschreiben, aber späterhin bei der Schilderung meiner drei Reisen in's Innere Afrika's, wo einzelne der eben noch zu nennenden Thiergattungen bestimmte Landstriche bewohnen, ihrer dann ausführlicher gedenken.) Die hochbegrasten Gegenden zeigen uns zahlreiche Bauten von Maulwürfen, des Schabrakenschakal, des Mäusehundes (das afrikanische Stinkthier), von Springhasen und Stachelschweinen, Blindmäusen, dem interessanten Erdferkel und kurzschwänzigen Schuppenthier. An den Moorstellen beobachten wir Fischottern, eine Wieselart und mehrere Rattenarten. Die felsigen Abhänge weisen zahlreiche Pavianheerden, Rohrrüßler, schwarzgefleckte Genetta's, Tharikatzen, Karakal's, Springmäuse, eine besondere Kaninchenart, röthliche Roibockgazellen und zahlreiche Klippschliefer auf. An hochbegrasten Strecken, wo sich, wie schon erwähnt, stellenweise gruppenförmig dichte Gebüsche vorfinden, finden wir nebst den schon bisher erwähnten Zahnarmen (Edentata), Deuker und Steinbockgazellen. Dichte, niedere, meilenweite Flächen bedeckende Gebüschstrecken beherbergen die gestreifte und gefleckte Hyäne, sowie den Strandwolf (Hyëna brunea) und unter zahlreichen Nagethieren eine riesige Wühlmaus; ferner zwei Arten von Gazellen, darunter namentlich den schönen Buschbock. Hochstehende, die weiten Abhänge bekleidende Büsche, sowie der Niederwald dienen Pavianen und Meerkatzen, grauen Wildkatzen und Füchsen und dem Leoparden, der Kudu-Antilope, dem Buschsark und Blacksark, dem Büffel und dem Elephanten (der größten von den drei afrikanischen Varietäten) sowie einem auf Bäumen lebenden Hyrax (einer besonderen Art) zum Aufenthaltsorte.
Die Leoparden sind in diesen Gegenden gefährlicher als in den menschenleeren Gegenden des Innern, wo sie weniger an den Knall des Feuerrohres gewohnt sind. Da sie als Feinde, namentlich wenn verwundet, sehr gefährlich werden, tödtet man sie in diesen bewaldeten Gegenden meist mit Gift, oder fängt sie in Eisen. Die Elephanten sind durch ein Gesetz vor den Nachstellungen geschützt, so daß wir in der Cap-Colonie noch einige wilde Heerden[1] (je zu etwa 20-30 Stück) zählten, während sie im Oranje-Freistaat, den Transvaal- und in den südlichen Betschuanaländern schon vollkommen ausgerottet sind. Weil sie jedoch nicht gejagt werden, sind diese Thiere recht übermüthig geworden, was uns sofort auffällt, wenn wir sie mit ihren Brüdern im nördlichen Süd-Afrika und in Central-Afrika vergleichen. Dort bringt ein Schuß (wenn er auch in einer Entfernung von 2-3 englischen Meilen abgefeuert wurde) eine Elephantenheerde sofort zur schleunigen Flucht und die Thiere legen dann meistens 20-30 englische Meilen zurück, bevor sie sich eine Rast gönnen; daß dort ein Elephant ungereizt den Menschen angreifen würde, gehört zu den größten Seltenheiten, trotzdem in den letzten zwanzig Jahren allein von den Europäern mehr denn 7500 Elephanten erlegt wurden. Hingegen muß man in den Gegenden zwischen Grahamstown und Port Elizabeth, wo sich die Elephanten aufhalten, vorsichtig sein, um nicht den hin- und herwandernden Kolossen zu begegnen. Bevor ich auf der Heimreise Port Elizabeth erreichte, ereignete sich eben ein trauriger Fall in dem Niederwalde am Zondags-River, der theilweise die genannten Waldpartien durchfließt. Ein farbiger Diener war von seinem Herrn ausgeschickt worden, um einige Ochsen zu suchen, welche sich verirrt haben mochten; da der Mann nicht wieder heimkehrte, forschte man nach ihm, fand aber blos seinen verstümmelten Körper. An den Spuren ringsum konnte man sehen, daß ihn eine vorbeipassirende Elephantenheerde ausgewittert, sich von ihrem Pfade ab auf ihn gestürzt und ihn zertreten hatte. Nur mit Erlaubniß des Gouvernements ist man berechtigt, eines der Riesenthiere zu erlegen.
1 Siehe Seite 25.
Von den Vögeln die mannigfachen Species zu erwähnen, würde zu weit führen. Ein etwa sechsmonatlicher Aufenthalt würde hier dem Ornithologen eine reichhaltige Sammlung verschaffen. Ich will nur bemerken, daß dem Jagdliebhaber mehrere Trappenarten, Perlhühner, Reb-, Hasel- und Steppenhühner, Schnepfen und Regenpfeifer, Wildenten und Wildgänse, sowie Taucher und Schlangenhalsvögel täglich seine und seines Dieners Jagdtasche füllen können. Bewundern wir auf der Jagd oder auf einem Ausfluge in dieser Gegend die, die verschiedenen Strecken charakterisirende Pflanzenwelt, so sind es namentlich die Vögel und Insecten, welche den schönen, oft wundervollen Pflanzenformen doppelten Reiz verleihen. Da sind es langschwänzige Kolibris und Honigsucher, welche bald in den prächtigen kelchförmigen Schwertblüthen, bald in den weithin schimmernden carminrothen Aehrenblüthen der Aloëarten nach Insecten haschen. Dort wiederum winken uns die hellglänzenden dunkelgrünen Blätter eines Zwergstrauches, wir fühlen nicht den leisesten Windhauch, der sie bewegen würde—und immer nicken die zarten Aestchen wie mit Befriedigung einander zu. Doch siehe da, ein ganzer Schwarm kleiner, gelblich-grünlicher, unserem Goldhähnchen nicht unähnlicher Singvögel tummelt sich emsig in der Krone des Strauches umher, um Käferchen von der Innenseite der Blätter aufzupicken.
Von der Spitze des Waggonbaumes halten Falken und zahlreiche schön gefiederte Würger ihre Rundschau—ein jeder hat ein kleines Reich um seinen hohen Wohnsitz eigen—und hat jener eine Blindschleiche oder ein Mäuschen, dieser einen summenden Käfer erspäht, stürzt er sich auf die arglose Beute herab und da schnellt sich immer wieder das Aestchen, auf dem er saß und mit ihm die nächsten Zweige, rasch empor, scheinbar froh, von der Bürde befreit zu sein. Die reichblättrigen Mimosen, mit hellglänzenden Insecten bedeckt, locken gar manchen Vogel an, doch auch die schilfigen Partien sind nicht weniger reich an befiederten Bewohnern der Lüfte. Rohrsänger, gelbe und feuerrothe Finken und Webervögel halten die schlanken Rohrstengel in fortwährender Bewegung, während die kleinen Thälchen von ihrem Gezwitscher wiederhallen.
Von den Reptilien finden wir den Wasserleguan (riesige Eidechsen) in jedem fließenden Gewässer; von Schildkröten eine reiche Auswahl auf dem Lande und eine Art in stehendem und fließendem Wasser, von Schlangen sehr viele und sehr giftige Species, namentlich Bussadern, Cobras, Hornvipern, Korallenschlangen etc. etc. und von Wasserschlangen schöne harmlose grüne Species, doch auch sehr giftige Seeschlangen, die manchmal vom Meere aus die Flüsse heraufzuschwimmen pflegen.
Spät in der Nacht desselben Tages, an dem ich Port Elizabeth verließ, gelangten wir nach Grahamstown, und verließen es schon zeitlich am nächsten Morgen. Wir stiegen in einem Hotel ab; die gewöhnlichen Logispreise waren und sind geblieben 2 Shillings und 6 Pence für ein Bett und ebensoviel für ein jedes Mahl.
Grahamstown liegt malerisch an den Abhängen einiger Sandsteinhöhen, dem Quellgebiete des Kowie-Rivers, es hat seinen eigenen doch offenen Hafen an der Mündung dieses Flusses, Port Alfred genannt.[1] Ich bemerkte schon, daß wir hier den besten der botanischen Gärten in Süd-Afrika antreffen, indem außer afrikanischen Pflanzen meist Bäume aus Australien, Acacien und Eucalyptusarten, sowie Kasuarinen, ferner Gewächse aus Mauritius, Madagascar und Süd-Amerika mit dem besten Erfolge gepflegt werden. Von einheimischen Gewächsen sah ich namentlich schöne Exemplare des wundervoll geformten »Elephantenfußes« und mehrere Encephalartos-Arten sehr gut gedeihen. In dem geräumigen Glashause fand ich unter andern Prachtformen riesige Exemplare südafrikanischer Farrenbäume.
Nach zwei Tagen angenehmer Fahrt in einer bequemen amerikanischen Kalesche hatten wir die 25 geographische Meilen lange Strecke zwischen Grahamstown (The Town of the Settlers) und Cradock zurückgelegt. Die durchreiste Strecke war zu Beginn schluchten- und waldreich, wie jene zwischen Grahamstown und Port Elizabeth, hierauf ein Hochplateau, das mit zahlreichen isolirten Tafel- und Spitzbergen besäet, von Bergkämmen und Höhenzügen im fernen Nordost und Nordwest begrenzt war. Die ersteren erhoben sich 200 bis 500 Fuß über das sie umgebende Flachland und sind meist mit niederem Gebüsch, namentlich dem Nahrung spendenden Speckbaume bewachsen. Die Thäler zeigen Dornenbäume und Sträucher, die Warte-bichi, den Heckenstich und andere Mimosenarten im Ueberfluß, welche Thalbewaldung weiter nach Norden über Cradock hinaus abnimmt und erst wieder gegen den Vaalfluß und von da nach Norden zu, häufiger auftritt. Auf dieser Strecke nach Cradock beobachtete ich auch zuerst jene großen Ebenen, die zur feuchten Jahreszeit ein unabsehbarer hellgrüner (wenn von Gras), dunkelgrüner (wenn von dem Kapbusche gebildet) Teppich, zur Zeit der Dürre ein einförmiger brauner oder röthlicher Wüstenstrich sind, wie wir sie in der westlichen Cap-Colonie, dem Freistaate, im westlichen Griqua-Lande, der Transvaal-Colonie und dem Batlapinenlande vorfinden, und welche den Zwergtrappen, den Spring- und Blaßbockgazellen sowie dem schwarzen Gnu zum Aufenthaltsorte dienen. Da wo diese Thiere wenig gejagt werden, finden sie sich noch zu Tausenden. Auf meiner Reise nach Cradock beobachtete ich nur die erstgenannten, doch die zierlichsten unter den größeren Gazellen. Sie nehmen auf den Ebenen nach Norden zu ab, und ich beobachtete sie nicht über das Salzseebecken im centralen Süd-Afrika hinaufreichend, während sie längs der Westküste bis zu den portugiesischen Besitzungen ausschwärmen.
Die Springbockgazelle (A. Euchore) gehört unstreitig zu den schönsten Gazellenarten, die wir kennen. Sie besitzt außer allen Vorzügen einer Gazelle eine seltene Sprungkraft in ihren stählernen Muskeln und ihr edles zierliches Köpfchen schmückt ein so schönes, lyraförmig geschwungenes Hörnerpaar, daß man ihr wohl den Vorzug unter den mittelgroßen ihrer Familie einräumen muß. Dieses ungewöhnlich reizende Thier hat so graziöse Bewegungen, namentlich wenn es spielt, oder aufgescheucht die Flucht ergreift, daß man in Verlegenheit geräth, selbe zu beschreiben. Selbst wenn sie gejagt wird und in Angst dahinfliegt, scheint sie es darauf angelegt zu haben, durch ihre Coquetterie des Jägers Mordlust zu beschwichtigen. Leider findet sie für ihre Schönheit abgestumpfte Nimrode in mehr als hinreichender Zahl und dies namentlich unter den holländischen Farmern und den Eingebornen, welche dafür sorgen, daß sie täglich seltener wird. Ihre Sprünge ähneln dem Ausschnellen einer Uhrfeder. Sie läßt namentlich gewöhnliche Jagdhunde, mit Ausnahme der Windspiele, ziemlich nahe kommen; sie schaut die anrennenden, laut kläffenden Köter so gleichgültig an, wie wenn sie geduldig erwarten würde, bis sie zu ihr gekommen und ihr Alles gesagt, was sie zu sagen hätten. Plötzlich, wenn nach ihrer Berechnung die Zeit zur Flucht gekommen, schnellt sie sich wie eine losgelassene Uhrfeder in die Höhe, um etwa 6-8 Fuß weiter die Erde mit ihren zarten, spitzen Klauen zu berühren, allein kaum daß dies geschehen, so ist sie schon wieder über derselben, und so macht sie fünf bis zehn Sprünge sehr rasch hintereinander und dem Emporschnellen eines auf harten Boden auffallenden Gummiballes nicht unähnlich; es scheint, als ob sie die Erde gar nicht berühren würde, kaum senkt sich der Körper zur Erde, hat er sich auch schon wieder emporgeschnellt. So in einem überraschend kurzen Zeitraume von dem Verfolger weit entfernt bewegt sie sich plötzlich eine Minute langsam im Schritte vorwärts, wiederum dem Hunde Zeit gönnend sich zu nähern, dann wiederholen sich die Sprünge, und so neckt das Thier seine Verfolger mehrmals, bis es endlich, gleichsam des Spielens müde geworden, in weiten, großen Sätzen, in wilder Flucht davonjagt, bis es sich vollkommen sicher glaubt, und man sie in einigen Augenblicken in der weitesten Entfernung auf der Ebene als winzigen, weißlichen, beweglichen Punkt wahrnimmt, welcher dem Jäger die Richtung angibt, in der das schnellfüßige Thier seinen Lauf, oder besser gesagt, seinen Flug genommen. Allein selbst seine fabelhafte Schnelligkeit rettet es nicht vor dem Tode. Die Entdeckung der Diamantenfelder hat Tausenden dieser Thiere, wie auch ihren Verwandten, dem Bläßbock und dem schwarzen Gnu, Verderben gebracht. Die holländischen Farmer als Besitzer der Striche, auf welchen die edlen Thiere weiden, und als vortreffliche Schützen, sind ihre ärgsten Feinde. Sie kamen periodisch auf die Diamantenfelder und immer mit reicher Beute versehen. Ich hatte während meines dortigen Aufenthaltes beobachtet, daß in den Wintermonaten von Mai bis September ganze Wagenladungen mit solchen erlegten Thieren zu Markte gebracht wurden; doch auch sonst ist dies Wildpret nicht selten zu haben. Namentlich sind es der öffentliche Auctionsmarkt, der jeden Morgen in Kimberley und Dutoitspan abgehalten wird, wo sie an den Meistbietenden überlassen werden. Da liegen sie vor uns, der Köpfe und Füße beraubt, oft zu Dutzenden nebeneinander in langen Reihen! Der Preis wechselt je nach der Jahreszeit und der Größe des Thieres zwischen 3-7 Shillinge.
Nicht uninteressant ist die Jagdweise dieser Thiere. Man jagt sie zu Pferde, erlegt sie auf dem Anstande und hetzt sie mit Windhunden zu Tode. Die gewöhnlichste ist jene zu Pferde. Der Jäger setzt im stärksten Galopp den Thieren nach; die auf jenen begrasten Ebenen geborenen und an die Löcher der vielen Erdthiere sowie die niedrigen Termitenhaufen gewöhnten Pferde eilen im schnellen Laufe in der ihnen angegebenen Richtung dahin, so daß sie dem Jäger wenig Mühe verursachen, ihm vielmehr gestatten, seine ganze Aufmerksamkeit den fliehenden Gazellen zuzuwenden. Etwa zweihundert bis hundert Schritte nach einem 1½-2 Meilen (engl.) langem Ritte den Thieren nahe gekommen, bringt oft schon ein leichter Druck mit den Knieen das im wilden Galopp dahinjagende Pferd zum plötzlichen Stillstand, der Jäger springt ab, legt an und schießt. Es sind namentlich holländische Bauern, welche in dieser Jagdweise Unglaubliches leisten. Ich habe Fälle beobachtet, wo der Jäger mit seinem Hinterlader zwei fliehende Gazellen mit einem Schusse erlegte, auch Fälle, wo die ersten beiden Schüsse fehl gingen oder sonst etwas dem Jäger seinen zweiten Schuß so spät abzufeuern erlaubte, daß die Gazellen erst nachdem sie 600 bis 800 Schritt weit abgekommen waren, stehen blieben. Während sie dann nach dem Jäger zurückblickten kniete dieser nieder, wies sich umwendend mit den Worten: »det rechte kantsche bock, Mynheer« auf eines der Thiere und streckte eben das bezeichnete mit der Kugel seines Carabiners nieder.
Die zweite Art, die Springböcke zu jagen, ist jene auf dem Anstande. In der Nähe der Wassertümpel, zu welchen die Gazellen trinken kommen, oder auch an den Lachen in einem bis auf diese ausgetrockneten Flußbette, gräbt man muldenförmige Gruben, in der Tiefe von 1½-3 Fuß und 3 Fuß im Durchmesser haltend. In diese Grube kauert sich der Jäger und schießt die zur Tränke kommenden Thiere nieder. Diese Jagdweise ist namentlich in trockenen Wintern sehr üblich, wo es nur wenige Wasserstellen gibt, an denen die armen Thiere ihren Durst stillen können. Die südlichsten der Betschuanen, die Batlapinen und Barolongen, lieben eine ähnliche Jagdweise, welche jedoch mehr eine Treibjagd genannt werden muß. Sie thun dies auch, weil sie als schlechte Schützen sonst dem Wilde nicht gefährlich werden könnten. Mehrere Männer legen sich in das etwa 2 Fuß hohe Gras, welches die Ebenen zwischen dem Hart-River und dem Molapo bedeckt, oder hinter die Termitenhügel platt auf die Erde, und da sie in der Regel nur gewöhnliche Musketen (Pavion boute) besitzen und somit der Erfolg von einem Schusse abhängt, 700-900 Schritte windabwärts von einer grasenden Springbockheerde, und zwar jeder Schütze etwa 50, wenn es nur wenige sind, etwa 200 Schritte von einander entfernt. Hier warten sie oft stundenlang, bis ihre zahlreichen Genossen im weiten Bogen die Heerde umgangen, und sie halbmondförmig einschließend, nach den Schützen zu gedrängt haben. Sind es nur wenige Eingeborne, die sich auf eine solche Jagd begaben, so warten sie ruhig einen ganzen Tag im Grase liegend, bis sich das grasende Wild ihnen allmälich genähert. Ich beobachtete Fälle, wo sechs Schützen auf ein Thier anlegten, sechs Donnerbüchsen (denn ihre Musketen sind wahre Donnerbüchsen) ließen die Erde erzittern und als sich der Rauch verzog, da schauten hoch aufgerichtet ebensoviel dunkle Gestalten verwundert, eine flüchtige Springbockgais schnellfüßig das Weite suchend—alle Schüsse waren fehl gegangen.
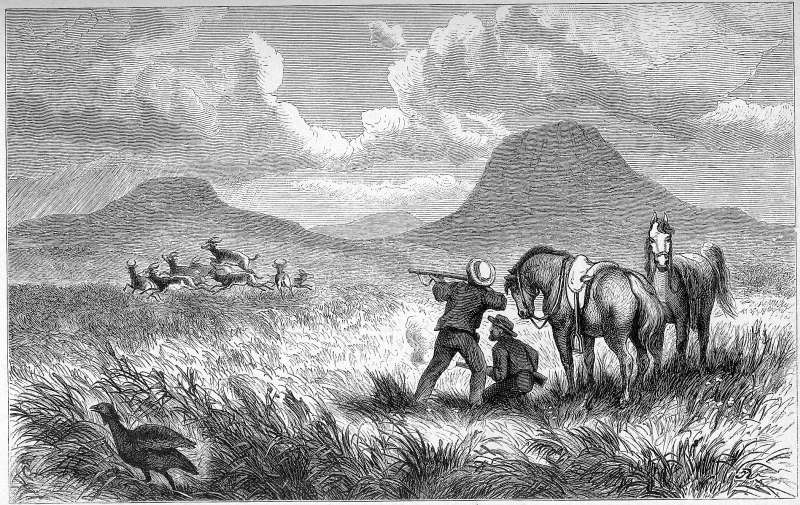
[Springbockjagd bei Colesberg.]
Mir selbst geschah etwas Aehnliches. Auf dem Anstande stundenlang in einer kurzgrasigen Ebene, nahe an einem Salzsee drei Springbockgazellen erwartend, sah ich endlich die schönen Thiere einige 20 Schritte vor mir, allein mir schien's ein Verbrechen, ihnen ein Leid anzuthun; nur der Gedanke, daß wir Nahrung brauchten, brachte mich dahin, von meinem Snider-rifle Gebrauch zu machen; allein die Hand zitterte—ich konnte mich nicht des Gedankens erwehren, daß ich einen Mord begehe, möglich, daß man in größerer Entfernung hartherziger ist—und so legte ich die Hand an den Drücker und die Thiere, erschreckt durch den plötzlichen Knall, flogen in weiten Sätzen von dannen. Livingstone erwähnt in seinen südafrikanischen Reiseberichten, bei Gelegenheit als er die Jagd auf Gazellen bei den Betschuanen beschreibt, der sogenannten Hopofalle. Ich sah sie nicht mehr im Gebrauch, sie ist auch heutzutage nicht mehr gut möglich. Zu seiner Zeit war das Wild in jenen Gegenden weniger scheu und in größeren Massen vorhanden.
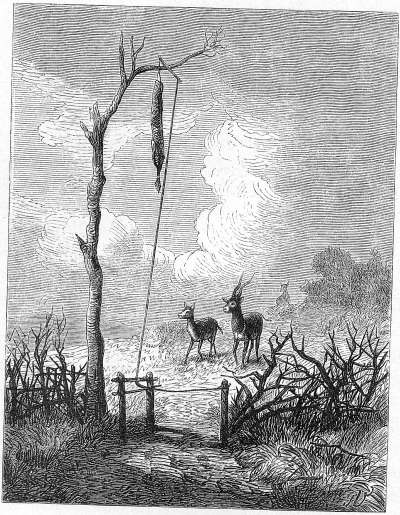
[Antilopenfalle.]
Die dritte Jagdweise auf den Springbock ist die von den Engländern eingeführte und besteht darin, daß man das Thier, ohne sich des Feuergewehrs zu bedienen, mit Windhunden zu Tode hetzt. Die Jagdgesellschaft jagt den Thieren mit verhängten Zügeln auf guten, allein weniger an das Terrain gewöhnten Pferden nach, bis es entweder den Hunden gelingt die Gazellen einzuholen, oder die letzteren einen solchen Vorsprung gewinnen, daß die Verfolger, müde geworden, die Verfolgung aufgeben müssen.
Auch in Cradock[1] währte unser Aufenthalt nur einen Tag.—Cradock liegt am linken Ufer des Fish-River, eines Flusses, der oft monatelang bis auf einzelne Tümpel versiegt. Treten jedoch starke Regengüsse ein, so genügen einige Stunden, um das Flußbett mit chokoladfärbigen Wasserfluthen zu füllen, die mit tausendfachen Trümmern bedeckt, Verderben und Entsetzen auf beiden Ufern verbreiten. Kommt man zur Zeit der Dürre zu einer der großen Brücken, von denen auch eine bei Cradock das Flußbett überspannt, so konnte man leicht versucht sein, die Zweckmäßigkeit derselben zu bezweifeln, wir erfahren aber, daß selbst diese große Brücke im Jahre 1874 von dem tückischen Gewässer zertrümmert wurde, und der neue Brückenträger um mehr als 6 Fuß höher gelegt wurde als der frühere. Die solide und schwere Eisen-Construction war von den Pfeilern gehoben und weggespült, die Pfeiler gleichfalls arg mitgenommen worden.[2]
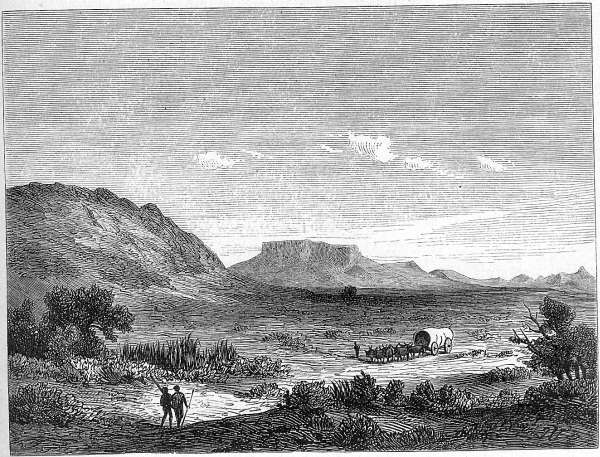
[Gegend bei Cradock]
Am zweiten Tage nachdem wir Cradock verlassen, langten wir in der Stadt Colesberg an, da wir aber mit Windeseile vorwärts ritten, fand ich kaum mehr die Muße, die Physiognomie der Landschaft in's Auge zu fassen. Auf meiner sieben Jahre später erfolgten Heimreise, auf der ich mit einem Ochsengespann der Dürre wegen langsam reisen mußte, hatte ich Gelegenheit, die Strecke theilweise geologisch zu durchforschen und dabei einige recht interessante vom Wege abseits liegende Partien kennen zu lernen. Gegen Colesberg zu nehmen die isolirten, tafelförmigen Erhebungen allmälich an Zahl und Höhe ab, dagegen geht das Land nach Norden zu in ein Hochplateau über. Eine der schönsten Partien ist New-Port, ein Paß, an dem sich die Wasserscheide der nach dem Süden fließenden Gewässer und der Nebenflüsse des Oranje-River befindet. Die Höhen im Colesberg- und Cradockdistrict beherbergen viele Pavianheerden, mehrere kleine Gazellenarten, kleinere katzenartige Raubthiere, sowie Leoparden, und bei Cradock auf den flachen Häuptern einiger Tafelberge finden sich noch mehr denn 50 der eigentlichen Quaggas, ich glaube die einzige Art, die wir noch in Süd-Afrika antreffen. Mit Freuden beobachtete ich, daß sie von einigen der Farmer geschont werden; vor etwa zehn Jahren waren sie schon bis auf 15 Stück herabgeschmolzen.[1]
1 Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jenen einsichtsvollen holländischen Farmern von Seite zoologischer Gesellschaften und der Thierschutzvereine einige Anerkennung zukommen zu lassen, damit sie nicht nur bei ihrem vernünftigen Entschlusse verharren, sondern auch ihre Freunde in der Umgegend die Thiere schonen und ihre Berufsgefährten in den anderen civilisirten Theilen Süd-Afrika's bezüglich anderer auch schon stark abnehmender, unschädlicher Vierfüßler ein Gleiches beobachten mögen. Und wenn es auch nur einfache Belobungsdecrete wären, sie würden eine gute Wirkung nicht verfehlen.
Der Cradocker-, Colesberger- und der benachbarte District von Graaf-reynet sind ausgezeichnet durch Lager fossiler Ueberreste, namentlich Dicynodonlager und der dieser Periode angehörenden fossilen Flora.
Colesberg selbst ist durch einen gleichnamigen Berg ausgezeichnet, an dem wir die Schichtung der einzelnen Gesteine, welche den District charakterisiren, vor uns aufgethürmt sehen. Die Stadt ist etwas kleiner als Cradock und liegt in einem ziemlich engen Felsenthale. Die Höhen, die sie umschließen, sind meist nur mit Gras und so kleinen Zwergbüschen bedeckt, daß sie dem Beschauer fast von aller Vegetation entblößt erscheinen. Die meist kahlen Blocke, welche sie bedecken, werden zur Sommerszeit gewöhnlich so ausgeglüht, daß sie die zwischen ihnen liegende Stadt zu einem förmlichen Backofen, und den Aufenthalt daselbst nicht besonders angenehm machen.[1]
Auf meiner Weiterreise von Colesberg nach Norden zu, gelangten wir nach zweistündigem Ritte zu dem Oranjeflusse, welcher die Grenze zwischen dem Oranje-Freistaat und der Cap-Colonie bildet. Wir übersetzten den an Wassergehalt der Elbe gleichkommenden Strom in einer Fähre, welche die Communication der beiden Ufer vermittelte und noch vermittelt; doch steht schon heute einige hundert Schritte stromaufwärts eine Eisenbrücke, und drei andere erleichtern den Verkehr zwischen beiden Staaten stromauf- und abwärts. Der erste Tag, den ich in der Republik verlebte, wollte mir nicht recht gefallen, und ich erinnere mich noch heute lebhaft aller jener kleinen Zwischenfälle, die ich auf der Strecke vom Oranjefluß bis Fauresmith erlebte. Der Weg zum Flusse bis Philipolis wurde in etwa zwei Stunden zurückgelegt. Hier mußten wir der Passagierkutsche Valet sagen und hatten den Rest des Weges nach Fauresmith in einem Postkarren zurückzulegen. Philipolis bot einen äußerst traurigen Anblick. Die Winterdürre hatte das Gras im Thale ringsum, sowie an den umliegenden Höhen verbrannt, so daß die ganze Gegend braun und kahl erschien; ebenso traurig war das Bild einiger sechzig viereckiger, flachgedeckter, in der Mehrzahl nicht eingefriedeter Häuser; nur an einer mit einigen seichten Wasserlachen bedeckten Schlucht, dem Rinnsale eines jetzt ausgetrockneten Bächleins, standen einige Bäume, deren fahles Laub den traurigen Anblick des Städtchens nicht zu heben vermochte. Die Oede desselben wurde noch durch die Stille des Ortes verschärft, kaum daß das Auge einem lebenden Wesen begegnete, denn die Mehrzahl der Häuser war unbewohnt.
Da wir hier einige Stunden auf den Postkarren warten mußten, nahm ich mit meinem Freunde, Herrn Michaelis, in dem Postgebäude Zuflucht. Es war zugleich der Sitz der politischen Behörde und des Polizei-Commissariats des Districts Philipolis. Denken wir uns ein kleines, etwa 14 Meter langes und 6 Meter breites Steinhäuschen, durch eine dünne Bretterwand in einen dem öffentlichen Dienste gewidmeten und Privatraum getheilt, von welchem letzterer nicht nur die Kanzlei der politischen Behörde (des Landdrostes), sondern zugleich das Amtslocale des Sheriffs (der Polizeibehörde) und des Postmeisters bildet. Ein mit einem Tuche behangener Tisch auf einem Podium, ein Stuhl dahinter, zwei Holzbänke und ein mit Latten abgesonderter, etwa einen Quadratmeter umfassender Raum vor demselben das ganze Meublement des ersterwähnten Raumes bildend, läßt uns dessen Bestimmung als Gerichts-, Sitzungs- und Wahlversammlungs-Saal des Districts errathen. Die Schilderung des Posthauses dürfte die geehrten Leser auch mit der Natur der Postkarren vertraut machen.[1]
1 Der Postdienst ist in Süd-Afrika zumeist an Privatleute vergeben, welche gegen eine fixe Subvention die Verbindung zwischen den einzelnen Städten (ein- bis dreimal die Woche) herzustellen sich verpflichten.

[Fahrt in die Diamantenfelder.]
In dichter bewohnten Gegenden, wo der Posthalter auf Passagiere rechnen kann, sind diese Karren gedeckt und mit Polstersitzen versehen, wo er jedoch auf diesen Nebenverdienst verzichten muß, sind dieselben sehr primitiver Natur; ein roher, viereckiger, gelbangestrichener und auf zwei hohen Rädern ruhender Holzkasten. Die Wohlthat eines solchen Vehikels mußten wir nun durch drei Stunden rascher Fahrt genießen. Selbst auf einer glatten, asphaltirten Chaussee, bei herrlichem Wetter einer Folterstrafe zu vergleichen, war unsere Fahrt mit einem solchen Vehikel bei dem damaligen Zustande der Straße ein waghalsiges Beginnen. Wir kamen in Verlegenheit, für den Weg von Philipolis nach Fauresmith selbst in Mexico und anderen durch den erbärmlichen Zustand der Straßen bekannten Ländern eine Analogie zu finden. Dazu beliebte es dem Kutscher die Schnelligkeit seiner Pferde im günstigsten Lichte zu zeigen.
Es bedurfte des Aufwandes aller Kraft und Balancirkunst, um bei dieser tollen Fahrt über einen von hunderten von Rinnsalen und Felsadern durchsetzten, mit Blöcken und Wasserlöchern überreich bedeckten Weg (oft ist derselbe das natürliche Rinnsal des abfließenden Wassers einer größeren Fläche des Hochlandes) nicht vom harten Sitze herabgeschleudert zu werden und bei dem durch die Fahrt verursachten Getöse nicht unbemerkt in Verlust zu gerathen. Fälle, wo Kutscher und Passagiere lebensgefährliche Verletzungen davontragen, sind nicht selten.[1]
1 So geschah es, daß vor wenigen Jahren in der Nähe von Cradock ein Postbote mit vier Pferden ertrank und in einer Schlucht zwischen Cradock und Grahamstown ein Anderer umwarf, wobei die meisten seiner Passagiere umkamen. In beiden Fällen hatten Regenfluthen und der schlechte Weg das Unheil verschuldet. Leider wird diesem Uebelstande noch für lange Zeit in vielen Theilen der südafrikanischen Colonie nicht abgeholfen werden, da man trotz der großen Opfer, die man schon gebracht, noch nicht so viel Capital verwenden konnte, um die langen Strecken gegen die Einflüsse der plötzlichen Regengüsse zu schützen. Es ist jedoch zu hoffen, daß der Eingeborne in Süd-Afrika sich mehr an die Arbeit gewöhnt, als es jetzt der Fall ist, und daß, wenn dann ausgiebige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, alle diese Arbeiten auch viel leichter und mit geringeren Kosten ausgeführt werden können.
Unsere Lage war noch dadurch erschwert, daß wir auch noch unser Gepäck ängstlich behüten mußten; da saßen wir drei auf einer ungefähr einen Meter langen und einen halben Meter breiten Fläche. Ein eisiger Wind wehte uns entgegen, so daß unsere Hände bald erstarrten. Zudem ging es langsam bergan und doch mußten die armen Thiere zum scharfen Trabe angehalten werden. Zum Ueberflusse fing es, als wenn sich Alles gegen uns verschworen hätte—eine Seltenheit in jenen Gegenden—zu schneien an. Wir hatten etwa zwei Drittel der Strecke in diesem eisigen Schneegestöber zurückgelegt, weiter, das fühlte ich, konnte diese Marterfahrt nicht ausgedehnt werden, denn Mensch und Thier waren der Erschöpfung nahe.
Lieblichste Musik däuchte uns in dieser Lage das Gebell eines Hundes, denn er bedeutete die Nähe einer Wohnstätte und Ruhe. Die elendeste Kaffernhütte wäre uns willkommen gewesen und mein Begleiter schwur, ein £ St. für ein Nachtlager, wenn auch nur in einer geräumigen Hundehütte, bieten zu wollen.
Wir waren auf das Freudigste überrascht, anstatt einer dürftigen Hütte die erleuchteten Fenster eines Farmhauses zu entdecken. Wir fanden eine überaus freundliche Aufnahme und, als wenn sich auch der Himmel mit uns aussöhnen wollte, ließ, bevor wir noch die Pferde ausgespannt hatten, das Gestöber etwas nach. Bald saßen wir am gastlichen Tische des holländischen Farmers und hatten alle ausgestandene Pein vergessen, so vollständig, daß ich, als wir nach einer Weile vor die Thüre tretend, um nach dem Wetter zu sehen, kreischende Vogelstimmen hörten, mich entschloß, mein Jagdglück zu versuchen. Der Himmel hatte sich etwas aufgeklärt und ließ das Licht des Mondes matt durchscheinen. Nach Südosten hing es noch dunkel; es war die Richtung des abziehenden Unwetters. Mir war schon, während wir bei Tische saßen, das hundertfache Vogelgeschrei aufgefallen und auf meine Anfrage antwortete mir mein freundlicher Wirth, daß es von »Det grote springhan Vogl« herrühre. Die Holländer nennen nämlich den grauen, südafrikanischen Kranich (C. Stanleyi), von welchem ich ein Exemplar dem Prager Stadtpark widmete, ob seines großen Nutzens, den er durch das Vertilgen der Wanderheuschrecken bringt, den großen Heuschreckenvogel; zum Unterschiede von einer anderen Art, welche sie den kleinen Heuschreckenvogel nennen, der in großen Schwärmen diesen Insecten folgt, während die südafrikanischen Kraniche ihre ständigen Quartiere nicht verlassen.
Langsam schlich ich mich an, allein ich machte die Erfahrung, daß diese Thiere sehr wachsam sind, denn die ganze Gesellschaft erhob sich kreischend in die Lüfte; da ich nicht in den ganzen Schwarm feuern wollte, zog ich mich wieder zurück. Später machte ich die Beobachtung, daß diese Vögel, so wie die Kronenkraniche (Balearia regulorum), auch Reiher und mehrere Storcharten, zur Nachtzeit stehende Gewässer aufsuchen und hier übernachten. Dieser Aufenthalt schützt sie vor den Nachstellungen der Hyänen, Schakale, Füchse, dem Hyänenhund (Canis pictus) und verschiedenen Katzenarten. Man findet oft große Heerden vermiedener Abarten dieser Stelzenvögel in den genannten Gewässern versammelt, bei Anbruch der Dunkelheit stellen sie sich in langen Zügen ein und erst bei Sonnenaufgang verlassen sie das schützende Versteck. Was mir besonders bei meinen häufigen nächtlichen Jagdausflügen zu den Salzseen und in der Nähe ähnlicher doch süßwasserhaltiger Gewässer in Süd-Afrika auffiel, war, daß sich die Vogelschaaren in den Gewässern nicht außer aller Gefahr hielten. Sie haben Wachen ausgestellt, welche sie von Zeit zu Zeit ablösen. Diese Wachen erheben etwa viertel- und halbstündlich ein kurzes Geschnatter, etwas ähnliches beobachtete ich auch im Transvaalstaate bei den gewöhnlichen und schwarzen Störchen, bei den grauen Fischreihern am Molapoflusse, bei den kleinen weißen Reiherarten in den Sümpfen des Limpopothales, bei dem Riesenreiher im Sibananie-Walde und den Purpurreihern und Sporngänsen im Zambesithale.
Nach einer beschwerlichen Fahrt von mehreren Stunden erreichten wir, nachdem wir die gastliche Farm verlassen, die Stadt Fauresmith. Sie zeigte den Charakter aller Städte des Freistaates; obschon sie kaum 80 Häuser zählte, dehnte sie sich doch über eine beträchtliche Fläche aus; die reinlich getünchten Häuser mit ihren flachen Dächern, aus den sie theilweise umgebenden Gärten hervorlugend, gewährten uns einen freundlichen Anblick. Fauresmith ist der Sitz eines Landdrosten und im Allgemeinen eine der bedeutenden Städte der Republik. Der gleichnamige District, dessen einzige Stadt eben Fauresmith ist und der zu den reichsten des ganzen Freistaates zählt, verdient weiters noch durch seine Pferdezucht und den nahe der Stadt gelegenen Diamanten-Fundort »Jagersfontein«, in dem der Abbau etwas rationell betrieben wird, besondere Erwähnung.[1]
Fauresmith, sowie die meisten südafrikanischen Städte, bieten viermal des Jahres, wenn die holländischen Farmer zur Andachtsübung und Erfüllung ihrer religiösen Pflichten (hauptsächlich um das heilige Abend- und Nachtmahl, wie es hier genannt wird, zu empfangen) und auch zur Besorgung ihrer En gros-Einkäufe und Abrechnung mit ihren Geschäftsfreunden nach der Stadt kommen, ein ungewöhnlich belebtes Bild, das zur gewohnten Stille und Einsamkeit einen grellen Contrast bildet. Eine Unzahl der bekannten südafrikanischen Riesenwägen durchzieht dann die Straßen und campirt theils in denselben, theils außerhalb der Stadt. Im Gefolge der Wagen fanden wir immer einige Reiter, theils Farmerssöhne, theils farbige Diener. Die bemittelteren der Farmer besitzen ihre eigenen Häuser in der Stadt und wo es die künstliche Bewässerung erlaubt auch ein Gärtchen dazu; die weniger wohlhabenden miethen sich von den letzteren für die Zeit ihres Aufenthaltes ein bis zwei Zimmer, oder wohnen—was jedoch nur die Aermsten thun—außerhalb der Stadt für die kurze Dauer ihres Besuches in ihren großen Wägen. Diese Besuche der holländischen Farmer sind für die dortigen Geschäftsleute heiß ersehnte Tage und erinnern in mancher Hinsicht an die europäischen Messen. Auch der Arzt findet in dieser Zeit eine vermehrte Beschäftigung, da die Farmer sehr oft bei allen nicht besonders gefährlichen Krankheiten mit ihrer Consultation bis zum Besuche der Stadt warten. Unter der nicht besonders zahlreichen Bevölkerung dieser Städte bilden die Prediger, der Landdrost, der Arzt, die Kaufleute und der Notar die Crême der Gesellschaft.
Ich erwähnte bereits, daß ich meine Reise nach Fauresmith mit den schönsten Hoffnungen und in gehobener Stimmung antrat. War ich doch hier dem ersehnten »Innern« viel näher als in Port Elizabeth, konnte ich doch über den Umfang und die Details meiner nöthigen Ausrüstung belehrt werden, endlich sollte ich hier die Gelegenheit finden, mir die Geldmittel zu meinen geplanten Reisen in das Innere zu verschaffen. Dies Alles war mir von dem Fauresmither Geschäftsmann so leicht, in solch' schönen Farben geschildert worden, daß ich es ja glauben mußte, und ich vertraute um so zuversichtlicher, als ich mich so alleinstehend, so fremd und weil mittellos, so verlassen in dem mir fremden Welttheile fühlte. Ein Ertrinkender faßt mit ganzer Kraft und Zuversicht nach dem schwächsten Zweige, der ihm erreichbar ist, von ihm erhofft er seine Rettung; wäre er am Ufer, er würde allerdings solche Hoffnungen thöricht schelten.
Enttäuschung ist wohl einer jener so oft im Leben wiederkehrenden, wenig angenehmen Momente, die den Menschen zum Sammeln aller seiner Kräfte und Fähigkeiten zwingen, wenn er nicht muthlos verzagen will. Dieser ungebetene Gast sprach aber bei mir so oft vor, daß er mich heute nicht mehr überraschen würde. Wir haben ihn gewiß alle ohne Ausnahme kennen gelernt, vielleicht bin ich jedoch häufiger mit ihm zusammengekommen, als Andere. Kannte ich ihn doch schon aus meiner frühen Jugend, aus den Anfängen meiner »Forschungsreisen« im Mittelgebirge und im Egerthale, aus meinen Universitätsstudien in Prag, aus dem Beginne und aus der Entwickelung meines Unternehmens.
Alle Hoffnungen, die ich auf den Aufenthalt in Fauresmith gesetzt hatte, zerrannen in wenigen Tagen; ich hatte wahrgenommen, daß ich auch dem, der mich zur Reise hierher bewogen, zur Last fiel; er kam mit seinem älteren Freunde, einem in Fauresmith wohnenden Arzte, meinethalben in Collision, schließlich siegten seine älteren Sympathien über die mir zugedachte Gewogenheit, doch gab er mir den wohlmeinenden Rath, die Diamantenfelder aufzusuchen, in welchen ich, wie er sich ausdrückte, am rechten Platze und der rechte Mann wäre. Mir blieb nichts übrig, als diesem »wohlmeinenden« Rathe zu folgen und so brach ich wieder auf. Ich hatte kaum die nöthigsten Kleider auf dem Leibe, meine Fußbekleidung war in Brüche gegangen und da meine Mittel nicht hinreichten, mir neue Kleider zu kaufen, mußte ich versuchen, sie creditirt zu erhalten. Dies gelang mir, und so zog ich weiter, mein Stolz verbot es mir, den Mann, der in Port Elizabeth den guten Willen gezeigt hatte, mir zu helfen, an sein Versprechen zu erinnern. Wie von Port Elizabeth nach Fauresmith, so war auch von Fauresmith nach den Diamantenfeldern Herr Hermann Michaelis mein guter Helfer. Für jene Strecke hatte er mir das nöthige Geld vorgestreckt, auf dieser nahm er mich als seinen Gast mit, da er eben auch nach den Diamantenfeldern gehen und sie besichtigen wollte. Wir fanden nun noch einen Reisegefährten in Herrn Rabinsvitz, dem Oberrabbiner für Süd-Afrika, der mir ein sehr freundliches Entgegenkommen bewies. So schied ich denn von Fauresmith, ohne Groll und muthig der Zukunft entgegenblickend. Dem Kaufherrn in Fauresmith sei hier für die gewährte Gastfreundschaft mein Dank ausgesprochen.
Die Gegend zwischen Fauresmith und den Diamantenfeldern ist recht eintönig. Nur die Strecke längs des Riet-River und im Thale des Modder-River, welches wir zu durchkreuzen hatten, bot eine etwas anziehendere Scenerie dar. Hier zeigte sich mir auch eine günstige Jagdgelegenheit, und ich benützte die wenigen freien Minuten während einer Ruhepause, nach eingenommenen Mahle, die nächste Umgebung zu durchstöbern. Der Riet-River floß in einem tiefen Bette als ein dünner Faden nach Nordwest, um sich mit dem Modder- (Sumpf-, Schlamm-) River zu verbinden. Wie in den meisten Flüssen Süd-Afrika's zur Trockenzeit (Winter) hatten sich auch hier mehrere die ganze Breite des Flußbettes einnehmende, bis drei Meter tiefe, fischreiche Tümpel gebildet.
Der großen Mannigfaltigkeit von Landschaftstypen entspricht auch eine große Mannigfaltigkeit von Thierformen, namentlich Vierfüßlern, und selbst in den zur Trockenzeit wüstenartig erscheinenden Gegenden bietet sich dem Zoologen wie dem Jäger ein reiches Arbeitsfeld. Diese Mannigfaltigkeit ist besonders bei den niederen Thierformen ausgeprägt, und ich fand schon in der Cap-Colonie viele Schmetterlings- und Käferarten oft auf kleine, durch zwei parallel laufende Flüsse begrenzte Striche beschränkt.
Mit einzelnen interessanten Arten von Federwild wurde ich eben jetzt in dem mit Trauerweiden (Salix babylonica) dicht bewachsenen Riet-Riverthale näher bekannt. Mein Jagdglück versuchend, war ich thalaufwärts vorgedrungen und wollte mich eben durch ein dichtes Gebüsch drängen, um eine bessere Rundschau über die Tümpel im Flußbette zu gewinnen, als ein wohl hundertstimmiges Geschrei und ein leises Rascheln in den überhängenden Zweigen mir die befiederte Gesellschaft verrieth. Zurücktretend, scheuchte ich die Thierchen vollends auf, welche mit lautem Gezwitscher in ein nahegelegenes Dorngebüsch einfielen. Es waren die zierlichen, beschopften und durch lange schmale Schwänzchen ausgezeichneten Wiriwa (Colius leucotis), von denen ich später noch zwei weitere Arten kennen lernte. Eines der Thiere hatte auf dem höchsten Zweige Posto gefaßt, wohl um den fremden Ruhestörer im Auge zu behalten, die übrigen hatten sich in das Innere des Busches zurückgezogen, so daß sie meinen Blicken vollends entzogen waren. Es sind sehr muntere Thiere, doch schwer in Gefangenschaft zu erhalten, die einzig lebenden fand ich in Grahamstown, wo sie ein Vogelliebhaber mit Finkenarten in einem großen Käfig gefangen hielt und sie mit Orangen ernährte.
Das Gros der Vogelwelt im Riet-Riverthale bildeten die Vertreter zweier Arten von Turteltauben, der eigentlichen südafrikanischen, bläulichgrauen Turtur und der Lachtaube, welchen wir bis zum Zambesi und darüber hinaus begegnen, Vögel, die jeder Thierfreund, wenn er sie in der Nähe beobachten kann, liebgewinnt. Ich hatte mir mehrere derselben, die ich im Fluge leicht angeschossen, jahrelang erhalten, und mir damit manche vergnügte Stunde verschafft. Schon um 3 Uhr Morgens ließen sich die Männchen mit ihrem Girren und dann mit ihrem Silbergelächter hören; und als sie so ihren Morgengruß den neben ihnen sitzenden Täubchen gespendet, da antworteten diese, allein so leise und zart, daß es wie aus der Ferne, doch äußerst melodisch und lieblich herüberklang. Leider fielen sie der Nachlässigkeit eines meiner schwarzen Diener zum Opfer.[1]
Auf der Ebene an den beiden Flußufern fand ich als das gewöhnlichste Wild Süd-Afrika's eine Zwergtrappenart, den Knurhahn, dessen Geschrei uns vom ersten bis zum letzten Tage, so lange wir in der Karroo im Freistaate[1] und Transvaalstaate reisen, begleitet und selbst einem minder geübten Schützen täglich gute Mahlzeiten sichert. Bemerkt diese Trappe den Jäger, so bewegt sie ihren Kopf neugierig nach allen Seiten, duckt sich plötzlich nieder und hebt sich mit lautem, kreischendem, weithin hörbarem Geschrei in die Lüfte, setzt ihren unbeholfenen Flug etwa bis 200 Meter fort, um langsam mit eingezogenen Flügeln und herunterhängenden Beinen sich wieder niederzulassen. Ihr Obergefieder ist schön braun melirt, das Gesicht, mit Ausnahme je eines weißen Streifens an den Wangen, Kehle und Unterleib schwarz, die Füße gelb. Ihr Verbreitungsbezirk endigt in den waldbedeckten, nördlicheren Gebieten Süd-Afrika's; gleich den vorhergehenden Repräsentanten der Vogelwelt ist auch sie nur sehr schwer in der Gefangenschaft zu erhalten.
1 Es ist damit stets der Oranje-Freistaat gemeint.

[Hotel am Riet-River.]
Unser Weg führte uns nun weiter im Thale des Riet-Rivers über Coffeefontein, nächst Jagersfontein bei Fauresmith, die zweite Diamanten-Fundgrube des Freistaates, woselbst kleine aber schöne und weiße Brillanten gefunden werden. Spät am Abend des ersten Tages unserer Reise gelangten wir zu der Furth des genannten Flusses, die wir benützten, und übernachteten in einem am jenseitigen Ufer stehenden Hotel.
Der pompöse Ausdruck Hotel wird bei den geehrten Lesern leicht irrthümliche Vorstellungen erwecken. Die folgende Skizze wird am besten diesem Irrthume vorbeugen. Denken wir uns zwei mit Segeltuch überspannte Bretterhäuschen, die zugleich als Wohnstätte und als Geschäftslocal dienen, einige auf der Erde ausgebreitete Ziegen- und Schaffelle und wir haben ein Bild der äußeren und inneren Ausstattung des sogenannten Hotels. Ein ungemüthlicher Aufenthalt fürwahr, besonders da ein heftiger Wind, durch die Fugen eindringend, die in Fetzen herabhängenden Reste einer Stofftapete, deren Aussehen kaum mehr ihre Provenienz errathen ließ, in schwingende Bewegung versetzte und uns mit einem dichten Staubregen bedeckte; dazu eine empfindliche Kälte während der Nacht, die mich in Versuchung führte, die Tapetenlappen vollständig abzureißen und sie als Decke zu benützen.
An Schlaf war in dieser angenehmen Situation nicht zu denken, und so erhob ich mich zeitlich des Morgens, nahm ein Gewehr und schlich mich in's Freie, die Richtung nach dem nahen Flusse einschlagend. Kaum angelangt, hörte ich stromaufwärts das mir schon bekannte, weithintönende Geschrei der Kraniche; ein Zug kam den Fluß abwärts geflogen. Es war mir leid, auf eines der Thiere anzuschlagen, allein die Aussicht, einen schönen Balg zu gewinnen, den ich vielleicht in den mir Tags zuvor als nahe bezeichneten Diamantenfeldern präpariren konnte, besiegte alle Bedenken. Als die Schaar mir beinahe über dem Kopfe hinflog, sandte ich eine Schrotladung hinauf, die Thiere wichen rechts und links aus dem Zuge, nur einer schien mir zu schwanken, senkte sich, und im nächsten Augenblick fiel er an einer seichten Stelle todt in den Fluß herab. Da war auch schon der kalte Morgen vergessen, rasch entledigte ich mich der Stiefel und watete in den Fluß, um mir meine Beute zu holen.
Von einem Rudel heißhungriger Köter begleitet, die der Schuß aus dem Hotel und den nahen Hütten der Koranna's herbeigelockt, kehrte ich, die Jagdbeute hochhaltend, zum Hotel zurück. Nach beendetem Morgenimbiß—einigen auf Kohlen gerösteten Fleischstücken und Zwieback—brachen wir auf, froh, diesem wenig einladenden Hotel den Rücken gekehrt zu haben. Nachmittags hatten wir das Städtchen Jakobsdaal erreicht, das mit seinen 25 ärmlichen, über eine von der Hitze ausgetrockneten Ebene zerstreuten Häuschen ein trostloses Bild bot. Schon am folgenden Morgen verließen wir auch dieses letzte der Freistaat-Städtchen und erreichten nach mehrstündiger Fahrt die Central-Diamantenfelder. Je näher wir denselben kamen, desto trauriger wurde die Gegend, die Büsche schwanden zusehends, blos hie und da war an den niedrigen Höhen zu beiden Seiten des Weges etwas trockenes Gras zu erspähen. Ich muß eingestehen, daß mir der Tag, an dem ich die Diamantenfelder erblickte, unvergeßlich bleiben wird. Wir fuhren mit unserem vierspännigen Karren rasch die Höhen von Scholze's Farm herab; mein Gefährte wies auf eine, etwa zwei Stunden vor uns liegende kahle, nur im Osten in der Entfernung von bläulichem Gebirge begrenzte Ebene und bedeutete mir, daß sich unter dem auf ihr ruhenden, uns sichtbaren Dunstkreise meine neue Heimat befinde. Ein kalter Wind strich von den Höhen nach der Ebene hin und ließ uns in dem luftigen, hohen Karren, trotzdem, daß wir uns in unsere Mäntel gehüllt hatten, den südafrikanischen Winter recht unangenehm empfinden. So weit der Himmel reichte, hingen an ihm dichte, graue Wolken, welche die ohnehin trostlose und wenig anmuthende Landschaft noch trauriger erscheinen ließen. Unser Wagen rollte schnell nach dem gepriesenen Eldorado von Tausenden aus aller Herren Länder, welche der Reiz eines reich entlohnenden Erwerbszweiges angezogen. Je näher wir kamen, desto mehr sank mein Muth, einen so deprimirenden Eindruck übte die trostlose Gegend auf mich. Der graue Dunstkreis, den wir früher von der Höhe erblickt, war endlich erreicht und Gesicht und Geruch des Besuchers konnten ihn nur zu leicht analysiren. Es waren dies dichte Staubwolken, die der Westwind aus dem röthlich-gelben Sande, der den Boden auf der Ebene bedeckt, aufwirbelte, und der sich mit den losen Theilchen der überall zwischen den primitiven Wohnungen und um die Diamantengruben angehäuften kalkhaltigen Erdmassen mischend, die Atmosphäre erfüllten, so daß es keiner besonders erregten Phantasie bedurfte, um sich in das Wüthen eines Sandsturmes in der Sahara zu versetzen. Der Zeltstadt nahe gekommen, jagte uns der Sturmwind eine so dichte Staubwolke entgegen, daß wir uns vorsichtshalber, da wir auf 30 Schritt nicht sehen konnten, nur langsam vorwärts bewegen mußten. Bald waren Gesicht und Kleider grau incrustirt, kein Wunder, daß wir uns—wie alle Neulinge—in dieser Atmosphäre, bevor wir das Geschäftslocale des Fauresmither Kaufmannes (er hatte in einem der Fundorte eine Geschäftsfiliale), das noch etwa 1000 Schritt im »Camp« entfernt lag, erreicht hatten, sehr unwohl fühlten; selbst die Pferde schnaubten und schienen dem reichsten Minendistrict der Erde keinen Geschmack abgewinnen zu können. Die aus dem eisen- und kalkhaltigen Sande bestehende Wolkenmasse schien die beiden Ortschaften in den Diamantenfeldern Bultfontein und Dutoitspan förmlich zu bedecken und erfüllte bis zu einigen hundert Fuß Höhe die Luft, alles in ein undurchdringliches Dunkel hüllend. Hie und da erblickte ich, rechts und links von uns—so weit es eben die staubgeschwängerte Atmosphäre erlaubte, einfache runde und längliche Zelte, Zelthäuser und aus geripptem Eisenblech errichtete, doch geschlossene Verkaufslocale. Die Zeltstangen bogen sich unter der Gewalt des Sturmwindes, der so heftig an den Stricken zerrte, daß man jeden Augenblick befürchten mußte, die luftigen Behausungen im Sturmwinde verschwinden zu sehen. Von den Dächern der eisernen Häuschen halb losgelöste Blechplatten kreischten mit dem heulenden Sturme um die Wette und vervollständigten den entmuthigenden Anblick. Gewiß ein seltsamer Willkommengruß für den Ankömmling! Hie und da hatten sich die Pflöcke, mit denen die Zelte zur Erde gehalten werden, losgelöst oder die Oesen hatten sich ausgerissen und das halbe Zelt flatterte wie eine Fahne lustig im Winde, hie und da lugten einige dunkle Körper aus dem Hintergrunde des flatternden Zelthäuschens hervor, die sich bei näherer Besichtigung als auf der Erde liegende, schlafende oder ausruhende halbnackte Gestalten der in den Diamanten-Fundorten arbeitenden Eingebornen entpuppten.
Die Diamantenfelder.
Leiden und Freuden in meiner ärztlichen Praxis.—Ein nächtlicher Ueberfall.—Dutoitspan und Kimberley.—Diggerverfahren.—Panorama der Kopje.—Morgenmarkt.—Meine erste Pavianjagd.—Vorbereitungen zur ersten Reise.
Es war nicht allein die trostlose Gegend, der höchst unfreundliche Anblick der Städte (Diamanten-Fundorte) und das rauhe stürmische Wetter, welches täglich in den verschiedensten, aber immer gleich unangenehmen Variationen uns seine Wuth fühlen ließ, was mich so niedergeschlagen machte. Meine Verhältnisse waren auch trostlose. Im Vertrauen auf die Versprechungen des Kaufmannes in Fauresmith hatte ich es versäumt, mir von Herrn Adler in Port Elizabeth Empfehlungsbriefe für die Diamantenfelder zu erbitten und meine Baarschaft war auf fünf Shillinge reducirt, ein Betrag, kaum hinreichend, um die Kosten einer Mahlzeit zu decken. Ich sollte hier entweder »diggen«, d.h. nach Diamanten graben, oder unter der aus aller Herren Ländern zusammengewürfelten, theilweise mehr als zweifelhaften Gesellschaft ärztliche Praxis ausüben, um meine Existenz fristen, sowie um mir die Mittel zur Weiterreise verschaffen zu können. Meine Lage war um so schlimmer, als ich weder der englischen, noch der holländischen Sprache mächtig war, die wenigen Redephrasen, die ich mir früher aneignen konnte, reichten kaum hin, um mich nothdürftig über die allereinfachsten Dinge zu verständigen, geschweige denn mit einem Kranken zu verkehren. Die Wahl zwischen dem »Diggen« und »Prakticiren« war bald entschieden, zu dem ersteren brauchte ich ein Capital—das ich nicht besaß—zum letzteren blos eine mitleidige Seele, welche mir auf einige Wochen ein Zelthäuschen und einige Möbelstücke lieh. Der Zufall war mir hold.
Ich hatte nämlich einen Brief in der Tasche, der mir als Empfehlungsbrief dienen, zugleich aber auch dem Adressaten mehr als ein solcher sein sollte. Dieser war nämlich kränklich und wollte, da er in den Diamantenfeldern keine Besserung erreichen konnte, nach Europa reisen, um hier von den Aerzten Heilung seiner Krankheit zu suchen. Glücklicherweise war dieser Mann der deutschen Sprache mächtig, und als ich ihm meinen Empfehlungsbrief übergab, aus welchem er entnahm, daß er einen Arzt vor sich habe, wollte er es noch mit mir versuchen, ehe er die beabsichtigte Fahrt nach Europa antrat, ein Entschluß, der angesichts der hohen Kosten einer solchen Reise dem praktisch angelegten und sparsamen Mann nicht schwer fiel. Es gelang mir denn auch, denselben in acht Tagen so weit herzustellen, daß er seine Reise definitiv aufgab, und sich meiner Behandlung vollends anvertraute. In dem Maße aber als mein Patient praktisch war, fehlte mir diese Tugend, ich unterließ es, meine Forderungen zu fixiren, und nahm mit Dank gleichsam als Abschlagszahlung für meine Dienste das an, was er mir bot. Er stellte mir nämlich ein altes, morsches Zelthäuschen zur Verfügung, lieh mir großmüthig 5 £ St., eine Gefälligkeit, um welche er von dem Kaufmanne in Fauresmith ersucht worden war, und einige der nothwendigsten, allein nichts weniger als comfortablen Möbelstücke. In meiner Lage sah ich jedoch all' dieses als eine sehr große Gefälligkeit an, und hatte meine herzliche Freude, den »Herrn Gönner« unter meinen Augen genesen zu sehen.
Dieses etwa 3½ Meter breite, ungefähr 3 Meter lange und 2 Meter hohe Zelthäuschen bestand aus Fichtenlatten, die mit einfacher Segelleinwand überzogen waren. Die Leinwand war durch Staub und Regen so morsch geworden, daß sie weder vor Wind noch vor den eindringenden Staubmassen schützte, die Latten knarrten bei jedem Windstoß und wäre nicht ein hölzernes Waarenhaus zur Seite gestanden, das dem Zelthause einigen Schutz verlieh, ich glaube die heftigen Südwinde, welche ihm oft eine völlig windschiefe Form gaben, hätten diese Ruine schon längst von der Erde gefegt. Auch der Zugang war recht bequem. Die Hütte stand nämlich knapp an der nach Kimberley (dem Hauptorte der Diamanten-Fundstätten) führenden Straße, und es kostete immer einen beherzten Sprung über den Straßengraben, wenn man den Eingang erreichen wollte. Die Thüre stellte ein beweglicher, mit Segeltuch überzogener Holzrahmen dar; um halbwegs sicher zu sein, stemmte ich Nachts von Innen eine Eisenstange vor, die ich in meinem »Grund und Boden«, den natürlichen Parquetten meines luftigen Palastes, gefunden. Statt des Fensters war eine bewegliche Leinwandklappe angebracht, welche bei dem geringsten Windstoße auf- und zuflog. Ein grüner Tuchlappen theilte den Innenraum in zwei Gemächer.
Das erste Gemach war mein Consultations-, mein Arbeitszimmer und die Apotheke; sein Meublement bestand aus einem alten, unangestrichenen Tische, zwei gleichen Stühlen und zwei Kisten, von welchen die eine zur Aufbewahrung meiner Medicamente, die zweite als Bücherschrank diente; war der Krankenbesuch zahlreich, und dies geschah, wenn eine ganze holländische Farmerfamilie mir in's Haus fiel, so stellten diese Kisten so etwas wie Fauteuils im Ordinationszimmer meiner etwas comfortabler eingerichteten europäischen Collegen vor. Die zweite und etwas kleinere Hälfte meines Zelthauses war meine Küche, meine Speisekammer und Schlafzimmer, sowie das für die Arbeiten meines Dieners bestimmte Local—Arbeiten, die ich mir vorderhand, bevor sich noch ergiebigere Einnahmen eingestellt hatten, nolens volens selbst verrichten mußte. Eine ähnliche splendide Ausstattung hatte mein Lager, auf welchem ich mich ohnehin meistens schlaflos vor Kälte zitternd, zusammenkauerte. Das eleganteste europäische Möbelstück war noch mein von der Reise arg hergenommenes Kofferchen.
Um die zu einer Reise in's Innere nöthigen Mittel möglichst bald zu erwerben und den Verpflichtungen, unter denen namentlich die Holitzer Sparcasse mit 300 fl., Herr Hermann Michaelis mit 16 £ St. etc. figurirten, gerecht zu werden, nahm ich mir vor, mich auf das Möglichste einzuschränken und so lebte ich auf Monate hin—als ich auch später eine Wohnung nehmen mußte, in der größten Einfachheit und Zurückgezogenheit; da mich die Theuerung in den Diamantenfeldern sehr erschreckte und mir der geringe Werth des Geldes—denn damals herrschten noch gute Zeiten in jenen Districten—auffiel, besorgte ich mir selbst die Küche. Sobald es dunkel geworden war und die Straßen menschenleer erschienen, besorgte ich meine Einkäufe und versah mich mit dem nöthigen Wasservorrath für den nächsten Tag, theilweise zur Herstellung der Arzneien, größtentheils aber, um allen gewöhnlichen Ansprüchen—und diese waren, wie sich leicht denken läßt, ziemlich mannigfaltige—zu genügen; mußte ich doch das Amt der Waschfrau und Köchin versehen—daß ich mein eigener Leibschneider war, brauche ich nicht weiter hervorzuheben.
Ich will die geehrten Leser nicht weiter in die Details meiner Wirthschaft einführen, sondern nur bemerken, daß ich all' dies sehr geheim halten mußte, da das Bekanntwerden dieser Details mir in meinem Ansehen als Arzt sehr geschadet hätte. Mit der Zeit hatte ich nach und nach eine ganz respectable Praxis erworben, deren Ertrag mich schon zu Beginn des Monats October 1872 (ich war am 26. August in den Diamantenfeldern angelangt) in den Stand setzte, meine Verpflichtungen in der Heimat zu tilgen.
Allmälich konnte ich mich auch aus meiner Zurückgezogenheit hervorwagen, mir eine kräftigere Kost gönnen, wenn auch meine Wohnung noch für lange hin ein Zelthäuschen verblieb, was wohl etwas unbequem war und manches Ungemach im Gefolge hatte, allein mir in meinem »öffentlichen« Auftreten zu jener Zeit keinen Abbruch that. Meine Praxis war mir dadurch bedeutend erleichtert worden, daß viele Deutsche, die von dem neu angekommenen, deutschsprechenden Arzte hörten, zu mir pilgerten. Damit war auch beiden Parteien geholfen, ich hatte aber noch den Vortheil, meine Kenntnisse in der holländischen Sprache in überraschend kurzer Zeit zu erweitern.
Zu der Zeit meines ersten Besuches waren die Diamanten-Fundorte noch nicht von allen den unreinen Elementen so gesäubert, wie es gegenwärtig der Fall ist; viele Abenteurer hatten sich da eingefunden und da die Engländer in dem erst kürzlich zuvor erworbenen Lande noch nicht alle Reformen durchzuführen Gelegenheit gehabt hatten, war die Sicherheit des Eigenthums und selbst des Lebens noch ziemlich problematisch. Den Uebelthätern konnte man aber um so weniger beikommen, als die meisten nach vollbrachter That das Weite suchten und in einer halben Stunde, von den Central-Diamantenfeldern (Dutoitspan, wo ich mich niedergelassen, bildet den östlichen Theil derselben) aus, den Oranje-Freistaat erreichten, wo sie vollständig geborgen waren, da die Regierung des Freistaates den Engländern noch immer ob der Annexion von West-Griqua-Land (d.h. eben der Diamantenfelder) grollte und sich deshalb auch nicht bemüssigt hielt, der englischen Polizei hilfreich die Hand zu bieten. Seitdem aber England die Ansprüche des Freistaates auf diese Provinz mit 90.000 £ entschädigte, haben sich diese Verhältnis selbstverständlich zum Besseren verändert. Unter jenen Abenteurern gab es viele, die sich darin getäuscht sahen, ohne jede Anstrengung in dem Diamanten-Eldorado Reichthümer zu erwerben, und da sie schwere Arbeit scheuten, bildete sich aus ihnen eine lichtscheue Bande, die auch unter der schwarzen Bevölkerung Rekruten und Helfershelfer fand. Gelang es nun auch, einen oder den anderen dieser Wegelagerer dingfest zu machen, so bot die nichts weniger als solide Bauart der Gefängnisse keine Sicherheit gegen Fluchtversuche; die Loslösung einer oder mehrerer Platten der Blechbedachung war keine schwierige Leistung, auf dem Camp gab es genug frei grasende Pferde, nichts leichter daher, als eine Flucht, die nach einem viertelstündigen scharfen Ritte in ein schützendes Asyl führte.

[Nächtlicher Ueberfall.]
Wie sehr Vorsicht im Umgange mit den Bewohnern der Diamantenfelder am Platze war, erfuhr ich leider selbst an einem im nahen (zwei englische Meilen entfernten) Kimberley wohnenden Landsmann, in dem ich einen Freund zu finden glaubte. Gleich vielen seiner Genossen hatte auch er gehofft, hier in kurzer Zeit Schätze zu sammeln, und war Digger geworden. So freundlich er sich mir aber im Verkehr zeigte, so hinterlistig und ehrlos manövrirte er hinter meinem Rücken und trieb länger denn zwei Jahre dieses Doppelspiel, bis mir Briefe aus der Heimat die Augen öffneten.
Es mag vielleicht unglaublich erscheinen, aber thatsächlich war Neid die Triebfeder seines ganzen Benehmens; er, der sich dazu ausersehen wähnte, Afrika als Vertreter Oesterreichs zu erforschen, suchte mich, seinen Nebenbuhler, zu verdächtigen.
Mit den Leistungen der vorerwähnten Strauchritterbande sollte ich früher als mir lieb war, bekanntwerden. Von einem Besuche in Kimberley eines Abends heimgekehrt, bemerkte ich, als ich eben mein primitives Lager aufsuchen wollte, daß die Zeltwand in der hinteren rechten Ecke gerade oberhalb der Stelle, wo mein Bettgestell stand, von oben bis unten zerschnitten war. Ich hielt sofort unter meinen Mobilien und Schätzen gründliche Nachschau, überzeugte mich aber, daß alles auf seinem Platze stand, woraus ich schloß, daß der freundliche Besucher, welcher in meiner Abwesenheit durch die Zeltwand hindurch bei mir vorsprechen wollte, an der Ausführung seines Vorhabens durch irgend einen Zufall gehindert worden war. Ich muß gestehen, daß ich diese Nacht nicht zu den angenehmsten zählen konnte, da ich sie im Dunkeln mit dem Revolver in der Hand durchwachen mußte. Bei reiflichem Nachdenken über den mir zugedachten Besuch hielt ich es für das Beste, meine Visiten nach Kimberley vorläufig einzustellen, um abzuwarten, ob sich derselbe nicht vielleicht wiederholen würde. Ich sollte darüber nicht lange im Zweifel bleiben; schon in der nächsten Nacht wurde ich darüber belehrt. Um den nächtlichen Besucher an meiner Wachsamkeit irre zu führen, hatte ich absichtlich den am Zelthäuschen verursachten Schaden nicht ausgebessert. Ich löschte rechtzeitig mein Lieht aus, warf mich mit meinem sechsläufigen Freunde auf meine Lagerstätte und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Es ist begreiflich, daß ich jedem, auch dem unbedeutendsten und leisesten Geräusche in der Nähe meiner luftigen Residenz meine volle Aufmerksamkeit schenkte. Als es in den Straßen stille geworden war, glaubte ich Jemanden sich meinem Zelte von rückwärts nähern zu hören, geräuschloser, als es ein Vorübergehender thun würde, und was mir auffiel, nach der Stelle zu, wo Nachts zuvor der Einbruch versucht worden war; ich erhob mich so sachte als möglich von meinem Lager, und da der Lehmboden meine Tritte dämpfte, war es mir möglich, dem von außen das Zelt Umgehenden Schritt für Schritt zu folgen, bis wir beide an der Thüre angelangt waren. Bald vernahm ich den Versuch, die Thüre aufzudrücken, ein Augenblick genügte, um die vorgeschobene Eisenstange geräuschlos zu beseitigen und so dem Ankommenden den Versuch, die Thüre zu öffnen, zu erleichtern. Im nächsten Augenblicke riß ich die Thüre auf und der Eindringling, der sich gegen dieselbe gestemmt, wäre fast in das Zelt hineingetaumelt. Den Strolch bei der Kehle fassen und ihm den Revolver an die Brust zu setzen, war das Werk eines Augenblickes. Nun sah ich bei dem schwachen Schimmer des halb von Wolken bedeckten Mondes, daß ich einen halbnackten Kaffer, der so schwarz wie ein Bewohner der Hölle war, gefaßt hatte. Der Eindringling war durch das plötzliche Nachgeben der Thüre und durch den Zusammenstoß, jedoch noch mehr durch die unsanfte Berührung seiner Kehle und den Anblick der Waffe derart verwirrt, daß er an keinen Widerstand dachte, kaum einige Worte, wahrscheinlich eine Entschuldigung, lallen konnte, und dann flehentlich bat, ihn freizulassen. Wir waren in dieser Weise über den Straßengraben in die Mitte der für ihn glücklicherweise menschenleeren Straße gekommen, ein Allarm hätte wohl den Kerl um sein süßes, schwarzes Dasein gebracht; ich schüttelte ihn weidlich durch, ließ meinen Revolver noch etwas vor seinen Augen verheißungsvoll blitzen und warf ihn dann in den Straßengraben zurück, aus dem er sich blizschnell aufraffte und eiligst die Flucht ergriff. Als ich am folgenden Tage meinen Patienten von dem nächtlichen Besuche erzählte, bedauerten sie allgemein, daß ich den Strolch nicht niedergeschossen hatte. Mein energisches und kluges Abwehren dieses Einbruchversuches hatte den gewünschten Erfolg, ich wurde später nicht weiter belästigt, und habe wiederholt die Erfahrung gemacht, daß dieses Diebsgelichter es scheut, einen mißglückten Versuch zu wiederholen.
Daß mein Heim nichts weniger als einbruchsicher war, ist damit wohl zur Evidenz erwiesen, daß es dem Regen und Winde freies Spiel ließ, habe ich bereits erwähnt; ich sollte aber noch erfahren, daß der ganze Bau sich der Elementargewalt des Windes gegenüber mehr als nachgiebig bewies. Bevor noch die Katastrophe mit meinem Zelte eintrat, die ich in Folgendem schildern will, sei es mir erlaubt, einer Episode aus meiner Praxis zu erwähnen. Eben mit einem Patienten beschäftigt, sah ich einen Fremden in meinen Ordinationssalon eintreten, und gedachte ihn zu ersuchen, noch einige Augenblicke sich auf der Straße zu gedulden, als ich an seiner Stimme einen meiner ersten Kunden erkannte. Es war ein Deutscher, Namens Oppermann, ein Mann, den ich an einer Lungenentzündung behandelt, und der durch einige Tage in Lebensgefahr geschwebt hatte. Während wir unter der gegenwärtigen Behandlung gewöhnliche, meist durch Verkühlung verursachte Fälle der Pneumonie (Lungenentzündung) in den gemäßigten Strichen des europäischen Continentes meist in kurzer Zeit gebessert und auch bald geheilt sehen, gehörten die Pneumonien in den Diamantenfeldern, namentlich als noch die Zelthäuschen und die Zelte überwogen und die Erkrankten gegen die Unbill des Wetters nicht den geringsten Schutz fanden, zu den gefährlichsten Krankheiten. Auch diesen meinen Klienten hatten dessen Freunde aufgegeben und erklärten mir, so oft ich ihn besuchte, daß alle meine Mühe vergebens sei, der Mann müsse doch sterben. Ich that dennoch mein Möglichstes, ihn gegen den eindringenden Staub und die Kälte zu schützen, denn daß mein Erfolg in diesem Falle für mich und die Zukunft meiner ärztlichen Praxis von größter Tragweite sein mußte, ist wohl selbstverständlich.
Zu einem Ausgange in die freie Luft hätte ich den Mann noch nicht fähig gehalten und war daher überrascht und erstaunt, ihn bei mir zu sehen. Ohne auf meine Widerrede zu achten, bestand er, der hier in den Diamantenfeldern Schiffbruch an seiner ganzen Habe gelitten, darauf, mich für meine Mühewaltung zu entschädigen, und schloß seine Ansprache mit den Worten: »Nun, Doctor, nur noch einige Worte: Sie wissen wohl selbst, daß Sie mir das Leben gerettet haben, und da ich Ihnen wirklich mit dem kleinen Geldbetrage nie meine Dankbarkeit hinreichend darthun kann, erlaube ich mir, mich Ihnen zur Verfügung zu stellen, wenn Sie mich als Begleiter auf Ihren Reisen brauchen könnten; ich werde gewiß Alles thun, um mir Ihre Zufriedenheit zu erringen.« So hatte ich meinen ersten Begleiter auf meine Reisen in das Innere gewonnen.
Und nun zum seligen Ende meines Zelthäuschens. Von einem Krankenbesuche zurückkehrend, war ich nicht wenig erstaunt, trotz alles Suchens mein afrikanisches Heim nicht mehr wiederzufinden; verblüfft blieb ich stehen, sah mich nach allen Seiten um, die Staffage war dieselbe geblieben wie immer, von einem Zelte aber keine Spur; während ich jedoch noch darüber nachgrübelte, was da vorgefallen sein mochte, trat einer meiner nächsten Nachbarn, ein Kaufmann, an mich heran und sagte lächelnd: »Sie suchen wohl Ihr Haus, der Wind hat es weggeblasen; sehen Sie, dort liegt es.« Und damit wies er auf einen etwa 150 Schritte weiter liegenden Haufen von Leinwandstücken, zwischen denen einige meiner Karten lustig im Winde flatterten. Ehe ich mich noch recht besinnen konnte, führte mich der Kaufmann zu den Ruinen und dann in sein Verkaufslocale und zeigte mir in einer Kiste die Ueberreste meiner Habe, die er freundlichst gerettet hatte. Mir blieb keine lange Zeit zum Nachdenken übrig, nachdem ich noch Manches aus den Trümmern gerettet, was dem Kaufmann vielleicht überflüssiger Ballast scheinen mochte, beeilte ich mich, da der Abend bereits angebrochen war, ein neues Zelt zu suchen. Nach langem Suchen und Fragen war ich so glücklich, dem Magistratsgebäude gerade gegenüber ein kleines Zelthäuschen vermiethet zu erhalten. Dasselbe war von gleicher Beschaffenheit wie das eben vom Wirbelwinde dagegen nicht so sehr vom Wind und Regen mitgenommen, auch befand es sich in der Reihe der übrigen Segeltuch- und Eisenhäuschen, welche die Hauptstraße von Dutoitspan bildeten, und war dadurch vor der Wuth des Sturmwindes etwas geschützt. Als Miethe mußte ich monatlich 3½ £. St. bezahlen, und da der Besitzer desselben die Wissenschaft der Hauseigenthümer gründlich studirt hatte, wurde mir diese Miethe im Laufe eines Jahres auf 5 £. St. erhöht.
Ich hatte mich bald davon überzeugt, daß ich mit meiner neuen Acquisition aus dem Regen in die Traufe gekommen war. Während der heißen Jahreszeit mußte ich stets im Innern meines Hauses den Schirm aufgespannt erhalten, um mich der durchdringenden Sonnengluth zu erwehren, bei Regenwetter war ohne Schirm noch weit weniger zu bestehen, denn das Wasser rann in feinen Fäden herab, dazu war der Raum so beschränkt, daß ich namentlich bei meinen Kochversuchen in die ärgsten Verlegenheiten gerieth.
Die Situation wurde aber eine in hohem Grade komische, wenn mich meine Patienten consultirten, denn dann wurde ihnen das Vergnügen zu Theil, den Schirm über uns beide emporzuhalten; glücklicherweise nahmen es dieselben nicht so genau, waren an die rauhe Witterung und das rauhe Leben in den Diamantenfeldern gewöhnt und so konnte ich auf Entschuldigung der vielfachen Gebrechen meines Empfangssalons rechnen. Eine der unangenehmsten Seiten meiner, sowie aller der Wohnungen mit ungedielten Fußböden war, daß sie von allem möglichen Ungeziefer strotzten. Mir wurde dieses in meiner neuen Wohnung zu einer wahren Tortur und erst als ich sie nach etwa zehn Monaten mit einer anderen vertauscht hatte, welche von dem Straßengetümmel abseits lag, fühlte ich, was ich in der Mainstraße ausgestanden und war um eine Centnerlast erleichtert.
Das ganze Arsenal von Vertilgungsmitteln, das mir zu Gebote stand, Pulver, Carbolsäure, brachte nicht die mindeste Besserung zu Stande; ergötzlich waren oft die Scenen, die sich unwillkürlich bei dieser Sachlage während meiner ärztlichen Ordinationsstunden abspielten. Da eines Tages wurde ich mitten in der Berathung mit den Worten unterbrochen: »Please pardon, my Doctor, but you have a large flea sitting on your left cheek.« Ja, mein aufmerksamer Patient ging noch so weit, daß er, über diese Landplage der Diamantenfelder losziehend, den Unverschämten von meiner Wange entfernte. Doch damit waren die nächtlichen Ruhestörungen nicht erschöpft, es gehörte nicht zu den außerordentlichsten Seltenheiten, des Morgens sich von einigen Kröten angestaunt zu sehen, oder gar durch ein eigenthümliches Rascheln am Boden aus dem Schlafe gerissen zu werden, und mit dem Licht in der Hand im tiefen Negligé sich plötzlich entsetzt einer Cobra capella gegenüber zu finden, die hochaufgerichtet, mit breit aufgeblähtem Halse den Zelt-Insassen laut anzischte. Gewiß eine erfreuliche Bescheerung!
Werfen wir nun einen Blick in das Straßenleben der Diamantenfelder-Städte. Es ist Mittag, die belebteste Stunde; von allen Seiten strömen die durch den grauen Staub der Diamantengruben fast zur Unkenntlichkeit entstellten Digger von der Arbeitsstätte nach ihren Wohnungen, um hier für kurze Zeit Ruhe und Erholung zu suchen. Diese Digger (Diamantengräber) sind—dies verräth ihr ganzes Benehmen und Auftreten—theils selbstständige Besitzer kleiner Claims (Gruben), welche die Arbeit in diesen selbst beaufsichtigen, oder Aufseher (Overseer), welche im Dienste einer Gesellschaft oder eines reichen Claimbesitzers stehen.
Ein Troß von Eingebornen aller Farben-Nuancen, bald schreiend und lärmend oder sogar tanzend, bald stille wie eine gedrillte Truppe, folgt den Diggern, ihren Herren; die verschiedenen Hautschattirungen verschwinden für den flüchtigen Blick unter der monotonen grauen Staubkruste, die alle gleichmäßig bedeckt, nur das äußere Costüm läßt hie und da auf die innern Neigungen des Einzelnen schließen.
In das Gewühl der bunten Menge von Passanten mischt sich ein Troß von Fuhrwerken aller Art, hier zwei- und mehrspännige, zweirädrige Scotchkarren mit der diamantenhältigen Grubenerde beladen, dort die von 8-10 Ochsenpaaren gezogenen Ungeheuer von Capwägen—alle diese Vehikel, zwischen welchen die leichten zweirädrigen Kaleschkarren mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit sich durchwinden, bilden oft einen dichten Knäuel, dessen Entwirrung kaum möglich scheint. In das Gejohle der Grubenarbeiter mischen sich dann die gegenseitigen höflichen Complimente der Fuhrleute in allen europäischen und südafrikanischen Sprachen.
Dieses rege Leben erklärt sich aber nicht nur aus der Natur und dem leitenden Motiv der Beschäftigung in den Diamantenfeldern, sondern auch aus der Zahl der Beschäftigten. In den auf einer verhältnißmäßig engbegrenzten Fläche sich ausbreitenden vier wichtigsten Fundorten Kimberley, Old de Beers, Dutoitspan und Bultfontein finden außer den häuslich und in Waarengeschäften bediensteten Eingebornen sechs- bis zwanzigtausend Schwarze, Hottentotten, Griqua, Koranna, Betschuana und Zulu lohnende und dauernde Beschäftigung.
Verlassen wir nun die Straßen der luftigen Zelt- und Eisenstadt und folgen wir den nach den Gruben zurückkehrenden Diggern und ihrem schwarzen Arbeiterheere, es erwartet uns ein für den ersten Augenblick sinnverwirrender Anblick. Bevor wir uns jedoch mit dem bunten, aufregenden Treiben in den Diamanten-Fundstätten vertraut machen, sei es mir erlaubt, in Kürze eine geographisch-historische Skizze der Diamantenfelder zu entwerfen.
Die Diamantenfelder Süd-Afrika's liegen zum überwiegenden Theile in der englischen Provinz Griqualand-West,[1] ein Landstrich, der mit der Entdeckung seiner unterirdischen Schätze zum Zankapfel aller eingebornen Fürsten wurde. Der Griquakönig Waterboer, die Batlapinenhäuptlinge Jantje und Gassibone, sie alle stritten sieh um den Alleinbesitz, obschon jeder von ihnen nur einen Theil des Gebietes sein Eigen nannte; Waterboer besaß die Hauptmasse des Landes, zu beiden Seiten des unteren Vaal- und Modder-Rivers, Jantje den nördlichen Theil an der Hart-Rivermündung, Gassibone den nordöstlichen zwischen dem Vaal- und Hart-River und die Koranna das Thal des Vaalflusses von Fourteen stream bis zur Einmündung des Hart-Rivers.
1 Die gegenwärtige Provinz Griqualand-West ist in drei Districte getheilt; einen nördlichen, am mittleren Vaal und am unteren Hart-River, das frühere Gebiet der westlichen Koranna's und jenes des Batlapinenfürsten Jantje in sich begreifend und »the Division of Barkly« (zu Ehren des früheren Gouverneurs der Cap-Colonie Sir Henry Barkly) genannt, einen mittleren District am linken Vaalufer zwischen dem südwestlichen und dem obengenannten gelegen, »the Division of Kimberley« (zu Ehren des gewesenen englischen Colonial-Ministers) genannt und einen südwestlichen an der Vereinigung des Vaal- und Oranje-Rivers gelegen »the Division of Hay« (zu Ehren des Generals gleichen Namens). Dieser war Waterboer's Stammland. Sein Hauptort, in welchen die Hauptmacht der westlichen Griqua's concentrirt ist, hieß früher Griqua-Town, nun Hay; in der mittleren Provinz ist Kimberley (früher New-Rush genannt) und im nördlichen Districte ist Barkly, früher Klipdrift, am rechten Vaalufer, der Berliner Missionsstation Pniel gegenüberliegend, der Hauptort. Im Süden bildet der Oranjefluß die Grenze gegen die Cap-Colonie, im Osten verläuft die Grenze zwischen der Provinz und dem Oranje-Freistaat nach einer von Colonel Warren und einer Freistaat-Commission bestimmten Linie, welche in ihrer nördlichen Fortsetzung die Provinz von der Transvaalprovinz (dem früheren Gebiete Gassibone's) trennt, nach Westen ist die Grenze noch nicht festgestellt—tief in's Kalahari-Bushveldt greifend—und nach Norden zu wurde die früher gezogene Scheidelinie durch den Krieg mit den Botlaros bis zu den südlichsten Viehposten der westlichen Barolongen vorgeschoben. Früher wurde dieser Landstrich von der Cap-Colonie aus verwaltet, seit den letzten sieben Jahren hat die Provinz ihre eigene Regierung, einen Gouverneur, dem ein »executive Council« zur Seite steht.
![Platz in Dutoitspan.]](images/013.jpg)
[Platz in Dutoitspan.]
Die Auffindung der ersten »Kieselsteine«, wie die Diamanten anfänglich von den Boers spöttisch genannt wurden, erregte in ihnen allen die Ländergier und als später die Annexion der Diamantenfelder durch die Engländer eine erbitterte Streitfrage zwischen diesen und der Regierung des Oranje-Freistaates hervorrief, hielten sich beide Theile als die allein berechtigten Besitzer kraft der ihnen von den vorerwähnten Eingebornenfürsten eingeräumten Concessionen.
Wie überall mußte auch hier nach kurzem Besitze der schwächere Theil, der Oranje-Freistaat, aus dem Felde weichen; er erklärte sich dennoch für den allein rechtmäßigen Besitzer, und alle Versuche Englands, zwischen der neuen Provinz und der Republik, die, civilisirten Grenzstaaten zum gemeinschaftlichen Wohle gereichenden Gesetze anerkannt zu sehen, blieben fruchtlos, bis das mächtige England, ob als »großmüthiger« Nachbar oder dem »Gerechtigkeitsgefühl« folgend, jedweden Anspruch des Freistaates auf den Landstrich Griqualand-West mit 90.000 £ St. ablöste, und sich nebenbei verpflichtete, weitere 15.000 £ St. zum Ausbau einer Bahn beizusteuern, welche den Anschluß des Freistaates an eine der Eisenbahnen in der östlichen Cap-Colonie herstellen sollte.
Die gesammten Diamantenfelder, sowie die Diamanten-Fundorte im engeren Sinne des Wortes lassen sich in drei Districte eintheilen. Die ältesten sind die am Vaalflusse, von dem Transvaal-Städtchen Bloemhof bis zur Vereinigung des Hart- und Vaalflusses sich erstreckenden »River (Fluß) Diggings«; ihnen folgen die in der Division Kimberley im engsten Umkreise um diese Stadt gelegenen »Dry-Diggings« (so genannt, weil man früher hier die Diamanten ohne die Erde zu waschen durch Sieben und Sortiren der diamanthaltigen Erde auf trockenem Wege gewann) und endlich die außerhalb der englischen Colonie Griqualand-West im Oranje-Freistaate gelegenen Fundorte bei Sagers- und Coffeefontein als dritten District.
Die Niederlassungen der »River-Diggings« wuchsen—wie es leicht begreiflich und wie wir es ähnlich in Californien beobachten können—wie aus der Erde empor. Das der Missionsstation Pniel gegenüberliegende Klipdrift, welches sich ungemein rasch entwickelte, wurde der Hauptort dieser Diamanten-Fundorte, ja zu ihrem Centralpunkte; seit den letzten neun Jahren hat Kimberley (das früher New-Rush hieß) ihm diesen Vorrang abgerungen.
Im Thale des Vaalflusses, wo vor der Entdeckung der »wasserhellen Steinchen« nur der eitle und müßige Koranna sein Dasein zu verträumen gewohnt war, reihten sich schon ein Jahr nach dem Bekanntwerden der Entdeckung ganze Colonnen von luftigen Zelten aneinander. Ganz Süd-Afrika schien wie vom Fieber befallen, Jung und Alt, Gesunde und Kranke, Lords und Diener, Landleute und Städter, entlaufene Matrosen und Soldaten, Boers mit ihren ganzen Familien wanderten nach dem gepriesenen und gelobten Lande. In überraschend kurzer Zeit verwandelten sich diese Zeltlager in Städte von drei- bis fünftausend Einwohnern, denn nach Bekanntwerden der aufregenden Nachrichten aus Süd-Afrika, namentlich seitdem der »Stern von Süd-Afrika«, ein 83½ Karat schwerer, wasserheller Diamant gefunden war, brachte jeder Dampfer aus Europa hunderte und wieder hunderte von Glücksjägern aus aller Herren Länder.
So entstanden neben Klipdrift die Städte Hebron, River-Town, Gong-Gong, Blue-Jacket, New-Kierks-Rush, Delpoortshope, Waldecks-Plant und andere. Doch ihr Wachsthum, ihre Blüthezeit, war ebenso schnell verflossen, als es begonnen, denn kaum war die Nachricht von der Entdeckung der Diamanten auf der Ebene der Farm Dutoitspan unter den River-Diggers am Vaalflusse verbreitet, und die Fama ließ die Diamanten hier in Massen auf der Erdoberfläche zu Tage treten, als Alles diese Orte verließ und nach den viel reicheren Dry-Diggings eilte.
Groß war die Zahl derer, die, durch das Glück begünstigt, sich in kurzer Frist Vermögen erwarben, groß aber auch die Zahl jener, welche es ebenso schnell entschwinden sahen und weitaus die Mehrzahl verkamen hier, denn die Fundstätten waren sehr bald Lasterhöhlen jeglicher Art.
Im Vaalflusse werden die Diamanten in dem angeschwemmten Geröll (Partien im Flußbette wie im Thale oder im Geröll an den höheren Thalpartien) gefunden. Dieses Geröll besteht aus Grünsteinblöcken, welche schöne mandelartige Chalcedons und Achate, bald bis faustgroß und milchquarzartig, bald rosa- oder carminroth und zahlreich und klein, bald bläuliche und gelbliche, kleine und größere einschließen, und welches Gestein als »Vaalgestein« namentlich die Strecken von Bloemhof bis Hebron bedeckt, ferner aus Bruchstücken der die Gegend von Hebron bis zur Hart-River-Mündung, doch auch die meisten Höhen in der östlichen Cap-Colonie, dem Oranje-Freistaat und Griqualand-West charakterisirenden Trap-Dykes, aus ausgewaschenen mannigfarbigen größeren und kleineren Achatstücken, Milchquarz- und Thonschieferfragmenten, titaneisenhaltigem Sand und zahlreichen, früher für Rubin und Granaten gehaltenen Pyropen (letztere in kleinen, Hirse- bis Maiskorn großen Stückchen vorhanden), auch Bruchstücke des die Gegend zu beiden Seiten des Vaalflusses, doch nicht im unmittelbaren Thale, bedeckenden Kalkgesteins, in dem ich jedoch keine Fossilien nachweisen konnte.
Die Diamantengräber holten das diamantenhaltige Gerölle aus den ihnen von der Behörde oder nach Uebereinkunft abgesteckten Gruben »Claims«, fuhren bis zum Flusse herab, um es durch Sieben von den gröberen Steinstücken zu befreien, und dann in einfachen, 2-4 Fuß lange, 1-1½ Fuß breite Wiegen »Craddles« zu waschen, worauf dann im feinen und von dem Lehmgrund befreiten Rückstand nach den Brillanten gesucht wurde. Man fand kleine Steine, selten einen größeren, doch die meisten waren schöne, weiße und reine, sogenannte Glassteine, so daß man seither die schönsten und werthvollsten der in den beiden anderen Diamanten-Districten vorgefundenen Brillanten als »wahre River-(Fluß-)Stones« bezeichnet.
Von den genannten Städten und Städtchen der River-Diggings hat sich nur Klipdrift als der Sitz der Obrigkeit und kleine unbedeutende Handelsstation—das jedoch als solche Hoffnung hat, wieder zu gewinnen—als nennenswerth erhalten, mehrere massive, zur Zeit seiner Blüthe aufgeführte Gebäude weisen noch auf seine frühere Bedeutung hin.
Der zweite und bis jetzt der wichtigste Diamanten-District ist der von mir »The Central-Diggings« oder früher die Dry-Diggings benannte; es ist Kimberley mit seiner Umgebung aus vier Fundorten in zwei Gruppen bestehend, die nordwestliche Gruppe, die Kimberley und das damit an seiner Ostseite zusammenhängende Old de Beers, und die östliche, welche Dutoitspan und das sich südlich und westlich daran schließende Bultfontein in sich begreift. Die letztere Gruppe liegt von Kimberley zwei, von Old de Beers etwas über eine englische Meile, und Kimberley selbst circa 22 englische Meilen von dem oberwähnten Klipdrift in südöstlicher Richtung entfernt. Der wichtigste der vier genannten Diamanten-Fundorte ist Kimberley; hier werden die meisten Diamanten in allen Qualitäten, sowie reiner Krystallbildung gefunden, Dutoitspan ist durch seine zahlreichen großen, hell und bis in's weingelbe spielenden gelblichen und Bultfontein durch seine kleinen, aber schönen den Riverstones ebenbürtigen Brillanten bekannt.
Diese vier, die Central-Diggings bildenden Niederlassungen stellen aus Segelleinwand, aus Brettern, aus galvanisirtem Eisenblech, auch (in der Minderzahl) aus gebrannten und ungebrannten Backsteinen und einige wenige aus Trapdykes (Gebirgsformation) errichtete Städte dar, in deren Mitte sich Krater und muldenförmige Vertiefungen befinden—die jeweiligen Diamantengruben. Diese Niederlassungen liegen auf einer schon von Osten und Süden in einer Entfernung von etwa neun englischen Meilen von Höhenzügen begrenzten und durch eine unmerkliche Bodenerhöhung in zwei Abschnitte gesonderten Ebene. Diese steinige Erhebung »the rise« scheidet auch die beiden oberwähnten Gruppen von einander.
Die Diamantengruben haben 45-200 Fuß Tiefe, 200-760 Schritte im Durchmesser; sie heißen »Diggings« oder »Kopjes« und jede ist in eine Anzahl Quadrate oder Parallelogramme, 10 Fuß breit und 30 Fuß lang, oder 30 Fuß lang und 30 Fuß breit (dies war die ursprüngliche übliche Größe derselben) in »Claims« eingeteilt. Ein Digger (Gräber) kann einen oder mehr, bis zu 20 solcher Claims besitzen, allein er muß sie bearbeiten und monatlich eine gewisse, in der Regel 20 fl. übersteigende Grund- und Wassersteuer (für das Herauspumpen des Wassers) an die Regierung und den Mining-Board (ein Ausschuß von Diamantengräbern, der über die Interessen derselben wacht) entrichten; in Dutoitspan und Bultfontein gesellt sich hierzu noch die Abgabe an den Proprietär, d.h. die Eigenthümer der Farmen, während in der anderen Gruppe Kimberley und Old de Beers die Regierung dieses Eigenthumsrecht von der Firma Ebden & Co. erstanden hat.
Ich halte diese Gruben für Oeffnungen von Schlammkratern, glaube aber nicht, daß diese vier Diggings sich von einem gemeinschaftlichen Kraterkanale abzweigen, nur die in Old de Beers und Kimberley zu Tage geförderten Steine zeigen eine gewisse Aehnlichkeit und geben der Vermuthung Raum, daß diese beiden Diggings unterirdisch communicirende Kraterbecken sind. Was die River-Diggings anbetrifft, so glaube ich, daß irgendwo in der Nähe des Flußbettes oder vielleicht an seinem Rande, doch oberhalb Bloemhof, sich eine oder mehrere Kratermündungen befanden.
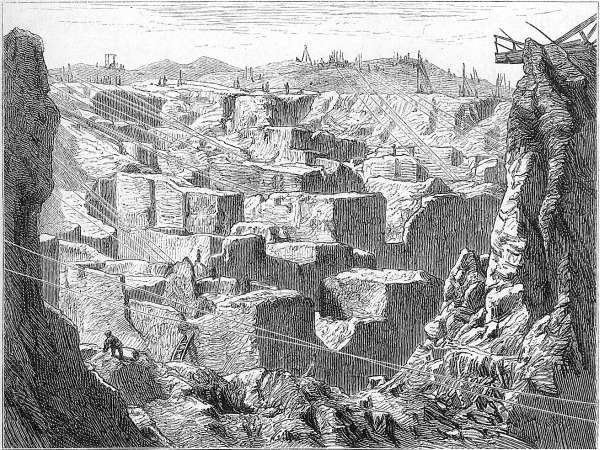
[Die Kimberley-Kopje im Jahre 1871.]
Die Jahre 1870 und 1871 waren die Glanzperiode der Diamanten-Diggings, waren jene Zeit, wo es vorgekommen ist, daß sich zuweilen ein übermüthiger Digger mit einer Fünfpfund-Note seine kurze thönerne Tabakspfeife anzündete, und wo es einem ärztlichen Gehilfen möglich war, 1100 £ in sieben Monaten zu verdienen. Man kann nicht sagen, daß die Ausbeute gegenwärtig geringer sei, allein die Steine sind seit 1871 stetig im Werthe gesunken, und so werden die Einnahmen die gleichen geblieben sein; dagegen haben sich die Auslagen mehr denn verzehnfacht und trotz des Sinkens der Preise hat sich der Werth der Gruben bedeutend erhöht. Bei der Entdeckung der Kimberley-Kopje konnte man für 10 £ einen Voll-Claim von 900 Quadrat-Fuß Fläche erlangen, freilich hatte man die bloße Oberfläche der Kopje vor sich, gegenwärtig ist man bis 200 Fuß tief gegangen und der Werth mancher der reicheren Gruben ist 12- bis 15.000 £ Sterling. Diese Thatsache beweist zur Genüge, daß sich die Verhältnisse in den Diamantenfeldern nicht so verschlechtert haben, als man es vielleicht erwartet hätte, weil, wie an ähnlichen stabilen Goldgruben, das zügellose, gierige Rennen und Jagen nach plötzlichem Reichthum einem besonnenen und erfolgreichen Streben nach Erwerb Raum gemacht hat.
Man erkennt dies an Allem und überall. Die Regierungsorgane handhaben mit Strenge und Unparteilichkeit die Gesetze, die socialen Verhältnisse haben sich gebessert. Ein flüchtiger Blick auf die Wohnhäuser belehrt uns darüber. An Stelle der windschiefen, jeden Augenblick dem Zusammensturz nahen Bretterbuden und Hartebeest-Häuschen, nothdürftig aus einigen mit Schilfrohr belegten, mit rother Thonerde und eisenhaltigem Sand angeworfenen Pfählen bestehend, finden wir jetzt solide Eisen- und Ziegelhäuser erbaut, deren innere Einrichtung den verfeinerten Bedürfnissen ihrer Bewohner entspricht, während die früheren Hausgeräthe des Diamantengräbers von ehemals sich kaum noch in einer Rumpelkammer vorfinden oder höchstens als Curiosität auf den »Morning Market« erscheinen dürften; die Zelte, die häufigste Behausung des Diggers in früheren Jahren, werden jetzt zu 95 Percent nur noch von den schwarzen, gemietheten Grubenarbeitern bewohnt.
Wie ich schon erwähnt, haben sich die Verhältnisse im Allgemeinen, sowohl jene für die Sicherheit der Person und des Eigenthums, als auch die gesellschaftlichen und endlich die Beziehungen zu anderen Staaten bedeutend und wesentlich zum Vortheile der Colonisten gebessert. Es besteht jetzt dort, wo früher ziemliche Willkür herrschte, wo man sich nicht viel um behördliche Verfügungen und Anordnungen gekümmert und die wenigen bestehenden respectirt hatte, eine feste, zielbewußte Regierung. Ihre Aufgabe ist keine leichte; denn auf der kleinen Fläche, welche die Central-Diggings bedecken, sind die verschiedensten Elemente, Vertreter aller Eingebornenstämme Süd-Afrika's zusammengewürfelt. Die gesellschaftlichen Verhältnisse gleichen jenen in einem civilisirten Staate, trotzdem daß hier die Eingebornenfrage Schwierigkeiten bereitet, die ein europäischer Staat nicht kennt und alle Industrie-Erzeugnisse, deren sich die Civilisation nicht entschlagen kann, hunderte von Meilen weit hergeschafft werden müssen.
Im Laufe der Jahre nahm der Betrieb des Diamantensuchens immer complicirtere Formen an; in den Jahren 1870 und 1871 schafften die Digger die Erde aus den in Parzellen getheilten Gruben mit Hilfe der als Arbeiter verwendeten Eingebornen, meist Kaffern, Hottentotten und Betschuanen heraus, ein oben am Rande der Grube in die Erde eingelassener Pfahl, an welchen eine Holz- oder Eisenrolle befestigt war, womit der diamantenhaltige Grund in Eimern mit den Händen herausgezogen wurde, war der ganze Apparat und galt für Gruben mit senkrechter Wand; da, wo sie mehr oder weniger geneigt, oder wo man etwa 100 Schritte weit her, über andere Arbeitende hin den Grund herausheben mußte, schlug man unten in der Grube einen, oben drei Pfähle ein, zwischen zweien bewegte sich ein Holzcylinder von 2-3 Fuß Durchmesser oder ein großes Rad; ein oder zwei Eingeborne setzten dieses auf beiden Seiten mit Drehkurbeln in Bewegung, so daß sich an demselben das Seil »ab-« und von demselben »aufrollte«, und die mit Grund gefüllten oder leer nach abwärts laufenden Eimer befördert wurden. Von dem dritten Pfahle lief ein Hanfstrick, ein starker Eisendraht oder ein schwaches Drahtseil zu dem in der Grube eingeschlagenen Pfahle und an diesem bewegten sich zwei eiserne mit einer Rinne versehene Stäbchen, welche ein mit einem Haken zur Aufnahme des Eimers versehenes Eisengestell trugen. Später als die Gruben etwas tiefer wurden und namentlich die Digger ihren Besitz auf mehrere Claims erweiternd, größere Mengen der diamantenhaltigen Erde, und weil sie mit größeren Kosten arbeiteten, auch in kürzerer Zeit herausholen wollten, wandte man zur Erleichterung dieser Arbeit hölzerne Fördermaschinen an, welche mittelst Pferdekraft in Bewegung gesetzt wurden. Von diesen sind gegenwärtig noch viele gang und gäbe, allein die reichen Grubenbesitzer, sowie die in neuerer Zeit gebildeten Gesellschaften haben bereits zu Dampfmaschinen ihre Zuflucht genommen.
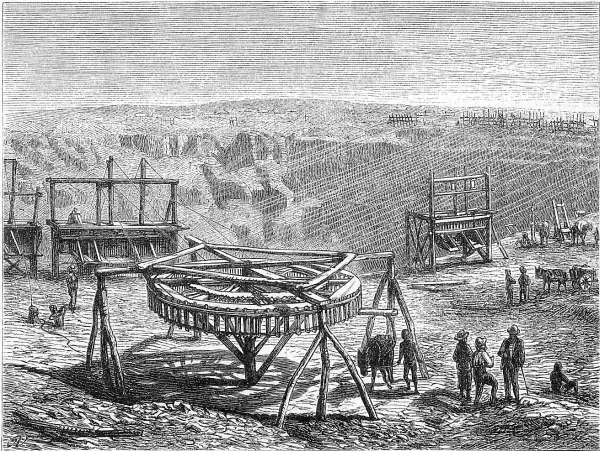
[Fördermaschinen in den Diamantengruben.]
Am besten konnte man dies an der Kopje zu Kimberley bemerken. Da diese den kleinsten Rauminhalt hat, allein, weil die reichste, die meisten Diamantengräber zählt, war es diesen nicht möglich, ihre in der ersten Zeit mit Handarbeit betriebenen Aufzüge nebeneinander aufzustellen. Deshalb wurden riesige Gestelle aus schwedischen Fichtendielen errichtet, diese in drei Stockwerke getheilt, und so drei Aufzüge übereinander auf einer Fläche von etwa 2 Quadrat-Meter errichtet. Diese Gestelle standen in Gruppen, von welchen jede 18-30 Diggern das Heraufholen der Diamantenerde ermöglichte. Gegenwärtig ist der dammartige Rand der Grube von großen durch Pferdekraft betriebenen Fördermaschinen und aus England eingeführten Dampfmaschinen bedeckt; auch ist es jetzt nicht mehr gestattet, den diamantenhaltigen Grund nahe an der Ausholungsstelle zu sortiren, wie es früher geschah, und viele Unannehmlichkeiten zur Folge hatte. Der Besitzer muß ihn auf seinen Grund und Boden oder auf eine dazu außerhalb der Stadt gemietete Stelle verführen, um ihn zu durchsuchen. Die letztere Prozedur ist gegenwärtig auch viel schwierigerer Natur.
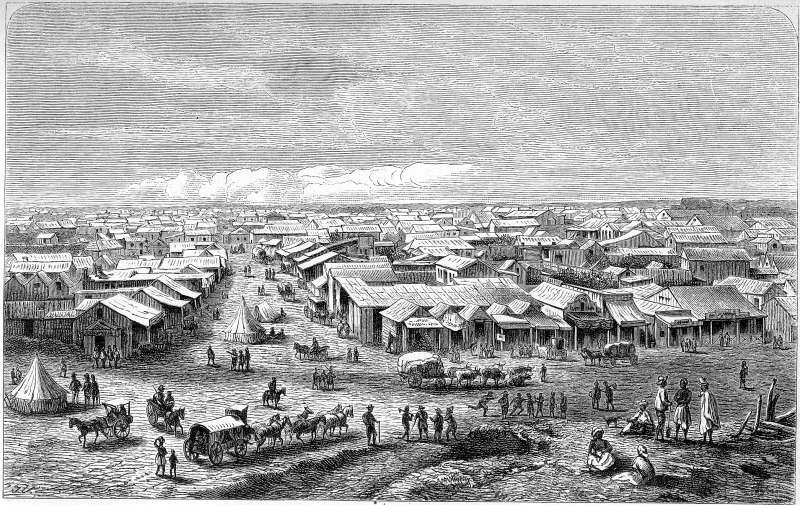
[Kimberley.]
Früher wurde die diamantenhaltige Erde mit Hilfe verschiedener Siebe von den gröbsten Bestandtheilen befreit, dann der feinere Rückstand auf einen flachen Tisch ausgeschüttet und mit Hilfe eines Eisenblechstückes oder eines kleinen Holzbrettchens sortirt. Bei einem solchen Verfahren konnte man aber viele, namentlich kleine Steine übersehen, so daß der früher schon durchsuchte Boden um die Kimberley-Kopje als diamantenhaltig verkauft wurde und als solcher die Mühe des Käufers reichlich lohnte. Man bedient sich (unbemittelte Diamantengräber durch Handarbeit in Bewegung gesetzter, wohlhabendere mit Pferdekraft getriebener, von den bedeutenderen Claimbesitzern auch mit Dampfkraft bewegter) complicirter Waschmaschinen, in denen die diamantenhaltige Erde von ihren lehmigen Bestandtheilen befreit, blos die körnerartigen Steinchen zurückläßt, welcher Rückstand, nochmals in Wasserfässer geworfen, die letzten ihm noch anhaftenden erdigen Bestandtheile verliert, gewöhnlich allabendlich mit Sieben herausgeschöpft, etwas durchgeschüttelt und dem Aufseher oder Claimbesitzer zur Ansicht auf eine Tafel vorgelegt wird. Finden sich Diamanten in der Lage, so sinken sie bekanntlich unter dem körnigen kleinen Gestein der diamantenhaltigen Erde als die schwereren Körper bis an das dichte Drahtnetz des Siebes, so daß sie beim Umstürzen des Inhaltes des letzteren obenauf zu liegen kommen, und gleich in's Auge fallen.
Im selben Maße aber als das Betriebsverfahren und die hierbei verwendeten Maschinen verbessert wurden, stiegen auch die Kosten desselben. Zur Zeit erfordert das Diamantengraben schon eine ziemlich ansehnliche Capitalsanlage, dadurch ist auch der Betrieb ein ruhiger und geschäftsmäßiger, das Heer der Glücksjäger bedeutend gelichtet worden, auch die Gesetze, welche das Diamantengraben behandeln und die Rechte der Digger sowie jene der Diamantenhändler schützen, sind geregelter geworden.
Unter der Bevölkerung der Diamantenfelder sind namentlich die Diamantengräber, die Diamantenkäufer, »The Diamond-buyers oder merchants« und die Kaufleute im allgemeinen stark, die Kanteenkeeper (Besitzer von Localen, in denen blos Spirituosen verkauft werden) zahlreich vertreten. Bei der großen Menge der schwarzen Diener und dem Werthe des gesuchten Artikels ist es leicht erklärlich, daß Veruntreuungen, namentlich von Seite der Eingebornen häufig vorkommen und in raffinirtester Weise ausgeführt werden, zur Steuer derselben wurden sowohl gegen die Verkäufer als auch Käufer verheimlichter und veruntreuter Steine drakonische Gesetze erlassen. Nebstdem wurde ein eigenes Detectiv-Korps errichtet, welches zur Säuberung der Diamanten-Districte von den diese Gesetze noch umgehenden Elementen beitragen soll. Die dagegen Handelnden werden mit Gefängnißstrafe (verbunden mit hard labour, d.h. schwerer Arbeit auf öffentlichen Orten) mit Geldstrafen bis zu 300 und 500 £ St. und in manchen Fällen mit körperlichen Strafen (der neunschwänzigen Katze) belegt.
Der Anblick, der sich uns bietet, wenn wir eine der größeren Diamantengruben von dem Kamme der ringsherum aufgetürmten Thonwälle aus betrachten, ist ein so seltsamer, daß Worte kaum hinreichen, ihn naturgetreu zu beschreiben. Die Kopje läßt sich zutreffend mit einem großen Kraterkessel vergleichen, der vor der Abarbeitung bis zum Rande, an dem wir stehen, mit vulcanischen Auswurfstoffen, hier der grünen, aus zerfetztem Tuff begehenden, bröckligen, diamantenführenden Erde ausgefüllt war, nunmehr aber tief ausgehöhlt ist. Die zu ungleicher Tiefe abgebauten viereckigen Claims füllen nun diesen großen Kraterkessel mit einer chaotischen Menge von Erdmassen, die hier als Pfeiler, Thürme, Plateaus, dort als Schächte, Wälle, Gräben, Treppen erscheinen, und es bedarf keiner erregten Phantasie, um in diesem Labyrinth sich das Bild einer vor Jahrhunderten versunkenen, nunmehr aber an das sonnige Tageslicht hervorgezauberten Stadt zu vergegenwärtigen, namentlich aber in der Abenddämmerung oder gar wenn des Vollmonds fahles Licht die Tiefen durchfluthet.
Die Illusion wird jedoch zerstört, wenn unser Auge das lebhaft pulsirende Leben, die geräuschvollste, emsigste Thätigkeit am Grunde dieses tiefen, dunklen Kessels erblickt, und sich uns der Vergleich mit einem zerstörten Ameisenhaufen unwillkürlich aufdrängt. Die unabsehbare Menge von Drahtseilen, die den Raum über dem dunklen Grunde wie mit einem riesigen Spinngewebe überzieht, an denen, glänzenden Knoten gleich, die zahllosen Fördereimer auf- und abrollen, verwirren die Sinne, dazu vermag das Ohr des Fremden das Geräusch der zahlreichen knarrenden Winden, das Summen der Drahtseile, das Getöse fallender Massen, alles noch übertönt von dem Rufen, Singen und Schreien der Arbeiter und von dem Klappern der das Wasser aus den Gruben entfernenden Saugpumpen auf die Dauer nicht zu ertragen. Fast betäubt verlassen wir diese, ein neues Weltwunder bergende Stätte.
Bevor ich diese in allgemeinen Zügen gehaltene Skizze der Diamantenfelder beschließe, will ich noch einiger eigentümlicher Scenerien des Straßenlebens in den Städten der Diamantenfelder gedenken. Vor Allem sind es die täglich mit Ausnahme Sonntags auf dem Markte zu Dutoitspan und Kimberley abgehaltenen Morning-markets (öffentliche Auctionen). Ein von der Regierung angestellter Morning-master (Auctionär), der jedoch auch Privatauctionen abhalten kann, versieht dieses, wenn auch die Lunge über die Zuträglichkeit anstrengende, dafür aber sehr lucrative Amt. Dieser alltägliche Morgenmarkt bietet ein höchst interessantes Schauspiel. Der ganze, von eisernen und leinenen Häusern umgebene, ungepflasterte Marktplatz ist in den Morgenstunden von 6-8 Uhr mit einer fast unabsehbaren Masse der bekannten Ochsenwagen förmlich bedeckt, die Mehl, Früchte, Gemüse, Kartoffeln, Mais, Schlacht- und Federvieh aller Art, aber auch Brennholz, Fourage, Schilfrohr zur Bedachung u.s.w. zuführen. Der Verkauf geschieht ausschließlich durch Auction. Von dem Markterlös erhält der Staat 5 Percent, der Marktmeister 2 Percent. Die Preise der Waaren sind ungemein schwankend und hängen ganz von der Größe der Zufuhr ab, der Preis eines Sackes Kartoffeln schwankte auf dem Markte in Kimberley zwischen 15 Shillingen und 3 bis 4 £ St.
Außer diesen Morning-markets werden noch an allen Orten und Ecken mit Ausnahme der Feiertage, in dazu errichteten Hallen, sowie Abends in den Cantinen öffentliche Versteigerungen von Privatsachen sowie anderer sonst unverkäuflicher Geschäftsartikel abgehalten. Um die Kauflust anzufachen, wird auf riesigen Plakaten nebst den zur Veräußerung gelangenden Artikeln hervorgehoben, daß während der Versteigerung liquors gratis an das kauflustige Publicum abgegeben werden.
Die Mehrzahl der Cantinen waren die ersten Jahre hindurch zumeist nur wahre Lasterhöhlen und bildeten eine der traurigsten Schattenseiten der Diamantenfelder; in letzterer Zeit macht sich indessen eine starke Abnahme dieser Locale bemerkbar. Die hie und da in den Straßen oder am Rande der Niederlassungen errichteten hohen Ziehbrunnen mit dem sie umkreisenden bunten Gewirre sind eine andere Specialität. Das Heraufziehen der Wasserkübel wird von Kaffern oder Pferden besorgt, das Wasser aber verkauft. Hunderttausende von Gulden werden jährlich in den Central-Diggings für dieses so notwendige, namentlich auf den Sortirplätzen unentbehrliche Element verausgabt.[1]
1 Zum Betriebe der Waschmaschinen und weil der diamantenhaltige Grund aus den Kimberley-Gruben erst längere Zeit der Atmosphäre ausgesetzt und mit Wasser benetzt werden muß, bevor er waschungsfähig ist. Gegenwärtig ist man darauf bedacht, die Grubenstädte aus dem etwa 15 Meilen entfernten Vaalflusse mit Wasser zu versorgen.
An Vergnügungen und Belustigungen fehlt es in den Diamantenfeldern keineswegs, dem Freunde lärmender Schauspiele bieten sie sich im Theater, auf Bällen u.s.w., wenn auch die Kosten solcher Vergnügungen exorbitante sind; wer zurückgezogen bleiben will und hier nur die Gelegenheit sucht, sein angelegtes Capital rasch zu verdoppeln oder überhaupt Ersparnisse zu machen, findet in den zwischen Kimberley und Old de Beers angelegten öffentlichen Gärten manche Zerstreuung. Wie indeß in den californischen Goldgruben ist auch hier Alles, selbst die luxuriösesten Dinge—allerdings zu fabelhaften Preisen—zu haben. Die hohe Fracht von der Küste bis hierher vertheuert eben alle Artikel europäischer Industrie in ungewöhnlichem Maße, besonders gilt dies von Metallartikeln, Maschinenbestandtheilen, Holzarbeiten u.s.w.
Unter den Unannehmlichkeiten, welche der Aufenthalt in den Diamantenfeldern mit sich bringt, sind die Unbilden des Wetters hervorzuheben, namentlich die in der trockenen (Winters-) Jahreszeit täglich daherbrausenden Staubstürme, welche eine den Athmungsorganen, Augen und Ohren wenig zusagende, mit allem möglichen Unrath gemischte Atmosphäre erzeugen, in die Häuser dringen und hier in kurzer Zeit Alles verderben. An meisten jedoch leiden jene unter dieser Unbill des Wetters, welche den Tag über unausgesetzt in den Diamantengruben arbeiten, oder sich als Karrentreiber etc. in den Straßen bewegen müssen.—Wird dann das Land im Sommer, während der Regenzeit, von heftigen Regengüssen überfluthet, wo sich die am Südende von Dutoitspan in einer 1/8 englischen Meile im Durchmesser haltenden Bodenvertiefung befindliche große aber seichte Brackpfanne (einer der bekannten, seichten, jährlich austrocknenden Salzseen) oft in einem Tage füllt, so werden die Straßen so sehr aufgeweicht, daß es namentlich bei dem regen Verkehr in Kimberley kaum für den Fußgänger möglich ist, sie zu passiren. Die neue Munizipalität war jedoch bemüht, diesem Uebelstande abzuhelfen, indem sie Abzugscanäle herstellen und die Straßen schottern ließ.
Wir nehmen nun vorläufig von den Diamantenfeldern Abschied, ich werde jedoch noch wiederholt Gelegenheit finden, manch' interessante Episoden und Scenen aus dem socialen Leben daselbst zu schildern.
Ich will nun noch eines dreitägigen Jagdausfluges gedenken, den ich in Gesellschaft von Pavianjägern zur Weihnachtszeit des Jahres 1872 von den Diamantenfeldern aus nach den nahen Höhen im westlichen Theile des Oranje-Freistaates unternahm.
Nachdem ich meine Patienten besucht und ihren Zustand derart gefunden hatte, daß ich sie auf einige Tage verlassen durfte, brach ich am ersten Weihnachtstage in den ersten Stunden des Nachmittags bei einer wahrhaft tropischen Hitze von Dutoitspan auf, um mich mit der Thierwelt der den Horizont im Osten begrenzenden Höhen im Oranje-Freistaat bekannt zu machen. Welch' großer Contrast zwischen jetzt und einst! Unwillkürlich stieg die Erinnerung an die in der Heimat verlebten Abende der Weihnachtszeit vor meiner Seele auf; anstatt in der gemütlichen, warmen Stube die Feier des Tages zu begehen, schritt ich jetzt unter afrikanischer Sonnengluth dahin, ohne durch irgend etwas an die Weihe des Tages gemahnt zu werden. In meiner Gesellschaft befanden sich ein junger deutscher Kaufmann, der hier mehr als in der Heimat zu Ausflügen Muße fand, ein junger Pole aus Posen, den sein Hang zum Abenteuerlichen nach den Diamantenfeldern verschlagen hatte, und ein Fingo, der mit den Reise-Utensilien beladen, die Wohlthat eines Dampfbades im Freien zu genießen verurtheilt war. Ich und der junge Pole waren jagdgerecht bewaffnet.
Wir zogen anfänglich über eine mit niedrigen, kaum 12-18 Zoll hohen Zwergbüschen (Scapbusch) bewachsene Ebene, auf welcher nur hie und da die tiefer liegenden Einsenkungen das saftige Grün eines Rasens, die höheren mit Felsblöcken besäeten Partien hohes Gras zeigten, die weite Fläche war von einem ungezählten Heere von Insecten bevölkert, unter welchen uns verschiedene, schön gefärbte Species von Heuschrecken—manche mit hervorgehenden stacheligen Schildern wie gewappnet—in dichten Schaaren die Milkbüsche (Euphorbiacea) occupirend, besonders auffielen.
Die 2-3 Zoll langen Thiere mit ihrem walzenförmigen Körper, hell bis dunkelgrün gefärbten und roth umsäumten Flügeldecken saßen in großer Menge träge an den Büschen und fielen bei der Berührung anscheinend todt zur Erde nieder. Bei dem großen Heere ihrer Feinde aus der gefiederten Welt (vom Adler bis zur Wildgans herab) fiel mir ihre Menge und Verwegenheit, sich auf die exponirtesten Stellen der Büsche zu wagend schon auf meiner Reise von Port Elizabeth nach den Diamantenfeldern auf, hier wurde mir das Räthsel durch mein Geruchsorgan gelöst. Diese Heuschrecken sondern nämlich einen äußerst penetranten und übelriechenden Saft aus, von dessen »Parfüm« wir uns nur mit Mühe nach längerem Reiben der Hände mit Sand befreien konnten. Außer diesen Heuschrecken fanden wir mehrere Käferarten—einige Sandkäfer, zwei große Laufkäfer und an den Büschen in schönen metallisch schillernden Farben prunkende Blattkäfer. Die artenarme und von der Sonnengluth gedörrte Vegetation erklärte uns den Mangel an Tagfaltern, deren Stelle zahlreiche Mottenarten einnahmen.
Von Vierfüßlern beobachteten wir nur ein hellrothes Scharrthier (Rhyzaena) und ein Erdeichhörnchen mit seinen Gesellschaftern, den großen Spitzmäusen, am Rande ihrer unterirdischen Bauten hoch auf ihren Hinterfüßen aufgerichtet und neugierig die Ankommenden anblickend. Das Scharrthier leise knurrend, die Eichhörnchen mit einem schrillen Pfiff, verschwanden bei unserer Annäherung.
Von Vögeln fiel uns der bekannte, kleine südafrikanische dunkelgefiederte Steppenstaar auf, der sich auf die zahlreichen Termitenhaufen schwingt oder die Spitzen vereinzelt stehender Dornenbüsche aufsucht und neugierig den Fremden zu mustern scheint. Er ist ein dreistes und munteres Thierchen, welches oft die verlassenen Höhlen der Scharrthiere und Erdeichhörnchen bewohnt, und sich, wenn verfolgt, namentlich aber wenn verwundet, dahin flüchtet.
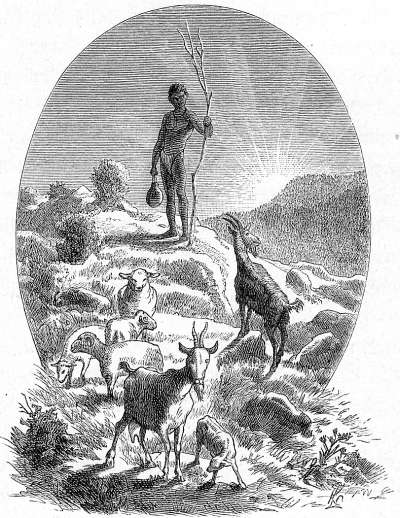
[Kaffer, Schafe hütend.]
Nach etwa 1½stündigem Marsche befanden wir uns am Rande einer jener kleinen viereckigen »Pfannen«, welche den Charakter der größeren, Süd-Afrika namentlich in seiner Längsachse charakterisirenden, seichten Salzseen zeigten. Nahe dabei befand sich (die Salzpfanne war trocken) eine kleine mit grünlichen. Wasser gefüllte Regenlache, deren Inhalt mit einem Löffel »Brandy« gemischt, genießbar war. Wir trafen hier auch einen Schafe hirtenden Kaffer, der, nachdem wir durch ein Stückchen Tabak seine Zuneigung gewonnen, uns über die weiter nach Osten liegenden Farmen belehrte; die sogenannte Krichofarm (auch Kuudu-place genannt) war die Stelle, die wir uns zu unserem Feldlager ausersehen hatten. Von hier wollten wir dann unsere Ausflüge nach den Höhen unternehmen.
Gegen Abend erreichten wir die ersten von Süden nach Norden sich erstreckenden Ausläufer der Freistaathöhen. Die Vegetation war hier schon üppig, wir fanden zahlreiche Büsche und die von den Diamantenfeldern als dunkle Punkte sichtbaren Stellen entpuppten sich uns als Kameeldornbäume, deren breite niedere Kronen und große, flache, graubewollte Samenschoten ihren Mimosen-Charakter verriethen. Seit der Zeit sind schon die meisten der Axt zum Opfer gefallen und in den Diggings zu Asche verwandelt worden. Was uns an diesen Bäumen, die bis zu zwei Schuh stark, den knorrigen Stamm mit dunkelgrauer zerrissener Rinde bedeckt, ein sehr hartes Holz liefern, auffiel, waren ihre bis drei Zoll langen und oft an ihrer Basis fingerstarken, je paarweise sitzenden, doch mit den Spitzen divergirenden Dornen und die an ihnen hängenden Vogelnester, von denen wieder zwei besonders erwähnenswerth waren. Es waren dies die Nester einer kleinen Kolonie von Siedelsperlingen (Philetaerus socius). Die Bauart dieser Nester ist eine höchst merkwürdige; haben diese Bienenfleiß entwickelnde Thierchen ein geeignetes Stämmchen gefunden und den Bau ihrer Nester begonnen, so verfertigen sie gemeinschaftlich das allen dienende Dach. Jedes Pärchen baut sein eigenes Nest aus trockenem Gras und bedacht es, aber eines so dicht neben dem andern, daß man nur ein einziges von einem großen, 2-5 Fuß Durchmesser und 1-3 Fuß Höhe haltenden Dache bedecktes Nest erblickt, zu dem von unten unzählige kreisrunde Löcher führen. Oft brechen die unter der Last dieser Nester sich biegenden Aeste, deren Kronen über das kegelförmige und steil abschüssige Dach herausragen. Obgleich die Eingänge zu diesen Nestern sich an der unteren Seite befinden und man doch denken würde, daß die munteren Thierchen durch ihr abschüssiges Dach nicht nur gegen Regenschauer, sondern auch gegen ihre Feinde geschützt wären, ist dies doch nicht der Fall; ich beobachtete, daß sich namentlich größere Schlangen, wie die Cobras, daran wagen, und habe selbst einige Jahre später einen solchen Räuber an einem Baume auf der Oliphantfontein-Farm erlegt, als er sich in einem Nestbau dieser Siedelsperlinge verkrochen und Verderben unter seinen Bewohnern angerichtet hatte. Die Vögel, welche die Schlange im Neste überraschte, waren von ihr gebissen und die Leichen herausgeworfen, die Jungen und die Eier verschluckt und die aufliegenden Eltern durch Fauchen verscheucht, die Muthigeren durch Bisse getödtet worden. Da ich durch einen Schuß nicht die vielleicht noch lebenden Jungen in den Nestern tödten wollte und auch nur den Schwanz der Schlange sah, brachte ich sie durch einen wohlgezielten Steinwurf zur Erde, um dann der davon Eilenden mit einem Doppelschusse den Garaus zu machen.
Am Abend nachdem wir die Ausläufer der felsigen Höhen erreicht hatten, befanden wir uns auf einer bis zu den gegenüberliegenden, etwa drei englische Meilen entfernten Höhen reichenden Grasebene. Unter einer nahen felsigen Erhebung standen zwei Zelttuchhäuschen, in denen ein Eingeborner eine kleine Cantine hielt, ein Beweis, daß wir auf den von den Diamantenfeldern nach dem Freistaate führenden Weg gestoßen waren. Aus einer nahen umfriedeten und bebuschten Stelle schlug das Meckern einiger Ziegen an unser Ohr.—Ein Geschenk von einigen österreichischen Zigarren billiger Sorte zauberte auf das Gesicht des Cantinenwirthes ein freundliches Lächeln und rief in seiner Seele eine wohl seltene Anwandlung von Freigebigkeit wach, denn als Gegendienst bewirthete uns der krausköpfige Schwarze mit Brandy, denselben vorsichtig in kleinen Gläschen credenzend. Ein befriedigendes Schmunzeln, mit dem er wieder in's Häuschen zurücktrat, überzeugte uns, daß er sich nicht zu viel zugemuthet und sein Vorrath an Brandy durch die eben bewiesene Gastfreundschaft nicht sehr gelitten hatte. Die Freigebigkeit unseres Wirthes brachte auch das Gespräch etwas in Fluß und bald zeigte er sich noch freigebiger, als er erfuhr, daß ein Farmer, den ich in den Diamantenfeldern behandelt hatte, und den er kannte, auf der Krichofarm wohne. Er glaubte wohl sich seinem Freunde erkenntlich zu zeigen, wenn er dessen Arzt in seinem kleinen Heim bewirthete. Seinen uns anstaunenden, im tiefen Negligé und barfuß erschienenen Kindern bedeutete er, den Fremden eine Christmaßboox zu bieten. Wir alle verstanden jedoch nicht, was er damit meine, bis die beiden größeren Knaben, mit drei Tassen schwarzen, duftenden Kaffee's und einem Teller Kuchen erschienen, eine Gabe, die von uns dankbar angenommen wurde. Nach dem Kaffee lud uns unser Wirth ein, die Nacht in seinem Häuschen zuzubringen, doch ich wollte noch desselben Tages an Ort und Stelle sein und so dankten wir herzlich für die Christmaßboox und die Bewirthung und setzten durch tiefen Flugsand watend, unsern Weg fort. Es war dunkel und deshalb gewagt, quer durch das hier dicht bebuschte Thal zu schreiten, das viele Schlangen zu beherbergen schien.

[Trunk aus einer Sumpflache.]
Spät Abends langten wir bei der Krikofarm an, ich entschloß mich im Freien zu übernachten, und da wir auch sehr durstig geworden waren, folgten wir dem Schimmer eines kleines Wassers, der uns zu einem halb ausgetrockneten Teich brachte, und wählten uns nahe an demselben eine ebene Uferstelle zu unserem Nachtlager aus. Unser Nachtimbiß war bald fertig, die tagsüber erlegten rothfüßigen Kibitze, sowie einige kleinere Trappen (eine von den Boers Patluperken genannte Art) mundeten nicht minder wie eine Tasse Thee, zu welcher wir das Wasser aus dem Teiche genommen hatten; bei Tage hätte uns wohl nur der peinlichste Durst dazu gebracht, dieses Wasser zum Munde zu führen, denn es schillerte im Feuerschein in allen Farben des Regenbogens und wurde selbst von den Rindern der Farm verschmäht.
Während wir um das Feuer sitzend die Erlebnisse des Tages besprachen, wurden wir durch den Besuch dreier Korannas beehrt. Vom Feuer angelockt, waren sie von dem etwa 100 Schritte entfernten Farmhause herangekommen und mochten uns wohl für arbeitsuchende Basutos (ein im Westen vom Oranje-Freistaat wohnender Eingebornenstamm) halten, die sich hier ein Nachtlager ausgesucht. Sie wunderten sich nicht wenig Weiße hier campiren zu sehen. Bald nachdem uns die neugierigen Besucher verlassen und das Gekläffe der Farmhunde verstummt, herrschte in unserer Umgebung tiefe Stille, nur durch das monotone Zirpen einer kleinen Grillenart unterbrochen. Nach so vielen in der Staubatmosphäre von Dutoitspan verlebten Tagen waren wir froh, hier in frischer, gesunder Luft zu athmen, und waren bald in tiefen Schlaf versunken.
Zeitlich des Morgens durchstöberten wir die nächste Umgebung der Farm. Dieselbe liegt in einem breiten Thale, in welches, nahe der Farm, einige Querthäler münden, die von den isolirten Hügelketten gebildet sind. Diese Höhen fallen ziemlich steil, oft sogar perpendiculär ab und zeigen Riesenblöcke der Trapdykes. Es that unserem Auge wohl, an den Abhängen dieser Hohen eine ziemlich reiche Vegetation zu finden, selbst die flachen Kuppen waren mit kleinen, baumartigen Mimosen bewaldet. Außer einer Menge gestreifter Mäuse fanden wir keine Säugethiere, dagegen eine Menge Turteltauben, Kibitze, Wiedehopfe, langschwänzige, weiß und schwarz gescheckte Würger, die gemeinen braunen Aasgeier oben auf den Felsen hockend, die von ihrem Unrath so weiß getüncht waren, daß man diese Stellen 15 englische Meilen weit erblicken konnte, ferner kleine Rothfalken und schöne braune Gabelweihen, uns die günstigste Gelegenheit bietend, unsere Jagdtasche zu füllen und den Mittagstisch mit manch' leckerem Bissen zu versorgen. Auch unsere Spiritusflaschen füllten sich mit Fröschen, Chamäleons, Eidechsen, riesigen Spinnen und zahlreichen Insecten. Zu unserem Lagerplatz zurückgekehrt, trafen wir den Farmer. Meine Frage, wie wohl den die Höhen bevölkernden Pavianen beizukommen sei, ließ ihn sehr gesprächig werden.
»Hier,« meinte er, »hausen in der Nachbarschaft zwei Pavianheerden, eine kleinere und scheuere geht in der Regel Vormittags in der nahen Bergschlucht zur Tränke, die große Heerde wagt sich täglich an den zweiten Teich in unserer Nähe.« Der Farmer klagte nun sein Leid über die Frechheit dieser Affen; sie waren eine große Plage, denn kaum, daß sie durch ihre auf den Felsen ausgestellten Wachen entdeckten, daß Feld und Garten verlassen waren, so war die Heerde auch schon bald über den Zaun eingebrochen und der Garten verwüstet, besonders schädlich aber wurden sie den weidenden Schafen. Geschah es, daß der hütende Hirt auch nur für kurze Zeit eingeschlafen, oder die Thiere aus einem anderen Grunde unbewacht blieben, so konnte der Farmer gewiß sein, einige Lämmer mit zerrissenem Körper zu finden. Die Paviane folgen den Thieren auf den Höhen, während die Schafe im Thale weiden und stürzen, sobald sie selbe unbeschützt sehen, auf sie herunter und reißen mit ihrem furchtbaren Gebiß den Thieren den Bauch auf, um zu dem Milchinhalt des Magens zu gelangen; haben sie diesen entleert, so lassen sie die zuckenden Körper liegen, um dasselbe an anderen der blöde hin- und herrennenden Lämmer zu versuchen. (Ich fand dies später oft bestätigt.) Nun begriffen wir wohl des Farmers zufriedenes Schmunzeln, als er unser Vorhaben, einige der Thiere zu erlegen, erfuhr. Des Farmers Redseligkeit bewog mich, ihn über die weiteren Absichten bei dieser Jagd zu unterrichten, daß ich gerne einige schöne Bälge zum Ausstopfen und einige Kopfskelette erlangen wollte. Diese Mittheilung machte ihn stutzen. Etwas ähnliches hatte er doch noch nicht vernommen »Allmachtag (Allmächtiger) wat will ye dun?«[1] und kopfschüttelnd ging er zu seiner Frau, um ihr das »wonderlijke« Vorhaben des »albernen« Doctors mitzutheilen, der einen »Babuin« todtschießen und das Fell, ja sogar das Kopfskelett nach »Duitsland« schicken wollte.
1 Das in der Regel von den Farmern gesprochene Holländisch in Süd-Afrika ist nicht das reine Holländisch, wie wir es in Europa hören, sondern ein Gemisch von vielen Sprachen, englisch, plattdeutsch, französisch etc., dagegen sprechen die gebildeten Holländer der Capstadt, in Bloemfontein und in der Nachbarschaft anderer Städte ein sehr reines Holländisch.
Viele der Freistaatfarmer sind einfache, gute, oft wahrhaft herzensgute Leute, denen nur die nöthige Bildung fehlt, um sie als beständige Gesellschafter zu wünschen. Ich habe nie dankbarere Patienten gekannt als sie.
Gegen die Mittagsstunde verließen wir die Farm und brachen nach den Felsenhöhen im Osten derselben auf, um noch zur Tränkezeit der kleinen Heerde auf dem Platze zu sein. Wir passirten einige von Korannas und Basutos, Dienern des Farmers bewohnte Hütten. Die Basutos kommen von ihrem im Osten gelegenen Lande und verdingen sich mit ihren Frauen an die Farmer, sie werden jährlich mit einer bestimmten Anzahl von Schafen, ein oder zwei Kühen und Ochsen, hie und da auch noch mit einer Mähre oder einem Fohlen bezahlt und bekommen nebstdem die nöthige Nahrung; außerdem wird ihnen gestattet, sich nach einem fruchtbaren Stück Land umzusehen, wo sie sich Korn (Sorghum-Art), Mais, Kürbisse, Tabak etc. anbauen können. Auf meinen späteren Reisen beobachtete ich, daß namentlich wohlhabende Farmer, wie Mynheer Wessels, auf dessem Gebiet auch jene auf unserem Marsche berührte Cantine lag und dessen Farmen einen Umfang von mehreren Meilen hatten, von welcher Fläche aber nur etwa 1/36 angebaut war, mehrere kleine Basutodörfer ihr eigen nennen, deren Bevölkerung sich in der obbeschriebenen Weise auf mehrere Jahre verdingt. Es sind meist mittellose Leute aus dem dicht bevölkerten Basutolande am Caledon-River, welche durch jahrelange Trockenheit um alle ihre Ernte-Erwartungen gebracht, genöthigt waren, aus der Heimat auszuwandern und günstigere Gebiete aufzusuchen.
An der Bauart der Hütten konnten wir sofort den ethnographischen Unterschied zwischen beiden Stämmen deutlich wahrnehmen; während die Hütten der Basuto's, aus Baumästen in cylindrischer Form (circa 3 Meter im Durchmesser haltend) gebaut und von einem kegelförmigen Dache bedeckt, das auf dünnen Pfählen ruhte und mit dürrem Grase überdeckt war, hatten die Koranna's halbkugelförmige Hütten, welche aus dürren Aesten erbaut und mit Matten lose überdeckt waren.
Wir hatten die Ehre, von einer der schwarzen Damen gemustert zu werden; sie war vor den Zaun getreten und blos mit einem grauen kurzen Kaliko (Unterrocke) bekleidet. Stirn, Wangen und die Brüste waren mit einem bläulich-schwarzen Ocker mit Wellenstrichen bemalt; an einer der Korannahütten stand ein europäisch gekleideter Mann, dem eben ein ältliches Weib, ebenfalls in schmutzige europäische Fetzen gekleidet, aus der Hütte einen mächtigen Feuerbrand brachte. Ich war neugierig, was sie wohl damit thun wolle, und siehe, er blieb ohne eine Miene zu verziehen, gleichgiltig vor sich hinstarrend stehen, die ältliche Frau jedoch hob das brennende Holz, von dem eine wahre Rauchsäule emporwirbelte, auf, legte die glühende Spitze desselben sachte an ihres Mannes kurze Pfeife, der nun mit seiner Rechten nachzuhelfen sich bemühte. Hervortretend fragte ich nach dem besten Aufgang auf die Höhe und erhielt von dem braungelben Phlegmatiker eine artige, meinem Ansuchen entsprechende Antwort. Eine halbe Stunde später erreichten wir die Kuppe der Höhe, die eine mit Busch bewachsene, wellenförmige, mit Steinblöcken besäete Ebene bildete. Nachdem wir sie in ihrer Länge von Süden nach Norden durchschritten und uns der vom Farmer erwähnten Schlucht genähert hatten, vernahmen wir von dem gegenüber liegenden Abhange derselben, etwa 300 Schritte vor uns, ein heiseres, mehrstimmiges Gebelle. Hinblickend sahen wir sieben, darunter vier erwachsene Paviane mit Sprüngen die Höhe erreichen, auf der kleinen Tafelebene noch einmal nach uns umsehen und dann wieder in einer weiter rechts liegenden Schlucht verschwinden. Wir folgten ihnen rasch, erkannten auch an den frischen Spuren am Boden der Schlucht, daß sie erst vor kurzem die Tränkstelle verlassen haben mußten. Um nicht die größere Heerde zu versäumen, folgten wir der Schlucht, die in unser Thal mündete, füllten auch unsere Waidmannstaschen mit einigen Taubenpaaren, die am Feuer geröstet, uns einen guten Imbiß lieferten.
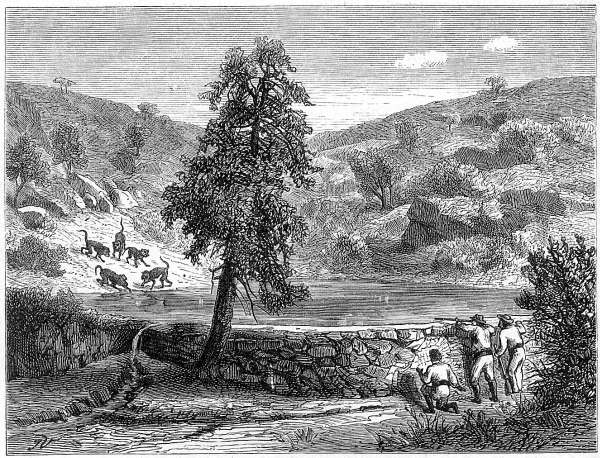
[Pavianjagd.]
Während wir beim Mahle saßen, ließen wir alle unwillkürlich die Blicke auf die zu beiden Seiten und vor uns liegenden Abhänge schweifen, um vielleicht einen der gesuchten Vierfüßer zu erspähen, allein vergebens. Da erscholl plötzlich ein lautes Geschrei von der Farm her, welches sich uns zu nähern schien, allein bald verstummte. Gegen diese hin standen hohe Mimosenbäume, zwischen denen nur durch eine schmale Lichtung ein Theil des Hauses sichtbar wurde, rechts von uns erhob sich der etwa 12 Fuß hohe steinerne Damm des Teiches, an dessen Ufer wir campirt hatten, so daß uns von unserem Standpunkte aus der Blick über die Ursache des Geschrei's nicht belehren konnte. Scherzweise warf ich hin, daß, während wir uns hier gütlich thaten die Paviane wohl die Mittagszeit benützend, dem Farmer einen Besuch abgestattet haben konnten. Ich hatte kaum ausgesprochen, als ich aufbringend auf die etwa 250 Schritte von uns entfernte Höhe zur Linken wies. »Seht, ist das nicht ein Affe?«—und richtig ein Pavian, ein zweiter—eine ganze Heerde lief den Abhang hinan, allein nicht sehr eilig und von Zeit zu Zeit auf einem Felsblock hocken bleibend; am Fuße der Höhe erschienen schon die Leute, der Farmer und die farbigen Diener mit Knütteln und Stocken bewaffnet und laut schreiend. In einem Nu waren wir unter der Höhe, bogen etwas nach rechts, wohin sich auch die Affen, den höheren Partien zustrebend, zu wenden schienen und meine Gefährten zur Vorsicht mahnend, stiegen wir empor. Ich schlug vor, in stille wie möglich uns aufwärts zu bewegen, damit die Aufmerksamkeit der Thiere sich auf die übrigen, ungefähr 200 Schritte mehr zur Linken langsam emporklimmenden, laut schreienden Verfolger richten möge.
Da der eine meiner Gefährten nur mit einem Schrotgewehr, der andere nur mit einem Stock bewaffnet war, hieß ich beide, in meiner Nähe bleiben, um ihnen, im Nothfalle beistehen zu können, denn ein erzürnter, erwachsener Pavian ist als Feind gefährlicher als ein Leopard. Wir hatten bereits den Abhang zur Hälfte erstiegen und noch immer war keiner der Flüchtigen zum Schuß gekommen. Endlich erschien einer über mir, doch hoch oben von Block zu Block springend, bald deckte ihn ein Busch, bald ein Felsen, so daß kein Schuß mit Erfolg anzubringen war. Das Thier verschwand als es die Höhe erreicht hatte und wir mußten, höher klimmend, trachten, es noch auf der flachen Kuppe zu treffen, oder vielleicht einen seiner Genossen zu erspähen. Meine Hoffnung wurde nicht getäuscht, denn schon 40 Fuß höher entdeckte ich ein erwachsenes Weibchen. Doch alle Mühe, zum Schuß zu kommen, war vergebens, einmal stand der schwarze Diener des Farmers mir in der Schußlinie, und die zweite günstige Gelegenheit verdarb mein Gefährte, der, als sich das Weibchen uns bis auf fünf Schritte genähert hatte, mit lautem Schrei in die Höhe sprang und damit das Thier in die Flucht jagte. Obwohl wir athemlos die steile Höhe emporklommen, um das Thier nicht gänzlich aus dem Auge zu verlieren, war es zu spät. Auf der Kuppe angelangt, war nirgends mehr eine Spur von den Affen zu entdecken.
Wir stiegen herab, gewiß nicht in der rosigsten Laune und gaben nicht allein jeden Gedanken auf, noch am selben Tage einen Pavian zu sehen, sondern hatten auch nicht die geringste Ahnung, daß uns mit derselben Heerde noch ein ähnliches Mißgeschick begegnen würde. Unten angelangt, hörten wir nun von den Koranna's, daß die Paviane einen Versuch gemacht hatten, in den Schafkraal (Umzäunung) zu gelangen, zu dem einige blökende Lämmer die Affen hingezogen hatten. Sie wurden jedoch zeitig bemerkt und damit sie ihren Raubzug nicht zu bald wiederholten, nicht nur verscheucht, sondern auch verfolgt. Man versicherte uns jedoch, daß sie gewiß noch einmal zur Tränke an den andern, uns schon früher bezeichneten nahen Teich kommen würden; alle Müdigkeit war bei dieser Nachricht vergessen und wir begaben uns sofort auf die bezeichnete Stelle. Ein kleiner von Regenwasser gefüllter Teich lag im Thale, zur Linken, etwa 300 Schritte entfernt zogen sich die Höhen hin, die wir eben verlassen hatten, zur Rechten, ihnen gegenüber, in der Entfernung einer Meile eine zweite Reihe von Höhen. Der Teich war an drei Seiten eingedämmt, nach dem Hause zu war der Damm aus Steinen errichtet und lag der freien Einflußstelle des Wassers gegenüber. Diese Stelle war sandig, zur Linken bildete das trübe, gelbliche Wasser eine kleine Bucht, zur Rechten fiel dem Beschauer ein dichtes, niederes von der schon erwähnten strauchartigen Euphorbia gebildetes Gebüsch auf. An der Sandseite des Dammes wuchsen aus den Steinspalten einige Sträucher hervor. Hinter einem derselben, ihn als Deckung für den Kopf benützend, hatte ich Stellung genommen.
Wir hatten kaum unsere Stellungen bezogen, als uns der Knabe des Farmers auf zwei dunkle auf dem Abhange des Hügels zur Rechten sichtbar werdende Punkte aufmerksam machte; in der That konnten wir eine größere Anzahl beweglicher dunkler Körper wahrnehmen. Sie bewegten sich bergab und als sie auf etwa 900 Schritte nahe gekommen waren, erkannten wir die Pavianheerde. »Sie kommen zum Wasser!« meinte der Knabe. Zu unserer Verwunderung schienen sich die Affen nicht von der Stelle rühren zu wollen, es verging eine Viertel-, eine halbe Stunde und noch immer war der Haufen auf derselben Stelle—da auf einmal, wie aus der Erde herausgezaubert, erschienen uns gegenüber an dem freien Ende des seichten, kaum 60 Schritt langen Teiches zwei riesige Männchen, keiner unserer Gesellschaft hatte ihre Annäherung beobachtet, ob sie in einem Bogen quer über das Thal oder durch das Gras geraden Weges von der Heerde zu uns gekommen waren, konnten wir uns nicht aufklären. Da ich die Thiere beobachten und mich dessen vergewissern wollte, ob sie zu jener Heerde, die unter den niedrigen Mimosenbäumen spielte, gehörten, kam ich von dem Entschlusse, sofort eines der Thiere zu erlegen, ab und wartete mit Spannung der weiteren Dinge. Nun sprangen sie vom Damme zum Wasser, beugten sich nieder und tranken; sich wieder emporrichtend, verließen sie recht gravitätisch auf allen Vieren einherschreitend das Wasser und schlugen die Richtung nach der Heerde ein; sie gehörten ihr also thatsächlich an und waren die ausgesandten Kundschafter. Zu den Ihren gekommen, setzte sich die ganze Truppe sofort in Bewegung; kurze Zeit darauf waren schon alle am Teiche. Da gab es Mütter mit Säuglingen und halb erwachsenen Thieren, der erwachsenen Männchen nur drei oder vier. Die Thiere kamen einzeln heran, tranken und kehrten unverweilt zurück; nachdem etwa zehn in dieser Weise ihren Durst gelöscht hatten, kamen mehrere auf einmal, während die übrigen sich auf dem Sande ringsum mit Sprüngen und Herumrollen ergötzten. Bald wären wir jedoch um alle weiteren Betrachtungen gekommen, denn vom Hause her näherten sich zwei Korannafrauen, Töpfe auf den Köpfen tragend, um Wasser aus dem Teiche zu holen, an dem wir lagen. Durch Gesticulationen hielten wir glücklicher Weise die Frauen ab, näher zu kommen, allein es war auch die höchste Zeit, zum Schusse zu kommen. Eben waren, wie ich mir einbildete, dieselben Männchen, welche so geschickt das jenseitige Ufer ausgekundschaftet, zum zweiten Mal an's Wasser getreten, sie setzten sich auf jede Seite der kaum zwei Fuß hohen Einbuchtung und beugten sich mit dem Vorderkörper zum Saufen nieder. Diesen Moment wollte ich benützen, um mein Glück zu versuchen. Wie wir später an den Spuren ersahen, hatten sich die beiden Thiere so gegeneinander vorgebeugt, daß blos ein Raum von nicht ganz vier Zoll zwischen den gesenkten Köpfen frei blieb. Da donnerte meine Büchse—wie wir uns später überzeugten, hatte die Kugel, zwischen den Köpfen der Thiere durchfliegend, etwa drei Fuß hinter denselben eingeschlagen. Hoch sprangen sie beide auf, wie auf ein Tempo mit den Händen nach der Schnauze greifend, und unmittelbar darauf eilte die ganze Heerde bellend, die größeren Thiere etwas zurückbleibend und sich oft umdrehend, von dannen.——Obgleich wir bis zum Abend liegen blieben und sogar unser Nachtlager hierher verlegten, sahen wir nichts mehr von den Affen, deren heiseres Gebell wir noch die halbe Nacht hindurch von den Bergen herab deutlich vernahmen. Wir blieben noch einen Tag, allein die Thiere, die uns von den Höhen bemerken konnten, behielten uns im Auge, und wollten sich von den Felsenhängen, wo sie Herren der Situation waren, nicht herabwagen.
Meine Begleiter waren in der dem mißglückten Jagdtage folgenden Nacht in tiefen Schlaf versunken, während mich das Gebell der Paviane in steter Spannung erhielt. Allein außer ihren heiseren Tönen konnte ich auch nichts Anderes vernehmen. Selbst der leise Wind war eingelullt und ließ von seinem Spiele mit den zarten Blüthen der Mimosen ab. Solch' stille Nächte—unter südafrikanischem Himmel—üben auf den Fremden einen mächtigen, lange hin nachklingenden Reiz aus. Die Atmosphäre war rein, der Himmel so dunkel und zwischen ihm und der Erde unzählige Wölkchen in solch' lebendigen Schattirungen zwischen milchfarben und grau, daß ich mich nicht entsinnen konnte, je etwas Aehnliches zuvor beobachtet zu haben.
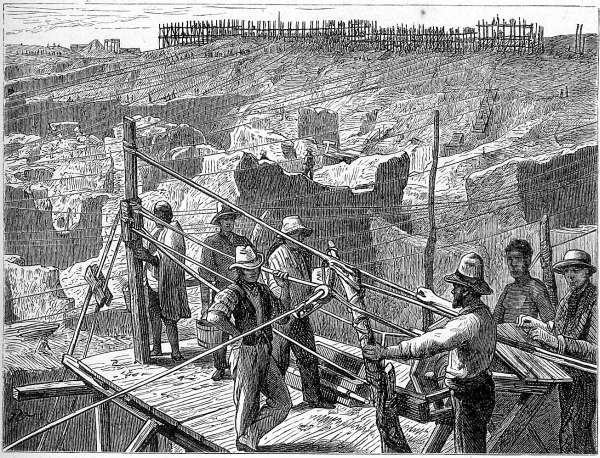
[Die Kimberley-Kopje im Jahre 1872.]
Nach den Diamantenfeldern zurückgekehrt, nahm ich wieder meine Berufsthätigkeit auf, die immer ausgebreiteter wurde, und es mir erlaubte, zur Verwirklichung meiner weitgehenden Pläne manches Pfund Sterling bei Seite zu legen. Nachdem ich schon im Laufe des Jänner mir einen der bekannten Wagen angeschafft hatte, also im Besitze des wichtigen Reisemittels war, hielt ich zu Beginn des Februar 1873 die Zeit für gekommen, um meine erste größere Reise, gewissermaßen eine Recognoscirung, zu unternehmen.
Von Dutoitspan nach Lekatlong.
Meine Reisebegleiter.—Schwierigkeit der Beschaffung geeigneter Zugthiere.—Aufbruch aus den Diamantenfeldern.—Trostloser Zustand der Wege.—Südafrikanischer Vorspann.—Old de boers-Farm.—Bismark's Retreat.—Der Vaal-River und sein Thal.—Ein Besuch im Korannadorfe bei Pniel.—Bauart der Korannahütten.—Sociale Zustände unter den Koranna's.—Vorschläge und Mittel zur Besserung derselben.—Freimaurerthum unter den Koranna's.—Ein gefährlicher Nachtmarsch zum Vaal-River.—Klipdrift.—Racenunterschiede zwischen Koranna's und Betschuana's.—Das Innere der Korannahütten.—Die River-Diggings am Vaal.—Die Fauna des Vaal-Thales.—Eine Krankenordination in Klipdrift.—Gong-Gong, Waldeks-Plant und der Fly-Diamond.—Eine desolate Strasse.—Die Holitzer Schlucht.—Die Cobra capella und ihre Gefährlichkeit.—Ringhalsschlangen.—Im Schlamme des Vaal River Versunken.—Ankunft in Lekatlong.
Meine Vorbereitungen waren beendet, die Ausrüstung besorgt; es blieb mir nur noch die für Reisen in Afrika wichtige und folgenschwere Wahl meiner Begleitung zu treffen. Von der Idee, mich blos mit eingebornen Dienern zu umgeben, kam ich bald ab und entschied mich in Begleitung von Weißen zu reisen. Meine Wahl fiel auf jene beiden jungen Männer, deren ich eben vorher auf meinem Ausflüge nach dem Freistaate erwähnte und als dritten Gefährten lud ich Herrn Friedrich Eberwald aus Thüringen ein, einen biederen Charakter, der später einer meiner herzlichsten Freunde wurde und mir auch auf der zweiten Reise treu zur Seite stand. Ein unwiderstehlicher Drang, fremde Länder mit eigenen Augen zu schauen, hatte ihn, nachdem er einen großen Theil von Europa, Kleinasien, Nord- und Südamerika gesehen, nach den Diamantenfeldern geführt, um hier sein Glück als Diamantengräber zu versuchen, doch war ihm dieses nicht besonders günstig. (Ich kam auch nach meiner letzten Reise mit ihm zusammen und bat ihn, mit mir nach Europa zurückzukehren, doch vergebens.)
Vor meiner Abreise galt es noch, jedem meiner Begleiter sein specielles Arbeitsressort zu bestimmen; mein Freund Eberwald legte sich die freiwillige Pflicht auf, uns, so weit es mit dem Schrotgewehr anging, mit Wildgeflügel zu versorgen und über den Wagen zu wachen. K., der zweite meiner Gefährten nahm die Küche auf sich, während der dritte, F., mir im Jagen und Sammeln behilflich sein sollte. Diesen letzteren hoffte ich mir zu einem steten Begleiter für künftige Reisen heranzubilden. Meine Mühe scheiterte jedoch an seinem ganzen Wesen; nicht nur, daß er sich gänzlich unfähig zeigte, er war auch böswillig und blieb verstockt—und obwohl ich mich von seinem Charakter bereits auf der ersten Reise überzeugt hatte, ließ ich mich verleiten, ihn auf der zweiten Reise mit mir zu nehmen, auf welcher er alle meine Geduld mit schwärzestem Undank lohnen sollte.
Der Zweck der ersten Reise war, mich durch einen mehrwöchentlichen Aufenthalt im Freien dem afrikanischen Klima anzupassen, einen Begriff vom Reisen im Innern zu gewinnen und namentlich durch eine solche Versuchsreise den Umfang der Ausrüstung für eine größere Forschungsreise nach dem Innern kennen zu lernen. Die endlich zur Abreise anberaumte Frist war schon verflossen, allein mein Wagen konnte sich noch immer nicht von der Stelle rühren. Man rieth mir, Ochsen als Gespann zu wählen, ich jedoch dachte einen Versuch mit jenen stillen, selbstzufriedenen Geschöpfen zu wagen, welche schon im grauen Alterthume durch mehrere ihres Gleichen, wie jenen, der durch Bileam's »Dressursinn« sprechen lernte, hochgeehrt waren und in dieser Absicht durch die Behauptung der Eingebornen bestärkt, daß die südafrikanische Race »tsetsefest« sei. Ich fand unter meinen Patienten einen im Besitze von zwölf solchen Stilldenkern und schloß den Kauf ab, 3 £ St. per Stück. Als jedoch der Tag der Abreise kam und wir auf den Farmer warteten, erschien er nicht, auch nicht den folgenden, sondern erst den dritten Tag und nun erst mit der traurigen Nachricht, daß sich seine zwölf »Grubh« in ihrem Wissensdrang nach neuen (newe d.h. frisch) Kräutern und Gras verlaufen hätten. »Vergebens habe ich sie überall gesucht und, heute heimgekehrt vernommen, daß sie etwa 30 Meilen von hier in der »Pound« seien.« To keep in Pound heißt das Recht, aufsichtslose Hausthiere, vom Pferde bis zur Ziege, wenn diese von dem Besitzer einer Farm auf seinem Grund und Boden angetroffen und von diesem an dazu gesetzlich bestimmte Stellen, d.h. Farmen, abgeliefert wurden—auf einen Monat zu behalten und zu überwachen. Eine solche Farm heißt eine Pound, der dazu gesetzlich bestimmte Farmer ist ein Poundmaster. Werden die so eingebrachten Thiere, die in den Districtsblättern genau beschrieben werden, nicht binnen vier Wochen (vom Tage des Einfangens) von ihrem rechtmäßigen Besitzer gegen Entrichtung eines verhältnißmäßig geringen Betrages ausgelöst und abgeholt, so werden sie in einer öffentlichen Auktion, die vom Poundmaster gehalten und in den Districtsblättern annoncirt wird, feilgeboten. Der Ertrag kommt dem Staatssäckel zu Gute.
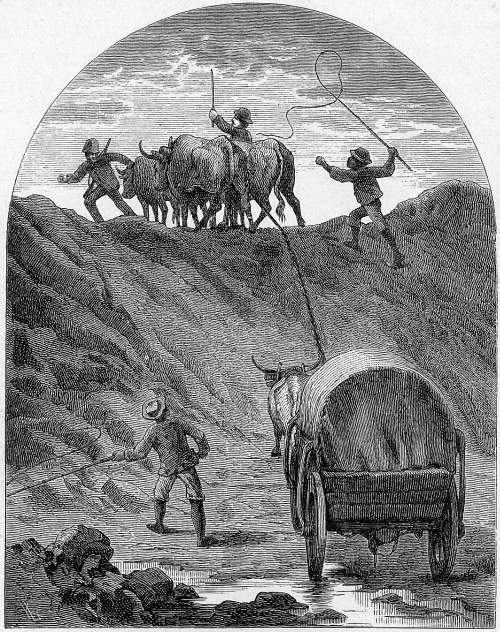
[Vorspann in Süd-Afrika.]
Es blieb mir nun nichts übrig, als mich nach einem behörnten Gespann umzusehen, machte hierbei jedoch die Erfahrung, daß es unmöglich war, sofort gute Zugthiere zu erlangen und ich hätte einige Wochen auf solche warten müssen. Dies war noch schlechter, es blieb mir also keine andere Wahl, als mich mit Pferden zu versehen, trotzdem der Preis eines Pferdegespanns das Zweifache eines Ochsengespanns betrug und es angesichts des herannahenden ersten Reifes, zu welcher Zeit eine bösartige Pneumonie in Süd-Afrika alljährlich Hunderte von Pferden vernichtet, sehr gewagt war, Pferde zu nehmen. Da F. prahlte, ein geübter Rosselenker zu sein, nahm ich mir vor, ihm nicht allein das Lenken des Gespanns, sondern auch dessen Ankauf zu übergeben. Allein der Preis, den man für die Pferde forderte, überstieg meine Berechnungen und ich wäre gezwungen gewesen, meine Reise doch noch aufzugeben, wenn mir nicht mein Gefährte K. mit der nöthigen Summe ausgeholfen hätte.
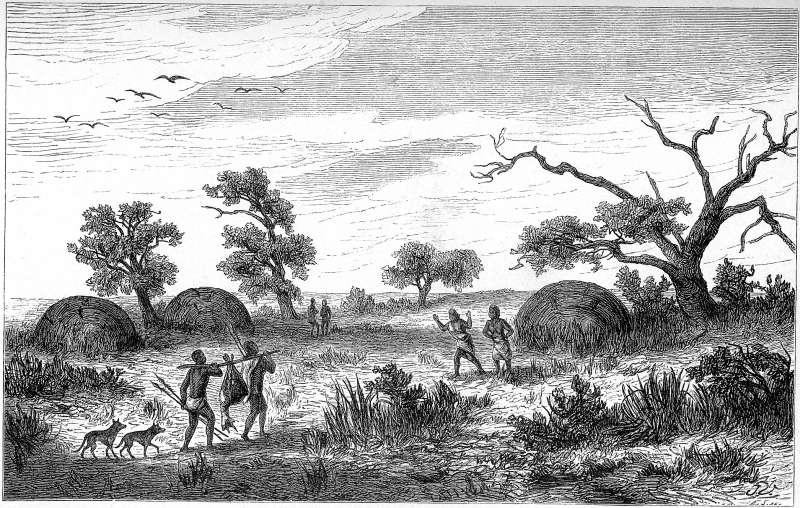
[Korannagehöfte im Hart-Riverthale.]
So schieden wir denn—vier Weiße mit fünf Pferden und fünf Hunden auf einige Wochen aus der staubigen Atmosphäre der Diamantenfelder. Ich wollte mich direct nach Klipdrift begeben und im Thale des Vaalflusses abwärts bis zu der Mündung des Hart-River, sodann im Thale des Hart-Rivers nach Nordost vordringen, um einige der Batlapinenstämme kennen zu lernen und nachdem ich diesen Zweck erreicht, in mein neues Heim zurückkehren. Der mir berichtete schlechte Zustand der einzigen Straße nach Klipdrift und mein Sammeleifer bewogen mich, querfeldein über die bebuschte Ebene zu reisen. Wir schlugen daher eine nordöstliche Richtung nach der Riet-Farm, einer der von allen Seiten die Diamantenfelder umgebenden Pounds, ein. Diese ist wie die meisten der übrigen, ein höchst unbeholfen aussehendes, viereckiges Farmhaus, an das ein ebenso einfacher Wagenschuppen angebaut war; ein aus Dornbüschen gebildeter Kraal für die eigenen und eingefangenen Thiere zur Linken war Alles, was von der einst blühenden und durch die Entdeckung der Diamantenfelder im Werthe so hoch gestiegenen Farm übrig geblieben war. Nicht ein Stückchen Garten war zu sehen; unsere Aufmerksamkeit erregten nur zwölf gezähmte, junge Strauße, welche den sie beaufsichtigenden Korannajungen willig folgten.[1]
1 In den letzten Jahren hat sich die Straußenzucht in Süd-Afrika so bedeutend gehoben, daß man gegenwärtig wohl über 100.000 Strauße in den Colonien hält.
Auch in der eben eingeschlagenen Richtung zeigte sich der Boden derart aufgeweicht, daß kaum an ein Fortkommen zu denken war; wir schlugen deshalb die Richtung nach Westen gegen die Old de boers-Farm zu, ein. Neues Mißgeschick! Auch hier stand das Land unter Wasser, nur ein schmaler Streifen am Fuße eines, einen künstlichen Teich umsäumenden Dammes schien passirbar; nahe gekommen, fanden wir selbst diesen Engpaß morastig. Mit vereinten Kräften gelang es, das Gefährt bis zur Mitte des Weges zu bringen, hier aber versanken die Räder bis zur Achse im morastigen Grunde und alle weiteren Anstrengungen waren nutzlos. Selbst als eine diese Strecke passirende Frau uns das Gespann ihres Karrens zur Hilfeleistung überließ, konnten wir keinen Erfolg erzielen. Ermüdet gaben wir jeden weiteren Versuch auf.
Auf einer etwa 50 Schritte vom Wagen entfernten freieren, aber leider nassen Sandstelle, breiteten wir unsere Decken aus und schlugen unser Nachtlager auf. Von Schlaf war keine Rede, ein leiser Regen, ein kalter durchdringender Wind und unzählige Mosquito's hielten uns die ganze Nacht wach. Wie es aber so oft geschieht, daß man über das Unglück eines Armen, trotz der eigenen erlittenen Unfälle noch lacht und spöttelt, so geschah es am Morgen des nächsten Tages dem armen F., als wir sein Antlitz von vielen Insectenstichen verunstaltet sahen. Das Gesicht stellte eine einzige dunkelrothe mit zwei feuerrothen Wülsten (den Lippen) geschmückte Kugelfläche vor, an der man von der Nase nicht viel, statt der Augen blos zwei Spalten bemerkte.
Eine sehr schwache Lösung von Salmiakgeist brachte Linderung und zu Mittag war er bereits wohlauf. Vier prächtige Ochsen und zwei Diener aus der nahen Farm, deren Besitzer uns schon tagsvorher Hilfe zugesagt hatte, stellten sich gegen Mittag beim Wagen ein und bald war derselbe aus dem »Modder« befreit. Kaum dieser Misère glücklich entronnen, fing der Himmel durch ein von Westen heranziehendes Gewitter sich zu verdunkeln an und wir mußten eilen, um noch vor dem Sturme die nahe Old de boers-Farm zu erreichen. Als wir eben die steinige Farmhöhe hinanfuhren, da brach das Ungewitter über uns herein und bald darauf begegnete uns schon ein gelblicher Strom, der von der Ebene herabfließend, den Weg als Abflußgraben benützte, und uns zum Stillstand nöthigte. Der kaum halbstündige, heftige Gewitterregen hatte den Weg so tief versandet, daß wir nun wieder verurtheilt waren, den Wagen aus dem Sande förmlich herauszugraben. In der Farm endlich angelangt, waren wir froh, für die kommende Nacht Ruhe und ein schützendes Dach finden zu können. Ich gewann jedoch auch die Ueberzeugung, daß wir von der Fortsetzung des bisher eingeschlagenen Weges absehen mußten und beschloß, die Pferde nach Kimberley zurückzusenden und sie gegen kräftige Maulesel umzutauschen. Der Tausch kam indessen nicht zu Stande und so waren wir genöthigt, auf dem morastigen Wege nach Klipdrift weiter zu reisen. Die Abwesenheit des Farmers, von dem ich zwei Ochsengespanne zu erhalten hoffte, nöthigte uns noch zu weiterem Aufenthalte, den wir durch einen Jagdausflug ausfüllten.
Unter der Beute dieses Jagdausfluges fanden sich auch zwei Exemplare jenes schon von Livingstone beschriebenen, südafrikanischen Riesenfrosches »Motla metlo«, die ich meiner Sammlung einverleibte. Diese Thiere verbringen die Zeit der Dürre in einer Art Halbschlummer unter der Erde, meist in verlassenen Erdlöchern, und kommen nur nach heftigen Regengüssen zum Vorschein.
Nachdem wir noch unsere Vorräthe auf der Farm ergänzt, brachen wir auf; es war dunkle Nacht geworden, als wir die einige Meilen nordwärts gelegene Bredekam's Farm und das in der Nähe derselben befindliche Hotel erreichten. Auch diese Farm, obwohl sie einem Manne angehörte, der in den Diamantenfeldern reich geworden, war blos ein dürftiger, zur Noth seiner Bestimmung entsprechender Bau. Das Hotel bestand aus zwei mit Eisenblech gedeckten Segeltuchhäusern; es war von einem Deutschen gehalten, von dem es »Bismarck's Retreat« (Erholungsplätzchen) genannt wurde. Trotzdem, daß derselbe dieser Stelle Berühmtheit und sich selbst ein gutes Stück Geld erwerben wollte, und deshalb mit Wort und Inserat einige der vielen, Süd-Afrika charakterisirenden, salzhaltigen Quellen als eminente Heilquellen ausposaunte, war es ihm nicht vergönnt, aus Bismarck's Retreat ein Eldorado zu schaffen.
Nach mancherlei unangenehmen Zwischenfällen erreichten wir endlich die Höhen, welche von Hebron ab das Ufer des Vaal-River säumen, und begrüßten hocherfreut und aufathmend das uns entgegenschimmernde Grün des Thales; bald weidete sich unser Auge am Anblicke des in ziemlicher Fülle hingleitenden Stromes, an dessen südlichem Ufer wir die zerstreuten Häuschen der Berliner Missionsstation Pniel und ein kleines Korannadorf erblickten.
Von den Pnielhöhen herabfahrend, passirten wir am Wege die Ruinen eines Missionsgebäudes, in dem ein Korannaschmied mit seinem aus Schafhäuten verfertigten Blasebalg den zahlreichen hier nistenden grauen Fledermäusen Gesellschaft leistete. Wir machten nahe am Vaalflusse Halt, und während meine Begleiter Anstalten zur Bereitung des Mittagsmahles trafen, nahm ich das Gewehr, um die Gegend zu durchstreifen. Im Bette einer ausgetrockneten Regenschlucht, die hier in den Vaalfluß einmündete, beobachtete ich zahlreiche Spuren von Wasserleguanen und Fischottern, und erlegte nebst mehreren Mäusevögeln und Turteltauben einige große Regenpfeifer, welche mich mit ihrem lauten Tip-Tip angelockt hatten. Der Vaal, der bedeutendste Nebenfluß des Oranje, ist an dieser Stelle, wo ihn der von Kimberley nach Klipdrift Reisende zuerst trifft, etwa 100 Schritte breit, sehr schlammig und durch seine unzähligen Stromschnellen charakterisirt, welche von einander durch tiefe schlammige Stellen geschieden sind und an welch' letzteren der Fluß eine fast gleichmäßige bis 200 Schritt messende Breite zeigt. Seine Ufer sind gleichfalls auf weite Strecken hin schlammig, und dadurch unnahbar; Hausthiere können nur an den in den Fluß reichenden Felsenbänken oder an den Stromschnellen zur Tränke geführt werden; durstige fremde Thiere, die hier ausgespannt und nicht gut bewacht zum Wasser hinabeilen, büßen einen solchen Versuch meist mit dem Leben.
Ein Besuch im Korannadorfe bot uns einen trostlosen Anblick und gab mir die Ueberzeugung, daß bei keinem anderen Eingebornenstamm, etwa mit Ausnahme der Matabele, die Missionsthätigkeit so geringe Erfolge aufzuweisen hat, als bei den Koranna's. Ihre socialen Zustände und Verhältnisse, ihre Bildungsstufe, bewiesen mir, daß sie nur die Laster der Civilisation angenommen, für die Lichtseiten derselben aber wie vorher unempfindlich geblieben waren. Krankheiten und Trunksucht mit ihren verderblichen Folgen herrschen auch hier unter den Koranna's.[1]
1 Zu Anfang des Jahres 1877, habe ich in einer Brochüre die Eingebornenfrage in Süd-Afrika zu besprechen mir erlaubt und der englischen Regierung angerathen, diesen Koranna's gegenüber, welche zum Theile im Vaalthale von Fourteen-Stream bis zur Hart-Rivermündung als englische Unterthanen wohnen, ferner am mittleren Hart-River um die Stadt Mamusa ein kleines selbstständiges Reich bilden, und auch unter den nördlicher wohnenden Barolongen in der Stadt Koranna leben, den Verkauf spirituoser Getränke zu sistiren, um sie zum Ackerbau anzuhalten, sowie durch wöchentliche Inspicirung durch Polizisten sie zur Reinlichkeit und Instandhaltung ihrer Dörfer und Gehöfte zu gewöhnen. Man kann sich keinen widerlicheren Anblick denken, als diese in europäische Fetzen gekleideten, von Schmutz und Unreinlichkeit im höchsten Grade strotzenden Gestalten. Es freut mich, in der letzten Zeit vernommen zu haben, daß der gegenwärtige Gouverneur Colonel Warren von Griqualand-West, die Ausfuhr von Spirituosen in die nachbarlichen Eingebornenreiche verboten und auf seine Provinz beschränkt hat. Ein voller Erfolg, eine gründliche Verbesserung in den socialen Verhältnissen der Koranna's, wird aber erst dann eintreten, wenn das Gesetz noch bis zur vollkommenen Verweigerung der genannten Getränke verschärft sein wird.
Unter allen Stämmen Süd-Afrika's verwendet dieses Volk die geringste Mühe auf den Aufbau und die Instandhaltung ihrer Wohnungen. In der wohl auch durch das Klima beförderten Indolenz und Energielosigkeit übertreffen die Koranna's und Griqua's diese beiden Bruderstämme der Hottentottenrace, selbst die übel beleumundeten Buschmänner, welche die Felswände ihrer früher bewohnten natürlichen Höhlen mit einfachen mit Ocker übertünchten Zeichnungen bedeckt und die Gipfel der von ihnen bewohnten Höhen, d.h. die diese bedeckenden dunkeln Felsenblöcke mit Ausmeißelungen von thierischen und menschlichen Gestalten und anderen Objecten geschmückt hatten. Wenn der Koranna sich aus der ihm eigenthümlichen Trägheit, dem Mangel an Streben und Ausdauer herausreißt, um als Diener Anderer zur Arbeit zu greifen, so geschieht dies nur, weil ihm dadurch die Möglichkeit geboten ist, sich dem heißersehnten Branntweingenusse hinzugeben.
Hier am Abhange eines kahlen Höhenzuges, dort am Flußufer oder am Rande einer Salzpfanne, hie und da auch in den Felsenschluchten des Vaalflusses, finden wir eine oder mehrere, etwa 1½ Meter Höhe und 3-3½ Meter im Durchmesser haltende halbkugelige, jeder Umzäunung bare Hütten, die augenscheinlich nur dem Nothbehelf dienen, weder geräumig, noch symmetrisch gehalten, mehr thierischen Strohbauten gleichen. Die Herstellung ist denn auch, dem Aussehen entsprechend, eine höchst primitive. Wenn die Frauen, denen die Herstellung der Wohnung obliegt, die oberen Enden etwa zwei Meter langer, dünner, im Kreise aneinander gereihter und gesteckter Baumzweige in einem Mittelpunkte zusammengebunden und das Gerippe mit Binsenmatten überdeckt haben, ist auch schon das Wohnhaus in der Hauptsache hergestellt. Eine Oeffnung, hinreichend groß, um einem Menschen in kriechender Stellung Einlaß zu gewähren, bildet die einzige Verbindung mit der Außenwelt, die im Nothfalle durch eine von innen vorgeschobene Matte abgesperrt wird. Das Innere der Hütte entspricht dem Aeußern, es läßt sich kaum etwas Trostloseres und zugleich Unreinlicheres denken als das Innere einer Korannahütte. In der Mitte eine schüsselförmige Vertiefung als Feuerherd, einige niedrige mit Querhölzern verbundene Holzgabeln, behangen mit den Ueberbleibseln einstiger europäischer Kleidungsstücke, einige Ziegen- oder Schaffelle, weiters einige Töpfe, und die Einrichtung ist damit fertig. Eine von dürren Mimosenzweigen nothdürftig umzäunte Stelle zwischen oder vor den Hütten, beherbergt die Rinder- oder Ziegenheerde, und wo nicht die Hyäne und der Leopard oder andere Raubthiere auf ihren nächtlichen Schleichwegen zu fürchten sind, bezeichnet blos ein Düngerhaufen den Sammelplatz des Vieh's. Bezeichnende Stille herrscht über dieser trostlosen Scenerie, nur nachdem Branntwein die Gemüther erhitzt, den einer der Insassen von der Stadt gebracht, oder den ein vorüberfahrender Händler ihnen überlassen, geht es lärmend zu, sonst aber unterbricht nur des Morgens und Abends, wenn die nackten Kinder die Heerden auf die Weide treiben, einige Bewegung die Monotonie im trägen Leben der Hütteninsassen.
Nur hie und da, wo wohlhabende Koranna's sich den Luxus einiger Makalahari und Masarwa, Diener und Sklaven, gönnen können, wurde im beschränktesten Maße Ackerbau versucht, für dessen Entwickelung an vielen Stellen des Landes die natürlichen Bedingungen vorhanden sind, und welche Versuche selbst bei der genannten Beschränktheit den günstigsten Erfolg hätten, wenn man Dämme aufzuwerfen oder hie und da den Hart-River oder Vaal-River abzuleiten versuchen würde.
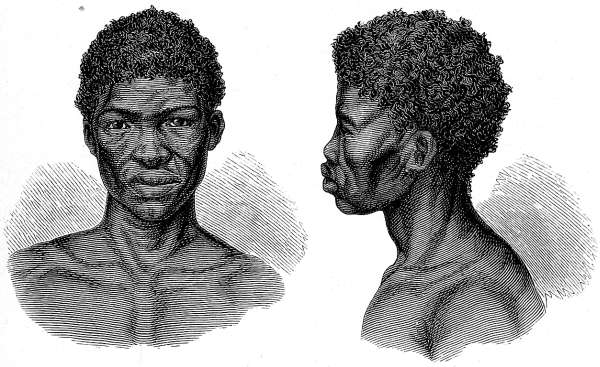
[Koranna.]
Wie die Hottentottenrace überhaupt, die eigentlichen, die Cap-Colonie bewohnenden Hottentotten, die Griqualand-West an der Einmündung des Vaals in den Oranje und jene, Neu- oder Ost-Griqualand oder das sogenannte Nomansland um Kockstadt herum bevölkernden Griqua's, sind auch die Koranna im Aussterben begriffen, ihre Zahl hat sich beinahe um 50 Percent, ihr Besitz um 25-75 Percent verringert. Arbeitsscheu und unrein, hinterlistig und in der Mehrzahl der Fälle untreu, rachsüchtig und nur für den Moment lebend, ohne auf das Morgen zu denken etc., sowie fähig, alle möglichen Verbrechen zu begehen, um sich nur den Branntwein zu sichern, boten sie mir ein abschreckendes Bild. Da sie jedoch als Rosselenker und Gespanntreiber im nüchternen Zustande (nur in der Wildniß, wo ihnen kein Europäer das Feuerwasser reichen kann) besser als die Kaffern etc. zu verwenden sind, so versuchte ich es auch mit ihnen und trachtete nach Möglichkeit, sie nüchtern zu erhalten—vergebliche Mühe, ich mußte den Versuch sehr bald aufgeben.
In England herrschen gegenwärtig unter den Gebildetsten bezüglich der Eingebornenfrage irrige Ansichten; dieses Mißverständniß beruht hauptsächlich darauf, daß die betreffenden Persönlichkeiten sich nicht selbst von dem Stand der Dinge überzeugt haben. Wenn einzelne Menschenfreunde oder ganze Gesellschaften etwas für die Eingebornen Süd-Afrika's thun wollten, wenn sie sich selbst ein Denkmal setzen und den Farbigen die größte Wohlthat erweisen wollten, so wäre es nöthig gewesen, daß sie die gegenwärtige Bewegung in Süd-Afrika, jene der Good-Templers in re unter den Eingebornen unterstützt hätten, welche auf Grund von namentlich in den Diamantenfeldern gesammelten, sehr bitteren Erfahrungen den Verkauf von Spirituosen an die Schwarzen zu hemmen suchten. Kriege mit den Eingebornen können denselben nicht so viel materiellen Schaden an Körper und Habe (die Habe des Einzelnen schmälernd) verursachen, als ein jahrelanger ungestörter Genuß des Feuerwassers und dies namentlich bei Stämmen, die schwach in ihren geistigen Anlagen, sich leicht durch alles Glänzende, kleinen Kindern gleich, bethören lassen. Ja, ich bin dessen vollkommen sicher, daß viele meiner hohen Gönner in England, denen die Eingebornenfrage Süd-Afrika's am Herzen liegt, nie einen solchen Anblick vergessen würden, wie er sich den Bewohnern vieler Capland-Städte noch darbietet, in den Diamantenfeldern jedoch ein alltäglicher war: daß der weiße Mann betrunkene Korannafrauen, wild fluchend, von Schmutz halb verzehrt, in den staubigen Straßen herumwanken sah, bis sich ihrer ein Wachmann erbarmte. Der Anblick eines unreinen, im Schlamm sich wälzenden Thieres könnte nicht mehr anwidern als jener. Wenn ich aber hinzufügen darf, daß in den Diamantenfeldern, in der Provinz Griqualand-West selbst, in dieser Beziehung ein lobenswerther, ein bedeutender Fortschritt geschah, daß die Regierung, um die materielle Lage ihrer farbigen Bevölkerung zu verbessern, die Summe von 3000 £ St. in Kantinenlicenzen (Kantinensteuern) aufopferte und sonst bemüht ist—obgleich gegen eine starke Opposition ankämpfend—den Verkauf des Brandy an Eingeborne zu beschränken, wird dies jeden einsichtsvollen Mann gewiß befriedigen. Unstreitig wird sich die materielle Lage der Eingebornen bessern, und sie als kleine Steuerzahler, den der Regierung durch jene Maßregel verursachten Schaden wieder gut machen.
Es ist zu hoffen, daß die in den letzten Jahren so vollkommen zerrütteten Verhältnisse, das über alle Begriffe demoralisirte Familienleben der Koranna's sich verbessern und sie namentlich als Viehzüchter und Ackerbauer etwas Bedeutendes leisten können. Einen kleinen Preis müßte die Regierung ausschreiben für jene, welche an ihren Hütten den einfachen europäischen Styl nachahmend, ihre Wohnungen sich selbst errichten, welche das meiste Feld bebauen, welche die schönsten Feldfrüchte gewinnen oder das beste Vieh aufziehen; so aufmunternd, edlere Gefühle in der bis jetzt nur noch von blinden thierischen Regungen erfüllten Brust zu wecken trachten. Die Koranna's könnten in der Holzschnitzerei und Steinschneiderei manches Gute leisten, wären also auch hier zu unterstützen.
Durch den moralischen Verfall der Koranna's im letzten Jahrzehnte haben dieselben die meisten ihrer früheren erwähnenswerthen Gebräuche außer Acht gelassen, ja ich möchte sagen; vollkommen vergessen; was sich jedoch noch bei ihnen erhalten hat, das ist eine Art Freimaurerthum. Die Mitglieder dieser Gesellschaft erkennen sich an einem äußeren Abzeichen, in der Regel drei auf der Brust ausgeführte 1-1½ Zoll lange (vernarbte) Schnitte. Ein Mitglied dieses Bundes findet überall, wo er zu Seinesgleichen hinkommt, die freundlichste Aufnahme, sowie er dem Hausherrn die Narben auf der Brust gewiesen, oder dieser, dem Besucher das Hemd an der Brust öffnend, das Zeichen erblickt hat. Solch' ein Freimaurer wird nun von dem Bruderhausherrn auf das Freundlichste aufgenommen, bewirthet, und einem Verwandten oder Familiengliede gleichgehalten. Will ein Koranna diesem geheimen Bunde beitreten, so macht er, da das Erkennungszeichen ziemlich bekannt unter dem Stamme ist, einem seiner Nachbarn, an welchem er ein solches beobachtet, seinen Entschluß bekannt, daß er beitreten wolle. Hat sich der Angesprochene überzeugt, daß der Antragsteller im Stande ist, die Kosten der Einweihungs-Ceremonie zu tragen, so meldet er es den in demselben Dorfe oder ringsherum Wohnenden, und wenn sich keine in der Nähe aufhalten, sondern weitab wohnen, so wird um diese gesendet und nachdem sie sich versammelt, die Einweihungs-Ceremonie vorgenommen, welche darin besteht, daß man dem neuen Bruder die gegenseitigen Unterstützungspflichten bekannt macht, und wobei er, von dem Aeltesten der Anwesenden mit den drei Schnitten gekennzeichnet, das Gelübde, jenen Verpflichtungen nachzukommen, abgibt und dies mit dem gewöhnlichen Schwure »so wahr als ich eine Mutter habe« bekräftigt. Eine Orgie beschließt diese Ceremonie, wobei einige Stück Rindvieh, Schafe und Ziegen geschlachtet werden und die Gesellschaft nicht eher scheidet, als bis alles consumirt ist.
Ich werde noch mehrfach Gelegenheit finden, diese in allgemeinen Zügen gehaltene Charakteristik dieses Stammes zu vervollständigen.
Nach einem fast dreistündigen Aufenthalte verließen wir Pniel, der Weg führte nun über bebuschte Hochebenen, welche von zahllosen rothen Flugsanddünen durchzogen waren, die unseren Zugthieren die größten Schwierigkeiten bereiteten. Wir mochten etwa zwei Drittel des Dünengürtels durchmessen haben, als unsere Thiere, erschöpft, nicht mehr von der Stelle zu bringen waren, und wir hier auf vorbeiziehende Batlapinen warten mußten, welche nach den Diamantenfeldern Holzhandel treiben. Wir waren schon mit der Herstellung unseres primitiven Nachtlagers beschäftigt, als uns der bekannte gedehnte Knall der Ochsenpeitsche (eines Monstrums in seiner Art) auf ein ankommendes Gefährte aufmerksam machte. Es waren, wie ich vermuthet, von Klipdrift kommende Holzfuhrleute; die Unterhandlungen über die geforderte Entlohnung waren bald beendigt, und der Wagen in kürzester Zeit aus der mit Dünen besäeten Ebene auf festem Boden in Sicherheit. Eine neue bange Sorge verursachte uns die Beischaffung des nöthigen Trinkwassers für unseren persönlichen Bedarf und zum Tränken der durstigen Thiere. Die Nacht war sehr dunkel, ein kalter Nordwind durchdrang unsere Kleider, nur ein ungewöhnliches Wetterleuchten am westlichen Horizonte erhellte zuweilen die tiefe Finsterniß.
Die Wegrichtung zum Strom war uns wohl bekannt, allein in der Dunkelheit, die uns kaum erlaubte, auf 40 Schritte hin deutlich zu sehen, war es uns unmöglich, uns über die Stelle zu orientiren, auf welche wir lossteuerten; es konnte ein steiler Abhang oder eine schlammige Uferpartie sein, beides gleich gefährlich.
Ich mein Reitpferd, meine weißen Gefährten je ein Paar der Zugthiere führend, steuerten wir, unseren zurückbleibenden Wagen allen Göttern empfehlend, in die Dunkelheit hinaus, von »Nigr« begleitet, der sich um die Dunkelheit wenig zu kümmern schien und vorwärtseilend durch lautes Bellen seine Befriedigung über den nächtlichen Ausflug kundgab. Anfangs ging es über eine kurz begraste Ebene, die nach dem öfteren Ausgleiten zu urtheilen, mit vielen breitblättrigen Liliaceen bedeckt zu sein schien, dann kamen wir an zahllose vom Regenwasser aufgewühlte Rinnsale, deren erstes uns ein Schrei meines Begleiters F. ankündigte, der bis zu den Hüften darin versank. Wir brachen von den unseren Weg säumenden Gebüschen Aeste ab, um damit das Terrain vor uns zu sondiren, doch half dies nicht viel, namentlich als wir uns dem Flusse nähernd, den Abhang heruntergingen. An den zahlreichen Mimosenzweigen blieb so manches wollene Wahrzeichen unseres kühnen Nachtmarsches zurück, der den Koranna unwillkürlich Achtung abringen mußte.
Am Flusse angelangt, war eine sichere Tränkstelle nicht anders zu entdecken, als daß wir selbst mit Stöcken den schlammigen Ufergrund sondirend, nach einer solchen suchten. Unsere Bemühungen waren über alles Erwarten glücklich, nur wenige Schritte unterhalb unserer Haltstelle stieß mein Begleiter F. auf einen vorzüglichen Tränkplatz. Nachdem die Pferde mit aller Vorsicht einzeln getränkt waren, hieß es, den Rückweg zum Lagerplatze auf der Hochebene antreten. Dies war nichts Leichtes, denn wir hatten uns bald überzeugt, daß wir beim Abstieg zu sehr vom directen Wege abgekommen waren. In der herrschenden undurchdringlichen Finsterniß war unser Beginnen nicht ohne Gefahr, nach wenigen Schritten, die wir vom Ufer ab zurückgelegt hatten, versperrte uns eine dichte Gebüschbarriere den Weg, wir mußten also versuchen, stromaufwärts freieres Feld zu gewinnen, ein in den letzten Zügen flackerndes Feuer in der Entfernung von etwa 600 Schritten wies uns auf die richtige Fährte. Vor Kälte zitternd (das Thermometer zeigte blos 7 Grad Reaumur) langten wir endlich am Wagen an, der heftige Wind und ein vom Blitz und Donner begleiteter Regenschauer machten alle Versuche, ein tüchtiges Feuer zu entzünden, zu Schanden. Obwohl auf das Aeußerste ermüdet, wollte dennoch kein Schlaf unsere Glieder stärken, die durch das Unwetter unruhig gewordenen Pferde zerrten ununterbrochen an unserer »Arche« und vereitelten dadurch jeden Versuch, Morpheus an uns zu fesseln, mit Gewalt. Da sich die Pferde durchaus nicht beruhigen ließen, vermutheten wir, daß sie durch herumschleichende Hyänen beängstigt wären und durchstreiften die nächste Umgebung, indeß ohne etwas Verdächtiges wahrzunehmen.
Gegen Morgengrauen des nächsten Tages brachen wir weiter gegen Klipdrift auf. Kleine in unsern Weg mündende Thälchen und mit hohem Busch bestandene Ebenen brachten in die bisherige Monotonie einige Abwechslung und waren durch Deuker und Steinbockgazellen belebt, auch die graue Zwergtrappe tummelte sich zwischen den in kleinen, dichten Gruppen stehenden, 6-12 Fuß hohen Büschen. Beide Gazellen halten sich tagsüber in dem niedrigen und dichten Gebüsch im Versteck, die Steinbockgazelle (Tragalus rupestris) verläßt dieses nur zur Nachtzeit oder bei annähernder Gefahr. Ich glaube auch darin, daß sie des Tageslichtes entwöhnt ist, den Grund des Erblindens der in der Gefangenschaft gehaltenen Thiere (zu 90 Percent) zu finden. Im minderen Grade ist das bei dem Deuker (Cephalolophus mergens) der Fall, da er auch zuweilen tagsüber der Nahrung nachgeht. Geübte Schützen jagen beide Thiere mit dem Riflestutzen; unter allen Umständen erfordert das Erlegen der zierlichen, kaum 20 Zoll hohen Gazelle auf 200-400 Schritte Entfernung eine meisterhafte Handhabung der Waffe.
»Sportsmänner« jagen die schönen Thiere mit Windhunden; ähnliche Thierquälerei, einem der unschuldigsten Thiere gegenüber, hat der Weiße auch in allen anderen Welttheilen eingeführt. In Süd-Afrika war es bisher nur unter den Eingebornen im Gebrauch, schädliche und namentlich des Pelzwerkes halber nützliche Thiere mit Hunden zu jagen und selbst bei diesen verkürzte man thunlichst die Dauer der Verfolgung. Dazu gehören die südafrikanischen Schakale (Canis mesomelas und cinereus), der Kamafuchs, sowie der Erdwolf (Proteles Lalandii), die Genettkatzen und das Scharrthier.
Der Steinbock, von den Boers »Steenbuck« genannt, sowie der Deuker oder Ducker sind in den dichtbebuschten und bewaldeten Partien am Abfalle des süd- und centralafrikanischen Hochplateau's nach der Küste zu durch den Grysbock (Tragalus melanotis) und den kleinen Blaubock (Cephalolophus coerula), nach Norden hin durch den auf den Ebenen des Salzpfannengebietes paarweise, jenseits des Zambesi in kleinen Heerden lebenden Orbecki vertreten.
Die Fahrt über die bebuschten Hügelpartien nahm unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, denn der Weg glich dem trockenen Bette eines mit Geröll übersäeten Wildbaches, der Wagen kam in die bedenklichste Situation, seine Schwankungen kosteten einem unserer Hunde, der sich unvorsichtiger Weise zu nahe gewagt, das Leben. Endlich war die Vaal-Fähre erreicht und wir alle gegen zehn Shillinge Entlohnung über das Wasser gesetzt.[1]
1 Zur Trockenzeit benützen die Wägen eine unterhalb der Fähre befindliche Furth.
Am rechten Ufer des Vaal angelangt, schlugen wir in unmittelbarer Nähe von Klipdrift, am Fuße einer Anhöhe unser Lager auf. Mit anderen südafrikanischen Orten verglichen, verdient Klipdrift ein hübsches Städtchen genannt zu werden. Aus etwa 150 theils steinernen, theils Eisenblechhäusern (die Ueberreste des früher 5000 Einwohner zählenden Hauptortes der River-Diggings) bestehend, liegt es am Abhange niedriger, kaum 80 Fuß das Niveau des Flußbettes überragender, mit unzähligen dunkelbraunen Felsblöcken (Trapdykes) bedeckter Höhen; der aus Südsüdost kommende Fluß macht hier eine Biegung nach West. Kleine, theils kahle, theils begraste, hie und da mit Bäumen bedeckte Inseln in dem ober- und unterhalb Klipdrift über Felsenblöcke rauschenden Strome verleihen dieser Ansiedlung einen nicht geringen Reiz. Zur Zeit meines Besuches schmückten hohe Bäume beide Ufer des Flusses, von denen das linke höher als das rechte ist.
Lange Zeit besaß Klipdrift eine architektonische Merkwürdigkeit, nämlich das einzige aus Steinen erbaute einstöckige Haus, das Kanzleigebäude der »Standardbank«, eines Institutes, dessen Noten vollen Goldwerth haben. Am Ostende von Klipdrift schließt sich die native location (die Niederlassung) der farbigen Eingebornen an, damals von Koranna's Batlapinen und Barolongen bewohnt, von welchen gegenwärtig nur noch die beiden ersten Stämme vertreten sind. Das Aeußere dieser Eingebornen-Niederlassung erhält durch ein buntes Gemisch verschiedener Baustyle (Korannahütten, Basutohütten und in europäischem Style aufgeführte Holz- und Lehmhäuschen) einen eigentümlichen Charakter.
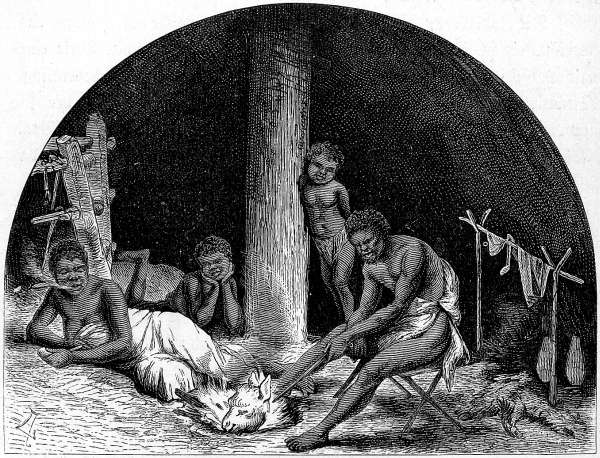
[Inneres einer Korannahütte.]
Die Bewohner, Männer sowohl als Frauen, entwickeln regen Arbeitssinn, während sich die ersteren im Taglohn oder zu anderen Arbeiten (Jobs) verdingen, steuern auch die Frauen (besonders die Kaffern- und Betschuanafrauen) durch ihren Verdienst als Wäscherinnen zu den Kosten der Haushaltung bei. Ihre Thätigkeit belebt die Scenerie am Flusse.
Ein flüchtiger Blick genügt, um die beiden Racen zu unterscheiden, und ohne Zaudern werden wir den Vertretern der Betschuanarace, den Batlapinen und Barolongen den Vorzug angenehmerer Gesichts- und Körperbildung einräumen. Von mattschwarzem bis dunkelbraunem Teint, sind ihre Gesichtszüge weder schön noch häßlich, während das gelblich-braune Gesicht des Koranna direct häßlich zu nennen ist. Die kleinen Augen liegen in tiefen Höhlen, das kurze und schmale Gesicht zeigt kaum einen deutlichen Nasenansatz, die unnatürlich vorgehenden Kinnbacken und wulstigen Lippen sind die Hauptmerkmale der vorderen, ein kleiner, länglicher Schädel jener der hinteren Kopfbildung. Der Körper der Frauen wird durch jene bekannte Sattelbildung der unteren Wirbelsäule, welche ihren Gang schwerfällig erscheinen läßt, nicht wenig verunstaltet. Viele Korannafrauen hatten Wange und Stirne mit rothem Ocker überschmiert, oder blau bemalt, und zwar mit vom Ohre zu den Augen, Nase, Mund und Kinn laufenden geraden oder nach oben zu concaven Linien. Häufig fand ich die Wangen und Stirne auch braun und schwarz bestrichen, was ihnen das Aussehen von gekleideten Affen verlieh.
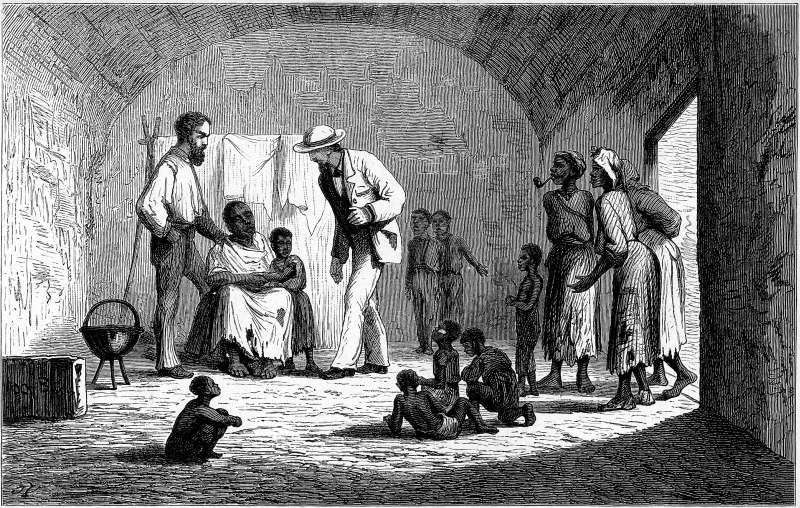
[Kranken-Ordination in Klipdrift.]
Bei einem meiner Besuche im Eingebornenviertel trat ich in eine der Korannahütten. Es bot sich mir da ein eigentümliches Bild dar. In einer schüsselförmigen Vertiefung in der Mitte der Hütte lag in glühender Asche ein wolliger Gegenstand; bei näherer Besichtigung erkannte ich, daß es ein Lämmchen war, das gebraten wurde. Zwei Frauen, den Oberkörper vollkommen entblößt, beide gemüthlich rauchend, saßen auf Matten, während einige nackte Kinder, deren gelblich-graue, lichte Körperfarbe durch Unreinlichkeit schwarz übertüncht war, herumspielten. Das Familien-Oberhaupt, in abgetragene europäische Lappen gekleidet, saß unmittelbar am Heerde und verfolgte mit gespannter Aufmerksamkeit das Garwerden des Bratens, das ein lautes Schnalzen mit der Zunge anzukündigen schien. Dies betätigte mir auch die Entfernung des Stückchens Kautabak, das der Koranna nur während des Mahles weglegt. Es währte nicht lange, so war der Lammsbraten von der glühenden Asche befreit, der verkohlten Wolle entledigt, in Stücke geschnitten und zertheilt. Während die Kinder fest und gierig darauf losbissen, schnitten sich der Mann und die Frauen, indem sie das eine Ende eines Fleischstückes mit den Zähnen, das andere mit der Hand festhielten, jeden Bissen mit dem Messer unmittelbar an den Lippen ab. Außer Fleisch, wobei sie namentlich die Eingeweide und das Hirn der Thiere vorziehen, genießen die Koranna's häufig Mehlbrei, gekochte Kürbisse und Milch, nur Fische, Krebse, Muscheln und Aehnliches verabscheuen sie wie die meisten afrikanischen Völker im Innern des Erdtheils, während wir überall längs der Seeküste Spuren von Menschen finden, welche sich durch eine sehr lange Periode nur von Fischen genährt haben mußten.
In geringer Entfernung von dem Eingebornenviertel in Klipdrift liegen die in früheren Jahren bearbeiteten River-Diggings. Welcher Unterschied—wie unscheinbar gegen die Dry- (Central) Diggings. Eine Unzahl zwei bis acht Quadratmeter großer, bis zwei Meter tiefer, theilweise mit Gerölle, namentlich calcedonartigen Steinen und kopfgroßen Grünsteinblöcken gefüllter Gruben, einem durchstöberten Friedhof nicht unähnlich, war Alles, was von den einst von Tausenden emsiger und mit Fieberhast arbeitender Menschen belebten Diamanten-Fundstätten übrig geblieben, seit Dutoitspan entdeckt worden war. Obwohl die Gruben keine besondere Tiefe hatten, mußte trotzdem das Diamantensuchen in diesem steinigen Boden sehr beschwerlich gewesen sein; ich traf jetzt nur zwei Digger, welche im Schweiße ihres Angesichts nach den kleinen, glänzenden Kieseln und allem Anscheine nach mit wenig Erfolg fahndeten; ein Engländer, der mit zwei Batlapinen arbeitete, und eine abgemagerte, etwa dreißigjährige weiße Frau, in deren Zügen Krankheit und Noth nur zu deutlich zu lesen waren; in ihrer Gesellschaft ein kleines Kind, welches mit farbigen Steinen spielte. Ihre sorgenschweren Mienen flößten mir Mitleid ein und ich konnte die Frage nach dem Erfolge ihrer Bemühungen nicht unterdrücken; ihre Antwort entrollte mir eines jener traurigen Bilder, an denen das Diggerleben in den Diamantenfeldern trotz der kurzen Zeit, die seit ihrer Entdeckung verflossen, überreich ist. Vor mir stand eine junge Frau, welche ihrem diamantensuchenden Gemahle nachgereist war, um ihn in sterbendem Zustande wiederzufinden und nun selbst allen tückischen Wechselfällen des aufregenden und aufreibenden Diggerlebens preisgegeben zu sein.—Ich werde später noch Gelegenheit finden, die Geschichte manches Opfers der Diamantenfelder zu erzählen.
Die mit üppiger, durch einige tropische Species charakterisirte Vegetation bewachsenen, kleinen Bergthäler, sowie einige morastige Wiesen in der Nähe des Flusses, hauptsächlich aber seine dichtbebuschten und belaubten Ufer und sein bald felsiges, bald schlammiges Bett, beherbergen als vorzüglich geeignete Schlupfwinkel, eine artenreiche Thierwelt. Ich bedauere, daß ich Klipdrift und seine nächste Umgebung stets nur flüchtig, meist auf dem Durchmarsche berühren konnte; bei längerem Aufenthalte winkt hier dem naturwissenschaftlichen Sammler reichliche Ernte, wie denn überhaupt der Ort wie eine Oase aus der eintönigen Oede des südafrikanischen Hochlandes hervorsticht. Doch selbst während meines kurzen Aufenthaltes fand ich von Falken und Sperbern manche interessante Art, graue Uhu's, Berg-, Baum-, Sumpf-, sowie auch Zwergeulen ziemlich vertreten; mehrere Krähenarten und namentlich in den Buschdickdichten der Ufer, sowie in der Nähe der Gehöfte fünf Staararten, von denen ich den kleinen, und den schönen großen, langschwänzigen Glanzstaar besonders hervorheben will. Zahlreich sind die Würger, doch noch zahlreicher die körnerfressenden Singvögel vertreten, von den letzteren fielen mir mehrere langschwänzige Finkenarten auf, doch fehlen auch Drosseln und andere Insecten fressende Singvögel nicht, namentlich Bachstelzen, Schnapper, Rohrfänger etc. Von spechtartigen Vögeln traf ich nur zwei, dagegen mehrere Arten Colibri's und eine Art des Bienenfängers, sowie zwei Eisvögel- und Kukuksarten an. Auch der schon erwähnte langschwänzige kleine Mäusevogel, mehrere Schwalben und eine Ziegenmelker-Species gehören zu den häufigeren Erscheinungen, in entsprechendem Verhältnisse sind auch die übrigen die Fauna Süd-Afrika's charakterisirenden Vogelarten vertreten, vor Allem aber Tauben, Zwergtrappenarten, Stelzenvögel, Enten und Taucher. Unter den Reptilien waren namentlich drei Species von Landschildkröten, neben einer im Wasser lebenden, häufig zwischen den Felsenblöcken an den Höhen anzutreffen. Die gewöhnliche Schildkröte, die gemeine südafrikanische Landschildkröte, und eine flache Art mit viereckigen grünlichen Zeichnungen in den Centren der oberen Schilder. Von Fischen beobachtete ich fünf Species, von welchen ich eine nordwärts bis über den Zambesi hinaus in allen Gewässern sowohl im Süßwasser, als auch in den Salzpfannen und Salzflüssen vorfand. Es ist der südafrikanische Wels mit schildförmigem Kopfe.
Erst hier, in der unmittelbaren Nähe von Klipdrift, gelang es mir, meine vier Pferde gegen die tauglicheren Zugochsen einzutauschen; obgleich ich dabei in pecuniärer Beziehung Einbuße erlitt, ging ich hocherfreut auf den Tausch ein, denn schon war in der Umgegend die alljährlich grassirende Pferdekrankheit ausgebrochen und in unserer Nähe sonnten sich bereits mehrere Pferdecadaver. Mein Gespann bestand nun aus sechs Zugochsen, von welchen leider zwei äußerst störrisch und unlenksam waren, während der Verkäufer mir alle als äußerst zahm, gefügig und Thiere par excellence anpries. Hätte nicht die grassirende Pferdekrankheit bereits so deutliche Beweise ihres mörderischen Auftretens in unserer Nähe gegeben, so wäre ich beim Tausche wohl besser weggekommen; so aber schien der Mann nur zögernd das Geschäft abschließen zu wollen. Mit der Vermehrung meines Gespanns erwuchs mir auch die Sorge, wenigstens zwei farbige Diener zu miethen; einen als »Leader«, um das vorderste Paar der hintereinander gespannten Zugthiere zu leiten und einen »Driver«, der das Gespann mit der Peitsche anzujagen hatte. Auch dieser Bedarf war bald gedeckt; bei einem Besuche des Korannadörfchens hatte Freund F. einen hier lebenden Deutschen angetroffen, den ich nun ersuchen ließ, uns unter seinen Nachbarn zwei rüstige, junge Männer auszusuchen und auf einige Wochen als Diener zu miethen. Noch am selben Tage brachte uns dieser einen echten Korannajüngling von ungefähr 16 Jahren und einen Korannabastard mit Namen Gert, welche sich beide geneigt zeigten, gegen einen wöchentlichen Lohn von 8 Shillingen und 6 Pence in meine Dienste zu treten.
Zu meiner nicht geringen Ueberraschung erbat sich der deutsche Ansiedler als einzigen Gegendienst einen Besuch bei seiner kranken Frau. Gern folgte ich ihm und fand mich bald darauf in einem kleinen, halb in europäischem, halb im Style der Korannahütten ausgeführten kleinen Gebäude, wo der Mann in Gesellschaft einer Bastardfamilie wohnte. Auch seine Frau gehörte zu diesen Mischlingen. Sie war in elende, doch reinliche Lappen gekleidet und der erste Blick belehrte mich über die Natur ihrer Krankheit; die Aermste war in Folge drückendster Nahrungssorgen gänzlich entkräftet; ich fand leider erst später Gelegenheit, ihr stärkende Arzneien senden zu können. Während ich noch mit der Frau sprach, hatte sich uns ein kleines, etwa sechsjähriges Mädchen mit wahrhaft feinen und schönen Gesichtszügen und kurzgelocktem, dunkelblondem Haare genähert. Es trug keine Spuren des dunklen Teints seiner Mutter an sich. Ueber meine Frage: wie es der Mann über sich bringen konnte, sich hier unter den Farbigen niederzulassen, erhielt ich die Antwort: »Wohne nicht lange hier, habe über 300 £ St., die ich mir durch langjährige Arbeit in der Colonie erworben, in jenen verlassenen Diamantengruben dort drüben eingebüßt; nun muß ich Taglöhnerarbeit verrichten, und in allen diesen Mühen, Sorgen und Enttäuschungen fand ich an diesem farbigen Weibe ein so treues, aufopferndes und mitfühlendes Wesen, daß ich mich nicht leicht von ihr trennen könnte.«
Trotz häufiger Regenschauer, welche sich während unseres Aufenthaltes in Klipdrift eingestellt hatten, dachten wir nicht daran, unser bisher gewohntes Nachtlager unter dem Wagen aufzugeben; unser Erfindungsgeist fand bald eine entsprechende Abhilfe. Dem Nachtlager war aber auch nicht ein gewisser origineller und phantastischer Zug abzusprechen. Unsere Diener schienen nicht nur in der Mythologie Süd-Afrika's wohl bewandert zu sein, sondern auch unter den Göttern des Alterthums so manchen Gönner zu haben, vor Allem schien Bacchus ihr Schutzpatron und Morpheus ihr Liebling zu sein. Wenn wir sie nicht zur Arbeit angehalten hätten, wären sie im Stande gewesen, sechs Stunden des Tages dem Dienste des ersteren, und den Rest des Tages dem Letzteren zu widmen. Ja, Gert trieb es so weit, daß er oft während des Mahles einschlief.
Nachdem wir uns mit etwas Provision, namentlich Mehl, Thee und Zucker versorgt, verließen wir Klipdrift und brachen nach Norden zu, gegen die Vereinigung des Hart-River mit dem Vaal-River, in die von den westlichen Batlapinen bewohnten Landstriche auf, wobei ich noch einige der flußabwärts liegenden, verlassenen River-Diggings und zunächst das auf halbem Wege liegende Gong-Gong berühren wollte. Die durchreiste Gegend war ein mäßig hügeliges, nach Westen zu dem Vaalfluß' steil abfallendes, nur stellenweise dichter bebuschtes Hochplateau, auf welchem einige Niederlassungen der Koranna's und Batlapinen zerstreut lagen.
Für den Jäger wie Naturforscher hat das Land zwischen dem unteren Hart- und Vaal-River insoferne besonderes Interesse, als man von Süden her hier zuerst das von den holländischen Farmern »blaues Wildebeest«, von den Betschuana's »Kokon« genannte, gestreifte graue Gnu (Catoblepas Gorgon) rudelweise antrifft. Es breitet sich von hier und von den nördlichen Gegenden des Oranje-Freistaates nach Norden zu bis über den Zambesi aus und ist größer als das schwarze oder gemeine Gnu, dabei auch minder wild. Seine Hörner unterscheiden sich auch wesentlich von jenen des gemeinen Gnu, sie sind nämlich nach vorne und innen gebogen und ähneln denen mancher unserer kurzhörnigen Rindviehracen.
Die Jäger unterscheiden beide Arten nach der Farbe der Schwanzhaare, indem das schwarze durch einen weißen, das auf bläulich-grauem Grunde, namentlich am Vorder- und Oberkörper schwarz gestreifte Gnu durch einen schwarzen Schwanz schon aus großer Ferne erkennbar ist. In den baumlosen Ebenen von den westlichen Theilen der Cap-Colonie bis zum 23. Grad nördlicher Breite ist es neben den Springbock- und den Bläßbockgazellen das häufigste Wild.
In später Nachmittagsstunde bogen wir in eine kleine Schlucht ein, an derem Ausgange im Vaalthale einige Segeltuchhäuschen und Zelte sichtbar wurden; es waren die Reste des einst so blühenden Gong-Gong, das anmuthig aus dem dunklen Grün üppiger Laubbäume hervorlugte. Auch fehlten einige Koranna- und Betschuanahütten nicht, die auf dem felsigen und niedrigen Abhange des Plateau's zwischen den Steinblöcken erbaut waren. Gegenüber von Gong-Gong liegt das noch ärmlicher aussehende Waldeks-Plant.
Wir schlugen im Dörfchen selbst auf einer einladenden Rasenstelle unser Lager auf. Ein Wagen war für Gong-Gong und Waldeks-Plant etwas nicht Alltägliches und so waren wir bald Gegenstand der allgemeinsten Aufmerksamkeit geworden.
Die Diamantengruben von Gong-Gong lagen auf dem Abhange; jene im Thale, unmittelbar am Flusse und im alten Flußbette waren schon seit Langem verlassen. Mehr Leben fand ich in Waldeks-Plant, welches sich auch durch den Fund zweier schönen Steine in einer und derselben Grube einen Namen errang. Es war ein gelblicher Stein, der 288¼ Karat wog und ein zweiter weißlicher, der in seiner Mitte einen schwärzlichen Fleck zeigte, einer Fliege nicht unähnlich und deshalb auch der »Fly-(Fliegen-)Diamond« genannt wurde. Ihr Finder wollte einst nach langer fruchtloser Arbeit seinen Claim verkaufen, doch Niemand fand sich, der auf seine Forderung eingegangen wäre; um nicht müßig zu sein, entschloß er sich allein, ohne Beihilfe schwarzer Diener, das Graben und Suchen fortzusetzen. Das bishin treulose Glück lächelte ihm nun zu und er fand zuerst den großen, kurze Zeit darauf den Fly-Diamond und ward über Nacht ein »gemachter Mann«. Der Werth des großen Steines wurde damals mit 10.000 £ St. angegeben und ich erinnere mich, daß er nach meiner Rückkehr von der ersten Reise in den Central-Diggings längere Zeit hindurch gegen 1 Shilling Entrée ausgestellt war.

[Batlapinenknaben den Kiri werfend.]
Von Gong-Gong schlugen wir eine nördliche Richtung nach dem Hart-River ein; einige weiße, aus der Ferne entgegenschimmernde Punkte an den zum Vaal sich steil herabsenkenden Felsenhügeln bezeichneten uns die Stellen, wo noch vor wenigen Jahren die blühenden River-Diggings New-Kierke-Rush u.a. lagen. Die Strecke von Gong-Gong bis Delportshope (dieses nicht ganz eine Meile von der Hart-Rivermündung entfernt) gehört gewiß zu den unbequemsten, die ich je mit einem Wagen passirte. Ich konnte es nicht fassen, wie zur Zeit der Blüthe der River-Diggings auf solchen Verkehrspfaden die Bedürfnisse von Tausenden von Menschen mittelst der Achse herbeigeschafft wurden. Auf der ganzen zurückzulegenden Strecke glich der als Fahrweg benützte Erdstreifen einem von Wasserfluthen ausgewaschenen Geröllboden. Die Fahrt über diese Chaussee war, wie leicht denkbar, eine martervolle; kaum war das eine Hinterrad aus einem der zahllosen wassergefüllten Löcher durch die vereinten Anstrengungen der Thiere und die virtuose Handhabung der riesigen Peitsche von Seite des Korannatreibers herausgefördert, als schon wieder eines der Vorderräder über einen fast fußhohen Block hinaufgezerrt wurde. Um das Maß voll zu machen, begannen die des Joches ungewohnten Zugthiere in störrischester Weise ihre Dienste zu versagen.
Kein Wunder, wenn diese Fahrt die dreifache Zeit in Anspruch nahm. Ein Blick auf die zu beiden Seiten des Weges zerstreut umherliegenden Wagentrümmer gewährte uns einen, wenn auch schwachen Trost; wir waren nicht die einzigen, die unter diesen Qualen zu leiden hatten. Leider waren dieser Fahrt alle meine Thermo- und Barometer zum Opfer gefallen. Die Begegnung mit einem Batlapinen, der an einem Kiri, einer bei den Zulu und Betschuana beliebten Waffe, ein Häschen trug, nahm mein ganzes Interesse in Anspruch. Die Waffe ist aus Holz (bei den nördlichen Bamanquato auch aus dem Horne des Rhinoceros) gearbeitet, 20-90 Centimeter lang und läuft an einem Ende in eine hühnerei- bis faustgroße, einfache oder geschnitzte Kugel aus. Im Handgemenge ist der Kiri eine sehr wirksame Waffe, auch findet er auf der Jagd Verwendung und einige Stämme werfen ihn mit wahrhafter Virtuosität. Bei den Matabele ist der Kiri jene furchtbare Waffe, mit welcher diese Zulu's die Schädel der männlichen, erwachsenen Bevölkerung der rebellirenden Makalakadörfer einschlugen.

[Batlapine.]
Nebst dem Hasen trug der Mann auch ein Paar aus gegerbtem Leder gearbeitete, mit Thiersehnen sauber zusammengenähte Unaussprechliche, welche ich ihm sammt der Jagdbeute und der Waffe abkaufen wollte. »Nein,« antwortete er, im gebrochenen Holländisch, »det brüke« (die Betschuana's haben in ihrer Sechuana[1] keine Benennung für viele der von den Europäern eingeführten Artikel, darum nehmen sie das dafür im Holländischen oder Englischen gebräuchliche Wort, es natürlich verunstaltend, oder sie umschreiben es durch mehrere ihrer eigenen Sprache), »bring' ich zu meinem »Bas« (Herrn) nach Klipdrift,« den Hasen, meinte er, könne er selbst gut brauchen und den Kiri könne er uns schon gar nicht überlassen, da er seiner zum Schutze gegen die Phyci (Hyäne) bedürfe. Wie der in der Colonie wohnende Kaffer auf seinen Wanderungen stets seine beiden, in der Regel aus Eisen oder Assagaiholz gearbeiteten Stöcke mit sich führt, so nimmt auch der Betschuana und Zulu seinen Kiri mit. Hat er auf der Weide oder im hohen Grase eine Zwergtrappe bemerkt, so sucht er sich so nah' als möglich anzuschleichen, erhebt sich dann plötzlich, um den Vogel zum Auffliegen zu bringen und in diesem Momente saust sein kleiner, am Ende verdickter Stock durch die Lüfte. Er thut dies ebenso geschickt, wie er sich als Schütze ungeschickt benimmt. Das Wild auf den unabsehbaren Ebenen zwischen dem mittleren Hart-River und dem oberen Molapolaufe ist durch diese Ungeschicklichkeit äußerst scheu geworden.
1 Die Sprache der Betschuana's.
Nach und nach senkte sich das Land gegen den Hart-River, dessen Thal breit und offen erschien, und im Norden aus der Ferne durch den »N'Kaap«, den bebuschten und felsigen Abfall des Hochlandes begrenzt wird. Die Vereinigung des Hart- und Vaal-Rivers wurde mir immer als ein besonders schönes Landschaftsbild geschildert, ich fand dies blos als Gegensatz zu dem an schönen Naturscenerien so armen Gebiete Griaqualand-West bestätigt.
Von Süden kommend, breiten sich hier die vorher über Stromschnellen dahin rauschenden Gewässer des Vaalflusses in einem geräumigen schlammigen Bett aus, wo sie ruhig dahinfließend sich gleichsam etwas Rast gönnen um unmittelbar vor der Mündung des aus Nordost kommenden Hartflusses eine plötzliche Wendung nach West zu machen, und nachdem sie diese Richtung für eine kurze Strecke verfolgt, eine entschieden südsüdwestliche zu nehmen. Das linke Vaalufer an der Biegung ist sumpfig, mit hohen Bäumen bestanden und birgt so manche Wildkatze, Luchse und ähnliches Raubgethier, sowie einige Heerden verwilderter Schweine.
Die südliche Partie des rechten Ufers, in den oberen Schichten aus Humus, in den unteren aus Lehm gebildet, ist eine fruchtbare, nur unmittelbar an der Flußmündung mit hochstämmigen Bäumen bewachsene Ebene. Das jenseitige Ufer des Hartflusses ist viel höher, steigt auch zu einer Felsenhöhe empor, die von Schieferlagern gebildet und von petrefactenarmem Kalk überlagert, jene oben erwähnte nach dem N'Kaap hinziehende Hochebene bildet. Diese Höhe fällt unmittelbar am Vaalflusse oberhalb der Biegung steil ab, und wird von einer hier einmündenden Schlucht getheilt, welche ich manches interessanten Fundes halber (meiner Vaterstadt zu Ehren) die Holitzer Schlucht nannte und die kaum 300 Schritt von der Hart-Rivermündung entfernt liegend, mit der von Hübner entdeckten Klippdachsgrotte nicht zu verwechseln ist. Beide Ufer des unteren Hart-River gehörten früher zum Besitze des 3 englische Meilen entfernt am rechten Ufer in der »Stadt« Lekatlong wohnenden Batlapinenfürsten Jantsche, der gegenwärtig als englischer Unterthan eine jährliche Subvention von 200 £ St. erhält.
Der Abstieg von der hohen Ebene von Gong-Gong in das Hart-Riverthal führte uns an dem im bereits bekannten südafrikanischen Styl erbauten Gehöfte eines Store-Keepers (Kaufmannes) vorüber. Der freundliche Empfang, den wir bei diesem fanden, brachte uns bald näher und so erfuhr ich, daß er ein Deutscher sei, der an eine holländische Frau verheirathet, im nahen Delportshope sein Glück im Diggen versuchte, dabei aber noch ein kleines Tauschgeschäft mit den Batlapinen des unteren Hart-Riverthales betrieb und das Holz der Kameeldornbäume, die hier das jenseitige Ufer des Vaal dicht bedeckten, auf dem Markte in Kimberley verkaufte.
Seine uns bewiesene Gastfreundschaft und das Bestreben, sich uns gefällig und nützlich zu erweisen, hätte bald ein Menschenleben gefordert. Als er meine naturhistorischen Sammlungen, all' die von ihm so verabscheuten Reptilien und das giftige Gewürm in theurem Spirit of wine (Spiritus) präparirt sah, war sein Erstaunen nicht gering, da er aber bemerkte, welchen Werth ich auf die Acquisition schöner Exemplare dieses »Gut« (spr. Chut) legte, war er bemüht, mir solches zu verschaffen. Besondere Freude glaubte er mir durch den Fang einer Fischotter[1] zu bereiten. Da es schwer hielt, die scheuen Thiere lebendig zu fangen, wollten er und seine Freunde mir mindestens zu einigen Bälgen verhelfen. Ein junger Holländer hatte deshalb sein altes Schrotgewehr geladen, jedoch zu stark, beim Schusse barst das Gewehr—glücklicherweise ohne den Schützen oder Jemanden seiner Umgebung zu verletzen.
1 Ich beobachtete drei Fischotterarten in Süd-Afrika, eine in den Strömen der südlicheren Partien und zwei im Limpopo- und Zambesi-Gebiete. Wenn die eine auch größer als die unsrige ist, hat doch keine der drei Arten einen gleich werthvollen Pelz.
In der durch Jahrtausende hindurch thätige Erosion ausgewaschenen Felsenmulde der Holitzer Schlucht, machte ich bei näherer Besichtigung derselben die interessante Entdeckung, daß dieselbe ein wahres schützendes Asyl für die artenreiche niedere Thierwelt und ein natürliches Treibhaus für die Vegetation sei. Während ich an den offenen Ufern des Vaal körner- und insectenfressende Singvögel nur in kleinen, mehrere Pärchen zählenden Colonien vorfand, wiederhallten hier die dichtbebuschten, bald terrassenförmig, bald steil abfallenden Wände der Schlucht von dem tausendstimmigen Gezwitscher der verschiedenartigsten Sänger. Die Bezeichnung »schützendes Asyl« ist eine um so zutreffendere, wenn wir die Lage und Umgebung der Schlucht näher in's Auge fassen. Die Schlucht—offenbar nur die Fortsetzung, d.h. das durch das Wasser muldenartig ausgewaschene Ende eines seichten Wiesenthales der Hochebene—ist an ihrem oberen Rande derart von dichten und dornigen Büschen eingerahmt, daß nur sehr kleine Thiere ungehindert Zu- und Ausgang finden; nach unten ist sie vom Flusse aus begrenzt, dessen steiles und hohes Felsufer, eine wirksame Schutzwehr gegen mordlustige Eindringlinge bildet.
Am Grunde der Schlucht, unter dem Schatten breitstämmiger, dichtbelaubter Bäume, erfreut uns das dunkle, saftige Grün eines üppigen Rasens; hier konnten wir das muntere Treiben der Springhasen, kleiner Gazellen, des Klippdachses und der Wildenten belauschen, während aus dem dichten Laube der Bäume das Geschnatter einer hier in Ruhe nistenden Chenalopex (Gansart) heraustönte. Den Reiz dieses verborgenen Erdenwinkels erhöhte das Rauschen eines von den dichten beerenbehangenen Büschen fast völlig verdeckten Wasserfalles im oberen Theile der Schlucht, dessen Ufer (von einer Kalksteinlage überdeckter Sandstein) grottenähnlich ausgehöhlt sind. Zur Trockenzeit versiegt nun allerdings das die ganze Scenerie belebende Rauschen des Bächleins. Mein Entzücken über dieses aus der anmuthslosen Umgebung edengleich hervorstechende Plätzchen war vollständig, als ich am Boden der Schlucht eine dichte Lage von Fossilien der letzten Alluvial Periode, darunter auch eine Tigerschneckenart entdeckt hatte.
An einem der zahlreichen, sein Geäste über die Schlucht ausbreitenden Bäume entdeckte ich einen mächtigen Nestbau, den ich für den eines Affen hielt, jedoch später erkannte, daß er einem der größten befiederten Nestkünstler, dem Hammerkopf angehöre. Dieser etwa 18 Zoll hohe, durch ein schön braunes Gefieder und einen langen Schopf am Hinterkopfe ausgezeichnete Vogel baut zwischen den Gabeln starker Aeste meist solcher Bäume, welche Abgründe und Flüsse überhängen, oder zwischen steilen Felsenklüften sein 18 Zoll bis 3 Fuß hohes im oberen Umfange 6-8 Fuß haltendes, nach unten spitzig zulaufendes Nest, das einem abgestutzten, oben umgekehrten Kegelkörper nicht unähnlich ist. Das Ganze stellt einen soliden, oben gedeckten und eine geräumige Kammer enthaltenden Bau dar; in die Kammer führt eine viereckige 8-10 Zoll im Quadrat messende Oeffnung. Der Bau, in dem eine Menge von Knochen anzutreffen sind, ist meist aus Reisig aufgeführt.
Doch auch dieses Eden, vielleicht nicht unrichtig mit einem im tauben Flußgerölle verborgenen Diamanten zu vergleichen, hatte seine Schlangen. Ich fand in der Holitzer Schlucht nicht weniger als sieben Arten, unter diesen zwei Species der in ganz Süd-Afrika wohl bekannten Cobra. Das erste Thier erblickte ich in dem Momente, als ich Insecten suchend, einen schweren Stein aufhob. Anfangs bemerkte ich nur, daß sich unter demselben in einer mäßigen Vertiefung die Reste eines Mausnestes befanden; der durch das Laubdickdicht dringende Sonnenstrahl ließ mich aber sofort die glitzernde Haut einer Schlange erkennen. Da ich keine geeignete Angriffswaffe bei mir hatte, blieb ich unbeweglich stehen, um nach der Flucht der Schlange das Nest nach kleinen Insecten durchstöbern zu können. Ich hatte auch nicht lange zu warten; durch die warmen Sonnenstrahlen geweckt, löste sich aus dem weichen Wollbettchen ein über vier Fuß langer Knäuel auf. Beim Emporrichten erblickte mich die Schlange sofort und schon fauchte sie, wie es die Cobras[1] thun, mit dem vorderen Drittel ihres Körpers aufgerichtet, nach mir herüber. Dabei blähte sie den dunkelgefärbten, ringförmigen, etwa zwei Zoll breiten Halstheil auf und züngelte lebhaft mit der gespaltenen dunklen Zunge. Meine Haltung mußte in ihr die Besorgniß einer drohenden Gefahr erweckt haben, denn sie verschwand bald darauf im dichten Gebüsch.
1 Obgleich ich während meines siebenjährigen Aufenthaltes mehr als 200 Schlangen erlegte, beobachtete ich in Süd-Afrika außer den drei Mambaarten keine Schlange, die ungereizt den Menschen angreifen würde.]

[Nest des Hammerkopf (Scopus Umbretta).]
Bevor ich mich auf diese erste Versuchsreise begab, hatte ich eines Tages, als ich mit meinem Gefährten F. zwischen den Gesteinen auf den Ebenen zwischen Dutoitspan und Kimberley nach Insecten und Echsen fahndete, eine über 5 Fuß lange Cobra angetroffen; es war ein Exemplar von seltener Schönheit, und da ich keine bessere Waffe zur Hand hatte, griff ich schnell entschlossen nach einem der zahlreich umherliegenden Ochsenskelette, brach eine Rippe davon ab und verfolgte das Reptil. In die Enge getrieben, wendet sie sich plötzlich um und richtete sich fast hart vor mir hoch auf; ich war aber schon zu weit vorgebeugt, um zurückweichen zu können, ein minutenlanges Zagen und ich war verloren, doch meine Geistesgegenwart verließ mich nicht, ein kräftig und sicher geführter Hieb in den Nacken und das schöne aber gefährliche Thier war mein; mit triumphirender Miene trugen wir das um die Rippe gewickelte Reptil heim.
Unter allen südafrikanischen Giftschlangen halte ich die Mambaarten, eine grüne, eine schwarze und eine gelbliche Species für die gefährlichsten. Mir sind Fälle bekannt, daß Mamba's (von den beiden ersten Arten, welche die wärmeren Buschpartien an der Küste bewohnen) nach dem Erblicken eines Menschen sofort zum Angriffe übergingen. Ich will hier nur eines solchen gedenken. Einige Kaffernkinder, die sich in den nur einige hundert Schritte vom Hause entfernten Büschen spielend ergötzten, wurden einer aus diesen hervorschleichenden Mamba gewahr; die Gefährlichkeit des Thieres kennend, wandten sie sich sofort auf der nahebei vorüberführenden Straße zur Flucht; nach einer Weile im Laufe innehaltend, blickten sie hinter sich und mäßigten nun, nachdem sie das Thier nicht mehr erblickten, ihre Schritte. Wenige Minuten darauf aber schrie plötzlich eines der Kinder laut auf, die Schlange hatte ihrerseits deren Verfolgung nicht aufgegeben und nun eines derselben in die Ferse gebissen. Eine Viertelstunde später war das Kind eine Leiche.
Die schmutzig-ockergelbe Mamba der wärmeren, nördlichen Partien des centralen Süd-Afrika, gibt auf eine andere, in den Mapaniwäldern der Sibanani-Ebene häufig zu beobachtende Weise den Rach- und Mordsinn[1] ihrer Familie zu erkennen. Auf Wildpfaden, da wo diese zum Wasser führen und wo sich zwei brüchige und hohle Mapanibäume einander gegenüberstehend mit ihren dichten, doch nicht breiten, unscheinbaren Kronen berühren, wird man diese Mamba finden. Sie liegt in dem Geäste und zwischen dem dichten ölhaltigen Laube der Bäume auf der Lauer; nähert sich ein Geschöpf, so rollt sie sich mit dem Schwanze um einen Ast und läßt sich mit dem Vorderkörper nach abwärts, hier aus dem Gezweige zwischen den zwei Stämmen nach dem Pfade zu wie ein Assagai herunterhängend. Da sie keine auffallende Farbe besitzt, wie ihre grüne und schwarze Schwester, so wird sie namentlich von dem Europäer gar nicht bemerkt und kann so bei der Heftigkeit ihres Giftes leicht sehr gefährlich werden.
1 Ich schreibe ihr ausdrücklich Mordlust zu, denn sie ist nie im Stande, die von ihr getödteten Thiere zu verschlingen.
Am selben Tage als ich in der Holitzer Schlucht jener Cobra gegenüberstand, wurde auch einer meiner farbigen Diener nicht wenig durch eine ähnliche Schlange erschreckt. Eben damit beschäftigt, ein angeschossenes Täubchen aus dem Dickicht des Uferabhanges herauszusuchen, sprang er plötzlich mit einem lauten Schrei aus den Gebüschen und eilte mit dem Rufe »Sir a Slang« zu mir. Alle Eingebornen, mit Ausnahme der unter den Zulus als Zauberer bekannten Medicinmänner, fürchten sich ähnlich wie die Affen, ungemein vor diesen Reptilien. Zwei Tage später erschoß ich am Grunde der Schlucht eine jener kurzen, schwarzen, von den holländischen Farmern ob ihres weißen, die untere Halspartie kennzeichnenden Fleckens Ringhals benannten Schlangen. Der früher erwähnte Kaufmann, dem ich mein Zusammentreffen mit dieser Schlange mittheilte, wußte mir etwas mehr über diese Schlangenart zu erzählen; eines Vorfalls, von dessen Wahrheit ich mich nur zu sehr durch andere ähnliche in der Folgezeit beobachtete Thatsachen überzeugen konnte, sei hier gedacht. Einige Monate vor meiner Ankunft fiel es dem Farmer auf, daß eine seiner täglich am jenseitigen Ufer weidenden Kühe regelmäßig durch mehr denn zwei Wochen um ein bis zwei Stunden später als die übrigen Thiere der Heerde in's Gehöfte zurückkehrte. Da es in der Nähe keine gefährlichen Raubthiere gab, ließ man die Thiere ohne Hirten auf die Weide gehen. Als nun dem Besitzer das eigenthümliche, tägliche Ausbleiben des einen Thieres auffiel, sandte er einen seiner Diener aus, um die Ursache dieser auffälligen Verspätung zu erforschen. Schon nach kurzer Zeit hörte der Farmer den Ruf des Dieners: »Bas, Bas, fat det rur[1] (Herr, fasse das Gewehr) und komm, schnell herüber, ein Ringhals säugt an Deiner Kuh.« Aeußerst begierig den Vorfall zu sehen, rief der Farmer seine Freunde zusammen und eilte nach dem Flusse. Unweit des Flusses sah er die Kuh gemächlich niedergekauert grasen, und um ihre Hinterfüße zur Hälfte geschlungen hielt sich ein Ringhals aufrecht an einem der Euter begierig saugend. Er war schon vollgesogen und hatte ganz das Aussehen eines riesigen Blutegels; der schwer angeschwollene Leib glitt fortwährend ab. Bevor die erstaunten Zuseher noch in die Nähe gelangt waren, verschwand die Schlange spurlos in den Büschen. Am folgenden Tage gelang es den Farmerleuten, sich ganz leise dem Busche zu nähern und das vollgesogene Reptil gefahrlos zu erlegen.
1 Geschrieben wie es ausgesprochen wird.

[Mamba auf der Lauer.]
Etwas Aehnliches ereignete sich einige Jahre vor meinem Besuche Süd-Afrika's in dem Freistaat-Städtchen Philipolis. Einer meiner Freunde, Mr. K., den ich in den Diamantenfeldern kennen lernte, war daselbst in dem Geschäfte eines Herrn H. thätig und wohnte in dessen nächster Nähe, in einem etwas höher als das Niveau der Straße stehenden, aus Backsteinen solid erbauten Hause. Er war eines Nachmittags mit einigen Boers beschäftigt, als ihn seine Magd mit der Nachricht abrief, daß sein kleines Kind in Lebensgefahr schwebe. Ohne Ahnung, was diese Nachricht zu bedeuten habe, ließ der Mann Waare und Käufer im Stich und eilte nach Hause. Heimgekommen findet er seine Frau vor Schrecken wortlos im Vorhause, während ihm sein Töchterchen in kindlicher Harmlosigkeit erzählte, daß eine lange schwarze Katze aus Baby's Flasche die Milch trinke. Mr. K. eilte in die Kinderstube und findet sein kleines Kind schlafend, auf der Erde die halbgeleerte, mit einem Gummisauger versehene Milchflasche. Unterdessen hatte sich die Frau einigermaßen von dem tödtlichen Schrecken erholt und begann den Vorfall zu erzählen. Als ihr das kleine Töchterchen von einer schwarzen, langen Katze erzählte, da war sie sofort zum Baby geeilt; ein ihr Mutterherz mit Entsetzen erfüllender Anblick bot sich ihr; eine schwarze Schlange, die neben dem Säugling zusammengerollt lag und aus der halbliegenden Flasche, die dem schlafenden Kinde aus dem Munde entschlüpft war, Milch sog. »Mit einem Schrei stürzte ich heraus und das mußte wohl das Reptil so erschreckt haben, daß es herunterfiel, oder sich irgendwo im Bettzeug versteckte, ich hörte auch die Flasche fallen, dann fühlte ich ein solches Zittern, daß ich nicht mehr das Zimmer betreten konnte.« Mr. K. sah sich erst im Zimmer nach der Schlange um, und der erste Blick, den er unter das Bett warf, überzeugte ihn, welchen gefährlichen Gast das Zimmer beherberge. Um die Schlange anzulocken und sie sicher zu treffen, schob er die Flasche mit dem Sauger nach dem Reptil zu unter den Rand des Bettes, während ihm seine Frau einen Kiri brachte. Die Schlange konnte dieser Lockung nicht widerstehen, doch im nächsten Augenblicke zerschmetterte ein einziger Schlag Schlange und Flasche. Nach Jahren erst erfuhr Baby[1] in welcher Gefahr sie geschwebt und welch' wunderliche, schwarze Katzen es früher in Philipolis gab.
1 Baby nennt man ein kleines, unmündiges Kind, und zwar stets das Jüngste.
In geographischer Hinsicht war es mir von großem Interesse, die Tiefen der von mir überschrittenen und besuchten Flüsse kennen zu lernen, und ich war, wo dies nur immer anging, und nicht Krokodile ein solches Beginnen vereitelten, bemüht, diesbezügliche Messungen anzustellen; in Ermanglung eines Bootes und anderer Apparate mußte ich die Tiefe an meiner Person selbst erproben. Ein Unfall im Harts-River, der mich näher als ich ahnte, an den Rand des Grabes brachte, verleidete mir für die Folge solch' gewagte Experimente immer mehr, bis ich sie schließlich ganz aufgab.
Es sei mir hier gestattet, diesem Unfall einige Worte zu widmen. Um eine passende Uebergangsstelle für meinen Wagen zu finden, mußte ich die Tiefe des nahe unserem Lagerplatze 6-8 Meter breiten Harts-Rivers untersuchen. Ich fand endlich eine mir günstig scheinende Stelle, die hohen und trockenen Ufer, die geringe Wassertiefe von 14-16 Zoll in dessen Nähe, bestärkten mich in der Hoffnung, die richtige Furth gefunden zu haben. Nachdem ich mit einem kühnen Wurfe den nothwendigsten Theil meiner Garderobe an das jenseitige Ufer befördert, ging ich daran, den Fluß zu übersetzen; schon nach dem ersten Schritt versanken meine Füße in tiefem Schlamm, langsam und vorsichtig den Grund prüfend, hatte ich etwa die Mitte der Flußbreite erreicht, ich stand in zwei Fuß tiefem Schlamm und ebenso tiefem Wasser. Jeder weitere Schritt zeigte mir, daß die Schlammschichte an Tiefe zunehme, ich wollte nur noch einen Schritt nach vorwärts versuchen und wenn die Tiefe nicht abnahm, umkehren, doch dazu kam es nicht mehr; ich sank immer tiefer und tiefer. Dabei fühlte ich, wie der Schlamm immer zäher und consistenter wurde.
Ein Hilferuf hätte kaum Erfolg gehabt, denn der Wagen war zu weit entfernt. Meine Lage war, ich muß gestehen, eine mich im höchsten Grade beängstigende. Schon umspülte das Wasser mein Kinn, und ich schien rettungslos verloren, als ich im Bewußtsein der eminenten Gefahr, vielleicht instinctmäßig den Oberkörper mit einem gewaltsamen Ruck nach vorwärts bog und mit den Händen die Bewegungen des Schwimmens versuchte. Ich kam so, nachdem die Brust die dünne oberste Schlammlage zertheilt hatte, mit Gesicht und Brust unter das Wasser, flach auf den Schlamm zu liegen; ein mit aller Kraft unternommener Versuch, den einen Fuß aus dem zähen Schlamm zu befreien, glückte. Doch nun drohte mir der Erstickungstod im Wasser und ich mußte wieder den Kopf über Wasser halten, um Athem zu schöpfen. Es war indeß kein Moment zu verlieren, wollte ich nicht den errungenen Vortheil opfern; ich wiederholte den vorerwähnten Versuch und endlich fühlte ich den zweiten Fuß aus seiner Umklammerung befreit. Ein zweiter Ruck nach vorwärts und es gelingt mir, meine Hände in den festen Schlamm des jenseitigen Ufers einzugraben. Ich war gerettet. Es bedarf wohl keiner weiteren Worte um meine Stimmung, meinen Körperzustand zu schildern, als ich wieder festen Boden unter mir fühlte.
Ich hatte mich kaum von der natürlichen Aufregung in Folge des mir zugestoßenen Unfalls erholt, als mir schon am folgenden Tage eine andere, höchst empfindliche Ueberraschung erwuchs und ich den bei vielen afrikanischen Stämmen so hoch entwickelten Diebssinn kennen lernte. Mein Reitpferd war plötzlich verschwunden, vergeblich alle unsere vereinten Bemühungen, eine Spur der Diebe zu entdecken. Erst nach sieben Jahren, gelegentlich eines Ausfluges, den ich aus den Diamantenfeldern nach dem Vaal machte, erfuhr ich von dem bereits mehrfach erwähnten Kaufmann, daß Jantsche's Leute das Pferd gestohlen hatten.
Nach mehrtägigem Aufenthalte an dieser mir in lebhafter Erinnerung bleibenden Stelle setzten wir unsere Reise im Thale des Hart-Rivers aufwärts fort.
Ab und zu verengt oder erweitert sich das Thal, je nachdem die es zu beiden Seiten begrenzenden, zumeist parallel laufenden Felsenhöhen näher aneinander oder weiter auseinander rücken, und behält diesen Charakter bis in die Nähe des Hauptortes des freien Batlapinenreiches, Taung. Von der Fruchtbarkeit des Bodens gaben die durchschnittlich ¼-½ Aere Flächeninhalt messenden und gut bebauten Felder Zeugniß, deren Gesammtausdehnung ich zu 1000 Schritt Länge und 2-400 Schritt Breite schätzte. Etwa hundert einzeln oder in kleinen Gruppen die Parzellen dieser bebauten Fläche bearbeitende Frauen belebten diese Strecke. Hier war eine Gruppe damit beschäftigt, die reifen Maiskolben abzubrechen, dort wieder das Feld auszujäten, andere wieder bearbeiteten mit äußerst primitiven Hauen den Ackerboden. Manche der Maispflanzen standen noch sehr niedrig, dagegen waren bereits Kürbisse und Wassermelonen in der Reife so weit vorgeschritten, daß den arbeitenden Frauen das Vergnügen vom Gesichte abzulesen war. Unter den Frauen bemerkten wir auch Mädchen und Greisinnen, denen die leichten Arbeiten, namentlich das Grasjäten und das Zusammentragen der Maiskolben oblag. Mehrere der Frauen trugen einen Säugling in einem Ledersacke am Rücken befestigt, oder hatten ihn auf einer auf der Erde liegenden kleinen Carosse gebettet, umgeben von mehreren bereits den Kinderschuhen entwachsenen Vertretern der hoffnungsvollen Jugend von Lekatlong, welche sichtlich bemüht waren, den kleinen Schreihälsen die Zeit und die quälenden Fliegen zu vertreiben, welches letztere sie theils mit Blättern, theils mit aus Thierschwänzen verfertigten und auf Holzstäbchen befestigten Wedeln mit wechselndem Erfolge zu Stande brachten. Manche der Frauen hatten blos einige Lappen (meist die Mädchen), andere eine kurze bis zu den Knieen reichende, glatt gegerbte Carosse um die Hüften geschlungen, andere wieder ein kurzes, viereckiges Fell als Vorder- und ein größeres, mit eingenähten schwarzen Lederringen geschmücktes als Rückenschürze benützt. Von der Stirn perlender Schweiß gab Zeugniß, daß sie wacker zur Arbeit hielten. Als Schmuck trugen die meisten Schnüre von großen blauen Glasperlen am Halse, aus Messingdraht geflochtene Ringe an den Armen und aus einem ähnlichen Material gearbeiteten Ohrschmuck, der jedoch bei den ärmeren nur aus rundlichen Holzpflöckchen bestand. Den Kopf hatten beinahe alle mit einem kegelförmigen aus Stroh oder aus Binsen und Gras geflochtenen, tief in's Gesicht fallenden Hute bedeckt, der ihnen unter ein »pund« (£ St.) nicht feil war.
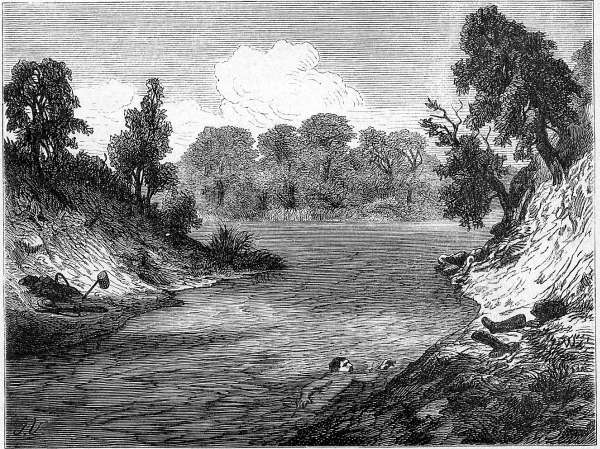
[Im Schlamme des Harts-River versunken.]

[Ackerbau bei den Batlapinen.]
Das heitere und spöttische Lachen der schwarzen Schönen galt besonders unserem Begleiter F., dessen herausforderndes Benehmen das Hauptziel ihrer Witze bildete,—diese fröhliche Stimmung der Batlapinen erleichterte auch den lebhaften Tauschhandel, der sich an unserem Reisewagen entwickelte und bei welchem wir gegen einige Stückchen Transvaaltabak und einige färbige Taschentücher unseren Bedarf an Melonen und Kürbissen einhandelten.
Von Lekatlong nach Wonderfontein.
Batlapinenleben.—Webervögel und ihre Nester.—Zuckerrohr-Pflanzungen.—Spitzkopf.—Mitzima's Dorf.—Schlauheit der Batlapinenweiber.—Termitenbauten.—Reisende Batlapinen.—In Lebensgefahr.—Springbockfontein.—Transvaal-Emigranten.—Gassibone und seine Residenz.—Tauschhandel.—Wanderheuschrecken.—Ein seltsamer Labetrunk.—Am Vaal-River.—Wasser- und Landleguane.—Christiana, die westlichste Transvaal-Stadt.—Einfache Rechtspflege.—Landschaftlicher Contrast der beiden Vaalufer.—Bloemhof.—Ein gefährlicher Nachtmarsch bei Gewittersturm.—Waidmann's Eldorado.—Königskraniche.—Gnu und Bläßbock.—Romberg's Farm.—Von schwarzen Gnu's überrascht.—Hühnervögel.—Klerksdrop.—Potschefstroom.—Das Moi-Riverthal.—Geognostische Entdeckungen—Wonderfontein und seine Grotten.
Die Hauptstadt des südlichsten der Batlapinenstämme, Lekatlong (der Name bedeutet Vereinigung, wohl in Bezug auf die beiden Flüsse), die Residenz des Fürsten Jantsche, bestand aus circa 160-200 Hütten, welche drei größere Gehöftgruppen bildeten, in welchen je 2-4 Hütten zu einem Gehöft vereinigt waren. Die einzelnen Gehöfte waren von einem 4-6 Fuß hohen, aus dürren Zweigen hergestellten Zaune umgeben. Die Hütten der mittleren Gehöftgruppe zeigten die emsigste Arbeit, auch reichte die Gruppe bis an den Fluß. In ihrer Mitte standen auf einem freien Platze die Ruinen eines Missionsgebäudes, welches einige Jahre zuvor abgebrannt war. Zur Zeit meines Besuches hielt sich hier kein Missionär auf, in neuerer Zeit soll jedoch von der »London Missionary-Society«, in deren Wirkungsbezirk Lekatlong gehört, ein solcher dahin delegirt worden sein. In einiger Entfernung vom Missionshause erhob sich die Kirche, ein längliches, aus ungebrannten Backsteinen aufgeführtes, unscheinbares Gebäude, dessen Giebeldach mit dürrem Grase gedeckt war.
Vom rechten Ufer aus gesehen bot die Stadt mit ihren regelmäßig aneinander gereihten Gehöftgruppen einen ganz netten Anblick. In den Straßen, d.h. den freien Räumen zwischen den einzelnen Gehöften herrschte reges Leben, hier sah man Frauen, welche, große thönerne Gefäße auf dem Kopfe tragend, zum Flusse eilten, dort wieder Frauen, die unter der Last großer schwerer Bündel dürren Grases oder Gestrüppe seufzend nach Hause gingen, während eine Schaar nackter Kinder sich spielend am Flußufer ergötzte, andere wieder mit den ihrer Obhut anvertrauten Heerden auf die Weide zogen. Zu diesem Bilde emsiger Thätigkeit der Frauen contrastirte das dolce far niente der Männer auffällig, man sah sie allerorts müßig auf der Erde liegen, sich einer gesättigten Schlange gleich im Freien sonnend und von den Anstrengungen des eingenommenen Mahles erholend.
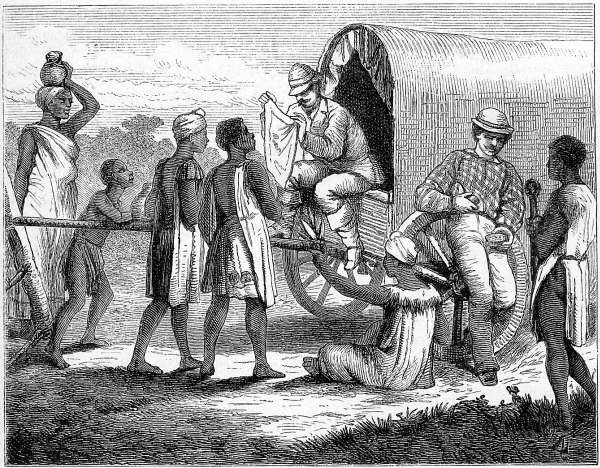
[Tauschhandel am Wagen.]
Einige der Männer hatten aus europäischen Stoffen, andere aus weichgegerbten Fellen gearbeitete Jacken und Hosen an; ihre Köpfe bedeckten kleine, aus Gras oder Binsen gearbeitete Hütchen. Die Männer waren meist von Mittelgröße, ihr Wuchs war aber weder so schön wie jener der Zulu's, noch so kräftig wie jener der Fingo's, auffallend hell schien mir ihre Hautfarbe. Ihre Gesichtszüge waren durch eine anormale Breite der Nase nicht wenig verunstaltet—eine Mißbildung, welche durch den Gebrauch kleiner, die Stelle des Taschentuchs vertretender Eisenlöffel hervorgerufen wird. Ihr Ruf als notorische Faullenzer war wohl begründet, denn obwohl ihr Gebiet sehr fruchtbar ist, verwendeten sie sehr wenig Mühe auf den Anbau von Cerealien und waren auch auf dem Markte von Kimberley seltene Gäste.
In moralischer Hinsicht war der Ausgang des letzten Krieges zwischen den Engländern und einem Bruderstamme dieser Batlapinen, den Botlaros, von wohlthätiger Wirkung. Vor dem Kriege, besonders aber zur Zeit der Entdeckung der River-Diggings kannten Jantsche's Hochmuth und seine Prätensionen keine Grenze, seine Unterthanen verübten zahlreiche Einfälle in die Provinz und ließen die berittene englische Polizei am Vaalflusse nie zur Ruhe kommen. Diesem Allen machte der Sieg der Engländer ein schnelles Ende.
Nachdem wir das Weichbild der Stadt Jantsche's verlassen hatten, betraten wir wieder einsamere Partien des Hart-Riverthales, in welchen erst in größerer Entfernung flußaufwärts zwei bedeutendere Eingebornenstädte liegen. Es sind dies Taung (nach dem früheren Herrscher »Mahura's Stadt« genannt), circa 70 Meilen von der Mündung des Hart-River's entfernt, und Mamusa, die Residenz eines freien Korannafürsten. Zur Zeit meiner ersten Reise (auf welcher ich jedoch die Stadt nicht besuchte) regierte daselbst ein Greis, der Maschon hieß, von den Boers jedoch Tibusch, d.h. Zerbusch genannt wurde, und welcher nach einer Version 112, nach einer andern 130 Jahre alt war. Mamusa liegt gegen 40 engl. Meilen flußaufwärts von Taung entfernt, welches, nebenbei erwähnt, der Sitz des unabhängigen Batlapinenfürsten Mankuruane ist. Außer diesen beiden Städten finden wir zwischen Lekatlong und Mamusa zahlreiche Eingebornendörfer, welche zu 90 Percent von Batlapinen, zwischen Taung und Mamusa auch von Barolongen und nur ostwärts und gegenüber von Mamusa von Koranna's bewohnt werden. Diese Dörfer sind mit Ausnahme der von Koranna's bewohnten zumeist auf den Gipfeln der niedrigen, an den Hart-River herantretenden und begrasten Höhen oder unmittelbar unter dem Gipfel dieser Höhen erbaut und bestehen gewöhnlich aus zwei bis acht Gehöften. Nur wenige, darunter das größte dieser Dörfer, Mitzima genannt, liegen im Thale; dieses zählt etwa 30 Hütten. Die von den Bewohnern dieser Dörfer bebauten Felder und Gärten liegen theils im Flußthale, theils an den Abhängen. Außer Kafirkorn und Mais wird auf diesen Grundstücken auch Zuckerrohr gebaut, dessen Schaft 7-8 Fuß Höhe erreicht.
Wir setzten im Thale des Hart-Rivers unsere Reise fort; die zahlreichen, unseren Weg kreuzenden, tiefen Schluchten nöthigten uns zu zeitraubenden Umwegen und bereiteten uns mancherlei Schwierigkeit. Einige Meilen hinter Lekatlong sah ich mich genöthigt Rast zu halten; es währte nicht lange, so kamen aus dem nahen Gehöfte ein Junge und ein Greis, welche mit uns Makoa (Weißen) in Tauschhandel traten. Ich war über ihre hohen Forderungen überrascht, fand aber bald die Erklärung; die Eingebornen kannten hier bereits den Werth des englischen Geldes.
Auf der Weiterreise fanden wir in den reichbebuschten und mit hohem Gras bedeckten Thalpartien nicht minder wie in den Ufergebüschen, günstige Jagdgelegenheiten. In den letzteren trafen wir vier Arten von Trappen, darunter zwei Zwergtrappenarten und eine Art von seltener Größe, die beiden ersteren in größeren Gruppen, die beiden größeren Arten nur paarweise aus den Büschen auffliegend; in der Nähe der niedrigen Dornbüsche fanden wir das große Cap-Perlhuhn paarweise in der Erde scharrend. An sandigen Uferstellen und mit Flugsand bedeckten Partien der Thalabhänge sonnten sich Steppenhühner, die dicht beschilften Ufer des Flusses, das Versteck großer Schwärme von Wildenten, lieferten uns manche Beute. Die freieren Uferstellen waren zumeist mit den herabhängenden Aesten der Mimosen überhangen, deren dünne Endzweige von den schönen gelben, mit einem schwarzen Flecke an der Kehle geschmückten Webervögeln entblättert waren, und an welchen diese ihre kunstvollen Nester erbaut hatten, welche herabhängenden Früchten ähnelten. Sie waren platt gedrückt, hatten einen elliptischen Querdurchmesser von 6-10 und 12-15 Centimeter und eine Höhe von 12-25 Centimeter. Der Eingang befand sich an der unteren, ebenen Seite des Nestes.
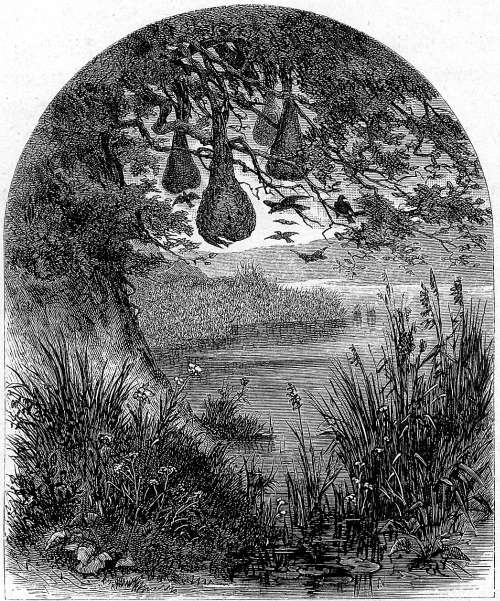
[Nest des Webervogels.]
Diese Eingangsöffnungen haben eine halbmondförmige Gestalt und sind nur so groß, daß ein Thier hineinzuschlüpfen vermag. Die obere Nestfläche läuft kegelförmig zu, so zwar, daß das Nest mit der Kegelspitze an den Zweigen befestigt ist. Die Nester waren aus frischem biegsamen Grase gewoben. Die Bauart des Nestes ist eine kunstreiche zu nennen, die einzelnen Grashalme sind sehr geschickt ineinander verwoben und der Bau so fest, daß er allen Stürmen vollkommen Widerstand zu leisten vermag. Bei dem leisesten Winde fingen die schönen Nester zu schaukeln an und diese Bewegungen spiegelten sich in der ruhigen, durch zarte, in der Tiefe wuchernde Algenformen verdunkelten Fluth treu wieder, ein Bild, das dadurch noch an Anmuth gewann, daß sich einer der einfliegenden Vögel zuweilen längere Zeit an der Oeffnung festklammernd schaukelte. Dann erschien am Wasserspiegel ein sich hin- und her wiegender schön gelbgefärbter Punkt, der wie ein schimmernder Edelstein über die hellen und dunklen Grottenpartien am Grunde des Flusses zu gleiten schien. Diese Webervögel zeigten nicht die geringste Scheu, so daß wir sie namentlich gegen Abend leicht im Neste fangen konnten. Hatten wir uns von dem Neste entfernt, und waren die bei unserer Annäherung entflohenen Sänger wieder nach ihren Wohnungen zurückgeflogen, so beobachteten sie mit anmuthiger Neugierde längere Zeit hindurch jede unserer Bewegungen.

[Reisende Batlapinen.]
Am dritten Tage unserer Reise erblickten wir im Osten einen aus Süden hervortretenden, in das Thal des Hart-Rivers tief eindringenden Höhenzug, der uns als zum Gebiete des Chefs Mitzima gehörig bezeichnet wurde. Den äußersten vorgebirgsartigen Ausläufer dieses Höhenzuges nannten die Boers Spitzkopf. Die von uns durchzogene Ebene glich auf weite Strecken hin einem carminrothen Teppich, welcher bei näherer Besichtigung aus einer Unzahl mehrblüthiger Lilien bestand. An anderen Stellen der Ebene trafen wir schöne, dunkelgrüne, auf der Erde wuchernde Blätter einer anderen Liliacee, welche mit verschiedenen Rüsselkäfer-Species förmlich bedeckt waren.
In der Nähe einer Zuckerrohrpflanzung begegneten uns vier arbeitende Frauen—ich benützte diese Gelegenheit, um noch vor unserem Eintreffen in Mitzima's Stadt unsern Milchbedarf zu decken und sprach die Frauen in dieser Absicht an. Sie zeigten sich überaus gefällig, ihre Hauen im Stiche lassend, eilten sie lachend und schreiend ihren mehr denn 300 Schritte entfernten Hütten zu und es währte nicht lange, so waren sie wieder da, zwei von ihnen mit irdenen Töpfen, die dritte, ein altes hageres Weib mit einem großen Holzgefäße, gefüllt mit köstlich frischer Milch. Als Kaufpreis forderten auch sie ein Stück Tabak, mein Erstaunen wuchs, als sie mir durch Gert, meinen Dolmetscher, zu verstehen gaben, daß sie leidenschaftliche Consumenten von Schnupftabak wären. Um mir jeden Zweifel zu benehmen, machten sie die Pantomime des Zerreibens und ließen mit dem Rufe »Monati« (d.h. das ist schön) den Tabak in den breiten Höhlen ihrer Nasen verschwinden.
Am Nachmittag fuhren wir an einem aus drei Hütten bestehenden Gehöfte, dessen Sauberkeit mir sogleich auffiel, vorüber. Auch auf meiner zweiten Reise unter den verschiedenen Batlapinenstämmen fand ich kein zweites, das sich mit ihm hätte messen können. Die Hütten waren geräumig und aus starken Pfählen erbaut, auch stand in einem aus Schilfrohr gearbeiteten Schuppen ein gut erhaltener schwerer Lastwagen und im Hofe ein kleinerer, an dem eben, was mir noch mehr auffiel, der Hausherr mit einem Diener Verbesserungen vornahm. Außerdem fehlte auch ein Pflug nicht—im Batlapinenlande war dies im Jahre 1873 noch eine große Seltenheit—und ein halbes Dutzend der ledernen Milchsäcke hing an der für das Vieh bestimmten Umfriedung. Im Schatten des Wagenschuppens saßen zwei andere Batlapinen, damit beschäftigt, aus Segeltuch ein neues Wagendach zusammenzunähen; ich habe nie wieder Leute dieses Stammes so eifrig an der Arbeit gesehen als diese beiden.
Im geräumigen Hofraume des Gehöftes tummelten sich 15 muntere dunkelgefärbte Kinder umher, welche bis auf ein kaum blattgroßes Lederschürzchen splitternackt waren. Den größeren oblag es, die Heerden an den Ufern des hier eine englische Meile entfernten Hartflusses zu hüten. Alles zeigte den Segen und die Früchte der Arbeit und des Wohlstandes.
Im Laufe des Nachmittags hatten wir uns den am Morgen erblickten Höhen genähert. Sie sind die nördlichsten Ausläufer des bei Hebron am rechten Vaalufer beginnenden Höhenzuges; ich fand sie namentlich durch die Form der sie bildenden Felsen interessant. Bald sind es senkrechte Blöcke, Menschengestalten nicht unähnlich und säulenartig aneinander gereiht, bald liegen sie stufenförmig übereinander und erwecken die Vorstellung einer gigantischen Treppe.
Als wir das diesseits vom Spitzkopf liegende Mitzima erreichten, waren wir, kaum angelangt, von den Neugierigen umringt, deren größtes Contingent das schöne Geschlecht und die hoffnungsvolle zarteste Jugend des nach seinem gegenwärtigen Besitzer genannten Eingebornendorfes stellten. Sie setzten sich in der nächsten Umgebung des Wagens gemüthlich nieder und begannen zuerst die Makoa (die Weißen) selbst, dann den Wagen und unsere ganze Ausrüstung auf das lebhafteste zu kritisiren. Ihr von oft höchst komischen Gesticulationen begleitetes Gespräch erregte die Lachlust unserer Diener im höchsten Grade, während wir im Zweifel waren, ob das Mienen- und Geberdenspiel Bewunderung oder abfällige Kritik zum Ausdruck bringe. Mein Begleiter K., dem böse Zungen Eitelkeit zum Vorwurfe machten, hielt es für das erstere, wofür auch die Thatsache sprach, daß F. ihn mehrmals mit dem Pennyspiegel in der Hand überraschte.
Während F., der die Kinderschuhe noch nicht abgelegt hatte, in das Lachen und das Mienenspiel mit einstimmte, behauptete E., wie immer, sein Pfeifchen schmauchend, stoische Ruhe. Seine Miene und sein ganzes Benehmen zeigten Verachtung, deren Ausdruck ihn aber zur besonderen Zielscheibe der Spötteleien des schönen Geschlechtes machte, während manch' wohlwollender Blick auf den netten K. gerichtet war.
Die anwesenden Frauen waren sämmtlich, wahrscheinlich um den Weißen ihren Reichthum zu zeigen, in Kattunröcken erschienen und hatten Brust und Hals mit zahlreichen Perlenschnüren geschmückt. Unter ihnen stachen zwei Mädchen durch bemerkenswerthe Häßlichkeit der Gesichtszüge hervor, die durch die rothen Ockerstriche im Gesichte keineswegs gemildert wurde.[1]
1 Im Allgemeinen gebrauchen die Batlapinenfrauen jedoch nicht so viel Ocker, um sich Gesicht, Hals und Brust zu beschmieren, als die Frauen der Hottentottenrace und der in der Cap-Colonie wohnenden Kaffernstämme.
Das schöne Geschlecht, der passiven Haltung müde, ging bald zum Angriff über und eine der Frauen ließ uns durch Gert bedeuten, unsere Waaren zur Schau auszulegen, da sie uns für reisende Händler hielten. Die mit ausgestreckter Hand uns entgegen gehaltenen Schnupftabakdosen waren eine stumme aber directe Aufforderung, dieselben zu füllen. Da wir keine Miene machten, ihren Wünschen nachzukommen, beschlossen einige unter den Frauen einen neuen Angriff, dessen Ziel unsere beiden Begleiter F. und K. waren, deren Lächeln sie den Frauen als die Zugänglichsten erscheinen ließ. Nach abgehaltener Berathung trat die Häßlichste und Aelteste der Frauen zu F. heran und machte ihm eine so aufrichtige und herzliche Liebeserklärung, daß es Gert, der hierbei als Dolmetsch fungirte, kaum möglich war, seine Lachmuskeln im Zaume zu halten. Die Scene rang uns Allen ein helles Lachen ab, während es F. in Wuth versetzte.
Um unseren Neckereien zu entgehen, wagte er die Behauptung, es sei Mitzima's jüngstes Weib, die hübscheste des ganzen Dorfes gewesen.
Als die Frauen bemerkt hatten, daß aller Minne Mühe vergeblich war, entfernten sie sich vom Wagen und legten den Rückweg tanzend zurück; im eigentlichen Sinne des Wortes war es kein Tanz, sie hüpften vielmehr, sie bewegten sich dabei in kleineren Gruppen zuerst in einem Halbkreise nach links, dann in einem Halbkreise nach rechts, dann machten sie einen etwa zwei Schritte langen Doppelsprung nach vorne, drehten sich um, und begannen die Bewegung von Neuem.
Wir waren froh, der lästigen Besucher los geworden zu sein—unsere Freude war aber leider nicht von Dauer, denn bald kam eine noch größere und zudringlichere Gruppe und umstellte den Wagen. Diesmal half uns eine List aus der Noth, ich erstieg den Wagen und begann das Schrotgewehr zu reinigen. Beim Anblick desselben machten die Angekommenen eine unwillkürliche Bewegung nach rückwärts, und ehe ich es vermuthete, war das Feld geräumt.
In später Nachmittagsstunde verließen wir Mitzima's Dorf, das Passiren mehrerer Schluchten nahm so viel Zeit in Anspruch und ermüdete die Zugthiere derart, daß wir noch diesseits des Spitzkopfes, in 1½ Meilen Entfernung von Mitzima, in der Nähe von drei kleinen Batlapinengehöften, Halt machen mußten.
Ein in unserem Rücken aufsteigendes Gewitter hatte uns auf dieser Straße bange Sorge gemacht, denn ein halbstündiger Platzregen hätte genügt, um jede dieser Schluchten, die zu überwinden wir große Anstrengungen machen mußten, in einen reißenden und gefahrbringenden Regenstrom zu verwandeln. Unsere Ankunft bei den erwähnten Gehöften war trotz vorgerückter Abendstunde nicht unbemerkt geblieben, es stellte sich auch bald Besuch ein.
Die Nacht, die wir hier zubrachten, war eine besonders helle und schöne, aber auch empfindlich kalte. Die Felsenbildungen am Abhange der Höhen glichen phantastischen Gestalten, deren dunkle Schatten weit in die Ebenen hinausragten. Der niedrige Spitzkopf schien einem Riesen gleich über uns Wache zu halten, aus der Nähe und Ferne klangen die hellen Töne der Batlapinengesänge zu uns herüber.
Am nächsten Morgen tauschten wir von dem Ortsvorstande der naheliegenden Gehöfte einige Kürbisse ein und brachen weiter nach Norden auf. Je weiter wir den Hart-River hinaufzogen, desto fruchtbarer schienen mir die Gefilde des Batlapinenlandes zu sein. Namentlich erregten die kleinen Zuckerrohr-Pflanzungen auf den Feldern und in den Gärtchen mein Erstaunen. Was mir aber besonders auffiel, war, daß die Eingebornen diese Zuckerrohrart nicht anders benützen, als daß sie den unteren und mittleren saftreichen Theil des Stengels in kleine Stücke schneiden und zerkauen.
Wir durchschritten zunächst eine baum- und buschlose Ebene, auf welcher mir namentlich ganz eigenthümlich geformte Termitenbauten auffielen. Diese Termitenbauten stellen statt der gewöhnlichen, manche der südafrikanischen Ebenen zu Tausenden bedeckenden halbkugel- und brodlaibförmigen bis 4 Fuß hohen Hügel, an dessem Rande zwei bis drei kleine Eingangslöcher in das Innere führen—eine aus der Erde hervorstehende bis zu 6 Fuß hohe und 3-10 Zoll im Durchmesser haltende gebrechliche, aus Thonerde und Sandkörnern mit Hilfe des Speichels der Thiere zusammengekittete Röhre dar. Wir beobachteten den Boden in einem Umkreise von 10-48 Fuß etwas wenig gehoben und meist kahl; aus der Mitte einer solchen Stelle erhoben sich in der Regel eine oder drei, doch auch mehrere nach oben zu offene Röhren, während im weiteren Umkreise die Anfänge zu solchen Röhren lagen, die oft in großer Menge als kleine kegelförmige nach oben zu geschlossene Erdaufwürfe zu Tage treten.
Gegen Mittag hielten wir in der Nähe des Flusses und mußten uns mit dem sehr trüben Wasser begnügen, das wir in einigen Lachen in seinem Bette vorfanden, welches überdies durch das Eintreiben der Heerden von Seite der Eingebornen sehr verunreinigt worden war. Auch das mit diesem trüben Wasser bereitete Mahl wollte nicht munden. Während unseres Mahles kamen hoch auf gehörnten Saumthieren einige Batlapinen von einem der nahen auf einem kleinen Höhenrücken zu unserer Rechten gelegenen Dörfchen herbeigeritten. Sie sprangen ab und machten sich's in der Nähe unseres Feuers bequem. Die Saumthiere blieben, kaum abgesattelt, wie an die Erde angewurzelt stehen. Man kann sich des Lachens nicht erwehren, wenn man eine solche Batlapinengruppe heranziehen sieht; ohne angetrieben zu werden, eilen die Ochsen dahin, wie wenn sie miteinander um die Wette liefen. Die Nasenscheidewand ist an den Nüstern durchbohrt und ein Holzpflöckchen durchgesteckt, an welches, an beiden Enden eingeschnitten, ein etwa 2 Meter langer Riemen, der Zaum, befestigt ist. Ueber den Rücken des Thieres ist in der Regel ein Sack oder eine Decke, oder ein Stück Leder geworfen, welches den Sattel vorstellen soll. Zu beiden Seiten hängen Riemen mit eisernen oder ledernen Steigbügeln. Die Ankömmlinge zeigten sich sehr freundlich und einer derselben antwortete auf meine Frage, wie weit es noch nach Springbockfontein sei, schnell gefaßt, indem er auf die über uns stehende Sonne wies: »Wenn Ihr jetzt diese Stelle mit Eurem Wagen verlaßt, so werdet Ihr zur Zeit, wenn sich jener Gebieter da droben zur Ruhe gelegt, mit der klaren Fluth des Wassers, in dem die Springböcke ihren Durst stillen, auch Eure Wassergefäße füllen können.«
Die nahen Mais- und Kürbißfelder boten mir Gelegenheit, meine Sammlungen zu bereichern, namentlich durch einige schöne Species von Sandkäfern (Cicindelidea). In meinem Eifer bemerkte ich nicht, daß ein Gewitter bereits dem Ausbruche nahe war, und erst als ein tüchtiger Regenschauer mich durchnäßte, eilte ich zum Wagen. Ein Blitzstrahl fuhr in diesem Momente einige hundert Schritte thalabwärts in einen der Maisgärten nieder; am Wagen angekommen, fand ich, daß meine Begleiter es unterlassen hatten, einige zum Trocknen an die Sonne gesetzte Pflanzenpräparate, sowie auch die an einem nahen Busche angelehnten Gewehre vor dem Regen in Sicherheit zu bringen. Der fremden Besucher saßen nur noch drei am halberloschenen Feuer, doch rückten sie nun, um etwas Schutz gegen den Regen zu suchen, auch näher an den Wagen heran. In den Wagen springend ersuchte ich meine Freunde, mir rasch die Pflanzen und dann die Gewehre zu geben.
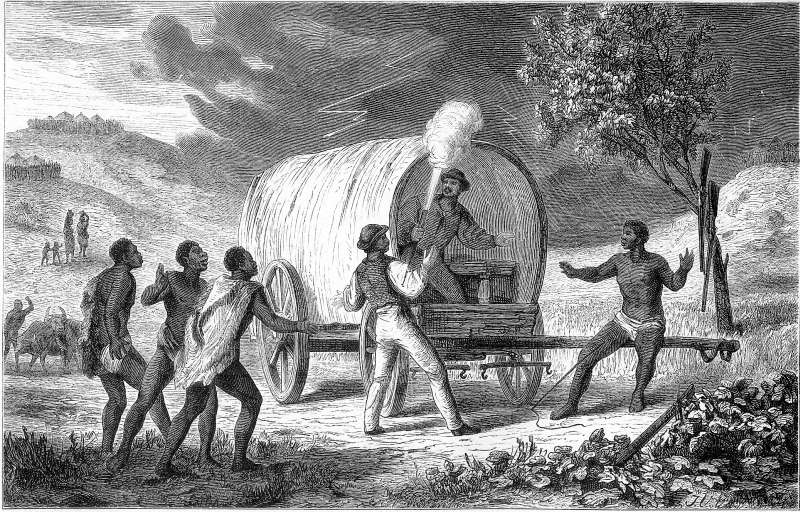
[Unfall im Hart-Riverthale.]
Einer meiner Begleiter hatte mir die ersteren gereicht, und war eben daran, mir auch die Gewehre zu übergeben, als ein Blitzstrahl in unmittelbarer Nähe hinter dem Wagen zur Erde niederfuhr. Ich hatte in diesem Momente das Gewehr mit der linken Hand am Laufende erfaßt, um es im Innern des Wagens an die gehörige Stelle zu legen (die Gewehre sind stets an der Innenwand des Wagens gebrauchsbereit angeschnallt). Durch den plötzlichen nahen Donnerschlag außer Fassung gebracht, ließ mein Freund das Kolbenende fallen, dabei hatte sich der eine Hahn (es war ein Doppellauf) an der Deichsel aufgespannt und als ich eben mit der Absicht, das Gewehr im Wagen zu bergen, dasselbe an mich heranzog, entlud sich der mit Hasenschrot geladene rechte Lauf. Ich weiß mich nur noch zu erinnern, daß in dem Augenblicke, wo der Blitzstrahl die ganze Umgebung grell beleuchtete, eine heftig auflodernde, von starker Detonation begleitete Feuererscheinung unmittelbar folgte. Ich fühlte heftigen Schmerz in der linken Augengegend, und theils durch den Schreck, theils betäubt von dem Schusse, verlor ich das Gleichgewicht und fiel vom Wagen herab. Meine Freunde hielten mich im ersten Augenblicke für todt, glücklicher Weise war meine Verwundung keine tödtliche. Die Schrote waren durch die linke Hohlhand von unten nach aufwärts gegangen und hatten die linke Schläfe so gestreift, daß sie die Hutkrämpe durchbohrt und die so erzeugten Löcher in derselben mit meinen Haaren ausgefüllt hatten.
Da jedoch der Schuß in solcher Nähe der linken Gesichtshälfte abgefeuert worden war, so war auch das Aeußere des linken Auges bedeutend verletzt. Ich blieb auf zwei Tage auf diesem Auge vollkommen blind und litt noch vierzehn Tage an einer äußeren Augenentzündung. Unmittelbar nach dem Schusse waren auch die Eingebornen aus ihrem Verstecke gesprungen und wunderten sich nicht wenig über das Ereigniß, das sich vor ihren Augen abgespielt hatte. Im Momente desselben war ein Batlapinengreis zu dem Wagen herangekommen, der bei seiner Annäherung auch ein Zeuge dieser Scene gewesen. Bevor meine Freunde noch eingespannt hatten, um wenigstens noch an diesem Tage Springbockfontein zu erreichen, kamen noch einige Eingeborne zu Besuch, wovon einer, der Anrede nach zu schließen, der Sohn des alten Mannes zu sein schien, und von diesem folgende weise Ermahnung erhielt: »Sieh hinein in den Wagen, dort liegt ein todter »Bas« (Gebieter, Meister). Mein Herz sagt es mir, daß es ein sehr böser Mann gewesen sein mußte, denn als er vorne am Wagen stand, und seine Freunde, die ihm langsam die Gewehre reichten, mit lauten zornigen Worten schalt, da schlug ihn »Morena« (der Herr der Wolken) mit Donner und Blitz, so daß er vom Wagen herabrollte, und wenn er nicht schon todt ist, gewiß nicht mehr lange Mais essen und das Zuckerrohr aussaugen wird.«
Obwohl Springbockfontein nicht mehr weit entfernt war, mußten wir es mit Rücksicht auf meinen Zustand aufgeben, denselben Abend noch hinzukommen. Die Erschütterungen des Wagens verursachten mir die heftigsten Schmerzen. Nach zweistündiger Fahrt machten wir auch Halt.
Am folgenden Vormittage erreichten wir die sogenannte Ansiedelung der Weißen, welche aus mehreren Zelten und Schilfhütten bestand und von vier holländischen Familien, Flüchtlingen aus der Transvaal-Republik, bewohnt waren, die wahrscheinlich Schulden halber ihre früheren Wohnsitze verlassen hatten.
Ich fand ähnliche Ansiedelungen auch in den anderen Betschuanaländern, deren Bewohner sich meist theils durch die Jagd, theils als Gerber, Holzschläger oder als Händler ernähren. Im Allgemeinen führen diese Menschen ein elendes Dasein und gehören wohl zu dem ungebildetsten Theile der holländischen Bevölkerung in Süd-Afrika. Ihre Lage ist furchtbar, wenn sie, von Krankheiten heimgesucht, ohne Rath und Mittel darnieder liegen.
Die Springbockquellen sind sehr schwach und durchfließen einen kleinen Morast, bevor ihr Wasser den Hart-River erreicht; in dem kleinen Moraste fand ich die gewöhnliche südafrikanische Wasserschildkröte zahlreich vertreten.
Am folgenden Morgen, als ich mich etwas besser fühlte, verließen wir den Ort und zogen thalaufwärts weiter; ich hatte im Sinne, das Gebiet des damals noch unabhängigen Batlapinenfürsten Gassibone zu bereisen; leider hatten uns die an den Quellen wohnenden Holländer eine falsche Richtung angegeben, was wir erst spät Abends von zwei vorübergehenden Eingebornen erfuhren. Unsere Reise an diesem Tage war eine recht beschwerliche, wir zogen theils durch sehr dichtes Buschland, theils über sandigen Boden, und mußten sehr oft halten und den Thieren Rast gönnen. Je weiter wir nach Nordosten vordrangen, desto waldreicher schien die Gegend, d.h. das Land war mit schwachen Beständen von Kameeldornbäumen bedeckt.
Nach und nach hatten wir uns vom Hart-River entfernt und mußten, nachdem wir von den beiden vorübergehenden Eingebornen die wahre Richtung von Gassibone's Stadt erfahren, denselben Weg bis zu dem Hart-River zurückgehen; reichliche Jagdbeute entschädigte uns indeß für diesen Zeitverlust.
Wir schlugen nunmehr eine ostsüdöstliche Richtung ein und zogen quer durch den Wald nach der das Hart-Riverthal im Osten begleitenden Höhenkette, an welcher der Hauptkraal Gassibone's liegen sollte. Der Weg war einer der beschwerlichsten, die wir auf der ganzen Reise zurückzulegen hatten, und erheischte die größte Vorsicht, um Wagen und Gespann vor Schaden zu behüten. Anfangs führte derselbe durch ein monotones Buschland, später durch einen Mimosenwald, in dem uns einige Batlapinen, Unterthanen Gassibone's, begegneten, die uns in freundlicher Weise den kürzesten Weg nach des Häuptlings Kraal zeigten. Ueber eine tiefe Einsattelung im Höhenrücken gelangten wir nun in ein kesselförmiges Thalbecken; im Hintergrunde, da wo mehrere Höhenzüge sternförmig zusammenstießen, lag theilweise in dem Hauptthale, theils in einem der einmündenden Querthäler, die Stadt Gassibone's. Das Hauptthal, vor dessen Eingang wir standen, war ziemlich gut angebaut.
Der lange beschwerliche Ritt hatte uns alle ziemlich abgespannt, ich beschloß daher, da der Kraal des Häuptlings noch ziemlich entfernt lag, hier das Nachtlager aufzuschlagen.
Früh Morgens ließen wir die Thiere grasen und dann ging es aufwärts nach Gassibone's Residenz. In den Maisgärten waren schon die Frauen emsig beschäftigt und die Jungen trieben nach allen Richtungen hin die Heerden in die Berge auf die Weide. Es war ein schöner warmer Morgen und die gesammten Mitglieder der Expedition (Weiße und Farbige) im besten Humor.—Der volle Titel des Königs dieses Batlapinenlandes, der sich zwei Jahre später der Transvaal-Republik freiwillig unterwarf, gegenwärtig aber, seit der Annexion derselben durch die Engländer, ein englischer Unterthan wurde, ist Morena Botlazitse Gassibone. Seinem Charakter nach ist er ein Mann, der vielen Lastern, besonders aber dem Trunke ergeben ist. Die Häuser der Stadt zeigten denselben Charakter wie jene Lekatlongs, die Stadt mochte ungefähr 2500 Einwohner zählen. Meine Absicht war, von der Stadt aus eine südliche Richtung nach dem Vaal-River zu nehmen und dann nordöstlich nach der Transvaal-Provinz vorzudringen. Da in dieser Richtung kein Weg nach derselben führte, so sandte ich zum König um einen Wegweiser und betraute mit dieser Mission den hoffnungsvollen F., der überdies den Auftrag erhielt, vom König einige Töpfe Milch zu erstehen. Um dem Ueberbringer meiner Botschaft mehr Ansehen zu verleihen, wurde ihm ein Revolver um den Leib gehängt und ein Paar hohe Stiefel angezogen. F. fühlte sich durch die Mission so geehrt, daß sein ganzes Gesicht mit dunkler Röthe überzogen war und seine Augen leuchteten, seine imponirende Haltung flößte nicht nur den Eingebornen, die ihm begegneten, demuthsvolle Scheu ein, sondern gewann ihm auch das zuvorkommendste Benehmen Seiner schwarzen Majestät, so daß dieser nicht nur seiner Bitte um Ueberlassung einiger Töpfe Milch zu willfahren versprach, sondern sich auch noch erbot, mir für einen zweiten Shilling einen Führer zur Verfügung zu stellen, der uns durch die Schluchten auf die freie Ebene bringen sollte. Ja der Fürst ging noch so weit, um dem martialisch aussehenden Jüngling einen Ausdruck seines besonderen Wohlgefallens zu geben, daß er ihm von dem Gerichte anbot, mit dem eben eine seiner Königinnen ihren Batlapinen-Appetit stillte.
Die cylindrische, etwa 5 Meter im Durchmesser haltende und bis zum Giebel des kegelförmigen Daches etwa 3 Meter hohe Hütte war durch einen Mimosenbaum gestützt, der bis zur Höhe des Daches reichte. Am Fuße dieser Säule saß die erwähnte schwarze Schönheit in ein europäisches Kattunkleid gehüllt und auf ihrem Schooße hielt sie eine Holzschüssel, gefüllt mit einem beliebten Batlapinengerichte. Unser wackere Herold wollte, nachdem er des Königs Antwort durch meinen Diener, der ihm als Dolmetsch beigegeben war, erfahren, vom Anerbieten Gebrauch machen, und griff mit voller Hand zu. Erschreckt zog er die Hand zurück, denn die Schüssel enthielt getrocknete Heuschrecken, nach deren Genuß es unserem Freund durchaus nicht gelüstete. Zum Wagen zurückgekehrt, versicherte F., ähnliche Gesandtschaftsdienste zu anderen Betschuanakönigen nicht mehr annehmen zu wollen.
Die königliche Hütte war inwendig mit Thonerde überschmiert und der Boden glatt cementirt, an den Wänden hingen ringsum auf Pfählen aus den Fellen des Proteles, des grauen Fuchses, des Schabrakenschakals und der schwarzgefleckten Genetta gearbeitete Carossen. Dem Eingange gegenüber hing an der Säule ein amerikanischer Hinterlader; auf der Erde längs der Wand lagen Schaf- und Ziegenfelle ausgebreitet—die primitiven Ruhebetten. Während des Gespräches mit F. hatte Gassibone sich entschuldigt, daß die Kürbisse auf den Feldern noch nicht reif seien, und daß er mir auch kein Fleisch übersenden könne, weil seine Heerden der Wassernoth halber am Vaal-River weideten. Ich konnte mich auch späterhin überzeugen, daß es zu jener Jahreszeit im Jahre 1873 zwischen dem Vaal- und Hart-River kein trinkbares Wasser gab. Selbst in Gassibone's Stadt floß die Quelle so spärlich, daß sie fortwährend von Batlapinenfrauen umlagert wurde und blos eine nach der andern zum Wasser gelangen konnte. Als unser Diener zur Quelle kam, wurde er von den Frauen so angeschrieen, daß er es vorzog, sich schleunigst mit dem leeren Eimer zurückzuziehen. Uns blieb nichts übrig, als uns welches von den Eingebornenfrauen zu kaufen oder uns mit einer entsprechenden Menge einer mispelartigen, wildwachsenden Obstart zu versehen, um unseren Durst zu stillen.
Im Allgemeinen schien es mir, daß diese Batlapinen ihr Oberhaupt nicht besonders respectiren. In den letzten Jahren (seit dieser ersten meiner Reisen) kam es zwischen Gassibone einerseits und Mankuruan und Jantsche andererseits zu Reibungen, welche größtentheils auf zwei Gründen beruhten: erstens behauptete Gassibone wie Mankuruan, daß jeder der Paramontchief (oberster Fürst oder der eigentliche König) der Batlapinen sei, zweitens bewies sich Jantsche wie Mankuruan den Engländern und Missionären gewogen, während Gassibone gegen dieselben eingenommen, den Holländern stets gewogen war. Darum trat er auch sein Land an die Transvaal-Republik ab, als Mankuruan daran dachte, sich der englischen Regierung zu unterwerfen. Als nun die Transvaal-Republik von den Engländern annectirt wurde, belästigte er die holländischen Boers, die er nunmehr als englische Unterthanen haßte, derart, daß gegen ihn ein Commando abgesendet werden mußte, dem gegenüber er sich ebenso feig als vorher prahlerisch bewies.

[Mein Gesandter bei König Gassibone.]

[Batlapinen bei der Arbeit.]
Wie in allen Eingebornendörfern hatten wir auch hier eine Belagerung von Seite der Eingebornen auszuhalten, die an Lärm nichts zu wünschen übrig ließ; es wurde geschrieen, gesungen und gelacht, dabei Tauschhandel getrieben, alte und frische Raubthierfelle, Ziegen- und Ochsenhäute, Holzlöffel und stumpfe unbrauchbare Assagayen, Mais und unreife Kürbisse, geröstete Heuschrecken und Honig zum Kaufe angetragen. Der Eine bettelte, der Andere bat, ein Dritter klagte, daß ihm alles mögliche fehle, dazwischen kreischte eine weibliche Stimme, ob ich auch ein Medicinmann sei, wie ihr einer meiner Diener berichtet, sie wolle eine Medicin kaufen, welche ihr zu einem Kinde verhelfen würde; sie hätte weder Sohn noch Tochter. »Ich habe aber einen Mann und mehrere andere Frauen wohnen in demselben Gehöfte und die haben Kinder, aber ich keine.« Je bereitwilliger man sich aber diesen Leuten gegenüber zeigt, desto ärger und unverschämter werden sie in ihren Forderungen; je zurückhaltender man ist, ohne jedoch barsch mit den Leuten zu verfahren, desto bessere Resultate erzielt man.
Nachdem wir etwas Mais von den Leuten erstanden, machten wir uns auf den Weg. Unsere Frage, ob wir unsere Fässer mit Wasser füllen sollten, verneinte der uns vom Könige mitgegebene Führer mit der Bemerkung, wir würden an vielen Stellen des Wegs hinreichend Wasser antreffen. Da wir den Mann als Führer erhielten, glaubten wir ihm vollkommen trauen zu dürfen, allein wir wurden bitter enttäuscht. Wir fanden auf der ganzen Strecke zum Vaalflusse kein Wasser, und hatten, da wir diesen und den folgenden Tag in brennender Sonnenhitze reisen mußten, viel Durst zu leiden. Das Land zwischen Gassibone's Stadt und dem Vaalflusse ist eine einzige Hochebene, theilweise bewaldet und bebuscht, theilweise, und namentlich in feuchten Jahren, hochbegrast.
Auf dieser Ebene dahinziehend, fiel uns ein eigenthümlicher grauer sich rasch nähernder Wolkenstreifen auf, der den westlichen Horizont bedeckte. Je näher er kam, desto mehr ähnelte er von der Erde aufsteigenden, stellenweise dichteren Rauchsäulen. Es war eine Heuschreckenwolke. Diese Wanderheuschrecken erscheinen oft während der südafrikanischen Sommerszeit in meilenlangen Schwärmen, alles Grün in der Vegetation vernichtend, wo sie einfallen. Ihr Flug ist aber ein ununterbrochenes Einfallen, d.h. während sich der eine Theil zum Fraße niederläßt, fliegen die bereits gesättigten Thiere über die Ersteren hinweg, so lange, bis sie der Hunger zum abermaligen Niederlassen zwingt.
Unser Führer bezeichnete uns in der grasreichen Ebene, in der ich zehn Monate später durch einen Brand beinahe eine aeronautische Excursion unternommen hätte, eine binsenreiche, durch einen hohen Kameeldornbaum gekennzeichnete Stelle in genau südlicher Richtung, wohin wir gegen Sonnenuntergang kommen und Wasser finden sollten. Als wir jedoch am Nachmittag an Ort und Stelle waren, fanden wir eine sehr seichte, bis auf einige wenige, kaum je einen Becher Wasser enthaltende Stellen, vollkommen ausgetrocknete Regenlache. Wasser konnte man es eigentlich nicht nennen; es war vielmehr ein grünlich-dickes reichlich mit Kaulquappen, Insectenlarven und Infusorien versetztes und stark nach Ammoniak riechendes, wässeriges Fluid. Es bedarf wohl keiner besonderen Versicherung, daß uns bei dem bloßen Gedanken an den Genuß dieses Fluids anfänglich Ekel erfaßte, allein der Durst besiegte schließlich alle Bedenken. Die Flüssigkeit wurde aus einigen der Löcher mit einem Löffel geschöpft und damit eine Serviette gefüllt, in der sicher Millionen von, dem bloßen Auge unsichtbaren und eine Unzahl von handgreiflichen thierischen Gebilden herumtummelte, und das Wasser mühselig durchfiltrirt. Das ganze Experiment ergab etwa 1½ Becher einer dicklichen Flüssigkeit, welche Menge in fünf gleiche Theile getheilt wurde.
Nach einer zweistündigen Rast, während welcher wir trotz brennenden Durstes keinen zweiten Filtrirungsversuch machten, brachen wir wieder auf. Im selben Maße als wir uns dem Vaalflusse näherten, schwanden die Büsche und Bäume, das Gras wurde niedriger—ein ausgezeichneter Weideplatz für große Heerden. Wir sahen nichts von den Gnu's und Gazellen, die wir nach der Angabe der Bewohner von Gassibone's Residenz auf der genannten Strecke hätten finden sollen; wir begegneten nur wenigen Batlapinen, welche blos mit Stöcken bewaffnet und von mehreren afrikanischen Windhunden begleitet, auf Niederwild jagten.
Tags darauf, als sich die Sonne bereits hinter dem bewaldeten Freistaatufer des Vaalflusses zu bergen begann, wurden wir von einem kleinen Batlapinenjungen, der auf der weiten Grasebene Ziegen hütete, auf die bewaldeten Hügel aufmerksam gemacht, hinter welchen sich der Fluß hinschlängelte. In der angegebenen Richtung sahen wir einige Hütten, wo Gassibone's Viehhüter wohnten, welche Früh und Abends die auf der Ebene weidenden Rinder nach dem Flusse zur Tränke zu führen hatten.
Der Vaal-River gehört unstreitig zu einem der trügerischesten Flüsse Süd-Afrika's. Seine Ufer, weniger sein Bett, sind so schlammig, daß die zur Tränke gehenden Zugthiere einsinken und eines elenden Hungertodes sterben; und dies namentlich ältere Thiere, welche der längs des Flusses fahrende Gespann- und Wageninhaber (Rider) wegen Abmattung an einer oder der anderen Stelle bis zu seiner Rückkehr von der eben unternommenen Geschäftsreise oder bis zu einem vielleicht mehrere Monate später erfolgenden Besuche zurücklassen muß. Auch ich machte mehrmals bittere Erfahrungen in dieser Hinsicht.
Während sich meine Begleiter daran machten, die Tränkestelle der Batlapinenrinder aufzusuchen, wandte ich mich mit dem Gewehre stromabwärts, um einige Wildenten für unsern Nachtimbiß zu erhaschen. Es wurde allmälich dunkel. Ich trat so leise wie nur möglich, auf den härteren Bodenstellen blos mit den Fußspitzen auf, und wo ich vor mir trockene Büsche an dem steilen Uferabhange zu berühren glaubte, da beugte ich mich nieder, um sie zu beseitigen und so jedes Geräusch durch ein Zertreten derselben zu vermeiden. Da, ein lautes Geschnatter—mir schon bekannt—zu meiner Linken, dann ein schwerer Flügelschlag und über das Wasser stromabwärts bewegten sich zwei der ersehnten Wildgänse (Chenalopa). Unwillkürlich knieete ich nieder, um desto besser sehen und dem Flügelschlage lauschen zu können; die tiefe über dem schönen hier so ruhig, so langsam dahinfließenden Strome herrschende Stille durch einen Schuß zu unterbrechen, schien mir ein Frevel zu sein. Der breite Fluß schimmerte matt vor mir nach dem Westen zu, wie ein riesiges, glänzendes Band; und in der Seele tauchte—unbewußt und ungesucht—ein ähnlich Bild aus weiter, weiter Ferne auf! Ein schönes, fast ähnliches Band, das den Fuß des Mittelgebirgs umsäumt, und an dem ich so manchen Abend und manche Nacht fischend durchgeträumt! In seiner Nähe, aus einem kleinen bescheidenen Häuschen, pflegte ein Licht in die dunkle Nacht mir entgegen zu schimmern!—Schimmert es nun auch jetzt,—wo ich hier in der Abendstille am Ufer eines afrikanischen Stromes weile? O, theures Vaterherz, o, liebe Mutter denkt ihr meiner?—Zürnet nicht, daß ich euch verlassen, ich komme wieder und dann ist ja Alles gut!—Und so saß ich stundenlang unter den hohen Weiden am Ufer des Garip. Nur undeutlich hoben sich die schattigen Bäume am Horizonte des jenseitigen Ufers ab.
Ich machte mich endlich auf den Heimweg. Die Dunkelheit erschwerte mir diesen Versuch mehr als ich dachte. Oft stieß ich mit dem Kopfe an einen quer gegen den Fluß reichenden Ast der Trauerweide oder ich stolperte über ihre Wurzeln. Einige Eulen schienen wohl am jenseitigen Ufer eine Meerkatzenheerde aufgeschreckt zu haben, denn zuerst plötzlich und mehrstimmig, dann nur in Pausen scholl das kurze, schwache Geschrei der Meerkatzen zu mir herüber, welche die Gipfel der höheren Bäume zu ihrem Nachtlager gewählt haben mußten. Mehrmals überraschte mich auch ein plötzlicher Fall in's Wasser, es waren flüchtende Wasserleguane (Polydaedalus), riesige, fünf Fuß und darüber lange Eidechsen, welche die Uferlehnen nach Mäusen, Kerbthieren etc. durchsuchend, geräuschlos bei meiner Annäherung bis an das Wasser geschlichen und dann plötzlich untergetaucht waren. Diese Riesenechsen wählen sich meist ein stetig oder wenigstens periodisch fließendes Gewässer zu ihrem Aufenthaltsorte, sowohl in der Nähe menschlicher Wohnungen als auch in der Wildniß. Ihr Gebiß ist für Thiere, die größer als ihr Schlund sind, ungefährlich, allein sie haben eine gewaltige Kraft in ihren Kiefern und eine noch bedeutendere in ihrem langen Ruderschwanze, der ihnen namentlich beim Fange von Wasserthieren von sehr großem Nutzen ist. Ein solcher Leguan wartet in der Regel am Rande eines Baches, flach auf der Erde oder auf einem überhängenden Baumstamme platt liegend, wie ein Stück Holz, so daß man ihn kaum bemerkt, und oft stundenlang unbeweglich auf Beute. Nichts verräth in dem dunkelbraunen Thiere, dessen Schuppenleib von zahlreichen grünen und gelblichen Querstreifen bedeckt ist, Leben, als die winzigen Augen, die sich ununterbrochen öffnen und schließen, bis sie eine nahende Beute erspäht und dieser ihre Aufmerksamkeit zollen. Mäuse, Frösche und Kerbthiere und alles was er bewältigen kann—also was unter Säugethieren die Größe einer Ratte, unter Vögeln die Größe eines Huhnes etc. erreicht—wird seine Beute. Eine besondere Vorliebe scheint er für Krabben und Eier zu haben. Doch glaube ich, daß jene Vorliebe für das Krabbenessen, die wir häufig beobachten konnten, eigentlich nur ein Gebot der Nothwendigkeit ist und daß die Echse nur aus Mangel an anderer Beute dieses durch ganz Süd-Afrika und auch weit nach dem Norden zu vorkommende Krustenthier aus seinen Löchern herausholt. An solchen Bächen und Flüssen werden wir eine Menge der zerkauten Schalenüberreste gewahr, so daß wohl eine beträchtliche Zahl von Krabben für die täglichen Mahlzeiten des schuppigen Wasserbewohners nothwendig sein mag. An fließenden Gewässern mit hochbegrasten Ufern liegende Gehöfte haben von den Leguanen viel zu leiden, weil sie nur zu gerne die Hühnerställe besuchen und dem Menschen das Einsammeln der Eier ersparen. Ja, sie gehen in dieser Vorliebe auch so weit, daß sie sogar hohe Bäume erklettern, um nach Vogelnestern zu fahnden, wie ich dies in der Missionsstation Limkana am Matebe-Flüßchen beobachtete. Doch werden sie im Baumklettern von ihren nahen Verwandten, den Landleguanen, bedeutend übertroffen. Ich fand die Wasserleguanen von der südlichen Meeresküste bis in das Marutse-Reich verbreitet. In Flüssen, wo sich Krokodile vorfinden, bewohnen sie die Stromschnellen, weil diese von den ersteren gemieden werden.
Nächst dem Wasserleguan finden wir auch in Süd-Afrika eine ähnliche, doch nie im Wasser lebende Species, den schon nebenbei erwähnten Landleguan. Diese Art ist breiter gebaut, unbeholfener, hat einen bedeutend kürzeren Schwanz als jene und wird im Ganzen 4-5 Fuß lang. Man findet sie auf grasarmen wie auf hochbegrasten Ebenen, in Felsenpartien, in Gebüschen, wie auch in Wäldern. Sie suchen kleine Vögel, Mäuse, Ratten, Asseln und Insecten zu ihrer Nahrung auf, auch das Nestausnehmen ist ihnen eine beliebte Sache und die Bäume sind für sie das, was für die Polydaedalus das flüssige Element ist. Wittern sie Gefahr, so klettern sie rasch auf ihren luftigen Wohnsitz und legen sich dann flach auf einen der Queräste nieder; sind sie jedoch am Boden, so verkriechen sie sich rasch in ein verlassenes Erdthierloch, oder wenn sie diese Zufluchtsstätte nicht finden, versuchen sie es, sich an den Boden anzuschmiegen und bewegungslos zu verharren. So wie man sie jedoch berührt, kommt plötzlich Leben in die anscheinend schlafenden Thiere. Sich aufrichtend, strecken sie sich, fauchen laut, und schreiten langsam und gravitätisch—man möchte sagen, blos auf ihren Nagelspitzen einher; ebenso dick als sie uns früher, auf der Erde liegend, erschienen, ebenso dünn und zu wahren Gerippegestalten werden sie nunmehr. Im Unterleibe dieses Pachysauriers trifft man eine reiche lappige Fettansammlung, welche von mehreren südafrikanischen Eingebornenstämmen als Heilmittel für verschiedene Krankheiten gebraucht wird.
Erst gegen Mitternacht war ich wieder zu meinen Begleitern am Wagen zurückgekehrt, welche durch mein langes Fernbleiben beunruhigt, wachgeblieben waren.
Am folgenden Morgen brachen wir, nachdem wir uns die Wohlthat eines Bades im Vaalflusse gegönnt, in ostnordöstlicher Richtung nach der Transvaal-Republik auf. Eher als ich es erwartet, stießen wir schon nach zweistündiger Fahrt auf einige Gebäude am rechten Vaalufer. Näher kommend fanden wir ein längliches Ziegelhaus mit Eisenblech bedeckt, einen zweiten aus Erde und Pfählen aufgeführten Kunstbau, der jeden Augenblick einzustürzen drohte und ein drittes aus gebrannten Backsteinen erbautes Häuschen mit flachem Dache. Diese an drei verschiedenen Enden der ausgemessenen, zukünftigen Stadt aufgeführten »Gebäude«, 2 Zelte und 13 Korannahütten, bildeten im Jahre 1872 das Häusermeer der westlichsten der Städte der Republik, das später durch die Unruhen im Lande Gassibone's und unter den nahe anwohnenden Koranna's in Süd-Afrika ziemlich bekannt gewordene Christiana. Das erstgenannte Haus war die Wohnung des Landdrostes und zugleich das Comptoir der höchsten Civil- und Militärgewalt des Districtes Bloemhof, in dem zweiten kleinen, mit flachem Ziegeldach bedeckten war ein Kaufmannsladen und in dem baufälligen Hause wohnten, wenn ich nicht irre, der Sheriff, ein Notar etc. In dem einen Zelte die dem Sheriff unterstehende Polizeiarmee für die Städte Christiana und Bloemhof und für den ganzen District—in Summa ein Schwarzer. In dem zweiten Zelt hatten sich ein paar Maurer einlogirt, welche ein öffentliches Gebäude, ich glaube ein fensterloses Gefängniß, errichten sollten.
Seit jener Zeit meines ersten Besuches der Transvaal-Provinz hat sich auch in Christiana viel und zum Bessern verändert, so daß das Städtchen gegenwärtig an Bedeutung mit Bloemhof rivalisirt, welches im Jahre 1876 etwa 30 Häuser zählte. Die rasche Entwickelung Christiana's ist, abgesehen von der günstigen Lage der Stadt auf der aus Griqualand nach der Transvaal-Provinz führenden Straße, wesentlich ein Verdienst seines Landdrostes, dessen Bekanntschaft ich zu machen später das Vergnügen hatte, und ich kann nur sagen, daß er unter der Republik seiner schwierigen Stellung als Grenznachbar mehrerer unruhiger Eingebornenstämme in der besten Weise gerecht wurde, so daß er selbst nach der Annexion von Seite der Engländer in seinem Amte belassen wurde.
Als ich damals, im Jahre 1873, dem mich am Wagen besuchenden Kaufmann (Kaufmann, Großhändler, Waffenschmied, Hotelbesitzer, Fleischer und Bäcker zugleich) mein Erstaunen an den Tag legte, daß sich in Christiana die Gesetzeskraft blos auf einen Polizisten stützen könne und man auch kein »Arrestlocal für gemeingefährliche Individuen« besäße, antwortete mir der Mann (der Nationalität nach ein Deutscher), daß man kein Gefängniß brauche, da es keinen Sträfling gebe. Die Einnahmen des Landdrostamtes von Christiana waren damals noch so klein, daß man schon an und für sich nicht darauf erpicht war, »Gefangene« zu machen; aber hätte man auch einen »Vogel« ertappt, wo hin mit ihm? Der Herr Notar konnte ihn unmöglich zu sich in sein Zimmer nehmen, er theilte es ja mit dem Sheriff, aus dem Zelte wäre er mühelos entwischt, ihn im Hause des Kaufmannes unterzubringen, ging auch nicht an, hier wäre ihm die Versuchung zu nahe gelegen, sich für die Flucht noch mit Proviant gratis zu versehen. Das waren alles wichtige Momente, die man berücksichtigen mußte, zudem hatten die Boers es gewöhnlich dem Herrn Landdrost erleichtert, daß sie den Schuldigen unter ihrem »Volke« (schwarzen Dienern) den Schambock (Hippopotamos-Peitsche) zu verkosten gaben, sobald sich einer eines Diebstahls etc. zu Schulden kommen ließ, und wobei jede Mühe (das Transportiren des Diebes zum Gerichte und die Tagfahrten) sowie Geld (all' die mit dem gerichtlichen Verfahren verbundenen Kosten) erspart wurden.
Wir hatten unser Lager unmittelbar am Ufer des Vaal aufgeschlagen, das hier ziemlich hoch ist und einen guten Einblick in die zahlreichen Inseln und Stromschnellen des Flusses gewährt. Unstreitig ist die Flußscenerie bei Christiana recht interessant und für den Ornithologen ein Besuch der Inseln sehr lohnend. Ich habe hier die prachtvollen, langschwänzigen Mandelkrähen an ihrer südlichsten Verbreitungsgrenze beobachtet.
Auch in Christiana wurden Diamanten gesucht, doch nur spärlich gefunden.
Am nächsten Tage (13. März 1873) verließen wir die »Stadt« und zogen weiter flußaufwärts nach Bloemhof. Die zwischen beiden Städten sich erstreckende Gegend gehört zu den kahlsten und ödesten des Transvaal-Gebietes und trägt ganz den Charakter einer Karoo-Ebene. Zu dem trostlosen Anblicke des Transvaalufers bildet das jenseitige Freistaatufer einen scharfen Contrast. Dichte Kameeldornbäume bedecken das Ufer auf weite Strecken hin und in den Fluthen des Vaal spiegeln sich zahlreiche Farmen ab, welche seine Gelände säumen.

[Gefährlicher Nachtmarsch.]
Von Wild sahen wir blos drei flüchtige Springbockgazellen, einige der kleinsten Zwergtrappen und an den kahleren, felsigen Stellen Erdeichhörnchen und Scharrthiere (Rhyzaena), die letzteren in großer Menge, 15-20 je einen Bau bewohnend. Kaum hatten sie das Wagengerassel gehört, eilten sie schon von ihren nicht weit vom Baue unternommenen Ausflügen, die ersteren um nach Wurzeln, die letzteren um nach Käfern, Larven, Scorpionen etc. zu graben, zu ihrem Baue zurück. Sie sind nicht besonders behend im Laufen und können leicht von einem Hunde, wenn sie auch vor ihm einen bedeutenden Vorsprung haben, eingeholt werden. Beim Laufen halten sie in der Regel den Schweif hochgehoben, die Eichhörnchen ihre Fahne entfaltet: letztere kehren sich nicht eher um, als bis sie über ihren Löchern sitzend, noch einmal nach dem Störenfried ausschauen, während die Scharrthiere sich oftmals umsehen, stehen bleiben und dabei verdrießlich knurren. Während die ersteren scheue und furchtsame Thiere, sind die Rhyzaena als Raubthiere muthig und vorsichtig. Von jenen beobachtete ich nur eine, von den letzteren mehrere Arten. Da, wo ich die Erdeichhörnchen auf der Reise nach Norden zu vermissen begann und wo die prairienartigen Ebenen dem Walde wichen, wurden diese Thierchen durch eine kleine, gelbbräunliche, auf Bäumen lebende Art ersetzt. Die Eingebornen, mit Ausnahme der Hottentotten, essen das Fleisch beider Thiere.
Am Nachmittag des 15. März gelangten wir nach Bloemhof, welches damals blos aus einer Straße bestand und das uns zu keinem Aufenthalte einladend erschien; die Scenerie ringsum bot ein dürftig-trauriges Bild, seitdem jedoch hat das Städtchen zusehends gewonnen.
Seitdem wir Klipdrift verlassen hatten, war uns fast ausnahmslos heiteres schönes Wetter hold gewesen, doch kaum hatten wir Bloemhof im Rücken, als sich der Horizont immer mehr zu umwölken begann. Mit der zunehmenden Dunkelheit wurde es durch das inzwischen losgebrochene Unwetter rings um uns so schwarz, daß wir auf 20 Schritte nicht sehen konnten und ich bedauern mußte, nicht im Weichbilde der Stadt übernachtet zu haben. Anfangs gingen wir vor dem Gespann, da der das Leitpaar am Riemen führende Koranna behauptete, den Weg vor sich von dem gleich dunkel aussehenden Boden zu beiden Seiten nicht hinreichend unterscheiden zu können. Der heftige Regen, der uns durchnäßte, im Verein mit dem kalten Winde, trieb uns jedoch in den Wagen hinein; hundert Schritte weiter und die Zugthiere blieben stehen; sie glitschten fortwährend aus, was mich auf den Gedanken brachte, daß wir vielleicht vom Wege abgekommen, auf einen Abhang gelangt waren, und dann konnte dies nur nach dem Flusse zu sein. An eine Fortsetzung des gefährlichen Nachtmarsches war unter solchen Umständen nicht zu denken, wir mußten hier das Morgengrauen abwarten.
Die Recognoscirung unseres unfreiwilligen Lagerplatzes führte zu einer Entdeckung, die mich tief erschreckte. Als ich den Wagen im strömenden Regen zum zweiten Male, diesmal in einem etwas größeren Radius umging, schien es mir, als wenn sich etwa 20 Schritte vor den Zugthieren eine dunkle Stelle befände. Mir däuchte es ein Erdloch, und so holte ich den »Triber« (sprich Trajbr) herbei, um gemeinschaftlich bei der Helle des nächsten Blitzes die Stelle zu untersuchen. Das erwünschte natürliche, elektrische Licht blieb auch nicht lange aus und wir sahen zu unserer Ueberraschung eine Regenschlucht, die zu dem Flusse führen mußte. Wären wir noch 20 Schritte weiter gegangen, wir hätten es theuer gebüßt. Am Morgen zeigte sich eine Schlucht mit schroff abfallenden, etwa 16 Fuß hohen Lehmwänden.
Es war eine äußerst ungemütliche Nacht, die wir hier zubrachten, der Regen durchdrang selbst die Leinwandhülle des Wagens, der kalte Wind ließ uns erstarren und führte uns die Thatsache zu Gemüthe, daß wir uns 4000 Fuß ober dem Meere, auf dem Plateau des südlichen Transvaalgebietes befanden. Nur David und Gert ließen sich durch das Unwetter nicht im Mindesten in ihrer Vorliebe für Morpheus stören, unbekümmert darum, daß sie förmlich in einer Regenlache schwammen, waren sie bald in tiefen Schlaf verfallen, aus dem sie nur am kommenden Morgen (das Unwetter hatte sich nach Mitternacht verzogen) die warmen Strahlen des Tagesgestirns weckten.
Das jenseitige Freistaatufer ist durch eine sandige, mit Mimosenbäumen stellenweise spärlich, stellenweise ziemlich dicht bewaldete und bebuschte Bodenerhebung gebildet. Viele der vermögenden Farmer, die südlich vom Flusse wohnen, haben sich hier Farmen, d.h. je etwa 3000 Morgen Land gekauft, um in der trockeneren Jahreszeit daselbst ihr Vieh zu halten. Sie klagten mir über bedeutende Verluste, die sie durch Hyänen (H. crocuta) erlitten, welche Fohlen, Kälber und Maulesel getödtet hätten, so daß die Farmer Strychnin zu Hilfe nehmen mußten und damit tüchtig unter den nächtlichen Räubern aufräumten. Dem Sohne des Farmers Wessel hatten die Raubthiere in einem Winter 18 Stück Hausthiere getödtet und unter seinen Notizen halte ich namentlich einen Fall nennenswerth. Sein Diener hatte, um ein leichtes Ueberwältigen der Maulesel zu verhüten, zwei derselben mit einem Riemen zusammengekoppelt; als man sie nach einiger Zeit suchte, fand man den einen neben der Leiche seines Gefährten, beide noch mit dem Riemen verbunden und nach den zahlreichen Spuren mußte man schließen, daß einer derselben von den Hyänen getödtet und halb abgenagt worden war, während sich der Ueberlebende, durch stete, jedoch fruchtlose Versuche sich loszureißen müde geworden, wohl in sein Schicksal ergeben haben mußte. Seit jener Zeit ließ man nur Rinder und erwachsene Pferde ohne Hirten auf die Weide.
Einige Stunden östlich von Bloemhof erreichten wir eine große seichte, schon aus der Ferne weiß schimmernde Salzpfanne, an der eine Farm lag. Wie immer war eine Stelle des Ufers der Pfanne von einem Hügel überragt, während die anderen, mit Gras überwachsenen, fruchtbaren und moorigen Stellen zum Ackerbau wohl geeignet sein mochten.
Ich sammelte einige, der mit Salz incrustirten Steine und vegetabilischen Stoffe, während sich meine Gefährten daran machten, die zahlreichen, am reinen Kiesgrunde der Pfanne reichlich aufliegenden, hirse- bis erbsengroßen Salzkrystalle zu sammeln. Wir betraten nunmehr das eigentliche südwestliche Wildrevier des Transvaal-Gebietes, das sich von den Ufern des Bamboesspruit bis zum Schoenspruit über eine ununterbrochene, im Süden vom Vaal-River, im Norden von den Maqwasihöhen begrenzte und von mehreren meist von Norden nach Süden oder Südosten laufenden periodisch fließenden Spruits und einem Flusse durchschnittene, hochbegraste Ebene erstreckt.
Seit meinem Besuche dieser Gegend im Jahre 1873 hat das Wild bedeutend abgenommen, doch ist zu hoffen, daß die neue Regierung zu seinem Schutze die nöthigen Maßregeln ergreifen wird. Bei einer vernünftigen Jagdweise kann sich das übrig gebliebene rasch vermehren und dennoch den Farmern einen ergiebigen Ertrag sichern.
Während meiner ersten Reise beobachtete ich das gemeine schwarze Gnu in Heerden von 5-30 Stück, Bläßböcke in Heerden von 15-300 Stück, Springböcke, Deuker und Steinböcke von 10-150 Stück, nahe an den bebuschten Partien nur paarweise; ferner eine Menge von den rothlöffeligen Hasen, eine Unzahl von Springhasen und Stachelschweinen, Schuppenthiere und Erdferkeln—doch fehlten auch Raubthiere und Hyänen, Schakale und Proteles, an den Spruits Fischottern und im hohen Ufergras Wildkatzen nicht; während mehrere Trappenarten, Wildenten und Gänse, Wachteln (eine kleine Art) und in den bebuschten Partien Perlhühner zahlreich vertreten waren.
Bevor wir noch den Bamboesspruit (18. März) erreichten, erblickten wir zuerst einige einzelne, später eine kleine Heerde von Bläßbock-Antilopen, so genannt, weil sie auf ihrer Stirne eine weiße »Bläße« zeigen, die gut zu der dunkelrothbraunen Behaarung des Körpers paßt. Die Hörner sind nach hinten geneigt, gegen die Spitzen auseinanderlaufend, weder so zierlich noch so schön wie jene der Springbock-Antilopen, wie denn auch der Bläßbock, im Ganzen stärker gebaut und eine längere Verfolgung, ohne dabei zu großen Sprüngen seine Zuflucht zu nehmen, auszuhalten im Stande ist.
Zahlreiche Kranichheerden jagten im hohen Grase nach Heuschrecken. Nahte man ihnen, so flogen sie nach einem kurzen Anlaufe auf, um knapp über dem Grase hinreichend, einige hundert Schritte weiter wieder einzufallen. So wie sie aufflogen, ließen sie ihre prächtige, weithin hörbare Stimme ertönen.
Heftige Regenschauer nöthigten uns, schon in den ersten Nachmittagsstunden an einer Regenpfütze, einige Meilen östlich vom Bamboesspruit, Halt zu machen. Dazu trat noch eine allgemeine Ermattung der ganzen Expedition ein, in Folge der letzt erlebten Nacht und des Genusses von Salz aus der vorerwähnten Salzpfanne.
Der heftige Regen und unser Unwohlsein ließ uns eine recht unangenehme Nacht zubringen, erst gegen Morgen ließ der Regen etwas nach und wir versuchten etwas Schlaf unter dem Wagen, da die Ausdünstung der in dem Wagen naß gewordenen Gegenstände nicht einladend war.
Während der Nacht ließen sich Hyänen und Schakale oft nahe am Wagen vernehmen, allein wir konnten weder in der Dunkelheit hinreichend klar sehen, noch wollten wir uns auch in dem feuchten Wetter unserer in Lederhüllen aufbewahrten Gewehre bedienen. Das Liegen auf dem feuchten Grase wurde uns jedoch bald unbehaglich und so waren wir schon vor Sonnenaufgang bereit, die Weiterreise anzutreten.
Während sich meine Gefährten nun im Feueranmachen versuchten, hielt ich eine Rundschau über die nur nach Norden in der Ferne von Höhen begrenzte Grasebene, konnte jedoch nichts erspähen; am Himmel hingen noch schwere, dunkle und tiefgehende Wolken, der Tag versprach so trübe zu werden, wie es die Nacht gewesen. Während ich noch Rundschau hielt, hörte ich vor mir—es schien von zwei, circa 600 Schritte vor mir vorüberfliegenden storch- oder kranichartigen Vögeln zu kommen—schöne, melodische, harfengleich klingende, sich mehrmals wiederholende Töne, welche auch die Aufmerksamkeit meiner Begleiter auf sich zogen. »Das ist schön!«—»o, prachtvoll!«—»hört Ihr die Aeolsharfe!«—so zollte ein Jeder von uns seine Bewunderung, kaum daß jene Töne verklungen waren.
Nur Gert, der edle Korannajüngling, schien ungerührt. Von uns Allen um Auskunft bestürmt—wobei er recht erschrocken von seinem Frühstückstöpfchen auffuhr—woher diese Laute kämen, ob von Vögeln, anderen Thieren, oder was sie sonst erzeuge, schaute er über die Ebene hin, konnte aber nichts sehen, dann beugte er sich nieder, um längs der Grasspitzen besser in die Ferne sehen zu können, plötzlich faßte er mich bei der Hand, zog mich zu sich herab und sagte:
»Siehst Du, Bas, dort fern von hier fliegen zwei Vögel, da—da setzen sie sich nieder, das sind, das mußten die Schreier gewesen sein, sie sind solche Vögel wie die »groten Springhanvogels« (graue Kraniche), allein sie haben schön weißrothe Flügel und auf dem schwarzen Kopfe tragen sie schöne gelbliche Kronen und diese Kronen«—dabei war er, als er das Erstaunen in unseren Mienen gemerkt, aufgestanden und hatte sich zur Stärkung nach seiner diesmal so ungewöhnlich wortreichen Rede mit einem neuen Stückchen Kautabak gelabt—»ja, diese Kronen sind nicht Federn, sondern lange, gelbe steife Haare. Alle Menschen kennen sie in Afrika und viele Farmer im Oranje-Freistaat und der Transvaal-Provinz halten sie zahm auf ihren Höfen.«—»Und ihr Name?« fragte ich—»Mā-hems, Sir, nennt man sie.«
Nun waren wir so klug wie zuvor. Stelzenvögel waren es wohl, allein wohin sie einreihen, wußte ich nicht, bis ich zwei Tage darauf das Glück hatte, drei davon auf einer Farm lebend zu finden. Es waren die gekrönten oder Königskraniche (Balearia regulorum), von denen ich ein Pärchen auch heimbrachte. Seine kaiserliche Hoheit, unser durchlauchtigster Kronprinz Rudolph, erwies mir die hohe Ehre, das Pärchen gütigst anzunehmen und die Vögel dem kaiserlichen Thiergarten zu Schönbrunn einverleiben zu lassen.
Auf der durch mehrere kleine, trockene Salzpfannen charakterisirten Ebene tummelten sich auch zahlreiche große Trappen. Wir überschritten den Bamboesspruit, welcher nur an sehr wenigen Stellen in seinem schlammigen Bette kleine Wasserlachen zeigte und zogen weiter ostwärts gegen den zu ihm parallel laufenden und stetig fließenden Maqwasi-River. Das Land stieg etwas nach dieser Richtung hin und war auch stellenweise mit kleinen Beständen von Mimosen, zumeist Kameeldornbäumen bedeckt.
Am Rande des ersten kleinen Gehölzes blieben wir über Mittag liegen und da meine Freunde mit dem Trocknen der durch den letzten Regen naß gewordenen Sachen die Hände voll zu thun hatten, ergriff ich ein Beil, um Holz für unsere Küche herbeizuschaffen. Da meine linke Hand noch von dem Unfall mit dem Gewehre her nicht völlig geheilt war, fiel mir die Arbeit schwer, und mein Ungeschick brachte mir nur eine neue schmerzhafte Wunde am Schienbein des rechten Fußes ein. Wenige Minuten darauf schwebte ich wieder in ernster Lebensgefahr.
Um nicht unverrichteter Dinge zu meinen Gefährten zurückkehren zu müssen, trachtete ich, wenigstens die trockene Rinde von den abgestorbenen Stämmen abzulösen. Bei diesem Beginnen sah ich plötzlich etwas vor meinen Augen glitzern und im selben Momente verspürte ich ein Gefühl von Kälte an meinem linken Unterarme. Eine Viper hatte sich, wie dies häufig vorkommt, unter der Baumrinde verkrochen und war mir nun in den linken Aermel gefallen. Mit dem Verhalten in solchen Fällen vertraut, blieb ich unbeweglich, um das Thier nicht zum Bisse zu reizen. Die Schlange hatte sich nun ausgestreckt, und dabei ragte glücklicher Weise das Schweifende aus dem Aermel heraus. Rasch entschlossen ergriff ich dieses und schleuderte das Thier weit von mir.
Die folgende Nacht war ebenso unangenehm wie die vorhergehende. Es regnete so stark, daß wir an Schlaf nicht denken konnten, wozu übrigens das Hyänen- und Schakalconcert nicht ermuntern konnte.
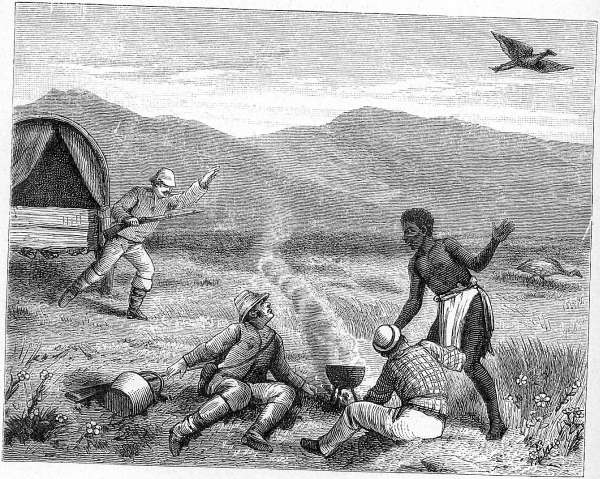
[Lager am Bamboesspruit.]
Am 19. März verließen wir unser Nachtlager. Nach etwa zweistündiger Fahrt hörten wir ein deutliches Brausen, wie von einem Bergstrome herrührend, welches vor uns aus einer durch einen langen von Norden nach Süden sich hinziehenden, durch einen Baumstreifen gekennzeichneten Vertiefung zu kommen schien. Wir fanden dies auch bestätigt und in jener engen 20-35 Fuß messenden Tiefe drängte sich der durch die in der gleichnamigen Hügelkette gefallene Regenmenge angeschwollene Maqwasi-River. Sein Bett ist meist steinig und steil, so auch seine Ufer, und zeigt oft, wie unterhalb der von uns benützten Furth, anmuthige Scenerie, wenn auch im beschränkten Maßstabe, wie es ein enges Flußbett und ein ebenso enges Thal nur bieten kann; der Fluß ist durch mehrere der Wintermonate bis auf einige der tieferen, felsigen Löcher trocken und ziemlich fischreich. Seine Ufer, und dies gilt namentlich von den felsigen, zerklüfteten Partien, sind von Fischottern, Wildkatzen, einer Wieselart, der Genetta und anderen kleinen Raubthieren, den Rohrrüßlern und auch von Wasserleguanen bewohnt. An der Furth, welche durch die steile Ab- und Auffahrt schwer zu passiren war, fanden wir das Wasser etwa drei Fuß hoch; am rechten Ufer trafen wir einige Transportwägen, welche Waaren im Gewichte von 6-7000 Pfund aufgeladen hatten, deren Fuhrleute den angeschwollenen Fluß nicht zu durchfahren wagten und das Fallen des Wassers in einer in der Nähe liegenden Cantine abwarteten. Ich entschloß mich jedoch, den Versuch zu wagen, der auch bis auf einen kleinen Unfall, der uns einen Theil unseres Kochgeschirres kostete, gelang.
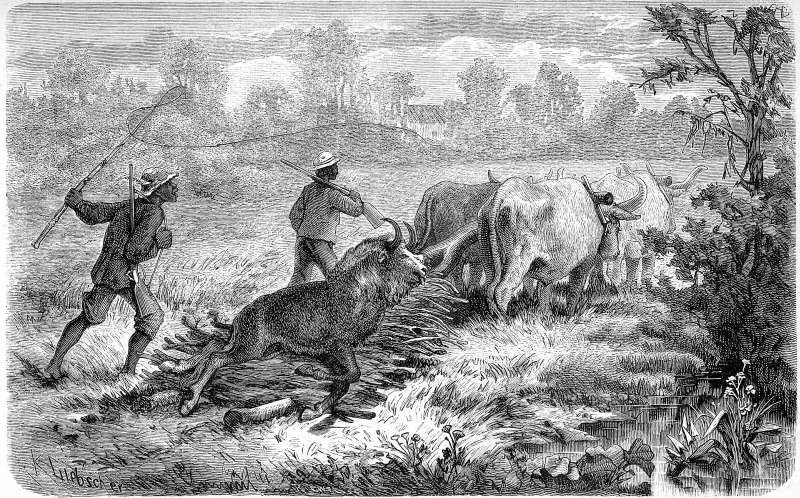
[Rückkehr von der Gnu-Jagd.]
Noch bevor die Sonne im Zenith stand, hatten wir die hier vom Norden nach Süden vorbringenden Maqwasihöhen an ihrem südlichsten Abhange erreicht, welche nicht nur dem Botaniker, sondern auch dem Mineralogen eine höchst lohnende Ausbeute, letzterem prachtvolle Quarzit-Porphyre bieten. Hasen und Trappen fanden sich auf der Ebene nach dem Süden, während der nahe Teich des Farmers, der sich am Fuße der Höhen angesiedelt hatte, von schwarzen Blaßhühnern, von Tauchern, Wildenten, Ibissen und Fischreihern wimmelte.
Am Nachmittage machte uns der Sohn des Farmers einen Besuch und ich staunte über die Fertigkeit, mit welcher dieser Mann meinen Revolver zu handhaben wußte. Schuß auf Schuß traf das Ziel. Gegen Abend verließen wir die Farm und zogen über eine weite Ebene, welche von zwei Fuß hohem, üppigem Graswuchs bedeckt, zahlreiches Wild beherbergte. Etwa sechs englische Meilen von unserem mittägigen Lagerplatze entfernt, am Abhange der Höhen, mußten wir anhalten, strömender Regen hinderte uns an der Weiterfahrt. Wir befanden uns in einem kleinen isolirten Mimosenwäldchen, das eine Farm umgab. Der außerordentliche Reichthum der Ebene an mancherlei Wild gab uns Veranlassung, hier einen ganzen Tag zu verweilen.
Bei Tagesanbruch wurde ich durch einige in der Nähe gefallene Schüsse aus meinem kurzen Schlummer gerissen. Die Schüsse schienen auf der Ebene nach Süden abgefeuert worden zu sein. Später, als wir beim Frühstücke um unsere Eisentöpfe saßen, wurde uns die Erklärung dazu geboten. Zwei Holländer kamen auf unscheinbaren, allein sehr ausdauernden Ponies herbeigeritten, und nachdem sie uns gefragt, ob der »Bas« (Hausherr) daheim sei, eine Frage, auf die wir keine Antwort hatten, ritten sie auf das mit Stroh gedeckte Häuschen zu, um sich hier vom Nachbarn, »Ohm« (gewöhnlicher Titel eines holländischen Farmers), einen Wagen zu entlehnen, mit dem sie die zwölf diesen Morgen auf seiner Farm erlegten Antilopen (Spring- und Bläßböcke) nach ihren, einige Meilen abliegenden Farmen schaffen konnten.
Jene holländischen Bauern, welche nahe an Städten wohnen, bringen die erlegten Thiere, meist nachdem sie dieselben ausgeweidet, und ihnen die Köpfe abgeschnitten, die sie draußen im Felde den Schakalen und Geiern überlassen, aufgeschnitten zu Markte. Jene, die entfernter wohnen, zerstückeln ihre Beute, nachdem sie selbe abgehäutet und die Häute zum Trocknen auf der Erde ausgespannt haben. Von Springböcken werden die Felle von den Farmern blos getrocknet, viereckig zugeschnitten und 8-12 solcher Häute zu Fußdecken zusammengenäht, eine Arbeit, in welcher sie von den Eingebornen weitaus übertroffen werden.
Die Felle des Bläßbockes und des in den Wäldern oder auf den bebuschten Höhen wohnenden Kudu werden in ähnlicher Weise ausgearbeitet und zu dem hinteren stärkeren Vorschlag (dem Achterschlag) der aus Giraffenhaut verfertigten Peitsche benützt. Auch gerben sie in sehr primitiver Weise die Bläßbock-, Gnu- und Quaggafelle, und verkaufen das so gewonnene Leder den in Städten ansäßigen oder herumziehenden Kaufleuten. Zum Gerben benützt man die Rinde mehrerer auf Höhen wachsenden Bäume, so z.B. des Waggonhout-Baumes und anderer, und wo diese mangeln, einiger der gewöhnlichen, doch größeren, meist an Flußufern wachsenden Mimosenarten. Solche, die das Gerben als Nebengewerbe betreiben, kaufen gewöhnlich die ungegerbten Felle den Jägern ab, bezahlen in der Regel 3-4 Shillinge für ein Bläßbockfell und verkaufen es gegerbt um 10 Shilling.
Aermere Farmer, die bei Freunden oder Verwandten wohnen, bereiten aus den halbgegerbten Gnufellen die Sohlen, aus Bläßbock-, Kudu-, Hartebeest-Fellen etc. das Oberleder zu einer unscheinbaren, allein auf Reisen in Süd-Afrika sehr bequemen Fußbekleidung, den sogenannten Feldshoen, welche an Ort und Stelle mit 6-8, bei den städtischen Kaufleuten mit 10-14 Shillingen verkauft werden.
Das Fleisch des Wildes wird in lange Stückchen geschnitten, etwas eingesalzen oder bei mäßiger Tageshitze auf Riemen aufgehangen getrocknet und als Beltong steinhart auf den Tisch gebracht. Zubereitet, d. h. abgerieben und dann in Butter gesotten, gibt es einen delicaten Imbiß. Ein Pfund von diesem getrockneten Fleische wird mit 6 Pence bis 1 Shilling bezahlt und von manchem Farmer in größeren Mengen auf den Markt gebracht.
Der große Wildreichthum der Umgebung des Gehölzes verhalf auch unserer Küche zu manchem Leckerbissen und meiner Sammlung zu schönen Bälgen. Unter Anderem gewann ich einen prächtigen Uhu, einen Hühnergeier, zwei Falken, eine Zwergeule, einen Wiedehopf, kleinere Spechte u.s.w.
Mein Enthusiasmus wurde indeß plötzlich abgekühlt, als der Farmer mich plötzlich mit seiner unmelodischen und schnarrenden Stimme zur Rede stellte. Es war ein vollbärtiger Boer, der grimmigen Blickes mich und meinen Gefährten F. frug, wo wir »del manier« gelernt hätten, »Finks, Falke, Eule und mar all det Vogels dot to skeuten« ohne daß man erst »will Mynheer permittiere« angesucht hätte. Die Entrüstung des Farmers hatte sich jedoch bald gelegt, als er erfuhr, daß ich ein Doctor sei, denn ein solcher ist dem holländischen Farmer stets ein willkommener Gast; ja er wurde später sogar noch so liebenswürdig, uns für einen Shilling eine reichliche Quantität frischer Milch zu überlassen.
Am folgenden Tage verließ ich das Gehölz und zog weiter nach Osten. Die Strecke von diesem Gehölze bis zum Estherspruit ist durch außerordentlichen Wildreichthum ausgezeichnet. Ich zählte zu beiden Seiten des Weges nicht weniger als zwanzig Antilopenheerden (Springböcke und Bläßböcke). Zahlreiche Aasgeier hatten sich in geringer Entfernung unseres Weges über einen angeschossenen Bläßbock zum Fraße niedergelassen; daß es an solchen Gelegenheiten auf dieser weitläufigen Ebene nicht fehle, bewies uns ihre große Zahl.
Wir kamen nach einiger Zeit zu einem nach Süden sich hinziehenden grabenartigen Spruit, an welchem aus dem Dickicht eines kleinen Mimosengehölzes in der Ferne ein weißgetünchtes Farmhaus uns entgegenschimmerte. Hier wohnte ein Holländer, Namens Rensburg, ein freundlicher, ältlicher Mann, den wir später kennen lernten.
Am Ufer der Spruit machten wir Halt. Während wir uns beim Mittagsmahle gütlich thaten, näherte sich uns ein eigenthümliches Gespann, das unsere Aufmerksamkeit für einige Zeit gänzlich in Anspruch nahm. Zwei bewaffnete Betschuana's escortirten ein Doppelgespann von Ochsen, welche eine aus Mimosenholz verfertigte schlittenartige, mit Aesten überdeckte Gabel schleppten, auf welcher ein frisch erlegter Gnu-Stier lag. Es war ein schwarzes Gnu, welches von den Eingebornen, die es erlegt hatten, ihrem Brodherrn überbracht wurde. Rensburg hielt sich mehrere Eingeborne, die mit ihren Familien in der Nähe seines Wohngebäudes in Hütten wohnten. Die Frauen halfen in der Haushaltung des Farmers, die dunklen Männer aber jagten für ihn. Diesen Stier hatte einer der Männer im Morgengrauen, nachdem er die ganze Nacht hindurch hinter einem kaum 2 Fuß hohen Termitenbau gelauert, aus unmittelbarer Nähe erlegt. Da das Fell des Thieres nicht bedeutend verletzt war, gab ich ihnen den Auftrag, ihren »Bas« von mir grüßen zu lassen und ihn zu bitten, mir das Gnufell zu überlassen, um es für meine Sammlungen präpariren zu können. Sie versprachen es und zogen ab. Nach einiger Zeit kehrten die Männer mit der Botschaft zurück, der Farmer überlasse mir das Fell um den Preis von 5 Shillingen, ein Vorschlag, auf den ich bereitwillig einging.
Der Besuch eines Boers, der, in entgegensetzter Richtung reisend, in der Nähe unseres Wagens Siesta hielt, verzögerte unsere Abreise und es war bereits ziemlich dunkel, als wir Estherspruit verließen.
Die Dunkelheit machte allen Jagdversuchen ein Ende, ich wurde indessen durch den Fund eines Exemplares der Ringhalsschlange von seltener Schönheit reichlich entschädigt. So oft mich später Farmersleute besuchten, zeigten sie einen unverkennbaren Schrecken beim Anblicke dieses schwarzen giftigen Reptils.
Die Straße, deren guter Zustand mich vor dem Estherspruit überrascht hatte, nahm bald ein Ende, wir waren plötzlich auf eine morastige Ebene gerathen. Alle Mühe und Anstrengung, unseren Wagenkoloß aus dem sumpfigen Boden herauszubringen, waren vergeblich, und so mußte ich denn, wenn auch mit Widerwillen, an dieser gesundheitsschädlichen Stelle den Morgen abwarten.
Nach Mitternacht wurde es heller, so hell, daß wir die ungemein dreist gewordenen Schakale in unserer unmittelbaren Nähe sehen konnten. So gerne ich die freche Zudringlichkeit dieser argen Kläffer gezüchtigt und mich in den Besitz einiger schöner Schabrackenfelle gesetzt hätte, stand ich davon ab, da mir der Farmer am Estherspruit hievon abgerathen hatte, und durch die Schüsse das Wild verscheucht worden wäre.
Am folgenden Morgen ging es weiter; schon nach 200 Schritten kamen wir zum Klipspruit, einem kleinen, damals fließenden, doch bald nach der Regenzeit bis auf einige Tümpel austrocknenden Flüßchen, welches nach heftigen Regengüssen zu einem 50-100 Schritte sich ausbreitenden Strom anschwillt. Wir überschritten es und schlugen auf einige Tage am gegenüberliegenden Ufer unser Lager auf.
Es war ein herrlicher, des Waidmann's Herz entzückender Anblick, als der anbrechende Tag uns einen Ausblick in die Ferne nach allen Richtungen hin vergönnte. Wohin wir auch das Auge wenden mochten, überall erfreute uns der Anblick kleinerer und größerer Gazellen- und Gnuheerden, die nächsten etwa 400 Schritte vor uns, und manche wieder nur als dunkle Punkte am Horizonte, der nach Westen, Süden und Osten unbegrenzten Ebene erkennbar. Während die Springböcke gruppenweise grasten, hielten sich die Bläßböcke in langen Ketten hinter- oder neben einander grasend. Von mehreren Seiten klang der langgezogene Ton des Trappengeschreies zu uns herüber; jedes Plätzchen um uns athmete Leben. Als ich an jenem Morgen des 23. März 1873 die mir unvergeßliche Rundschau von meinem Wagen aus hielt, da kam es mir in den Sinn, mir einen größeren Landbesitz in diesen Gegenden zu wünschen, der umzäunt, dem von allen Seiten verfolgten Wilde als Hort dienen könnte; doch leider, dieser Wunsch wird sich wohl nie erfüllen! Nicht das Klima, der beschränkte Raum in den zoologischen Gärten ist einer der Hauptgründe, daß so viele Thiere der Gefangenschaft erliegen. Jene wandernden Menagerien werden mit der Zeit aufhören müssen, je mehr stabile entstehen, die sich rasch mehren, denn der notorischen Thierquälerei der ersteren, dem sogenannten Gefängnißsystem, muß einmal die sich mehr und mehr entwickelnde Veredelung des menschlichen Geistes ein Veto gebieten.
Am Klipspruit wollte ich einen mehrtägigen Aufenthalt nehmen, nicht um eine Razzia unter dem Wilde zu halten, sondern, wenn möglich, zu beobachten und von den hervorragenden Wildspecies je ein Fell für meine Sammlung zu gewinnen. Leider war der Zufall selbst diesem bescheidenen Wunsche nicht hold und heute bin ich zufrieden, daß es so geschah. Wir blieben bis zum 27. März. Den ersten Tag beschäftigten wir uns mit dem Präpariren des erkauften Gnufelles—eine mühevolle Arbeit. Am zweiten verfolgten wir den Lauf des Spruit, der sich grubenartig durch die Ebene wand und nur stellenweise in Tümpeln Wasser aufwies, um ein geeignetes Versteck in seinem Bette zu finden und das Wild aufscheuchen zu können.
Mehrere Wägen, die Transvaal-Farmern angehörten, welche mit Getreide theils nach den Diamantenfeldern zogen, theils von daselbst kamen, und die uns begegneten, hatten bis drei Stück Wild unter und an dem Wagen befestigt. Das Wild ließ denselben oft bis auf 300 Schritte Nähe vorüberfahren, was dann von den vortrefflichen holländischen Schützen benützt wurde, um auf der anderen Seite vom Wagen zu springen, sich in's nahe Gras zu werfen und auf die arglosen Thiere anzuschlagen. Von je drei Schützen traf in der Regel einer tödtlich und so bot man uns Springbockgazellen mit Fleisch und Haar für 1 Shilling bis 1 Shilling 6 Pence, Bläßböcke für 2-3 Shillinge und Gnus für 7-8 Shillinge an. Ich erstand zwei der ersteren Thiere.
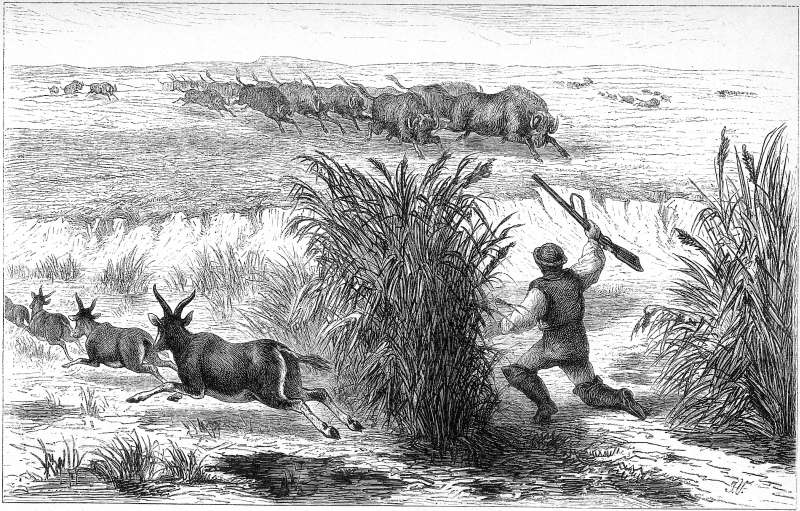
[Von schwarzen Gnu's überrascht.]
Doch weder mir noch meinen weißen Gefährten war Waidmannsglück jetzt hold; schon waren drei Tage resultatlos verflossen, den letzten Tag (27. März) beschloß ich noch einmal, mein Glück zu versuchen, und unternahm einen Ausflug, am Spruit abwärts.
Auf meinen an den früheren Tagen nach dieser Richtung hin unternommenen Ausflügen war mir eine Stelle in dem etwas verbreiterten Flußbette aufgefallen, die von dem Wilde als Tränkstelle benutzt zu sein schien. Neben ihr führte quer durch das sonst trockene Bett ein zu beiden Seiten von einem Tümpel (der Tränkstelle) umsäumter Pfad, den das Wild und namentlich nach den Spuren zu urtheilen, Gnu's zum Ueberschreiten des Bettes zu wählen schienen. Ich hielt es für das Beste, an diesem Pfade im Anstand zu liegen und das Herannahen des Wildes zu erwarten.
Ich verließ den Wagen nach Sonnenaufgang und legte kriechend die etwa zwei englische Meilen entfernte Strecke zurück. Es mochte jedoch schon 11 Uhr gewesen sein, bevor ich es zu Stande gebracht, denn stellenweise war das eigentliche Bett sehr seicht und ein sich in demselben vorwärts bewegender Mensch konnte leicht vom Wilde von der Ebene aus beobachtet werden. Der Pfad war eng, zu einer Seite Tümpel mit Schilf umsäumt. Der Fluß war, wie ich schon erwähnt, ziemlich breiter, flacher und seichter, als es sonst am Laufe des Klipspruit zu beobachten war. Ich mochte eine Stunde an dem Pfade gelegen haben, die Sonne brannte heiß und machte mir meine Lage recht unbequem, als von Nordosten her in weiter Entfernung einige Schüsse fielen; theilweise durch einen Grasbusch gedeckt, lugte ich nach Osten zu aus, sah jedoch nichts, außer mehreren ruhig grasenden Heerden von Springböcken, Bläßböcken und Gnu's. Von den letzteren fiel mir die eine dadurch auf, daß die Thiere, eines hinter dem andern trottend, eine bestimmte Richtung, und zwar gerade nach mir zu, eingeschlagen zu haben schienen. Ich wandte mich deshalb auch gegen dieses Ufer und machte mein Gewehr schußbereit. Da jedoch die Gnu's noch weit entfernt waren und sich langsam vorwärtsbewegten, kehrte ich meinen Kopf nach der entgegengesetzten Seite, wohin ich zuvor ausgelugt, und staunte nicht wenig, eine zahlreiche Bläßbockheerde im schnellen Laufe aus derselben Richtung, aus welcher die Schüsse gefallen waren, herannahen zu sehen. Die Thiere waren mir näher als die langsam schreitenden Gnu's, und da sie dieselbe Richtung, d.h. nach dem Pfade eingeschlagen zu haben schienen, wurde ich den letzteren untreu, kroch, mich flach auf den Boden legend, bis zur Mitte des Bettes; bis zum gegenüberliegenden flachen Rande zu gelangen war mir keine Zeit mehr geblieben.
Nach einigen Sekunden erhebe ich ein wenig den Kopf, die Thiere mußten nun schon in unmittelbarer Nähe sein. Doch welche Enttäuschung! Die Bläßböcke mußten mich bemerkt haben, denn etwa 200 Schritte vor mir hatten sie sich zur Flucht gewendet. Die letzten Thiere der Heerde waren eine Gais und ein kleines Böcklein, das lebend zu erlangen, mein lebhaftester Wunsch war; ich wollte es daher versuchen, die Gais zu verwunden und mich dann des Böckleins zu bemächtigen. In den rechten Lauf geschossen, bäumte die Gais auf, hinkte anfangs, allein bald war sie wieder in vollem Lauf, unmittelbar von dem Böcklein gefolgt und hatte die enteilende Heerde eingeholt.
Ich kroch nach meiner früheren Stelle zu, an den westlichen Rand, bückte mich nieder, um rasch noch einmal laden und einen der schönen Böcke erlegen zu können. Ich führte eben die Kugel ein, als ich über mir ein Pusten und Fauchen vernahm. Aufblickend, erschrak ich wie selten zuvor. Ohne mich zu bemerken, war die von mir beobachtete Gnuheerde im vollen Laufe nach dem Durchgangspfade herangeraunt gekommen, die bemähnten Köpfe tiefgesenkt, den weißen Schwanz hochgehoben, kamen sie wie ein Sturmwind herangebraust. Noch einige Momente und ich lag unter ihren Hufen. Da ich mich nach der näheren Bekanntschaft mit ihren Hörnern und spitzen Hufen durchaus nicht sehnte, sprang ich rasch auf, um mit lautem Geschrei und durch das Abfeuern des Gewehres, die Thiere zu erschrecken, zum Stillstand, wo möglich zur Rückkehr zu zwingen.
Gesagt, gethan. Aufspringend und das Gewehr schwingend schrie ich laut auf. Da stutzten die Thiere. Die struppigen Köpfe richteten sich auf mich—ein Schuß und der vorderste Stier wandte sich, den Kopf tiefgesenkt und laut aufbrüllend, zweimal im Kreise herum, dann nach rechts, gefolgt von der Heerde, nach etwa 10 Schritten drehte er sich wieder um, beschrieb einen Kreis, abermals von der ganzen Heerde gefolgt, und dieses Manier von Zeit zu Zeit wiederholend, entfernte sich die Heerde mit hochgehobenen Schwänzen und laut brummend.
Bevor jedoch die Thiere zum zweiten Male sich im Kreise gewendet hatten, sandte ich ihnen eine wohlgezielte Kugel nach, mir ein halberwachsenes Thier der Heerde auswählend. Trotzdem, daß ich das Geschoß einschlagen hörte, schien sich das Thier, ohne Schaden gelitten zu haben, zu entfernen. Da ich meines Schusses auf's Blatt, wie ich glaubte, sicher war, folgte ich den Thieren im Schweiße meines Angesichts in der brennenden Sonne etwa vier englische Meilen nach—doch vergebens; das Thier blieb wohl das letzte in der Heerde, allein die Entfernung zwischen mir und den Thieren wurde immer größer, auch war ich derart ermüdet, daß ich endlich die Verfolgung aufgeben und enttäuscht zum Wagen zurückkehren mußte.
Nachdem ich mich etwas gestärkt, machte ich mich mit Gert auf, um der Spur des angeschossenen Gnu zu folgen; es war nicht schwer, sie zu finden, wir folgten der Spur der Heerde von der Stelle, die ich bei dem Anpralle der Gnu's innehatte und wohl bis zwei Meilen weiter als ich früher die Verfolgung aufgegeben—es waren im Ganzen fünf Stunden seit dieser Zeit verflossen—fanden wir, schon halb abgenagt, den Cadaver eines jungen Gnu-Stieres, den wir den zahlreich versammelten Geiern als Beute überlassen mußten. Ich wurde jedoch durch diesen Mißerfolg so verstimmt, daß ich am selben Tage das Lager abbrach und unsere Reise nach dem Innern der Transvaal-Republik fortsetzte.
Als Ziel meiner Reise hatte ich mir die am oberen Moi-River gelegenen Wonderfonteiner Felsenhöhlen gewählt, von wo ich den Rückweg nach den Diamantenfeldern anzutreten gedachte. Als wissenschaftliche Ausbeute brachte mir der Aufenthalt am Klipspruit einen hübschen jungen Wasserleguan, einige Fischottern, Insecten, Skolopender und Pflanzen, namentlich Gramineen, und einige Grünsteinvarietäten ein.—Wir fuhren spät in die Nacht hinein und hielten an einer Ebene etwa vier Meilen nordöstlich von der Klipspruit-Furth an. Die Nacht war schön, ziemlich hell und während wir beim Abendfeuer sitzend unsere Erlebnisse an den Ufern des genannten Spruit besprachen, hörten wir wiederholt in einer mäßige Entfernung das Brummen der Gnu-Stiere, manchmal auch einen dumpfen Schlag, der sich dann einige Male wiederholte, ein Schall, der von den Anpralle der übermüthigen, sich mit ihren breiten Hörnern anrennenden Thiere herrührte. Das am Abende von allen Seiten beginnende, dann sich von Mitternacht an bis gegen Morgen wiederholende Schakalgebell und jenes langgezogene häßliche Hyänengeschrei zeigten, daß die wildreichen Gegenden auch zahlreiche hundeartige Raubthiere beherbergten.
Auch die Reise am 27. März führte uns durch wildreiche Gegenden, nur daß jetzt die Senken, in denen sich die Spruits wanden, tiefer wurden und stellenweise mit Buschwerk bestanden waren. Manche der letzteren beherbergten die von der südlichen Meeresküste bis über den Zambesi hinaus verbreiteten Perlhühner.
Dieser wild lebende Hühnervogel gehört unstreitig zu den interessantesten Erscheinungen der afrikanischen Vogelwelt und da er in den bewaldeten Gegenden ziemlich häufig vorkommt, mehrt er sich rasch, trotzdem er vielfach gejagt wird. Der liebste Aufenthalt des Vogels, der in Ketten zu 10-40 Stück haust, sind bebuschte und bewaldete Gegenden in der Nähe von Flüssen oder nie versiegenden stehenden Gewässern. Von unserem Perlhuhn unterscheidet er sich namentlich durch seinen hornartigen Auswuchs auf der Stirn. Ich will vorläufig nur der Jagdweise Erwähnung thun, die ihn uns bekannt machte.
Am Vaal-, Hart-River und den anderen Nebenflüssen des ersteren jagt man diese Vögel mit dem besten Erfolge 1½-2 Stunden vor Sonnenuntergang, zur Zeit wo die Thiere von der Weide aus der hie und da bebuschten Ebene, in anderen Gegenden aus den Büschen und Wäldern zur Tränke eilen, woselbst sie dann gewöhnlich auf den höheren Uferbäumen übernachten. Es läßt sich fast mit Sicherheit die Tränkstunde auf 4 Uhr Nachmittags für alle Jahreszeiten feststellen. Gewöhnlich wählen die Thiere einen und denselben Pfad; hat man sich nahe an diesem Pfade versteckt und blickt man etwa um ½ 4 Uhr von dem Gewässer landeinwärts, so wird man, wenn es die Witterung gestattet, eine Staubwolke sich herannahen sehen, einige Minuten später vernimmt man die ersten Gackerlaute, ohne die Vögel selbst noch zu erblicken. Die Staubwolke wird dadurch erzeugt, daß die zur Tränke eilenden Thiere noch auf ihrem Wege unausgesetzt im Sand oder Thonboden nach Insecten und Samen scharren. In dichtem Grase erleichtern die übrigen Vögel den Hühnern die Arbeit dadurch, daß sie alle zeitweilig ihr Köpfchen erheben und für einige Sekunden Rundschau halten; ist das Gras 3 und über 3 Fuß hoch, so beobachtete ich, daß die Führer 10-15 Schritte weit voraus eilten und von Zeit zu Zeit aufflogen, richtiger gesagt aufsprangen, um sich umsehen zu können. Hatten sie etwas Verdächtiges gesehen, oder näherte sich ein Mensch oder ein Raubthier von vorne her, so ergriffen sie mit lautem Gackern die Flucht, und leisteten darin wahrhaft Unglaubliches. Ich kenne wenig Vögel, welche so schnell laufen können; es geht so rasch im Wildpfade vorwärts, daß der mit den Gewohnheiten dieser Thiere wenig vertraute Jäger sie während des ganzen Tages nicht mehr zu Gesicht bekommt. Kennt man jedoch ihre schnelle Flucht und sendet man ihnen Hunde nach, oder hat man sich versteckt gehalten und tritt man plötzlich ihnen entgegen, so fliegen sie auf und da sie einen schweren Flug haben, so ist es für einen halbwegs guten Schützen leicht, mit jedem Schusse eines der Thiere herunterzuholen. Von den Eingebornen droht ihnen, wie auch dem übrigen Wildgeflügel, keine große Gefahr. Ich beobachtete, daß blos die Koranna's den Vögeln einigermaßen nachzustellen pflegten, sie mit Hilfe ihrer Hunde aufstöberten und dann—ohne Schrot—mit den harten Körnern des »Blue-bushes« (eine eßbare kleine Frucht) niederschossen.
Am Nachmittage des 27. März gelangten wir zum Matheusspruit. Trotz der regenreichen Jahreszeit war der Spruit ziemlich ausgetrocknet und neben dem Wege ein kleiner Damm quer über sein Bett errichtet und dadurch ein Teich gebildet. An einem nahen Abhange breitete sich ein dichtes Gebüsch aus, in dem einige verarmte Boers-Familien wohnten, welche über die Vorüberreisenden wie Raubvögel herfielen und sie in folgender schlauer Weise auszubeuten suchten.
Zog ein Boer aus dem Transvaal-Gebiete nach den Diamantenfeldern, um seine Producte auf den Markt zu bringen, oder kehrte er zurück, oder waren es—damals begann schon die Auswanderung—Unzufriedene aus den Diamantenfeldern, welche die Leydenburger Goldfelder aufzusuchen im Begriffe waren, so kamen wie zufällig einer oder zwei dieser Boer's aus dem Gebüsche heraus und auf den Wagen zu, knüpften ein Gespräch an, und gaben sich den Anschein, in Tauschhandel treten zu wollen, worauf sie dann auf die gute Weide und auf das schöne Dammwasser hinzuweisen nicht vergaßen und zum »Utspannen« (ausspannen) einluden; half dies nichts, so wußten sie die Wasserarmuth der nächsten Strecke bis Klerksdorp in den düstersten Farben zu schildern. Gaben die Reisenden nach, so waren sie bald darauf von drei und mehreren Ohmen, ihren Frauen und einem Rudel schmutziger Kinder umringt und ihre Vorräthe gebrandschatzt. Auch ich ging ahnungslos in die Falle.
Als wir ausgespannt hatten, fanden sich nicht weniger als 17 Köpfe an meinem Wagen ein. Zuerst wurde um Tabak gebettelt, leider willfahrte ich ihrem Ansuchen und so kam dann rasch Zucker, Kaffee, Thee, Blei, Schießpulver etc. an die Reihe. Bevor wir noch abzogen, wurden wir noch daran gemahnt, daß für das Tränken unserer Thiere am Teiche ein Shilling zu bezahlen sei. Kaum war dies geschehen, da kam der ganze Troß zum zweiten Male wieder und zwar um sich ärztlichen Rath von mir einzuholen, nachdem sie zuvor im Laufe des Gesprächs erfahren hatten, daß ich ein Arzt sei. Da hatte einer kranke Augen, jenem that der Kopf weh u.s.w. Ich hörte sie an, ertheilte den ärztlichen Rath während wir einspannten, und pries den Augenblick glücklich, als Gert, der »Wagentriber«, ohne sich um die uns Umlagernden zu kümmern, mit einem lauten »Fatt mer« (fasset nun, ziehet an) das Gespann in Bewegung setzte.
Vom Mattheusspruit gegen den Estherspruit war der Zustand des Fahrweges ein wahrhaft erbärmlicher. Theils führte er über felsigen Grund, theils durch derart aufgeweichten Boden, daß wir alle Augenblicke stecken blieben. Am 29. März erreichten wir den Estherspruit, ruhten hier in der Nähe einer gastlichen Farm etwas aus und erreichten am Abend desselben Tages den Jagdspruit. Die landschaftliche Szenerie vom Mattheusspruit (auch Matjesspruit genannt) bis hieher glich anfangs jener vom Maqwasi-River bis zu diesem Spruit, rechts und links von uns meilenweite Grasebenen, im Norden von den Maqwasihöhen, im Süden vom Vaalflusse begrenzt, von dem wir uns jedoch nach und nach so weit entfernt hatten, daß wir sein eigentliches Thal nicht mehr wahrnehmen konnten. Gegen den Jagd- (der Holländer spricht »Jach-«) Spruit zu änderte sich die Scenerie insofern, als die Höhen zur Linken näher Herantraten, sich sogar zwischen diesem Spruit und Klerksdorp (Klerksdorf) quer über den Weg nach dem Vaal-River ziehen und bei Klerksdorp einige interessante Höhengruppen bilden.
Der folgende Morgen war schön und warm. Die aufgehende Sonne beleuchtete die Ostabhänge der felsigen Klerksdorper Höhen, welche theilweise kahl, theilweise mit Büschen überwachsen, die einen kegel- oder brodlaibförmig am Ufer des Schoenspruit isolirt, die anderen zu Hügelketten mit scharfen Felsenkämmen gruppirt sind. Zwischen uns und diesen Höhen breitete sich eine mäßige Niederung, ein etwa zwei Meilen breites offenes Thal aus, welches einige Meilen nach abwärts in das enge Thal des Schoenspruit einzumünden schien. Jenseits einer quer über den Weg sich hinziehenden Felsenkette sollte Klerksdorp, die älteste Niederlassung in der Transvaal-Provinz, liegen. Der angenehme schöne Morgen lud mich zu einem Spaziergange auf der Ebene ein, wobei mich unwillkürlich die artenreichen Kinder Flora's zum Botanisiren aufforderten.
Schon am Wege fand ich mehrere sammelnswerth, unter diesen eine in Unmasse, förmlich als Unkraut wachsende Cinna mit dunkelziegelrothen oder rosafarbigen Blüthen; sie bildet dichte, doch kleine, 12-40 Zentimeter hohe, meist zwei- doch auch hie und da mehrblüthige Stöcke.
In einem nahen Gebüsche zur Linken fand ich reichliche Ausbeute an kleinen Prachtkäfern (Buprestidae), Blattkäfern (Chrysomelidae) und mittelgroßen Bockkäfern (Capricornia), auch an zahlreichen großen, gelb- und schwarzgescheckten Spinnen, welche große, unseren Kreuzspinnen ähnliche Gewebe zwischen den Bäumchen und Büschen ausgespannt hatten. Zwei Deukergazellen sprangen durch den Eindringling erschreckt auf, und verschwanden ebenso rasch in dem Dickicht.
Von diesem kleinen Morgenausfluge zurückgekehrt, machte mich Freund E. auf einen großen Vogel aufmerksam, der auf unseren Wagen loszulaufen schien. Es war eine große Trappe; ich legte an, ziele nach dem Halse, der Schuß kracht und der Vogel stürzt zur Erde. Es war ein prächtiges Thier, und zwar eines der größten seiner Art. Kaum 30 Fuß von der Rohrmündung entfernt, hatte sie den ganzen Schuß in die vordere Brusthöhle bekommen, so zwar, daß der Balg für meine Sammlung ganz unbrauchbar war, hingegen war das Fleisch eine werthvolle Acquisition für die Küche. Außer einem noch größeren Trappenpärchen derselben Art, welches ich auf der dritten Reise am linken Limpopo-Ufer beobachtete, sah ich nie wieder ein so großes Exemplar in Süd-Afrika.
Einen Gebirgssattel übersetzend kamen wir in das eigentliche Thal des Schoenspruit, den man füglich River nennen könnte, weil er in gewöhnlichen Jahren meist fortwährend fließt, nur in sehr trockenen den Charakter eines Spruit zeigt. Im Allgemeinen gehört dieses Flußthal zu den interessanteren Thälern des südafrikanischen Hochplateau's und auch zu einem der fruchtbarsten und bestbebauten. Im Thale des Schoenspruit reiht sich Farm an Farm; prachtvolle Weideplätze für das Hornvieh, längs den Höhen und den Abhängen zum Flusse, erhöhen noch den Werth des Landbesitzes am Schoenspruit und im Moi-Riverthale. Bei Entfaltung einiger Energie und einer rationellen Bearbeitung des Bodens könnte leicht das Zehnfache des gegenwärtigen Ertrages an Cerealien erzielt werden.
Klerksdorp oder Klerksdorf bestand im Jahre 1873 aus einer Hauptstraße, in der ich, wenn ich nicht irre, 25 Häuser zählte; seitdem hat es sich vergrößert und verspricht unstreitig neben Potschefstroom die bedeutendste Stadt des südwestlichen Transvaal-Gebietes zu werden. An jedem Hause fand ich einen Garten mit Obstbäumen, namentlich Pfirsichen, Orangen etc. und die Zäune aus Quitten und Granatbäumchen gebildet. Jener Theil des Schoen-Riverthales, in dem Klerksdorp erbaut ist, gehört überdies zu den günstigsten, namentlich in Bezug auf Wasserfülle des Flusses. Das Thal ist bei Klerksdorp von beiderseits aufzeigenden Höhen eingeengt, und durch einen isolirt stehenden Höhenzug flußaufwärts nach dieser Seite hin ziemlich geschützt.
Da wir mit dem Ueberschreiten des Schoenspruit eine andere Bodenformation betreten, welche sich bis Wonderfontein im centralen Transvaal-Gebiete verfolgen läßt, so will ich noch mit wenigen Worten der geologischen Struktur der Strecke vom Bamboesspruit bis zum Schoenspruit gedenken. Die Hauptmasse des sichtbaren Gesteins auf der Ebene bilden in Bezug auf Farbe, Consistenz und die schon in den Gegenden weiter vaalabwärts beobachteten mandelartigen Einschlüsse, verschiedene Varietäten des Grünsteins. An manchen Stellen finden wir ihn sehr hart und fest, riesige Platten bildend, an anderen ist er bröcklich und dann zeigt die Oberfläche viele quarz- (Milch- und Rosenquarz) und chalcedonartige Einschlüsse. Hie und da finden wir Thonschiefer, an andere eisenhaltige Schiefergeschiebe aufgelagert und manche der die Wildebene umsäumenden Höhen werden von Porphyr gebildet.
Ich durchstreifte die nächste Umgebung von Klerksdorp und war namentlich mit der Pflanzenausbeute zufrieden. In einigen der brach liegenden Gärten fand ich eine Malvacee, welche in veschiedenen Varietäten vorkommt, deren Verbreitungsbezirk von der südlichen Meeresküste bis über den Zambesi hinaus reicht und schöne, große, schwefelgelbe Blüthen besitzt.
Schon den folgenden Tag nach unserer Ankunft brach ich wieder auf, um meine Reise gegen Potschefstroom, der bevölkertsten Stadt der Transvaal-Republik, fortzusetzen. Auf dieser 34 Meilen langen Strecke überschritt ich drei trockene Spruits, den Kockemoer, den Matchavis und den Bakenspruit, welche gleich den vorhergenannten so ziemlich parallel von Norden nach Süden dem Vaal-River zuströmen. Das Land ist mehr hügelig als jenes zwischen Bloemhof und Klerksdorp; die flacheren wie die tieferen Thäler scheinen sehr fruchtbar zu sein. Zwischen Klerksdorp und den Kockemoerspruit überschritten wir eine stellenweise morastige Hochebene, welche unserem raschen Vorwärtskommen Schwierigkeiten bereitete. Zwei tief in den Modder (Morast) eingefahrene Wägen mahnten uns zu größter Vorsicht. An manchen Stellen mußten wir den Schlamm ausschaufeln, dann Steine in die so erzeugte Mulde werfen, um einen harten Untergrund zu gewinnen und dann rasch mit lautem Peitschengeknall und Geschrei die Zugthiere zum Anspannen ihrer ganzen Kräfte aufmuntern. An anderen Stellen hieß es, die unliebsamen Strecken zu umfahren; dies gelang zuweilen an einer, jedoch fanden wir an anderen den Wiesengrund so aufgeweicht, daß sich die Räder tief einschnitten, als wenn die breiten Eisenbänder mit scharfen Schneiden versehen gewesen wären.
Zur Zeit meines Besuches geschah für die Communicationswege in der Transvaal-Republik fast nichts. In der unmittelbaren Nähe von Potschefstroom fand ich die Wege im schlechtesten Zustande.
Am nächsten Tage führte uns der Weg am Fuße eines höheren Felsenhügels vorüber; die Scenerie der Landschaft auf diesem Punkte war nebst jener bei Klerksdorp die anziehendste auf der Gesammtstrecke meiner ersten Reise. In dem flachen hochbegrasten Thale des Bakenspruit war eine zahlreiche Heerde von grauen Kranichen mit der Heuschreckenjagd beschäftigt, auch einige ruhig zwischen den Vögeln grasende Springbockantilopen fielen uns auf. Nimrod F. versuchte sein Müthchen an den arglos weidenden Thieren zu kühlen, doch wie bisher ohne anderen Erfolg, als ob seiner staunenswerthen Ungeschicklichkeit von uns herzlich ausgelacht zu werden.
An der etwas morastigen Furth fanden wir Tausende von Schwalben, welche sich auf dem nassen Grunde niedergelassen hatten. In höherem Grade als unsere Hausschwalben sind die südafrikanischen Species wahre Menschenfreunde und so zutraulich, daß sie sich nicht nur in den Gängen eines Hauses, die eine stets offene Communication mit Außen verbinden, sondern auch in bewohnten Zimmern, in denen die Fenster durch längere Zeit offen gelassen waren, anzubauen versuchen. Ich habe mehrere derartiger Fälle beobachtet. Die Nester der südafrikanischen Schwalben sind auch kunstvoller als jene der europäischen Hirundo erbaut, indem sie frei an einer horizontalen Decke angeheftet, mit einem bis zwei Fuß langen geraden oder unbedeutend geschlängelten bedeckten Gange versehen sind, so zwar, daß Gang und Nest ein Ganzes darstellen. Die südafrikanischen Schwalben-Arten, sowie die Ziegenmelker- (Caprimulgus) Species sind zahlreicher als die europäischen vertreten, allein ich beobachtete bei keiner der ersteren eine so starke und doch so melodische Stimme, wie sie die europäische Hausschwalbe auszeichnet.
Vom Bakenspruit fuhren wir über eine Felsenstraße und hatten einen Bergsattel zu überschreiten, von dem wir in ein Seitenthal des Moi-Rivers einfuhren, welch' letzteres über der Einmündungsstelle zu einer weiten Ebene sich ausbreitend, zum Aufbaue einer Niederlassung hinreichenden Raum bot, auf dem sich gegenwärtig Potschefstroom oder das neue Moi-Riverdorp erhebt. Die Abhänge, an denen entlang der Felsenweg führte, lohnten reichlich die Mühe des Botanikers und nach den zahlreichen in den Höhen zur Linken, von denen die höchste etwa 4000 Fuß über dem Meere sich erhebt, theils Vieh- und Ziegenheerden hütenden, theils Holz sammelnden Eingebornen dachte ich auf eine Eingebornenstadt in diesen westlichen Potschefstroomhöhen schließen zu müssen. Als ich darüber fragte, theilte man mir mit, daß daselbst eine Stadt der Mohavis, eines Betschuana- (Barolong?) Stammes liege.
Aus dem hochbegrasten Seitenthale in das geräumige, an beiden Ufern in der Entfernung einiger englischen Meilen von Höhenketten und isolirt stehenden Höhenkuppen begrenzte Thal des Moi-Rivers—eines stets fließenden Gewässers—einbiegend, sahen wir Potschefstroom vor uns liegen. Aus der Entfernung erscheint es dem Besucher bedeutend kleiner als es wirklich ist, was sich wohl dadurch erklärt, daß sich die Stadt in einer Ebene ausbreitet, ein Parallelogramm bildet und die Straßen so wie die Gärten an den Häusern mit dichtbelaubten Bäumen bepflanzt sind. Schon zur Zeit meines Besuches im Jahre 1873 war Potschefstroom eine der bedeutendsten Städte Süd-Afrika's, seither hat sie sich noch bedeutend entwickelt und gehoben.
Sie war die Gartenstadt der Republik und wird diesen Rang auch in der Transvaal-Colonie behaupten, so wie sie bis heutigen Tages die bedeutendste Handelsstadt des Landes ist und nur durch den Bau der Delagoa-Middleburg-Bahn von Pretoria überflügelt werden würde. Zur Zeit meines Besuches schätzte ich die Einwohnerzahl auf etwas über 4000 Seelen, welche Zahl sich jedoch höher herausstellt, wenn wir das sogenannte alte Moi-Riverdorp, d.h. die dicht aneinander liegenden, am nördlichen Stadtende beginnenden und flußaufwärts im Thale des Moi-Rivers an beiden Ufern meilenweit sich hinziehenden Farmen in Betracht ziehen. Der Fluß, ziemlich stark strömend und viele dichtbeschilfte Sümpfe bildend, umfließt die Stadt an ihrer östlichen Seite. Sein Wasser ist die meiste Zeit hindurch klar und beherbergt zahlreiche Vaal-Riverfische und Krabben, seine Ufer Fischottern, Wildkatzen und Leguane. Von dem Flusse aus, und auch, wenn ich nicht irre, von den Höhen von Westen her versieht eine Wasserleitung die Gärten der Stadt, sie an ihrer westlichen Seite umfließend, von welchem Hauptstrome kleine Bächlein zu den zahlreichen Häusergruppen geleitet sind.
In der Sommerszeit wuchert in den weniger bewohnten Straßen üppiges Gras, allein selbst in der Trockenzeit gleicht die Stadt, ob der vielen immergrünen, meist ausländischen und hier eingeführten Bäume, Cupressineen, Eucalyptusarten, Epheu etc., welche im Moi-Riverthale sehr gut gedeihen, mit ihren reinlich angetünchten, schmuck aus dem dunklen Grün hervorblickenden, theils flachdachigen, theils begiebelten Häusern, einem Garten, der sich namentlich aus der gelblichen Grundfarbe des ringsum auf dem weiten Thalboden vertrockneten Grases ausdrucksvoll hervorhebt. Sind jedoch—wie es zur Zeit meines ersten und zweiten Besuches (1873 und 1874) der Fall war—die entfernten, mäßig hohen Hügel und die breite Thalebene mit hohem, üppigem Gras bedeckt und haben sich die Ufer des Flusses in zwei, mit weißen, feuerrothen und gelben Blüthen bedeckte Blumenbeete verwandelt, dann ist die wahre Zeit gekommen, wo Potschefstroom, im schönsten Schmucke prangend, den Ehrentitel der Blumenstadt des Transvaal-Gebietes verdient.
Die Straßen sind gerade—die Stadt ist in »Blocks« ausgemessen—mehrere geräumige Plätze, von denen der bedeutendste theilweise als Markt und Auctionsstätte dient, finden sich an der Bereinigung mehrerer Straßen. Unter den Kirchen bietet das englische, epheuumringte Kirchlein ein schönes idyllisches Bild. Sonst finden wir an öffentlichen Gebäuden nicht eines, das über das Niveau der gewöhnlichen, neueren südafrikanischen Städtebauten hervorragen würde. Die Stadt ist der Sitz eines Magistrats, des portugiesischen Consuls, einiger Volksschulen, und treibt regen Handel mit Natal; mehrere Mühlen und Lohgerbereien sind außerhalb der Stadt angelegt. Die Haupt-Ausfuhrartikel sind Mehl, Getreide, Tabak und Schlachtvieh nach den Diamantenfeldern, nach Natal Tabak, Vieh, Häute und Carossen, auch etwas Straußenfedern und gegenwärtig nur wenig Elfenbein. Ein guter Theil der Handelswaren aus Natal, dem Oranje-Freistaat und den Diamantenfeldern hat auf seinem Wege in das Innere des Landes Potschefstroom zu passiren.
Ohne daß die Gebäude der Stadt durch architektonischen Schmuck hervorragen, sind doch sowohl die Geschäftslocale feste, ihren Zwecken vollkommen entsprechende, geräumige Bauten, als auch die Wohngebäude nett und niedlich, viele gleich eleganten Villen eingerichtet. Was speciell oft jedem einzelnen, ja sogar einfachen Häuschen besonderen und der Stadt einen allgemeinen Reiz verleiht, das sind die sie umschließenden Obst- und Gemüsegärten und Gärtchen, sowie die vielen, mit Hunderten und Tausenden, hier hellen, dort dunkelrothen Blüthen geschmückten dichten Rosenhecken und Zäune aus hohem Feigengebüsch oder solche von der in einem schönen, glänzenden, dunklen Blattkleide und mit feuerrothen Blüthen prangenden, späterhin mit faustgroßen Früchten überladenen Granatäpfelstaude gebildet. Ueberall grünt, blüht und duftet es und mehrere Monate hindurch winken reife Früchte an den Hecken, Büschen und Bäumen. Ohne große Mühe können die Gehöftbesitzer ihren jährlichen Bedarf an Grünzeug und Obst ziehen, ohne dabei ihrem Ländchen den Reiz des Blumengartens zu benehmen.
An den meist von stetig fließenden Bächlein durchrieselten Straßengräben stehen riesige, in heißer Sonnenhitze erquickenden Schatten spendende Trauerweiden, welche mit dem lichteren Grün ihrer Blätter und den schwermüthig herabhängenden, dünnen, doch mit dichtem Blattwuchs beladenen Zweigen deutlich und um so anmuthiger von den dunkel nüancirten Kronen der Obstbäume, den noch dunkleren Eucalyptusblättern, den spitz zulaufenden Blättern des Lebensbaumes und dem dunklen Grün der Cypressenbäume abstechen.
Wir hatten nicht weit von den Friedhöfen in unmittelbarer Nähe der Stadt ausgespannt und wechselten uns bei dem Besuche derselben ab, um den Wagen nicht ohne Aufsicht zu lassen. Unsere Ankunft war nicht unbemerkt geblieben, bald hatte sich einer der dunkelfarbigen Konstabler eingestellt, um sich über unsere Absichten und den Inhalt des Wagens zu informiren. Ihn folgte bald der Clerk (Gehilfe) des Marktmeisters, der auch öffentlicher Auctionär war, um nachzusehen, da er eben des Weges vorbeiging, ob der Besitzer des hier ausgespannten Wagens nicht vielleicht Schlachtochsen oder sonst andere Artikel mit sich führe, deren er gerne los werden wolle. »Sein Chef,« meinte er, »wäre a capital Auctionar und er bringe die Sachen, die er verkaufen solle, so gut an den Mann, daß die Leute weit und breit seine Hilfe in Anspruch nahmen.—»Kommt wohl von den Diamantenfeldern und wollt es nun in den Goldfeldern versuchen?« war seine Frage. Die Goldfelder im Leydenburger District fingen im Jahre 1873 an, sich merklich in der öffentlichen Meinung zu heben, im selben Maße, als die Diamantenfelder zu sinken begannen; gegen das Ende des Jahres 1873 und im folgenden Jahre fand ein Massenauszug von den letzteren nach den Goldfeldern statt.
Am Nachmittage bekamen wir neue Besucher, einige Deutsche, von denen einer bei der Polizei angestellt, einer ein Maurer und die anderen Gärtner waren. Freund E. war mit ihnen in der Stadt zusammengetroffen. Sie hatten in jener, in der Mitte der Fünfziger Jahre von der englischen Regierung in Süd-Afrika nach der östlichen Provinz des Caplandes eingeführten »deutschen Legion« gedient, deren Mitglieder unter dem Namen der Legionäre ziemlich bekannt sind. Viele derselben haben sich in den Districten East-London, King-Williams-Town und Queens-Town angesiedelt und leben daselbst als Farmer. Diese waren die ruhigeren Elemente der Legion. Die energischeren traten in Geschäfte als Handlanger, als Storekeeper ein, avancirten zu Klerks (Buchhaltern und Geschäftsführern) und einige haben sich zu wohlhabenden Kaufleuten emporgeschwungen. Eine gute Anzahl, denen das Ansiedlerleben nicht gefiel, und die eine vagirende Lebensweise vorzogen, zerstreuten sich über die Cap-Colonie, Natal, den Freistaat und die Transvaal-Provinz, um hier als Maurer, dort als Zimmerleute etc. zu arbeiten, wobei sie in der Regel den Erlös noch im Orte verjubeln, um dann wieder weiter zu ziehen, eine neue Arbeit aufzunehmen, wochenlang hart und anstrengend bei zurückgezogener Lebensweise zu arbeiten, und kaum, daß sie mit dem Accord fertig geworden und die 20-40 £ St. empfangen haben, diese ebenso wie die frühere Summe in Saus und Braus aufgehen zu lassen. Daß es bei solchen Trinkgelagen oft allzu lustig und lärmend herging und man sich zuweilen auch dabei brutal betrug, ist nicht zu verwundern; so kam es, daß namentlich im Freistaat und in der Transvaal-Provinz die Legionäre, trotzdem sie als gute Arbeiter gepriesen werden, sich sonst keines guten Rufes erfreuen. Wir müssen hier jedoch eine scharfe Grenze zwischen den in der Colonie ansäßigen, Ackerbau oder Geschäfte betreibenden und den herumwandernden Legionären ziehen.
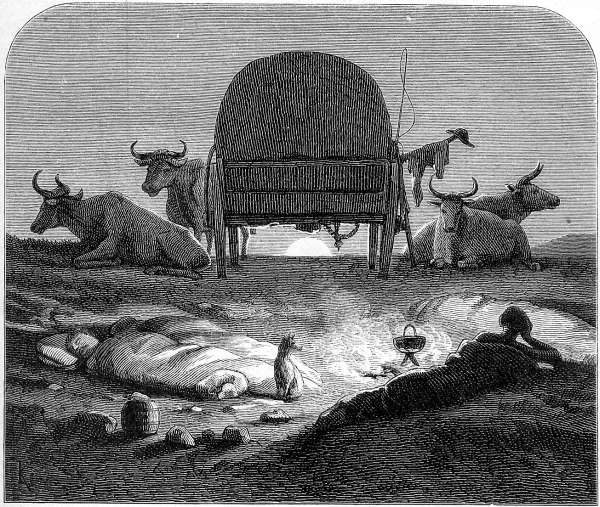
[Nachtlager.]
Einige mit ihren Wägen vorüberziehende Boers blieben kurze Zeit an unserem Wagen stehen, um der althergebrachten Sitte gemäß uns Weißen die Hand zu schütteln und mit einfachen Worten nach dem Ziele unserer Reise zu fragen. »Uns chat nach Wonderfontein to um det wonderljike chate to kiek« (Wir gehen nach Wonderfontein um die wunderlichen Höhlen zu sehen) war die Antwort in unserem gebrochenen Holländisch. Die sich Verabschiedenden meinten, die Erdhöhlen wären es werth, besichtigt zu werden. Je mehr ich von diesen Wonderfonteiner Felsenhöhlen hörte, desto begieriger war ich, sie zu sehen, und um so größer meine Enttäuschung, als ich sie später sah.
Bevor ich mich auf diese erste Versuchsreise begab, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß sich in Potschefstroom ein Herr dem Insectenstudium widme und der portugiesische Consul, Herr Foßmann, sein Möglichstes zu der geologischen Erforschung des südlichen Transvaal-Gebietes beitrage, ich solle sie gewiß besuchen. Doch ich hatte mich auf diese erste Reise so einfach ausgerüstet, daß ich mich nicht im Stande fühlte Staatsvisiten zu machen. Und so hieß es, nachdem wir uns mit Proviant versorgt, der Stadt Valet zu sagen.
Wir brachen Abends auf und schlugen eine ostnordöstliche Richtung nach dem Moi-River zu ein. Es war ein hartes Stück Arbeit, um—nachdem wir die Stadt durchfahren—die kurze, blos einige hundert Schritte lange vom Nordende der Stadt bis zu der damals noch sehr primitiven Moibrücke reichende Strecke zurückzulegen. Obwohl die Stelle ziemlich breit, war sie doch durch die Feuchtigkeit des Bodens und in Folge der letzten Regen sowie durch die Sorglosigkeit der Bürger von Potschefstroom in einen einzigen, stellenweise bis 1½ Fuß tiefen Morast verwandelt worden. Mit geringen Unterbrechungen hatten wir die nächsten Stunden hindurch mit immer wiederkehrenden Passage-Schwierigkeiten zu kämpfen; die Erschöpfung der Thiere zwang mich endlich, an einer keineswegs einladenden, sumpfigen Stelle Rast zu halten.
Der nächste Morgen führte uns durch ein breites, nach mehreren Seiten hin offenes Thal, in dem eine aus mehreren Häusern bestehende und in gutem Zustande gehaltene, von Aeckern und Gärten umgebene Farm lag. Wir erstanden hier einige Kürbisse und fuhren weiter nach Osten, gelangten auch bald auf eine Hochebene, die gegen Süden von einer theilweise von Bäumen bedeckten Höhenkette umsäumt, nach Osten, Norden und Nordwest einen freien Einblick in das Moi-Riverthal mit seinen zahlreichen Farmen und den sie umgebenden dunklen Gärten gestattete. Es war einer der herrlichsten Anblicke die ich genoß, in weiter Ferm zeigten sich einzelne Höhen und Höhenrücken, der Abfall des Blue-Bank-Hochplateaus und am fernen Nord-Horizonte die Umrisse der Magalies-Berge.
Auf der Hochebene, nach der wir unseren Weg nahmen, fielen mir trichterförmige, von Weitem schon durch dichten Baumwuchs auf den Grasebenen gekennzeichnete 25-60 Fuß tiefe Bodenvertiefungen auf. Ich fand später, daß solche Bodentrichter im Transvaal-Gebiete in manchen Strichen zwischen dem Hart-River und dem Molapo und zwischen dem unteren Molapo und dem Vaal-River, im Barolong- und Batlapinen-Gebiete und im Bereiche von Griqualand-West (im westlichen Theile der Division of Hay) ziemlich zahlreich verbreitet sind und ein Charakteristicum des Riesenbettes eines oberflächlich liegenden, seltener in dünnen Lagen aufliegenden, oft jedoch mächtig bis Hunderte von Fuß tief in die Erde eingreifenden, stellenweise von Sand und weißen, schäligem Kalksteinen, an anderen Punkten von Granitblöcken und Schieferlagen überdeckten Kalksteins bilden. Sie sind die weiten Oeffnungen von mehreren sich vereinigenden, den Felsen in der Tiefe spaltenden Rissen. Dieses Riesenbett des Kalksteins, welches deutliche, oft prachtvolle, wellenartige Lagerung und Schichtung besitzt, zeigt meist von außen den Einfluß der Einwirkung des Wassers und ist in seiner Hunderte von Meilen Fläche bedeckenden Masse geborsten und gesprengt, doch mußte das Gestein ob seiner Härte und Massen-Ausdehnung den Erdrevolutionen einen großen Widerstand entgegengesetzt haben, so daß 90 Percent der geborstenen Theile, mit Ausnahme der entstandenen Klüftungen und der daraus erfolgten verhältnißmäßig geringen Verschiebungen, keine nennenswerten Umwälzungen erlitten haben.
Diese unterirdischen Risse und meilenlangen Spalten dienen unterirdischen Gewässern zum Abfluß, welche sich dann in kleinen Spalten an den Abhängen tiefer, steiler Thäler, wie am oberen Molapo, nach außen Bahn brechen. Ein Theil des Moi-Rivers fließt in dieser Weise unter der Erde fort, ja er verschwindet theilweise an manchen Stellen ganz und kommt weiter thalabwärts wieder zum Vorschein. Diese Spalten vereinigen sich und an diesen Vereinigungsstellen finden sich dann jene auch schon erwähnten (in tieferen und höheren Partien des Hochplateaus liegenden) nach oben trichterförmig sich erweiternden Oeffnungen, welche an ihrer oberen Mündung einen Umfang von 24-180, selbst bis zu 240 Meter erreichen. Sie erscheinen rundlich, weil die Wand oft mit Geröll und Erde bedeckt ist, doch bei näherer Untersuchung zeigen sie sich viereckig, die Mehrzahl jedoch dreieckig. Manche dieser Felsentrichter besitzen kahle Felsenwände, selten sind dieselben steil, häufiger mit Geröll überlagert oder durch Felsenblöcke gebildet; meist sind diese Blöcke mit Erde bedeckt, oder die Fugen und die Zwischenräume damit ausgefüllt, so daß diese von einer ziemlich üppigen Vegetation, namentlich aber Bäumen und Sträuchern überwuchert werden und da die höheren Bäume dann über diese Vertiefungen auf der begrasten, wenig oder gar nicht bebuschten Ebene hervorragen, weithin erkennbar sind.
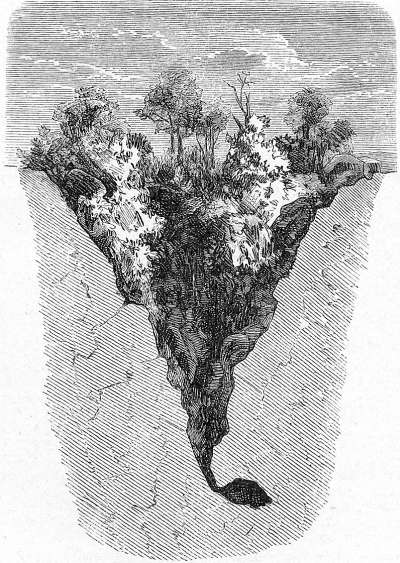
[Felsentrichter.]
Da wo die am Boden solcher Felsentrichter sich vereinigenden oder von hier austrahlenden Risse entsprechend breit sind, kann man einige Fuß, bei manchen tief senkrecht hinabsteigen und dann oft Hunderte von Metern weit, die Risse als niedrige, mehr oder minder hohe und geräumige Spalten verfolgen. Manche der trichterförmigen Oeffnungen sind mit krystallklarem Wasser gefüllt und ich konnte nicht umhin, eine derselben, welche eine Wassertiefe von über 140 Fuß zeigte und die ich auf der Rückkehr von meiner dritten Reise am linken Ufer des Molapo untersuchte, einen Miniatur-Felsensee zu nennen.—Ohne sie gesehen zu haben, glaube ich, daß Herrn Hübner's Klipdachs-Schlucht in die Kategorie dieser eigentümlichen Bodenbildungen gehört. So fand ich, daß viele Flüßchen im Gebiete des Vaal, Hart-River, Molapo und Marico (wohl auch des oberen Limpopo) ihren Ursprung in solchen engen Felsenlöchern nehmen, also da, wo das unterirdische Wasser nicht abfließen konnte und sich durch eine der trichterförmigen Oeffnungen nach oben Bahn brach. Wenn wir zu Farmen kommen, in deren Nähe sich solche Quellbächlein befinden, so wird unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß diese Bächlein oft meilenweit, oft aber nur einige hundert Schritte weiter aufwärts, an einer marschigen Stelle entspringen und sich in deren Mitte neben anderen aufsprudelnden Quellen ein umschriebenes, 50 und mehr Fuß tiefes Loch wie im Felsen eingebohrt befindet. An allen diesen Stellen, selbst an solchen, welche blos unterirdischen Abfluß hatten, fand ich stets dieselben Fischspecies vor. Auf den wildreichen Ebenen zwischen dem Hart-River und dem Molapo lernte ich einen beschilften Sumpf kennen, der nach keiner Seite hin Abfluß zeigte und äußerst fisch- und vogelreich war; nach der beinahe die Mitte desselben einnehmenden größte Tiefe desselben zu schließen, hielt ich auch diesen für eine ähnliche Felsenöffnung. Der diese Felsenformation bedingende Kalkstein zeigt außer Quarzadern und anderen quarzhaltigen Mineralien Einschüsse von Blei, Kupfer, Eisen und Silber.
Am dritten Tage nach unserem Aufbruche von Potschefstroom erreichten wir Wonderfontein, mit welchem Namen die Boers die »wonderlichen« Grotten und Höhlen in den Felsen bezeichnen. Es ist nicht, wie in der Regel, der Name einer Farm, sondern der Sammelname für eine Anzahl solcher, welche nahe aneinander in ausgezeichneten Weidetriften im Thale des Moi-Rivers liegen. Es sind meist steinerne, ebenerdige, doch hohe, luftige Wohngebäude mit einem angebauten Wagenschuppen und in der Regel einer oder zwei meist aus Schilfrohr verfertigten zum Trocknen des hier eifrig cultivirten Tabaks gebrauchten Hütten. Von diesen Farmen wird jene, auf die wir zusteuerten, d.h. in deren Nähe sich der Eingang zu den Höhlen befindet, das eigentliche Wonderfontein genannt.
Die Ufer des Moi-Rivers, der hier einen breiten Bach darstellt und dem von beiden Seiten zahlreiche Quellen zuströmen, sind stellenweise sehr sumpfig und von Schilfrohrdickicht umsäumt, die für den Ornithologen ein förmlich unerschöpfliches Arbeitsfeld abgeben. Ein tausendstimmiges Pfeifen und Singen, Gezwitscher und Gackern tönt an unsere Ohren und versetzt uns in Verlegenheit, wohin zuerst unsere Schritte lenken.
Mit der Erlaubniß des Farmers schlugen wir unseren Lagerplatz unter hohen und schattigen seinen Pfirsichgarten umsäumenden Trauerweiden auf. Als wir jedoch nach dem Eingange der Höhle fragten, gab man uns zu verstehen, daß der Eingang wohl zu finden sei, daß man sich aber leicht in den Höhlen verirren könnte und es darum gerathen sei, den Besuch der Höhlen nur mit einem Führer zu unternehmen, wozu sich uns die Söhne des Farmers gegen ein Honorar von 1 £ St. per Person anboten. Da ich ja hauptsächlich der Höhlen halber nach Wonderfontein gekommen war, ließen wir uns diese Erpressung gefallen und nachdem sich auch einige bei dem Farmer zu Besuche weilende Verwandte desselben uns angeschlossen, machten wir uns auf den Weg.
Zwei Söhne des Farmers, die sich mit einem Bündelchen von Talglichtern versehen hatten, waren unsere Wegweiser. Wir überschritten das Flüßchen an seiner breiten, sehr seichten Furth, und hatten das rechte, felsige und bewaldete Ufer zu erklimmen. Nach einer Viertelstunde kamen wir zu einem uns entgegen gähnenden, senkrecht nach abwärts führenden Felsenloche, eine der engeren, doch tieferen trichterförmigen, vorher beschriebenen Felsenklüfte. Obgleich mir der Eintritt in die unterirdischen Höhlen theilweise die Berstungen im Felsen deutlich vor Augen führte, muß ich doch gestehen, daß ich mich schon durch diesen Eingang zur Höhle sehr enttäuscht fühlte. Ich dachte eine jener Höhlen zu finden, in welcher ich Knochenablagerungen von Thieren, der letzten geologischen Periode finden und so diese Lücke in der Geologie Süd-Afrika's ausfüllen hätte können.
Aus den Wänden des Trichters hervorragende Felsenblöcke ermöglichten es uns, den Boden der sich nach unten bis zu einer schmalen Spalte nach Nordnordwest verengenden und in schräger Richtung nach abwärts gegen (und untere) das Flußbett fortsetzenden Felsenöffnung zu gewinnen. Wir drangen in das Spaltengewirre ein; anfänglich waren es enge, niedrige Gänge, kaum so hoch, daß wir Einer nach dem Andern auf allen Vieren durchkriechen konnten, später verbreiterten sich dieselben bis zu 4 und 8 Fuß und erreichten dabei bis zu 10 Fuß Höhe. Beinahe alle verengten sich nach oben zu dünnen Spalten, aus denen das Wasser herabrieselnd und sickernd Stalaktiten erzeugte, ohne daß sich diese durch auffallende oder große Formen ausgezeichnet hätten. Leider hatten frühere Besucher schon die meisten abgeschlagen oder beschädigt, deren Bruchstücke bedeckten den Boden. An jenen Stellen—und deren gab es viele, denn die unterirdischen Felsenspalten, in denen wir uns bewegten, zeigten die Felsenmasse nach allen Richtungen gesprengt—wo sich zwei kreuzend begegneten, erhob sich über dem Beschauer eine Art Kuppe, etwas höher als die Zerklüftungen, doch auch nichts Bemerkenswertes bietend. Die Wände waren dunkelgrau, meist kahl und ziemlich glatt. Die Hälfte unserer unterirdischen Wanderung legten wir barfuß zurück, denn das von Osten nach Westen durch die Grotten strömende und plätschernde Bächlein floß in der Gesammtbreite des Ganges und wir konnten sein Murmeln schon beim Eintritte in die unterirdischen Spalten vernehmen. Je weiter wir nach Westen und Norden vordrangen, um so tiefer wurde das Wasser und gerade von jenen Gängen her schimmerten schöne, unbeschädigte Stalaktiten herüber, doch wir mußten das weitere Vordringen, der Weigerung unserer Führer wegen, aufgeben.
Ohne allzugroße Mühe, könnte man die engen Stellen zwischen den breiteren Zerklüftungen und dem Eingange, die schräg nach abwärts führende Partie des unterirdischen Ganges erweitern und ein kleines, kurzes Boot einführen und auf diese Art möglicher Weise das Ende der Gänge oder vielleicht größere Höhlenräume erreichen. Mir schien es, als ob auf der vom Flusse abgewandten Seite weniger gangbare und meist nur dünne, spaltenförmig sich fortsetzende Gänge liegen, die breiteren dagegen nach dem Flusse zu führen würden, so daß hier das eingeströmte Wasser die an und für sich engen Spalten vielleicht weiter und breiter ausgewaschen haben mußte.
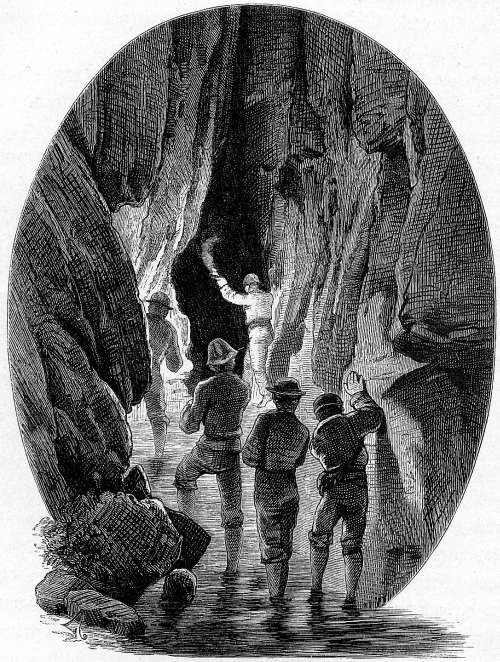
[Grotte von Wonderfontein.]
Trotz unseres kurzen Aufenthaltes hatten wir in den Höhlen so manchen Begleiter gefunden, denn als wir sie verließen, da gaben uns diese in Unzahl bis zum Felsenausgang hinauf ihr treues Geleite und als Andenken sowohl an die Wonderfonteiner Höhlen, wie um meine Sammlung der Mamalia zu mehren, nahm ich zwei derselben zum nicht geringen Staunen unserer Führer mit, welche die flatternden Fledermäuse (Vespertiliones) nicht anzurühren wagten.
Wonderfontein ist einer jener Orte in Süd-Afrika, an welchen der Forscher getrost längere Zeit verweilen kann; seine Mühe wird hier reichlich belohnt. Thiere, Pflanzen wie Mineralien sind hier des Sammelns werth. Leider war mein Aufenthalt wegen der schon erwähnten Gründe nur auf drei Tage beschränkt und so konnte ich nur einen Einblick in die Natur der nächsten Umgebung gewinnen. Große wilde Vierfüßler gab es hier nicht mehr, sie waren seit etwa 15 Jahren ausgerottet, doch fanden sich noch Caloblepas Gorgon, Antilope albifrons und Euchore in Menge auf den nördlich sich erstreckenden Ebenen, während im hohen Ufergras, in seinen Binsen und den beschilften, doch trocken liegenden Partien einzeln oder paarweise, die schön gelblichbraune, mit ihren nach vorwärts gerichteten, kurzen, etwas hakenförmig gebogenen Hörnern versehene Rietbockgazelle ziemlich häufig anzutreffen war.
Unser Farmer bewies sich die Zeit unseres Aufenthaltes hindurch äußerst freundlich und lud uns mehrmals ein, seine auf die Jagd gehenden Söhne zu begleiten. Auf den Ebenen zur Rechten und Linken zeigten nicht selten frisch »eingefahrene« Löcher die Gegenwart der Schabrakenschakale, des Proteles und der gestreiften Hyäne, häufig waren Stachelschweine, Springhasen und kurzschwänzige Schuppenthiere zu finden. Zwischen dem Gestein bemerkte ich Genetta's und eine schwarz gestreifte Wieselart. Auf einem meiner mit Freund E. am jenseitigen Ufer unternommenen Ausflüge, als wir beide unsere Gewehre abgelegt, dem Treiben einiger großer Finkenarten im Röhricht unsere Aufmerksamkeit schenkten, hörte ich einige Schritte vor mir, dort wo eine Oeffnung im Schilfe den Blick auf eine Flußstelle freigab, ein Plätschern in dem klaren, murmelnden Gewässer. Es rührte von vier sich rasch stromaufwärts bewegenden, neben und hintereinander schwimmenden Fischottern her. Bevor wir unsere etwas hinter uns an einem Felsen angelehnten Gewehre ergreifen und benützen konnten, waren die Thiere im dichten Schilfe vor uns verschwunden. Die braunen Fischottern der südafrikanischen Flüsse sind gedrungener und kürzer als die europäische Art, haben ein weniger werthvolles Fell und halten sich an allen beschilften, fließenden Gewässern oder auch in den Tümpeln der Spruits auf. An den zahlreichen Stromschnellen, sowie in den tiefen Lachen, welche nach der Austrocknung der Flüßchen in ihrem Bette zurückbleiben und sehr zahlreiche Fische bergen, ist ihnen Gelegenheit geboten, feist zu werden, indem ihnen fast nie nachgestellt wird, außer wenn sie zufällig am Flusse angetroffen oder durch das Geschrei der Hähne zu einem Besuche menschlicher Wohnungen angelockt, von den Hunden angegriffen und getödtet werden, letzteres jedoch ein seltener Fall. Nur wo Eingeborne etwas dichter das Flußufer bewohnen, scheinen sie seltener zu sein, da ihnen diese, sowie deren Hunde (letztere des Fraßes halber) eifrig nachstellen. In den Flüssen des südlichen mittleren, westlichen und nördlichen Transvaal, wo selbst die Thäler der Flüsse marschig, und von ausgedehntem Röhricht bedeckt sind, finden die Thiere ihre besten Schlupfwinkel. Selten beobachtete ich sie in stabilen Wohnplätzen, meist jagen sie über größere Strecken, wobei ihre Jagd in den seichten Sümpfen nach Fischen und Crustaceen, auf dem hochbegrasten Ufer nach Mäusen und Ratten und in den mit Schilf dicht bestandenen tieferen Morast- und Flußpartien nach Vögeln äußerst lohnend sein muß.
In den Schilfdickichten beobachteten wir hängende Nester von Rohrfängern, von zinnoberrothen, schwarz gefleckten Feuer- und von dem schönen langschwänzigen Königsfinken (Vidua capensis). Diese schöne und wohl eine der größten Finkenarten besitzt ein bräunliches Winterkleid und ein schön sammtschwarzes Sommergewand. Die Schultern tragen je einen orangefarbenen Fleck, der sich namentlich auf dem dunkelfärbigen glänzenden Sommergewande prachtvoll ausnimmt. Doch außer dieser Auszeichnung, mit der die Natur den schmucken Vogel für die Periode des üppigen Lebens in der südlichen Hemisphäre bedacht, hat sie ihm noch eine andere zukommen lassen. Während im Winter der Schwanz des Vogels von normaler Länge ist, wächst er mit der zunehmenden Schwärze des Federgewandes im Sommer zu einem Busche von bis zu 18 Zoll langen Federn, welche den Vogel im Fluge hindern, ihm namentlich beim windigen Wetter den Flug so erschweren, daß er sich windabwärts tragen lassen muß. Dieser schöne Finke ist wie alle die im Röhricht lebenden Finkenarten ein sehr munterer Vogel, oft sieht man ihn sich im oberen Drittel der Schilfstengel wiegen und ausäugeln oder über den Morästen flattern; sowie er sich unbeachtet wähnt, läßt er sich in die unteren Schilfpartien herab, aus denen sein Gezwitscher ertönt. Wird er durch etwas in Aufregung versetzt, ist es ein anderer Finke, der sich an sein Nest wagt, oder eine plötzlich vor ihm sich aufrichtende Schlange, oder wird er als Gefangener von den Menschen geneckt, so bläst er seinen Hals auf, faucht, richtet die schönen, melirten Halsfedern zu einer Krause auf und trachtet mit seinem scharfen Schnabel Hiebe auszutheilen. Unstreitig gehört er zu den interessantesten Erscheinungen der südafrikanischen Vogelwelt.
Langohrige Eulen—echte Sumpfeulen fliegen auf, um sich nach kurzem Fluge am Rande des Sumpfes niederzulassen. Am meisten sind jedoch Wasservögel, Schwimm- wie Stelzenvögel, vertreten. Wir finden mehrere Arten der Strandläufer, Rohrdommel, kleine Silber- und gewöhnliche graue, doch auch Purpurreiher, eine Species Kampfhähne, ferner Blaßhühner, mehrere Wildentenarten und Taucher. Während der Forscher im Kahne nach Nestern und Eiern dieser Thiere fahnden kann, ist es den ihm längs der Ufer Folgenden möglich, die auffliegenden Thiere zu beobachten, oder die von ihm bezeichneten zu erlegen. Der reiche Blumenflor an den feuchteren Thalpartien begünstigt auch die Entwickelung einer vielartigen Insectenwelt und so sind denn die kleine Insecten wie Körner fressenden Vögel, Kolibris, Bienensauger und Schwalben zahlreich vertreten, die hier über den schönblüthigen Blumen, dort im Gebüsche, in den Gärten und bewaldeten Partien sich herumtummeln.
Als der Farmer meinen Eifer bemerkte, mit dem ich den gesuchteren der hier lebenden Vögelspecies nachstellte, gab er mir den Rath, mich hinter seinem Wagenschuppen zu bergen, weil sich auf dem über diesen erhebenden, theilweise verdorrten Baum ein »besonderlik Vogel« zu sonnen pflege. Ich folgte seinem Rathe und hatte die Freude denselben, einer kleinen Schlangenhalsvogelart angehörend, zu erlegen.
Die feuchten Wiesen bargen eine reiche Fülle verschiedenartigster Insecten, doch hatte das Sammeln derselben manche Schwierigkeit und Gefahr. Erstlich wimmelten diese Wiesen von Mosquitos, welche uns nicht nur Abends belästigten, sondern selbst in der Sonnenhitze Gesicht und Hände wund stachen; außerdem waren dieselben reich an Schlangen, unter denen ich eine noch nie beobachtete schwarzgraue, fast gleichmäßig fingerdicke, unten schwefelgelbe und etwa zwei Fuß lange Art erhaschte.
Aus einem Gespräche mit dem Farmer entnahm ich, daß auch mein College Mauch diese Höhlen aufgesucht und sich hier eine Zeit lang aufgehalten hatte und im Ganzen schien der Besitzer sehr stolz auf die »wondeljike chate« (Höhlen) zu sein. So oft Jemand von uns im Hause vorsprach, wurde er sofort mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Zwieback bewirthet und unser freundliche Wirth bedauerte nur, daß wir zu viel det slechte Chut (Reptilien u.s.w.) sammelten, unsere Zeit unnützer Weise verschleuderten, während wir bei ihm sitzen und über die Diamantenfelder, Duits-land und Osteriek sprechen sollten.
Manche der Farmer destilliren aus den Pfirsichen eine Art Branntwein, welcher namentlich im Transvaal-Gebiete als Perschke-Branntwein »verrufen« und bedeutend schwächer und billiger ist als jener unter dem Namen Cango in der westlichen Cap-Colonie aus Weintrauben bereitete.
Rückreise nach Dutoitspan.
Wolmaran's Farm.—Ein junger Boer.—Tabakbau im Moi-Riverthale.—Ueppige Vegetation.—Optische Täuschung.—Transportkosten und Schwierigkeiten.—Gestörte Mahlzeit.—Ein Hinterhalt.—Farm Rennicke.—Eine Vogel-Colonie.—Gildenhuis.—Eine Löwenjagd an den Maqwasihöhen.—Gekränkte Hottentotten-Ehre.—Auswanderer nach den Leydenburger Goldfeldern.—Hallwater-Farm und Saltpan. (Vermeintliche Ruine von Monopotapa.)—Batlapinen-Gerichte.—Eine unliebsame Entdeckung.—Hebron.—Ostersonntag im Vaal-River.—Ankunft in Dutoitspan.
Ich schied von Wonderfontein mit dem dankbarsten Herzen seinem Besitzer, wie der gütigen Natur gegenüber. Mit Wonderfontein war das Endziel meiner ersten Reise erreicht und ich begab mich auf den Heimweg nach Dutoitspan, bis Bloemhof dieselbe Route wie auf der Herreise benutzend.
Am zweiten Marschtage bemerkte ich, daß Gert mit seltenem Eifer die Kaufertigkeit seiner Kinnbacken erprobte; auf meine Frage, welche Delicatesse er wohl erhascht, zeigte er mir eine Handvoll Gummi, von den Mimosen herrührend, die unseren Weg säumten, und pries die durstlöschende Eigenschaft desselben. Ich fand später wiederholt Gelegenheit, zu diesem Ersatzmittel des Wassers meine Zuflucht zu nehmen. Am folgenden Tage, in der Nähe von Wolmaran's Farm, begegneten wir einem etwa 12jährigen, von der Jagd heimkehrenden Boerjungen. Obwohl das Gewehr, das er nachlässig geschultert trug, beinahe größer war als er selbst, sprach dennoch aus allen seinen Mienen großes Selbstbewußtsein und er schien die Ehre einer Ansprache von Seite meines Begleiters F. ganz gleichgiltig hinzunehmen.
Der junge Jäger hatte sich inzwischen auf sein Gewehr gelehnt und reichte mit einem »Guten Tag, Ohm« Einem nach dem Andern die Hand. Von seinem Hute hing das Schwänzchen einer frisch erlegten Deukergazelle.—»Und Du hast sie selbst erlegt?«—»Ja, Ohm.«—»Hast Du das Thier im Laufen oder Stehen geschossen?«—»Ungefähr 200 Schritte vor mir sprang sie auf, lief ein Stückchen, blieb stehen, ich war niedergeknieet und hatte das Stillstehen erwartet, so wie sie stehen blieb, blies ich ihr die Kugel durch den Leib.« Ohne auf unsere weiteren Fragen zu warten, schulterte er sein Gewehr, berührte den Hut, reichte wieder einem Jeden die Hand und ging seiner Wege.
Um die bereits erwähnte morastige Straßenstelle jenseits der Brücke über den Moi-River bei Potschefstroom am nächsten Tage bei Tageshelle zu passiren, beschloß ich, nachdem wir Wolmaran's Farm im Rücken hatten, die ganze Nacht hindurch zu reisen und nur einige Stunden zu rasten.
Während einer solchen Rast wurde ich durch eigentümliche volle Töne aus meinen Betrachtungen gerissen. F. machte mich auf ein Pärchen großer Vögel aufmerksam, welche kaum 100 Schritte vor uns ihre Stimme ertönen ließen. Die Dunkelheit ließ jedoch ihre Art nicht erkennen. Bevor wir uns noch anschleichen konnten, hatten uns die Thiere bemerkt und hoben sich in die Lüfte. Den schönen, langgezogenen und vollen, durch die Stille der Nacht erschallenden Ton, den sie dabei ausstießen, erkannte ich sogleich als den Warnungsruf des grauen südafrikanischen Kranichs. Dieser voll schallende Ton, der wie über einem Resonanzboden ausgestoßen so voll klingt und so deutlich und von großen Entfernungen her hörbar ist, wird durch die einigen wenigen Vogelarten (auch den Schwänen) zukommende Eigentümlichkeit bedingt, daß sie ein weit ausgehöhltes Brustbein besitzen und die Luftröhre in diese Höhlung eintritt, um, nachdem sie eine Curve gebildet, sich wieder nach auswärts zu wenden und herauszutreten.
Am Abend des nächsten Tages schlugen wir wieder in Potschefstroom an der bereits bekannten Stelle unser Lager auf.
Von einigen Bekannten, die zu unserem Wagen gekommen waren, erfuhr ich, daß sich Mauch mehrmals in Potschefstroom aufgehalten und in Herrn Foßmann einen guten und opferwilligen Freund gefunden, und daß in den nach Osten zu sichtbaren Bergen Versteinerungen und Pflanzenabdrücke anzutreffen wären. Als ich zu den Besuchern über das Innere des Landes sprach, meinten sie, daß hier mehrmals im Jahre mit Elfenbein, Straußenfedern und allerhand Häuten und Fellen beladene Wägen von der Stadt der Bamanquato, »Schoschong«, auf dem Wege nach Natal ankämen, die einem Brüderpaar, den Händlern Drake (die ich später auf meiner zweiten Reise in Schoschong auch kennen lernte und den einen zu behandeln hatte), angehörten. Sie kämen den Limpopo herab, wobei sie den Marico kurz vor seiner Mündung überschritten. Von denselben Besuchern hörte ich noch, daß sich in Potschefstroom zwei Männer aufhielten, welche Elephanten im Matabeleland gejagt hatten.
Wie die meisten Hottentotten so sind auch die Griqua's und Koranna's leidenschaftliche Raucher und gleich manchen (doch meist den ärmeren) Holländern leidenschaftliche Tabakkauer; weil nun der im Moi-Riverthale angebaute Tabak ein ziemlich gutes Renommé besitzt, hatten mich Gert und David mehrmals ziemlich unverblümt daran erinnert, bevor ich die Stadt zum zweiten und letzten Male verließ, doch eine ganze Rolle (etwa 5 Pfund) von dem »notwendigen Ding« zu kaufen. Jeden Tag verbrauchten sie per Mann ein fingerlanges Stückchen der daumenstarken Rollstange. Bis jetzt wurde—wenn ich nicht irre—der größte Theil des hier angebauten Tabaks im Lande selbst verbraucht, doch wird er unstreitig, in größerer Menge angebaut und etwas billiger auf den Markt gebracht, in nächster Zeit einen nennenswerthen Exportartikel bilden.
Obgleich ich keine statistischen Daten bezüglich des Tabakbaues vor mir habe, glaube ich doch, daß von den gesammten südafrikanischen, civilisirten Staaten die Transvaal-Provinz den meisten Tabak producirt. Unter den unabhängigen, im Westen und Nordwesten dieser Colonie wohnenden Betschuanastämmen sind es namentlich die in dem Lande der Bakwena wohnenden Bakhatla, welche ihre Zeit meist als Diener der Farmer in der Transvaal-Provinz zugebracht und die Tabakcultur in ihrer primitivsten Weise nach ihrer Heimat verpflanzt haben.
Die Strecke nach Klerksdorp legten wir ziemlich rasch (in zwei Tagen) zurück. Auf dem Wege längs eines in den Moi-River einmündenden Querthales auswärts gegen einen Höhensattel zu, den wir zu überschreiten hatten, beobachtete ich an den feuchteren, kurzbegrasten Partien—trotzdem, daß wir die Stelle noch keine zwei Wochen vorher passirt hatten, neue Amaryllisspecies und andere mir noch nicht zuvor bekannte Pflanzenspecies im Sprossen begriffen. Mit Leichtigkeit könnte man in Süd-Afrika ebenso wie die aus dem wilden Zustande in Töpfe und Gärten verpflanzten Zwiebelgewächse, die sehr artenreichen Staphelien und Euphorbiaceen verpflanzen und es wäre wünschenswerth, daß diese beiden ersteren als Garten- wie Zimmerschmuck so leicht zu gewinnenden Familien häufiger als nur bei einigen wenigen Amateurs und als die von Europa, Australien und Süd-Amerika eingeführten Gewächse gepflegt würden. Man kennt leider in Süd-Afrika im Allgemeinen mehr von europäischen Gartenpflanzen und von australischen und neuseeländischen als von den einheimischen in diese Kategorie einschlagenden Pflanzenproducten. Die schönen Gladiolus-, Amaryllis-, Iris- und ihnen verwandte Species könnten in Gärten und Töpfen sehr gut gedeihen, nicht minder zahlreiche zartblüthige Malvaceen, Scabiosaceen, Cinneen, namentlich aber die im Süden so artenreichen Ericaceen. Unzählig sind die Species der Bodenkriecher, die, wenn etwas cultivirt, noch bedeutend gewinnen würden, zahlreich sind die lianenartig sich emporschlingenden Gewächse. Im Süden, in den Küstendistricten, werden mit Ausnahme der schon erwähnten botanischen Gärten, die einheimischen Pflanzen doch nur von wenigen Liebhabern cultivirt, und da sind es meist nur die aloëartigen, Encephalartos, Strelitzien, Staphelien, Euphorbiaceen, Geranium-Arten, Farrenkräuter und einige wenige mehr.—Doch zurück zu unserer Rückreise nach Klerksdorp.

[Junger Boer.]
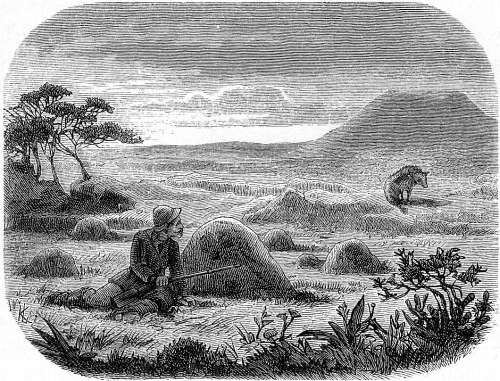
[Jagd auf Zibethyänen am Klipspruit.]
Auf der Höhe des Bergsattels befindet sich eine kleine, weniger tiefe Wasserlache, welche, obgleich seicht, wegen der steinigen Unterlage, bedeutend länger als tiefere Lachen in der Ebene und in manchen der Spruits ihr Wasser hält. Diese kleinen Höhenlachen sind zuweilen ein nennenswerthes Charakteristicum vieler Höhen, besonders der Sattel und Kämme des centralen südafrikanischen Hochplateaus, der Reisende begrüßt sie mit freudigem Herzen und den Neuling überraschen sie nicht selten da, wo er sie am wenigsten erwartet. Nachdem er oft lange, ebene Strecken durchreist, vergebens da, wo das Land eine Neige zeigte, nach Wasser geforscht, fruchtlos einem trockenen Flußbett stundenlang gefolgt und sich mühevoll—nur um seinen und den peinlichen Durst der am Wagen harrenden Gefährten zu stillen—durch Schilfbrüche Bahn gebrochen, ohne das begehrte Element zu finden, endlich zu dem Wagen zurückkehrt, die Reise fortsetzt, um noch die vor ihm liegende Höhe oder die sich quer über seine eingeschlagene Route ziehende Bodenerhebung oder Hügelkette zu erreichen und von den höheren Punkten Rundschau zu halten, findet er unerwartet oben auf der Höhe eine, wenn auch oft trübe, so doch volle Wasserlache. Welch' eine beseligende Ueberraschung für den Neuling, ein Schatz für den Veteran, der, ohne nach rechts oder links abzubiegen, ohne sich durch noch so viel trocken scheinende Schluchten oder Flußdickichte täuschen zu lassen, gerade auf die ihm schon bekannten oder Wasser versprechenden Bodenerhebungen lossteuert. Zur heißen Tageszeit wird leider das Wasser in diesen seichten Becken bedeutend erwärmt, doch in der Abendkühle ist es bedeutend kälter als jenes in den Morästen oder Spruitlachen und wenn es nicht durch häufig hier zur Tränke kommende Viehheerden verunreinigt wird, bedeutend reiner und namentlich frei von faulenden Substanzen.
Während ich auf der Reise vaalaufwärts meine Zeit meist zur Croquirung der Strecke verwendete, konnte ich mich nunmehr meinen Sammlungen und der Jagd widmen. Ich ging mit meinem treuen und bereits gute Dienste als Hühnerhund leistenden Niger in der Grasebene auf der einen, F. mit seinem Karabiner auf der anderen Seite, 2-400 Schritte vom Wagen entfernt, demselben als Eclaireurs voran. Die grauen und schwarzen Zwergtrappen (die großen Trappen Eupodotis caffra und Kori waren zu scheu), Rebhühner, Steppenhühner, rothfüßige Kibitze (in den Flügeln schwarzweiß gescheckt) und an den Flügeln bespornte Hoplopteri (an den feuchteren Stellen) bildeten meist unsere Beute. Niger (ein bei der während meines Aufenthaltes in den Diamantenfeldern unternommenen und bereits geschilderten Pavianjagd erworbener Hund) that sein Möglichstes.
Zwischen dem Baken- und Matschavisspruit hielt uns ein Vorfall, der zu den heiteren Zufällen dieser ersten Reise gerechnet werden muß, einige Stunden auf. Auf einer der Grasebenen zu unserer Linken erspähte Gert vom Bock aus, etwa zwei Meilen vom Wege entfernt, einen dunklen Gegenstand, der bald als ein einzelnes grasendes Thier erkannt war. Nach der Größe schien es ein Rind zu sein, doch war von einer Heerde oder einem Hirten nichts zu sehen, und so wurde der dunkle Gegenstand trotz den Einwendungen der beiden Diener, die uns Weißen nicht beistimmen wollten, für einen jener alten, von den Heerden wegen ihrer Reizbarkeit und Kampflust ausgestoßenen Gnu-Stiere angesehen, der allein, sein ferneres Dasein in der Verbannung fristen mußte. »Deinen Gefährten bist du nutzlos, desto eher kannst du in einem europäischen Museum paradiren, dachte ich und meine Freunde stimmten mit ein.« Die Vorsicht, mit der ich mich in die Nähe des vermeintlichen Wildes schlich, erwies sich jedoch bald überflüssig, denn schon auf 500 Schritte erkannte ich einen Bullen, der seinerseits nun mir eine größere Aufmerksamkeit zuwendete als mir lieb sein konnte und mit gesenkten Hörnern auf mich losging. Einige blinde Schüsse brachten ihn jedoch schließlich zum Nachgeben und verstimmt über diese Täuschung kehrte ich zum Wagen zurück. Das scharfe Korannagesicht hatte seine Ueberlegenheit über uns Europäer bewiesen.
Ohne Unfall passirten wir die Furth über den Schoenspruit und lagerten bald auf dem freien, zwischen dem Flusse und der nach Klerksdorp führenden Wasserleitung liegenden Rasenplatze. In unserer Nähe standen zwei einem Transvaaler Fuhrmann (Transportrider) gehörende Wägen. Der Eigentümer derselben kam an unseren Wagen und da wir eben Kaffee nahmen, wurde ihm ein »Becher« offerirt. Der Transportrider führte Güter, wie er glaubte, Kistchen mit französischen Weinen und Brandy, rothe Kistchen mit holländischem Gin, große Kisten mit englischem Bisquit, ferner solche mit eingelegten Früchten (Jam), sowie Picken, Schaufeln etc. im Ganzen 13.000 Pfund Gewicht auf den beiden Wägen, die ihm in den Diamantenfeldern aufgeladen wurden und die er nach den Goldfeldern zu schaffen hatte.
Nach der Berechnung unseres Gastes, der ziemlich geläufig englisch sprach, hoffte er nach Abzug aller Kosten 140 £ St. an diesem »Trip« (Fahrt) zu verdienen, so daß wir mit Zurechnung der Frachtauslagen von Port Elizabeth annehmen müssen, daß das Heraufschaffen der Güter von diesem Hafenorte bis Pilgrims-Rast (Leydenburger District) auf 300 £ St. zu stehen komme. Die Strecke von Port Elizabeth über Hope-Town, Kimberley (Diamantenfelder), Christiana, Klerksdorp, Potschefstroom, Pretoria, Middleburg und Leydenburg (Lydenburg) beträgt nahezu 1100 englische (etwas über 255 geographische) Meilen; für den Transport von 130 Centner war mithin die Fracht von 3450 fl. eine sehr hohe. Die meisten dieser sogenannten Transportrider (sprich »raider«) stehen sich gut, nur in trockenen Jahren und wenn sie Schneegestöber im Winter auf den Karoohochebenen ereilen, haben sie oft sehr viel zu leiden und können ihr gesammtes Zugvieh einbüßen. So weiß ich mich vor drei Jahren eines Falles zu erinnern, wo ein einziger Fuhrmann, der mit sechs Wägen nach der Cap-Kolonie fuhr, in einigen kalten Nächten 75 Stück Ochsen verlor. Die Weide war sehr schlecht, wenn er die Thiere auch drei Tage lang grasen ließ, hatten sie sich nicht genügend erholt und erfroren um so eher. Ich kenne auch Fälle, wo solche Fuhrleute beim Durchfahren größerer Flüsse, wie des Oranje-Rivers, im Flusse stecken blieben und bevor noch ausgiebige Hilfe ankam, war der Fluß gestiegen und der Fuhrmann verlor Wagen und Güter, die er ersetzen mußte, Vorfälle, die schon so manchen an den Bettelstab gebracht.
Am nächsten Morgen verließen wir das Weichbild von Klerksdorp und schlugen die Richtung nach dem Estherspruit ein. Die letzten Tage hatte es nicht geregnet und so durften wir auf schönes Wetter hoffen, doch wurden die Nächte empfindlich kälter als zur Zeit, da wir uns von den Diamantenfeldern verabschiedet hatten.
Unter dem einladenden Schatten einiger jener mehrstämmigen, hutförmigen, nach abwärts mit ihrem verschlungenen Kronengezweige sich neigenden Zwergbäumchen hielten wir am folgenden Tage Mittagsrast. Die beschatteten Stellen waren grasarm, beinahe nackt und kahl und zeigten zahlreiche Mäuselöcher. Doch ringsum in einigen unbedeutenden Vertiefungen wucherte um so üppiger ein dichter Graswuchs.
Freund E. wollte eine hübsche Stelle für den Mittagstisch und unsere Sitze aussuchen, er schien endlich unter dem schattigsten der oben erwähnten Zwergbäumchen den gesuchten Ort gefunden zu haben, als er die Mäuselöcher zu zerstampfen begann. Ich wollte eben mit dem Insectennetze in der nächsten Umgebung eine Razzia halten, als mich Freund E.'s wunderliches Betragen zu der Frage veranlaßte, was er hier thue. »Sehen Sie, diese Löcher sind nach ihrer Umgebung zu urtheilen, verlassen und da gibt es keinen unbequemeren Ort, als deren Nähe sich zum Rasten auszusuchen, weil eben diese Löcher mit Vorliebe von Schlangen—«. »Eine Schlange, eine Schlange, Doctor, nehmen Sie den Schambock (Bileamspeitsche), passen Sie auf, sie läuft auf Sie zu!« schrie plötzlich aus der nächsten Vertiefung der erschreckte F., der hinabgestiegen war, um einige an den Grashalmen erspähte Käfer für mich zu erbeuten. Das »ausgesucht werden« blieb Freund E. in der Kehle stecken, er hatte nicht nöthig, seinen Satz zu beschließen, denn da kam schon pfeilschnell das Reptil hervorgeschossen, schnurstraks auf eines der zugestopften Löcher zueilend. Dieses und ein anderes verschlossen findend, wandte sich die etwa vier Fuß lange, fingerdicke Schlange nach dem Zwergbäumchen, wo sie mir über eine halbe Stunde harte Arbeit machte, bevor ich sie in dem dichten Geäste bemeistern konnte. Es war eine als Giftschlange in Süd-Afrika wohlbekannte Scap- (Skap-) stecker.
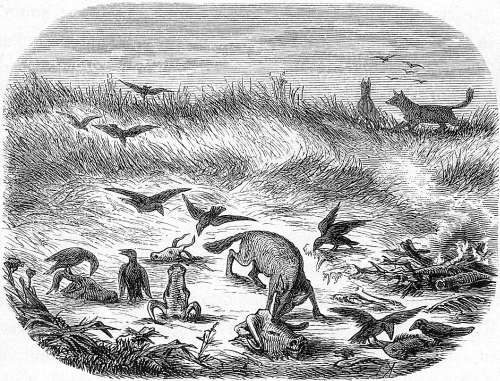
[Verlassener Jagdplatz.]
Im blumigen Thale des Estherspruit angekommen, widmete ich am folgenden Morgen, wie an der letzten Raststelle, einige Stunden dem Insectenfange, da hier viele Doldengewächse, auch Orakelblumen und Liliaceen von kleinen Coleoptera-Arten strotzten. Mylabris, Cetonia Marienkäfer, Erdflöhe etc. fanden sich artenreich vor. Dann wurde noch ein allgemeiner Ausflug mit Gewehr, Pinzette und Schambock zwischen den das enge Spruitthal zur Linken umgebenden Felsen versucht. Das Resultat war der Fang einiger Echsen, zweier Schlangen, von denen sich (nach der Breite der Spur zu urtheilen) hier viele Buffadern aufhalten mußten. Sie mußten auch gut gedeihen, denn alle Bedingungen dazu waren hier in den geschützten Felsenlöchern vorhanden, in denen sich kleine, braune und große, graue, schwarz gestreifte Rohrrüßler aufhielten, während in den nahen Zwergbüschen gestreifte Mäuse und im nahen Thale Lurche in großer Zahl anzutreffen waren. Die Rohrrüßler sind kleine muthige Raubthiere, der Gestalt nach müßte man sie Spring-Spitzmäuse nennen. Die großen (von der Größe einer Ratte) leben paarweise in Löchern unter umfangreichen Blöcken, sind sehr wachsam und nähren sich von Insecten und Insectenlarven. Sie springen sehr behende und pflegen sich auf der Flucht zeitweilig umzusehen, was ihnen natürlich oft zum Verderben gereicht.
Spät am Nachmittage erreichten wir den durch die bereits geschilderten Raubritter—jene holländischen Quälgeister, deren ich schon auf der Hinreise gedacht—berüchtigten Matjesspruit. Ich nahm mir vor, in dem Thale gar nicht zu halten, sondern noch drei Meilen darüber hinaus zu fahren, um nicht belästigt zu werden. Als wir ungefähr das erste Drittel des zum Spruit führenden Abhanges erreicht hatten, machte mich der mit der Peitsche neben dem Gefährte schreitende Gert auf den »Wächter« des in dem Gebüsche zur Rechten liegenden Raubgehöftes aufmerksam. Einer der Bauern stand unter einem Bäumchen auf dem Wege und lugte aus. Als wir auf etwa 300 Schritte nahegekommen waren, verschwand er plötzlich und lief buscheinwärts, um die Annäherung einer »Prise« zu melden.
Wir wähnten, als von Gert angetrieben das Gespann sich in Trab gesetzt hatte, der drohenden Gefahr glücklich entronnen zu sein, und konnten uns nicht enthalten, ob der gelungenen List in ein lautes Gelächter auszubrechen. Doch wie gewöhnlich, wir hatten zu früh gelacht. Plötzlich erscheint eine schmutzige Hand an dem Seitenbrette und dann folgt ein bestürztes Gesicht. »Chun (guten) Dag, Mynheer, ah, ah Dokter, wart doch bichi—ras ni so banje (viel) mit det ow (alte) wachen (Wagen).« Dann erschien neben Gert ein zweiter Raubritter in zerrissenen Hemdärmeln und beide bemühten sich, ihn zu überreden, das Gespann zum Stehen zu bringen. So hatten uns doch die unbarmherzigen Quälgeister ereilt! Doch Gert ließ vom Peitschen nicht ab und das Gefährte eilte bis zu dem Flüßchen, das wir zu durchschreiten hatten. Kaum daß wir das Spruitbett überschritten hatten, als ein Troß von Kindern und Frauen dem Wagen nachgerannt kam. »Ja warum lauft Ihr denn so vorbei,« hieß es von allen Seiten, »bleibt doch ein bischen stehen.« Wir sprangen vom Wagen ab, um wenigstens der Sitte gerecht zu werden und den zwölf Anwesenden Einem nach dem Andern ihre nichts weniger als reinen Hände zu schütteln und sie zu versichern, daß wir es sehr eilig hätten und unter keiner Bedingung hier bleiben könnten. Da nahmen die diesmal glücklich zurückgeschlagenen Freibeuter zu einer anderen List ihre Zuflucht, wobei sie jedoch vergaßen, daß wir dieselbe schon kannten. »Aber Ihr könnt' nicht weiter, denn wo Ihr noch heute Nacht hinkommt, da ist kein Gras für Eure Ochsen, kein Wasser für Euren Thee, der Boden ist kahl gebrannt, ohne Gras wie dieser Weg, bleibt doch hier über die Nacht.« Doch es half alles nichts, wir kannten unsere Pappenheimer zu gut und so blieb ihnen nichts übrig, als mit leeren Händen den Heimweg anzutreten.
Die Sonne stand schon ziemlich hoch, als wir am folgenden Tage am Klipspruit (steinigen Spruit) Rast hielten. Etwa 1½ englische Meilen an demselben auswärts stand ein Wagen und nahebei grasten einige Pferde. Hinter dem Wagen schien ein Zelt zu stehen. Ich hoffte holländische Jäger zu finden, von denen ich, im Falle wir ohne Erfolg gejagt hätten, einige frisch erlegte Thiere, der Häute halber, zu erstehen gedachte. Wir hatten auch ganz richtig geurtheilt, denn wir fanden den Besitzer der Landstrecke, auf der wir rasteten und der weiter auswärts sein Farmhaus hatte und mit seiner Familie auf einer Erholungsreise begriffen war, wobei er sich seine Zeit mit Jagen vertrieb. Um den Wagen waren mehrere Aeste in den weichen Boden eingelassen und mit Ochsenriemen verbunden, an denen zahllose, längliche Fleischstücke hingen, um zu dem bekannten Beltong getrocknet zu werden. Auf der Erde lag ein Gnu-Stier, den eben ein Koranna abzuhäuten bemüht war.
Wohin wir auch unsere Blicke wenden mochten, überall begegneten sie einem überraschenden Reichthum an Wild jeder Gattung. Wir waren Zeugen eines Kampfes zweier Gnu-Stiere, die mit unglaublicher Vehemenz aufeinander eindrangen; nichtsdestoweniger aber hatten sie ihren gemeinschaftlichen Gegner in uns bald gewittert und folgten der fliehenden Heerde rasch nach.
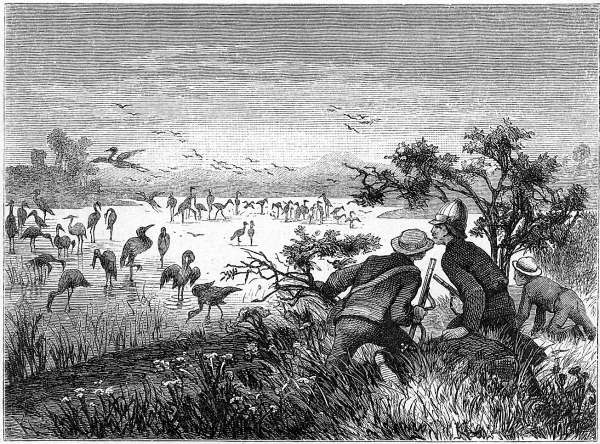
[Eine Vogel-Colonie.]
Bei dem Präpariren des mir von dem Farmer überlassenen Gnufelles hatte ich mich an den spitzen Knochen des Kopfskelettes verletzt, im Eifer der Arbeit, zu deren Beschleunigung ein drohender Regenguß mich anspornte, achtete ich nicht darauf. Heftige Schmerzen und angeschwollene Hände belehrten mich nächsten Tages, daß ich unvorsichtig genug vorgegangen und das Arsenikpräparat in die Wunden eingedrungen war. Ich wurde erst später eindringlich an die Gefahr dieser Sorglosigkeit gemahnt.

[Löwenjagd in den Maqwasibergen.]
Am nächsten Morgen verließen wir Klipspruit, überschritten den Löwen- und Wolfsspruit und erreichten gegen Abend die schon erwähnte Farm Rennicke, deren Besitzer uns auf der Hinreise anfangs ziemlich unfreundlich empfangen hatte. Diesmal hatte er gegen unser Vorhaben, im Gehölze zu jagen, nichts einzuwenden, ja er gab uns sogar seinen Jungen als Führer mit. Der kleine Bursche geleitete uns an den nördlichen Rand des Gehölzes, an dem angelangt er uns niederbeugen und ihm stille folgen hieß.
Nach etwa 60 Schritten standen wir an einem niederen, kaum fünf Fuß hohen, hie und da mit Zwergsträuchern überwucherte Erddamme. Der Junge vor uns kroch aufwärts und sah sich um, dann hieß er uns vorsichtig folgen und durch eines der Büschchen gedeckt auslugen. »Kick, Ohm« (schau, Onkel), flüsterte er mir in's Ohr, und wies mit seiner Linken über den Damm. Ein unvergeßlicher Anblick bot sich uns dar. Ich wünschte ein Netz über diese Scene ausgespannt zu sehen und das Leben darunter als »Leben« zu erhalten.
Der Damm, an dem wir lagen, war die südliche Umzäunung einer dreiseitigen, eingedämmten Vertiefung, die von Gras und Binsen überwachsen, nur vom Regenwasser gespeist zu sein schien. In diesem Gewässer watschelte, schwamm und tauchte ein Heer von Vögeln umher, Die auffallendsten waren die heiligen Ibise, wenigstens fünfzig, die Einen in ihrem schneeweißen Gefieder auf einem Fuße schlummernd, die andern langsam und gravitätisch ausschreitend und den kleineren Genossen (den Tauchern etc.) zuweilen Hiebe austheilend, während die meisten rasch hin und herliefen und dabei unter der Wasserfläche mit dem dunkelgefärbten Kopfe und dem Schnabel hin- und herfahrend fischten. Außer ihnen stand nach der einen Dammseite, wie aller Welt vergebend, ein graues Fischreiherpärchen. Zwischen dem Grase und in den Binsen gackerten graue und schwarzweiß gescheckte Wildenten, während unzählige Bläßhühner ihre tiefen Stimmen hören ließen. Dazwischen tummelten sich die kleinen behenden Taucher. Am Rande des schräg zu dem trüben Wasser abfallenden Dammes liefen laut pfeifend einige Kampfläufer (Philomachus pugnux) auf- und nieder, während kleine Strandläufer in dichten Schaaren von dem einen zum andern Ufer flogen, ohne lange auf derselben Stelle zu verweilen. Später fand ich die Erklärung zu dem lauten Treiben dieser an das flüssige Element gebundenen Vogelwelt. Ein heftiger Platzregen hatte eine Unmasse von Insecten und Würmern von der Ebene in die Vertiefung herabgeschwemmt, auch todte Eidechsen, sogar Mäuse fanden ihren Weg dahin; an dieser reich besetzten Tafel ließ es sich nun die befiederte Gesellschaft recht wohl schmecken.
Einer von uns mußte wohl unvorsichtig den Kopf vorgestreckt haben, denn bevor ich mich dessen versah, hatten sich alle die Langstelzen mit lautem Geschrei in die Lüfte erhoben. Unwillkürlich und wohl auch in der Angst, sie alle davonfliegen zu sehen, legte ich auf einen der Ibise an und brachte ihn wie auch ein Bläßhuhn herunter. Auf dem Heimwege die Moräste berührend, erbeutete Freund E. eine Wildente.
Am Wagen angekommen, erfuhr ich von Freund K., daß der Farmer mich zum Besuch eingeladen habe. Obgleich derselbe wohlhabend zu nennen, war doch sein Haus höchst einfach aus Backsteinen aufgeführt. Er klagte mir sein Leid über die Verluste, die er durch die herrschende Pferdekrankheit alljährlich erleide und bat mich um meinen Rath, da eben sein Reitpferd von der Krankheit befallen war.
Am Nachmittage verließen wir Rennicke's Farm und langten in der Dunkelheit an »Gildenhuis Place« an, derselben am Südfuße der hier vorbringenden Maqwasihöhen erbauten Farm, welcher ich auf der Hinreise bereits erwähnte.
Auf der dritten Reise—zwei Jahre später—traf ich weit im Innern einen herumwandernden Elephantenjäger, der seine Heimat an den nördlichen Ausläufern der Maqwasihöhen hatte, zu deren südlichem Abhange wir eben lagerten. Er war ein tüchtiger Jäger, und ich will im Folgenden, bevor ich von den Maqwasihöhen scheide, eine seiner Jagdepisoden erzählen. Weinhold Schmitt hielt sich in seiner Junggesellenzeit in einer an den Quellen des Maqwasi-Rivers liegenden Farm auf. Zu dieser Zeit waren die nördlichen Schluchten der Maqwasihöhen durch das Treiben von vier in der Regel gemeinschaftlich jagenden Löwen arg verrufen. Keiner von den in der Umgebung wohnenden Boer's hatte sich bisher erkühnt, den verwegenen Löwen an den Leib zu gehen. Da kam eines Tages der Sohn des einen Farmers mit der traurigen Botschaft heimgeritten, daß er die Leichen dreier Pferde—es waren »gesoute« (gesalzene, d.h. gegen die Pneumonie gefeite), welche er abzuholen hatte—vorfand, die schon halb aufgezehrt im Grase lagen, und an den zahllosen Spuren waren die Urheber der ruchlosen That nur zu deutlich zu erkennen.
Diese Nachricht brachte es zu Stande, daß sich die Boer's endlich zur That aufrafften und gemeinschaftlich die Raubthiere zu erlegen beschlossen. Der Farmer und sechs Reiter fanden sich ein, der junge Mann, der die getödteten Pferde aufgefunden, wurde zum Führer gewählt; die Spur der Löwen war bald gefunden. Es ging durch ein Thal, über eine, über eine zweite Höhe, dann kamen sie auf eine Ebene, die leider kurzbegrast war; der Boden war hart und wohl auch deshalb verloren sie die Spur der Thiere und mußten die Verfolgung aufgeben. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß den Löwenjägern der Muth etwas gesunken war und daß alle nur zu sehr einverstanden waren, lieber heimzukehren, als noch, abgemüdet nach einer längeren Verfolgung, den Kampf mit den Raubthieren aufzunehmen. Auf ihrer Heimkehr trennten sich die enttäuschten Jäger nahe an Schmitt's Wohnung. Doch wie erstaunten er und sein Freund, als sie in unmittelbarer Nähe des Gehöftes ein Löwenpärchen im hohen Grase erblickten. Nach der Stellung, welche die Raubthiere eingenommen hatten, schienen sie auf der Lauer zu liegen. Beim Annähern der beiden Reiter, deren Pferde sich brav in der Nähe ihres Erzfeindes hielten, erhoben sich die Löwen, und Schmitt, um einen sichern Schuß zu gewinnen, sprang ab, nahm die Zügel, machte einige Schritte nach vorwärts und legte gerade auf den nach ihm stierenden Löwen an, als ihn sein Gefährte anrief; als sich Schmitt umwandte, sah er, daß ihn dieser verlassen und eben in einer Entfernung von 50 Schritten Posto gefaßt hatte. Dies war unserem Jäger sehr unangenehm. Zwei Löwen sah er vor sich, die übrigen durften wohl nicht ferne sein, sein Freund hatte ihn in dieser ungemüthlichen Situation verlassen.
So blieb ihm nichts übrig als selbst an den Rückzug zu denken. Sein Pferd am Zügel führend wich er zurück, doch so, daß er stets die Raubthiere im Auge behielt. Bevor jedoch der Schütze seinen Gefährten erreicht hatte, wandten sich die Löwen zur Flucht nach den Höhen. Dies gab unsern Jägern Muth und beide galoppirten ihnen nach, Schmitt mit der Absicht—wie es jeder berittene und etwas erfahrene südafrikanische Löwenjäger in einem solchen Falle versucht—den Löwen einen Vorsprung abzugewinnen und ihnen den Weg zu verlegen. Es gelang ihm und die beiden Löwen befanden sich nun zwischen ihm und seinem Gefährten, der mit Geschrei und Hutschwenken die Freunde, von denen sie kurze Zeit zuvor geschieden und die noch nicht aus Schußweite gekommen waren, auf den Fund aufmerksam zu machen sich bemühte. Bevor jedoch diese—obwohl mit verhängten Zügeln einhersprengend—zur Stelle waren, hatte sich die Löwin nach links gewendet und war in einer trichterförmigen, bebuschten doch seichten Felsenvertiefung verschwunden, während der Löwe mit fletschenden Zähnen den Augenblick, wo beide Jäger dem Dickicht näher gerückt waren, benutzend, mit einigen Sätzen im Gestrüppe der nahen Höhe verschwand und—nachdem er wohl noch durch den Anblick der heranjagenden Menschen eingeschüchtert—seine Flucht längs der Höhe auch so eilig fortsetzte, daß er seinen Verfolgern nicht mehr zu Gesichte kam.
Als die übrigen fünf Jäger sich zur Stelle eingefunden hatten, beschloß man, die Vertiefung zu umzingeln und namentlich den dem Hügel zugekehrten Rand derselben scharf im Auge zu behalten, weil man nach dieser Seite einen Fluchtversuch der Löwin befürchtete. Hier postirten sich auch drei der Jäger und begannen mit Geschrei und Steinwürfen die Löwin zu beunruhigen und zu einem Fluchtversuche zu bewegen. Die Steinwürfe mochten sie wohl kaum belästigt haben, umsomehr aber schien die Löwin über das entsetzliche »Holländisch« empört, in welchem die drei Jäger sich mit ihr unterhielten, denn nach einiger Zeit erschien sie am Rande der Vertiefung, um die Situation auszuspähen. Anstatt gerade nach dem schützenden Dickicht des Hügels zu halten, bog sie etwas nach links ein, um in einer schiefen Linie das Ziel zu erreichen. Bei der Ausführung dieses Vorhabens stand ihr jedoch das Unangenehme bevor, vor den drei Schützen vorbeidefiliren zu müssen. Sie zögerte nicht lange und folgte der letzterwähnten Richtung. Drei Schüsse knallten zur selben Zeit. Die Löwin machte einen Versuch, ihre Bahn fortzusetzen, den auszuführen jedoch ihre Lebenskräfte nicht mehr ausreichten. Sie war mit dreifach durchbohrter Brust zur Erde gesunken.
»Und die anderen Löwen?« fragte ich.
»Wir hatten für längere Zeit Ruhe vor den Raubthieren, sie zogen sich nach dem Hart-River zu und hausten da im Lande der Barolongen. Doch kamen sie zuweilen noch immer herüber und selbst gegenwärtig kann man in trockenen Wintern daselbst von Westen her zugelaufenen Löwen begegnen.«
Nächsten Mittag spannten wir im Schatten einiger schöner Cameeldornbäume unfern der Furth des Maqwasi-River aus. Der vor wenigen Wochen hoch angeschwollene Fluß war nunmehr wieder zu einem dünnen in der Ebene sich hinschlängelnden Wasserfaden herabgesunken. Am jenseitigen Ufer standen einige Wägen ausgespannt. Sie waren sämmtlich mit Wein- und Branntweinfässern geladen, welche nach den Goldfeldern gebracht werden sollten. In einem nahen Ziegelhäuschen ging es sehr lärmend zu, man credenzte auch hier den Feuertrank, und vor dem Häuschen lagen auf der Erde im betrunkenen Zustande einige der zu den Wägen gehörenden schwarzen Diener, während zwei andere—auch unter demselben Einflusse—schreiend ihre Fertigkeit im Boxen an sich versuchen wollten. Der eine hatte seine schmutzige Jacke abgeworfen und schlug die Hemdärmel zurück, um sich für den Zweikampf »klar« zu machen, während sein Gefährte mit in der Hose steckenden Händen und mit ausgespreizten Beinen ihm die ärgsten Schmähworte zuschleuderte. »Du bist kein Hottentot nicht, nur ein elendige Boschman,« warf dieser ein. Das war zu viel für das erhitze Gemüth des braun-gelblichen Stammesbruders. »Ik ke Hottentott ni, so wahr ich eine Mutter habe (dies der gewöhnliche Schwur der Koranna) bin ich einer—nimm das—dafür Du drunken lap Du.« Und die eine der an die Brust gezogenen Fäuste traf den sich kaum im Gleichgewicht haltenden Gegner so dreist und wuchtig auf die Nasenwurzel, daß er mit einem »Allmachtag« nach rückwärts fiel und hoch mit den Beinen aufschlug.
Auf unserer Weiterfahrt nach Bloemhof begegneten wir zwei Fußgängern (Weißen), die nach monatelangem, erfolglosem »Diggen« in den Diamantenfeldern ihr Heil in den Leydenburger Goldfeldern zu finden gedachten. Der eine der Männer trug zusammengerollte Decken, der zweite in einem Ledersack Brod etc., sowie eine Theekanne und einen Becher. In dieser Verfassung dachten sie die Gesammtstrecke von über 115 geographischen Meilen Länge zurückzulegen. »Nachts schlafen wir unter einem Busche, polstern uns die Stelle weich mit Gras aus und überrascht uns ein Regen, so bleiben wir—wenn wir gerade nicht nahe an einem Farmhause sind, um Schutz in dem Wagenschuppen zu suchen—ruhig liegen, ist's ja nur Wasser, und reines Wasser, das da vom Himmel auf uns kommt.« Das war ein Paar jener Wettergebräunten, die man oft in den Diamantenfeldern begegnet und die von dem Glanze der Diamanten und des Goldes angezogen, die rauhesten Seiten des menschlichen Daseins kennen, ertragen und verachten gelernt hatten; und haben sie sich an dieses rauhe Leben, an dieses mit den größten Mühen und großen Kosten verbundene, selten oder fast nie zu befriedigende Jagen nach Reichthum gewöhnt, so sind sie den gesellschaftlichen Formen des Lebens entfremdet; außer daß sie—was ihnen jedoch in Süd-Afrika nicht leicht möglich ist—die eleganten Säle der Spielhöhlen besuchen.
Spät am Abend langten wir am Bamboesspruit an und übernachteten am diesseitigen Ufer, um die Furth nicht in der Nacht passiren zu müssen. Wir blieben bis gegen Mitternacht um das lodernde Feuer geschaart und besprachen die Gladiatorscene am Maqwasi-River, der wir ohne Eintrittskarten gelöst zu haben, beigewohnt hatten.
Am nächsten Tage legten wir die Tour durch die schon vorher erwähnten Grasebenen zurück, berührten die beiden an Salzpfannen liegenden Farmen Rietfontein und Coetzee's Farm und erreichten den folgenden Tag Bloemhof.
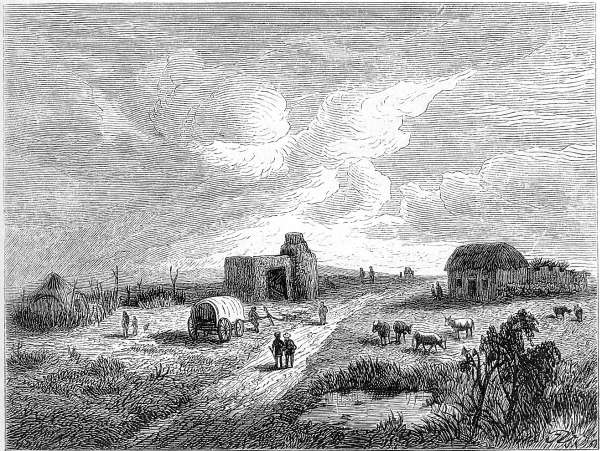
[Hallwater Farm.]
Nach kurzem Aufenthalte brachen wir noch am selben Tage nach der Hallwater Saltpan auf, um auf diesem kürzeren Wege nach Christiana zu gelangen. Diese Salzpfanne war im Jahre 1872 dadurch in Süd-Afrika berühmt geworden, daß man daselbst die Ruinen von Monopotapa (Monomotapa, Motapa, Mosogra etc.), einer in einem Reiche desselben Namens (das vor 200 Jahren noch existirte) liegenden Stadt, gefunden zu haben glaubte. Aus alten Chroniken ersehen wir, daß das ganze Centrum Süd- und des südlichen Central-Afrika von diesem Reiche eingenommen wurde, daß mit seinen Bewohnern—meist durch die an der Küste wohnenden Eingebornen als Zwischenträger—von Seite der portugiesischen und holländischen Händler ein lebhafter Handel getrieben wurde und man glaubte auch, daß bereits portugiesische Missionäre von Osten her bei den Bewohnern Monopotapa's gewirkt hätten. Den Chroniken entnehmen wir auch, daß die Städte meist in der Nähe von Goldminen erbaut und in unmittelbarer Nähe der Stadt Monopotapa selbst an 3000 bearbeitete Erdlöcher (Minen) zu finden waren. Man hatte nun in der Nähe der Hallwater Salzpfanne Steine vorgefunden, welche menschliche Arbeit und zwar meist Bruchstücke von Säulen, ferner Gesimsstücke—jedoch nur diese beiden Formen—darzustellen schienen, und da die Entfernung dieses Fundortes von Kapstadt mit der, in den Büchern als Entfernung zwischen der Stadt Monopotapa und Kapstadt angegebenen ziemlich übereinstimmt, glaubte man Monopotapa gefunden zu haben. Ich hielt deshalb die Stelle eines Besuches werth, um so mehr, als sie nicht weit, nur einige Meilen nordwärts von meinem Wege liegen sollte.
Am selben Tage, nachdem ich Bloemhof verlassen, traf ich bei der bezeichneten Salzpfanne ein. Obgleich nahe am Vaalflusse gelegen und zum Gebiete der Transvaal-Republik gerechnet, und obschon hier eine weiße Frau mit ihren Töchtern in einem Moodhouse wohnte, die uns sogar einlud, uns in ihrem Palaste niederzusetzen, fand ich, daß die Koranna's von Mamusa die eigentliche Herrschaft führten und diese auch bis zu Beginn des Jahres 1879 aufrecht zu halten wußten.
Die Stelle bildete die Südspitze eines Dreieckes mit der Basis gegen Mamusa und dem Hart-River zu, welches von Gassibone und Mankuruan (damals beide unabhängig), den Batlapinenchefs, Old-David Maschon, dem Korannakönig von Mamusa und den Holländern beansprucht wurde; bei dieser Sachlage waren nur die hier angesiedelten Farmer zu bedauern, denn auf sie fiel die Last aller Quälereien, sie waren der Sündenbock in allen Streitigkeiten.
In der Nähe der Salzpfanne, welche wohl das beste Kochsalz in dem Bloemhofer District liefert, und deshalb neben dem Graslande als Weide durch den Salzgewinn einen Erwerb in cash (in Baarem) abwarf, war eine Farm, ein besonders hervorstechender Punkt in »the disputed territory« (streitigem Gebiete). Außer dem aus rohem Thonboden verfertigten und nothdürftig mit Gras gedeckten Häuschen, das von der erwähnten Frau, entweder um ihr Vieh an der Pfanne weiden oder das Salz durch ihre Diener gewinnen zu lassen, bewohnt wurde, standen noch am Nordrande der Salzpfanne einige Korannahütten. Zwei etwa 12 Fuß tief in die Erde gegrabene Löcher lieferten einen kleinen Wasserstrahl, der durch einen Graben in eine Bucht geleitet, die Bewohner mit Wasser versah. An diesem äußerst schmutzigen Tümpel tummelten sich zahlreiche rothfüßige und einige Sporen-Kibitze, während im Wasser zahlreiche Wasserschildkröten und Frösche ihr genügsames Dasein fristeten.[1]
Die vorgehende Zeichnung der Hallwaterfarm habe ich im Jahre 1875 (zwei Jahre später) auf meiner dritten Reise aufgenommen. Wir sehen ein aus Thon aufgeführtes Häuschen und einige Hütten, in denen Koranna's hausten. Die Weißen hatten die Stelle bald nach meinem Abgange verlassen. Die Koranna's gewannen nun selbst das Salz, von dem sie 25 Pfund für eine halbe Krone verkauften. Einem Reisenden, der nach dem Innern Afrika's seine Schritte lenken will, würde ich es anrathen, sich hier mit einer genügenden Menge Salz zu versorgen, da er beim Einsalzen des Wildfleisches und Präpariren der Haut großer Säugethiere viel davon brauchen, allein nicht leicht wieder ein ähnlich gutes auf seiner weiteren Reise finden wird. Die hier lebenden Koranna's ernähren sich von Viehzucht, halten meist Rinder und Ziegen und besitzen einige schadhafte Wägen, in denen sie das Salz nach Bloemhof, Potschefstroom und den Diamantenfeldern zum Kaufe bringen und daselbst für 1 £ St. per mule (d.i. 200 Pfund) feilbieten. Oberhalb der Stelle, wo die trockenen Bäche einmünden, könnte die nächste Umgebung der Pfanne mit einem niedrigen Damm versehen, und von dem so gebildeten Weiher hinreichendes Wasser zur Bewässerung von Feldern gewonnen werden. Doch es gehört mehr als Koranna-Energie dazu, um einen solchen Versuch zu wagen; vielleicht wird es doch möglich werden, wenn hier, wie in Griqualand-West, die Eingebornen nicht mehr Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Kräfte im Brandygenusse verkümmern zu lassen.
Während unseres ersten Aufenthaltes an der Hallwater Salzpfanne hatten wir auch Gelegenheit, das Batlapinengericht, »die Wanderheuschrecken«, zu verkosten. In der Asche gebraten wurden sie von einigen durchreisenden Batlapinen genossen, die Einen aßen sie mit »Haut und Haaren«, Einer riß die Füße und Flügel, der Klügste von Allen auch den Darmkanal aus; in der letzteren Verfassung versuchten wir dieses Gericht. Ich benützte die Gelegenheit, dieses noble Betschuana-Gericht allen Gourmands, wenn sie so weit gediehen sind, daß sie nichts mehr zu essen haben, oder daß ihnen nichts mehr pikant genug erscheint, als ein billiges und doch ungewöhnliches Ultimatum zu empfehlen. Wenn ich mich jedoch zu diesem freundschaftlichen Rath erkühne, ist es auch nöthig, des »Geschmacks« dieser Wildgattung Süd-Afrika's mit einigen Worten gedenken zu wollen. Derselbe ist jenem getrockneter, etwas ausgelaugter italienischer Sardellen ähnlich. Benützt wird nur die eigentliche südafrikanische Heuschrecke. Ich für meinen Theil fand das Thier als Köder zum Angeln ausgezeichnet, besser als Regenwürmer etc.; bei ihrem Schwärmen fallen Hunderte in die Flüsse den Fischen zur willkommenen Beute, sowie sie in den Lüften sowohl von dem kleinen Vogel, der sie mit beiden Fängen halten muß und stückweise verzehrt, bevor er mit ihnen fertig wird, als auch vom Adler und Kranich als besondere Leckerbissen angesehen und jeder anderen Nahrung vorgezogen werden.
Nachdem wir die kürzere Wegrichtung nach Christiana erfahren hatten, nahm ich mir vor, um die Gegend kennen zu lernen, meinen Weg nach Westen fortzusetzen, und erst unterhalb Christiana gegen Hebron auf die Route einzulenken, so daß ich auf diese Weise den südlichen Theil von Gassibone's Gebiet von Ostnordost nach Westsüdwest durchzog. In der Richtung, die wir einschlugen, gab es keinen fahrbaren Weg, wir mußten uns durch Gebüsche und über begraste Ebenen unseren Weg bahnen. Mir war es hauptsächlich darum zu thun, einen Ueberblick über die Gegend zu gewinnen, leider war mir dies nicht gestattet und ich entschloß mich, wegen der Beschwerden, die uns diese Reise bereitete, lieber die kürzeste Strecke nach dem Vaal einzuschlagen. Im selben Verhältnisse als die jede Aussicht benehmenden Büsche abnahmen, traten nun leider wieder die Kameeldornbäume in größeren Beständen auf.
Zahlreiche fahle Zwergtrappenpärchen, Deuker- und Steinbockgazellen wurden sichtbar, die ersteren Gazellen ruhig grasend, die letzteren nur wenn aus dem Gebüsch aufgescheucht, bemerkbar. Wir fanden auch Spuren von Hartebeest-Antilopen und solche, die den des Gnu ähnlich, doch wahrscheinlich jene des gestreiften Gnu's (Catoplepas Taurina, Gorgon) sind. Diese Spuren und die Hoffnung, das Wild selbst beobachten zu können, ließ uns den Wald willkommen heißen, allein um uns nicht zu sehr der Freude über den Wechsel im Charakter der Gegend und den damit in Aussicht gestellten Eroberungen genießen zu lassen, wurde unsere allgemeine Zufriedenheit schon während der ersten Stunden dieser, zwischen den wenn auch wenig dicht stehenden Bäumen unbequemen Fahrt durch den Umstand getrübt, daß wir kein Wasser aufzufinden vermochten.

[Koranna.]
Gegen Mittag stießen wir auf einen, den Fußspuren nach zu schließen, ziemlich betretenen Pfad und hielten in Mitte einer Lichtung Rast. Schon seit einigen Tagen war mir ein penetranter Fäulnißgeruch aufgefallen, welcher einer Kiste entströmte, in der ich die erbeuteten und präparirten Felle untergebracht hatte; es waren im Ganzen zwei schwarze Gnu-, drei Bläßbock- und zwei Springbockfelle, ferner solche von Schakalen, Proteles, Springhasen, Scharrthieren, Erdeichhörnchen und Klippschliefern. Da in der Kiste auch die Hörner der erlegten Thiere obenauf lagen, so schrieb ich diesen den fatalen Geruch zu; um mich aber darüber zu beruhigen, machte ich mich daran, die Kiste zu öffnen. Meine schlimmsten Befürchtungen waren noch weit überholt, alle Mühe und Plage war verloren, meine Wunden an den Händen schmerzten mich bei dem Anblicke der aller Haare entblößten, vom Regen aufgeweichten und in Folge dessen in Fäulniß vergangenen Felle doppelt heftig. Es blieb mir nichts übrig als die Felle zu opfern und mich mit den Hörnern zu begnügen, die ich von den Kopfskeletten herabsägen mußte. Während dieser Arbeit wurden wir durch Gäste überrascht, Batlapinen, die durch den Rauch des Lagerfeuers angelockt, nicht wenig erstaunt waren, im Walde Weiße mit einem Wagen zu finden.
Dem Rathe der Batlapinen nachkommend, verfolgten wir den Fußpfad und es währte nicht lange, so waren wir aus dem Walde heraus auf eine begraste, stellenweise dicht, doch niedrig bebuschte Ebene gekommen, welche ich für eine der an Kleinwild reichsten Stellen in Gassibone's Lande halte. Unter dem Kleinwild war die schmucke, kleine Steinbockgazelle vorherrschend, doch sahen wir auch drei Springböcke, die sich bald empfahlen, ohne uns auf Schußweite nahekommen zu lassen, sowie auch zwei gravitätisch neben einander einherschreitende Sekretäre, welche die weniger dicht und hochbegrasten Partien aufsuchend, eine Razzia auf Schlangen und Eidechsen hielten. Unter dem Federwild waren Rebhühner (meist paarweise) das häufigste Wild. Wir hielten einige 20 Minuten an der Batlapinen-»Post«, die Frauen waren mit der Herstellung einer neuen Umzäunung beschäftigt, die sie für ihre Ziegen aus Dornbüschen bereits halb aufgebaut hatten. Die Männer hatten zwei Hartebeestfelle, die rauhgar gegerbt waren, mit feuchter Erde überschüttet, um sie noch weicher und nachgiebiger zu machen und dann daraus eine Carosse verfertigen zu können.
Da ich in der Folge rasch reisen und mich nirgends länger als unumgänglich notwendig aufhalten wollte, entschloß ich mich, in der Nähe des Vaal angelangt, noch einen Tag am Ufer desselben zuzubringen, um zu fischen. Wir hatten kaum am Lagerplatze Feuer angezündet, als auch schon aus dem kaum eine halbe englische Meile entfernten Farmhause (unmittelbar am Flusse gelegen) der Farmer erschien und mir bedeutete, daß er mir nicht gestatten könne, hier zu übernachten. Ich wäre vom Wege »abgefahren« und auf dieses Vergehen stünde in der Republik 5 £ St. Strafe.
Ohne mich in weitere Unterhandlungen einzuladen, traf ich Anstalten zum Aufbruche. Unser Gefährte F. war noch so glücklich, vor unserer Abfahrt aus den Fluthen des Vaal einen etwa dreipfündigen Wels herauszufischen, ein Fang, der in das Menu unserer täglichen Mahlzeiten angenehme Abwechslung brachte.
Gegen Mitternacht hatten wir Christiana erreicht und gedachten nun, uns an einer Tasse heißen Thee's zu erwärmen, als wir die Entdeckung machten, daß wir die Kiste mit dem Kochgeschirr verloren hatten. Mich traf dieser Verlust sehr empfindlich, denn meine Mittel waren schon derart zur Neige gegangen, daß sie die Neubeschaffung des notwendigen Geschirres nicht zuließen. Freund E. half uns aus dieser Verlegenheit.
In Christiana hielten wir uns nur bis zu Mittag des folgenden Tages auf. Nach einer halbtägigen Fahrt erreichten wir den am Wege erbauten kleinen Eingebornenkraal, an dem wir, von Gassibone kommend, auf die Klipdrift-Christiana-Route gestoßen waren. Von hier bis nach den Diamantenfeldern zu hatte ich eine für mich vollkommen neue Strecke zu durchreisen. Den interessantesten Theil derselben bildet unstreitig die mittlere Partie, d. h. das Hebroner Höhennetz.
Der erste Theil der Strecke bis zum Fuße der Höhen ist flach, zeigt einige der bekannten, doch kleinen, von Wildgänsen (Chenalopes) und Kranichen aufgesuchten, länger als gewöhnlich mit Wasser gefüllten Salzpfannen. Der Vaalfluß entfernt sich von uns nach links in einem weiten Bogen und wir treffen ihn erst nach einem langen Doppelmarsche, indem wir die Secante zu diesem Kreisabschnitte beschreiben. Das Land nach links, eine prachtvolle Grasebene (das Land innerhalb des vom Flusse betriebenen Bogens), gehörte zu der Transvaal-Republik, jenes zu unserer Rechten, hochbegrast, hie und da von Büschen und kleinen Niederwald-Complexen bedeckt, Gassibone an; jetzt gehört beides zu der Transvaal-Colonie. Die Grasebene zu unserer Linken war eine der von den schon oft erwähnten Knurrhühnern (Otis afra) am dichtesten bevölkerten Jagdstellen, die ich auf meinen südafrikanischen Wanderungen kennen gelernt, es rauschte vor uns, neben uns, in der Ferne, auf beiden Seiten des Weges.

[Von der Arbeit heimkehrende Batlapinen.]
Unser Gefährte F. wollte, als er die Trappen so häufig auffliegen sah, wieder einmal Proben seiner weidmännischen Ausbildung geben und rühmte sich, mindestens einem halben Dutzend den Garaus zu machen. Doch bald kehrte er zum traulichen Herde am Wagen heim, traurig mit gesenktem Kopfe und—ohne Jagdbeute. Sein Gewehr war gut, sein Auge scharf, und die Rechte sicher wie immer, doch sein Pulver war »krumm« und warf die Schrote in jeder, nur nicht—wenn auch wohlgezielt—in der entsprechenden Richtung. Wer hätte auch dagegen ankämpfen können, wenn Diana neckend die Schrote zerstreute. Freund E. brachte zwei Knurrhühner und für mich zwei Stück schwarzweiß-gescheckte, unserer ähnlich gefärbten Art naheverwandte Würger.
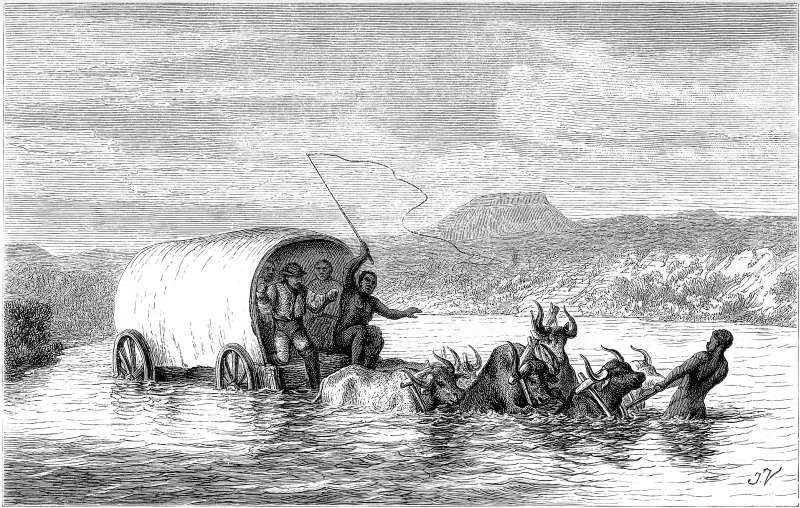
[Ostersonntag im Vaal-River.]
Ich ging mit Gert in das nahe liegende Gehölz Insecten suchen und gewann einige Bockkäfer, sowie zwei Species der Borkenkäfer (Bostrichidae). Hie und da stießen wir auf Gnuschädel, ein Beweis, daß alle diese Gegenden vor kurzer Zeit noch von Gnu's bevölkert waren, während sie sich jetzt mehr im Innern von Gassibone's Lande aufhalten und sich nach Norden in die zwischen dem Hart- und Molapo-River liegenden Wildebenen und jene an der Klipspruit, die freier und gebüschlos sind und daher das Anschleichen erschweren, zurückgezogen haben.
Von Bloemhof ab fuhren wir parallel mit dem Freistaatufer, das bis gegen Hebron höher als das rechte ist und an dem zahlreiche Farmen liegen. Ungefähr 18½ engl. Meilen von Christiana entfernt trafen wir wieder mit dem Vaalflusse zusammen. Hier stand eine Cantine, in der es wild zuging; an der Cantine theilt sich der Weg, der eine führt nach Hebron (weiter stromabwärts) zu, der andere nach einer Ueberfuhr über den Vaal, die gegenwärtig unter dem Namen Blignauts-Pont bekannt und die häufigst eingeschlagene Tour von den Diamantenfeldern nach der Transvaal-Republik bildet; sie ist die kürzeste, billigste und beste. Ich wählte die längere und beschwerlichere, weil ich die Hebroner Höhen, sowie die umliegenden verlassenen River-Diggings kennen lernen wollte. Von Blignauts-Pont bis gegen Delportshope (unweit der Vereinigung des Hart- und Vaal-Rivers), theils in dem Hauptthale, theils in den einmündenden Thälern wohnt in kleinen Dörfchen und in einzelnen Gehöften die Mehrzahl der als englische Unterthanen lebenden Koranna's. Ueberall sahen wir diese in europäische Kleider und Fetzen gehüllten Gestalten herumlungernd, oder mit ihren Hunden die Gebüsche durchstreifend, während die meist nackten Kinder kleine Viehheerden hüteten.
Von der oberwähnten Cantine ab, wurde die Scenerie etwas interessanter, theilweise schon dadurch, daß wir uns dem Vaalflusse wieder genähert hatten, an dessen Ufer ein geübtes Auge immer eine Jagdbeute erspähen kann und ein Forscher reichen Stoff für seine Studien und Sammlungen findet. Am Fuße der Hebroner Höhen kamen wir an ein theils aus Eisenblech, theils aus Segeltuch und Holz aufgeführtes Hotel und Waarenlager—nach dem Vaal-River, der hier zahlreiche Inseln bildet und eine sehr anziehende Scenerie darbietet »Fourteen Stream« genannt. Von hier erheben sich die Hebroner Höhen, welche den Vaal bis Delportshope begleiten und einige Ketten nach Norden, Nordwest und Nordnordost gegen den Hart-River zu ausstrecken, von denen eine mit dem schon erwähnten Spitzkopf, andere mit den Höhen um Taung, Mankuruana's Residenz, enden, und die sich endlich bis gegen Mamusa hinziehen. Diese Höhen sind dicht bebuscht und mit Bäumen bestanden und über sie führt die Grenze zwischen Griqualand-West und der Transvaal-Colonie. Sie beginnen etwa acht Meilen oberhalb Hebron, der früheren Missionsstation, und dem verlassenen Diamanten-Fundorte. Die Gesteinsformation ist auch hier wieder Vaalgestein (Grünstein mit mandelartigen Chalcedon-Einschlüssen), mit zahlreichen Quarzgeschieben und von eisenhaltigem, quarzkörnigem Thonsand bedeckt. Der Fluß hat sich über die Felsenblöcke Bahn brechen müssen und bildet Stromschnellen. Einen anziehenden Anblick gewährt die Scenerie nach Nordost in dem Momente, wenn wir Hebron erreicht haben und dann nach den eben überschrittenen Höhen und den Fluß aufwärts blicken. Zugleich breitet sich vor uns ein weites Panorama, das jenseitige Griqualand-West- und Oranje-Freistaat-Ufer mit einigen den Horizont begrenzenden Höhenzügen und dem 800 Fuß hohen abgeflachten Plattberg in der Ferne, mit seinen Flüßchen, Weidegründen und seinen Farmen aus.
So sehr die Landschaft auf der Strecke vom Fourteen-Streams-Hotel bis Hebron das Auge entzückte, um so schrecklicher war der Weg, den wir zu überwinden hatten; es war eine wahre Felsenstraße, die von der Natur mit Blöcken gepflastert worden war. Das Regenwasser hatte die befahrene Stelle als Abflußrinne benützt, die Blöcke waren theilweise aus- und der Boden zwischen ihnen abgewaschen worden. Dem Wagen, der in die bedenklichsten Stellungen kam, drohte auf Schritt und Tritt Verderben. Daß solch' eine Reise den in den Kisten im Wagen geborgenen, auf der Reise gesammelten Gegenständen nicht zum Vortheil gereichen konnte, ist selbstverständlich. Keiner von uns konnte es im Wagen aushalten, besonders wurde derselbe jedoch herumgeschleudert, als wir die letzten Höhen nach Hebron zu herabfuhren. Der Abhang war steil und zeigte mehrere rasche Biegungen, so daß wir alles aufbieten mußten, um den Wagen mit den Ochsen nicht die Höhe herabrollen zu sehen.
Ziemlich früh am Ostersonntag langten wir in Hebron an. Der Morgen war kalt, in jeder Beziehung höchst unfreundlich; der Himmel war mit dichten Wolken bedeckt, die von kalten Südwestwinden getrieben auf ihrer luftigen Bahn dahinstürmten, es war ein Tag, der das fröhlichste Herz trübe stimmen konnte. Der Blick auf die Ueberreste (Ruinen ist nicht der entsprechende Ausdruck dafür, denn das Material, mit dem das noch vor wenigen Jahren mehr denn 3000 Diamantendigger zählende Hebron so rasch aufgebaut wurde, war zu nichtig, zu vergänglich, um Ruinen hinterlassen zu können) dieses früher als Missionsstation wichtigen, dann als Diamanten-Fundort berühmt und endlich berüchtigt gewordenen und in diesem Zustande dahingesunkenen Ortes, war kaum geeignet, diese trübe Stimmung zu verscheuchen. Oede ist die Stätte, um so einsamer und trauriger an einem kalten, regnerischen Herbstmorgen, denn dann vermag selbst die schöne Aussicht, die man von dem Orte aus genießen kann und die uns an warmen, klaren Frühlings- und Sommertagen die Oede der Stelle vergessen läßt, die Gedanken nicht heiterer zu stimmen; das einstens belebte Hebron war auf zwei Krämerladen, ein »Hotel«, eine Schmiede, ein Schlachthaus und ein Gefängniß herabgeschmolzen.
Planlos zerstreute, vom Regen aufgeweichte und »zerfließende« Thonwände etc. deuteten auf einen bedeutenden Umfang der Niederlassung, deren Größe uns jedoch dann erst auffiel, als wir die River-Diggings aufsuchten. Hunderte von seichten Erdgruben zeigten, daß hier Tausende, Weiße und Farbige, nach dem werthvollsten der Edelsteine gefahndet hatten. Tausende Tonnen Geröll sind hier mit der bloßen Hand aufgehackt, herausgeschaufelt und auf das Emsigste durchsucht worden; jeder der Steine und dort die riesigen Sandhaufen, die aus dem Gerölle durch's Absieben gewonnen wurden, sind durch emsige Hände gegangen und doch war hier der Erfolg so gering, daß wohl kaum zwei von den 3000 Diggern Reichthum erwarben, und der Erfolg von 150-200 anderen unter ihnen so viel Reingewinn abwarf, daß sie ihre Auslagen hätten decken konnen.
Hebron sank so rasch als es emporgeblüht war, viel rascher als Klipdrift und andere Diamanten-Fundorte. In den angeschwemmten Geschieben, in denen die Diamanten gefunden wurden, konnte man deutlich Elemente nachweisen, die von den umliegenden Höhen, und solche, die weiter aus stromaufwärts liegenden Gegenden angeschwemmt worden waren. Nebst massenhaftem Grünstein, in kleinen Fragmenten wie in Blöcken, waren Quarzstücke als Milch- und Rosenquarz, Quarzit, Porphyr, Quarzitporphyr, sowie eigenthümlich kuchenartig geformte, länglich-viereckige Thonschieferstücke von einer gelblichen oder gelblich-grünen Farbe zu finden, welch' letztere durch eine schwarze Umhüllungskruste, wohl das Product einer Zersetzung der äußersten Lage, auffielen. An der Bruchfläche erschienen diese Thonschieferkuchen schön gebändert und zeigten concentrisch angeordnete, dunkelbraune oder röthliche Zeichnungen; irriger Weise wurden diese Thonschieferblöcke als Muttergestein der Diamanten angesehen.
Als ich bei einem der Krämer meine nöthigen Einkäufe besorgt hatte und meine Barschaft nachzählte, gewahrte ich, daß dieselbe auf 16 Shillinge herabgeschmolzen war. Mit diesem Gelde mußte ich bis nach den Diamantenfeldern gelangen. Ich mußte unter solchen Umständen trachten, so schnell als thunlich Dutoitspan zu erreichen, und da der Fährmann sich weigerte, uns des hohen Feiertags halber über den Fluß zu bringen, überdies seine Gehilfen derart betrunken waren, daß wir selbst am folgenden Tage keine Aussicht hatten über den Vaal zu kommen, entschloß ich mich nach abgehaltenem Kriegsrath selbst mein Glück zu versuchen und den Fluß an einer Furth zu übersetzen.
Mein Gefährte F., den ich auf Erkundigung ausgesandt hatte, kam bald mit der freudigen Nachricht zurück, eine sehr praktikable Furth gefunden zu haben. Wir waren bald darauf an der zwei Meilen stromabwärts befindlichen Stelle angelangt.
So einladend zur Rast die dicht bewachsenen Ufer auch waren, mein ganzes Sinnen und Trachten war auf die glückliche Durchfahrt durch den reißenden Fluß gerichtet. Aus dem Geäste der Bäume lockte so mancher schöne Vogel, doch vergeblich, denn meine Hände waren von kleinen Wunden wie besäet und schmerzten mich auf's Aeußerste, seitdem mich noch ein Scorpion gestochen hatte; das Gift des Arsenikpräparats und des Scorpion's vereinigten sich zu doppelter Wirkung.
Die Strahlen der scheidenden Sonne versprachen eine glückliche Ueberfahrt, doch sie zeigten sich trügerisch, der Fluß war wohl seicht, aber die Strömung so stark und das Bett des Flusses derart von Felsblöcken besäet, daß die Thiere sich entsetzlich abgemüht, bevor wir noch das erste Drittel der Flußbreite erreicht hatten, auch hatte die Strömung uns sichtlich von der Furth abwärts getrieben. Unsere Situation war sehr kritisch.
Trotz alles Antreibens und Schreiens von Seite der farbigen Diener konnten die Thiere nicht mehr von der Stelle und von der Strömung bedrängt, begannen sie sich zu bäumen, an den Jochen und dem Ziehtaue zu zerren, dabei sanken die vorderen Zugthiere immer tiefer ein und waren in Gefahr zu ersaufen. Da war rasches Handeln nöthig, und obgleich ich mit meinen wunden, verbundenen Händen nicht viel ausrichten konnte, so sprang ich sofort von F. gefolgt in's Wasser. Doch allen unseren vereinten Anstrengungen wollte es nicht gelingen, Thiere und Wagen aus der gefährlichen Situation zu befreien, es blieb uns nichts übrig, als die Thiere auszuspannen und mit unendlicher Mühe an das jenseitige Ufer zu bringen, sodann aus dem Wagen die Kisten mit dem heiklichsten Theile der Sammlungen hinüber zu transportiren und den Wagen im Flusse stehen zu lassen, bis Hilfe nahte. Ueber dieser anstrengenden Beschäftigung, während welcher ich auf den einzelnen Gängen zum Wagen zuletzt erliegen zu müssen glaubte, senkte die Nacht ihre dunklen Fittiche auf die Scene herab.
Es war eine traurige Nacht, die mich in steter Aufregung über das Schicksal unseres Wagens erhielt. Endlich dämmerte es im Osten und aus der Ferne vornahmen wir am jenseitigen Ufer Peitschengeknalle,—die ersehnte Hilfe nahte. Es waren vier je mit 6-8 Ochsenpaaren bespannte, von Korauna's geleitete Wägen. Ohne weiteren Aufenthalt gelangten dieselben an unser Ufer und gegen eine Entschädigung von 10 Shillingen willigten die Fuhrleute ein, unseren Wagen aus dem Flusse herauszubringen, was denn auch bald geschehen war.
Wir fuhren noch am selben Tage bis River-Town, einem der früher berühmten Diamanten-Fundorte, von welchem aus die Uferhöhen als Fortsetzung der Hebroner Höhen sich zu entwickeln beginnen. Der Fluß wird hier von mehreren Felsenriffen und riesigen Felsenblöcken durchsetzt, von welch' letzteren, einige jener Gravirungen von Thieren und Gestirnen (Säugethieren, Schildkröten, Schlangen, Sonne etc.) zeigen, mit denen sich die Buschmänner in Süd-Afrika unsterblich gemacht haben. Auch an einer der nahe anliegenden Höhen finden sich ähnliche Producte dieses Volksstammes, auf den und auf dessen Zeichnungen etc. ich bei meiner Rückreise durch die Colonie noch zurückkommen werde. River-Town war in einem ziemlich großen Umfange ausgemessen worden, ist aber, bevor noch die in Zelten Wohnenden ihre Mühe in den Diamantengruben gelohnt fanden und zum Baue stabiler Wohnungen schreiten konnten, von anderen Orten überflügelt worden, so daß wir nur zwei Familien noch diggend am Ufer des Vaalflusses antrafen; ein geräumiges Hotel und eine Segeltuchcantine waren die letzten Ueberbleibsel von River-Towns früherer Glanzperiode. Ich blieb in River-Town über Nacht und reiste erst am Nachmittage ab, da ich in den tiefen »Claims« einige interessante quarzhaltige Mineralien und so manche Coleoptera-Species an den Abhängen sammeln konnte.
Am nächsten Tage hatten wir einen so beschwerlichen Marsch, daß wir erst am folgenden in den Diamantenfeldern anlangten. Die Strecke beträgt 15 englische Meilen, allein der bei weitem größte Theil davon wird durch tiefsandige Flächen, eines der größten Hindernisse auf südafrikanischen Reisen, gebildet. Die Ebenen zeigten kaum nennenswerthe, wellenförmige Erhebungen, der stark quarz- und eisenhaltige Sand war mit hohem, büschelförmig wucherndem Gras bewachsen. Stellenweise fand ich eine kleine, kaum 2 Fuß hohe, mimosenartige Pflanze, welche große braune, mit 2-5 Körnern gefüllte Schoten trug. An Wild beobachteten wir in dem gruppenweise stehenden Niedergebüsch Deuker und Steinbockgazellen, Hasen, Tauben, Knurrhühner und Trappen; nach den vielen Löchern zu urtheilen, mußte es hier zahlreiche Erdthiere geben. Auch war die Ausbeute an Käfern trotz der Einförmigkeit der Gegend und der Vegetation eine recht lohnende.
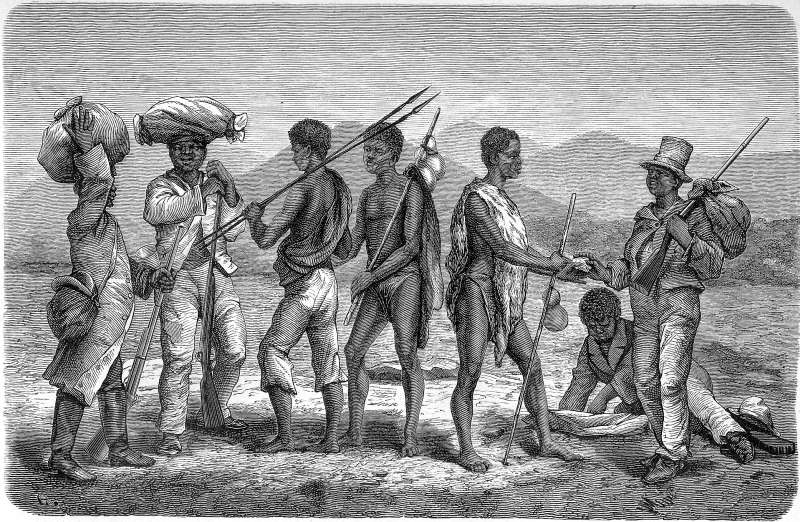
[Aus den Diamantenfeldern heimkehrende Basutos begegnen
dahinwandernden.]
Am dritten Tage nach jener trüben am Vaalflusse verlebten Nacht traf ich wieder in Dutoitspan ein. Obgleich ich mich auf das Möglichste eingeschränkt hatte, betrugen die Auslagen auf dieser ersten Versuchsreise doch mehr denn 4000 fl. Ich hatte durch meine zweimonatliche Abwesenheit die Hälfte meiner Patienten eingebüßt, und von jenen Familien, die in der Zwischenzeit nicht zu anderen Aerzten Zuflucht genommen, hatte die Mehrzahl—meist holländische Farmer—die Diamantenfelder verlassen, um sich im Freistaate anzusiedeln. Durch die Behandlung einiger schwieriger Fälle konnte ich mir nach einiger Zeit das verlorene Terrain zurückerobern und so war es mir möglich, K. sein Darlehen zurückzuzahlen, der bald nach unserer Rückreise Dutoitspan verließ, um sich in der Colonie niederzulassen.
Den Zweck und das eigentliche Ziel meiner ersten Reise, einen Ueberblick über die Art und Weise des Reisens, Einsicht in den landschaftlichen Charakter der zu durchreisenden Gegenden, Einblick in das häusliche Leben der Eingebornen und holländischen Farmer, einige Erfahrung über ihr Betragen zu Fremden u.s.w., hatte ich glücklicher Weise erreicht. Durch die Reise in der Spätsommerzeit und bei so unfreundlicher, regnerischer und stürmischer Witterung glaubte ich mich ziemlich acclimatisirt zu haben. Obgleich ich durch die häufigen Regengüsse einige der auf dieser Reise gesammelten werthvollsten Gegenstände, darunter die mühevoll präparirten Gnufelle etc., eine Unzahl von Vogelbälgen, getrocknete Pflanzen etc., eingebüßt hatte, brachte ich 30 anatomische Präparate, etwa 1500 getrocknete Pflanzen, 1 Kiste mit Mammaliafellen, 2 Kistchen Vogelbälge, über 200 Reptilien, einige Fische, 3000 Insecten, einige Fossilien und 300 Mineralien mit, ungerechnet die zahlreichen Duplicate bei letzteren, die ich namentlich aus den Diamantenfeldern am Vaal (River-Diggings) mitnahm, um daheim Museen und Schulen damit zu beschenken. Daß ich auf dieser Versuchsreise Manches gelernt hatte, versteht sich von selbst; ich sah namentlich ein, daß, um die sich oft weit verlaufenden Zugthiere rasch aufzufinden und zurückzubringen, um eine interessant erscheinende, rechts oder links in der Entfernung sichtbare oder aus diesem oder jenem Grunde von den Eingebornen als anziehend bezeichnete Oertlichkeit näher zu untersuchen, ohne den Wagen aufhalten zu müssen, um nach Wasser in wasserlosen Gegenden zu fahnden, ohne erst mit dem Wagen planlos herumzuwandern oder sich zu Fuße halbtodt zu laufen und sich zu verirren, doch auch, um sich des Wildes leichter zu bemächtigen, ein Reitpferd unumgänglich nothwendig sei; auch war es mir klar, daß ich besserer Waffen bedürfe.
Bezüglich meiner Gefährten machte ich die Erfahrung, daß E. auch für die nächste Reise mir willkommen sein würde, als Freund und Rathgeber in manchem kritischen Momente und herzlich gerne bereit, mir in allen schwereren Arbeiten nach Kräften beizustehen. Durch die reichen Erfahrungen auf seinen früheren Reisen in Amerika und Nord-Afrika, sowie durch die Erzählungen interessanter Episoden aus jener bewegten Zeit war er mir ein äußerst angenehmer Reisegefährte geworden.
Wir blieben die ganze Zeit meines siebenjährigen Aufenthaltes in Süd-Afrika treue Freunde und sind es bis zur Stunde. Von F. kann ich leider nicht dasselbe sagen, ein 17jähriger, unerfahrener Jüngling, war er nur gewöhnt, das Leben von der leichtesten Seite aufzufassen—er hatte wohl Mitleid mit jedem Geschöpfe das in Nöthen war, er nahm stets einen guten Anlauf, doch dieser gute Wille war nicht von langer Dauer etc. etc.—trotz Allem war ich ihm dankbar für Alles, was er auf der Reise für mich gethan und wofür ich ihm hiermit nochmals danke.
Freund E. ging wieder an das Diamantendiggen, um nochmals sein Glück zu versuchen, K. nahm auch sein Geschäft wieder auf und F. vermietete sich als Ladendiener, eine Beschäftigung, bei welcher er, wahrscheinlich um die Mannigfaltigkeit des menschlichen Charakters kennen zu lernen, vier- bis sechswöchentlich seinen Principal wechselte.
Als ich die Diamantenfelder verließ, um mich auf diese erste Reise zu begeben, hatte ich mein kleines Zelthäuschen, dem Gerichtsgebäude gegenüber, in Miethe behalten und zog wieder in dasselbe ein; der Wagen wurde hinter das Häuschen geschoben, und die Zugthiere sofort verkauft, um mit dem Erlöse die zweimonatliche Miethe von 10 £ St. und je 3 £ St. für die Diener zu begleichen, sowie einiges Baargeld in der Hand zu haben, da ich von allen Mitteln entblößt nach den Diamantenfeldern zurückgekehrt war.
Obgleich nur von sechsmonatlicher Dauer—war doch dieser Aufenthalt eine sehr bewegte Zeit für mich. Es gibt wenige Orte der Erde, wo der Arzt nicht allein als solcher, sondern auch als Freund seiner Patienten angesehen und angesprochen wird, und so ist es ihm ermöglicht, interessante psychologische Studien zu machen; die Beschränktheit der Räumlichkeiten, namentlich in der ersten Periode der Diamantenfelder, in denen die Kranken wohnen mußten—selbst bei Wohlhabenden oft eine zahlreiche Familie in einem Zelte—macht es ihm möglich, nolens volens das häusliche Glück, die edlen, schönen Seiten des häuslichen Lebens, doch leider auch manch' trübe und traurige, manch' herzerschütternde Scene zu beobachten. Und aus dem Arzte mußte der Rathgeber, aus dem Arzte mußte der Fürsprecher werden, zuweilen sah er sich selbst zu Zurechtweisungen veranlaßt, wenn es auch oft allen Muth erforderte—mehr Muth als im Kampfe mit einem wilden Thiere, an ein in Jahren vorgeschrittenes, an ein graues Haupt mahnende, warnende Worte richten zu müssen.—Was ich während meines Aufenthaltes in den Diamantenfeldern erlebt und beobachtet, hätte mir die reichste Praxis in dem hundertthürmigen Prag nicht im vierfachen Zeitraume bieten können.
Ein eigentümlicher Fall verhalf mir wieder zum großen Theile zu meiner ehemaligen Praxis. Eines Morgens, etwa um 5 Uhr wurde ich—wie es sich später herausstellte irriger Weise statt eines anderen Arztes—zu einem Unglücklichen gerufen, der sich im Delirium tremens die Kehle durchschnitten hatte. Meine Verlegenheit in diesem Falle war keine geringe, da der größte Theil meiner chirurgischen Instrumente auf der Reise in Folge ihrer Verwendung zu nichts weniger denn chirurgischen Operationen, zerbrochen oder unbrauchbar war. Doch zum Ueberlegen war keine Zeit, der Mann drohte zu verbluten, und so lief ich mit dem Boten um die Wette.
Ich fand einen ältlichen Mann in seinem Blute liegend mit einer klaffenden, 13 Zentimeter langen Halswunde, die er sich mit einem Rasirmesser beigebracht hatte. Nach den zwei Schnitten hatte der Mann noch dreimal in die so entstandene klaffende Wunde das Messer angesetzt, so daß der Kehlkopf im Ganzen fünf Schnitte zeigte.[1] Meinen aufopfernden Bemühungen und meiner Pflege gelang es aber zu meiner größten Befriedigung den Mann dennoch zu retten, trotzdem er nach den ersten drei Tagen in einem Deliriumsanfalle sich den Nothverband herabgerissen hatte.
Da sich meine Patienten englischer Nationalität mehrten, sah ich mich nun genöthigt, mich mit Eifer auf das Studium der englischen Sprache zu werfen. Ein Drittel meiner Kunden waren Deutsche, ein Drittel machten die Holländer aus, ein Viertel der Patienten waren Engländer und den Rest bildeten Eingeborne, Halfcasts aus der Colonie, Koranna's Fingo's, Basuto's und Zulu's. Die Medicamente für meine Kranken bezog ich aus der Apotheke eines Engländers, mit Namen Anthony Davison, dem ich auch seiner prompten Bedienung wegen, während meines Gesammtaufenthaltes in den Diamantenfeldern treu geblieben bin.
Die Basuto-, die Zulu- und die Transvaal-Betschuanastämme stellten damals das größte Kontingent zu den Tausenden der in den Diamantenfeldern sich als Diener verdingenden Schwarzen. Sie bekamen 7 Sh. 6 P. bis 10 Sh. per Woche und die meisten blieben nur sechs Monate in den Feldern, um, nachdem sie um 3 Sh. bis 4 £ St. ein Gewehr, dann um 15 Sh. fünf Pfund Schießpulver, etwas Blei und Kapseln, sowie eine oder zwei Wolldecken, oder einen Hut etc. erstanden hatten, heimzukehren und sich daheim eine Lebensgefährtin zu kaufen. Jeder der Diener war seinem Herrn durch einen, von einem eigens dazu angestellten Beamten ausgefüllten Schein zum Dienste verpflichtet, den er bei jedesmaligem Platzwechsel erneuern mußte, und ohne den angetroffen, er einer Strafe verfallen war. Hatte er sich gut betragen und wollte er heimgehen, so gab ihm sein Herr auf Ansuchen einen Zettel an die Magistratsbehörde, von der dann für den Diener ein Waffenschein ausgestellt, d.h. ihm die Erlaubniß ertheilt wurde, sich ein Gewehr zu kaufen. Auf diese Weise hatten sich Tausende von den sowohl in der Kolonie als in ihren eigenen, unabhängigen Staaten wohnenden Eingebornen Schießwaffen verschafft.
Ich erwähnte der Basuto's unter den obigen Stämmen. In den Jahren 1872 und 1873 bildeten sie wohl als Diener das größte Contingent unter ihren dunkelhäutigen Stammesverwandten. Es sei mir gestattet, ihnen hier einige Worte zu widmen, um so das allgemeine Bild der Bantufamilie zu vervollständigen. Ich unterscheide in Süd-Afrika drei Eingebornenracen, die Buschmänner, die Hottentotten und die Bantu's. Zu der ersteren gehören die eigentlichen Buschmänner, zu der zweiten die eigentlichen Hottentotten, die Griqua's und die Koranna's, zu der dritten die Colonial-Kaffern, die Zulu's, Basuto's, Betschuana's, Makalaka's etc., mehr als 40 Stämme, doch kennen wir auch Uebergangsformen, wie zwischen den Buschmännern und den Bantu etc. Obgleich es dieser Stoff verdienen würde, gründlich behandelt zu werden, habe ich weder Raum noch Zeit, es hier zu thun.[1] Von den obgenannten Familien hatten wir bisher theilweise die Koranna und zwei Stämme der Batlapinen kennen gelernt. Die Basuto's (ihre Sprache heißt »Sesuto«) wohnen zum größten Theile an dem Cornetspruit und am Caledon-River, zwischen diesen und den Dracken-Bergen, also auf einem Gebiete, das vom Freistaat, vom Capland, Normansland und Natal begrenzt wird. Sie leben unter englischer Oberhoheit und dies seit ihrem Kriege mit dem Oranje-Freistaat, während ein zweites Bantuvolk, die südlichen Barolongen, als ihre westlichen Nachbarn, Unterthanen der Oranje-Republik sind.
1 Während meines Aufenthaltes in London im Jänner bis März 1880 von der Anthropological Institute of Great Britain and Ireland aufgefordert, über diesen Gegenstand zu sprechen, behandelte ich dieses Thema in einem speciellen Vortrage.
Unter allen Bantustämmen haben es die Basuto's in Bezug auf den Ackerbau am weitesten gebracht. Ihnen zunächst stehen die Baharutse im Maricodistrict der Transvaal-Colonie, deren ich auf meiner zweiten Reise gedenken werde. Hunderttausende Centner Getreide werden in dem kleinen Ländchen in guten Jahren producirt und man muß zugeben, daß diese Stämme jährlich an Wohlhabenheit zunehmen. Sie besitzen auch große Heerden von Pferden und Rindern.
Als sich letzthin der südlichste der Basutohäuptlinge, der allerlei unruhige Elemente, weggelaufene Diener, Diebe, aus dem letzten Kaffernkriege flüchtige Gaika's und Galeka's etc. bei sich aufnahm, gegen die Engländer erhob und den Krieg mit Diebstahl eröffnete, waren es die übrigen Basuto's, die freiwillig 2000 bewaffnete Reiter in's Feld stellten, um den Engländern beizustehen. In der Bauart ihrer Hütten und in den übrigen Arbeiten kommen sie bis auf wenige unbedeutende Abweichungen den Betschuana's gleich, und nehmen in der eigenen Industrie etwa die Mittelrolle unter den Bantuvölkern ein. Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale ihrer Industrie von jener der übrigen Bantustämme ist, daß sie aus Holz geschnitzte Fetische (Götzenbilder) verfertigen und diese meist roth und schwarz tünchen. Thaba Bosigo ist der bedeutendste Kraal (Stadt) des Landes und Thaba Unschu jener des von den Barolongen im Freistaate bewohnten Striches. Gegen Norden sind die Basuto's bis an die Vereinigung des Tschobe und Zambesi vorgedrungen.

Nach Musemanjana—Moschaneng—Molopolole—Schoschong—und Rückkehr über Linokana nach den Diamantenfeldern.
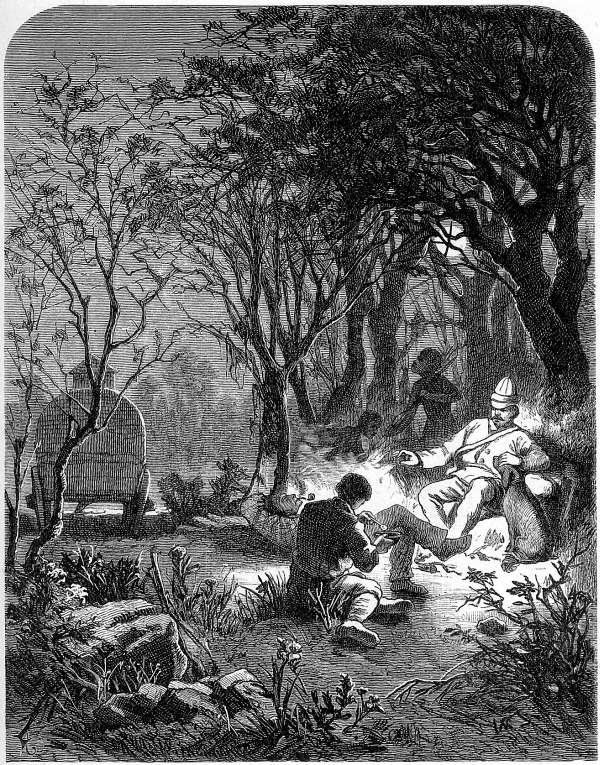
Von Dutoitspan nach Musemanjana.
Vorbereitungen und Ausrüstung zur Reise.—Meine diesmaligen Reisegefährten.—Aufbruch von Dutoitspan.—Klipdrift.—Platberg in Gefahr.—Diamantenfund.—Afrikanische Wegmauth.—Hebron.—Wassermangel.—Ein Grasbrand auf der Hochebene.—Hartebeest-Antilopen.—Ein theuerer Labetrunk.—Gassibone's Kraal.—Rigers Abenteuer mit einer Cobra.—Taung.—Ein Holländischer Schmied.—Reverend Brown und die Missionsstation in Taung.— Maruma.—Monkey's Freuden und Leiden.—Eine dornenvolle Jagd.—Billige Diamanten.—Von Pavianen genarrt.—Unser Empfang in Musemanjana.

[Ein Broddieb.]
Während meines sechsmonatlichen Aufenthaltes machte ich unter anderen Bekanntschaften (unter meinen Patienten) auch die dreier mit einander nahe verwandter deutscher Familien, welche, um mir ihre Dankbarkeit für einige gelungene Curen zu beweisen, mich aufforderten, mir ein Häuschen in ihrem Hofe zu bauen, wohl in meiner Office, wo ich bisher wohnte, zu praktiziren, allein in dem ersteren zu wohnen, damit ich eine bessere Kost etc. und andere Bequemlichkeiten genießen und mich auch besser für meine zweite Reise vorbereiten könnte. Ich nahm ihren gütigen Antrag an, und wohnte etwa zwei Monate unter ihnen, gerade die Zeit vor meiner zweiten Abreise in's Innere. Ich betrachtete die Sprossen dieser Freunde als meine Brüder und Schwestern und wir haben immer dies freundschaftliche Verhältniß zu einander bewahrt. Sie waren mir alle zu den Vorbereitungen zur Reise behilflich, und als ich, bis auf 120 £ St., die gesammten Kosten (gegen 900 £ St.) für diese Reise zurückgelegt hatte, da wurde es mir durch die Güte des einen der drei Familienväter ermöglicht, Güter zu denen, die ich schon für baares Geld erkauft hatte, von einem der Handelshäuser in Dutoitspan im Werthe von 117 £ St. geliehen zu erhalten, und schon vier Wochen vor der anberaumten Zeit die Reise antreten zu können.
Diese Güter bestanden in Schießmaterial, baumwollenen gefärbten Decken, Tüchern, Kleidern und Draht, und ich gedachte die Objecte als Tauschgegenstände zu benutzen, um uns, wenn nöthig, Nahrung zu verschaffen, hauptsächlich aber, um ethnographische Gegenstände und Carossen aus verschiedenen Thierfellen für meine Sammlungen zu erstehen.
Seitdem sich die Diamantenfelder zu purificiren begannen, viele Elemente ausschieden und nur jene geblieben waren, die auf einen längeren Aufenthalt vorbereitet, sich wohnlich eingerichtet hatten, seitdem die gesetzlichen und socialen Verhältnisse einen Umschwung zum Guten erfuhren, haben sich die Central-Diggings einer europäischen Großstadt genähert. Früher herrschte zwar auch der Luxus der letzteren auf der traurigen Ebene zwischen dem Modder- und Vaal-River, allein dieser Luxus wohnte in Zelten und elenden Bretter- und Eisenhütten und war mehr Waare als Gegenstand ruhigen und praktischen Genusses.
Im Jahre 1873, eben nach meiner Rückkehr von der ersten Reise, griff eine lebhafte Auswanderung nach den Goldfeldern im Leydenburger District der Transvaal-Republik um sich, und dies namentlich, weil aus dem letzteren Staate sehr gute Nachrichten über die Goldfelder einzulaufen pflegten, und die Regierung der Transvaal-Republik mit der Idee der Delagoa-Pretoria-Eisenbahn sich zu befassen begann. Diese Nachrichten ermuthigten Viele, nach Leydenburg zu pilgern und Golddiggers zu werden, ihnen schloß sich eine große Zahl, der aus allen Erdtheilen meist mit kleinen Baarschaften Zugewanderten an, die sich in den Diamantenfeldern arm »gediggt« oder ihre Mittel zu gutem Theile vertrunken oder verspielt hatten und daher begierig die Idee aufnahmen, an einer anderen Stelle dem in Australien, Amerika, Neu-Schottland etc. vergebens gesuchten Glücke wieder nachjagen zu können.
Je näher die Zeit des beabsichtigten Aufbruches rückte, desto eifriger und umfangreicher wurden die Vorbereitungen betrieben. So wurde der Wagen mit neuen Eisenbändern versehen, und um das Brechen der Dachleisten—denn meine zweite Reise sollte mich durch bewaldete Partien führen—zu verhüten, ein Eisendrahtnetz zwischen drei wasserdichte Leinwandlagen eingelegt, was sich jedoch, sowie ein kleines Aussichtsthürmchen, das am Wagen angebracht wurde, später auf der Reise als unnöthig erwies. Ich selbst benützte die Zeit, um mich in der Reitkunst zu üben; an Gelegenheiten, meine Fertigkeit in dieser Hinsicht zu erproben, sollte es auf der zweiten Reise nicht fehlen. Die ungesunde Jahreszeit forderte auch bei mir ihren Tribut, ich verfiel in ein heftiges Fieber, von dem ich mich nur allmälig erholen konnte, und welches mich veranlaßte, die Abreise aus den Diamantenfeldern thunlichst zu beschleunigen.
Freund E., der in der Old de Beers-Mine sein Glück als Diamantendigger, allein mit immer gleichem Mißerfolg erprobte, willigte ein, mich auch auf dieser zweiten Reise zu begleiten. Er wollte auch ein Stückchen mehr von Afrika sehen und nach seinen Worten »mir helfen wo er konnte«. Ich bat ihn, die Oberaufsicht über den Wagen zu übernehmen (wie auf der ersten Reise), was er auch that, und derselben in der besten und redlichsten Weise gerecht wurde.
Die zweite Reise sah ich keineswegs als meine Hauptreise an, sondern als eine zweite, doch größere Versuchsreise, auf der ich wenigstens die Hälfte der Strecke zwischen den Diamantenfeldern und dem Zambesi zurücklegen und neue Erfahrungen für meine geplante große Reise nach Central-Afrika sammeln wollte.
Unter meinen früheren Patienten befand sich auch ein junger Mann aus Preußisch-Schlesien, der gewillt zu sein schien, mich auf dieser zweiten Reise zu begleiten. Doch eines schönen Tages, nachdem ich für ihn bei seinen Gläubigern gutgestanden und einen Theil seiner Verpflichtungen getilgt, war er auf Nimmerwiedersehen verschwunden, mir es überlassend, seine Gläubiger zu befriedigen. Es war dies eine der gewöhnlichen Erfahrungen in den Diamantenfeldern, die damals noch ein Heer zweifelhafter Existenzen beherbergten.
Durch Freund Eberwald's Fürsprache ließ ich mich trotz aller meiner schlimmen Erfahrungen mit F. erweichen, ihn wieder als Begleiter auf die Reise mitzunehmen. Als dritten Gefährten brachte Freund E. eines Tages einen seiner Bekannten, Herrn Boly aus Hannover mit und sprach sehr zu seinen Gunsten; ich habe es später nie bereut, daß ich ihn acceptirte. Einer meiner Kunden hatte mir ein Gespann von acht Ochsen und einen Griqua als Triber besorgt.
Im Allgemeinen war ich diesmal viel besser ausgerüstet als auf der ersten Reise, ich hatte auch einen Sextanten erstanden, in dessen Gebrauch mich ein gewesener Schiffsofficier unterrichtet hatte; leider war es mir nicht vergönnt ihn benützen zu können, da ich auf keine Weise ein Exemplar des »Nautical Almanach« auftreiben konnte.
Am 3. November verließ ich endlich in Begleitung von Herrn Eberwald, Boly, F. und einem Griquadiener, sowie neun Hunden, darunter meinem treuen Niger, meinem Reitpferd und acht Zugthieren die Diamantenfelder. Von Dutoitspan nahm ich den kürzesten Weg nach Klipdrift; von Klipdrift jedoch wollte ich bis Hebron, im Vaal-Thale aufwärts fahren und von Hebron querfeldein die Richtung nach Gassibone's Stadt und dann weiter nach dem von mir noch nicht besuchten Taung, dem Sitz des Batlapinenkönigs Mankuruan nehmen. Ich wollte auf diese Weise ein Stück des rechten Vaalufers besuchen, das mir noch neu war und Gassibone's Land von Süden nach Norden durchschneiden, während ich es auf der ersten Reise von Westen und Ostsüdost durchzog. Unseren ersten Reisetag beschlossen wir an der Old de Beers-Farm.
Am folgenden Morgen ausbrechend, gelangten wir zu einem Trümmerhaufen, einige Meilen vor den Ruinen eines Missionsgebäudes in der Nähe der jetzigen Pnieler Missionsstation gelegen, deren bereits Erwähnung geschah. Auf dieser Strecke beobachtete ich eine Niederung in dem Hochplateau, bevor wir noch seinen Abhang nach dem Vaal zu abzusteigen begannen, in einen Binnensee von etwa 1½ Meilen Länge und Breite verwandelt. Zahlreiche schwarze Störche und Kraniche liefen am Rande des Gewässers umher. Als ich mich ihnen mit Niger näherte, folgte dieser einer Spur in den Binsen am Ufer, blieb dann plötzlich stehen und machte mich durch sein Wedeln auf ein kleines Binsendickicht aufmerksam, ich machte mich schußbereit, gab dem Hunde das Zeichen und er sprang vorwärts; mit ihm zugleich sprang ein rothlöffliger Hase aus den Binsen, der unseren ersten Mittagstisch auf dieser Reise bereicherte. Wir benützten auf der Weiterfahrt die neue, unmittelbar über dem Flusse von den Sträflingen in den Felsen gehauene Straße und wichen so dem tiefen Sande auf dem Hochplateau, der uns auf der ersten Reise so viele Schwierigkeiten bereitet hatte, aus; Abends hatten wir jene Stelle erreicht, an der wir im Februar 1873 eine schlimme Nacht verlebt hatten.
Am folgenden Morgen wollte ich in den Büschen der Umgebung jagen, wurde aber bald durch F. zurückgerufen, der mir berichtete, daß bei dem Tränken der Zugthiere, die zeitlich früh von Pit, unserem Griquadiener, auf die Weide getrieben waren, eines derselben bis zum Halse im Ufer-Schlamme eingesunken sei. Nur B. am Wagen zurücklassend eilten wir zur Stelle und fanden »Platberg«, eines unserer Zugthiere in einer schrecklichen Lage. Es war ein hartes Stück Arbeit, das Thier aus seiner mehr denn ungemütlichen Situation zu befreien, doch gelang es; der Tag war indeß verloren, da wir dem an den Füßen fast erlahmten Thiere Erholung gönnen mußten.
Am nächsten Tage hoffte ich das Versäumte nachholen zu können und brach mit Morgengrauen auf. Die Fahrt ging flott von statten, denn zu meiner Ueberraschung fand ich die Straße seit meiner ersten Recognoscirungstour in bedeutend besserem Zustande. Nach sechsstündiger Fahrt standen wir am Ufer des Vaal.
Bevor ich noch den Fluß in Klipdrift erreichte, hatte ich den Verlust zweier Hunde zu beklagen, einer war während unseres nächtlichen Aufenthaltes am Flusse, wohl zur Tränke gelaufen und da wahrscheinlich von einer Hyäne getödtet worden, der zweite kam nahe an Klipdrift unter das Wagenrad und wurde getödtet.
Der Fährmann am Vaal verweigerte uns den Dienst, indem er bei dem niedrigen Wasserstande und dem Gewichte meines Wagens mit dem Boote aufzufahren befürchtete; er verwies uns auf eine flußabwärts befindliche Furth. Nach den unerquicklichen Erfahrungen des Ostersonntags, hieß es mit aller Vorsicht diese Furth untersuchen. Der Vaalfluß war bis auf eine kaum sechs Meter breite und ½ Meter tiefe Rinne ausgetrocknet, diese Stelle war sandig, doch der übrige Theil des Bettes ein einziges aus kopfgroßen und noch bedeutend größeren Grünsteinblöcken gebildetes Gerölle. Ohne jeglichen Unfall wurde der Fluß übersetzt und in der Nähe von Klipdrift gelagert. Während der Rast überraschte mich Pit mit einem etwa ¼ Karat schweren Diamanten. Während die Ochsen grasten, lag er stundenlang auf der Erde und durchsuchte den ausgesiebten Sand, der schon früher von den Diamantengräbern ausgebeutet worden war. So hatte er das Steinchen gefunden, ich nahm es an, um es meiner Sammlung einzuverleiben, später verlor ich es auf eine mir unerklärliche Weise.

[Platberg's Befreiung aus dem Schlamme des Vaal.]
Wir brachen noch am selben Abende auf und fuhren eine steinige Höhe hinan, auf der oben eine, dicht von jauchzenden, d.h. betrunkenen Korauna's umlagerte Cantine stand. Der wiederholte Zuruf »Wach mit det wagon, Wach« machte uns stutzig und bewog mich, anhalten zu lassen. Es dauerte nicht lange und von rechts und links erschien ein durch das Nachlaufen, doch auch von einem nicht zu seltenen Genusse des gambrinischen Gebräues geröthetes Gesicht; das plötzliche Emportauchen der zwei fleischigen mit mehreren dunklen Punkten und Stellen markirten Gesichter war von einem mit heftigen Athembewegungen und Hustenausbrüchen unterbrochenen Redeschwall begleitet. Von der einen Seite klang es holländisch, von der andern englisch, was wollten eigentlich die beiden Kerle? Pit war der erste, der die anscheinend hochtönenden in Wahrheit aber unverständlichen Phrasen aufzufassen vermochte. Der eine war der Sheriff (Polizeibeamte), der zweite ein Policeman, die »Herren« kamen nachgelaufen, um 10 Shillinge Schadenersatz für den Mann zu fordern, dessen Grund und Boden unsere Zugthiere während unseres Aufenthaltes bei Klipdrift so schrecklich zugerichtet haben sollten. Ich müsse die 10 Shillinge begleichen, sonst würden sie mich nicht einen Schritt weiterziehen lassen. Obwohl ich mir bewußt war, daß die beiden übereifrigen Diener der Gerechtigkeit eine plumpe Finte gebrauchten, willfahrte ich ihren Forderungen; wir hatten ihnen kaum den Rücken gekehrt, als F., den das Schicksal der 10 Shillinge beunruhigte, uns aufmerksam machte, daß die beiden Gehilfen der heiligen Hermandad in der Cantine verschwunden waren, um hochstwahrscheinlich auf das Wohl des durch unsere Thiere geschädigten Grundherrn ein Gläschen Brandy zu leeren.
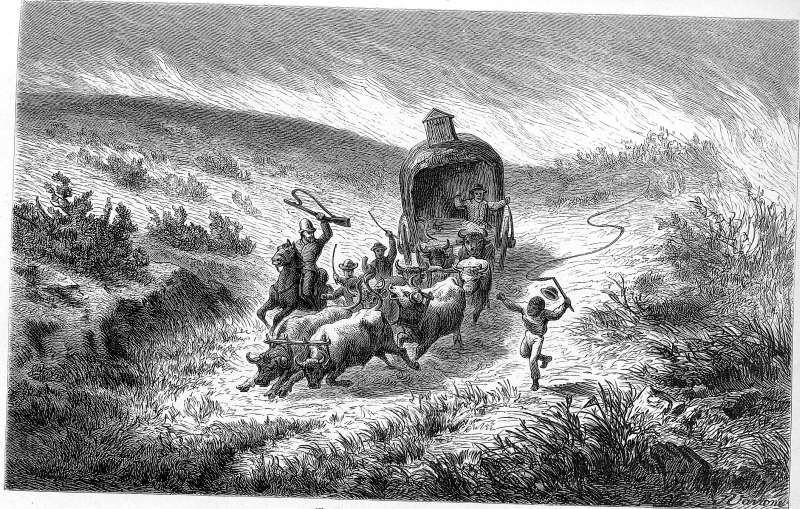
[Grasbrand auf der Hochebene.]
Wir fuhren bis spät in die Nacht hinein, wobei wir uns von dem zur Rechten nach Südsüdosten einen Bogen beschreibenden Vaalflusse entfernten. Die bereiste Gegend waren bebuschte, steinige Höhen, die oft von meilenlangen, ebenen Alluvialflächen gekrönt oder von solchen, allmälig gegen den Fluß abfallenden Strecken von einander getrennt waren. Zahlreiche Feuer an beiden Seiten wiesen auf Korannagehöfte hin, aus den näheren konnten wir das deutliche Geblöke der Böcklein und Ziegen hören. Diese Gehöfte schienen alle am Abhange der Höhen, gewöhnlich in einem Winkel, an vor Nord- und Nordwestwinden geschützten Stellen zu liegen. Wir begegneten noch zu solch' später Stunde zwei Halfcastmännern, die von der Transvaal-Republik nach Klipdrift wanderten und da sie uns auf zwei tiefe Regenschluchten, die wir bald zu durchschreiten gehabt hätten, aufmerksam machten, hielt ich es für das Gerathenste, nicht weiter die Götter zu versuchen, sondern hier unser Nachtlager aufzuschlagen. Bald loderte ein lustiges Feuer und prasselte und sang mit unseren aufthauenden Lebensgeistern, ja auf F. wirkte dieses und der duftende Mocca so mächtig ein, daß er sich während des Nachtimbisses feierlich erhob und den gefüllten Blechbecher hochhaltend, einen Toast auf die in Klipdrift weilenden Gerichtsmandarinen des 25. Ranges ausbrachte; in welchen die Runde, das Blaßgesicht wie der Schwarze einstimmte, daß die Becher hell in die stille Nacht hinein zusammenklangen.
Am 7. November blieb die Scenerie gleich der, die wir am Abend zuvor beobachtet, nur hatten wir darüber zu klagen, daß kein Wasser in der Nähe des Weges gefunden werden konnte, die mitgenommene Quantität war am Abend, Morgen und Mittag verbraucht worden und wir konnten früher denn am Flusse auf keines hoffen.
Gegen 4 Uhr langten wir in Hebron an, wo wir uns jedoch nicht aufhielten, sondern blos durchfuhren, um noch bei Tage zu der Stelle zu gelangen, wo ich den Hebron-Christiana-Weg verlassen und querfeldein nach Gassibone zu einhalten wollte. Seit den wenigen Monaten, die während meines ersten Besuches des Ortes verflossen, waren die Ueberreste der einst blühenden Stadt noch mehr zusammengeschmolzen. Der schlechte Zustand des Weges gebot uns bald Halt. Ein junger Batlapine, dem wir begegneten, offerirte sich uns am nächsten Morgen als Führer. Gegen Mittag hielten wir unter dem Schatten eines breitkronigen Mimosenbaumes unsere gewohnte Siesta und schlugen endlich, nach mehrstündigem Marsche unser Nachtlager mitten auf der Hochebene auf.
Es war eine herrliche, eigentümlich anmuthende Scenerie, die sich uns hier bot. Nach Süden und Westen umrahmten die Hebroner Höhen und ihre dunklen von Purpurschimmer übergossenen Ausläufer den Horizont, der nach Norden und Osten die unabsehbare Ebene in wunderbar dunkler Färbung überlagerte, und ein sicherer Vorbote einer, wenn wolkenfreien, so überaus schönen südafrikanischen Nacht war. Ein leiser Windhauch bewegte um uns das blumenreiche, hie und da von dunkelgrünen, gruppenweise zusammenstehenden Büschen überschattete Gras, dessen Keime der Wind gesäet, das flüchtige Wild in den Boden gebettet und das im Sommer die unabsehbare Ebene mit einem grünen duftenden Teppich überzieht und im Winter kaum je von weichem flockigen Schnee gedeckt wird,—nur die gelblich-braune Färbung der Halme läßt uns erkennen, daß die Sonne dem Norden zulächelt. Bald züngelt es überall unter und zwischen dem dicht übereinander gelagerten trockenen Gezweige und die Flämmchen zu einer Flamme sich vereinigend, streben nach einer Seite hin—nach Nordnordost. Ob etwa nach der trauten Heimat zu? Der leise Abendwind, der sie angefacht, eilt heute nach jener mir liebsten, nach jener gesuchten Richtung hin, nach welcher so oft unwillkürlich das Auge in banger Sehnsucht schweift. Das Feuer, die Ebene, Gassibone's Land, Afrika, sind vergessen, das Ohr hört nur zeitweilig menschliche Laute, Laute, die der Gedanke sofort mit der fernen Heimat verknüpft. Ein schwarzer, vor dem mein Auge blendenden Feuer vorbeihuschender Schatten—es war der unseres jungen Führers—gibt mich der Gegenwart zurück. Es war ein friedlicher Abend, ihm folgte eine friedliche Nacht, ein Gegensatz zu der letzten, eine gute Rast, gleichsam eine Stärkung für das, was uns Ahnungslose am nächsten Tage erwartete.
Die Zugthiere, die etwas abseits grasten, kamen von selbst herbeigelaufen und lagerten sich in des Wagens Nähe, während wir unsere Decken in das duftende Gras werfend, weich gebettet, und überwoben von den überhängenden zarten Stengeln, Rispen und Blüthen, bald in den wohlverdienten Schlummer fielen. Zeitlich machten wir uns nächsten Morgens auf den Weg. Nach des Führers Worten schätzte ich die Entfernung bis zur Stadt des Batlapinenkönigs auf 35 englische Meilen; was uns jedoch etwas erschreckte, war, daß der Führer die Wassernoth der zu bereisenden Gegend eingestand. Wir mußten uns auch den Tag über damit begnügen, Wasser für das Mittagsmahl gefunden zu haben, ein Labetrunk blieb ein unerreichbarer Wunsch.
Oft bei Nord-Richtung verfolgend zogen wir bald weiter und mußten wohl den von unserem Führer bezeichneten, monatelang Regen entbehrenden Strich erreicht haben, denn je weiter wir zogen, desto gelblicher und trockener wurde das Gras. Trotz des vorgeschrittenen Frühlings konnten wir anfangs nur wenig, weiterhin gar keine neu aufgesprossenen Halme sehen, nur selten gewahrte das Auge die erste, doch in Folge der Dürre schon halb vertrocknete Blattanlage der Amarillys.
Wir zogen allmälig bergaufwärts auf eine kleine Plateauhöhe; je höher wir kamen, desto seltener wurden die Büsche, desto dürrer die ganze Vegetation. Aus Nordwest erhob sich ein ziemlich starker Wind, der sausend durch die hohen Grasstengel fuhr, daß sich diese wie ein Saatfeld bogen und hoben, und der uns höchst willkommen war, denn er linderte die große Hitze und kühlte unsere brennenden Lippen. Die Zugthiere, die 30 Stunden zuvor zum letzen Male getrunken hatten, kamen nur sehr langsam vorwärts, wir konnten sie auch nicht in solcher Hitze antreiben, da es bergan ging; seit zwei Stunden folgten wir einem Fußpfade und unser Führer meinte, daß wir, auf dem höchsten Punkte des Plateau's angelangt, uns etwas nach rechts wenden müßten (West bei Nord) und da auf Wagenspuren stoßen würden, da der Morena (König) zuweilen jene Strecke mit Wägen befahren lasse—um Holz nach den Diamantenfeldern zu bringen. Wenn wir dann ohne zu halten bis in die Nacht den Spuren nach links folgten, würden wir zu den erwähnten Eingebornenhütten kommen. Das war für uns halb Verdurstete eine trostlose Aussicht.
Während einer kurzen Rast am Abhange des Hochplateau's wurden wir auf eine dunkle, lange Zeit hindurch gleichsam unmittelbar über dem Plateau schwebende Wolke aufmerksam, die von meinem Diener, von dem gemietheten Führer, wie auch von uns allen als ein riesiger Heuschreckenschwarm angesehen wurde. Am Rande der Hochebene angelangt, schreckte mich plötzlich ein von den Gefährten im Wagen ausgestoßener Schrei aus meinen Träumereien.—Ein Anblick, der mir und meinen Freunden einen Schrei des Entsetzens entlockte, bot sich uns.—Die vor uns liegende, mit hohem, trockenem Gras und Gebüsch bedeckte Ebene, die wir durchziehen sollten, war ein Flammenmeer. Der Brand kreuzte unsere Wegrichtung und war 5-6 englische Meilen weit entfernt, die graue Wolke, die wir eine Stunde zuvor erblickt, waren die aufsteigenden, nach Ostsüdost getriebenen, dichten Rauchmassen. Der erste, der sich erholte, war der dunkle Führer, der uns auf die kaum 20 Schritte entfernten Wagenspuren aufmerksam machte, welche nach seiner Beschreibung mitten durch das Feuer führten. Wir hatten uns auf 600 Schritte dem Feuer genähert, das nach rechts bis an einem sozusagen parallel mit denselben laufenden Höhenzuge reichte, das Land war nach dieser Richtung hin eben; nach links senkte sich das Plateau nach der rechten Feuerflanke in eine etwa 300 Schritte breite Mulde, an deren Ende das Feuer eben zu nagen begann; diese Mulde lag im Hochplateau und war nach links von einem nach Norden felsig und steil abfallenden, etwas bebuschten, etwa 40 Fuß hohen Hügel begrenzt, der zugleich den nördlichen Abfall der Plateau-Erhebung bildete, die wir eben erreicht hatten. Was war zu thun! Rasches, sofortiges Handeln war nöthig. Wir mußten dem Feuer zu entkommen, und unsere schreckliche Wassernoth berücksichtigend, deßungeachtet vorwärts nach dem Wasser zu gelangen trachten. Die Zugthiere waren auch zu müde, um einen sofortigen Rückzug nach Süden oder Osten nach dem Vaalflusse zu nehmen, nach Osten war es auch wegen dem rasch vorwärts schreitenden Feuer nicht möglich, um so weniger, da die Zugthiere eine Hetzjagd durch das Gras wohl auf eine Meile, allein kaum auf 10 oder 15 Meilen aushalten konnten, und eine solche wäre nach Osten unvermeidlich gewesen.
Es blieb nichts übrig als vorwärts zu kommen; ja, vorwärts, allein wie, um dem Feuer auszuweichen, vom rasenden Elemente verschont zu werden? Das Gras um uns abzubrennen und so das Feuer zu erwarten war unmöglich, weil wir nebst einigen tausend Patronen 300 Pfund Schießpulver am Wagen hatten, unmöglich, weil die Wagenleinwand und das Holz durch die sengende Sonnenhitze erhitzt, kaum das Anlegen der Hand gestattete und von den vom Winde fortgetragenen brennenden Zweigen und glühenden Blättern leicht in Brand hätte gesetzt werden können und wir wohl Spiritus und Branntwein, aber kein Wasser mit uns führten. Mein Blick blieb an dem Hügel zur Linken hasten, wäre es möglich, da unten in der Schlucht durchzukommen?—Bis jetzt schien das Feuer etwa 300 Schritte von dem Hügel entfernt, doch es näherte sich uns wie dem Hügel, wenn auch dem letzteren, weil dieser etwas aus der Windrichtung lag, weniger schnell. Ja, wenn wir nur mit dem Wagen schon an dem Hügel in dem noch freien Zwischenraume angelangt wären, und so das Feuer, das etwa 100 Schritte breit war, umfahren hätten können.
Hinter dem Feuermeere breitete sich eine meilenweite, schwarze Fläche, das abgebrannte Feld, aus, über welche hie und da Flammen, die Ueberreste eines brennenden Busches aufflackerten. Meine den Gefährten mitgetheilte Ansicht fand einstimmigen Beifall. Der dunkle Diener begriff es »a Bass sol dun« und der Blick seines dunklen Auges zeigte, daß er sein Bestes thun wolle, um die Zugthiere in der angegebenen Richtung zu führen und in derselben zu halten.
Nun erst, nachdem ich mich auf mein Pferd geschwungen hatte, ließ ich meinen Blick über die Strecke schweifen, die wir zu durchfahren, nein,—zu durchfliegen hatten. Ich konnte mich eines Ausrufs nicht enthalten, denn die circa 1000 Schritt messende Entfernung (bis an den Hügel) war ein mäßiger, in den unteren Partien etwas steiler, mit niedrigen Büschen und Gras bewachsener, und mit Felsblöcken übersäeter Abhang; wie, wenn ein Rad bei dem raschen Fahren an einem der braunen Steine zerschellen würde?—Doch ich hatte keine Zeit zum Denken, meine Gefährten hatten ihre Posten eingenommen, Boly schwang die Peitsche und gab mit dem gebräuchlichen »Fat an« das Zeichen zur schleunigen Flucht—dem Feuer entgegen, um dem Feuer zu entrinnen.
Durch das Geschrei, Hiebe mit Peitsche und Aesten, doch auch durch den grauenhaften Anblick der Feuerwoge zur Rechten angetrieben, der wir mit jedem Schritte näher kamen, jagten die Ochsen mit ihrer Last, wie mit einem leeren Karren dahin. Oft wähnte ich, daß der Wagen schon auf der Seite liege, so hoch kam zuweilen ein Rad auf einen der Felsenblöcke, während die beiden Vorderräder im nächsten Momente gegen das Gestein so heftig anfuhren, daß die Stangenthiere durch den Anprall niedergeworfen wurden. Die Hitze wurde unerträglich, da wir noch immer den Wind gegen uns hatten, das Prasseln des trockenen Grases und der Büsche, von denen jedoch die meisten grünten, erfüllte die mit dichtem Qualm und brennenden Grasstengeln, Aestchen, Blättern etc. geschwängerte Luft mit einem sinnebetäubenden Getöse; das Pferd, das ich auf dieser Reise ritt, war kein scheues Thier, allein der Anblick zu seiner Rechten machte es wild und unbändig, daß ich es kaum bemeistern konnte.
Doch wir rasten weiter. Mehrmals stolperte mein Reitthier an Felsen und fiel gegen Büsche an, denn ich mußte die Wagenleinwand im Auge behalten, um etwaige, sich da ansetzende Brandstücke rasch zu beseitigen und mußte auch noch Pit dem »Führer« und Boly dem »Lenker« die einzuschlagende Richtung angeben, um den größeren Blöcken vor uns, die ich von dem Pferde aus wahrnehmen konnte, auszuweichen. Das Schreien und das Antreiben der Ochsen, welche dichte Schaumflocken abgeiferten, das Laufen über Stock und Stein, durch die brennende Tageshitze und die Gluth der nahen Flamme, hatte meine Gefährten im höchsten Grade abgehetzt; als wir endlich die Niederung erreichten, mußten wir einige Minuten Athem schöpfen, alle hatten sich mehr oder minder im Gesicht und an den Händen verwundet, waren unzählige Male gestolpert und gefallen.
In der Niederung angelangt, fanden wir, daß das Feuer sich bereits auf 100 Schritte der Anhöhe genähert hatte, während 200 Schritte weiter ab es über 100 Schritte von ihr entfernt, zu erlöschen begann, es war hier durch eine trockene Regenschlucht gehemmt, während es nach uns zu eine sehr seichte Stelle derselben, über die wir ohne Mühe gesetzt, durchgezüngelt hatte. Mein Pferd zitterte, daß es sich kaum auf den Beinen erhalten konnte und die Ochsen »bliesen« (athmeten) schwer mit zur Erde gesenkten Köpfen und doch hatten wir noch die schwierigste Aufgabe zu lösen, wir mußten, nur 30 Schritte vom Feuer entfernt, etwa 100 Schritte neben dem Brande zurücklegen, bevor wir nach links abbiegen konnten. So kurz auch die Strecke war, die wir zurückzulegen hatten, sie drohte uns sicherer Verderben zu bringen als jene, die wir von den felsigen Höhen herabgestürmt hatten. Ein zwischen mir und dem Feuer kaum 15 Schritte vom Wagen entfernter, durch einen brennenden Zweig in Flammen gesetzter, trockener Vaalbusch wurde uns zum zweiten Losungswort dieser Hetzjagd.
»Halloh an,« die Zugthiere legten sich in's Joch, doch nach kaum fünf Schritten, drängen sie von dem dichten Qualm betäubt, nach dem Felsenhügel, wobei sie den Wagen unwiderruflich umwerfen mußten. In diesem kritischen Momente setzt der neben ihnen an meiner Seite laufende Genosse auf die andere, die Hügelseite über, wo es ihm, den übrigen Genossen und dem dunklen Führer gelingt, durch Schlagen und Schreien die Thiere wieder auf die ebene Fläche herabzudrängen. Schlagt zu, schreit, sonst sind wir verloren und fliegen in die Luft! Und nun ging es durch den dichten Qualm, dicht herabnieselnde, von dem Winde aufgewirbelte Asche, durch brennende Grashalme, Rindenstücke, glühende und brennende Zweige—als wären wir bis auf das Gefühl der Selbsterhaltung sinnlos geworden—mitten durch das Verderben vorwärts, um jene freiere, nur noch 80, 70, ja nur noch 50 Schritte entfernte, uns Rettung verheißende Stelle zu erreichen. Die Hize wurde so furchtbar, daß ich jeden Moment die Wagenleinwand aufflackern zu sehen wähnte.
Nur noch 20 Schritte—ob es die Zugthiere nur aushalten, sie keuchen und wanken im Joche!—Endlich, Gottlob, da sind wir, zu unserer Linken ein freies Grasfeld, zu unserer Rechten die etwa 10 Fuß tiefe und 12 Fuß breite Schlucht und darüber hinaus das schwarz verkohlte Gras. Ich springe aus dem Sattel, nehme ihn rasch ab und lenke meine Schritte zu den Gefährten, die sich in's Gras geworfen hatten. Sie konnten kaum ein Wort hervorbringen. Ihre Gesichter sind blutroth, die Hände, von den knorrigen Aesten und dem häufigen Fall blutig geritzt und geschunden, die Augen drohen aus den Höhlen zu springen. Pit's Kleider, der mit den Frontochsen zuerst die Hindernisse (Büsche etc.) zu bewältigen hatte, sogar sein Hemd war in Fetzen zerrissen, vom Rücken und von der Brust tröpfelte Blut aus langen, doch glücklicher Weise nicht tiefen Rißwunden.
Weiterziehend, trachteten wir, uns einen Anhang hinaufbewegend, die quer durch das Feuer nach Gassibone's Stadt führenden Wagenspuren wieder zu erreichen, was uns wohl gelang, obgleich wir der müden Thiere halber jede 200 Schritt stehen bleiben mußten. Wir folgten den Wagenspuren in nördlicher Richtung über ein ebenes Land, was den armen Zugthieren wesentliche Erleichterung bot. Der Abend war inzwischen eingetreten. Ein entsetzlicher Durst quälte uns, wir nahmen zum Essig unsere Zuflucht und netzten damit die Lippen. Ein Ausruf Pits, der voranschritt, riß uns alle aus dem dumpfen Hinbrüten. »Bass, kick (sieh) da so sin (sind) ye det Hartebeeste?« Wir alle beugten uns vor, ja, richtig, der Junge hat ein gutes Auge. Quer über unsere Richtung, einige 300 Schritte vor uns, trappten drei Hartebeest-Antilopen an uns vorüber. Doch wir waren zu abgehetzt, zu müde, um ihnen mehr als unsere Blicke zu widmen.
In Afrika habe ich drei Hartebeest-Antilopenarten beobachtet, das gewöhnliche Hartebeest, das von der Colonie bis gegen den Zambesi, doch häufiger in den südlicheren und mittleren hochbebuschten Partien Süd-Afrika's gefunden wird, ferner das Sesephi oder Zulu-Hartebeest, welches dasselbe Terrain bewohnt, doch auch nördlich vom Zambesi angetroffen wird, woselbst ich auch die dritte Art vorfand, welche jedoch der ersten näher als der zweiten Species verwandt ist, indem sich die letzteren mehr dem Buntbock nähert. In Folge seines hammerförmigen Kopfes, sowie auch seiner winkelig gebogenen Hörner ist das eigentliche Hartebeest die häßlichste der Antilopenarten. Auf das Sesephi werde ich noch zurückkommen, dem eigentlichen Hartebeest will ich in Folgendem einige Worte widmen. Ich fand es am häufigsten zwischen dem Vaal und dem Soa-Salzsee, doch hörte ich, daß es auch im Osten und Nordosten der Transvaal-Colonie und im nördlichen Theile der Cap-Colonie häufig vorgefunden wird. Das Thier ist mehr als andere Antilopenarten ausgerottet und dies wohl, weil es weniger flüchtig und dreister als andere ist. Es lebt in kleineren Rudeln und wir finden es nicht selten in den von dem gestreiften Gnu bewohnten Gegenden. Daß es in dem nördlichen Theile des zentralen Süd-Afrika seltener als in den südlichen ist, hat wohl seinen Grund darin, daß es von den Bamanaquato's ob seines Felles anderem Wilde vorgezogen wird, und dies darum, weil sich der östliche Bamanaquato zu seiner kleinen Carosse, seinem Nationalmäntelchen, das Fell dieses Thieres gewählt hat.
In den bebuschten, doch weniger bewaldeten Gegenden jagt man es zu Pferde; verfolgt, zeigt das Thier einen schwerfälligen Lauf, der wohl in seinem hohen Vorderleib und Widerrist seinen Grund hat. Ich glaube, daß diese Species (Antilopa caama), obwohl die gemeinste von den drei genannten, doch zu den Seltenheiten in den europäischen Thiergärten gehört und daß die transzambesische Art gar nicht in denselben vorhanden ist. In den Wäldern wie im Lande der mittleren Betschuana's sucht man sich ihnen durch Bäume und Büsche gedeckt zu nähern, an solchen Stellen trachten die Thiere sich womöglich am Rande einer Lichtung oder in den weniger bebuschten Partien aufzuhalten, um eine bessere Rundschau halten zu können, während sie in den waldlosen Gegenden nur hoch und gruppenweise bebuschte Partien und im Allgemeinen die Ebene bewohnen. Von weißen Jägern werden sie meist nur neben anderem Wilde, Elephanten, Straußen etc. gejagt und erlegt.

[Hartebeest-Gazellen.]
Der entsetzliche Tag war zu Ende, unser Führer hatte Mühe, den durch den Brand mit Asche gefüllten und unkenntlich gewordenen Wagenspuren zu folgen und uns in der wahren Richtung nach der kleinen Niederlassung der Eingebornen zu bringen. Nicht blos die Lippen waren heiß, der ganze Mund schien uns wie verkohlt und die quälende Trockenheit war bis in den Schlund hinein zu fühlen. Wir sprachen nicht mehr und jeder suchte so still als möglich sein Leid zu tragen. Wir hatten auf die Kühle Nacht gehofft, doch diese war ausnahmsweise warm und selbst der Wind hatte aufgehört uns etwas Erfrischung zu spenden. Endlich vernahmen wir Hundegebell und bald darauf den monotonen Gesang der dunklen Mädchen, ein Himmelsgesang für unsere niedergedrückten Geister. Nie wieder mehr auf meinen späteren Wanderungen habe ich diese monotonen, diese einfachen, stets sich wiederholenden, mit Holzkastagnetten begleiteten Weisen der farbigen Mädchen mit solcher Wonne, mit solchem Nachhall in meinem Herzen begrüßt, wie an jenem Abend. Der Durst ist doch eines der schrecklichsten Gefühle, welche die menschliche Natur niederdrücken, abquälen können.

[Kopf der Hartebeest-Gazelle. (Antilopa caana).]
Endlich erblicken wir am Abhang zu unserer Linken und etwas vor uns einige rothleuchtende Stellen, welche auf ebenso viele Feuer hindeuteten; ich ließ den Wagen stehen, mit demselben Entschlusse hatten meine Gefährten und der Führer ein Gleiches gethan und wir alle eilten nach den menschlichen Wohnungen zu. Die Köter kamen nun herangeflogen, während das Singen verstummte und vor uns erschien eine dunkle Gestalt, ein Bewohner der Häuschen, nicht wenig überrascht, um diese Zeit und an diesem Orte einen Wagen vorbeifahren zu sehen. So wie ich den Menschen vor mir sah, stürzte ich auf ihn los, faßte ihn bei den Armen und schrie ihm mit meiner heiseren Stimme »Meci, Meci« zu. Der so Angefallene stieß einen Schrei aus, wohl den Warnungsruf, denn unser Führer konnte, von einem Lachkrampf darob erfaßt, gar nicht zu Worte kommen. In einem großen Ochsenhorn brachte der Mann nach einiger Zeit eine übelriechende Flüssigkeit, die er als seinen ganzen Wasservorrath bezeichnete und für deren Ueberlassung er eine halbe Krone forderte. Weder die Menge noch die Qualität dieser Flüssigkeit waren jedoch hinreichend, um den heftigsten Durst zu löschen. Es gelang uns endlich, unsere Wünsche dem Manne verständlich zu machen und in kurzer Zeit darauf brachte er und zwei Frauen mehrere große Töpfe mit Milch gefüllt, deren Inhalt von uns gierig verschlungen wurde. Nun galt es auch den Hunger zu stillen und bald loderte ein großes Feuer, an dem eine Hammelkeule briet.
Der Steppenbrand bildete natürlich das Hauptgespräch; im Süden stand noch immer eine hohe Röthe am Himmel, ein Beweis, daß das Feuer weiterschritt. Diese Brände werden zuweilen durch Unvorsichtigkeit verschuldet, doch in jenen Partien, wo Büsche und Bäume seltener sind, von Farmern oder von Eingebornen im Spätwinter angezündet und dies namentlich in trockenen Jahren, um, wie die Leute sagen, das Wachsthum des Grases zu befördern. Dasselbe thaten früher die Straußenjäger im Innern, um die Strauße, die das grün aufsprossende Gras mit Begierde aufsuchen, an solche Stellen zu locken. Diese Brände sind sehr oft in den von den niederen, kaum 18 Zoll hohen Büschen (Scap [Schaf-]büschen) bewachsenen Ebenen der Colonie und des Freistaates zu bemerken; auf etwa drei englische Meilen nahegekommen, sehen wir dann in dunklen Nächten einen oder mehrere gerade, längere oder kürzere »glühende Streifen« langsam über die Erde hinkriechen.
Am folgenden Morgen wieder aufbrechend fanden wir uns eine halbe Stunde später in dem schon zu einem Wege ausgefahrenen Wagenspuren, denen wir im März nach der Abreise von Gassibone gegen den Vaal-River zu gefolgt waren. Hier verabschiedete sich unser freundlicher Führer und wir fuhren bergab eine der Schluchten hinunter nach Gassibone's Residenz zu. Die Seiten (d.h. Abhänge) der durchfahrenen breiten, sich nur nach der Stadt gegen ihre Mündung zu verengenden Schlucht zeigten einen terrassenförmigen Abfall der Gebirgsschichten, die trotz des üppigen Graswuchses deutlich hervortraten; die ebenen Partien dieser Terrassen waren von der Natur mit Mimosenbäumchen bepflanzt worden und boten so einen, unseren auf Berglehnen angebauten Kirschbaumgärten nicht unähnlichen Anblick.
Gegen Mittag fuhren wir in Gassibone's Stadt ein, durchschritten dieselbe und lagerten unter einigen Bäumen, etwa in der Mitte des thalförmigen Kessels, unmittelbar an einer Regenschlucht. Der Boden des ganzen Kessels war ein üppiger Rasen, der, weil in der Tiefe liegend und durch die oben in einer Schlucht liegenden Quellen befeuchtet, sich in diesem Zustande erhielt. Pit trieb, von E. und F. gefolgt, die Ochsen nach den Quellen, allein sie fanden dieselben von mehr denn 20 Frauen umlagert und hatten über 1½ Stunden zu warten, bevor sie an die Reihe kamen.
Es ist staunenswerth, unter diesen östlichen mit den Bamairen gemengten Batlapinen so wenig Energie zu finden. Am Tage müssen in der trockenen Zeit die Farmer stundenlang auf ihren Wasserbedarf harren. Wenn man die Quellen ausreinigen und unterhalb derselben den feuchten, marschigen Boden ausgraben und einen Damm errichten würde, könnte man in der so gewonnenen Cisterne nicht allein hinreichendes Trinkwasser für die Bevölkerung von Gassibone's Residenz-Kraal, sondern auch in dem errichteten Teiche das nöthige Trinkwasser für eine große Anzahl von Hausthieren gewinnen.—Inzwischen war Gassibone selbst, von seinem Bruder und einigen Männern begleitet, herangekommen, die meisten in gewöhnliche graue Baumwollkleider gehüllt, einige noch trotz der Hitze mit überhängenden Carossen, um zu forschen, was wir in seiner Stadt begehrten. Ich ersuchte ihn, mir einen Ziegenbock zu verkaufen, da ich auf der zwischen dieser Stadt und jener Mankuruan's am Hart-River von Eingebornen häufig begangenen Strecke nicht allzuviel Wild anzutreffen glaubte.
Es würde das Ansehen Seiner königlichen Hoheit geschmälert haben, wenn er sofort eingewilligt hätte. Es wären keine—später meinte er—nur wenige Ziegen da, dann begehrte er ein Glas Branntwein, setzte sich auf unser Wasserfäßchen und begann den Verkauf der Ziege mit seinem Bruder und dem herum im Grase hockenden und an einigen Bäumen angelehnten Gefolge bis in's Detail zu ventiliren. Da sie die Setschuana sprachen, verstand ich sie nicht, vernahm jedoch unzählige Male ein und dasselbe Wort, welches ich später Pit mittheilte und das mir von diesem als Kalpater (Ziegenbock) verdolmetscht wurde. Endlich stand einer der Männer auf, kam auf mich zu, und meinte, indem er auf den Chef (König) hinwies, daß Morena Botlazitse Gassibone mir einen Bock für ein »half pund« überlassen wolle, ein Anbot, das ich sofort annahm. Seine Herrlichkeit geruhte mich noch mit einem längeren Gespräche zu beehren, nach dessen Beendigung wir unsere Reise fortsetzten.
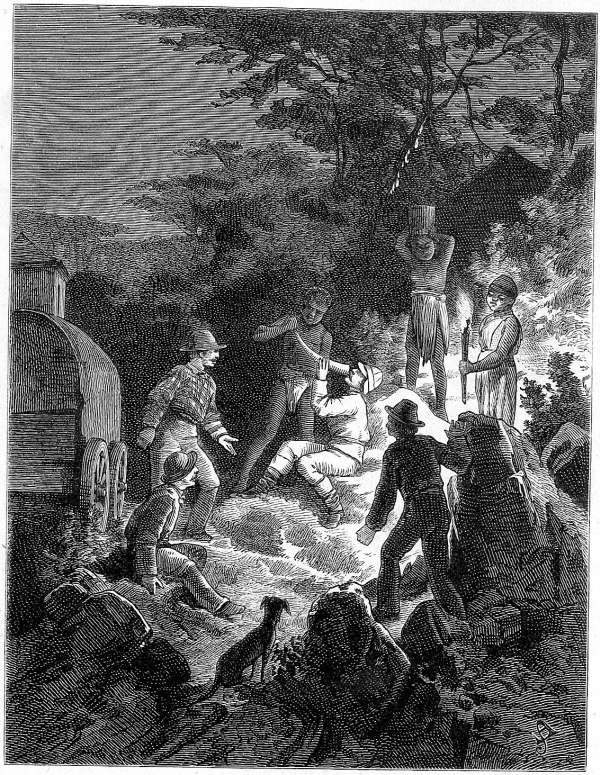
[Ersehnter Labetrunk.]
Als wir durch eine der Stadt gegenüberliegende Schlucht die Höhe erreicht hatten, waren dunkle Wolken aufgestiegen, welche auf Sturm und den so heißersehnten Regen deuteten. Wir hielten Kriegsrath und da Pit meinte, daß der Sturm sicher auf uns heranzöge, spannten wir kaum drei englische Meilen von der Stadt entfernt aus.

[Niger und Cobra.]
Pit hatte richtig geurtheilt, die Wollen hatten sich zu dichten Massen aufgethürmt, welche näher und näher heranrückten und bevor eine Stunde verging, kam ein tüchtiges Sturzbad auf uns herabgeströmt. Was hätten wir tagszuvor für eine solche Wohlthat geboten! Es war einer der heftigsten, etwa zweistündigen Platzregen, die ich in Süd-Afrika beobachtet. Noch während des Regens kamen zwei halbnackte, einen höchst widerstrebenden Ziegenbock heranschleppende Batlapinen auf uns zu.
Gegen Sonnenuntergang, als die »schäumenden« Wasser abgeflossen, nur noch in dünnen Stränchen der erzürnten Fluth nacheilten, verließen wir den Abhang und zogen weiter. Derselbe führte durch ein nur stellenweise erweitertes Felsenthal, das zu unserer Linken dicht bebuscht war. Niger, der voran eilte, fing plötzlich in dem hohen Grase zur Rechten zu bellen an und schien dann etwas, was wir jedoch nicht sehen konnten, über den Weg zu verfolgen. Ich bemerkte, wie er nachsprang und dann stets wieder zurückfuhr, was mich nicht wenig befremdete. Wir hielten sofort an und eilten Niger nach. Er stand nun an dem, einen der riesigen Termitenbauten—eine hohe nach oben zu offene Röhre—umgebenden Dickicht und bellte die darin versteckte Beute heftig an, worin ihm nun unsere übrigen Köter treulich halfen. Unser Erstaunen war nicht gering, als wir eine über 7 Fuß lange, gelbliche Cobra capella, welche sich um die Röhre geschlungen und den Hund mit dick aufgeblasenem Halse laut anzischte, erblickten. Ein Dunstschuß machte ihr bald den Garaus und ich zog das Reptil aus dem Busche um es meiner Sammlung einzuverleiben.
Gegen Abend erreichten wir ein breites Thal, verließen hier das Hauptthal und wandten uns längs eines Felsenabhanges nach Norden, auf den uns als kürzest bezeichneten Weg nach Taung zu. Kaum einige Wagenlängen die neue Richtung verfolgend, drang von den mit Sykomoren bewachsenen sandigen Felsenzinnen ein vielstimmiges, wenn auch verschieden modulirtes, doch in der Mehrzahl im tiefen Bariton gebelltes »Cha-Cha«, der Ruf der Paviane zu uns herab; unsere Hunde antworteten und rannten gegen den Felsen an, während wir die flüchtigen, gelenkigen Affen im saftigen Grün der Sykomoren und im dürren Mimosendickicht verschwinden sahen; wir trachteten zwar, unsere Gewehre ergreifend, einen Vorsprung zu gewinnen, allein sahen bald das Nutzlose unserer Verfolgung ein und schlugen, zum Wagen zurückgekehrt, unser Nachtlager auf.
Ein kühler, frostiger, umwölkter Tag folgte. Wir überschritten einen Kessel; an einer der kahlen Berglehnen standen einige Batlapinenhütten. Es waren schon des neuen Herrschers Leute, Mankuruana's Unterthanen, die hier etwas Feld anbauten und in gewisser Hinsicht die Grenze gegen Gassibone's Heerden zu bewachen hatten.[1]
Wir kamen über einen Höhensattel in ein dichtbebuschtes Thal, dessen Abhänge mit mannigfachem Gebüsch bewachsen waren. Das Thal öffnete sich in einen andern weiten Kessel, der hunderte kleine, kaum 200 Schritt im Umfange zählende, aufgegrabene Grundstücke barg.
Nach einer 1½stündigen Fahrt durch diese öden Gefilde verließen wir den Kessel und einige Höhen überschreitend, sahen wir das Thal des centralen Hart-Riverlaufes vor uns liegen. Diese Höhen um Taung bilden ein förmliches Netz, und obgleich sie wohl kaum 800 Fuß über das Bett des Flusses emporragen, sind sie die höchsten des Hart-Riverthales und bieten manche recht anziehende Scenerie. Wir hatten den östlichen Abhang der Höhen, an die wir zuerst gekommen waren entlang zu fahren und dann uns nach Norden zu wenden, um zu der Furth zu gelangen; Taung, oder Mahuras-Town, wie es auch nach dem früheren Herrscher genannt wird, liegt am rechten Ufer des Flusses, etwas ab von dem Flusse im Schutze und am Abhange einiger Felsenhöhen. Der Fluß wälzte einen Schwall gelblichen Wassers durch sein stellenweise mit Schilfrohr durchwachsenes, doch auch sehr steiniges Bett. Dem Abhange der Höhen entlang fahrend erblickten wir unter uns ein Eingebornendorf am Abhange liegen, in dem es lebendig wurde, als man den Wagen bemerkt hatte. Es währte auch nicht lange, als sich eine der unangenehmsten Scenen vor uns entrollte, die ich in Afrika unter den Wilden beobachtet habe. Halbnackte, in schäbige Carossen und zerfetzte europäische Kleider gehüllte Männer, später auch nackte Kinder und nur mit kurzen schmutzigen Lederschürzen versehene Frauen kamen aus den Wohnungen heraus und auf uns zugestürzt. Die einen hielten uns leere, schwarze Flaschen, andere Töpfchen entgegen, während sie »Suppy«—»Bass, verkup Brandwen«—andere »Brandy, Brandy« schrieen. Die Einen hielten uns ein Schakal- oder Deukerfell, die anderen Ochsenriemen, Peitschen, Einer ein Joch, sein Nachbar hölzerne Löffel, ein Greis eine Holzschüssel entgegen, für welche Gegenstände sie Branntwein eintauschen wollten. Als wir auf all' dies wie auf eine Märchenscene herabschauten und ohne uns um die Halbnackten zu kümmern weiter fuhren, da stellten sie sich gegen den Wagen, ergriffen die Ochsen an den Hörnern und suchten sie zum Stillstehen zu bringen, was ihnen auch gelang.
»Wir haben keinen,« gaben wir allseitig als Antwort zurück. Da brachten Einzelne einige schmutzige Shillinge hervor und glaubten uns dadurch nachgiebiger zu stimmen. Inzwischen hatten einige ihren Frauen zugerufen und diese kamen mit Milchsäckchen, auch eine Ziege brachten zwei derselben geschleppt. Wir waren förmlich umlagert. Doch all' das Schreien, Gesticuliren und der Widerstand gegen unseren Weitermarsch nützte nichts. Ich gab nicht einen Tropfen des Feuerwassers her und es blieb ihnen nichts übrig, als Einer nach dem Andern abzutreten und uns ziehen zu lassen. Einige jedoch folgten uns bis zur Furth, sie dachten, hier würde ich ihnen, abseits von ihren Genossen, ihren Willen thun und boten mir fünf Shillinge für eine Flasche, doch vergeblich.
Wir alle waren froh, nach einem so anstrengenden, unangenehmen Marsche endlich auf einige Stunden rasten zu können. Der Fluß war an der Drift etwa 60 Schritte breit, zeigte eine einzige steinige Insel in der Mitte, so daß wir gleichsam zwei Arme zu überschreiten hatten, die Strömung war jedoch so bedeutend, daß meine Gefährten zu warten vorschlugen. Ich konnte jedoch ihre Ansicht nicht theilen. Kaum einen Büchsenschuß von uns entfernt, im Schatten eines großen Cameeldornbaumes, stand ein Wagen und zwei Zelte, wie wir sehen konnten, von einer weißen Familie bewohnt, daneben mehrere alte, gebrechliche Wägen und ringsherum lag Schmiedematerial. Die Stadt war durch den Aufenthalt zweier Schmiede beglückt, von denen einer nahe an der Furth, der zweite weiter aufwärts in der am Eingange von dem Missionär bewohnten Schlucht seinen Aufenthaltsort genommen hatte. Der Eine hatte sich schon eine Heerde von Rindern und Schafen, mit denen er für seine Arbeiten bezahlt wurde, erworben (doch klagte er, daß sein Verdienst in der letzten Zeit ob der Verarmung der Leute ein karger sei), während der andere seinen Erwerb bei der nächsten sich ihm darbietenden Gelegenheit in Branntwein verjubelte. Daß natürlich diese beiden großartigen Schmiedewerkstätten, d.h. die Firmen und die Handwerker, in grimmiger Feindschaft lebten, ist selbstverständlich.
Um Auskunft über die Brauchbarkeit der Furth befragt, theilte uns der Schmied mit, daß die Händler, die Elephanten- und Straußenjäger, sowie die Missionäre, wenn sie von den Diamantenfeldern kommen, kurz alle, welche die kürzere Tour über Kuruman einschlagen, hier durchkämen, daß aber ein Drittel der Reisenden an dieser »Drift« Schaden an ihren Wägen leide. Der Chef that nichts, um sie zu verbessern und es hätte auch eigentlich nicht viel geholfen, da der Fluß große Mengen Sand, Erde und oft große Steine herabschwemmte und auf diese Weise die Furth nach jedem Hochwasser ein mehr oder weniger verändertes Aussehen erhielt.
Seinem Rathe folgend übersetzten wir den Fluß im Laufe des Nachmittags und kamen glücklich an das jenseitige Ufer, an dem wir Halt machten und uns dann auf den Weg nach Taung begaben. Nachdem wir einen Theil der Stadt der Eingebornen durchschritten hatten, kamen wir an das von einem Gärtchen umgebene, aus Stein erbaute und mit einem mit Gras gedeckten Giebeldach versehene Missionsgebäude. Wir traten in dasselbe ein und fanden uns einem etwa dreißig Jahre alten Manne mit langem blonden Bart gegenüber, der uns erstaunt, namentlich den bewaffneten F., anblickte. Ich stellte mich vor, legte ihm mit wenigen Worten den Zweck meiner Reise dar, was den Missionär, Herrn Brown, gleich freundlicher stimmte. Er entschuldigte sich über die Einfachheit seiner library (Studirzimmers), das ihm auch für seine Kranken als Ordinationszimmer diente und theilte mir mit, daß er eben an einem Setschuana-Wörterbuch arbeite.[1] Nachdem er mich über die Dauer meines Aufenthaltes in Taung befragt, lud er mich ein, um nicht von den Eingebornen des Branntweins halber belästigt zu werden—meinen Wagen in die Nähe seines Gehöftes zu bringen und daselbst mein Lager aufzuschlagen da selbst Mankuruana die Reisenden oft unnütz aufhielt und belästigte, war ich in der Nähe des Missionärs auch gegen ihn am besten gesichert. Doch er war diesmal nicht daheim, sondern in Kuruman bei dem Chef Mora zu Besuche, wohin auch die Gemahlin des Rev. Brown mit ihren Kindern abgereist war, um einige Wochen in der Gemeinschaft der Frauen der dortigen Seelsorge zuzubringen.
1 Es ist seither veröffentlicht worden.
Unter den Batlapinenstädten nimmt Taung unstreitig den ersten Rang ein, einesteils durch seine malerische Lage an einem der Haupt-Verkehrswege nach dem Innern, anderntheils durch seine Einwohnerzahl. Leider war seine Wohlfahrt von Jahr zu Jahr gesunken und ich glaube, daß sich Taung wohl jetzt, nachdem der Export von Spirituosen nach Mankuruana's Land von der Regierung in Griqualand-West möglichst erschwert wurde, wieder heben und namentlich Getreide, Vieh etc. nach den Diamantenfeldern exportiren wird, wozu ihm seine relativ geringe Entfernung von diesem Markte sehr zu Gute kommt; außerdem ist der Stadt durch ihre Lage in der Nähe des Hart-Rivers die Möglichkeit geboten, die bebauten Niederungen regelmäßig und ergiebig bewässern zu können. Die frühere Einwohnerzahl von Taung läßt sich mit 5-6000, die gegenwärtige (1879) mit 3500-4000 angeben. Die Zahl variirt um 500, weil sich manche Familien periodenweise zu ihren Viehposten, auf denen ihre Diener das Vieh hüten, entfernen, die Männer oft in größerer Zahl auf Jagd ausgehen und andere wieder ihre Makalahari-Diener mitbringen.
Um die Zeit meines Besuches und drei Jahre nachher (1877) gab es für Taung schlimme Zeiten, die theils durch die Aufregung während der Kämpfe gegen den Vasallenchef Mora und gegen Gassibone, theils durch große Trockenheit und deren überall fühlbare Folgen bedingt waren. Im Jahre 1872 starben mehrere Familien in Taung Hungers, weil sie alles, selbst das letzte Fell, auf dem sie lagen, das Holz von den Dächern ihrer Hütten den Brandyverkäufern opferten.
Im Jahre 1843 wurde die »London Missionary-Station in Taung« durch Mr. Roß eröffnet. König Mahura (der Onkel Mankuruana's) verließ jedoch die Stadt, um sich auf der Höhe des Mamusaberges (zwei Tagreisen stromaufwärts) anzusiedeln, wohin ihm, nach der Mitteilung meines hochgeehrten Freundes, Rev. S. Mackenzie von Kuruman, der weiße Prediger nachfolgte, und dort auch verblieb, als es Mahura einige Jahre später wieder einfiel, Taung zu seiner Residenz zu machen. Herr Roß hatte an beiden Orten Kirchen erbaut, die seitdem in Ruinen verfallen sind, und schlug dann seinen Sitz in dem auf der ersten Reise erwähnten Lekatlong auf.[1] Im Jahre 1858 spielte sich in Taung die Scene eines grausamen Kampfes ab, dessen Opfer wir noch als bleichende Gebeine in den Felsenklüften der Taung überragenden Höhen finden konnten. Das Schicksal der Mahuras-Batlapinen war um so härter, als sie unschuldiger Weise in diesen Krieg, der mit dem Kampfe in Taung seinen Abschluß fand, einbezogen wurden.[2]
1 Herr Roß, der ein hartes, beschwerliches Leben unter den Batlapinen führte, starb im Jahre 1863.
Die alte verfallene Kirche war durch eine neue ersetzt worden, welche einem unserer gewöhnlichen, ländlichen Arbeiterhäuschen nicht unähnlich, in Taung außer dem Missionshause das einzige im europäischen Style gehaltene Gebäude war und von der hiesigen Gemeinde mit nicht geringem Stolze angesehen wurde. In ihrer Nähe hing in einer eingepflanzten Baumgabel ein Glöckchen, deren Schall hinreichte, die kleine Gemeinde zur Versammlung aufzufordern.
Der Schmied in der Schlucht, hinter dem Missionsgebäude war mit dem Schmieden eines jener schweren Rosenkränze beschäftigt, deren sich die Gerechtigkeit bedient, um Uebelthäter zu strafen und an den Ort ihrer Einsamkeit zu fesseln; er war für einen Cap-Bastard bestimmt, der einen Jungen in der Stadt erschossen, und nun an die Behörde von Klipdrift ausgeliefert werden sollte.
Am Nachmittage des 12. November setzten wir unsere Reise in nordnordöstlicher Richtung und in mäßiger Entfernung vom Hart-River aufwärts bis zu dem von Barolongen bewohnten Kraal (Stadt) Maruma fort, welcher Ort unter der Oberaufsicht eines gleichnamigen Chefs stand. Bevor wir diese, am Abhange einiger Höhen und in einem engen in das Hart-Riverthal einmündenden Seitenthale gelegene Stadt erreichten, begegneten wir zahlreichen von der Feldarbeit heimkehrenden Frauen, welche sehr primitive eiserne Hauen und Holzbündel trugen.
Das Thal, in dem Maruma liegt, würde dem Maler eine anziehende Felsenscenerie bieten und ich bedaure nur, von anderweitigen Beschäftigungen während des Aufenthaltes in derselben so sehr in Anspruch genommen worden zu sein, daß ich es selbst nicht skizziren konnte. Felsenthore und schroff abfallenden Ruinen nicht unähnliche Felsen wechseln hier ab, und durch sie einerseits, sowie durch die an dem gegenüber liegenden Abhange sichtbaren dunklen Eingebornengehöfte andererseits wird das den Boden des engen Thales schmückende Grün sehr gehoben.
Trotz der letzten heftigen Regen war das Flüßchen des Thales bis auf einige in demselben gegrabene Löcher vollkommen trocken, der Regen war nur auf gewissen, äußerst beschränkten Partien gefallen.
Bevor ich Dutoitspan verließ, hatte ich eine Meerkatze erstanden, welche ich der Unterhaltung halber mit mir nahm. »Monkey« hatte ihren Sitz oben am hinteren Wagenende und war mit einem Kettchen an eines der Seitenbretter gebunden. Komisch war es anzusehen, mit welcher Angst der Affe die Gebüsche und Bäume beobachtete, an denen wir knapp vorbeifuhren, und welche oft die Seiten des Wagens oder das Dach streiften. Er legte sich flach auf das Wagendach, um dürre Aestchen über sich hinwegstreichen zu lassen, während er bei stärkeren hinten auf das untere Wagenbrett herabsprang, um, so wie wir die vermeintliche Gefahr passirt hatten, seinen früheren Sitz sofort einzunehmen. Dieses zeitweilig recht bissige Affendämchen hatte Tag für Tag längere Zeit einer äußeren Besichtigung und Untersuchung des Thürmchens am Wagen gewidmet. Steckte Einer von uns seinen Kopf zu einem von dessen vier, nur mit einem Drahtnetz überzogenen Fenstern heraus, so kam sie, leise die Zähne aneinanderschlagend—was bei ihr eine Bitte oder Zufriedenheit ausdrücken sollte—heran und trachtete in das Innere des Wagens hineinzuschlüpfen, was wir natürlich nicht gestatten konnten, da unter dem Thürmchen die eine der beiden Zucker, Reis, Kaffee, Thee, Zwieback etc. enthaltenden Speisekisten aufbewahrt lag. Monkey wußte uns indeß doch zu überlisten und sehr geschickt in das Drahtnetz Bresche zu legen. Obgleich wir den Einbruch bemerkt hatten und das Dämchen zur Flucht zwangen, hatte sie sich doch schon ihre Backen mit Reis gefüllt, während sie mit beiden Händen ein riesiges Brodstück nachzuschleppen sich bemühte.
Zur Mittagsstunde des 13. November verließen wir das Thal und hielten schon nach einer kurzen Fahrt zwischen einigen Felsenhügeln, an einer üppigen Weidestelle. Während der Rast erlegte ich einen schönen Raubvogel (Melierax canorus) und die schon früher erwähnte Art eines Landleguans.
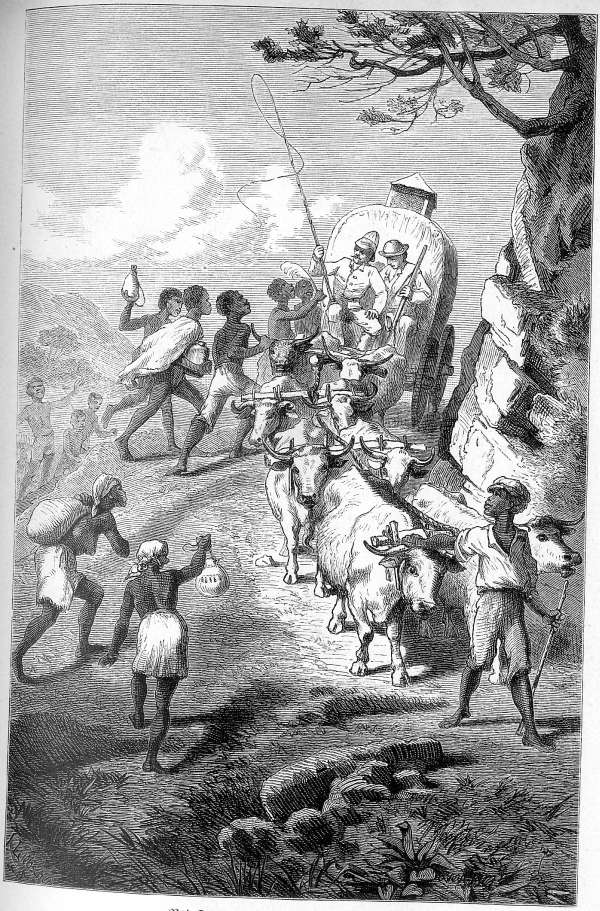
[Bei Taung um Branntwein bestürmt.]
An einem seichten Bache bemerkte ich einen schuppigen Gegenstand, der sich bei näherer Besichtigung als eine der genannten Riesenechsen entpuppte, welche sich bei meiner Annäherung zu verbergen suchte. Ein Schrotschuß tödtete sie auf der Stelle und verschaffte mir den ersten Balg dieser Species, dem später noch mehrere folgten. Zum Wagen zurückgekehrt, traf ich einige mit einem alten, dachlosen Wagen auf ihre Viehposten ausziehende Barolongen von Maruma. Der Wagen, dessen vier Räder nicht in einer und derselben Werkstätte gearbeitet waren, schien jeden Moment auseinanderfallen zu wollen, welcher Befürchtung ich dem Eigentümer desselben gegenüber Ausdruck gab; doch dieser lachte, daß seine Perlenzähne glänzten und meinte, der Koluj (Wagen) müsse noch oft den Weg hin und zurück machen. Um uns von der Reisetüchtigkeit desselben zu überzeugen, setzte er das Gespann vor unseren Augen in Bewegung; das war ein Getöse, Geklapper, Geknarre und Gepolter, jedes Rad hing anders und lief anders, die Seitenbretter bogen sich und die Bodenbretter schnellten auf und nieder zum nicht geringen Vergnügen der in einer dichten Gruppe auf dem Wagen sitzenden Frauen und Kinder.
Wir näherten uns nunmehr der nordöstlichen Grenze des Batlapinenreiches und ich hoffte bald jenes schon erwähnte, kleine unabhängige Königreich der Mamusa-Koranna's zu erreichen.[1]
Am 14. November wandten wir uns direct nach Norden und kamen auf eine sehr ausgedehnte, mit hohem Buschwerk bewachsene Ebene, auf welcher heftige Regengüsse uns zu öfterem Stillstande nöthigten. Zwischen den hohen Marethwa-Büschen sprangen häufig Antilopen auf und entfachten meine Jagdlust. Doch diesmal war die Jagd keine leichte, ich mußte unaufhörlich das Pferd bald nach rechts, bald nach links wenden, um den gruppenförmig beisammenstehenden Büschen auszuweichen. Ich sah jedoch bald ein, daß ich auf diesem Wege nicht zum Ziele gelangen könne, ich mußte meine Taktik ändern und geradewegs durch die Büsche jagen. Schon setzt das Pferd in einen kleinen Busch, doch plötzlich hielt es an; es ist in ein niederes, kaum 1½ Fuß hohes, mit Doppeldornen versehenes Mimosengebüsch gerathen; ehe ich das Pferd zurücklenken kann, macht es, wohl in der Absicht um darüberzukommen, einen zweiten, einen dritten Satz, doch leider nur immer tiefer in den Dornbusch hinein, es fängt endlich an auszuschlagen—armes Thier; ich sehe zwar vor mir eine kleine offene Stelle in dem größeren Gebüsche, doch derart mit Wartebichidorn überhangen, daß ich keine Lust verspüre, den Versuch eines Durchbruchs zu wagen. Aufwiehernd macht das Pferd noch einen Satz, der Vorderleib des Thieres war nun wohl aus den Dornen, doch war mir Hut und Jacke zerrissen; mit den Hinterfüßen noch immer in den Dornen gefangen, schlägt der Rappe wieder und wieder aus und hopp—hopp—gerathe ich selbst immer tiefer in die Dornen hinein.

[In Dornen gefangen.]
Nicht alle Kinder Flora's spenden Wohlgerüche und Honig, manche, die Armen, sind von ihr stiefmütterlicher bedacht worden und diese lassen nun ihren Unmuth, wo sie nur können, an den Sterblichen aus; Mutter Flora hat viele solcher Stiefkinder nach Süd-Afrika verbannt; mich haben sie oft geherzt und geküßt, doch wenn ich auch Afrika wieder aufzusuchen gedenke, nach ihnen sehne ich mich wahrhaftig nicht.—Je mehr ich mich der dornigen Umarmung zu entwinden suchte, desto fester wurde diese endlich kam der Gaul mit den Beinen aus dem niederen Dorngebüsch heraus, wurde ruhiger und ich konnte nun, das Gewehr auf den nächsten niederen Busch werfend, abzusitzen trachten. Es gelang mir schließlich, das Pferd durch eine schmale Spalte aus dem Gebüsche heraus zu ziehen und uns beide von den Dornen zu befreien. Gesicht und Nacken, Hände und Arme, sogar die Schenkel brannten wie Feuer; ich kam zum Wagen zurück wie ein Held aus einer Katzenschlacht.

[Billige Diamanten.]
Ungefähr um die Mittagszeit fuhren wir in einen seichten Thalkessel ein. Am Abhange der Felsenhöhen erblickten wir einige Eingebornen-Gehöfte. Der Kessel öffnete sich nach Osten zu auf eine große, mit hohem, dürrem Gras bewachsene Ebene, auf der sich eine Heerde der zierlichen Springböcke in Neckereien erging. Als wir nach unserem Mahle und einer etwa zweistündigen Rast weiter ziehen wollten, sahen wir von Norden her einen Kafirwagen herankommen. Pit begrüßte den Eigenthümer, einen in einen langen Ueberrock gekleideten Batlapinen, den er von Klipdrift her kannte. Dieser Mann war früher arm, jetzt, meinte Pit, wäre er reich, hätte große Heerden und zwei Wägen und wandere unter den Barolongen zwischen dem Hart-River und dem Molapo, um ihnen allerlei Artikel, die er in den Diamantenfeldern einhandle, zu verkaufen. Als der Ankömmling von Pit hörte, daß wir von den Diamantenfeldern kämen, fragte er, welcher der Baß (der Herr) des Wagens sei. Nachdem er es erfahren, grüßte er mich mehrmals mit seinen kleinen listigen Augen, ging zweimal um den Wagen herum und dann an mich herantretend berührte er mit der Hand seinen Hut und sagte »Sir«. Dabei brachte er aus seiner Tasche eine etwa drei Zentimeter hohe und sechs Zentimeter im Durchmesser haltende Blechdose, wie sie in der Regel den Eingebornen als Schnupftabaksdose verkauft wird, zum Vorschein. Grinsend schüttelte er das Döschen. Ich begriff sofort, auf welche Weise der Mann reich geworden war. Mit der Hand nach den bei seinem Wagen stehenden Dienern weisend, meinte er, die hätten in den Diamantenfeldern gearbeitet und ihm dies—dabei öffnete er die Dose—heimgebracht. In der Dose lagen etwa 20 Diamanten, der größte etwa 3 Karat. Obgleich er blos 30 Shillinge für die Edelsteine verlangte, ging ich auf den Kauf nicht ein, denn die Steinchen waren jedenfalls von den Dienern des Schwarzen in den Diamantenfeldern gestohlen.[1]
Auf dem nachmittägigen Marsche fing ich eine größere Anzahl von Rüsselkäfern unter den Blättern einer lilienartigen Pflanze, sowie mehrere, noch nicht beobachtete Heuschreckenarten. Als wir Abends bei strömendem Regen unter dem Schutze eines ausgespannten Segeltuches unser Lager ausgeschlagen hatten, entfesselte unser Affendämchen die Lachlust Aller. Ich reichte ihr einige Käfer, die kleineren nahm sie in ihre Hände, beroch sie, und dann den Kopf ohne oder mit dem Thorax vom Hintertheile abreißend, verspeiste sie dieselben. Mit Heuschrecken that sie ein Gleiches, dagegen warf sie übelriechende Insecten, der letzteren Species angehörend, sowie eine Meloë weg, dasselbe that sie mit einigen Silpha's (Silpha). Zwei erlegte Eidechsen, die ich ihr reichte, warf sie vom Wagen, anders jedoch geberdete sie sich, als ich ihr eine frisch erlegte Buffadder gab. Im Nu war sie auf der anderen Wagenseite, dann lugte sie vorsichtig nach mir aus, und als ich mich ihr wieder nahte, lief sie das Wagendach entlang und zerrte mit voller Kraft an dem Kettchen.
Unser Weg führte uns nächsten Tages über kurzbegraste Hochebenen, über welche Millionen beflügelter, großer Ameisen schwärmten. Die Regengüsse der letzten Tage ließen mich hoffen, überall Wasser zu finden, und hatten wir uns deshalb an unserer letzten Raststelle damit nicht versehen, noch die Thiere vor unserer Abfahrt getränkt. Leider fanden wir keines und mußten von Durst gequält unsere Wanderung bis zu später Abendstunde weiter fortsetzen. An der Abzweigung eines nach Norden streichenden Thales öffnete sich plötzlich eine Felsenschlucht vor uns, die nach Regengüssen augenscheinlich Wasser enthalten mußte. Diese Stelle umgehend stieg ich in das tiefe Felsenbett des nur nach Regen fließenden Spruits, eines Zuflusses des Mokara-Rivers, herab und fand hier mehrere an beiden Seiten einmündende Schluchten, und da die Wände dieser Schluchten theils von senkrechten nackten, theils von terrassenförmigen und überhängenden Felsen gebildet wurden, boten sie viele interessante und des Besuches werthe Punkte.
Vergebens suchte ich im sandigen und steinigen Bette nach Wasser und wollte eben die Tiefe verlassen, als einige von der gegenüber liegenden, steilen Felsenwand wie mir schien herabgekollerte Steine mich aufwärts blicken hießen. Oben in den Bäumen, sowie an den Felsen bewegte sich eine Truppe von Pavianen. Da mir die Thiere mit den herabkollernden Steinen über meinem Kopfe nicht gefielen, dachte ich sie mit einem oder zwei Schüssen zu verscheuchen. Auf einen der überhängenden Bäume zielend, feuerte ich auf den Stamm, in dessen kleiner Krone zwei Paviane saßen. Die in den Stamm eindringende Kugel erschütterte den ganzen, nur lose in den Felsenfugen hängenden Baum und erfüllte die beiden Insassen desselben derart mit Entsetzen, daß der eine hoch aufsprang, der andere sich fest an den Stamm anklammerte. Ein altes Männchen erschien nun bellend am Fuße des Baumes, ergriff jedoch, nachdem es einige große Felsstücke losgebröckelt hatte und ein zweiter Schuß neuerdings den Baum traf, mit den übrigen die Flucht.
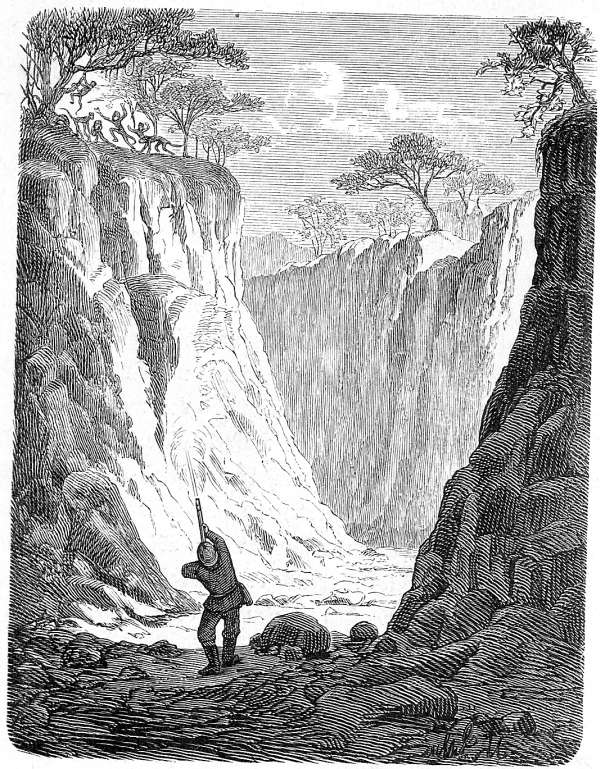
[Von Pavianen überrascht.]
Der Hügel, den ich sodann bestieg, mußte den Makalahari- oder anderen hier vor 100 und mehr Jahren wohnenden Eingebornenstämmen zum Aufenthalte gedient haben, die Kuppe war nämlich von einer Unzahl kleiner, aus Steinen roh (ohne Zierat) ausgeführter 2-3 Fuß hoher, und 4-8 Meter im Gevierte haltender Umzäunungen bedeckt. Manche der Betschuanastämme behaupten, daß diese Stellen von ihren Voreltern bewohnt waren, allein es scheint mir unwahrscheinlich, daß die Nachkommen diese Gewohnheit ihrer jüngsten Vorfahren so bald aufgegeben hätten.

[Erschreckte Paviane.]
Wir gewannen nach und nach bis auf 15 englische Meilen Fernsicht und sahen, daß sich die Gegend nach Norden zu senkte. Fünf oder sechs Meilen vor uns sahen wir ein kleines, auf einer unbedeutenden Bodenerhebung erbautes Eingebornendorf; hier durfte ich doch auf Wasser hoffen. Als ich jedoch, in der Nähe des Dorfes angelangt, darnach fragte, wies man mich nach einer in nordwestlicher Richtung liegenden Vertiefung, die theilweise durch den Abhang, an dem ich stand, verdeckt war. Leider sah ich mich wieder, trotz eifrigen Suchens bitter enttäuscht und mußte, von Durst gefoltert, hier die Nacht zubringen.
Früh Morgens wieder aufbrechend lenkten wir in ein größeres nach Norden sich erstreckendes Thal und erblickten ein aus etwa 40 Hütten bestehendes Dorf am rechten Ufer eines bis auf einige Lachen ausgetrockneten Flüßchens, das nach der Form der Hütten von Koranna's und Betschuana's, wahrscheinlich Barolongen, bewohnt sein mußte. Sobald die Zugthiere das Wasser witterten, hatten wir alle Mühe sie zurückzuhalten; auf das Ufer lossteuernd, erstaunten wir nicht wenig, als wir den Weg plötzlich durch ein Dutzend meist in abgetragene, zerfetzte europäische Kleidungsstücke gehüllte Koranna's versperrt sahen. Laut gesticulirend bedeutete man mir, daß da kein Thier getränkt werden dürfe, bevor nicht der Eigenthümer des Wagens für jedes fünf Shillinge Tränkegeld bezahlt hätte. Ich wies diese Forderung zurück und bot einen vernünftigen Geldbetrag an, der nun wieder von den Farbigen abgewiesen wurde; auch Pit, der seine ganze Beredsamkeit aufbot, vermochte die Opposition der Koranna nicht zu beschwichtigen.
Die Leute sahen uns und den Thieren den Durst an und so dachten sie uns so hoch wie nur möglich zu schrauben; als kein vernünftiger Ausgleich zu erzielen war, bedeutete ich den Leuten, die Feigheit der Koranna's wohl kennend, daß ich um jeden Preis zum Wasser gelangen müsse. Unsere Opponenten dachten, daß ich dies mit den Waffen erzielen wolle und fingen jämmerlich zu schreien an, wobei sie ein und dasselbe Wort in der Begleitung verschiedener Eigennamen riefen, nach Pit's Erklärung riefen sie ihre Freunde zur Hilfe herbei.
Diese kamen auch rasch zum Succurs herbeigelaufen, die Koranna's mit Musketen, die Barolongen und Makalahari mit Assagaien bewaffnet; Frauen brachten den meisten der uns gegenüberstehenden, deren Zahl im Nu sich mehr als verzehnfacht hatte, Gewehre herbei. Wie auf ein Zeichen brach nun der ganze wüst durcheinander rennende Haufe in ein Höllenspektakel aus. Die Männer (Koranna's) fluchten theils in ihrer Sprache theils holländisch, die Barolongen stießen Verwünschungen und Beschwörungen aus, am ärgsten aber schimpften die Frauen, während hinter den nothdürftigen Umzäunungen der Hütten der Kinder ungezählte Schaar lustig darauf losheulte. Daß unsere Hunde nicht ruhig zusehen konnten, sondern auf den Haufen losbellten und darin von den Dorfkötern auf das Kräftigste secundirt wurden, ist leicht begreiflich. Mir schien das Ganze, trotzdem ich den Ernst der Lage begriff, ein Traum. Ich zog in diese Länder im Frieden ein, Frieden wollte ich den Farbigen bringen, und als Freund von ihnen scheiden. War ich der Schuldige in diesem unerwarteten Falle oder meine Gefährten; oder hatte ich es mit einem' Auswurfe von Schwarzen zu thun, die durch den Alkoholgenuß so tief gesunken waren, daß sie sich seinethalben zu wahnsinnigen Forderungen, zu Gewaltthätigkeiten hinreißen ließen.
Meine Begleiter griffen nun, angesichts der drohenden Haltung der Eingebornen auch zu den Waffen, was jedoch sofort unsere Gegner veranlaßte, ihre Gewehre auf uns anzuschlagen und die Assagaien über dem Kopfe zu schwingen. Unkenntniß des Koranna-Charakters hätte sich in diesem Augenblicke bitter gerächt—ich kannte aber die Leute zu gut, um mich zu voreiligen Schritten hinreißen zu lassen. Meine zwei mir folgenden Gefährten einige Schritte vor dem Wagen zurücklassend ritt ich mit meinem Rappen auf die Menge los; von den Waffen Gebrauch zu machen, fiel mir nicht ein, ich hielt es bei der Feigheit der Koranna's, trotzdem, daß der Wagen nur fünf Vertheidiger zählte, für nutzlos und hatte sofort erkannt, daß die Koranna's, obwohl in der Minderzahl, doch die Anführer waren und den Aufstand inscenirt hatten. Statt auf mich zu feuern, ließen die meisten die gehobenen Gewehre sinken, um jedoch nur heftiger zu schimpfen. Und ehe ich noch auf Wurfweite angeritten war, begannen schon die Vordersten sich nach rückwärts zu concentriren. »Kerle lup, det Kerle lup! (die Kerle laufen) schrie mir Pit nach; auch ich konnte nun deutlich sehen, daß die hinteren Reihen sich auffallend lichteten und setzte nun mein Pferd in Galopp. Die Wirkung dieses Manövers auf die Gegner war außerordentlich und rief in mir einen förmlichen Lachkrampf hervor. Der dichte Knäuel hatte sich wie auf Commando gelöst, die einen liefen nach links, die anderen nach rückwärts, um hinter den Umzäunungen ihrer Gehöfte Schutz zu suchen und einen den Pferdehufen weniger zugänglichen »Standpunkt« einzunehmen; während wieder andere gegen die Vertiefung nach rechts abbogen und in diese hinabsprangen, in ihr fortliefen, um erst am unteren Dorfende innezuhalten und aus ihr herauszulugen, und hinter den Zäunen ihrer Gehöfte gedeckt in ein ohrzerreißendes Geschrei auszubrechen, das mir wohl unverständlich, jedenfalls aber die vermeintliche Herzlosigkeit und Undankbarkeit der Weißen verdammen sollte. Ohne weiteren Zwischenfall wurden die Thiere getränkt und unser Wasservorrath ergänzt.
Wir brachen nun wieder auf. Am letzten Gehöfte gab es wieder viel Liebesworte und da wir ohne zu erwidern vorüberzogen, wurden diese süßen, freundlichen Reden so laut und heftig, daß die Ochsen sich darob scheuten und sich plötzlich nach rechts wandten, in Folge dessen die Vorderachse brach. Das war ein schlimmer Zufall und uns allen entfuhr ein Schrei des Erstaunens, es war das Aergste, was uns hier, in diesem Orte passiren konnte. In diesem Augenblicke schätzte ich mich glücklich, ohne Drohungen und ohne wirklichen Zusammenstoß meine Absicht erreicht zu haben; im entgegengesetzten Falle wäre es uns jetzt schlecht ergangen, denn selbst der Feigste hätte hinter diesem oder jenem Zaune, aus dieser oder jener Hütte seine rostige Muskete auf uns abfeuern können, und trotzdem die Bewohner keine treffsicheren Schützen waren, hätte manche Kugel ihr Ziel erreicht und mir vielleicht die Gelegenheit benommen, diese Episode niederzuschreiben. Wenn allein Barolongen oder Makalahari Musemanjana bewohnt hätten, würde es nie zu einem Mißverständnisse gekommen sein, die Leute hätten mäßige Forderungen und in entsprechender Weise gestellt.
Durch mein sicheres Auftreten in der Tränke-Angelegenheit hoffte ich den Bewohnern Musemanjana's Respect eingeflößt zu haben, und darauf baute ich in diesem Momente, da ich ihnen durch den Achsenbruch vollkommen preisgegeben war, meine Hoffnung. Lachend und schreiend, singend, die Mädchen und Halberwachsenen der edlen Vertheidiger Musemanjana's sogar tanzend, stürzten sich die Eingebornen aus ihren Gehöften, um sich uns von allen Seiten zu nähern. Den Gefährten, die am Bock mit den auf den Knien gelegten Waffen saßen, bedeutete ich, sofort die letzteren in den Wagen zu legen und mit in das Gelächter einzustimmen.
Das machte die meisten der Schwarzen stutzen. Ich benützte diesen Augenblick um einen baarfüßigen, mit einer langen Kranichfeder an Hute geschmückten Koranna, den ich für den Häuptling des Dorfes hielt mit lachender Miene anzusprechen und ihm zu bedeuten, daß wir nun trotz des Widerstrebens der Bewohner von Musemanjana noch öfters die Thiere zur Tränke führen müßten. Der Angesprochene war blos der Stellvertreter des Chefs oder Captain, wie sie ihn zu nennen geruhten, zeigte sich vernünftig und forderte für die Benützung der Tränke einen Shilling, den ich auch gern erlegte.
Nun kamen die Eingebornen bis an den Wagen und jeder gab seine Meinung kund, die Frauen blieben noch am längsten feindlich gesinnt. »Ja, es ist Euch recht geschehen, Weiße müssen nicht die Herren spielen, Schwarze sind die Herren von Musemanjana, und nicht Ihr, sondern Hendrick, der Koranna, der nach Bloemhof gefahren ist, um fette Ochsen zu verkaufen und Kleider und Branntwein dafür zu erstehen, ist unser Captain!« Die Männer wollten an der Achse die Bruchstelle untersuchen etc. etc., was ich jedoch ablehnte, da ich fürchten mußte, unversehens bestohlen zu werden.
Ich dankte für ihre Hilfe und fragte wo es hartes Mimosenholz gäbe, um eine neue Achse zu zimmern. »Wach, Sir,« meinte der Vicechef, »mut det ni dun, nicht weit von hier in einer Barolongenstadt mit Namen Marokana lebt ein alter Mann, der bei einem Schmiede in der Transvaal-Colonie gearbeitet, zu dem mußt Du senden.« Ein Barolonge erbot sich auch sofort für ein Sixpencestück nach Marokana zu reiten, um den Schmied zu holen.
Da wo sich das Hottentotten-Element mit dem der Bantu vermischt (ich spreche von den letzten Decennien), namentlich seitdem die Spirituosen in's Land Eingang gefunden hatten und wo der Häuptling der Batlapinen, Barolongen oder wie sie alle hießen, nicht ein einsichtsvoller Mann gewesen, wurden die letzteren Stämme von den alle Laster, doch nicht die Tugenden des weißen Mannes sich aneignenden Koranna's, Griqua's etc. verleitet, in Folge dessen griffen Trunkenheit, Faulheit, Arbeitsscheu, Diebstahl, ja sogar Mord unter ihnen immer mehr um sich. Um so folgenwichtiger und wie wir hoffen wollen wohlthätiger halten wir die von der Regierung in Griqualand-West in der letzten Zeit namentlich in Bezug auf die Koranna's getroffenen Maßregeln.
Mit dem Vice-Captain schloß ich einen Vertrag, demzufolge ich gegen Entrichtung eines Shillings per Tag meinen Wasserbedarf decken konnte, ja seine Leutseligkeit ging so weit, daß er mir andere, klares Wasser enthaltende Lachen angab, die selbst von den Eingebornen nicht benutzt wurden.
Am Nachmittage kam der alte Schmied, ein Griqua mit seinem Sohne, um den Schaden zu besichtigen. Als ein alter Bekannter der Koranna's im Dorfe, schüttelte er zuerst allen die Hände, wobei die Männer mit Bru'rs (Bruder) und Ohm, die Frauen mit Tante und die Jungen mit Kinders titulirt wurden. Der Künstler erklärte die Achse aus einem zwischen Marokana und Musemanjana stehenden Kameeldornbaume (Acacia giraffe) zimmern zu wollen, doch müsse er dies alles in Marokana thun und deshalb müßten wir die Räder und die gebrochene Achse mit der Deichsel nach Marokana befördern lassen. Als Lohn für seine Arbeit forderte er zwei Flaschen Branntwein und 2 £ St. und wollte unter keiner Bedingung von dieser Forderung abgehen und betonte besonders die Ueberlassung des Branntweins, dessen er zur Stärkung bedürfe.
Unterdessen hatte F., der sich mancher »Eroberung« unter den schwarzen Schönen rühmte, die Gelegenheit benützt, um die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wohl um die an uns begangene Unbill zu rächen, griff er zu einem probaten Mittel, sich die Herzen der zahlreich versammelten Koranna-, Barolong- und Makalahari-Schönheiten im Fluge zu erobern und zog eine Concertina (sechseckige Handharmonika) hervor, um ihr die herzzerreißenden, dem Gehör der Musemanjana-Beauties jedoch sichtlich einschmeichelndsten Töne zu entlocken. Doch nicht Frauen allein, nicht blos das arme schwache Geschlecht, sondern auch die wackeren Herzen in der Heldenbrust der gelblich- und schwarzbraunen Krieger von Musemanjana waren von der Macht dieser Töne ergriffen und Stille—wie vielleicht noch nie—heilige, friedliche Stille herrschte weithin. Und der Mitleidslose, sehr geschmeichelt und von uns applaudirt, hätte bis zum Sonnenniedergange musicirt, wenn nicht die Hunde des Dorfes gegen diese himmlischen Laute einmüthig protestirt und den häuslichen Frieden der Familien Musemanjana's gerettet hätten.
Vielleicht des Effektes wegen, den die Musik auf die Schönen des Ortes ausübte, vielleicht jedoch auch aus anderen unbegreiflichen Gründen machte einer der Koranna's unserem Künstler den schmeichelhaften Antrag, ihm das Musikinstrument für einen Ziegenbock zu verkaufen. Wir alle dachten, daß F. ob einer solchen Zumuthung, seine Concertina zu verkaufen, in gerechter Entrüstung auflodern werde; doch wer beschreibt unser Erstaunen, als F. bereitwilligst auf den Antrag einging.
Am folgenden Morgen, den 17., wurde Pit mit den Rädern und der Achse nach Marokana gesandt und machte uns nicht wenig Sorgen, da er erst am Nachmittag heimkehrte.
Musemanjana ist die nördlichste Besitzung des Korannakönigs von Mamusa, nach Norden und Osten grenzen die wildreichen Ebenen (von mir »Quagga flats« benannt) an, welche Montsua angehören, in denen Batlapinen, Barolongen, Koranna's und holländische Farmer aus der westlichen Transvaal-Republik oder jene, die sich mit der Erlaubniß der Fürsten der genannten Stämme in deren Gebiet niedergelassen haben, friedlich neben einander jagen. Nach Westen liegt das kleine Gebiet des Marokana-Häuptlings, der Montsua, den König der Barolongen als Oberhaupt der nördlichen und westlichen Barolongen anerkennt, allein ihm keinen Tribut abliefert.[1]
Die Gebirgsformation der Umgegend bestand meist aus bläulich-grauem Kalkschiefer in Blöcken und Platten, Quarzitfelsen im Gerölle, zahlreichen Quarzstücken und »Vaalgestein« (Grünstein mit mandelartigen Chalcedon-Einschlüssen).
Am Abend besuchte mich der Schmied, um mir mitzuteilen, daß die Achse an der Bruchstelle schon früher geborsten war, doch in Wirklichkeit nur, um eine Flasche Branntwein als Abschlagszahlung zu fordern. Da ich befürchtete, daß der Genuß desselben den alten Mann arbeitsunfähig machen würde, verweigerte ich ihm denselben, worüber er sehr mürrisch wurde und den Rückweg antrat, nicht ohne in laute Klagen auszubrechen, daß ihm »det Medicin« verweigert wurde.
Am folgenden Tag meldeten sich zwei Eingeborne, um in meine Dienste zu treten. Ich nahm sie gegen 8 Shillinge Wochenlohn auf (Pit bekam 10 Shillinge), mußte mich jedoch ihrer Hauptbedingung, ihnen allabendlich einen Schluck Branntwein zukommen zu lassen, fügen. Der eine war ein Griqua, der Sohn des Schmieds, der uns bediente, klein, untersetzt mit sehr einfältigem Blick, der zweite eine Hopfenstange, ein Bastard und mit dem Häuptling Hendrik verwandt. So dumm als der erste, so verschmitzt sah der zweite aus. Der Schmied erschien zeitlich und wich nicht eher vom Platze als bis er seinen Branntwein erhalten hatte. Die Folgen meiner Nachgiebigkeit waren bald bemerkbar, denn er lag bald betrunken in des Häuptlings Hause, während der Vice-Häuptling, die Frau des Herrn von Musemanjana und ihre Dienerinnen, die alle vom Feuerwasser etwas erhascht hatten, wie besessen sangen und tanzten.
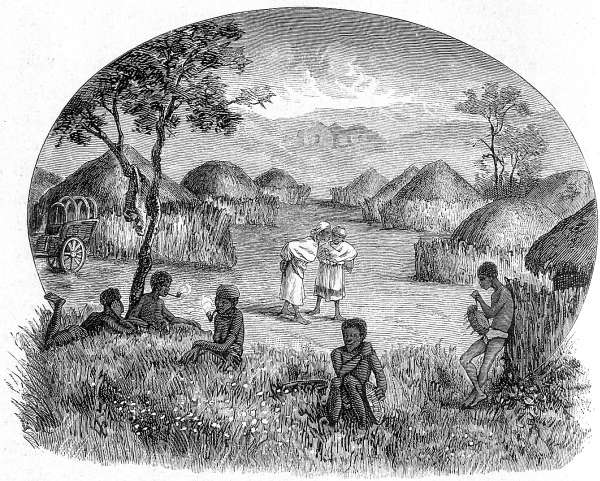
[Musemanjana.]
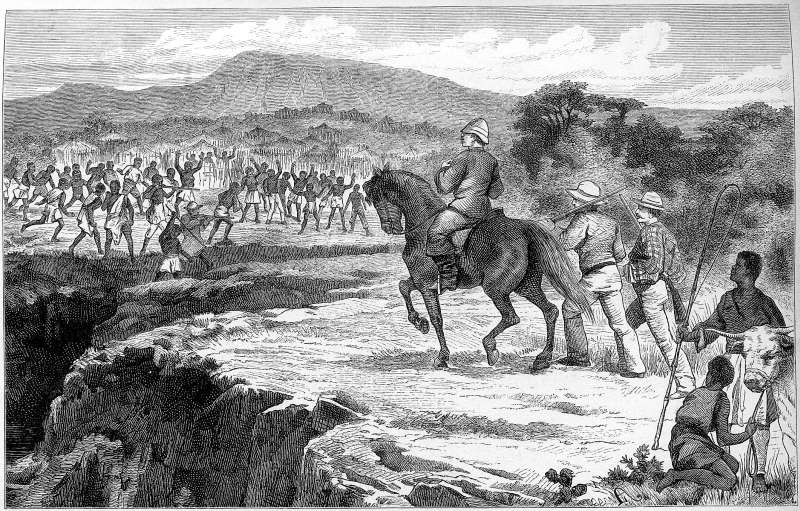
[Empfang in Musemanjana.]
Am Abend kehrte auch Hendrik, der Häuptling des Dorfes zurück. Allgemeiner Jubel aller seiner Ohm's und Tanten, denn ihre Hoffnungen waren erfüllt. Hendrik brachte eine riesige, wenigstens 10 Liter fassende Flasche Feuerwasser mit. Bevor er jedoch seine jubelnde Umgebung damit bewirthete, kam seine Frau herangetrippelt, ihren langen Ehegespons am Arme führend und präsentirte ihn uns mit den Worten. »Das ist der Herr dieses Ortes! Das ist der Herr der vielen Schafe, die Ihr täglich blöken hört, und ist auch mein Mann!« Hendrik, eine schwankende Hopfenstange, grinste verschämt, streckte mir seine Hand entgegen und hieß mich willkommen.
Mit Hendrik war der Häuptling eines anderen an der Mokara gelegenen Kraal's, angekommen. Er fiel mir auf, weil er sich an dem nun folgenden Saufgelage nicht betheiligte. Trotz des Unfalls murrte ich nicht mehr über den Aufenthalt, der mir in Musemanjana begegnete, da ich Gelegenheit fand, einen tiefen Einblick in das Leben und Wesen der Koranna, Barolongen und Makalahari zu gewinnen und bedauerte nur, daß ich nicht genug Geld mit mir führte, da mir der mit Hendrik angekommene Korannahäuptling einen vernünftigen Antrag machte. Er besah meine Zugthiere und hielt fünf von acht für reiseuntauglich. Er wollte mir für dieselben gute Zugochsen, die ich mir selbst aussuchen konnte, gegen eine Aufzahlung von 2 £ St. per Stück überlassen.
An diesem Tage hatte ich auch Gelegenheit, das Anfertigen irdener Töpfe von Seite der Barolongenfrauen zu beobachten. Auf einer hölzernen runden Schüssel wurde die aus Thon und Humus zubereitete Masse mit den Händen in die natürliche ausgebauchte Topfform geknetet, stehen gelassen, um nach einigen Tagen im Feuer eingebrannt zu werden. Diese Gefäße, von 7-12 Zoll Höhe und gleicher, oder noch um 2-3 Zoll größerer Breite, mit einer Oeffnungsweite von 5-7 Zoll und einer Wandstärke von ¼-½ Zoll wurden beinahe ausschließlich als Wassergefäße benützt.
Von Musemanjana nach Moschaneng.
Aufbruch nach Moschaneng.—Quaggaflats.—Hyänenjagd bei Mondschein.—Makalahari-Reiter—Konana.—Barolongenstolz.—Acht Löwen.—Eine Begegnung mit Löwen am Setlagole.—Thierleben auf der Hochebene.—Gnujagd bei Nacht.—Boly verirrt sich.—Zebrajagd.—Skeletthügel.—Eine abenteuerliche Gansjagd.—Südafrikanischer Frühling.—An Ufer des Molapo.—Molema's Town.—Rev. Webb und die Mission daselbst.—Chef Meloma.—Kranken-Ordination.—Siedlersperlinge.—Huß-Höhe.—Ankunft in Moschaneng.—Hohe Gäste.
Abends fand sich der Schmied mit seinem Meisterstücke ein, das kaum zur Noth brauchbar war. Als man im Dorfe unsere Vorbereitungen wahrnahm, kamen die Leute herbeigeströmt und ein Jeder begehrte ein Geschenk; nur die, welche uns behilflich waren, bekamen etwas Tabak und je ein färbiges Tuch. Als wir schon eingespannt hatten, kam noch der Chef mit einem Ansuchen. »Mein Kind (der ihm verwandte Schwarze) geht mit Euch, er war einer meiner Diener, deshalb verliere ich einen Arbeiter, ich kann ihn nicht ziehen lassen, bevor Ihr mir nicht 8 Shilling bezahlt, d.h. so viel, als Ihr ihm wöchentlich Lohn gebt!« Um nur loszukommen und die ausgeglichenen Differenzen nicht vielleicht im letzten Augenblicke durch andere erneuert zu sehen, gab ich dieser Erpressung nach und wir zogen ab.
Unter der Führung des oben erwähnten Dieners setzten wir unsere Reise fort und machten erst in später Nachtstunde Halt. Beim Anzünden des Lagerfeuers hatten wir viel Mühe, um einen Grasbrand zu verhüten, da sich der Wind zu einem wahren Orkan gesteigert hatte. Dagegen war der folgende Morgen (21. November) schön und warm, wir begegneten einigen Makalahari- und Barolongfrauen, welche junge, kaum aus den Puppen gekrochene Heuschrecken emsig sammelten. Nach einer 3½ stündigen Tour erreichten wir eine seichte Vertiefung, in welcher wir in einigen Löchern schönes klares Trinkwasser fanden. Unsere Weiterfahrt führte uns in einer nordöstlichen Richtung über unabsehbare, sehr spärlich bebuschte Ebenen. Das trockene Gras verbreitete einen angenehmen Heugeruch, frisches Gras sproßte allenthalben unterhalb der trockenen Stengel. Der Boden war nach allen Richtungen von den Eingängen zu den unterirdischen Bauten der Springhasen, Stachelschweine und Erdferkeln durchfurcht. Doch mangelte es auch nicht an solchen der Schakale, während die Hyänen die von den Erdferkeln verlassenen Löcher bezogen hatten. In diesen von Weißen unbewohnten Gegenden werden die Schakale, die Kaamafüchse und die Proteleswölfe ihres Balges halber, der zu Carossen verarbeitet wird, von den Eingebornen häufig gejagt. In den wildreichen, von Weißen bewohnten Localitäten sind es wieder die Hyänen, die meist mit Strychnin ausgerottet werden.

[Barolongmädchen Heuschrecken sammelnd.]
Nachdem wir 14 englische Meilen zurückgelegt, kamen wir in ein zweites, doch breiteres Thal, das wieder zahlreiche Wasserlöcher aufwies. Man hatte hier das Gras im September niedergebrannt, das frische stand schon 12 Zoll hoch. In diesem Thale trafen wir auch die äußerste von Chef Hendriks Ansiedlungen, d.h. Viehposten, und an dieser allein zählten wir über 100 Rinder. Um uns nach allen Seiten hin erstreckte sich die Ebene bis an den Horizont.
Wir betraten die Quaggaflats und damit Montsua's Gebiet. Der nächste Tag war schön und warm, auch hatte sich der Wind gelegt, dagegen hatten wir auf dem die ganze Strecke entlang morastigen Boden mit zahllosen Schwierigkeiten im Fortkommen zu kämpfen. Wir begegneten aus Marokana kommenden und auf die Jagd ausgehenden Barolongen und knüpften mit ihnen Verhandlungen über den Austausch einiger Zugthiere an, die indeß resultatslos waren, da die Barolongen in einem Athem ihre Forderungen hinaufschraubten und Schließlich 8 £ St. für je ein Thier begehrten.
Am folgenden Tage, den 23., verließ ich, von F. und einem unserer Schwarzen (Boy) begleitet, den Wagen, um zu jagen. Ich beobachtete auf diesem Jagdausfluge, daß die Springbockgazelle ihre Kälbchen den Tag hindurch sich selbst überläßt, oft sich auf weite Strecken entfernt und erst gegen Abend zu den Kleinen zurückkehrt und dann bis gegen Sonnenaufgang bei ihnen verbleibt. Geht man ruhig durch das zwei Fuß hohe Gras jener Ebenen, so kann man sich den im Grase verborgenen Thieren bis auf 20-25 Schritte nähern, ohne im Geringsten ihre Gegenwart zu bemerken. Die schönen Thierchen bleiben, ohne sich gleich den Orbekigazellen, um dem Beobachter zu entgehen, flach ausgestreckt auf den Boden zu legen, selbst im kurzen Grase völlig unbemerkt.
Nachmittags kamen wir auf einen nach Norden führenden Weg, der sich später als die Verbindungsstraße zwischen Mamusa und Konana herausstellte und dem wir auch folgten. Dieser Weg bestand in einem vielleicht vor drei Monaten zuletzt befahrenen Geleise und schien auch häufig als Fußpfad von den Eingebornen benutzt zu sein. Wir waren an den Rand einer von Osten nach Westen unabsehbaren, nach Norden zu in ihrer Mitte von Höhenkuppen begrenzten und nach dieser Richtung in der Entfernung einiger Meilen von isolirten Gehölzen unterbrochenen Ebene gelangt. Abend und Nacht waren ungewöhnlich schön, der bleiche Mond mit einem Nebelkreis um seine runde Scheibe lächelte so freundlich und die flimmernden Sternlein blickten so hell zur Erde, daß ich trotz der Müdigkeit stundenlang die Pracht dieser Nacht bewunderte. Meine Gefährten hatten einer nach dem Andern sich in Morpheus Arme geworfen. Nur die Hunde blieben bei mir, ich konnte mich von der dunklen, mit einem grauen Schimmer—dem Abglanz von Luna's Strahlen—übergossenen unabsehbaren Fläche und dem leuchtenden Gestirn über mir nicht trennen.
Eine plötzliche Bewegung Niger's riß mich aus meinen Gedanken. Von »Onkel«, einem zweiten Hunde gefolgt, sprang Niger einige Schritte vorwärts und fing an zu knurren. Ich sollte über die Ursache dessen nicht lange im Zweifel bleiben. In die Stille der Nacht tönte von der etwas niedriger liegenden Ebene vor mir ein langgezogenes, äußerst unangenehmes, klagendes Geheul. Der häßliche Laut, dieses tiefe, entfernte Stöhnen einer gefleckten Hyäne fiel wie ein Mißton in die Idylle der schönen Nacht um mich. Eben im Begriffe, es meinen Gefährten gleichzuthun, die alle bereits im Reiche der Träume lebten, wurde ich durch die gesteigerte Unruhe der Hunde auf die Annäherung der Raubthiere aufmerksam und faßte den Entschluß, auf diese lästigen Ruhestörer Jagd zu machen. Ich kroch zu Pit und Boy, rüttelte sie auf und hieß sie die Hunde halten, holte dann Gewehr und Munition aus dem Wagen, weckte F. auf und ohne mich mehr nach ihm umzusehen, hielt ich nach der Richtung zu, von der mir das Geheul zu kommen schien. Die Hunde am Wagen gaben aber den Dienern tüchtig zu schaffen, da die afrikanischen Hunde die Hyäne stets als ihren Erzfeind betrachten und sie anzugreifen suchen. Theils gebeugt, theils auf Händen und Füßen vorwärts schleichend, hatte ich etwa 100 Schritte zurückgelegt, als mir ein dumpfes Knurren auffiel. Ich hielt an, legte mich flach hinter einen der niedrigen Termitenhügel und nachdem ich mich umgesehen, ob alles auch hinter mir in Ordnung sei, legte ich den Hinterlader zum Schusse bereit neben mir nieder. Das Knurren kam näher, doch schien es mir mehr wie ein Scharren denn ein Knurren—vielleicht ein Stachelschwein oder Erdferkel? »Hu—hu,« tönt es plötzlich vor mir, und das »Hu—hu« wiederholt sich, noch ein zweites und tieferes, dann ein Scharren und Knurren, alles klar und deutlich hörbar und doch vermag ich nichts zu sehen.

[Hyänenjagd.]
Vergebens beuge ich mich mit dem halben Körper über den Hügel, ich sehe nichts als Termitenhügel—es wird stille. Das Knurren und Scharren hört auf und ich mußte annehmen, daß ich durch meine Unvorsichtigkeit die Raubthiere verscheucht hatte—ich hocke mich wieder hinter den Erdhügel nieder und verhalte mich still, um selbst die leiseste Annäherung der Thiere wahrnehmen zu können. Doch ich harre vergebens, einige Termiten machen mir das Liegen recht unbequem, ja unmöglich. Plötzlich erschallt, kaum einige Dutzend Schritte vor mir das Doppelgeheul und das grunzende Stöhnen abscheulicher wie je—doch trotz Mondscheins und der äußersten Anstrengung meiner Sehkraft kann ich nichts erspähen, nichts als Termitenhaufen starren mich an. In diesem spannungsvollen Momente vernahm ich ein Rauschen, ein Knurren und Fauchen hinter mir, mich umwendend, will ich schon losdrücken, ich sehe eben einen dunklen Gegenstand an mir vorübergleiten, als glücklicher Weise ein bekanntes Gebell mich rechtzeitig an den Irrthum mahnt, den ich mit dem Niederstrecken eines meiner Hunde begangen hätte. Bei dem letzten Geheul der Hyäne hatte sich Niger losgerissen und Boy, fürchtend, daß die Hyäne den Hund erwürgen könnte, hatte sofort auch dem starken Onkel die Freiheit gegeben, der nun in Sätzen nach Niger gesprungen kam. Sie jagten die Ebene weit nach abwärts, doch die Hyänen waren rechtzeitig geflüchtet und verdrießlich mußte ich den Rückzug antreten.
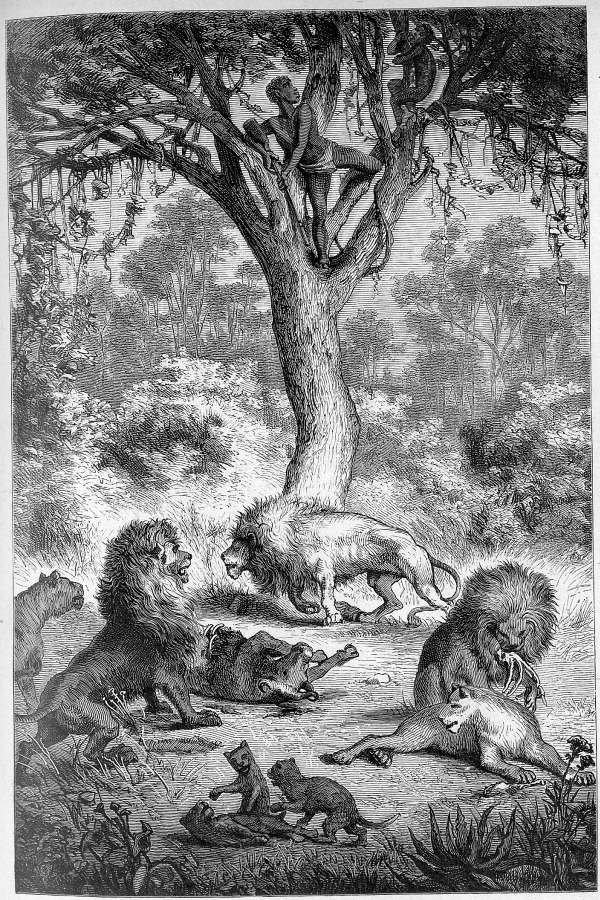
[Von acht Löwen überrascht.]
Unter den südafrikanischen Raubthieren ist die gefleckte Hyäne in Bezug auf Lebenskraft das zäheste Thier, sowohl dem Hunger, als auch den schlimmsten Verwundungen setzt ihr Organismus zähen Widerstand entgegen. In einem Falle war einer Hyäne am Schascha-River (Matabele-Land) durch einen Streifschuß der Unterleib aufgeschlitzt worden, so daß die Eingeweide heraushingen, trotzdem lief sie noch lange, mindestens die doppelte Zeit als es ein anderes Säugethier ausgehalten hätte, um dieselbe Einfriedigung, aus welcher der Schuß gefallen war. Die in Gangrän übergegangene Wunde eines durch eine Löwin verwundeten Bamanquato hatte sie angezogen. Ich werde noch mehrmals Gelegenheit haben, auf diese Raubthiere zurückzukommen.
Nächsten Morgens fanden wir uns am Rande eines die eben durchschrittene Ebene nach Norden begrenzenden Gehölzes. Wir fanden hier einige elende Hütten aus in die Erde eingetriebenen und mit Gras überworfenen Aesten errichtet, welche von Jochoms, einem Zweigstamme der Makalahari, bewohnt wurden. Diese Eingebogen waren Vasallen eines eine Stunde weit ab in einem anderen Gehölze wohnenden Barolongen, mit Namen Mokalana, beide Gehöftgruppen führten auch den Namen des Besitzers. Es wiederholt sich unter den Betschuana's häufig, daß neue Städte und Dörfer, nach dem Erbauer oder Besitzer benannt werden, eine Gepflogenheit, die oft zu Irrungen Anlaß gibt, indem ein Ort zuweilen zwei bis drei Namen, seinen herkömmlichen, den nach dem letzten und den nach dem gegenwärtigen Häuptling führt, oder daß der Häuptling seinen Wohnsitz ändert und einige Meilen weit ab eine zweite gleichnamige Stadt erbaut. Die Jochoms hatten eine Heerde Kühe und Schafe zu hüten und zugleich für ihren Herrn und Gebieter zu jagen. Zu letzterem Zwecke hatten sie einige Pferde zu Gebote und schienen sich weit besser im Sattel zu fühlen als je ein Betschuana.
Für das Geschenk eines Taschenmessers bewog ich einen der Eingebornen zu dem »Baß« zu reiten und ihn zu ersuchen, mir gegen Geldentschädigung und Munition einige junge Ochsen gegen unsere matteren auszutauschen. Während unseres Imbisses sahen wir einen Makalahari hoch zu Rosse von der Jagd heimkehren. Der nur in glatt gargearbeitete Lederstücke gehüllte und mit Assagaien, die mit ihrem unteren Schaftende in eine Ledertasche am Steigbügel eingelassen waren, bewaffnete rothbraune Sohn der südafrikanischen Hochebene sah ganz stattlich aus, er ritt eine starke Fuchsstute und hatte vorne über seinen primitiven Sattel und den Nacken des Pferdes einen Bläßbock liegen. Dem von Jugend auf an die Ebene, ihr hohes meist in Büscheln wachsendes Gras, ihre zahllosen, kleinen und größeren Löcher gewöhnten Pferde die Zügel lassend, jagt der Reiter der flüchtigen Heerde nach (Springböcke sind zu rasch für ihn, um sie vollkommen einzuholen), bis er sie nach einem halbstündigen Ritte eingeholt, dann ist der Assagaie auch schon wurfbereit und bohrt sich in das Thier, an dem er vorübersaust; der Jäger begnügt sich mit diesem einen und verfolgt fast nie ein zweites, sondern wendet das Pferd und wirft seinen zweiten Wurfspeer, der dem flüchtigen Thiere meist den Garaus macht. Je weniger Wunden, desto gnädiger wird das Fell von dem Baß entgegen genommen.
Da der ausgesandte Bote nicht kam, ließ ich einspannen. Kaum hatten sich jedoch meine Diener an diese Arbeit gemacht, als einer der Makalahari den von der Ferne ankommenden Genossen entdeckte. Die Antwort lautete dahin, daß der Baß nur ein Gespann (Zug) Ochsen hätte, die er selbst benöthige, daß er uns aber ein Schaf für einen Becher Schießpulver (etwas über ein Pfund) geben wolle. Ich nahm dieses Anerbieten an und erhielt einen feisten »Fettschwanz« für die geforderte Quantität Schießpulver, dem ich einige Kleinigkeiten (Feuerdosen, Kettchen, Nadeln etc.) als Geschenk beifügte, das zu entgegnen die Makalahari sich beeilten und mir einige Protelesfelle und einige Bläßbock- und Hartebeesthörner überbrachten.
Der Morgen des folgenden Tages brachte mir eine sehr unangenehme Ueberraschung, eines der Zugthiere war verendet, es blieb mir nun nichts übrig, als die schwere Last des Wagens den übrigen drei Zugthierpaaren aufzubürden. In das Thal, das wir nun verfolgten, mündeten einige Querthäler, deren Sohle bebaute Felder bedeckten; nach einigen Meilen gelangten wir in ein von Süden nach Norden sich erstreckendes Thal, das uns von einigen vorübergehenden Koranna's als das des Konana-Rivers, welcher sich durch ein Höhenland nach dem Maretsane zuwendet, bezeichnet wurde. Dieses Höhenland wird von Koranna's und Barolongen sowie deren Vasallen bewohnt und steht unter der Gerechtsame des Häuptlings Schebor, der selbst wieder Montsua's Unterthan ist.

[Jochom-Makalahari einen Bläßbock jagend.]
Nach einer einige englische Meilen langen Fahrt kamen wir zu dem sich in einem Höhensattel und am Abhange mit Bäumen bestandener Höhen ausbreitenden, an 1000 Einwohner zählenden Konana. Auf einer freien, von der Stadt nach Osten und nach dem tiefen, engen Thale des Konana-Rivers abfallenden Lehne sich ausbreitenden Rasenstelle hielt ich an, um mit meinem Wagen besser die Aufmerksamkeit der Bewohner auf uns zu lenken, denn ich hoffte hier einige frische Zugthiere eintauschen zu können. Es währte auch nicht lange und wir waren von zahlreichen Besuchern belagert, unter welchen die Koranna's das Hauptcontingent stellten. Ich hatte vor dem Wagen einige der auszutauschenden, ursprünglich für den Kauf von ethnographischen Gegenständen bestimmten Waaren ausgebreitet. Es waren ein guter Plüsch-Anzug, ein Paar Schuhe, zwei bunte Wollhemden, ein Hut, ein halbes Dutzend Taschentücher und eine halbe Rolle Tabak. Der Häuptling des Dorfes kam selbst, um die Waaren zu besehen, und trank eine Tasse Kaffee mit uns, doch die Leute zeigten keine Neigung, auf meinen beabsichtigten Tausch einzugehen. Von einem der Barolongen kaufte ich für ein Kalikohemd eine Holzschüssel, von einem Anderen für einen Becher Schießpulver zwei Kiri's und zwei Schakalfelle, von einer Frau zwei aus Glasperlen gearbeitete Schmucksachen. Von einigen der Besucher erfuhren wir, daß die umliegenden Höhen, wie auch jene am Setlagole- und Maretsane-Flüßchen zahlreiche Löwen beherbergen. Die Löwen waren hier so dreist und dies namentlich (was ich bestätigt fand), weil sie oft den Knall des Gewehres zu hören bekamen und an des Menschen Anblick gewöhnt waren. Obgleich die Umgegend von Wild wimmelte, bekundeten die Könige des Waldes trotzdem eine besondere Vorliebe für die Heerden des Menschen.
Einer der Barolongen brachte mir das Fell eines nicht vollkommen ausgewachsenen Löwen, für das er 3 £ St. in Gold begehrte. Ich bot einen alten Rock dafür, doch er bestand auf dem geforderten Preis, da er schon früher ein anderes Löwenfell in Klipdrift für 3 £ St. verkauft hatte. Ich rieth ihm an, es auf den Rücken zu nehmen und damit nach Klipdrift zu wandern, eine Zumuthung, die den Barolongen in Aufregung versetzte. Um mich vielleicht nachgiebiger zu stimmen, begann sein Freund mir in wahrhaft mustergiltigem Holländisch zu erzählen, auf welche Art der schmollende Gefährte zu diesem Löwenfelle gekommen sei.[1]
1 Ich lasse hier absichtlich den vollen Wortlaut dieser Erzählung folgen, um die Umständlichkeit der Eingebornen bei solchen Anlässen zu charakterisiren.
»Der Mann,« meinte unser Vis-à-vis und zeigte auf den grollenden Helden, »hatte blos eine Kuh, die Kuh war sein, auch hat er zwei Frauen und ein gutes Stück Feld. Ein Hirt, der noch andere Rinder aus dem Dorfe zu beaufsichtigen hatte, hütete auch die Kuh. Dieser Junge kommt nun eines Tages gelaufen und klagt unter Heulen, daß ein Löwe die Kuh erwürgt hätte. Mein Gefährte lud schweigend sein Gewehr und folgte dem Jungen, der das Pulverhorn tragen mußte. An einer Stelle, von welcher man den Löwen und sein Opfer erblicken konnte, kroch mein Freund auf einen Baum, um Rundschau zu halten. Ja, dort sah er die Kuh liegen, aber keinen Löwen dabei. Mein »Bruder« näherte sich deshalb und kroch mit dem Jungen auf einen nahen Baum, von welchem herab er den Räuber wie eine Meerkatje (Scharrthier) todtschießen wollte. Mein armer »Bruder« hatte bis zum nächsten Morgen auf dem Baume zu sitzen, er wollte gegen den Abend heruntersteigen, da es ihm auf dem Dornbaume—er saß da drinnen (der Erzähler ahmte mit ausgespreizten Fingern eine Gabel nach)—nicht gefiel und sein Körper »hart« (steif) wurde, doch dachte er wieder auf die Abends aus den Gebüschen ausbrechenden Löwen und so blieb er mit dem Jungen, der, weil ihm die Füße von dem Stehen auf einem dünnen Aste schmerzhaft geworden waren, fürchterlich heulte. In der Nacht kamen sie, »nicht einer« (der Erzähler warf sich in die Brust), sondern viele (er begann von dem kleinen Finger der linken Hand nach rechts zu zählen), acht Löwen, he Makoa (Weißer)—acht Löwen!« Dabei sah er sich nach meinen Gefährten und den Dienern um, ob es wohl auch alle gehört hätten und wiederholte »acht Löwen«, wobei er sich etwas bückte, den Körper vorstreckte und beide Hände vor sich haltend mit acht Fingern die Zahl noch deutlicher zu verdolmetschen suchte, während sein Freund finster dareinblickend, noch immer ob der vorerwähnten Zumuthung beleidigt, unaufhörlich etwas in sich hineinmurmelte, wovon nur die Worte dree pund—dree pund (drei Pfund) hörbar waren.
Nachdem sich der Erzähler vergewissert hatte, daß wir alle die acht Löwen begriffen hatten, setzte er seinen Bericht fort. »Mein Bruder am Baume und das Kind bei ihm wollten keinen Löwen vor Tagesanbruch todtschießen; erst dann schoß der Mann auf einen, dessen Haut hier liegt und der zu dem Baume gekommen war, um sich mit dem Schädel daran zu reiben. Mein Bruder hielt sich mit den Füßen auf dem Baume und nachdem er dem Jungen zugeschrieen, sich mit Hand und Fuß festzuhalten, um nicht durch den Schrecken, den in ihm der Schuß hervorrufen könnte, herunter zu fallen, legte er an. »Tla-bumm« (hier folgte ein tüchtiger Schnalzer mit den Fingern, der den Schuß versinnlichen sollte) und (der Erzähler ahmte nun das Fallen nach) det Leu wat dod, morsh dod (der Löwe war todt, mausetodt). Die Andern aber grollten und brüllten und wiesen meinem Bruder und dem Kinde die Zähne so grimmig, daß dieses wieder zu heulen begann. Allein als die Sonne warm wurde und sie die Kuh abgenagt hatten, liefen sie davon. Mein Freund aber sprang herab, ließ den Jungen als Schildwache auf dem Baume und zog die Haut des geschossenen Löwen ab, die er dann heimbrachte und für die er 3 £ St. bekommen mut (muß), weil die Löwen seine einzige Kuh erwürgt haben, er konnte nicht einmal ihr Fell brauchen. Zudem bekam mein Bruder 3 £ St. für das Fell eines Löwen, welcher keine Kuh getödtet hatte.«
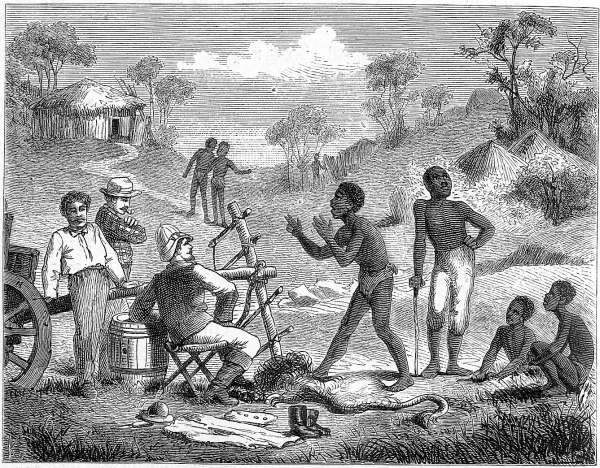
[Erzählender Barolonge.]

[Der Betschuana findet seinen zerfleischten Bruder.]
»Und warum hat denn Dein »Bruder« nicht alle die Löwen erschossen?«—Der Berichterstatter wandte sich nach den nach immer grollend dastehenden Gefährten und dieser, der sich durch die Frage beleidigt hielt, antwortete in der Setschuana mit vor Zorn entstellten Zügen. »Sagte nicht das Kind als es zu mir kam. »Ra« (Vater, Herr), ein Löwe hat Deine Kuh erwürgt? Und so nahm ich eine Kugel mit.« Darauf ergriff er seine Löwenhaut und trug sie von dannen.
Auch Schebor, der später hinzutretende Häuptling, betätigte, daß die Löwen in den Büschen und auf den Höhen an den drei Flüssen Konana, Setlagole und Maretsane »schlimm« (böse) seien und ihm schon so Manchen seines Volkes, so manches seiner Rinder getödtet hätten. Er ermahnte uns, namentlich während der Auffahrt auf die gegenüberliegenden bebuschten Höhen vorsichtig zu sein, da diese ein besonders beliebter Aufenthalt der Löwen seien. Er berichtete mir folgenden traurigen Fall, der sich an diesen Flüssen zugetragen und der mir auch später in Linokana (Stadt der Baharutse) wiedererzählt wurde.
Eine Schaar Eingeborner aus der Nähe von Maraba (Maraba's Stadt) passirte auf ihrem Wege nach den Diamantenfeldern jene Gegend. Diese Menschen, die oft ihre Heimat (z.B. das Makalakaland, von den Diamantenfeldern über 800 englische Meilen entfernt) nur mit einem Assagai und einem Stück Fell ausgerüstet verlassen und sich auf der ganzen langen Strecke bis nach den Diamantenfeldern nur von Wurzeln, wilden Früchten, nur hie und da vom Fleische kleinerer Wildbeute ernähren, bieten häufig dem Reisenden, der mit ihnen auf seiner Wanderung nach Norden zusammentrifft, einen Anblick, der den Hartherzigen erweichen müßte. Es sind förmlich zu Skeletten abgemagerte, oft tagelang hungernde Gestalten, die ihres Weges dahinschleichen und die den Hunger dadurch bekämpfen, daß sie die Leibriemen, die meist neben dem Stückchen Fell ihre einzige Bekleidung bilden, fester zusammenziehen. Eine solche Schaar war auf ihrem Marsche bis an den benachbarten Setlagolefluß gekommen. Wie gewöhnlich folgte Einer dem Andern auf dem von den Eingebornen dieser Gegend benützten Pfade. Der Kräftigste, noch Ungebeugteste, übernahm die Führung, die Schwächeren blieben zurück, der schwächste, oder ein Kranker sich selbst überlassen, gewöhnlich als letzter weit hinter seinen Genossen. Bei dieser Schaar befanden sich zwei Brüder, von denen der eine seit acht Tagen schon der »letzte« war. Am Ufer des Setlagole angekommen, wollte sich die Schaar etwas ausruhen und fahndete nach rübenartig geformten Knollen, die auf Kohlenfeuer gebraten, den ersehnten Nachtimbiß liefern sollten. Das Ufer des Flusses erwies sich an solchen so ergiebig, daß man hier zu übernachten beschloß. Der gewöhnliche Kreis schloß sich jedoch diesen Abend nicht vollkommen—einer der dunklen Männer fehlte. Sie sahen sich gegenseitig an, worauf Einer, des Vermißten leiblicher Bruder, aufstand, seine und des Bruders Knollen in sein kleines Fell nahm, das er sich von der Schulter zog, den Assagai ergriff und seinen Bruder suchen ging. Die Uebrigen setzten sich näher zum Feuer, schlossen den Kreis, verzehrten ihren Imbiß und nachdem sie mehrere Feuer errichtet, legten sie sich zwischen diese und ein Gebüsch zur wohlverdienten Ruhe.
Der kranke, durch Hunger geschwächte, von wunden Füßen gequälte Betschuana (ein Batloka) mußte häufig ausruhen und so war er vom rechten Pfade abgekommen und einem gefolgt, der in einen felsigen, durch zahllose Kareebäume und Büsche zu einem stellenweisen Dickicht umgewandelten und unter den Eingebornen als Löwenhöhle notorisch bekannten Thalstrich führte. Unter einer blühenden, schattigen Mimose ausruhend, wurde der Arme durch einen plötzlichen Sprung von einem dem ganzen Schwarm seiner Freunde und ihm unbemerkt folgenden Löwen niedergeworfen und im nächsten Momente auch getödtet.
Sein Bruder geht den Pfad zurück, läuft im Grase, um desto deutlicher die Stelle zu erkennen, an der die Fußspuren den Pfad verlassen, er findet die Stelle und den Irrpfad, den der Kranke eingeschlagen, doch er sieht auch schon des Löwen Spur im Sande. Statt umzukehren und die Hilfe der Genossen anzusprechen, eilt er vorwärts—er hat ja eine Waffe, doch was ist diese Waffe in der Hand eines Halbverhungerten gegen einen Löwen, der schon warmes Menschenfleisch genossen und Blut gerochen? So kommt er zu der Stelle wo der Bruder ohne Gegenwehr von dem Löwen getödtet wurde, des Bruders Stock liegt auf der Erde—die Leiche selbst mußte von dem Löwen fortgeschleppt worden sein—er blickt herum, geht einige Schritte—dort des Bruders aus Stroh geflochtener Hut und sein Kürbißgefäß, er springt näher, um einen Baum herum—unter diesem liegt die halbbenagte Leiche des Gesuchten. Ein Schrei dringt durch die Stille des Abends am Setlagole-Ufer. Aber auch der Löwe, der den Ankömmling schon lange bemerkt, hatte sich hinter ein nahes Gebüsch in Hinterhalt gelegt und sein zweites Opfer in dem Momente erfaßt, als es sich über den zerfleischten Körper seines Bruders zu werfen im Begriffe war.
Am folgenden Morgen als die Batloka's aufwachten und sich zur Weiterreise rüsteten, vermißte man die beiden Brüder. Nichts Gutes ahnend, liefen erst einige zu einem, am anderen Ufer einige hundert Schritte abseits liegenden Barolongen-Gehöfte, um sich Hilfe, d.h. Männer mit Gewehren zu erbitten, die man ihnen auch bereitwilligst mitgab. Man folgte dem Pfade, fand die Löwenspur theilweise von den Fußspuren des zweiten Bruders verwischt und endlich beide Leichen; die Leute konnten auch deutlich wahrnehmen, daß das Raubthier erst vor sehr kurzer Zeit, wahrscheinlich vor den lärmenden Menschen zurückweichend, den Ort verlassen haben mußte. Man nahm nun seine Spur auf und folgte ihr 500 Schritte weit längs des Flußufers. Bei einer Biegung glaubten einige in den Vaalbüschen einen gelbschimmernden Gegenstand zu sehen, riefen die Uebrigen herbei und obgleich man den Gegenstand nicht für einen Löwen hielt, schlugen sämmtliche Schützen auf das kleine Gebüsch, respective das gelb durchscheinende Object an und drückten los. Das Erstaunen aber war groß, als sie einen ausgewachsen, männlichen, von sechs Kugeln durchbohrten Löwen todt im Gebüsche vorfanden.[1]
Drei Meilen von Konana auf dem gegenüberliegenden Abhange (nachdem wir den zur Zeit unseres Besuches bis auf einige Lachen trockenen Fluß durchschritten hatten) wählten wir uns einen Lagerplatz aus und trafen alle nöthigen Vorkehrungen, um etwaigen Ueberraschungen von Seite der Löwen vorzubeugen. Am nächsten Morgen—es war ein wahrhaft lieblicher, klarer Morgen—drangen die goldenen Strahlen warm durch die Zweige über uns und ermunterten die in diesen Zweigen sich tummelnde gefiederte Welt zur Eröffnung ihres Concertes. Namentlich zahlreich waren Würgerarten, kleinere Singvögel und Tockus plavirostris (Tukans) vertreten.—Die Fahrt ging sehr langsam von statten, da wir den Zugthieren oft einige Rast gönnen mußten und die dichtbebuschte Strecke nur vorsichtig durchfahren werden konnte. Ohne eines der königlichen Thiere auch nur ansichtig zu werden, traten wir nach einigen Stunden aus der bebuschten Partie des Weges heraus. Unvergeßlich wird mir und meinen Gefährten der Ausblick auf die Gegend bleiben, der sich uns nun darbot, als wir einen freien Ueberblick über die sich vor uns ausbreitende Hochebene gewannen. Tage wie der 26. November 1873 werden mir, als Jagdfreund, doch in höherem Grade als Beobachter des freien Thierlebens, mein ganzes Leben hindurch in frischem, unvergeßlichem Angedenken bleiben und mich manche bittere Erfahrung vollkommen vergessen lassen, sie mögen auch dem geehrten Leser meine Sehnsucht, nach jenen Gefilden zurückzukehren, begreiflich erscheinen lassen.
Auf die Höhe des Plateaus gelangt, sahen wir eine etwa 20 Meilen lange, von Süden nach Norden sich hinziehende, nach Osten von einigen Mimosengehölzen begrenzte und hier durch freie Zwischenräume mit einer nachbarlichen zusammenhängende, 6-7 englische Meilen breite Grasebene. Dieser mit zahllosen röthlichbraunen, niedrigen Termitenhügeln bedeckte und von frischem, kurz zuvor aufgesproßtem und nur stellenweise, wie in der Nähe der Wassertümpel, aus hohem Gras gebildete, dunkelgrüne Teppich war durch Tausende von Thieren aller Gattungen belebt. Dunkelbraun und schwarz, rothbraun und hellbraun, gelblich und gescheckt waren die Farben der Roben, mit denen Mutter Natur die hier versammelte Gesellschaft bekleidet hatte. Es waren meist schwarze und gestreifte Gnu's, Bläßböcke und Hartebeest-Antilopen, Springbockgazellen und Zebra's (Quagga's). Die einen grasend, die andern einander neckend und spielend, dort eine Heerde Gnu's eines hinter dem andern wie in tiefes Nachdenken versunken gemächlich dahinschreitend. In ähnlicher Weise grasten mehrere Bläßbockheerden, während eine uns zunächst stehende, etwa 150 Thiere starke Zebraheerde, sich in weitem Bogen langsam nach dem Süden zu bewegte. Zahllose Hartebeeste weideten in kleineren Heerden und, wie immer, näher an den Gebüschen, schwarze Gnu's in Rudeln von 10-80 Stück über die ganze Ebene zerstreut, während es zwischen ihnen und den Zebra's, ja überall, wohin man auch sehen mochte, von Springbockgazellen wimmelte. Eine artenreiche Vogelwelt brachte in dieses reizende Bild erhöhte Bewegung. Vor Allem waren es die großen Trappen Eupedotis Kaffra und Kori zwei der schon oft erwähnten Zwergtrappen, Chenalopes, Enten, Kibitze, Ibise, Kraniche, Fischreiher, Regenpfeifer und viele andere, welche durch ihr buntes Gefieder und ihre schlanken Gestalten, durch ihren meist nahe über den Boden dahinstreichenden Flug und durch ihr in allen Modulationen ertönendes Gepfeife und Geschnatter in die Augen sprangen.
Obwohl ich auf der ersten Reise so manche Scene südafrikanischen Thierlebens gesehen, dieses Bild auf dem zwischen der von mir Jungmanns-Pfanne benannten Salzpfanne und dem Konanaflüßchen gelegenen Hochplateau übertraf die kühnste Phantasie, es mußte selbst den Gleichgiltigsten zum Naturfreunde machen. Nachdem wir uns—unsere armen, müden Zugthiere völlig vergessend—wohl eine Stunde lang an diesem Anblick geweidet hatten, beriethen wir uns über die Wahl eines geeigneten Lagerplatzes. Der eben genossene Anblick hatte in mir den Entschluß gereift, hier einige Tage zu verweilen.
Diese Ebene reicht mit anderen zusammenhängenden bis gegen den oberen Hart-River nach Osten, bis zum Maretsane-Fluß nach Norden und bis gegen Mamusa nach Süden, bedeckt einen riesigen Flächenraum und gehört zum größten Theile zum Gebiete des Königs Montsua. Sie hat keinen merklichen Abfall, kaum hinreichend, daß das überschüssige Regenwasser mit Ausnahme der unmittelbaren Uferpartien einen Abfluß nach dem Hart-River, dem Maretsane, Konana und Mokara findet, daher treffen wir auf derselben zahlreiche größere und kleinere Salzseen und eine Unmasse seichter Vertiefungen, die zur Regenzeit durch Wasserlachen gefüllt sind. Diese Salzpfannen scheinen zum Gedeihen des Wildes wesentlich beizutragen.
Eine solche Vertiefung, etwa drei Meilen von der Stelle, wo wir standen, wurde zum Lagerplatze auserwählt. Als wir mit unserem Wagen durch die Ebene zogen, waren es zuerst die Zebra's und die Bläßbockantilopen, welche die Flucht ergriffen; einige der zahlreicheren Heerden, wie die Zebra's, jagten gegen eines der Gehölze, um durch eine der vielen Lichtungen in demselben auf die nächste Ebene zu flüchten.
Am Nachmittag machte ich mit E. und B. einen Ausflug in südlicher Richtung, wobei wir Gelegenheit hatten, die Gnu's ziemlich nahe beobachten zu können, einige der Thiere blieben ohne Scheu stehen, andere rannten südwärts, als wir auf der Rückkehr etwas näher an das eine Gehölz herantraten, setzten sich sämmtliche Thiere—eine wenigstens 300 Stück zählende Gnuheerde—eine hohe Staubwolke aufwirbelnd, in Bewegung und wandten sich an uns vorbei nach Süden (windabwärts). Das interessante Schauspiel wiederholte sich auch am folgenden Morgen und war durch eine nicht weniger anziehende Fata Morgana noch erhöht, welche die einzelnen Thiere riesig gestaltete und die hüpfende Bewegung ihres Laufes in den über dem fernen Horizonte liegenden Luftschichten widerspiegelte.
Am folgenden Abend beschlossen wir an einem der zahlreichen, von den Regenlachen gebildeten, seichten Löcher auf den Anstand auszugehen. Deutlich konnten wir das Brummen der Gnu-Stiere hören, die ihre Heerden nach den Lachen zur Tränke führten. Am Morgen versuchten wir im südlichen Theile der Ebene eine Treibjagd, doch ohne Erfolg. F. und Pit hatten eine falsche Richtung eingeschlagen, und das Wild benützte eine entstandene, etwa 360 Schritte breite Lücke, um durchzujagen.
Zum Wagen zurückgekehrt fanden wir einige Barolongen, die von Konana kamen und auf eines der Mimosengehölze lossteuerten, in dem schon ihre Gefährten bei der beabsichtigten Treibjagd harrten. Sie trugen uns ihre Hilfe an, von der ich jedoch keinen Gebrauch machte, da ich weniger der Jagd als vielmehr der Beobachtung der Wildspecies obliegen wollte. Endlich kam der Abend und mit ihm eine Nacht, die mir ebenso unvergeßlich bleiben wird, wie der vorhergehende Tag, unstreitig die schlimmste Nacht in der ersten Hälfte meiner zweiten Reise. Bei Anbruch der Nacht war ich mit Boly ausgegangen, wir hielten uns nahe an unserem Bestimmungsorte und Jeder von uns suchte es sich in dem engen Erdloche so bequem wie möglich zu machen. Da ich mich kriechend einer Lache genähert, gelang es mir, meinen Platz einzunehmen, ohne die Vögel an dem Gewässer aufzuscheuchen. Dieser Vielen vielleicht unscheinbar dünkende Umstand ist aber für den Jäger auf den südafrikanischen Ebenen insoferne wichtig, als die aufgescheuchte Vogelwelt solch ein Zetergeschrei erhebt, daß das Wild, auf eine nahende Gefahr aufmerksam gemacht wird und dann die gewöhnlichen Pfade meidet.
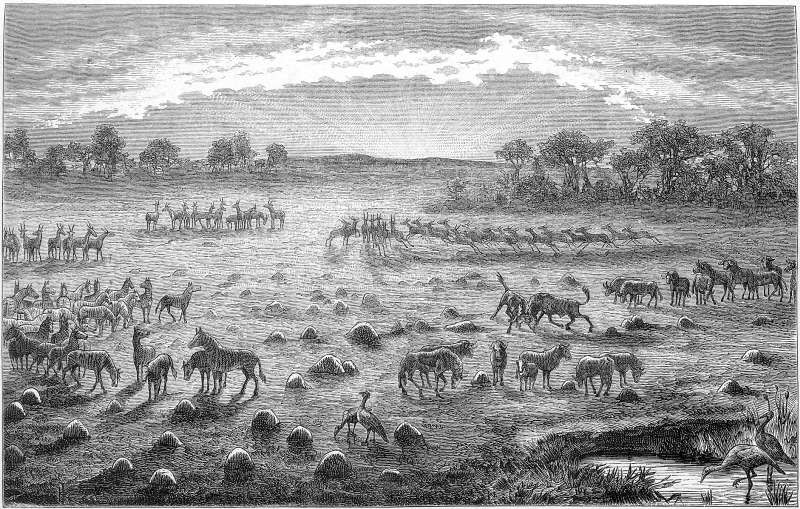
[Wild auf den Quaggaflats.]
Die Nacht war ziemlich dunkel, im Norden blitzte es unaufhörlich, ein Gewitter zog dort nach Osten zu. Außer dem zeitweiligen Gepfeife und Geschnatter in dem Gewässer vor mir war die Stille um mich nicht unterbrochen; einigemale schien es mir, als ob ich das Grunzen des schwarzen Gnu's hören würde, doch es mochte nur Einbildung sein, die meine Gedanken in der Erwartung dieser Thiere eben nur auf sie concentrirte. Einmal hörte ich deutlich das Schlürfen von Wasser, ähnlich wie es die Hunde thun, ich strengte mich an, den Gegenstand zu erkennen, doch war dies nicht möglich, es mochte wohl ein Schakal sein, der sich mir windabwärts genähert hatte.
Ich lauschte noch in der Stille der Nacht hin, als ich plötzlich das erwartete Grunzen vernahm. Ich richtete mich etwas auf, um desto deutlicher hören zu können, richtig, ja das sind schwarze Gnu's; ich lege das Ohr an eine vom Gras entblößte harte Stelle und vernahm deutlich den dumpfen Schall, den eine auf dem Wildpfade dahinschreitende Gnuheerde hervorbringt.
Freudig und in gehobener Stimmung ducke ich mich wieder nieder, sowie ich jedoch wieder aufschaue und mit dem Blicke die Richtung suche, in der ich die Annäherung des Wildes erwartete, blizt es ziemlich hoch am nördlichen Himmel auf, dort, wo ich zuvor das Gewitter beobachtet.
Ich unterschied ein mehrstimmiges Brummen und etwas später erschien ein dunkler Gegenstand am gegenüberliegenden Ufer der Lache. Das Gnu ging um das Gewässer nach mir zu, kehrte um, kam wieder zurück und nun sah ich es von mehreren anderen gefolgt. Sie standen eine geraume Zeit, ohne sich zu nähern, dann trat der Leitstier von einem zweiten Thiere begleitet vor und kam auf das sandige Ufer zu. Da steht das Thier einige Schritte vor mir mit dem Kopfe nach mir zugekehrt, daß ich nur diesen Theil und die Lache darunter sehe. Ich ziele so wie es die Dunkelheit erlaubte, auf den Schädel und mit einem lauten Krach schlägt die Kugel ein. Ich springe auf, um meine Jagdbeute zu suchen, ohne mich weiter um die enteilende Heerde zu kümmern. Doch ich sehe nichts, ich reibe mir die Augen, mit dem Gewehrlaufe auf der Erde herumtastend, hoffte ich jeden Augenblick den Körper des gefallenen Thieres zu finden.—Doch alles war Täuschung. Der Schuß traf, trotzdem war das verwundete Thier noch mit den anderen geflohen. Das Aufleuchten des Blitzes am nördlichen Firmament brachte mich wieder zur Besinnung. Ich mußte für diese Nacht das Jagen aufgeben und zum Wagen zurückkehren.
Boly, der mit mir auf den Anstand gezogen, war noch nicht zurückgekehrt. Ich ließ F. mit einem Feuerbrande etwa 200 Schritte aufwärts gehen, um damit den vielleicht irre Gehenden sein richtiges Ziel zu weisen. Allein F. schwenkte den Feuerbrand bis es zu regnen anfing und noch immer war von B. nichts zu hören und zu sehen. Der Wind hatte sich inzwischen gesteigert und bald raste ein wahrer Orkan über die Ebene hin. Theilweise kam uns nun—und auch später als Blitz auf Blitz auf die Ebene niederfuhr—unsere etwas tiefere Lage zu Gute, allein sie hatte auch ihre Schattenseiten. Das Wasser fiel nicht allein in Strömen, es floß auch in solchen von der Ebene herab in die Tiefe und machte unsere Lage recht unbequem. Doch es war weniger diese, die uns beunruhigte, Boly's Zustand machte uns Alle sehr besorgt, sogar die Schwarzen sprachen von nichts Anderem, als wo doch der Baß B. sein möge. Blitz folgte auf Blitz, kaum war der Nachhall des einen Donners verhallt, folgte schon ein anderes Donnergebrüll und dazwischen schlug der Regen, von der rasenden Windsbraut getragen, so heftig gegen den Wagen an, daß wir uns kaum durch Schreien einander vernehmbar machen konnten. Die Atmosphäre war auch bedeutend abgekühlt worden, welcher Temperaturfall uns nach der furchtbaren Tageshitze und bei den bis auf den Leib durchnäßten Kleidern durchaus nicht willkommen war.
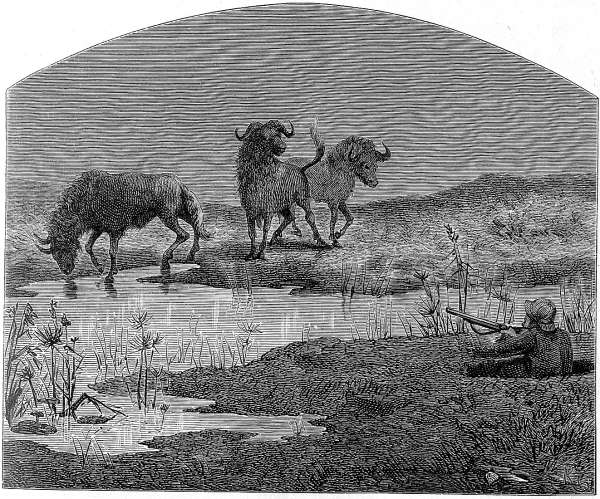
[Gnujagd bei Nacht]
Stunde auf Stunde verrann, das Gewitter war vorübergezogen, Regen und Wind hatten sich gemäßigt, endlich hörte der Regen gänzlich auf. Die Sorge um Boly's Schicksal ließ uns kaum zwei Stunden der Ruhe pflegen, zu der uns die Müdigkeit zwang. Am frühen Morgen sandte ich einen der schwarzen Diener nach Boly aus. Schon nach einigen hundert Schritten sah dieser den Gesuchten kommen, er war über und über mit Koth bedeckt und sah recht erbärmlich aus. Sein Körper zitterte vor Kälte, doch was uns alle erstaunte, war, daß er das Gewehr so rein zurückbrachte wie er es mitgenommen. Der Aermste hatte an einem Termitenhügel zusammengekauert das Unwetter über sich ergehen lassen müssen und hatte überdies, um seine Waffe schußbereit zu erhalten, dieselbe mit seiner Jacke umwickelt.
Am Abend fanden sich einige berittene Barolongen bei uns ein, welche uns ein Zebra für einen Sack Pulver (5 Pfund Gewicht) und zwei Stangen Blei (12 Pfund) zum Kaufe anboten. Sie hatten eine Treibjagd veranstaltet, dabei eine Zebraheerde »eingejagt« und von ihren Pferden eines mit den Assagaien so verwundet, daß das Thier zurückblieb und von den zu Fuße mit Gewehren nacheilenden Genossen erlegt wurde. Schon wollte ich den Kauf eingehen, als ich noch rechtzeitig bemerkte, daß das Fell sehr beschädigt und zum Präpariren ungeeignet war.
Die gesammten bis nach Mamusa reichenden Ebenen sind von etwa 70, in der Regel 100-300 Schritte breiten, 200-800 Schritte langen Mimosengehölzen bedeckt. Beinahe in jedem dieser Gehölze stoßen wir auf eine Eingebornentruppe, welche über dem Winter oder Sommer auf den wildreichen Ebenen der Jagd obliegt; trotzdem wird, da die Barolongen und Batlapinen meist schlechte Schützen sind, höchstens alle 2-4 Tage ein Stück Wild erlegt.
Die Formation dieser Ebene ist der harte, graue, im südlichen Transvaal-Gebiete erwähnte Kalkstein, dem hie und da das Vaalgestein aufliegt, im Gerölle sind häufig Rosenquarzstücke zu finden. An den Abhängen zum Konanaflusse sah ich mäßige Quarzitadern, einige Fuß hoch jenen Kalkstein durchbrechend, weithin in ihrer weißlichen Farbe schimmern.
Am 29. November Morgens machte ich einen Ausflug und kehrte mit einem Hyänenschädel heim. Im Allgemeinen hatten wir hier eine große Anzahl von Gnu-, Bläßbock- und Springbock-Schädeln gesammelt. Um Mittagszeit verließ ich den Ort und zog nach Osten, um den vom östlichen Taung nach Molema's Town führenden Weg zu treffen und auf diesem meine Reise nach Norden fortzusetzen. Nach einer sechs Meilen langen Tour hielten wir in einem Mimosengehölze Rast und trafen mehrere Barolongen, außerdem sahen wir zahlreiche verlassene Hütten. Um diese Hütten lagen förmliche Knochenhügel; mit Ausnahme der Hörner waren alle Knochen zerschlagen, es mußte wohl unzähligen der auf den Ebenen ringsum flüchtigen Thieren das Leben in den letzten Jahrzehnten gekostet haben, bevor diese Knochenhaufen aufgestapelt werden konnten. Ich suchte unter den Knochenresten nach pathologischen Mißformen und fand nur zwei verunstaltete Hörner. Beide Hörner waren durch Kugelschüsse abgeschossen, die entstandene Wundfläche zugeheilt und durch neuen Hornüberzug bedeckt worden; ich fand außerdem ein zum Lederarbeiten von den Eingebogen gebrauchtes, zugespitztes und durchlöchertes, an einem Riemchen hängendes Hornstück.
Bei einbrechender Dunkelheit schlugen wir an einem dicht bebuschten, in der Nähe eines Salzsees sich erhebenden Hügel, unter einigen schattigen Kaameeldornbäumen unser Nachtlager auf. Der sich unter uns ausbreitende Salzsee war trocken, allein an seinem Ufer, am Abhange des Hügels und der Ebene, fanden sich überall süße Quellen, die uns mit reinem Trinkwasser versahen. Zeitlich am nächsten Morgen machte ich einen kleinen Gang durch das Gehölz und fand abermals Knochenstätten und mehrere Gruppen verlassener Jagdhütten der Eingebornen; da ich auch mehrfach Hasen, Perlhühner, Rebhühner und Deukerantilopen bemerkte, entschloß ich mich, hier einen Tag zu bleiben. Der Tag war schön und lohnte meinen Aufenthalt in jeder Beziehung. Vogelbälge, zahlreiche Schlangen, Insecten und Krustenthiere, doch auch Pflanzen hatten am Abend meine Sammlungen bereichert. Meine Gefährten erbeuteten so manchen schönen Vogelbalg, darunter namentlich Bienenfänger, schwarze und kleine graue Würger, Regenpfeifer etc., während es mir gelang eine Chenalopes zu überlisten.
Der bewaldete Hügel erhob sich über der westlichen Ecke der Salzpfanne, doch auch das südliche und nördliche Ufer waren von felsigen, niederen Höhen begrenzt. Zwischen dem ersteren und den nördlichen Höhen öffnete sich ein Thal und hier führte ein gegenwärtig trockener Bach von der Ebene das überschüssige Regenwasser herab, der vorgestrige heftige Regen, der uns kaum 12 englische Meilen von dieser Stelle entfernt überraschte, hatte hier keine Spuren hinterlassen, war also, wie immer in dieser Gegend, im engsten Sinne des Wortes local gewesen. Von der Höhe herab vernahm ich das Geschnatter mehrerer egyptischer Gänse. Durch einen Busch am Abhange gedeckt, übersah ich die gesammte Pfanne, folgte dem Ufer und doch konnte ich nirgends das schreiende Thier zu Gesicht bekommen. Erst nach langem Suchen erblickte ich das Thier auf dem hervorragenden Aste einer halbvertrockneten Mimose. Da ich nur mit kleinem Schrot geladen hatte, mußte ich mich näher anzuschleichen trachten. Hier durch einen Busch, dort durch einen Block gedeckt, war es mir gelungen, unbemerkt in das Thal hinabzusteigen. Das Thälchen war mit niedrigen, blos stellenweise höheren, schütteren Büschen und einigen wenigen Bäumen bewachsen, doch der Boden war steinig, und ich mußte nun meine Fußbekleidung zurücklassen und barfuß weiter schleichen. Der Vogel saß hochaufgerichtet auf dem dicken Aste, gegen den Stamm zu sah ich ein Nest, welches ich später als das seine erkannte. Auf 60 Schritte nahegekommen, feuerte ich und erlegte die Gans, deren schöner Balg meiner Sammlung einverleibt wurde. Die Formation um diese Pfanne, welche ich Jungmanns Salzsee oder Chuai Jungmann taufte, war ähnlich jener des Vaalgesteins bei Bloemhof, die Grünsteinblöcke bis drei Kubikfuß groß.
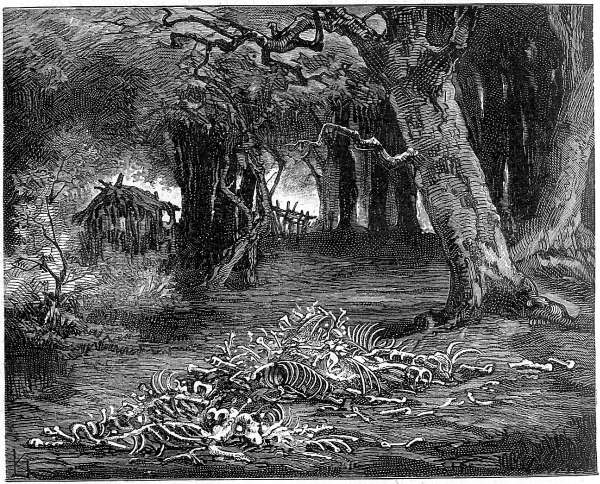
[Verlassener Jagdplatz der Barolongen.]
Nach Sonnenuntergang setzten wir unsere Reise wieder fort. Wir übernachteten auf einer unabsehbaren Ebene, die deutliche Spuren von Regenlosigkeit trug, der Boden war zersprungen, das Gras so trocken, daß es bei der Berührung bröckelte, und selbst die dahinjagenden Springböcke wirbelten Staubwolken auf. Der Wassermangel gab uns auch Veranlassung am nächsten Tage tüchtig auszugreifen, so daß wir an diesem Tage 18 englische Meilen zurücklegten. Auch das Wild war in diesem wasserarmen, nördlichen Striche recht spärlich geworden; zweimal trafen wir mit Barolongentruppen zusammen, welche Schießpulver erhandeln wollten; sie brachten Milch als Tauschartikel. In Folge ihrer Ungeschicklichkeit als Jäger und ihrer Arbeitsscheu schauten die Leute recht verhungert aus; wir gaben ihnen Schießpulver und etwas Beltong (getrocknetes Wildfleisch). Die Entdeckung einer mit reichlichem Wasser gefüllten Bodeneinsenkung gab das Signal, den heutigen Marschtag zu beschließen.
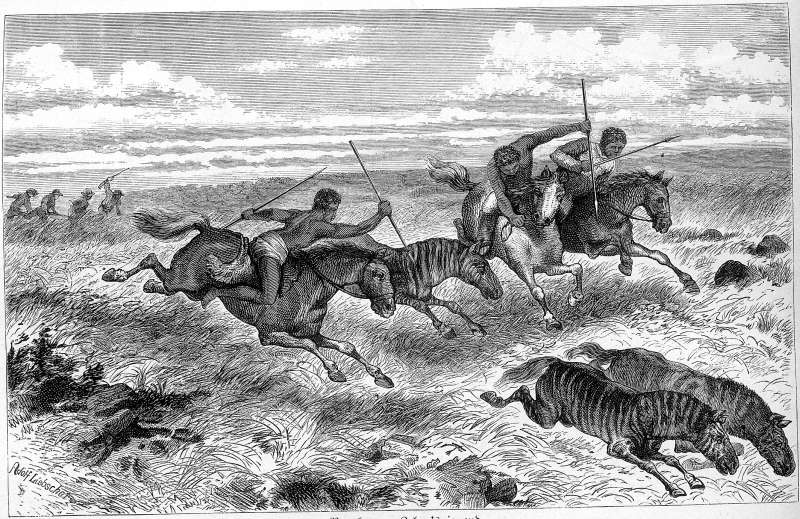
[Barolongen Zebra's jagend.]
Am Morgen des 1. December wurden wir durch den Besuch eines Boers überrascht, dessen Mitteilungen uns dahin belehrten, daß wir an der westlichen Grenze der Transvaal-Republik angelangt waren. Der in der Nähe unseres Lagers angesiedelte Boer wartete auf den Besuch des Präsidenten Burger, von dem er endlich Abhilfe von den unausgesetzen Grenzstreitigkeiten mit den Barolongen erwartete. Er theilte uns auch mit, daß zwei seiner Söhne in das Innere auf Elephantenjagd ausgezogen waren und ersuchte uns, ihnen im Begegnungsfalle seine Grüße zu entbieten. Von dem gesprächigen Farmer scheidend, setzten wir unsere Fahrt in nordwestlicher Richtung fort und gelangten auf eine reichlich mit Mimosen bestandene Ebene, zwischen dem Molapo- und Maretsaneflusse, dessen Quellen wir in der verflogenen Nacht, ohne es zu wissen, passirt hatten.
Einige der weißdornigen Mimosen waren auf dieser Ebene in voller Blüthe, mit hunderten und aber hunderten kleiner, grellgelber, kugelförmiger und duftender Blüthen behangen. Die Blüthen wie Blätter der bis zu 18 Fuß hohen Bäumchen waren äußerst zart und mit hunderten von verschiedenartigen Blumenkäfern (Cetonidae), sowie einigen rothgebänderten Holzböcken bedeckt; es wunderte mich, daß unter den zahlreichen Bäumchen blos zwei von den Insecten ausgesucht wurden, während an den Aesten zahlreiche weiße, über einen Zoll lange Puppen der großen Cicade klebten, die allenthalben ihre laute Stimme erschallen ließen, bei unserer Annäherung mit lautem Summen davonflogen und sich mit einem hörbaren Schlag auf dem nächsten Mimosenbäumchen niederließen. Auch buntfärbige Blattwanzen fehlten nicht und große stahlblaue Raubwespen zogen summend und nach Fliegen haschend um die Büsche. In gewohnter emsiger Weise schnurrend flogen zahlreiche Hummeln über den kräftig emporsprießenden Grasteppich hin, um für sich und die im nahen verlassenen Termitenhaufen eingenistete Brut Vorräthe zu sammeln.
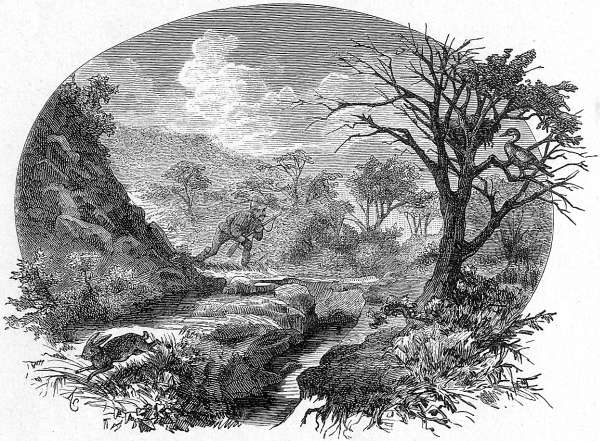
[Pürsch auf egyptische Wildgänse.]
Der südafrikanische Frühling war mit aller Macht in die Gegenden am oberen Molapo eingezogen, all' das kleine Gethier fühlte seine Herrschaft und war zum Leben erwacht, um ein neues Dasein zu beginnen; fremd, weder ersehnt noch willkommen schien er dem Menschen am oberen Molapo zu sein. Friede, neues Leben, vereinigtes Schaffen, Lust und Freude, das war um mich her an jenem Morgen auf den Fluren am Molapo der Hauch der verstandeslosen Natur. An Hader, Brand und blutige Thaten dachten, davon sprachen und damit drohten—die Herren der Schöpfung.
Nach einer kurzen Fahrt am Morgen des 2. Decembers langten wir bei dem Dorfe der Makuben an, welches am südlichen (linken) Ufer des Molapo gelegen, zu Molema's Town (d.h. die Stadt Molema's, eines Bruders des Königs Montsua) gehörte. Das Thal des oberen Molapo ist in den ersten 15 Meilen seiner Länge eng, von dem steilen Abfall des Hochplateaus eingeengt, in seinem weiteren Verlaufe ist es flach, ein mäßiger Einschnitt in die etwas nach Westen abfallende Hochebene. Wir hatten es in der letzteren Partie zu überschreiten. Das Bett des Flusses war hier von Kalktuff gebildet, der zahlreiche fossile Pflanzen enthält und deutlich darauf hinweist, daß dieser Thaleinschnitt schon vor Jahrtausenden als ein geräumigeres Flußbett benützt worden war. Dieser Kalktuff wird von dem harten, grauen Kalkstein überlagert und ist durch eine Unzahl kleiner Grotten, Höhlen, Löcher charakterisirt, welche die Tümpel der fast monatelang trockenen Flußrinne bilden. Oberhalb dieser Stellen und in den eingeengten oberen, wie auch in dem Bergthale ist das Bett schlammig und sumpfig und dieser Umstand ist wohl der Grund, daß in der trockenen Jahreszeit große Wassermengen verloren gehen und der Fluß schon nach wenigen Meilen seines Oberlaufes versiegt.
In dem marschigen Theile des Thales finden sich die westlichsten, die sogenannten Molapo-Farmen des Marico-Districtes, deren Besitzer ihre Felder continuirlich irrigiren können; in dem mehr offenen Theile finden sich die Niederlassungen der Barolongen[1], welche ihre hie und da nach europäischem Vorbilde angelegten Grundstücke zu bewässern im Stande sind.
1 Nach Westen erstreckt sich ihr Gebiet bis gegen Namaqualand.
Den Molapo (d.h. ein Fluß) überschreitend, lagerten wir an seinem rechten Ufer in der Nähe einiger Wartebichi-Mimosen. Gegen Sonnenuntergang blickend sahen wir Molema's Town vor uns, an einem mäßigen Abfall der im Hintergrunde bewaldeten Hochebene; im Osten ist die Stadt durch zwei interessante Felsenpartien begrenzt und im Schutze der einen, zwischen ihr und dem Flüßchen, stand das geräumige, im Style der Eingeborenen ausgeführte Missionshäuschen der Wesleyan Missionsgesellschaft.[1]
1 Dieselbe besitzt in Molema's Town, in Lothlakane und Poolfontein (zu der Zeit meines Besuches war die eine, die sich jetzt in Lothlakane befindet, in Moschaneng) je eine Station, von denen früher die in Molema's Town, gegenwärtig die in Lothlakane von einem weißen Missionär dirigiert wird. Außerdem ist Poolfontein auch der Sitz eines Predigers der deutschen Hermannsburger Missionsgesellschaft, der jedoch unter den meist der Wesleyan'schen Kirche angehörenden aus der südcentralen Transvaal-Republik nach der Poolfonteiner Ebene (auf Montsua's Gebiet) verpflanzten Borolongen eine schwierige Stellung hat. Poolfontein liegt zwischen Lothlakane und Lichtenburg.
Die erwähnten Felsenpartien, das mit Bäumen bestandene Ufer des kaum vier bis zehn Schritte breiten Flüßchens, sowie die vielen zwischen den Gehöften sich erhebenden Karie-, Kameeldorn- und Weidenbäume, welche den ganzen Abhang des Plateaus bedecken, verleihen Molema's Town eine der schönsten Lagen unter den Eingebornenstädten des centralen Süd-Afrika. Seine Gehöfte stehen weniger dicht aneinander und sind mit Zäunen versehen, aus denen sich die spitzig zulaufenden mit den Stauden der Kalebaß-Kürbisse überwucherten Dächer der Hütten erheben.
Zahlreiche Wägen zeugen von der zunehmenden Wohlhabenheit des Stammes, die namentlich dem Umstände zugeschrieben werden darf, daß König Montsua den Branntweinverkauf im Lande sistirte, eine Verfügung, welche Molema, der Unterchef und Gouverneur von Molema's Town, mit seiner ganzen Autorität zur Geltung brachte, ferner daß der früher hier ansäßig gewesene Missionär, europäischen Getreidearten in Molema's Town Eingang verschaffte.[1]
Was mich in Molema's Town besonders angenehm berührte, war das Verbot Molema's, der nebenbei gesagt ein Christ und Prediger ist, im Bereiche der Stadt keinen Baum zu fällen; wir hatten kaum unser Lager ausgeschlagen, als ein Eingeborner (einen Polizisten vertretend) im Namen des Fieldcornets (Sheriff, oberster Sicherheits-Beamter) bei uns erschien, um uns Weideplätze für die Zugthiere anzuweisen und das eben erwähnte Verbot zur Kenntniß zu bringen.
Bevor ich noch meinen Entschluß, Rev. Webb aufzusuchen, ausführen konnte, kam aus dem Missionshäuschen ein blondbärtiger, untersetzter Mann, ein kleines Mädchen an der Hand führend, auf mich zu. Es war der Gesuchte. Wir waren bald in ein eifriges Gespräch über Molema's Town und die Grenzfrage verwickelt. Von Montsua, dem Herrn des Landes, erfuhr ich, daß er in Moschaneng, in einer im Gebiete seines königlichen Freundes, des Banquaketse-Herrschers Chatsitsive, erbauten Stadt wohne und entschlossen sei, sich in Poolfontein niederzulassen, wohin jedoch, wohl um den unabhängigen Barolongenfürsten zuvorzukommen, die Transvaal-Regierung ihr unterthane Barolongen bereits angesiedelt hatte. Montsua war darüber sehr verdrießlich und im Begriffe, Moschaneng zu verlassen und sich in seinem Gebiete eine andere Stelle zum Baue der Residenz auszusuchen.[1]
1 Er hat dies auch später gethan, indem er der englischen Regierung die Oberhoheit über sein Gebiet antrug.
Des Missionärs Häuschen war nur auf das Nothdürftigste eingerichtet, denn aus den eben erwähnten Gründen betrachtete Rev. Webb seinen Aufenthalt nur als provisorischen, überdies war Molema selbst Prediger und den weißen Missionären nicht sehr gewogen. Rev. Webb und seine Frau, die ihrem Lebensgefährten in dieser Abgeschiedenheit treu zur Seite stand, riethen mir, baldigst nach Moschaneng aufzubrechen.
Herr Webb begab sich hierauf zum Chef Molema, um ihm meine Ankunft anzuzeigen. Als er heimkehrte, kam er mit dem an Asthma leidenden alten Manne zurück, der mich herzlich willkommen hieß und meinte, daß außer dem Naka (Doctor) Livingstone noch kein Naka zu ihm gekommen sei, er zeigte sich über meine Ankunft sehr erfreut, denn er hoffe, daß ich ihm doch ein Molemo (Medicament) bereiten werde, das ihm den garstigen Husten benehmen und ihm ein freieres Athmen gestatten würde. Zugleich lud er mich ein, ihn am folgenden Morgen zu besuchen, sowie meinen Aufenthalt auf einige Tage auszudehnen, er wolle mir als Gegenleistung ein fettes Schaf senden.
Am Morgen des 2. Decembers machte ich einen Ausflug thalaufwärts und fand dieses in allen, mächtige Humuslagen aufweisenden Partien dicht mit Kafirkorn angebaut. Ich war durch die ersten Anzeichen einer von Grahamstown bis zum Molapo vermißten tropischen Vegetation überrascht, welche sich durch manche Species bemerkbar machte, anderseits traf ich hier auch Pflanzen der gemäßigten Zone, in artenreicher Zahl, so Campanula Saponaria, Veronicae, mehrere der doldenblüthigen Euphorbiaceen und andere; auf den Wiesenflächen stand das Gras 4 Fuß hoch. Ich erlegte einen Fischreiher, mehrere Finkenarten, darunter zwei Feuerfinken und zwei Spornkibitze, die mich durch ihr lautes »Tik-Tik« angelockt hatten. Die auf den Feldern arbeitenden Frauen sahen bedeutend reinlicher als die Batlapinen aus und ich mußte auch später, als ich von Molema's Town schied, diesen sogenannten nördlichen Barolongen eine höhere Stufe als den Batlapinenstämmen und selbst als den Mokalana, Marokana etc. oder südwestlichen Barolongen einräumen, obgleich sie im Ackerbau und der Viehzucht von den südöstlichen Barolongen, die unter Maroka in Taba Unschu und der Umgebung dieser über 10.000 Einwohner zählenden Stadt wohnen, übertroffen werden; jenen kommt allerdings die Pferdezucht zu Gute, welche am Molapo wie in der Transvaal-Republik durch die grassirende Pferdekrankheit vereitelt wird.
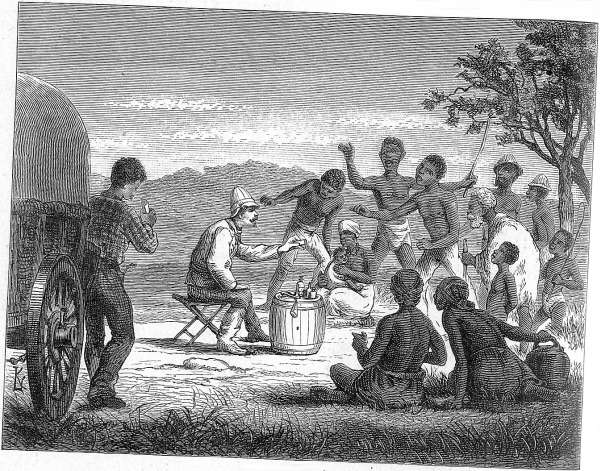
[Feldapotheke.]
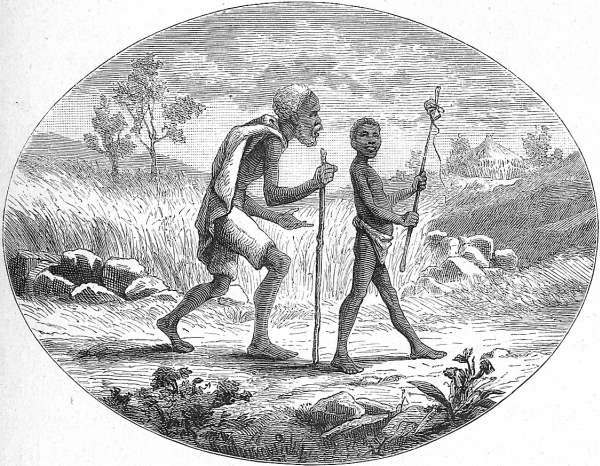
[Die Ueberbringer der Arznei.]
Ich bereite für Mrs. Webb und den Häuptling einige Medicamente, darunter auch Pulver, bei welcher Manipulation ich von den zahlreichen uns besuchenden Eingebornen angestaunt und bewundert wurde. Einer der Männer setzte sich neben Pit am Feuer nieder und fragte hier mit gedämpfter Stimme, was ich da thue, Pit meinte, ich bereite ein Medicament. Der Fragesteller mischte sich nun sofort unter die gaffende Menge und verbreitete unter ihr die Nachricht, daß ich ein Naka sei und eben ein Molemo bereite. Das dadurch hervorgerufene Erstaunen war in den Zügen Aller, der Männer, Frauen, ja selbst der Halberwachsenen deutlich zu bemerken. Einer raunte dem Andern die Worte »Naka und Molemo« zu und man konnte an den Lippenbewegungen beobachten, wie es sich die Einzelnen wiederholten. Ich hatte damit bedeutend an Ansehen und Respect gewonnen und es wurde so stille um mich, daß man jedes Wort der abseits am Feuer sprechenden Diener vernehmen konnte. Jede, auch die geringste meiner Bewegungen wurde mit dem größten Interesse verfolgt, am meisten jedoch das Abwägen der gleichen Theile und das Einschütteln der Pulver in die von F. am Wagenbrette zubereiteten Papierhülsen. Als ich meine Arbeit beendet, frug ich, ob einer das Molemo zum Chef Molema tragen wolle; Alle, die Männer wie die Knaben, schrieen durcheinander, manche eine, manche beide Hände darnach ausstreckend. Jeder wollte der Ehre theilhaftig werden, des weißen Naka's Medicin dem geliebten Häuptlinge zu überbringen. Bei solcher Auswahl hatte ich die Laune, auch wirklich wählerisch zu sein, ich suchte mir den Aeltesten im Haufen aus, ein gebeugtes, weißhaariges Männchen, das gar nicht seinen Augen trauen wollte, und gab ihm die zu einem Päckchen geformten Pulver; er wollte sie jedoch nicht berühren, sondern bat mich, sie ihm an seinen Stock zu binden, den er nun vor sich hertragen wollte. Da ihm dies jedoch, beschwerlich fiel, so ergriff ich einen der zunächst stehenden Jungen, seine Peitsche fassend befestigte ich an dieser das Päckchen und hieß ihn dem Alten folgen, was diesem erwünscht war, und den Haufen um mich zu befriedigen schien, denn wiederholt hörte ich den Ausruf monati, monati (schön).
Am folgenden Tage hatte ich den Häuptling wieder zu besuchen. Molema empfing mich in seinem Höfchen, stellte mir seine Frau und seine um ihn herum wohnenden Söhne vor. Dann ließ er für mich und Herrn Webb je ein hölzernes Stühlchen bringen und bat mich, ihm die letzten Ereignisse und Tagesneuigkeiten aus der Cap-Colonie und den Diamantenfeldern mitzutheilen, erkundigte sich nach den Verfügungen der englischen Regierung im Süden, klagte über die Anmaßungen der Boers im Osten und frug mich endlich, ob ich ein Engländer oder Boer wäre. Die ihm von Herrn Webb ertheilte Antwort, daß ich ein Böhme (Bohemian) sei, konnte er nicht begreifen und ließ, nachdem er noch nach meinem Namen gefragt, die beiden ihm so fremd erscheinenden Worte von den im Höfchen herumsitzenden alten Barolongen so oft wiederholen bis er sich dieselben eingeprägt hatte. Als ich von ihm schied, mußte ich ihm versprechen, ihn so oft ich in das Land der Barolongen käme, zu besuchen, ich würde ihm stets willkommen sein. Ich traf hier auch den Häuptling Schebor von Konana, der zu Molema auf Besuch gekommen war, und dieser entschuldigte sich, daß seine Leute, von denen wir drei Ochsen für einen Hinterlader eintauschen wollten, sich verspätet hatten, wodurch der Handel nicht zu Stande kam.
Den kommenden Nachmittag verbrachten wir mit Fischfang, der ein äußerst ergiebiger war (wir fingen nicht weniger als 42 Welse). Als Köder benützten wir die überall häufigen, 1½ Zoll langen Grasheuschrecken. Das Wasser in den Grotten der Tufffelsen war so klar, daß man auch jedes größere Sandkörnchen auf eine Tiefe von 2½-6 Fuß unterscheiden konnte. Wir hatten kaum unsere Angeln ausgeworfen, als die dunkle Gestalt eines schildköpfigen Welses (Glanis siluris) aus einer der Seitengrotten herauskam, den Köder langsam umschwamm und dann ahnungslos verspeiste. Die Thiere wogen alle ¾-1 Pfund; als ich im Jahre 1875 während meines zweiten Besuches an derselben Stelle fischte, fand ich nur kleine, braune, 6 Zoll lange Thiere; die Trockenheit des Jahres 1874 hatte die meisten der Grotten trocken gelegt und die Fische getödtet, die neue Brut war mit den Regenfluthen aus den Sümpfen des oberen Molapo herabgekommen.
Herr Webb versah mich mit zwei Briefen, an Herrn Martin, einen in Moschaneng wohnenden Händler, und an den König Montsua, den ihm der Erstgenannte vorlesen sollte. Montsua's Titel lautete: »Morena Montsua (Montsiwe, Montsiva) Khoschi ca Barolong.« Außerdem machte mich mein neuer Freund auf zwei alte, unter den Barolongen noch vor ihrer Kenntniß des Christenthums geläufige Sagen aufmerksam. Die eine berichtet von einem Chef, der nach Belieben die Gewässer eines Flusses theilen und durch die so entstandene trockene Stelle schreiten konnte, und die zweite erzählt von einem Chef, der gleich Salomon zwischen zwei Frauen zu entscheiden hatte, von welchen jede ihr Mutterrecht an einem und demselben Kinde geltend machen wollte.
Am 5. brachen wir endlich auf, und zogen nordwärts am Fuße einer bewaldeten Erhebung. Die nächste Umgebung unserer Route bot mir reichlich Gelegenheit, meine Insectensammlung zu bereichern; unter anderen fand ich eine schöne große, mir bisher unbekannte Schildkäferart, deren Flügeldecken grünlichgolden und braun punktirt waren und die ich häufig an einer der gemeinsten Nachtschattenarten Süd-Afrika's antraf. Meine Aufmerksamkeit war auch auf die zahlreichen, den Weg säumenden Kameeldornbäume gerichtet, die mit den Nestern des Siedelsperlings (Philetaerus socius) dicht bedeckt waren.
In einer Bodenvertiefung nahe einem nach Nordosten dem Taung oder Notuani-River zufließenden Bache beendeten wir unsern heutigen Marsch. Die zu einem förmlichen Niederwald angewachsen Kameeldornbestände durchziehend stießen wir am nächsten Morgen auf ein Makalaharidorf, dessen Insassen Hirten und Jäger Montsua's waren. Sie schilderten uns den weiten Weg bis nach Moschaneng in sehr düsteren Farben und meinten, wir würden mit den schwachen Zugthieren kaum die Königsresidenz erreichen. Der Weg war auch thatsächlich äußerst beschwerlich, der tiefe Sand ermüdete die Thiere in hohem Grade, dazu war der Wald von zahllosen kleinen, 1-2 Fuß tiefen Senken (in der Regenzeit Tümpel) durchsetzt; der von dem Sandboden aufsteigende Staub trocknete Mund und Luftröhre in bedenklicher Weise aus und schmerzte im Gesichte. An einer kleinen der eben genannten ausgetrockneten, mit frischem Gras überwachsenen Senken fand ich zu hunderten eine metallischblau glänzende Lytta mit einem rostrothen Flecke (ich traf sie später nur noch einmal und unter ähnlichen Verhältnissen auf meiner dritten Reise im Schescheker Walde, etwa 15 Meilen nordwestlich von Schescheke an), auch schoß ich einen über uns kreisenden Honigbussard (Pernis apivorus).
Dieser Zustand des Weges blieb sich auch am folgenden Tage gleich und an zwei zum größten Theil trockene Salzpfannen angelangt, schien es kaum möglich, die mit 14 Zoll tiefem Sand bedeckten Pfannen zu passiren. Unter Anwendung aller erdenklichen Auskunftsmittel und mit vereinten Kräften gelang es nach stundenlanger Arbeit, das jenseitige bewaldete Ufer zu erreichen. Die nun folgende Rast war redlich verdient. In dem Walde fanden wir zwei eßbare Beerenfrüchte, und zwar die schon vom Hart-River bekannte rostrothe Beere des Blaubusches (die Samenkerne derselben werden von den Koranna's als Schrot verwendet) und gelbliche, unseren Johannisbeeren nicht unähnliche Beeren, die von den Boers wilde Granaten, von den Koranna's geip genannt und gerne genossen werden.
Wir näherten uns am nächsten Tage einem unseren Weg kreuzenden Höhenzuge, der uns von vorbeiziehenden Barolongen als Malau's Höhen bezeichnet wurde und dessen höchste, bisher namenlose Kuppe ich Hußhöhe nannte. Ich hatte an diesem Tage Gelegenheit, meine Sammlungen um eine Zwergeule und den Balg eines Milans zu vermehren. Am Fuße der Höhen stießen wir auf zahlreiche Viehposten der Baharutse und Barolongen von Moschaneng, welche ihr Vieh an Regenlachen tränkten, während sie selbst ihren Wasserbedarf den natürlichen Felsencisternen entnahmen. Die Abhänge der Höhen waren zum größten Theile hochbegraste Triften, zur Viehzucht wie geschaffen. In der Nacht begegneten wir zwei mit Elfenbein beladenen von Schoschong, der Stadt der östlichen Bamanquato kommenden und von den Elfenbeinhändlern Francis and Clark nach Grahamstown abgesandten Wägen.
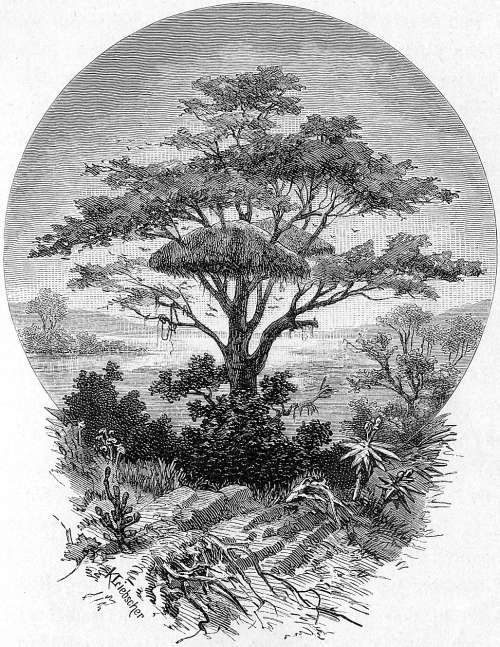
[Nest des Siedelsperlings.]
Am 9. hatten wir den Sattel der Malauhöhen erreicht und lagerten zwischen grünen, gruppenweise zusammenstehenden mit Zaunrüben, Cucurbitacaeen und Lianen überspannten Büschen, auch schattige Kameeldornbäume fehlten nicht, in denen sich namentlich die langschwänzigen, schwarzweiß gescheckten Würger bemerklich machten. Große Turteltauben waren nicht selten und zum ersten Male vernahm ich hier einen Pfiff, der einem Psittacus anzugehören schien. Dem Rufe folgend hatte ich auch die Freude, ein Pärchen kleiner, graulicher, am Kopfe und den Flügelwurzeln gelb gefleckter und an der Brust schön grün gefärbter Papageien zu entdecken. Diese Species (Psittacus Rupelii) ist bis über den Zambesi verbreitet, lebt meist paarweise und nistet in Baumlöchern.
Auf unserer Weiterfahrt fand ich neben dem Wege einen getödteten Schlangenadler, den wohl ein einfältiger Barolonge aus Muthwillen erlegt und dann abseits vom Wege in den Busch geworfen haben mochte. Wir hatten mehrere Thäler zu überschreiten und steile, äußerst steinige Höhen zu erklimmen. Auf einem der Hügel hatte Niger eine Schlange entdeckt und sie in einen Dornbaum gejagt; und da ich den Schlangen Süd-Afrika's, nachdem man mir überall von den vielen Opfern, die jährlich den giftigen Schlangen dieses Kontinentes anheimfallen, berichtet, ewige Feindschaft geschworen hatte (alle, die nicht in Spiritus untergebracht werden konnten, wurden abgehäutet oder wenigstens enthauptet und der Kopf aufbewahrt), war ich auch bald mit dem Gewehre zur Stelle, um dem Hunde beizustehen. Das von ihm verfolgte Reptil war mehr denn daumenstark, grün und über vier Fuß lang und hatte sich in ein Bäumchen (Acacia giraffe) geflüchtet, in dessen dichtem Geäste es sich blitzschnell auf- und nieder bewegte. Ein Dunstschuß betäubte die Schlange, ohne sie zu tödten, ich ergriff nun das Schwanzende des Thieres, um es aus dem Dornengeäste herauszuziehen. Ich zerrte etwas heftiger—da gibt der neben mir stehende Pit einen Schrei von sich, ich kehre mich nach ihm, als durch ein schmerzliches Gefühl an meinem rechten Daumen meine Aufmerksamkeit rasch zu dem Object zurückgeführt wurde. Die Schlange hing mit ihren Kinnladen an meinem Finger. Mir wurde recht warm um's Herz, ich riß an dem Schwanzende, daß ich beinahe die Schlange entzwei gerissen hätte, wodurch das Thier vollends getödtet zur Erde fiel. Sofort rief ich nach Salmiak, beugte mich jedoch gleichzeitig zu dem Reptil nieder, um die Art zu bestimmen. Ist das nicht ein Bucephalus viridis (cupensis)? Eine gift- und harmlose Schlange? Das Köpfchen ergreifend öffne ich die Kinnladen, kein Giftzahn zu sehen, noch zu fühlen. Auf F. hatte dieser Zwischenfall einen tiefen Eindruck gemacht und ihn zum erbitterten Feinde aller Reptilien umgewandelt; während wir unsere Fahrt fortsetzten, ließ er kein Akazienstämmchen unbehelligt, seine Rache spähte eifrig nach einem Opfer, doch stundenlang mußte er nur über sich selbst die Rache der Dornen ergehen lassen.
»Hurrah, Halloh, Hurrah,« und ebenso viele Luftsprünge von Seite F.'s unterbrachen unseren Gedankenlauf; wir hielten den Wagen an, Weiß und Schwarz eilte auf den vor Freude übersprudelnden Jüngling zu. Da stand er, selbstbewußt, und wies siegesgewiß nach der Spitze des nächsten Busches. Doch nur einen Augenblick währte sein vermeintlicher Triumph, in das krampfhafte Gelächter, welches B. und E. mit den Schwarzen im Chorus anstimmten, mußte auch ich einfallen, als ich ein harmloses Chamäleon erblickt hatte. Der arme F. hatte aber auch entschiedenes Unglück mit seinen Anläufen zu Heldenthaten.
Der Wassermangel wurde am nächsten Tage schon äußerst fühlbar und obwohl wir von vorbeiziehenden Barolongen einige Töpfe mit Milch erstanden, war unseren lechzenden Zugthieren nicht gedient. In einem breiten Thale nach Norden bei Osten vordringend, hatten wir endlich die bewaldeten Abhänge der Ausläufer der Malauhöhen erreicht, eine frische Brise fächelte uns Armen Kühlung zu und zu unserer größten Freude versprach ein aufsteigendes Gewitter das heißersehnte Naß zu spenden.
Unsere Hoffnung ward nicht getäuscht, ein mäßiger Regenschauer füllte unsere Wassergefäße und gestattete die Thiere zur Noth zu tränken. Nun hieß es frisch weiterziehen, da ich die Absicht hatte, noch am selben Tage Moschaneng zu erreichen. Ein dumpfer Schall, der sich uns deutlich zu nähern schien, verzögerte unsere Abfahrt. Ueber die Ursache desselben wurden wir bald aufgeklärt.

[Auffangen von Regenwasser.]
Es erschien ein berittener Barolonge und ihm folgte eine Heerde von gegen 50 Pferden, welche von zwei anderen Barolongen angetrieben und deren seitliches Ausweichen von je einem an jeder Seite in dem Gehölze galoppirenden Eingebornen verhindert wurde. Unsere Ueberraschung, hier eine solche Pferdetruppe zu sehen, war nicht gering. Einer der Nachtreiber sprang auf einen Augenblick aus dem Sattel und berichtete uns, daß dies Montsua's, des Barolongenkönigs, Pferde seien, die er jährlich zu seinem Vetter Maroka nach dem Freistaat schicke, um sie daselbst während der Dauer der in den Betschuanaländern grassirenden Pferdekrankheit weiden zu lassen. »Hat denn Dein König so viel Pferde, wie die Zahl derer beweist, die an uns vorbeigejagt hatte?«—O, Master. Morena (der König) hat mehr denn diese, in der Stadt behält er sich nur die gesouten (gesalzenen) Pferde, welche eben die werthvollsten sind.«

[Wald am Fuße der Malau-Höhen.]
Nach einer kurzen Fahrt hielt ich eine Stunde Weges vor Moschaneng. Der Regen hatte hier alle Vertiefungen mit Wasser gefüllt, und die Stelle war ein anziehendes, gegen den Wind geschütztes, leicht bewaldetes, für einen zweitägigen Aufenthalt wie geschaffenes Thal, so daß ich hier von den Anstrengungen der Molapo-Reise auszuruhen und dann erst nach Moschaneng zu gehen gedachte, wo ich außerdem recht beschäftigt zu sein und für meine Zugthiere, der vielen in der Stadt gehaltenen Heerden halber, keine gute Weide zu finden glaubte.
In dem Gehölze gab es schöne (von den Boers so genannte) Buchenholzbäume, sowie die unter dem (fälschlichen) Namen wilde Syringa bekannten, wilden Oliven- und Kareebäume, Mohatla- und Morethwabüsche, Bäume und Sträucher mit ahornartigen, geflügelten Samen, mehrere Arten von Mimosen (Acacia detinens, Acasia giraffe, Acacia horrida), an den Höhen die von Süden her bekannten (doch wie es mir schien in neuen Formen vertretenen) Aloën. Hier schoß ich auch einen großen, grauen Lori (Go-away von den Engländern, grote Mausevogel von den Holländern genannt), ferner eine braune Gabelweihe und zwei gelbgeschnäbelte Tukane. Der erstere Vogel nistet auf den höchsten Spitzen der Bäume, von wo er mit nach rechts und links bewegendem Köpfchen Alles ihm fremd erscheinende beäugelt, und dabei so oft er sein häßliches Geschrei go-a-wäh ausstößt, seinen Schopf hoch ausrichtet. Am 11. December machte ich mehrere Ausflüge in die Umgegend, die meinen Sammlungen sehr zu Statten kamen. Unter der Ausbeute befanden sich Papageien, sechs jener Lori's, Witwen, Tukane und zwei Kukuksarten, eine kleine, grün und grau melirte, rothbeschopfte Spechtart und Würger.
Unsere Ankunft führte, da ich F. nach der Stadt entsendet hatte, um den dort ansässigen holländischen Schmied zu entbieten, bald mehrere Besucher herbei, deren erste scheu hervorgebrachte Frage dem Feuerwasser galt. Ihre Verlegenheit bewies mir, daß Montsua's Ruf als Gegner des Branntweins begründet war.
Nachmittags erhielten wir einen andern Besuch aus Moschaneng, und zwar den ehrendsten im Lande der Banquaketsen, deren Gebiet wir (ungefähr unter 25° 10' südlicher Breite) etwa halben Weges zwischen Molema's Town und dem jetzigen, 70 englische Meilen davon entfernten Aufenthalte überschritten hatten. Ein gedeckter, zweirädriger mit vier Pferden bespannter Karren kam angefahren, bog im Gehölze um und dann gerade auf uns zu. Während Stephan die Pferde hielt, stiegen die Insassen, vier Eingeborne, aus. Zuerst ein junger Mann von etwa 25-28 Jahren, der sich uns als Mobili, den Sohn eines Basutohäuptlings vorstellte und der F. von Kimberley aus kannte, wo er ob seiner englischen Erziehung und seiner Fertigkeit in der englischen Sprache durch einige Zeit als Dolmetsch bei dem Gerichtsamt angestellt und ein Lebemann südafrikanischen Anstrichs war. Er war auf einer Rundreise unter den Betschuanahäuptlingen begriffen und eben vor wenigen Tagen vom Könige der Bakwena's angekommen. Mobili stellte uns nun, nachdem er mit F. Händedrücke ausgetauscht, die übrigen drei Personen mit den Worten vor. »These are two of the most distinguished Bechuana Kings (zwei der hervorragendsten Betschuanakönige), Montsua, jener der Barolongen, of a wealthy and mighty tribe (über einen wohlhabenden und mächtigen Stamm), hier Chatsitsive, König der Banquaketsen und dort der Hauptrathgeber oder der Vice-Kanzler des Banquaketse-Reiches.«
Montsua, ein Mann von über 50 Jahren, wohlbeleibt mit einem stets lächelnden, gutmüthigen Gesicht, flößte mir sofort Zutrauen ein. Chatsitsive, ein großer, hagerer Mann, zeigte deutlich, wie auch sein Reichskanzler, daß sie ihr faltenreiches Antlitz den Umständen anzupassen verstanden. Alle waren europäisch gekleidet, Chatsitsive mit einem langen Ueberrock und Cylinder und sein Factotum mit einem Mentschikoff. Nachdem wir während des Gesprächs, das Mobili und Pit als Dolmetscher leiteten, scharf gemustert worden waren, meinte Montsua, daß er mich im Weichbilde seiner Stadt willkommen heiße, er wäre wohl nicht eigentlich auf seinem Gebiete, er lebe hier auf dem Boden seines Freundes Chatsitsive und habe vor langer Zeit schon den Molapo verlassen, weil er von den Boers bedrängt worden war; er sei nun aber ihres Treibens satt und wolle Moschaneng verlassen, um sich am Molapo oder in Poolfontein oder am Lothlakaneflüßchen eine Stadt zu bauen, dann müsse ich kommen und ihn besuchen.
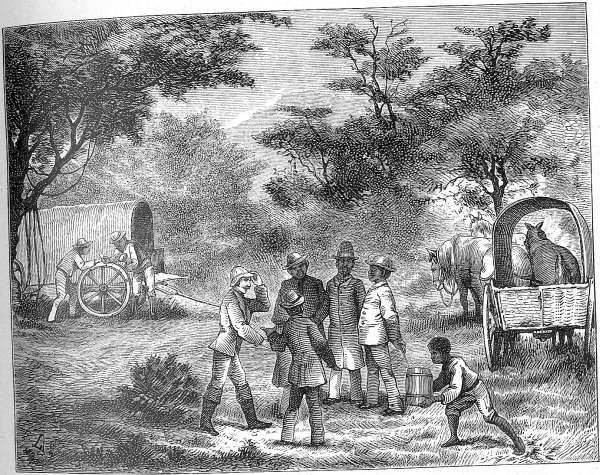
[Königliche Besucher.]
Hierauf wurde ich über Ziel und Zweck meiner Reise befragt. Als Antwort zeigte ich einige der Vogelbälge, welche mit Staunen betrachtet wurden. Mobili verdolmetschte dem König die Bearbeitung des Balges, was dieser jedoch nicht begreifen konnte und darüber unaufhörlich den Kopf schüttelte. Als ich den König zur Vorsicht mahnte, da Gift in der Haut des Balges enthalten sei (Mobile übersetzte es mit molemo maschwe, schlechte, böse Medicin) stieß der alte König einen leisen Schrei aus und ließ den Balg fallen; die Betschuana's fürchten nichts mehr als künstlich zubereitetes Gift, jedes Medicament, das nicht hilft und eine Verschlechterung des Kranken herbeiführt oder den Tod nicht verhüten kann, wird als Gift betrachtet »O,« seufzte Montsua, und er wie seine beiden Genossen besahen sich die Hände und fingen an, die Aermel ihrer Röcke aufzuschlagen, um sich die Finger im Sande abzureiben. Ich ließ Wasser und Seife bringen und holte eines meiner Handtücher, das Montsua noch immer mit einem besorgten Gesichte annahm und sich nicht eher beruhigte, als bis ich ihm durch Mobili die Wirkungslosigkeit des Giftes auf der menschlichen Haut erklären ließ.
Größeres Erstaunen aber als der Vogelbalg, und laute Ausrufe selbst auch von Seite des sich den Anschein eines Gelehrten gebenden Mobili folgten, als ich zwei meiner mit Reptilien, Schlangen, Eidechsen, Fröschen und Spinnen gefüllten Flaschen vorwies. Alle vier Besucher waren dabei zurückgewichen und Montsua, seinen Kiristock gegen die Flasche vorhaltend, wollte nicht näher herantreten. Bald mich, bald die Flasche anstaunend beruhigte er sich erst, nachdem er sich überzeugt hatte, daß die Schlangen in dem Butshuala a Makao (im Biere des Weißen) »schliefen« und nicht heraus konnten.
Inzwischen war ein Mokka fertig geworden und die Blechbecher wurden herumgereicht. Unterdessen besah sich Montsua den Wagen, frug die Jungen (Diener), woher sie kämen und mich endlich, was sein Bruder Molema thue, ob er wohl sei; ich antwortete ihm, daß er an seinem alten Uebel leide und daß ich ihm ein Molemo gab, was ihm wohl helfen dürfe. Montsua nahm diese Nachricht mit beifälligem Schmunzeln auf.
Sowie sich auch Chatsitsive gesetzt, frug Mobili, ob ich den »hohen Herren« keine andere Erfrischung zu bieten hätte. Ich verneinte, ich wüßte nicht, was ich ihnen antragen könnte. Mobili stand auf, kam zu mir herüber und meinte, ich solle Pit und Stephan um Wasser schicken, er wollte mir etwas sagen, die Diener dürften jedoch nicht dabei sein. Ich that es und nun entpuppte sich das Geheimniß. Ich sollte jedem einen Schluck Brandy anbieten. Ich that es und Montsua meinte, daß er seinen Unterthanen Brandy anzubieten nicht gestatte, daß er ihn selbst nur ein oder zwei Mal im Jahre und dann nur zu einem halben Glas Wein trinke. Ich schenkte ein, Montsua trank etwa einen halben Löffel voll, griff aber darauf sofort nach Wasser. Chatsitsive brachte zwei Löffel voll hinunter, verzog aber dabei sein langes Gesicht derart, daß selbst Montsua (mit uns) in ein krampfhaftes Lachen ausbrach. Chatsitsive ließ etwa einen Löffel in dem Blechbecher übrig, reichte ihn dem Vize-Kanzler, und dieser leerte ihn rasch, worauf er den Rest mit dem Finger zu erhaschen sich bemühte. Mobili spülte den halben Becher hinab, ohne eine Miene zu verziehen.
Nachdem die hohen Herren uns allen die Hände geschüttelt hatten, und sogar die Diener mit einem Kopfnicken bedachten, stiegen die Besitzer von einigen hundert deutschen Quadratmeilen Landes in ihren Karren, Mobili nahm die Zügel zur Hand, um sich zur Abfahrt fertig zu machen; da legte sich Montsua's Linke an seine Schulter, während er mir mit der Rechten noch einmal an den Karren heranzukommen winkte. Mit zwei Sätzen war ich an seiner Seite und der Dolmetscher frug mich in des Königs Namen, wo ich den für ihn bestimmten »Rumela« (Empfehlungsbrief) des Missionärs Webb habe. Ich holte beide Schreiben und bat nun den König, den zweiten an seine Adresse zukommen zu lassen, konnte jedoch nicht umhin, meiner Verwunderung Ausdruck zu geben, daß man am Hofe zu Moschaneng schon von der Sache vernommen hatte. Montsua lachte. »Ja,« meinte er, »ich weiß es seit drei Tagen, denn an Euch gingen eines Tages, während Ihr schliefet, zwei Barolongen von Molema's Town vorüber, welche mir die Nachricht von Deinem Besuche der Stadt, Deinem Thun daselbst und von dem Zwecke Deiner Reise, von den beiden Briefen und der guten Wirkung Deines Molemo an Bruder Molema zu berichten hatten.«
Am folgenden Morgen besuchte mich Herr Martin, einer der besten Männer unter den Weißen, die ich unter den central-südafrikanischen Eingebornen gefunden, zugleich mit Gentuña, dem Häuptling der Baharutsestadt, welche den nördlichen, durch einen Bach getrennten Theil von Moschaneng bildet. Wir hatten eine längere Unterredung, die mir sehr willkommen war.[1] Ich benutzte jeden freien Augenblick zum Sammeln und war mit dem Aufenthalte in dem traulichen Gehölze sehr zufrieden.
1 Kanja (Kanje) die Hauptstadt der Banquatetsen (oder Ba-N'Quatetsen) und Chatsitsive's Residenz liegt neun englische Meilen, Süd bei Ost, von Moschaneng; eine Tagreise weit ostnordöstlich (zwischen 17 und 20 Meilen liegen die Ruinen der früheren Residenz des Balwenakönigs Seschele, doch in ihrer Nähe, nur durch ein Flüßchen entfernt, gegenwärtig zwei Eingebornenstädte, die diesseitige, welche an Chatsitsive's Gebiet liegt von den Manupi und eine zweite an Seschele's Gebiet grenzend, die von den Makhosi bewohnt wird (seitdem sind die Makhosi ausgewandert). Herr Martin sprach sich sehr lobend über Gentuña aus. Herr Martin hatte mit einem anderen Händler auch einen Jagdzug nach dem westlichen Matabeleland unternommen, dabei jedoch durch Krankheit, die Tsetse und andere Unannehmlichkeiten viele Zugthiere und im Allgemeinen sehr viel eingebüßt. Er war an die Tochter des vor Kurzem verstorbenen Districtbeamten des Maricodistrict verheiratet und seine Frau wohnte theils bei ihren Verwandten in Zeerust, theils lebte sie mit ihm in einem kleinen Häuschen in Moschaneng, das er mir gastlich zur Verfügung stellte.
Am 14. Nachmittags setzte ich meine Reise nach Moschaneng fort. Die Fahrt dahin ging durch angebaute Felder und in einem offenen sich nach Osten ausbreitenden, nach Westen durch Felsenhöhen und zu unserer Linken nach Süden durch bebuschte Höhen begrenzten Thale; die letzteren bildeten als die nördliche Kette von Malau's Rand die Höhen von Moschaneng. Malau's Rand ist wiederum als der südcentrale Theil der Banquaketsehöhen zu betrachten, welche durch die Lekhutsa und Makarupuhöhen in östlicher Richtung mit dem westlichen Gebirgsknoten des zentralen Süd-Afrika zusammenhängen.[1]
1 Ich unterscheide drei Gebigsknoten im centralen Süd-Afrika; einen östlichen, die Magalisberge; einen westlichen, das Marico-Höhennetz; und einen nördlichen, den im Matabeleland.
Von Moschaneng nach Molopolole.
König Montsua und das Christenthum.—Die Wesleyan-Mission in Moschaneng.—Besuch am Wagen.—Meine ärztliche Praxis in Moschaneng.—Merkwürdige Termitenbauten.—Ein Intermezzo bei unserer Abreise.—Das Banquaketse-Hochland.—Anzeichen tropischer Vegetation.—Hyänenhunde.—Pittoreske Landschaftsscenerien an den Naprstek-Höhen.—Beleuchtungseffecte auf der Hochebene.—Ruinen von Mosilili's Stadt.—Klippdachsjagd.—Grasbäume.—Ein Thari.—Molopolole.
Der südliche Theil von Moschaneng war von Molema und seinen Barolongen bewohnt, und mit Ausnahme der schon verfallenen Kirche und dem Häuschen, in dem Herr M. wohnte, besaß es kein im europäischen Style aufgeführtes Wohnhaus. Die Häuschen der Eingebornen zeigten den, den Betschuana's eigenthümlichen Typus, nur waren sie ob des beschränkten Raumes sehr dicht nebeneinander erbaut, dagegen waren die Gehöfte des durch einen Bach und sein kleines Thälchen geschiedenen Stadttheils der Baharutse geräumiger. Ich schätzte die Einwohnerzahl beider Städte auf 7000, welche Zahl um circa 1000 auf- und abschwankt, da einestheils viele Bewohner längere Zeit in den Diamantenfeldern arbeiten, andere wieder die entfernten Felder bestellen. Des Königs Behausung, je ein Gehöft mit zwei Wohnungen für jede seiner fünf Frauen und sein eigenes stand in der westlichen Hälfte der Stadt nahe am Ufer des Bächleins.
Die Verfassung unter den Barolongen und Banquaketsen ist eine im gewissen Sinne constitutionelle, wenn auch etwas beschränkter als unter den Bakwena's und östlichen Bamanquato's. Unter den Betschuanakönigen steht nach Khama, dem nunmehrigen Könige der östlichen Bamanquato, Montsua obenan. Er ist ein Heide, doch besser als der christliche Seschele, obwohl er anfangs, als das Christenthum in's Land drang, aus Unkenntniß seiner Satzungen es lebhaft bekämpfte, da er befürchtete, daß dasselbe seine Unterthanen von ihm abwendig machen und seine königliche Macht schwächen könnte und daher alles aufbot, es wieder aus dem Lande zu verdrängen.
Wie bei den meisten Betschuanastämmen, unter denen Missionäre zu wirken begannen, waren es auch hier meist die jungen Leute, welche an den neuen Lehren Gefallen fanden, während die alten fest an ihren heidnischen Satzungen hielten. Montsua fiel dies auf und dies um so mehr, als sich die jungen Männer und Mädchen nicht in der entsprechenden Anzahl zur Circumcision einstellten, an den Hochzeitsorgien nicht theilnehmen wollten und viele andere heidnische Feste spärlich besucht waren. Unter den Betschuana's ist ein Tanz gebräuchlich, welcher Rohrtanz heißt, einem alten, heidnischen Gebrauche zu Grunde liegt und der von durch die Städte ziehenden, auf Schilfrohrpfeifen unaufhörlich blasenden Männern getanzt wird (zuweilen stirbt einer oder mehrere während des Tanzes oder kurz darnach an acutem Emphysem der Lungen durch das unaufhörliche Pfeifen hervorgerufen). Montsua stellte daher das Verlangen, daß die jungen Leute der herkömmlichen heidnischen Sitte gerecht werden sollten, und hatte unter dieser Bedingung nichts gegen die Taufe (bathu ba lehuku: nach Rev. Mackenzie das Volk des Wortes, oder das Volk, welches das Wort Gottes aufnimmt) einzuwenden. Durch seinen eigenen Bruder Molema, der das Christenthum mit vollem Herzen aufgenommen, angespornt und ermuntert, verweigerten es die Neubekehrten, dem Wunsche des Königs nachzukommen. Molema fand an Jan, dem nunmehrigen dunklen Barolongen-Prediger einen treuen Helfer.
Von seinen Regendoctoren aufgestachelt, forderte Montsua, daß sich die Bekenner des neuen Glaubens an zwei mit der Regenzauberei zusammenhängenden Ceremonien betheiligen sollten, d.h. an der Letschulojagd, welche von den Regendoctoren veranstaltet wird, um von gewissen Wildarten bestimmte, zu ihren abergläubischen Handlungen gebrauchte Theile zu erlangen, sowie an dem Umgraben einer Ackerstelle, welche von den Regendoctoren benutzt und als geweiht angesehen, und tsimo ea pulta, d.h. Garten, dem Regen geweiht, genannt wird. Auch dies wurde von den Bekehrten verweigert, sie ließen jedoch dem Könige wissen, daß sie ihm jeden anderen Beweis ihrer Treue und ihres Gehorsams als Unterthanen geben wollten, allein die Gebräuche ihrer Vorväter, seitdem sie bathu ba lehuku geworden, nicht mehr ausüben könnten.
In Folge des constitutionellen Regimes und der Zahl der Anhänger des neuen Glaubens konnte er die sich Weigernden nicht so leicht bestrafen, allein er sann auf andere Mittel und fand auch bald Gelegenheit, solche in Anwendung zu bringen, als sich am nächsten Sonnabend Molema und Jan auf das Land begaben. Er ließ in der Stadt bekannt machen, daß sich am folgenden Tage kein Mensch in der Kirche blicken lassen dürfe. Allein ohne sich um diesen Befehl zu kümmern und von zwei Frauen (denn diese erkannten zu wohl, daß das Christenthum sie aus der Stellung der »Sclavinnen« in eine dem Manne ebenbürtige hob) angefeuert, fehlte auch nicht Einer, als die Zeit des Gottesdienstes kam, in dem kleinen Gebäude. Des Königs Getreue brachten ihm bald die Kunde von dem Geschehenen, auch konnte er aus seinem Häuschen den Gesang der Hymnen hören. Aufgebracht über diesen offenen Widerstand bewaffnete sich Montsua mit einem langen, dolchartigen Messer und eilte nach der Kirche, in welche er eintrat, als eben einer der Männer (in Molema's Abwesenheit) das Dankgebet vorlas. Sein Erscheinen brachte natürlich Schrecken unter die Versammelten und diese Verwirrung benutzend, befahl ihnen der König, sich sofort zu entfernen. Da war es eine der Frauen, die ihm mit den Worten entgegentrat, daß sie (die Versammelten) als bathu ha lehuku erst ihre Andacht beenden würden. Diese Worte brachten den König derart in Zorn, daß er auf die Frau losstürzte und es ihm nur durch die Drohung, von seiner Waffe Gebrauch zu machen, gelang, die Anwesenden aus der Kirche zu treiben. Unter den Bekehrten befand sich auch eine seiner Töchter und ihr Mann. Der König verbot ihr aus dem Hause zu gehen, als sie jedoch von einem der Unterrichteten aus der neuen Gemeinde besucht wurde und mit diesem in einem Hymnenbüchlein las, schied sie ihr Vater von ihrem Manne, nahm sie zu sich in's Haus und zwang sie, der alten heidnischen Sitte gemäß sich blos mit dem Lederschürzchen zu bekleiden.
Doch alles dies half Montsua nichts und so wurde er endlich seines strengen Verfahrens müde und nachdem er eingesehen, daß die Bekehrten sonst ebenso treue Unterthanen waren und überdies arbeitsamer und wohlhabender wurden, ließ er nicht allein von den Verfolgungen ab, sondern beförderte (ohne selbst die neuen Lehren anzunehmen) die Verbreitung des Christenthums in seinem Lande als Jener und Molema später von einander schieden, ordnete er an, daß Jan, der Barolonge, den um ihn Wohnenden und Molema den in Molema's Town am Molapo Weilenden predigen sollte.[1]
1 Das Christenthum wurde unter die Barolongen durch die Weslyanische Missionsgesellschaft gebracht, deren nördlichste Station zur Zeit meines Besuches im Jahre 1875 Moschaneng, gegenwärtig, nach der Uebersiedlung Montsua's nach Lothlakane, Molema's Town ist. Hier wirkt noch immer Molema, während Herr Webb seitdem die Stadt verließ und in Lothlakane Rev. Harris (statt Rev. Webb) fungiert. Das Wirken der Missionsgesellschaft hat insofern gute Früchte getragen, als es viele der Barolongen veredelte, den Herrscher zu weisen Maßregeln brachte, und dadurch, daß die Missionäre auch Ackerbau einführten, den Wohlstand der Eingeborenen hob.
Einer der ersten Besucher am Wagen war ein alter Regendoctor, der mich, als er von Montsua hörte, daß ich ein Naka (Doctor) sei, als Kollegen zu begrüßen kam. Der alte Mann fand großen Gefallen an Monkey und bat mich wiederholt, ihm das Thier zu verkaufen, da er es zu seinem pula-jana (Regenzauberei) gebrauche, und wunderte sich, daß ich, trotzdem ich auch ein Naka sei, es nicht glauben wolle. Auch Montsua kam mit Einigen seines Haushaltes, ein Diener trug ihm ein Stühlchen nach, worauf sich Seine königliche Hoheit niederließ; er erzählte mir von dem die Manupi beherrschenden, über 100 Jahre (105) alten Häuptling und von der Weise, wie die Matabele Moselikatse's Begräbniß gefeiert hatten.
Was ich schon während der Reise bis hierher wiederholt befürchtet, trat ein, von meinen Zugthieren erkrankten nicht weniger als vier, von denen ich drei, Dank eines mir von Herrn Martin anempfohlenen Heilmittels noch retten konnte, ihre Leistung konnte aber für die nächste Zeit kaum in Betracht kommen. Ich stand nunmehr der absoluten Nothwendigkeit gegenüber, mir Ersatz zu schaffen; glücklicher Weise gelang mir dies leichter, als ich es je gehofft. Am nächsten Tage ließ mich Montsua zu sich rufen und erbat sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für drei seiner Frauen, von welchen er eine mir als sterbenskrank schilderte, meinen ärztlichen Beistand. Die von mir verabreichten Arzneien hatten Wunder gewirkt, alle meine Patienten fühlten sich schon in den nächsten Tagen bedeutend wohler. Ich sah mich in Folge dessen bald von Hilfsbedürftigen umlagert, des Königs Bruder, der Chef Chatsitsive, der Barolong-Prediger Jan Leschumo, seine Frau und sein Sohn und zahlreiche andere Eingeborne, darunter besonders Frauen mit ihren Säuglingen, drängten sich zu meinem improvisirten, unter freiem Himmel errichteten Ordinationssalon. Meinen ärztlichen Erfolgen hatte ich es zu danken, daß ich Moschaneng mit einem frischen, zugkräftigen Gespann verlassen konnte.
Die von Molema (des Königs Bruder) vom Molapo gesandte und durch zwei Boten abermals bestätigte Nachricht von seiner Besserung hatte mir nicht allein als Empfehlung gedient, sondern mir auch das Vertrauen der Leute in Moschaneng im Sturm gewonnen.[1]
Montsua bewies seine Erkenntlichkeit, indem er mir 1 £ St. für die verabreichten Arzneien nebst vier weißen und ebensovielen schwarzen Straußenfedern von seltener Schönheit überreichte, von welchen er die weißen für meine Frau bestimmte; meine Entgegnung, daß ich noch keine Frau hätte, nahm er mit ungläubiger Miene auf, rieth mir aber schließlich, die Federn für meine zukünftige Gattin aufzubewahren. Dem Wohlwollen des Königs verdankte ich auch fünf kräftige Zugthiere, die er mir für mein Snidergewehr überließ, während Herr Martin und der Händler Mr. T. mir zu weiteren fünf Thieren verhalfen, so daß ich nunmehr über 14 Zugthiere verfügen konnte und frohen, leichten Muthes der Weiterreise entgegensah.

[Barolongfrauen aus Moschaneng.]
Ich muß hier einer interessanten Beobachtung gedenken. An der Lehmwand von Mr. Martin's Wohn- und Verkaufslocale sah ich Termiten von einem unter der Mauer, in der Erde befindlichen Baue einen Gang nach auswärts an der Außenseite der Wand, aus dem Anwurf mit Hilfe der Speichelsecretion kneten und formen. Dieser bedeckte Gang war so weit, daß man etwa einen Bleistift hätte einführen kennen, zeigte viel Abzweigungen nach rechts und links und auch Gabelungen nach oben. Aus einem zweiten Souterrainbau führten mehrere solcher Kanäle nach auswärts, aus der Ferne betrachtet schien es, als hätten Menschenhände an Herrn Martin's Hauswand Strauchformen durch Ankneten von röthlicher Thonerde nachzuahmen versucht.
Der Aufenthalt in Moschaneng war auch der Vermehrung meiner ethnographischen und etymologischen Sammlungen sehr förderlich. In Bezug auf erstere erwarb ich mehrere Carossen, Kiri's, Waffen, Stöcke mit eingebrannten Verzierungen, zu Wassergefäßen hergerichtete Straußeneier, hölzerne Löffel, eine Holzschüssel, Schnupftabakdosen aus Kürbisschalen und Horn gearbeitet und viele Insecten. Unter den letzteren eine neue Cerambyx und eine dieser Familie verwandte, schwarzgelb gebänderte Species, zwei stahlgrüne und eine kupferfarbige Scarabidenart, sowie andere neue Stücke und Duplicate, im Ganzen etwa 350 Stück. Die trockenen Mimosenzäune waren die Rendezvousstellen zweier schöner Bockkäferarten.
Am 17. wollte ich endlich abreisen, doch Montsua ließ es nicht zu. Ich müsse noch bleiben, hätte ich kein Fleisch, würde er mir welches senden und um Mittag wurde ich thatsächlich mit einem Ziegenbock als Geschenk des guten Mannes überrascht. Dann kam er selbst wieder und bat mich noch einen seiner Leute, einen wohlhabenden Mann, besuchen zu wollen. Als ich einwilligte, wurde ich sofort zu dem letzteren geführt und hatte hier Gelegenheit, Einblick in das Familienleben eines Betschuana's zu thun.
In einem etwa 40 Schritte im Durchmesser zählenden Höfchen standen drei der gewöhnlichen Betschuanahütten oder Häuschen. Eine Schaar nackter Kinder spielte lustig umher. Ich hatte kaum Zeit, mich in dem Höfchen umzusehen und die riesigen aus Gras geflochtenen Körbe zu betrachten, in denen das Kafirkorn aufbewahrt wird, als der Bote aus dem Häuschen heraustrat und mir mit den Worten Bapila, Sir (Warte, Herr) ein primitives Stühlchen zum Sitze anbot. Dann lief er in die nächste Hütte und holte ein junges Weib heraus, sowie eine alte Frau, welche die Kinder zur Ruhe verwies. Die Frauen begaben sich sodann in das Häuschen, in dem der Kranke lag, brachten zuerst ein gegerbtes Ochsenfell heraus und dann mit Hilfe des Führers den kranken Mann, der es nicht zugeben wollte, daß sich der weiße Doctor in das Innere der kleinen Wohnung bemühen solle. Ich hatte vor mir einen noch jungen Mann. Er betrachtete mich mit neugierigen, etwas ängstlichen Mienen und schien seit Langem ein Lazarus zu sein. Um den Hals trug er ein aus Gras geflochtenes Schnürchen und an diesem im Abstande von 1¼-1½ Zoll kleine, gekerbte, Schwärzliche Holzpflöckchen, etwas ähnliches über der Wade—Beschwörungsmittel die ihm, um seine Krankheit zu heilen, von den Regendoctoren angelegt worden waren. So ängstlich wie der Kranke, sahen mich auch die beiden Weiber, seine Frau und seine Mutter, an. Ich fand den Fuß in sehr schlechtem Zustande und die meisten der Tarsusknochen cariös entartet. Als ich die Sonde in die Wunde einführte, schloß ihm die junge Frau mit ihrer rechten Hohlhand die Augen und ich sah deutlich, wie sich die Stirne des Mannes über der vorgehaltenen Hand und seine Schläfe mit dichten Schweißtropfen bedeckten.
Als ich die Untersuchung der Wunde beendet hatte, sprach ich dem Kranken gegenüber die Hoffnung aus, ihn bei meinem nächsten Besuche Moschanengs besser zu finden. Er war des Holländischen nicht mächtig und richtete einen fragenden Blick auf den Boten. Sofort übersetzte dieser mein Gutachten, wobei er dreimal so viel Worte gebrauchte. Nun folgten meine Rathschläge, welche zwei- und dreimal so lang, meist in umschriebener, mit Gesticulationen verbundener Form wiedergegeben wurden. Als der Mann das Einspritzen von lauwarmem Wasser in die Wunden, dann jenes einer Lösung von Medicamenten erklärte, mußte ich alles aufbieten, um nicht in lautes Lachen auszubrechen. Ich hatte eine kleine Glasspritze mitgenommen, deren Wirkung von allen offenen Mundes angestaunt wurde; höchst verwundert nahm jeder der Anwesenden die Spritze zur Hand.
War schon die Gebrauchsanweisung derselben von meinen Zuhörern schwer begriffen worden, so war dies noch im höheren Grade der Fall, als ich das Vorgehen bei dem Loslösen zerstörter Knochenstücke und das Herauf- und Herausheben der so zur Oberfläche durch die Wundkanäle getretenen zu erklären hatte; doch auch dies gelang, ebenso die Belehrung, täglich häufige Waschungen zu halten und ihm eine Medicin (Eisen und Chinin) dreimal und ein Pulver (Kalk-Phosphate) zweimal des Tages zu verabreichen. Hier mußte ein Holzlöffel geholt, Wasser eingeschüttet, dann das Pulver mit etwas Mehl nachgeahmt und das ganze von dem Führer verschluckt werden, um alles dies im Höfchen wohl begreiflich zu machen und dem Kranken selbst Vertrauen einzuflößen. Als ich beendet, ersuchte mich der Kranke, ihm meine Hand zu reichen und unter einem allseitigen Rumela verließ ich das Höfchen, um die Medicamente zu präpariren; mein Führer jedoch eilte zu dem Könige, um hier (wie ich später erfuhr) die ganze Scene, mein Betragen etc. haarklein zu beschreiben.
Während unseres Aufenthaltes in Moschaneng wurde Pit häufig von einer Landsmännin besucht, welche von ihrem Vater (einem Griqua) an einen hiesigen Barolongen verkauft, d.h. verheirathet worden war. Sie schien sich vollkommen glücklich zu fühlen, ebenso daß sie einen »Stammesbruder« fand, mit dem sie, einen Säugling im Tuche am Rücken gehüllt und ein Kind an der Hand führend, stundenlang im Tage Pfeifchen um Pfeifchen ausschmauchen konnte. Sie schien ein weniger hartes Los zu haben, als es sonst die Frauen der Betschuana's ertragen müssen.
Montsua machte mir den Vorschlag, mich in Moschaneng häuslich niederzulassen, und meinte, an Praxis würde es mir hier nie fehlen können, da die Leute von Kanja, Molema's Town, von Manupi u.s.w. alle um Molemo (Medicin) zu mir kommen und diese mit Straußenfedern, Fellen, Ochsen und Ziegen bezahlen würden. So wohlwollend die Einladung auch war, ich hatte eine andere Aufgabe vor mir.
Am Morgen des 18. machte ich mich zur Abreise bereit. Alle Notabilitäten von Moschaneng fanden sich ein, Montsua und Herr Martin brachten noch je eine schöne, weiße Feder und ich mußte wiederholt dem Könige die Hände schütteln. Als letzten Beweis seiner Huld bot mir der König einen Führer nach Molopolole zu dem Könige der Bakwena's an, den ich, obwohl er nicht kräftig schien, mitnahm. Ein Intermezzo, das unsere Lachlust auf's Höchste in Anspruch nahm, beschloß unseren Aufenthalt in Moschaneng. Unser neuer Führer nahm Freund Boly bei seite und frug ihn, ob der Baß es wohl erlauben würde, daß er seine Frau und Nichte mit auf die Reise nehmen könne. Da Boly es verneinte, wandte er sich darauf an mich und über den Grund dieses seines Ansuchens befragt, gestand er, daß dieser Makoa (Weiße), auf B. weisend, seiner Frau und dem Kinde (Nichte) tata, tata (viel, viel) gefiele und sie deshalb mitreisen wollten.

[Klippdachsjagd.]
Wir schlugen eine nordwestliche, dann eine nördliche Richtung ein und hatten zwischen der verlassenen Stadt und dem zweitnächsten Flusse, den Koluany, den wir zu überschreiten hatten, ein Hochland zu durchziehen, welches an Schönheit der Gebirgsscenerien en miniature nur von dem großartiger geformten Makalaka-Höhenlande (Westmatabele) übertroffen wird. Das Hochplateau ist theilweise Busch-, theilweise freies Grasland, doch hie und da auch dünn bewaldet und von einer Unzahl bis an 80 Fuß hohen meist pyramidenförmig geformten, aus riesigen Granitblöcken bestehenden Felsenhöhen übersäet. Da sich in ihrer Nähe der Boden in der Regel feucht erhält, sind sie von einem Mimosengürtel umsäumt und von üppigster Vegetation bedeckt, in welcher sich namentlich kleine Aloëarten und niedrige cactusförmige Euphorbiaceen, doch auch Stapelien bemerkbar machen und letztere mit ihren dunklen, sammtartigen, fein behaarten, erstere mit ihren schönen rosa- und dunkelrothen Blüthen und die Euphorbiaceen durch ihre Formbildung besonders hervorstechen und um so wirkungsvoller in das Auge fallen, als sich ihr Bild hier aus einer verwitterten Felsenritze, dort zwischen zwei eng aneinander gefügten Blöcken oder aus den grauen Felsenhöhlungen anmuthig hervorhebt. Doch das, was uns am meisten aus der Pflanzenwelt an diesen interessanten Felsenkuppen auffällt, sind die Sykomoren, welche mit hellgrauen, dicken wulstigen, bald breiten und flachen, bald netz- oder auch gabelförmigen Wurzeln senkrechte Felsenwände überziehen um in einer Höhe von 2-10 Fuß und darüber (von der Ritze, aus der diese Wurzeln gekommen) in den fleischigen, gedrungenen, mit schönen großen Blättern und einer schattigen Krone geschmückten Stamm überzugehen. Oxalis, Farrenkräuter und Moose sowie Flechten sind in artenreicher Anzahl vorhanden; auch beobachtete ich auf diesem Plateau neue Lepidopteren und Käfer, und fand von Säugethieren marder- und katzenartige Raubthiere, sowie auch den Klippdachs zahlreich vertreten. Nach Westen senkt sich das Hochplateau gegen einen nach Regen zu einem Flusse angeschwollenen und von Moschaneng von Norden bei Westen, dann Nordwesten und endlich Norden fließenden und in den Masupa-River mündenden Bach. Der Abfall ist steil, oben bewaldet, ein Lieblingsaufenthalt der Hyäna brunea und punctata, doch hauptsächlich des Caracal und des Leopard.[1]
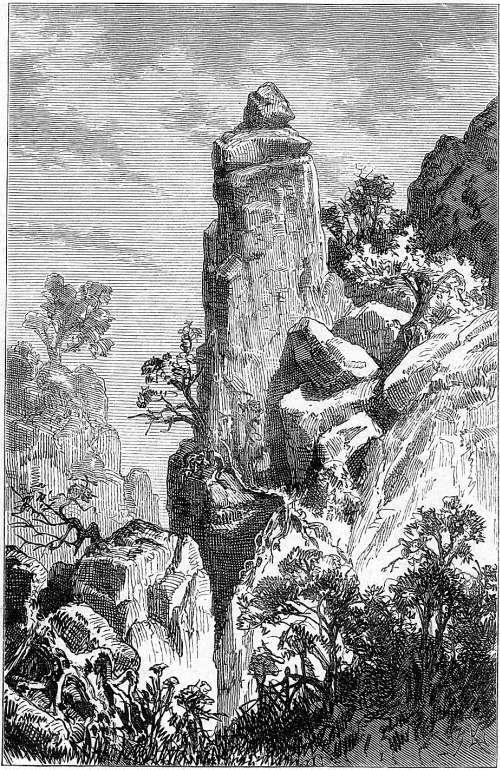
[Naprstek-Höhen.]
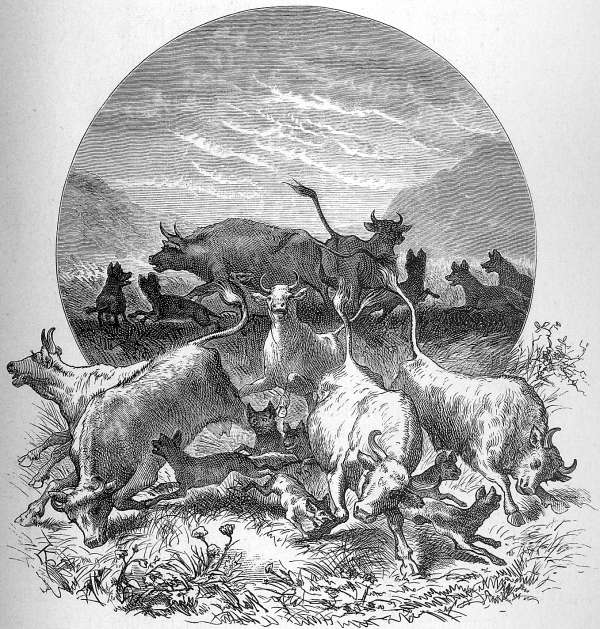
[Wolfshyänen eine Viehheerde überfallend.]
Diese ausgedehnten Hochflächen sind aber besonders durch die in großen Rudeln auftretenden, gefürchtetsten aller südafrikanischen Raubthiere verrufen. Von Gestalt zwischen Proteles und Hyäne, ist dieses Thier der grimmigste Feind aller Viehheerden, vor ihm warnte mich sowohl Herr Martin als König Montsua selbst. »Du darfst nie,« meinte Montsua, »Deine Ochsen in der Nacht grasen, nie sie allein ohne Aufsicht am Tage weiden lassen, sonst wirst Du nur wenige mehr nach Molopolole bringen.« Jenes Raubthier ist der wohlbekannte Canis pictus (auch Lycaon pictus oder venaticus, in Süd-Afrika als »the wild dog« bekannt) der zu den räuberischsten, mit einem unauslöschlichen Vernichtungstriebe und einer nicht minder gierigen Freßwuth von der Natur bedachten Geschöpfen der Erde gehört. Von der Größe eines nicht ganz erwachsenen Wolfes, doch schmächtiger, wird dieses Thier großen Säugethieren wie Rindern, Eland-, Hartebeest-Antilopen etc., dadurch gefährlich, daß es nur in Rudeln jagt, niederen Thieren dadurch, daß es, sobald es eines derselben (Ziege, Schaf, Wildschwein) getödtet, sich auf ein zweites und drittes wirft und auf diese Weise unbewachten Heerden die größten Verluste beibringen kann. Die Länder der Eingebornen und die Grenzdistricte der Transvaal-Provinz werden besonders häufig von ihnen heimgesucht.
Dieses Raubthier bewohnt unterirdische Höhlen und jagt in Rudeln in einem bestimmten Districte von seinen Höhlen aus oder über weite Strecken, um sich zur Frühjahrszeit in seinen alten Wohnsitzen einzufinden. Mit hochgehaltener Schnauze sucht es die Witterung aufzunehmen, ist es darin erfolglos, so läuft die Truppe zerstreut, doch nicht weit auseinander, durch das Gras, mit der Schnauze längs dem Boden hinfahrend. Aufgenommene frische Spuren von Wild und Hausthieren (sehr selten Pferden, die für den Canis pictus zu rasch und gefährlich sind) werden sofort verfolgt dann jagt die Meute dicht gedrängt, heulend und kläffend in der Spur, kommt ihnen außerdem die Witterung noch zu Hilfe, so geht ihr Lauf in ein solches Rasen über, daß manche oft gegen Büsche anrennen und über Gestein und Ameisenhügel kollern. Ihrer geringen Größe halber lassen größere Thiere, wie Rinder und Elandantilopen, sie oft nahe kommen, was diesen dann zum Verderben wird. Ja es geschieht sogar zuweilen, daß sich dieselben nicht eher zur Flucht wenden, als bis sie von der Meute angegriffen werden. Während sich nun das eine Rind mit den Hörnern gegen zwei oder drei der Austürmenden kehrt, haben sich deren drei bis vier andere in die Schenkel, ebenso viele in den Bauch verbissen—statt sich nun zu wehren, sucht sich das Thier durch die Flucht zu retten; manchmal gelingt dies und die Rinder kehren mit in den Unterleib gebissenen Löchern heim, doch wenn es stolpert, wenn es am Halse, oder gar an den Nüstern gefaßt wird, wenn ihm die Kniegelenke durchbissen werden und durch die Wunden im Unterleibe, die in der Regel die gefährlichsten werden, die Eingeweide herausfallen oder herausgezerrt werden, ist es verloren und geht nach stundenlanger Qual zu Grunde.
Am 18. zogen wir über das Hochplateau des Banquaketse-Landes. In Folge des vorgeschrittenen Sommers grünte alles um die Wette, ich sah nicht eine trockene Mimose. Die Perle der verschiedenen, dem Auge sich bietenden Felsenscenerien trafen wir an den Naprstekhöhen, mit denen das pittoreske Landschaftsbild auch nach Norden zu seinen Abschluß findet.
Gegen Sonnenuntergang fuhren wir in das mäßig tiefe Thal eines bis auf eine kleine Rinne trockenen Sand-Rivers, Mosupa (Masupa, Moschupa) genannt, der sich mit dem Taung, einem linken Nebenfluß des Notuany vereinigen soll. Das Bett des Flusses wie seine Ufer waren stellenweise mit riesigen Granitblöcken übersäet, welche am linken Ufer gewaltige Platten bildeten, deren ebene, etwas vertiefte, obere Flächen große von der Natur gebildete, seichte Wasserreservoirs zeigten. Einige hundert Schritte zur Rechten macht der Fluß eine plötzliche Wendung nach Nordosten; im inneren Winkel dieses Buges und am linken (nördlichen) Ufer erhebt sich ein grotesker Felsenhügel, welcher mit zwei anderen zusammenhängenden, doch niedrigeren, aus wahren Riesenblöcken bestehenden, abgeflachten Höhenkuppen durch einen Sattel zusammenhängt.
Von dem Hochplateau gegen die Thalsohle herabfahrend, verwehrte uns üppiges Baum- und Buschdickicht den Fernblick und so öffnete sich denn plötzlich vor uns eine der anmuthigsten und schönsten Scenerien. Die glühende Sonnenscheibe berührte den Rand des nahen, bebuschten Hochplateaus, aus dem sich der Masupa-River den Weg nach Osten bahnt. Die ganze Fülle der Strahlen ergoß sich in das Thal und auf die ihm zugekehrten Seiten der Höhen. Während es ihnen ob der tiefen Lage des Flußbettes, aus dem nur hie und da der weißliche Sand und die hellen Felsenblöcke undeutlich herausschimmerten, nicht möglich war, in diese Mulde zu dringen, beschienen sie hell die riesigen Felsenplatten und Massen aufgetürmter Felsenblöcke am linken, jenseitigen Ufer, aus denen an verschiedenen Stellen die erleuchteten Oberflächen der klaren, natürlichen Felsencisternen nach allen Seiten riesigen Diamanten gleich funkelten. Hob sich der Blick nach den Höhen im Norden und Nordosten (den nahen Naprstekhöhen) so erschienen die schroffen und abschüssigen, die abgerundeten und abgeflachten Felsenblöcke derselben überall da, wo sie nicht eine schattige Sykomore oder anderes, helleres oder dunkleres Grün von Bäumen oder Sträuchern deckte, wie durch innere Hitze erglühend und der Reflex dieses Purpurlichtes, sowie die unmittelbar auf das Laub der Bäume fallenden Strahlen des untergehenden Sonnenlichtes hüllten die dem Westen zugekehrten Kronen in ein goldenes Gewand, welches bei der Bewegung der Aeste, Zweiglein und Blätter, zu flimmern schien. Von den so herrlich beleuchteten Punkten der vor unseren Blicken sich ausbreitenden Scenerie vollkommen gefesselt, hatte unser Auge die weniger beleuchteten Partien, wie z.B. jenen freien geschützten Raum am Fuße der Höhen zwischen den nördlichen und den am jenseitigen Ufer sich erhebenden Felsenmassen nicht gesehen. Doch als nun das goldene Gestirn untergegangen war, als der Purpurglanz an den Höhen und den vorragenden Erhebungen und Felsenformen im Thale erbleicht war und eine gleichmäßigere Vertheilung des Lichtes platzgriff, fiel uns jene oberwähnte, anfangs nicht beachtete Strecke am südlichen Fuße der Höhen, jener zwischen denselben von pittoresken und belaubten Felsenmauern umschlossene Raum auf.
Hatten wir mehrere zufällig hingeblickt, oder war es die erwähnte gleichmäßige Lichtvertheilung, welche die Netzhaut unseres Auges in gleicher Weise afficirte, genug, E., ich und Pit der Griqua stießen unwillkürlich einen Ruf der Ueberraschung aus. Was hatten wir erblickt? War das ein Kirchhof—doch nein, wir sind ja im Centrum Süd-Afrika's unter Wilden. Ruinen sind es, Ruinen einer mit einer niedrigen Felsenmauer umgebenen Stadt. Der von Montsua uns mitgegebene Führer wußte uns darüber folgendes zu berichten: Diese Eingebornenstadt war bis in die letzten Jahre hin von einem Banquaketsestamm (Zweigstamm) bewohnt. Der Sohn des Häuptlings Mosilili, mit Namen Pilani, ein Freund Seschele's des Bakwenakönigs, verließ mit einer Anzahl seiner Anhänger seines Vaters Stadt und das Gebiet des Chatsitsive, um sich im neuen Gebiete des Königs Seschele in Molopolole niederzulassen, worauf Mosilili, ein alter Freund von Chatsitsive, die halbverlassene Stadt mit dem Reste ihrer Einwohner im Stiche ließ, um sich in der Nähe von Kanja anzusiedeln. Die Ruinenstelle ist etwa ¾ englische Meilen lang und stellenweise 2-600 Schritte breit. Die Mauer, die um den Kraal läuft, ist niedrig, blos 3 Fuß hoch, 1-2 Fuß dick und diente wohl dazu, nur das Vieh nahe an den Häusern zu halten. Zur Vertheidigung war sie nur dann von Nutzen, wenn mit Dornenbüschen 4-5 Fuß hoch überdeckt; mit einer ähnlichen, blos aus aneinander gelegten, kopfgroßen Gesteinen errichteten Mauer war auch der tiefste Einschnitt im Höhensattel versehen. Der nächste Tag wurde dem Besuche der Ruinen gewidmet und auf die zahlreichen, die Höhen bewohnenden Hyänen Jagd gemacht.
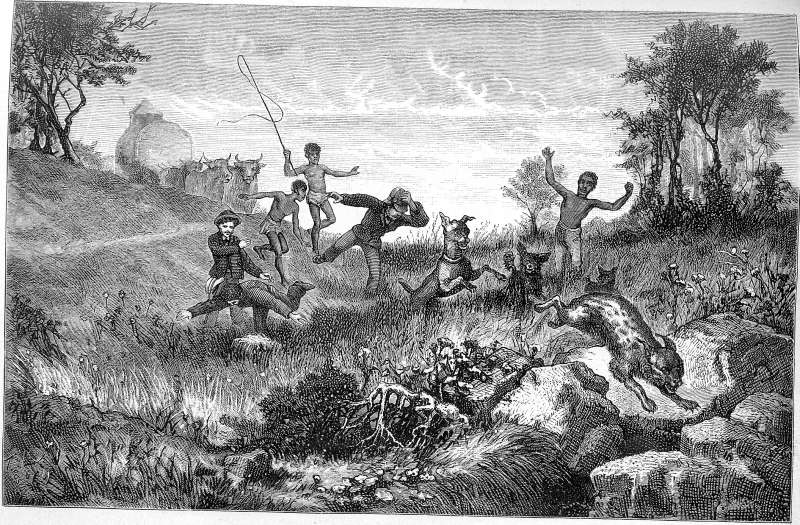
[Afrikanischer Luchs.]
An den Ruinen fielen uns vor Allem die cylindrischen Mauern, Ueberreste der Wohnungen und Gehöft-Einfriedigungen, ferner einige noch bedachte Hütten, zur Rechten die Ruinen eines Missionshauses, doch vor Allem kegelförmige gedeckte, meist aus röthlichem Thon gefertigte, noch ziemlich gut erhaltene Eingebornen-Wohnungen auf.[1]
Auf einem längs des Flußufers unternommenen Ausfluge fand ich recht anziehende Partien sowohl in dem Flußbette selbst als auch an den beiden hohen, mit bunter Boden- und Buschvegetation dicht bewachsenen Ufern. Bald stufen- bald walzenförmig lagen die vom Wasser spiegelglatt geschliffenen Felsenblöcke übereinander und bildeten kleine Katarakte, die für den künftigen Besiedler des Ufers natürliche Wehren sind, um seine Mühle zu treiben und seine Gefilde zu bewässern. In den Dickichten am Flusse jagten sich Heerden der gehörnten Perlhühner (N. coronata) und an den lehmigen Stellen sah ich deutliche Fischotter- und Leguanspuren.
Um die Mittagszeit, als wir überall auf den vorragenden Felsenblöcken den Klippschliefer hocken und herumhuschen sahen, machten wir uns mit den Hunden auf, um einigen dieser von den Engländern Rockrabbits, von den Boer's Dossies genannten Dickhäutern nachzustellen. Wohl weil von den Eingebornen häufig verfolgt, zeigten sich diese kleinsten der lebenden Pachydermata sehr scheu; so lange wir am Wagen oder im Bereiche der Ruinenstadt blieben, wichen sie, meist in kauernder Stellung an den vorragenden Felsenblöcken—vielleicht auch als Wachen sitzend—sonst aber in den Büschen nach Wurzeln und Gras, auf den dickstämmigen Sykomoren nach Feigen suchend, nicht von der Stelle; sobald wir jedoch den Fuß der Höhen erreicht hatten, verschwanden sie in der nächsten Felsenritze.
Während Freund Eberwald und F. mit Stephan auf dem östlichen Hügel darauf losknallten, hatte ich mich von dem westlichen steilen Abhange nach dem nördlichen geschlichen, um einen auf der äußersten Felsenspitze vollkommen apatisch und melancholisch hockenden, um seine und die Sicherheit seiner Kameraden unbesorgten Klippdachs anzuschleichen. Nicht ohne Schwierigkeiten und manchen meine Lachlust erregenden Zwischenfall gelang es, den steilen Abhang emporzuklimmen und eine Stelle zu erreichen, von welcher aus das kleine Thierchen in Schußweite lag. Mein Begleiter Pit wollte durchaus noch weiter klettern, ich aber ersah den günstigen Moment und feuerte eine Schrotladung hinauf. Der Schuß hatte getroffen, der Klippdachs kollerte zum Stamm einer über den Abhang sich erhebenden Sykomore und fiel dann einige Fuß senkrecht herab. Athemlos klettern wir über die großen Felsblöcke auswärts, um die Stelle am Fuße der Sykomore zu erreichen—doch welche Enttäuschung, die Erde war vom Blute des Thieres geröthet, das Thier selbst war jedoch verschwunden. Wir durchsuchten alle Ritzen und Löcher zwischen den Felsen—vergebens.
Hyrax capensis, wohl eine und dieselbe Species oder eine sehr nahe Varietät des Hyrax abissinicus ist von der südlichen Meeresküste durch ganz Süd-Afrika über den Zambesi hinaus verbreitet und wählt sich meist felsige Höhen zum Aufenthaltsorte. Von seinem gewählten Schlupfwinkel weicht er nicht gerne und mag auch unter dem Felsen, auf den er sich eingenistet, ein Gehöft oder eine Stadt entstanden sein, er bleibt ruhig wo er war, nur daß er scheuer als in der Wildniß wird. Als kleinster der Dickhäuter ist er ein eigentümlicher Kauz, ein tiefer Denker, der seine Handlungen wohl überlegt, bevor er sie ausführt, sonst ein närrischer und bissiger Geselle. Etwas über Kaninchengröße, mit kurzen Ohren und kleinen, sehr lebendigen Aeuglein, ist er mit einem dichten, dunkel gelblich-braunen Pelze bekleidet, dessenthalben ihm von den Eingebornen eifrig nachgestellt wird. Doch auch sein Fleisch wird von vielen Weißen und von den Eingebornen genossen und manche der Stämme, wie die Makalaka's, bedienen sich mit Nägeln versehener Stöcke, um die in die Felsenritzen geflüchteten Klippschliefer aus diesen herauszuholen. Nebst dem Menschen sind es der Caracal und der südliche Luchs (Lynx pardinus) sowie der braune Adler, welche ihm nachstellen, doch ohne seiner großen und raschen Verbreitung viel Abbruch thun zu können; seiner Brut werden die Genetten gefährlich.
Die steilsten Höhen, schroffe Abfälle, in Süd-Afrika als »Kränze« bekannt, sind seine Lieblings-Aufenthaltsorte. Ein kleiner Hase bewohnt diese Höhen und ist oft sein Gesellschafter, wenn dieser auch nicht in die tiefsten Spalten herabsteigt, sondern sich mehr an der Oberfläche aufzuhalten sucht. Der Klippdachs liebt die Wärme und sich zu sonnen ist neben seinen Nahrungssorgen seine wichtigste Beschäftigung. Nasse Winter (eine Seltenheit auf den Hochebenen) und große Kälte schaden ihm sehr. Gefangene, denen man nicht vollkommen das freie Herumlaufen gestatten konnte und die in feuchten, oben geschlossenen Localen gehalten wurden, erkrankten an Augenentzündungen und siechten zusehends ab; sonst sieht man sie häufig in Behausungen gehalten und an Schnürchen, die sie nicht zerbeißen, angebunden. Man kann sie hier und da für 2-5 Shilling per Stück erstehen.
In einer der vielen trichterförmigen Kalk-Felsenhöhlen in der westlichen Transvaal-Republik beobachtete ich eine Art mit etwas zottigem, fuchsrothem Fell, ohne ihrer jedoch habhaft werden zu können und in den bewaldeten Partien des südlichen Theiles der Cap-Colonie, wie auch in Kafraria, Natal und weiter nordwärts lebt eine graue mit einem weißen Band geschmückte, etwas kleinere Art nur auf Bäumen, von der ich zwei Exemplare sah. Sie sollen ein weithin tönendes Gepfeife ausstoßen und sind sehr scheue, besser als ihre Stammesbrüder auf den Felsen, Feuchtigkeit vertragende Thierchen.
Freund E. war glücklicher als ich, er brachte Turteltauben und ein schönes großes Rebhuhn (Francolinus gariepensis), sowie einige der uns bisher fremden, palmenartigen Grasbäume heim; manche derselben waren stark angekohlt, ein Beweis, daß die Höhen zeitweilig von Bränden heimgesucht werden. Wir benutzten die aus den Stammenden und an den armleuchterartig emporsehenden Abzweigungen hervorsprießenden, viel Kieselkrystalle enthaltenden Blätter, um damit unsere Eisen- und Stahlsachen blank zu scheuern. Ich beobachtete noch eine zweite, höhere und bedeutend dünnere starkverzweigte Art an einigen (immer nur an) Höhen im Zambesithale, eine der beiden Arten soll auch im centralen Transvaal-Gebiete auf den Magalisbergen vorkommen. Die Pflanze gehört unstreitig dem wärmeren Theile Süd-Central-Afrika's an und fesselt durch ihre dunklen, aus dem Grase und zwischen den grauen oder weißlichen Felsblöcken hervorsprießenden, 2-3 Fuß hohen und armdicken Stämmchen sofort die Aufmerksamkeit des Fremden.
Nachdem ich die Häupter meiner Lieben gezählt und keines fehlte, brach ich wieder auf; unser Weg führte uns durch mehrere sandige Flußbette (Koluany und Mahatelve) und zahlreiche Regenmulden, deren Ufer von herrlich grünenden Mimosen bestanden waren. An einer dieser Regenmulden entdeckte unser Führer zahlreiche Hyänen- und Leopardenspuren, die uns zur Vorsicht mahnten. Kaum hatten wir das Schutaniflüßchen, dessen felsiges Flußbett den Zugthieren viel zu schaffen gab, überschritten, als die Hunde mit besonderer Vehemenz auf einen Busch anschlugen.
Da rief Stephan plötzlich: »Bas, Bas. Sir, pass up, een chut lup nack ye tu« (Herr, Herr, gib' acht, ein Ding läuft auf Dich zu). Ich sprang zur Erde, Pit, E. und B., wir alle wandten unsere Blicke nach der Schallrichtung, das Hundegekläffe kam näher, entfernte sich dann aber, als plötzlich einige Schritte vor den Ochsen ein gelbliches, schwarzgeflecktes Thier, ein südlicher Luchs, Thari von den Eingebornen genannt (L. pardinus) über den Weg setzte und den Anhang hinablief. Es schien uns allen so klein, und da die Hunde, namentlich Onkel, dem Thiere auf den Fersen waren, dachte Niemand nach dem Gewehre zu greifen, alles lief dem flüchtigen Thiere nach. Ueber Busch, über Stock und Stein flogen und fielen wir—doch dieses spontane Wettrennen war nur von kurzer Dauer, denn an einem Haufen tief in die Erde eingebetteter Felsblöcke, vor einer tiefen, in eine Höhle führenden etwa 16 Zoll breiten Zerklüftung hielten die Hunde mit einem Male still und kläfften in die Höhle hinab, aus der das Fauchen des Raubthieres zu hören war.
Wir hatten indeß keine Zeit zu versäumen und mußten, wenn auch ungern, zum Wagen zurückkehren. Am Lagerplatze angelangt, schärfte ich den Dienern die größte Wachsamkeit ein und ließ mehrere größere Feuer zur Abwehr der Leoparden errichten.
Durch dichten Niederwald, in dem Laubhölzer zahlreich auftraten, setzten wir am nächsten Tage unsere Reise fort. Wir begegneten zwei Frauen, deren Hals und Brust über und über mit Glasperlenschnüren und Arme und Schenkel mit aus kleinen Glasperlen gearbeiteten fingerdicken Ringen bedeckt waren; ein ihnen folgender Knabe trieb einen Ochsen, der als Packthier das Gepäck der »Schönen« trug. Mit dem Ueberschreiten des Koluanyflüßchens hatten wir das Gebiet Seschele's betreten, des Herrschers der Bakwena's, der nächst den beiden Bamanquato-Herrschern das umfangreichste Landgebiet unter den unabhängigen Betschuana-Königen besitzt.
Durch den Knall unserer Peitsche angelockt, kamen zwei Bakwenaknaben zum Wagen herbeigelaufen, und trugen mir eine Deukergazelle zum Kaufe an; ich erstand das liebe, zierliche Thierchen, das ohne Verwunderung über den Wechsel seines Gebieters so treu und traulich uns mit seinen schönen, großen Augen anblickte und sich im Wagen bald heimisch fühlte, für eine Bagatelle.
Nachdem wir das theils felsige, theils sandige Flüßchen, Malili genannt, überschritten hatten und durch einen tiefsandigen Wald reisten, erblickten wir, während des Aufstiegs durch Bäume verdeckt, eine Höhenkette im Norden, welche bebuscht zu sein schien. Näher kommend, gewahrten wir, daß sich im Osten noch andere Höhen an die erwähnte (der mittlere Theil der Bakwena-Höhen) anschlossen und auf einer derselben hoch oben einen weißen Punkt, einem europäischen, weißgetünchten Gebäude nicht unähnlich. Unser Führer machte uns auf diesen weißen Punkt aufmerksam, es war das Wahrzeichen Molopolole's, die Residenz Seschele's. Der Weg zu der am Abhange eines Höhenzuges erbauten Stadt führte uns durch ein Kesselthal, dessen Sohle von dürftigen und schlechtgepflegten Feldern eingenommen wurde.
Abends fuhren wir bis zu einem in der Mitte des Kessels sich ausbreitenden, von einer Bachschlucht durchschnitten Rasenplatz, in dessen Nähe drei Eingebornendörfer gruppenweise je an dem Fuße einer Höhe lagen und schlugen hier unser Lager auf. Gegen Osten blickend sahen wir in der Entfernung von circa 300 Schritt den Höhenrücken mit Seschele's Villa, die einige hundert Fuß hoch über dem Bette des Baches und dem südlichen Ende einer auf den Höhenrücken sich nach Norden windenden seichten Thalvertiefung, erbaut war. Diese Villa, der sieh die Gebäude des königlichen Haushaltes und die Kotla (der umzäunte Berathungsplatz der conservativen Bakwena's) wie die Gebäude der hier zeitweilig wohnenden Händler anschlossen, lag unter dem Schutze eines kleinen Felsenhügels. Unten am Rande des Thalkessels und am Fuße dieser Höhe lag ein anderer Theil Molopolole's (ein Eingebornendorf). Ein dritter Theil liegt am Fuße des isolirten südlichen Höhenrückens, der von den östlichen und von der lagen nördlichen, von Westen nach Osten sich ziehenden Höhenmasse durch eine lange Felsenenge, das von den Eingebogen Kobuque genannte Felsenthor, geschieden war. Auch am Fuße der eben erwähnten nördlichen Kette liegt ein Stadttheil neben einem in Ruinen verfallenen, doch nicht mehr im Thalkessel, sondern außerhalb desselben, an die nach der offenen Südsüdwestseite hin sich ausbreitenden Felder angrenzend. Eine zweite Schlucht, deren felsenthorartige Mündung Molopolole genannt ist und der Stadt den Namen gab, führt in nördlicher Richtung aus dem Thalkessel; durch sie tritt der Bach aus dem Bakwena-Höhennetze in den Kessel. Unter der Mündung dieser Schlucht im Thalkessel liegen die Gebäude der Missionäre und die Schule, während die Kirche oben auf dem Höhenrücken im oberen Stadttheile zu Anfang einer zum Thalkessel führenden Schlucht erbaut ist.
Von Molopolole nach Schoschong
Malerische Lage der Stadt.—Rev. Price und Williams.—Die Kotla.—Ausflug in die Molopolole-Schlucht.—Ein Festtag für Molopolole.—Millionärs-Laufbahn in Süd-Afrika.—Empfang bei Seschele.—Die Bakwena's.—Geschichte des Bakwena-Reiches.—Königin Ma-sebele und Kronprinz Sebele.—Molopolole's Umgebung.—Sitten und Gebräuche der Betschuana's.—Religiöse Vorstellungen derselben.—Naka's, Linjaka's und Moloi.—Heilmethode und Heilmittel derselben.—Beschwörung Khama's.—Regenmacher.—Aufbruch von Molopolole.—Ein dornenvoller Marsch.—Eingeborne Postboten.—Wassernoth.—In Lebensgefahr.—Barwa's und Masarwa's.—Abergläubische Gebräuche dieses Sclavenstammes der Betschuana's.—Ihre Jagdlist.—Neujahrsfeier in der Wildniß.—Im Bakwenalande verirrt.—Von Masarwa's gerettet.—Ein merkwürdiger Fund.—Begegnung mit Leoparden.—Ein besorgter Vater.—Einzug in Schoschong.
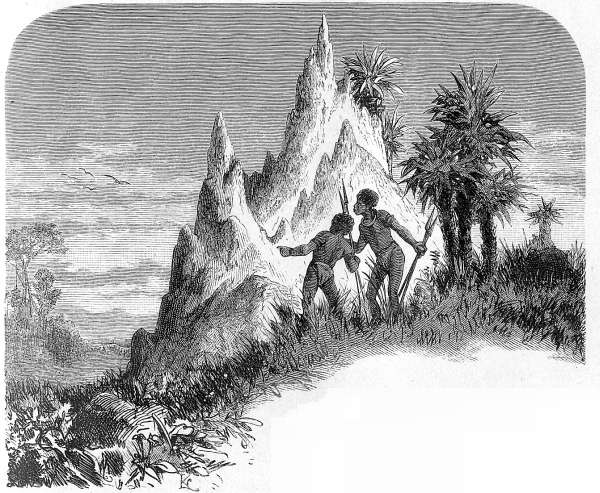
[Termitenhügel.]
Unstreitig bietet Molopolole von dem Thalkessel aus gesehen den interessantesten Anblick und die schönste Scenerie unter allen Betschuanastädten dar. Aus dem kleinen, grün begrasten Thalkessel, in dem wir stehen, erblicken wir um uns die meist in ihren oberen Partien oder bis zur Hälfte perpendiculär abfallenden, oder bis an ihren Fuß von Blöcken gebildeten, zwischen diesen aber und an den minder abschüssigen Abhängen dichtbebuschten, hie und da mit einer riesigen Aloëspecies gezierten Felsenhöhen. Zu unserer Rechten die von Norden kommende Schlucht mit der überaus interessanten Felsenformation des überhängenden Molopololefelsens und zwischen uns und dieser Schluchtmündung hohe Laubbäume, die Gebäude der Missionäre und ihre Gärtchen mit dem tropischen Pflanzenwuchse der Bananen und des Zuckerrohres geschmückt. Vor uns, am Fuße der östlichen steilen, und rechts von uns an dem der westlichen bewaldeten Höhe je ein Eingebornendorf, in dem letzteren die umfangreichen Gehöfte der Handelsfirma Taylor, nächst Francis und Clark die bedeutendste in den Betschuanaländern, und zwischen den beiden dringt der Blick durch das nach Süden führende Felsenthor, die Kobuque—und über dem Dorfe vor uns endlich nach Osten zu—hoch oben der von den Besten des Stammes bewohnte Stadttheil mit den königlichen Gehöften. Wenden wir uns nach Norden und Westen, so sehen wir den nördlichen Stadttheil am Fuße der nördlichen Höhenkette und außerhalb des Thalkessels die röthlichen Ruinen einer verlassenen Eingebornenstadt und die breite Ebene, von dem dunklen Grün des eben durchreisten, tiefsandigen Waldes nach Süden und Südwesten begrenzt. Was uns noch bei dieser Betrachtung auffällt, sind einige am Fuße der letztgenannten Höhen wie am Uferrande des Bächleins stehende Riesenbauten der Termiten.[1]
1 Der eine war 9½ Fuß hoch (die Hauptpyramide) und hatte (mit den Nebenpyramiden) 40 Fuß Peripherie.
An Molopolole haben wir die Schönheit der Naturscenerie zu bewundern, ohne daß der Fleiß seiner dunklen Bewohner durch Anpflanzungen oder hervorragende Form im Baustyle seiner Hütten etwas dazu beigetragen hätte, nur die Anlage der Stadt an der von der Natur aus befestigten Stelle spricht zu Gunsten ihres Königs. Der gegenwärtige König Seschele, dem schon Livingstone einige Capitel seines Buches (»Missionary Travels«) widmet, und von dem ich noch ausführlicher zu reden haben werde, wohnte mit seinem Stamme, den Bakwena, der durch innere Reibungen und Kriege mit den umwohnenden Stämmen bedeutend herabgeschmolzen war, südöstlich von Molopolole, nahe da, wo wir jetzt die Stadt der Manupi finden. Ruinen bezeichnen noch die Stelle wo er gehaust; diese seine erste, gegen die Transvaal-Grenze zu gelegene Residenz hieß Kolobeng. Hier wurde er im Jahre 1842 von dem Nestor der Afrika-Reisenden besucht.
Aus Kolobeng wurde Seschele von den Boers vertrieben und siedelte sich dann in Liteyane, 10 englische Meilen westlich von Molopolole an. Seit 1865 residirt er in Molopolole, wo sich schon früher eine Niederlassung im Thalkessel befand und wohin auch Pilani aus der Mosupa-Stadt übersiedelte. Das Gebiet Seschele's, das nördlichste der vier erwähnten Betschuanareiche, grenzt nach Westen an das große Namaqualand, im Norden an das der westlichen oder N'Gami-Bamangwato's oder der Batowana's und an das der östlichen oder Schoschong-Bamangwato's, im Osten mit dem Limpopo und Marico an die Transvaal-Colonie und im Süden an das Land der Banquaketse. Die Südgrenze verläuft unter 24° 10' s. Breite von Koluany, an Kolobeng vorbei in südöstlicher Richtung zu den Dwarsbergen bis zum großen Marico. Die nördliche Grenze gegen die zwei Bamangwato-Reiche liegt unter 23° 30' s. Breite und folgt zum Theile dem Sirorume-River. Die Zahl der eigentlichen Unterthanen Seschele's schätze ich auf 32-35.000 und jene der im Lande wohnenden, allein keinen Tribut an Seschele zahlenden Batloka, Bakhatla und Makhosi auf 18-20.000, während ich die Kopfzahl der das ganze Banquaketseland bewohnenden Stämme auf 28-30.000, die eigentlichen Unterthanen im Lande Montsua's, des Königs der Barolongen auf 33-35.000 und jene in seinem Lande südlich vom Molapo gegen die Batlapinen zu wohnenden, allein ihm nicht Tribut zahlenden kleinen Barolongenstämme in der Umgebung gewisser Städte, wie Marokana etc. auf 30.000 veranschlagen möchte. Mankuruane, der Batlapinenkönig hat über 30.000 unter seinem Scepter, während sich in dem kleinen Mamusa-Königreiche kaum 8000 finden dürften, obwohl die Stadt Mamusa allein vor einigen Jahrzehnten an 10.000 Bewohner in ihrem Weichbilde beherbergt hatte.
Als wir am 21. Abends auf dem Rasenplatze in dem Molopololekessel lagerten, näherten sich uns ein ärmlich gekleideter Holländer, der hier Schmiedarbeiten versah, und zwei Eingeborne, welche uns Weideplätze für die Zugthiere anwiesen. Bald adarauf erschienen die beiden Missionäre Price und Williams und hießen mich willkommen. Der letztere ist seitdem nach Europa zurückgekehrt, während Rev. Price von seiner Gesellschaft nach Central-Afrika beordert wurde. Durch seine zweite Verehelichung mit Miß Moffat ist er mit Livingstone verschwägert.
Am folgenden Morgen unternahm ich einen Ausflug zu der nach Westen gelegenen Ruinenstadt und einen zweiten in die mit dem Molopolole-Thor in den Thalkessel mündende Schlucht aufwärts. In der Ruinenstadt fielen mir die gewölbten, aus Schilfrohr und Ruthen errichteten und cementirten Doppelbauten auf, wie ich sie in Mosilili's Stadt am Mosupaflusse beobachtet habe.
Türkische Feigen und die bekannte südafrikanische violettblühende Datura gediehen auf diesem Platze vorzüglich.
Unter den bewohnten Hütten der Baknena oder Bakwena fielen mir namentlich zwei Merkmale auf, durch welche sich dieselben von jenen der Barolongen und Batlapinen etc. unterscheiden. Sie waren im Allgemeinen weniger fest gearbeitet und konnten sich mit denen der Barolongenhütten etc. nicht messen, doch zeigten die meisten aus Thon gearbeitete Umzäunungen, die wir z.B. bei den östlichen Batlapinen nur noch an dem Feuerherde, bei den südlichen und westlichen gar nicht vorfinden. In den Dörfern fand ich frei zwischen den Gehöften stehende Berathungshäuschen, d.h. ein kegelförmiges, auf 20 und mehr Pfählen ruhendes Strohdach, die Oeffnungen zwischen den einzelnen Pfählen waren bis auf die Eingangsstelle mit einer solid gearbeiteten Rohrwand bis zur halben Höhe der Pfähle geschlossen und diese Wand mit einfachen Ockermalereien verziert.
Mein Ausflug die Molopolole-Schlucht aufwärts, an den Gebäuden der Missionäre vorbei, war recht lohnend. Ich schoß in dem Gewässer, das jedoch noch im Bereiche der Stadt versiegt, mehrere Fische und fing mit der Angel am Felsenthore sieben Welse. Der linke Flügel des Felsenthores wird durch einen perpendiculären, man könnte beinahe sagen, in seinen oberen Partien etwas überhängenden Felsen gebildet, unter welchen sich eine tiefe Stelle findet, die durch theils natürliche, theils künstliche Abdämmung stets gefüllt ist und den Fischen auch in trockenen Jahren eine sichere Zufluchtsstätte bietet; diese würden sich auch in den oberhalb in der Schlucht befindlichen Tümpeln bedeutend vermehren, wenn die letzteren ob ihres geringen Umfanges nicht so leicht von den Fischottern und Leguanen heimgesucht wären.
Mit nicht geringem Erstaunen und zugleich mit Unwillen, hörte ich von einer Elephantenjagd, die sich einige Monate zuvor mitten in der Stadt zugetragen. Der letzte Winter (die Zeit des europäischen Sommers) war im Lande der Bakwena's ungemein trocken. Von allen Seiten brachten die Barwa's und Makalahari Wildfleisch und Felle zu ihren Herren nach Molopolole, denn das abgemattete und durstende Wild ließ sich mühelos erlegen. Die Regentümpel, die Quellen (die Flußbette waren längst ausgetrocknet) trockneten aus, so daß man die Heerden bis an den unteren Marico und Limpopo zur Weide führen mußte. In Molopolole selbst war der Bach beinahe vollkommen versiegt und die Frauen mußten stundenlang warten, bevor sie ihre Töpfe füllen konnten. Die halbverdursteten Thiere, Eland-Antilopen, Giraffen, Säbel-Antilopen, gestreifte Gnu's, nebst einer Unzahl Gazellen und kleiner Antilopen schleppten sich zu den wenigen übrig gebliebenen Wasserstellen, um hier in den Tod zu laufen, denn diese waren von Jägern umstellt.
Zu dieser Zeit—im Monate Juni—erscholl eines Tages ein Geschrei von Hütte zu Hütte, von Dorf zu Dorf im Thale sich verbreitend und auf die Hohen dringend, ein Geschrei, das die Händler und Missionäre für Kriegsgeschrei hielten; als sie bestürzt nach der Ursache desselben forschten, sahen sie mitten im Thalkessel eine zehn Stück zählende, laut brüllende, nach den Quellen sich Bahn brechende Elephantenheerde vor sich. Weiße und Schwarze, alles was nur ein Kugelgewehr hatte, sprang herbei und die Metzelei begann.
Für Molopolole war dies der größte Tag seitdem es zur Residenz des Königs Seschele auserkoren war. Das Auge des Bakwena, der an der Jagd, recte Metzelei, Theil genommen, glüht und er lacht und gesticulirt laut, wenn er von dem Ereignisse spricht, das sich auch bis in die Köpfe der Greise und der Frauen, selbst die ihrer Kinder eingeschlichen hat, wer von ihnen hätte auch jener glorreichen Festtage vergeben können, an denen man einige Tage hindurch an Fleisch ñama (njama) Ueberfluß hatte. Diese in Molopolole getödteten Elephanten gehörten sämmtlich (wie ich später von den Boers erfuhr) der größten, doch die kleinsten Zähne tragenden Varietät des afrikanischen Elephanten an, die Zulah oder Hohlkopf genannt wird.
Von den beiden Predigern eingeladen, besuchte ich sie und fand, daß Rev. Price geschmackvoll eingerichtet jeder Bequemlichkeit sich rühmen konnte. Er hatte aber auch hart arbeiten müssen, bevor er es so weit gebracht. Er war einer der beiden Missionäre, welche die Mission im Lande der Makololo, d.i. in dem von ihnen mit Waffengewalt eingenommenen Gebiete zu errichten bestimmt worden waren und die Arbeit auch in Angriff genommen hatten, allein durch Mißerfolge entmuthigt, endlich aufgeben mußten. Rev. Price und Helmore erreichten die Stadt Linyanti am nördlichen Tschobe im Februar 1860 nach einer siebenmonatlichen Reise von Kuruman und wurden von dem Makololokönige Sekeletu freundlich aufgenommen, doch schon nach 14 Tagen waren beinahe Alle am Fieber erkrankt. Zuerst starb Malatsi, einer der Betschuana-Wagenführer—alle central-südafrikanischen Betschuana's mit Ausnahme der Batowana's vom N'Gami-See und der Makoba's am Zuga-River werden in Malaria-Gegenden vom Fieber decimirt—acht Tage später, als Rev. Price, der sich noch auf den Füßen erhielt, den Kranken die letzte Wegzehrung reichte und Einer nach dem Andern mit dem Tode abging, fand er das kleinste der vier neben Frau Helmore liegenden kranken Kinder kalt und leblos. Der Mutter, die bewußtlos am Fieber dalag, wurde so das Leid erspart, das erste Opfer unter den Ihrigen zu sehen; am 9. März starb der Säugling, dem Frau Price das Leben gegeben. Am 11. schied Selma Helmore aus dem Kreise der Niedergeworfenen und am nächsten Tage folgte ihre Mutter, den Folgen des schrecklichen Uebels erliegend. Selbst die Schwarzen wissen nur Gutes von dieser edlen Frau zu berichten, welche die Wildniß und das giftige Klima nicht gescheut, um dem Manne zu folgen, und mit ihm das Los seines Berufes zu theilen, unter einem wilden, kriegerischen Volksstamm das Wort Gottes zu verbreiten.
Auf der Reise gegen den Tschobe, auf welcher die Reisenden mehr als einmal vor Durst beinahe umgekommen wären, hatte sie oft ein seltenes, aufopferndes Beispiel ihrer Mutterliebe gegeben, um ihre Kinder vor dem Tode des Verdurstens zu retten und nun, in ihre neue Heimat gekommen, war ihrem, einem der edelsten Leben, in wenigen Tagen Halt geboten worden. Doch selbst in ihren Delirien—zu einem Skelett abgemagert und mit entstellten Gesichtszügen—hatte ihre innige Mutterliebe ihr momentan die überstandenen Sorgen in's Gedächtniß zurückgebracht, denn oft murmelten die in Fieberhitze glühenden Lippen, daß ihrem »Henri« (dem ersten Opfer in ihrer Familie) dürste und baten, man möge den ihr zukommenden Löffel voll des rettenden Elementes dem Kinde reichen. Nach dem Tode der Frau besserte sich für kurze Zeit der Zustand der übrigen, verschlechterte sich jedoch wieder im April und am 21. erlag Helmore dem Fieber, nachdem schon am 11. und 19. März Tabe (sprich Teb) und Setloke, zwei Betschuana's (Batlapinen), gestorben waren.
In dieser schweren Zeit wurde außerdem einer der Diener mit Namen Mahuse Verräther an den übrig gebliebenen. Den Zustand derselben wohl einsehend, fand er sich täglich am Hofe des Sekeletu ein und brachte ihn endlich zu der Ueberzeugung, daß alles, was dem Herrn Helmore gehöre, nur ihm, dem Könige, zufallen müsse. Daß diese und ähnliche Worte unter dem wilden Makololostamme und von Seite seines Königs williges Gehör fanden, wird man leicht begreifen. Die Makololo stahlen und nahmen was sie wollten und als Herr Price Linyanti verlassen wollte, da kam Sekeletu, nahm ihm außer einigen wenigen Kleidungsstücken alles ab und ließ ihn nur mit dem leeren Wagen von dannen ziehen. Bei dem später erfolgten Besuche Livingstone's trachtete er seine Infamie auf jede Weise zu beschönigen, doch sein unruhiger Geist ließ ihm keine Rast, bis er freiwillig einem in die Tschobe-Gegenden auf die Elephantenjagd ausgehenden Banquaketse, mit Namen Sebehwe, ein volles Geständniß seines schurkischen Betragens abgelegt hatte.
Auf seiner Reise von Linyanti nach dem Süden verlor auch Rev. Price sein treues Weib in den Ebenen des östlichen Mahabi; sie starb am 5. Juli und wurde von ihrem Gemal unter dem einzigen auf der weiten Grasfläche sichtbaren Baum beerdigt. Er reiste langsam mit den beiden Waisen des Herrn Helmore weiter gegen den N'Gami-See und wurde, hier endlich angekommen, von dem Könige der westlichen Bamangwato's Letschulatebe, freundlich aufgenommen und behandelt und traf einige Tage später meinen geliebten Freund, Rev. Mackenzie, der auf dem Wege nach Linyanti begriffen war, um der Mission Proviant etc. zuzuführen.
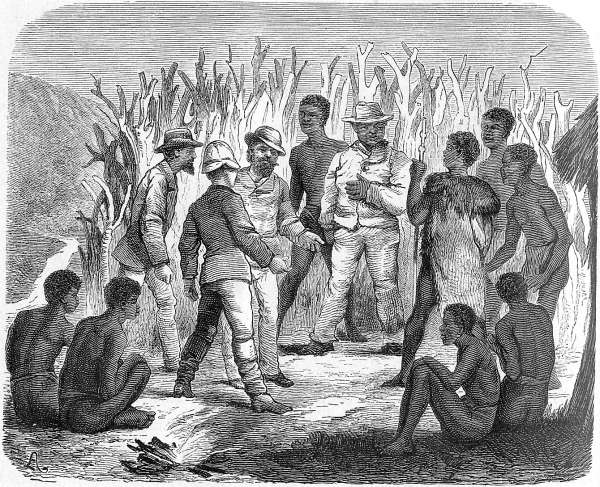
[Bei König Seschele.]
Rev. Price hatte mir bei meinem Besuche in seinen. Hause in Molopolole diese Episode mitgetheilt, später hörte ich sie wieder von meinem Freunde in Schoschong, ohne zu ahnen, daß auch die Zeit an mich herantreten würde, in der ich mit einem ähnlichen Ungemach zu kämpfen haben sollte. Doch wenn wir Beide auch aus verschiedenem Antriebe die Einöden Süd-Afrika's durchwanderten, er mit dem Banner der Religion, ich um meine geringen Kräfte der Wissenschaft zu widmen, die Sumpffieber haben unsern Wissens- und Thatendrang nicht zu ersticken vermocht.
Obwohl er sich in Molopolole bereits eine Heimat gegründet hatte, folgte er willig dem an ihn ergangenen Rufe an den Tanganjika-See.
Neben Rev. Price erwähnte ich Rev. Williams als seinen Brudermissionär, gleich den Missionären in Kuruman (Batlapinen), Taung, Kanja (Banquaketse) und Schoschong (östliche Bamangwato) der »London Missionary Society« angehörend, war er erst einige Jahre in Süd-Afrika und eben im Begriffe, sich ein Wohnhaus aufrichten zu lassen. Die beiden Herren erboten sich, mich dem Könige vorzustellen und so machten wir uns den zweiten Tag nach meiner Ankunft in Molopolole daran, die Felsenhöhe, auf der wie ein Adlernest der von den Getreuesten der Getreuen Seschele's bewohnte Stadtheil erbaut ist, hinanzuklimmen. An Mr. Williams Gebäude vorüber, hatten wir eine enge, steile Schlucht nach aufwärts zu verfolgen, an derem Eingange die von Mr. Price erbaute Kirche, ein 60 Fuß langes und 21 Fuß breites, mit einem Anbau versehenes, gewöhnliches, mit Gras gedecktes Gebäude steht. Von der Kirche gingen wir durch den südöstlichen Theil des oberen Stadttheiles nach der Residenz zu, doch zuvor mußten wir in die Kotla eintreten, um hier in formeller Weise den von meiner Ankunft in Kenntniß gesetzten König zu begrüßen. Unter der Kotla verstehen wir die aus starken Pfählen und Baumstämmen geformte runde Umzäunung, wie sie in der Regel in der Mitte der Betschuanastädte für Berathungszwecke erbaut ist. Auf der der königlichen Wohnung zugekehrten Seite der Umzäunung befindet sich in derselben eine Oeffnung, die nach Belieben mit Baumstämmen geschlossen werden kann. An der den genannten Wohnungen nächsten und besonders dicht gebauten Stelle findet sich der Ort, wo der Herrscher, auf einem Stühlchen sitzend zu beiden Seiten von den Aeltesten des Stammes, oder den Häuptlingen, oder seinen Verwandten umgeben, die Berichte der vor ihm auf der Erde hockenden Boten, Jäger, Spione und die Parlamentäre anderer Eingebornenkönige anhört und ihnen selbst, oder durch einen der zunächst Sitzenden Bescheid ertheilt. Oft ist in der Umzäunung eine kleine gedeckte Holzhütte erbaut, in welcher in der Regel ein Feuer brennt, dieselbe wird während der Regenzeit als Versammlungsort benutzt. Diese Kotla's dienen zugleich als Forts; bei jenen, die am Fuße von Höhen liegen, sind namentlich die gegen dieselben gewendeten Umfriedungspartien aus großen und schweren Baumstämmen errichtet, um die Wirkung der Wurfgeschosse abzuschwächen.
Seschele empfing uns stehend. Der König der Bakwena's ist hoch in den Fünfzigern, wohlbeleibt, von großer Statur, ein beinahe unaufhörliches Lächeln umspielt sein Gesicht. Es war leicht erklärlich, daß ich mich in meinem Urtheile über dieses eigentümliche Lächeln nicht täuschte, und meine Ansicht auch bestätigt fand. Es drängte sich mir unwillkürlich die Meinung auf, daß ich einen »Tartuffe« vor mir habe.
Seschele wandte sich, nachdem er unsere Grüße erwidert, zu Rev. Price und ersuchte ihn, mir zu sagen, es hätte ihm noch nie ein Weißer so gefallen wie ich. Während mir es Price übersetzte und ich erstaunt war, solch' ein Kompliment von einem Eingebornen, den ich zum ersten Male getroffen, zu hören, und den König prüfend anblickte, sah ich, wie dieser mit seinem rechten Auge einen ihm zunächst stehenden Alten (Unterhäuptling) und seinem Sohne zuwinkte; sein Mienenspiel der rechten Gesichtshälfte stand mit dem mir vorhin erwiesenen Komplimente im offenen Widerspruche. Die Leichtigkeit, mit der er sich aber sofort, als er mein Erstaunen begriffen, aus der zweideutigen Lage zu helfen wußte, zeigte von nicht geringer Selbstbeherrschung.
Er lud mich und die beiden Missionäre hierauf ein, ihn in seine Behausung zu begleiten und eine Tasse Thee zu nehmen. Wenige Augenblicke später standen wir vor seinem neuen Hause, einem reinen und schmucken Gebäude, neben welchem sein früheres, nur von dem ältesten Sohne bewohntes Häuschen stand, an das sich die übrigen von der königlichen Familie bewohnten anschlossen. Das neue Haus für den König von Taylor um den Betrag von 3000 £ St. aufgebaut und adaptirt worden, welcher Betrag dem Kaufmanne in Straußenfedern und Ochsen ausgezahlt wurde.
Unter allen Betschuana-Herrschern ist Seschele am bequemsten und in europäischem Style eingerichtet. Doch bevor wir mit dem Könige das reine, gepflasterte Höfchen, in dem die Königin, auf unseren Besuch unvorbereitet, nach Bakwenasitte auf einem Rindsfelle lag, und sein Wohnhaus betreten, erlaube ich mir, den geehrten Leser mit Seschele etwas vertrauter zu machen. In Bezug auf Charakter nimmt Seschele unter den sechs Betschuana-Herrschern, trotzdem er sich die längste Zeit zur christlichen Religion bekennt, die unterste Stufe ein, während sein nördlicher Nachbar, der jetzige König der östlichen Bamangwato, Khama, am höchsten und ihm als der Nächste unser gutherziger Freund Montsua zur Seite steht.[1] Seschele ist ein geschickter Intriguant, ein Mann mit einem Doppelgesicht, seinen Intentionen entspricht die Sentenz »Der Zweck heiligt das Mittel«.
1 Von Chatsitsive will ich noch nachträglich erwähnen, daß er als Character zwischen Mankuruan und Montsua die Mitte hält, d.h. daß ihm mehr zu trauen und zu glauben ist als dem Ersteren, ohne daß er die Gutmüthigkeit und lobenswerthen Eigenschaften des letzteren besäße.
Sein Stamm, die Bakwena's, leiten ihren Namen von Ba (oder Ma) und Kuena (Kwena) her, d.h. »die Menschen des Crocodils, oder die Menschen, die den Tanz des Crocodils tanzen,« also Menschen, die, ohne das Crocodil zu vergöttern, ihm eine gewisse Achtung zollen.[1]
1 In dieser Weise finden wir auch die übrigen Betschuanastämme benannt, d.h. mit Namen, die sie sich selbst gegeben, nachdem sie das centrale Süd-Afrika eingenommen und sich dann in die verschiedenen Stämme getheilt hatten. So bedeutet der Name der Batlapinen eigentlich die Ba-Tlapi, d.h. »die den Fische geweihten«. Bakhatla (Ba-Khatla), die den Affen Geweihten; Batau = Ba-Tau (Taung), dei dem Löwen Ergebenen: Makhosi oder Makosi = Ma-Khoschi, Menschen, die einen Herrn (Häuptling), Banoga = Ba-noga (oder nocha), die eine Schlange etc. verehren.
Die Bakwena waren noch vor vierzig Jahren, nachdem sie sich bereits von den Banquaketse getrennt und selbst nachdem ein Theil derselben nach Norden auswanderte und sich näher an die Bamangwato ansiedelte, ein reicher Stamm, der sich meist von der Jagd und Viehzucht nährte. Der schwächere Theil zog nach dem Ngami-See ab, wo er zwar anfangs durch Fieber arg litt, der Rest aber sich nach und nach acclimatisirte und über die daselbst wohnenden Stämme die Oberhand gewinnend, mit ihnen ganz verschmolz. Die zahllosen am Notuany, am westlichen Marico-Ufer und den westlichen Nebenflüssen des letzteren weidenden Heerden bildeten den Reichthum des Stammes.
Mochoasele, Seschele's Vater, machte sich eines Verbrechens à la Morena David schuldig, in Folge dessen er ermordet wurde und die unzufriedenen Häuptlinge eine andere Herrscherfamilie zu wählen beschlossen. Es geschah um die Zeit als Sebituane, von dem Stamme der Basuto's, mit seinen kriegerischen Makololo die Masse der Betschuana's durchbrechend, nach Norden zog, um sich jener Striche, von denen er vernommen, daß sie sich eines ewigen Frühlings erfreuen, d.h. der Gegenden am Tschobe und Zambesi zu bemächtigen. Die Freunde des getöteten Mochoasele sandten heimlich Boten zu Sebituane und baten ihn, dem jungen Seschele zu seinem Rechte zu verhelfen. Sebituane entsprach auch ihrem Wunsche und sicherte dem Sohne des getöteten Fürsten die Herrschaft über die Bakwena's. Diese Verfügung, sowie die neuerliche Loslösung einzelner Abtheilungen vom Hauptstamme, welche nach Nordost, Süden und Südost auswanderten, schwächte die Bakwena's an Zahl und Macht und verminderte ihre Wohlhabenheit. Auf Livingstone's Anrathen, der im Jahre 1842 Seschele zum ersten Male besuchte und ihm den ersten Begriff eines rationell betriebenen Ackerbaues, wenn auch in einfachster Form, beibrachte, wechselte der junge Herrscher seinen Wohnsitz und ließ sich 20 geographische Meilen entfernt am Kolobengflüßchen nieder; so entstand seine erste und eigentliche Residenz Kolobeng.
Der Ackerbau schien den Bakwena's Segen zu bringen und der Stamm erholte sich sichtlich; trotz einiger Dürre-Perioden war der Stamm derart erstarkt, daß er den anwohnenden Holländern, die, wie es ihr Vorgehen mit Mankuruan, Montsua und Chatsitsive beweist, ihre Grenzlinien nach Westen ausdehnen wollten, allzu mächtig zu werden schien und sie ihn »kleen« zu machen beschlossen. Sie beschuldigten die Bakwena's, daß sie Diebstähle an ihren Farmen begangen und drangen auf Züchtigung derselben. Mochte nun auch der Vorwurf des Viehdiebstahls gerechtfertigt sein, das Vorgehen der holländischen Boer's, welche im Jahre 1852 Kolobeng überfielen und verbrannten, alles Vieh, dessen sie habhaft werden konnten, raubten und zahlreiche Gefangene mitschleppten, läßt sich in keiner Weise entschuldigen, es bleibt ein willkürlicher Gewaltact. Nach der Zerstörung Kolobeng's erstand Liteyane und später Molopolole.
Seschele wurde in seiner Jugendzeit Christ, als er aber bemerkte, daß die Mehrzahl seines Stammes am Heidenthume hielt, sein Bruder Khosilintschi von dem Volke sehr geachtet wurde und durch seine (Seschele's) Bekehrung die von ihm aufgegebenen heidnischen Gebräuche, deren Leitung dem jeweiligen König zufielen und mit dem Genuß der ersten Feldfrüchte und der Regenmacherei etc. verbunden waren, nunmehr von seinem Bruder geleitet und vollstreckt wurden und dieser in der Gunst der Volkes stieg, entschloß sich Seschele, wohl bis zu einem gewissen Punkte, so z.B. den Besuch der Kirche, der Taufe seiner Kinder u.s.w. Christ zu bleiben, sonst aber, soweit dies mit seiner Macht als Herrscher zusammenhing, die heidnischen Gebräuche auszuüben und theilweise auch zu leiten. Die kleine, junge, christliche Gemeinde unter den Bakwena's sah darin nichts Arges, betrachteten das Singen, Kirchengehen und die Monogamie als die Hauptpflichten eines Christen, während die mächtige Partei der Regenbeschwörer, id est Heiden, froh war, den König den alten herkömmlichen Landesgebräuchen treu zu sehen.
Noch einige Züge aus seinem Leben, um seine Geschichte abzurunden und dann, lieber Leser, wollen wir sein jetziges »Schlößchen« auf den Bakwenahöhen betreten. Im Jahre 1864 sandte Seschele einige Hundert seiner Leute aus, um Sekhomo, den damaligen König der Bamangwato, anzugreifen. Doch die Makalahari-Vasallen berichteten diesem rechtzeitig die Annäherung der Bakwena's und diese wurden im Thale des Schoschon-Rivers, vor der Stadt Sekhomo's, geschlagen. Diese Truppe wurde von Khosilintschi angeführt. Seschele entschuldigte sich, daß er den Raubzug auf Anrathen Matscheng's, des früheren, nun flüchtigen und bei ihm wohnenden Bamangwatokönigs angeordnet hatte. Einer weiteren Schandthat machte sich Seschele durch die Ermordung Tschukuru's im April 1866, des Schwiegervaters des gegenwärtigen Königs der Bamangwato, Khama (Sekhomo's Sohn), schuldig. Bei einem der schändlichen Versuche, seine beiden vom Volke geliebten Söhne Khama und Khamane zu tödten, wobei diese sich flüchten mußten, sich später aber auf Gnade ergaben, wollte Sekhomo den Anhängern seiner Söhne gegenüber nicht gleiche Gnade walten lassen, weshalb diese, darunter auch Tschukuru, auf Seschele's Einladung hin, Zuflucht bei diesem nahmen. Sie kannten zwar Seschele nicht, allein weil ihnen ein Sohn Seschele's (ein Getaufter) mitgegeben war, ließen sie sich doch überreden, nach Molopolole zu wandern. In der ersten Nacht wurde Tschukuru unter dem Vorhaben aufgeweckt, daß ihn des Königs Bruder zu sehen wünsche und als er unvorsichtiger Weise dem Boten folgte, im Walde von Bewaffneten niedergestoßen. Seschele hatte dies angeordnet, weil sich Tschukuru im Kampfe gegen die Schoschong angreifenden Bakwena hervorgethan und dann auch, um Sekhomo, der den alten Mann haßte, einen Gefallen zu erweisen. Als Sekhomo durch den vertriebenen und zu Seschele geflüchteten Mascheng verdrängt wurde und selbst bei Seschele Zuflucht nahm, half dieser mit seinen Leuten den Söhnen Sekhomo's, Mascheng, seinen früheren Schützling, zu vertreiben.
In den folgenden erneuten Kämpfen zwischen Sekhomo und seinem Sohne Khama bot er beiden seine Hilfe zugleich, gegen eine Summe von 2000 £ St. in Straußenfedern und Elfenbein. Eine seiner letzten Ehrenthaten war das von ihm erlassene Gesetz, womit er einigen holländischen Jägern gegen schweres Geld Erlaubniß gab, durch sein Land zu ziehen und in dessen nordwestlichem Theile zu jagen, dabei aber den Makalahari, welche die Jagdgebiete bewohnten, sowie den Führern der Jäger verbot, diesen die Wasserstellen zu zeigen. Die von den Bakwena's unter Führung seiner Söhne im Jahre 1876 an den Bakhatla's verübten Grausamkeiten sind noch in frischer Erinnerung.—
Bei unserem Eintritt in den Hof des königlichen Hauses wurden wir von der sich erhebenden Königin, einer großen starken Frau, die ein nach hinten zusammengebundenes Kopftuch, so wie ein großes, wollenes Umschlagtuch und ein Cattunkleid trug, bewillkommnet und in's Haus geführt. Des Königs voller Titel ist »Seschele M'Kwase Morena ea Bakwena.«[1]
1 Unter den centralen Betschuana's ändert der Vater seinen Namen wenn seine Familie mit mehreren Söhnen bedacht ist und diese im Aufwachsen begriffen sind, indem er den Namen des ältesten Sohnes annimmt, z.B. heißt der Häuptling der östlichen Bakhatla gegenwärtig Ra-Piti, d.h. der Vater (Ra) des Piti (sein ältester Sohn), während die Mutter den des jüngsten Sohnes annimmt, so heißt die Königin oder Seschele's Frau, Ma-sebele, d.h. (Ma oder M') Mutter des Sebele.
Wir wurden von Seschele zuerst in das Empfangszimmer geführt, während Ma-sebele den Auftrag gab, uns einen Imbiß zu bereiten. Das Empfangszimmer (Seschele gebraucht den englischen Ausdruck »drawing-room«, nur daß er ihn in einer regelwidrigen Weise ausspricht) ist vollkommen mit europäischem Comfort eingerichtet, Stühle etc. aus Nußbaum, die Sitzpolster mit rothem Sammt überzogen. Ein selbstbewußtes Lächeln, durch die hohe Meinung über sich selbst hervorgerufen, besonders wenn er sich in seinem drawing-room befand, soll das ohnehin freundlich lächelnde Vollgesicht des Bakwena-Herrschers umspielen, so oft er einem Weißen das Innere seines Palastes zu zeigen in der Lage ist, und sich an dem Erstaunen des Fremden weiden kann—auch mir armen Sterblichen wurde das hohe Glück zu Theil, es zu schauen.
Während wir uns niederlassen mußten, breitete sich der König erst sein Schnupftuch (das er jedoch nicht zu gebrauchen scheint) auf den von ihm erkorenen Stuhl aus, bevor er sich auf denselben niederließ. Ma-sebele trat später auch ein, und ließ sich auf einem Holzstuhle nieder. Durch meine beiden Begleiter befragte mich Seschele nach dem Zwecke meiner Reise, nach meiner und der Nationalität meiner Begleiter. Da er, wie die meisten der Betschuana's nur »Engländer« und »Boers« kannte, die ersten gerne sah, die letzteren »nicht liebte«, so war er sehr erstaunt zu hören, daß ich ein Weißer sein konne, ohne zu einer der beiden Nationen zu gehören. Endlich hatte er sich das Wort »Austria« eingeprägt und nun fragte er, an welchem Flusse ich wohne und ob in einer Stadt oder auf einem Viehposten, d.h. auf dem Lande. Ich nannte Prag, für ihn ein neues Räthsel und dies um so mehr, als ich, um die Größe der Stadt nach Betschuanabegriffen darzustellen, ihm mittheilte, daß Prag seine Residenz Molopolole zwanzig Mal an Umfang übertreffe. Er meinte, sein »Herz wäre voll Staunen über das große Dorf« und nachdem er die ihm übersetzten Worte meiner Begleiter nachgesprochen, erzählte er der Königin, die mich gnädig zu mustern schien, die ganze Episode mit den Worten: »Er (nach mir weisend) ist ein Naka (Njake, Njaga oder auch Njaka, d.h. Doctor) no Englishman, no Boer (er sprach Bur), sondern ein—hier sah er wieder fragenden, doch auch lächelnden Antlitzes Herrn Price an; dieser nickte auch und sagte Au—strian—O—O—stri—en, plapperte Seine Majestät nach und stand auf, um sich in die Brust zu werfen, da ihm dies gelungen.
Ein neuer Ankömmling, lachend und beide Missionäre begrüßend, ward nun auf der Thürschwelle sichtbar, es war ein etwa 14jähriger, hoch aufgeschossener, mit Hemd, Weste und Beinkleidern angethaner Jüngling, der eine rothe, wollene Zipfelmütze trug. Er lachte zu allem was gesprochen wurde, namentlich als ihn seine Mutter—denn der schmucke Jüngling mit dem Barett auf dem wolligen Kopfe war kein Minderer als Sebele, der Jüngste oder Ma-sebeles darling Baby (Herzenskindlein)—mir mit den Worten mo Sebele o Thō-li[)ng] Bĕb vorzustellen geruhte. Nach einer halben Stunde fiel es plötzlich dem jungen Königssohne ein, seiner Mutter mitzutheilen, daß der Thee im Speisesalon aufgetragen sei.
Seschele eröffnete hierauf den Zug, wir folgten und Ma-sebele bildete den Nachtrab. Wir waren alle im besten Humor—namentlich ich und Tholing—, ich weil ich zum ersten Mal seit zwei Monaten, und Tholing Beb, weil er schon zum zweiten Mal an diesem Morgen die »Kuchen« des Makoa (die Kuchen des weißen Mannes) erblickte. Doch wurde ihm das Glück nicht zu Theil, gleich uns an der Tafelrunde zu sitzen; er war bestimmt die »Honneurs« zu machen, worauf er sich ziemlich gut zu verstehen schien.
Das Speisezimmer hatte eine schöne mit weißem Linnen gedeckte Tafel, der Thee wurde in napfförmigen Tassen servirt, von denen die des Königs, der oben an der Tafel saß, mindestens einen Liter fassen mochte. Die Kannen, Zuckerdose und das übrige auf einem Seitentischchen stehende Tischgeschirr war aus Silber gearbeitet und wie ich hörte, dem Könige von den periodisch sich in Molopolole aufhaltenden Kaufleuten verehrt worden. Der Thee war gut und die Kuchen ließen nichts zu wünschen übrig. Unser Gespräch aus dem drawing-room wurde fortgesetzt und ich über das Gebahren der englischen Regierung in den Diamantenfeldern und jenes der holländischen in Pretoria und Bloemfontein befragt.
Ihre schwarze Majestät schien an unserer Conversation kein Interesse zu finden und fing anfangs leise und verstohlen, doch als nach und nach die Natur über sie die Oberhand gewann, merklicher und hörbarer, ihre durch unser Eintreten in's Höfchen unterbrochene Beschäftigung wieder aufzunehmen, d.h. zu schlummern. Der Herr Ehegemahl sah dies und da es ihm vielleicht etwas ungebührlich dünkte, gab er ihr erst durch ein Hüsteln und als dieses nichts half, zeitweilig durch eine zarte Berührung mit seinen Elephantenfüßchen den begangenen Verstoß gegen die Hofsitte zu verstehen. Ich hatte alle Mühe meine Lachmuskeln im Zaume zu halten und bemeisterte endlich die Versuchung, indem ich an den König das Wort richtete.
»Morena! Als ich ein Knabe von dreizehn Jahren war und zum ersten Male die Bücher Naka Livingstone's las und in denselben auch Deinen Namen fand, dachte ich wahrlich nicht, daß ich einst Dich selbst sehen, sprechen, ja noch Thee und Kuchen in Deinem Hause genießen würde.« Seschele, der es, trotzdem er die Regendoctorei prakticirt, sehr gut versteht, an passender Stelle Bibelsprüche anzuführen, war auch sofort mit einer ebenbürtigen Erwiderung zur Hand. »Die Wege der Vorsehung sind wunderbar,« waren seine unmittelbar darauf folgenden Worte; doch schon während Mr. Williams Uebersetzung meiner Worte hatte der König, dessen rechte Gesichtshälfte uns, die linke seinem Weibe die nöthige Aufmerksamkeit zuzuwenden schien, zu seinem Bedauern beobachtet, daß Ma-sebele wieder eingeschlummert war und diesmal sich gefährlich nach der Seite neigte. Mich mit listigem Blicke betrachtend, applicirte er seiner Frau einen so unzarten Fußstoß, daß Ma-sebele, die arme Königin, mit ihrer Stirne beinahe die vor ihr stehende Tasse umgeworfen hätte.
Nach Tisch machte ich mit den beiden Herren einen Spaziergang auf die Felsenhöhe, auf welcher Molopolole erbaut ist; diese Höhe heißt Mo-ra-a-Khomo, d.h. der Vater der Ochsen, so genannt nach einem einst hier ansässigen Bakwena-Viehzüchter und bildet mit der ihr gegenüber liegenden Höhe das Felsenthor Kobuque.
Die früher hier ansässigen Makalahari's und Bakwena's—es geschah dies noch als Seschele in dem nahen Liteyane wohnte—benützten die steil abfallenden Wände der Moraakhomo-Höhe an dem Felsenthore, um altersschwache Eltern oder nahe Verwandte, deren Ernährung und Verpflegung ihnen lästig fiel, über dieselben herabzustürzen. Die Unthat wurde vom nächsten in demselben Gehöfte wohnenden Verwandten vorgeschlagen und mit Hilfe seiner Nachbarn im Dunkel der Nacht vollbracht. Die Schwachen und Hilflosen, wohl wissend, was ihnen unausweichlich bevorstehe, wurden ohne Widerstand an den Felsenrand hingebracht oder hingetragen und Hyänen oder Schakale besorgten noch in derselben Nacht die Bestattung der Herabgestürzten oder machten den Leiden der durch den Sturz nur Schwerverletzten ein Ende.
Das unter dem Molopolole-Felsen, d.h. am nördlichen Felsenthore befindliche, von dem etwa 2½ englische Meilen auswärts in der Schlucht entspringenden Tschanjana-Flüßchen gefüllte, drei bis vier Fuß tiefe Felsenloch wird an trockenen Tagen von der dunklen Jugend Molopolole's als Badeort benützt. Daß jedoch Baden und Waschen keine den Betschuana eigentümliche Tugend ist, konnte ich an den Jungen, die sich vor mir badeten, und wobei natürlich Sebele, des Königs Sohn, den Anführer spielte, und die unsinnigsten Sprünge etc. ausführte, bemerken. Sie krochen wohl in's Wasser, beeilten sich jedoch, bald aus dem nassen Elemente herauszukommen und sich an den sengenden Sonnenstrahlen zu trocknen; an trüben Tagen mieden sie ängstlich das Wasser.
Die freie Zeit meines Aufenthaltes in Molopolole benützte ich zu Ausflügen in die nächste Umgebung, auf welchen meine Sammlungen um manches interessante Object vermehrt wurden. Theils erstand ich, theils erhielt ich als Geschenk: einige Carossen, einige sehr primitiv gearbeitete Assagaie, d.h. Wurfspieße, deren Schaft kurz und fingerdick, deren Eisen stumpf und äußerst schlecht gearbeitet, deren oberes Schaftende mit Sehnen umflochten, oder mit einigen Stückchen einer im nassen Zustande umgelegten und zusammengenähten Boahaut zusammengehalten war, ferner Schlachtbeile, welche in dem ¾ Meter langen, hölzernen Stiel lose befestigt, unseren Hackbrettmessern nicht unähnlich sind, ferner einige gut gearbeitete Holztöpfe und einige Beschwörungsmittel, eines aus Rüsselkäfern, zwei aus Samen und eines aus Vogelklauen, Haut- und Hornstücken gearbeitet. Herr Williams verehrte mir einen aus Boababrinde (Andansonia) gearbeiteten Reissack, den er von den von einem Raubzuge aus dem Maschonalande heimkehrenden Matabele erhalten hatte.
Meine zoologischen Sammlungen vermehrten sich um einen schönen Orix capensis-Kopf mit langen Hörnern, ein Leopardenfell und eines von Gueparda jubata, einige Hyraxfelle, ferner eines von Viverra Zivetia, welches jedoch selten zu sein scheint, und mehrere von Felis caligata. Herr Williams brachte mir den Cadaver eines dreijährigen Kamafuchses, das Thier hatte sich früher schon in einem Schlageisen gefangen, war jedoch nach Zurücklassung des einen Hinterfußes davongekommen, nun hatte es sich zum zweiten Male täuschen lassen und diesmal sein Leben verwirkt. Die Bakwenahöhen beherbergen auch den schönen Klippspringer; im Lande der Bakwena's, nördlich von Molopolole begegnen wir endlich zum ersten Male der Eland-(Elen-)Antilope und der Giraffe.
Unter den Vögeln fiel mir die Häufigkeit mittelgroßer Raubvögel auf, namentlich Sperber, Falken, Bussarde und Milane; von letzteren hatte Herr Williams mehrere erlegt, da sie die Küchlein seiner Frau Gemahlin decimirten. Sonst fielen mir durch ihre Häufigkeit Eulen, Uhu's, Schleiereulen und Zwergkäuze auf, welche in den Felshängen ihre Wohnsitze aufgeschlagen hatten. In den Felsenritzen und unter den vielen Felsblöcken herrscht ein reges Thierleben—Säugethiere, namentlich Raubthiere in großer Zahl, dann Reptilien, besonders Schlangen und Eidechsen finden hier die besten Schlupfwinkel; an die reiche und üppige Pflanzenwelt, die an den Abhängen vermodernden Baumstümpfe ist die Existenz zahlloser Insecten, darunter Lepidoptera, Fliegen etc. gebunden. Meine Ausbeute an Käfern, Spinnenarten und Scolopender war eine sehr reiche; für einen Naturforscher ist überhaupt der Aufenthalt in dem Bakwena-Höhennetze in jeder Beziehung ein äußerst lohnender.
Wir finden auch hier wie an den Bamangwato- und anderen auf dem Hochplateau des zentralen Süd-Afrika gruppenförmig ansteigenden, felsigen, mit dem Marico- oder Matabele-Gebirgscentrum zusammenhängenden Höhen, den steilen, zerklüfteten Abfall der Tafelberge oder tafelförmige, mit kegelförmigen, isolirten Höhenspitzen besäete Hochflächen. Dieses Gesammthöhennetz geht allmälig nach Norden in eine bewaldete und meist tiefsandige Hochebene über, um sich dann wieder ebenso allmälig in einer Ausdehnung von 30 bis über 100 englische Meilen zu einem seicht eingeschnittenen Flußbette zu verflachen, auf dessen gegenüber liegendem Ufer ein ähnlich beschaffenes Höhennetz, wie das eben beschriebene sich fortsetzt. Granit, Quarzitschiefer, Trapdykes, Kalkadern und eisenhaltiger, sandiger Thon bilden die Hauptformation der Höhen, deren Vegetation durch mehrere riesige Aloëspecies charakterisirt wird, welche förmliche Gehölze bilden.
Bevor wir von Molopolole scheiden, sei es mir erlaubt, hier einige der wichtigen religiösen und lokalen Gebräuche unter den Betschuana's zu erwähnen. Ich verdanke die folgenden Mitteilungen der Güte der englischen Missionäre Herren S. Mackenzie, Hephrun, Price, Williams, Brown und Webb und des deutschen Missionärs T. Jensen, ferner einigen der hervorragendsten Trader und einigen gebildeteren holländisch und englisch redenden Betschuana's und fand dieselben aus eigener Anschauung während meiner drei in's Innere unternommenen Reisen betätigt.
Religion im eigentlichen Sinne des Wortes besitzen die Betschuana's, d.h. die das centrale Süd-Afrika bewohnenden Stämme dieser Völkerfamilie nicht, doch kennen wir aus dem Umstande, daß sie bei den ersten Belehrungen über das Christenthum dem unsichtbaren Gott sofort den Namen Morimo beilegten, ohne daß das Wort eine anderweitige Verwendung fände, schließen, daß sie in längstvergangener Zeit einem sichtbaren oder unsichtbaren Wesen göttliche Verehrung gezollt haben mußten. So hat sich denn das Wort Morimo bei ihnen traditionell erhalten. Das nächstverwandte Wort zu Morimo ist Barimo, welchen Ausdruck die Betschuana's noch immer häufig gebrauchen und der »die Geister der Abgestorbenen« bezeichnet. Trotzdem sie also keine eigentliche Religion besitzen, hängt doch die Masse an vielen Gebräuchen, welche bei anderen Völkern, die Vielgötterei treiben, als religiöse Gebräuche angesehen werden, z.B. eine gewisse Verehrung, die sie, wie schon erwähnt, gewissen Thieren zollen, dieselbe ist jedoch nur darauf beschränkt, daß sie das Thier nicht tödten, sein Fleisch nicht genießen und sein Fell nicht gebrauchen. So finden wir auch, daß diese Gebräuche von bestimmten, dazu herangebildeten Personen gelehrt und ausgeübt werden, welche den König, oder ist der König ein Christ geworden, einen ihm an Würde zunächststehenden Heiden als ihr Oberhaupt anerkennen und auf diese Weise die Kaste der Priester und des Oberpriesters repräsentiren, welche unter den Betschuana's Naka (Njaka, Njaga) heißen. Als die Betschuana's ein wohl in mehrere Unter-Familien getheiltes, doch noch unter einem Scepter vereinigtes Volk und Reich darstellten, war das Königthum in der Familie Baharutse erblich. Selbst als sich später die Betschuana's theilten, der eine Stamm (eine Abzweigung, Unter-Familie) etc. nach Norden, die anderen nach Süden, Osten, Südost und Südwest zogen und selbstständige kleinere und größere Königreiche errichteten, die alte königliche Familie von den meisten ihrer Unterthanen verlassen auf die Unter-Familie, aus der sie entsprang, beschränkt, und machtlos geworden war, blieb ihr doch das Vorrecht jene abergläubischen, dem Hohenpriesteramte unter den Betschuana's zukommenden Gebräuche zu verrichten, und Mitglieder königlicher Familien, sowie Naka's aus den neuerstandenen Betschuana-Reichen wanderten an den Hof der Baharutse (Bahurutse) um von dem jeweiligen Oberhaupte diese Gebräuche verrichten zu sehen. Seitdem jedoch einzelne der losgetrennten Stammzweige der Betschuana's eigene, ziemlich mächtige Reiche errichteten und einige der Chefs oder Könige Christen geworden sind, hat dies beinahe völlig aufgehört, trotzdem aber wird von allen Betschuana's mit höchster Verehrung von der alten königlichen Familie gesprochen, welche seitdem durch des Geschickes Walten ihre Macht durch eine abermalige Theilung ihrer Mitglieder und der daraus folgenden Zersplitterung ihres Stammes völlig eingebüßt hat und gegenwärtig als Unterthanen der Transvaal-Colonie in und im Weichbilde der Stadt Linokana (früher zur Lebzeit des Häuptlings Moilo nebenbei Moilio oder Moiloa genannt) und als Unterthanen des Königs der Banquaketsen, Chatsitsive, die Stadt Moschaneng bewohnt. Der gegenwärtige Häuptling der ersteren (der östlichen Baharutse) und somit das eigentliche Oberhaupt der Betschuana's ist Kopani, ein noch junger Mann.

[Regenbeschwörer.]
Zu jenen Gebräuchen, die in den einzelnen Betschuana-Reichen von dem Oberhaupte des Landes oder wo verschiedene Stämme ein Reich bewohnen von den diesen vorgehenden Häuptlingen angeordnet werden, gehört vor Allem der ceremonielle Genuß der ersten geweihten Feldfrüchte (meist Kürbisse), ferner die Ausübung der Heilkunde, das Regenmachen und das Bezaubern. Dem Stammes-Oberhaupte als obersten Doctor, Zauberer etc. stehen bei der Ausübung der Zeremonien mit Ausnahme der ersten obgenannten, die er nur allein verrichten kann, die Linjaka's (Priester), die man jedoch auch Naka (Njaka) nennt, zur Seite (wir wollen sie aber der Unterscheidung und ihrer untergeordneten Stellung halber Linjaka's nennen), welche die übrigen Zeremonien der Zauberei und der Regenmacherei verrichten und damit auch einige primitive Kenntnisse der Heilkräuter verbinden.
Als Heilkünstler erkennt man sie in der Oeffentlichkeit an einem aus Pavianfell (Cynocephalus Babuin) verfertigten Mäntelchen, und in ihren Wohnungen an den aus dem Felle der Hynena crocaia (maenlaia) gearbeiteten Fußdecken (Teppichen), auf denen sie Audienzen ertheilen. Manche tragen auch um den Hals an Schnüren oder Riemchen verschiedene Säugethier-, Vögel- und Reptilienknochen, doch immer auch vier meist aus Elfenbein, zuweilen aus Horn geschnitzte, mit eingebrannten Zeichnungen versehene Stäbchen und Pflöckchen, welche Würfel darstellen und zur Diagnose benutzt werden. Diese letzteren werden auch von Menschen getragen, welche gegen Bezahlung des Lehrgeldes blos in dem Werfen dieser Dolo's unterrichtet werden, ohne daß sie wirkliche Linjaka's wären.
Ihr Amt ist unter den Betschuana's erblich, doch werden auch wißbegierige junge Männer zu Doctoren gebildet. Der Aspirant hat als Honorar seinem Lehrer eine Kuh (gegenwärtig zumeist andere Objecte im gleichen Werthe), oder falls derselbe in den Diamantenfeldern Mali (Geld) verdient hat, 4-7 £ St. zu geben und wird darauf sofort in die »Lehre« genommen. Der medicinische Lehrcurs beginnt mit dem Ausgraben (das »Graben« bildet einen wichtigen Begriff und eine wichtige Manipulation bei vielen Zeremonien der Betschuana's) der Heilkräuter, wobei er von seinem Lehrmeister durch Wald und Flur geleitet, über die Species der Pflanzen, die zur Benützung gelangenden Theile, sowie über die Jahres- und Tageszeit, zu welcher die Pflanze ausgegraben werden muß, belehrt wird. Die gesammelten Pflanzentheile werden sodann getrocknet, geröstet oder zerstampft und dann ein Pulver oder Absud derselben als »Heilmittel« erklärt, wobei jedoch gewisse Sprüche und Formalitäten bei der Zubereitung wie bei der Verabreichung zu beobachten sind, welche von den Aerzten bei der Behandlung wohlhabender Leute unter großem Lärm inscenirt werden.
Ein oft verordnetes Heilmittel sind schweißtreibende Vegetabilien und dies, wie das Schröpfen um locale, so jenes um innere, im ganzen Körper oder über größere Partien desselben verbreitete Schmerzen (Typhus, Dysenterie etc.) zu beseitigen, dabei wird der Kranke verhalten, sich in seine beste Carosse oder in eine gekaufte Wolldecke zu hüllen, und nachdem das Mittel seine Schuldigkeit gethan, erscheint der Doctor, um die Carosse oder die Decke mit dem Schweiße, dem transpirirten Krankheitstoffe »einzugraben«, d.h. sie in Besitz zu nehmen, während der Kranke froh ist, den Grund seines Uebels aus dem Hause entfernt zu wissen. Der Patient würde es nie wagen, dieselbe zurückzufordern, sollte er auch nach seiner Genesung die Frau Doctorin mit seinem Schakalmantel in den Straßen des Dorfes herumstolziren sehen.
Den letzten Lehrcurs bildet die Belehrung über das Werfen der Dolo's. Neben dem Dienste der Medicinmänner haben die Linjaka's auch einen zweiten Dienst, den der Beschwörer oder guten Zauberer zu versehen. Hierher gehören: das Herbeischaffen, der Gebrauch und der Verkauf von Mitteln, welche an einer Schnur an der Stirne und am Halse getragen, z.B. den Träger einer Löwenklaue muthig und flink, seine Verfolger träge und ihn selbst kugelfest machen sollen. Solche Mittel sind ferner: aus kleinen Tarsus- und Carpusknochen gewisser kleiner Säugethiermännchen, verschiedener Vierfüßler, Schuppen des Schuppenthieres, Metatarsus-Knochen gewisser Vögel und den Klauen bestimmter Raubvögel, aus Schlangen- und Leguanhaut, kleinen Schildkröten, den Leibern großer Rüsselkäfer verfertigte Amulete; mit verschiedenen eingebrannten Zeichen versehene Holzpflöckchen, eingeschnittene Ziegenbockhörner und kleine Hörnchen der zarteren Gazellenarten etc. welche allein oder mit verschiedenen buntbemalten Glasperlen an eine Gras- oder Giraffenschwanzhaar-Schnur angefädelt als Schutz vor Krankheiten, Uebeln und Unfällen am Arme oder um den Hals getragen werden. In den Amtsberuf der Linjaka's gehört endlich der Gebrauch der Dolo's um die Zukunft oder z.B. den Ort zu erfahren, an welchem ein gestohlenes Gut oder ein Flüchtling zu finden ist etc. etc.; die Beschwörungsweisen, um böse und unreine Menschen und Thiere zu schrecken, und sich von den ersteren zu befreien: z.B. durch das Aufhängen verschiedener Artikel unmittelbar an oder in der Nähe der Umzäunung des Gegners, durch das Errichten von Feuer in seiner Nähe, welche umgangen, umtragen und über welche gewisse Formeln gemurmelt werden.
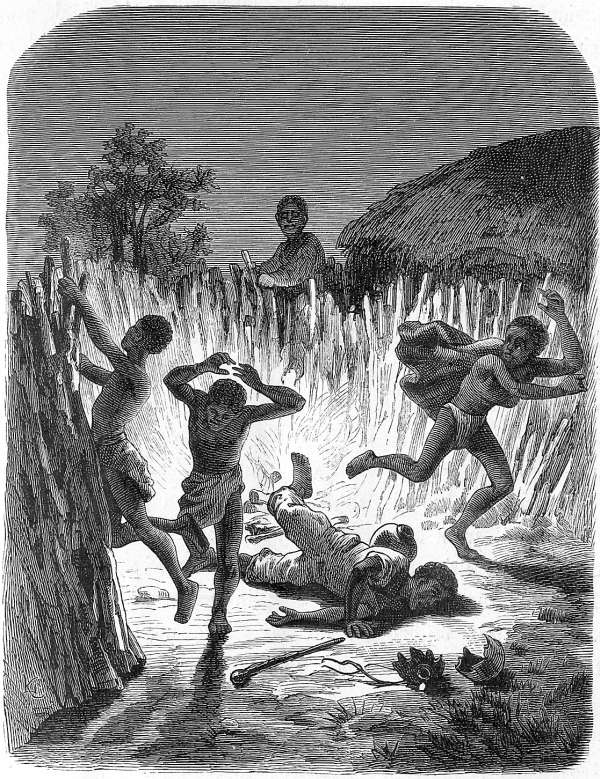
[Die Beschwörung Khama's.]
Zur Arbeit der guten Zauberer gehört auch die Ausübung der zum öffentlichen Wohle gereichenden Beschwörungsgebräuche, wie das Vergraben von zwei Antilopenhörnern an den zu einer Stadt führenden Pfaden, das Aufhängen von Töpfen auf Pfählen zwischen den Gehöften, in manchen Hofräumen oder an den die Stadt beherrschenden Punkten, das Aufhängen von Pavianköpfen nahe am Eingange zur Kotla und der Köpfe größerer Raubthiere in der Nähe jenes Viehkraals, dessen Insassen von dem betreffenden Raubthiere getödtet worden waren etc.
All' dieses geschieht, um damit Segen und Gedeihen über eine Stadt zu verbreiten, um sie gegen Feuersbrunst und feindliche Angriffe zu schützen, im letzteren Falle um die Heerde vor einem weiteren Unfall zu bewahren. Auch die Felder werden in ähnlicher Weise mit Beschwörungsmitteln umgeben, um eine gute Ernte zu sichern und Heuschrecken abzuhalten. Aus diesem Grunde werden auch diese öffentlichen Amulete, lipeku genannt, auf die feierlichste und geheimnißvollste Weise bereitet (bei den Marutse am centralen Zambesi wurden Menschenopfer zu diesem Zwecke dargebracht) und nur die ältesten Linjaka's zu der Zubereitungs-Ceremonie zugelassen. Nur einige solcher Ceremonien sind auch Fremden zugänglich, z.B. der Khomo kho lipeku, d.h. der dem lipeku geweihte Ochs; zu dieser Ceremonie wird ein bishin weder als Zug- noch als Packthier benütztes Thier ausgesucht, diesem die Augenlider mit seinen Thiersehnen zugenäht und dasselbe wieder in die Heerde eingetrieben, dabei sorgfältig bewacht und nach einiger Zeit geschlachtet; hierauf wird sein Blut mit anderen Mitteln zusammengekocht und der Brei in kleinen Kürbisgefäßen aufbewahrt. Im Kriege beschmieren sich der König und die Heerführer mit diesem Brei oder behängen sich mit kleinen, damit gefüllten Gefäßen.
Linjaka's, welche aus Rache oder Böswilligkeit, Jemandem schaden wollen, aber auch solche, deren Zauberschwindel eine der beabsichtigten entgegengesetzte Wirkung hervorbringt, erhalten den Beinamen Moloi, d.h. böser Zauberer und werden gefürchtet und gehaßt, so daß schon der Name Moloi den Ausdruck der höchsten Verachtung bezeichnet und man dem Betschuana keinen ärgeren Schimpf anthun kann, als ihm diesen beilegen. Der Moloi erscheint den Betschuana's auch mächtiger als der Linjaka, da ihm ohne die Ausübung seiner Zaubermittel selbst die stumme Natur gehorcht, er bewegt sich, klettert über Zäune und Felsen und geht über Flüsse, ohne gehört zu werden, Feuer schadet ihm nicht, Hunde, Schakale etc. hören auf zu heulen und verhalten sich stille, wenn er an ihnen vorbeigeht oder an sie herantritt. Mütter gebrauchen den Namen Moloi, um ihre schlimmen und schreienden Kinder zur Ruhe zu verweisen.
Die bösen Zauberer trachten auch die Ernte zu schädigen; werden jedoch die Linjaka's von ihren Häuptlingen ausgesandt, dies einem Nachbarstaate anzuthun, so trägt nur der Auftraggeber das Odium der That, sie, die blos seinen Befehl ausgeführt, bleiben wie zuvor Linjaka's. Die Betschuana's behaupten, daß die Moloi's Leichen ausgraben, um ihnen gewisse Körpertheile zu entnehmen, auch daß sie Neugeborne tödten und aus gewissen Korpertheilen derselben Zaubermittel bereiten, doch die wichtigsten ihrer Mittel (d.h. die ihrer Meinung nach schädlichsten) behaupten die Moloi von Thieren zu gewinnen, die allgemein gefürchtet sind und nur schwer in die Gewalt des Menschen gelangen, so z.B. von der Boa, vom Krokodil und anderen. Haßt ein Mann seinen Nebenmenschen, ist er auf ihn eifersüchtig, so begibt er sich in der Dämmerung zu einem Moloi, um diesen gegen entsprechendes Honorar für seinen Plan zu gewinnen. Ereignet es sich nun zufällig, daß der auf der Jagd Abwesende oder Verreiste der bösen Macht des Zauberers erliegt und natürlichen Todes stirbt oder von einem Thiere getödtet wird, dann heißt es, der Mann sei im ersten Falle durch das Molemo (Gift), oder im letzteren Falle durch das vom Moloi gewonnene Thier (Büffel, Löwe etc.) getödtet worden.
Das vorstehende Bild stellt eine Scene dar, die sich im Jahre 1866 in Schoschong zutrug. König Sekhomo hatte Moloi's gedungen, welche durch verschiedene in der Nacht vor dem Häuschen Khama's, seines beim Volke beliebten Sohnes, auszuführende Zaubereien diesen tödten sollten. Khama erwachte durch den Glanz des vor seiner Einfriedigung hell auflodernden Feuers, schlich sich an den Zaun und sah ruhig zu. Als sich zufällig einer der »Alten« nach seiner Wohnung umsah und ihn erblickte, stieß er einen Schrei aus; bei dem nun folgenden Tumulte suchten die Zauberer das Weite. Khama trat vor, zerschlug die Beschwörungsgefäße, warf den Beschwörungströdel in's Feuer, löschte dieses aus und erschien zum größten Erstaunen Sekhomo's und der von ihm gedungenen Moloi's am nächsten Morgen, frischer und froher wie je in der Kotla.
In Uebereinstimmung mit ihrem Charakter gelten die Moloi auch als Feinde des Regens. Die Moloi glauben durch die frischen Zweige eines grünen Busches, welche unter einer Verwünschungsformel in die Flammen geworfen werden—den Regen bannen zu können, ferner suchen sie denselben Zweck durch die Verwüstung der von den Regendoctoren ausgesetzten Zaubermittel zu erzielen, auch glauben sie, daß das wiederholte Abfeuern von Gewehren die sich nähernden Wolken verscheuche.
Der wichtigste Dienst, der von den Linjaka's und ihrem Oberhaupte gefordert wird, ist die Regenbeschwörung. Da jedoch der Mißerfolg bei dieser öffentlichen Beschwörung nur zu leicht ersichtlich wäre, überträgt man zur Zeit langer Dürre-Perioden die Beschwörung des Regens an Linjaka's aus regenreichen Gegenden. Es sind meist die am rechten Ufer des mittleren Limpopo wohnenden Ma-lokwana, welche gegen ein Geschenk an Vieh zu dieser Arbeit gewonnen werden.
In feuchten, niederschlagsreichen Jahren wird die Arbeit den heimischen Linjaka's überlassen; allein oder von Freiwilligen begleitet, begeben sich dieselben auf ein speciell dazu bestimmtes, fruchtbares Grundstück, um »isimo ea pula« d.h. das Feld des Regens zu graben. Dies ist eine allgemeine Ceremonie und geschieht zeitlich im Frühjahr. Dann folgt das Umgraben der Fluren durch die Frauen, nachdem noch zuvor die Männer von den Linjaka's durch Beschwörung gesegnete Samen (Kafirkorn, Mais, Kürbis, Wassermelone etc.) gekauft und diese in die vier Ecken des Feldchens eingepflanzt haben. An diesem Tage wird alle Arbeit eingestellt und erst am folgenden von den Frauen fortgesetzt.
Von diesem Tage ab ist es ferner den Betschuana's verboten, die jungen Zweige der Bäume abzubrechen, vor Allem aber nicht jene des schon oft erwähnten Wart-en-bichi(bitje)-Baumes, der unter den Betschuana's allgemein verehrt wird. Erst zur Kafirkornreife und von den Njaka angeführt, versammeln sich die mit Aexten und Messern versehenen Männer in der Kotla, um einige Aeste von der geheiligten Accacie abzuhauen; mit den ersten wird der an die Kotla angrenzende königliche Viehkraal ausgebessert und nachdem dies geschehen, dasselbe an den übrigen Kraalzäunen gethan. Vor der Ernte einen abgeschnittenen Ast der Accacia detinens um Mittagszeit in einem Betschuanadorfe herumzutragen, käme einer schweren Beleidigung des Stammes gleich.

[Pit, der Griqua, entdeckt Leopardenspuren.]
Zur Erntezeit müssen alle Baum- und Buschfrüchte, Straußenfedern und Elfenbein bedeckt aus dem Walde zur Stadt gebracht werden. Hat es in der Nacht geregnet und der Regen bis zum Morgen angedauert, so bebaut Niemand an diesem Tage die Felder, um den Regen nicht aufzuhalten und zu stören. Hat sich die nasse Jahreszeit eingestellt, oder, wie der Betschuana sagt, der Linjaka mit seinen Medicinen den Regen herbeigerufen, so trachten nun die letzteren auch den Regen auf längere Zeit zu »fesseln«. Aus diesem Grunde besuchen sie allein oder von ihren Schülern oder von den Besitzern der Felder begleitet einsame Orte, meist Höhen, pfeifen, schreien, murmeln Formeln und entzünden hie und da an den vorspringenden Stellen der Höhen Feuer, wobei sie zuweilen gewisse Ingredienzen in's Feuer werfen.
Versagen alle angewendetem Zaubermittel und fällt kein Regen, dann wird in der Regel die Schuld auf die Masse geschoben und dieselbe irgend eines Verstoßes gegen die herkömmlichen Gesetze beschuldigt; meist sind es Witwen und Witwer, welchen der Vorwurf trifft, die vorgeschriebenen Reinigungen unterlassen zu haben. Die Untersuchung beginnt und findet sich nun ein Schuldiger oder eine Schuldige, so wird der- oder dieselbe verurtheilt, sich öffentlich der Reinigung zu unterziehen. Die Linjaka's bauen ihnen dann gegen Bezahlung außer der Stadt Grashütten, in welcher sie einige Zeit bleiben müssen, um sich ihre Wolle vom Kopfe abschaben und sich von den Linjaka's reinigen zu lassen; dann erst können sie zu den Ihrigen heimkehren.
Hilft auch dies nichts, dann wird eine allgemeine Reinigung des Feuers und der Herdsteine vorgenommen. Die Linjaka's beseitigen in jedem Höfchen die drei Herdsteine, auf denen der Topf an's Feuer gestellt war und tragen sie auf einen bestimmten Punkt vor die Stadt, wo sie aufgehäuft und neue geweiht werden. Während der Dauer dieser Zeremonie müssen alle Herdfeuer im Orte ausgelöscht werden. Abends oder am folgenden Morgen erscheint der Unterpriester mit Reisig und einem geweihten brennenden Stock, um, nachdem die Feuerstelle gut abgescheuert worden ist, die Feuer in der ganzen Stadt anzuzünden.
Sollte dies Alles noch keinen Regen zur Folge haben, ordnet man eine allgemeine Reinigung der Stadt an, herumliegende Fellstücke, Knochen, im Felde, vielleicht nahe an der Stadt zu Tage liegende Menschenreste werden begraben. Liegt der Ort in der Nähe der Begräbnißstelle eines Häuptlings, die sonst sehr geheim gehalten wird, so schlachtet man ein Stück Hausvieh, um damit den vielleicht erzürnten Todten zu besänftigen. Es werden auch ganze Jagden auf gewisse Thiere abgehalten, von welchen die Linjaka's gewisse Organe als Regen beschwörende Mittel gebrauchen; diese Jagd heißt »Letschulo« und wird unter den Auspicien der Regenmacher abgehalten.
Obgleich das Christenthum das Loos der Frauen unter den Bekehrten etwas gemildert hat, konnte es ihnen doch viele der schwersten Arbeiten nicht abnehmen, und erst der eingeführte Pflug, dessen Gebrauch sich gegenwärtig immer mehr einbürgert, hat das Loos des Betschuanaweibes erleichtert, dadurch, daß der Mann ihn mit Hilfe der Ochsen verwendet, welche die Frau nie berühren darf. Einen ähnlichen guten Einfluß wird die Einbürgerung des Pflugs auf das allmälige Verschwinden der eben betriebenen abergläubischen und sinnlosen Regenbeschwörungs-Gebräuche nehmen.
Ich schließe hiemit diese vorläufige ethnographische Skizze und kehre zur Schilderung meiner Reiseerlebnisse zurück.
Der freundlichen Einladung Rev. Williams, die Weihnachts-Feiertage noch in Molopolole zuzubringen, konnte ich leider nicht willfahren.
Durch das Kobuque-Felsenthor verließen wir den Thalkessel von Molopolole und zogen im Thale eines Tschanjanazuflusses nach Norden. Die üppigste Vegetation sproßte um uns her, das Ufer des Flüßchens und die unbebauten Thalstellen, die Abhänge an den Felsenhöhen waren mit den mannigfachsten Blumen und Gräsern bekleidet, stellenweise bebuscht und mit Bäumen bestanden, so daß die hier röthlichen, dort gelblichen, dann wieder auch grauen bis schwarzbraunen senkrechten Felsenmauern, stufenförmige, natürliche Felsenterrassen, die viereckigen und die abgerundeten, sowie die herabgekollerten Felsblöcke wie von einem buntgeblümten hier hellen, dort dunkelgrünen Teppich umrahmt schienen.
Der Himmel hatte leider kein Erbarmen mit uns, in strömendem Regen mußten wir uns durch den tiefen Sand des Weges hindurcharbeiten. Das Mißgeschick dieses Tages war aber damit nicht erschöpft. Als ich nach des Tages Mühen ruhen wollte, fehlten die beiden schwarzen Diener Stephan und Dietrich, die ich von Musemanjana mitgenommen, und mit ihnen waren zwei meiner kräftigsten Zugthiere spurlos verschwunden. Es war mir schon am verflogenen Abend aufgefallen, daß die beiden Flüchtlinge mich wiederholt vor umherstreifenden Löwen warnten, sie hatten offenbar mich damit von der Verfolgung abhalten wollen. Obwohl bereits 15 englische Meilen von Molopolole entfernt, beschloß ich, dahin zurückzukehren, um Seschele zu bitten, die Diebe durch Reiter auf Chatsitsive's Gebiet verfolgen zu lassen. Von Boly und Pit begleitet, machte ich mich am nächsten Tage, nachdem der Regen etwas nachgelassen, zu Fuß auf den Weg.
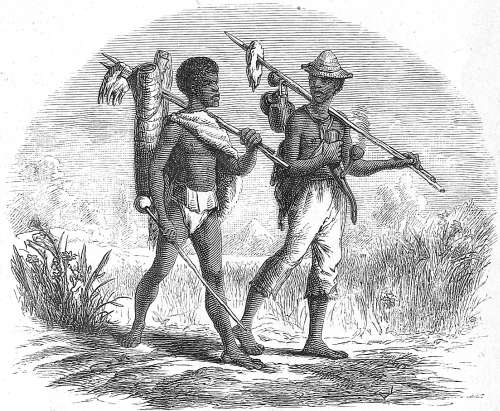
[Eingeborne Postboten.]
Doch schon nach fünfstündigem Marsche war ich außer Stande den Weg fortzusetzen, die schwere Fußbekleidung hatte meine Fuße gänzlich dienstunfähig gemacht; ich blieb am Rande des zum Molopololekessel führenden Kobuque liegen und sandte Boly und Pit zu Rev. Price und Seschele. Stunde um Stunde verrann, es war ein böses Omen für den Erfolg ihrer Mission—endlich spät Nachmittags hatten sie mich wieder erreicht, wie ich es geahnt, war ihr Gang vergebens.
Die Rückkehr zum Wagen war für mich eine wahre Martertour. Der Regen hatte zahllose Samen einer Ranunculus-Species (R. crepens) von der Höhe in das Thal herabgeschwemmt, die ob ihrer stachlichen Eigenart von den Boers »Develkies« genannt werden. Unfähig in meiner Beschuhung den Rückweg anzutreten, mußte ich es barfuß thun,—das weitere bedarf keiner näheren Schilderung. Mitternacht war nicht fern, als wir das lodernde Feuer des Lagers meiner Gefährten mit einem Freudenschrei begrüßten—die Stunde der Erlösung war gekommen.
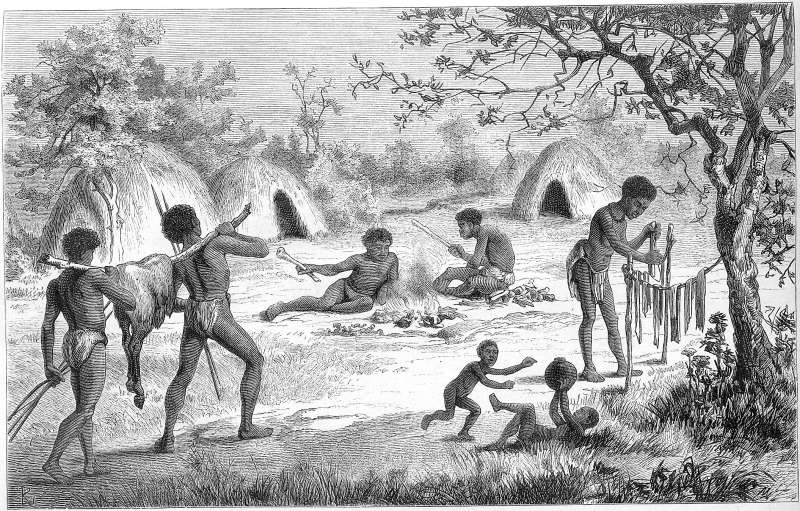
[Scene aus dem Leben der Masarwa's.]
Wir beeilten uns am 27. zeitlich Morgens die Stätte trüber Erinnerungen zu verlassen und setzten die Reise durch den tiefsandigen Wald nach Norden fort. Die schlechte Beschaffenheit des Weges nöthigte uns zu öfterem Rasten; während einer solchen kam Pit, welcher die Zugthiere abseits des Wagens zwischen den Grasbüschen weiden ließ, athemlos auf mich zugelaufen und schrie von Weitem. »Teiger, Teiger, Bass!« Bei näherer Untersuchung fanden wir zwar keinen Teiger (Leopard), jedoch zahlreiche Spuren desselben auf den salzhaltigen Stellen des Bodens. Ich hielt es daher für rathsam, den Marsch wieder weiter aufzunehmen.
Die Reise am 28. führte uns theils durch einige seichte Vertiefungen, welche deutlich den Abfall des Bodens nach Osten zu zeigten und in einige in der Regenzeit dem Limpopo zufließende Bachbetten ausliefen, theils durch sandigen Wald, in dem ich mir, nach dem Weglaufen der Diener als unfreiwilliger Wagenlenker meine Sporen zu verdienen hatte. Von Wildspuren fanden wir jene des gestreiften Gnu, der Elandantilope, des kurzschwänzigen Schuppenthieres und auch solche von Hyänen zahlreich vor.
Auch am 29. war die Fahrt recht beschwerlich, nicht allein daß der Sand nicht abnahm, es hob sich das Land merklich gegen Norden. Die Entfernung von Molopolole nach Schoschong beträgt in der kürzesten Strecke 128 englische Meilen, doch kann man diese, häufigen Wassermangels halber, nicht zu allen Jahreszeiten passiren und muß deshalb zeitraubendere Touren wählen. Zu Fuße kann die Strecke mit Benützung der Fußpfade in fünf Tagen zurückgelegt werden, eine Leistung, die auch von den Post-Betschuana's zu Stande gebracht wird. Der im westlichen Theile des Marico-Districtes wohnende Missionär, Herr T. Jensen, versieht den Dienst des Postmeisters für das Innere, d.h. für die in den Eingebornenstädten wohnenden Missionäre und Händler, bei denen auch die Briefe, die den Jägern von den Ihrigen nachgesendet werden, aufbewahrt werden. Wöchentlich kommt ein Eingeborner mit den Briefen von Molopolole und bringt die in Linokana angekommenen nach der Balwenastadt; alle vierzehn Tage werden wieder zwei Bamangwato von Schoschong von dem dortigen Prediger nach Molopolole gesandt, um die Post, die der Molopololer von Linokana gebracht, nach Schoschong zu befördern. Ein Feuerbrand, einige Assagaien, auf welche sie rohes Fleisch spießen und der lederne Gurt mit den Briefen ist die ganze Ausrüstung der Postboten. Früher wurde je ein Mann für diesen Postdienst von Schoschong nach Molopolole auf sechs Monate gemiethet, er erhielt Kost und wurde mit einer Muskete und etwas Schußmaterial, gegenwärtig aber mit barem Gelde für seine Mühe entlohnt.

[Flüchtender Leguan.]
Zahlreiche Löwen- und Leopardenspuren am Rande der vielen vegetationslosen Bodeneinsenkungen mahnten uns am folgenden Tage zur größten Vorsicht, auch bot der tiefe Sand, in dem die Räder bis acht Zoll tief einsanken, große Schwierigkeiten. Einst mochten diese eben durchzogenen Gegenden sehr wildreich gewesen sein, dafür sprachen die aufgehäuften Skelette von Antilopen, besonders des Elands und der Giraffe. An keinem der vielen, hier und auf der weiteren Reise nach Schoschong angetroffenen Giraffenschädeln beobachtete ich die kleinen knöchernen Stirnauswüchse gleich hoch, an manchen einen, an manchen beide mit Exostosen bedeckt, oder durch solche an der Stirnbasis brückenförmig mit einander verbunden.
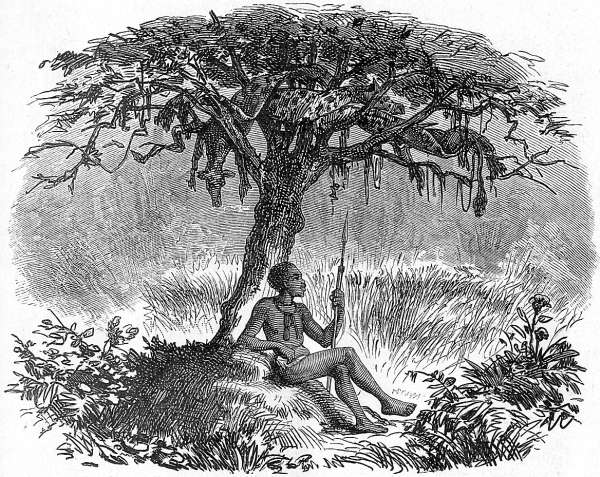
[Trocknen von Giraffenhäuten.]
Gegen Abend fiel mir Niger's Betragen auf, der im Grase zu unserer Linken hin- und herlief. Ich rief Onkel herbei—wir hatten nach und nach die übrigen Hunde (sieben) eingebüßt—beschleunigte meine Schritte und kam eben noch zur rechten Zeit, um einen riesigen Landleguan gemächlich auf einen Baum klettern zu sehen. Auf dem ersten horizontallaufenden, dicken Aste legte er sich flach nieder und dehnte sich derart, daß man ihn leicht übersehen hätte, wenn nicht die gelblichen Querstreifen von der grauen Rinde des Baumes grell abgestochen hätten. Das Thier, welches durch sein plötzliches Erscheinen die befiederten Bewohner des Baumes nicht wenig erschreckt hatte, blieb vollkommen ruhig auf dem Aste liegen, man sah nur die Bewegungen der Augenlider und das momentane Aufblitzen der kleinen schwarzen, glänzenden Augen. Ein Schrotschuß tötete das Thier, das meinen Sammlungen einverleibt wurde.
Am 31. waren wir wieder in tiefsandigen Wald gelangt, die Gegend zeigte wellenförmige, geringe Bodenerhebungen, welche stellenweise bebuscht oder mit Bäumen schütter bestanden, stellenweise jedoch dicht bewachsen waren, während die seichten Vertiefungen eine äußerst üppige, wenn auch nicht tropische Vegetation bargen. Der Regen hatte in den letzten Tagen abgenommen und die südafrikanische Decembersonne ließ uns warm ihre Strahlen fühlen. Auf dem tiefsandigen engen Wege einherziehend, machte mich B. auf einen dunklen, auf einem hohen Kameeldornbaum hängenden Gegenstand aufmerksam. Wir fanden nähergekommen mehrere große Stücke trockener Giraffenhaut, die von den Jägern vor langer Zeit aufgehangen und vergessen worden sein mochten. In der Untersuchung derselben wurden wir durch einen herbeieilenden Makalahari unterbrochen, welcher durch seine Mittheilung, daß die Haut dem Morena Seschele gehöre, alle Annexionsgedanken im Keime erstickte. Er und seine im Walde wohnenden Gefährten waren hier stationirt, um die zeitweilig anzutreffenden Giraffen zu jagen. Das Fleisch gehörte ihnen, doch die Haut dem Könige. Die weitere Mittheilung des von mir beschenkten schwarzen Jägers, daß wir erst zu Mittag des folgenden Tages auf Wasser stoßen würden, trieb uns zur Eile an. Erst die einbrechende Nacht machte unserem Tagemarsche ein Ende.
Am Lagerplatz angelangt, berieth ich eben mit meinen Gefährten, wie der Wassernoth zu begegnen sei, als die Hunde zu knurren anfingen. Aus dem Benehmen derselben, die, ohne die Nähe des Feuers zu verlassen, auf eine Stelle in's Dunkle hinblickten und dann sich nach der entgegengesetzten Seite kehrten, wobei es uns auffiel, daß sie einen sich um unser Gefährt in den Gebüschen bewegenden Gegenstand witterten, schloß Pit, daß diesmal Masarwa oder Makalahari (die Sclaven der Bakwena's) die Ruhestörer waren.
Ein leises »Rumela, Sir!« das uns aus den Gebüschen entgegentönte, löste jeden Zweifel; nachdem Pit die Hunde zur Ruhe verwiesen hatte, traten zwei Schwarze an's Feuer, es waren die Postboten aus Schoschong auf dem Wege nach Molopolole. Der eine trug ein großes Stück Fleisch, das er in einem, eine halbe Tagreise entfernt liegendem Barwadorfe für eine Handvoll Zündhütchen erhandelt; als sie sahen, daß wir mit dem Wasser recht sparsam umgehen mußten, boten sie uns ihre beiden mit Wasser gefüllten und mit frischen Grasbüscheln zugepfropften Kalebassen an, leider konnten wir des starken Geruches der unrein gehaltenen Kürbisgefäße halber von ihrem freundlichen Anerbieten keinen Gebrauch machen.
Der Neujahrsmorgen 1874 brach recht trübe an, Tags zuvor war es glühend heiß gewesen, heute war der Himmel mit Wolken bedeckt und die Atmosphäre bedeutend abgekühlt. Gegen Mittag heiterte sich der Himmel auf und als wir unsere Ost bei Nord-Richtung in eine nördliche änderten, sahen wir in eine Vertiefung vor uns, die sich nach Osten zu ziehen und der Anfang eines Thales zu sein schien, sowie eine kleine Rauchsäule an der bebuschten Erhebung ober dieser Vertiefung. Ein Säule Gold hätte uns alle nicht so elektrisiren können, wie es der bläuliche, in kleinen Wölkchen sich emporhebende Dunst und Rauch vermochte. Nach und nach erkannten wir auch einige elende Grashütten, dann spielende Kinder in ihrer Nähe und unten in der Tiefe zwei Barwa, die auf uns zu warten schienen. Ich sandte Pit voraus, um nach Wasser zu fragen; als wir zur Gruppe gestoßen waren, theilte uns der Diener mit, daß außer einigen tiefen, engen Löchern, aus denen nur die Bewohner des kleinen Dörfchens Wasser holten und aus denen höchstens Ziegen trinken konnten, kein trinkbares Wasser in der Nähe sei, wohl aber gegen Sonnenuntergang, wohin sie uns mit der Erlaubniß ihres Herrn, eines Bakwena's, führen wollten.
Unser Führer gehörte ebenfalls dem Bakwenastamme an. Ich glaube schon erwähnt zu haben, daß die Betschuana's sowie die Koranna's von Mamusa Diener, oder besser gesagt Sclaven besitzen, die dem Makalaharistamme (auch Bakalahari) angehören, welcher früher die Gebiete zwischen dem Zambesi und dem Oranjeflusse sein eigen nannte. Außer diesen Sclaven, die jedoch ziemlich mild behandelt werden, befinden sich in den sechs Betschuana-Reichen noch zwei andere Stämme in der Stellung von Sclaven den Betschuana's gegenüber, doch ist diese Stellung eine drückendere, denn während es zu geschehen pflegt, daß Makalahari freigelassen werden, und zuweilen eine Annäherung und Verschmelzung der Ma- oder Bakalahari und der Bakwena's etc. statthat, geschieht dies nie zwischen den letzteren oder anderen freien Betschuanastämmen und den beiden hart behandelten Sclavenstämmen, den Barwa's, die bei den nördlichen Betschuana's Masarwa's genannt werden, und den Madenassana's, die in dem nordwestlichen Gebiete der östlichen, und dem nordöstlichen der westlichen Bamangwato's wohnen.
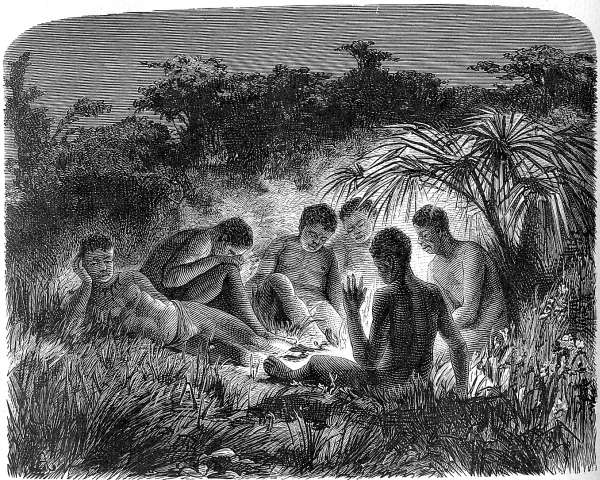
[Masarwa's am Feuer.]
Ich möchte die Barwa's und Masarwa's als ein Mischlingsvolk, hervorgegangen aus der Verschmelzung der Makalahari, d.h. eines Zweiges derselben, mit den Buschmännern bezeichnen. Gestalt, Teint, Gebräuche und die Sprache sind ebenso viele Indicien für diese beiderseitige Verwandtschaft und ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich die Barwa's und Masarwa's ein Bindeglied zwischen den Buschmännern und der Banthufamilie nenne. Während die Makalahari etwa Leibdiener, hauptsächlich aber Hirten der Betschuana's sind, haben die übrigen Sclavenstämme Jagddienste zu versehen, in welcher Beschäftigung sie ihre Gebieter auch weit übertreffen. Der Bogen und der Pfeil, den Betschuana's fremd, sind bei den Barwa und Masarwa wie bei den eigentlichen Buschmännern noch immer im Gebrauch, ebenso verstehen sie die Thiere in Fallen, d. h. mit vergifteten Assagaien (siehe die Illustration Seite 44) und in Fallgruben zu fangen, als Antreiber sind sie—wie die ihnen bezüglich der Sprache und des Gesichtsausdrucks verwandten, doch sich sonst an die westlichen Eingebornenstämme anlehnenden Madenassana's—vorzüglich verwendbar. Nur gegen ihre Verschmitztheit, Untreue und ihren Hang zum Diebstahl ist es gerathen, sich vorzusehen.
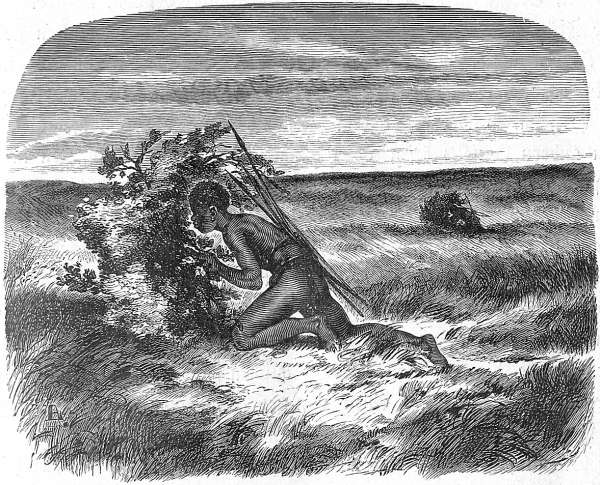
[Anschleichende Masarwa's.]
Sie bewohnen in wildreichen Gegenden kleine Dörfchen, d.h. Hütten, deren heuschoberähnliches Gerippe aus einigen in die Erde schief eingetriebenen, etwa fünf Fuß über dem Boden miteinander verbundenen Pfählen besteht und mit einer Lage von dürren Zweigen und Gras überdeckt wird. Sonst zeigt keine Umzäunung, blos einige glatte Steine, worauf Samen zerrieben, Knochen zerschlagen oder geschliffen werden, sowie einige Aschenhaufen, zahlreiche trockene Schoten von Leguminosen (Bäumen, Sträuchern und Pflanzen) und einige Fußpfade, daß hier Menschen hausen oder gehaust haben. Gewehre und Schießbedarf werden ihnen anvertraut, die Felle, Straußenfedern, Elfenbein und Rhinoceroshorn, nebstdem auch wilde Früchte, wie jene des Baobab, der Fächerpalme etc. müssen sie an ihre Herren abliefern. In der Regel finden wir jedoch einen Bamangwato oder Barolong etc., dessen Leibdiener sie sind, mit ihnen jagen, kehrt er heim, so übergibt er dem ältesten von ihnen das Commando. In jedem andern Falle müssen sie sich nach zwei bis fünf Monaten in der Hauptstadt einfinden und die Jagdbeute abliefern. Bei dem Besuche derselben ist es ihnen aber nicht gestattet, bei Tage in die Stadt zu treten, sie lassen sich vor der Stadt nieder, und nachdem sie dem nächsten besten Einwohner ihren Namen, ihren Wohnort und den Zweck ihres Kommens mitgetheilt und dieser es dem König hinterbracht hat, wird ihnen am Abend nach Sonnenuntergang ein Bote zugesendet, der sie in die Kotla führt. Solche, die den Besuch der königlichen Stadt zur bestimmten Zeit unterlassen, wenden durch einen von dem Chef ausgesendeten Boten an ihre Pflichten gemahnt und abgeholt.
Die Masarwa's sind von mittelgroßer Statur, besitzen einen röthlichbraunen Teint und abstoßende Gesichtszüge; in ihrer Gestalt nähern sie sich dem Buschmanne, in ihren Gesichtszügen und dem Teint den Makalahari's. Sie sind weniger treu und anhänglich als letztere, darum werden sie auch von ihren Herren seltener im Kampfe und als Hirten benützt, wohl aber als Spione oder um die Grenzen zu bewachen und von der ersten Annäherung eines feindlichen Haufens nach des Königs Stadt Nachricht zu bringen.
Kein Stamm im centralen Süd-Afrika versteht es in den trockensten Gegenden mit solchem Erfolge nach Wasser zu spüren, die Fährte des Wildes so treu aufzunehmen und das Wild so geschickt und unbemerkt zu beschleichen und zu überlisten wie die Barwa's und Masarwa's. Weil sie jedoch in Folge ihrer Untugenden von den Betschuana's hart behandelt werden, sind sie auch den Weißen gegenüber mißtrauisch geworden. Reist man durch die Kalahari, oder in den sandigen Wäldern, die wir eben durchzogen, oder in jenen zwischen Schoschong und dem Zuga-River und jenen zwischen den Salzseen und dem Zambesi, so ist man oft, ohne die leiseste Ahnung davon zu haben, von Angehörigen dieses Stammes gefolgt, der ob seines Mißtrauens und um nicht schwere Arbeit verrichten zu müssen, sich scheu in der Ferne des Weißen hält. Hat man jedoch ein Stück Hochwild geschossen, so sieht man sich, bevor noch die Beute erstarrt, von einem Trupp Barwa's umringt, welche mit Ungeduld den Moment erwarten, zum Ausweiden der Jagdbeute aufgefordert zu werden, um einen Theil des Fleisches als Entlohnung zu erhalten. Ich möchte sagen, sie sind unter den südafrikanischen Racen das, was unter den Vögeln der Aasgeier und unter den Säugethieren die Schakale. Kreist in den obgenannten Gegenden ein Aasgeier hoch in den Lüften, so hat ihn auch schon des Masarwa Auge erspäht und er eilt rasch nach der Stelle zu, wo der Geier sich niedergelassen. Ueberraschen sie nun bei solcher Gelegenheit den König der Thiere beim Mahle, so trachten sie durch Geschrei, mit Stein- und Feuerbrandwürfen das Raubthier zu verscheuchen, angegriffen, flüchten sie sich wie die Affen in die Bäume und verkriechen sich wie die Wiesel in die Dorngebüsche, um dem sie verfolgenden Löwen einen ihrer vergifteten Pfeile in eine dünnere Hautstelle einzubohren.
Nach der Mittheilung meines Freundes Mackenzie werden diese Masarwa's und Barwa's von den Betschuana's in der Regel Masarwa a bolotsana thata, d.h. schlechte Menschen (Bösewichter) und Masarwa Ki linoga hela (wahre Schlangen) betitelt.
Gleich den Buschmännern in der Colonie und im Oranje-Freistaat hassen die Barwa's und Masarwa's Ackerbau und Viehzucht, doch beobachtete ich nie—außer an einigen, jenen der Makalahari's ähnlichen, auf Bein und Holz ausgeführten, höchst einfachen, eingebrannten oder eingeschnittenen Strichen etc.—daß sie Gravirungen in Stein ausführen oder steinerne Objecte in ihrer einfachen Haushaltung benützen würden. Dagegen arbeiten sie lange Ketten aus rundlichen Straußeneier-Scheibchen und andere Verzierungen aus diesem Material. Ich konnte bei ihnen weder von einem Höhlenbau in Felsen, noch etwas von einer Ausschmückung der Felsenkuppen sehen oder in Erfahrung bringen, hingegen fand ich bei ihnen den crassesten Aberglauben in voller Blüthe.
Auf der Jagd, mag der Masarwa nun allein oder in Begleitung seines Betschuanaherrn sein, werden die einfachen Knochen- und Holz-Amulete (Dolos) geschüttelt und geworfen, um die Richtung des Wildes, die Art und Zahl desselben und den Erfolg der Jagd zu erfahren. Sie werden auch in Krankheitsfällen befragt, und ob der »Herr« kommt. Von den Betschuana-Herren hat er den Namen Morimo für Gott aufgeschnappt, und obgleich der Betschuana selbst den Begriff Morimo, der von seinen Vorfahren verehrt wurde, bis auf den Gedanken, daß Morimo ein höher als die Morena's (Fürsten) gestelltes Ding oder höheres Wesen bezeichnet, verloren, so bezeichnet doch auch der Masarwa und der Barwa seine Dolos, die ihn über alles belehren und unterweisen sollen, seinen Schatz und seinen theuersten Besitz mit Morimo, er meint »dies ist mein Gott (Se-se morimo-se)« oder er sagt »die Dinge meines Gottes (Lilo tsa Morimo oa me)« und Dinge die ihn benachrichtigen, »Lilo-lia impulelela mehuku.« Doch nicht allein, daß ihm die Dolos sein Morimo oder die Eigenschaft, das Eigenthum eines mächtigen Wesens sind, er behauptet auch andererseits, daß er selbst mit dem Werfen dieser Dolos Morimo Gelegenheit gebe, seine Kenntniß darzuthun, und daß er selbst Morimo's Werkzeug sei.
Die Barwa- und Masarwamänner zeigen ihren Frauen gegenüber mehr Anhänglichkeit als die Betschuana's und Makalahari's, die schwerste ihnen zukommende Arbeit ist das Wasserholen in den mit Bast, Stricken oder Thierhautstreifen umflochtenen Straußeneier- oder Kürbisschalen und das Tragen der kaum nennenswerthen Hausutensilien. Die primitiven Hütten sind in wenigen Stunden mühelos hergestellt. Eine große Anhänglichkeit zeigt der Masarwa für seine Hunde, die, im Gegensatz zu der schlechten Behandlung, die diesem Hausthiere von den Betschuana's zu Theil wird, bei ihnen zumeist gut gepflegt werden.
Von ihren Gebräuchen sind nur wenige bekannt, da noch kein Reisender in der Lage war, längere Zeit in oder in der Nähe eines Masarwadorfes zu wohnen und ihrer Sprache mächtig zu werden; wir wissen blos, daß sie sich im Stadium der Pubertät, mit einem Knochen die Nasenscheidewand durchbohren und ein Holzpflöckchen einschieben, um eine kleine kreisrunde Oeffnung zu erzeugen. Das Hölzchen wird, nachdem der Zweck erreicht, wieder entfernt; sie benennen diese That rupa, was jedoch ein aus der Setschuana entnommenes Wort ist und die Einleitungceremonie zu der Beschneidung bei den Betschuana's bezeichnet.
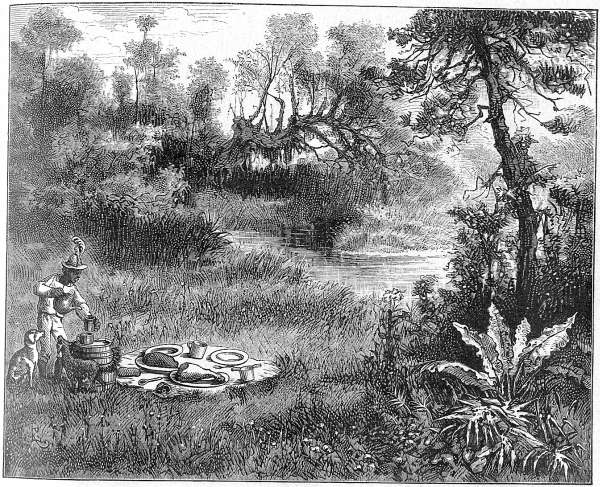
[Neujahrstafel im Urwalde.]
Was vielleicht dem Reisenden am meisten an den Masarwa's, die in manchen Gegenden über Mittelgröße, ja zuweilen im Lande der Bamangwato's oder Bakwena's etc. ebenso wie der herrschende Stamm von hoher Statur sind, neben der Häßlichkeit ihrer Gesichtszüge am meisten auffällt, das sind die röthlichen, wie halbgeröstet aussehenden vorderen Schienbeinflächen, oft tragen die Vorderarme und der Rücken sowie die Fußrücken und Schenkel ähnliche narbenartige Merkmale. Der Masarwa—in selteneren Fällen der Makalahari—der kaum mehr als ein kurzes Fellstück, über die Schulter geworfen hat und zuweilen außer einem kleinen aus Elandfell gearbeiteten Schildchen nichts zu seinem Schutze mit sich trägt, ist gegen die Kälte sehr empfindlich. Statt sich nach Betschuanasitte ein umzäuntes Höfchen zu machen und hier oder nach jener der Koranna's in der Hütte selbst ein Feuer anzuzünden, entzündet er das seine stets im Freien und sucht sich dann so rasch wie möglich zu erwärmen; er rückt dem Feuer so nahe wie möglich und schläft hockend mit auf die Kniee gesunkenem, zwischen die Arme gepreßtem Kopfe ein, daher sind dann auch die vorderen Unterschenkelflächen dieser armen Geschöpfe denen des Metatarsus der paarenden Straußenhähne nicht unähnlich gefärbt.
Berichtet man von dem Buschmann der Colonie, daß er die Haut des Wildes benützt, um sich demselben bis auf Treffweite seines Pfeiles zu nähern, so benützt der Masarwa einen kleinen dichten Busch als Deckung, d.h. den Busch mit der einen Hand vor sich hinhaltend und vorschiebend, um in kriechender Stellung seine Opfer zu beschleichen. »Eines Abends,« erzählte ein mir wohlbekannter Jäger, »saß ich allein an meinem Feuer in einer der weiten Ebenen des Mababifeldes. Vor mir lag die Ebene, das Gras war noch jung, kaum zwölf Zoll hoch. Ich rauchte und blickte auf die Ebene hinaus; vor mir hob sich hie und da ein kleiner Busch empor. Als ich nach einer Weile wieder aufsah, schien es mir, als ob sich der eine Busch an einer Stelle befände, an welcher ich zuvor keinen erblickt, d.h. kaum 50 Schritte vor mir. Ich fixirte das Object, doch mehr denn eine Viertelstunde verrann und noch immer stand der Busch an seiner Stelle. Ich hielt das ganze für Sinnestäuschung und kehrte mich zum Wagen—doch wer beschreibt meine Ueberraschung, als ich mich nach einigen Minuten zufällig umwandte und etwa 20 Schritte vor mir einen Masarwa erblicke.«
Bei den Wassertümpeln angelangt, fühlte ich mich bedeutend wohler. Unsere Haltstelle, wo ich uns eine mehrtägige Rast gönnen wollte, schien vor einem Jahre, oder doch während dieser Zeit von Jägern bewohnt gewesen zu sein. Einige Hufe von Zebra's, welche mit Auswüchsen, durch Wespenmaden hervorgebracht, wie mit Zoten dicht überwachsen waren, sowie Bruchstücke von Kudu- und Bläßbockhörnern, gestreifte Gnuschädel, ein Giraffen- und ein beschädigter Nashornschädel, und Reste einiger Grashütten wiesen deutlich darauf hin. Unsere Masarwa-Führer betätigten meine Vermuthung und theilten mir mit, daß hier Bakwena's (die Herren des Landes) unter der Anführung eines Sohnes Seschele's, d.h. des königlichen Prinzen mit mehreren Pferden gejagt und nebst einigen Straußen einen großen Wagen mit Fellen und Fleisch beladen nach Molopolole zurückgebracht hätten.
Nachdem wir uns alle gelabt und erfrischt hatten, konnten wir endlich daran denken, den Tag der Jahreswende zu feiern. Es geschah dies nicht ohne jedes Ceremoniell, ein Toast auf das Wohl des Kaisers von Oesterreich schloß die Feier des Neujahrstages 1874 im Herzen der südafrikanischen Wildniß. Erstaunt sah uns der Masarwa an, er sah uns in die Lüfte sprechen und frug Pit, ob wir zu unserem Morimo geredet hätten.
Gegen Abend fühlte ich mich so weit hergestellt, daß ich sogar einige hundert Schritte weit in die Büsche gehen konnte, wobei mir ein undurchdringliches dichtes Gehölz nahe an der Stelle, wo der nach Westen zu führende Weg plötzlich nach Norden sich wendet, durch seine Höhe auffiel. Gruppenweise fanden sich in diesem Walde zwischen Molopolole und Schoschong bis zu 60 Fuß hohe Bäume. Eine der Acacia horida äußerst ähnliche Art war besonders häufig vertreten. Alte Stämme waren niedergefallen, lagen theilweise zwischen den zerschmetterten, schwarz berindeten Aesten gebettet, theils lehnten sie an anderen, sich noch kräftigen Gedeihens erfreuenden und bildeten mit den vielen neu aufsprossenden Bäumen, dem anderweitigen Gebüsch, sowie den durch den Moder der absterbenden Bäume beförderten reichen Pflanzenwuchs dichte, oft undurchliche, wenn auch beschränkte Urwaldpartien in dem unabsehbaren, tiefsandigen Niederwalde. Bei der herrschenden Dunkelheit hielt ich es nicht für gerathen, in das oberwähnte Gehölz einzudringen, trotzdem mich ein mehrstimmiges Perlhuhngegacker anlockte.
Nachdem ich sie reichlich beschenkt, entließ ich die beiden Masarwa-Führer und ließ ihrer Mahnung entsprechend, sechs große Feuer um unser Lager anzünden, um die hier zahlreich herumwandernden Raubthiere abzuhalten. Ohne Ahnung, daß der folgende Tag für mich einer der ereignißreichsten und zugleich trübsten während meines siebenjährigen Aufenthaltes werden sollte, verfiel ich bald darauf in einen wohlthätigen Schlummer. Später als ich es sonst gewohnt war, wachte ich durch ein unnatürliches Kältegefühl auf, welches durch eine von der Wärme angelockte und wohl irgendwo unter den zahlreichen umliegenden Thierschädeln wohnende kleine Schlange verursacht worden war. Die Sonne stand schon hoch und am Feuer saßen Besucher aus dem gestern von uns wahrgenommenen Dorfe. Ich erkannte sie an dem Bakwena, der das Wort führte. Der Mann hatte einige Pallahfelle, einige weiße, doch nicht besonders feine Straußenfedern und einen etwa neun Pfund schweren Elephantenzahn mitgebracht, der deutliche Spuren trug, daß er von einem der Thiere »verloren«, durch lange Jahre irgendwo im Grase gebleicht hatte, bevor ihn der Zufall dem Bakwena oder einem seiner Masarwa-Diener in die Hände gespielt hatte.

[Verirrt.]

[Von Masarwa's gestörtes Löwenmahl.]
Gegen Mittag schulterte ich das in Moschaneng erstandene Doppelgewehr, nahm 12 Patronen mit und schlug eine westliche Richtung ein, um unseren Tisch mit frischem Wildfleisch zu versehen. Etwa 700 Schritte vom Wagen stieß ich auf Gnu's und nach weiteren 1000 Schritten, nachdem ich diese in Süd- bei West-Richtung verfolgt, auf quer über meinen Pfad nach Norden führende, frische Giraffenspuren. Ich verließ sofort die zuerst eingeschlagene Richtung und folgte den Giraffen, die, etwa 20 an der Zahl hier ihren Weg genommen haben mußten. Nach einer Stunde Weges theilten sich die Spuren, ich folgte den zahlreicheren, die nach Nordwest zu führen schienen. Der Rasen wurde dicht ohne hoch zu sein, die Spuren wurden immer undeutlicher, trotzdem fand ich an einigen abgebrochenen Zweigen deutliche Merkmale, daß hier die Thiere noch vor einigen Stunden geweidet haben mußten. Die Gegend war derselbe Niederwald, doch nur stellenweise dichter, und bestand aus geringen Senken und ebenso unbedeutenden sandigen Bodenerhebungen. Seitdem ich die abgebrochenen Zweige wahrgenommen, hatte ich weniger die Richtung im Auge behalten und als ich bei meinem Suchen drei Meilen zurückgelegt, hatte ich dieselbe vollkommen verloren. Während ich mich zu orientiren versuchte, fühlte ich mich recht matt und abgeschlagen, dabei mächtigen Hunger, das Aergste von Allem jedoch war, daß es in meinem Kopfe wohl durch den Einfluß der brennenden Sonnenhitze wie in einer Mühle sauste und sich stechende Schmerzen in den Schläfen einstellten. Ich war so, ohne es zu wissen, zweimal im weiten Bogen zurückgegangen und mußte mich höchstens fünf Meilen weit vom Wagen befinden, doch in meiner Verwirrung und von unsäglichem Kopfschmerz geplagt, schlug ich die entgegengesetzte Richtung ein und ging so rasch es meine Müdigkeit nur gestattete, gerade nach Nordnordwest. War der Kopfschmerz die Ursache, oder war ich so matt und meine Sinne durch die große Hitze so abgestumpft, ich kann es mir selbst heute nicht erklären, daß es mir in dieser Zeit, als ich schon die Giraffenspuren verlassen und den Heimweg angetreten zu haben wähnte, nicht einfiel, das goldene Himmelsgestirn anzusehen, nicht eher, als bis es sich schon zum Untergange neigte und die langen Schatten der Bäume das Ende des Tages anzeigten.
Da schlug ich eine südöstliche, dann aber eine östliche Richtung ein, um den von Molopolole nach Schoschong führenden Weg zu treffen. Allein als ich zu diesem Entschlusse gekommen war, hatte auch meine Abmattung den Gipfelpunkt erreicht und ich konnte kaum 20 Schritte gehen, ohne ausruhen zu müssen. Der Durst quälte mich entsetzlich. In der Hoffnung, daß ich vielleicht dem Wagen näher war als ich es vermuthen konnte, oder aber um die Aufmerksamkeit zufällig in der Nähe jagender Masarwa's auf mich zu lenken, feuerte ich acht Schüsse ab und horchte mit größter Spannung auf den Erfolg meines Nothsignals. Doch Alles blieb stille.
Mit Anstrengung und der Wunden nicht achtend, die mir das Erklimmen eines Dornbaumes verursachte, feuerte ich nochmals von seiner Spitze zwei Schüsse ab, vielleicht wurde ich nun gesehen, doch wie weit mein wirrer Blick auch reichte, keine Bewegung in den Büschen, kein Gegenstand zu erblicken, der mir Hilfe hoffen ließ. Nun sank mir der Muth. Ich fühlte mich außer Stande, einige Meilen weiter zu gehen. Die letzten beiden Schüsse konnte ich doch nicht aufopfern, ich fühlte mich so schwach, daß mir das Tragen des Gewehres zur Last wurde und hätte es wegwerfen mögen. All' dies wohl die Folge der heutigen Anstrengungen, des Unwohlseins und der Unfälle, die mir Tags zuvor zugestoßen waren. Was nun thun! Schreien! Ja, Schreien, ich begriff nicht, daß mir dies nichts helfen, höchstens wilde Thiere anlocken würde. Ich kroch auf einen Termitenhügel und schrie aus Leibeskräften. Es währte nicht lange und ich hatte mich—ohnehin derart abgemattet, daß ich mich mit aller Macht an den Termitenbau anklammern mußte, um nicht herunterzugleiten—heiser geschrieen. Als ich mich zur Erde gleiten ließ und hier neben dem Gewehre lag, brach ich, durch die glühende Sonne und die gänzliche Ermattung wie sinnesverwirrt, in ein Gelächter aus. Es kam mir selbst sinnlos vor, in dieser Wildniß, in der weit und breit im Umkreise keine menschliche Seele zu treffen war, auf solche Weise Rettung zu suchen. Das krampfhafte Lachen hatte einen krampfhaften Husten zur Folge und dieser führte mich wieder zur Besinnung zurück.
Der in mir wühlende Durst drohte mir den Rest meiner Kräfte zu rauben, vergebens sah ich mich nach Blättern um, deren Feuchtigkeit meinen brennenden Lippen Kühlung gewähren konnte, die einen waren dürr, die anderen mit Wollhaaren bedeckt; mechanisch griff ich nach den Blättern eines mir unbekannten Busches und führte sie an die Lippen, doch auch sie waren—Ironie des Schicksals—gallbitter. Noch einige Schritte und ich ließ das Gewehr fallen, Blitzartig durchzuckte mich jedoch bald nachher der Gedanke, daß ich damit meinen einzigen Schutz, meinen besten Freund geopfert und mit Aufgebot aller Kräfte schleppte ich mich zur Stelle zurück und hob das Gewehr, das noch zwei Schüsse barg, auf. Was war ich ohne Waffe in dieser Wildniß—ein wehrloses Opfer hungriger Hyänen!
Meine letzte Hoffnung war darauf gerichtet, mit einem der Schüsse ein kleines Feuer zu entzünden, unter dessem Schutze ich die Nacht überleben konnte. Doch auch dieses letzte Auskunftsmittel versagte, die dürren Aeste fingen kein Feuer. Nun ergriff mich nackte Verzweiflung, wie im Fieberwahnsinn jagten die tollsten Gedanken durch mein erhitztes Gehirn, Verwünschungen drängten sich auf die Lippen und mechanisch griff ich nach dem Gewehre.
Ich fühlte nun vollends meine Kräfte schwinden und erinnere mich nur noch, daß ich auf die Knie fiel, beide Hände ausstreckte und wie sich in diesem Momente eine schwarze Gestalt vor mir auf die Erde warf, an mich herankroch und mich erfaßte. Ich war gerettet—gerettet durch einen Masarwa, der viele Meilen weit von Westen her auf dem Wege zu der gestern passirten Niederlassung begriffen war, um seine Genossen zu holen, denn er hatte früh am Morgen weit von hier ein Gnu erlegt.
Ein labender Trunk hätte mich nicht mehr elektrisiren konnen als diese Erscheinung. Er richtete mich auf und als ich mit den Fingern nach dem Munde wies, daß ich durstig sei, da holte er aus seinem Ledersacke am Rücken eine Handvoll Beeren und preßte sie mir in die Hand. Als ich sie geschluckt und mich an ihrem süßlichen Saft gelabt, fühlte ich mich wie verjüngt. Nun trachtete ich ihm mit dem Namen Koloj begreiflich zu machen, daß ich zum Wagen gehen wolle, Koloj ist kein Setschuana-Wort, doch bei den Betschuana's, ihren Vasallen und den Makalaka's etc. eingebürgert. Mein Retter grinste mich an und wies nach Südost; »Pata-Pata« meinte er. Dies ist unter diesen Stämmen der aus dem Holländischen entnommene und verunstaltete Ausdruck für einen Weg, den ein Wagen befahren kann, und ich konnte nur nicken, um ihm meine Befriedigung auszudrücken. Mich erhebend, versuchte ich zu gehen und der Mann, obwohl kleiner als ich, stützte mich; er nahm mein Gewehr und schulterte es mit seinen drei Assagaien auf die linke Schulter, während er mir die rechte als Stütze bot. Allmälig kehrten meine Kräfte zurück und wenn auch nur äußerst langsam und nach längeren Ruhepausen—aber es ging vorwärts.
Als die Sonne unter den Horizont gesunken war, befanden wir uns am Fahrwege. Im Osten zeigte der Himmel eine dunkle Färbung, dort blitzte es und dumpf grollte der Donner zu uns herüber. Die Atmosphäre war kühler geworden und obgleich noch immer warm, schauerte ich doch unter dem Hauche des leisen Windes, der aus Nordosten durch die Bäume strich. Ich war in Schweiß gebadet und mein Hemd (ich hatte die Jacke im Wagen zurückgelassen) klebte am Körper. Nach einer halben Stunde Ganges wollte ich mich niedersetzen, doch mein Begleiter ließ es nicht zu. Kurz darauf ging er links vom Wege in die Büsche, ich wollte ihm nicht folgen, es war ja eine verkehrte Richtung, die er einschlug. Da wies er auf den Mund und ahmte einen schlürfenden Laut nach. »Meci? (Wasser)« frug ich. »E-he, E-he! (ja, ja)« antwortete er mit einem Kopfnicken und Grinsen und ich gehorchte.
Nahe am Wege in einer kleinen Sandvertiefung lag eine kleine von Eingebornen ausgegrabene, mit schlechtem Pfützenwasser gefüllte, doch mir sehr willkommene Grube. Gnu's hatten die Stelle kaum eine Stunde zuvor besucht und sich mit demselben Naß ihren Durst gestillt. Kaum hatte ich mich von dem Pfuhle erhoben, bedeutete mir der Masarwa ihm zu folgen, indem er nach dem Gewitter im Osten wies; die Dunkelheit war schon eingebrochen als wir vom Wege abbogen, und beinahe zur selben Zeit brach auch der Sturm los. Bald fiel der Regen in Strömen, die großen Tropfen schienen mir wie Schloßen und erzeugten, auf meinen schwitzenden Leib fallend, ein höchst unangenehmes Gefühl von Abmattung und Kraftlosigkeit.
Mein Führer hatte sein kleines Ledermäntelchen um mein Gewehr geschlagen und auf meinen Retter gestützt, ging es, stellenweise bis an die Knie durch das Wasser watend vorwärts. Endlich hörte ich die Hunde anschlagen und kaum hatte man mich erblickt, kamen E. und B. auf mich zu gelaufen und schalten mich wegen der Besorgniß, die ich ihnen mit meinem Ausbleiben bereitet hatte. Sie ahnten wohl nicht, wie es mir ergangen.
Nun, da ich wieder im Innern meines Wagens geborgen war, erwachten wieder alle Lebensgeister. Ich bat sie, den Masarwa zu bewirthen und ihn bei Pit am Feuer schlafen zu lassen. Ein kräftiger Imbiß und ein mehrstündiger tiefer Schlaf hatten mich so weit hergestellt, daß ich mich schon am nächsten Morgen ohne Stütze bewegen konnte.
Da nach Aussage des uns begleitenden Bakwena's der direkte Fahrweg in Folge des heftigen Regenfalles schwer passirbar geworden, schlugen wir am folgenden Morgen (am 3. Jänner 1874) einen etwas weiteren Seitenweg durch die Büsche ein. Schon nach einigen hundert Schritten stießen wir auf eine verendete Deukergazelle, welche in der verflossenen Nacht von einer Hyäne getödtet worden war. So unglaublich es mir auch schien, die von den Masarwa's verfolgten Spuren ließen keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die schlanke Gazelle dem plumpen unbeholfenen Raubthiere zum Opfer gefallen war.
Nicht weit vom Wege trafen wir die Reste—einer amerikanischen Pumpe. Ein größeres Räthsel konnte uns nicht aufstoßen—unsere Führer konnten uns darüber keinen Anschluß geben, d.h. sie wollten oder durften es nicht. Nicht eher als in Schoschong wurde mir das Räthsel gelöst. Seschele hatte, als die Händler noch die directe, sehr wasserarme Route nach Schoschong frequentirten (gegenwärtig wird zumeist der wasserreiche Weg über die Dwarsberge und längs des Marico und Limpopo eingeschlagen), aus diesem Umstande Profit ziehen wollen, und sich deshalb durch einen der in seiner Stadt wohnenden Händler eine amerikanische Pumpe von Port Elizabeth bringen und an jener Stelle einsetzen lassen. Hier hatten Makalahari für die nach dem Innern reisenden Jäger, Händler etc. Wasser auszupumpen und jene dafür an den König eine Abgabe zu bezahlen. Da jedoch eine amerikanische Kettenpumpe den Makalahari's etwas Ungewöhnliches war und von ihnen trotz aller Instructionen unrichtig behandelt wurde, so währte es nicht lange und sie versagte den Dienst.
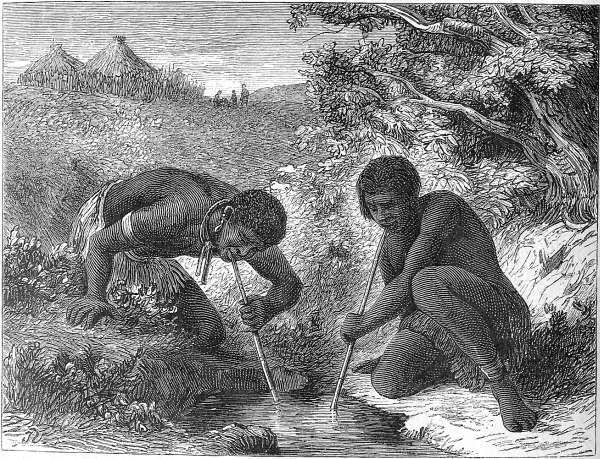
[Trinkende Masarwa's.]
Freund Eberwald, der dem Wagen vorausging, um demselben den Weg durch die Gebüsche anzuweisen, kam plötzlich athemlos zum Wagen zurückgelaufen. »Kommt rasch, nehmt Eure Gewehre, verseht sie mit frischen Zündhütchen, allein rasch, sonst verlieren wir ein schönes Stück Wild, das heißt Sie, Doctor, einen sehr schönen Balg. Wir folgten ihm alle, auch die Masarwa's. Hundert Schritte vom Wagen entfernt, war Eberwald plötzlich im hohen Grase auf einen Leoparden gestoßen. Das Thier sprang auf, fauchte und fletschte ihn an, machte einen Sprung und duckte sich weiter abwärts einige 30 Schritte vor ihm im hohen Grase nieder. Da Eberwald nur mit Schrot geladen hatte, wollte er sich nicht zu einem Schusse auf das Thier erkühnen und holte Succurs. An Ort und Stelle angekommen, konnten wir jedoch nichts wahrnehmen, einer der Masarwa warf seinen Speer nach der deutlich bezeichneten Stelle, doch nichts regte sich. Ich ließ die Hunde holen, doch da ich den Haß kenne, mit dem sich diese beiden Thiere stets verfolgen und Niger, der immer dem starken Onkel voraus war, dabei leicht zu Schaden kommen konnte, hielt ich und Pit die Hunde an der Leine, während B. mit einem Masarwa als Wächter am Wagen zurückblieb. Bellend nahmen die Hunde die Spur auf, welche geraden Weges auf das hohe dichte Gehölz zuführte, welches ich bereits Abends zuvor bemerkt hatte. Doch der Leopard war verschwunden, in dem dichten Buschwerk war er übrigens vor Entdeckung sicher.

[Begegnung mit einem Leoparden.]
Im weiteren Verlaufe unseres heutigen Marsches, der des aufgeweichten Bodens halber sehr beschwerlich war, begegneten uns Masarwa's, welche mit Honig beladen heimkehrten. In Wäldern folgen sie dem Honigvogel, auf der Grasebene und da, wo nur niederes Gebüsch zu treffen ist, dem Fluge der von den Wasserstellen heimkehrenden Bienen. Die Thiere folgen eines dem andern der Richtung nach ihrem Bau und leiten auf diese Weise die Honigsucher zu ihrem Neste. Ist der Eingang zum Bau (meist eine Höhlung im Baume) entdeckt, trachtet man die Bienen auszurauchen und sich dann des Honigs zu bemächtigen. Für ein etwa 1½ Zoll langes, fingerdickes Tabakstückchen erstand ich mehr denn einen halben Liter Honig.
Der Weg wurde auch am folgenden Tage nicht besser, an den sumpfigen Stellen trafen wir zahlreiche Schildkröten-Leichen. Zu den dem Auge wohlgefälligsten Schlingpflanzen Süd-Afrika's gehören unstreitig einige der gurkenartigen Gewächse. Auch auf der heutigen Fahrt beobachtete ich welche, die sich an Büschen emporschlangen, von denen sie durch ihre gelappten, schönen bläulichgrünen Blätter, namentlich aber durch ihre mehr denn daumenstarken und lang herabhängenden, unreif hellbläulichgrünen, weiß gescheckten, reif scharlachrothen Früchte deutlich abstechen. Eine solche Staude trägt oft drei bis sieben, ja bis zehn Früchte, von denen selten drei in gleichem Entwicklungsstadium stehen. Zumeist fand ich das herabhängende Ende der Frucht scharlachroth, den dem Stengel zugekehrten Theil jedoch noch grün und den dazwischen liegenden im allmäligen, oder auch plötzlichen Uebergang von bläulichgrün oder hellgrün zu gelb, orange und röthlichgelb. Während der Nacht begegnete uns ein Händler, der mit Elfenbein, Straußenfedern, Carossen und ungegerbten Thierhäuten über Molopolole und weiter südwärts nach der Cap-Colonie fuhr.
Auch am 5. Jänner blieb der Weg tiefsandig, der Wald wurde immer lichter und endlich gelangten wir auf eine große, blos stellenweise mit Büschen bewachsene Grasebene. Ich erbeutete auf derselben eine 4½ Fuß lange giftige, von mir bisher noch nicht beobachtete Schlange. Was mir besonders während der heutigen Fahrt auffiel, waren die zahlreichen, nicht blos in den nächstanliegenden südlichen Strichen, sondern auf weite Flächen hin einzeln auftretenden hohen, bald pyramiden-, bald kegel- und kegelstutzförmigen, sowie auch säulenförmigen, bis zu vier Meter hohen, graulichweißen Termitenhügel, welche sich in dem hohen Grase freistehend oder sich oft an ein kleines, dichtes Gebüsch anlehnend, gleich Monumenten emporhoben.
Nachdem wir etwa weitere 11¼ Meilen zurückgelegt hatten, sahen wir einen nur mit zwei Assagaien und einer Holzaxt bewehrten, mit einem Lederschürzchen bekleideten Makalahari auf uns zukommen. Nach Wasser befragt, erbot er sich unsere Thiere zu einem etwa drei Meilen entfernten Tümpel zu führen. Unterdessen ließ ich unser Nachtlager aufschlagen.
Hundegebell schreckte mich aus dem Schlafe auf; aus dem Wagen hervortretend, fand ich mich zwei Eingebornen gegenüber, die mich mit einem Redeschwall in der Setschuana begrüßten, von dem ich nicht ein einziges Wort verstehen konnte. Ich weckte Pit und erfuhr von ihm, daß ich zwei Bamangwato's, beide Unterthanen Sekhomo's, vor mir habe, wovon einer des Königs Abgesandter, eine Art Polizist, und der zweite ein »betrübter Vater« sei, der seinen entlaufenen Sohn, den er »Kind« titulirte, suche. Der Ungehorsame, der sich schon die »männlichen« Sandalen zu tragen berechtigt glaubte, hatte Schoschong und den Seinen heimlich Valet gesagt und sich dann am vorigen Tage einem vorüberziehenden Händler als Diener verdungen. Der besagte Vater frug nun, ob und wo wir sein »Kind« und den Weißen gesehen, dem es nachgelaufen, er müsse es zurückbringen, zu welchem Zwecke er den mit einer Donnerbüchse bewaffneten Vertreter der Behörde mitgenommen. Nachdem sie den gewünschten Bescheid erhalten, verließen uns die Verfolger raschen Schrittes. Einige Tage später, als ich bereits in Schoschong weilte, kam ein ältlicher Mann mit einem etwa vierzehnjährigen Jungen zu mir, mich freundlich und im vertraulichen Tone begrüßend. Pit kam meinem Gedächtnisse zu Hilfe. »Erkennst Du ihn nicht, Herr?« warf mein Griqua ein. »Es ist der Alte, der jene Nacht an uns vorbeirannte, um sein entflohenes Kind zu suchen. Das ist das Kind, er kommt es Dir zu zeigen.«
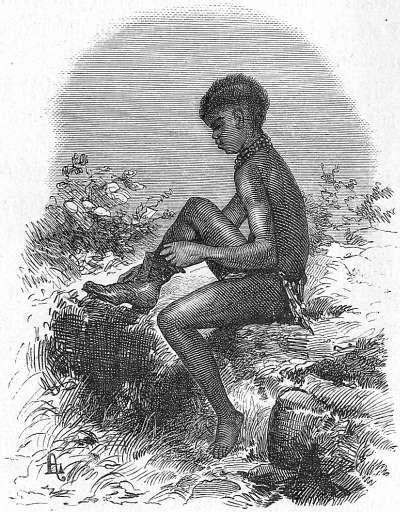
[Bamangwatoknabe.]
Der 6. Jänner war wieder ein durch mancherlei Unfälle ausgefüllter Tag. Kaum hatte ich mich von einem Stoße erholt, den mir eines unserer unbändigen Zugthiere versetzte, als mich Monkey in den Daumen biß, da ich eben daran war, die durch Sturm und Regen beschädigte Deckleinwand des Wagens in Stand zu setzen. Spät Nachmittags begegneten wir auf die Jagd ziehenden Bamangwato's, welche uns auf die Nähe der Stadt Schoschong aufmerksam machten.
Nach einer 1½stündigen Fahrt langten wir in dem großen, flachen Thale eines Flusses, in den sich zur Regenzeit der Schoschon als linkes Nebenflüßchen ergießt und bei den Feldern der Bamangwato's an. Dieses Thal scheidet die Bamangwatohöhen in eine nördliche und eine südliche Partie, von welchen die südliche durch einige Höhenketten charakterisirt wird, welche ihrerseits wieder durch Querthäler untereinander getrennt werden. Die nördliche Partie bildet ein sehr interessantes, von zahlreichen Parallel- und Querthälern durchzogenes Höhennetz, von denen das des Schoschon- und Unicorn-Flusses zu den bedeutendsten gehören; Hochplateaus auf den abgeflachten Höhen, kegelförmige kleine Kuppen, die hie und da aus diesem emporsteigen und aus großen Blöcken gebildet werden, Felsenthore etc. charakterisiren das nördliche Bamangwato-Höhennetz. Mit dem schon erwähnten Höhenrücken am Limpopo und durch diesen mit dem Central-Gebirgsknoten im Marico-District sind die Bamangwatohöhen durch einige kegelförmige Berge verbunden; die nördliche Partie der Bamangwatohöhen hängt durch die Tschopokette mit dem nördlichen Central-Gebirgsknoten des Matabele-Reiches zusammen. Dieses für die Geschichte der Bamangwato's bedeutende Thal—die wichtigsten geschichtlichen Episoden dieses Stammes spielten sich darinnen ab—erlaubte ich mir »Franz Josef-Thal«, sowie den höchsten Punkt des Höhennetzes »Franz Josef-Kuppe« zu benennen.
Ich zog am 8. Jänner zum ersten Male in Schoschong ein. Da meine Provisionen sehr abgenommen hatten und ich nicht im Stande war, neue mit barem Gelde zu erstehen, da ich ferner keinen Diener miethen konnte und bestrebt sein mußte, mich in drei Monaten auch wieder in den Diamantenfeldern einzufinden, um bei meinen früheren Kranken nicht vollkommen in Vergessenheit zu gerathen und die Mittel für die dritte, die eigentliche Reise zu gewinnen, so wurde Schoschong der fernste nördliche Punkt meiner zweiten Versuchsreise und ich wandte mich von hier nach einem längeren Aufenthalte, den ich im Folgenden näher beschreiben will, wieder nach dem Süden.
Von Schoschong zurück nach den Central-Diggings
Lage und Bedeutung Schoschongs.—Unser Empfang daselbst.—Rev. Mackenzie und die Mission der London Missionary Society.—Geschichte der Bamangwato's und ihres Reiches.—Sekhomo und Khama.—Sekhomo's Rath.—Sitten und Gebräuche der Betschuana (Schluß).—Die Circumcision und Boguera.—Die Kotla in Schoschong.—Die Breiprobe.—Aufbruch von Schoschong.—Das Fasanhuhn.—Khama's Salzsee.—Elephantenspuren.—Die Buffadder.—Die Dornfelder im Limpopothale.—Ein Löwe und die Hundemeute.—Ein seltener Anblick.—Zu Tode erkrankt.—Tschune-Tschune. —Die Dwarsberge und der Schweinfurth-Paß.—Brackfontein.—Eine Sonderbare Elephantenjagd.—Linokana.—Rev. Jensen und die Hermannsburger Mission.—Die Baharutse und Ihr Ackerbau.—Zeerust und der Marico-District.—Das Hooge Velt.—Potschefstroom.—Die Elephantenjäger David Jackob und Biljeon.—Die Quarzitwälle am Klip-Port.—Trennung von meinen Gefährten.—Ankunft in Dutoitspan.
Die wichtigste Stadt der unabhängigen Eingebornenreiche im Innern Süd-Afrika's ist unstreitig der Hauptort der östlichen Bamangwato: Schoschong. Im Hauptthale der interessanten, nach dem sie bewohnenden Stamme benannten Höhen zieht sich das nur nach den sommerlichen Regengüssen gefüllte Bett eines unbedeutenden Flüßchens, das von Norden her aus einer an der Mündung ziemlich breiten Felsenschlucht ein auch nur periodisch fließendes, zur Regenzeit jedoch hochangeschwollenes Bächlein »Schoschon« aufnimmt und an dem die Stadt gelegen ist; daher auch der Name »Schoschong«, der Ablativ von Schoschon (am Flusse liegend).
Schoschong war vor etwa zehn Jahren, bevor noch die Kämpfe zwischen den einzelnen Gliedern der königlichen Familie ausgebrochen waren, die bevölkertste Stadt in den unabhängigen Betschuanaländern. In diesen, den Ländern der Batlapinen, Barolongen, Banaquaketsen, Bakwena, der östlichen und westlichen Bamangwato, in denen die Hauptmacht des regierenden Stammes gewöhnlich in der jeweiligen Hauptstadt concentrirt ist, nahm Schoschong als eine der älteren Städte mit seiner Bevölkerungszahl von 30.000 Seelen den ersten Rang ein, gegenwärtig zählt die Stadt kaum mehr als ein Fünftel der einstigen Bevölkerung. Diese Abnahme ist namentlich Sekhomo's Werk, der zur Zeit meines ersten Besuches die östlichen Bamangwato beherrschte, er ist es, der nicht allein den Bürgerkrieg entfachte, durch welchen viele Bewohner das Leben verloren, sondern auch eine Spaltung des Stammes und die Auswanderung der Makalaka hervorrief. Unter dem gegenwärtigen Regime des besten der Betschuana-Herrscher erholt sich die Stadt augenscheinlich und wenn das Land nicht in den nächsten Jahren durch einen feindlichen Einfall der Zulu-Matabele leidet, wird es wie früher seinen Vorrang unter den Eingebornenreichen im Innern Süd-Afrika's erringen. Für den Weißen, sei er Forscher, Händler oder Jäger, war es von jeher ein Ort von höchster Wichtigkeit und wird es auch bleiben, und zwar aus folgenden Gründen:
In die vier südlichen Betschuana-Königreiche führen drei Wege: vom West-Griaqualande, vom Oranje-Freistaate und dem Transvaalstaate; diese vereinigen sich nach Norden zu in der Stadt Schoschong und von hier verzweigt sich wieder die Route nach Norden zum Zambesi, nach Nordosten zu dem Matabele- und Maschona-Lande, und nach dem Gebiete der westlichen (Ngami-See) Bamangwato und endlich zum Damaralande nach Nordwesten, so daß ein Besuch dieser Länder oder des nördlichen Theiles Süd-Afrika's, sowie das Vordringen nach Central-Afrika vom Süden her, von der Aufnahme der Weißen von Seite des Königs Khama, des Sohnes Sekhomo's, abhängt.
Das erwähnte Hauptthal in dem Hochlande der Bamangwato ist 4-6 englische Meilen breit, mit Gras und Büschen bewachsen, ein Theil ist cultivirt und an der Vereinigung mit der Schoschong-Schlucht erblickt das Auge des Reisenden einige hundert dunkelgraue, kegelförmige Strohdächer, welche die niedrigen cylindrischen, etwa 2 Meter hohen und 3-3½ Meter im Durchmesser enthaltenden Hütten bedecken. Hie und da ist eines von den rauhen, dunkelgrünen Blättern der Kalebaß-Kürbisse überrankt.
Bevor wir jedoch aus Süden kommend die Stadt betreten, finden wir etwa 600 Schritte vor derselben das aus drei Gehöften und fünf einzeln stehenden, theils im Style der Bamangwatohütten, doch größtentheils im europäischen Style aus gebrannten Ziegelsteinen erbauten und mit Giebeldächern versehenen Häusern bestehende, »weiße oder Händler-Viertel«, in dem englische Händler einen Theil des Jahres wohnen, um mit den Eingebornen zu verkehren, und auch, wie es früher der Fall war, um den in das Innere ziehenden Jägern die nöthigen Bedürfnisse vorzustrecken, welche Darlehen von den Jägern nach ihrer Rückkehr mit Elfenbein und Straußenfedern zurückerstattet wurden. Das wichtigste Handels-Etablissement war das der Herren Francis und Clark, welche jedoch wie alle Binnenhändler in den letzten Jahren große Verluste erlitten. Bisher verwehrte es der König den Weißen, sich an Ort und Stelle ein Grundstück käuflich zu erwerben, er überließ ihnen jedoch während der Zeit ihres Aufenthaltes dasselbe unentgeltlich. Nachdem wir die zerstreuten Gehöfte der Weißen passirt, um zu dem Labyrinthe der Betschuanahütten zu gelangen, betraten wir die Stadt, in der mir zahllose verlassene Gehöfte auffielen. An einigen wurden Verbesserungen vorgenommen. Hier sahen wir Frauen mit Hilfe der bloßen Hand die in den Boden etwa einen Fuß tief eingerammten, armdicken, knorrigen und mit Grasstricken aneinander befestigten, eine cylindrische, fünf bis sechs Fuß hohe Wand bildenden Pfähle überschmieren. Das Material hiezu bereiten einige Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, welche bis auf eine etwa handbreite, aus Glasperlen oder Sternchenschnüren gearbeitete Schürze jeder Bekleidung entbehrend, in einer mäßigen Vertiefung den rothen Lehmboden unter einem monotonen Gesange stampfen, was ihnen ebenso Freude bereitet, wie es den Müttern das notwendige Baumaterial verschafft. Eine alte Frau, die mit ihren dünnen Gliedern und der vertrockneten, pergamentartigen Haut mehr einer wandelnden Mumie ähnelt und in ihrem Aussehen der Sorgfalt ihrer Kinder kein gutes Zeugniß gibt, sitzt nahe an der Grube und schüttet langsam aus den an sie herangestellten Töpfen dem Anwurfsmateriale Wasser zu. Dort klettern wieder einige Frauen auf den eben mit frischgetrockneten und in Bündelchen angelegten, grasbedeckten Dächern herum, um sie theilweise zu glätten, die widerspenstig hervorragenden Halme herauszuziehen, andere das Dach mit dünnen Grasschnüren der Länge und Breite nach zu überziehen. An den Pfaden, in den Höfchen, doch meistens am Zaune, haben sich neugierige Frauen postirt, die ihre Säuglinge auf dem Arm und überdies noch einen Haufen kleiner, nackter Kinder um sich geschaart, lachend den fremden Makoa (Weißen) anstaunen und ihre Meinungen über denselben austauschen. Der Hals ist mit zahllosen, dunkelblauen großen Glasperlen, die in Schnüren aneinander gereiht sind, bedeckt, die Brust entblößt—blos hie und da bedeckt ein Cattunröckchen und ein Wolltuch (meist roth und schwarz carrirt) den Körper, der Unterkörper ist meist mit einer bis an die Knie oder bis zu den Knöcheln reichenden Carosse verhüllt. Nach einer Stunde haben wir uns aus dem Labyrinthe herausgearbeitet und treten in die eigentliche Schlucht ein, die etwa 400 Schritte breit, sich nach 1000 Schritten allmälig zu einem Felsenthore einengt. Wenn wir gegen dasselbe hinblicken, so scheint es, als wenn hier die Schlucht ihren Abschluß finden möchte; dem ist aber nicht so, es ist nur die westliche steile Wand der Felsenenge, welche in ihrer Wendung nach Osten sich bis an die von zerrissenen Felsblöcken (der sogenannten Affenburg) gekrönte Ostwand vorschiebt; wie die Geschichte der Stadt es beweist, ist diese Felsenge für den Besitz derselben von der größten Wichtigkeit.
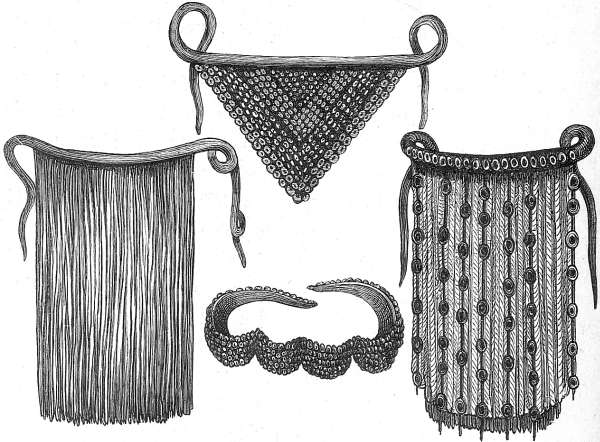
[Frauenschürzen der Bamangwato's.]
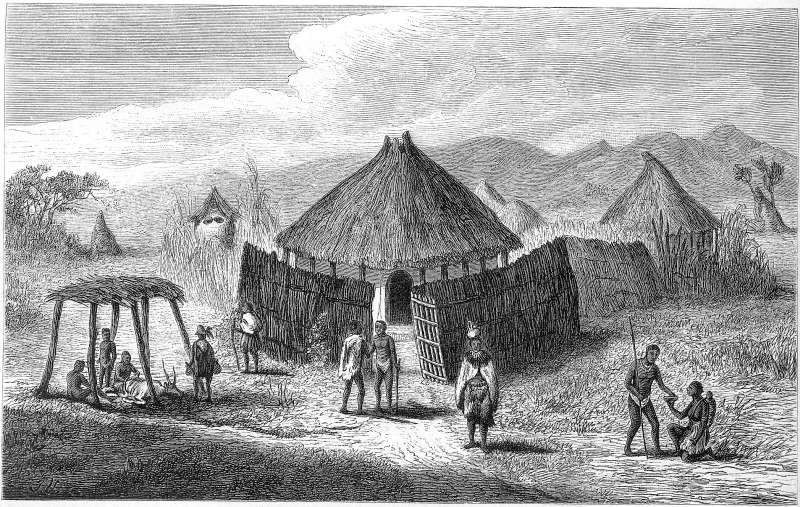
[Bamangwatohütten in Schoschong.]
Auf unserem Wege durch die Schlucht, nach den vor diesem Felsenthore je an einem Abhange erbauten steinernen Missionsgebäuden, sehen wir den zur Rechten durch drei Häusergruppen gebildeten mittleren Stadttheil, während der hintere eine halbe Stunde jenseits der Felsenenge in einem Felsenbecken erbaut ist.
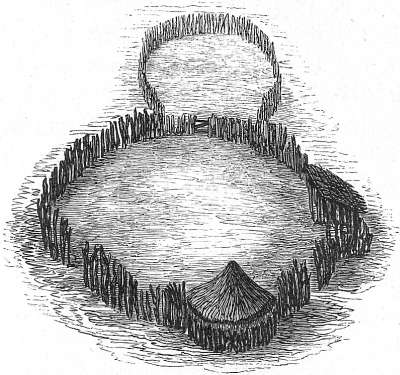
[Kotla in Schoschong.]
An der steilen Berglehne zur Linken (unbedeutend hoch über dem Flußbette) sieht man Ruinen eines europäischen Häuschens, es sind die Ueberreste der Hermannsburger Missionskirche, die nach dem Scheiden der Hermannsburger Mission von Schoschong, wo sie der Londoner Missions-Gesellschaft Raum machte, verfiel, bis sie in einem der Kämpfe als ein Bollwerk benützt, und bis auf die lehmigen Mauern zerstört wurde.
Das Missionsgebäude an der rechten Felsenwand ist wohnlicher und stellt ein großes Gehöfte dar, in dem sich auch die Schule und die Wohnungen für die verheirateten, schwarzen Seminaristen und die Kirche befinden. Zur Zeit meines ersten Besuches in Schoschong wohnte hier als Prediger einer der edelsten Männer, die ich in Afrika kennen gelernt, Rev. Mackenzie, der seit 1876 mit dem Seminar nach Kuruman übersiedelte. Seine Stelle wurde nicht ersetzt, in dem anderen Hause wohnt bis heute noch Rev. Hephrun.

[Bamangwatohaus.]
Von dem Herrn des Hauses freundlichst aufgenommen, wurden wir von seiner Frau Gemahlin mit einer Tasse Thee und einer Brotschnitte bewirthet und brachen sodann in seiner Begleitung wieder nach der Stadt auf, um den König, der schon in der Kotla Platz genommen, zu begrüßen. Aus dem engen Felsenthore, unter der vorerwähnten Affenburg strömt ein förmlicher Zug von Frauen, manche wieder lenken in die Schlucht ein—andere kommen von den im mittleren Drittel der Schlucht entspringenden Quellen, um Wasser zu holen oder eilen zu ihnen hin. Sie haben die rauhgar gegerbten Felle, Carossen (mit den Haaren nach innen) toga-artig um den Leib geschlungen; die Rechte hängt heraus oder hält das am Kopfe getragene Thongefäß. Sie verstehen sich darauf, diese irdenen, wenn auch noch so schweren Töpfe über den sehr steinigen Weg hin, sehr gut zu balanciren. Die Carossen sind reichlich mit einfachen aus Glasperlen und Riemchen verfertigten Zierraten geschmückt, die Waden mit Wadenringen (Glasperlen und Messingdraht) bedeckt, die Unterschenkelbildung vollkommen verunstaltend und verhüllend.
Auf unserem Wege nach des Königs Hütten, welche um die Kotla, d.h. den Berathungsplatz der conservativen Betschuana's, erbaut sind, haben wir Gelegenheit zu beobachten, wie freundlich unser Begleiter von Alt und Jung von den Vorübergehenden mit »Rumela« oder einem Hutlüften gegrüßt wird. Die Kotla ist ein kreisförmiger, von 10 bis 30 Centimeter im Durchmesser starken Baumstämmen umfriedeter, ebener Raum, welcher nach Süden einen Ausgang in eine kleinere Umfriedung und nach Norden einen Eingang hat. Die zweite Einfriedung ist des Königs Rindviehkraal, d.h. eine Umzäunung, in welcher die Milchkühe oder Schlachtthiere zur Nachtzeit untergebracht werden, während die Pferde in der Kotla übernachten können. Der Eingang zu diesen beiden Räumen wird in der Nacht mit Holzpfählen geschlossen. Zur Kriegszeit wird Nachts in der Kotla ein hellloderndes Feuer unterhalten.
Schoschong, früher der Sitz eines Hermannsburger Missionärs, ist gegenwärtig eine Station der London Missionary Society. Zur Zeit meines ersten Besuches (1874) standen derselben Rev. J. Mackenzie (der Autor des Werkes »Ten Years north of the Orange-River«) und Hephrun vor. Ihre Amtsbrüder in Molopolole hatten mir die Post für Schoschong mit auf den Weg gegeben, und mich damit an Rev. Mackenzie gewiesen. Seine freundliche Aufnahme, sein höchst freundliches und anspruchsloses Betragen während meines ersten Aufenthaltes in Schoschong, seine freundschaftliche Zuvorkommenheit während meines zweiten Besuches und seine wahrhaft brüderliche Sorgfalt, die er mir angedeihen ließ, als ich mittellos und krank von der dritten Reise zurückkehrte, haben mich oft alle Müh- und Drangsale meiner Laufbahn vergessen lassen, mich mit innerstem Danke gegen diesen wahren Apostel des Friedens erfüllt und mich seinen anhänglichsten und wärmsten Freund werden lassen. Ich erfülle eine der angenehmsten Pflichten, indem ich auch an dieser Stelle meinem Dankgefühle Ausdruck gebe.
Rev. John Mackenzie, ein Ehrenmann im vollsten Sinne des Wortes, bekleidete als Missionär in Schoschong angesichts der steten Kämpfe in der königlichen Familie der östlichen Bamangwato eine der schwierigsten Stellen in Süd-Afrika, doch wie geschaffen für den Posten wirkte er mit der größten Umsicht als Vermittler zwischen den einzelnen Parteien; mit seltener Klugheit und tiefem Mitgefühl für das Edle und Gute begabt, wußte er jeden Conflict zwischen den einzelnen Stämmen in Güte zu schlichten und den Sinn für Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu wecken. Wenn heute Khama, der Sohn Sekhomo's, als der beste Herrscher unter den Eingebogen Süd-Afrika's anerkannt wird, so ist dies das Werk Rev. Mackenzie's. Ich verdanke ihm vielfache Aufklärungen und Mittheilungen über die Geschichte und die Gebräuche der Betschuana's, deren Treue ich in mehrfacher Hinsicht durch eigene, spätere Forschungen bestätigt fand.
Ich lagerte mit meinem Wagen am Südostende der Stadt und war bald von einem Haufen Neugieriger umringt. Da es Herr Mackenzie für angezeigt hielt, baldigst Sekhomo's, des Königs, Bekanntschaft zu machen, so begab er sich mit mir zu ihm und bald saßen wir dem alten Manne auf kleinen Stühlen in der Kotla gegenüber. Von seiner bettelhaften Zudringlichkeit abgesehen, konnte ich mich während meines kurzen Aufenthaltes in Schoschong über Sekhomo's Betragen nicht beklagen. Mehr als von Mittelgröße, etwas beleibt, unterschied er sich durch nichts von den Umsitzenden, sein Auftreten ließ den Beherrscher eines so großen Gebietes kaum vermuthen. Ein kleiner Lederlappen war um seine Lenden geschlungen, ein Ledermäntelchen hing um die Schultern. Dieses ist in der Regel bei den östlichen Bamangwato's aus Hartebeest-Fell gearbeitet, bis auf fünf Stellen (siehe die Illustration) glattgar gegerbt, mit einem aus dem Felle der Säbelantilope geschnittenen schwarzen Ringe (oder zuweilen ohne denselben) nahe an der unteren Ecke verziert und oben am Halsrande mit aus Glasperlen etc. gearbeiteten Verzierungen behangen. Nach einigen gewechselten und durch Herrn Mackenzie verdolmetschten Phrasen schied ich aus der Kotla, um meinen Besuch nächsten Tages zu wiederholen.
Ich will nun, bevor ich zu meinem persönlichen Verkehr mit Sekhomo und seinen Bamangwato's übergehe, einige wichtige Episoden aus der Geschichte des Bamangwato-Reiches anführen.
Nach den von meinem Freunde Mackenzie gesammelten Traditionen stammen die Bamangwato von den Banquaketse ab. Wie schon erwähnt, theilten sich die Baharutse in mehrere Unterabtheilungen und wanderten von den gemeinsamen Stammsitzen aus; eine dieser Unterabtheilungen theilte sich später wieder in zwei Stämme, die Banquaketse und die Bakwena, von welchem ersteren endlich die Bamangwato's sich als der schwächere Theil loslösten und die Gebiete nördlich der Bakwena's bis an den Zambesi und Tschobe besetzten. Zur Zeit Matipis, des Urgroßvaters Sekhomo's, fand eine neuerliche Theilung der Bamangwato's statt, welcher die beiden Bamangwato-Reiche (das westliche am Ngami-See und das östliche zu Schoschong) ihre Existenz verdanken.
Der Stifter des ersteren war Towane, der jüngere der beiden Söhne Matipi's, Khama blieb in den Bamangwato-Höhen. Towane behandelte den mit ihm ziehenden greisen Vater so schlecht, daß dieser wieder zu Khama seine Zuflucht nahm. Khama ließ ihn zwar im Lande, verbot ihm aber die Stadt zu betreten; über diesen schnöden Undank seiner beiden Söhne brach dem alten Manne das Herz und er nahm sich das Leben. Seine Grabstelle wird noch bis jetzt von den Bamangwato's in hohen Ehren gehalten.
Der Gerechtere unter den sieben Bamangwato-Herrschern, deren Namen uns die Tradition nennt, war Khari, von ihm heißt es, daß er muthig und kriegerisch war, klug, wenn er in der Kotla sprach, und milde mit den Makalahari, den Madenassana und Masarwa's, den Unterjochten im Reiche. Er war auch von den Nachbarvölkern so geachtet, daß viele, wie die Makalaka's und einige weiter östlich wohnende Maschona's an ihn freiwillig Tribut zahlten. Leider wird auch hier an den Betschuana-Fürsten der Historiker eine ihm so wohlbekannte Erscheinung zu beobachten haben. Der Mächtige, im eigenen Lande Hochgeehrte, bei den Nachbarn Geachtete und von seinen Feinden Gefürchtete wollte noch höher steigen. Dieser Versuch führte aber seinen Fall herbei. Einen der südlicheren kleineren Maschona-Häuptlinge angreifend, fiel er mit dem Kerne seiner Truppen in einen Hinterhalt, in dem er mit seinem Unterhäuptling den Tod fand, während die Bamangwato-Armee beinahe vollkommen aufgerieben wurde und in Folge dieser Niederlage im Lande allgemeine Anarchie einriß. Die Maschona's, welche die Kampfweise der Bamangwato kennen gelernt hatten, theilten ihre Armee in zwei Theile. Die jüngeren Regimenter (die jungen Soldaten) mußten den anrückenden Feinden entgegengehen und ihn angreifen, dann zurückweichen, die Flucht fingiren, während inzwischen die alten Regimenter die feindliche Armee nach Zulu-Art zu umzingeln hatten. Der Plan gelang vollständig. Die angreifenden Maschona's nahmen Reißaus, kehrten sich jedoch gegen ihre Verfolger und stachen sie nieder, während die Hauptmacht der Ersteren Khari und sein Gefolge, die sorglos der scheinbar siegenden Vorhut folgten, angriff und niedermetzelte. Die in der Hauptstadt des Landes und hie und da im Lande zurückgebliebenen Häuptlinge hoben nun die Söhne des Khari auf den Schild; bevor es indeß noch zum Bürgerkriege kam, wurde das Land von dem aus den Oranje-River-Gegenden ausgewanderten und von Sebituane angeführten Basutostamme der »Makololo« besetzt, während die Hinterbliebenen des Königs als Gefangene nach Norden mitgeschleppt wurden, wohin die Makololo's zogen, um sich am Tschobe eine neue Heimat zu gründen. Im südlichen Theile des Mababifeldes gelang es den Gefangenen zu entfliehen und Sekhomo, der älteste Sohn Khari's, obwohl nach dem Gesetze von der Thronfolge ausgeschlossen, da er nicht ein Kind des ersten Weibes seines Vaters war, durcheilte das Land, um die Zerstreuten zu sammeln und sich Vasallen zu sichern. In einem der folgenden Kämpfe mit den Makololo's gelang es ihm nicht nur den Angriff derselben erfolgreich abzuwehren, sondern auch ein Reservecorps der Makololo's in einem Engpasse der Bamangwato-Höhen (Unicornpaß) vollkommen aufzureiben. Dieser Sieg gewann ihm die Unterstützung der meisten Häuptlinge des Landes. Der eigentliche Thronerbe und Stiefbruder ward auf sein Anstiften von den Letzteren getödtet. Sein Bruder Matscheng wurde von der Königin (seiner Mutter) durch Flucht vor einem ähnlichen Schicksale bewahrt.
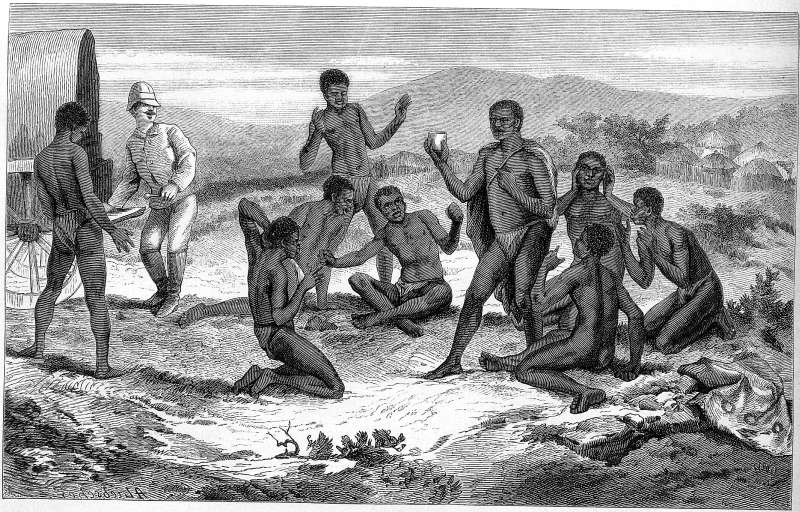
[Sekhomo und sein Rath.]
Der Sieg der Bamangwato's über die Makololo's blieb nicht lange vereinzelt, bald waren sie so erstarkt, daß sie auch den Matabele-Zulu's erfolgreich Widerstand leisten konnten, welche seit 30 Jahren jährlich nach den Betschuanaländern kamen, um zu morden, zu plündern und zu rauben. Ja es gelang ihnen sogar, den Matabele das geraubte Vieh abzujagen und viele derselben niederzumachen. Dieser Waffenerfolg der Bamangwato schüchterte den Matabele-König Moselikatse etwas ein und hatte zur Folge, daß die östlichen Bamangwato längere Zeit von den Belästigungen der Matabele verschont blieben. Ein späterer Versuch Moselikatse's einen Raubzug nach dem Lande der Bamangwato zu unternehmen, hatte ein klägliches Ende. Moselikatse sandte 40 Zulukrieger zu Sekhomo ab, um von ihm Tribut zu fordern. Sekhomo ließ die Seinen sich heimlich rüsten und die Abgesandten niedermetzeln. Seit diesem Vorfalle wagte es Moselikatse 20 Jahre hindurch nicht, die Bamangwato's zu beunruhigen, so daß diese sogar ihre Viehheerden bis gegen den Matliutse vorschoben. Im März 1862 jedoch erneuerte er, durch einen zu ihm geflüchteten Bamangwato-Unterhäuptling, Kirekilwe, dazu bewogen, den Angriff. Die am Matliutse und Serule Vieh hütenden Makalahari wurden getödtet, ein Dorf der Maschwapong in den östlichen Bamangwato-Höhen zerstört. Nur zwei Männer konnten als Ueberlebende des Dorfes die Nachricht nach Schoschong (der von Sekhomo gewählten Residenz) bringen. Seine Söhne Khama und Khamane brachen nun auf, um diesen Einfall zu rächen; sie griffen die Matabele an, schlugen zwei Haufen zurück, wurden jedoch von einem dritten, der auf einem Raubzuge begriffen, durch das Schießen angelockt wurde, im Rücken angegriffen und hatten Mühe, nachdem sie etwa 40 Matabele getödtet und dabei 20 der Ihrigen verloren, Schoschong wieder zu gewinnen.
Die Matabele kamen nur bis in das Franz Josef-Thal und näherten sich den die Schoschon-Schlucht und Schoschong beherrschenden und von den Bamangwato's vertheidigten Höhen bis auf Schußweite. Sie zerstörten die Felder und da sie aus guten Gründen das Eindringen in die Schlucht vermeiden wollten, machten sie mehrere, jedoch erfolglose, Versuche, die Bamangwato's zum Kampfe in der Ebene zu verleiten. Sie verließen endlich das Franz Josef-Thal und zogen heim, die geraubten Heerden mit sich führend, die ihnen Sekhomo indeß zwei Wochen später wieder abjagte.
Seit diesen Erfolgen mehrte sich das Ansehen der Bamangwato, da die Matabele als die tapfersten Krieger angesehen wurden; aus dem Matabelelande kamen Makalaka, Batalowta, Mapaleng, Maownatlala und Baharutse als Flüchtlinge und baten um die Erlaubniß, sich an den Bamangwato-Höhen niederlassen zu dürfen. Ich erwähnte, daß der Stiefbruder Sekhomo's, Matscheng, mit seiner Mutter zu den Bakwena's geflohen war. Hier wurde er von den auf einem Raubzuge befindlichen Matabele's gefangen, doch befreit, fiel aber bei dem nächsten Raubzuge denselben Matabele's wieder in die Hände und wurde von diesen als gemeiner Soldat »Le-chaga« aufgezogen.
Seschele, der schon längst seine angeblichen Anrechte auf die Bamangwato's (da sie von den Banquaketse's abstammten) geltend machen wollte, sich jedoch offen aufzutreten zu schwach fühlte, suchte im Geheimen die Bamangwato's für Matscheng, ihren rechtmäßigen Herrscher zu gewinnen, was ihm auch theilweise gelang. Durch Dr. Mossat's Einfluß wurde der Gefangene im Matabeleland freigelassen und von Seschele mit Pomp empfangen, was diesem in Schoschong zu solchem Ansehen verhalf, daß er als sich Tschukuru (nächst Sekhomo der erste Mann im Lande) für ihn erklärte, als König in Schoschong einziehen konnte. Seschele wurde für seine Hilfe mit Elfenbein und Straußenfedern bezahlt.
Sekhomo flüchtete nun zu Seschele, wo er mit offenen Armen aufgenommen wurde. Matscheng behauptete sich jedoch nicht lange in Schoschong; er war als Matabele-Krieger aufgezogen worden und wollte den Despotismus derselben unter den conservativen Bamangwato's einführen, die von ihm begangenen Uebergriffe und Grausamkeiten kosteten ihm bald den Thron. Tschukuru war der erste, der sich gegen ihn auflehnte und mit Seschele's Hilfe, Sekhomo wieder auf den Thron brachte. Der flüchtige Matscheng aber wurde wieder von Seschele auf das Freundlichste aufgenommen. Dies geschah im Jahre 1859, also vor dem letzterwähnten Angriffe der Matabele auf die Bamangwato.
Von Interesse ist es vielleicht zu hören, daß, obgleich Matscheng als Stiefbruder Sekhomo's, Khari's Sohn genannt wurde, er thatsächlich nicht dessen Sohn war. Seine Mutter war die erklärte Königin und deshalb war Matscheng, obwohl einige Jahre nach Khari's Tode geboren, legal, während Sekhomo, obwohl Khari's Sohn, aber von einem Weibe zweiten Ranges geboren, als illegal angesehen wurde.
Im Jahre 1864 vereitelte Sekhomo den bereits erwähnten Angriff Seschele's auf Schoschong. Als im Jahre 1865 die Boguera in Schoschong gefeiert wurde und Sekhomo seine beiden Söhne, Khama und Khamane, nicht unter den »gestellten« Knaben und Jünglingen gewahrte, wurde der König so wüthend, daß er dieselben ein volles Jahr durch Moloi's »bezaubern« ließ, allein mit keinem anderen Erfolge, als beiden die Sympathien der jungen Regimenter zuzuwenden.
Der Haß Sekhomo's mehrte sich noch, als Khama, ein Schwiegersohn Tschukuru's, sein ihm von dem Prediger angetrautes Weib der Boguera nicht unterwerfen wollte, was Sekhomo den alten Gebräuchen gemäß forderte, wenn sie von Rechtswegen Königin werden sollte. Sekhomo wollte heimlich Tschukuru tödten; unter den Bamangwato's wagte er es jedoch nicht, die Mörder zu suchen und auch von den Matabele-Flüchtlingen wollte keiner die That auf sich nehmen. Im Jahre darauf, nachdem Sekhomo durch alle möglichen Mittel, Ueberredungen und Abschreckungen seinen Söhnen viele Freunde abwendig gemacht zu haben glaubte, unternahm er während einer Nacht einen Angriff auf die Hütten der Beiden. Er ließ heimlich seine Getreuesten versammeln und hieß sie auf die Hütten seiner Söhne losfeuern. Da jedoch Keiner dem Befehle Folge leisten wollte, legte er selbst an, doch wurde ihm das Gewehr aus der Hand geschlagen. Vergeltung befürchtend floh er nun zu seiner Mutter, doch seine Söhne verziehen ihm nicht allein, sondern setzten ihn wieder unter der Bedingung als König ein, daß er gegen sie und die christliche Gemeinde kein neues Attentat versuchen dürfe. Sekhomo versprach es, doch sein Charakter war nicht darnach, einer neuen Versuchung, die Verhaßten verderben zu können, aus dem Wege zu gehen.
Schon kurze Zeit darauf sandte er zu Seschele, lud Matscheng zu sich, um sich mit diesem gegen seine Söhne zu verbinden. Im März desselben Jahres brachte Sekhomo einen zweiten Anschlag gegen seine Söhne zur Ausführung, diesmal gelang es ihm namentlich durch Versprechungen viele der Bamangwato's zu gewinnen, so daß Khama und Khamane mit ihrem Anhang sich auf die Berge flüchten mußten, nachdem sie eine Belagerung in der zerfallenen Kirche der Hermannsburger Mission ausgehalten hatten. Als nach vierwöchentlichem Kampfe Sekhomo noch immer kein Resultat sah, sandte er um Makalahari und die Makalaka erstürmten die Tafelfläche der Höhe und belagerten von hier aus die auf dem, von der Tafelfläche emporsteigenden isolirten Felsenhügel sich verteidigenden Söhne. Nach achttägiger Belagerung ergab sich Khama mit seinem Anhange aus Wassermangel auf Gnade und Ungnade, ohne jedoch persönlich zum Heidenthume zurückzukehren. Sekhomo schenkte wohl seinem Sohne das Leben, nicht aber seinen Getreuen, sie mußten alle fliehen, und viele, darunter auch Tschukuru, wurden getötet.
Schon im Monat Mai erschien Matscheng in Schoschong um abermals sein Recht zu fordern. Khama und Khamane erklärten sich offen gegen den Prätendenten, ohne jedoch zu den Waffen zu greifen. Sekhomo wurde jedoch zuerst seines »Stiefbruders« überdrüssig und sann auf neue List. Er berief eine öffentliche Versammlung ein, wozu Matscheng und seine Söhne geladen waren, er wollte diese zuerst in die Kotla eintreten und selbe dann umzingeln lassen, um sich so mit einem Schlage von allen seinen Gegnern zu befreien. Allein wie immer erfuhr Khama diesen Anschlag und warnte Matscheng; am Versammlungstage wußten es die Geladenen so einzurichten, daß sie die Letzten in die Kotla eintraten. Da sann Sekhomo einen neuen Plan, doch die Seinen ließen ihn wieder im Stiche und er mußte fliehen. Matscheng ward nun zum zweiten Male erklärter Herrscher der Bamangwato's.
Sekhomo flüchtete sich zu den Manupi, im Lande der Banquaketse, dann zu den Makhosi, wurde jedoch von hier auf Seschele's Befehl ausgetrieben und floh zu Chatsitsive nach Kanja. Kaum fühlte sich jedoch Matscheng alleiniger Herrscher der östlichen Bamangwato, so verfiel er in seine alten Gelüste und benahm sich wie ein Zulu-Usurpator. Den Einfluß und die steigende Macht Khama's und seines Anhanges trachtete er bei dem Volke durch die Erklärung zu untergraben, daß die Kirche eine dem Staate feindliche Gewalt sei und versuchte das religiöse Pflichtgefühl der christlichen Gemeinde auf jede Art zu verletzen. Der offene Ungehorsam, der seinen diesbezüglichen Befehlen entgegengesetzt wurde, bestärkte Matscheng in seinem Streben, sich Khama's zu entledigen. Da dies mit Waffengewalt nicht gut möglich war, blieb kein anderer Ausweg übrig, als die Moloi's herbeizuziehen; doch all' ihre anstrengende Arbeit blieb wirkungslos, ebenso erfolglos war Matschengs Bestreben, zu diesem Zwecke von einem weißen Händler Gift zu erhalten.
Matschengs Herrlichkeit nahm ein schnelles Ende. Während eines Besuches bei Chatsitsive im Banquaketseland traf Khama den König Seschele, welcher ihm Hilfstruppen lieferte, um Matscheng aus Schoschong zu vertreiben. In einer im Franz Josef-Thale an der Mündung der Schoschonger Schlucht gelieferten Schlacht, welche auch in taktischer Hinsieht dadurch an Bedeutung gewann, daß die unter Kuruman, dem Sohne Moselikatse's, Führung stehenden Matabele's, die Verbündeten Matschengs, zu Pferde fochten, wurde dieser geschlagen. Khama, der diesen Angriff voraus sah, hatte seine in früheren Kämpfen erprobten Schützen als Tiralleurs vorrücken und hinter kleinen Büschen Posto fassen lassen und dadurch die berittenen Matabele zur zerstreuten Fechtart gezwungen, in welcher sie gegen die gedeckt stehenden Schützen nicht aufkommen konnten. Noch während der Schlacht fiel Kuruman von Matscheng ab und trat den Rückzug nach dem Rustenburger District an. Matscheng und seine Leute flohen in regelloser Flucht, nachdem sie das Haus des Händlers Drake geplündert hatten.
Seit jener Zeit ließ sich der nach den Landesgesetzen rechtmäßige, doch allgemein durch seine Handlungsweise verhaßte Herrscher der östlichen Bamangwato nicht mehr in Schoschong blicken und zog zunächst nach den Maschwapong-Höhen am mittleren Laufe des Limpopo (im östlichen Bamangwatolande) und von Khamane aus diesem Zufluchtsorte vertrieben später nach dem Mabolo-Gebirge. Nach der Vertreibung Matschengs wurde Khama der erklärte König der östlichen Bamangwato, und es schien, als ob nun nach so vielen Fehden und nachdem die beiden Haupt-Unruhestifter Matscheng und Sekhomo außer Land waren, Friede in demselben herrschen sollte. Doch das gute, kindliche Herz Khama's brachte es trotz aller bitteren Erfahrungen nicht über sich, Sekhomo in der Verbannung zu lassen; unter dem Versprechen Frieden zu halten, rief er ihn nach Schoschong zurück. Doch es währte nicht lange und Sekhomo begann neuerdings zu wühlen; zunächst versuchte er seine beiden Söhne Khama und Khamane zu entzweien, indem er das Matscheng abgenommene Vieh sowie ein Dorf der Manansa, die im Albertslande (dem Höhenlande südlich von den Victoriafällen) wohnten, Khamane zusprach. Leider ließ sich Khamane verleiten; in der Hoffnung, einst den Thron zu besteigen, blieb er gegen Khama's und die Vorstellungen meines Freundes Mackenzie taub, der eine Verständigung zwischen den beiden Brüdern und dauernden Frieden im Lande herbeiführen wollte.
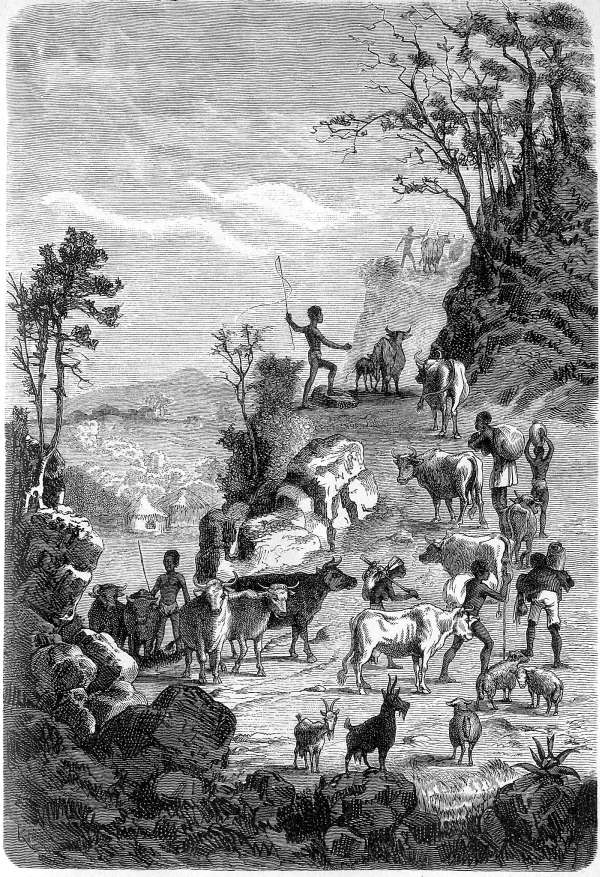
[Flucht auf die Berge.]
Khama wanderte hierauf mit dem größten Theile der Schoschonger Bevölkerung aus, ließ sich im Gebiete der westlichen Bamangwato am Zuga-River nieder und erwarb sich hier unter den Batowana's große Achtung und Zuneigung. Doch seine Leute wurden durch die Fieber am Zuga-River decimirt und so blieb Khama nichts übrig, als an die Rückkehr zu denken. Dies war der Zustand der Dinge, als ich in Schoschong anlangte.
Meine nächste Sorge nach unserer Ankunft in Schoschong war die Ergänzung meines Proviants, der bereits bedenklich zur Neige ging; es ging dies schwerer als ich dachte, und nur durch die freundliche Vermittlung Rev. Mackenzie's gelang es mir, den dringenden Bedarf zu decken. Aus eben diesem Grunde mußte ich auf die Ausführung meines Wunsches verzichten, bis zum Zuga oder Botletle vorzudringen.
Schon am 9. stattete mir Sekhomo den ersten Gegenbesuch ab und ich hatte anfangs das Vergnügen, das sich bald in eine Plage umwandelte, den König mit seinen Linjaka's, die wir aus näher zu erläuternden Gründen den Aasvogel-Rath nannten, täglich ein bis zweimal bei uns zu sehen. Der König schüttelte mir stets die Hand, während unterdessen sein holländisch redendes Factotum diese oder jene Bettelei vorbrachte. Er stand in der Regel mit eingestemmten Armen vor mir, während der Rath in einem Halbkreise um ihn herumhockte und seine Geberden nachahmte. Lachte er, lachten die Aasvögel mit, eines Tages verbrannte er sich die Lippen an dem heißen Thee, den ich ihm anbot, auch diesmal beeilte sich der versammelte Rath, die Gesichter zu verziehen und ihrem Bedauern Ausdruck zu geben; gähnte seine Majestät, so blieben die alten Getreuen mit ihrer Beisteuer nicht zurück und macht er sich auf den Heimweg, so erhob sich einer nach dem andern, um dem König im Gänsemarsch zu folgen.
Am 11. wurde ich auf einen vorüberfahrenden holländischen Jäger, Namens Franz Vissasi, aufmerksam, der mit seiner Familie von der Jagd aus den Zuga- und Mababi-Gegenden heimkehrte. Während seiner sechsmonatlichen Abwesenheit hatte er in diesen 21 Elephanten und 15 Strauße erlegt und theilte mir zwei interessante Löwenabenteuer mit, bei welchen sich sein kleiner Sohn recht heldenmütig betragen haben sollte; er nahm noch am selben Tage meine Hilfe in Anspruch, da drei seiner Kinder an Febris intermittens darniederlagen.
Sekhomo's direkte Einnahmen betrugen nach einer Mittheilung Rev. Mackenzie's 3000 £ St. und bestanden in Rindern, Elfenbein, Straußenfedern, Häuten und Carossen. Staatsausgaben waren unbekannt. Den freien Bamangwato's blieb der Ertrag ihrer Viehheerden, die minderwerthigen Straußenfedern, Thierfelle, sowie je ein Elfenbeinzahn von jenen Thieren, die sie selbst oder ihre Vasallen für sie erlegten.
Am 22. kamen zwei Boerwägen vom Marico-District an, welche verschiedene Victualien zum Verkaufe brachten. An den folgenden Tagen besuchte ich die Höhen, an denen ich einen Matabeleschädel fand und machte Ausflüge im Schoschonthal aufwärts, besuchte den am jenseitigen Ufer des Schoschon-Flüßchens sich erhebenden pittoresken Monkey-Felsen, den nächtlichen Sammelort der Paviane und bestieg einige der anliegenden Höhen. Da wo sich das Thal über dem Monkey-Felsen erweitert, lagen zwei Dörfer der hier als Flüchtlinge lebenden Makalaka's und eines der verlassenen Missionsgebäude des Hermannsburger Predigers Herrn Schukenberg. Ueber dem östlichen Dorf erhob sich ein isolirter Tafelberg, auf dessen Kuppe die Pferde während der Herbstpneumonie-Zeit mit gutem Erfolge gehalten wurden.
Unser Wagen war trotz des mit geringen Unterbrechungen herabströmenden Regens während der ganzen Dauer unseres Aufenthaltes stets von Besuchern und Arbeitern umlagert, es entwickelte sich ein reger Verkehr, der nur einmal durch einen kleinen Zwischenfall, den meine Zugthiere verschuldet hatten, unterbrochen wurde. Die allgemeine Friedensstimmung und gemächliche Ruhe der Bevölkerung wurde eines Tages plötzlich in unerwarteter Weise durch die Nachricht gestört, daß feindliche Matabele im Anzuge seien. Eine mir unerklärliche Panik ergriff nun die Bevölkerung; der König eilte zu mir und lieh sich eines meiner Gewehre aus—ich hatte die größte Mühe, es später wieder zu erlangen—er zeigte mir sein Palladium, ein aus einer Löwenklaue verfertigtes Amulet, das ihn kugelfest machen sollte, und ordnete die Flucht der Bamangwato's auf die Schoschong beherrschenden Höhen an. Die geringen Habseligkeiten eiligst zusammenraffend, die widerspenstigen Rinder- und Schafheerden vor sich hertreibend, floh Jung und Alt den Höhen zu. Die Bestürzung und Verwirrung erreichte den höchsten Grad, als einige Männer auf eine vor der Stadt aufgescheuchte Hyäne einige Schüsse abfeuerten, man wähnte die Matabele schon an den Fersen zu haben.
Tags darauf traf ein Boer-Jäger aus dem westlichen Matabelelande, ein Sohn des berühmten Elephantenjägers Pit Jacobs, der am Tatiflusse residirt, in Schoschong ein, der die Bevölkerung über die völlige Grundlosigkeit ihrer Aufregung aufklärte. Die Beschwichtigungen des Jägers fanden indeß keinen Glauben und selbst die Weißen (Händler) trafen Anstalten zu ihrem Schutze. Rev. Mackenzie rieth mir, baldigst abzureisen, da mir, wenn nicht persönlich, so doch meiner Habe Gefahr drohen konnte.
Als Sekhomo hörte, daß ich abreisen wollte, klagte er über den Schmerz, den ihm mein Entschluß bereite, nannte uns seine Freunde und bat uns, ihn in dieser Bedrängniß nicht zu verlassen. Ich gab ihm für eine seiner sieben Frauen ein blaues Wollkleid als Abschiedsgeschenk, das er mit einem Büschel grauer Straußenfedern erwiderte.
In keiner anderen der auf dieser Reise berührten Eingebornenstädte war es mir vergönnt, eine ähnliche Menge der mannigfachsten ethnographischen Objecte zu gewinnen, als eben hier; was ich noch an Gütern im Wagen hatte, tauschte ich leider zum sichtlichen Mißbehagen der hier ansässigen Händler für Arbeiten der Eingebornen aus. Ich erstand zahlreiche Assagaie, Schlachtbeile und einige Dolche und Messer, Kiri's und Stöcke, hölzerne Kopfpolster, Töpfe und Pfannen, hölzerne Löffel, aus verschiedenem Material gearbeitete Würfel (Zauber- und Doctorwerkzeuge), die verschiedenartigsten Schnupftabaksdosen, Kürbißgefäße, Toiletteartikel und Carosse-Verzierungen, Schürzen und Mützen, Puppen und aus Thon gearbeitete Spielsachen. Zu den wichtigsten von mir erworbenen Gegenständen gehörten Sekhomo's Regen- und Kriegstrommel, ein aus Elfenbein gearbeiteter kleiner Fetisch, Kiri's aus Rhinoceros-Horn etc., auch fehlten Pfeifen nicht. Ich tauschte viele Pallah- (Antilopen-) Leoparden-, Luchs-, Caracal-Felle etc. aus und ließ mir daraus gegen Bezahlung Carossen verfertigen. Bis auf kleine Unterscheidungs-Merkmale gleichen die Arbeiten der Bamangwato's denen aller übrigen Betschuanastämme. Die Bauart der Hütten gleicht der bei den Barolongen üblichen, die Hütten selbst sind nur kleiner und leichter gebaut, hingegen traf ich in ihrer Größe unübertroffene Korngefäße aus ungebranntem Thon. Nicht minder zahlreich als meine ethnographischen Acquisitionen waren die naturhistorischen.[1]
1 Unter den Eidechsen zeichnet sich eine schöne, metallisch in Braun, Dunkelgrün und Blau glänzende, leicht gestreifte, mitunter auch streifenlose Art durch ihre Häufigkeit und Zutraulichkeit aus.
Bevor ich auf die Schilderung meiner Rückreise nach den Diamantenfeldern eingehe, will ich die im vorigen Kapitel begonnenen Mittheilungen über Sitten und Gebräuche der Betschuana's zu Ende führen. Der gewöhnliche heidnische Betschuana besitzt in der Regel eine Frau, die wohlhabenderen zuweilen zwei, Unterhäuptlinge drei bis sechs, die Könige noch mehr, doch nicht so viele, als es im Marutse-Reiche Gebrauch ist. Der wohlhabende Mann macht der neu erworbenen Frau ein Geschenk von mehreren kleinen oder großen Hausthieren.
Beim Betreten einer Stadt hebt der Ankömmling die auf seinem Pfade liegenden Steine auf und wirft sie in einen dichten Busch oder legt sie in die Astgabelungen der Bäume, indem er den Wunsch ausspricht, er möge den Zweck seiner Reise erreichen. Das Fell, Horn und Fleisch eines geweihten Thieres—die Deukergazelle bei den Bamangwato's, das Krokodil bei den Bakwena's etc.—darf nicht berührt werden; eine auf der Hütte sitzende Eule wird als Unglücksbote angesehen und die Hilfe des Linjaka in Anspruch genommen, um die vom Vogel berührte Stelle zu reinigen.
Außerdem werden Thiere, welche zuweilen etwas nach Betschuana-Begriffen Ungewöhnliches begehen, als gefährlich und verderbenbringend angesehen und müssen getödtet oder durch einen Linjaka gereinigt werden. So wird z.B. eine auf das Dach springende Ziege mit dem Assagai durchbohrt. Peitscht ein Thier, eine Kuh, in einem Viehkraal längere Zeit hindurch mit dem Schweife den Boden, so ist sie keine gewöhnliche Kuh mehr, sie ist »Tiba«, eine Unheilbringende, welche dem Eigenthümer Schaden, Krankheit, sogar den Tod bringen kann. Ein Reicher tödtet ein solches Thier sofort, ein Armer bietet sie dem Weißen oder einem Nachbarstamme zum Kaufe an, es ist dies der einzige Fall, in welchem der Betschuana seine Milchkühe verkauft. Keinem Weib ist es gestattet, die Milchkühe und überhaupt das Rind zu berühren, dies ist Sache der Männer, der Knaben wie des Mannes und Greises, so auch das Hüten derselben, während es bei der Hottentottenfamilie gestattet ist, daß diese Hausthiere auch von den Frauen gehütet werden.
Wie ich bereits erwähnt, ist die Regierungsform unter den Betschuana's eine im gewissen Sinne constitutionelle; alle wichtigen Verfügungen und Beschlüsse müssen von dem Pitscho (der öffentlichen Versammlung) besprochen werden, doch sind in der Regel, namentlich da, wo der König die Häuptlinge beeinflußt, diesen oder jenen für sich zu gewinnen weiß—alle Beschlüsse eine im Vorhinein heimlich abgemachte Sache. Wie bei anderen Banthuvölkern ist auch bei den Betschuana's der König (Morena oder Koschi) der Oberste bei allen öffentlichen Functionen; unter ihm stehen die Unterhäuptlinge des eigenen Stammes oder die Flüchtlinge, die seinen Schutz angefleht, sowie die Häuptlinge anderer Betschuanastämme, welche die Erlaubniß erhalten hatten, sich auf seinem Gebiete niederzulassen, z.B. Chatsitsive und die Häuptlinge der Manupi und der westlichen Baharutse. Diese Häuptlinge und Unterhäuptlinge wohnen in eigenen Dörfern, die mehr oder minder von einander entfernt liegen, oft jedoch an einander grenzen und Theile der Residenz bilden. In jedem dieser Dörfchen ist nahe an dem Gehöfte des Häuptlings ein kleiner mit Pfählen umfriedeter, runder Raum, welcher die Stelle der Kotla vertritt, und in welchem die in der Kotla zur Sprache kommenden Gegenstände vorberathen werden. Beruft der König die Unterhäuptlinge und das Volk zu einer wichtigen Berathung, so legt der königliche Bote je einen Baumzweig in die kleinen Kotla's—es ist das Zeichen des Aufruf's.
Eine Berathung über Krieg wird im Plenum außerhalb der Stadt gehalten—um nicht so leicht wie in der Kotla belauscht zu werden, eine solche Zusammenkunft wird Letschulo genannt, ebenso wie die von den Linjaka's anläßlich der Regenbeschwörung veranstalteten Jagden. Bei diesen Berathungen, an welchen die Einwohner der einzelnen Dörfer sich unter der Führung ihrer Unterhäuptlinge betheiligen, wird sehr viel gesprochen, Kleinigkeiten bis zur Erschöpfung ventilirt und dem Redeschwall keine Zügel angelegt.
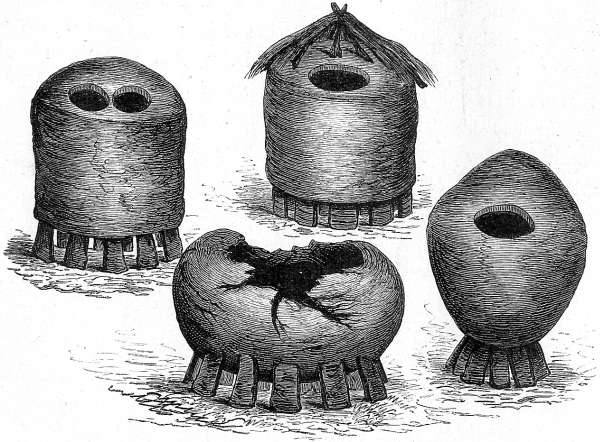
[Korngefäße der Bamangwato's.]
Hat sich die Versammlung als Gerichtsbehörde constituirt, so wird in der Regel darauf Rücksicht genommen, ob der Schuldige eine bei Hofe beliebte Person sei oder nicht, im ersteren Fall geht oft auch ein Mörder straflos aus. Hat Jemand sich eines Diebstahls schuldig gemacht, so eilt des Königs Bote durch die Stadt und verkündet denselben, sowie die königliche Androhung der über den Dieb verhängten Strafe. In der Regel wirkt die bloße Androhung und im Dunkel der Nacht beeilt sich der Dieb das gestohlene Gut auf einem öffentlichen Orte zu deponiren. Oft aber werden die Linjaka's zur Hilfe gerufen, um einen Dieb zu eruiren, sie benützen in solchen Fallen verschiedene Kunstgriffe oder werfen blos die Würfel, im ersteren Falle gelingt es ihnen zuweilen, den Dieb ausfindig zu machen. Eine oft gebrauchte List ist folgende: Nach eingehender Untersuchung des Falles werden die der That Verdächtigen durch des Königs Boten in die Kotla vorgeladen. Der Linjaka setzt sie in einem Kreise um sich und nachdem er bei den Worten »der die Kuh etc. gestohlen, muß noch heute sterben,« mehrmals im Kreise herumgegangen, läßt er einen Topf mit warmem Mais- oder Kornmehlbrei herbeibringen. Er schöpft nun einen Holzlöffel voll dieses Breies und spricht dazu. »Der Dieb, der diesen Brei verschlingt, wird noch heute sterben,« und wiederholt diese Worte, so oft er jedem der Umstehenden einen Löffel voll in den Mund schiebt.

[Staatskleid eines Bamangwato's.]
Nachdem er seine Arbeit gethan, beobachtet er Jeden genau, wirft dann die Elfenbeinwürfel und mit den Worten: »Ich habe den Dieb gefunden,« erhebt er sich, um den Kreis der Angeklagten zu umgehen. Er befiehlt hierauf Allen den Mund zu öffnen und siehe da, Alle bis auf Zwei haben den Brei geschluckt, diese Zwei jedoch, das sind die Diebe, die aus Furcht vor dem Tode den Brei im Munde behielten um ihn im günstigen Momente heimlich ausspeien zu können. Der eruirte Dieb muß doppelt bis vierfach das Gestohlene ersetzen. Einem wiederholt ertappten Diebe werden die Finger, einem unverbesserlichen Gewohnheitsdiebe die ganze Hand verbrüht. Der Mord wird in der Regel mit dem Tode bestraft, doch ist es auch zulässig, sieh durch ein Blutgeld von der Strafe loszukaufen, wobei die Gegenstände (Rinder etc.) welche der zuerkannten Geldstrafe gleichkommen, an die nächsten Angehörigen des Getödteten abzugeben sind.
Zur Zeit als noch Matscheng in Schoschong herrschte, ereignete sich der Fall, daß ein Mann aus Habsucht einen Brudermord beging. Sein alter Vater hatte dem älteren Bruder den größten Theil seines Besitzes gegeben, und da entschloß sich der Jüngere, sich einfach des Bruders zu entledigen, um das Ganze zu haben. »Bruder, hat Dir nicht der Vater erzählt, daß der Linjaka (Doctor) ein Affenfell braucht, um seinen Gliedern die Kraft wieder zu geben? Ich gehe heute auf jenen Hügel dort«—er wies auf den isolirten nahe der Stadt im Franz Josef-Thal sich erhebenden, felsigen Kegel—»um einen Affen zu schießen.« Der Angeredete hielt es für seine Pflicht mitzugehen und folgte dem Bruder. Am Fuße des eine Gehstunde entfernten Hügels, schlug der Antragsteller des sicheren Erfolges halber vor, die Jagd von zwei entgegengesetzten Seiten aus zu beginnen, worauf der ahnungslose Bruder auch einging. Eine alte Frau, welche unweit davon Beeren sammelte, und welcher das Betragen der beiden mit Gewehren Bewaffneten auffiel, schlich sich näher und folgte vorsichtig dem Einen derselben nach. Schon in der Mitte der Höhe kroch der Jüngere, statt geradeaus emporzusteigen, nach rechts um den Hügel, bis er seines Bruders ansichtig wurde und schoß ihn dann nieder. In der Stadt erzählte er mit großer Bestürzung, daß er seinen Bruder für einen Affen angesehen und getödtet habe, allein das alte Weib berichtete Matscheng den wahren Sachverhalt und statt in den Besitz des Erbes zu kommen, wurde der Schuldige auf Matschengs Befehl an den Thatort geführt und hier mit dem Gewehre des getödteten Bruders erschossen.
Unter den noch zu erwähnenden Gebräuchen gibt es solche, die uns an die alten mosaischen Gesetze erinnern und an die wir mehr oder weniger bei allen mir bekannten, zu der Banthufamilie gehörenden Stämmen lebhaft erinnert werden.[1] Vor Allem die Beschneidung (Circumcision); sie ist die wichtigste Ceremonie für den heidnischen Betschuana, ohne die der Jüngling von seinen Gefährten weder als Mann, noch die Frau als heiratsfähig anerkannt wird. Doch fällt diese Ceremonie nicht mit dem Stadium der Mannbarkeit zusammen—wie wir es bei anderen Stämmen, wie z.B. bei den Matongas und Maschukulumbe und deren Sitte des Zähneausbrechens beobachten—sie wird einfach ausgeübt, um die Reihe von Abhärtungen zu beginnen, die ein Knabe durchmachen muß, um einst, wenn er Mann geworden, auch den Titel eines Mona und Ra führen zu können. Die Ceremonie heißt Boguera und wird an den Knaben nach ihrem neunten Altersjahre ausgeführt. Je nach der Stärke des Stammes wird sie alle zwei bis fünf Jahre vorgenommen und bildet eine der größten Festlichkeiten in den Städten. Mit einer Kalklösung bestrichen, gehen um diese Zeit die dazu sich freiwillig meldenden oder gezwungenen Knaben einher, die Mädchen nur mit aus Schilfrohrstücken verfertigten Bändern oder Genettaschwanz-Schürzen bekleidet, auch sie werden auf der Brust und im Gesichte ähnlich wie die Knaben weiß übertüncht. Die Zeremonie wird außerhalb der Stadt bei den ersteren von alten Männern, bei den Mädchen von alten Frauen ausgeführt.
1 Ich verweise den Leser auf die zwei Sagen der nördlichen (Montsua's) Barolongen.
Da eben zur Zeit meines Besuches in Schoschong die Boguera gefeiert wurde, hatte ich Gelegenheit, die Zeremonie näher kennen zu lernen. Singend ziehen die Knaben und Mädchen, von den Gauklern begleitet vor die Stadt. Hier werden die Knaben im männlichen Auftreten, die Mädchen in weiblichen Arbeiten und Pflichten unterrichtet und ihnen sofort schwere Arbeiten, wie das Tragen großer Holzbündel, Wasserholen etc., auferlegt, bei deren Verrichtung sie meist einen monotonen Gesang anstimmen. In ihrer Uebertünchung und mit den klappernden Schilfrohrbändern behangen, gewähren diese Gestalten einen nicht minder phantastischen als komischen Anblick. Die Knaben werden partienweise in die Kotla berufen, wo sie gepeitscht werden. Wir finden hier zwei Reihen gegen einander mit dem Rücken stehender, bis auf ein sehr primitives Kleidungsstück nackter Knaben, welche in ihren Händen Sandalen halten und niederzuknieen haben, um von den vor ihnen stehenden Männern (in der Regel ihren nächsten Verwandten) auf den Rücken geschlagen zu werden. Sowie aber der Mann zum Schlagen ausholt, hebt der Knabe die Sandalen empor und die meisten verstanden es, die Wucht des Schlages mit den Sandalen zu brechen, oder den Schlag vollkommen damit aufzufangen. Dabei singen die Knaben und heben abwechselnd die Füße empor.
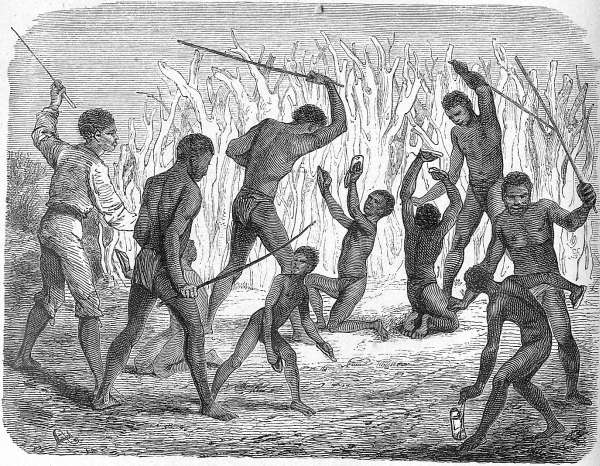
[Züchtigung der Knaben.]
Alle jene Knaben, die sich zur selben Zeit dieser Zeremonie unterziehen, werden in ein Regiment eingereiht, und desto größer ist der Stolz des heidnischen Betschuana, je mehr Söhne er zur Boguera mitbringen kann. Der Häuptling aber trachtet, daß auch er einen Sohn einstellen kann, oder wenigstens den eines seiner nächsten Verwandten, da dieser die Leitung dieses neu gebildeten, d.h. seines Regimentes übernimmt. Enge Freundschaft wird dann geschlossen und von ihr auch bei den zuweilen am Hofe auftauchenden Streitigkeiten guter Gebrauch gemacht. Diese Freundschaft bleibt selbst dann aufrecht erhalten, wenn der Sohn des Häuptlings, d.h. der Chef des Regiments, sich später taufen läßt. Die Mädchen dürfen nach der Ceremonie längere Zeit hindurch nicht schlafen, um sie wach zu erhalten, haben sie des Nachts auf den hölzernen Kornstampfblöcken (motso Chlobole) zu sitzen; da jedoch diese Stampfblöcke in der Regel so unförmlich gearbeitet sind, daß sie an und für sich kaum das Gleichgewicht halten können, fallen die darauf Sitzenden sofort nieder, wenn sie, sich vergessend, einschlummern.

[Bamangwatomädchen zur Boguera bekleidet.]
Der Hauptzweck dieser Ceremonie ist die Abhärtung der Jugend. Denselben Zweck verfolgt auch der dieser Ceremonie folgende und sich auch im nächsten Jahre wiederholende Jagdzug. Die zu einem Regiment Vereinigten theilen sich, von erfahrenen Jägern angeführt, in mehrere Haufen, um Antilopen, Gazellen etc., im folgenden Jahre Büffel, Elephanten etc. zu tödten. Auf dieser Jagd werden der Jugend alle möglichen Strapazen aufgelegt, ihr jede Erleichterung versagt, lange Märsche in wasserlosen Gegenden unternommen, der Zutritt zu dem Feuer in der oft bitterkalten Jahreszeit nur ausnahmsweise gestattet und sie überdies mit den Qualen des Hungers bekannt gemacht.
Der gemeine Betschuana bestimmt sein Alter nach der Boguera, d.h. er sagt, daß er zu dem oder jenem (bestimmt benannten) Regimente gehöre, oder er nennt eines oder zwei der wichtigsten Mitglieder desselben, z.B. des Oberbefehlshabers, die als »weise« angesehen, den Fragesteller vielleicht mit einer anderen Antwort befriedigen können.
In die Kategorie des eben betriebenen Gebrauches gehört auch nach Mackenzie die Tschwaragana moschwang, das Bündniß zwischen zwei Häuptlingen, das Gelübde der Treue, Freundschaft und des Vertrauens zwischen ihnen, z.B. dem Herrscher eines Landes und einem bei ihm als Gast oder Schützling weilenden Häuptling. Das Bündniß wird auf folgende Weise ceremoniell gefeiert. Ein Hausthier wird geschlachtet und der Magen aufgeschnitten, und nun tauchen beide Häuptlinge ihre Hände in seinen Inhalt und schütteln sich dann dieselben.
Zu diesen Gebräuchen gehört auch die Reinigung jener, die aus einem Kriege oder von einem Raubzuge heimkehren, die Reinigung ihrer Waffen und der Gefangenen wie der übrigen Beute, die sie aus dem Kriege mitbringen, die Reinigung aller Personen, die eine Leiche berühren oder berühren müssen, jene der Frauen nach Geburten, die ein bis drei Monate, je nach der Wohlhabenheit ihres Mannes (je wohlhabender desto länger) abgesondert leben müssen, ferner die Isolirung und Abschließung der Schwererkrankten. Die Reinigungen, die meist gegen Bezahlung von Seite der Linjaka's ausgeführt und von ihnen auch oft angeordnet werden, sind äußerst mannigfach. Dazu gehört z.B. das Abschaben der Wollhaare am Kopfe mit einem scharfen, kleinen Horn, Messer etc.
Am 16. Februar brachen wir endlich von Schoschong nach dem Maricodistrict auf. Jupiter grollte uns noch immer und sorgte für die ausgiebigste Erschwerung des Fortkommens auf dem völlig durchweichten, schlammigen Boden. An manchen Stellen stand das Wasser zwei Fuß hoch und auch an ein Ausweichen war bei dem dichten Baumwuchs auf der Strecke nicht zu denken. Die Gesammtstrecke von Schoschong bis zu dem Punkte, an welchem der Reisende den Limpopo auf seinem Zuge nach Südosten trifft, ist ein einziger Wald. Manche Stellen zeigten salzhaltigen Grund und auch Salzseen waren nicht selten. Der südlichere Theil an den Ufern des Sirorume ist etwas hügelig und hier ist der Wald tiefsandig. Zur Winterszeit hat diese drei Tagereisen beanspruchende Strecke nur an zwei Stellen Süßwasser.
Während der Fahrt am 17. beobachtete ich zum ersten Male ein hühnerartiges Federwild, welches in Süd-Afrika allgemein »det fasant« genannt wird. Ich hörte ein lautes, schrilles Gackern in einem dichten Niederbusch und bald darauf erschien der Schreier, ein bräunlicher Vogel, (Francolinus nudicollis) auf einem Baumstumpf. Er gehört zu den rebhuhnartigen Vögeln und ist über einen großen Theil der bewaldeten und bebuschten, wasserreichen Thalpartien der von mir besuchten Gegenden Süd-Afrika's verbreitet, auch in Süd-Central-Afrika sehr häufig. Paarweise oder in kleinen Ketten lebend, wacht der Hahn treu über das Wohl der Seinen, schreit bei jeder Gelegenheit, während des Scharrens, wenn er sich umsehen will, sich ein Feind nähert, oder wenn er Abends die Lagerstätte im gewohnten Busch oder Baum aufsucht. Durch sein Geschrei und weil er sich, wenn auch nur für wenige Momente, auf hervorragende Gegenstände setzt, wird er oft des Jägers Beute.
Am 18. passirten wir einen einige hundert Schritte langen, ellyptisch geformten, flachen, kaum zwei Fuß tiefen Salzsee, der mit einer stark salzhaltigen, milchigen Flüssigkeit gefüllt war. Nur an seinem nördlichen Ende ist in trockenen Jahren in Felsenlöchern Trinkwasser zu finden. Still lag die milchig-graue Fluth des todten See's von einem breiten, hellgrünen Rasenbande umsäumt in einer mäßigen Vertiefung des Waldes vor uns. Kein grüner Binsenhalm, kein Blatt der Seerose schaukelte sich darin. Hier waren es Bäume, die das sich sanft erhebende Ufer bekränzten, dort undurchdringliches Gebüsch, wo nur gebeugt und mühselig zwischen den Stämmchen die flüchtige Deukergazelle wandeln mochte—in den übrigen Uferpartien neigten sich von dem Niederwalde die kurzen schattigen, einer gemeinschaftlichen Wurzel mehrfach entsprossenen Akazienbäumchen herab und Blumen wucherten überall—daß der todte See in der Vertiefung einer duftenden bebuschten und bewaldeten Au begraben zu sein schien. Später nannte ich den Salzsee dem jetzigen, edlen Bamangwato-Könige zu Ehren »Khama's Salzsee« (Khama's Saltpan). Am Rande des See's fand ich Grünsteinstücke und Chalcedone, sowie an der nahen, dicht mit Dornbäumen bebuschten Bodenerhebung Quarzit und weiterhin Kalkfelsen vor. Zahlreiche Spuren deuteten auf die Anwesenheit kleinerer Gazellen, Gnu's, Zebra's und Giraffen, welche in den westlich und östlich nach dem Limpopo sich ausbreitenden bewaldeten Ebenen reichliche Weide finden.
Unter den Bäumen fiel mir namentlich einer auf, dessen vortreffliches Holz ich noch später kennen lernen sollte; es ist dies eine den Boers als Knopidorn bekannte und bis zu 50 Fuß Höhe meist gerade wachsende, selten gabelig verästelte Mimose. Die grau bis gelblichgraue Rinde ist mit ein bis zwei Zoll langen Auswüchsen versehen, welche an ihrer meist stumpfen Spitze hakenförmig gekrümmte, kleine und scharfe Dornen tragen. Ihr Holz wird als Bauholz, namentlich aber zu Wagnerarbeiten verwendet.
Nachmittags gelangte ich zu einigen Salzlachen, in denen ich zu meinem Erstaunen Fische—eine mir bekannte Species—äußerst verkümmert vorfand. Bei der Lage der Tümpel auf der Höhe des Hochplateau's läßt sich ihr hiesiges Vorkommen nicht anders erklären, als daß sie durch Vögel hieher übertragen worden waren. Der Abend überraschte uns in dem Thale des oberen Sirorume, dort, wo er sich über einige interessante Sandsteinbänke in ein offenes Thal Bahn bricht, um dann eine südliche, später eine Ostsüdost-Richtung nach dem Limpopo zu verfolgen. Als wir am nächsten Tage den tiefsandigen Wald, in dem inneren Bogen des Sirorume durchzogen, wurden wir vom Wagen aus auf eine Spur aufmerksam, welche durch das Gras führte; das hohe Gras schien wie mit einer zwei Meter breiten Walze niedergedrückt worden zu sein—die Stelle näher untersuchend fanden wir Elephantenspuren. Zwei nach dem Transvaal-Gebiete ziehende Bamangwato berichteten uns, daß diese Spuren von einer kleinen Heerde der großen, kleinzähnigen Elephanten herrührten, welche hier an der Grenze von Sekhomo's und Seschele's Gebiet »wechsle«. Es mußte jene Heerde sein, von der ich schon vernommen und die sich auch hier noch zwei Jahre aufhielt, bis sie von den Damara-Emigranten vernichtet wurde.
Vor uns in ziemlich geringer Entfernung wand sich das Thal des Sirorume, darüber hinaus nach Westen und Süden lag unabsehbar ein dichter Niederwald. Bald darauf stiegen wir zum zweiten Male in das Thal des Sirorume, von den Engländern the Brack reeds genannt, herab. Das Bett des Flusses ist hier meilenweit auf- und abwärts flach und ein einziges mit bohem Schilf bewachsenes Moor. Dreimal passirte ich diese Strecke und jedesmal fand ich die Gegend überraschend reich an der bekannten Buffadder. Alle unsere Mühe Trinkwasser zu finden war vergebens und so zwang mich die Wassernoth und der herabgeschmolzene Mehlvorrath weiterzureisen.
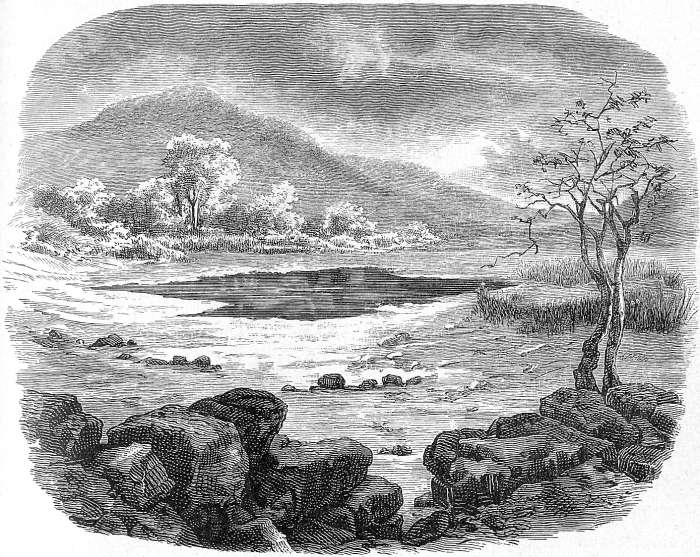
[Khama's Salzsee.]
Am 21. endlich stießen wir auf der Höhe des bewaldeten Plateau's auf eine jener unverhofft anzutreffenden Regenlachen, deren Vorkommen ich bereits bei der Schilderung meiner ersten Reise erwähnt habe.
Auf unserer Weiterfahrt am 18. hatten wir Gelegenheit, zwei Buffaddern, Puffotter (Vipera arietans), einen Meter lange, armdicke Exemplare mit herzförmigem Kopf und zwei sehr langen und stark gekrümmten Giftzähnen zu erlegen. Das Schuppenkleid dieser Schlangen variirt in der Farbe zwischen gelblich- bis dunkelbraun und ist schräg nach abwärts, abwechselnd hell und dunkel gebändert. Vom Meere bis zum Zambesi verbreitet, bewohnt sie unstreitig gewisse Striche häufiger als andere. So fand ich namentlich dicht bebuschte, besonders mit Dornbüschen bewachsene Partien dichter von dieser Schlange bevölkert. Eben diese Partien werden auch seltener von den Schlangenadlern aufgesucht. Die meisten Exemplare lagen träge am Rande von Gebüschen und Pfaden tellerförmig zusammengerollt. Ihre Trägheit und Unbeholfenheit ist merkwürdig—denn ich sah sie in Wasserlöchern liegen, aus denen sie sich nicht mehr emporwinden konnte. Ihrer stark nach rückwärts gekrümmten Giftzähne halber, kann die Buffadder nicht gleich den gewöhnlichen Species verwunden, sie muß vielmehr um dies zu thun, ihren Vorderkörper nach rückwärts krümmen, den Kopf senken und sich mit dem halben oder ganzen Körper auf ihr Opfer werfen. Dies vermag sie auf mehrere Fuß Entfernung hin und mir sind namentlich Beispiele dieses Angriffs aus der Cap-Colonie und Natal bekannt. Außer dieser finden wir noch eine zweite Eigenthümlichkeit, die mehrmals schon, und dies namentlich in der westlichen Cap-Colonie, beobachtet wurde und welche ich mir in folgender Weise zu erklären suche. Zufällig trifft hier ein Landmann, dort ein Jäger oder ein Hirt auf eine dieser Schlangen. Nicht ihr Anblick, sondern ein eigenthümlicher Ton, der zwischen Fauchen und Aechzen die Mitte hält, wird die Aufmerksamkeit desselben erregen. Diesem fauchenden Aechzen nachforschend, findet der Beobachter eine Buffadder vor sich, welche sich hin- und herwindet, hin- und herschlägt und sich wiederholt krümmt. Bei näherem Herantreten sieht er, daß der Leib des Thieres durchlöchert ist und aus diesen Oeffnungen sich die kleine Brut einen Weg nach Außen zu bahnen sucht. Jene, welche dies beobachtet, waren und sind der Ansicht, daß die »Brut« auf diese Weise zur Welt gebracht wurde, d.h. daß sie sich selbst aus dem Mutterleibe herausfresse; ich konnte dieser Ansicht nicht beipflichten und wurde darin später durch den Bericht eines gebildeten Augenzeugen bestärkt. Unter den Schlangen, die ich in Süd-Afrika kennen gelernt, ist die Buffadder durch die Anhänglichkeit an ihre Brut wohlbekannt. Bei Gefahr, die sie außerhalb ihres Schlupfwinkels überrascht, bläst sie sich auf und droht dem Feinde mit weit aufgesperrtem Rachen. Dabei geschieht es nun—doch bleibt es mir ein Räthsel, ob das Thier dies absichtlich thut oder nicht—daß ein Theil der herumschlängelnden über und unter der Mutter hingleitenden, sich an sie schmiegenden Brut in dem weiten Rachen verschwindet. Die Mutter bläst sich noch mehr auf, wobei die Jungen bald darauf sich gewaltsam einen Ausweg nach außen bahnen, nachdem ihnen zum Theile oder insgesammt vielleicht durch das Schließen der Kinnladen der Mutter der natürliche Ausweg benommen wurde.
Von den Buffadder-Höhen am Unterlaufe des Sirorume herabfahrend, kamen wir in das Thal des Limpopo (auch Ouri und Krokodil-River genannt); die hügelige Gegend am linken Ufer desselben geht nach Westen in ein bewaldetes Hochplateau über, während das rechte und flache theils bewaldete, theils prairienartige Ebenen besäumt. Das Bett des 12-30 Meter breiten Flusses ist sandig, das Ufer steil geböscht und mit undurchdringlichem Gebüsch oder mit hohem Gras bewachsen. Am Ufer fand ich häufig Krokodil-, sowie einige Flußpferdspuren, an den freieren und lehmigen Uferstellen Löwen- und Leopardenspuren und in dem anliegenden Walde konnten wir folgende Wildarten theils beobachten, theils deren Anwesenheit an den frischen Spuren erkennen: Kudu's, Roenantilopen, Wasserböcke, Buschböcke, Hartebeeste, Gnu's, Giraffen und Zebra's.
Wir waren noch nicht weit das Limpopothal nach aufwärts gefahren, als wir erstaunt ein Gefährte vor uns erblickten. Es war ein mit Mehl schwer beladener Wagen, Eigenthum eines Baharutse in Linokana, der den Ertrag seiner Felder nach Schoschong bringen wollte, um ihn da an die Händler oder an die Bamangwato's zu verkaufen. Ein auf südafrikanischen Wegen häufiger Unfall, ein Achsenbruch, nöthigte dem armen Manne an dieser Stelle einen unfreiwilligen, dreiwöchentlichen Aufenthalt auf, denn so lange währte es, bis seine Diener aus Linokana Ersatz herbeischaffen konnten.
Am 22. langten wir an der Mündung des Notuany, eines im westlichen Maricodistrict des Transvaal-Gebietes entspringenden, nur nach heftigem Regen und selbst dann nur stellenweise fließenden etwa 150 engl. Meilen langen Flusses an. Sein Bett ist tief, grubenförmig, und an seinen bewaldeten Ufern finden sich hie und da große, stets wasserhaltende Lachen, welche zahlreiche Fische und oft auch Krokodile beherbergen. Zur Zeit unseres Besuches floß der aus Westen zahlreiche Sand-River aufnehmende Notuany, und da seine Mündung stark verschilft war, dachten wir, daß die Saurier nicht über Land in den Fluß gelangen könnten und gönnten uns an der ziemlich tiefen Furth die Wohlthat eines Bades.
In dem südlichen Winkel der Notuany-Mündung finden wir, wie an mehreren anderen Stellen im Limpopothale, ein »Dornfeld«, d.h. eine umfangreiche ebene und humusreiche Strecke, die mit bis sechs Fuß hohen Acacia horrida-Gebüschen bewachsen ist. Es sind dies Strecken, deren Bodengattung das Herz eines europäischen Landwirthes erfreuen müßten, die hier aber lange Jahre noch brach liegen werden. Auf meinen Ausflügen während des zweitägigen Aufenthaltes am Notuany schoß ich einen grauen Uhu und einen Aasgeier. Thier- und Pflanzenleben boten mir reichlichen Stoff zu den interessantesten Studien.
Im Jahre 1870 hatte einer der Schoschonger Händler zwei Wägen unter der Oberaufsicht von drei Colonial-Halbcastmännern und eines ihnen untergeordneten Bamangwato-Dieners nach Zeerust gesendet. Eine ihrer Raststellen war an der Furth des Notuany-Flusses. Da es die Wagenführer für gut fanden, in der Tageshitze nicht zu reisen, so betrug die Rast mehrere Stunden, welche Zeit sich einer der Halbcast mit einem Ausflug verkürzen wollte und zu diesem Zwecke von einer Meute Hunde gefolgt auf die Jagd zog. Längs des Ufers vordringend, sah er sich bald von seinen vierfüßigen Freunden verlassen, die eine Wildspur aufgenommen zu haben und ihr nun kläffend zu folgen schienen. Er achtete anfangs nicht darauf, als es ihm jedoch däuchte, daß sie mit vereinten Kräften auf eine bestimmte Stelle anschlugen, nahm er diese Richtung auf und näherte sich vorsichtig derselben. Dichtes Gebüsch, hie und da ein Baum und hochbegraste Lichtungen bildeten die Scenerie seiner nächsten Umgebung.
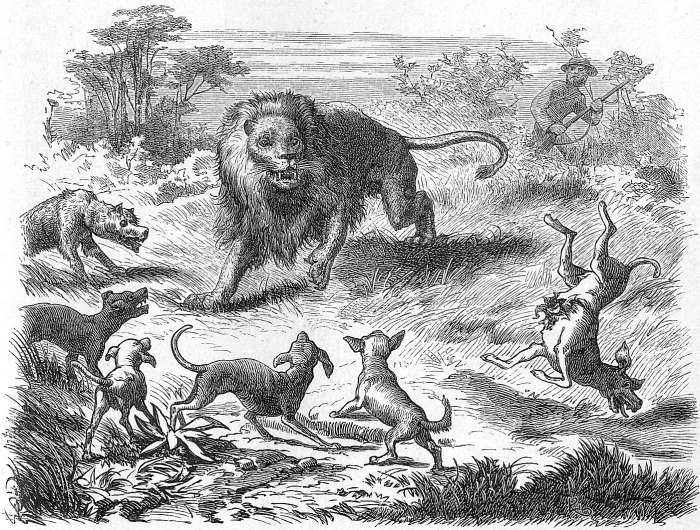
[Löwe von Hunden umringt.]
Je deutlicher das Gebell ihm entgegendrang, um so rüstiger schritt er darauf los und sah sich nach einer Viertelstunde einem seltsamen Schauspiele gegenüber. Von der kläffenden Meute umringt, saß einige Schritte vor ihm ein ausgewachsener, dunkel bemähnter Löwe, der seinen mächtigen Schädel bald nach dieser, bald nach jener Seite wendete und dem das heisere Kriegsgeschrei der Hunde kein besonderes Vergnügen zu bereiten schien. Der Jäger schlich sich gedeckt durch einen Busch, bis auf 50 Schritte heran und konnte nun das Zähnefletschen des Löwen sehen und sein dumpfes Brummen vernehmen. Der Mann legte an, doch in dem Augenblicke als er losdrücken will, springt der größte der Hunde, der in Schoschong als ein Hyänenwürger bekannt war, vorwärts, um den König des Waldes zu fassen. Das arme Thier büßte seinen Muth mit dem Tode, ein blitzschneller Hieb mit der Pratze schlug ihn nieder. Seine Brust und der Unterleib zeigten eine klaffende Wunde, aus der die Eingeweide hingen. Nach allen Seiten stoben daraufhin die Hunde auseinander, auch des Schützen Hand zitterte fühlbar und er mußte niederknieen, und mit aller Kraft das Gewehr an die Schulter und Wange pressen, um einen sicheren Schuß zu erzielen. Der Löwe war aufgestanden und beschnupperte sein zuckendes Opfer—da traf ihn die Kugel, wie eingegossen saß sie unter dem Blatte in der Brust und der königliche Räuber fiel auf derselben Stelle, an der er seinen verwegenen Angreifer getödtet hatte.
Am 24., als wir uns der Marico-Mündung näherten und einige der hier zahlreichen den Weg kreuzenden, nach dem Limpopo zu führenden engen Regenschluchten passirten, brach die in Schoschong gezimmerte Achse, doch gelang es dieselbe noch so weit herzustellen, daß sie bis zur nächsten Transvaal-Farm Dienste leistete. Am folgenden Tage hatte ich Gelegenheit, zwei Heerden der schönen, im Buschlande in den Wäldern nördlich vom Molapo bis in's centrale Afrika wohnenden, hier an Häufigkeit den südlichen Bläßbock der Grasebenen vertretenden Pallah's zu treffen. Unsere Weiterfahrt war durch anhaltende Regen gehindert und da wir noch immer in der Niederung des Limpopo und später jener des Maricothales aufwärts zogen und es in den letzten Wochen hier ebenso stark wie in Schoschong geregnet haben mußte, so reisten wir fast die Hälfte der Strecke hindurch durch Wasserlachen und Sumpfland, ohne selbst zu unserem Nachtlager eine trockene Stelle ausfindig machen zu können.
Auf einer großen Wiesenfläche zu unserer Linken (am linken Maricoufer) wurden wir auf der Morgenfahrt des 26. von einem seltenen Anblick überrascht. Mehr denn die Hälfte der Au, einige hundert Schritte im Gevierte messend, glich einem einzigen feuerrothen Teppich, ringsum von dem üppigen Grün der Wiesenflur und dem dunklen Grün der Mimosen-Büsche und Bäume umrahmt. Dieses herrliche Bild war durch blühende Aloën hervorgerufen, welche aus dem Kranze ihrer fleischigen und bedornten Blätter, die bis drei und vier Fuß hohen, oben armleuchterförmig verästelten Aehrenblüthen tragenden Stengel emporhoben. In den dichteren Büschen beobachtete ich manche derselben mit einer schön schwefelgelbblüthigen Schlingpflanze überladen.
Die Anstrengungen der Reise, die Fieberluft der durchzogenen Gegenden und die feuchten Nachtlager der letzten Tage blieben nicht ohne Folgen für meine Gesundheit, am 28. hatte sich mein Zustand derart verschlimmert, daß wir die Reise unterbrechen mußten. Die allgemeine Abspannung hatte in einem solchen Grade zugenommen, daß ich nicht im Stande war, vom Wagen herabzuklimmen, sondern von den Gefährten heruntergehoben werden mußte. Nach 1½ Stunden trat heftiges Erbrechen ein, der Kopf schien mir centnerschwer, und ich war unfähig, auf die Fragen der mich bestürmenden Freunde zu antworten. Allmälig schwand die Kraft der Sinne und ich verfiel in ein zweistündiges Delirium, aus dem ich auf einen Moment—Dank der Hilfe meiner Gefährten—erwachte. Die drei Männer knieten an meiner Seite und frottirten mich mit kühlem Wasser. Freund E. schluchzte laut und F. lief wie sinnlos umher. Nur nach der aufopfernden Pflege des um mich besorgten Freundes Eberwald, und nachdem ich mir, des heftigen Blutandranges zum Kopfe halber, mit Noth zur Ader gelassen hatte, trat eine merkliche Besserung ein. Die rührende Sorgfalt und Theilnahme Eberwalds zeigte sich mir bei dieser Gelegenheit im schönsten Lichte und machte mir den Freund um so werther. Das eiserne Gebot der Notwendigkeit, die afrikanische Natur, hatten indeß den besten Einfluß auf meine Genesung, am dritten Tage war ich wieder so weit hergestellt, daß wir die Reise fortsetzen konnten.
Am 3. verließen wir das eigentliche Thal des Marico[1] überschritten den Sattel und kamen in einen nur nach dem Marico zu offenen Kessel, der von dem Betschuanaspruit durchkreuzt, im Süden von der interessanten Gruppe der Berthahöhen gebildet wird. An ihren südwestlichen Ausläufern liegt Tschune-Tschune (engl. Tshwene-Tshwene), die Stadt der unter dem Häuptling Matlapin stehenden Batloka, die auf dem Gebiete Seschele's liegt, das von der Sirorume-Mündung bis an die Dwarsberge reicht. In dem Niederwald im Kessel, namentlich gegen Tschune-Tschune, fand ich den Morula-Baum mit reifen Früchten.
1 Ich beobachtete am Marico-Ufer Granit- und Gneisfelsen mit aufsteigenden mächtigen Quarzadern, die von großen Goldglimmerplättchen durchzogen waren.
Am 4. trafen wir im Weichbilde der Stadt ein. Die Stadt selbst war ziemlich reinlich gehalten. Die Gehöfte und Hütten waren größer und geräumiger als jene der meisten Betschuana's und hie und da von Gärtchen umgeben. Auf den Feldern stand nur noch hie und da etwas Korn, Mais und Kafirzuckerrohr. Ich hielt vor der Stadt, da mir von Batloka's bedeutet wurde, daß der Morena betrunken sei und es in der Stadt lustig hergehe. Von dem Hochplateau, aus dem sich der letztgenannte Höhencomplex erhebt, herabsteigend, fanden wir an dem Abfall desselben in dem harten grauen Kalksteinfelsen mehrere tiefe Löcher, welche kühles Quellwasser enthielten. Von diesen Quellen bot sich uns ein überraschender Anblick. Vor uns lag ein mehrere Meilen breites, leicht bewaldetes Thal, das sich gegen Osten nach dem Marico zog und im Süden von einem langen bebuschten und bewaldeten, zahllose Kuppen aufweisenden Höhenzuge, den Dwarsbergen, begrenzt war. Jenseits derselben lag bereits das Gebiet der Transvaal-Republik. Den Paß, über den ich die Dwarsberge am 6. überschritt, nannte ich Schweinfurths-, den nächsten westlichen Rohlfs-Paß. Von der Sattelhöhe desselben erblickten wir auf einer namentlich nach Osten gegen den Marico sich ausbreitenden Ebene die erste Farm. Am jenseitigen Fuße der Höhen begegneten wir einem nach dem Damaralande auswandernden Boer.
Auf der Farm Brackfontein angelangt, entdeckte ich zu meiner freudigsten Ueberraschung, daß der Eigenthümer ein Schmied war, und ich nun die Schäden an meinem Wagen ausbessern lassen konnte. Der Einladung seiner beiden Söhne, sie auf die Jagd zu begleiten, konnte ich mit Rücksicht auf meine Reconvalescenz nicht folgen, obwohl der Reichthum der Gegend an Wild verlockend war. In den dichter bebuschten Partien an den Dwarsbergen gab es Gazellen und Kudu-Antilopen, in den leicht bewaldeten Partien an ihrem Fuße und auf den Grasebenen nach Osten und Süden Heerden der beiden Gnu-Arten, Zebras, Springböcke und zuweilen wurden auch Säbel-Antilopen und Strauße sichtbar. Fourier, der Farmer, erwähnte auch, daß Löwen zur Winterszeit die Gegend beunruhigen und erzählte mir mehrere Jagdabenteuer, von welchen ich eines hier anführen will, das er und seine benachbarten Farmer im Maschonalande erlebten.
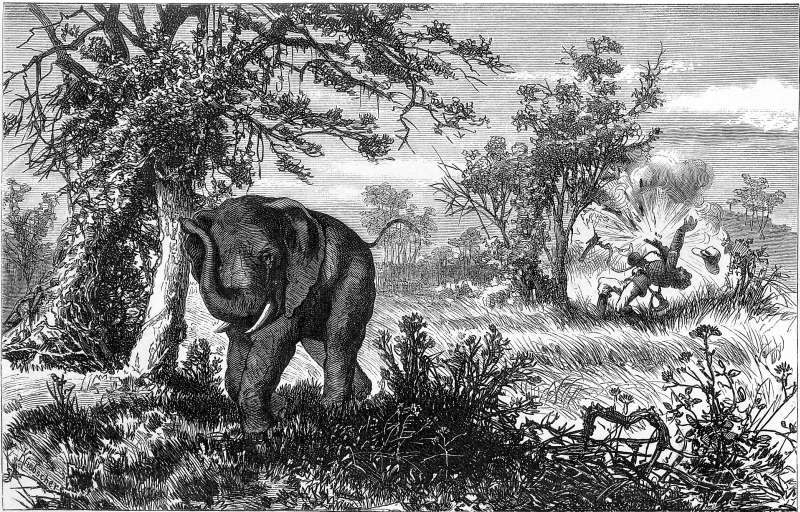
[Elephant und Boer.]
Auf einem gemeinschaftlich unternommenen Jagdausfluge im Gebiete der Tsetsefliege hatten dieselben eine Elephantenheerde aufgespürt; da sich die Spuren plötzlich theilten, folgte Fourier mit seinen Matabele-Dienern den zahlreicheren, während sein Freund die riesige eines männlichen Thieres aufnahm. Er war auch der erste, der seiner Beute nach einem halbstündigem Marsche ansichtig wurde. Fourier hörte auch dessen Schuß und kehrte, nachdem sein Bemühen, die Heerde aufzufinden, erfolglos war, zu seinem Freunde zurück, er fand ihn, doch nur als Leiche, wieder. Auf den Boden gestreckt, sein Gesicht mit Blut befleckt, das aus Mund, Nase und den Ohren floß. Vor ihm lag sein Gewehr[1] mit geborstenem Kolben und etwa 30 Schritte in gleicher Richtung unter einem Baume der Cadaver eines großen männlichen Elephanten. Während der Erzählung des Farmers hatte ich eines der riesigen, unbeholfenen und schweren, stark verrosteten Vierpfünder in die Hand genommen, die Innenfläche (Backenfläche) war mit Schafwolle ausgefüttert und mit einer weichen Haut überzogen.
1 Das Gewehr, von ¼pfündigem Kaliber, wird, da vier Kugeln auf ein Pfund gehen, von den Boers Vierpfünder genannt.
Von Brackfontein wandte ich mich am 12. nach Süden, um—das sogenannte »Bushveldt« (Buschfeld) durchkreuzend—die in dem eigentlichen Marico-Höhennetze liegende Eingebornenstadt Linokana aufzusuchen.
Ohne vorläufig auf eine nähere Beschreibung des Bushveldts einzugehen, will ich hier nur erwähnen, daß es von einem bewaldeten Hügelland gebildet wird, das zahlreiche mit den Dwarsbergen zusammenhängende, niedere Kämme, sandige Bodenerhebungen, isolirte Hügel und zahlreiche Thäler aufweist und dessen Boden mit üppigem Grase bewachsen ist. Bevor ich es durch den Buyspaß (Buysport) verließ, berührte ich die Farmen Markfontein, Sandfontein, Witfontein. Der Eigenthühmer der erstgenannten, Zwart, hatte die ziemlich umfangreiche, große Farm um 300 £ St. erstanden. Auch Zwart war ein alter Elephantenjäger und hatte das Damaraland und die Zambesi-Fälle auf seinen Streifzügen besucht. In Sandfontein wohnte in einem Hartebeest-Häuschen ein Holländer, der für Herrn Taylor, den Kaufmann bei Seschele, die Verfrachtung der Waaren besorgte. Wir wurden von ihm und seiner freundlichen, alten Mutter, trotzdem daß er hier nur mit den Seinen periodisch einige Tage im Monat wohnte, auf das Beste bewirthet.
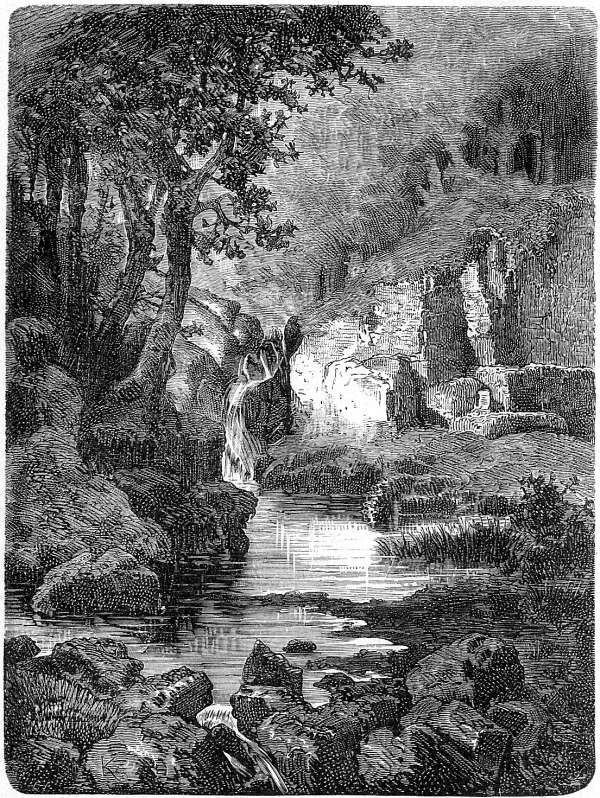
[Buysport, Felsenthor im Bushveldt.]
Abends erreichten wir den erwähnten Buysport (Paß) und überschritten ihn am folgenden Tage (15. März). Der Buyspaß gehört zu den anziehendsten Partien des Marico-Höhennetzes. Ein Spruit, der in kleinen, tiefen Lachen das ganze Jahr hindurch Wasser in seinem felsigen Bette birgt, muß einigemal gekreuzt werden, und wenn auch das Fortkommen dadurch sehr erschwert wird und die größte Vorsicht erheischt, so bietet sich dem Auge in dem bald von bewaldeten, bald schroff abfallenden oder stufenförmigen Felsenblöcken eingeengten Flußthale ein so pittoreskes und schönes Bild dar, daß man die Mühen der Reise durch den Paß nicht scheut, und dies um so mehr, als der Naturfreund sich reichlich belohnt findet.

[Baharutse Wasser schöpfend.]
Buschböcke, Roibock-Gazellen, Klippspringer, Paviane und Meerkatzen gehören nebst kleineren katzenartigen Raubthieren und dem Hyrax zu den gewöhnlicheren Erscheinungen unter den größeren Vierfüßlern, doch trifft man auch zuweilen Leoparden, Luchse und Kudu's. Der Reichthum an Vögeln, Schlangen, Insecten und Pflanzen ist überraschend. Nebst dem schon hie und da erwähnten Wildgeflügel—mit Ausnahme der Trappen und der trappenähnlichen Otis—fand ich Wachteln, zwei mir neue Drosselarten, einen Wendehals, zwei Mandelkrähen-Arten etc.
Das Hochplateau, das wir nach Passirung des Passes betraten, war ein herrliches Wiesenland und von zahlreichen bebauten Flächen bedeckt, nach Westen und Osten senkt es sich zu den Notuany- und Zeerust-Höhen herab. Diese Höhen einige Meilen in südwestlicher Richtung herabfahrend, kamen wir in das Thal des obern Notuany, das von dem unmittelbar vor uns einmündenden Matebethal durch einen Höhenzug theilweise getrennt und zur Hälfte seiner Ausdehnung bebaut war. Diese Felder bildeten das Wahrzeichen Linokana's, einer Baharutsestadt, von deren blühendem Ackerbau ich schon in Moschaneng, Molopolole und an anderen Orten vernommen hatte. Der Notuany, den wir einige Meilen oberhalb seiner Quellen überschritten, floß in einem grabenförmigen Bette und war mit einigen Holzstämmen neu nothdürftig überbrückt, über welchen höchst primitiven und gefährlichen Bau wir den Wagen übersetzen mußten. Wir fuhren in das Thal des Matebeflüßchens und kamen bald in den Thalkessel von Linokana, in dessen Mitte, sowie an dessen nördlichem und östlichem Rande der Höhen die gleichnamige Eingebornenstadt erbaut ist.
In den zahlreichen Schilfrohrdickichten am Matebeflüßchen macht sich eine reiche Thierwelt bemerklich. Der Abend und der Morgen sind die Zeiten, an denen wir ihrem Treiben lauschen, die graue Wildkatze im Beschleichen der Schnepfen und der langschwänzigen Capfinken, den Wasserleguan und seltener auch den Caracal beobachten können, den letzteren doch nur dann, wenn es ihm in seinem Felsengeklüfte an Nahrung gebricht und er sich gezwungen sieht, in das Thal herabzusteigen, wo ihm dann die Schilfrohrdickichte reiche Beute und einen sicheren Schlupfwinkel bieten.
Gleich beim Betreten des östlichen Thalkessels fällt uns neben den wohlbebauten Feldern eine dichte Baumgruppe am nördlichen Ende der Stadt auf, aus welcher Baumgruppe sich namentlich einige schlanke und weithin sichtbare Eucalyptus-Bäume[1] bemerkbar machen. Sie beschatten mehrere im europäischen Style erbaute Häuschen, die einem freundlichen und zuvorkommenden Manne als Wohnstätte dienten, der mit seinem Beispiele so wohlthätig auf die Baharutse eingewirkt hat, daß diese jetzt unter den Transvaal-Betschuana's die bedeutenden Ackerbauer und wohl auch die wohlhabendsten sind. Thomas Jensen ist der Name dieses Missionärs, ein Mitglied der Hermannsburger Missionsgesellschaft; er nahm uns freundlich auf, führte mich zum Häuptling Moilo (oder Moiloa) und zu den anderen an den Bergen wohnenden Häuptlingen, Tschukuru etc. Moiloa war eine hohe Greisengestalt, freundlich, obgleich mit harten Gesichtszügen, er war ein treuer Unterthan der Transvaal-Republik, besorgt um das Wohl seiner Unterthanen und überragte in mehrfacher Hinsicht die Herrscher der Nachbarreiche. Er stellte mir seine Söhne vor, von denen er keinen der Nachfolge auf den Thron fähig bezeichnete, übrigens war der in Moschaneng lebende Sohn eines verstorbenen Verwandten, als Ursprosse des alten Königshauses aller Betschuana's, der Baharutse in Linokana, der rechtmäßige zukünftige Häuptling.
1 Dieselben hatten bei einer Höhe von über 60 Fuß einen Stamm-Durchmesser von zwei Fuß.
In jedem größeren Gehöfte in der Stadt fand ich einen Pflug und überall ragten Wagendächer zwischen den kegelförmigen Grasdächern hervor. Dem Rathschlage Rev. Jensens folgend, haben es die Baharutse verstanden, die an den westlichen Höhen des Thalkessels entspringende Quelle des Matebeflüßchens auszunützen; sie wird theilweise durch die Stadt, doch auch in mehreren Armen durch die Felder und Obstgärten geleitet und sowohl zur Bewässerung des angebauten Landes, als auch als Wasserleitung für häusliche Zwecke in Anspruch genommen. Die erwachsene männliche Bevölkerung zahlte zehn Shillinge Kopfsteuer an die Transvaal-Republik und war im Kriegsfalle verpflichtet, Männer und Zugthiere beizustellen. Rev. Jensen war mit der Inempfangnahme der Kopfsteuer betraut und lieferte sie an die Regierung ab, wofür ihm keine Vergütung irgend einer Art zu Theil wurde, obgleich er jährlich an 400 £ St. abgab.
Um das Missionsgehöfte ziehen sich die Gärten und Felder, in denen Mais und Weizen angebaut wird und Pfirsiche, Aprikosen, Birnen, Feigen, Orangen und Zitronen gedeihen, deren Ertrag eine willkommene Beisteuer zu dem allzu bescheidenen Gehalt des Missionärs bildet. In dem kleinen Blumengärtchen begrüßten wir alte Bekannte aus der trauten Heimat, da gab es mehrere Arten von Rosen, theils einzeln, theils als Hecken gezogen, Schwertlilien, die buntfarbigen, duftenden Nelken, den Pfeifenstrauch, verblühte Tulpen, Hyazinthen etc.
Das Familienleben des Missionärs unter den hohen Bluegum-Bäumen am Matebeflüßchen glich einer stillen, glücklichen Idylle, und war um so beachtenswerther, als sie den dunklen Nebenmenschen ein leuchtendes Vorbild war. Rev. Jensen theilte uns auch mit, daß sicheren Nachrichten zufolge, die über Capstadt von Zanzibar gekommen waren, Livingstone einem Ruhr-Anfall am Bangweolo-See erlegen sei, was unsere allgemeine Freude über die freundliche Aufnahme nicht wenig trübte. Von Rev. Jensen erfuhr ich, daß der erste Begleiter Livingstone's auf seinen Missionsreisen in Linokana noch lebe.
Der Häuptling Moiloa beklagte sich bei mir durch Rev. Jensen über das Betragen einiger Weißen, die in die Stadt gekommen waren, namentlich eines Photographen von Gewerbe (eines Amerikaners) und eines Engländers, der sich C.H. nannte. Rev. Jensen berichtete mir eine höchst interessante Heilung von Schlangenbiß, die er an einem Bewohner Linokana's beobachtet hatte. Ein Mann war während des Holzfällens von einer Cobra gebissen worden. In seiner Angst laut schreiend, ließ er Beil und Pfähle im Stiche und lief aus Leibeskräften über Stock und Stein nach dem Missionshause zu. Verwundert sieht Jensen einen über und über mit Schaum bedeckten Mann heranstürzen, der, bei ihm angekommen, vor Ermattung niederfällt und kein Wort zu stammeln im Stande ist. Als er nach einiger Zeit zu sich kommt und die Wunde vorzeigt, war ihre nächste Umgebung nur etwas geschwollen, allein der Mann fühlte sich ganz wohl und ward gesund, ohne ein Medicament genommen zu haben. Der heftige und reichliche Schweiß hatte zweifellos das Gift aus dem Körper getrieben.
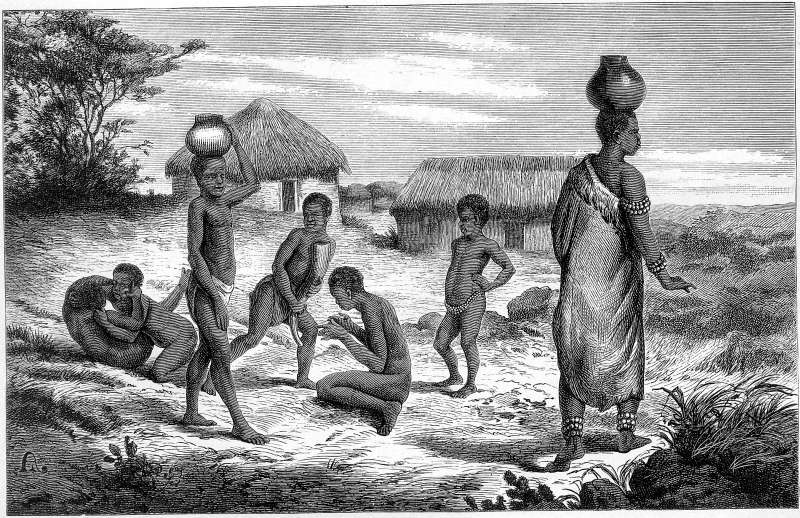
[Scene aus dem Leben der Baharutse.]
Die Baharutse besitzen zahlreiche Heerden, obgleich sie jährlich eine bedeutende Anzahl durch die herrschende Lungenseuche verlieren.[1]
1 Nur durch von der Regierung erlassene Maßregeln und durch die Einführung von Acid. sulphuricum dilutum als Specificum, wird man mach meinem Dafürhalten diesem Uebel kräftig entgegenwirken und damit ein großes Capital, das jährlich im Transvaal-Gebiete nutzlos verloren geht, vielleicht retten können.
Linokana (=ein kleiner Fluß—Li=der—noka=Fluß—nokana=Flüßchen) wurde früher, aber nur zu Lebzeiten des Häuptlings Moiloa und ihm zu Ehren Moiloa genannt. Für den Sammler ist, wie Karl Mauch dies bestätigt hat, ein mehrwöchentlicher Aufenthalt in Linokana sehr lohnend. Mit Ausnahme der Mamalia sind naturhistorische Objecte aller Art reichhaltig vertreten.[1] Die Höhen, von denen der nördliche der To- (Elephanten-), der östliche Po- (Büffel-) Berg genannt werden, die Wiesen und morastigen Partien des Matebethales, die bewaldeten des Notuany zeigen eine große Reichhaltigkeit an Vögeln, unter denen namentlich Raubvögel, langschwänzige Finken, Bienenfänger, grünliche Tauben und Purpurreiher etc. auffallen.
1 Eisenhaltiger Schiefer sowie der harte graue Transvaal-Kalkstein mit Kalkspath, Blei-, Eisen-, und Kupfererzen durchschlossen und ganze Hügel von Petrefacten, der letzten Periode angehörend, welche deutlich auf ein Vorhandensein heißer Quellen schließen lassen, werden die mineralogischen Sammlungen bereichern.
In früheren Zeiten hatte Moiloa große Treibjagden veranstaltet, welche auf der westlichen Hochebene abgehalten wurden. Er ließ große Flächen derselben umzingeln und die Treiber das aufgescheuchte Wild gegen den Abfall der Hochebene nach Linokana zu treiben, wo es von den Schützen erwartet und zum großen Theile erlegt wurde.
Am 16. verließ ich Moiloa's freundliche Ackerbauer und schlug eine südliche Richtung ein, um nach Zeerust zu gelangen. Wir kamen am selben Tage bis zur nächsten schönen Farm, die dem Fieldeornet Martin Zwart gehörte, und den wir eben mit der Destillation von Pfirsichbranntwein beschäftigt fanden. M. Zwart besaß hier zwei Farmen, hatte mehrere an der Grenze verkauft und befand sich trotzdem in keineswegs rosigen Verhältnissen. Gleich vielen anderen einst wohlhabenden Farmern ließ die leidenschaftlich betriebene Jagd auch ihn nicht aufkommen. Er war 21 Jahre lang Jachter (Jagter-Jäger) gewesen, während welcher Glanz- und zugleich Verarmungsperiode er 294 Elephanten erlegt hatte.
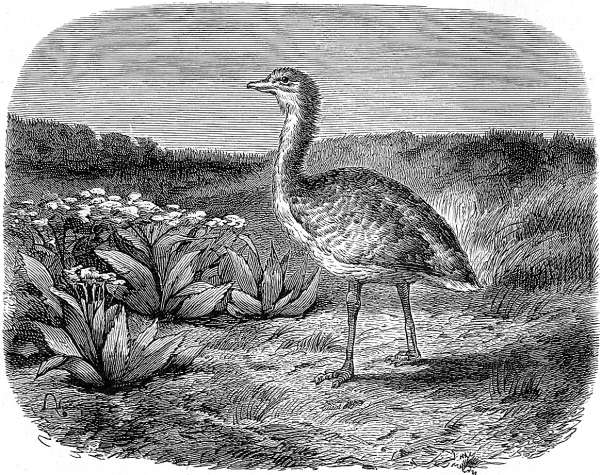
[Südafrikanische Trappe.]
Im Notuanythal aufwärts zu den Quellen dieses Flusses ziehend, unternahm ich eine Excursion, nach der Farm des Oosthuisen, der hier mit mehreren Verwandten in einem schönen Thalkessel wohnte. Seine Farm ist nennenswerth reich an Kupfererzen, welche auch hier zuvor von den Eingebornen gewonnen, geschmolzen und zu Armringen etc. verarbeitet wurden; ebenso wie man an den Höhen unfern der Matebequellen bei Linokana Stellen findet, an denen Eisenerze in ähnlicher Weise verarbeitet wurden. Oosthuisen beschäftigte sich namentlich mit Mais-, Weizen- und Tabakbau und dem Gerben von Thierfellen, die er den aus dem Inneren heimkehrenden Jägern abgekauft hatte. Nach Zwarts Farm zurückgekehrt, fuhren wir zwei Stunden später in das nahe liegende Zeerust, den Sitz der Behörde für den District Marico. Damals nur aus circa 40 Häusern bestehend, hatte das Städtchen eine mit hoher Mauer umfriedete holländische Kirche, welche bei der früheren Unsicherheit der Gegend, der holländischen Bevölkerung der nächsten Umgebung als Zufluchtsort diente.

[Tschukuru, Häuptling der Baharutse.]
Zeerust liegt am kleinen Marico, der sich nach Osten durch die Höhen Bahn bricht, um sich mit dem großen Marico zu vereinigen. Der Marico-District ist zum größten Theile ein von zahlreichen fließenden Bächlein und Flüßchen durchzogenes und äußerst fruchtbare Thäler besitzendes Höhenland, das auch verhältnißmäßig besser als die meisten übrigen Transvaal-Districte angebaut ist. Ein Theil ist mit einem Mimosen- und anderem Niederwald bedeckt und in seiner Gesammtheit ein gutes Weideland für Pferde und Rinder. Die Farmen stehen hier auch dichter und wir sehen die Gartencultur ziemlich schwunghaft betrieben, daß wir jedoch trotz Allem die Wohlhabenheit nur auf gewisse Farmen concentrirt fanden, rührt daher, daß sich die Besitzer der meisten derselben der Elephantenjagd ergeben hatten und dabei die Erträgnisse des fruchtbaren Bodens an dieses so beschwerdenreiche Vergnügen vergeudeten. Das von den Betschuana-Königen erlassene Jagdverbot wird diese Jäger zwingen, daheim bei ihren Pflügen zu bleiben, was ihre materielle Lage heben und in einigen Jahren dem Reisenden nur ein Bild allgemeiner Wohlhabenheit im Marico-District bieten wird.
Am 19. verließ ich Zeerust im Thale des kleinen Marico aufwärts nach Süden. Nachdem wir eine Anzahl von Farmen, die theils im Thale und in den Seitenthälern, theils an den Abhängen liegen und Quarifontein, Quaggafontein, Kafirkraal, Graffel und Deukfontein etc. heißen, passirt hatten, gelangten wir auf das Hooge-Veldt (Hohe Feld), eine der größten Grasebenen des südafrikanischen Hochplateaus. Im Osten waren die Zwart-Ruggens (schwarzen Höhenrücken) sichtbar. Die wildreiche Ebene ist der östliche Theil der zwischen dem Molapo- und dem Hart-River liegenden Wildebenen jenes Hochlandes, in dem der Hart-River, der Molapo und der Marico mit vielen ihrer Nebenflüsse entspringen und denen der bei Wonderfontein beschriebene und sonst oft erwähnte graue Transvaal-Kalkstein als Grundlage dient. Auf diesem Hochplateau, dem östlichen Theil des Hooge-Veldt, stießen wir blos auf zwei Farmen, Pit- und Witfontein, welche in kleinen Vertiefungen lagen, die nach dem Hart-River zu führen schienen.
Auf einer der Farmen klagte mir der Eigenthümer über die Dreistigkeit der Hyänen. Eine solche war einige Wochen zuvor Abends, als der Eigenthümer in der Stube saß, in dieselbe eingedrungen. Der Mann, der eben eine holländische Zeitung las, dachte, es sei ein Hund, als ihn sein unter dem Tische liegender Hund, der auf den frechen Eindringling lossprang, eines Anderen belehrte. Auf Pitfontein fanden wir Löwenspuren und die Söhne des Farmers erzählten uns, daß eine der in dem umzäunten Felde arbeitenden Barolong-Dienerinnen zwei Tage zuvor, Früh am Morgen einen Löwen gesehen hätte. Auch war am selben Tage eines ihrer Kälber im »veldt« (auf der Ebene) von einem Löwen getödtet gefunden worden. Nach diesen Mittheilungen zu schließen, mußten es Löwen vom Maretsane- und Konanaspruit gewesen sein, welche vom Westen her ähnliche Besuche diesen Farmen und den wildreichen Ebenen abzustatten pflegten.
Auf Witfontein klagte man über die Unverschämtheit eines Mannes, der in Potschefstroom wohne und zeitweilig das Land bereise, um unter dem Vorwande, neue Quellen aufzufinden, den Bauern schweres Geld ablocke. Nach der Beschreibung der Leute hatten wir dem Mann begegnet, als wir eben das Hochplateau betraten. Es war ein verschmitzt aussehender Alter, das Prototyp eines echten Transvaal-Raubritters, mit einem hoffnungsvollen Sprossen und einem Betschuana, der den zweirädrigen von zwei Ochsen gezogenen Karren lenkte.
Am 22. März begannen wir allmälig herabzusteigen und betraten das Thal des Makoksspruit, an dem Makoks-(Eingebornen-)Kraal liegt. Im Thale fand ich eine Farm und in dem Farmer den Verwandten eines Mannes, den ich in den Diamantenfeldern behandelt. Obgleich sehr verarmt, bemühten sich die Leute uns zu bewirthen. Am folgenden Tage erreichten wir das Thal des oberen Schoenspruit, der reichlich floß und in dessem Thale sich eine Farm an die andere reihte. Zwischen dem Schoenspruit und Potschefstroom hatten wir mehrere flache Höhenrücken zu überschreiten, welche südwestliche Ausläufer des Hooge-Veldts sind und die Moi-River und Schoen-Zuflüsse begleiten.
Unter den in meinem Tagebuche verzeichneten Löwenjagden finde ich einige, welche sich auf dem Terrain zwischen Zeerust und Potschefstroom abspielten. Die interessanteste derselben, welche mir in dem Urwalde des östlichen Bamangwatolandes von dem im Jakobsdaler District ansässigen Elephantenjäger David Jakobs mitgetheilt wurde, will ich hier wiedererzählen.
Im Jahre 1863, während der in der Transvaal-Republik herrschenden Unruhen hatten sich auch die Bewohner des Marico-Districtes an denselben betheiligt und so war ein Haufen der Farmer zu Pferde nach Potschefstroom abgezogen. Unter diesen befanden sich die zwei berühmten Elephantenjäger J.W. van Viljoen und Pit Jakobs, dann der Erzähler und 17 andere Boers. Auf ihrem Wege dahin waren sie bis zu Makoks-Kraal gekommen, als unweit desselben die Reiter nahe am Wege eine ausgewachsene Löwin im hohen Grase liegen sahen. Viljoen, ein Löwenjäger à la Gordon leitete den sofortigen Angriff ein und die übrigen, seine Erfahrenheit in diesen Dingen wohl kennend, fügten sich willig. Er ließ absatteln, die Pferde mit den Zügeln aneinander binden und dann die Männer mit ihren Gewehren eine Stellung zwischen dem Raubthiere und den Pferden einnehmen, in dieser waren sie etwa 100 Schritte von demselben entfernt. Viljoen erlaubte sich bei solchen Gelegenheiten immer einen Spaß; so oft er mit Jemandem jagte und dabei zufällig einem Löwen begegnete, stellte er immer den Muth seines oder seiner Begleiter auf die Probe. Van Viljoen, der seitlich von seinen Begleitern stand, benützte den Moment, wo deren Augen auf die Pferde gerichtet waren, um sich nach der Löwin zu wenden, und um sie herauszufordern, eine Kugel über sie hinwegfliegen zu lassen. Seine Absicht gelang vollkommen. Die Löwin kam zähnefletschend bedächtig herangeschritten. Auf 40 Schritte Entfernung traf sie der Schuß eines der Jäger am Ohr und nun kam sie rascher heran. Als das Raubthier die Entfernung schon um 20 Meter verkürzt hatte, geriethen die Männer in's Schwanken—Viljoen stand ruhig etwa 18 Meter von dem Thiere entfernt und fixirte bald das Thier, bald die auf dasselbe gerichteten Mündungen der Gewehre seiner Genossen—da blitzte es auf, sechs Schüsse fielen und die Löwin that keinen Schritt näher—fünf Kugeln waren ihr in die Brust gedrungen.
»Nun, da haben sich Deine Freunde wacker gehalten,« sagte ich zu David Jakobs.
»Nun, es war nicht so arg mit ihnen, denn als die Löwin näher kam, kehrten sich einige von ihnen nach den Pferden um, d.h. sie wollten sich empfehlen, allein die Pferde, welche die Löwin gewittert, hatten sich ängstlich aneinander gepreßt und waren um volle 20 Schritte zurückgewichen, so mußten die Genossen bleiben, die Löwin hätte ihnen den Rückzug abgeschnitten.
Auf dem Wege vom Schoenspruit nach Potschefstroom entdeckte ich auf der ersten Höhe ein interessantes Felsenthor und mehrere senkrecht aus der Erde meist halbkreisförmig aufsteigende, kammförmige Quarzit-Wälle. Die zwischen denselben gelegene Farm führt den Namen Klip-Port und eine der nächsten Farmen Klip-(Stein-)Fontein; auch hier fand ich massenhaft schönen, ein wellenförmiges Geschiebe bildenden mit Quarzit durchschossenen Eisenschiefer, wie wir es an den Quarzitfelsen auf Klip-Port beobachtet. Auch weiterhin gegen Potschefstroom zu, hatten wir enge Thäler und felsige Höhen zu überschreiten.
Am selben Tage Nachmittags langten wir in Potschefstroom an. Meinem Vorhaben gemäß verkaufte ich daselbst zwei Zugthiere, da mein Baargeld völlig erschöpft war. Freund E. und B. sagten mir hier Lebewohl, um sich nach den in Schwung gekommenen Goldfeldern des Leydenburger Districtes zu begeben und ihr Glück, das sie vergebens in den Diamantenfeldern gesucht, nochmals zu erproben; auch F. verließ mich hier.
Am 28. brach ich von Potschefstroom auf und erreichte Tags darauf Klerksdorp. Auf dieser 34 englische Meilen langen Strecke begegnete ich auffallend vielen Wägen. Es waren Kaufleute und Diamantensucher, sowie Kantinjers, welche Leydenburg mit den Diamantenfeldern zu vertauschen gesonnen waren und nun nach Gold lechzten, ebenso wie kurz zuvor Diamanten ihr Losungswort war. Ich verließ Klerksdorp noch am Abend desselben Tages und fuhr bis zum Estherspruit.
Am 30. begegneten wir der Passenger cart, dem zwischen den Diamantenfeldern und Leydenburg verkehrenden, auch die Transvaalpost befördernden Omnibus.
An der Furth des Maqwasispruit wurde mir eine angenehme Ueberraschung bereitet. Die Zugthiere an der Tränke beaufsichtigend, schlug plötzlich der Ruf: »Doctor, mein Gott, Doctor, sind Sie es?« an mein Ohr. Ich sah auf und blickte in das freundliche Gesicht der Frau P., eine jener Frauen, in deren Höfchen ich in Dutoitspan am Hill gewohnt. Sie war immer so gütig gegen mich, daß ich sie Mutter nannte. Ihr Mann wie ihr Bruder hatten sich aufgemacht, um ihr Glück, das sie in den Diamantenfeldern vollkommen im Stich gelassen, nun in den Goldfeldern zu versuchen.
Am 1. April überschritt ich den Bamboesspruit und 17 Meilen unterhalb Christiana den Vaal an Blignauts (sprich Blechnots) Fähre und langte am 7. April 1874 in Dutoitspan an. Die Gesammtauslagen dieser zweiten Reise überstiegen 9000 fl. Unter den mitgebrachten, mehr als 20 Kisten füllenden Gegenständen waren die ethnographischen Objecte, 400 an der Zahl, am besten vertreten, ihnen folgten, der Zahl und dem Werthe nach: Insecten, Pflanzen, Hörner, Reptilien, Säugethierfelle, Mineralien, Vogelbälge, anatomische Präparate, Spinnen und Krustenthiere, Weichthiere und Versteinerungen. Auch in kartographischer Hinsicht konnte ich während dieser zweiten Reise der Aufnahme meiner Routen mehr Muße widmen; leider verhinderten mich theils Wassermangel, theils verschiedene Unfälle, die der geehrte Leser bereits kennt, an einer umfassenderen Verwirklichung meiner diesbezüglichen Absichten.
Dritter Aufenthalt in den Diamantenfeldern.
So war ich denn zum dritten Male in Dutoitspan angelangt, gleich wie nach meiner ersten Ankunft in den trostlosesten pecuniären Verhältnissen. Gleich am Tage nach meiner Ankunft wurde mir von einem Attorney (Notar) das Good for zur Zahlung präsentirt, das ich vor der Abreise für den später entlaufenen M. gegeben und hatte bald darauf den weiteren Betrag von 117 £ St. zu bezahlen. So mußte ich denn die meisten Carossen und Straußenfedern sowie meinen Wagen und Gespann um jeden Preis losschlagen. Auch in anderer Hinsicht hatte ich mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen, umsomehr, als es länger denn einen Monat währte, bis ich mir wieder eine nennenswerthe Praxis verschafft hatte.
Ich miethete mir in einer der Nebenstraßen Dutoitspans ein aus Lehm aufgeführtes, aus einem Zimmer bestehendes, mit galvanisirtem Eisenblech gedecktes Häuschen, dem eine aus gleichem Material errichtete Bude angebaut war, zu welchem auch ein Hof mit einem Brunnen und ein nach zwei Seiten hin offener Pferdestall gehörte und bezahlte für diese weitläufigen Appartements 5 £ St. monatliche Miethe. Im Juni hatte ich mir wieder eine ansehnliche Praxis erworben und war genöthigt, mir ein Reitpferd, einen Monat später zwei Ponnies zu einem Cabriolet anzuschaffen. In den Wintermonaten des Jahres 1874 gab es eine böse Zeit für die Central-Diggings, die Masern waren ausgebrochen, 40 Visiten täglich waren mehrere Wochen hindurch an der Tagesordnung, manche Woche stieg die Zahl derselben auf 52.
Mit dem Aufblühen meiner Praxis begannen bei mir auch schon die Vorbereitungen zu meiner dritten und großen Reise. Ich schaffte mir einen neuen Wagen und zehn ausgesuchte, kräftige Zugthiere an; von allen Seiten trugen sich mir Begleiter an, doch diesmal hatte ich es mir vorgenommen, mit der größten Vorsicht meine Auswahl zu treffen.
Eine große Erleichterung während meines dritten Aufenthaltes in den Central-Diggings erfuhr ich durch meinen Cap'schen Halfcast-Diener mit Namen Jan van Stahl, der englisch und holländisch schreiben konnte, es auch bald begriff, mir die Medikamente bereiten zu helfen und überdies ein ausgezeichneter Eincassierer war. In einem der vielen Kaufläden lernte ich einen jungen Commis kennen, der mir seine Berufsgenossen an Bildung zu überragen schien und auch sonst ein einnehmendes Wesen hatte. Ich machte ihm daher, als ich mich seines Charakters versichert hielt, den Antrag, mit mir zu gehen, und einen Monat darauf kam er auch thatsächlich zu mir, da sein Brodherr das Geschäft aufgegeben hatte. Theunissen, so hieß mein neuer Gefährte, wurde bald mein Freund, und obwohl wir über ein Jahr bei einander wohnten und lebten, hatte ich mich nicht eher ernstlich über ihn zu beklagen, als am Zambesi, woselbst er mich im Stiche ließ, da er der ihm vom Fieber drohenden Gefahr entgehen wollte. In Dutoitspan hatte er sich bald in das Zubereiten der Medicamente gefunden und da er eine ziemlich gute Kenntniß der Landwirthschaft besaß, war mir oft sein Rath, namentlich was die Wahl der Zugthiere etc. betraf, von nicht unerheblichem Nutzen. Der Diener van Stahl hatte keine Lust mit in's Innere zu reisen—die Löwen waren ihm zu schreckliche Gestalten—dagegen entschloß sich der Hirte Pit Dreyer mitzugehen.
Vor und während der Zeit meines dritten Aufenthaltes hatten die Verhältnisse in den Diamantenfeldern einen großen Umschwung erfahren. Mehr denn ein Viertel der einstigen weißen Bevölkerung hatte sie verlassen, war nach der Colonie, nach dem Oranje-Freistaat (ihrer früheren Heimat), nach Europa etc. zurückgekehrt oder nach den Transvaaler Goldfeldern ausgewandert. Man begann namentlich in Kimberley größere Sorgfalt auf die eisernen und hölzernen Wohnungen zu verwenden. Doch zeigte sich ein guter Theil der Bevölkerung mit dem ersten Gouverneur der Provinz unzufrieden, welche Mißstimmung während meiner dritten Reise zu einer Revolte ausartete. Die Diamanten waren im Preise seit dem Jahre 1872 gesunken, da aber dies nicht mit den Claims der Fall war, verwendete man größere Capitalien und bessere Maschinerien, um der Edelsteine habhaft zu werden.
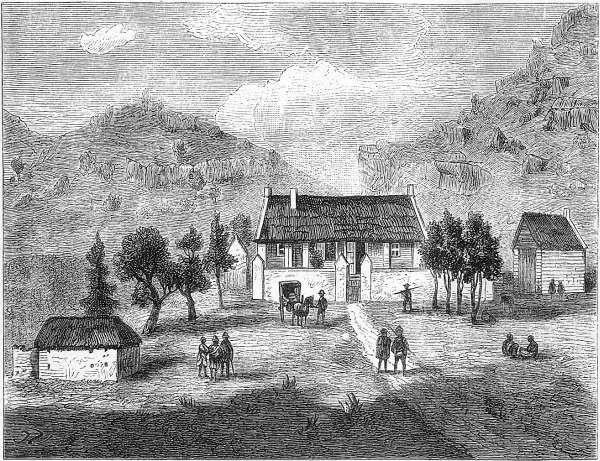
[Mein Wohnhaus in Dutoitspan.]
Vor dem Antritte meiner dritten Reise begab ich mich im November 1874 nach dem Vaal-River und schlug hier, Delportshope und der Hart-Rivermündung gegenüber, zu meiner Erholung für 14 Tage mein Lager auf. Kleine Jagdausflüge und das Sammeln naturhistorischer Objecte füllten diese Tage bald aus.
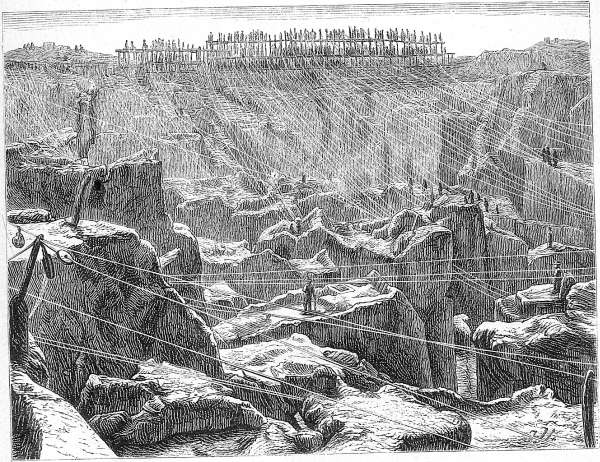
[Koles-Kopje im Jahre 1875.]
Nach Dutoitspan zurückgekehrt, erhielt ich aus Prag die erfreuliche Nachricht, daß die auf der ersten Versuchsreise und während meines Aufenthaltes in den Diamantenfeldern gesammelten Objecte, mit Ausnahme einiger beschädigter Vogelbälge und Insecten, vollkommen erhalten in der Heimat eingetroffen waren.
Ich hatte mich mit Kleidern auf 2½ Jahre, mit Lebensmitteln auf zehn Monate versehen, in den wildreichen Gegenden hoffte ich genügende Mengen Fleisch zu gewinnen, um nicht Noth zu leiden. Schließlich traf ich Vorsorge, daß mir meine Correspondenz nach Zeerust im Marico-District nachgesendet werde.
1) Das Museum, um dessen Gründung und Hebung sich namentlich die Herren Grey, Fairbridge und der frühere österreichische Consul, Herr Adler, hohe Verdienste erworben haben, steht mit seiner Hauptfaçade dem Tafelberge zugewendet. Es enthält theils inländische, theils auch eingetauschte oder geschenkte ethnographische und naturwissenschaftliche Gegenstände, ferner eine kleine Gemäldesammlung und eine bedeutende Bibliothek. Aus der Vorhalle, in der dem Besucher der ausgestopfte Balg eines aus der südlichen Polarzone herrührenden See-Elephanten und Gemälde von den Victoriafällen des Zambesi besonders in die Augen fallen, tritt man zur rechten in die Bibliothek, zur Linken in den großen Saal ein, der zwei Gallerien aufweist, und die ethnographischen und zoologischen Sammlungen enthält. Die ersteren sind ziemlich bedeutend, von den letzteren namentlich die Sammlung afrikanischer Mamalia, Aves, Crustaceen und Lepidoptera nennenswerth. Das Museum steht unter der Leitung eines Kurators, R. Trimen, welcher sich nicht nur um das Museum große Verdienste, sondern auch als Erforscher der südafrikanischen Lepidoptera einen Weltnamen in diesem Fache erworben hat. Auch der sich anschließende botanische Garten ist in jeder Beziehung nennenswerth, wenn er auch vielleicht nicht so viel zur Pflanzencultur beiträgt als wie jener in Grahamstown, der unter den sogenannten botanischen Gärten Süd-Afrika's, deren es mehrere gibt, wohl der bedeutendste ist. Diese Gärten sind wie in Europa theils vom Staate, theils von den Städten, in deren Nähe sie errichtet sind, theils durch freiwillige Beiträge unterhalten und sollen Erholungsorte vorstellen, wobei jedoch auch besondere Rücksicht auf Pflanzen- und Baumcultur genommen wird, so daß aus ihnen die für öffentliche Anlagen und neu zu errichtende botanische Gärten nöthigen Setzlinge bezogen werden und sie auch im Stande sind, den Bedarf an Pflanzen, Sträuchern und Bäumen für Privatgärtner und Farmer zu decken. In diesen Gärten werden jedoch auch exotische Gewächse mit vorzüglichem Erfolge cultivirt und gedeihen namentlich australische Baumarten, ferner Gewächse aus Mauritius, Madagaskar und Süd-Amerika. Vor Allem scheinen namentlich die australischen Eucalyptus-Arten sehr gut fortkommen zu wollen.
2) Port Elizabeth ist der bedeutendste Hafenplatz in der Cap-Colonie, dann folgt Capstadt, East London, Port Alfred etc., und ist der Handel in demselben meist in den Händen englischer und deutscher Kaufleute. Bei meiner Ankunft im Jahre 1872 wurden aus Port Elizabeth in der ersten Jahreshälfte 280.000 Centner Schafwolle im Werthe von 2,500.000 £ St., Diamanten im Werthe von über 1,000.000 £ St., Elfenbein und Straußenfedern im Werthe von über 100.000 £ St., Felle und Häute im Werthe von über 300.000 £ St., ferner:
| im zweiten Quartale des Jahres | |||
|---|---|---|---|
| 1878 | 1879 | ||
| Aloë | 9.150 | 3.625 | Pfund |
| Mehl | — | 5.000 | " |
| Hafer | 4.500 | 120 | " |
| Straußenfedern | 15.403 | 15.347 | " |
| Eingesalzene Fische | 1.000 | — | " |
| Angorahaar | 79.555 | 268.690 | " |
| Rindshäute | 17.476 | 14.172 | Stück |
| Rindshorn | 23.519 | 34.208 | " |
| Pferde | — | 188 | " |
| Elfenbein | 30.771 | 12.258 | " |
| Schaffelle | 250.922 | 203.741 | " |
| Ziegenfelle | 147.798 | 89.680 | " |
| Branntwein | — | 15 | Gallonen |
| Castantia-Wein | — | 76 | " |
| Wolle | 57.753.42 | 66.036.66 | Centner |
| im Werthe von | 524.730 | 509.538 | £ St. ausgeführt. |
Die Zoll-Einnahmen dieses Hafenamtes betrugen im Oktober 1879 39.915 £. St.; gewiß eine sehr beträchtliche Summe, wenn man bedenkt, daß Port Elizabeth kaum 20.000 Einwohner besitzen dürfte.
3) Bezüglich ihrer Lage gilt Grahamstown oder die Stadt der »Settlers« als die schönste Stadt der Cap-Colonie. Malerisch breitet sie sich an den Ufern des Oberlaufes des Kowieflüßchens am Abfalle der ersten Stufe des südafrikanischen Hochplateaus aus. Grahamstown ist der Sitz eines katholischen und englischen (Hochkirche) Bischofs und besitzt mehrere Bildungsanstalten. Es ist mit Port Elizabeth durch die Bahn verbunden und soll nun auch mit seinem Hafen Port Alfred durch einen Schienenstrang in engere Beziehung treten, welcher der Stadt große Vortheile bieten würde. Unter den Sehenswürdigkeiten steht der Cathedralthurm obenan (an der Kirche selbst wird gebaut), es ist der schönste in Süd-Afrika und mit den größten Glocken versehen; um die Förderung des Baues hat sich der dem Dome vorstehende Rev. Dean Williams hoch verdient gemacht. Sehenswerth sind ferner: ein Gebäudecomplex des früheren Militärkommando's für Süd-Afrika mit einem Paradeplatz und dem sich anschließenden botanischen Garten, ferner am entgegengesetzten Stadtende die Irrenanstalt und das im provisorischen Stadthause in der Bathurststraße untergebrachte Museum. Es wird von der Stadt und durch Beiträge von Privaten unterhalten und besitzt viele Versteinerungen, meist von Dr. Atherstone für dasselbe erworben, ferner eine reichhaltige ornithologische Sammlung und ein bedeutendes Herbarium. Im Allgemeinen sind alle naturwissenschaftlichen Fächer, auch das ethnographische, ziemlich gut vertreten. Im Hofraum werden einige lebende Thiere gehalten.
4 u. 5) Cradock gehört zu den bedeutenderen Städten der Colonie und wird in allernächster Zeit durch die Bahn mit Port Elizabeth verbunden sein. Die Stadt besitzt eine Merkwürdigkeit, die holländische Kirche, die mehr einem Rathhause als einer Kirche ähnelt und mit einem Kostenaufwande von 30.000 £ St. erbaut wurde.
Von großer Bedeutung für Cradock ist die Gilfillanbrücke, eine Eisenconstruction auf drei Pfeilern ruhend. Sie wurde im Jahre 1874 von dem tückischen Fish-River hinweggespült und ist seitdem um sechs Fuß höher angelegt worden. Nahe an der Stadt, theilweise auf ihrem Gebiet wie auf der nahen Farm des Herrn von Rensburg finden sich warme, schwefelhaltige Quellen, der Boden ihrer nächsten Umgebung zeigt tiefe Lagen von Asche. Zwei Wollwäschereien sind hier angelegt. Der District Cradock ist einer der bedeutendsten in der Colonie und namentlich durch seine Zucht von Angoraziegen und Straußen ausgezeichnet. Er ist einer der Gebirgs-Districte und stellenweise ungewöhnlich reich an fossilen Ueberresten des Dicyuodon. In Cradock selbst wohnte der um die Geologie des Districtes so hochverdiente Dr. Grey, leider hat ihn der Tod zu früh, bevor er noch seine Forschungen beenden konnte, der Wissenschaft entrissen.
6) Colesberg, auf der Hauptstraße von Port Elizabeth nach den Diamantenfeldern gelegen, hat in den letzten Jahren bedeutend gewonnen. Auf meiner Hinreise hielt ich mich hier nur zwei Stunden, auf der Heimreise dagegen fünf Tage auf.
7) Jagersfontein hat in den allerletzten Jahren, namentlich durch die Rührigkeit der Kaufleute in Fauresmith bedeutend gewonnen.
8) Der Wunsch und die Absicht, Thiere, welche in der Regel in der Gefangenschaft schwer zu erhalten sind, vor meinen Augen gedeihen zu sehen, bewog mich zur Anlage eines kleinen Thiergartens, in welchem ich unter anderen Thieren Proteles Lalandii, das Erdferkel, Schuppenthiere, Rohrrüßler etc. hielt. Nach dem Erstgenannten fahndete ich mehrere Jahre vergebens, bis ich endlich zwei Thiere von einem Elfenbeinhändler erstand und sie in einer etwa sieben Meter großen aus Faßdauben errichteten Umzäunung verwahrte. Am nächsten Morgen fand ich nur mehr ein Thier, das andere, obgleich noch ganz jung, hatte sich nachtsüber den Weg nach Außen aufzuscharren gewußt und war, wie die angestellten Nachforschungen erwiesen, von Hunden zerrissen worden. Das Ueberlebende wollte lange Zeit durchaus keine Nahrung zu sich nehmen. Das kleine Gebiß dieses merkwürdigen Raubtieres weist es auf Termiten an und so blieb mir nichts übrig, als ihm mit Gewalt die Nahrung,—zerhacktes, in Milch eingeweichtes Fleisch—hinzubringen. Nach einigen Tagen, nachdem ich den Boden des geräumigen Zwingers mit Steinen pflastern ließ, fraß es diese Nahrung aus meiner Hohlhand, ließ ich sie jedoch in einer Tasse in oder an seinem Baue, so rührte es dieselbe nicht an. So ging es durch volle vier Monate, dreimal des Tages hatte ich das Thier eigenhändig zu füttern. Allmälig wurde das Thier in mancher Hinsicht zahmer, es fauchte nur mehr zuweilen, wobei es seine Mähne hoch aufzurichten pflegte. Da sich während meines vierten Aufenthaltes in den Diamantenfeldern die Zahl meiner Patienten von Woche zu Woche steigerte, sah ich mich gezwungen, die Behandlung der meisten meiner Thiere und auch die Fütterung des Proteles einem meiner schwarzen Diener zu übergeben. Ich gab mich der Hoffnung hin, das Thier werde durch den Hunger genöthigt werden, selbst die Nahrung aufzusuchen, hatte mich jedoch getäuscht, es ließ dieselbe drei Tage gänzlich unberührt und biß mich, als ich ihm am vierten Tage mit Gewalt einige kleine Stückchen Fleisch in den Schlund einführte. Zwei Tage später war das Thier verhungert.
9) Die Salzpfanne (Salzsee) an der Hallwaterfarm besitzt zwei Buchten, eine nach Norden und eine nach Westen, am Südufer erhebt sich ein aus dem nie fehlenden schäligen Kalk bestehender Hügel, sonst sind ihre Ufer flach und sehr steinig, das Gestein meist Grünstein in Form von Blöcken mit mandelartigen, rosarothen Chalcedoneinschlüssen. Bis auf die Mitte ausgetrocknet, war sie an der tiefsten Stelle höchstens zwei Fuß tief, so daß die Bodenfläche sehr eben erschien, doch konnte man deutlich wahrnehmen, daß dieser kleine Salzsee in früheren Perioden einen höheren Wasserstand besaß als gegenwärtig. An den Buchten münden kleine, nur nach heutigen, in der nächsten Umgebung niedergefallenen Regengüssen fließende Bäche. Es scheint mir, daß dieser, wie die meisten übrigen Salzseen, tief in das Terrain eingebettet war, da sie nur in abflußlosen Landstrichen vorkommen. Das in den Bachbetten nach der Pfanne strömende Wasser, das bisweilen selbst kleine Felsenplatten mitreißt, laugt den salzhaltigen Boden aus, und da das Wasser sehr schnell verdunstet, concentrirt sich der Salzgehalt während der Trockenheit in den übrigbleibenden Lachen und macht den Inhalt derselben ungenießbar. Die nächste Umgebung der Savanne ist bebuscht, namentlich dicht nach Norden und Nordwest, in welcher Richtung sich ein Kameeldornwald anschließt. Wir forschten nach den Stellen, d.h. nach den Ruinen, die man uns als Reste von Monopotapa bezeichnet hatte, allein wir fanden von denselben auch nicht die geringsten Anzeichen, dagegen in einigen Gruben gesimsartig geformte Schieferplatten. Dieselben trugen keinerlei Spur menschlicher Arbeit an sich, es sind Schieferlagen, welche meist in horizontaler Lage aufeinander geschichtet sind und auf welche in dieser Lage eine Strömung zu verschiedenen Perioden mit einer verschiedenen Stärke einwirkte. Da wo die Schieferplatten der Quere nach gespalten waren, drang das Wasser ein und erzeugte die rundlichen Scheiben, die als Fragmente von Säulen angesehen wurden. Die meisten Schieferplatten haben in der Mitte eine härtere Struktur, man möchte sagen, daß sie schalig sind, und daher rührt auch die an manchen beobachtete Linsenform. In geognostischer Beziehung von großem Interesse ist der Ort vorläufig, so lange nicht Nachgrabungen zu einem entsprechenden Resultate führen, für den Archäologen von keiner Bedeutung. Ich glaube, daß Nachgrabungen, die ich an dieser Stelle zu veranstalten hoffe, uns neue Aufschlüsse über die Geologie Südfrika's bieten werden. Vorläufig ist der Traum von der glänzenden Vergangenheit zerstoben und nur die prosaische Wirklichkeit geblieben, daß die Pfanne gutes Salz liefert. In letzterer Zeit machten die durch das Glück der Zulu's in den ersten Kämpfen aufgestachelten und kühner gewordenen Koranna's die Gegend so unsicher, und betrugen sich den Gerichtsbeamten gegenüber so unverschämt, daß bewaffnete Mannschaft gegen sie abgesendet werden mußte, um die Diebe zu fassen. Leider wurden diese von den Koranna's mit den Waffen in der Hand empfangen, wobei ein Weißer das Leben verlor, bevor den beraubten Farmern und dem verhöhnten Gesetze Genugthuung verschafft werden konnte.
10) Die Carotiden waren unverletzt, dagegen die äußeren Kehlkopfarterien schwer verletzt. Ich verband vorerst die Arterien und nähte sodann den durchschnittenen Adamsapfel zusammen. Der Zustand des Verwundeten war ein sehr bedenklicher und Piämie zu fürchten. Ich gab kleine Dosen von Chinin, 1/10 Gramm in flüssiger Form jede drei Stunden, ferner Tinctura Aconiti Napellus einen Tropfen alle vier Stunden mit Wasser, sowie dreimal des Tages die in meiner südafrikanischen Praxis als ausgezeichnet befundene Tinctura ferri sesquichlorati in zweitropfigen Dosen.
Als ich am dritten Morgen zu meinem Kranken kam, hörte ich schon beim Eintreten in's Zimmer einen starken Luftstrom durch die Kehlkopfwunde mit dem eigenthümlichen Geräusch entweichen. Der Kranke war während der Nacht wieder in Hallucinationen verfallen und hatte sich den Kehlkopf, sowie den rechten Flügel der äußeren Wunde aufgerissen. Ich entfernte mit Hilfe der Pincette und der Scheere die zerrissenen Kehlkopftheile, wodurch eine klaffende Oeffnung in der vorderen Wand des Adamsapfels entstand, ätzte mit Lapis die umliegenden mir als schlecht erscheinenden Fleischstellen, wusch die Wunde aus und applicirte eine schwache Höllensteinlösung. Schon am nächsten Tage nahm das Fieber ab und der Kranke besserte sich von diesem Augenblicke an, ohne ein einziges Mal eine Verschlechterung seines Zustandes zu erfahren. Sechs Wochen später war die vordere Kehlkopfwand bis auf eine bohnengroße Oeffnung geschlossen und nach acht Wochen vom Tage der Behandlung an, war die Wunde geschlossen bis auf eine erbsengroße Vertiefung, eine vollkommen seichte Narbe zurücklassend. Die Stimme des Kranken war weniger laut, doch auch nicht heiser zu nennen.
11) Nachdem Gassibone sein Gebiet der Transvaal-Republik angeboten und diese es auch angenommen, fürchtete sich Mankuruana, daß er ein Unterthan dieses Staates werden müsse, und bot sein nördlich vom Hart-River bis gegen den unteren Molapo sich erstreckendes Gebiet, mit Ausnahmne einer kleinen Strecke bei Taung, der englischen Regierung an, die es nicht annahm. Ich erlaubte mir, als dies geschah, die Colonial-Regierung auf Mankuruana's Charakter aufmerksam zu machen, hauptsächlich darauf, daß man seiner Erklärung von »Loyalität und Freundschaft« nur wenig glauben schenken dürfe. Die Folge betätigte meine Ansicht: sowie der Transvaal-Staat englisch geworden war, änderte er sein Spiel, erst in allerletzter Zeit zeigte er sich abermals freundlicher und englisch gesinnt, dies jedoch nur, nachdem sich seiner Vasallen, Mora von Kuruman zu Ungerechtigkeiten den Weißen gegenüber hinreißen ließ und dafür gezüchtigt wurde.
12) Als in der Mitte der Fünfziger Jahre die Freistaatboers in einem Kampfe mit dem im Südosten wohnenden Basutokönig Moschesch begriffen waren, benützten einige südlich vom Vaal wohnende Koranna's mit ihrem Häuptling Kousop (Kusop) die durch diesen Krieg hervorgerufene Entblößung der nordwestlichen Freistaatfarmen von der männlichen Bevölkerung, die zu dem Kriege abcommandirt war, um hinterlistiger Weise die ihnen zunächstgelegenen Niederlassungen der Weißen zu überfallen, und nachdenm sie die Frauen und Kinder getödtet, mit den gesammten Heerden in ihre Heimat zu flüchten, und da sie sich nach dieser ruchlosen That im Freistaate nicht sicher fühlten, ihre Niederlassung zu verlassen und über den Vaalfluß zu setzen. Kusop begab sich zu Gassibone, dem Vater des von mir besuchten Chefs der Batlapinen, und nachdem er ihm von seiner Beute Geschenke abgegeben, erhielt er von diesem die Erlaubniß—da Gassibone als der Paramont Chef das eigentliche Oberhaupt der Batlapinen anerkannt war—sich in seinem Gebiete niederzulassen. Als die Batlapinen die schönen Heerden sahen, die Kusop geraubt, waren sie, als ihnen die Söhne des alten Gassibone, Pohu'tsive und Bojong, den Befehl ertheilten, sofort bereit, sich zu einem Raubzuge nach dem Freistaate zu rüsten, an welchen sich auch ein benachbarter Chef der Bamairen »Motlabane« betheiligte und auf welchem auch die Transvaalfarmen im Osten überfallen wurden. Da der Krieg mit Moschesch noch nicht beendet war und der Überfall nach der Ostseite plötzlich geschah, fanden die wilden Horden weder im Freistaate noch im Transvaalgebiete erheblichen Widerstand und kehrten mit zahlloser Beute beladen in ihre zwischen dem unteren Hart- und dem mittleren Vaal-River gelegenen Wohnsitze zurück. So wie sich jedoch die Nachricht von diesen Ueberfällen im Freistaate und dem Transvaalgebiete verbreitete, rüsteten sich alle jene der Farmer, die nur abkommen konnten, gegen Kusop, er wurde im Kampfe getödtet und ihm ein Theil der geraubten Heerden nebst seinen eigenen abgenommen. Die übrig gebliebenen seiner Leute flüchteten sich gegen Mamusa, oder folgten den Farmern, um in deren Dienste zu treten. Pohu'tsive, der die Vergeltung seiner räuberischen That an seines Vaters Kraal fürchtete, dachte, daß es besser wäre, die holländischen Farmer, bevor sie noch ihre Farmen erreichen konnten, anzugreifen, zu vernichten und ihnen die Heerden abzujagen. Sein Plan ging dahin, die Truppe der Weißen zu umzingeln. Doch die Angreifer wurden zurückschlagen, zerstreut, ihre Reihen nach allen Seiten durchbrochen, und der Führer getödtet, bevor er seines Vaters Kraal erreichen konnte. Ohne den Angriff Gassibone's des Vaters abzuwarten, griffen nun die Farmer, die außerdem durch Zuzug verstärkt worden waren, ihn, sowie seinen Bundesgenossen Motlabane an und schlugen beide, der erstere wurde später enthauptet. Die so zerstreuten Koranna's, Batlapinen und Bamairen flüchteten nach Taung, und da es manchen noch glückte, mit den gestohlenen Heerden zu entkonmmen, so folgten die Krieger in ihren Spuren bis nach Taung. Mahura, der König der östlichen Batlapinen, hatte jene Raubzüge der übrigen südlichen Batlapinen nicht gebilligt, allein er zeigte sich nicht willig, die zu ihm geflohenen Stammesgenossen mit ihrem geraubten Gute auszuliefern. Darum setzte er sich zur Wehre, nahm den Kampf auf und stellte sich den Farmern entgegen. Er wurde geschlagen und seine Leute flüchteten sich in die felsigen Höhlen über der Stadt, nach der holländischen Version sie zu vertheidigen trachtend, nach der eigenen nun von den unten campirenden Boers, wo sie sich blicken ließen, niedergeschossen zu werden. Der Sieg über Taung führte zu einem Frieden, den die Söhne Mahura's im Namen ihres Vaters mit † unterzeichneten, die Friedensbedingungen waren überspannte und grausame, da doch Mahura's Batlapinen sich keiner Räubereien gegen die Boers schuldig gemacht hatten. Die Strafe lautete auf Auslieferung einiger der Freibeuter und die Zahlung von 8000 Stück Rindvieh, 390 Pferden und 500 Musketen, eine Kontribution, welche die vereinigten Batlapinenstämme zu jener Zeit nicht aufbringen konnten.
13) Mankuruana's Batlapinenreich stellt gleich den übrigen nördlich liegenden Betschuanareichen ein Parallelogramm dar, dessen lange Seiten von West bei Nord nach Ost bei Süd und von West nach Ost laufen. Die östliche Grenze dieser Reiche wird theilweise vom Hart-River, theilweise vom Marico-District der Transvaal-Republik, dem unteren Maricolaufe, sowie von dem centralen Limpopo gebildet, die westliche erstreckt sich tief in das Kalabari-Bushveldt bis nach Groß-Namaqualand. Die regierenden Stämme der Betschuana's, die Batlapinen, Barolongen, Banquaketsen und Bakwena's, sowie einige ihnen verwandte Stämme, denen gestattet wurde, im Lande zu wohnen, die Bamairen, Botlaro's, Baharutse, Makhosi, Manupi, Batloka und Bakhatla wohnen in dem östlichen Theile des Gebietes, in Gegenden die wasserreich sind, während die wasserarmen, theilweise centralen, theilweise westlichen Striche von ihren Dienern, den Makalahari's, den Barwa's und Masarwa's, bewohnt werden. Die Makalahari, auch Bakalahari genannt, können, wenn sie dem Könige langjährige gute Dienste erwiesen, sowie wenn sie ihren Herren durch glückliche Jagden viel Nutzen brachten, von diesen frei erklärt werden, es wird ihnen dann gestattet, in der Residenz des Königs oder eines Unterchefs zu wohnen und sie werden als Batlapinen oder Barolongen etc. betrachtet und behandelt. Rev. Mackenzie, der seit 20 Jahren Gelegenheit hatte, das Verhältniß zwischen beiden Stämmen, den Dienern und Herren, zu beobachten, bemerkte, daß die Diener auch Bakhalahatsane oder Bathu-hela (»Menschen«, oder »gleich anderen Menschen«) von den letzteren genannt werden. Unter den Betschuana-Reichen ist das Mankuruan's das kleinste, und bisher das am wenigsten ergiebige gewesen, doch wenn der Stamm durch die gegenwärtigen, von Seite der Regierung in Griqualand-West ergriffenen Maßregeln arbeitsamer geworden, wird er durch Ackerbau und Viehzucht leicht emporkommen können, wobei ihm die Nähe der Diamantenfelder besonders zu Gute kommt.
14) In den Diamantenfeldern war die Ansicht allgemein verbreitet, daß die in denselben arbeitenden Schwarzen ihren Chefs Diamanten von den Feldern in die Heimat mitzubringen verpflichtet wurden. Ich glaube nicht, daß dies regelmäßig geschieht und von allen Eingebornen-Chefs gefordert wird, doch von manchen Häuptlingen, wie von Secoccuni und anderen geschah es ganz sicher; daß jedoch viele Betschuana's ihre Makalahari- und Barwadiener nach den Diamantenfeldern zur Arbeit senden, ohne daß deren Häuptlinge von diesen Diebstählen wissen, ist ebenso gewiß. Die Haupturheber der zahllosen an den Diggers von Seite ihrer farbigen Diener begangenen Diebstähle sind jedoch weniger die unwissenden Eingebornen, sondern jene Bande von verkommenen Weißen und Halfcasts, welche eine wahre Plage der Diamantenfelder sind, und trotzdem viele von ihnen von dem Arme der Gerechtigkeit erreicht wurden, ihr Unwesen noch lange forttrieben. Die Behörde hält sich natürlich in erster Linie an den factischen Verbrecher, sie trachtet aber auch den Anstifter zu eruiren. In dem Falle in dem ein Weißer oder Halfcast der Schuldige war, wird der Dieb dies sofort eingestehen, dagegen wohl nie, wenn der Dieb von seinen Angehörigen, von seinen gleichfarbigen Herren daheim, nach dem Diamanten-District »zur Arbeit« gesendet wurde. Die Meisten erdulden ihre Strafe, ihre Lasches und ihr bis dreijähriges Gefängniß, ohne etwas zu verrathen, daheim hätten sie im entgegengesetzten Falle die Rache ihrer Herren zu fürchten.
15) Die ethnographischen Verhältnisse auf dem Gebiete zwischen dem Konana-, Hart- und Vaal-River lassen erkennen, daß sich das Koranna-Element vom Süden nach Norden ausgebreitet hat. Ich glaube, daß die Hottentotten, die längs der Westküste nach dem Süden zogen und den westlichen Theil der Cap-Colonie bevölkerten, sich theilten, d.h. durch Streitigkeiten und Kriege unter sich verfielen und theils gezwungen theils freiwillig jene Gebiete verließen, wobei ein Theil im Thale des Oranje-Rivers nach aufwärts zog (das folgen der Flüsse ist ein Charakteristicum in der Verbreitung des Hottentotten-Stammes) und sich endlich in den fruchtbaren Gefilden an der Vereinigung des gelben und schwarzen Gariep (Oranje- und Vaal-Rivers) niederließ. Die veränderte Lebensweise, Einwirkung des Klima's, sowie deren theilweise Vermischung mit den Buschmännern im Süden und Osten, mit den Barwa's im Norden, vielleicht auch mit den Stämmen im Westen erzeugte jene Veränderungen, welche diesen am Oranje-River angesiedelten Stamm charakterisiren, ihn von den eigentlichen Hottentotten schieden und zum Griqua stempelten. (Ich glaube, daß der Linguist leicht den Namen Griqua wie Koranna aus der Hottentottensprache herleiten könnte, was gewiß von Wichtigkeit sein würde.) Diese Griqua haben durch diese Veränderung ihres ursprünglichen Elementes nicht gewonnen, physisch und psychisch stehen sie unter ihren Stammvätern ebenso wie die Koranna's wieder unter den Griqua's, die ich als eine Abzweigung der letzteren halte, welche ähnlich wie jene der Griqua's von den Hottentotten vor sich gegangen sein mußte. Die Koranna's zogen den Vaal aufwärts, bis sie gegen das jetzige Bloemhof von dem Betschuana-Elemente, den Bamairen, Barolongen, Batlapinen etc. zum Stillstand gebracht wurden. Diese sie zwischen den Hart- und Vaal-River drängende Barriere durchbrachen sie zwischen Christiana und dem Hart-River, da, wo zwischen den verschiedenen Stämmen der Batlapinen ein von allen beanspruchtes, von keinem aber in Besitz genommenes Land lag und setzten sich am Mamusahügel fest. Von Mamusa gingen sie auf das obere Mokarathal (rechter Nebenfluß des Hart-Rivers) über und von da sogar noch nördlicher in das Thal und Gebiet des Konanaspruit, der nach Norden nach dem Maretsane fließt. Hier mußten sie die Obergewalt der Barolongen anerkennen und mischten sich theilweise mit diesem Betschuanastamme diese Abkömmlinge fand ich physisch und intellektuell höherstehend als die Koranna's und Griqua's.
16) Die theilweise Verschmelzung des Koranna-Elementes mit dem der Barolongen in Konana hatte theilweise zur Folge, daß die Wohnungen im Style der Betschuana's aufgeführt, reinliche Gehöfte darstellten. Ein ziemlich großer Theil der Bevölkerung hatte sich schon an den Gebrauch europäischer Kleidung gewöhnt. Dagegen konnte man jedoch auch deutlich beobachten, daß Frechheit eine der Untugenden ihrer Bewohner war und diese war dadurch begründet, daß viele derselben längere Zeit in den River-Diggings als Diener und zwar in der ärgsten Zeit, unmittelbar nachdem die Diamantenfelder aufgefunden wurden, gearbeitet hatten. Daß sie nicht auch den Branntweingebrauch hierher verschleppt, war in dem Verbote von Seite des Herrschers dieser Landstriche, des Königs Montsua, begründet. Auf meiner Fahrt von Konana nach Molema's Town traf ich drei Eingeborne, welche gemeinschaftlich einen Hinterlader ihr Eigenthum nannten. Darüber erstaunt, wurde ich belehrt, daß dies hier zu Lande häufig vorkomme: die Miteigenthümer gehen dann gemeinschaftlich auf die Jagd und einen Tag benützt ihn der Eine, am nächsten der Zweite u.s.w. Die Beute wird ohne Rücksicht auf die Leistungen der einzelnen Jäger zu gleichen Theilen vertheilt. Schießen sie zwei oder blos ein Zebra, so theilen sich zwei in das Fleisch, der Dritte nimmt das Fell. Doch häufiger geschieht es, daß jeder der Eigenthümer tourweise mit seinen Dienern während einiger Wochen der Jagd obliegt.
17) Aus den Fellen der beiden letzteren werden Carossen verfertigt und dem Könige verehrt oder an die in Moschaneng wohnenden Händler verkauft, d.h. gegen Waaren ausgetauscht, um von diesen wieder nach Süden gesendet und hier als Bett- oder Sophadecken, oder als Zimmerschmuck feilgeboten zu werden. Für eine Caracal-Carosse von zehn Fellen, welche in Süd-Afrika als Roikat-Karossen bekannt sind, erhält der Eingeborne Waaren im Werthe von 3 £. St., in Moschaneng z.B. folgende Gegenstände: 1. Zwei Wolldecken und eine Hose; 2. einen Rock, eine Banmwolldecke, sechs farbige Tücher, oder 3. zehn Pfund Schießpulver. Beim Wiederverkaufe begehrt der Trader 4 £. St. in barem Gelde, in der Colonie 4-10 £. St., oder 5 £. St. in Waaren. Eine aus vier Leopardenfellen gearbeitete Carosse wurde mit einer Muskete, zwei Sack Schießpulver, 10-15 Pfund Blei, einer Dose Zündhütchen und einem kleinen Geschenk als Zugabe bezahlt, und in Moschaneng für 9 £. St. in der Colonie für 10-13 £. St. in Barem feilgeboten. Gegenwärtig, wo durch das Waffen-Einfuhrsverbot die Gewehre entfallen, würde der Kaufpreis einen Anzug, zwei Wolldecken, ein Paar Stiefel und ein großes Frauentuch, oder mit der Zugabe eines Schafes zu der Carosse, einen Pflug betragen. Eine Carosse aus Silberschakalfellen (Canis mesomelas), gewöhnlich aus 14 Fellen gearbeitet, hat in Moschaneng einen Werth von 4-10 £ St., eine aus 30 Klippdachsfellen, einen solchen von 3-10 £. St., eine Carosse aus den Fellen der gewöhnlichen bläulich-grauen Wildkatze 3-10 £. St., eine aus 16 Proteles-Lalandiifellen 4 £. St., eine aus 6 Tharifellen 8 £. St. und eine aus 32 Genettafellen einen Werth von 4-10 £. St. Die schönsten Carossen (für das Auge) sind die Silberschakal-Decken, die schönsten Felle liefern die Batlapinenländer und der südlich vom Molapo liegende Theil der von den Barolongen bewohnten Striche.
18) Während meines Aufenthaltes in Moschaneng hatte ich Eingeborne und Weisse in folgenden Krankheitsfällen zu behandeln:
| Person | Krankheit | Ursache | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Montsua, König der Barolongen | Chron. Rheumatismus mit Ablagerungen inden Kniegelenken | Verkülung d. Nässe | |
| Seine älteste Frau | Marasmus | ||
| Eine zweite Frau | Pneumonie beid. Lungen | Verkülung d. Nässe | |
| Eine dritte Frau | Herzvergrößerung, Aortenstenose. | " | Rheumatismus vorhergehend |
| Des Königs Bruder | Lumbago | " | |
| König Chatsitsive | Ischias | " | |
| Prediger Jan Leschumo | Coprostasie | --- | |
| Seine Frau | Herzvergrößerung, Isufficienz der Aorta | Verkühlung d. Nässe | Rheumatismus vorhergehend |
| Sein Sohn | Tuberculosis beid. Lungen | --- | selten |
| Pit, ein Barolonge | Ischias (seit 17 Jahren) | eine alte Wunde | |
| Eine Barolongin einer Pneumonie | Reconvalescent nach | Verkühlung d. Nässe | |
| Jan, ein Barolonge | Abscesse am linken Fussrücken, Cariöse Knochen | Verwundung durch einen eingetriebenen Dorn | |
| Ein Weißer Händler Kanja | 4 tägiges Intermittens, Leberverhärtung, Hydrothorax Hydropericardium | Fieber | häufig unter den Weißen |
19) Zu den unwirschesten Gesellen der afrikanischen Katzenwelt gehört unstreitig der Caracal (Caracal melanotis) von den Boers det Roikat genannt. Dicht bebuschte Felsenpartien, dichtbelaubte, hohe Bäume an schwer zugänglichen Flußufern sind seine Lieblings-Aufenthaltsorte, an denen er zusammengekauert, anscheinend schlummernd, doch die Umgebung ringsum wohlbeachtend, den Tag zubringt. Kleines Wild wird von dem Caracal mit Tatzenhieben erschlagen oder betäubt. Seine Muskelkraft ist bedeutend größer als man bei der Größe des Thieres vermuthen würde. Ob seines röthlichen Felles weiß er sich leichter dem Auge des Menschen zu entziehen als der Thari und gelingt es selten, ihn zu erlegen. Sein Fell wird zu sehr gesuchten Carossen verarbeitet, doch da es zu lange währt, bis ein Betschuana so viele Felle erwirbt, um eine ordentliche Carosse verfertigen zu können, kommen nur kleine, acht bis zehn Felle enthaltende Roikat-Carossen in den Handel. Ich brachte einen Caracal nach Europa mit, er befindet sich gegenwärtig in dem Zoologischen Garten zu London. Er hatte an dem Fish-River-Rand, einen dicht bebuschten sich zum Fish-River neigenden Abhang zwischen Grahamstown und Cradock seine Heimat und war ein Geschenk des Rev. Dean Williams von Grahamstown.
20) Ich möchte unter den Ruinen von Mosilili's Stadt namentlich die gewölbten Innenbauten hervorheben und dabei schon auf den Unterschied zwischen den Bauarten der Barolongen und Batlapinen hinweisen. Die Wände der Häuptlingswohnung und der übrigen Hütten waren 3-5 Fuß hoch, die Wanddicke an der Basis 5, oben 4-4¾ Zoll. Sie bestanden aus einer Innenlage und einer Umhüllung, welche die erstere deckte. Die letztere bestand aus einem aus Thon und Sand gearbeiteten Cement und der Innenbau aus einer Reihe von in die Erde eingetriebenen und nur an und nebeneinander befestigten Stäben, Ruthen, Schilfrohr, doch auch trockenem Zuckerrohr und Kafirkornstengeln, auf welche der Cement aufgetragen wurde. Die Bauten waren so elastisch, daß wir eine ganze Rundwand durchschütteln konnten, ohne daß Sprünge entstanden oder die Mauer vielleicht eingestürzt wäre. An einigen Hütten fand ich, daß man den Cement auf die innere Holzlage dünn aufgetragen hatte, dann ihn trocknen ließ und eine zweite Lage anbrachte und so weiter. Wir konnten sechs deutlich unterscheidbare Lagen wahrnehmen, wobei die Basis der Mauer 12 Zoll, die obere Kante 6 Zoll breit war. An manchen der Gehöftsmauern fanden wir kleine aus größeren Steinen oder Dornenästen aufgeführte zwei bis vier Fuß hohe Umzäunungen, welche als Ställe dienten. Der Boden in dem Höfchen war festgestampft, oder wir fanden ihn mit Cement, oder auch mit Rinder-Ererementen überdeckt, in einigen wenigen mit ungebrannten, in dem des Königs mit gebrannten Ziegelsteinen gepflastert. In vielen Gehöften war dies mit Steinplatten geschehen und in manchen eine Cementlage auf die Steinplatten aufgetragen worden. In einem Höfchen beobachtete ich ein erhöhtes, mit Topfscherben ausgelegtes Trottoir. Neben der inneren Mauer lief in einem andern Gehöfte eine um drei bis vier Zoll erhöhte, cementirte Stufe, welche wohl den hier Versammelten als Sitz zu dienen hatte. Der Durchmesser der Häuschen war 6-12 Fuß. Bei den meisten war das Dach durch die Verwitterung der Aeste (Pfähle), bei manchen durch Feuer zerstört. Ich fand nur zwei gedeckt und in dem einen ein Betschuanaskelett. Es mochte wohl ein alter Mann gewesen sein, den man mitzunehmen nicht werth gefunden und der hier Hungers gestorben war, oder ein Wanderer, der in der Hütte ein Nachtlager gesucht und von einer Schlange gebissen, hier verschmachten mußte. Dem Schädel nach schien es mir ein Banquaketse zu sein; ich räumte ihm eine Stelle unter meinen anatomischen Präparaten ein. Topfscherben, Ueberreste von hölzernen Stampfblöcken, Schüsseln, Löffeln waren überall zu sehen, auch jene glatten Steine, zwischen denen der Rauchtabak zu Schnupftabak zerstäubt wird. Was mir besonders auffiel, war der verschiedenfach geformte Eingang in diese Häuschen, einmal viereckig, dann oben spitzig zulaufend oder abgerundet, oder aber unten eng und oben breiter, gewöhnlich 1¼-1½ Fuß breit und 1¾-3 Fuß hoch. Die Räume der Wohnung des Häuptlings waren die umfangreichsten, doch das auffälligste in der Ruinenstadt waren die kegelförmigen, aus zwei bis drei Absätzen bestehenden den Schmelzöfen nicht unähnlichen, gedeckten, aus eisenhaltigem Thon ausgeführten und in die obbeschriebenen gewöhnlichen Wohnungen eingebauten Kammern. Diese Kammern waren noch einmal so hoch, als die sie ringförmig (concentrisch) umgebende Mauer des Häuschens, allein das Dach des letzteren deckte auch den inneren Bau, indem seine Spitze auf der Kuppe des letzteren aufruhte. Ich fand diese Innenbauten auch bei den Bakwena's, ohne mich jedoch vergewissert zu haben, ob sie Pilani dorthin übertragen hat, was ich jedoch bezweifeln möchte, schöner und geräumiger auch bei den am zentralen Zambesi wohnenden Marutse im Gebrauch.
End of the Project Gutenberg EBook of Sieben Jahre in Süd-Afrika. Erster
Band., by Emil Holub
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SIEBEN JAHRE IN SÜD-AFRIKA. ***
***** This file should be named 15787-h.htm or 15787-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
https://www.gutenberg.org/1/5/7/8/15787/
Produced by Inka Weide and the Online Distributed
Proofreading Team. This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale
de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr.
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
https://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: https://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
https://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
*** END: FULL LICENSE ***